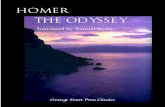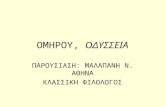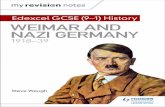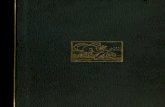Review: Óskar Guðmundsson, Snorri Sturlusson. Homer des Nordens. Eine Biographie (Weimar, Wien...
Transcript of Review: Óskar Guðmundsson, Snorri Sturlusson. Homer des Nordens. Eine Biographie (Weimar, Wien...
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Rezensionen
RüdigeR BRandt, Einführung in das Werk Gottfrieds von Straßburg (Einführungen Germanistik), Darmstadt 2012. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 143 S., ISBN 978-3-534-19080-5, EUR 17,95
Nachdem RüdigeR BRandt bereits Einführungen in kleinere epische Werke Konrads von Würzburg, in die mittelalterliche Poetik und Rhetorik und in die mediävistische Literatur- und Kulturwissenschaft vorgelegt hat,1 erweitert er nun die bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erscheinende Reihe ‘Einführungen Germanistik’ um einen Band zu Gottfried von Straßburg.2 Wie tomas tomasek in seiner 2007 publizierten Einführung widmet sich auch BRandt dem Autor sowohl als Großepiker als auch als Lyriker, während sich ChRistoph huBeR und maRk ChinCa auf den Text konzentrieren, der am festesten mit Gottfrieds Namen verbunden ist, den ‘Tristan’.3 Im einleitenden Kapitel (S. 7-13) ordnet BRandt Gottfrieds Werk in literar- und kultur historische Zusammenhänge ein, indem er maßgebliche Entwicklungen vom Be-ginn deutschsprachiger Schriftliteratur im 8. Jh. bis zu ihren höfischen Ausprägungen im Hochmittelalter vor Augen führt, und positioniert den um 1210 datierbaren Versroman in zeitgenössischen Konzept- und Traditionskontexten. Im folgenden Überblick über die Forschungsgeschichte (S. 14-26) stellt der Verfasser Bibliographien und Forschungs-berichte zusammen, geht auf Editionen und Übersetzungen ein, analysiert die Forschung zu Gottfried quantitativ und systematisiert sie für das 19. Jh., die erste Hälfte des 20. Jh.s und den Zeitraum bis in die Gegenwart. Kapitel III informiert mit den historisch bedingten Einschränkungen über Autor und Werk (S. 27-37): Zunächst versammelt BRandt “biographische Fragmente” und fügt sie zu “puzzles” zusammen, danach legt er dar, welche Texte neben dem ‘Tristan’ in Mittelalter und neuzeitlicher Wissenschaft Gottfried zugewiesen wurden, informiert über die Überlieferung des ‘Tristan’ und fragt für Lyrik und Epik nach dem Rezeptionsprofil, das sich aus der Zusammenschau der
1 RüdigeR BRandt, Konrad von Würzburg: Kleinere epische Werke, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage (Klassiker-Lektüren 2), Berlin 2009; ders., Kleine Einführung in die mittelalterliche Poetik und Rhetorik. Mit Beispielen aus der deutschen Literatur des 11. bis 16. Jahrhunderts (GAG 460), Göppingen 1986; ders., Grundkurs germanistische Mediävistik / Literaturwissenschaft. Eine Einführung (UTB 2071), München 1999; Geisteswissenschaften: Germanistik. Arbeit an/in der Kultur, hg. vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen, federführender Autor: RüdigeR BRandt (Essener Unikate 26), Essen 2005.
2 Zur mittelalterlichen Literatur in dieser von gunteR e. gRimm und klaus-miChael Bogdal herausgegebenen Reihe bisher: otfRid ehRismann: Einführung in das Werk Walthers von der Vogelweide (2008); ders.: Fabeln, Mären, Schwänke und Legenden im Mittelalter. Eine Einführung (2011); gaBy heRCheRt, Einführung in den Minnesang (2010); nine R. miedema, Einführung in das Nibelungenlied (2011); meinolf sChumaCheR, Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters (2010); JüRgen Wolf, Einführung in das Werk Hartmanns von Aue (2007).
3 tomas tomasek, Gottfried von Straßburg (Reclams Universal-Bibliothek 17665), Stuttgart 2007; ChRistoph huBeR, Gottfried von Straßburg: Tristan, 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage (Klassiker-Lektüren 3), Berlin 2013 (1. Aufl. 2000, Vorgängerband 1986); maRk ChinCa, Gottfried von Strassburg: Tristan (Landmarks of world literature), Cambridge 1997.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
92 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Textzeugen ergibt. Das vierte Kapitel ist den lyrischen Texten gewidmet (S. 38-54), die Gottfried zugeordnet wurden und sich in BRandts Augen “heute weder als echt noch als unecht erweisen” lassen (S. 42): den beiden Sangsprüchen ‘Vom gläsernen Glück’ und ‘Mein und Dein’, dem Minnelied ‘Diu zît ist wunneclich’, dem ‘Marienlob’ und dem religiös-didaktischen ‘Lied von der Armut’. Nachdem er die Lyrik als Gattung abgegrenzt und Genres mittelalterlicher Lyrik unterschieden hat, zeigt er “Aporien der Echtheits-diskussion” auf und plädiert für einen Perspektivwechsel hin zur Rezeptionsgeschichte. In der Vorstellung “textanalytische[r] Ansätze” thematisiert er Überlieferung und Edition der Texte, greift erneut Fragen der Zuweisung auf, analysiert die Strophen formal, gibt Hinweise zu Gattungszusammenhängen und interpretatorischen Möglichkeiten; zu dem sonst wenig beachteten ‘Lied von der Armut’ bietet er überdies eine Übersetzung und eine vergleichsweise ausführliche Kommentierung. Das Kapitel zum ‘Tristan’ (S. 55-108) beginnt mit einer gegliederten und punktuell mit Anmerkungen versehenen Nach-erzählung, die auch auf den in Gottfrieds Romanfragment nicht überlieferten Schluss ausgreift. Im Anschluss an eine knappe Darstellung zum “Tristan-Stoff und seine[n] Literarisierungen im Mittelalter” mit einem Ausblick auf sein Weiterleben in der Neuzeit geht der Verfasser auf die explizite Auseinandersetzung mit anderen Stoffausprägungen im ‘Tristan’ ein, auf die Bearbeitungstendenzen, die sich aus dem Vergleich der wenigen geeigneten Textpartien ableiten lassen, und auf die Profilierung, die aus dem Umgang mit dem Stoff resultiert. “Strukturierungen” ergeben sich für BRandt aus dem Verhältnis von Elternvorgeschichte und Tristan-Isolde-Handlung, aus thematischen Blöcken im Hauptteil, aus den Bewegungen Tristans zwischen Handlungsräumen, aus für die ‘Tristan’-Epik charakteristischen “Verdoppelungen oder Vervielfachungen von Hand-lungen, Namen, Motiven” (S. 69), durch die teils in Spannung zur Handlung stehenden Exkurse, durch die Namenkryptogramme in den Akrosticha und die Vierreimstrophen. Stilistische und rhetorische Durchformung sowie Metrik, Versbau und Reimtechnik misst BRandt an zeitgenössischen Lehrbüchern bzw. literarischen Standards und fragt nach den Implikationen von Neologismen, Metaphern und Allegorien, antithetischen Doppelformeln und Sentenzen, die den ‘Tristan’ in auffälliger Weise prägen. Schließlich präsentiert BRandt “Interpretationsansätze” zum Prolog, zur Frage nach einem Liebes-konzept, zur Figurengestaltung (“‘Gemischte Charaktere’?”), zu “‘starke[n] Frauen’” und zur Hofthematik. Das Schlusskapitel zur Rezeption Gottfrieds (S. 109-118), das im Wesentlichen eines zur ‘Wiederaufnahme’ des ‘Tristan’ ist, behandelt die mittelal-terliche Rezeption, wie sie – unterschiedlich sicher – in Überlieferung, Nennungen von Autor und Werk, Zitaten, Stil-Imitationen sowie anderen Anklängen und Übernahmen, Fortsetzung und bildlicher Darstellung erkennbar wird, und die undeutlichen und weni-gen Spuren in der Frühen Neuzeit, die bislang aufgefunden wurden; die literarisch wie musikalisch produktive Rezeption, die der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem ‘Tristan’ und seinen Übersetzungen im 18.-20. Jh. folgt, wird ebenso umrissen wie die Aufnahme in der jüngeren Gegenwart, die der Verfasser durch den Rückgang der lite-rarischen Rezeption gekennzeichnet sieht, durch Medienverbund und -wechsel, durch eine Trennung der wissenschaftlichen und der künstlerischen Rezeption und durch ein Wiederaufleben in Schuldidaktik und -unterricht. Komplettiert wird der Band durch eine Auswahlbiblio graphie mit einem möglichst vollständigen Verzeichnis der Titel, die nach 2002 erschienen sind, dem Jahr, das die Aufnahmegrenze der Bibliographie von huBeR
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
93Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
bildet.4 Register erfassen erstens Verfasserinnen und Verfasser von Forschungsliteratur, zweitens Autoren, Werke, Gattungen und Namen und drittens Orte, Motive und Sachen. BRandt spricht sich mit Blick auf den ‘Tristan’ als Werk der ‘mittelhochdeutschen Klassik’ gegen Formen normativer Poetik aus, die in der Theorie überholt, in der Praxis aber immer noch wirksam sei (S. 7, 76), gegen “Immanenz und Nachfühlungsphilo-logie”, die er vereinzelt durch die Hintertür sich wieder einschleichen sieht (S. 80), gegen “das oft emphatische Lob”, bei dem man nicht entscheiden könne, ob es “immer tatsächlicher Überzeugung entspricht, eine vorbeugende Demutsgeste vor einer commu-nis (?) opinio der gegenwärtigen Wissenschaft darstellt oder reine Attitüde ist” (S. 80). Die große Bedeutung, die man diesem Werk zuerkenne, könne den Blick auf literarische und thematische Zusammenhänge verfälschen (S. 7, 23, 37, 41, 111), seine Betrachtung aus je aktueller Perspektive berge die Gefahr, den Text zum Steinbruch zu degradieren (S. 23), die Zuschreibung von Uneindeutigkeit oder Widersprüchlichkeit sowie von sprachlicher, formaler und stilistischer Meisterschaft sei teilweise vorschnell bzw. nicht historisch plausibilisiert (S. 23, 76f., 80). Desiderate bleiben für BRandt die Erstellung von “Einzelausgaben der vollständigen [‘Tristan’-]Handschriften und Sammelausgaben der Fragmente (beides in Form diplomatischer Abdrucke), möglicherweise auch [von] synoptischen Ausgaben” (S. 18), “eine Zusammenfassung und Ergänzung vorliegender Bibliographien, geordnet nach praktikablen und forschungsadäquaten Kategorien und zusätzlich erschlossen durch ausführliche Register” (S. 26) sowie “die vernetzte und ver-gleichende Erfassung Gottfriedscher Spezifika” in Sprache, Form und Stil des ‘Tristan’ (S. 76-79, Zitat S. 78).5 Zur verstreuten Forschung zur Lyrik, die Gottfried zugeschrieben wurde, und zur umfang- und aspektreichen Forschung zum ‘Tristan’ bahnt die hilfreiche Bibliographie den Weg,6 das Kapitel zur Forschungsgeschichte bietet eine kategorisierende Sichtung und Auswertung. Wer Literatur zu einzelnen Stellen oder Fragestellungen sucht, wird zwar immer wieder Angaben finden, aber mit Gewinn zudem tomaseks thematisch aufgebaute Einführung zurate ziehen, die durch eine Vielzahl fortlaufend eingefügter Verweise, durch eine nach den Kapiteln gegliederte Bibliographie und mithilfe eines Episoden- und Sachregisters die Forschung erschließt, oder huBeRs Band, der jeweils Hinweise auf relevante Literatur und konzentrierte Forschungsdiskussionen ans Ende der systematisch und textchronologisch angelegten Kapitel stellt, sowie die Kommentare, vor allem den in der ‘Tristan’-Ausgabe von WalteR haug und manfRed günteR sCholz.7
4 ChRistoph huBeR, Bibliographie zum ‘Tristan’ Gottfrieds von Straßburg (1984-2002), http://bibliographien.mediaevum.de/bibliographien/bibliographie_tristan.htm (19.3.2014).
5 Vielversprechende Forschungsmöglichkeiten sieht BRandt darüber hinaus in der literatur-psychologischen Untersuchung des ‘Tristan’ und möglicherweise auch der beiden Sangsprüche auf der Grundlage laCans (S. 23), in der Anwendung gendertheoretischer und feministischer Perspektiven auf die neuzeitliche Rezeption des ‘Tristan’ (S. 24), in der Erarbeitung von Kate-gorien für die Untersuchung der Figurenkonstitution (S. 88) und in der Suche nach Spuren des ‘Tristan’ in Werken der Frühen Neuzeit (S. 115).
6 Im Literaturverzeichnis ist zum Titel “Ermittlung, Darstellung und Deutung von Verbreitungs-typen in der Handschriftenüberlieferung mittelhochdeutscher Epik” (1988) der Vorname des Verfassers zu ändern; es muss hier (und entsprechend auf S. 36) lauten: thomas klein.
7 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isold, hg. von WalteR haug und manfRed günteR sCholz, mit dem Text des Thomas, hg., übersetzt und kommentiert von WalteR haug, 2 Bde. (Bibliothek des Mittelalters 10-11, Bibliothek deutscher Klassiker 192), Berlin 2011. – Vgl. auch tomasek [Anm. 3], S. 11-15 (Einleitung: Allgemeine Forschungslage, Hilfsmittel),
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
94 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Dem Charakter des Bandes als Einführung trägt BRandt durch an verschie-denen Stellen eingefügte allgemeine Hinweise Rechnung, die theoretisch-methodische Voraussetzungen transparent machen, Erscheinungen in größere Kontexte einordnen oder Kenntnisse erschließen sollen (vgl. z.B. S. 14 zu Funktionen von Forschungsgeschichte, S. 24f. zu kulturwissenschaftlichen Ansätzen, S. 38-40 zur Gattung Lyrik und lyrischen Genres, S. 67 zur Präfiguration, S. 73f. zu Kryptogrammen, S. 75 zur mittelalterlichen Hermeneutik, S. 88 zu ‘Charakteren’, S. 101f. zum mittelalterlichen Hof, S. 109 zur ‘Rezeption’). Diese Hinweise wie auch Nebenaspekte der Darstellung finden sich durch Randschlagwörter markiert, die fortlaufend eine inhaltliche Orientierung bieten. Mit dieser bewusst eher nüchtern gehaltenen und kompakten Darstellung steht nun ein weiterer Band über Gottfried von Straßburg zur Auswahl, auf den im akademischen Unterricht, für die Prüfungsvorbereitung und von mediävistisch Interessierten über-haupt zurückgegriffen werden kann; die hier präsentierten Informationen, aufgezeigten Perspektiven und aufgeworfenen Fragen ermöglichen eine Annäherung an die Gottfried zugeschriebene Lyrik und den ‘Tristan’, dessen Verfasser “zu den am intensivsten be-handelten deutschen Autoren des Mittelalters” gehört (S. 80), der “über seine Inhalte an einer ganzen Reihe von mittelalterlichen Diskursen beteiligt ist – literarischen, ethi-schen, religiösen, rechtlichen, ästhetischen” (S. 24), dessen rhetorische und stilistische Durchformung von einer überdurchschnittlichen Bildung zeugt (S. 77) und der sich, wie der Blick etwa auf den Prolog, die Exkurse und die Figurengestaltung lehrt, durch narrative Komplexität und Innovation auszeichnet (S. 70-73, 81-85, 87-101).
Dr. Susanne Flecken-Büttner, Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwis-senschaft der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Am Hof 1d, D–53113 BonnE-Mail: [email protected]
S. 60-66 (Zur Editionsgeschichte) und S. 237-248 (Grundpositionen der Werkanalyse seit dem 19. Jahrhundert), und huBeR [Anm. 3], S. 153-163 (Wie erzählt Gottfried von Straßburg von passionierter Liebe? Retrospektive auf die Kontroversen der Forschung).
Digitale Rekonstruktionen mittelalterlicher Bibliotheken, hg. von saBine philippi und philipp VansCheidt (Trierer Beiträge zu den historischen Kulturwissen-schaften 12), Wiesbaden 2014. Reichert Verlag, V, 132 S. mit Abb., ISBN 978-3-89500-995-2, EUR 49,–
Wann dermaleinst der Beginn des ‘Digitalen Zeitalters’ festgelegt wird, steht noch in den Sternen – gut möglich, dass es wie bei anderen Periodeneinteilungen auch hier unterschiedliche Ansätze geben wird. Denn hier – das dürfen wir zur Zeit miterleben – handelt es sich ebenso nicht um ein Umschalten, sondern um einen Wandlungsprozess. Die künftige Frage wird also sein, was als auslösendes Moment dieses Prozesses gesehen wird. Dies könnte die Etablierung des Internets als ein neues Kommunikationsmedium sein, denn in Bezug auf die Digitalisierung, also die Verfügbarmachung von Inhalten im digitalen Medium, erweist es sich als Motor. In den vergangenen ein bis zwei Jahr-zehnten sind gerade hier enorme Fortschritte zu verzeichnen. In Bezug auf Bücher und
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
95Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Bibliotheken heißt das, dass die Datenbanken nicht mehr nur einfache Metadaten in strukturierter Form – also Kataloge – bieten, sondern auch Digitalisate der Bücher selbst. Angefangen wurde bei den seltensten und kostbarsten Bibliotheksbeständen, den Hss. Inzwischen werden ganze Jahrhunderte digitalisiert (z.B. GW, VD16 und VD17). Dies ist nichts anderes als ein Transformationsprozess von einem analogen hin zu einem digi-talen Zugriff auf die Informationen. Letzthin schließt dies auch digitale Untersuchungs-methoden ein. Wie weit der Prozess gehen wird, kann erst die Zukunft zeigen. Der von saBine philippi und philipp VansCheidt vorgelegte Tagungsband ist Doku-ment dieses Prozesses. Die vier ersten Aufsätze befassen sich mit der Frage, wie eine mittelalterliche Bibliothek rekonstruiert werden kann. Es geht dabei wesentlich um ihre Bestände, um die Art der Präsentation und – damit verbunden – um die Verknüpfung mit Metadaten, denn die Scans noch vorhandener Hss. sind ohne Kontextdaten nur wenig Wert. Allein die Fragen, die sich bei solchen Projekten stellen, zeigen, wie fortgeschritten die Verfahren inzwischen sind. Welche Frage jedoch nicht gestellt wurde, ist, ob für eine Bibliothek, die mehrere hundert Jahre Bestand hatte, auch bestimmte zeitlich definierte Zustände gezeigt werden können. Denn auch Bibliotheken unterliegen einem Wandel und sind keine statischen Objekte. Der Beitrag von ChRistoph WinteReR geht über die einzelne Bibliothek hinaus und ver-sucht zu zeigen, wie mithilfe von Digitalisierungsprojekten auch Bibliothekslandschaften dargestellt werden können. Für eine Zeit, in der Bücherbesitz etwas Besonderes war, kann dies ganz neue Einsichten für die räumliche Verteilung von und den Zugang zu Texten erbringen. Projekte dieser Art sind nicht allein Projekte eigenen Rechts, sondern liefern darüber hinaus Material und Erkenntnisse für weitere – darauf aufbauende – Projekte. Schon im 19. Jh. wurde oft nicht mit den Bibliotheksmaterialien direkt gearbeit; so mancher Editor ließ sich von Hss. Abschriften erstellen, über deren Qualität man nicht immer sicher war und die inzwischen selbst zu Forschungsobjekten geworden sind. Später gab es die photographische Wiedergabe, nun ist es das Digitalisat. Mithin haben die Umstände nahezu Idealcharakter erhalten: Geht es allein um die Texte oder die Mini-aturen, so stehen die Digitalisate – über das Internet vermittelt – nun jedem Interessierten jederzeit zur Verfügung. Reisen zu den Bibliotheken werden nur noch dann nötig, wenn Fragen geklärt werden sollen, die am Digitalisat nicht erfahrbar sind; in der Regel sind dies Fragen, die die Materialität betreffen. Ein Umstand, der uns immer wieder daran erinnert, dass die Digitalisate die Hss. nicht ersetzen, aber die Zugriffsmöglichkeiten erweitern. Insbesondere die Beiträge von endeRs u.a. und Bain u.a. gehen über die eigentlichen Rekonstruktionsfragen hinaus, indem sie Möglichkeiten ausloten, wie die Digitalisate selbst für die Forschung nutzbar gemacht werden können. Es geht also um Fragen, wie Digitalisate mit digitalen Mitteln bearbeitet werden können und welche neuen Erkenntnismöglichkeiten diese Verfahren eröffnen. Verschiedentlich ist dabei die Rede davon, die Gegenstände, also die Vorlagen der Digitalisate über die Digitalisate auch für Maschinen lesbar zu machen. Dies ist wohl allein in einem rein technischen Sinne gemeint; doch sofern darunter auch Erkenntnisgewinn (insbesondere in einem hermeneutischen Prozess) gemeint ist, bleibt am Ende ‘nur’ der Mensch. Worauf der Tagungsband damit ebenfalls hinweist, ist der Umstand, dass sich das hilfswissenschaftliche Instrumentarium des Geisteswissenschaftlers um digitale Werk-zeuge erweitern wird. Dies ist ebenfalls Teil des o.g. Wandlungsprozesses, und vermutlich werden digitale Untersuchungsmethoden eine neue Kulturtechnik ähnlich wie Schreiben und Lesen. Wie gesagt, ist der Tagungsband Dokument eines sich langsam vollziehenden
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
96 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Wandels. Von Zeit zu Zeit ist es nötig, solche Dokumente herauszubringen, um diesen Wandel kritisch zu reflektieren.
PD Dr. Ralf G. Päsler, Philipps-Universität Marburg, Fachbereich 09 Germanistik und Kunstwissen schaften, Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters, Wilhelm-Röpke-Str. 6A, D–35032 MarburgE-Mail: [email protected]
Elckerlijc – Jedermann, hg. und übersetzt von ClaRa stRiJBosCh und ulRike zellmann (Bibliothek mittelniederländischer Literatur 6), Münster 2013. agenda Verlag, VIII, 117 S. mit Abb., ISBN 978-3-89688-491-6, EUR 25,–
Im Sommer 2013 ist der sechste Band der ‘Bibliothek mittelniederländischer Literatur’, kurz: BIMILI, erschienen. Herausgeber der Reihe sind BaRt BesamusCa, Medionieder-landist an der Universität Utrecht, und CaRla dauVen-Van knippenBeRg, Germanistin und Mediävistin an der Universität Amsterdam. Die BIMILI-Reihe soll einem möglichst breiten deutschsprachigen Publikum den Zugang zu den bekanntesten niederländischen Werken des Mittelalters eröffnen. Um dieses besondere Unternehmen gelingen zu lassen, umfassen die mittelniederländischen Klassikerausgaben jeweils im Paralleldruck eine nhd. Übersetzung, Stellenkommentare und ein Nachwort, in dem u.a. der Entstehungs-kontext des Werkes, die Überlieferung und Rezeptionsgeschichte zusammenfassend vorgestellt werden. Jeder dieser Bände ist nur möglich dank fruchtbarer Arbeitsgemein-schaften zwischen Forschenden der germanistischen und niederlandistischen Mediävistik, verbunden an deutschen, belgischen und niederländischen Universitäten. Zudem konnte der erfahrene Übersetzer gRegoR sefeRens (Berlin) für diese Reihe gewonnen werden, der alle nhd. Übertragungen kritisch mitliest und bspw. stilistische Verbesserungsvorschläge anreicht. Die BIMILI-Ausgaben sind somit ein professioneller Beitrag zu der seit einigen Jahren verstärkt wahrnehmbaren (Wieder-)Annäherung zwischen der mediävistischen Germanistik und Niederlandistik. Im Anschluss an die ersten fünf BIMILI-Bände, die ich bereits in dieser Zeitschrift (Bd. 143 [2014], S. 96-105) vorgestellt habe, möchte ich nun den neuesten Band präsentieren. Während die Textausgaben I-V Klassiker der epischen Literatur aus dem 13. und 14. Jh. umfassen (I. Karel ende Elegast – Karl und Ellegast, II. Reynaerts historie, III. Heinric van Veldeken, Sente Servas, IV. Sankt Brandans Reise und V. Roman van Walewein), wird nun mit dem sechsten Band ein Theaterstück des ausgehenden 15. Jh.s zugänglich, dessen älteste Textfassungen bereits als Inkunabeln tradiert werden: ‘Elckerlijc’. Im Vorwort wird zu Recht bemerkt, dass dieses “kürzeste Bühnenstück der spätmittelalterlichen Niederlande” zwar zum nieder-ländischen Bildungskanon gehört, dieser Titel dem breiten deutschsprachigen Publikum aber wohl kaum etwas sage (S. VII). Der Aha-Effekt stellt sich mit der deutschsprachigen Übersetzung auf der Titelseite ein: Jedermann – eine Information, die auch ruhig auf dem Buchumschlag hätte erscheinen dürfen. Weithin bekannt ist das Spiel durch die wesentlich jüngere Bearbeitung Hugo von Hofmannthals ‘Jedermann – Das Spiel vom Sterben des Reichen Mannes’, aus dem Jahr 1919, dessen Aufführung seit fast einem Jahrhundert zum jährlichen Ritual der Salzburger Festspiele gehört. Hofmannsthals direkte Quelle ist zwar der englische ‘Everyman’ und nicht der ‘Elckerlijc’. Da es sich
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
97Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
aber beim ‘Elckerlijc’ aus Brabant um den Ur-Jedermann handelt – nur ein “zählebige[s] Mißverständnis” meint, dies sei der ‘Everyman’ (S. VII) – geht also auch Hofmanns-thals Werk indirekt auf den ‘Elckerlijc’ zurück. Die Herausgeberinnen dieses sechsten BIMILI-Bandes sind die Niederlandistin ClaRa stRiJBosCh (Utrecht), auch Mitarbeiterin an der ‘Brandan’-Ausgabe, und die Germanistin ulRike zellmann (Berlin). Es gibt wohl kaum ein anderes spätmittelalterliches Werk von solch bleibender Aktua-lität wie dieses allegorische Spiel, hervorgegangen aus dem kulturell und wirtschaftlich blühenden städtischen Milieu der burgundischen Epoche, genauer: dem Schauspiel der Rederijker, der “Freunde der Beredsamkeit” (S. 79). Nach dem Vorbild nordfranzösischer ‘Puys’ schlossen sich in den südlichen Niederlanden seit Anfang des 15. Jh.s wohlhabende und gebildete Stadtbürger zu (Amateur-)Gesellschaften, Kammern, zusammen und wid-meten sich dem Schreiben von Poesie und Theaterstücken. Untereinander trugen diese Kammern literarische Wettbewerbe aus, die ‘Landjuwelen’, in denen sie selbstbewusst Themen der religiösen Laienbildung aufgriffen, wie bspw. im ‘Elckerlijc’ (S. 79-83). Dieses vermutlich Antwerpener Spiel eines bisher unbekannten Autors (S. 93) ist eine allegorische Darstellung eines jeden einzelnen Menschen aller Zeiten, der im Angesicht des plötzlich und unerwartet auftauchenden Todes die Bilanz seines Lebens aufmachen muss. Er ist vorgeladen, um am Ende seiner Tage vor Gott rekening te doen (Rechenschaft abzulegen). Hierbei handelt es sich um eine im ‘Elckerlijc’ stets wiederkehrende, damals geläufig Redewendung für das letzte Urteil. Die Rechenschaftslegung ist zugleich Teil des Rechtsganges, der neben der Pilgerfahrt eines der beiden das Stück tragende Handlungs-modelle ist, so erklären die Herausgeberinnen (S. 90-92). Ähnlich einem Diptychon ist die Grobstruktur dieser dramatisierten Moralität zweiteilig. Im ersten Teil wird ‘Elckerlijc’ auf sich selbst zurückgeworfen und muss sich in schmerzhafter Selbsterfahrung von allem losmachen, worauf sein Vertrauen und Ansehen im Diesseits gründete: Freunde, Verwand-te und Besitz. Ergreifend ist der “Tiefpunkt völliger Verlassen heit” (S. 90), ungefähr in der Mitte des Stückes, an dem Elckerlijc sich selbst nicht mehr ertragen kann (v. 429f.): Dies ic mi selven wel mach bespuwen. / Tfy, elckerlijc, u mach wel gruwen. / Hoe deerlic mach ic u versmaden (Dafür könnte ich mich selbst bespucken. / Pfui Jedermann, Euch mag wahrlich grausen! / Wie tief ich euch verachten kann). Diese aufrichtige beginnende Reue ist die Voraussetzung für die Handlungswende zum zweiten Spielteil, der langsamen Wiederaufrichtung Elckerlijcs. Endlich besinnt er sich seiner Tugend, die er zeitlebens verwahrlost hat. Dann erscheint die Schwester der Tugend, die Erkenntnis, die Elckerlijc zur Beichte und Buße führt. Hierdurch wird die Tugend aus dem Zustand der Verkrüp-pelung gerettet. Elckerlijcs Heilsweg schließt Begegnungen mit seinen Fähigkeiten, der Klugheit, Kraft und Schönheit, ein und bringt ihn zu seinen fünf Sinnen. Am Ende seiner Pilgerreise, in der Todesstunde, werden aber auch diese Freunde ihn verlassen. Nur die Tugend begleitet ihn über den Tod hinaus vor den höchsten Richterstuhl. Sie ist die Zeugin seiner Umkehr und Garant für Elckerlijcs Rettung. Die Tatsache, dass dieses mittelalterliche Spiel so ungemein modern daherkommt, liegt auch darin begründet, dass genauere Angaben zu Personen, Zeit und Raum aus-geblendet werden und somit die Geschehnisse jeder Geschichtlichkeit entrückt zu sein scheinen. Selbstverständlich gehört dies zum Thema, allerdings deutet die übersichtliche Darstellung der nachfolgenden Rezeption im Nachwort an, dass der ‘Elckerlijc’ hierin konsequenter war als einige jüngere Texte. Die BIMILI-Bände stellen meistens nhd. Erstübersetzungen bereit. Für den ‘Elckerlijc’ gilt dies nicht. Im Nachwort wird auf eine frühere Übertragung des Schriftstellers und
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
98 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Archäologen Wolfgang CoRdan1, erschienen 1950, hingewiesen und noch im selben Satz hinzugefügt, dass mit der BIMILI-Ausgabe der erste ‘Elckerlijc’ vorliege, “dem ausschließlich Frauen ihre Zuwendung gewidmet haben” (S. 97). Dies wirft die Frage nach den inhaltlichen Konsequenzen auf und da sie unbeantwortet bleibt, erweckt die Feststellung den Eindruck, es handele sich um ein vorgeschobenes Argument für diese Ausgabe. Das ist nicht nötig, und zwar nicht nur, weil eine Bibliothek mittelnieder-ländischer Klassiker ohne den ‘Elckerlijc’ unvollständig wäre oder CoRdans Übersetzung heute nur noch antiquarisch erhältlich ist und außerdem weder den mittelniederländischen Text, noch nähere (literatur-)geschichtliche Erläuterungen bietet wie die vorliegende Ausgabe. Wichtiger in diesem Zusammenhang ist, dass CoRdan entsprechend seiner Vorlage eine Übersetzung in Paarreimen verfasst hat, die zwar auch ihren Charme hat, allerdings hat er hin und wieder Klang und Rhythmus über die genaue Wortbedeutung gestellt. Zudem wirkt CoRdans Wortwahl heute etwas altertümlich. stRiJBosCh und zellmann haben ganz bewusst die Reimform aufgegeben, wie dies grundsätzlich für alle nhd. BIMILI-Translate gilt. Ihr übersetzerisches Anliegen ist es, “sich so nah wie möglich, ohne zu archaisieren, an die sprachliche Gestalt und Diktion des Drucks zu halten” (S. 103). Und dies ist ihnen gelungen. Einige Verse sollen einen Eindruck geben, CoRdans Fassung wird zum Vergleich zitiert.
Gleich zu Textbeginn spricht Gott zum Tod (v. 26-29): Want liet ic dye werelt dus langhe staen / in desen leven, in deser tempeesten, / tvolc souden werden argher dan beesten / ende souden noch deen den anderen eten. CoRdan überträgt: Denn ließ ich’s treiben, wie’s gegangen / Mit diesem Leben, dem Gestürme: / Das Volk würd ärger als Gewürme –/ Sie würden noch einander fressen. stRiJBosCh und zellmann übersetzen: Denn ließe ich die Welt länger so gewähren / In diesem Leben, in diesem Sturm, / würden die Menschen schlimmer als Tiere, / und es würde der eine den anderen verschlingen.
Wo CoRdan bspw. mittelniederländisch volc mit “Volk” überträgt, wählen stRiJBosCh und zellmann das heute weniger beladene Wort “Mensch”. CoRdan übersetzt beesten mit “Gewürme”, vollreimend auf “Gestürme”. Eine Wahl, die allgemein zum Text passt, denkt man an die biblischen Vergleiche der Menschen mit niedrigen Würmern – oder in eine andere Richtung – an Vergänglichkeitsdarstellungen mit wurmzerfressenen Toten. Im spezifischen Kontext dieser Verse jedoch, in denen es darum geht, dass die Menschen einander “verschlingen” oder “fressen”, ist die Übersetzung “Tiere” doch näher an mittelniederländisch beesten. Wer heute also über den egoistischen und oberflächlichen Menschen klagt, den Grund hierfür vielleicht sogar in einer modernen Gottlosigkeit sucht, den wird dieses Spiel daran erinnern, dass dies nie anders war. Ein beeindruckender und nachdenklich stimmender spätmittelalterlicher Spieltext, der es verdient, nicht nur erforscht, sondern vor allem ‘einfach’ gelesen zu werden. Diese neue Übersetzung und die erhellenden Begleittexte dieser gelungenen Ausgabe sind dabei eine große Hilfe.
Dr. Elisabeth Meyer, Cornelis van Alkemadestr. 37, NL–1065 AB AmsterdamE-Mail: [email protected]
1 Jedermann, Lanselot und Sanderein, Mariechen von Nymwegen. Altflämische Spiele nach dem Urtext neu erstellt von Wolfgang CoRdan, Köln 1950.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
99Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Erzählen im mittelalterlichen Skandinavien II, hg. von RoBeRt nedoma (Wiener Studien zur Skandinavistik 22), Wien 2014. Praesens Verlag, 209 S., ISBN 978-3-7069-0777-4, EUR 31,10
Band 22 der ‘Wiener Studien zur Skandinavistik’ widmet sich nach längerer Zeit wieder dezidiert der Erzählkunst des nordischen Mittelalters. Der Publikation ging im Jahre 2000 ein erster Teil voran, als Band 3 der Reihe. So will man RoBeRt nedomas einlei-tender Bemerkung, es sei nun “opportun, einen Nachfolgeband vorzulegen” (S. 9), gerne beipflichten; viele der aktuellen Beiträger haben bereits zum ersten Band beigesteuert. Das der ‘Njáls saga’ entstammende Zitat ekki dugir ófreistat – ‘nichts nutzt, was nicht erprobt ist’, erhebt der Herausgeber zum Leitgedanken der versammelten Beiträge. Faktisch stehen dann neben Fallstudien aber auch allgemeinere Betrachtungen. Mit familienhistorischen Überlegungen zur ‘Karlamagnús saga’ leitet susanne kRamaRz-Bein den Sammelband ein; sie bewegt sich damit auf dem ihr wohlvertrauten Terrain der altnordischen Karlsdichtung. Die zwölfseitige programmatische Betrachtung sucht zu demonstrieren, in welchem Maße der Einbezug literaturtheoretischer Ansätze auch die Altskandinavistik bereichern kann. Bemerkenswerterweise, das bezeugen auch kRamaRz-Beins einleitende Worte, dominiert dort noch immer eine Skepsis gegenüber explizit theoriegeleiteten Untersuchungen, die eine stete Rechtfertigung zu fordern scheint. Das dieser skeptischen Haltung zugrundeliegende eigentümliche Verständnis vieler Mediävisten, was ‘Theorie’ eigentlich ist oder nicht ist, sei hier dahingestellt; kRamaRz-Bein ist jedenfalls zuzustimmen, wenn sie fordert, literaturtheoretische Posi-tionen sollten “die behandelten Themenspektren nicht inflationär überfluten”, in einer “dosierten und reflektierten Anwendung” (S. 11) aber als potenzielle Bereicherung ernstgenommen werden. Die nachfolgende Betrachtung liest sich dann als akzentuierte Zusammenfassung bestehender literaturanthropologischer und -psychologischer Zugänge in der Mediävistik. Schwerer einordnen lässt sich hans kuhns Beitrag zu ‘Andra saga’ und ‘Andra rímur’, der wesentlich in einer Nacherzählung der Handlung besteht. Das sind u.a. 24 der genannten rímur (‘Reimgedichte’) auf elf Druckseiten; dabei wurde allein deren jüngere Redaktion bedacht. Der anschließende Kommentar bietet eine weitgespannte, daher notwendig oberflächlich verharrende Zusammenschau bisheriger Forschung zur Sagaliteratur, in der Themen wie Mündlichkeit/Schriftlichkeit, Figurenpsychologisierung und Erzähllogik gestreift werden. kuhns Bestreben ist es anscheinend, die ‘Andra saga’, wie sie sich heute nur noch aus den rímur rekonstruieren lässt, in diesen Diskussionen zu verorten. Der interessante Versuch bleibt aber allzu vage. Hinzu kommen schwer verständliche Formulierungen wie: “Je anspruchsvoller die metrischen Vorbedingungen sind [...], umso größer wird der Aufwand an poetischem Vokabular aus dem Arsenal der Skaldendichtung und an Kenningar. Wir können die Rímur nicht auf dem Vo k a b u l a r ihrer Saga-Vorlagen behaften, wohl aber auf dem I n h a l t ” (S. 25). Was ist damit für die nachfolgende Zusammenfassung der rímur gesagt? kuhn enthält dem Leser ein präzisierendes Fazit oder einen Ausblick vor, sodass man auf künftige Ausführungen hoffen muss. Dem Korpus der ‘originalen Riddarasögur’ nähert sich hendRik lamBeRtus, mit Fokussierung der narrativen Funktion von Magie. Damit ist ein weites Feld betreten, das lamBeRtus in einigen Vorbemerkungen auf seine Fragestellung eingrenzt, mit besonderer Betonung der Spannung zwischen ‘Eigenem’ und ‘Fremdem’; dahinter wird man Ergeb-
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
100 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
nisse seiner 2013 publizierten Dissertation zu “Darstellung und Funktion des Fremden in den originalen Riddarasögur” sehen dürfen. An einigen Fallbeispielen legt er knapp aber überzeugend dar, wie Magie nicht allein als Chiffre des Fremden, sondern auch als Chiffre der Verfremdung, also eines Prozesses, gelesen werden kann. Damit werde zugleich deutlich, dass simple Schematisierungen die Erzählkunst der ‘Riddarasögur’ nur bedingt zu fassen vermögen, dass die narrative Funktionalisierung von Magie vielmehr die Dynamik dieser Erzählungen hervorstechen lasse. maRina mundt diskutiert anschließend das in der ‘Egils saga’ überlieferte Gedicht ‘Sonatorrek’ (‘Verlust der Söhne’) hinsichtlich seiner Einpassung in den umgebenden Text und möglicher Einflüsse aus dem Nahen Osten. Zur Adaption orientalischer Motive in altnordischer Literatur hat mundt seit den 1970er Jahren gearbeitet und – meines Wissens – zuletzt 1993 eine umfängliche Studie vorgelegt. Einen kulturellen Austausch des mittelalterlichen Europas mit dem vorderasiatischen Raum wird heute niemand in Frage stellen wollen, und tatsächlich hat mundt hier in der Vergangenheit auf eine Forschungslücke hingewiesen. Ihre im vorliegenden Aufsatz vorgestellte These einer Einflussnahme des iranischen Nationalepos ‘Shahnama’ auf ‘Sonatorrek’ bleibt aber eine Spekulation, der man nur bedingt folgen will. Die Ausgestaltung des Sujets – ein Vater beklagt den frühzeitigen Tod seines Sohnes – erscheint jedenfalls nicht so exklusiv, dass man Ähnlichkeiten überbewerten sollte; ein Verweis mundts auf einen Vortrag aus dem Jahre 2000 hilft da nicht weiter. Ein spekulatives Moment beherrscht indes den gesamten Beitrag, der eigenartigerweise Forschungsliteratur nach der Jahrtausendwende nirgends explizit zur Kenntnis nimmt, vielmehr noch Studien der frühen 1990er Jahre als ‘unlängst’ deklariert. Dabei wurde sowohl zur ‘Egils saga’ im Allgemeinen als auch ‘Sonatorrek’ im Besonderen in den letzten 20 Jahren vielfältig publiziert; mit der Rede von opinio communis (S. 57) lassen sich diese Debatten nicht einfach übergehen. So wird man mundts Beitrag als Erinnerung an die Notwendigkeit einer intensivierten Diskussion bisher vernachlässigter Thesen zu außereuropäischen Einflüssen auf die mittelalterlich-skandinavische Literatur auffassen dürfen. Mit den Bausteinen literarischer Erzählung, einzelnen Wörtern und Ausdrücken, setzt sich RoBeRt nedoma in drei Fallbeispielen der eddischen Dichtung auseinander. Dahinter steht die Tatsache, dass trotz beachtlicher Grundlagenwerke wie dem Frankfurter ‘Edda’-Kommentar längst nicht jedes Interpretationsproblem geklärt ist, dass die Arbeit am Detail weiterhin unabdingbar ist. nedoma nähert sich dieser Aufgabe einerseits auf etymologischem Wege, andererseits durch Kontextualisierung. Das ist generell kein neues Prozedere. Gleichwohl bezeugt seine akribische Zusammenschau und Bewertung möglicher Deutungen, wie ungemein produktiv Wortschatzuntersuchungen bereits auf kleinster Ebene sein können – solche streng philologische Arbeit wird erfahrungsgemäß längst nicht immer mit der nötigen Sorgfalt betrieben. Dass nedomas Ergebnisse als Vorschläge zu betrachten sind, denen die letzte Beweiskraft fehlt, liegt in der Natur der Sache. Der Konstruktion von ‘Männlichkeit’ in der Sagaliteratur widmen sich andRea Rau und maRkus gReuliCh auf rund 45 Seiten, konzentriert in mehreren Einzelbetrachtungen. Dabei bestätigt sich, dass die narrative Funktionalisierung von Macht und Männlichkeit in den behandelten Sagas keinem starren Schema folgt, diese vielmehr zwischen gewalt-samer Konfrontation und gewaltfreier Kommunikation ein breites Spektrum eröffnen. Vor allem die Auseinandersetzungen hervorragender Männer aus Island und Norwegen sind dabei von Bedeutung. Die Argumentation arbeitet sich an ausgewählten Passagen
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
101Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
entlang, und man folgt ihr bereitwillig. Abschließend stellt sich aber die Frage nach einem Erkenntnismehrwert: ‘Männlichkeit’ im Spannungsfeld von Wort und Tat ist aus meiner Sicht keine Neulesung der Texte, sondern eine Umformulierung wohlbekannter Thesen (wesentlich in Nachfolge CaRol J. CloVeRs, auf die mehrfach verwiesen wird). Das ‘Monologische’ und das ‘Dialogische’, also die narrativ-funktionalen Relationen von männlichen zu anderen männlichen und/oder weiblichen Protagonisten, sind Termini, deren erzähltheoretische Relevanz nur angedeutet bleibt. Demgegenüber erscheint die abschließend formulierte Aufgabe, “das Wechselspiel von unterschiedlichen kulturellen Mustern und veränderten Erzähl- und Handlungslogiken intensiver zu untersuchen” (S. 129), sehr weit gefasst – zumal die Verfasser selbst einräumen, dass ‘Männlichkeit’ nicht “im Horizont eines festen Konzepts” funktioniere, “sondern sich sowohl für jeden Einzeltext als auch im Überlieferungskontext aus einem komplexen Spannungsfeld heraus artikuliert” (S. 131). Da der Aufsatz offensichtlich als Einleitung in ein größeres Forschungsprojekt konzipiert ist, darf man auf künftige Ergebnisse gespannt sein. miChael sChulte, der unlängst den Fridtjof-Nansen-Preis für international herausragende Forschungsleistungen erhielt, befasst sich mit dem narrativen Charakter ausgewählter spätwikingerzeitlicher Runeninschriften. Klar ist, dass es sich bei diesen Gedenkformeln nur um “minimale Erzähleinheiten” (S. 137) handeln kann, die gleich-wohl, je nach Interpretation, bemerkenswerte kulturhistorische Details enthüllen können. Nach knapper Einleitung arbeitet sChulte an mehreren Beispielen solche Details prägnant heraus und verortet sie in der Forschungsdiskussion. Sprachhistorische Feinheiten der überlieferten Formeln mögen nicht jedem Leser unmittelbar zugänglich sein, belegen aber die philologische Akribie, mit der sich der Verfasser seinen Untersuchungsgegen-ständen nähert. Wünschenswert wäre in Ergänzung eine kurze Diskussion des Konzepts der ‘historischen Narration’ gewesen, das sChultes Argumentation zugrundeliegt. Den mit über 50 Seiten umfangreichsten Beitrag steuert abschließend matthias teiCheRt bei. Den Themenkomplex des Fantastischen und Unheimlichen in der altwest-nordischen Literatur hat er bereits in früheren Aufsätzen bedacht. teiCheRts schließende Worte, im vorgegebenen Rahmen nicht mehr als eine “referatsartige einführende Gesamtschau” (S. 202) präsentieren zu können, fassen den Charakter des Aufsatzes recht treffend (wobei der hypotaktische Stil an mancher Stelle dieses Einlesen behindert). In “Siebenmeilenstiefeln” (S. 201) durchschreitet er verschiedene Gattungen der mittel-alterlich-nordischen Erzählkunst, gibt Zusammenfassungen ausgewählter Episoden, eingerahmt von forschungsgeschichtlichen Aspekten, bereichert durch punktuelle eigene Deutung. Was nach der Lektüre zurückbleibt, ist, wie vom Verfasser intendiert, ein Gefühl dafür, wie umfangreich dieses “Kabinett des Grauens” in der behandelten Literatur tat-sächlich ist – auch wenn zahlreiche der vorgestellten Erzählausschnitte natürlich bereits bekannt sind. teiCheRts Versuch einer Typologisierung der verwendeten Motive, auch anhand ihrer narrativen Funktion, bleibt, wie er selbst einräumt, noch unabgeschlossen. Deutlich wird aber, wie solche horror fiction Menschen seit jeher fasziniert hat, hier also eine anthropologische Konstante greifbar wird, die eine viel beschworene Alterität des Mittelalters zurückstellt. So wird man auch dem Fazit einer “Lesbarkeit mittelalterlicher (hier: altnordischer) Texte als Narration vom Schrecken und Grauen” (S. 201) nicht widersprechen wollen, darf aber in Ergänzung bisheriger Arbeiten künftig auf eine weitere Konzentration und Präzisierung der umrissenen Thesen hoffen. Summa summarum vereint der vorliegende Band eine heterogene Auswahl an Bei-trägen, denen man am ehesten mit der Überschrift “work in progress” gerecht werden
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
102 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
dürfte. So gesehen erlaubt der Sammelband einen Einblick in aktuelle Fragestellungen der Altskandinavistik, wie man ihn sich im deutschsprachigen Raum häufiger wünschen würde – durchaus unter verstärkter Berücksichtigung eines wissenschaftlichen Nach-wuchses, der sich naturgemäß der eigenen Publikation noch mit besonderem Elan widmet. Unbesehen des wissenschaftlichen Gehalts der versammelten Beiträge ist das kleine Schriftbild gewöhnungsbedürftig; mag sein, dass da erst im Druck verkleinert wurde. Wenn aber etwa kuhns Beitrag die Lektüre von elf Seiten rímur voraussetzt (s.o.), dann muss das auch junge Augen ermüden. Weniger störend erscheint der Umstand, dass auf eine einheitliche formale Einrichtung der Beiträge verzichtet wurde; ein sorgsameres Lektorat wäre hingegen angebracht gewesen. Erwähnenswert ist schließlich das zwei-seitige Register, das Autoren und Texte listet.
Dr. Jan Alexander van Nahl, Kirchstr. 11, D–53560 VettelschoßE-Mail: [email protected]
thomas fRenz, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart (Bibliothek des Buchwesens 21), Stuttgart 2010. Verlag Anton Hiersemann, 217 S. mit Abb., ISBN 978-3-7772-1014-8, EUR 148,–thomas fRenz, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart. Tafelband (Bibliothek des Buchwesens 24), Stuttgart 2014. Verlag Anton Hiersemann, 306 S. mit Abb., ISBN 978-3-7772-1400-9, EUR 168,–
Mit dem Erscheinen des Tafelbandes ist das zweibändige Werk des bekannten Diploma-tikers und Paläographen abgeschlossen. Ziel ist die Erläuterung, “wie die Abkürzungen der lateinischen Schrift ‘funktionieren’, und so den Leser zu befähigen, unbekannte Abkürzungen selbst herzuleiten und zuverlässig zu deuten.” Dazu unternimmt der Ver-fasser einen weitgehend chronologisch angeordneten Durchgang durch die Geschichte des gekürzten Schreibens von der römischen Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart, in die fRenz das 19. und 20. Jh. einbezogen wissen möchte. Einer Literaturübersicht und einem knappen definitorischen Kapitel lässt er die elf Hauptabschnitte folgen. Grundlage des abendländisch-lateinischen Kürzungswesens wurden, teils unter Aufnahme griechischer und über diese phönizischer Gebräuche, die verschiedenen Kürzungsmöglichkeiten des ‘klassischen’ Lateins, wie etwa die notae juris, die sog. Nomina-Sacra-Kürzungen sowie die Tironischen Noten. Sie bedienten sich häufig spezieller Kürzungszeichen, die nicht alle aus Buchstaben hervorgingen. Den graphischen Formen der Kürzungen wendet sich das Buch im nächsten Punkt zu, wenn es zwischen Abkürzungszeichen, “mechanischen Methoden der Schriftkürzung” und Platzhaltern unterscheidet. Die Nutzung der antiken Abbreviaturen lebte im frühen Mittelalter weiter; in den verschiedenen Teilen Europas ging die (Weiter-)Entwicklung unterschiedliche Wege. Nach Vereinheitlichungen im Zuge der Durchsetzung der karolingischen Minuskel in weiten Teilen des Kontinents ergaben sich im Zuge des Übergangs zur gotischen
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
103Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Schrift vielfältige Neuerungen. Silbenkürzungen und fachspezifische, fRenz nennt sie “Abkürzungen der ‘2. Generation’”, erweiterten das Repertoire beträchtlich. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks kam für die meisten dieser Formen innerhalb weniger Jahrzehnte das Aus. Mit einem Blick auf die Adaption der Kürzungen in den Volkssprachen verlässt fRenz nun das Gebiet des Lateinischen, um zu den neuzeitlichen Kürzungen zu gelangen. Bevor er sich den Kürzungen der Gegenwart widmet, schaltet er ein Kapitel zu Zahlen und Symbolen als Kürzungen ein, dem er zum Abschluss des Textes einen Exkurs zur symbolischen Bedeutung von Buchstaben und Zahlen folgen lässt. Eine Liste von Hilfsmitteln zur Auflösung von Kürzungen beschließt den Text. Im Anhang findet sich ein vollständiger Abdruck einer Liste von Kürzungen aus dem Rituale von Durham, das im Text erwähnt wird. Literaturverzeichnis und Register beschließen den Band. Der 2014 erschienene Tafelband vereinigt 76 Faksimiles von – meist recht stark – abgekürzten Textbeispielen. Die bei weitem überwiegende Zahl dieser Beispiele stammt aus dem hohen und späten Mittelalter, das 16. Jh. ist mit einigen Exempeln vertreten, alle anderen Epochen werden kaum repräsentiert. Zu einer knappen Einleitung bei jedem Text kommt eine zeilengenaue Transkription, in der auf alle Kürzungen hingewiesen wird. Dabei werden diese verschiedenen Gruppen zugeordnet. Texte der Gegenwart sind als “Kuriosa” mit vier Beispielen berücksichtigt. Die Abbildungsqualität ist meist gut, die Transkriptionen zuverlässig mit den üblichen Interpretationsmöglichkeiten, die Hss. häufig erlauben. Direkte Bezüge vom Text- zum Tafelband oder umgekehrt werden nur an einigen Stellen hergestellt. Der Sinn des Tafelbandes dürfte – neben der reinen Illustration – möglicherweise darin liegen, Material für den Paläographieunterricht zur Verfügung zu stellen. Dies wäre preiswerter und praktikabler über die Beigabe oder separate Herausgabe einer CD-ROM zu erreichen gewesen. fRenz’ Arbeit reiht sich ein in eine Tradition der Paläographie, die vor allem im deut-schen Sprachraum gepflegt wurde. Das Entdecken und Zusammenstellen bestimmter Schriftphänomene steht dabei im Vordergrund. So ist es auch hier: Die Bände sind ein Florilegium im guten wie im schlechten Sinne. Sie erlauben den Blick auf die bunte Blütenwiese, kümmern sich aber weder um das Wachstum, die verschiedenen Pflanzen-gattungen in einer exakten Abgrenzung noch um die Häufigkeit und Verteilung der Blumen. Zudem kommt bei dieser Art von Paläographie in der Regel der Blick über die Grenzen des eigenen Faches zu kurz. So auch hier. Dass etwa die Linguistik etwas zu Kürzungen zu sagen hätte, wird entweder ignoriert oder gar – bisweilen sehr herab-lassend und mit abfälligen Worten – kritisiert. Dass es neben der Geschichte der Schrift auch eine Geschichte des Schreibens gibt, in deren Tradition sich der Rezensent ver-ortet, erfährt der Leser nicht. Alle Bemühungen des Autors, Kürzungen in Systematiken zu erfassen, müssen scheitern, weil er nicht erkennen will, dass es klar zu trennen gilt zwischen Kürzungsformen (z.B. Suspension und Kontraktion) und Kürzungszeichen (z.B. waagrechter Kürzungsstrich, “er”-Haken). An einigen Beispielen seien die Unzu-länglichkeiten des Werkes benannt:
Schon im Vorwort wendet sich fRenz gegen die Benutzung von Nachzeichnungen, nimmt aber selbst an mehr als einer Stelle eben genau dieses Instrument zur Hand. Seine Darstellung der “Abkürzungsarten” ist entschieden zu simpel und in sich unlogisch, weil er Zeichen für und Formen der Kürzungen vermischt. Regelrecht verliebt ist fRenz in die tironischen Noten, deren Benutzung er ein viel zu umfangreiches Kapitel widmet. Sie gehören seit eh und je zum “Kanon” und werden ausgiebig betrachtet, obwohl sie in der schriftlichen Überlieferung
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
104 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
allenfalls eine marginale Rolle spielen. Statt der u.a. vom Rezensenten mit guten Gründen bevorzugten Unterscheidung zwischen determinativen und indeterminativen Kürzungszeichen, die entweder allgemein eine Kürzung oder aber den genauen gekürzten Buchstabenbestand bezeichnen, will er die Worte “spezifisch” und “unspezifisch” benutzen, bei denen das erste “die Art der Abkürzung” und das zweite allgemein eine Abkürzung signalisiere. Auch hier hätten ihm die Sprach- und Kommunikationswissenschaften weiterhelfen können, um zu Klarheit zu gelangen. Dass er Monogramme, Zahlzeichen, Symbole u.a. zu den Kürzungen zählen will, belegt umso mehr, dass er sich mehr Mühe mit der Klassifikation, auch aus dem Schreibvorgang heraus, hätte machen müssen. Wenn Kürzungen Raum und/oder Zeit sparen sollen, sind die aufwändig gezeichneten Monogramme etwa auf den hochmittelalterlichen Königsurkunden selbstverständlich keine Kürzungen. Daran ändert auch ihre eventuelle Herleitung von Kürzungen nichts. Dass Schreiben ein Vorgang ist, ist der paläographischen Schule, zu der fRenz gehört, seit jeher weitgehend gleichgültig.
Die Gewichtung seines Textes folgt der “klassischen” Paläographie: antike Grundlagen, sehr ausführlich das frühe, ausführlich das hohe, knapp das späte Mittelalter, kaum Neuzeit, die Gegenwart – wie im Tafelband – als “Kuriosum”. Dies steht in einem voll-kommenen Gegensatz zur schriftlichen Überlieferung in den Archiven und Bibliotheken und hat das Fach in Deutschland ins Abseits geführt. Fragen der Lesbarkeit und des Lesekomforts sowie der Schreibgeschwindigkeit und der Schreibtechnik interessieren fRenz nicht. Unglücklich ist die Wiedergabe von Kürzungszeichen, für die an mehreren Stellen des Buches ohne vorherige Erklärung arabische Ziffern benutzt werden, was der Klarheit abträglich ist. Es mag sein, dass manche dieser Zeichen diesen Ziffern (aber in wesentlich jüngeren Texten!) ähneln, doch ist ihre umstandslose Benutzung in der Wiedergabe von Textbeispielen eher dazu geeignet, zu verwirren. Einmal, bei der Beschäftigung mit den Kürzungen im Buchdruck, wendet fRenz tatsächlich moderne paläographische Methoden bei der Ermittlung der Verteilung von Kürzungen an, scheint sie also zu kennen. Umso unverständlicher ist es, dass er die Ergebnisse vergleichbarer Untersuchungen kaum zur Kenntnis nimmt. Mit dem Erreichen der Neuzeit sind fRenz’ humanistische Methoden der Sammlung dann vollends untauglich. Da wird bspw. eine Liste nach folgenden Kategorien strukturiert: Akten, Deutsch, Französisch, Verdoppelung des letzten Buchstabens – den inneren Zusammenhalt dieser Liste vermag wohl nicht nur der Rezensent nicht zu erkennen. Unangenehm sind auch die Besserwissereien des Autors, der etwa drei Mal darauf hinweist, dass “ff.” nicht als “fortfolgende” aufzulösen sei, der die Arbeiten anderer Autoren als “unergiebig” oder als um Unverständlichkeit bemüht bezeichnet und mit anderen Invektiven belegt und nicht müde wird, kulturpessimistische Klagen in seine wohl als “launig” empfundenen Anmerkungen einzuflechten. Es ist dem interessierten Leser vermutlich egal, ob fRenz bestimmte Kürzungen des Internetchats “witzig” oder “geschmacklos” findet. Ebenso wenig spielt seine private Sicht auf die Orthographie-reform eine Rolle. fRenz verheddert sich in der Darstellung von Zahlen als Abkürzungen, eine Sichtweise, die er vermutlich exklusiv hat und behalten wird. Da steht Abseitiges neben Zufälligem, gepaart mit richtigen Beobachtungen und Sachfremdem wie baro-cken Chronogrammen. Dass die Neuzeit fRenz’ Metier nicht ist, wird sehr deutlich. Er staunt darüber, dass in schnell geschriebenen Gebrauchstexten wie etwa Klausuren so wenig abgekürzt werde – dass seine Studenten möchten, dass ihr Professor ihre Texte verstehen kann, scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen. Dass und wie in der Werbe-welt des späten 20. und 21. Jh.s Abkürzungen als Logos und Brands von Agenturen
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
105Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
designt werden – man vermisst hier den Terminus ‘Akronym’ –, dass gesprochene und handgeschriebene Sprache der gedruckten und an Hochschulen benutzten voraus ist, dass man Abkürzungen nicht “mißbrauchen” kann: all das hätte man sehen können, wenn man sich auf den Dialog mit Nachbarwissenschaften einließe. Sein Exkurs zur symbolischen Bedeutung von Buchstaben und Zahlen gehört nicht zum Thema. An Stelle der von ihm gewählten, obskuren Beispiele hätte er wenigstens etwa die Zahlencodes von Neonazis – “18” = “A. H.” (erster und achter Buchstabe des Alphabets) = “Adolf Hitler” – anführen können, um so etwas wie gegenwärtige Bedeutung zu generieren. Kurzum: Das Werk ist enttäuschend, weil es über die reine Sammlung nicht hinaus-gelangt. Dass Paläographie eine Disziplin ist, die auch Fragen stellen kann, die über die Tätigkeit des Sammelns hinausweisen, ist in fRenz’ Buch nicht zu erkennen. Die nicht wenigen Druckfehler, an einer Stelle sogar in den hervorgehoben in der Schriftart Arial gesetzten Kürzungsbeispielen, machen zu alledem einen wenig sorgfältigen Eindruck. Ob das Werk dem akademischen Unterricht dienen kann, sei dahingestellt. Studierende dürfte der Preis – namentlich für den aufs Ganze gesehen schmalen Textband – abschrecken.
Dr. Jürgen Römer, Mündener Str. 2, D–35104 Lichtenfels-DalwigksthalE-Mail: [email protected]
ÓskaR guðmundsson, Snorri Sturluson. Homer des Nordens. Eine Biographie. Aus dem Isländischen übersetzt von Regina JuCknies. Mit einem Vorwort von Rudolf simek, Köln/Weimar/Wien 2011. Böhlau Verlag, 447 S. mit Abb., ISBN 978-3-412-20743-4, EUR 24,90
Die neue Biographie über Snorri Sturluson aus der Feder des isländischen Historikers und ehemaligen Journalisten ÓskaR guðmundsson wurde im Heimatland des Autors sehr gut von den Kritikern aufgenommen und gehörte zu den meistgelesenen Büchern des Erscheinungsjahres 2009 (Originaltitel: ʻSnorri – ævisaga 1179-1241ʼ).1 Im Zuge der Buchmesse in Frankfurt 2011, auf der Island als Ehrengast auftrat, wurde die deutsche Übersetzung des Buches auch in der hiesigen Presse z.T. überschwänglich gelobt. Die Frage, warum bislang noch keine Biographie über den bedeutendsten Autor des skandina-vischen Mittelalters, den Verfasser der ‘Prosa-Edda’ und der ‘Heimskringla’ vorlag, ist im isländischen Pavillon der Frankfurter Buchmesse vom Autor und Rudolf simek diskutiert worden. Die auch in der Presse wiederkehrende Feststellung, es handele sich um die erste Biographie über Snorri ist jedoch nicht ganz richtig. Monographien, die nicht nur das Werk Snorris vorstellen, sondern auch dessen Leben nachzeichnen, gibt es durchaus. An erster Stelle sind insbesondere die Werke von fRedRik paasChe2 und siguRðuR noRdal3 zu nennen. Freilich weniger einschlägig, aber im vorliegenden Zusammenhang ebenfalls
1 Der Vergleich mit Homer, den man meinte dem Titel der deutschen Ausgabe hinzufügen zu müssen, hinkt aus mehreren Gründen (vgl. das Vorwort von Rudolf simek, S. 9). Er soll schlicht die außergewöhnliche Bedeutung Snorris unterstreichen, ist aber irreführend. Auch Ossian ist bekanntlich als ʻHomer des Nordensʼ bezeichnet worden.
2 fRedRik paasChe, Snorre Sturlason og Sturlungene, Oslo 21948.3 siguRðuR noRdal, Snorri Sturluson, Reykjavík 1920.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
106 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
zu erwähnen sind etwa das Buch von maRlene Ciklamini4 sowie eine Snorri-Biographie von iVaR eskeland5. Eine Besonderheit der vorliegenden Biographie ist, dass der Autor tatsächlich jeden Schritt Snorris darzulegen versucht. Dabei ordnet er die Kapitel – fast annalenartig – nach Jahreszahlen. So lauten die Kapitel am Beginn des Buches bspw. “1181-1191 – Kindheit und Erziehung in Oddi” oder “1197 – Tod des Ziehvaters”, am Ende etwa “1240 – Frieden im Reich” oder “23. September 1241 – Nicht schlagen!”. Das wichtigste Merkmal des Buches ist jedoch, dass es die Grenzen zwischen historischen Fakten, Rekonstruktion und Fiktion konsequent verwischt. Auf der Grundlage der vorhandenen Quellen liefert guð-mundsson eine lebendige, ja spannende Erzählung über Snorris Leben und die bewegte Zeit, in der es sich abspielte. Zwar informieren die Quellen – insbesondere natürlich die ‘Sturlunga saga’ – vergleichsweise gut über das Leben des mittelalterlichen Gelehrten, ihre Auswertung ist jedoch nicht ohne Schwierigkeiten und liefert keineswegs ein so klares, lebendiges und detailreiches Bild, wie es das Buch von guðmundsson sugge-rieren mag. Man könnte auch sagen, eigentlich hat der Autor weniger eine Biographie als vielmehr eine Art ʻSnorra saga Sturlusonarʼ geschaffen. Gerade diese Mischung aus quellenbasierter Darstellung und romanartiger Rekonstruktion, die durch farbenfrohe Erläuterungen der Lebensumstände auf Island im 12./13. Jh. angereichert wird, ist beim breiten Publikum sowie in der Presse hervorragend angekommen. guðmundsson versteht es, Geschichte lebendig zu machen. Aus wissenschaftlicher Sicht bereitet die Vorgehensweise freilich Bauchweh. Die Kritik fiele sanfter aus, wenn der Autor seine Leser mit Hilfe des Anmerkungsapparats fortwährend darüber informierte, was glaubhaft überliefert, was problematisch und was schlicht erschlossen, interpretiert oder hinzu-gefügt ist. Dies geschieht jedoch nur ansatzweise. Quellenkritische Anmerkungen sind rar. Ein einführendes Kapitel, in dem der Autor seinen Umgang mit den Quellen, seine Methode und seine Absichten erläutert, hätte ebenfalls Abhilfe schaffen können, fehlt jedoch gänzlich. Die Biographie beginnt unmittelbar nach dem Vorwort von Rudolf simek mit dem ersten Kapitel (“8. Juli 1181 – Ziehsohn in der Fremde”):
Getümmel auf dem Gutshof. An einem schönen Julitag nach dem Althing im Sommer 1181 stand Snorri staunend zusammen mit seinem Vater Sturla Thórdarson auf dem Hof von Oddi in Rangárvellir (S. 17).
Das – übrigens sehr gelungene – Vorwort, das die literarische Sonderstellung Islands im Mittelalter umreißt und Snorri als einen sowohl von einheimischen als auch von europä-ischen (christlichen und antiken) Traditionslinien geprägten Gelehrten charakterisiert, geht gar nicht auf die Biographie von guðmundsson ein und hat eigentlich nichts mit ihr zu tun. Hinzu kommt, dass der Autor auch bezüglich seiner kulturgeschichtlichen Exkurse recht sparsam mit weiterführenden Hinweisen umgeht. Wie die Bibliographie zeigt, greift er überwiegend auf skandinavische Forschungsliteratur, insbesondere isländische zurück. So kommt es etwa, dass guðmundsson das spätwikingerzeitliche Prunkkästchen
4 maRlene Ciklamini, Snorri Sturluson, Boston 1978. Siehe dazu die Rezensionen von anthony faulkes (Saga Book of the Viking Society for Northern Research 20 [1978], S. 306-309) und sVeRRiR tÓmasson (Skandinavistik 12 [1982], S. 65-67).
5 iVaR eskeland, Snorri Sturluson – ein biografi, Oslo 1992. Siehe auch John simon, Snorri Sturluson: His Life and Times, in: Parergon 15 (1976), S. 3-15.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
107Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
von Cammin (Pommern) mit der Plünderung von Konungahella durch die Wenden verbindet und dem norwegischen König Sigurður Jórsalafari zuschreibt, ohne auf die einschlägigste Arbeit zum Thema von aRnold muhl6 hinzuweisen (S. 24f., Anm. 18), in der die verschiedenen spekulativen Herkunftstheorien kritisch hinterfragt werden. Ein weiteres Beispiel betrifft den ‘Physiologus’, den der Autor anführt und kurz vorstellt, um das europäisch geprägte intellektuelle Umfeld in Oddi zu veranschaulichen und greifbar zu machen (S. 31, Anm. 37). Hier verweist guðmundsson lediglich auf eine Ausgabe der Bruchstücke des isländischen ‘Physiologus’ im dritten Band der ‘Heimskringla’-Ausgabe von 19917 und versäumt, auf die einschlägigen kommentierten Editionen und Studien etwa von halldÓR heRmannsson8 und CaRla del zotto tozzoli9 oder die grundlegen-den Arbeiten von nikolaus henkel10 und VittoRia dolCetti CoRazza11 aufmerksam zu machen. Als interessant und durchaus gewinnbringend betrachte ich guðmundssons Über-legungen, die Snorris Gewaltlosigkeit und Trinkfreudigkeit sowie sein politisches und häufig auch privates Unvermögen betreffen (S. 200f., 317-320). Das Vorhandensein eines Glossars, verschiedener Stammtafeln und eines Registers sind zu loben. Wissen-schaftlichen Ansprüchen kann das Buch von guðmundsson, der ohne Zweifel ein guter Kenner ist, nicht genügen. Doch scheint dies auch nicht das erklärte Ziel des Autors gewesen zu sein. guðmundsson wollte offenbar keine ʻtrockenenʼ Fakten aufzählen und eine Quellenkritik der ‘Sturlunga saga’ ausbreiten, er wollte ein lebendiges Bild von Snorri Sturluson für ein breiteres Publikum zeichnen, informieren und gleichzeitig unterhalten. Dem Studienanfänger der Altskandinavistik etwa, der sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie das Leben Snorris ausgesehen haben mag, wie man sich den Menschen hinter der ‘Edda’, der ‘Heimskringla’ und der ‘Egils saga Skallagrímsso-nar’ sowie deren Entstehungsumfeld und -bedingungen vorstellen könnte, ist das Buch – sozusagen zur Einstimmung – durchaus zu empfehlen.
Dr. Sigmund Oehrl, Georg August Universität Göttingen, Skandinavisches Seminar – Akademie-projekt “Runische Schriftlichkeit in den germanischen Sprachen”, Käte-Hamburger-Weg 3, D–37073 GöttingenE-Mail: [email protected]
6 aRnold muhl, Der Bamberger und der Camminer Schrein. Zwei im Mammenstil verzierte Prunkkästchen der Wikingerzeit, in: Offa 47 (1990), S. 241-420, hier S. 323-329.
7 Snorri Sturluson. Heimskringla 1-3, hg. von BeRglJÓt s. kRistJánsdÓttiR u.a., Reykjavík 1991.
8 The Icelandic Physiologus. Facsimile Edition with an Introduction, hg. von halldÓR heRmannsson (Islandica 27), Reykjavík u.a. 1938.
9 Il Physiologus in Islanda, hg. von CaRla del zotto tozzoli, Pisa 1992.10 nikolaus henkel, Studien zum Physiologus im Mittelalter (Hermaea N.F. 38), Tübingen
1976.11 VittoRia dolCetti CoRazza, Il fisiologo: nella tradizione letteraria germanica (Bibliotheca
germanica 2), Alessandria 1992.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
108 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Karsthans. Thomas Murners ‘Hans Karst’ und seine Wirkung in sechs Texten der Reformationszeit: ‘Karsthans’ (1521), ‘Gesprech biechlin neüw Karsthans’ (1521), ‘Göttliche Mühle’ (1521), ‘Karsthans, Kegelhans’ (1521), Thomas Murner: ‘Von dem großen Lutherischen Narren’ (1522, Auszug), ‘Nouella’ (ca. 1523), hg., übersetzt und kommentiert von thomas neukiRChen (Beihefte zum Euphorion 68), Heidelberg 2011. Universitätsverlag Winter, 298 S. mit Abb., ISBN 978-3-8253-5976-8, EUR 55,–
Der elsässische Franziskaner Thomas Murner belebte 1520 eine zuvor durchaus geläufige Personifikation des selbstbewusst-aufrührerischen Bauern, um mit Hilfe dieser Figur die ihm missliebigen Umtriebe der Reformation zu brandmarken – er bediente sich des gewöhnlichen Hans mit seiner zweispitzigen Forke, dem Karst. Murner stach mit seinem ‘Hans Karst’ in ein Wespennest, wie die im Jahre darauf verbreitete Replik ‘Karsthans’ zeigt: Murners religiöse Widersacher ließen ihn darin u.a. neben der Titel-figur auftreten, er wurde als “Mur-Narr” und, gemäß seinem Namen, als maunzender Kater geschmäht (murner murmaw; S. 12 der besprochenen Edition). Sei es, dass von Murners Wieder-Erwähnung des Karsthans eine unmittelbare, reaktualisierende Wir-kung auf die alte fiktive Figur ausging, wie es der Untertitel der vorliegenden Edition behauptet, oder sei es auch, dass die Verkörperung des selbstbestimmten, reformatorisch gesinnten Bauern in den 1520er Jahren quasi in der Luft lag und nicht die eine, unfrei-willige Erweckung benötigte: In jedem Fall ist eine große Massierung von Texten zu beobachten, die in engem zeitlichen Anschluss an Murners ‘Hans Karst’ folgten und in denen der Bauer Hans fast durchgehend zum wortgewandten und selbstbewussten Verfechter pro-reformatorischer Anliegen wurde. thomas neukiRChen versammelt sechs dialogisch bzw. dramatisch geprägte Texte der Reformationszeit. Im ersten, ‘Karsthans’, treffen u.a. Thomas Murner und Martin Luther aufeinander. Diese Begegnung endet mit dem fluchtartigen Rückzug Murners und seiner kompletten Bloßstellung. Die in diesem Pamphlet latent greifbare Gewaltbereitschaft des Karsthans (Wo ist myn pflegel, S. 14) wurde durch das 1521 erschienene ‘Gesprech biechlin neüw Karsthans’ deutlich gemildert. Hier trifft der als einfältig-lernbegieriger Bauer dargestellte Karsthans auf den Reichsritter Franz von Sickingen. Diesem gelingt es nicht nur, Karsthans durch mehr als 100 Bibelzitate die neue lutherische Lehre näher zu bringen, sondern auch, ihn seiner aufkeimenden Gewaltbereitschaft zu entfremden und für Sickingens Sache zu gewinnen. Im ebenfalls 1521 erschienenen dritten Text der Sammlung neukiRChens, ‘Göttliche Mühle’, fungiert Karsthans wiederum als ein “Beschützer der Reformation” (S. 292). Die nachfolgende Unterredung ‘Karsthans, Kegelhans’ beleuchtet die Unterdrückung und Ausbeutung der Bauern, vor allem ini-tiiert durch die Geistlichkeit. Thomas Murner, erzürnt durch die Schmähungen seiner Person, veröffentlichte 1522 die Satire ‘Von dem großen Lutherischen Narren’. In dieser Kampfschrift, die neukiRChen in einem Auszug in seine Textsammlung aufge-nommen hat, rechnet Murner mit seinen Gegenspielern ab. Dabei wird Karsthans als Narr dargestellt, der sich aus Angst vor dem Galgen in Murners Bauch versteckt hält. Die pro-reformatorische Antwort folgte kurz darauf durch die ‘Nouella’. In diesem Text erscheint einem Pfarrer, einem Mesner und anderen Dorfhonoratioren der Geist eben jenes “großen lutherischen Narren” und verschluckt schließlich den zu Hilfe geholten Thomas Murner.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
109Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Diese mit der Figur des Karsthans einmal enger, einmal lockerer verknüpften Pamph-lete der Reformationszeit erstmals in einem Band zusammenzustellen, ist zweifellos ein ebenso lohnendes wie naheliegendes Vorhaben. Die Edition thomas neukiRChens ist also von vornherein ein erfreuliches Projekt. Durch sie werden die genannten fünf pro-reformatorischen Schriften und eine Replik Murners versammelt, bequem greif- und lesbar in einem Band von knapp 300 Seiten. Wir fragen uns freilich, warum die von neukiRChen auf S. 295f. erwähnten ‘Sendschreiben’ an Karsthans aus dem Jahre 1524 nicht ebenfalls in die Ausgabe aufgenommen wurden. Fest steht jedenfalls, dass mit neukiRChens Edition eine bisher nur sehr aufwändig zu leistende Betrachtung der Einzelwerke im Kontext zeitnah entstandener, sinnvoll vergleichbarer anderer Werke möglich wird. Dass diese Betrachtung keineswegs dem mehr oder minder esoterischen Zirkel der Gegenwartsleser vorbehalten bleiben mag, welche des oft trügerisch bekannt scheinenden Frühneuhochdeutschen mächtig sind, könnten die für diese Ausgabe erstellten Übersetzungen ins Gegenwartsdeutsche befördern. Die Edition neukiRChens zielt also wohl insgesamt – ohne dass dies irgendwo im Buch angeführt würde – darauf, diese zumindest halbwegs vergessenen Texte des frühen 16. Jh.s durch eine erstmalige Zusammenstellung und Übersetzung interessant zu erhalten bzw. sie wieder schmack-haft zu machen. Der Herausgeber bezweckt dabei offenkundig, die Karsthans-Texte sozusagen “für sich sprechen zu lassen” und editorische Begleittexte auf ein Minimum zurückzuführen: So fehlt eine Einführung, die die Anliegen der vorliegenden Arbeit explizieren würde. Ein Variantenapparat zu den Editionstexten ist ebenfalls nicht vor-handen, die bisweilen eher stereotyp gereihten Erläuterungen (Zitatnachweise, seltener Sacherläuterungen, oft Grammatikparagraphen à la: “26 doctern] e für o, Wein §17”, S. 65) muss man sich im Anschluss an jeden Einzeltext erblättern. Zudem würde man sich zur besseren Orientierung und deutlichen Zeitersparnis Hinweise auf kommentierte Textelemente im Editionstext bzw. zeilengenaue Verweise der Kommentare auf die jeweiligen Referenzstellen wünschen. So ist mit einem ohnehin nicht allzu hilfreichen Kommentar wie “76 daz] Zu ‘daz’ in kausaler Funktion vgl. FNG § S 306,7” nur mit einiger Mühe etwas anzufangen, wenn sich auf Seite 76 achtmal daz findet. Die Darstellung der editorischen Prinzipien in acht Zeilen (S. 296) fällt nicht nur viel zu knapp aus, sondern bleibt auch Begründungen für fast alle Grundsatzentscheidungen des Herausgebers schuldig; etwa, warum die Texte weitgehend konsequent diplomatisch wiedergegeben sind, dann aber doch bisweilen in sie eingegriffen wird (und wann bzw. wann eben nicht). Es geht thomas neukiRChen bei seiner Arbeit also offenbar kaum um kernphilologische Hasenreinheit, wie etwa Anm.16 auf S. 288 zu einer Vorgänger edition des ‘Karsthans’ verdeutlicht: “Die Ausgabe Burkhardts verzeichnet in einem Apparat die Varianten, ist also nach wie vor zu Rate zu ziehen.” Warum, so könnte man fragen, dann also die Neu-Edition des ‘Karsthans’, wenn ein bloßer Variantenapparat dafür sorgt, dass die bisherige Standardausgabe weiterhin unerlässlich bleibt? Insgesamt ist thomas neukiRChen – dann kaum überraschend – der Vorwurf einer gewissen editionsphilologischen Laxheit nicht ganz zu ersparen: Die Transkriptionen der zugrunde liegenden Drucke gelingen zwar nach unseren Stichproben komplett fehlerfrei; zu fragen ist aber, warum neukiRChen nicht einmal dann in den Text eingreift, wenn er explizit einen Druckfehler annimmt und dies plausibel begründet (Wittenberg statt Württemberg in Bezug auf Luther!, S. 260f., 282) oder zumindest die Interpunktion der frühneuzeitlichen Pamphlete modernen Lesegewohnheiten anpasst, wo die ursprüngliche Gestalt Verständnisschwierigkeiten verursachen kann (z.B. S. 188, v. 26f.). Problematisch
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
110 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
finden wir auch, dass dem ‘Karsthans’ ohne nähere Begründung zwei Anhänge aus anderen Drucken beigefügt werden, sodass fast ein Cento entsteht, das in dieser Form nirgends überliefert ist. Dieses Konstrukt mag jedoch vom Leser ohne näheres Hinschauen dem als “Quelle” bezeichneten Straßburger Druck von 1521 zugerechnet werden. In seinen Übersetzungen gelingt neukiRChen oft ein eleganter, gut lesbarer Übertrag des Frühneuhochdeutschen in die moderne Sprache, aber zugleich unterlaufen ihm nicht wenige Fehler auf verschiedenen Ebenen, etwa Auslassungen ganzer Wendungen (z.B. wie yetzund geschicht, S. 120) oder Wörter bzw. Namen (z.B. der from doctor Martin Luther → “Der fromme Doktor Luther”, S. 40f.), dazu Inkonsequenzen bei der Übersetzung mancher Lexeme (vgl. z.B. bischoff als “Bischof” oder mehrfach “Hohe-priester”, zugleich fürsten als “Hohepriester”; jeweils S. 42f.). Im Falle des Wortspiels Murnar → “Murnarr” glättet neukiRChen in seiner Übersetzung einmal die Verwendung von Murnar durch den mit ihm sympathisierenden Studenten zu “Murner” (S. 39), wenig später lässt er denselben Studenten aber vom “Glauben Doktor Murnarrs” sprechen (S. 43). Er folgt also einmal der “inneren Logik” des Textes und einmal dem Wortlaut. Wenig gelungen ist zuletzt manches an der drucktechnischen Gestalt der Monographie – auch dies geht mitunter zu Lasten der guten Benutzbarkeit des Werkes (siehe z.B. S. 152):
Zeilennummerierung der Prosatexte wäre jedenfalls leserfreundlicher, das Mitzählen von Leerzeilen in versifizierten Texten ist irritierend (S. 180f.). Ein Leser, der parallel den früh-neuhochdeutschen und den nhd. Text betrachten möchte, ist zu ständigem Hin-und Herblättern über umfangreichere Passagen gezwungen, das durch größere Absätze im kürzeren Originaltext hätte vermieden werden können.
Freilich sind philologische Bedenken gegenüber dem Vorliegenden angesichts der mut-maßlichen Zielstellung der ‘Karsthans’-Edition beileibe nicht alles: Zu würdigen ist zunächst – aber nicht zuletzt –, dass es neukiRChen gelingt, etwa durch attraktive Bebilde-rung und das Einfangen einer gewissen druckgraphischen “Exotik” der Reformationszeit (v.a. S. 168f.) ein Buch zu kreieren, das ein Bibliophiler – trotz der genannten typogra-phischen Mängel – gern in die Hand nimmt. Mehr noch macht die ‘Karsthans’-Ausgabe den Fachleuten v.a. aus der Germanistik und der Geschichtswissenschaft aufschlussreiche, als Quellen wie mitunter auch als literarische Werke betrachtenswerte Texte bequem nutzbar und ermöglicht zugleich interessierten “Laien” Perspektiven auf eine Zeit, die für das “kulturelle Gedächtnis” dieses Landes noch immer von besonderer Relevanz ist. Dass wir uns dabei eine anschaulichere Darstellung der Anliegen und Prinzipien des Herausgebers sowie bisweilen eine sauberere philologische Arbeit gewünscht hätten, ist also nur ein Aspekt im Hinblick auf einen Textband, dessen Vorzüge letzten Endes deutlich überwiegen.
Anja Braun / Dr. Matthias Kirchhoff, Universität Stuttgart, Institut für Literaturwissenschaft, Abteilung für Germanistische Mediävistik, Keplerstr. 17, D–70174 StuttgartE-Mail: [email protected] / [email protected]
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
111Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
RaBea kohnen, Die Braut des Königs. Zur interreligiösen Dynamik der mittel-hochdeutschen Brautwerbungserzählungen (Hermaea N.F. 133), Berlin/Boston 2013. Walter de Gruyter Verlag, X, 300 S., ISBN 3-11-027965-8, EUR 99,95
Die zu besprechende Studie, eine Bochumer Dissertation aus dem Jahr 2010, setzt sich zum Ziel, die mhd. Brautwerbungsepik aus einer neuen Perspektive zu betrachten, indem sie die darin verhandelten interreligiösen Problemstellungen untersucht. Anstatt also wie bisher die gefährliche Brautwerbung als ein Erzählschema zu betrachten, das auf die Bestätigung bzw. Verstetigung feudalherrscherlicher Gewalt abhebt, wird vielmehr das Verhältnis von Christen und Sarazenen in den Blick genommen. Durch diese originelle Herangehensweise entgeht kohnen der Aporie, in die der Fokus auf Brautwerbung und Prokreation stets geführt hat, weil erstere in der hier untersuchten Textgruppe (‘König Rother’, ‘Oswald’, ‘Orendel’, ‘Salman und Morolf’, ‘Kudrun’, ‘Ortnit’) vergleichsweise selten überhaupt in letztere mündet. kohnen analysiert die Erzählungen stattdessen als Formen der mittelalterlichen Auseinandersetzung mit religiöser Differenz, welche hier im Konfliktfeld interreligiöser Eheschließungen geführt wird. Als Aufriss dieses Problemhorizonts enthält die Einleitung einen ausführlichen Forschungsbericht zum ‘spielmännischen Erzählen’, das, in der Forschung schon lange überholt, noch immer den literarhistorischen Blick auf diese Texte prägt, sowie zu Datie-rungsfragen und Überlieferung der Texte. Es folgen drei Analysekapitel: zur Gestaltung der religiösen Konflikte und Kriegshandlungen, zum Umgang mit dem religiösen Anderen sowie ein synthetisierendes Schlusskapitel zur narrativen Verbindung von interreligiösen Konflikten und Brautwerbungshandlung. Jedes Kapitel wird systematisch eingeleitet und mit einem kurzen Fazit abgeschlossen. Die Textauswahl folgt dabei jeweils dem Fragehorizont, d.h. nicht in jedem Kapitel werden alle Texte behandelt und es wird auch keine korpusimmanente Chronologie, beginnend mit ‘König Rother’, zugrunde gelegt. Diese produktive Abkehr von den Setzungen einer Einordnung ins Vorhöfische bringt erst die erzählerische Vielfalt zur Geltung, mit der die untersuchten Erzählungen die interreligiösen Problemstellungen verhandeln. Anstatt sie jeweils an den dem Braut-werbungsschema “unterstellten, ‘feudalen’ Sinngebungen” (S. 35) zu messen und etwaige Brüche zu konstatieren, stehen für kohnen die Variabilität im Rahmen einer “narrative[n] Grammatik der gefährlichen Brautwerbung” und das “intertextuelle[] Spiel” (S. 39) im Vordergrund. Zur Erschließung des Zusammenhangs von Brautwerbung und interreligiösen Konflikten modelliert kohnen zusätzlich die jeweiligen kulturellen bzw. diskursiven Kontexte, welche sie aus theologischen und historiographischen Quellen zum Islam, zur christlichen Mission und zu den Kreuzzügen rekonstruiert. Verpflichtet ist die Studie dabei neben Ansätzen der Intertextualitätsforschung dem New Historicism (vgl. S. 53-57). Zentrale Bedeutung besitzt für kohnen in diesem Zusammenhang die Metapher des ‘diskursiven Gewebes’: Allenthalben werden Diskursfäden gesponnen, gewirkt, vernetzt und verwoben. Diese Metapher erscheint insbesondere deshalb etwas überstrapaziert, weil sie unscharf wird, sobald die historische Analyse diachrone Vorgänge in den Blick nimmt. Zusätzlich können sich nämlich auch diachrone ‘Diskurslinien’ “sowohl auf die Form des Gesagten, also auf Erzählmuster, Motive, Gattungstraditionen, etc. als auch auf inhaltlich bestimmte Diskurse richten” (S. 55f.). Dieser Blick auf synchrone Ko- und Kontexte wie diachrone Traditionslinien ist insbesondere dann produktiv, wenn kohnen deren Zusammenwirken im einzelnen Text betrachtet. In der Analyse des (von
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
112 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
der Forschung besonders stiefmütterlich behandelten) ‘Orendel’ zeigt sie etwa, dass sich die geschilderten Kriegshandlungen auf Darstellungstraditionen der beiden ersten Makkabäerbücher beziehen lassen (S. 102-106) und der interreligiöse Konflikt in der Überblendung unterschiedlicher Zeitebenen zusätzlich heilsgeschichtlich aufgeladen wird. Erhellend für die narrative Gestaltung des ‘Orendel’ ist auch die Beobachtung, dass der interreligiöse Konflikt sich zwar auf historische Problemlagen (die Herrschaft der Tempelritter in Jerusalem, vgl. S. 89-92) beziehen lässt, der literarische Text aber die Provokation auf christlicher Seite ansetzt, da erst mit Auftreten des Titelhelden in Jeru-salem überhaupt eine Auseinandersetzung entsteht. Weitere Differenzierungen erbringt auch der Blick auf die Raumkonfigurationen der Erzählungen: Während im ‘Orendel’ auf heiligem Terrain gekämpft wird und damit die Braut Bride als Objekt des Streites zugleich metonymisch die Stadt Jerusalem und die christliche Kirche verkörpert, wird im ‘Oswald’ auf neutralem Gebiet zwischen den beiden Reichen gekämpft. Hier geht es nicht um eine territoriale Erweiterung des eigenen Herrschaftsgebietes, sondern um die Mission selbst. kohnen gelingt es somit, die in den Erzählungen je unterschiedlich wirksamen Dar-stellungsformen und Identitätskonstruktionen im Verhältnis von Christen und Heiden überzeugend herauszuarbeiten. Nicht immer erscheinen allerdings die intertextuellen und -diskursiven Bezüge in gleicher Weise belastbar. In den herangezogenen chronikalischen Quellen zu historischen interreligiösen Eheschließungen etwa treten zwar bestimmte Motive (wie Botenfahrt und Ringtausch) auf, wie sie auch aus den Brautwerbungs-erzählungen bekannt sind. Ab wann aber wird die historische Brautwerbung zum “Erzähl-modell einer ‘Missionarin im Ehebett’” (S. 212), wie es kohnen für die Darstellung der Werbung Chlodwigs I. um Chlothilde bei Fredegar und insbesondere im ‘Liber Historiae Francorum’ geltend macht (S. 207-212)? Wie ist analytisch damit umzugehen, dass es sich hier um eine gegenüber der Dichtung umgekehrte Konstellation (christliche Frau bekehrt heidnischen Mann) handelt? Als Ersatz für den harten Schemabegriff etabliert kohnen einen gemeinsamen Nenner der “erzählerische[n] Gemachtheit” literarischer wie “außerliterarischer Werke” (S. 206); entsprechend unspezifisch ist der analytische Ertrag, dass es verschiedentlich motivische Übereinstimmungen gibt (“erinnert an den Erzählverlauf”, S. 216) und die Themen Eheschließung und Mission im Mittelalter virulent sind. Unbestimmt bleibt auch die immer wieder argumentativ herangezogene “Attraktivität” (S. 5, 270 u.ö., auch “überzeitliche Attraktivität”, S. 212) der im literarischen Spiel gene-rierten Erzählungen. Abgesehen von einer vielleicht allzu voraussetzungsreichen Intentio-nalität stellt sich die Frage, was im Blick auf einen historischen Rezipienten eigentlich die “attraktive” Erzählung ausmacht: Unterhaltsamkeit? Popularität? Anschlussfähigkeit an geltende Leitbilder? Aus kohnens Ausführungen lässt sich für die Attraktivität des Erzählmodells allenfalls der positivistische Befund ableiten, dass es immer wieder zur An-wendung kommt. Für eine Konkretisierung würde – eine neue Aporie? – dann doch wieder die historische Verortung der einzelnen Texte relevant. Indem kohnen die schwierigen Datierungsfragen ausblendet, öffnet sie die Analyse für produktive Fragestellungen, die nicht an eine Textchronologie gebunden sind. Ihre Betonung der Varianz mittelalterlicher Texte (S. 58f.) steht jedoch in einem gewissen Missverhältnis dazu, dass sie sich letztlich auf diejenigen Fassungen stützt, die besonders breit überliefert sind bzw. ediert vorliegen (S. 60). Aus pragmatischer Sicht ist das durchaus gerechtfertigt, aber gerade angesichts der innovativen Fragestellung wäre der Blick auf die unterschiedlichen Fassungen für die
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
113Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Modellierung des jeweiligen diskursiven Felds vielleicht doch produktiv gewesen. Die spätmittelalterliche Prosa des ‘Berliner Oswald’ etwa akzentuiert die Verhandlungen von Heiligkeit und Herrschaft neu (das gilt auch für die “völlig eindeutig” geistlichen Über-lieferungsverbünde, vgl. S. 65); auch der in der Druckfassung von ‘Salman und Morolf’ modifizierte, dynastische Nachfolge u n d Seelenheil verbindende Erzählschluss weist die Tendenz auf, den interreligiösen Konflikt umfassend zu harmonisieren.1 Für die Frage nach der Anschlussfähigkeit des Brautwerbungsmodells an interreligiöse Fragestellungen birgt der diachrone Fassungsvergleich somit das Potential, die ‘Attraktivität’ des Erzähl-modells historisch differenziert zu bestimmen. Denn die zentrale Erkenntnis der Arbeit bleibt, dass das Erzählmodell der gefährlichen Brautwerbung im Spannungsfeld der Religionen die Profilierung ganz unterschiedlicher Herrschaftsmodelle bzw. Herrschertypen ermöglicht. Die titelgebende “Braut des Königs” steht dabei stets für etwas anderes (vgl. S. 271): die Anerkennung durch Byzanz im ‘König Rother’, die allegorische Braut Jerusalem im ‘Orendel’, die ‘Passfähigkeit’ heidnischer Partnerinnen in interreligiösen Beziehungen (in sehr unterschiedlichen Deutungsange-boten: ‘Oswald’ und ‘Salman und Morolf’). In der literarischen Imagination mündet die erfolgreiche Werbung gerade nicht in die genealogisch begründete Herrschafts- bzw. Identitätsstiftung, sondern privilegiert häufig Modelle von Translation oder (spiritueller) Nachfolge. Dies eröffnet neue Perspektiven auf die Brautwerbungsdichtung; kohnen räumt damit nicht nur mit veralteten, implizit weiter wirksamen Prämissen der Spiel-mannsepik- und Brautwerbungsforschung auf, sondern schließt auch gewinnbringend an aktuelle kulturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit mittelalterlichen Denk- und Erzählmodellen an.
Jun.-Prof. Dr. Julia Weitbrecht, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germanistisches Seminar, Leibnizstr. 8, D–24118 KielE-Mail: [email protected]
1 Siehe dazu RaBea kohnen, Alternate Endings und Varianz. Überlegungen zu Morolfs Himmel-fahrt, in: Alterität als Leitkonzept für historisches Interpretieren, hg. von anJa BeCkeR und Jan mohR (Deutsche Literatur. Studien und Quellen 8), Berlin 2012, S. 171-195.
klaus landa, herre und pfaffe. Die Repräsentanten weltlicher und geistlicher Macht in der Sicht ihrer Zeitgenossen in Mittelalter und Gegenwart. Ein Vergleich anhand didaktischer Literatur des 13. Jahrhunderts und demoskopischen und programmatischen Datenmaterials aus Österreich, Kiel 2012. Solivagus Verlag, 513 S., ISBN 978-3-943025-04-0, EUR 69,–
Bei dieser Publikation handelt es sich um eine Dissertation, die am Germanistischen Institut der Universität Salzburg Anfang 2004 approbiert worden war, betreut von Renate
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
114 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Hausner.1 Die Drucklegung – welche ja gemäß österreichischer Doktoratsstudienrege-lung nicht Pflicht gewesen wäre, um den Doktortitel dauerhaft zu erwerben – erfolgte mit achtjähriger Verspätung und damit zu einem Zeitpunkt, als klaus landa bereits außerhalb des akademischen Betriebs eine verdienstvolle Wirkungsstätte gefunden hatte:2 Somit ahnt man zwar, warum im Zuge der nachträglichen Veröffentlichung im Kieler Fachverlag Solivagus3 eine Einbindung der seit 2004 erschienenen Fachliteratur und -diskussion unterblieb, es entschuldigt diese Tatsache aber nicht.4 Im Grunde liegt damit nämlich eine auf dem Stand von 2003/04 eingefrorene “Fallstudie” vor (S. 67, Anm. 198), deren Publikationsdatum “2012” schlicht falsche Erwartungen weckt.5 Probleme ergeben sich jedoch nicht nur aus dieser zeitlichen Diskrepanz, sondern sie scheinen bereits der ursprünglichen Dissertation aufgrund einiger methodischer und inhaltlicher Mängel inhärent. Ehe nun darauf sowie auf die verdienstvollen Aspekte etwas näher eingegangen wird, soll ein ‘neutral’ referierender Überblick helfen, Zielsetzung und Struktur der Arbeit zu erkennen. In fünf große Teile gliedert sich landas belesene Studie, die auf der Suche nach mittelalterlichen ‘Kontinuitäten’ und ‘Alteritäten’ recht innovationsfreudig darauf abzielt, das einstige Bild von herren und pfaffen mit dem aktuellen österreichischen Image von Po-litiker/innen und Pfarrern (vgl. S. 20f.) kritisch zu vergleichen, wobei als historische Da-tenbasis der ‘Welsche Gast’ des Thomasin von Zerklaere, die Spruchsammlung Freidanks und ‘Der Renner’ Hugos von Trimberg dienen, als modernes Datenmaterial die Ergebnisse von Meinungsumfragen und meinungsbildenden Programmatiken aus Österreich. Dieser
1 Wie den Dankesworten auf S. 17f. zu entnehmen ist.2 Siehe den hinteren Umschlagtext der Publikation, wo auf eine Anstellung im “Museums-
bereich” hingewiesen wird.3 Gegründet 2008 mit dem Schwerpunkt auf der Mediävistik, aber auch zur Verbreitung aller
“exzellenten Forschungsleistungen” der Universität Kiel (zitiert von http://www.solivagus-ver-lag.de; [4.8.2013]).
4 Vgl. S. 18, wo es dazu u.a. heißt: “Die Arbeit muss sich daher den Vorwurf gefallen lassen, keine aktuellen Daten mehr zu präsentieren.” ‘Konsequenterweise’ bleiben daher auch alle Zitate von Internetquellen unter ihren veralteten Zugriffsdaten zwischen 2002 und 2004 ver-zeichnet (vgl. S. 511f.), begleitet von dem pauschalen Hinweis, dass einige von ihnen “nicht mehr online aufscheinen” (S. 18). Doch selbst wenn man dem Autor konzediert, dass diese mangelnde Aktualität z.B. in Bezug auf die historische Textanalyse nicht unbedingt mit ‘fal-schen’ Ergebnissen einhergeht, bleibt der Eindruck eines grundlegenden wissenschaftlichen Mangels erhalten. Und Rechtfertigungsversuche wie dieser irritieren eher, anstatt zu ‘beru-higen’: “Da aber die Veränderungen auf der politischen Bühne [der Jetztzeit] oftmals derart schnell vonstattengehen, wurde für die vorliegende Publikation bewusst auf ein Heranziehen von demoskopischen Daten bis zum Jahr 2011 verzichtet, da man auch in diesem Fall nicht vor raschen Umbrüchen in der politischen Landschaft gefeit ist” (S. 18f.).
5 In das Bild eines unglücklichen Anfangs fügt sich auch der Druckfehler “Osterreich” statt “Österreich” auf dem Buchumschlag, der vermutlich auf das Konto des Verlagshauses geht; für eine im Grunde solide Lektorierung der Arbeit spricht die geringe Anzahl an drucktechnischen Pannen im Inneren des Buches (wie z.B. “der Historische Anthropologie” S. 24, “ÊreS” S. 137, der störende Leerraum auf S. 299 unten, “an den papsti” am Ende einer Überschrift S. 463 oder ebda “Ihnen In aufrichtiger Sorge”). – Als formales, doch zugleich elementares ‘Publikationsmanko’ ist noch zu registrieren, dass für den Autor im Bereich der Statistik ein “Abdruck der Tabellen [aus der Dissertation] aus rechtlichen Gründen nicht möglich [war]” (S. 21): Die genauen Gründe für diese Einschränkung, welche die Datenevidenz des Buches erheblich schwächen, bleiben unklar.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
115Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
viele Jahrhunderte überspannenden Stoßrichtung dienen die Kapitel zur Methodendis-kussion, Quellensicherung, die Textanalysen zu herre sowie pfaffe und am Ende der auswertende Vergleich. Die Ergebnisse aller Abschnitte stellen sich prägnant rekapituliert wie folgt dar: Nach ausführlichen Erörterungen der Fachbegriffe ‘Geistes wissenschaft’, ‘Kulturwissenschaft’, ‘Historische Anthropologie’ und ‘Mentalitäts geschichte’ wird in Hinblick auf die Forschungsinteressen der Germa nistischen Mediävistik die Methode des diachronen und synchronen Vergleichs als erkenntnisträchtig eingestuft. Für die Textanalyse wird ein Hineinhorchen des Interpreten auch zwischen die überlieferten Zeilen angestrebt, um so den bislang verborgenen Mentalitäten und ihrem allfälligen Wandel auf die Spur zu kommen (vgl. S. 54). Zur Verifizierung der daraus gewonnenen Einsichten eigne sich laut landa ein statistischer Ansatz, bei dem an repräsentative Quellen die richtigen Fragen zu stellen seien, und zwar vor allem solche, die “unsere Zeit bewegen und in Atem halten” (S. 56); durch diese gegenwartsbezogene Herange-hensweise seien neue Erkenntnisse zu erwarten. Dem dient auch eine überblicksartige Sichtung der literarischen Quellen (vgl. S. 63f.) sowie hernach der Quellen allgemein, also der historischen und modernen (S. 70-109). In den nächsten Großkapiteln gilt eine textnahe, zahlreiche Primärzitate wiedergebende Analyse zuerst den historischen herren und ihren modernen ‘Gegenstücken’ anschließend den literarischen pfaffen bzw. der gegenwärtigen Geistlichkeit, wobei am Ende der Untersuchungen für Erstere wie für Letztere der “Wunsch nach der Realisierung eines Ideals” (S. 460) als mentalitäts-geschichtliche Konstante festgestellt sowie – darauf gründend – die Tatsache gefolgert wird, dass die Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit seit jeher Kritik ausgelöst habe. Weniger Wandlungen sei dabei das Politikerbild unterworfen, weil die “Forderungen an die politisch Verantwortlichen [...] zu allen Zeiten aus dem Wunsch [resultieren], die existenziellen menschlichen Bedürfnisse befriedigt zu sehen, die zu einem sicheren und guten Leben entscheidend beitragen können” (S. 460f.). “Im Gegenzug haben sich die Wünsche an die pfaffen und Priester in vielen Bereichen vollkommen gewandelt, obwohl oder vielleicht gerade weil die Rahmenbedingungen innerhalb der Kirche sich funda-mentalen Veränderungen entzogen haben” (S. 461); hier stimmten daher die heutigen Wünsche nach Veränderung, wie sie sich etwa im österreichischen “Kirchenvolks-Be-gehren” widerspiegelten (siehe den Textabdruck des zentralen Briefes vom 25. Jan. 1996 an Papst Johannes Paul II. auf S. 463-466), keineswegs mit den einstigen Forderungen nach Bewahrung der Tradition überein. Diese leicht nachvollziehbaren Ergebnisse, gewonnen aus einer Diskussion bzw. Referierung zahlreicher Fachquellen und aus leidenschaftlichen Text- und Datenerör-terungen, wird man gerne anerkennen, kommt dabei aber nicht umhin, jene methodischen Unschärfen und inhaltlichen Probleme mit ins Kalkül zu ziehen, die – zumindest aus Sicht des Rezensenten – das Gesamtbild doch erheblich trüben, da sie sehr Grundsätzliches, scheinbar Selbstverständliches betreffen. Zuerst zum M e t h o d i s c h e n: Hier ist zuerst nolens volens nochmals an die unzu-reichende Aktualität der Arbeit zu erinnern, denn diesem Umstand scheint es geschuldet, dass (1) ‘Kulturwissenschaft’ diskutiert wird, ohne deren spannende cultural turns mit in den Blick zu nehmen,6 (2) im Unwissen (?) etwa um thomas Beins wegweisendes
6 Vgl. doRis BaChmann-mediCk, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaf-ten, 3. Auflage, Reinbek 2009.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
116 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Kapitel zu den Methoden der Germanistischen Mediävistik7 um vorgeblich erstmalige Orientierung in einem (vom Autor generell übermarkierten) “Methodendschungel”8 ge-rungen wird, (3) vielleicht auch ob solcher Lücken die Methode der kulturanalytisch hoch ergiebigen Rezeptionsästhetik unbeachtet bleibt, (4) das Thema ‘Freidank’ abgehandelt wird unter Ignorierung von JoaChim heinzles langjährigen Grundlagenforschungen,9 (5) dem viel zitierten “Kirchenvolks-Begehren” nicht die für Österreich besonders signifi-kanten “Wir sind Kirche”- und “Aufruf zum Ungehorsam”-Appelle an die Seite gestellt sind10 und (6) “[g]ravierende Brüche” bei den österreichischen Einstellungen gegenüber der katholischen Kirche erst den “letzten dreißig Jahren” (S. 448) zugeordnet werden, also der Zeit ab ca. 1980 (?), wobei man doch eher – gerechnet ab dem Dissertations-jahr 2004 – an die plausiblere ‘Umbruchszeit’ ab den späten 60er- und beginnenden 70er-Jahren denken möchte. Noch mehr methodologisches Kopfzerbrechen bereitet jedoch die äußerst fragwürdige Zugrundelegung des ‘Österreichischen’ für die drei schon eingangs genannten Werke und die waghalsige Verknüpfung dieser Texte mit der modernen nationalstaatlichen Bezugs-einheit, denn allen Homogenitätsbeteuerungen landas zum Trotz (vgl. etwa S. 17) bleibt festzuhalten, dass wir es bei den von ihm ausgewählten didaktischen Dichtungen mit ‘Quellen’ zu tun haben, die sowohl regional als auch temporal, gattungstypologisch und funktional kaum als kohärente Vergleichsfolie taugen bzw. – anders ausgedrückt – besser durch genuin im österreichischen Raum/Herzogtum verankerte zu ersetzen gewesen wären11 oder gleich durch beliebige didaktische Literatur aus dem gesamten deutschen Sprachraum des 13. bis 15. Jh.s, denn selbst dann hätten sich landas Gesamtergebnisse nicht wesentlich verändert. Doch ohne diese Spekulation weiter zu verfolgen, sei hier nur die Inhomogenität der drei Werke auf allen o.g. Ebenen festgehalten: Demnach ist der ‘Welsche Gast’ im heutigen oberitalienischen Raum zu verorten, erfolgte die (bis heute unklare) Korpusbildung der Freidanksprüche am ehesten im Bayrischen, und Hugos von Trimberg Werk entstand im oberfränkischen Bamberg. Zeitlich bewegen wir uns dabei zwischen dem Hoch- und dem beginnenden Spätmittelalter, also im Abstand von mehreren Generationen mit ihren durchaus unterschiedlichen historischen Problemlagen. Bei der Frage der Gattungszugehörigkeit mag man allenfalls Thomasin und Hugo als miteinander ‘verwandt’ betrachten, nicht aber Freidanks Sprüche, gegen deren Paralle-lisierung nicht zuletzt ihre zitathafte intertextuelle Potenz spricht.12 Textfunktional ist sodann relevant, dass mit Thomasin von Zerklaere ein ordinierter Geistlicher spricht, mit Freidank vermutlich ein wandernder, nicht geweihter Kleriker, mit Hugo von Trimberg ein ‘städtisch’ sozialisierter Schulleiter. Dies alles zusammen ergibt im Grunde drei hoch disparate Interessenlagen, für welche schwer nachvollziehbar bleibt, warum sie
7 Vgl. thomas Bein, Germanistische Mediävistik. Eine Einführung (Grundlagen der Germanistik 35), 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 2005 (Erstauflage 1998).
8 In der – wohl etwas anmaßend wirkenden – Überschrift “C| Die Mediävistik im Methoden-dschungel” (S. 22); vgl. auch S. 57f. (letzter Absatz).
9 Mit einem Textkorpus-Projekt seit 1998; siehe http://www.mrfreidank.de.10 Vgl. http://www.wir-sind-kirche.at sowie http://www.pfarrer-initiative.at (mit dem weltweit
beachteten ‘österreichischen’ “Aufruf zum Ungehorsam” 2011).11 Angeboten hätten sich ‘Der Jüngling’ des Konrad von Haslau oder der ‘Seifried Helbling’.12 Weniger die längeren politischen Sprüche, sehr wohl aber Freidanks kurze Spruchweisheiten
entfalten in ihren verschiedenen Kontexten, in denen sie aufgerufen werden (darunter oftmals auch in Hugos ‘Renner’!) je eigene Sinnbezüge, die mit zu bedenken wären.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
117Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
für das heutige Österreich als besonders geeignete Vergleichsbasis dienen sollten. Die-ser Faktenlage zeigt sich landa zwar in gewisser Weise bewusst, zumal er sie korrekt aus den gängigen Nachschlagewerken referiert, doch hindert ihn das nicht daran, sein litera risches Quellenmaterial über die gesamte Arbeit hinweg mit dem ‘Österreichischen’ mentalitätsgeschichtlich zu korrelieren. Einen grundlegenden methodischen Widerspruch provoziert noch landas generelle Sicht auf die vermeintlich unmittelbare sozialhistorische Aussagekraft seiner literarischen Quellen: Stutzig macht da schon im Vorwort die pauschaliert vorgetragene “Idee, die Sicht der Menschen [!] des 13. Jahrhunderts” (S. 16) aus literarischen Texten gewinnen zu wollen, und diese Wunschvorstellung scheint sich einige Seiten weiter (markant an einem Kapitelende stehend) auf besorgniserregende Weise wie folgt zu verdichten (S. 64):
Lehrhafte Literatur stellt auch deshalb eine wertvolle Quelle gerade für mentalitätsgeschicht-liche Untersuchungen dar, da kein Gewand fiktiver Verfremdung gegeben ist, das es zu dechiffrieren bzw. ‘abzutragen’ gilt.
Wohlwollend gelesen, mag man dahinter eine Anspielung auf jene (auf S. 76 von landa mit JoaChim Bumke zitierten) “Wirklichkeitselemente” erkennen, die es zweifellos in didaktischer Dichtung gibt, doch keinesfalls ‘ungeschminkt’, sondern ähnlich perspek-tiviert wie etwa in der Sangspruchdichtung oder in der politischen Lyrik – also im Grunde wie in jeder Form sog. engagierter Literatur. Und bei all diesen Texten wird man gut daran tun, zwecks Gewinnung ihrer Realitätsreflexe eine ganze Reihe von poetischen Merkmalen “abzutragen”, als da wären ihre Verankerung in einer Motiv- und Stofftradition, die Artikulierung des Textes durch eine – stets in fiktiver Narration wurzelnde – Erzählergestalt, der Sprechgestus (welchen neben individuellen Zügen vor allem das Topische, Formelhafte und die Regeln der Versifizierung prägen), aber auch die Installierung fiktiver Figuren. Wie unbekümmert landa mit dieser poetischen Dimension umgeht und wie sie ihm zum interpretativen Verhängnis wird, sei an zwei Beispielen verdeutlicht:
In dem (sehr ‘obskur’ benannten) Kapitel “Dunkle Seiten der Herrschaft” (S. 211-233)13 hält landa fest, dass “die drei Autoren [...] in ihrem Denken stets von kontemporären und historischen Interessen und Traditionen geprägt sind” und dass dem “Genre der didaktischen Literatur [...] per se ein belehrender und kritisierender Charakter anhaftet” (S. 224), wobei insbesondere die daraus von ihm gefolgerte Annahme, dass die dabei “geäußerte Kritik manch-mal zur Formelhaftigkeit verkommt”, den Verdacht eines bei landa vorhandenen prekären Misstrauens gegenüber Poetizität bzw. Modelliertheit stärkt.
13 Diese Kapitelbenennung wiederholt sich auf S. 393 als “Dunkle Seiten des Priesteramtes” und scheint insofern unglücklich formuliert, als damit nicht der eher zu erwartende Amtsmissbrauch oder sonstiges ‘Skandalöses’, das Seelenheil der Herrschenden Gefährdendes gemeint ist, sondern – einmal mehr den Realitätsbegriff strapazierend – die “realen Belastungen, die die Ausübung einer politischen Aufgabe mit sich bringt, sowie die Konfrontation der Herrschen-den mit Skepsis und Kritik, die ihnen vonseiten der Menschen [!] entgegengebracht werden” (S. 211).
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
118 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Zweites Beispiel:
Im Kapitel zu Hugo von Trimberg wird dieser Dichter korrekt als [jahrzehntelang wirkender] Rektor einer geistlichen Stiftsschule in Bamberg charakterisiert, aber aufgrund von Äuße-rungen in seiner Dichtung als dennoch “vermutlich in ärmlichen Verhältnissen” lebend (S. 94), wobei als zentrale Belegstelle v. 8095 [Kumt aber ein hungerjâr uns armen] aufgerufen wird.Hier bewegen wir uns aber (und ähnlich bei den anderen ‘Armuts’-Klagen in Hugos Text)14 zum einen im Bereich der traditionellen, oft (mehr oder minder sublim mit Lohn- bzw. An-erkennungsheische) verknüpften Armuts-Topik, und zum andern wird diese Topik in v. 8095 zusätzlich von einer tugendallegorischen Beispielserzählung überformt, aus der heraus sich der Erzähler mit dem Stand der pfaffen15 rollenhaft (!) solidarisiert. Um dies mit zu bedenken, hätte es also sehr wohl genau jene hermeneutische Prozedur einer ‘Abtragung’ des Fiktiven gebraucht, die aber von landa schon eingangs seiner Arbeit programmatisch für unnötig erklärt worden war.
Nun sei jenseits des Methodischen auswahlhaft noch auf i n h a l t l i c h e Probleme in landas Studie hingewiesen, jedoch nicht, ohne vorher einige der anerkennenswerten Leistungen zu erwähnen: Zu den positiven Aspekten zählen Umfang und Belesenheit seiner Abhandlung, aber auch die Stringenz des klar gegliederten Aufbaus sowie des breit gefächerten, problemorientierten Themenspektrums rund um ‘Herrschaft’ und ‘Geistlich-keit’. Terminologisch mag man das eine oder andere vermissen, doch im Rahmen der vom Autor gewählten Fokussierungen herrscht prinzipiell die wünschenswerte begriffliche Einheitlichkeit und Schärfe. Inhaltlich erfrischend mutet an sich der Versuch an, ‘alte Literatur’ mit ‘modernem Datenmaterial’ zu konfrontieren, und bei der Durchführung dieses begrüßenswerten Ansatzes, der auch den (bekanntlich nie einfachen) Umgang mit Statistiken beinhaltet, sind Engagement und Kompetenz des Autors zu spüren, wobei man auch den meisten seiner Texterläuterungen und Detailauswertungen gerne vertrauen mag – die oben monierten methodischen ‘Unschärfen’ freilich nie außer Acht lassend. Kurzum: Man kann von einer philologisch und fächerübergreifend grundsätzlich sauberen Arbeitsweise sprechen. – Umso stärker stechen folgende Details negativ hervor, von denen das erste noch halb methodischer Natur zu sein scheint: landa schreibt generell z.B. “Politiker” und ignoriert damit die Rolle des weiblichen Geschlechts. Das scheint für seine Analysen der mittelalterlichen und gegenwärtigen Würdenträger in der Kirche sowie – schon mit Einschränkungen – des mittelalterlichen und männlich dominierten Herrenstandes nachvollziehbar, nicht aber für die moderne Politikszene. Hier fehlt ein klärendes Wort zu einer allfälligen Sprachregelung, sodass sich Unsicherheit bzw. Unbehagen überall dort breit machen, wo hinter der ‘Herrschaft’ oder ‘einer politischen Person’ weibliche Machtrepräsentation mit impliziert scheint oder (evtl. gezielt ein- bzw. ausschließend) von landa zu thematisieren gewesen wäre; dann hätte sich nebenbei gerade aus der Geschlechterdifferenz ein wohl nicht unwesentliches Alteritätsmerkmal
14 Vgl. z.B. v. 5417-5430 und 5499-5502: Hier wird von Hugo von Trimberg – der damit die Tradition der Armutsklage fortschreibt – die wirt-gast-Thematik ins Spiel gebracht. Dies erinnert u.a. an Walther von der Vogelweide (siehe vor allem L 12,II), wobei sich der Trim-berger jedoch selbst auf der wirt-Seite verortet, also auf der eines ‘Hausherren’: Als solcher hätte er gerne mehr Mittel, um seine Gäste gebührend ‘fürstlich’ bewirten zu können – wohl primär ein ‘Armutszeugnis’, mit dem sich der angesehene und literaturkundige Schulmeister in eine lange, überpersönliche Motivtradition stellt.
15 V. 8083: Diese knehte bediutend [!] pfaffen und leien.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
119Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
gewinnen lassen. Dem Bereich des Klischeehaften gehören zwei biographistische, zu unkritisch postulierte Prämissen an, die landa den Werken des Thomasin von Zerklaere und des Hugo von Trimberg zumutet: Thomasin sei zur Abfassungszeit des ‘Welschen Gastes’ noch sehr jung gewesen, “ein Grund für die positive Einstellung des Klerikers zu seiner Umwelt, die meist jüngeren Menschen eigen ist” (S. 79). Hugo von Trimberg – dessen literarischem Schaffen landa (ermüdet von der eigenen Lektüre?) so nebenbei die Etiketten “Maßlosigkeit” und “thematisches Ausschweifen” (S. 96) anheftet – verfasste seinen ‘Renner’ hingegen erst in bereits sehr fortgeschrittenem Alter, worin denn auch “der Grund dafür zu suchen [sei], dass Hugo im Vergleich zu Freidank und Thomasin wohl als der größte Moralist auftritt, dessen ständige Ermahnungen für uns manchmal schwer verdaulich scheinen” (S. 93f.); dennoch gesteht ihm landa (zu Recht) “eine gewisse[ ] Offenheit und ein Interesse an anderen Kulturen” (S. 94) zu – was einen Wi-derspruch produziert, der aber nicht zu Ende gedacht scheint. Lässt man diese Klischees von ‘jung – optimistisch’ versus ‘alt – pessimistisch’ dennoch gelten, betonen sie die oben schon quellenkritisch hervorgehobene Disparatheit dieser Werke und Untauglichkeit für eine mittelalterliche ‘Meinungsumfrage’. Eine begriffliche Sorglosigkeit, die vielleicht von modernen Klischees verursacht wurde, scheint in landas publizierter Dissertation beim Gebrauch der Wörter “Privatheit” und “Humanität” zu walten: Den ‘Privatheitsbegriff’ bemüht er u.a. in der waghalsigen Überschrift “Das Privatleben der Herrscher im 13. Jahrhundert” (S. 193, vgl. aber auch z.B. S. 252); angesichts unseres Wissens um das Fehlen ‘privater’, womöglich wie heute rechtlich abgesonderter Rückzugsbereiche im Mittelalter macht die Unreflektiertheit, mit der dieser Terminus auf den mittelalterlichen Textbefund projiziert wird, schlicht staunen. Vergleichsweise harmlos mutet dagegen das Einstreuen des Ausdrucks “Humanität” an, eines Begriffs, den landa gebraucht, um damit im ‘Welschen Gast’ den Ruf nach Herr-scherliebe auch für die weniger guten Menschen zu charakterisieren (Bezug nehmend auf v. 3086-3093): “Diese Aussage ist wohl als Aufforderung zu mehr Humanität im Umgang mit den Menschen aus dem Volk anzusehen” (S. 147). landas Nachgedanke dazu rechtfertigt diese Übertragung des renaissancezeitlichen Humanitätsideals auf das mittelalterliche Denken nicht wirklich: “Vielleicht handelt es sich hierbei aber auch nur um die bloße [gemeint wohl “bloß um die”, dann aber pleonastisch zu “nur”] Projektion eines Wunsches” (S. 147). Quasi als formulierungstechnische ‘Kuriosa’, die aber vielleicht Tieferes erkennen lassen, seien noch zwei Passagen zitiert: So liest man gegen Ende der Zusammenschau aller untersuchten Repräsentanten der weltlichen Macht an einem Absatzbeginn den Satz: “Doch dürfen wir uns nicht zu selbstverliebt unseren moralischen Anforderungen hin-geben” (S. 254) – eine Aus- resp. Ansage, die in puncto Diskurshaltung sowie Sprachlogik gelinde gesagt unpassend ist. Auf andere Weise bemerkenswert mutet wenige Zeilen später eine Feststellung an, welche zwischen Vergangenheit und Gegenwart das Thema ‘Schuldzuweisungen’ und ‘Sündenböcke’ auf den Punkt zu bringen versucht, dabei aber über einen Gemeinplatz der conditio humana nicht hinauskommt: “Darin zeigt sich: Die Diskrepanz zwischen ‘Herrschern’ und ‘Beherrschten’ existierte wahrscheinlich schon immer” (S. 255). Wieder mehr verwirrend denn banal mag landas Zitierung des für ihn “ansonsten sehr pessimistische[n] Hugo” mit den Versen 2300-2302 (Nieman die sünder smêhen sol: / Swer hazzet ir missetât und si niht, / Der hât mit rehten dingen pfliht.) wirken, weil in ihnen “für den heutigen Leser [...] durchaus Ansätze zu einem ‘modernen’ Sündenverständnis [erscheinen]”, gefolgt von der Feststellung: “Auch wenn
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
120 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
diese Aufforderung Hugos an die Priester schon immer Teil der christlichen Botschaft gewesen ist, überrascht sie aus dem Munde des Didaktikers” (S. 286). Für den Rezen-senten produziert diese Argumentationskette angesichts ihrer verqueren Vorannahmen und Schlussfolgerungen anstatt eines imaginären Ausrufezeichens gleich mehrere Fragezeichen. Zu guter Letzt sei als ein Beispiel für zu starke ‘Verkürzung’ bzw. Pau-schalierung noch diese Passage genannt: “Eines ist den drei Didaktikern aber gemein: Über die tieferen Beweggründe, die zur Entstehung von Häresien geführt haben, wurde kaum nachgedacht, über Verfehlungen und Missstände in den Reihen der Kirche noch viel weniger räsoniert” (S. 309). Diese Formulierung offenbart einmal mehr das allzu ‘chronikalische’, dichtungsferne Autorbild landas, welches durch solch realitätsfixierte Erwartungen überfrachtet und (einen alt bekannten circulus vitiosus zwischen ‘Dich-tung und Wahrheit’ schließend) zugleich abgewertet wird, denn – so muss man kritisch nachfragen – was ‘dachten’ sich die Literaten einst wirklich, und was davon wollten sie in ihren Texten explizit festhalten, sei es der (poetischen) Tradition der Zeit gehorchend oder diese abtönend? In Summe liegt in landas Doktorarbeit ein zwar streckenweise fächerübergreifend anregender Beitrag vor, der sich voll Elan um ein moderneres und positives Mittel-alterbild bemüht, doch nicht nur der Versuch, damit das ‘Österreichische’ in den Blick zu bekommen, sondern auch weitere methodische sowie formulierungstechnische Mängel schmälern die angestrebten Erträge ganz erheblich. Gerne würde man da zur Rechtfertigung dieser Publikation halb augenzwinkernd z.B. Freidanks Spruch der wille ie vor den werken gât / ze guote und ouch ze missetât (3,13f.) zitieren, aber gemessen am Erwartungshorizont der wissenschaftlichen Publizistik verliert diese Lebensweisheit ihre Macht.
Prof. Dr. Wernfried Hofmeister, Karl-Franzens-Universität Graz, Mozartgasse 8/I, A–8010 GrazE-Mail: [email protected]
The Last Judgement in Medieval Preaching, ed. by thom meRtens, maRia sheR-Wood-smith, miChael meCklenBuRg, and hans-JoChen sChieWeR (Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching 3), Turnhout 2013. Brepols Publishers n.v., XXXIV, 185 S., ISBN 978-2-503-51524-3, EUR 70,–
Das Thema des Jüngsten Gerichts weckt Interesse als bedeutende religiös-kulturelle Konstante mit unterschiedlichen Einsätzen und ‘Einstellungsmöglichkeiten’ je nach den konkreten Zeitpunkten, wobei die Erfassung des Jüngsten Gerichts im Mittelalter ein unerschöpfliches Forschungsfeld mit immer neuen Aussichten zu sein scheint. Der vor-liegende Band setzt die Reihe ‘Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching’ fort, in der Monographien, Sammelbände und Texteditionen auf dem Gebiet der Predigt erscheinen. Dementsprechend wird bereits im Bandtitel die Grundfrage nach der Interpretation des Begriffs im Rahmen einer Textsorte gestellt. Das Thema des Jüngsten Gerichts spielt eine wichtige Rolle im Predigtwesen. Umso mehr gilt das für die eschatologischen Erwartungen in Kirche und Gesellschaft. Das ganze Mittelalter hindurch gibt es viele Predigten mit Hinweisen, Anknüpfungen und
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
121Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Anspielungen darauf. Schon durch einen Hauptbestandteil des Gottesdienstes, das gemeinsame Glaubensbekenntnis, ist das Jüngste Gericht allgegenwärtig: Et interum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos (das Credo, im Ordinarium der Hei-ligen Messe an Sonntagen und Hochfesten). Wie steht es aber mit den Predigten, die das Jüngste Gericht zum Hauptthema haben? Man könnte erwarten, es seien viele. Ein gestrenger Prediger, der seinen Zuhörern mit dem apokalyptischen Grauen von der Kanzel droht, ist wohl zu einem Klischee ‘des finsteren Mittelalters’ in der profan-modernen Wahrnehmung geworden. Die gängige Vorstellung wird bei thom meRtens angedeutet: “Where would one expect to hear more about the menace of the Last Judgement than in a sermon, especially in a fire-and-brim-stone sermon?” (S. 43). Im Band wird jedoch hervorgehoben, dass das Jüngste Gericht im Laufe des Kirchenjahres nur am ersten oder zweiten Adventssonntag als Predigtthema erscheint, an anderen Sonntagen wird es allenfalls selten besprochen (S. 1-6 und 85). Weiterhin sei zu bemerken, dass es dazu bemerkenswerte Parallelen in der Ordnung der russisch orthodoxen Kirche gibt: Die Predigten zum Thema des Jüngsten Gerichts kommen dort auch am genannten Zeitpunkt vor, nämlich am Sonntag Sexagesimä (d.h. eine Woche vor der Fastnacht), ‘Sonntag über das Jüngste Gericht’ genannt. Das Jüngste Gericht erweist sich also als seltenes Thema sowohl in lateinischen als auch in volkssprachigen Predigten: “It seems to be avoided or at least toned down” (S. XXVIII). Das entspricht der allgemeinen kirchlichen Praxis und kann wohl dadurch erklärt werden, dass die Apokalypse im Unterschied zu den Evangelien und Episteln beim Gottesdienst nicht benutzt wird und demgemäß keine öffentliche Erklärung in der Kirche braucht. Allein die eschatologischen Topoi der Evangelien können in Perikopen in diesem Sinne in Frage kommen. Und, wie die Herausgeber völlig zu Recht betonen, gab es im Mittelalter so viele bildliche Darstellungen des Jüngsten Gerichts, dass es nicht nötig war, darüber zu predigen (“no need to preach”, S. XXXI). In der Tat konnte jeder Mensch im Mittelalter, sei es in Rom oder Byzanz, das Bild des Jüngsten Tages an der westlichen Kirchenwand, d.h. am Ausgang aus der Kirche beim Hinausgehen ins Alltagsleben betrachten. Die Schlussfolgerungen der Verfasser über die enge zeitliche Anknüpfung und eine begrenzte Rolle des Themas auf dem Gebiet der Predigt kommen also mit der breiten kirchlichen Praxis des Mittelalters zusammen und sind deshalb von allgemeiner theoretischer Bedeutung. Von Interesse sind auch die Beobachtungen zur Verteilung des Themas des universellen und individuellen Gerichts und zu ihren Ver-hältnissen in verschiedenen Traditionen und Epochen. Ein weiteres nicht hoch genug einzuschätzendes Ergebnis ist die Klärung der regionalen Verhältnisse, der Querverbindungen und der Auseinandersetzungen mit dem Jüngsten Gericht. Die Untersuchung der regionalen Predigtüberlieferung lässt darauf schließen, dass sich das Thema in der altenglischen und skandinavischen (schwedischen und dänischen) Tradition großer Beliebtheit erfreute, während es in der mittelenglischen, mittelniederländischen und weiteren kontinentalen Traditionen nicht so populär war (S. XXVIII-XXX sowie die Beiträge von o’maRa [S. 19-41], meRtens [S. 43-65], andeRsson [S. 67-78] und sheRWood-smith [S. 79-100]). Die im Band versammelten Beiträge sind als Einzelwerke und als Teile einer ge-meinsamen Erforschung nützlich. In der Einleitung von miChael meCklenBuRg und thom meRtens werden eine Übersicht der Aufsätze dargeboten und die wichtigsten Schlussfolgerungen zusammengefasst. stephan BoRgehammaR behandelt in lebhafter Weise die Darstellung des Jüngsten Gerichts in mittelalterlichen lateinischen Modell-
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
122 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
predigten. Im Beitrag von VeRoniCa o’maRa wird das entsprechende Thema in den altenglischen prosaischen Predigten beschrieben. Sehr aufschlussreich ist der Beitrag von thom meRtens über das Jüngste Gericht in den mittelniederländischen Predigten über das Sonntagsevangelium. Der Verfasser konturiert die Thematik des Jüngsten Gerichts im mittelniederländischen Predigtwesen anhand der Überlieferung und der Rezeptions-kontexte. Daran schließt der Aufsatz von maRia sheRWood-smith an. Er ist dem Jüngsten Gericht in den mittelniederländischen Predigten und ihrer Rolle in der niederländischen Übersetzung Gregors des Großen gewidmet. Im Beitrag von RogeR andeRsson wird die Popularität des Themas in den altschwedischen Predigten bewiesen. In einer Reihe von Beiträgen wird dann die eschatologische Problematik in Werken von einzelnen mittelalterlichen Verfassern besprochen. Jussi hanska widmet sich Eudes de Châteauroux und den apokalyptischen Erwartungen nach dem Erdbeben 1269 in Viterbo. CaRola RedziCh nimmt die ‘Letzten Dinge’ in den Predigten von Johannes Nider OP auf die Apokalypse 22,14f. in den Blick und ChRistoph BuRgeR stellt Über-legungen zur Predigt des Augustiners Johannes von Paltz von 1487 über die Ankunft Christi als Richter an. Den Abschluss des Sammelbandes macht der Beitrag von miChael meCklenBuRg über die narratologischen Aspekte der Predigt und des religiösen Dra-mas (Weltgerichtsspiele) und ihre Möglichkeiten bei der Representation der Zukunft, wodurch die Darstellung des Jüngsten Gerichts in Predigten in einen breiteren Kontext der mittelalterlichen Literatur eingeschlossen wird. Bei der Behandlung des Hauptthemas ist es den Herausgebern und den Verfassern gelungen, das Gleichgewicht zwischen dem unübersehbar großen Themenkomplex und den konkreten Forschungsaufgaben zu halten. Viele Fragen müssen notwendigerweise offenbleiben, vor allem die Frage nach den eschatologischen Stimmungen in den Predigten, die das Jüngste Gericht nicht formell zum Thema haben, aber sich apokalyp-tisch geben (Johannes Tauler). Das Buch ist gut ausgestattet und mit einem Handschriften- und Namenregister versehen. Der Band leistet einen konstruktiven Beitrag zur Mediävistik und Literatur-geschichte und ist zugleich als Werk zum Predigtwesen und zur mittelalterlichen Eschatologie von großem Interesse.
Prof. Dr. habil. Natalija Ganina, Staatliche Lomonossov-Universität Moskau, Philologische Fakultät, Lehrstuhl für germanische und keltische Philologie, 119991 Moskau, Leninskie gory GSP-1E-Mail: [email protected]
Manuscripta chemica in Quarto, bearbeitet von haRtmut BRoszinski (Die Hand-schriften der Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel 3,2,2), Wiesbaden 2011. Harrassowitz Verlag, XXXVIII, 671 S., ISBN 978-3-447-06494-1, EUR 198,–
Spätestens seit den profunden Alchemie-Studien des im vorletzten Jahr verstorbenen JoaChim telle ist die Kenntnis über die Bedeutung der Alchemie an den frühneuzeit-lichen Fürstenhöfen bis hin zu Kaiser Rudolf II. in Prag Allgemeinwissen. Allerdings herrscht – nicht zuletzt durch die häufigen Wiedergaben altniederländischer Darstellungen
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
123Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
der alchemischen Labore als Hexenküchen verschrobener Sonderlinge ‒ häufig noch die Vorstellung vor, es handele sich dabei um allerhand Hokuspokus, Geheimniskrämerei mit abseitiger, vorwissenschaftlicher Vermengung mystischer, astrologischer und spekulativer Vorstellungen. Gewiss, das spielte alles eine Rolle, aber genauso wichtig ist, dass hier unter unerreichbaren Zielvorgaben wie der Transmutation von Metallen, der Herstellung von Aurum potabile oder des Steins der Weisen, um nur Weniges zu nennen, elaborierte naturwissenschaftlich-chemische Technologien entwickelt und angewendet wurden, die der zeitgleichen Entwicklung mathematischer, physikalischer oder mechanischer Instrumente, vom Fernrohr und Mikroskop bis zum Himmelsglobus, entsprachen. Zu den Fürstenhöfen in Deutschland, die große alchemische Labore, zahlreiche Laboranten und riesige Bibliotheken mit immensen Kosten unterhielten, gehörte auch der des hessischen Landgrafen Moritz des Gelehrten (1572-1632) in Kassel, später Eschwege, der mit dem Mathematiker und Mediziner Johannes Hartmann den ersten Lehrstuhl für Chymiatrie an seiner Landesuniversität in Marburg weltweit überhaupt besetzte und damit als Begründer der Chemie als Universitätsfach angesehen werden kann. Trotz zahlreicher Verluste alchemischer Hss. bei der Bombardierung der hessischen Landesbibliothek in Kassel während des Zweiten Weltkriegs hat sich ein Großteil der alchemischen Literatur aus den Beständen des Landgrafen erhalten. Dieses riesige Korpus ‒ und zwar zunächst nur der Quartbände! ‒ im Verlaufe der vergangenen 30 Jahre systematisch und akribisch nach den Vorgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgearbeitet und 2011 in einem gewichtigen Band herausgegeben zu haben, ist das großartige Verdienst des früheren Leiters der Landesbibliothek Fulda, haRtmut BRos-zinski. Wie axel halle, der Leiter der Universitäts- und Landesbibliothek in Kassel, in seinem Geleitwort schreibt, hält der kundige Leser “mit dem Katalog einen großen Wissensschatz in Händen, der zu weiterer Forschung die Basis abgeben wird”. Ehe diese Aussage durch Belege aus dem rund 400 Seiten umfassenden Katalogteil des Bandes gestützt wird, sei zunächst dessen Aufbau mitgeteilt: auf den rund 20 Seiten umfassenden Einleitungsteil folgt das Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur, dann von S. 1-396 die Beschreibungen der Hss., anschließend die Zusammenstellung der alten Bibliothekssignaturen. konRad Wiedemann als direkter Nachfolger BRoszinskis in der Leitung der Abteilung steuert nach einer kurzen Einführung eine gut 40 Seiten umfas-sende Edition des Katalogs der Bibliothek des gelehrten Landgrafen Moritz bei, dessen umfassender Bildungs- und Wissensanspruch diesen Beinamen unbedingt rechtfertigt. Die folgenden 200 Seiten enthalten das äußerst wichtige Initienregister und das ebenso stimulierende wie umfassende und als Informationsquelle kaum zu überschätzende Personen-, Orts- und Sachregister. Um bei diesem Abschnitt zu bleiben: allein das Initienregister bringt trotz aller topischen Formulierungen eine derartige Fülle an Stichworten, Themen und Sachgrup-pen, dass man unmittelbar angeregt wird, sich in die Details der Fundstellen zu vertiefen, ähnlich wie dies die Alchemisten auf den Bildern der alten Holländer tun. Im folgenden Personen-, Orts und Sachregister stößt der kundige Leser fortwährend auf bekannte Na-men aus der Entourage und Korrespondenz des Landgrafen. Es tut sich ein europaweites Netzwerk von der Alchemie verbundenen Personen auf, die in engster Beziehung zu dem Landgrafen und seinen Mitarbeitern stehen. Unter Letzteren finden sich nicht nur Laboranten, Apotheker, Ärzte und “Probierer”, sondern auch zahlreiche Kammerdiener, zumeist in Mehrfachfunktionen, z.B. als Musiker wie der Vizekapellmeister Andreas Ostermeier, sein Vorgesetzter Georg Otto, der ehemalige Sänger Johannes Eckel oder
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
124 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
der spätere Hofkapellmeister Christoph Cornett, von dem besonders zahlreiche Einträge erhalten sind. Andere, wie etwa Heinrich Schütz, damals Hoforganist in Kassel, oder dem Fürsten nahestehende Adlige wie der Freiherr von Winnenberg oder der Hofmeister der Hofschule, Johann von Bodenhausen, fehlen, während z.B. englische Adlige wie Francis Segar mit einigen Rezepten vertreten sind. Diese wenigen Hinweise mögen schon ge-nügen, um den Wert dieses Registers z.B. bei prosopographischen Studien des Kasseler Landgrafenhofs zu unterstreichen. Damit ist natürlich nur ein Randbereich angesprochen. Die Fülle dessen, was mit diesem Katalog alles bewerkstelligt werden kann, erschließt sich aus dem Vorwort des Verfassers, das mit seiner Informationsdichte, den pointierten Formulierungen und häufig launigen Bemerkungen des glänzenden Stilisten BRoszinski die Lektüre so anregend und unterhaltsam macht. Nach einer kurzen Einführung in die Genese der Bibliothek und der mit der Erfassung und Betreuung beteiligten Personen folgt eine Bestandsübersicht: heute umfasst die Sammlung 34 Bände in Folio (25 Signaturen), 164 Bände in Quarto (108 Signaturen) und 61 Bände in Octavo (44 Signa-turen), in summa 259 Hss. Dieser Bestand zeichnet sich durch die Einheitlichkeit seiner Entstehung aus, nur wenige Codices stammen von Moritz’ Vater Landgraf Wilhelm IV., der bereits ähnliche Interessen wie der Sohn pflegte, allerdings weit weniger intensiv. So beziehen sich zahlreiche Briefstellen in der umfangreichen, in Kassel und Marburg erhaltenen Korrespondenz von Moritz auf Alchemie oder alchemische Literatur und Versuche. Auch von seinen Hofbeamten, etwa dem “Zeugobristen” von Siegerodt oder den Leibärzten Rhenanus, Hartmann, Wolf und Mosanus, aber auch auswärtigen Korrespondenten, erhielt, behielt oder erwarb Moritz Hss., so auch die Bibliothek des ehemaligen Schmalkalder Arztes Dr. Ortholph Marold. Und eine besondere Trouvaille war die Tatsache, dass auch der bedeutende niederländische Bildhauer und Architekt Wilhelm Vernukken, Hofbaumeister in Kassel, sowohl bei alchemischen Versuchen wie der Darstellung alchemischer Gerätschaften beteiligt war. Seine Bilder von Destillieröfen, Gefäßen und anderem eröffnen einen eigenen kunsthistorischen Auswertungshorizont. Überhaupt spielen Bilder, oft in ganzen Sequenzen, eine große Rolle in den Hss., aber auch Musik findet sich in Form von kurzen Lautentabulaturen und anderem. Ebenso wichtig ist die Fülle der Themen, deren sich die Hss. annehmen. Sie reichen vom Bergbau, zu Paracelsica, dem Rosenkreuzer-Problem (wobei Moritz sicher nicht als Verfasser der “Fama Fraternitatis” infrage kommt) bis hin zu den fast unüberschau-baren, über 600 Rezeptsammlungen. BRoszinski hebt hervor, dass eine Besonderheit des Bestandes der hohe Anteil an Einbänden aus Resten anderer Hss. (insgesamt 61 wurden identifiziert) und Permanentfragmenten darstellt. Letztere setzen bereits aus der Zeit um 900 ein (Codex Hersfeldiensis des Ammianus Marcellinus); ein “Highlight” sind dabei die Fragmente eines niederdeutschen Paradiesspiels aus der zweiten Hälfte des 14. Jh.s, somit der älteste bisher bekannte Textzeuge im Niederdeutschen! Auf die zahlreichen weiteren Beispiele (S. XXVIII) sei hier nur hingewiesen. Wie üblich berichtet der Verfasser über die Arbeit an dem Band und verschweigt dabei dezent die unglaubliche Arbeitsleistung, den umfassenden Kenntnisreichtum und die ungemeine Sorgfalt, die er bei dieser sich über 30 Jahre erstreckenden Tätigkeit aufgewendet hat und hebt dagegen die Hilfe durch Kollegen und Mitarbeiter hervor, insbesondere Frau Dr. Betty Bushey, bei der Kompilierung der Register und den Mühen des Korrekturlesens. Diesem Dank, auch an die hier nicht Genannten, kann man nur beipflichten, wenn man das Resultat betrachtet. Es würde hier zu weit führen, alle Namen
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
125Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
der im Vorwort vorgestellten Mitarbeiter und an den Handschriftenbeschreibungen Beteiligter zu nennen. Es ist ganz unmöglich, die Fülle der Informationen, die in jeder Einzelbeschreibung steckt, hier wiederzugeben. Ein Beispiel für die Vielfalt der Textsorten, der buchtech-nischen Details und der wissenschaftshistorischen Kontextualisierung sei nur für 4° Ms. chem. 9 (S. 31-40) kurz angerissen: auf die Überschrift (“Sammlung klassischer alche-mischer Traktate [...]”), folgen die Charakterisierung, Verortung und Zeitstellung der Hss. sowie im petit-Druck die bibliothekarischen Details der Form, des Schrifttyps, der Besonderheiten wie Zeichnungen, Einband mit Pergamentfragmenten, Binnenincipits, Ornamentik, Anordnung usw. Die Schreibsprache ebenso wie der Besitzer werden identi-fiziert und auf die Behandlung der Personen im Vorwort verwiesen. Es folgt seitenweise die Darstellung der einzelnen Traktate mit Verweisen auf die entsprechende Literatur. Zitate aus den Hss. mit Korrekturverweisen und die Kontextualisierung im Spiegel der zeitgenössischen und späteren Literatur ermöglichen zahlreiche Querverbindungen zu erschließen und geben eine Fülle von Anregungen. Damit geht der Katalog weit über die einfache Erschließung des Bestandes hinaus und stellt ein wunderbares Instrument für das wissenschaftliche Arbeiten in einem faszinierenden wissenschafts- und kulturhistorischen Bereich dar, der in keiner germa-nistischen, kulturwissenschaftlichen und frühneuzeitgeschichtlichen Bibliothek fehlen sollte. Dieser Katalog ist schlicht ein Meisterwerk, das seinen Preis allemal wert ist.
Prof. Dr. Gerhard Aumüller, Am Möhrengarten 1, D–35117 MünchhausenE-Mail: [email protected]
Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein. Edition und Kommentar, Bd. 2: 1420-1428, Nr. 93-177, hg. von anton sChWoB unter Mitarbeit von kaRin kRaniCh-hofBaueR, ute monika sChWoB, BRigitte spReitzeR, Wien/Köln/Weimar 2001. Böhlau Verlag, XXV, 379 S., ISBN 3-205-99370-5;Bd. 3: 1428-1437, Nr. 178-276, hg. von anton sChWoB unter Mitarbeit von kaRin kRaniCh-hofBaueR und BRigitte spReitzeR, kommentiert von ute monika sChWoB, Wien/Köln/Weimar 2004, XXVIII, 405 S., ISBN 3-205-77274-1;Bd. 4: 1438-1442, Nr. 277-386, hg. von anton sChWoB und ute monika sChWoB, Wien/Köln/Weimar 2011, XXII, 349 S., ISBN 978-3-205-78631-3;Bd. 5: 1443-1447, Nr. 387-524, hg. von anton sChWoB und ute monika sChWoB, Wien/Köln/Weimar 2013, XXIII, 379 S., ISBN 978-3-205-78951-2
Zu berichten ist über den erfolgreichen Abschluss eines großen Unternehmens. Der erste Band der umfassenden Edition aller Urkunden und sonstigen nichtpoetischen Lebenszeugnisse, die Oswald von Wolkenstein betreffen, war 1999 erschienen.1 Längere Zeit war das Projekt vom österreichischen Fonds für wissenschaftliche Forschung gefördert worden, die letzten Bände aber haben anton und ute monika sChWoB mit bewundernswerter Energie selbst vollendet. Beide haben die Edition auch durch eine
1 Vgl. meine Rezension in ZfdA 131 (2002), S. 134-136.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
126 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Fülle von lesenswerten Publikationen, die in den Literaturverzeichnissen der Bände aufgeführt sind, begleitet. Reichen Gewinn dürfte von der Edition und den begleitenden Publikationen vor allem die Landes- und Alltagsgeschichte haben. Die große Südtiroler Landesausstellung “Ich Wolkenstein” von 2011 auf Schloss Tirol, die mich vor allem für diese Aspekte beeindruckt hat, wäre ohne diese (und weitere, vor allem archäologische) Grundlagen-forschung sicher nicht möglich gewesen. Es ist zu hoffen, dass die Historiker das ihnen dargebrachte Geschenk intensiv nutzen. Immerhin erfasst die Edition “exemplarisch nichtfürstliche Adelsexistenz im 14. und 15. Jahrhundert. Sie stellt Grundherren, Bur-gherren und Unternehmer, Krieger und Diplomaten, Rechtssachverständige, Fürsten-diener und provokante Opponenten gegen vermeintliche fürstliche Willkür sowie die bedienten und bekämpften Fürsten selbst vor” (Bd. 5, S. XVIII). Die sehr genaue diplomatische Wiedergabe der (meist datierten und lokalisierten) Aktenstücke kommt auch sprachhistorischen Interessen entgegen. Für sie sollte allerdings eine digitalisierte Version der Edition im Internet zugänglich gemacht werden. Der Literarhistoriker und Interpret der Lieder wird sich vor allem mit Band 2 befassen müssen, weil für diese Zeit autobiographische Elemente der Poesie und archivalische Zeugnisse am ehesten aufeinander beziehbar sind. Der Abstand zwischen den poetischen und den archivalischen Lebenszeugnissen bleibt freilich groß, und wer sich um die Lied-texte bemüht, wird in dieser Edition nicht immer fündig werden. Der Ausfall aus Burg Greifenstein z.B., der in Kl. 85 so temperamentvoll inszeniert wird, und die weiteren Scharmützel, die in diesem Lied erwähnt werden, sind unterhalb der Ebene geblieben, die in archivalischen Quellen fassbar wird; anton sChWoB hat den Ausfall schon 1418 angesetzt,2 aber es kämen wohl auch spätere Termine in Frage. Bei der Unfestigkeit des zeitgenössischen Namengebrauchs macht die Identifizierung von Personen oder weniger bekannten Örtlichkeiten öfter Schwierigkeiten. Im Allge-meinen sind sich die Herausgeber und Bearbeiter dieses Problems sehr bewusst und bieten Lösungen an, die für mich plausibel sind. In einem Fall aber wäre ich wohl noch vorsichtiger: Kl. 81 beginnt mit einer Serie von Klugheitsregeln, die als Mitteilung eines Bekannten deklariert werden: schreibt uns Hainz Mosmair mit geschrai. Und Kl. 116 werden die Anzeichen des Frühjahrs einem Mosmair in den Mund gelegt: hort ich den Mosmair sagen. Die Vermutung, dass es sich in beiden Liedern um ein und dieselbe Person handelt, ist nicht beweisbar, liegt aber nahe. Wie immer man die merkwürdige Fügung schreibt mit geschrai übersetzen mag,3 man würde doch gern wissen, wer dieser Hainz Mosmair war und in welcher Beziehung er zu Oswald stand. sChatz merkt an: “Hainrich Mosmair war ein Bauer bei Kastelruth, der von 1410 ab in Urkunden genannt wird”.4 ute monika sChWoB scheint sich dem anzuschließen, indem sie ihn in anderem
2 anton sChWoB, Oswald von Wolkenstein. Eine Biographie, 3. Auflage, Bozen 1979, S. 126-128, vgl. Lebenszeugnisse Bd. 1, S. 263.
3 WeRnfRied hofmeisteR, Oswald von Wolkenstein, Das poetische Werk, Berlin/New York 2011, S. 215 übersetzt “so hat es uns Heinz Mosmair mit großem Nachdruck schriftlich übermittelt”; lamBeRtus okken und heinRiCh l. Cox, Untersuchungen zu dem Wortschatz der Lieder Os-walds von Wolkenstein 81 und 116, in: Modern Language Notes 88 (1973), S. 956-979, und 89 (1974), S. 367-387, hier S. 979, übersetzen “so schreibt Hainz Mosmair gewichtig”.
4 Oswald von Wolkenstein, Geistliche und weltliche Lieder, ein- und mehrstimmig, bearbeitet von Josef sChatz (Text) und osWald kolleR (Musik) (Denkmäler der Tonkunst in Österreich 18), Wien 1902 (Nachdruck Graz 1959), S. 115.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
127Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Zusammenhang in der engeren Umgebung von Hauenstein ansetzt (Bd. 3, S. 59). Konnte ein Bauer schreiben? Oder ist schreibt nicht wörtlich zu nehmen? Kompliziert wird die Frage auch deshalb, weil in Bd. 2, S. 119, ein Heinrich Mosmayr als Brixner Bürger, der häufig in Urkunden aufscheine, genannt wird,5 außerdem erscheint 1442 ein Hans Mair von Moos als Nachbar Oswalds von Wolkenstein in St. Lorenzen (Bd. 4, S. 174). Wie viele Mosmairs oder Mairs von Moos mag es in den von den “Lebenszeugnissen” nicht erfassten Urkunden in Oswalds Bekanntenkreis noch gegeben haben? Aufgenommen sind ja nur Quellen, in denen Oswald ausdrücklich genannt ist. Nicht alle Fragen zu Biographie und Lebensumständen Oswalds von Wolkenstein sind mit dieser umfangreichen Edition gelöst. Aber wir haben allen Grund, für diese Ausgabe der archivalischen Lebenszeugnisse und für ihre überaus gründliche Kommentierung dankbar zu sein.
Prof. Dr. Burghart Wachinger, Engelfriedshalde 15, D–72076 TübingenE-Mail: [email protected]
5 Vgl. auch okken/Cox [Anm. 3], S. 369f. und 387.
timo ReBsChloe, Der Drache in der mittelalterlichen Literatur Europas (Beiträge zur älteren Literaturgeschichte), Heidelberg 2014. Universitätsverlag Winter, 430 S. mit Abb., ISBN 978-3-8253-6205-8, EUR 65,–
The volume is a somewhat revised version of the author’s dissertation, accepted in 2012 by the Universität Köln. It is a timely work, given the fascination with the dragon figure that, if anything, has increased, rather than abated, since the close of the European Middle Ages. In fairness to ReBsChloe, let it be said that this is a vast subject, one worthy, per-haps, of several volumes. Herein lies one difficulty for the reader who takes the title at face value: this is a book concerned less with the dragon in medieval literature per se as it is about the dragon in the literature of the G e r m a n - s p e a k i n g area of medieval Europe, specifically with respect to the vernacular literature. While it would understand-ably have exceeded the limits of the dissertation to have included analyses of the medieval vernacular literature of England, Ireland, France, Spain, etc., a more differentiated choice of title might have been appropriate, given the main focus of the book. ReBsChloe’s analyses of the role and function of the medieval dragon concentrate on three clearly-defined areas: 1. the Christian tradition, 2. the appearance of the dragon in medieval treatises on natural history, and 3. the vernacular (mostly, but not exclusively, Middle High German) literature of the High Middle Ages. Overall, the volume has a coherent and transparent structure, although it might be suggested that a two-page dis-cussion of the (East) Asian dragon (p. 48f.) would be better combined with a somewhat longer commentary on the same subject towards the end of the book (p. 367-371). Important questions are posed by ReBsChloe, perhaps foremost among them, what, in fact, are dragons, and why are they so frequently depicted in a one-sided manner as negative entities (p. 14f.), at least in Western tradition? Initially, ReBsChloe responds to the former using linguistic criteria: any being described in a primary text as “Drache”,
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
128 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
“Wurm”, “Wyrm”, “Draca”, “Lint”, “Lintdrache”, or “Lintwurm” (p. 15), fits the concept of ‘dragon’ for the purpose of his study. The author does not attempt to deal with the thorny issue of the dragon’s ultimate origins (in the Far East?), a question that would far exceed the parameters of this book. Regarding the dragon’s essence, ReBsChloe re-views his presence in myth, whether in the Classical period, ancient Egypt, or Biblical tradition, and the view of monsters and the ‘monstrous’ put forth by such diverse twen-tieth-century thinkers as Jung and fouCault. There are tantalizing references here and there to the concept of the archetype (note p. 50ff.), and to the work of Jung, including illustrations from Jung’s ‘Von den Wurzeln des Bewusstseins’ (p. 424), but they remain fleeting allusions. More might be said, for example, of Jung’s reference to the (evil) ‘devouring and entwining animal”1, and the degree to which these characteristics of the dragon in Gottfried von Straßburg’s ‘Tristan’, or the gabilûn in the anonymous ‘Kudrun’, resonate in the monsters’ (courtly/heroic) adversaries. As to the dragon’s predominantly negative image in the Western world, the author’s stance throughout his study is that not every dragon is bad per se, although Christian influence has contributed much to cast the monster in a pejorative light, that he is rarely to be identified with the devil, that there is no unified (negative) image of the dragon to be derived from medieval sources, and, finally, that, despite the negative portrayal of the dragon in a large number of works, the figure does, in the final analysis, remain morally ambivalent. A basic premise to which ReBsChloe adheres, one that is hardly problematical, is that the dragon was considered by the medieval public to be real, and that this belief persisted long after the Middle Ages (p. 20). As such, the dragon can be viewed, in his excessiveness, as the ultimate challenge to the hero, functioning, as the author points out on numerous occasions, as a catalyst to bring forth evidence of the latter’s courage and prowess. Yet, if the dragon is not, in his essence, inherently evil, why must he be combatted at all? As ReBsChloe correctly asserts, a dragon’s appearance in a primary work must be analyzed individually within its specific context in order to determine the essential meaning of the beast for that source (p. 26). ReBsChloe makes two major points when considering the dragon against the backdrop of Christian tradition, both during and prior to the Middle Ages: 1. while the devil may appear as a dragon, not every dragon is the devil (p. 59) – one may go further and claim that it is indeed rare for the dragon to be identified with the devil; 2. Christianity had a (significant) role to play in the ‘taming’ of the medieval dragon, although ‘tame’ dragons were not unknown during the Classical era (p. 43). Despite the relative paucity of a direct association between dragon and devil, given the “kalokagathia ideal” (p. 107) of the time, it is difficult to imagine that either the educated or the more primitive contemporaries of that period would have seen anything other than the malevolent in a dragon or snake, even if their role in a particular literary work was not overly aggressive or destructive. A lion may be an ambivalent beast when it is a matter of the duality of good and evil – Gawan’s dispatching of the lion that attacks him in Schastel marveil in ‘Parzival’ can be contrasted with Iwein’s assistance to, and alliance with, the lion in Hartmann’s romance of the same name. The dragon, viewed from the perspective of the kalokagathia tradition, remains consistently the antithesis and adversary, or potential adversary, of the warrior/knight. A noble, sympathetic dragon (draco nobilis) will eventually emerge within society,
1 C. G. Jung, The Archetypes of the Collective Unconscious, translated by R. F. C. hull (Bollingen Series 20), Princeton 21962, p. 82.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
129Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
but not until many centuries after the Middle Ages.2 The devouring, vicious monster in ‘Tristan’ is still present, even if others, the dragons of Heinrich von dem Türlin’s ‘Diu Crône’, or the dragon of Konrad von Stoffeln’s ‘Gauriel von Muntalban’, for example, pale in comparison with respect to both their role and functionality within these works. ReBsChloe’s analyses of the dragon in medieval works on natural history, ranging from Isidor of Seville († 636) to Johann Jacob Scheuchzer († 1733!), illustrate the tenacity of the belief in the factuality of dragons in Western Europe for at least a millennium, whether in the form of the prima materia of the alchemists (p. 104), the descriptive narratives of travelers such as Marco Polo, Philippe Ménard, or John Mandeville (p. 124ff.), who were consistent in situating monsters far from ‘civilized’ Western Europe, or the remark-able observations of Hildegard von Bingen in the seventh book of her ‘Physica’. No doubt is expressed that dragons exist, or that, in some instances, they are regarded in the same way one might regard a lion or a camel, i.e., as any other living animal (Isidore of Seville, Albertus Magnus). The bulk of ReBsChloe’s volume (p. 149-359) focuses on his analyses of dragon appearances in the vernacular literature of the (mostly German – although ‘Beowulf’ and the Nibelungen tradition in Scandinavia are treated) High Middle Ages. It must be admitted that, upon completing one’s reading of these two hundred plus pages, one could be inclined to agree with tolkien’s 1936 remark that “dragons, real dragons, essential both to the machinery and the ideas of a poem or tale, are actually rare. In northern literature there are only two that are significant [...]. [W]e have but the dragon of the Völsungs, Fáfnir, and Beowulf’s bane”3. While the reader may concur with ReBsChloe (and ChRistine RaueR, whom he cites) that Beowulf’s encounter with the dragon repre-sents the “culmination” of the plot (p. 165), a reflection of tolkien’s view of almost eighty years ago, he may be less inclined to accept unequivocally the author’s declaration that the dragon is “kein Feind Gottes; er ist [...] ein normales Lebewesen” (p. 166). The unnamed dragon in ‘Beowulf’ is certainly not depicted as a self-proclaimed adversary of God, although his penchant for destruction once provoked underscores his potential as an entity fully capable of turning ordo into inordinatio, i.e., as constituting a dire threat to what is, to the medieval mind, a God-ordained order. A “normal, living creature”? This would describe the figure that tolkien r e j e c t e d as a suitable adversary for Beowulf at the end of his life and why he ascribed so much significance to the dragon as dragon, precisely because it was, to quote ReBsChloe, “übermenschlich” (p. 166) and anything but “normal”. The Fáfnir-Sigurd episode in the Scandinavian Nibelungen tradition and the nameless dragon-Siegfried encounter in the ‘Nibelungenlied’ are the two best-known dragon-hero confrontations in continental, medieval literature although, in the former instance, the encounter does not culminate in a battle per se. An intriguing point noted by ReBsChloe is how Fáfnir comments, after having been defeated by Sigurd, that the
2 Note the 1996 film ‘Dragonheart’, with – the voice of – Sean Connery in the role of the dragon; the three dragons raised by Daenerys Targaryen in the more contemporary HBO series, ‘Game of Thrones’, tend to be rather sympathetic creatures as pre-adolescents, but their ambivalent nature becomes horrifyingly apparent as they mature.
3 J. R. R. tolkien, “Beowulf: The Monsters and the Critics,” in: ‘Beowulf. A Verse Translation. Authoritative Text, Contents, Criticism’, translated by seamus heaney, ed. by daniel donoghue, New York/London 2002, p. 109.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
130 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
latter has unjustly attributed hostility to him. This is worthy of more detailed analysis. Fáfnir is, in fact, telling the truth. This dragon-shapeshifter, son of Hreidmar and brother of Regin, certainly demonstrated a tendency toward avarice and selfishness and was, furthermore, guilty of patricide. Sigurd had been put up to seeking the hoard of Fáfnir by Regin who, contemplating fratricide, specifically referred to his brother as “evil.” However, did Fáfnir at any time pose a threat to Sigurd? An appropriate response must be formulated against the backdrop of Sigurd’s intentions; his motivation for killing the dragon appears to be primarily, if not solely, motivated by his desire for affluence. From a Christian perspective, avaritia is a cardinal sin, but Sigurd does not confront Fáfnir as a sort of miles Christi – after all, he might well be considered guilty of the same flaw. In essence, Sigurd represents little more than Fáfnir’s competition when it comes to the hoard; moreover, his arrogance is exacerbated by his stubbornness in ignoring the dragon’s wise and, it would seem, well-intended advice concerning the curse associated with the hoard. ReBsChloe is certainly correct to distance the Fáfnir of Nordic tradition from the devil per se (p. 180). On the other hand, he may encounter skepticism when he claims that the dragon “nicht dem Übernatürlichen angehört” (p. 179). Fáfnir was, after all, a shapeshifter, capable of transforming himself from a man into a dragon, and that is an entity that, neither in the medieval world nor thereafter, can, by any stretch of the imagination, be considered ‘natural’ or ‘normal’. ReBsChloe’s identification of the ‘Nibelungenlied’-Siegfried with the Otherworld (p. 189) is justified, but his suggestion that Siegfried, after having killed the dragon (in that Otherworld), assumes the latter’s place in the world requires clarification. In which world? The dragon in the ‘Nibelungenlied’ remained confined to the Otherworld; at no point did he intrude into the ‘normal’ world of the warrior/knights and their courts. The ‘intruder’ was, in fact, Siegfried (a point not lost on Fritz Lang in his 1924 film, ‘Die Nibelungen’). One can agree with ReBsChloe when he claims “Auf jeden Fall teilt er auffällige Eigenschaften mit dem Drachen” (p. 189); Siegfried does become the unchal-lenged master of the otherworldly Nibelungenland and its hoard (although there is no indication that the dragon was actually integral to that particular Otherworld), and he engenders chaos in the ‘normal’ world because of those draconic characteristics, despite his sincere, but ultimately unsuccessful efforts to ‘re-integrate’ himself into the latter (marriage to Kriemhild, seeking to be a friend to the Burgundians, assisting Gunther in the Saxon-Danish war and in the acquisition of Brünhild, for example). Rather than r e p l a c i n g the dragon in the courtly/heroic world, he becomes the intruder who intro-duces those otherworldly characteristics into the ‘normal’ world – a fact that differentiates him significantly from his dragon adversary. The dragon may well have represented the p o t e n t i a l for chaos, although it is thoroughly passive in the ‘Nibelungenlied’ and never overtly threatens Worms, Xanten, or, for that matter, any other court. Siegfried, on the other hand – with one foot in each world – manifests that chaos through both his words and deeds, with catastrophic consequences. ReBsChloe’s differentiation of Parzival and Tristan with regard to their respec-tive identi fication with a dragon deserves particular mention. He accepts this as a “fortdauerndes Motiv des Romans Wolframs von Eschenbach”, but claims: “[...] dass Tristan selbst ein Drache sei, scheint [...] eher problematisch” (p. 275). Yet, the dragons in these works are by no means identical. Herzeloyde’s dragon exists in her dream world, even if Parzival inherits some of its characteristics and may represent, on a certain plane, the dragon itself when he ventures out of Soltane – symbolically tearing his mother’s
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
131Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
heart in two and causing her real death when he departs from her. Parzival, however, in the role of homo viator, ultimately restores order and wholeness to a world he has turned topsy-turvy. As hero, he experiences integration on the highest level as Grail King. Tristan’s symbolic ‘devouring’ of the slain dragon in Ireland (through the pressing of its tongue to his breast) initiates a very different odyssey, one that threatens the ordo of society and leads to a state of isolation of the hero with respect to courtly society that suggests a commonality with some of the protagonists of heroic epic.4
ReBsChloe includes numerous other instances of dragon episodes in medieval Germanic vernacular literature in his study, ranging from the Old Norse tradition, through the Dietrich cycle, including the ‘Thidrekssaga’, Arthurian romances from Hartmann von Aue’s ‘Iwein’ to Heinrich von dem Türlin’s ‘Diu Crône’, historical and classical narratives, folktales and fairy-tales. Running like a red thread through the analyses of the Middle High German sources is ReBsChloe’s observation that the dragon, or dragons, are of little or no major significance for the plot of many of the aforementioned works, beyond accentuating the prowess and courage of the heroic adversary. In his discussion of the dragons of the ‘Rabenschlacht’, for example, ReBsChloe comments that dragons as “eigenständige Figuren”, as a motif separate from specific subject matter or figures, constitute the exception rather than the rule (p. 221). The author detects a gradual ‘taming’ or ‘domestication’ of the dragon figure from the ‘active’ and truly frightening presence of the monster in ‘Beowulf’, through the very real and significant – albeit, in terms of dedicated text, marginalized – dragon of the ‘Nibelungenlied’, to the tamed, hybrid form of the monster in ‘Das Lied vom hürnen Seyfrid’, or the rather anemic portrayal of the dragon in ‘Virginal’. Dragons, he opines, become secondary, a process that ReBsChloe attributes to Christian influence and the poetics of courtly romance (p. 211f.). We can concur with the author that the majority of romances considered contain dragons that are less significant in their own right than as catalysts for heroic action, for demonstrations of prowess and courage on the part of the hero adversary. In the case of Ulrich von Zatzikhoven’s ‘Lancelet’, however, ReBsChloe observes that the dragons before Valerin’s castle can be ignored, while Lanzelet’s kissing of the bearded Elidîâ-dragon tests not the prowess, but simply the courage of the former. Apart from the literary analyses, shorter sections of the book deal with the dragon in scholarly discourse, the origins of the monster, the dragon in Greek mythology, the dragon as archetype, the dragons of East Asia, Richard Wagner’s ‘Ring’, the influen-ce of J. R. R. Tolkien, dragons in municipal coats of arms, and the dragon in modern literature – with no claim to inclusivity suggested. By the conclusion of the book, the reader will have no difficulty summarizing the half dozen major points enunciated by ReBsChloe:
1. no unified image of the dragon-figure emerges from the literature of the Middle Ages; each occurrence must be analyzed and judged on its own merit and within its particular context;
2. for most medieval observers, the dragon is ‘real’;3. dragons are rarely identified unequivocally with the ultimate evil, i.e., the devil; they may
be, in fact, less of a negative force than is generally assumed;4. a gradual transformation (owing much to the influence of Christianity and the rise of courtly
romance) of the dragon from a formidable, ferocious, superhuman adversary of the ordo and the hero who attempts to preserve it, to a tamer, more domesticated entity is evident over
4 Note ReBsChloe’s very pertinent remarks on this point on p. 307.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
132 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
the centuries that separate ‘Beowulf’ from, for example, the ‘Lied vom Hürnen Seyfrid’ in the sixteenth century;
5. the dragon of medieval (Germanic) literature is rarely, in and of itself, of great significance for the plot, but may be essential for the development or individuation (self-identification) process of the hero (note, in particular, Tristan);
6. dragons frequently, but not exclusively, are relegated to an Otherworld or live on the threshold between such a world and ‘normal’ society.
It might be argued that, ReBsChloe, perhaps inadvertently, has demonstrated convin-cingly the veracity of tolkien’s assertion of almost eight decades ago that the only significant dragons in Germanic literature are the dragon of ‘Beowulf’ and Fáfnir. A cynical reader may query: that being the case, is not a volume of 430 pages on dragons in medieval literature somewhat superfluous? Such a suggestion would, in the opinion of this reviewer, do a great injustice to the author. Although its focus is quite clearly aimed at the Germanic sphere, the volume betrays a remarkable familiarity with copious primary and secondary sources. ReBsChloe’s analyses will be most useful not only for scholars with a particular interest in the occurrence of dragons in medieval literature (Appendix A on p. 418-423, with its table of the characteristics of dragons in 27 medie-val works should prove most helpful for future study), but can also provide the impetus for more intensive research into the role and function of other non-heroic, non-courtly, otherworldly entities, and the commonalities they may share with the dragon-figure and their relationship to a heroic/knightly adversary. In sum, a book that, despite its technical flaws (poorly edited; lack of an index), offers scholars a most competent and welcome overview of a ubiquitous, enigmatic, and often highly ambivalent motif in three different medieval literary traditions.
Prof. Dr. Winder McConnell, 205 North Union St., McLouth, Kansas 66054, USAE-Mail: [email protected]
uRsula sChulze, Geistliche Spiele im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Von der liturgischen Feier zum Schauspiel. Eine Einführung, Berlin 2012. Erich Schmidt Verlag, 264 S. mit Abb., ISBN 978-3-503-13717-6, EUR 39,80
Das geistliche Spiel zählt zu jenen Formen der mittelalterlichen Literatur, die in besonderer Weise das Paradigma der Alterität stützen. Einerseits der christlichen Liturgie verbunden, aus der seine Keimzelle abgeleitet ist, andererseits auf theatrale Elemente und Inszenierungsmöglichkeiten setzend, steht es auf der Schwelle zwischen Kult und Spiel, zwischen “Ritual und Inszenierung”,1 zwischen “Kerygma und Mythos”2 und ist insofern weder mit dem antiken noch mit dem neuzeitlichen Drama konzeptuell zusammenzusehen. Johannes Janota hat diese, dem mittelalterlichen geistlichen Spiel
1 So der Titel des von hans-JoaChim ziegeleR herausgegebenen Bandes: Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Tübingen 2004.
2 RaineR WaRning, Funktion und Struktur. Die Ambivalenzen des geistlichen Spiels (Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste. Texte und Abhandlungen 35), München 1974, S. 27.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
133Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
angesichts seiner spezifischen Voraussetzungen ganz eigenen, subtilen Übergänge und Vermittlungen jüngst, auf der Grundlage seiner umfassenden Edition der Melodien der lateinischen Osterfeiern,3 noch einmal und gerade auch für den Ansatzpunkt der Spieltradition, für die lateinische Tropus-Feier konstatiert, indem er ihr den Status einer “dramatischen Kleinstform” beigemessen hat.4 Genau diese “Ambivalenzen” (WaRning) und damit einen zentralen Aspekt der gegenwärtigen Forschungsdiskussion evoziert denn auch der Untertitel des jetzt von uRsula sChulze vorgelegten Einführungsbandes – der ersten Einführung speziell – zum deutschsprachigen geistlichen Spiel des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Zugleich ist hier in Verbindung mit dem Haupttitel eine Entwicklungslinie angedeutet, die die Oppositionen “liturgische Feierˮ und “Schauspiel” in Stationen eines Prozesses überführt, der in der Darstellung selbst dann etwa unter dem Stichwort “ästhetische Verselbständi-gung” thematisiert wird (S. 223-226). Ziel des Bandes ist “eine grundlegende Orientierung über die Geistlichen Spieleˮ des 13. bis 16. Jh.s (S. 3) respektive eine elementare “Darstellung zur Geschichte der deutschsprachigen Geistlichen Spiele, zu den inhaltlichen und strukturellen Erschei-nungsformen sowie zu ihrer Funktion im Zusammenhang der Frömmigkeitspraxis und des gesellschaftlichen Lebens” (Klappentext). Die Konzeption des Bandes sucht diese Vorgaben auf zweierlei Weise einzulösen. Das umfangreiche Kernstück (Kap. V, S. 45-199) präsentiert verschiedene “Inhaltstypen” des geistlichen Spiels im Zuge einer langen Reihe der ihnen jeweils zugeordneten erhaltenen oder signifikanten Einzeltexte, die detailliert beschrieben und charakterisiert werden. Die Abfolge der vorgestellten Typen ist dabei organisiert sowohl nach ihrer “Bedeutung im Kirchenjahrskalender” (S. 3) wie auch nach Kontiguitäten, die sie untereinander aufweisen (z.B. Passionsspiele, Marienklagen und Magdalenen-spiele), und diachronischen Gesichtspunkten, die ihre Entstehung betreffen. Die Serie beginnt demnach mit dem Ostertropus und den drei Typen der lateinischen liturgischen Osterfeier als Ansatzpunkten der ersten geistlichen Spiele, der Osterspiele, bringt danach die Weihnachtsspiele und die große Gruppe der Passionsspiele, die Fronleichnamsspiele und “andere festtagsbezogene Spiele”, fährt fort mit den Endzeitspielen und Spielen mit alttestamentlichem Sujet und mündet schließlich in die Heiligen- oder Legendenspiele und Moralitäten. Immer ist dem, was als eigener Typus definiert und anhand konkreter Spiele und ihrer jeweiligen genetischen, strukturellen und funktionalen Merkmale beleuchtet und detailliert erörtert wird, eine Skizze vorgeschaltet, die die spezifischen liturgie- und frömmigkeitsgeschichtlichen Voraussetzungen und Kontexte erläutert. Diese zentrale Reihe der diversen Spielgenera und Einzelspiele wird ergänzt oder flankiert von einem Bündel kleinerer systematischer Kapitel, die auf übergreifende Aspekte und Zusammenhänge zielen. Hier geht es zunächst, am Beginn des Bandes (S. 11-44), um Definitionen und terminologische Fragen, um neuere Forschungspositio-nen, um den eingangs berührten Konnex von Kult und Spiel, um Entstehungskonditionen
3 Die Melodien der lateinischen Osterfeiern. Editionen und Kommentare, 4 Bde., hg. und erarbeitet von ute eVeRs und Johannes Janota, Berlin/Boston 2013.
4 Ich beziehe mich hier auf Janotas Vortrag “Die lateinische Tropus-Feier als dramatische Kleinstform” im Kontext der vom 18. bis zum 21. September 2014 veranstalteten Rostocker Tagung der Wolfram von Eschenbach-Gesellschaft (“Die Kunst der brevitas. Kleine litera-rische Formen des deutschsprachigen Mittelaltersˮ).
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
134 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
und Wirkungsintentionen (Kap. I). Thematisiert werden zudem die Spielüberlieferung (Kap. II), die intermediale, “sprachliche, musikalische und strukturelle Konstitution” der Spiele im Blick auf “Rollentexte”, “Gesängeˮ, “Spielanweisungen” und formales Arrangement (Kap. III) sowie zuletzt mögliche Aufführungszusammenhänge (Kap. IV), in deren Rahmen dann etwa auch tradierte Bühnenpläne abgedruckt und besprochen werden. Analog werden am Ende des Bandes (S. 200-226) noch einmal verschiedene durchgängige thematische Aspekte synthetisiert (Kap. VI: Repraesentatio und Compassio, Abendmahlsszenen, Frauenfiguren, Teufelsszenen, Darstellung der Juden, Einflüsse des zeitgenössischen Strafvollzugs) und die “Funktion der Spiele in der Gesellschaftˮ (S. 218), in den ausgewählten Rubriken “Gottesdienst und Theaterˮ (S. 218), “Auf-führungsrealität” (S. 221) und “Ästhetische Verselbständigung” (S. 223), diskutiert (Kap. VII). Ein Ausblick auf das “Fortleben Geistlicher Spiele in der Neuzeitˮ (S. 227) beschließt den Band (Kap. VIII). In dieser Gestalt ist die Einführung von uRsula sChulze geeignet, einen ersten fun-dierten Überblick über die Geschichte des deutschsprachigen geistlichen Spiels und seine produktions- und wirkungsästhetischen Implikationen zu vermitteln. Vor allem das kommentierte Repertorium der Spielgenera und Einzelspiele, das verständlicherweise Vollständigkeit nicht anstreben kann, aber doch eine repräsentative Zusammenschau bietet, wird derjenige, der sich grundlegend über das Genus oder aber punktuell über einzelne mehr oder minder herausragende Vertreter informieren möchte, mit Gewinn studieren – gerade auch als (mitunter aktualisierende) Ergänzung oder Vertiefung zu den einschlägigen Handbuchartikeln von hansJüRgen linke und Johannes Janota.5 Die systematischen Kapitel erweitern schließlich den Fokus der Darstellung in kulturwissenschaftlicher Per-spektive mit grundsätzlichen Hinweisen zu den spezifischen intermedialen Konditionen der geistlichen Spiele, zu deren genuiner Positionierung zwischen Kultischem und The-atralem, zu Dramaturgie und Spielpraxis sowie zu tatsächlichen oder rekonstruierbaren Gebrauchszusammenhängen und eigentümlichen Reflexen historischer Lebensweltlichkeit. Es gibt allerdings auch einige Mankos und Unausgewogenheiten. Eines scheint mir gerade in der strikten Separierung der behandelten Materie in einen Katalog- und einen systematischen Teil zu bestehen, wobei das umfangsmäßige Ungleichgewicht beider Partien besonders deutlich wird. Etwas knapp geraten ist vor allem der Abriss zu den neueren und neuesten Positionen der Forschung (S. 12-15), der in dieser Form manche Aspekte eher mit Schlagworten belegt, als sie inhaltlich auszufüllen. Unangemessen scheint mir speziell der Verweis auf RaineR WaRnings Buch ʻStruktur und Funktionʼ, der dessen Anliegen und für die Spielforschung wichtigen Erkenntnissen nicht gerecht wird, sondern sie im Gegenteil – mit Rekurs auf fRiedRiCh ohlys Gegenposition – einer notwendigen Diskussion entzieht (entsprechend vermisst man bei sChulzes Darstellung der Spielgenera und Einzelspiele hin und wieder Deutungsoptionen jenseits der geläu-figen Lesart des geistlichen Spiels als “Medium christlicher Didaxeˮ6). Nicht genannt
5 hansJüRgen linke, Drama und Theater, in: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter. 1250-1370. Zweiter Teil: Reimpaargedichte, Drama, Prosa, hg. von ingeBoRg glieR (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart III/2), München 1987, S. 153-233, 471-485; Johannes Janota, Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit III/1), Tübingen 2004, S. 356-378, 470.
6 Jan-diRk mülleR, Osterspiel, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft 2 (2000), S. 775-777, hier S. 776.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
135Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
ist im Forschungsüberblick helmut de BooRs zentrale Studie zur ʻTextgeschichte der lateinischen Osterfeiernʼ (Tübingen 1967), und auch neuere Beiträge zur Forschungs-diskussion wie der von hans-JoaChim ziegeleR herausgegebene Sammelband ̒ Ritual und Inszenierungʼ (Tübingen 2004) oder BRuno Quasts Monographie ̒ Vom Kult zur Kunstʼ (Tübingen 2005) erscheinen erst unkommentiert im Literaturverzeichnis am Ende des Bandes. Generell verzichtet der Einführungsband auf eine dichtere Dokumentation des Forschungsdiskurses in Fußnoten oder Anmerkungen (nur sporadische Verweise in runden Klammern im Fließtext bestätigen die Regel), was einerseits den Lesefluss begünstigt, andererseits aber zur Konsequenz hat, dass man sich die jeweils relevanten Beiträge und Positionen mit einigem Aufwand aus der allgemeinen Bibliographie zusammensuchen muss. Für einen Band, der sich doch wohl vor allem auch an Studierende oder Studien-anfänger richtet, ist dies vielleicht nicht das optimale Verfahren. Ein anderes Desiderat betrifft den intermedialen Status der Spiele und insbesondere die Rolle der Musik. Das, was die Einführung zu diesem Aspekt beiträgt, beschränkt sich auf sehr allgemeine Angaben (S. 27-29) und bleibt dann am Ende doch ziemlich marginal. Um nur ein Beispiel zu geben: Im systematischen Kapitel zur “musikalischen Konstitutionˮ der geistlichen Spiele (S. 27-29) wird das ʻAlsfelder Passionsspielʼ ange-sichts der hier markanten “Ausweitung der Gesangspartien zu Wechselgesängen” und deren Verdichtung bis hin “zu acht gesungenen Teilen in einer Szeneˮ als signifikanter Fall vorgestellt, der eine “Entwicklung zum Musiktheater, das in der Barockzeit die Oratorien repräsentieren”, erkennen lasse (S. 29). Wer nun aber zum Katalogteil vor-blättert, um im Spezialkapitel zum ʻAlsfelder Passionsspielʼ (S. 92-98) nähere Infor-mationen zu diesem Phänomen zu erhalten, wird nicht recht fündig – es bleibt bei der Aussage, dass “deutsche und lateinische Gesänge [...] in dem gesamten Spiel in großer Zahl vor[kommen]”, “unterschiedliche Funktionenˮ besitzen und insbesondere “zum Ausdruck der Klage [...] konzentriert” werden (S. 96). Um nicht missverstanden zu werden: Man wird einer litera turwissenschaftlichen Einführung zum geistlichen Spiel schwerlich vorhalten können, dass sie ihr Augenmerk zuvorderst auf literarische und textuelle Kategorien richtet. Dass aber eine interdisziplinäre Perspektive bei einem Gegenstand wie dem mittelalterlichen geistlichen Spiel und speziell auch für einen Ein-führungsband hilfreich, wenn nicht essenziell ist, wird einleuchten. Die Voraussetzungen dafür hat die Forschung, haben jetzt vor allem auch wieder die vorliegenden und noch zu erwartenden Editionsarbeiten zur Melodieüberlieferung der Osterfeiern und -spiele von Johannes Janota und ute eVeRs auf den Weg gebracht. uRsula sChulze hat eine solide Darstellung zum geistlichen Spiel des Mittelalters und der Frühen Neuzeit vorgelegt. Vor allem das umfangreiche Repertorium der Genera und ihrer jeweiligen Repräsentanten ermöglicht einen profunden Überblick über das vorhandene Material und wird gerade auch als Nachschlagewerk für denjenigen Leser von Nutzen sein, der sich grundlegend über einzelne Spieltypen sowie konkrete Spiel-texte und -inhalte orientieren möchte. Für den systematischen Zugriff der Einführung hätte man sich allerdings eine breitere Aufbereitung des Forschungsdiskurses wie auch eine stärkere Berücksichtigung der spezifischen intermedialen, d.h. besonders auch der musikalischen Konzeption des geistlichen Spiels gewünscht.
Dr. Christian Seebald, Universität zu Köln, Institut für deutsche Sprache und Literatur I, Albertus-Magnus-Platz, D–50923 KölnE-Mail: [email protected]
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
136 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Von achtzehn Wachteln und dem Finkenritter. Deutsche Unsinnsdich-tung des Mittel alters und der Frühen Neuzeit. Mittelhochdeutsch / Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch, hg., übersetzt und kommentiert von hoRst BRunneR (Reclams Universal-Bibliothek 19212), Stuttgart 2014. Verlag Philipp Reclam jun., 163 S. mit Abb., ISBN 978-3-15-01912-2, EUR 5,80
hoRst BRunneR hat eine zweisprachige Ausgabe einiger Dichtungen des 13.-16. Jh.s vorgelegt, die er – im Anschluss an seine Schülerin sonJa keRth – als “Unsinnsdich-tung” bezeichnet. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus jenem Corpus mixtum, das dem 19. Jh. unter dem Begriff “Lügendichtung” geläufig war und das im ‘Verfasser-lexikon’, weniger glücklich, unter dem Eintrag “Lügenreden” versammelt erscheint.1 Diese Texte waren, sieht man von wenigen Sangspruchstrophen ab, fast durchweg dem Vergessen anheim gefallen. Für eine Seminarveranstaltung zur Sache ist man auf die alten, auf Zeit- und Festschriften verstreuten Editionen angewiesen. Da ich seit einiger Zeit eine wissenschaftliche Neuausgabe der vormodernen Lügendichtung vorbereite, ist mir die Bedeutung des von BRunneR vorgelegten Bändchens vollauf bewusst. Aufrich-tige Dankbarkeit ist der erste Reflex, werden doch von der populären Ausgabe gewiss jene Impulse für die Forschung ausgehen, die die alten Editionen offenbar nicht mehr auszulösen vermögen. Das kann der Sache nur gut tun, war doch im letzten Jahrzehnt sonJa keRth eigentlich die einzige, die sich mit diesen Texten etwas näher befasst hatte.2 Dass ich mit ihrer Auswahl und Klassifizierung der Texte als “Unsinnsdichtung” alles andere als glücklich bin, soll im vorliegenden Zusammenhang eine nachgeordnete Rolle spielen. BRunneRs Büchlein ist keRths Entscheidung jedenfalls nicht anzulasten. Ich gehe nur am Schluss, im Zusammenhang der Textauswahl und ihrer literaturgeschicht-lichen Einordnung, kurz darauf ein, rede ansonsten der Einfachheit halber weiter von “Lügendichtung”. BRunneRs Ausgabe bringt insgesamt 15 Texte. Die meisten von ihnen führen in der Forschung keine etablierten Titel, sodass BRunneRs Entscheidung, Titel einzuführen, grundsätzlich nachvollziehbar ist. Man wird sie als Provisorien sinnvoll vor allem für die Verständigung mit Studierenden nutzen können. Dass das ‘Wachtelmäre’ nun ‘Die Geschichte von den Wachteln’ (Nr. VII) heißen soll, wird sich in der Forschung wohl ebenso wenig durchsetzen wie ‘Der notorische Lügner’ (Nr. VI) oder ‘Aufschneidereien’ für Reinmar (Nr. II) bzw. ‘Seltsame Geschichten’ (Nr. III) für die Marner-Strophe. Dass gleich vier Dichtungen ‘Verkehrte Welt’ heißen (Nr. IV, X, XI, XIV), stellt die Schwierig-keiten bei der Vergabe deskriptiver Titel bestens aus. Gegen die vorgestellte Auswahl, die sich nur teilweise mit dem Bestand des ‘Verfasser-lexikons’ deckt, ist nichts einzuwenden. BRunneR, der die Anfänge der Lügendichtung zurecht in der Spruchdichtung sieht, geht über das bekannte Minnelied Berngers von
1 Vgl. aRne holtoRf, Lügenreden, in: 2VL 5 (1985), Sp. 1039-1044; außerdem mike malm, ‘Lügenrede’, in: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter 5 (2013), Sp. 580-583.
2 Vgl. sonJa keRth, ‘Twerher sanc’. Adynata in Sangspruchdichtung und Minnesang, in: Neue Forschungen zur mittelhochdeutschen Sangspruchdichtung, hg. von hoRst BRunneR und helmut teRVooRen (ZfdPh 119, Sonderheft), Berlin 2000, S. 85-98; dies., Lügen haben Wachtelbeine. Überlegungen zur deutschen Unsinnsdichtung des Mittelalters, in: Vom Mittel-alter zur Neuzeit. Festschrift Horst Brunner, Tübingen 2000, S. 267-289; dies., ‘ich quam geriten in ein lant ûf einer blawen gense’. Weltbetrachtung und Welterfahrung im Zerrspiegel mittelalterlicher Unsinnsdichtung, in: Wolfram-Studien 20 (2008), S. 415-434.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
137Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Horheim (MF 113, 1-32) hinweg, bringt dafür aber neben Reinmar von Zweter (I-II) und dem Marner (III) auch Ps.-Reinmar den Alten (IV). Die weitere Lied-Tradition entfällt leider: weder die Strophen der ‘Kolmarer Liederhandschrift’ (2VL Nr. 4), noch die von Uhland verzeichneten hoch- und niederdeutschen Lieder, noch die von der Forschung z.T. völlig übersehenen Lieder aus dem ‘Ambraser Liederbuch’ finden einen Platz.3 Eher unter didaktischem Aspekt hätte ich die Aufnahme der alten, von den Brüdern Grimm in den ‘Kinder- und Hausmärchen’ (Nr. 158) bearbeiteten Lügenrede ‘Vom Schlauraffenlande’ (vor 1330/1350; 2VL Nr. 7) gewünscht.4 Peter Suchenwirts und Hans Rosenplüts Reden (2VL Nr. 9, 12) hätten schöne Vergleichsstücke zu Hans Kuglers ‘Windbeutel’ (IX) abge-geben. Erfreulich ist, dass mit Michel Beheims Lied (X) ein Stück aufgenommen wird, das bisher noch gar keine Rolle gespielt hat; die einschlägigen Strophen Muskatbluts hätten sich freilich zum Vergleich aufgedrängt (sie fehlen leider auch im 2VL). Sehr froh bin ich über die Aufnahme der Stücke XI-XV (u.a. Hans Sachs, ‘Finkenritter’), die das Fortleben der Lügendichtung bis an die Schwelle zum 17. Jh. belegen. Die Absenz von Priameln ist zu verschmerzen; Fastnachtspiele (2VL Nr. 14) hätten wohl den Rahmen gesprengt. So stellt das Heft eine vertretbare, das Spektrum der beteiligten Texttypen angemessen repräsentierende Auswahl etwa der Hälfte aller einschlägigen Texte vor. Die Texte selbst werden mehrheitlich aus der Überlieferung ediert. Der erfahrene Herausgeber BRunneR bringt dadurch einige durchaus stimulierende Lesarten ins Ge-spräch. Man kann das gleich sehr gut an der eröffnenden Reinmar-Strophe (I) (Roethe Nr. 159) verdeutlichen. Hier geht BRunneR mit Hs. D. Er erhält dadurch etwa in v. 2 affentôren (Hs.: affen toren) statt âventiure (Roethe). affentoren ist Hapaxlegomenon, die Übersetzung “äffische Narren” konsequent. Wenn der Kommentar (S. 127) freilich erklärt: “Abenteuer in einem fernen Land sind ein übliches Motiv der Unsinnsdichtung. [...] affentôren ist Verballhornung von âventiuren ‘Abenteuer’”, leuchtet mir die Entschei-dung für D (gegen Roethe) nicht mehr unmittelbar ein. Zudem legt sich BRunneR mit D auf eine Perspektive fest, die mindestens diskutabel ist: will der Spruch die anmaßenden Tiere als affentôren vorführen, oder zielt er nicht doch auf deren abenteuerlich-unmögliche Aktionen: dass nämlich Krähe und Habicht Schweine fangen, ein Hirsch Seide spinnt und ein Krebs mit einer Taube um die Wette fliegt? Das sind, zumindest nach meinem Verständnis, âventiuren, keine “äffischen Narren”. – Grundsätzlich behandelt BRunneR die Texte (mit einigem Recht) wie höfische Literatur; parallele Überlieferung fordert zur kritischen Ausgabe heraus. Die in zwei Hss. überlieferte ‘Lügenpredigt’ (VI: “Unsinns-predigt”) gibt BRunneR nach dem Münchner Cgm 717 (datiert 1347) mit Lesarten und Emendationen aus dem Karlsruher Cod. Donaueschingen 104 (ca. 1371). Auf Grund des Textzustands von M nimmt er zwei Lücken bzw. vier fehlende Verse an, um die sein Text nun länger ist als in den alten Abdrucken (v. 16, 18, 112f.). Die für das Genre typische parataktische Struktur rechtfertigt Eingriffe unter inhaltlichem Aspekt natürlich nur selten. Der Blick in die Parallelhs. hätte m.E. die erste Lücke gar nicht reißen müssen: wo es in M haun : gaggzen heißt, bietet K han : gaxan (“haben” : “gackern”). Ähnlich die zweite Lücke: huostet : brunzet ist kein großartiger Reim (M, v. 112f.), auch K hat ihn beseitigt. Doch scheinen mir beide Reime gerade wegen ihrer anstößigen Reimwörter
3 Aus dem ‘Ambraser Liederbuch’ wurden freilich die Prosastücke XIII und XIV in die An-thologie aufgenommen.
4 Zum Text und seiner Tradition bis ins 17. Jh. vgl. jetzt ausführlich sylVia JuRChen, Vom Schlaraffenland, in: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter 5 (2013), Sp. 1001-1004.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
138 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
(gaxen, brunzen) erst einmal unanstößig im Kontext der Texte, in denen sie stehen. – Zum ‘Scherzrezept’ (XIII), das dem ‘Ambraser Liederbuch’ entnommen wurde, bringt BRunneR eine handfeste Konjektur: krebßblut “Krebsblut” statt kreßblut “Kresseblüte” (Z. 6; S. 138). Ich gebe zu, dass ich das “Mäßlein Krebsblut” ebenfalls amüsanter finde als ein Maß Kresseblüten. Der Kontext freilich stellt nicht allein Unmögliches aus: wohl fordert das Rezept “das Fett einer Mücke” (Z. 5), aber eben auch “fünf rostige Hufeisen” und “neun Sensenspitzen” (Z. 6f.), was bizarr sein mag, aber nicht unmöglich. Die Lü-gendichtung stellt die Textkritik also vor besondere Aufgaben. Im Kontext der eigenen Ausgabe habe ich mich eingehend befragt, wie ich es an-gesichts der Spezifik der Texte mit den Übersetzungen halten solle. Mit Blick auf ihre mitunter atemberaubende Artistik bin ich zu einem anderen Ergebnis gekommen als BRunneR, der sich sehr eng an den Wortlaut anlehnt und zuweilen auch den Satzfluss für ein leichteres Abgleichen mit dem Ausgangstext opfert. Vielleicht ist BRunneRs Weg pragmatischer. Er erspart es Studierenden, auch die Übersetzung noch übersetzen zu müs-sen. Dass es sich in den meisten Fällen um die erste Übersetzung überhaupt handelt, ist ein weiteres Argument für sein Verfahren. Dass die enge Übersetzung mitunter den Witz an die Kette legt, werden ihm jugendliche Leser, denen es an ästhetischem Empfinden oft gebricht, nachsehen. Da ich regelrechte Fehler nicht gefunden habe, vermerke ich wenigstens drei Zweifelsfälle.
1. Marner (III), v. 1f.: “Mancher erzählt Sachen über Rom, die er nie gesehen hat.” Roma ist Femininum; der Witz liegt nicht in den “Sachen über Rom”, sondern im Umstand, dass man Rom nicht gesehen hat und trotzdem darüber redet. Daher wohl: “Mancher erzählt Dinge über Rom, das er nie gesehen hat.”2. ‘Wachtelmäre’ (VII), v. 10f.: “Butter aus Latwerge / spann er viele Tage.” Der mhd. Text bietet puttern auz twerg. Die eingebürgerte Übersetzung von twerg mit “Latwerge” überzeugt nicht. Bereits das Deutsche Wörterbuch wusste es – unter Angabe des ‘Wachtelmäres’ – besser: “zwerg, m., kleingeformter sauermilchkäse, dasselbe wie zwarg” (DWB XVI, Sp. 1098). Die ein wenig gesuchten Ausführungen, mit denen (Studierenden) das Wesen der Latwerge erklärt wird, sind daher entbehrlich (vgl. S. 133).3. ‘Finkenritter’ (XV), Z. 13f. und Z. 344f.: Gegeneinander stehen des Großmechtigen Fürsten / Morotathorum und mein [...] ampt der pflegerey in Morothaten. BRunneR übersetzt Z. 345 wohl zutreffend “zu Morothaten”; Z. 15 hingegen belässt er “des großmächtigen Fürsten Moro tathorum”. Ich halte die Form für einen Genitiv Plural: “[Fürst] der Morotathen / Moro-tarier”. BRunneRs Einschätzung, es handele sich “vermutlich [...] auch hier um ein Versehen” (S. 140) des Druckers, möchte ich mich nicht bedenkenlos anschließen. Auch halte ich die “Morothaten / Morotarier” nicht für eine krause Kreuzung der “Mohren mit den Tataren [...], die freilich sonst nichts miteinander zu tun haben” (S. 140). In einem Text, der um 1560 in Straßburg erscheint und sogar explizit auf das Königreich Narragonien (Z. 48) verweist, ist doch bei den Moro tariern eher an ein “Land der Toren”, eine “Narrenherrschaft” zu denken.
Damit bin ich bereits bei den Anmerkungen. Sie sind in der Regel knapp gehalten. Wort-erklärungen werden allenfalls dort gegeben, wo lexeR nicht hinreicht (etwa zu VII, v. 140, 159; X, v. 18, 20; XV, 299 usw.). Bei einigen Hapaxlegomena führt BRunneR anschaulich vor, wie die artistischen Wortspiele aufgelöst werden könnten (etwa VII, v. 165f.; XV, Z. 47, 237, 299). Im Kern gibt BRunneR griffige Sachinformationen, die landeshisto-rische, christliche oder sonstige realienkundliche Hintergründe aufschlüsseln. Alles ist
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
139Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
mit Kennerschaft auf den Punkt gebracht. Knapper und präziser als die Erörterung der Währungen, die BRunneR zum ‘Schlauraffenland’ des Hans Sachs (XII, v. 65-77) gibt, geht es vermutlich kaum (S. 138). Nur ganz weniges sei erwähnt, insofern es vom Ein-deutigkeits- und Brevitas-Postulat der Kommentierung abweicht und damit gleichsam die Grenzen der Kommentierung von Lügendichtung markiert.
1. Kuglers ‘Windbeutel’ (IX) bringt das hübsche Bild vom Messerschmied, der gerade die Hälfte der Sterne vom Himmel gestochen hatte (v. 112-114), als ein alter Bierbrauer aus Schwabach vorbeikam, sie in seine Tasche sammelte und in seine Heimatstadt trug, wo er heute noch lebt (v. 116-119). Man kann hier natürlich mutmaßen, dass Kugler den Schwabachern eins auswischen wollte, obwohl außer der Nennung Schwabachs nichts Ungewöhnliches passiert: die ausgestochenen Sterne passen ja allem Anschein nach in das Taschenfach des Bierbrauers, der also nicht mal als einfältig enttarnt wird, weil sein Versuch fehlgeschlagen wäre. Die Konkretisierung auf Schwabach samt der Option einer Überprüfung ist Konsequenz aus der emphatischen Wahrheitsbeteuerung in v. 115. So geht BRunneRs Anmerkung: “Hier könnte auf eine reale Person aus dem Nürnberg benachbarten Schwabach angespielt sein” (S. 135) wohl über den Text hinaus ins Leere.2. Eine weitere Anspielung vermutet BRunneR am Schluss des ‘Windbeutels’, wo der Verfasser auf ein in disem hauß verweist, der wol kunt lugen und possen machen / und sollt ein haus vor ligen crachen (v. 142-144): “könnte sich auf eine anwesende Person beziehen” (S. 135). Ich kann dem nur beipflichten. Könnte Kugler etwa auf sich selbst verweisen?3. Am Schluss der ‘Geschichte vom Backofen’ (VIII) finden sich acht Verse, mit denen der Verfasser sich und seinen Zuhörern die Aufnahme in den Himmel, das ewige Leben und den Beistand der Gottesmutter wünscht (v. 127-134). Die Verse schließen direkt an die Kunde vom exzessiven höfischen Treiben an, das in dise lant (v. 125) gekommen war. BRunneR findet, dass der geistliche Schluss “kaum anders denn als Parodie auf ernstgemeinte Schlüsse dieser Art zu verstehen” sei (S. 134). Ich störe mich am Parodie-Begriff. Nicht der fromme Wunsch wird parodiert. Er wird nur einem Text angehängt, zu dem er nicht zu passen scheint. Indes finden sich solche Segenswünsche, “an extremely common feature of closure”, auch unter dem ‘Wigamur’, dem ‘Wigelis’ oder dem ‘Wiener Oswald’.5
An Hinweisen wie diesen dürfte, gerade weil sie so partikular sind, mehreres ablesbar sein. Zum einen hat eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Einzeltexten erst in Ansätzen stattgefunden. Sie scheint mir bei einem Corpus, in dem sich Autoren wie Reinmar, der Marner, Muskatblut oder Beheim wiederfinden, geboten. Sie scheint mir zudem geboten angesichts der Tatsache, dass es zumindest für einige wenige Texte sehr differenzierte Lektüren gibt, die in eine andere als die von BRunneR und keRth eingeschlagene Richtung weisen.6 Denn das Problem betrifft nicht nur die Noten; es be-trifft vielmehr die Vorzeichen. Ob Ironie vorliegt, ob Parodie oder Satire, was überhaupt
5 nigel f. palmeR, Manuscripts for Reading. The Material Evidence for the Use of Manuscripts Containing Middle High German Narrative Verse, in: Orality and Literacy in the Middle Ages. Essays on a Conjunction and its Consequences in Honour of D. H. Greeen, hg. von maRk ChinCa und ChRistopheR young (Utrecht Studies in Medieval Literacy 12), Turnhout 2005, S. 67-102, hier S. 71.
6 Vgl. etwa thomas CRameR, Von einem, der auszog, die Welt kaputtzulachen: der Finckenritter, in: Komische Gegenwelten. Lachen und Literatur in Mittelalter und Früher Neuzeit, hg. von WeRneR RöCke und helga neumann, Paderborn u.a. 1999, S. 283-299; kaRina kelleRmann, ach musgapluot / wie seer hastu gelogen! Lügendichtung als Zeitkritik, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 52 (2005), S. 334-346.
Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015
140 Rezensionen
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 144 • Heft 1 • 2015 – © S. Hirzel Verlag, Stuttgart
unter Ironie zu verstehen ist, was parodiert wird, worauf die Satire zielt, und generell: welche Gattungskonventionen gelten, wie sie gehandhabt werden und wie mit ihnen gespielt wird – das alles ist noch ganz unklar. Wenn wir ein Stück wie den ‘Finkenritter’ als “skurril-grotesken Unsinnstext ohne didaktische oder satirische Absichten” (S. 140) buchen, unterschätzen wir womöglich (auch hier!) das komplexe 16. Jh.7 Ich gebe zu, dass ich vor diesem Hintergrund weiter zögere, eine etablierte Bezeichnung wie “Lügen-dichtung” gegen eine neuere wie “Unsinnsdichtung” einzutauschen. Dass wir die Texte längst noch nicht gut genug kennen, vermag auch sie nicht zu verbergen. Aber sie birgt die Gefahr, die Tür direkt vor den Texten zuzuschlagen. Das Nachwort (S. 143-163) trägt somit eine Reihe von Bürden, doch es trägt sie souverän. Sehr hilfreich sind die thematischen Bündelungen wesentlicher Motive, die BRunneR vornimmt (a: “Überlegenheit Schwacher über Starke”, b: “Gestalten oder Sachen aus völlig unpassenden Materialien”, c: “Leistungen und Handlungen, die jeder Realitätserfahrung spotten”) sowie die souveräne Ordnung der Darstellung innerhalb des Referenzsystems der literarischen Typen (S. 149-162). Gleich eingangs bemüht sich BRunneR um eine (auch in der Diktion) an hanns fisCheRs kanonisches Diktum angelehnte, bündige Definition seiner Texte, “die ausschließlich oder wenigstens über-wiegend zweck- und tendenzfrei unterschiedlich anspruchsvoll dem Vergnügen der Hörer und Leser dienen sollen. Sie verweigern sich konsequent jeglichem tieferen Sinn und jeder gültigen Logik, sind auf oft überraschende Weise komisch oder witzig und wollen damit zum Lachen reizen” (S. 143).8 Unter den vielen Verdiensten, die sich der Herausgeber mit der hier vorgelegten Anthologie zuschreiben darf, wäre es nicht das geringste, wenn das Büchlein nachwachsende Generationen dazu ertüchtigte, sich in 15, 20 Jahren einvernehmlich von einer solchen Definition zu verabschieden. Bis dahin möge sie ein Pfahl im Filet der Texte und ein Dorn im Auge der Forschung bleiben.
Prof. Dr. Christoph Fasbender, Technische Universität Chemnitz, Institut für Germanistik und Kommunikation, Thüringer Weg 11, D–09107 ChemnitzE-Mail: [email protected]
7 Der Forschungsstand zum ‘Finkenritter’ jetzt bei aRmin sChulz, Der Finkenritter, in: VL Frühe Neuzeit 2 (2012), Sp. 354-358.
8 Es ist sicher richtig, dass der (übergeordnete) Diskurs der Forschung auf “fortwährende Sinn-suche” zielt und “unterhaltsame Momente” der mittelalterlichen Literatur “zu kurz” kommen “oder gar nicht beachtet” werden (S. 162). Von einer fachgeschichtlichen Unter suchung, die insbesondere die Erforschung der Lügendichtung im frühen 19. Jh. (und ggf. die französischen Surrealisten um 1900) in den Blick nähme, erwarte ich für diese Einschätzung einige Impulse.