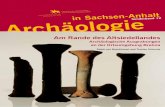Archäologische Voruntersuchung in der Karlskirche, Wien 4
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Archäologische Voruntersuchung in der Karlskirche, Wien 4
2
Von 7. bis 9. Februar 2011 fand eine archäologische Voruntersuchung in der Wiener
Karlskirche (erbaut 1714-1739) statt. Im Auftrag des Bundesdenkmalamts, Abt. für
Bodendenkmalpflege, betreute der Verfasser einen Suchschnitt im Bereich des
Triumphbogens und überwachte Bohrproben im Fußboden- und Wandbereich der Krypta.
Zusätzlich wurde eine bauarchäologische Untersuchung der Krypta durchgeführt. Am 23.
Februar wurde dann auch eine Bodenöffnung im Erdgeschoss des östlichen Treppenturms
dokumentiert. Nach dem Abschluss der Arbeiten vor Ort wurden ein historischer
Vermessungsplan digitalisiert und die Ergebnisse in graphischer Form zusammengefasst (vgl.
Anhang).
Die Krypta der Wiener Karlskirche wurde nie für Bestattungen verwendet. Sie wird durch
eine Falltür unmittelbar vor den Stufen zum Chorraum erschlossen, die sich zu einer 4,5 m
langen Steintreppe öffnet. Am Ende des angeschlossenen 5,5 m langen Gangs befindet sich
der Hauptraum, ein Rechteck mit gerundeten Enden, das 9,25 x 5,7 m misst und eine Fläche
von ca. 41 m² besitzt. Im südlichen Teil dieses Raums (die Kirche ist nach Süd-Südosten
orientiert) – hier befinden sich massive Stützfundamente – öffnen sich Bögen nach Osten und
Westen, um weitere kleine, längsrechteckige Räume (ca. 14 bzw. ca. 11 m²) zu erschließen.
Während die Krypta im Osten nicht weiter zieht, öffnet sich der westliche Raum in einen fast
quadratischen Raum (ca. 6,2 x 6 m) mit fast 40 m² Grundfläche, der sich unter dem
westlichen Treppenturm befindet. Das Treppenhaus wird hier durch vier quadratische
Ziegelpfeiler unterstützt. Die Krypta ist durchgehend mit Tonnengewölben überspannt.
Suchschnitt
Um den Bodenaufbau an jenem Standort zu untersuchen, an dem eine neue Erschließung der
Krypta angedacht war, wurde ein bodenarchäologischer Suchschnitt im westlichen
Triumphbogenbereich angelegt. Der Schnitt hatte die Maße 2,9 x 0,45-0,79 m (Grundfläche
1,6 m²) und lag in 30-35 cm Abstand zu einem Wandpfeiler und 2,5 bis 5 m vom derzeitigen
Abgang in die Krypta. Unter den nur 2 cm starken Marmorplatten des Fußbodens (SE 1)
wurden zuallererst mehrere Beton- und Isolierungsschichten (SE 3-7) bzw. das
Rollschotterfundament (SE 8) einer nach mündlicher Überlieferung rund 25 Jahre alten
Fußbodenheizung angetroffen (Abb. 1).
Erst in 30 bis 50 cm Tiefe kamen ältere Befunde zum Vorschein. Es handelte sich um eine 20-
25 cm breite Kanalwange (SE 10) auf der ein mehr als 30 cm breites flaches Tonnengewölbe
ruhte (SE 9). Wange und Gewölbe bestehen aus gewöhnlichen Mauer- (27-28 cm Länge, 13,5
D2126
3
cm Breite) und aber auch so genannten Gewölbeziegeln (24 cm Länge, 7 cm Höhe). Der
dazugehörige Mörtel ist hellgrau, fein, meist fest und mit Rollsteinen und Kalkfragmenten
durchsetzt (bis 1 cm groß). Der Kanal schneidet (IF 12) ein eher lockeres, mittelbraunes
sandiges Planiermaterial (SE 11), das wiederum gegen das nur 15-20 cm vorspringende
Fundament des Wandpfeilers – sichtbar durch eine Unterhüllung des Profils – läuft. Die
Oberkante des Gewölbes fällt vom Westen nach Osten ab, also in Richtung Krypta (Abb. 2).
Abb. 1: Kirchenraum, Suchschnitt. Beton- und Isolierschichten der 1980er Jahre.
Abb. 2: Kirchenraum, Suchschnitt. Überblick mit Lüftungskanal, der auf die Krypta ausgerichtet ist (oben).
Ein Blick auf die Westseite des Abgangs in die Krypta erklärt diesen Befund. Der Kanal ist
offenbar die Fortsetzung eines primären, also hochbarocken Lüftungskanals, der in die
Treppenwand der Krypta mündet (Abb. 3). Der Anfang des Kanals ist unbekannt. Eine neue
Erschließung an der beprobten Stelle hätte also die komplette Zerstörung dieses barocken
Bauteils und in weiterer Folge des ursprünglichen Abgangs zur Folge.
Abb. 3: Krypta, Abgang. Lüftungskanal mündet in die Westwand.
D2127
4
Bohrproben in der Krypta
Der gesamte Boden der Krypta ist von einer starken Betonschicht überlagert, die zu einem
unbekannten Zeitpunkt im mittleren oder späteren 20. Jahrhundert eingezogen worden ist. Im
Auftrag der Kirchenleitung wurde an drei Stellen im Hauptraum und Ostraum der Krypta der
Betonboden mit einem 30 cm breiten Bohrer geöffnet. Im Ostraum wurde eine Betonstärke
von rund 30 cm Stärke ermittelt. Unter dem Beton lagen in dieser Tiefe zwei Lagen von
Ziegel, wohl der ältere Boden der Krypta, die wiederum auf brauner, toniger Erde lagen. Im
Hauptraum jedoch zeigte sich an zwei Stellen eine erstaunliche Betonstärke von 95 bzw. 113
cm. Darunter lag der wohl anstehende Schotter (Abb. 4). Der Grund für diese aufwändige
Betonierung ist derzeit unklar.
Abb. 4: Krypta, Hauptraum. Schotter an der Sohle eines Bohrlochs.
Abb. 5: Krypta, Ostraum. Mauerziegel mit dem erhabenen Zeichen ‚G M’ = Graf Mollard 1687-1800.
In der Ostwand des Ostraums der Krypta wurde weiters von einem Bauarbeiter ein Loch
geöffnet, das von seiner Unterkante 28 cm über dem Betonboden 1,09 m hoch und von der
Nordostecke des Raums aus 0,74 m breit war. Die Ostwand, ein reines Ziegelmauerwerk,
zeigte sich in diesem Loch 62-75 cm stark. Sie läuft zwar in der Ecke gegen die Nordwand, da
aber jene Wand nach nur 10 cm ausläuft – das heißt ein gemauertes Eck fehlt vollständig –
gehört sie zur selben Bauphase. Das Gewicht der Tonne liegt ausschließlich auf den
Längswänden. Mehrere Mauerziegel der Wand trugen die hochgestellten, erhabenen
Buchstaben ‚G (dieser Buchstabe spiegelverkehrt) M’ (Abb. 5). Dieses Ziegelzeichen
entstammt der Ziegelei des Grafen Mollard im heutigen 6. Bezirk, die von 1687 bis 1800 in
Betrieb war1. Für den Bau der Karlskirche (1714-1739) wurde zwar ein eigener Ziegelofen an
1 Bestimmung durch Dr. Gerhard Zsutty, Wiener Ziegelmuseum.
D2128
5
Ort und Stelle errichtet2, eine damals nicht unübliche Vorgehensweise bei Großprojekten,
doch wie bereits Alois Kieslinger herausgefunden hat, mussten trotzdem Ziegel anderer
Herkunft angekauft werden3. Dass die Mollard’sche Ziegelei ebenfalls die Kirche beliefert
hatte, war aber bislang unbekannt.
Abb. 6: Krypta, Ostraum. Sondage in der Ostwand mit Blick auf das Fundament der östlichen Wendeltreppe.
Hinter der Ostmauer wurde ein lössähnlicher, aber etwas dunkler als in Wien gewöhnlicher,
anstehender Erdboden durchstoßen. In 1,19 bis 1,32 m Entfernung von der Innenkante der
Wand wurde hinter dieser Schicht ein gekurvtes Ziegelfundament, bestehend aus
Mauerziegelbruchstücken und weißem kalkigem Mörtel, angetroffen (Abb. 6). Es handelt sich
offenbar um das Fundament der großen Wendeltreppe im östlichen Treppenturm. Die
Existenz dieses Fundaments erklärt, warum der Lüftungskanal, der sich in der Wand oberhalb
des Suchlochs befindet, scharf nach links (Norden) biegt, anstatt direkt zu seiner Öffnung in
der Ostfassade des Ostturms zu führen. Die Unterkante des Treppenfundaments liegt bereits
90 cm über dem heutigen Kellerboden, ein Detail, das zur Bauzeit unbedenklich war, das aber
heute bei etwaigen Umbauten möglicherweise zu einem Problem führen könnte (vgl. unten).
Der derzeitige Betonboden lässt sich nicht ohne weiteres datieren: Es fällt jedoch auf, dass das
Jahr 1969 an mehreren Stellen in der Krypta an den Wänden geschrieben steht.
2 Gerhard Zsutty, Wiener Ziegelöfen: Wieden, Wiener Ziegelmuseum 13/14, 1996, 280f. 3 Alois Kieslinger, Die Bausteine der Karlskirche in Wien, Kirchenkunst. Österreichische Zeitschrift für Pflege religiöser Kunst IX, 1937, 79-86, s. 81.
D2129
6
Baugeschichte der Krypta (vgl. Anhang)
Bereits während einer kurzen Begehung der Krypta fallen zahlreiche Unregelmäßigkeiten im
Baubestand auf, die darauf hindeuten, dass die Krypta nicht in einem Zug angelegt worden ist.
Um die Baugeschichte zu klären, nahm der Verfasser eine fotografische Dokumentation des
Bestandes vor und untersuchte Mauerwerk und Mörtel. So konnten zwar an manchen Stellen
eindeutige Baufugen identifiziert werden, doch an anderen Stellen waren Mauerteile
miteinander verzahnt, die den Fugen nach eigentlich hätten getrennt sein sollen. Es stellte sich
darüber hinaus heraus, dass die verwendeten Ziegel (Mauerziegel des Formats 27,5-29 x 13-
14 x 5,5-7 cm) und Mörtel (eher fein, hellgräulich-weiß, Kiesel und Rollsteine bis 1 cm
Größe, Kalkfragmente) überall sehr ähnlich sind. Tatsächlich wird die Baugeschichte der
Krypta durch zwei zeitlich nahe zueinander liegende Bauabschnitte charakterisiert. Zum
ersten Bauabschnitt gehören die primäre Erschließung (Treppe und Gang), die nördliche
Hälfte des Hauptraums, das Fundament des Chorabschlusses im Süden, die beiden
längsrechteckigen, seitlichen Räume und ein kleinerer Teil des großen Kellers im Westen.
Zum zweiten Bauabschnitt gehören wiederum die südliche Hälfte des Hauptraums,
einschließlich der großen Stützpfeiler und der eher niedrigen Bögen zu den seitlichen
Räumen, sowie der eigentliche ‚Turmkeller’ im Westen.
Die primäre Erschließungssituation ist allem Anschein nach komplett erhalten. Dazu gehören
die Steinstufen und die Auflagefläche der Falltür, einschließlich zweier Verankerungslöcher
der Tür (Abb. 7). Treppe und Eingang gehen nahtlos in den Hauptraum über, der
Nordabschluss dieses Raums ist durch einen durchaus eleganten kuppelartigen Übergang zum
Gewölbe gekennzeichnet. Doch nach 4,35 m enden Mauerwerk und Gewölbe des ersten
Abschnitts abrupt – Fehlstellen von Ziegeln in der Seitenansichtsfläche der Tonne (Abb. 8)
beweisen, dass diese ursprünglich weiter nach Süden führen sollte. Stattdessen wurde mit
Hilfe von ca. 1 m breiten und niedrigen Ziegelbögen (heutige Scheitelhöhe im Osten nur 1,53
m), die eher grob an den älteren Seitenwänden anschließen, ein um 90 cm höheres
Tonnengewölbe eingebracht. Dieses Gewölbe wird auch durch zwei große Pfeiler unterstützt
(1,33 x 1,14 bzw. 1,2 x 1,07 m), die zwar zuletzt eingezogen worden sind, aber zur selben
Phase gehören (vgl. Titelseite). Beide Pfeiler bestehen aus Ziegeln, verwenden aber im
unteren Bereich auch Bruchsteine und verschiedene Architekturspolien. So finden sich im
linken, östlichen Pfeiler, neben einem Stein mit einem 5,7 cm hohen Steinmetzzeichen (Abb.
D2130
7
9), zwei identische 76-80 x 42 x 43 cm große Voluten, die ursprünglich eine repräsentative
barocke Fassade geschmückt haben oder hätten sollen (Abb. 10).
Abb. 7: Krypta, Abgang. Verankerungslöcher einer früheren Falltür.
Abb. 9: Krypta, Hauptraum. Steinmetzzeichen am östlichen Stützpfeiler.
Abb. 8: Krypta, Hauptraum. Blick nach Norden mit Ansätzen für die Fortsetzung des Tonnengewölbes.
Abb. 10: Krypta, Hauptraum. Architekturspolien (Voluten) im östlichen Stützpfeiler.
In dem schmalen Raum hinter den Pfeilern, also südlich von ihnen, ist der älteste Bauteil das
runde Fundament des Chorabschlusses. Dieses besteht bis in einer Höhe von 2,8 cm über dem
heutigen Boden aus unregelmäßigem Mischmauerwerk (Bruchsteine bis 30 cm Seitenlänge),
an dem Löss bzw. Sand haftet. Das heißt, dieses Mauerwerk wurde als Fundament gegen eine
Baugrube errichtet und erst im Nachhinein freigelegt. Die seitlichen Ost- und Westwände
kamen in einem zweiten Schritt dazu; sie bestehen ebenfalls aus unregelmäßigem
Mischmauerwerk (Bruchsteine bis 42 cm Seitenlänge, mehr Ziegel als Stein), das gegen ein
Erdprofil gebaut wurde (bis 2,0-2,8 m Höhe). Als letzte Maßnahme wurden die Pfeiler
eingesetzt, diese schließen an die Seitenwände unten mit deutlichen Fugen, sind im oberen
Teil mit diesen jedoch verzahnt und zeigen im unteren Teil (bis 1,7-2,95 m Höhe) ebenfalls
die Spuren einer ehemaligen Erdverankerung. In den östlichen, südlichen und westlichen
oberen Wandteilen dieses Raums deuten bis zu 15-25 cm tiefe und 40 cm lange Aussparungen
bzw. Vorsprünge im Mauerwerk vielleicht auf die Nutzung von Hölzer während des Baus
dieses im Grundriss ungewöhnlichen Bereichs. Die Fugen und unterschiedlichen Mörtel
D2131
8
lassen annehmen, dass das Chorfundament als erstes eingesetzt wurde, die anderen Wände
bzw. die Pfeiler jedoch erst in einem zweiten Schritt, während zu guter Letzt die restliche
Erde entfernt worden ist.
Dass die längsrechteckigen Seitenräume, deren Wände an den Längsseiten aus
Mischmauerwerk bestehen, zu dem älteren Abschnitt gehören, sieht man nicht nur an einer
deutlichen Baufuge zwischen dem westlichen Raum und dem westlichen Ziegelbogen,
sondern auch an der Erde, die an den Enden beider Nordwände dieser Räumen in den Nähten
zu den Bögen und unter dem Verputz zu finden ist. Diese Mauerteile sollten in der
ursprünglichen Planung offenbar an den Hauptraum in einem rechten Winkel anschließen,
aber das Einbringen der Stützpfeiler führte zur Versetzung der verbindenden Öffnungen nach
Norden, womit Mauerflächen, die Anfangs im Erdreich lagen, frei gegraben und verputzt
werden mussten.
Abb. 11: Krypta, Keller unter westlichem Treppenturm. Abgebrochenes Gewölbe an der Ostwand.
Im Kellerraum unter dem westlichen Treppenturm ist der ältere Bauabschnitt durch wenige
Hinweise nachvollziehbar. Dazu gehören, erstens, das massive Verputzen (Flickung) des
Gewölbes des westlichen längsrechteckigen Raums an jener Stelle, wo das Gewölbe in der
Ostwand des Kellers zu sehen ist und, zweitens, an den Nord- und Südwände des Kellers,
verzahnte, 19-37 cm vorspringenden Mauerteile, die an ihren Oberkanten schräg
abgeschlossen sind und möglicherweise Teil der Auflagefläche eines Gewölbes bilden sollten.
An der Ostwand finden sich, drittens, in einem leicht vorwölbenden Wandteil bei 1,5-1,9 m
D2132
9
Höhe einige schräg vermauerte Ziegel, die nachträglich und in situ abgeschlagen worden sind
(Abb. 11). Hier wurde also ein begonnenes Gewölbe am Ansatz wieder abgebrochen. Ein
wesentlicher höherer Raum wurde stattdessen anstelle des ursprünglich geplanten Kellers
gebaut. Das Ziegelmauerwerk der Pfeiler enthält, wie auch die Stützpfeiler im Hauptraum,
nicht nur Mauerziegel, sondern auch den damals (im frühen 18. Jahrhundert) bereits eher
antiquierten, so genannten Fortifikationsziegel, d.h. Ziegel von ungewöhnlicher Länge (bis zu
33-34 cm), die wohl zur Stabilisierung der Architektur beitragen sollten. Im Nordwesten des
Raums befindet sich oberhalb 1,85 m Höhe eine 70 cm breite, primäre, aber nun vermauerte
Öffnung, vielleicht ein Transportschacht.
Die Krypta hätte also Anfangs einen T-förmigen Grundriss mit leichter Rundung im
Chorabschlussbereich haben sollen, doch nach einer Planänderung wurde sie mit massiven
Pfeilerfundamenten im Süden und Westen ausgeführt, die mit erheblichen höheren Gewölben
einhergingen. Der bereits im Bau befindende Keller im Westen wurde neu errichtet. Diese
Änderungen fanden mit hoher Wahrscheinlichkeit ab 1722 statt, als Johann Bernhard Fischer
von Erlach erkrankte (†1723). Sein Sohn Johann Emanuel wurde mit der Fortsetzung des
Baus beauftragt und setzte eine Planänderung durch, die laut Dehio eine steilere Kuppel, die
Ostpartie und den Hochaltar betraf4. Das ist der Grund für die baulichen Maßnahmen des
zweiten Kryptaabschnitts, denn die neuen Pfeiler befinden sich unter dem westlichen
Treppenhaus und unter bzw. neben dem Hochaltar. Die Gewölbe sind höher weil, die Pfeiler
direkt an der Unterkante der oberen Bauteile anschließen mussten. Gleichzeitig erklärt eine
Planänderung während der laufenden Baustelle das Beibehalten der Bautechnik und Baustoffe
der Krypta. Warum auf einen Raum unter dem östlichen Treppenturm von Anfang an
verzichtet worden ist, bleibt unklar. Jedenfalls hat die historische Bauforschung durch die
Aufnahme der Krypta neue Daten zur Baugeschichte der Karlskirche beisteuern können.
Bodenöffnung im Ostturm
In Kalenderwoche 8 wurde ohne archäologische Aufsicht ein Suchloch von 1,9 x 1,4 m und
bis zu 1,7 m Tiefe (Gesamtvolumen ca. 5 m³) im Erdgeschoss des östlichen Treppenturms
ausgegraben, um den Bodenbefund in Vorfeld einer auch an dieser Stelle angedachten
Neuerschließung der Krypta zu erheben. Am 23. 2. konnte der Verfasser den Befund
dokumentieren. Wegen der Kurvatur des Bereichs – das Loch befindet sich direkt unter der
4 Bundesdenkmalamt (Hg.), Dehio-Handbuch: Wien II. bis IX. und XX. Bezirk, Wien 1993, 145.
D2133
10
Wendeltreppe, wo die Unterkante der Treppe ausläuft – und dem Fehlen jeglicher
Vermessung an dieser Stelle musste auf eine Planzeichnung verzichtet werden.
Der historische Ziegelboden wurde in neuerer Zeit, wahrscheinlich zum Zeitpunkt des
Einbaus der Bodenheizung in der Kirche (vgl. oben) neu ausgelegt. Darauf deuten ein
passendes Kabel und die verschiedenen Betonschichten seines Bodenunterbaus. Die Ziegel
sind gewöhnliche Mauerziegel, darunter sind einige mit dem erhabenen Ziegelzeichen ‚G M’
(vgl. oben). Unter dem Boden befindet sich eine Feinabfolge barocker Schuttschichten. In 1,7
m Tiefe liegt eine dunkle lehmige Schicht, die zwar fest, aber noch nicht der gewachsene
Boden ist.
Abb. 12: Östlicher Treppenturm, Bodenöffnung. Jüngerer Lüftungskanal liegt (von links oben nach unten) auf einem älteren (von links nach rechts).
Die Wände des Raums, also das Fundament des Treppenhauses, sind an dieser Stelle aus
Mauerziegeln (27,5-29 x 13,5-14 x 6,5-7 cm, also des in der Karlskirche üblichen Formats)
mit gräulichweißem, feinem Mörtel. In 0,85-0,95 m Tiefe trifft man auf jenen gewölbten
Lüftungskanal, der in der Krypta in die Ostwand des östlichen Raums mündet. Er dreht sich
an dieser Stelle von seinem Anfangspunkt an der Außenwand 90° nach Norden, um das runde
D2134
11
Treppenfundament zu umgehen (Abb. 12). Ganz unerwartet war die Entdeckung eines älteren
Ost-West ausgerichteten Ziegelkanals, auf dem der jüngere Kanal in 1,65 m Tiefe ruht. Mit
30-31 cm lichter Breite wurde er vom Treppenfundament abgeschnitten. Man baute den ersten
Kanal offensichtlich ohne Rücksicht auf das später eingesetzte Treppenhausfundament, so
dass auch der heutige Lüftungskanal das Ergebnis einer kleinen Planänderung ist. Von der
südöstlichen Ecke des Suchlochs ausgehend hatten die für das Suchloch eingesetzten Arbeiter
das innere Eck des Turms in Tunnelbauweise freigelegt. Hier fußt die runde Wand des
Treppenhauses mit der Hilfe eines breiten Bogenfundaments auf dem Rechteck des Gebäudes,
das aus statischen Gründen viele Fortifikationsziegel verwendet (34 cm Länge).
Fazit
Gegen die Absenkung des Bodenniveaus in der Krypta um ca. 30 cm besteht aus
denkmalpflegerischer Sicht kein Einwand, denn diese Maßnahme würde eine
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes bedeuten. Beide bislang angedachte
Neuerschließungen würden jedoch zu schwerwiegenden Eingriffen – Mauerdurchbrüchen,
Abbruch von primären Lüftungskanälen – in der Substanz führen. Besonders schmerzvoll
wäre auch die Zerstörung der gut erhaltenen ursprünglichen Erschließungssituation.
Alle hier zusammengefassten Maßnahmen, aber insbesondere die bauarchäologische
Aufnahme der Krypta, die Licht auf die Planänderung von 1722/23 geworfen hat, haben zu
neuen Erkenntnisse für die Baugeschichte der Karlskirche geführt.
D2135