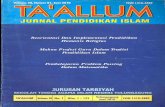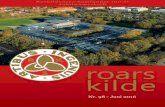fsz - Wien Juni 2013, S. 30-33.
-
Upload
uni-bayreuth -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of fsz - Wien Juni 2013, S. 30-33.
frauensolidarität 125
! 6.– 3/13
MIGRATION – ARBEIT – ASYLSimbabwe, Armenien, Mexiko, Bangladesch,Dominikanische Republik, Malawi, China
Literatur – Liebe – MusikPeggy Piesche, Yari Yari Literaturkonferenz (Accra),Difficult Love, Fortpflanzungsindustrie, Celia Mara
Entg
eltli
che
Eins
chal
tung
Wir helfen weiter! !"Rechts- und Sozialberatung mit den Schwerpunkten Ehe- und Familienrecht, Unterhalt
!"Drehscheibe zu Wiener Beratungs- und Betreuungsangeboten
24 Stunden Soforthilfe !"Für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren
!"Bei sexueller, körperlicher und psychischer Gewalterfahrung
!"Telefonische, persönliche, E-Mail-Beratung
Frauensolidarität 3/2013
3EDITORIAL / INHALT //
Migration – Arbeit – Asyl, diese Bereiche waren in Österreich, Deutschland und der Schweiz
immer wieder Thema in den letzten Monaten. Rassistische Erlassungen in der Schweiz, wo Flüchtlingen der Be-such von Freibädern untersagt wurde, oder die kruden Abschiebepraxen in Österreich und Deutschland führten dazu, dass Flüchtlinge immer wieder ihre Rechte einfordern mussten. In die-sem Heft blicken die Autorinnen auf die Zusammenhänge zwischen Migration, Arbeit und Asyl - z.B. in Malawi, Sim-babwe oder der Dominikanischen Re-publik. Doch auch die Asylpolitik in Ös-terreich und Deutschland ist Thema. So berichtet etwa Leticia Hillenbrand von der Frauenflüchtlingskonferenz, die im April 2013 in Hamburg stattfand, und Irene Messinger, Petra Pint und Steve Mayer werfen einen kritischer Blick auf das neue österreichische Staatsbürger-schaftsgesetz. Des Weiteren beschrei-ben Cristiana Luis Francisca und Sirana Dolis, beide Gründungsmitglieder von MUDHA, die schwierigen Lebensbe-dingungen von dominiko-haitianischen Frauen ohne Papiere in der Domini-kanischen Republik und Stefanie Kron anaysiert die Bedeutung der coyota-je (Transmigration der Männer in die USA) für mexikanische Frauen.
Außerhalb des Schwerpunkts stehen diesmal Literatur, Liebe und Musik im Fokus. Die langjährige Autorin der Frauensolidarität Ishraga M. Hamid be-richtet von der spannenden Literatur-konferenz Yari Yari in Ghana, wo sie u.a. Angela Davis traf. Johanna Treindl be-spricht Zanele Muholis Film „Difficult Love“ und Silvia Jura stellt die in Wien lebende brasilianische Musikerin Celia Mara vor.
In der nächsten Ausgabe, welche im Dezember 2013 erscheinen wird, wer-den wir uns den Themen Liebe und Lust widmen und ihrer Bedeutung für die Entwicklungszusammenarbeit.
Wir wünschen viel Vergnügenbeim Lesen!
Das Redaktionsteam derFrauensolidarität
04 Magazin, Impressum06 Veranstaltungsankündigungen07 „Bar neko ovde samnom pri"a moj jezik” – Unter die Haut
Migration – Arbeit – Asyl08 Women’s Rights: Vienna+20 and beyond Claims on work and migration!
10 Unsere Stimmen nach außen bringen Die Frauenflüchtlingskonferenz in Hamburg
12 Gender in der Lebensplanung junger Krankenpfleger_innen aus Malawi … und was das mit Migration zu tun hat
14 Situacion de indocumentacion de la mujer Haitiana y sus decendientes en la Republica Dominicana15 Die Situation haitianischer Migrantinnen und ihrer Nachfahren in der Dominikanischen Republik
16 Textilfabriken in Bangladesch – eine Endlosschleife aus Ausbeutung, Katastrophe und Entsetzen?
18 Jes uzum em ais teriz heranam – Ich will hier weg Warum ein Großteil der armenischen Frauen ihr Glück m Ausland sieht
20 „(No) Papers for all“ Ein feministischer, kritischer Blick auf das neue Staatsbürgerschaftsgesetz
22 San Pedro Soloma: Gender und Citizenship in der transnationalen Migration Die transnationale Familie, die „weiße Witwe“ und die Politisierung der Mutterschaft
24 Chinas Wanderarbeiterinnen 2013 Kurze Geschichte einer Frauenmehrheit
26 Zuflucht in Südafrika? Probleme politisch verfolgter Frauen und Migrantinnen aus Simbabwe
28 Ungleiche Reproduktion – reproduzierte Ungleichheit Entwicklungen und Perspektiven transnationaler Fortpflanzungsindustrien
30 „Euer Schweigen schützt Euch nicht“ Interview mit Peggy Piesche
34 Literatur macht Schwarze Frauen sichtbar Bericht über die Yari- Yari- Literaturkonferenz in Accra, Ghana
36 Nicht besonders exotisch Célia Mara – die starke Stimme aus Brasilien
38 Die blinden Flecken des Regenbogens Über den Film „Difficult Love“ von Zanele Muholi und Peter Goldsmid
40 Frauenrechte sind Menschenrechte Rückblick und Vorausschau der Vienna+20-Konferenzen
42 Kommentar43 Rätsel44 Musik45 Bücher46 Bibliothek
EDITORIAL INHALT
Frauensolidarität 3/2013 Frauensolidarität 3/2013
4 5// MAGAZIN / IMPRESSUM
ISRAELIsha L’Isha – Das Haifa Feminist
Center wird 30! In Zusammenarbeit mit Frauen welt-weit hat das Haifa Feminist Center in den letzten Jahren viel erreicht. Die jüdische Philanthropin Barbara Dob-kin bringt es in ihren Glückwünschen auf den Punkt: „You have been the leaders for women in Israel since the organization’s inception and that you continue to incubate, to raise issues, to beat the drums after all this time is exemplary.“ Besonders hervorzuhe-ben ist die Funktion von Isha L’Isha als Mentorin und Initiatorin unabhängiger Non-Profit-Organisationen, wie die Hotline für misshandelte Frauen, so-wie die Notunterkunft für diese Frau-en, die ein Modell für Frauenhäuser in ganz Israel geworden ist, das Kayan Feminist Center für palästinensische Bürger_innen in Israel oder die Eco-nomic Empowerment of Women – die Schaffung und Erhaltung eines Rau-mes, in dem Frauen zusammenkom-men, teilen, lernen, diskutieren und arbeiten können.www.isha.org.il/eng
ÖSTERREICHWeniger Geld fürGewaltprävention
Die Anzeigen gegen häusliche Ge-walt sind leicht zurückgegangen, da-für werden die Übergriffe zunehmend brutaler, berichten Mitarbeiterinnen aus Frauenhäusern. 95 % der Täter sind männlich. Die finanzielle Unter-stützung für Antigewalttrainings wird sukzessive zurückgefahren, wie eine parlamentarische Anfrage zeigt.Laut Maria Rösslhumer, Geschäftsfüh-rerin des Vereins Autonome Österrei-chische Frauenhäuser (AÖF), nehmen die Fälle schwerer häuslicher Gewalt massiv zu. Die Kriminalstatistik für das erste Halbjahr 2013 weist zwar einen Rückgang von 5 % bei den Anzeigen aus. „Doch die Täter werden immer hemmungsloser, immer brutaler“, sagt Rösslhumer. Menschen, deren Gewaltbereitschaft wie im oben ge-nannten Beispiel gemeldet wird, soll-ten zu Antiaggressionstrainings ver-
pflichtet werden, fordert Rösslhumer.Doch die Finanzierung von Antige-waltschulungen steht auf unsiche-ren Beinen: Wurden 2011 in Summe noch 166.646 Euro an alle Einrichtun-gen ausbezahlt, die solche Trainings anbieten, waren es 2012 nur noch 129.012 Euro. Wie aus der Anfrage-beantwortung hervorgeht, hat das Innenministerium unter Ministerin Jo-hanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Vorjahr die Unterstützung sogar komplett ein-gestellt. Auch 2013 wurden „bis dato keine Förderungen vergeben“.www.derstandard.at
AFGHANISTANRamon-Magsaysay-Preis für
Afghanistans einzige Gouverneurin Die erste und einzige Gouverneurin Af-ghanistans, Habiba Sarabi, will ihre Pro-vinz zum Vorbild für andere machen. Habiba Sarabi hat das scheinbar Un-mögliche geschafft: Seit acht Jahren steht sie als einzige Frau einer afghani-schen Provinz vor - trotz vieler Wider-stände der männerdominierten Ge-sellschaft des Landes am Hindukusch. In diesem Umfeld sei es ihr sogar ge-lungen, die Situation der Frauen deut-lich zu verbessern - so die Begründung der Jury, die Sarabi mit dem Ramon Magsaysay Preis würdigte. Habiba Sarabi erkämpft sich ihre Chance. In der Hauptstadt Kabul stu-diert sie Pharmazie und übernimmt anschließend einen Lehrauftrag an der Universität. Als 1996 die Taliban die Herrschaft über Afghanistan über-nehmen, flieht sie nach Pakistan und setzt sich dort für Bildung, Frauen-rechte und medizinische Versorgung in Flüchtlingscamps ein. Nach dem Fall des Taliban-Regimes 2001 kehrt sie in ihre Heimat zurück. 2003 wird sie Ministerin im afghanischen Frauenmi-nisterium, bevor sie 2005 Gouverneu-rin der Provinz Bamiyan wird - als erste Frau in einer vergleichbaren Position in der Geschichte Afghanistans.Bamiyan ist die einzige Provinz, in der die in Afghanistan diskriminierte Min-derheit der Hazara die Mehrheit stellt. Traditionell werden die Nachkommen mongolischer Einwanderer sozial und
religiös benachteiligt, denn sie sind im Gegensatz zu den meisten Afghanen Schiiten. Unter der Führung von Habiba Sarabi haben die öffentlichen Bildungsange-bote und die Zahl der weiblichen Stu-denten deutlich zugenommen. Immer mehr Frauen wagen sich in Berufe, die unter der Taliban-Herrschaft 1996 bis 2001 verboten waren. „Angesichts weit verbreiteter Widerstände in Af-ghanistan gegenüber Frauen in öf-fentlichen Ämtern sind ihr Mut und ihre Entschlossenheit außerordent-lich“, so die Magsaysay-Stiftung in ih-rer Laudatio über Sarabi, die selbst zur religiösen und ethnischen Minderheit der Hazara gehört. www.dw.de
EUROPA/TÜRKEIWIDE + Statement of solidarity
with protestors and women’s-rights activists in Turkey (Ausschnitt)
As European feminists and women’s rights activists, we express our soli-darity with the protestors in Turkey. We deplore the repression and massi-ve state violence against people who exercise their basic freedoms of dis-sent and assembly. We call upon our governments, the EU and internatio-nal authorities to a) unequivocally op-pose the undemocratic behaviour of the Turkish government, b) to demand an end to the detention of protestors, medical personnel and legal counsel under questionable anti-terror legisla-tion, the violence against them which contradicts human rights principles and the release of all those detained in connection with the protests, and c) to insist on an investigation of the mass violence exerted and persecuti-on of those responsible. As European feminists and women’s rights activists, we reaffirm the indivisibility of human rights, including the rights of demo-cratic opposition, freedom of opinion and media, and the right to move and speak freely in public, the right to a life free from violence and to control over one’s own body, health and sexu-ality. Die vollständige Erklärung:
http://wideplusnetwork.wordpress.com
FRAUENSOLIDARITÄT Nr. 125 (3/2013) ISSN 1023-1943
Offenlegung laut Mediengesetz: Medieninhaberin und Herausgeberin: Frauensolidarität – Frauensolidarität – feministisch- entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit; Vorstand: Ulrike Lunacek (Obfrau), Gundi Dick (Obfrau-Stellvertreterin), Nela Perle (Kassierin), Maria Gerbel-Wimberger (Kassierin-Stellvertreterin), Hanna Hacker (Schriftführerin), Luisa Dietrich (Schriftführerin-Stellvertreterin), Nina Hechenberger (Geschäfts-führerin); Blattlinie: Verbreitung von Informationen über die Situation von Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika sowie Reflexionen des Nord-Südverhältnisses aus feministischer Sicht.
Impressum: Medieninhaberin und Herausgeberin: Frauensolidarität im C3 – Entwicklungspolitische Initiative für Frauen, Sensengasse 3, A-1090 Wien //Telefon: 0043/1/3174020-0 / Fax: 0043/1/3174020-406 // E-Mail: [email protected] / Internet: www.frauensolidaritaet.org // Redaktion: Jule Fischer und Claudia Dal-Bianco (Koordination) // Lektorat: Gertie Aichhorn // DVR.-Nr.: 0771023 // ZVR-Zahl: 624081934 //Grafik: Julia Löw / Anne Lange » www.weiderand.net // Druck: REMAprint, Neulerchenfelderstr. 35, 1160 Wien. //
Copyright: bei Autorinnen bzw. Redaktion. Die in den Beiträgen vertretenen Meinungen müssen nicht mit denen der Redaktion ident sein. Die Frauensolidarität erscheint viermal im Jahr; Preis pro Heft: EUR 6,– plus Porto; Jahresabo: EUR 20,– (Österreich) bzw. EUR 25,– (andere Länder); Bestellungen an: Frauensolidarität, Sensengasse 3, A-1090 Wien / E-Mail: [email protected] // Konto: lautend auf Frauensolidarität,PSK Nr. 93.009.458, BLZ 60.000, BIC: OPSKATWW, IBAN: AT446000000093009458 //
MAGAZIN //
ÖSTERREICHIm Rahmen des österreichischen Na-tionalratswahlkampfs 2013 präsen-tierten die Grünen vor kurzem auf Fa-cebook ein Sujet, das zwei Schwarze Reinigungsfrauen zeigt. Übertitelt ist das Bild mit der Frage: „Wer putzt bei dir?“ Das Foto wurde ursprünglich in Südafrika aufgenommen und von ei-ner Bildagentur erworben.
STATEMENT ZUM SUJET „WER PUTZT BEI DIR?“ DER GRÜNEN IM
RAHMEN DES NATIONALRATS-WAHLKAMPFS 2013
Unsere vielseitigen Widerstände gegen eine lange Tradition “gut ge-meinter” paternalistischer, sexisti-scher und rassistischer Darstellungs-weisen Schwarzer Frauen beginnen und enden weder mit dem National-ratswahlkampf 2013 noch sind sie auf Österreich beschränkt. Denn jenseits der Wahlen kämpfen wir als Schwarze Frauen*, Women* of Color und Mig-rantinnen* tagtäglich auf individueller und struktureller Ebene gegen (neo)koloniale Ausbeutungsverhältnisse und rassistische und (hetero)sexisti-sche Gewalt.Wir wehren uns gegen die unreflek-tierte Verwendung von Bildern als Auslöser für Diskussionen, die auf dem Rücken von Schwarzen Frauen*,
Women* of Color und Mig-rantinnen* ausgetragen wer-den, und so unsere Stimmen und Widerstände unsichtbar machen. Dies alles, ohne die Privilegien derjenigen zu hinterfragen, die an unserer Unterdrückung beteiligt sind. Wie ungebrochen diese Pri-vilegien sind, zeigt sich auch im Umgang mit Kritik. So ver-wundert es nicht, dass auch die Grünen die stereotype und plakative Bebilderung zwar als Gratwanderung, jedoch als notwendi-ges Mittel verteidigen und Kritiken mit dem Hinweis abtun, diese seien „nicht beabsichtigte Interpretationen“. Ein-mal mehr wird die mangelnde Be-reitschaft, sich mit Rassismus und Sexismus auseinanderzusetzen und Verantwortung für das eigene Han-deln zu übernehmen, offensichtlich. Weiters sprechen wir uns gegen die ins Feld geführten Argumente rund um die Nützlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Migrant*innen aus und weisen Versuche, uns nach unserer Verwert-barkeit zu kategorisieren, entschieden zurück. Jenseits von „gnädigen“ Op-ferdiskursen fordern wir die Anerken-nung von internationalen Bildungsab-schlüssen, uneingeschränkten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
und zu Sozialleistungen, gerechte Ent-lohnung, einen generellen Abschiebe-stopp und Bewegungsfreiheit für Alle! Wir lassen uns nicht auseinanderdivi-dieren und solidarisieren uns mit allen Arbeiter*innen und Asylsuchenden!
Liste der unterzeichnendenOrganisationen (in alphabetischer
Reihenfolge):ADEFRA – Schwarze Frauen in Deutschland, Afrikanet.info, Afrika Vernetzungsplattform (AVP), GHA-NA UNION, GHANA UNION YOUTH, ISD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen, mi-grazine.at, PAMOJA – Bewegung der jungen afrikanischen Diaspora, PANA-FA – Pan African Forum in Austria,Peregrina
Die Veröffentlichung wurde mit Unterstützung der Europäischen Union ermöglicht. Für den Inhalt dieser Veröffentlichung ist al-lein die Frauensolidarität verantwortlich; der Inhalt kann in keiner Weise als Standpunkt der Europäischen Union angesehen werden
Frauensolidarität 3/2013
6
Frauensolidarität 3/2013
7Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
Rada Zivadinovic
Morgen ist ziemlich grau. Ich gehe den schon viel zu ge-wöhnten Weg. Geruch aus
der Bäckerei. Drinnen große Schlan-ge. Ich stelle mich an. Noch voll ver-schlafen höre ich wie die Verkäuferin ziemlich leise und möglichst unauffäl-lig ihrer Kollegin etwas auf mir viel zu bekannte Sprache sagt. Erstes Lächeln auf meinem Gesicht an diesem Mor-gen. Ich bin dran.- „Dobar dan.“ sage ich. - „Guten Tag.“ kommt die Antwort.- „Dajte mi ono tamo pecivo, ono sa suncokretom“. Ich fühle schon die komischen Blicke auf meiner Haut. - „Mit Sonnenblumenkern?“ fragt sie und schaut mich dabei nicht an. - „Da.“ antworte ich. „Koliko?“- „Neunzig Cent.“- „Izvolite.“- „Danke.“Bei jedem Wort wird sie leiser. Sie schaut mich gar nicht mehr an. Die an-dere Verkäuferin dreht den Kopf ab.
Ich stehe an der Kassa. Ich kenne die Kassafrau. Ich kenne ihre Sprache. Sie kennt meine. Noch ein Versuch.- „Vier Euro vierzig.“- „Izvolite. Nemam ni!ta sitno.“Sie nimmt das Geld. - „Bitte.“- „Hvala. Prijatan dan!“- „Schönen Tag noch.“Ihr ist es nicht angenehm.
Eine Freundin von meinem Vater er-zählte mir wie sie bei der Arbeit, wenn der Chef nicht da ist, die Möglichkeit ausnutzen, um miteinander auf ihre Muttersprache zu reden. Mit Kund_in-nen dürfen sie nur Deutsch sprechen. „Nur Deutsch!“ sagt sie mit dem Zei-gefinger hoch während sie ihren Chef imitiert. Angst? Peinlichkeit? Angst wovor? Die Arbeit zu verlieren? Als „die An-dere“ herauszustechen? Rassistische Kommentare abzubekommen? Nein, hier handelt es sich nicht um ei-nen blöden Chef, oder um rassistische
Zur Autorin: Rada !ivadinovi" ist kvir_feministische Aktivistin, die unter Anderem gerne schreibt, diverse queere/antirassistische Veranstaltungen organisiert und Klavier spielt. Zur Zeit studiert sie in Wien, ihre Studien- bzw. Forschungsschwerpunkte sind Postcolonial Stu-dies, feministische Theorien und Queer Studies. Außerdem trainiert sie feministische Selbst-
verteidigung und setzt sich für Empowerment von kvir_en Migrant_innen ein.
Unter die Haut
Ladenpolitik. Es handelt sich um viel mehr. Eigene Sprache nicht sprechen zu können ist Gewalt. Rassistische Ge-walt hat Struktur. Das wissen viele theoretisch. Und obwohl ich auch das weiß, hebe ich manchmal nicht ab wenn ich in der U-Bahn bin und meine Schwester mich anruft. Mein Vater weiß das auch, doch sagt er mir „Ich ruf später an“ wenn er im Firmenbüro ist. Ich verstehe warum. Alles denkbar, er-klärbar... für viele andere spürbar. Eine Freundin fragt wie ich „es“ auf meiner Haut spüre. Ich spüre es unter meine Haut, sage ich. Es geht wirklich unter die Haut und noch tiefer.
Ich gehe händchenhaltend mit meiner Freundin durch die Straße. Wir sind laut, wir lachen. Wir bleiben stehen und küssen uns. Sie sagt mir etwas schönes. Ein Mann geht vorbei.„Gore"ete u paklu!“ sagt er durch die Zähne.„Bar neko ovde samnom pri#a moj jezik.“ sag ich zu ihr.
ZUSAMMENHALT! 40 JAHRE NEUE FRAUENBEWEGUNG IN WIEN
Ausstellung von Bettina Frenzelund Brigitte Theißl
Erst 40 Jahre ist es her, dass sich in Ös-terreich die AUF – Aktion Unabhängi-ger Frauen – gegründet hat. Und doch gerät bereits wieder in Vergessenheit, unter welchen Umständen Frauen zu dieser Zeit gelebt, was sie bewegt und verändert haben. Die Ausstellung macht die damalige Lebenssituation nachvollziehbar, lässt frau selbst zu Wort kommen und verfolgt den Strang der Geschichte von damals bis heute. Und das alles an dem Ort, der erst im Jahr 2000 nach Jahren hartnäckiger Besetzungen, Aktionen und Protesten von Frauen erkämpft und erstritten wurde: dem kosmos.frauenraum bzw. dem heutigen KosmosTheater.Die Ausstellung wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Liebhaberinnen des Radikalen – 40 Jahre Neue Frau-enbewegung“ eröffnet und von der Plattform 20000frauen „bespielt“.Vernissage: 25.10.2013, 20:00 UhrDauer: 24.10.–7.12.2013 Eintritt frei www.kosmostheater.atwww.denkwerkstattblog.net
SEXUALITÄTEN UND KÖRPER-POLITIK / SEXUALITIES AND BODY
POLITICSPräsentation des JEP 1/2013 und
DiskussionWelches Gewicht haben „Körper” im Entwicklungsdiskurs? Welche Rolle können oder müssen Sexualpolitiken spielen, wenn wir internationale Un-gleichheitsverhältnisse analysieren? Autor_innen des JEP - Journal für Entwicklungspolitik diskutieren über die Zusammenhänge von Sex, Körper, Ökonomie, Gewalt und Handlungs-macht in feministisch-postkolonialer Perspektive.Within development discourse, do bodies matter? How do we relate to sexual politics when it comes to analy-zing international relations of inequa-lity? Contributors to JEP - Journal for Development Studies discuss the in-terconnections of sex, body, econo-
my, violence, and agency in feminist postcolonial perspectives.Es diskutieren:Jules Falquet, Soziologin, Université Paris Diderot, ParisHanna Hacker, Sozial- und Kulturwis-senschaftlerin, IE, Universität WienClemens Huber, Soziologe und IE-Ab-solvent, WienModeration: Jule Fischer, Frauensoli-darität, WienVeranstaltung in englischer Sprache, Übersetzungshilfe bei Bedarf. Im An-schluss laden wir zu Erfrischungen.Zeit: 17.10.2013, 19:00 UhrOrt: Alois Wagner Saal, C3 –Centrum für Internationale Entwicklung, Sens-engasse 3, 1090 WienEine Kooperation von Frauensolidari-tät, Institut für Internationale Entwick-lung und Mattersburger Kreis für Ent-wicklungspolitik.
BILDUNG IM C3NTRUM „Schreiben, Biografie & Migration:
Reflexionen zeitgenössischer Autorinnen über Zuschreibung
und Positionierung am Literaturmarkt“
In der Rezeption zeitgenössischer Lite-ratur ist ein biografisierender Zugang zu den Werken von Autor_innen festzu-stellen, die eine Migrationserfahrung teilen. Unter dem Stichwort „Literatur der Betroffenheit“ erfreuen sich litera-risch verarbeitete Migrationserfahrun-gen bei Verlagen und Leser_innen gro-ßer Beliebtheit. Im Vordergrund der Publikationspolitik scheint dabei die erfolgreiche Vermarktung von „Migra-tionsgeschichten“ zu stehen, die sich an den vorherrschenden Marktbedin-gungen orientieren. Andererseits nüt-zen Autor_innen diese Politik, um auf ihr literarisches Schaffen aufmerksam zu machen. Die Literatinnen Seher Çakır und Zdenka Becker werden am 15. Ok-tober ein Gespräch über diese Fest-schreibungen führen. Im Zentrum stehen ihre individuellen Wahrneh-mungen und wie sie sich selbst zu ihrer Rezeption am österreichischen Litera-turmarkt positionieren. Sie werden gemeinsam mit Olivera Stajic (der-
Standard.at, okto.tv) Möglichkeiten erörtern, sich kreativ (Mehrfach-)Zu-gehörigkeiten anzunähern und Brüche auf der sprachlichen, stilistischen und rhetorischen Ebene zu nützen, um ein neues Publikum anzusprechen. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, welcher Bildungsauftrag sich in ihrer literarischen Arbeit daraus ergibt. Die Autorinnen werden an diesem Abend auch in kurzen Episoden aus ihren ei-genen Texten lesen. Zeit: 15.10.2013, 19–21 UhrOrt: C3-Bibliothek für Entwicklungs-politik, Sensengasse 3, 1090 Wien Moderation: Olivera Stajic(derStandard.at; okto.tv) Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Bildung im C3ntrum“ statt und ist eine Kooperation der Orga-nisationen ÖFSE, Baobab, Frauenso-lidarität, Paulo Freire Zentrum sowie Mattersburger Kreis und wurde mit dem Verlag Exil, der Initiative Minder-heiten und Ö1 geplant.
ALTERNATIVEMEDIENAKADEMIE 2013Schulung, Vernetzung und
Organisierung für kritische und alternative Medienarbeiter*innen
von 9. bis 17. NovemberFreie und alternative Medienarbeit meint vor allem: Medienberichter-stattung selbst aktiv mitzugestal-ten, unabhängig von institutioneller Anbindung und ökonomischer Ver-wertungslogik. Alternative Medien ermöglichen damit jeder und jedem am öffentlichen Diskurs teilzunehmen – nicht nur als Rezipient_in, sondern auch als Gestalter_in. Alternative Me-dienarbeiter_innen intervenieren in mediale Diskurse, erzeugen kritische Öffentlichkeiten und gestalten demo-kratische Mitbestimmung.Im Rahmen der Alternativen Me-dienakademie 2013 sollen die Ver-netzung von Medienarbeiter_innen, Rezipient*innen und Interessierten er-möglicht, Diskurse geführt und Orga-nisierung vorangetrieben werden. Es wird Workshops, (Podiums-)Diskussi-onen und Vernetzungscafés geben.http://alternative-medien-akademie.at
// VERANSTALTUNGSANKÜNDIGUNGEN
Frauensolidarität 3/2013
8 9Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
Frauensolidarität 3/2013
WOMEN‘SRIGHTS:
Filomenita Mongaya Høgsholm
The Vienna+20 CSO Conference emphasized the pri-macy of human rights over all other rights, underlin-ing the fact that protection and promotion of human
rights is the first responsibility of governments but that the primacy of human rights is not yet reflected in the policies and institutions of many states. These include some of the most powerful globally, for example in Europe. Despite the progress made in institutionalizing human rights systems, real politics‘ vested interests, in particular business inter-ests, still tended to prevail. Of great concern is that hu-man rights law, in the context of in particular economic, social and cultural rights, are still not equipped with the proper forms of legal sanctions, as compared to other areas of law such as for example international commer-cial law. The meeting also emphasized the importance of strengthening extraterritorial obligations in order to ad-dress the challenges of globalization while observing the importance of including ecological perspectives into hu-man rights. There was broad support expressed for the welfare of human rights defenders, especially leaders and rank-and-file advocates who are facing growing criminali-zation, while working for the rights of women, indigenous
peoples, peasants, and others in vulnerable categories. Despite the universality of human rights, many states still interpret these obligations as being applicable only within their own borders. The attempt to limit obligations territo-rially has led to gaps in human rights protection that have become more severe in the context of globalization over the past 20 years.
Cross-cutting effects of Gender and WorkIt was interesting to note the great interest on the cross-cutting effect of gender during the two day conference. Indeed, in Vienna at least 8 main points were taken up by the participants relating the Rights of Women:We call on states to guarantee and implement the human rights of migrants, refugees and displaced persons as en-shrined in the UN Universal Declaration of Human Rights, the ILO Conventions 97, 143, 181, 189, and the Maritime Labour Convention 2006. Furthermore, we urge states to ratify the UN Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, and ILO Convention 189 on Domestic Work. We call on States to implement the outcomes of the UN High Level Dialogue
on global migration governance and institutionalize the ac-tive participation of migrant and refugee organizations in future governance mechanisms.States also have the responsibility to ensure the equality of migrant workers with nationals of the state in respect to wages and conditions of employment and in matters of so-cial security, health and welfare. States should prioritize co-herence in economic, trade, investment and development policies to make migration a choice and not a necessity. States should ensure protection of the rights of migrants and refugees, including unaccompanied children, in tran-sit and passage through borders, whether in regular travel or when caught in crisis situations of distress. Involuntary cross-border and internal displacements have increased due to forced eviction from investment projects, environ-mental disasters and climate change, to land grabbing, economic deprivation and political persecution, including in the situations of conflict, occupation and war. However, violations continue against persons and families seeking refuge from well-founded fear in many countries. They are often stripped of their human rights and crimi-nalized in countries of transit while risking falling victim to forced labor, human trafficking and organ trade. Refugee and IDP situations are emblematic of protracted crises. We request that fragile states be addressed and transitional justice processes instituted that call for reparation of vic-tims and national reconciliation.Legal norms and procedures for refugee and IDP protec-tion, such as the International Migrant Workers’ Conven-tion coming into force ten years ago, have been developed. The ILO Convention No. 189 concerning decent work for domestic workers and Maritime Labor Convention entered into force in 2013. However, only 46 states have ratified the Migrant Workers Convention so far, and only 49 states are party to ILO Migration for Employment Convention No. 97 (1949 revised), and just 23 ratified the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention No. 143 (1975). We call upon states to become parties to these instruments.
Migration and development nexusGovernments must create and implement mechanisms of migration governance, in particular in the post 2015 con-text, meet the international standards of treatment for refugees, IDPs and migrants, and prevent and remedy their forced eviction and displacement. Migrant women and mi-grant children, regardless of status, must have access to basic services and protection. States also must redouble efforts to avoid and prevent mass detention and expulsion of migrants, and to investigate deaths on borders.The over-all effects of the many factors in the migration and development nexus have led to the increasing impov-erishment and exploitation of women. It is now recognized that among women migrants, these vulnerabilities increase in all aspects of the migration process: pre departure, transit, arrival, stay and even return. Efforts are intensify-
ing in many sectors and in many theatres of discussion and policymaking in order to correct this state of affairs where women continue to be disenfranchised, even as more and more women take the challenge upon themselves to forge a better future for their children and their families by cross-ing borders and becoming migrants. Parallel developments at the UN High Level Dialogue affirm similar view. Accord-ing to the newly formed WGMWG*, the Women and Global Migration Work Group, which was established during the AWID Conference in Istanbul last year, migration impacts women who move within and across borders as well as women who remain at home when family members leave. Migration affects women as workers, care-givers, partners and parents, and has differential impact due to ‘race’, class, religion, age, national origin, ability, sexual orientation and status. Women around the world who are impacted by mi-gration affirm that states have the obligation to protect, respect and fulfill fundamental human rights, including women’s human rights, regardless of status.
Claims of ENoMW, the European Networkof Migrant Women
The WGMMG enumerate the following key priorities as starting points for addressing women’s human rights in the context of migration:- WOMEN ARE AGENTS OF CHANGE and need the re-
sources, autonomy and access to realize our human rights- WORKER RIGHTS that are gender-sensitive and value
care-work - END CRIMINALIZATION OF MIGRANTS, detention and
deportation. Women must have full access to public serv-ices and protection of civil and human rights
- END DISCRIMINATION/RACISM/XENOPHOBIA towards migrant women in all their diversity
- END GENDER-BASED VIOLENCE and guarantee protec-tions regardless of status
- HEALTHCARE INCLUDING SEXUAL AND REPRODUC-TIVE HEALTH regardless of status
- BUILD BRIDGES NOT WALLS demilitarize borders and respect women’s human rights
- KEEP FAMILIES TOGETHER; recognize LGBT families, women’s status not dependent on a spouse
- GENUINE GENDER-SENSITIVE DEVELOPMENT must put people and nature at the center, deliver economic and social human rights, and make migration a choice, not a necessity
Tip: The Women and Global Migration Working Group:» www.wgmwg.org
The author: Filomenita Mongaya Høgsholm is editor of Abakada and Founding Chair of Babaylan Denmark. She is also a member of ENoMW, the European Network of Migrant Women. She lives in Kopenhagen.
Representatives of various CSOs around the world gathered in Vienna on June 25th and 26th, 2013for a Conference on the occasion of the 20th anniversary of the Vienna Declaration and Plan of
Action. The gathering recognized the important areas of progress made on the basis of the Vienna 1993 Declaration and Plan of Action but also noted that the implementation of that plan still
suffered from severe gaps in a number of areas, broadly admitting that many of today’s human rights challenges are yet not fully addressed twenty years on – like work and migration.
Vienna+20 and beyond Claims on w
ork and migration!
Vienna+20 and beyond. Claims on workand migration!
Frauensolidarität 3/2013
10
Frauensolidarität 3/2013
11Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
UNSERE STIMMEN NACH AUSSEN BRINGENDie Frauenflüchtlingskonferenz in Hamburg
Leticia Hillenbrand
Die FlüchtlingsfrauenkonferenzDie Idee, diese erste Flüchtlingsfrauenkonferenz zu or-ganisieren, entstand auf dem „Break Isolation Camp“ in Erfurt im Sommer 2012. Dort wurde den Organisator_in-nen und den Flüchtlingsfrauen klar, dass, obwohl Frauen als Flüchtlinge besonders betroffen sind, reden sie selten darüber. Die besondere Problematik der Frauen benötigt besondere Lösungen. Daher wurde ganz konkret die Fra-ge angegangen, wie Frauen sich stärker organisieren und für ihr Recht auf politischen Widerstand eintreten kön-nen. Die Konferenz hatte auch das Ziel, die Situation der Flüchtlingsfrauen zu dokumentieren, um dies dem „inter-nationalen Flüchtlingstribunal gegen die Bundesrepublik Deutschland“ vorzulegen. Das internationale Tribunal fand vom 13. bis 16. Juni 2013 in Berlin statt. Die deutsche Re-gierung wird mitverantwortlich gemacht für die tägliche Generierung von Fluchtursachen und „für das psychische und physische Leid, das Flüchtlinge und MigrantInnen hier in Deutschland und in Europa täglich erleben“.
Flüchtlingsfrauen – die Vergessenen Weltweit ist die Lage der Flüchtlingsfrauen und -mädchen besorgniserregend. Es gibt nicht genügend Schutzmaß-nahmen für sie, weder in internationalen, noch in deutschen Flüchtlingslagern. Es fehlen nach Geschlechtern getrennte sanitäre Anlagen, die nach Geschlecht getrennt sind. Die wenigen existierenden sind meist schlecht beleuchtet oder liegen weit abgelegen. Es wird immer wieder von sexuel-len Übergriffen auf dem Weg dahin berichtet. Ein ähnliches Problem ist, dass die Wege vom die Flüchtlingslager weit weg von Wasserstellen oder Versorgungsmöglichkeiten sind. Viele der Flüchtlingslager in Deutschland befinden sich vorwiegend in isolierten Gegenden, in denen laut di-verser NGOs, das Nottelefon nicht funktioniert. Auf diese Problematik haben internationale Organisationen wie die UNO und auch deutsche NGOs aufmerksam gemacht. Sie haben die jeweiligen Regierungen aufgefordert die nöti-gen Maßnahmen zu ergreifen. Tatsächlich wird allerdings wenig unternommen. Die Flüchtlingsfrauen und -mädchen
in Deutschland müssen nicht nur in einer heruntergekom-menen und unsicheren Unterkunft leben, sie stehen mit ihren seelischen Leiden allein da, denn die Behörden kon-zentrieren sich mehr auf die restriktive behördliche Kon-trolle der Bedürftigen. Psychologische Betreuung wird in der Regel nicht angeboten. Viele der Frauen kommen mit einer Vorgeschichte von Gewalt, Verfolgung, Folter und Krieg, was die Bewältigung ihres Alltags erschwert. In Deutschland dürfen sie nicht arbeiten und bekommen kei-ne Möglichkeit sich weiterzubilden. Nicht selten werden sie von den männlichen Flüchtlingen belästig, was bei vielen Frauen dazu führt, dass sie sich zurückziehen und in ihren Zimmern Schutz suchen. Sie stellen in der Regel keine For-derungen, sie gehen nicht in an die Öffentlichkeit. Die Teilnehmerinnen der Frauenkonferenz haben den Be-schluss gefasst 2014 die zweite Flüchtlingsfrauenkonferenz in Deutschland zu organisieren, sich mit Flüchtlingsfrauen in anderen Ländern zu vernetzen und zusammen auf ihre besondere Situation aufmerksam zu machen.
Zum Beispiel: JasminJasmin* kommt aus Marokko. Sie ist ausgebildete Journa-listin. Auf der Konferenz erzählt sie, wie sie die zahlreichen Korruptionsfälle in der marokkanischen Regierung auf-deckte und sich so viele Feinde machte. Mit leiser Stimme spricht sie über ihre Arbeit und über die Menschenrechts-verletzungen gegenüber marokkanischen Journalist_innen und Aktivist_innen. Trotz Bedrohungen schrieb sie weiter über die Korruption. „Ich war eine starke Frau“ betont sie. Als sie Morddrohungen bekam, floh sie nach Deutschland. Sie kam allein in ein Lager, wo überwiegend Männer waren. Ständig wurde sie von den Männern sexuell belästig und bliebt oft in ihrem Zimmer. Doch dort war sie auch nicht sicher, da sich die Tür nicht abschließen ließ. Jasmin erzählt von schlaflosen Nächten und davon, wie sie abends ihre Zimmertür verbarrikadierte, aus Angst, die Männer könn-ten in ihr Zimmer eindringen. Sie informierte die Ausländer-behörde, aber es wurde nichts unternommen. Ihr Anspruch auf ein Türschloss wurde abgelehnt. Als die Belästigungen nicht aufhörten, entschied sie sich die Täter anzuklagen und bekam Recht, doch ihre Forderung eine eigene Woh-nung zu bekommen, blieb erfolglos. Jasmin war mit den Nerven am Ende, sie wurde depressiv, konnte nicht mehr schlafen. Trotz ihres sichtbaren Leidensdrucks, hat Jasmin bis heute keine psychologische Betreuung bekommen. Sie hoffte in Deutschland bleiben zu können. Sie lernte fleißig Deutsch, um Pluspunkte für die Erteilung einer Aufent-haltserlaubnis zu sammeln. Im März 2013 bekam Jasmin die Benachrichtigung, dass ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Sie muss Deutschland verlassen. In dem Schreiben, das sie uns vorliest, steht, dass sie zuerst nach Spanien abgescho-ben und von dort weiter per Schiff nach Marokko gebracht
wird. Während ihres Vortrags gerät sie in Panik, als sie über die zu erwartende Verfolgung und Bedrohung in ihrem Hei-matland spricht.
Olesia und Miloud Das Ehepaar Olesia und Miloud lebte bis vor Kurzem in der Ukraine, in Olgas Heimatland. Miloud kommt aus Algerien, wo er politisch verfolgt wurde. In der Ukraine konnten sie nicht lange bleiben, denn die rassistischen Einschüchterun-gen gegen Miloud machten dem Ehepaar das alltägliche Leben unmöglich. Sie flohen nach Deutschland, wo sie dachten bleiben zu können. Doch die Ausländerbehörde erteilte keine Aufenthaltserlaubnis. Im Gegenteil, sie droh-te immer wieder mit der getrennten Abschiebung. Aus die-sem Grund flohen die beiden nach Norwegen. Dort durf-ten sie aufgrund der Dublin-II-Verordnung ebenfalls nicht bleiben. Diese besagt, dass nur das Einreiseland für die Überprüfung des Asylantrages zuständig ist, also im Fall von Olesia und Miloud Deutschland. Der Fall Olesia und Miloud kam, dank der Flüchtlingsorganisationen wie „The Karawane“ an die Öffentlichkeit. Diese starteten eine So-lidaritätskampagne für Miloud und Olesia. Zurzeit ist das Paar noch in Deutschland.
Was noch zu tun istDie Konferenz war ein wichtiger und erster Schritt, die Problematik der Flüchtlingsfrauen in Deutschland bekannt zu machen, sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutau-schen. Die Problematik der Frauenmigration sollte sich auf zwei Aspekte konzentrieren: erstens auf den Kampf gegen Stigmatisierung und Kriminalisierung der Flüchtlinge, die vor allem in den Medien stattfindet und von konservati-ven Politiker_innen mitbetrieben wird; zweitens auf eine dringende Verbesserung der Lage der Flüchtlingsfrauen, indem Maßnahmen gegen deren Isolierung und für ihre persönliche Sicherheit und körperliche Unversehrtheit er-griffen werden und die ihnen das Recht auf Bildung, Woh-nung und Aufenthalt gewähren.
*Name geändert.
Lesetipps: Benz, Wolfgang (Hg.) (2006): Umgang mit Flüchtlingen. Ein humanitäres Problem. München. // » Müller, Dorothea (2010): Flucht und Asyl in europäischen Migrationsregimen. Metamorphose einer umkämpften Kategorie am Beispiel der EU, Deutschlands und Polens. Göttingen. // » Rohr, Elisabeth/Jansen, M. Mechtild (Hg.) (2002): Grenzgängerinnen. Frauen auf der Flucht, im Exil und in der Migration. Gießen.
Zur Autorin: Leticia Hillenbrand ist in Mexiko-Stadt geboren und lebt seit 1995 in Deutschland. Sie hat Geschichte und Mediendokumen-tation studiert und ist Doktorandin der Universität Hamburg. Derzeit arbeitet sie als freie Journalistin.
Vom 19. bis 21. April fand in Hamburg die erste Frauenflüchtlingskonferenz statt. Die mehr als 100 Frauen, die an der Konferenz teilnahmen,kamen aus verschiedenen Flüchtlingslagern Deutschlands.
Sie sind Flüchtlinge aus Afrika, dem Kosovo, aus Herzegowina, Russland, der Türkei und dem Iran.
Frauensolidarität 3/2013
12
Frauensolidarität 3/2013
13Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
GENDER IN DER LEBENSPLANUNGJUNGER KRANKENPFLEGER_INNEN
AUS MALAWI… und was das mit Migration zu tun hat
Gender kann auf vielen Ebenen auf Migration Einfluss nehmen, u.a. auf persönliche, soziale und berufliche Ausgangsbedingungen für eine
Migrationsentscheidung. Im Rahmen meiner Diplomforschung in Lilongwe 2010 sprach ich mit Studierenden des Bachelor (BA) General Nursing der Universität
in fünf Forschungsworkshops und zehn biografischen Einzelinterviews über die Bedeutung von Migration für ihre Lebensentwürfe und -pläne. Die
Beschreibungen der jungen Pfleger_innen, zwei Drittel hiervon Frauen, führten mir einige genderbezogene Gesichtspunkte von Migrationsintentionen
unmittelbar vor Augen, die im Mittelpunkt dieses Artikels stehen.
Christiane Vossemer
Gut ausgebildete Krankenpfle-ger_innen aus Malawi, die ihre Koffer packen und mit einem
international anerkannten Abschluss nach Großbritannien, Südafrika oder in die USA ziehen, gelten als „Problem-fälle“ für das nationale Gesundheits-wesen: Zum einen war ihre Ausbildung kostspielig, zum anderen werden sie als qualifiziertes Pflegepersonal auf allen Ebenen des Gesundheitssys-tems händeringend gebraucht. Ab-wanderung ist hierbei nur ein Faktor – in Statistiken stechen insbesondere niedrige, schwankende Ausbildungs-zahlen und frühes Ausscheiden aus dem Beruf aufgrund von Krankheit
oder Frustration als wesentliche Grün-de heraus. Aber als 75 malawische Krankenpfleger_innen sich 2002 auf Großbritanniens Arbeitsmarkt regis-trierten, entsprach dies ebenso 12 % der heimischen Pflegekräfte. Viele Erwartungen sind bekannt, die Krankenpfleger_innen dazu bewegen, sich für Migration „in den Westen“ zu entscheiden: bessere Bezahlung, kürzere Schichten, Verfügbarkeit von Personal, Geräten und Medikamen-ten, soziale Absicherung, Ausbildung der Kinder, Druck der Familie oder ein höherer Lebensstandard.Wie meine Forschung deutlich mach-te, funktionieren Migrationsintentio-
nen nicht nach „Schema F“. Sie hän-gen unmittelbar mit biografischen Erfahrungen, Zielen und Werten zu-sammen. Welche Faktoren eine Rolle spielen, ist maßgeblich von individuel-len und sozialen Prioritäten für den Le-bensweg abhängig, auf die Gender in vieler Hinsicht Einfluss nehmen kann:
„Servants of God“Krankenpflege ist gesellschaftlich und für die Studierenden stark mit femi-ninen Attributen konnotiert und wird als weiblicher Statusberuf betrachtet. Studentinnen identifizieren sich stark mit dem religiös konnotierten Berufs-ethos, der Pflegerinnen als „Servants
of God“ und ihren Beruf als Weg zum Status einer „Real Lady“ schätzt – was sie über die Schwesternuniform stolz nach außen tragen.Für die berufliche Identität männli-cher Studierenden wirkt dieses Image hingegen als fundamentale Hürde: Konfrontiert mit Zurückweisungen durch Patient_innen, aber auch mit femininen Zuschreibungen, durch die sie ihre Genderidentität in Frage ge-stellt sehen, orientieren sich ihre Be-rufswünsche stark auf einen schnellen Aufstieg in Gesundheitspolitik oder -management – ein Karriereweg, der durch ein Masterstudium im Ausland angebahnt werden soll. Malawische Wortführerinnen in der Krankenpflege problematisieren, dass die wachsende Zahl von Männern in der Pflege stark in hohe Positionen des Pflegemanage-ments dränge, diese dort bevorzugt und die starke Frauenquote des Pfle-ge-Leaderships unterlaufen würden. Dies erscheint umso bedenklicher, als die Mehrheit der befragten Frauen nicht nur eine starke Karriereorientie-rung, sondern auch ein hohes Com-mitment für den Pflegeberuf zum Aus-druck brachte, obwohl die Mehrzahl von ihnen aus (männerdominierten) anderen Studiengängen in den Pfle-gestudiengang „versetzt“ worden war – eine Umlenkung ihrer Karrierewege, die durch institutionelle Genderbil-der gekennzeichnet ist und gleichzei-tig die geringe Frauenquote in allen Leadership-Bereichen außerhalb der Krankenpflege verstetigt.
Pflege-LeadershipsFrauen wie Männer im Pflegeberuf sind in ihren Karriereambitionen durch den feminisierten Status ihres Berufs innerhalb der patriarchalen Hierar-chie der Gesundheitsberufe unmit-telbar beeinträchtigt. So werden die überwiegend männlichen „Clinical Officers“ (Hilfsärzte) trotz ihrer kürze-ren Ausbildung in Führungspositionen meist bevorzugt. Dies zeigte sich als zentrale Sorge aller Studierenden, die sich als Teil der akademischen Elite des Landes sehen und mit hohen persön-lichen und sozialen Erwartungen an
Lesetipps: Astrida Ieva Grigulis (2010): Lives of Malawian nurses. Stories behind the stati-stics. Thesis for the degree of Doctor of Phi-losophy. Centre for International Health and Development, University College London. // Lwanda, John (2007): Scotland, Malawi and Medicine: Livingstone’s Legacy, I Presume? An Historical Perspective. Scottish Medical Journal. 52(3): 36-44.
Zur Autorin: Christiane Vossemer ist Univer-sitätsassistentin am Institut für Internationale Entwicklung der Universität Wien und arbeitet dort zu den Themenbereichen Migration, Gesundheit und Entwicklung mit Fokus auf Südostasien.
ihre Karriere, den ökonomischen und gesellschaftlichen Status konfrontiert sind – was deutlich mit Entlohnung, Entscheidungskompetenz und Auf-stiegsmöglichkeiten qualifizierter Pfle-ger_innen kollidiert. Die wohl stärkste Übereinstimmung zwischen den Pfle-ger_innen liegt in der Hoffnung, durch einen hohen akademischen Titel, ei-nen MA oder sogar PHD im Ausland, den Sprung in Entscheidungspositio-nen zu schaffen. Diese Dynamik steht mit den Migrati-onsintentionen der Studentinnen eng in Verbindung, insofern als die jungen Frauen Migration als d e n Weg anti-zipieren, in nichtfeminisierte Bereiche ihres Berufsfelds und der Gesund-heitspolitik allgemein aufzusteigen, den Status ihrer Berufsgruppe inner-halb der Gesundheitsberufe zu heben und selbst in Führungspositionen der Gesundheitspolitik zu agieren.Allgemein unterstreichen sie durch ihre individuell motivierten Migrati-onsprojekte den Anspruch, wesentli-che Lebensentscheidungen selbst zu treffen und ihre Lebensplanung ent-lang der persönlichen Prioritäten zu verfolgen. Dieses Selbstverständnis müssen sie in Malawi mit Familie und Gesellschaft verhandeln, insbesonde-re wenn sie z.B. als einziges Kind der Familie ausgebildet wurden mit dem Hintergedanken, dass sie als Frauen besonders große Verantwortung für die Familie übernehmen würden, auch finanziell. Oder auch wenn sie sich der sozialen Erwartung zu Heirat und Familiengründung entziehen wollen. Während dies nur einige Frauen be-traf, waren alle meine Gesprächspart-nerinnen noch unverheiratet und ca. ein Drittel ohne Partner – ein außerge-wöhnliches Bild in ihrem Alter (22 bis 24 Jahre).Migration wird von den jungen Frauen als Weg gesehen, die eigenen Projek-te zu verfolgen, ohne soziale Erwar-tungen zu verletzen: die Möglichkeit, Ersparnisse selbst zu verwalten und trotzdem die Familie zu uwnterstützen, einen individualisierten und als „west-lich modern“ eingeordneten Lebensstil zu verfolgen. Ohne den eigenen Ruf
oder das Ansehen der Familie zu be-schädigen, ihren akademischen Status zu heben und trotzdem eine Familie zu gründen sind hierbei wichtige Aspekte.
Migration: das Hindernis GeschlechtNicht zuletzt scheint der Status als erfolgreiche Migrantin, den sie sich erhoffen und der dem sozialen Bild über Migrantinnen als modernisierte Elite entspricht, ein Stück weit gen-derbezogene Hürden zu relativieren. Die Erwartung zu heiraten erscheint als einzige Ausnahme, was sich darin niederschlug, dass Verfechterinnen des Single-Lebens die einzigen waren, die eine langfristige Migration für sich in Betracht zogen. Gender ist nicht nur eine wichtige Dynamik im Hintergrund der Migrati-onsintentionen junger Pfleger_innen, es zeigt sich auch als Hürde für die Migration von Frauen, da die femini-ne Konnotation von Pflege für sie im persönlichen Umfeld besondere Ver-pflichtungen birgt: Mehrere Frauen sahen sich für die Pflege von Fami-lienangehörigen verantwortlich und mussten ihre Migrationsprojekte ent-sprechend mit diesen verhandeln und mit dem eigenen Verantwortungsge-fühl in Einklang bringen. Eine Situati-on, mit der sich keiner der männlichen Pfleger auseinandersetzte, selbst wenn sie akut pflegebedürftige An-gehörige hatten – für die dann ihre Schwestern sorgten ...
Frauensolidarität 3/2013
14
Frauensolidarität 3/2013
15Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
Innerhalb eines Jahres erschwerte eine Reihe von Fakto-ren die Aktionen von Organisationen wie MUDHA, die sich mit dem Thema Lohnarbeit der dominiko-haitiani-
schen Bevölkerung befassen. Die Zahl der Frauen, die ei-ner Lohnarbeit nachgehen, steigt, und auch die Nachfrage nach Hausangestellten ist im Anstieg begriffen. Gleichzei-tig merken viele Frauen, die migrierten, bei ihrer Ankunft, dass die am ehesten zu erreichende Nische für sie die Ar-beit als Hausangestellte ist, unabhängig von ihren Qualifi-kationen, ganz besonders wenn sie einen irregulären mig-rantischen Status besitzen. Das Zusammentreffen des Anstiegs der Nachfrage nach Hausangestellten und die begrenzten Arbeitsmöglich-keiten der Migrantinnen im Bereich der Hausarbeit füh-ren also dazu, dass hauptsächlich dominiko-haitianische Frauen und haitianische Migrantinnen ohne Dokumente als Hausangestellte arbeiten. Ein Bereich, der historisch immer ein weitgehend unsichtbarer war, informell und un-reguliert; ein Bereich, in dem diese Arbeit am ehesten als „Hilfe“ und nicht als „Lohnarbeit“ verstanden wurde. Ob-wohl die Frauen in der Migration einen so hohen Beitrag leisten, leben sie in Umständen, die sie verletzlicher ma-chen als Männer. Der Mann kann hinausgehen und Arbeit suchen, die Frauen dagegen können das nicht, da sie für die Familie verantwortlich sind. Manchmal kommen diese Männer nicht mehr zurück, und die Frauen werden zu Müt-tern, die alle Verantwortung allein tragen müssen. Diese Realität lässt den Frauen nur wenige Optionen. Arbeiten können sie oft nur als Haushaltshilfe, als Prostituierte oder wenn sie einen Mini-Handel betreiben. In der letzten Meinungsumfrage über bezahlte Hausarbeit präsentierte sich im Rahmen des Prozesses der regionalen Integration (SICA 2009) eine verblüffende Aufschlüsselung zwischen in der Dominikanischen Republik geborenen do-miniko-haitianischen Frauen und migrierten haitianischen Frauen. In der Darstellung zeigte sich, dass in der Studie nicht zwischen Migrantinnen und ihren Nachkommen un-terschieden wurde.Die Wirklichkeit in der Dominikanischen Republik stellt sich so dar, dass 90 % der Haushalte von alleinerziehenden Müttern geführt werden. Die alleinerziehenden dominiko-haitianischen Frauen übertragen ihren Status als Menschen ohne Papiere direkt auf ihre Kinder und dann auf ihre En-kel. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Familie, son-
A medida que las mujeres se insertan en la fuerza laboral remunerada, la demanda para servicios de trabajo doméstico remunerado va en aumento. A la
vez, muchas mujeres que migran para sostener sus propias familias encuentran que el trabajo doméstico es el nicho más accesible, independientemente de sus calificaciones, sobre todo cuando tienen un estatus migratorio irregular. El resultado de la confluencia de estos fenómenos es la creciente participación de las mujeres migrantes en el tra-bajo doméstico, que históricamente ha sido un sector may-ormente invisible, informal y no regulada, ya que se desem-peña en la casa y se le considera más bien como “ayuda” y no “trabajo”. Aunque el aporte de la mujer cuando llegan y su familia que residen en el país viven situaciones que la hacen más vulnerable que el hombre por ser mujer y den-tro de la población las mujeres son más afectadas. Si bien el hombre puede salir y buscar trabajo pero las mujeres no puede porque tienen que quedarse para atender la familia y estos hombre a veces no regresan y ellas se convierten en madre y padre asumiendo todas las responsabilidades; por esta realidad la mujer tiene como opciones el trabajo domestico, la prostitución o la posibilidad tener pequeños negocios como medio de producción. La encuesta más reciente sobre el trabajo doméstico re-munerado en RD en el marco del proceso de integración regional (SICA 2009) presenta un desglose confuso entre mujeres migrantes haitianas y mujeres nativas. En la mu-estra, se llevó a cabo aproximadamente una cuarta parte de las entrevistas con mujeres de ascendencia haitiana sin distinguir entre inmigrantes y sus descendientes. De de-scendencia haitiana/ migrantes haitianas/os afecta direc-tamente a la familia, la realidad dominicana es que el 90% de los hogares está liderado por mujeres madres solteras las cuales la indocumentación en las mujeres dominicana y de manera específica de las mujeres migrantes haitianas transfieren su estatus de ilegalidad a sus hijos, nietos y de-scendiente, y no solamente en la documentación estos ti-ene repercusiones también en el ámbito laboral donde las mujeres que carecen de documentos son expuestas a la explotación laboral por salarios desproporcionados, abuso de autoridad y violencia de género.
Übersetzung: Jule Fischer
Zu den Autorinnen: Cristiana Luis Francisca ist Präsidentin und Mit-begründerin von MUDHA; Sirana Dolis ist Koordinatorin und ebenfalls Mitbegründerin von MUDHA.
Las autoras: Cristiana Luis Francisca es Presidenta de MUDHA y una de las miembras fundadoras; Sirana Dolis es Coordinadora de MUDHA y también una de las miembras fundadora.
MUDHA – die Bewegung dominiko-haitianischer Frauen ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich der ganzheitli-chen Entwicklung der Bevölkerung mit haitianischer Herkunft in der Dominikanischen Republik widmet. In Anerkennung der Lebens-umstände der dominiko-haitianischen Bevölkerung als ethnischer Minorität verteidigt MUDHA deren Menschenrechte und zivilen Rechte und versucht ihre demokratische Partizipation zu stärken.
dern vor allem Auswirkungen im Bereich der Arbeit, wo diese Frauen unverhältnismäßig schlecht bezahlt werden und besonders stark der Ausbeutung durch Autoritäten sowie sexueller Gewalt ausgesetzt sind.Unbestreitbar ist, dass die Frauen dieses Sektors, deren Anzahl unbekannt ist, abhängig sind von drei grundlegen-den Faktoren: a) der Abwesenheit von Statistiken über die schlechten Bedingungen in der Migration nach Geschlecht, b) der verschleiernden Natur von Lohnarbeit im häuslichen Bereich und c) der Realität, dass viele Migrantinnen keine Dokumente bekommen oder sich in einem irregulären Sta-tus der Migration befinden.Diskriminierung und Rassismus gegen haitianische Mi-grant_innen erleben Menschen vor allem in den Bateyes (Gemeinschaftunterkünfte nahe den Zuckerrohrfeldern) der Dominikanischen Republik. Sie befinden sich in einem Zustand, der Entwicklung verunmöglicht, und wenn wir von Armut sprechen, müssen wir darauf hinweisen, dass die Gemeinschaften zu den ärmsten in der Dominikanischen Republik gehören.Inmitten der Hilflosigkeit dieser Gesellschaften unterstüt-zen Organisationen wie MUDHA und andere Organisatio-nen jene Menschen, die in den Bateyes leben, sich zu orga-nisieren und Bewusstsein über ihre Lage zu erlangen, um dieser Realität die Stirn zu bieten und von den Autoritäten eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen einzufordern. Zugleich werden Menschen darin ausgebildet, sich ihrer Si-tuation und Realität selbst zu ermächtigen.Darum gilt es, Verträge zu respektieren, die die Rechte von Migrant_innen und ihren Familien betreffen, die Arbeitssitu-ation im Land zu verbessern und Arbeitsrechte einzuhalten.
Las mujeres migrantes de este sector es incuestionable, se desconoce el número exacto que están empleadas en el trabajo doméstico debido a tres factores fundamentales: la ausencia de estadísticas sobre migración desagregadas por sexo; la naturaleza oculta de trabajo doméstico debido al ámbito privado en que se desempeña; y la realidad de que muchas mujeres migrantes están indocumentadas o tienen un estatus migratorio irregular.La Discriminación y el racismo en contra los/as migrantes haitianos/as es lo que viven los/as personas en los bateyes comunidades y barrio de Republica Dominicana. Están desprovistos de las condiciones necesarias para el desar-rollo y si hablamos de pobreza estas comunidades están dentro de los mas pobre del país. En medio del desamparo de estas comunidades, organiza-ciones como Mudha y otras organizaciones acompañan a las personas que viven en los bateyes para organizarse en la toma de conciencia para enfrentar esta realidad y exigir a las autoridades mejores condiciones de vida, también se les da capacitación para que tomen empoderamiento de su situación y realidad:
Respetar los convenio de los derechosde los migrantes y sus familias
Mejorar la situación laboral del paísCumplir con el Código del Trabajo.
Cristiana Luis Francisca und Sirana Dolis
Cristiana Luis Francisca Presidenta y Sirana Dolis Coordinadora
DIE SITUATION HAITIANISCHER MIGRANTINNEN UND IHRER NACHFAHREN IN DER DOMINIKANISCHEN REPUBLIK
SITUACION DE INDOCUMENTACION DE LA MUJER HAITIANA Y SUS DECENDIENTES EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Während des Jahres 2012 kamen in Bezug auf das Thema Arbeit der dominikanischen Bevölkerung mit haitianischem Hintergrund und haitianischen Migrant_innen Ereignisse auf, die die Situation derjenigen
Organisationen, die zu dieser Thematik arbeiten, erheblich veränderten. Die im Folgenden dargestellten Ereignisse haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft allgemein und speziell auf den Teil
der Bevölkerung, der ohne Papiere in der Dominikanischen Republik lebt.
En la Republica Dominicana durante el año dos mil doce (2012) en torno a la temática de trabajo hacia la población dominicana con ascendencia haitiana y migrantes haitianos/as se desarrollaron acontecimientos y situaciones que cambiaron de manera significativa los contextos operativos y acciones de las organizaciones
que trabajan la temática. Las situaciones que a continuación se explican han tenido gran repercusión de manera general en la sociedad dominicana y en particular en la población meta.
En relación con la población migrante haitiana, durante un año en torno al trabajo con esta población que reside en la Republica Dominicana, una serie de elementos dificultaron el desarrollo de la acción.
MUDHAes una organización no gubernamental cuyos fines están vinculados al desarrollo integral de la población domini-cana de descendencia haitiana, promoviendo su partici-pación en el proceso de defensa de los derechos huma-nos y civiles por el reconocimiento de su condición de
minoría étnica
Frauensolidarität 3/2013
16
Frauensolidarität 3/2013
17Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
Textilfabriken in Bangladesch – eine Endlosschleife aus Ausbeutung,
Katastrophe und Entsetzen?
Die im April 2013 eingestürzten Textilfabrikgebäude forderten das Leben vieler Arbeiterinnen und lösten
internationale Forderungen nach gerechteren Arbeitsbedingungen aus. Warum sich diese Szenerie stetig wiederholt und sich trotz aller Proteste nichts an der Arbeitssituation der Frauen ändert, wird im
folgenden Artikel untersucht.
Petra Dannecker
Die Bilder des eingestürzten Gebäudes im April 2013 in Bangladesch, in dem sich fünf Bekleidungsfabri-ken befanden, die für den globalen Markt produzie-
ren, haben die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie gelenkt. Die über 1200 Toten sowie die Bilder der verletzten Arbeiter_innen haben kurzzeitig den Ruf nach Mindestlöhnen und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen laut werden lassen. Die Schuldigen waren schnell gefunden: lokale Fabrikbe-sitzer, die „korrupte“ nationale Regierung sowie transna-tionale Konzerne, die ihre Produktion nach Bangladesch auslagern, um die Produktionskosten zu senken und auf dem Konsumgütermarkt weltweit konkurrenzfähig zu blei-ben. Dass die Senkung der Produktionskosten nur über geringe Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen und vor allem über niedrige Lohnkosten, gerade auch vor dem Hin-tergrund der Konkurrenz zwischen einzelnen Ländern und Regionen, möglich ist, wurde ebenso wenig thematisiert, genauso wenig wie die Rolle der Konsument_innen im glo-balen Norden, immer auf der Suche nach den günstigsten Angeboten. Die Arbeiterinnen blieben unsichtbar und Opfer: Opfer globaler Machtstrukturen, internationaler Konzerne, nati-onaler Regierungen und lokaler Geschlechterverhältnisse. Das alles trifft zweifelsfrei zu – was allerdings nach der Ka-tastrophe bleiben wird, ist einzig das Etikett „made in Ban-gladesch“ in unserer Kleidung.
Falsche Fragen – keine AntwortenAbermals wurden entscheidende Fragen nicht gestellt, etwa warum unter den Opfern so viele Frauen waren und wer diese Arbeiterinnen eigentlich sind. Das muss offen-sichtlich auch nicht gefragt werden, da das Bild der „billi-gen“, „ungebildeten“ und „fügsamen“ asiatischen Arbeite-rin so dominant, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung scheinbar so naturgegeben ist und vor allem weil seit Jahrzehnten argumentiert wird, Arbeitsmärkte seien ge-schlechtsneutral. Vorzugsweise im globalen Süden wird die Spezialisierung von Frauen auf den Reproduktionsbereich, ihre fehlende Bildung oder die Migration vom ländlichen in den städti-schen Raum für geschlechtsspezifische Segmentierung ver-antwortlich gemacht, sprich: die Angebotsseite. So dienen die Diskriminierungen außerhalb des Arbeitsmarkts und lokale Geschlechterverhältnisse der Legitimierung unter-schiedlicher Einbindung von Frauen und Männern in den Arbeitsmarkt und der darauf beruhenden Bezahlung. Die aktuelle Berichterstattung hat gezeigt, dass sich an der Konstruktion der „armen“ Frauen als unterdrückte „Ande-re“ in den letzten Dekaden wenig geändert hat. Mangelnde Qualifikation ist das Zauberwort in der Konst-ruktion weiblicher Tätigkeiten. Die Qualifikation von Frau-en ist ihre „typisch“ weibliche Fingerfertigkeit und Geduld. Im diskursiven Universum von Management, Arbeit und internationalen Konzernen stehen Nähmaschinen, , da sie einfach zu bedienen sind, für anspruchslose Technologie,
während Bügeleisen oder Schneidemaschinen als techno-logisch anspruchsvoller und risikobehaftet konstruiert wer-den, also mit männlichen Attributen versehen sind. Diese Verbindung von Maskulinität und Qualifikation ist mit Sta-tus verbunden und wird entsprechend höher entlohnt. Ihren Ursprung hat die geschlechtsspezifische Grenzzie-hung zwischen Tätigkeiten in der Natur des Produktions-prozesses, insbesondere in exportorientierten Sektoren. In Bekleidungsfabriken findet der Großteil der Arbeit (70 %) an Nähmaschinen statt, daher müssen gerade die Ar-beitskosten in diesem Bereich über die Konstruktion von Qualifikation bzw. fehlender Qualifikation niedrig gehalten werden. Überträgt man diese Argumentation auf globale Güterketten, wiederholt sich das Muster: je höher die Po-sition eines Unternehmens in der Kette, desto größer der Anteil der Arbeiter und desto höher die Entlohnung.
Sexualität und KörperlichkeitFrauen sind qua Geschlecht „fügsamer“, das prädestiniert sie nicht nur für die Rolle als Opfer, sondern auch als billi-ge Arbeitskräfte. Die „Fügsamkeit“ ist das Resultat spezi-fischer Formen der Kontrolle und Machtausübung in den Fabriken, die stark über Körperlichkeit und Sexualität her-gestellt wird. Neben spezifischen Kontrollmechanismen, wie dem Verschließen der Fabriken nach Arbeitsbeginn oder die Einschränkung der Mobilität – beides Ursachen für die vielen Toten bei den regelmäßigen Bränden in Fa-briken –, sind es die sexuellen Diskurse in den Fabriken, die die Schlüsselkategorie in der Konstruktion von Macht-beziehungen zwischen Geschlechtern am Arbeitsplatz her-stellen. Das „Verfügen“ über sexuelle Diskurse ist Macht, so wie es auch ein Ausdruck von Macht ist, anderen zu verbieten, an diesem Diskurs teilzunehmen. Der Gebrauch sexualisier-ter Sprache von männlichen Vorgesetzten und Kollegen ist nicht nur der Versuch, Frauen an „ihren“ Platz zu verweisen, sondern auch eine Strategie, männliches Zusammengehö-rigkeitsgefühl über männliche heterosexuelle Diskurse auf-zubauen.
BlickwechselTrotz der komplexen Herrschaftsverhältnisse agieren, erle-ben und erfinden sich die Arbeiterinnen immer wieder neu – sie sind politische Subjekte trotz der diskursiven Rahmung, dementsprechend müssen auch sie als aktive Akteurinnen wahrgenommen und angesprochen werden. Widerstand kann und sollte nicht reduziert werden auf gewerkschaft-liche Organisation oder auf Arbeitsbeziehungen. So kann die Migration vom ländlichen in den städtischen Bereich und die Suche nach einem Arbeitsplatz in einer der vielen Bekleidungsfabriken bereits als Form des Widerstands de-finiert werden, z. B. Widerstand gegen arrangierte Ehen oder gegen die Arbeit als Hausangestellte. Auch innerhalb der Fabriken sind die Arbeiterinnen trotz der beschriebenen Kontrollmechanismen nicht allein Opfer,
sie haben Netzwerke gebildet zur Bewältigung des Alltags außerhalb und innerhalb der Fabriken und zum Austausch von Wissen, von Taktiken und Informationen. Sie kämpfen gemeinsam für bessere Bezahlung oder gegen verspätete Lohnzahlung – trotz der Versuche, über die Organisation der Arbeit Proteste im Keim zu ersticken. Genau diese For-men des Widerstands werden von den Akteur_innen, die nach der Katastrophe medienwirksam mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen eingefordert haben, nicht berücksichtigt. Die traditionellen Gewerkschaften in Bangladesch, die meist eng mit politischen Parteien kooperieren, haben die Arbeiterinnen in den Bekleidungsfabriken lange Zeit nicht wahrgenommen, ebenso wenig wie die internationalen. Fehlendes Bewusstsein, ländliche Herkunft und mangelnde Bildung werden immer wieder als Ursachen herangezogen, um das sogenannte Desinteresse der Arbeiterinnen an ge-werkschaftlicher Arbeit zu erklären. War das der Grund, warum die Arbeiterinnen selbst nach der Katastrophe nicht zu Wort kamen, dass stattdessen eine Vielzahl von nationa-len und internationalen Akteuren für sie gesprochen hat?
FazitVor 20 Jahren begann ich mich mit dem Bekleidungssek-tor in Bangladesch zu beschäftigen, seitdem hat sich nichts geändert, weder die Arbeitsbedingungen noch die Bezah-lung. Auch die internationale und nationale Bestürzung nach Katastrophen wie zuletzt in Savar folgt dem gleichen Muster und wird erneut folgenlos bleiben. Unverändert blieb die Bereitschaft der Arbeiterinnen, Or-ganisationen zu gründen oder zu unterstützen, wenn diese ihren unterschiedlichen Lebensrealitäten Rechnung tragen. Geblieben ist leider auch die mangelnde Unterstützung für die Arbeiterinnen und die Tatsache, dass viel zu selten die Arbeiterinnen und deren Lebens- und Arbeitswelten sowohl der Ausgangspunkt als auch im Zentrum interna-tionaler Berichterstattung und transnationaler Solidarität stehen. Das hätte die Katastrophe wahrscheinlich nicht ver-hindert, aber es hätte gezeigt, dass die Arbeiterinnen um ihre Rechte wissen, sie allerdings Unterstützung brauchen, damit diese umgesetzt werden können, und nicht Mitleid, welches beim nächsten Kleidungskauf wieder verflogen ist.
Lesetipps: Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen e. V. (2012): Entwicklungspolitik, Gewerkschaften und Wissenschaft zu globalen Arbeitsrechten und Sozialstandards. Frankfurt a. M. // Kabeer, Naila (2008): Globalization, labor standards, and women’s collective rights: dilemmas of collective (in) action in an interdependent world, in: Feminist Economics, 10 (1) 3-35.
Zur Autorin: Petra Dannecker ist Professorin für Entwicklungssozio-logie und Leiterin des Instituts für Internationale Entwicklung an der Universität Wien. Sie arbeitet zu den Themenfeldern Entwicklungspoli-tik, Globalisierung und Migrationsprozesse, Gender Studies, Transnati-onalismus und Migration.
Frauensolidarität 3/2013
18
Frauensolidarität 3/2013
19Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
JES UZUMEM AIS TERIZ HERANAM –
Ich will hier weg
Der erste Genozid des 20.Jahrhunderts, 70 Jahre Fremdherrschaft und eine radikale Wende zur wirtschaftlichen Liberalisierung sind die Schlagwörter, welche die jüngere Geschichte der Armenier_innen
kennzeichnen. Der Wandel zur Errichtung einer Gesellschaft, in der faire Geschlechterbeziehungen herrschen, vollzieht sich leider nicht im selben Tempo wie die einschneidenden Ereignisse des letzten
Jahrhunderts in dem kleinen Staat im Südkaukasus.
Nadine Spring
Seit 1991, mit dem Zusammen-bruch der Sowjetunion, ist Ar-menien ein unabhängiger Bin-
nenstaat, der weit weniger Fläche umfasst als die eigentlichen traditio-nellen Siedlungsräume des südkau-kasischen Volkes. Der erste große Flüchtlings- und Auswanderungs-strom ereignete sich im Zuge des Ge-nozids der Türken an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Hun-derttausende armenische Flüchtlinge wanderten vor allem nach Frankreich, in den Iran und in Länder des Nahen Ostens wie Syrien (wo auch heute noch 2 bis 3% der Bevölkerung Arme-nier sind), in den Libanon und den Irak aus. Teilweise wurden Frauen jedoch auch mit türkischstämmigen Männern
zwangsverheiratet, was automatisch auch die Konvertierung zum Islam bedeutete. Die Endgültigkeit dieser Wende in ihrem Leben wurde oft mit der Tätowierung eines Halbmondes auf den Handrücken der Frauen be-siegelt.
Die Macht der VeteranenNach dem Krieg, als Armenien 1921 als Teilrepublik in die Sowjetunion ein-gegliedert wurde, veränderte sich die Situation für Frauen wie auch für Män-ner. Die armenische Identität und Kul-tur wurde in der Sowjetrepublik weit-gehend unterdrückt. Russisch wurde zur Unterrichtssprache, Intellektuelle wurden umgebracht oder deportiert, und der Kontakt zu im Ausland leben-
den Armenier_innen wurde als kos-mopolitischer Verrat gebrandmarkt und verfolgt. Die Unterdrückung der vertrauten Traditionen ist mitunter die Ursache für die Vormachtstellung der Veteranen, welche in den frühen 90er-Jahren aufgrund eines Grenzkonflikts um das Gebiet Berg Karabach gegen Aserbaidschan kämpften. Viele ein-flussreiche Politiker, u.a. der vor kur-zem wiedergewählte Präsident Sersch Asati Sargsjan, stammen aus der Re-gion Berg Karabach. Diese kleine männliche Elite war bis heute relativ erfolgreich in ihrer Machterhaltung, auch wenn nach den Präsidentschafts-wahlen 2008 Proteste aufkamen, bei denen offiziell acht Menschen ihr Le-ben ließen.
Ungenutzte UnabhängigkeitÜber 20 Jahre nach der Unabhängig-keit sind die Fakten über die men-schenrechtliche Stellung der Frau ernüchternd: Waren es damals 35%, sind heute gerade mal 10% der Parla-mentsabgeordneten Frauen, obwohl diese Zahl in den letzten Jahren wie-der leicht angestiegen ist. Armenien rühmt sich oft mit dem hohen Beschäf-tigungsanteil von Frauen, wobei dabei außer Acht gelassen wird, dass die Haus- und Erziehungsarbeit noch im-mer fast ausschließlich von den Frauen getragen wird. Schon zu Zeiten der Sowjetunion wa-ren die Armenier_innen in punkto Frauenthemen eine eher patriarchale Gesellschaft: Beschäftigung fanden Frauen vor allem im Haushalt, die Scheidungsraten und die Zahl der al-leinerziehenden Mütter ist sehr ge-ring.Darüber hinaus ist ein alarmieren-des Problem die häusliche Gewalt und deren Akzeptanz in der Gesellschaft. Da die Beziehung zwischen Mann und Frau als Privatsache angesehen wird, findet zum einen keine öffentliche De-batte darüber statt, auf der anderen Seite gibt es nur wenige Stellen, an die Frauen sich wenden können. Die Po-lizei wie auch Ärzte weigern sich oft, Fälle von Missbrauch zu dokumentie-ren und zu melden, da dies kein The-ma darstellen sollte, das eine Frau mit ihrem Arzt bespricht.
Von allen SeitenLaut Amnesty International ist Gewalt in der Familie aber keineswegs nur ein männliches Phänomen. Die Organi-sation berichtet von Fällen, in denen Frauen, die nach der Hochzeit in der Regel bei der Familie des Mannes le-ben, oft von ihren Schwiegermüttern durch Schläge gezüchtigt werden. Bei einer anonymen Umfrage gaben 46 von 100 Frauen an, schon einmal Op-fer von Gewalt innerhalb der Familie geworden zu sein, einige erzählten sogar von sexuellem Missbrauch. Nur sechs dieser 46 Frauen meldeten die Missstände bei den Behörden.Im Mai 2012 wurde die Aggression
Lesetipps: von Gumppenberg, Marie-Carin/Steinbach, Udo (2010): Der Kaukasus. Ge-schichte – Kultur – Politik (2. neu bearbeitete Auflage). München: C.H. Beck. // Hofmann, Tessa (1993): Die Armenier. Schicksal – Kultur – Geschichte. Nürnberg: DA Verlag Das Andere. // Hofmann, Tessa (1994): Armenier und Armenien – Heimat und Exil. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt
Zur Autorin: Nadine Spring hat Internationale Entwicklung studiert und den Fokus ihrer Bachelorarbeit auf die armenische Diaspora gelegt. Im Moment ist sie Studentin der Rechtswissenschaften an der Uni Wien.
Warum ein Großteil derarmenischen Frauen ihr Glück
im Ausland sieht
gegen engagierte Frauenrechtsakti-vistinnen sogar in die Öffentlichkeit getragen. Laut Human Rights Watch verübte eine gewalttätige Gruppe auf eine Bar in Jerewan, welche gerne von Aktivistinnen sowie von Homo- und Transsexuellen besucht wird, einen Anschlag mit einer selbst gebastelten Bombe. Ein stellvertretender Sprecher des Parlaments begrüßte den Vorfall, zwei der Verdächtigen wurden kurz nach ihrer Festnahme wieder freige-lassen.
Privatisierung und wirtschaftliche Ohnmacht
Die wirtschaftliche Ohnmacht, vor al-lem der Frauen, spielt in diesem ge-sellschaftlichen Gefüge eine zentrale Rolle. Durch die schlagartige Privati-sierung aller Unternehmen nach der Unabhängigkeit und die damit verbun-dene Schaffung einer Zweiklassenge-sellschaft wanderte seither über eine Million Armenier_innen aus. Die his-torische Belastung des armenischen Volkes trug dazu bei, dass heute nur noch ein Drittel aller Armenier_innen in der Republik Armenien leben, das sind ca. drei Millionen Menschen. Der Großteil der Auswanderer waren Män-ner zwischen 20 und 40 Jahren, um im Ausland Geld zu verdienen, während die Frauen zu Hause blieben, die Kin-der erzogen und versuchten, die Fami-lienkasse doch irgendwie durch Arbeit im Inland zu füllen.Trotz des höheren Anteils der Männer im Bezug auf bezahlte Beschäftigung haben Frauen in Armenien einen hö-heren Bildungsstand. Gesunkene In-vestitionen in Bildung unter Bevorzu-gung der traditionellen Bereiche der Wirtschaft, aus der vor allem Männer ihr Einkommen beziehen, spielen hier möglicherweise eine Rolle. Sehr vie-le Frauen, die die Möglichkeit eines Universitätsabschlusses wahrnahmen, setzen sich eine gut bezahlte Arbeits-stelle in einer der westlichen Indust-rieländer zum Ziel. Sind Frauen nicht in den Genuss einer akademischen Ausbildung gekommen, gibt es noch die Möglichkeit, ihr Glück im Ausland
durch die Heirat mit einem armeni-schen Mann der Diaspora zu finden. Die Tatsache, dass Frauen dadurch in vielen Fällen noch abhängiger von ih-ren Männern sind, da sie die Sprache ihrer neuen Heimat nicht sprechen und durch die restriktive Fremdenpo-litik der Aufnahmeländer teilweise jah-relang nicht arbeiten dürfen, wird den Betroffenen manchmal erst im Nach-hinein bewusst. Trotzdem zieht ein Großteil der weiblichen Bevölkerung diese Ungewissheit der Aussicht vor, ihr Leben in Armenien aufzubauen.„Quo vadis?“ Frauenorganisationen gibt es aufgrund der fehlenden zivil-gesellschaftlichen Emanzipation nur sehr wenige. Die bestehenden Or-ganisationen wie das „Women’s Res-source Center Armenia“, welches eine Anlaufstelle für Frauen und ihre Pro-bleme bietet als auch aktiv an einem Demokratisierungsprozess im Hin-blick auf Frauen jeden Alters beteiligt ist, werden in den meisten Fällen von Gruppierungen der Diaspora finanziell unterstützt. Die rund 50 offiziell akti-ven Frauenorganisationen innerhalb Armeniens haben demzufolge noch einen langen Kampf vor sich. Es ist absehbar, dass die ältere Gene-ration, welche von Fremdherrschaft, Krieg und Isolation mit den Nachbar-ländern geprägt ist, irgendwann von einer jüngeren, dynamischen Gene-ration abgelöst wird. Bis dieser Tag kommt, werden aber vermutlich noch viele junge Frauen und Männer das Land verlassen, um ihr Glück an einem anderen Ort zu suchen.
Frauensolidarität 3/2013
20
Frauensolidarität 3/2013
21Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
„(NO) PAPERS FOR ALL“Ein feministischer, kritischer Blick aufdas neue Staatsbürgerschaftsgesetz
Steve Mayer, Irene Messinger und Petra Pint
Die Staatsbürgerschaftsnovelle 2013 stellt eine neue Spielart der Exklusion dar, die zur gezielten Entrechtung und Hierarchisierung
bestimmter Gruppen von Migrant_innen führt. Über die Ablehnung der restriktiven Zugangsmöglichkeiten hinaus muss eine
feministische und kritische Migrationsforschung radikaler ansetzen.
Anfang Juli 2013 wurde eine neuerliche Novelle des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes be-schlossen. Im europäischen Vergleich bleibt das
Gesetz eines der restriktivsten, es beharrt auf dem Prin-zip der Abstammung, lehnt Doppelstaatsbürgerschaften ab und fordert von potentiellen Staatsbürger_innen lange Wartezeiten von sechs bis zehn Jahren ununterbrochenen legalen Aufenthalts, weiters Unbescholtenheit, ein regel-mäßiges Einkommen und ein Bekenntnis zur österreichi-schen Nation. Ist der teure Spießrutenlauf durch Ämter und Behörden überstanden, gilt es, sich feierlich zum Staat zu bekennen, müssen doch ab 2013 Staatsbürgerschaftsver-leihungen verpflichtend in feierlichem Rahmen erfolgen – gemeinsames Absingen der Bundeshymne inklusive.
Forschung stützt Herrschaft …Fragen um Abschottung und selektive Zulassung werden nicht nur auf österreichischer, sondern vermehrt auch auf europäischer bzw. EU-Ebene gestellt. Diskurse um Migrati-on, um „Wirtschaftsflüchtlinge“ vs. „echte Flüchtlinge“, so-genannte „freiwillige Rückkehr“ und soziale wie nationale Sicherheit verschmolzen im Laufe der 1990er-Jahre zu ei-ner unappetitlichen Mischung. Die Verteidigung „unserer“ Sicherheit rückte immer mehr in Richtung eines Schutzes
vor „den Anderen“ innerhalb der jeweiligen Nationalstaa-ten. Stets geht die vermeintliche Bedrohung von Menschen aus, die allein ihre „falsche“ Hautfarbe, Staatsbürger_in-nenschaft oder Sprache verdächtig macht. Die aktuell gängige Mainstream-Migrationsforschung ver-schiebt nun tendenziell diesen Fokus, indem sie den „Nut-zen“, den Migrant_innen der Mehrheitsgesellschaft bringen (müssen), ins Zentrum rückt – sie bleibt dabei aber genau jenen Klassifikationen und Hierarchisierungen verhaftet, die auch offen rassistische Diskurse und Politiken prägen. Grundlage dafür ist eine Perspektive, die Menschen klar in „Wir“ und „die Anderen“ einteilt und beispielsweise entlang von vermeintlicher ethnischer Zugehörigkeit, Auf-enthaltsstatus und vor allem Staatsbürger_innenschaft dif-ferenziert.Die Effekte einer solchen Forschung, die sich in erster Linie als Politikberatung versteht, lassen sich an der aktuellen Novelle ablesen: Diese zeichnet sich u.a. durch die „Erleichterung“ aus, dass „besonders gut integrier-te“ Personen die Staatsbürgerschaft schon nach sechs Jahren erwerben können, doch dafür müssen sie – neben den erwähnten restriktiven Zugangsvoraussetzungen – hervorragende Deutschkenntnisse und zeitintensives eh-renamtliches Engagement in anerkannten Organisationen nachweisen. „Integration“ wird als von Migrant_innen indi-
feministischen Bewegungen auf aktivistischer wie akade-mischer Ebene. Im deutschsprachigen Raum wurde spä-testens ab Anfang der 1990er-Jahre die Bedeutung von Kategorien – und insbesondere die politische Tragfähigkeit der Identifikation als „Frau“ – in Frage gestellt. In diesen Debatten wurde feministische Theorie insbesondere von antirassistischen, migrantischen und Schwarzen Aktivistin-
nen sowie von Jüdinnen und Frauen mit Behinde-rung kritisch weiterent-wickelt.Wenn heute in – meist akademisch geprägten – Debatten (zu Recht) ein antirassistischer Grund-konsens und eine Refle-xion der eigenen Ver-stricktheit in Macht- und Herrschaftsverhältnisse eingefordert werden, bleiben diese (Bewe-gungs-)Geschichten zu oft unerwähnt. Für jede sich als kritisch und femi-
nistisch verstehende Forschung wäre daraus freilich min-destens zu lernen, dass stets jene Kategorien, die die Basis des eigenen Denkens darstellen, am dringendsten der Re-flexion bedürfen. Ähnlich wie „Geschlecht“ hier zu einem ohne jeden Zweifel weiterhin relevanten, doch nicht mehr unproblematischen und quasi natürlichen Faktor gemacht wurde, bedarf „Staatsbürgerschaft“ einer grundsätzlichen Hinterfragung. Nicht nur als historisches Beispiel braucht kritische und feministische (Migrations-)Forschung den Bezug zu Bewe-gungen. So wurden anhand der jüngsten Refugee-Protest-bewegung in Wien Bewegungsfreiheit, das Aufbrechen der starren Grenzen in Asyl- und Migrationssystemen und die Durchsetzung elementarer Menschenrechte wieder zum Thema gemacht. Die massive Reaktion des österreichi-schen Staates in Form von Kriminalisierung, Polizeigewalt und Abschiebungen gibt einen Hinweis auf die Relevanz dieser Proteste, die nicht (nur) die schlechte Verwaltung des Systems, sondern dessen Grundregeln in Frage stellen. Wenn Refugees sich weigern zu akzeptieren, dass sie durch fehlende Papiere zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden, denen der Staat nach Lust und Laune ihre Würde, ihr Recht auf Unversehrtheit und ihr Recht auf Leben ent-ziehen kann, wird die Demo-Parole „(No) Papers for all“ zur Praxis.
Webtipp: » www.univie.ac.at/kritische-migrationsforschung
Zu den Autorinnen: Steve Mayer, Irene Messinger und Petra Pint sind Politikwissenschaftlerinnen in Wien und Mitglieder der Forschungs-gruppe [KriMi] – Kritische Migrationsforschung.
viduell zu erbringende Leistung verstanden. Mit einem fe-ministischen Blick auf intersektionelle Diskriminierung, also das Zusammenwirken unterschiedlicher Dimensionen von Ungleichheit, wird deutlich, dass Migrantinnen von diesen Anforderungen in besonderer Weise betroffen sind: (Nur) ökonomisch erfolgreiche Migrant_innen, die Zeit finden, sich für die Interessen des Gemeinwohls zu engagieren, werden als potentielle zukünftige Österrei-cher_innen willkommen geheißen – alle ande-ren geraten aufgrund ihrer vermeintlich man-gelnden sozialen und kulturellen Integrations-fähigkeit in Verdacht, eine Gefahr für den na-tionalen Wohlstand und sozialen Zusammenhalt darzustellen. Kritische und feministische Mig-rationsforschung muss die Annahmen, die dem herrschenden Migra-tions- und Integrationsparadigma zu Grunde liegen, auf mehreren Ebenen in Frage stellen. Eine solche Perspektive ermöglicht es zunächst, nach den institutionellen Bedin-gungen zu fragen, die Ungleichheit reproduzieren. Dann geraten Fragen rechtlicher und institutioneller Diskriminie-rungen ebenso in den Blick wie jener alltägliche Rassismus, der soziale Ungleichheit (mit)reproduziert. Dabei macht es natürlich nicht zuletzt die prekäre soziale und ökonomische Lage vieler Migrant_innen notwendig, dass kritische Mig-rationsforschung auch kapitalistische Herrschafts- und Pro-duktionsverhältnisse analysiert. Nicht zuletzt muss der ökonomisierende Diskurs über „Migration als Nutzen für die nationale Wirtschaft“ in Beziehung zu neoliberalen Flexibilisierungsprozessen gebracht werden. Durch die Entrechtung von Migrant_in-nen werden so ständig neue Ausbeutungsverhältnisse ge-schaffen, etwa in der Haus- und Pflegearbeit oder in Form von Saisonnier-Beschäftigung. Radikale feministische Kritik muss jedoch weiter gehen und die Kategorie Staatsbürger-schaft als Differenzierungstool per se ebenso wie deren „Normalität“ in Frage stellen. Gerade dieses Hinterfragen grundlegender Kategorien des (auch wissenschaftlichen) Denkens erscheint uns als Kern einer kritischen Perspekti-ve. Ebenso wichtig ist dabei auch die Reflexion der eigenen Involviertheit in den Prozess der Kategorisierungen, in For-schungs- oder politischer Arbeit.
Kritik braucht Bewegung …Diese Kritik der Kategorien ist freilich keine „Erfindung“ der kritischen Migrationsforschung, sondern findet ihre Basis nicht zuletzt in antirassistischen und postkolonialen
Frauensolidarität 3/2013
22
Frauensolidarität 3/2013
23Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
SAN PEDRO SOLOMA:GENDER UND CITIZENSHIP IN DER TRANSNATIONALEN MIGRATIONDie transnationale Familie, die „weiße Witwe“
und die Politisierung der Mutterschaft
Stefanie Kron
Seit Mitte der 1990er-Jahre ist die USA-Migration in San Pedro Soloma zu einer sozialen Norm geworden. Die so genannte „coyotaje“, die Transmigration
der Männer, hat neue grenzüberschreitende Praktiken und Beziehungen herausgebildet. Dies hat zum Auftauchen neuer geschlechtsspezifischer Subjektivitäten geführt, die es etwa den „viudas blacas“ ermöglicht, als
anerkannte politische Subjekte in Erscheinung zu treten.
Der kleine guatemaltekische Landkreis (municipio) San Pedro Soloma liegt etwa 80 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt in den von Armut
geprägten und dünn besiedelten Bergen der „Sierra de Cuchumatanes“. Die große Mehrheit der etwa 37.000 Ein-wohner_innen bezeichnet sich selbst als „Kanjobales“, eine der 22 indigenen Gruppen Guatemalas. San Pedro Soloma ist heute auch über Guatemalas Grenzen hinaus bekannt: Das „municipio“ gilt als „pueblo sin ley“, als Ort ohne Gesetz, in dem die Intermediäre der irregulären Migration, die „coyotes“, und die zumeist irreguläre Migrati-on der Männer in die USA seit etwa 20 Jahren das kollektive Leben im Ort bestimmen. Die Mehrheit der männlichen Be-völkerung führt eine Art mobilen Lebensstil zwischen Solo-ma und den USA. Ihre monetären Transfers (remittances) und die Einkünfte der „coyotaje“ bilden die ökonomische Basis der meisten Familien wie auch der Kommune von Soloma.In Soloma hat seit Mitte der 1990er-Jahre die coyotaje auf der Ebene des „municipio“ zum Auftauchen neuer ge-schlechtsspezifischer und ethnisch markierter Akteur_in-nen und Subjektivitäten geführt, die trotz ihrer Informalität
demokratische Ideen und Partizipationsformen beinhalten und damit die nationalstaatlich determinierten Machtbe-ziehungen in Bezug auf „race“, class und gender verändern können. Saskia Sassen analysiert dieses Auftauchen neuer sozialer wie politischer Subjekte und Räume und fordert eine Neubestimmung der bisher nationalstaatlich definier-ten Institution „Citizenship“.
Citizenship im Kontext der irregulären Migration Informelle „Citizenship“-Praktiken können mit den natio-nalen und territorialen Beschränkungen formaler Staats-bürgerschaftskonzepte nicht erfasst werden. Bezogen auf transnationale Migration, spricht Sassen von der Entwick-lung informeller, deterritorialisierter und denationalisierter „Citizenship“-Praktiken. Dies öffnet den Blick für Formen geschlechtsspezifischer Partizipation und Aktivitäten von Individuen, die nicht als politische Subjekte anerkannt wer-den und in Räumen agieren, die als apolitisch gelten, wie der Haushalt, die Familie oder die Community. Sassen analysiert die „Politisierung der Mutterschaft“ (mothering) als ein „Bündel geschlechtsspezifischer
Die männliche Subjektposition des transkulturellen „nor-teño transeúnte“ hat deshalb ihren weiblichen Gegenpart in der „weißen Witwe“ (viuda blanca), wie die zurückblei-bende Partnerin eines USA-Migranten genannt wird. Sie erhält viele neue Pflichten, aber wenig neue Rechte. Gleich-wohl haben „social remittances“ erste Ansätze neuer ge-schlechtsspezifischer „Citizenship“-Praktiken unter den „viudas blancas“ hervorgebracht. Beispielsweise kursiert das Wissen darüber, dass Gewalt gegen Frauen in den USA strafrechtlich verfolgt wird und Frauen dort für ihre Rechte eintreten. So haben sich, vorangetrieben von den „viudas blancas“, Frauengruppen gegründet, die gegen häusliche Gewalt und Alkoholmissbrauch eintreten oder Frauen und Kinder unterstützen, die von ihren Partnern in den USA verlassen worden sind. Diese werden von der katholischen Kirche in Soloma unterstützt. Die Subjektposition der „viuda blanca“ lässt sich diesbe-züglich als Aktualisierung des katholischen Marien-Bildes der leidenden und aufopferungsvollen Mutter interpre-tieren, das sich die Frauengruppen in Soloma angeeignet haben, weil sie eine anerkannte Sprecherinnenposition für Frauen ist.
FazitDie informellen, denationalisierten und deterritorialisierten Räume, in denen die skizzierten „Citizenship“-Praktiken ausgeübt werden, sind geschlechtsspezifisch differenziert. Während die „coyotes“ und Transmigranten kulturelle wie soziale Mobilität und damit die Aneignung der zentralen Orte und Ämter im öffentlichen Raum der „cabecera mu-nicipal“ erreicht haben, sind die Räume der Partizipation der Frauen auf den Haushalt, die Familie und die katholi-sche Kirche beschränkt. Dennoch lassen sich auch bei den Frauen neue „Citizenship“-Praktiken – wie die Politisierung der „viuda blanca“ und die Politisierung der Mutterschaft – beobachten.
Literaturtipps: Der vollständige Artikel in: Reese, Welkmann (Hg.), (2010): Das Echo der Migration. Unkel-Verlag. // » Kron, Stefanie (2007): El estilo solomero no tarda mucho. Negociando la frontera en la transmigración q’anjob’al, in: Manuela Camus (Hg.). Comunidades en movimiento. La migración internacional en el norte de Huehueten-ango (Antigua Guatemala: Junajpu) // » Levitt, Peggy (2001): The Transnational Villagers.Berkeley/Los Angeles/London // » Molyneux, Maxine (2001): Gender and Citizenship in Latin America: Historical and Contemporary Issues, in: Maxine Molyneux, Women’s Movements in International Perspective: Latin America and Beyond. New York // » Sassen, Saskia (2002): The Repositioning of Citizenship: Emergent Subjects and Spaces for Politics. Berkeley.
Zur Autorin: Stefanie Kron ist Soziologin und derzeit Gastprofessorin für sozialwissenschaftliche Entwicklungsforschung am Institut für Inter-nationale Entwicklung der Universität Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Migration und Migrationspolitiken, Gender Studies, postkoloniale Theorie, soziale Bewegungen. Ihr regionaler Schwerpunkt sind die Amerikas.
„Citizenship“-Praktiken“. Die strategische Positionierung und Repräsentation als Mütter und Hausfrauen ermögliche es den Frauen, Zugang zum öffentlichen Raum zu erhalten, ihre menschenrechtlichen und sozioökonomischen Forde-rungen zu artikulieren und als politische Subjekte aner-kannt zu werden.
Soloma: gesetzloser Ort oder Modell transnationaler Citizenship-Praktiken?
Der „coyote solomero“ ist zu einem neuen transnationalen Akteur geworden, dessen kommerzielle Aktivitäten im Be-reich der Organisation der irregulären Migration ihm auf der Ebene des „municipio“ Soloma u.a. soziales Prestige eingebracht haben. Sein Leben ist geprägt von Strategien der kulturellen Verhandlung und Mobilität, d. h. der perma-nenten Überschreitung politischer, kultureller und sozialer Grenzen. So gehört das Beherrschen der indigenen Spra-che „Kanjobal“ zu den unerlässlichen Bedingungen, um in-nerhalb der indigenen Bevölkerung anerkannt zu werden. In Mexiko hingegen muss sich der „coyote solomero“ als Mexikaner präsentieren, in den USA wiederum gibt er sich als „Chicano“ aus, um nicht als illegaler mexikanischer Mi-grant zu gelten. Diese Strategien der Camouflage machen den „coyote“ in Soloma zum kulturellen Modell für einen transmigran-tischen Lebensentwurf, den vor allem junge Männer zwi-schen 15 und 35 Jahren annehmen und der eine neue maskuline transkulturelle Subjektivität hervorgebracht hat – den sogenannten „Passanten aus dem Norden“ (norte-ño transeúnte). Hierzu schreibt Luis Arriola, dass die Sub-jektivität des „norteño transeúnte“ als Synchretismus aus Männlichkeitskonzeptionen der „Kanjobales“ und Elemen-ten der „Chicano“-Kultur in den USA zu verstehen ist.
Rolle und Bedeutung der „weißen Witwen“ Die Familie bildet den wichtigsten Motor transnationaler migrantischer Aktivitäten sowie gleichzeitig die Basis der kulturellen Reproduktion der „Kanjobal“-Gemeinschaft in Soloma, wobei die spezifische Ausgestaltung der Ge-schlechterrollen die männliche Dominanz der Migration in die USA bedingt. Die USA-Migration der Männer kann daher als eine aktualisierte Form der Reproduktion der ge-schlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Migrationszyklus verstanden werden: Der Mann geht und die Frau bleibt.Die in Soloma zurückbleibenden Frauen spielen eine zentrale Rolle für das Funktionieren des transnationalen Haushalts. Sie übernehmen Aufgaben, die zuvor männlich definiert waren: sie verwalten das Eigentum und die „re-mittances“ des Haushaltes, betreiben Handel und über-nehmen die Ämter der abwesenden Männer in den kom-munalen Entwicklungskomitees. Dennoch wird der Mann – auch in seiner Abwesenheit – als die höchste Autorität des Haushaltes gesehen, und die Aktivitäten der zurück-bleibenden Frauen werden von ihren Familienangehörigen und den Gemeindeautoritäten kontrolliert.
Frauensolidarität 3/2013
24
Frauensolidarität 3/2013
25Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
CHINASWANDERARBEITERINNEN
2013Kurze Geschichte einer
Frauenmehrheit
Astrid Lipinsky
Nach dreißig Jahren lohnt sich ein neuer Blick: In den 1980er-Jahren begann mit der städtischen Nachfrage nach Billigarbeitskräften und der Lockerung des inländischen Reiseverbots die Flut der Wanderarbeiter_innen vom Dorf. Heute
wird ihre Gesamtzahl auf mindestens 262 Millionen geschätzt.
Zuerst wanderten vor allem Männer auf die städti-schen Baustellen – Frauen, Kinder und Alte blieben im Dorf und kümmerten sich um die Landwirtschaft.
Die Männer blieben nicht auf Dauer in der Stadt, häufig kamen sie passend zur Ernte zurück.
Die FließbandarbeiterinDann siedelten sich Textil-, Elektronik- und IT-Fabriken vor allem in den Exportsonderzonen nahe Hongkong, in Shenz-hen und Dongguan, an. Für ihre Fließbänder rekrutierten sie bevorzugt junge unverheiratete Frauen, sie galten als fleißiger und gehorsamer als Männer, als geschickter beim Kleinteile-Zusammenbauen. Billiger waren sie auch, und sowieso ist die Textilindustrie, auch in China, eine Frauen-branche. Mehr als 80 % der Wanderarbeiter_innen im Per-lflussdreieck sind weiblich und zwischen 18 und 22 Jahre jung. Den Mädchen kam es auf den kurzzeitigen, möglichst hohen Verdienst an, mit dem sie die Schulbildung ihrer Brü-der finanzierten oder für die eigene Mitgift sparten. Es war ihnen nur recht, dass die Überstunden ihnen keine Zeit zum Geldausgeben am Arbeitsort ließen. Die Eltern beruhigte es, dass Dorfnachbarinnen oder Mitschülerinnen mit vor Ort waren. Das Firmenwohnheim ähnelte sogar ein biss-chen dem Studentenwohnheim, da waren die Töchter si-cher und vor der bösen städtischen Umwelt geschützt. Die Unternehmen sparten die Fortbildungskosten. Lange gab es jährlich nach dem Frühlingsfest ausreichend Nachschub für das Fließband. Mit der Jahrtausendwende änderte sich aber einiges: Es kam zu mingonghuang, einem Mangel an billigen Arbeits-kräften vom Dorf. Die Exportunternehmen reagierten mit dem Abzug in noch weniger entwickelte und deshalb preisgünstigere Regionen innerhalb Chinas oder gleich ins Ausland nach Vietnam oder Bangladesh – oder in das arme
Südosteuropa wie Albanien und Rumänien. Die Mädchen fanden genauso gut bezahlte Arbeitskräfte näher von zu hause. Chinas Geburtenpolitik mit maximal zwei Kindern auch im ländlichen China wurde Anfang der 1990er-Jahre erstmals flächendeckend umgesetzt, und eins von zwei Kin-dern schicken Eltern nicht mehr bereitwillig in die Ferne. Im Gegenteil sind sie bereit, ihr Geld auch in die Ausbildung der Töchter zu stecken.
Die Aufwertung und die Diversifizierung der dagongmeiChina ist riesig, und „die“ Wanderarbeiterin gibt es heute nicht mehr. Sie blieb so kurzfristig wie eine Semesterferi-enpraktikantin, und deshalb wurde ihre (nicht versicherte) Arbeit verächtlich als dagong, als bloßes Herumjobben, klassifiziert. Jung und unqualifiziert war sie, deshalb mei, kleine Schwester. Mit der Bezeichnung als dagongmei wur-de die weibliche Wanderarbeit entqualifiziert und informa-lisiert, die Wanderarbeiterin war als Arbeiterin überhaupt nicht ernst zu nehmen. Mehr und mehr dagongmei kamen aber in die Stadt, um langfristig dort zu bleiben, und verlangten mehr: langfris-tigere, mit einer Qualifizierung und allmählicher Lohner-höhung sowie Sozialversicherung verbundene Arbeit; eine Tätigkeit, die mit Familie vereinbar war. Der Titel der dago-ngmei wollte nicht mehr passen: auf die verheirateten Frauen mit Kindern im mittleren Alter, die in städtischen Haushalten und als Kinderbetreuerin nachgefragt waren und sind; auf die Inhaberinnen von mobilen Gemüse- und Obstständen; auf die Frauen, deren Kinder in der Stadt aufwuchsen.
Städtisch – aber ohne hukouKinder von Wanderarbeiterinnen erben, wie jede/r Chi-nese/in seit 1958, die lebenslange Wohnortregistrierung der Mutter. Dieser hukou ist unabhängig vom aktuellen
Wohnort und sollte den ungebremsten Zuzug in die Städ-te ja gerade verhindern. Das heißt, in der Stadt geborene Wanderarbeiterkinder und ihre auf Dauer in die Stadt um-gezogenen Eltern bleiben vom hukou her „Dorfbewohner“. Damit haben sie zu vielen sozialen Vergünstigungen der Städte – von der Schulbildung bis zum verbilligten Wohn-raum, zur Krankenversicherung und Pension – keinen oder nur erheblich teureren Zugang. Der hukou der in der Stadt geborenen Wanderarbeitertochter sieht nicht vor, dass sie auf Dauer in der Stadt bleibt, selbst wenn sie ihr hukou-Dorf noch nie gesehen hat und von landwirtschaftlicher Tätigkeit keine Ahnung hat.
Die neue Städterin und die Diskriminierungder Landbevölkerung
Heute sind in China ein Drittel der Stadtbevölkerung Wan-derarbeiter_innen. Gleichzeitig nimmt die Urbanisierung zu und ist zum Regierungsziel geworden. Die meisten Chines_innen meinen, dass das hukou-System geändert gehört, aber es gibt auch Städter_innen, die an ihrer bevorzugten Stellung festhalten wollen. Wanderarbeiter-Ehepaare konnten und können in den Städten kaum bezahlbaren Wohnraum für eine Familie fin-den, viele von ihnen lassen deshalb ihre Kinder auf dem Land bei den Großeltern. 2010 fand eine Studie des Chine-sischen Frauenverbandes, dass 22 % aller chinesischen Kin-der so leben, und 38 % der Kinder von Eltern mit ländlicher Wohnortregistrierung, nämlich über 61 Millionen Kinder unter 18 Jahren. 2013 ergab eine Untersuchung, dass 75 % der Kinder ihre Eltern nur ein Mal im Jahr sehen, wenn sie zum Frühlingsfest heimkommen. Selbst zu Telefonkontak-ten kommt es selten. Viele Eltern nehmen deshalb die Kinder mit in die Stadt, wo sie aber beim Zugang zu den lokalen Schulen und illega-
lerweise durch erhöhte Gebühren diskriminiert werden. Ei-gene Wanderarbeiterschulen toleriert die Regierung nicht; immer wieder werden solche zugesperrt. Dennoch: Wenn Stadtluft frei macht, dann gilt das ganz besonders für Frauen, und sie wollen bleiben. Das urba-ne Umfeld bietet ihnen verschiedene Möglichkeiten: frau kann sich von der ungelernten Arbeiterin im Unterneh-men hocharbeiten; frau kann in der Familienphase von der Fließbandarbeit in die Klein-Selbstständigkeit wechseln, etwa durch einen Laden in einer der wuchernden Wander-arbeiter_innen-Siedlungen. Sind die Kinder im Schulalter, kann sie in die Haushaltsdienstleistung wechseln, idealer-weise zu einem gut zahlenden westlichen Ausländer oder als Vollzeit-Tagesdame in den Edelhaushalt eines alten chi-nesischen Paares ohne Kinder. Zwar bietet die Regierung den Wanderarbeiterinnen keinen hukou-Wechsel, aber sie ermutigt sie zur Weiterbildung und fördert diese.
Webtipp: China Labour Bulletin » www.clb.org.hk/en/content/migrant-workers-and-their-children
Lesetipps: Li Wanwei/Pun Ngai (2008): Dagongmei. Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen. Assoziation A, Hamburg. // Ching Kwan Lee; Pun Ngai (2010): Aufbruch der zweiten Generation. Wan-derarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China. Assoziation A, Hamburg. // Georg Egger, Daniel Fuchs, Thomas Immervoll, Lydia Steinmassl (Hg) (2013): Arbeitskämpfe in China: Berichte von der Werk-bank der Welt, Promedia, Wien. // Pun, Ngai/Lu, Huilin/Guo, Yuhua/Shen, Yuan (2013):iSlaves. Ausbeutung und Widerstand in Chinas Foxconn-Fabriken. Mandelbaum, Wien.
Zur Autorin: Astrid Lipinsky hat eine halbe Professur zu Wirtschaft und Gesellschaft Chinas in Göttingen und eine halbe Stelle als Post-Doc-Assistentin an der Universität Wien. Sie lebt in Wien
Frauensolidarität 3/2013
26
Frauensolidarität 3/2013
27Migration – Arbeit – Asyl / SCHWERPUNKT //
ZUFLUCHT IN SÜDAFRIKA?Probleme politisch verfolgter Frauen und
Migrantinnen aus Simbabwe
Rita Schäfer
Seit Beginn der politischen und wirtschaftlichen Krise in Simbabwe im Jahr 2000 hat ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung das Land verlassen.
Über 40 Prozent der Geflohenen sind Frauen. In Südafrika erweitern sie ihre wirtschaftlichen Handlungsspielräume, dort müssen sie aber auch erneute
Gewaltübergriffe fürchten.
Südafrika gilt in vieler Hinsicht als Vorreiter auf dem Kontinent. Seine demokratische und wirtschaftliche Entwicklung gilt als vorbildlich. Auch die nach der po-
litischen Wende 1994 begonnenen Rechtsreformen, umfas-sende Gleichheitsgrundsätze, Leitlinien zur Gender-Politik und Empowerment-Programme sind im Ländervergleich richtungweisend. Diese Maßnahmen sollen die mehrfache Benachteiligung schwarzer Frauen während der Apartheid (1948–1994) überwinden. Allerdings ist die systematische Umsetzung wegen der frauenfeindlichen Einstellungen vieler männlicher Füh-rungskräfte weiterhin eine Herausforderung. Mit den Schwierigkeiten, Rechtsgrundlagen in der Realität zu ver-wirklichen, sind vor allem Migrantinnen konfrontiert. Zwar loben etliche politische Beobachter die gender-neutralen Einwanderungs- und Asylgesetze Südafrikas, dennoch ver-schleppen die Behörden die Anträge oft über Jahre, und die Antragsstellerinnen leben in ständiger Unsicherheit.
Für Frauen aus Simbabwe ist die Situation in mehrfacher Hinsicht schwierig. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass über 1,5 Millionen Menschen aus Simbab-we im Nachbarland Südafrika leben. Sie bilden dort die größte Gruppe von Migrant_innen, gefolgt von mehreren hunderttausend Männern aus Mosambik, die als Wander-arbeiter oder Bürgerkriegsflüchtlinge während der 1990er-Jahre kamen und in Südafrika geblieben sind. Die meisten Migrant_innen haben keinen legalen Aufenthaltsstatus.
ArbeitsverhältnisseBis Ende 2010 konnten die im regionalen Vergleich sehr gut ausgebildeten Simbabwer_innen eine temporäre Ar-beits- und Aufenthaltsgenehmigung in Südafrika beantra-gen. Dazu entschied sich aber nur eine Minderheit; zu groß war die Sorge, die Registrierung sei der erste Schritt zur Deportation in die diktatorisch regierte und wirtschaftlich marode Heimat. Viele waren nach Südafrika gekommen,
weil gravierende wirtschaftliche Fehlentscheidungen der simbabwischen Regierung ab dem Jahr 2000 einen drama-tischen Rückgang der Arbeits- und Einkommensmöglich-keiten zur Folge hatten. Hinzu kam die gewaltsame Verfol-gung von Regimegegnerinnen und der Ehefrauen, Töchter und Schwestern von Regimegegnern. Auch diejenigen, denen Regimekritik unterstellt wurde, gerieten ins Visier folternder Sicherheitskräfte.Simbabwerinnen arbeiten in Südafrika als Krankenschwes-tern, Farmarbeiterinnen oder Hausangestellte. Auch einige Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen haben frühere Verwaltungsfachfrauen eingestellt, denn sie verfü-gen über viel Berufserfahrung. Ein Fallstrick in diesem Kon-text ist die Tatsache, dass südafrikanische Arbeitgeber für ausländische Fachkräfte keinen Mindestlohn zahlen müs-sen und arbeitsrechtliche Vorschriften unterlaufen. Hier-durch bestätigen sie ausländerfeindliche Vorurteile vieler Südafrikaner_innen, die meinen, Simbabwer_innen würden ihnen die umkämpften Arbeitsplätze wegnehmen. Trotz umfangreicher Förderprogramme ist die Schulbil-dung etlicher Südafrikaner_innen immer noch so schlecht, dass Unternehmen und internationale Organisationen Sim-babwerinnen bevorzugen. Deren Bildungssystem war nach der politischen Unabhängigkeit 1980 grundlegend refor-miert und auf europäische Standards ausgerichtet worden. Hier hat Südafrika noch großen Nachholbedarf.Die Beschäftigungs- und Einkommensoptionen in Südafri-ka ermöglichen Simbabwerinnen, ihre Familienmitglieder in der Heimat zu versorgen. Durchschnittlich schicken sim-babwische Arbeitskräfte ein Drittel ihres Einkommens an ihre Herkunftsfamilien. Dadurch sichern sie deren Existenz, zahlen das Schulgeld für die Kinder und stärken die Wirt-schaftskraft ihres Landes.Mehrheitlich kommen Frauen zwischen 20 und 40 Jahren ohne ihre Kinder, die sie bei Verwandten zurücklassen. So sparen sie Kosten und müssen die Kinder nicht den laten-ten Anfeindungen an südafrikanischen Schulen aussetzen. Auch das oftmals herablassende Verhalten des Personals in Krankenhäusern bleibt ihnen erspart. Offiziell haben alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft ein Recht auf Behandlung, doch faktisch müssen Migrantinnen oder Flüchtlinge vielerorts lange warten, und Patientinnen wer-den unzureichend versorgt. Etliche Südafrikaner_innen meinen, Ausländer_innen aus afrikanischen Nachbarlän-dern würden HI-Viren und Tuberkulose verbreiten. Einen schweren Stand haben simbabwische Krankenschwestern, die Versorgungslücken schließen, welche weiße Ärzte oder Krankenschwestern hinterlassen haben, die nach Großbri-tannien oder Australien emigriert sind. In vielen Berufsfel-dern sind simbabwische Arbeitnehmerinnen mit xenopho-ben Anfeindungen und sexueller Belästigung konfrontiert. Viele sehen sich genötigt, diese zu erdulden, weil sie Kün-digungen fürchten.
Manche Simbabwerinnen arbeiten im informellen Sektor als Kleinhändlerinnen. Flexibel passen sie ihre Produk-te an die Präferenzen unterschiedlicher Käuferinnen an, mancherorts verlangen Verwaltungsmitarbeiter für Li-zenzen Bestechungsgeld und drohen sogar mit sexueller Gewalt.
Gewalt und GewaltpräventionAuch in ihrem oftmals problematischen Wohnumfeld er-dulden etliche Simbabwerinnen geschlechtsspezifische Gewalt, etwa durch südafrikanische Jugendbanden. Frau-en, die eine Aufenthaltserlaubnis haben oder als Flücht-linge anerkannt sind, melden die Übergriffe nicht, weil sie vermeiden wollen, von der Polizei verhöhnt zu werden. Frauen ohne Aufenthaltsrecht melden die Übergriffe nicht den staatlichen Behörden, weil sie fürchten, deportiert zu werden. Einige suchen anonym bei Menschenrechtsor-ganisationen Hilfe, vor allem wenn die geschlechtsspezi-fische Gewalt mit xenophoben Anfeindungen von Seiten südafrikanischer Täter verbunden ist. Nur wenige Frau-enorganisationen bieten Hilfe, sie sind zumeist auf süd-afrikanische Klientinnen ausgerichtet und haben zu wenig Personal. Auch Sprachprobleme erschweren die Kommunikation; das professionelle Weiterleiten der Fälle an staatliche Behör-den ist schwierig, weil simbabwische Gewaltopfer wegen der xenophoben Einstellungen von Polizisten oder Ärzten den Weg zu diesen Instanzen scheuen. Umso wichtiger sind Programme von Menschenrechtsorganisationen, die gen-der-sensible Beratungen anbieten und auf Einstellungsver-änderungen der Mitarbeiter in Behörden abzielen. Sie ar-beiten ganz konkret an der Überwindung von Vorurteilen, und an ihren Kursen für das Personal staatlicher Einrichtun-gen wirken Migranten_innen mit. Inzwischen kooperieren die in Menschenrechtsorganisatio-nen tätigen Juristen_innen mit dem „Sonke Gender Justice Network“. Dieses Netzwerk eint Männer, die sich für die Überwindung geschlechtsspezifischer Gewalt und sexis-tischer Vorurteile einsetzen. Zu ihren Zielgruppen zählen Männer in Führungsfunktionen, Mitarbeiter in Behörden und Lehrer. Das „Sonke Gender Justice Network“ versteht sich als profeministischer Allianzpartner von Frauenorgani-sationen. Es beruft sich auf die südafrikanische Verfassung und die Gender-Politik, zu deren Umsetzung staatliche Ein-richtungen verpflichtet sind.
Lesetipp: Sigsworth, Romi/ Ngwane, Collet/ Pino, Angelica (2008): The gendered nature of xenophobia in South Africa, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, Johannesburg.
Zur Autorin: Rita Schäfer ist freiberufliche Wissenschaftlerin und Autorin der Bücher „Im Schatten der Apartheid“ (2008), „Frauen und Kriege in Afrika“ (2008) und „Gender und ländliche Entwicklung in Afrika“ (2012).
Frauensolidarität 3/2013 Frauensolidarität 3/2013
29Frauenrechte / QUERSCHNITT //28
UNGLEICHE REPRODUKTION –REPRODUZIERTE UNGLEICHHEIT
Entwicklungen und Perspektiventransnationaler Fortpflanzungsindustrien
Veronika Siegl
Für eine Samenspende nach Dänemark, für eine Eizelle nach Tschechien oder Spanien und eine Leihmutter nach Indien oder in die Ukraine? Globalisierung,
Neoliberalismus und individualistische Vorstellungen von Freiheit eröffnen eine Reihe von Möglichkeiten innerhalb der technologisch unterstützten Reproduktionsmedizin,
die auf traditionelle Familienbilder sowie auf geschlechtliche und globale Ungleichverhältnisse widersprüchlich wirken.
Doron Mamet macht es möglich. Er und sein Partner hatten von einer Leihmutter in den USA ein
Kind austragen lassen und sich damit einen großen Traum erfüllt. Aber nur wenige Menschen können sich dieses kostspielige Prozedere leisten, und so gründete der Israeli vor einigen Jah-ren die Vermittlungsfirma „Tammuz“. Wählt man seinen so genannten „East-West-Plan“, werden Eizellen in den USA befruchtet und dann in Indien – wo die Kosten mit 20.000 bis 30.000 Dollar bei ca. einem Drittel der Preise in den USA liegen – einer Leihmutter einge-setzt. Das Land galt als Hotspot für schwule Klienten, bis Indien im Früh-jahr 2013 ein Leihmutterschaft-Verbot für homosexuelle Paare einführte.Seit den 1990er-Jahren haben sich Fragen sexueller Reproduktion im eu-ropäischen und nordamerikanischen Raum zunehmend zu einem inter- und transnationalen Unterfangen entwi-ckelt. Unter dem Stichwort Fertili-tätstourismus oder Reproduktionsrei-sen bewegen sich Eltern in spe, Kinder, Zellen, Embryos, „Spender_innen“, Mediziner_innen und nicht zuletzt auch Geldströme um den Globus. Die jeweiligen Reiserouten sind von Unter-schieden in nationalen Gesetzgebun-
gen, von medizinischen Spezialisierun-gen und Erfolgen, Kosten, Wartelisten und Sicherheitsaspekten geprägt. Die in Israel und Indien gedrehte Do-kumentation „Google Baby“ (2009) über den Vater und Geschäftsmann Mamet veranschaulicht das Dilemma der neuen Reproduktionstechnolo-gien. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach persönlicher Verwirk-lichung – Diskussionen rund um das Thema Reproduktion werden oft un-ter dem Aspekt der freien Entschei-dung („choice“) diskutiert, die es po-tenziell möglich macht, traditionelle Familien- und Geschlechterbilder auf-zubrechen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wo diese persönliche Freiheit endet, denn Angebote der Reproduk-tionstechnologien werden durch ein System globaler Ungleichheiten er-möglicht und reproduzieren diese. Sie entwickeln und verbreiten sich an den Schnittstellen von u.a. Gender, „race“, Ethnizität, Nationalität und Klasse und positionieren Menschen an un-terschiedlichen Enden des Spektrums von Angebot und Nachfrage. Kritik am „outsourcing“ gefährlicher und belastender medizinischer Ein-griffe in Niedriglohnländern haben
vor allem feministische Theoretiker_in-nen und Aktivist_innen formuliert. Un-ter dem Schlagwort „renting wombs“ sind nicht zuletzt indische Fertilitäts-kliniken wie jene in „Google Baby“ für ihre Kommerzialisierungsstrategien ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.
Gabe versus Ware
Ihre Leihmütter seien alle „beschei-den“ und „einfach“, so die Worte von Dr. Nayna Patel, mit der Doron Mamet über das Internet Kontakt aufnimmt. Die abgeklärte und geschäftstüchti-ge Ärztin avancierte vor einiger Zeit zum internationalen Star der indischen Fertilitätskliniken und weiß, wie man diese „Dienstleistungen“ schmackhaft macht. Leihmutterschaft ist eine Win-win-Situation, an das muss sie im Film auch des öfteren die austragenden Frauen „erinnern“, die neun Monate lang abgeschieden von der Außenwelt in der Klinik leben und ihre Körper einer Komplettüberwachung unterwerfen. Nayna Patel leugnet nicht, dass die meisten Frauen aus finanziellen Grün-den für die Klinik arbeiten – um ein Haus zu kaufen oder ihren Kindern Bildungschancen zu eröffnen. Im Vor-
dergrund soll aber ein anderer Aspekt stehen: Laut der Ärztin sei Leihmut-terschaft ein Geschenk Indiens an die Welt. Damit bedient sie sich eines Diskurses, den sich viele indische Kli-niken zunutze machen, um sich von der kühlen Sprache der Medizin und Technik zu distanzieren und potenziel-le Klient_innen auf einer emotionalen Ebene anzusprechen. Durch diesen Diskurs werden nicht nur Bilder von vermeintlich aufopferungsbereiten indischen Frauen sowie kulturelle Klischees reproduziert – die Vorstel-lung von Leihmutterschaft als „Gabe“ bietet auch eine moralische Recht-fertigung und verschleiert die realen Machtverhältnisse.Aber nicht nur Leihmutterschaft, son-dern auch Eizellenspende – ein nur in wenigen europäischen Ländern lega-les Vorgehen – und damit verbundene „eggs-ploitation“ (ein Begriff der fe-ministischen Wissenschaftlerin Naomi Pfeffer) entfachen kontroverse Diskus-sionen, da das Verfahren oft mehrwö-chige hormonelle Stimulation erfor-dert und gesundheitliche Risiken birgt. Die eher niedrig gehaltene finanzielle Kompensation (in Spanien beispiels-weise um die 800 Euro) soll einen gesetzlichen Schutz vor Ausbeutung
Lesetipps: Kroløkke, Charlotte/Foss, Karen A./Pant, Saumya (2012): Fertility Travel: The Commodification of Human Reproduction. In: Cultural Politics 8(2), 273–282. // » Wald-by, Catherine/Cooper, Melinda (2008): The Biopolitics of Reproduction. Post-Fordist Biotechnology and Women’s Clinical Labour. In: Australian Feminist Studies 23(55), 57–73.
Zur Autorin: Veronika Siegl ist Kultur- und Sozialanthropologin und arbeitet im wissen-schaftlichen und journalistischen Bereich in Wien
bieten. Hier manifestiert sich ein inte-ressanter Gegensatz zur Samenspen-de, die eine wesentlich höhere gesell-schaftliche Akzeptanz genießt und von Männern weniger als „Hilfsleistung“, sondern als Job verstanden wird.
Selbstbestimmung versus Prostitution
Im Kontext von Eizellenspende ist vor allem der Fall Spanien interes-sant, denn das katholische Land mit über 200 Fertilitätskliniken hat über-raschenderweise eine besonders „li-berale“ Gesetzgebung in Bezug auf Reproduktionstechnologien. Zurück-führen lässt sich dies u. a. auf die lan-gen Jahre der Franco-Herrschaft. Die pronatalistische Staatsdoktrin des Dik-tators führte dazu, dass sich Feminis-tinnen nach seinem Sturz vom Thema Mutterschaft distanzierten, dadurch aber verabsäumten, für die Rechte von Müttern einzutreten. Am Arbeits-markt hat dies fatale Konsequenzen, denn viele junge Frauen riskieren mit einer Schwangerschaft ihren Job. Aus diesen Gründen gibt es in Spanien ei-nen hohen Bedarf nach Eizellenspen-den und In-vitro-Fertilisation.
Weit verbreitet sind Werbekampag-nen in Zeitschriften, Radios und an Universitäten, die v. a. junge Studen-tinnen und Migrantinnen als Spen-derinnen ansprechen sollen und in gewisser Weise an eine „Solidarität“ zwischen Frauen appellieren. Dieser altruistische Diskurs beschränkt sich nicht nur auf Spanien. In Rumänien scheint die Situation ähnlich zu sein. Auch der Diktator Ceau#escu hat mit der Illegalisierung von Abtreibung und seiner 5-Kinder-Familienpolitik in die Entscheidungsmacht von Frauen eingegriffen. Ohne die ökonomischen Notwendigkeiten dahinter auszublen-den, kann vor diesem historischen Hin-tergrund die Spende von Eizellen auch einen Schritt der Selbstbestimmung darstellen. Die Frage nach der Entscheidungsau-tonomie von Frauen, die ihren Körper oder Substanzen ihres Körpers anbie-ten, scheidet die feministischen Geis-ter. Viele Kritiker_innen vergleichen Leihmutterschaft und Eizellenspende mit Prostitution. Natürlich ist es ein unbehagliches Gefühl, sich beispiels-weise durch den Onlinekatalog rus-sischer Fertilitätskliniken zu klicken, wo die Frauen je nach Bikinifigur, Ge-sichtsform, Nasengröße und Ausbil-dung unterschiedliche Preise zu haben scheinen. Aber die Lebensrealitäten vieler Frauen zeichnen ein komplexes Bild, das sich nicht auf moralisierende Schlagworte reduzieren lässt. Die Fra-ge, ob Frauen nun Subjekte oder Ob-jekte der neuen Reproduktionstech-nologien sind, lässt sich daher weder mit Ja noch mit Nein beantworten.
© O
rigi N
alko
pie
Frauensolidarität 3/2013
30
Frauensolidarität 3/2013
31Frauenrechte / QUERSCHNITT //
„EUER SCHWEIGENSCHÜTZT EUCH NICHT“
Interview mit Peggy PiescheIm Juni 2013 war die Wissenschaftlerin und Autorin
Peggy Piesche auf Einladung von der Frauensolidarität und dem Referat für Genderforschung in Wien. Aus diesem Anlass führte Jule Fischer von der
Frauensolidarität mit Peggy Piesche ein Interview über die Schwarze Frauenbewegung in Deutschland, die „Kinderbuchdebatte“, über Scham, Schuld und
Tabus und das Schweigen weißer Frauen. Der zweite Teil wird in der kommenden Ausgabe (Nr. 126) der
„Frauensolidarität“ erscheinen.
Jule Fischer: Peggy, vor zwei Tagen hast du aus der von dir
herausgegebenen Anthologie „Euer Schweigen schützt Euch nicht: Audre Lorde und die Schwarze
Frauenbewegung in Deutschland“ gelesen. Davor hast du viel zur
„Kritischen Weißheitsforschung“ in Deutschland gearbeitet. Woran
arbeitest du momentan, was interessiert dich gerade theoretisch?
Peggy Piesche: Ich fange gerade eine neue Stelle in Bayreuth in der Acade-my for Advanced African and Diaspo-ra Studies an, und das finde ich eine ganz wunderbare Herausforderung, denn ich hab so das Gefühl, dass al-les, woran ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, gerade kulminiert und sich in einem theoretischen Raum fokussiert. Es geht bei dieser Arbeit um eine „notion of future from an Af-rican-diasporic perspective“, bearbei-tet von einer interdisziplinären inter-nationalen Forschungsgruppe. Mein Arbeitstitel lautet dabei: „Diasporas on the move“. Es geht also darum, wie die Übergänge von diasporischen Communities sich gerade – auch im Internet – in den verschiedenen Me-dien gestalten. Das finde ich momen-tan sehr aufregend. Wir fangen ge-rade damit an. Das interessiert mich schon seit Längerem und trifft den transnationalen Aspekt von Diaspora,
den Audre Lorde mit einem Schwar-zen Internationalismus gemeint hat.
Du hast in den letzten sechs Jahren in den USA gelebt. Wie
ist die Verbindung zur Schwarzen Frauenbewegung in Deutschland
während dieser Zeit gewesen, wie ist sie heute?
Ja, vielleicht ist das schon eine Refe-renz, zum einen, dass dieses Theorem einer transnationalen Diaspora stim-mig ist und auch funktioniert, und zum anderen, dass wir auch leben, was wir theoretisieren oder worüber wir sch-reiben, wie wir Bewegung auch kulmi-nieren. Ich würde fast sagen – und das ist überhaupt nicht mein Verdienst –, dass ich in einer sehr sehr positiven Form gar keine andere Chance hatte, als weiterhin in Kontakt zu bleiben. Das ist schon ganz kraftvoll, ganz „powerful“. Ich komme jetzt zurück und habe meine Schwarzen ADEFRA-Räume, in aller Komplexität. Sie ha-ben zu Recht auch über all die Jahre den Anspruch an mich gestellt, dass ich mich nicht einfach ausklinken kann und dann irgendwo im Hinterland ver-schwinde. Das ist ja auch gerade das Schöne an politischen Communities. Ich habe da mein Korrektiv, das mich wieder zurückholen kann. Kontakt hatte ich immer: das ist meine Familie, meine selbst gewählte Familie.
In Berlin hat sich viel getan, es gibt viel mehr Räume für Schwarze
Frauen. Wo bündelt sich die Schwarze Frauenbewegung derzeit?
Eigentlich kann man die Frage so nicht stellen, denn mit dieser norma-tiven Verortung, der Frage, wo die festen Stellen der Bewegung sind, kann sie nicht beschrieben werden. Die Bewegung ist in Generationen gewachsen, also die Bewegung aus den Anfängen, und sie hat keine phy-sischen Räume in dem Sinn. Es gibt nicht diesen Raum mit Vereinsstruk-tur, wo man anklingeln kann. Das hat sich eigentlich für uns von ADEFRA als nicht so produktiv herausgestellt, weil es unsere Kräfte auf eben diese sehr normativen Strukturen bündelt und diese füttert. Was wir stattdes-sen sehen, ist, dass diese Bewegung in Diskurs gegangen ist, und das finde ich viel, viel einflussreicher, viel, viel nachhaltiger. Das ist mir noch mal richtig deutlich geworden bei der Arbeit an der An-thologie, wie viele Diskurse beein-flusst wurden, Diskurse überhaupt erst mal geschaffen wurden, im Sinne von „in die Sichtbarkeit getragen wur-den“. Das wird in Texten deutlich. Und es ist auch wichtig, sich immer mehr an der Akademie, an den Universitäten zu verorten, weil wir ja auch wissen, wie die Mechanismen von Wissens-
produktion und Wissensreputation funktionieren. Wissensproduktion fin-det überall statt, aber Wissensreputa-tion nicht. Das ist bedeutungsvoll für nachfolgende Generationen. Wenn wir jetzt Schwarze Student_in-nen sehen, die in einer so angeneh-men Selbstverständlichkeit Themen bearbeiten können oder zum Beispiel Maisha Eggers als Professorin an-sprechen können, ob diese Arbeiten betreuen könnte von Bachelors, Mas-ters bis hin zu Dissertationen, und wir dann zurückdenken an die 1980er-Jahre, dann ist das schon beachtlich. Ein Teil von „Farbe bekennen“ war ja auch May Ayims Diplomarbeit, die nicht angenommen wurde, die ein-fach mit einem „Damit können wir hier nichts anfangen, damit kannst du in die USA gehen“ abgespeist wurde. Ich mag zwar die Phrase „Wir sind einen langen Weg gekommen“ nicht so, aber daran sieht man den Einfluss dieser Bewegung. Und das ist mir viel wichtiger: Diskurse, sich darin zu ver-ankern, Geschichtlichkeit auszugra-ben. Ich finde ja immer, dass wir wie Archäologinnen sind. Wir graben et-was aus, was mutwillig verdeckt und mit Dreck überschüttet wurde. Und wir machen es zugänglich für nach-folgende Generationen. Das funkti-oniert gerade an den Universitäten, weil dies oft die Wege sind, wo Wis-sensakkumulation sich bewegt, aber auch in anderen Settings wie in der Malerei, im Theater, in der Musik, im Tanz – das finde ich sehr wichtig.
Angestoßen wurde durch die Schwarze Frauenbewegung in den letzten Monaten auch die Debatte
um rassistische Benennungen in Kinderbüchern. Die Reaktionen in den deutschen Medien waren
hauptsächlich „jenseitig“. Vor allem
ging es um das Herausstreichen rassistischer Begriffe, wie des N-Wortes. Bleibt nicht eher zu
hinterfragen, ob nicht das gesamte Setting, die Beschreibungen an sich rassistisch sind, es also nicht
reicht, einzelne Wörter zu streichen? Sollten diese Bücher besser nicht
verlegt und lieber gewartet werden, bis politisch sensible Kinderbücher erscheinen? Oder sollten sie weiter verlegt werden, zum Beispiel mit einem entsprechenden Zusatz,
der Erwachsene und Kinder in die Reflexion einspannt?
Erstmal finde ich ja diese Debatte um die Kinderbücher auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Community funktioniert bzw. für die emotiona-le und intellektuelle Kraft, die darin steckt. Aber es ist auch ein Beispiel, das uns zeigt, was wir alles immer noch tun müssen. Letztendlich sieht man darin sehr schön – und darauf hat Maisha Eggers auch verwiesen –, dass es keine intellektuelle Debatte war, die von irgendwelchen „abgedrehten entzogenen Theoretiker_innen“ kam, sondern vor allem Schwarze Kinder, Schwarze Familien haben gesagt , es kann ja wohl nicht angehen, dass wir im-mer noch damit konfrontiert werden. Die Reaktionen zeigen nicht nur, wie tiefgreifend banal und widerlich der Rassismus in der deutschen Gesell-schaft immer noch ist, sondern sie verweisen uns auch noch mal darauf, was eigentlich Schwarzen Menschen in so einer Gesellschaft abverlangt wird. Das sind Familien, das sind Men-schen, die wollen einfach nur abends ein Kinderbuch vorlesen. Die haben einen Job gemacht wie du und an-dere, die haben ein Alltagsleben und genug damit zu tun. Und dann müssen sie abends noch in Personal-union im Prinzip Rassismusdebatten
kindgerecht herunterbrechen, einen deutschen Literaturkanon auseinan-dernehmen und, wenn das Kind end-lich eingeschlafen ist, sich auch noch als „intellektuelle Redakteur_innen“ hinsetzen und sich dann auch noch gefallen lassen, dass sie ja sowie-so nichts dazu zu sagen hätten. Das Ganze zeigt, welche enorme Leistung Schwarze Menschen jeden Tag auf-bringen, um hier einigermaßen men-schenwürdig existieren zu können. Auf den ganz normalen Job, der oft ein Doppel- bzw. Dreifach-Job ist, fol-gen diese Arbeiten. Das ist enorm! Es ist wichtig, das im Kopf zu behal-ten, denn die Frage „Was muss getan werden?“ oder „Ist es jetzt nicht an der Zeit, endlich mit diesen Büchern aufzuhören?“ ist dann auch wieder an diese Menschen gerichtet. Ja, ich finde auch, dass etwas getan werden muss und wir schon längst einen Punkt erreicht haben, an dem wir nicht ein-fach mehr Altes tradieren können. Das Problem ist jedoch, dass dies nicht un-ser Job ist! Das ist der Job der Mehr-heitsgesellschaft, der weißen Gesell-schaft. Aber da wird natürlich nichts passieren. Wir sehen es ja. Wir sind ja nicht erst letztes Jahr aufgewacht und haben gesehen, was da alles in den Büchern ist. Und als Literaturwissenschaftlerin geht es mir überhaupt nicht um ein Verbot, sondern um eine Historisie-rung. Vor allem im deutschen histo-rischen Kontext kann das Ziel nicht sein, etwas auf den Index zu setzten. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das unser Job sein sollte, sondern der von Verlagen. Das heißt, wenn die sich entscheiden, diese Kinderbücher noch zu verlegen, sollten sie sie auch mit Glossaren versehen. Da können sie entsprechend fitte Leute anspre-chen. Das sollten wir nicht hintragen » »
Frauensolidarität 3/2013
32
Frauensolidarität 3/2013
33Frauenrechte / QUERSCHNITT //
» » Teil zwei des Interviews erscheint in Nr.126 der Frauensolidarität!
Lesetipps: Piesche, Peggy (2012): Euer Schweigen schützt Euch nicht: Audre Lorde und die Schwarze Frauenbewegung in Deutschland. Orlanda, Berlin. // Arndt, Susan/Eggers, Maureen Maisha/Kilomba, Grada/Piesche, Peggy (Hg.) (2009): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Unrast, Münster. // Oguntoye, Katharina/Opitz, May (May Ayim)/Schultz, Dagmar (Hg.) (1986): Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Orlanda, Berlin. // Eggers, Maureen (2008): Rassifizierung und kindliches Machtemp-finden [Elektronische Ressource]: Wie schwarze und weiße Kinder rassifizierte Machtdifferenz verhandeln auf der Ebene von Identität, Universitätsbibliothek Kiel.
müssen! Es gibt genug Leute, die auf diesen Gebieten arbeiten, die das studiert haben, die dazu forschen, sei es Geschichte, Kolonialgeschichte, sei es zu medialer Repräsentation, sei es Erziehungswissenschaft oder Kind-heitsentwicklung. Diese Expert_in-nen können ein Glossar verfassen, das entsprechend zugänglich ist für das Medium Kinderbuch. Gleichzeitig gehört dieses Thema, diese Debatte an die Schulen, gehört das in die Schulbücher. Genauso wie wir uns Gedanken darüber machen mussten, wie man den Holocaust herunterbricht und es auch Kindern beibringt, genauso müssen wir uns Gedanken darüber machen, den Ko-lonialismus so runterzubrechen, dass er kindgerecht verständlich ist, damit Kinder im Alltag verstehen, dass es eben nicht okay ist, irgendwelches Schaumgebäck mit N-Wörtern zu ver-langen. Sie sollten die Referenzen ver-stehen, wenn eine Schokolade buch-stäblich eine direkte Kolonialreferenz hat. Sie müssen das nicht schulmäßig runterrattern können, aber ein Ver-ständnis entwickeln können. Dann ha-ben wir vielleicht in einer Generation auch nicht mehr so viele buchstäblich ignoranten Reaktionen. An den Reaktionen in der Kinder-buchdebatte sieht man aber auch die-sen Moment der Entlarvung: „Meine Güte, ich bin jetzt ertappt worden bei etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Ich kann nicht reagieren.“ Und dann geht man sofort in das Kontraproduk-tive und zieht sich auf die Definitions-macht zurück: „Du hast kein Recht, das anzugreifen, du willst mir meine ganze Geschichte wegnehmen, wer bist du eigentlich …“ usw.
Eigentlich braucht es „queeres“ Denken und Handeln, also den Willen,
sich der Unsicherheit auszuliefern, etwa indem die Anker der eigenen
Vergangenheit, wie eben diese Kinderbücher, auch herausgerissen
werden können.Ja genau, und das ist wieder eine andere Aufklärungsebene. Ich sag-te ja schon bei dem Vortrag, dass wir endlich kollektiv verstehen müs-sen. Geschichte ist eine kollektive Verantwortung und keine persönli-che Schuld. Ich bin wirklich nicht an Scham- und Schuldzuweisung interes-siert. Manchmal ist Scham ganz gut. Für Sachen muss man sich auch ab und zu schämen, denn dies hat auch ein kathartisches Element. Wenn man das überspringt, dann sieht man nur, dass Reaktionen lediglich künstlich sind. Es ist so schade, dass gerade im deutschen Kontext dies so wenig ver-standen wird. Schauen wir in den US-amerikani-schen Kontext und den Umgang mit der Sklaverei: Heutzutage ist niemand mehr persönlich für die Geschichte der Sklaverei verantwortlich, die Ver-antwortlichen sind alle tot. Aber was ich mit der Geschichte mache, wo ich mich in ihr verorte, da ist eine dünne Linie zwischen Beteiligung, also einer privilegierten Beteiligung und damit auch Reproduktion dieser Machtver-hältnisse, oder ob das als kollektive Verantwortung verstanden wird.
Es gab nach deiner Lesung eine Meldung, die sehr stark von Scham
und Schuld geprägt war – zum einen über eine weiße Frau, die das N-Wort
benutzt hat, aber auch über das eigene Sein, Sprechen dort. Was kann
die Scham bzw. was kann sie nicht?Na ja, die Frage ist: Wer war da ei-gentlich angesprochen? Wer war da adressiert, an wen hat die Frau sich gewendet? Ich habe ja auch deswe-
gen diese persönliche Scham zurück-gewiesen und gesagt, dass es das nicht sein kann, worum es geht, son-dern um Transformation im Handeln. Mein Gefühl war eher, dass hier ei-gentlich die Schwarze Community im Raum gerade als Vehikel benutzt wur-de, um sich von der anderen weißen Frau zu distanzieren, die gerade den großen Fauxpas begangen hat. Und ein Fauxpas ist immer nur im Kontext von Tabu denkbar, wenn jemand ein Tabu überschreitet. Und die Person, die darauf hinweist, dass eine ande-re einen Fauxpas begangen hat, will eigentlich das Tabu aufrechterhalten. Und daran bin ich nicht interessiert. Das ist Macht erhaltend, das ist Macht fortschreibend: Sie hat im Prinzip in zwei Richtun-gen geredet. Die offenkundige, aber eigentlich oberflächliche Richtung war zu uns, den Schwarzen Frauen auf der Bühne: zu sagen, ich schäme mich so sehr für diese andere weiße Frau. Aber eigentlich ging es darum, der anderen weißen Frau Bescheid zu geben: Mensch, so geht das nicht, jetzt sind wir hier in diesem peinlichen Setting, und eigentlich bin ich total sauer, dass ich jetzt sagen muss, dass ich mich schäme, denn du hast dieses Tabu verletzt. Ehrlich gesagt, nervt mich das eher. Es ist mittlerweile ge-nug da, oder – wie Belinda Kazeem immer sagt – es liegt alles auf dem Tisch. Ihr könnt euch das alles abho-len: Texte, aber auch Diskurse, es liegt ja alles schon vor. Die Notwendigkeit von so einer Aus-einandersetzung beginnt nicht, wenn ein Schwarzes Gesicht in den Raum tritt. Die Notwendigkeit beginnt, wenn weiße Frauen miteinander sind, wenn sie über Backrezepte reden oder irgendwas. Wenn da konstant und kontinuierlich Rasse ausgeschal-
tet ist und es immer nur reinkommt, wenn ich symbolisch in den Raum trete, dann haben wir ein Problem, und genau das wurde dann deutlich. Diese Diskussion wäre anders verlau-fen, wenn die beiden untereinander gesprochen hätten. Ich hätte mir eher eine konstruktive, also eine inhaltlich konstruktive Bemerkung gewünscht, denn das ist nicht mein Job, das ist nicht Belindas Job.
Ihr zu erklären, warum das N-Wort nicht zu benutzen sei, wäre in dem
Moment schwierig gewesen, weil sie ja gerade darauf hingewiesen hatte,
wie gut sie es findet, wie sich die Sprache verändert hat …
Das Ganze hat zwei Ebenen, eine inhaltliche und eine historische. Ich räume gern ein, dass nicht alle alles kennen. Aber wir hatten ja gerade von der Gewalt der Sprache gespro-chen, und sie hat es vor allem auch selber noch betont, und dann brachte sie dieses Beispiel und reproduzierte diese Gewalt. Die Inhaltsebene ist eine Seite: Worum es wirklich geht, ist zu benennen, was da wirklich gerade passiert. Dass die Frau uns mehrmals nach unseren Einlassungen sagt, wir haben sie missverstanden, da hätte jemand sie darauf aufmerksam ma-chen können, dass sie genau die Ebe-ne reproduziert, die sie selbst als so gewaltvoll beschrieben hatte. Und das kann jede sagen. Auch wenn man sagt, okay ich beschäftige mich nicht viel damit, aber was ich hier merke, ist, dass es irgendwie merkwürdig ist, dass du weiterreden kannst. Auf irgendwas wirfst du dich ja zurück: „Ich habe das ja so nicht gemeint, ich will ja hier nur was beschreiben.“ Auch nach der Lesung ging das so weiter. Da musste ich nochmals erklä-ren, und da war keine weiße Frau weit
und breit, die sich eingemischt hätte. Da musste erst eine andere Schwarze Frau kommen, um in der Situation zu intervenieren.
Ich habe das auch bemerkt, mich dann allerdings doch nicht getraut,
das zu unterbrechen. Ich denke, da stand die Angst dahinter,
vormundschaftlich zu handeln …Geht mit ihr ins Gespräch! Belinda hat natürlich als eine Schwester, diese Codes, diese Dynamiken verstehend, mich aus dieser Situation rausgeholt, gesagt: Peggy, hast du eigentlich schon ein Glas Wein. Eine weiße Frau hätte jetzt kommen können und mit ihr sprechen können. Bei der Lesung sind wir da dreimal durchgelaufen. Es hat nichts damit zu tun, einer Schwar-zen Frau in diesem Moment zu „hel-fen“. Aber diese „gemischten“ Räume würden so viel entspannter für alle Frauen sein, wenn sich alle in ihren eigenen Räumen miteinander mehr Gedanken machen würden. Ich habe das Gefühl, ihr macht euch immer erst dann Gedanken darum, wie ihr nicht
rassistisch sein könnt, wenn es wie-der darum geht, bloß keinen Fauxpas zu begehen, und das ist zweischnei-dig. Das ist nicht wirklich eine Aufar-beitung, und es versetzt die andere Person auch in eine unmögliche Si-tuation, fast so wie eine katholische Absolution: Es ist okay, ja, wir machen alle Fehler. Tut mir leid … Als müsste es mir leid tun, dass du beschämt bist. Aber das kostet einfach zu viel Kraft. Darum habe ich ja auch das Beispiel gebracht, und ich werde nicht müde, es zu wiederholen: Wie geht ihr in mehrheitlich weißen Räumen mit Ras-se um? Wie geht ihr da mit Macht-strukturen, mit Intersektionalität um? Ich brauche da gar nicht zu spekulie-ren, ich bekomme ja die Auswirkun-gen mit – nämlich: gar nicht. Es geht nicht darum, mir zu helfen, mir „bei-zustehen“ und mir zu zeigen, wie be-troffen man ist. Das ist nicht das, was ich brauche, was wir brauchen, weil es uns nämlich zum Vehikel macht: So, jetzt muss ich auch noch ihre Scham auffangen – darauf habe ich über-haupt keine Lust.
Peggy Piesche und Belinda Kazeem
ADEFRA e.V. – Schwarze Frauen in DeutschlandADEFRA ist ein Forum, in dem sich Schwarze Frauen mit unterschiedlichsten The-men wie Politik, Bildung, Lifestyle und Gesundheit beschäftigen. ADEFRA wurde 1986 gegründet und repräsentiert eine Vielfalt von Schwarzen Frauen: Töchter, Mütter, Frauen, die allein oder in Beziehung leben, Frauen aller sexuellen Orien-tierungen, alte und junge Frauen. Alle verbindet auf die eine oder andere Weise – unabhängig von Weltanschauung, Glauben, Nationalität, Beruf und Sozialisation – die Erfahrung, schwarz und eine Frau zu sein. » www.adefra.com
» »
Frauensolidarität 3/2013
34
Frauensolidarität 3/2013
35Frauenrechte / QUERSCHNITT //
LITERATUR MACHTSCHWARZE FRAUEN
SICHTBARBericht über die
Yari Yari Literaturkonferenzin Accra, Ghana
Ishraga M. Hamid
Als Literatin war Ishraga M.Hamid selbstverständlich von der „Organisation of Women Writers of Africa“
(OWWA) zur internationalen Literaturkonferenz „YARI YARI Ntoaso“ in Accra eingeladen. Die langjährige Autorin der „Frauensolidarität“ führte im vergangenen Mai Dutzende
Interviews mit Schriftstellerinnen und Aktvistinnen wieAngela Davis, Virginia Phiri oder Arroyo Pizarro.
Es war eine große Ehre und Freude, als ich die Ein-ladung zur Yari Yari Ntoaso – Internationale Litera-turkonferenz in Accra/Ghana erhalten habe. „YARI
YARI continuing the Dialog“ war eine leidenschaftliche Gelegenheit, mit 60 Schwarzen Schriftstellerinnen aus 20 Ländern der Welt zusammenzutreffen. Darunter waren weltweit bekannte Gesichter wie Angela Davis, Ama Ata Aidoo, Sapphire, Lola Shoneyin und Veronique Tadjo. Die Konferenz hat nicht nur Schriftstellerinnen zusammenge-bracht, sondern auch Schwarze Wissenschaftlerinnen aus Afrika und seiner Diaspora. Ich habe meine „Wurzeln“ bei dieser Konferenz gefunden, so strahlten die Frauen in mir, und für eine kurze Weile habe ich alle 60 Frauen mit deren lebhaften Worten und Intelli-genz in Wien gesehen, wo eine „arme“ afrikanische Frau auf dem Plakat einer Organisation der „Entwicklungshilfe“ rausgeht und gegen die Stereotypen demonstriert und der Welt zeigt, was diese immer vergessen mag: dass Afrika eine Zukunft hat. Diese vier Tage waren voller Leidenschaft und Sehnsucht, Sehnsucht nach der Urkönigin von Afrika, voll von Ideen, Konzepten, sachlicher Kritik, vielen Beden-ken, Nachdenken und Umdenken.
Es war sehr bewegend, als ich den eleganten großen Saal sah, der dem Horizont Afrikas glich. Auf der Bühne stand hochstrahlend Rosemond S.King, die Koordinatorin dieser Konferenz. Die Königin im Bienenwald startete mit Conti-nuing the Dialog von Jane Cortez (1934-2012), der bekann-ten afroamerikanischen Dichterin und Mitbegründerin der Organisation of Women writers of Africa (OWWA). Als Ama Ata und Rashida Ismalili über sie in der beeindruckenden Performance Tribune to the Life, Writing and Activisim of Jane Cortez 1934-2012 erzählten, weinten sie, und Jane hat mit dem starken bunten Flügel ihrer Seele das trauri-ge Schweigen im Raum durchbrochen. Neben Workshops zu Identity and Creativity oder Writing through the Body Performance art war beeindruckend, dass junge Schrift-stellerinnen im Alter von 10 bis14 Jahren Workshops unter den Titel „Childern’s Storytime“ hielten. Sie gaben uns die Chance, ihre Geschichte zu hören, mit ihnen zu diskutieren. Ich war sehr bewegt, als ein Mädchen ihre Geschichte An-gela Davis vorgelesen hat. Tränen fliegen wie Tauben und richteten sich an den vergangenen Jahren und und Orten auf. Die alten Jahre waren heiter vor mir und erleuchteten den Moment, in dem ich vor Angela Davis stand. „Schon
vor vierunddreißig Jahren habe ich angefangen, dir Briefe zu schreiben“, sagte ich mit tränenverschleierten Augen, als ich sie nun sah, diese Frau, die mir Kraft gegeben hat.Nach dem Film „Audre Lord: The Berlin Years 1984-1992“ führte ich intensive Diskussionen mit Olumide Popoola und Lucia Charun-Illescas über die Diaspora in Österreich und Deutschland. Wir diskutierten über Schwarze Menschen und deren Situation in Österreich und Deutschland, was wir gewonnen und verloren haben und wie unsere Kreativität durch sie beeinflusst wird. Viele der Teilnehmerinnen beeindruckten mich, darunter Yo-landa Arroyo Pizarro, die ihre literarischen Beiträge in mehr als ein Dutzend von Anthologien in der ganzen Welt veröf-fentlicht hat. Ihr Vortrag und das Interview, das ich mit ihr führte, waren sehr bewegend. Hier ein Ausschnitt ihres Vor-trags. „To Talk about Ancestras: Towards a New Insurgent Literature of African descendants in Puerto Rico“:
I. Why talk about Ancestras
Notice that I don’t use the masculine “Ancestro” which means ancestor. In my perspective, we have a lot of the male nouns throughout history. Articles, essays, narratives, chapters and books have been dedicated by historians. It is not the same to say “Ancestra” (or Ancestress), a ne-ologism female that I prefer to use. I think Ancestress is more appropriate, it fills the emptiness of historicity and poetic liability that force me to tell the life of my foremoth-ers and predecessors, female human beings with which I desire to stand out because I understand that they ask me themselves, through a literary trance, to do this. The right thing, given the chauvinism and rampant racism that reigns in my country today, it would be ok to talk about my black Ancestresses that came from Africa. At least, that is how I feel, with the necessity to scrutinize and capture in literature this mental rapture that disturbs my sense until I put my mind to writing. The expert William A. Baralt in his text, Rebel Slaves. Conspiracies and slave revolts in Puer-to Rico. (1795-1873), Ediciones Huracán, 1982, explains: „Until very recently, I only knew of a very small number of slave conspiracies and uprisings occurred during the late nineteenth century. However, this research mainly based on primary documentary sources in several municipalities in Puerto Rico, shows that, contrary to what had always been believed, the island‘s slaves frequently rebelled. The number of known conspiracies to take over the white peo-ple and the island, more incidents to murder whites, and particularly to the Butlers, exceeds forty attempts. But if we consider the secrecy and clandestine nature of these movements, the number would be undeniably superior.” In 1998 I invented a pseudonym. By that time I attended a very fundamentalist church who will certainly be shocked by my transgressed trend of my writings. Under the name of Gabriela Soyna I made up this quote somehow trying to
dialogue with Baralt’s writing: “Black women took part in the thousand individual and group escapes that took place in slavery and subsequent times, this side of the globe. They performed active and starring roles in the majority of the seditions and revolts held, in a pure manifestation of re-belliousness. Tired as they were of the institution of slavery and all kinds of restrictions to freedom, they transgressed, infringed and upset the established order.”Thanks to this dictate that I intuited in some fashion, I start-ed to work on a book that I finally published in 2012, the story book Negras, using as an epigraph that quote by my alter ego Gabriel Soyna. I further included the following dedication: “To historians, for leaving us out. Here we are again… present of body, current colour, rejecting invisibil-ity… refusing to be erased.” And the fact is that I always bore in mind the Nigerian proverb that dictates: “until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter”. On the other hand, Gloria Stei-hem, the American feminist, had already infected me with a voracious and disturbing idea, which applies to those who tell the story always from the male or patriarchal point of view. She remarks: “I have met brave women who are ex-ploring the outer edge of human possibility, with no history to guide them.” Thus, guided by history’s logic, or maybe still without any necessarily known history, I took it upon myself to challenge the “hunter’s glory” and talk about the Ancestresses from the standpoint of a new insurgent lit-erature of the Afrodescendence. And I say “new” because in Puerto Rico we have next to no literature at all describ-ing our ancestresses. We do not have the Slaves Narratives genre or category as the stories told by distinguished male or female slaves are called – or even biographies narrated by the slave himself or herself.”
Ein anderer wichtiger Beitrag – „Why Write about Sex Wor-kers?“ – kam von Virginia Phiri aus Zimbabwe. Die spannen-de Diskussion warf ein starkes Licht auf ihren Roman The Highway Queen. Neben den Vorträgen, Workshops und Panels kamen alle Teilnehmerinnen zu Abendlesungen zusammen, an denen Dichter_innen und Schriftstelle_innen aus Ghana mitwirk-ten, aber auch Teilnehmerinnen der Konferenz, wie Samiya Bashir und Natalia Molebatsi.In mir klingen bis jetzt die Worte des letzten Vortrags „Con-tinuing the Dialogue: Keeping Our Work in the World“, wobei ich hoffungsvoll bin, dass die Yari Yari Konferenz weitergeht und eines Tages in Wien stattfinden könnte, so umarmt Europa Afrika in Wien.
Anmerkung: Die Teilnahme von mir wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung von WIDE, Brot für die Welt, Drei-königsaktion und Frauensolidarität.
Zur Autorin: Ishraga Mustafa Hamid ist Literatin, Publizistin, Buchau-torin, Übersetzerin und Aktivistin. Sie lebt in Wien.
Frauensolidarität 3/2013
36 // QUERSCHNITT / Frauenrechte
Frauensolidarität 3/2013
37Frauenrechte / QUERSCHNITT //
NICHTBESONDERSEXOTISCHCélia Mara –
die starke Stimmeaus Brasilien
Silvia Jura
Die Ausnahmekünstlerin, die ihre internationale Karriere von Wien aus betreut, bringt die großen Themen
unserer Zeit in tanzbares Format. Mit viel Mut setzt sie sich für Menschen- und
Umweltrechte ein, je nachdem, wo sie gerade gehört wird.
„Libertaaaaaam as suas deuas ocultas – Befreit eure versteckten Göttinnen!“, ruft sie in die Menge. Sie hält kurz inne, schiebt die lilafarbe-
ne Turbanwollmütze im Nofretete-Look leicht nach hin-ten, wischt sich ein paar Schweißperlen von der Stirn. Das Publikum starrt sie an, hypnotisiert, wartet auf ihr Signal … was kommt jetzt? Ihre Mandalakette schwingt seitlich, die weite Seidenbluse wird vom Wind erfasst, die grün-rot gestreifte Hose flattert an ihren zarten Beinen – plötzlich reißt sie die Gitarre wieder hoch, lacht, „Oh deusas ocul-taaaaas!“ – springt quer über die Bühne, im Twostep mit ihrer Bassistin … Die Band setzt in die nächste Runde Ska ein, die Percussionsection aus Senegal macht Druck, die Trompeterin legt noch ein paar jazzige Akkorde drauf. Par-tytime auf der großen Afrika-Tage-Bühne, das Publikum: in Extase. Célia Mara – in Aktion! Seit fast 20 Jahren lebt und arbeitet die Brasilianerin Célia Mara in Österreich. Nur mit ihrer Gitarre bewaffnet, kam sie, über die Schweiz, zuerst nach Mondsee, zog dann nach Salzburg, bis es sie schließlich in die Kulturmetropole des Landes verschlug. Die Autodidaktin, geboren in einer der ärmsten Regionen der Welt, im trockenen Vale de Jequitinhonhas, einem aus-gebeuteten Minengebiet im Nordosten von Minas Gerais, verließ mit neunzehn ihre Region. Als Frau stand ihr nicht wirklich eine Karriere als Sängerin offen, im Gegenteil, die Vorgabe wäre: heiraten und Kinder großziehen.
Sie ging in die Hauptstadt, Belo Horizonte, Musik machen; schlug sich durch, spielte in Bars, immer öfter in politischen Zusammenhängen – man sah sie auf den großen Streiks, mit ihrer Gitarre, Seite an Seite mit den Gewerkschaftsfüh-rern. Brasilien war frisch von der Militärdiktatur befreit, der damalige Präsident José Sarney war allerdings noch ein Re-likt des Autoritarismus.Die Musikszene von Belo Horizonte war stark männlich und bürgerlich geprägt, aber das Mädchen aus dem Landesin-neren ließ sich nicht einschüchtern. Bald entdeckte sie das Publikum, sie spielte im TV, in Theatern, bekam großartige Kritiken. Sie reiste in Brasilien herum, nahm in São Paolo eine Single auf, kam nach Rio. Die junge Sängerin stand am Beginn einer vielversprechenden Karriere. Doch drakoni-sche Sparmaßnahmen drehten der Kultur das Geld ab, von Musik leben wurde immer schwieriger. Célia Mara verließ Brasilien. Sie war in die Schweiz eingela-den worden. Geld hatte sie keines, nur ein Ticket und einen Festivalauftritt in Solothurn.
Cut: Das Jahr 2000 in Österreich
Schwarz-Blau an der Macht. Das Frauenministerium ist von einem Tierarzt besetzt, der gleich mal ein Männerschutz-sekretariat einrichtet. Das Staatsilber wird verscherbelt, Abfangjäger werden gekauft … Österreich schlittert in ein
politisches Desaster, Ethik und Staatsfinanzen tragen ei-nen bleibenden Schaden davon.Der damalige ÖGB-Boss Fritz Verzetnitsch bestellt Célia Mara zur Eröffnung des Bundesgewerkschaftskongresses – über 3.000 Abgeordnete aus den Bundesländern, die ge-samte Regierung, Kirchenspitze und Bundespräsident sind anwesend. Die Stimmung ist gespannt, die schwarz-blaue Regierung stößt auf keine Gegenliebe. Célia Mara zieht in den Saal des Austria Centers ein … Percussion, klatschen … brasilianische Stimmung zur Kongresseröffnung! Ein we-nig Exotik, die Ablenkung tut gut. Und dann legt sie los: „Ich bin froh, froh … sowie so – ich bin so bei dir!“, trällert sie mit breitem Grinsen ins Pub-likum! In einen indischen Mantel gehüllt, mit Pudelhaube auf dem Kopf, macht sie Stimmung, feuert ihre Musiker an. Die Lyrics werden auf der großen Leinwand hinter ihr ein-geblendet: „Unsympathisch idyllisch ist dein Ideal / flexible Sklavin für dein Kapital / Technokraten, homophob / ethno-zentristisches Alarmsignal… “Ungläubiges Staunen breitet sich in den vorderen Regie-rungsreihen aus …„Hey, Boss, ich finde dich einfach genial! Hey, Boss, ich treffe dich auch gerne informal …“, tönt es in voller Laut-stärke von der Bühne. Célia Mara singt – der Kanzler zupft an seinem Mascherl, hochrot im Gesicht, empört über die Frechheit der kleinen Ausländerin … Der Bundespräsident kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, die Gewerkschafter_innen applaudieren … Das Eis ist gebrochen, der Kongress beginnt kämpferisch – die Stimmung ist großartig.
Cut: 11.6.2001, Berlin
Eine halbe Million Menschen rund um die Siegessäu-le – sie lauschen mit offenem Mund Klaus Wowereit, dem neuen SPD-Bürgermeister. „Ich bin schwul, und das ist gut so“, outet er sich. Tosender Applaus – und Cé-lia Mara übernimmt die Bühne: „We’re not alone, alone, alone, aaalone! Never!“, singt sie, tanzt – „celebrate your pride, celebrate!“ – die Party geht ab, so weit das Auge reicht: tanzende und feiernde Menschen – Deutschland ist LGBTIQ!(LesbianGayBiTransInter Queer)Célia Mara outet sich ständig, in ihren Handlungen, in ihren Texten, in ihren Shows. Sie lebt Musik als Sprachrohr ge-sellschaftlicher Anliegen, ihrer Anliegen. Bei einem Auftritt in Genua mit der Banda di Piazza Caricamento, einem Kol-lektiv von jungen Asylsuchenden, widmete sie dem von der Polizei getöteten G8-Demonstranten Carlo Giuliani explizit den Song „Fabrica de Armas“. „Baila, baila, baila“, heizt sie dem Publikum ein – der Text ist eine bissig-ironische Abrechnung mit der Rüstungsindustrie und den Mächtigen dieser Welt. Dass sie es mit ihrem eigenwilligen Bastardsound ganz nach vorn in die europäischen Charts gebracht hat, macht sie nicht nur stolz. Musik ist ihr Lebenselixier. Die Qualität ist
ausschlaggebend, sagt sie immer. Sie arbeitet hart, ist Kon-zeptionistin der Vermischungen, experimentiert zwischen den Kulturen. Sie bastelt wochenlang an seltsam anmuten-den Sounds, arrangiert ihre Lieder immer wieder neu, bis sie zufrieden damit ist … Die Texte kommen, manchmal wie von selbst, direkt aus dem Universum, manchmal in Kleinst-arbeit, wo an jedem Wort gefeilt wird, überlegt, in welcher Sprache es wohl am besten passen würde. Ihre mächtige Stimme, die überwältigende Bühnenprä-senz– und auch die unbestrittene Band Leadership machen sie zu einer höchst anerkannten, auf den Festivals dieser Welt gefragten Künstlerin.Als das Jazzfest Wien sie für 2007 einlud, in der Wiener Staatsoper aufzutreten, war sie vor Ehrfurcht völlig perplex … ein Konzert in den heiligen Hallen der Hochkultur! Sie teilte sich den Abend mit der legendären Omara Portuon-do, der Grand Dame des Buena Vista Social Club. Dass sie mit ihrer Musik die Welt verändern kann, glaubte sie sogar in Moskau, als das Land noch im Umbruch war – Putin hielt sich noch ein wenig zurück. In den Straßen hingen Outdoors und Transparente mit ihrem Namen und ihrem Bastard-Manifest, als sie anreiste; die Pressekonfe-renz, zu der Russlands bekanntester TV-Moderator, Dima Dibrov, eingeladen hatte, war mit über 30 Journalistinnen aus TV, Radio und Print besucht, die zwei Shows komplett ausverkauft. Célia Mara passt in keine Schublade – schon aus Prinzip nicht. Als Künstlerin ist sie eine Ausnahmeerscheinung. Ihr Leben zwischen den Welten – nicht nur zwischen Öster-reich und Brasilien – ist eine gelungene Verbindung von Widersprüchen und Gegensätzen. Europa ist für sie zu ei-ner echten Homebase geworden, sie hat sogar die Dop-pelstaatsbürgerschaft im Interesse der Republik verliehen bekommen. Rassismus, Homophobie, Sexismus, religiöser Fundamen-talismus, das sind die großen Probleme unserer Zeit. Des-wegen mischt sie sich aktiv in die Politik ein, um an einer besseren Welt zu arbeiten, hier wie auch in Brasilien. Mit ihrem Projekt Casa Matria baut sie in ihrer zweiten Wahl-heimat Salvador/Bahia gerade ein Zivilcourage-Aktivismus-zentrum auf, in Österreich engagiert sie sich mit femous an der Vernetzung, Sichtbarmachung und Professionalisie-rung von Musikerinnen.Migration ist für sie – der Weg des lebenslangenLernens …
Webtipps: » www.celiamara.net // » www.globalista.net //» www.silvias.net
Über die Autorin: Silvia Jura ist Kulturanthropologin mit Schwerpunkt Brasilien und als Vortragende und Bloggerin aktiv. Sie ist u.a. Grün-dungsmitglied der IG Worldmusic Austria und von femous. Gemeinsam mit Célia Mara leitet sie den Verein Globalista, der das Projekt Casa Matria in Salvador und femous: platform for famous female culture betreibt. Silvia Jura lebt in Wien und Salvador/Bahia.
Frauensolidarität 3/2013
38
Frauensolidarität 3/2013
39Frauenrechte / QUERSCHNITT //
DIEBLINDEN FLECKEN
DES REGENBOGENS Über den Film
„Difficult Love“ vonZanele Muholi und
Peter Goldsmid
Johanna Treindl
Im Jahr 1996 wurde Südafrika der erste Staat, der gleichgeschlechtlicher Liebe rechtlichen Schutz gab. „Difficult Love“ zeigt, wie wenig die Lebensrealität
Schwarzer Lesben mit dem Bild der liberalen „Regenbogennation“ gemein hat.
Die Kamera ist auf ihr Gesicht gerichtet. Sie lehnt an einer weißen Wand. Ihre Dreadlocks sind aus-nahmsweise nicht unter der großen Mütze gebün-
delt, die sie sonst gerne trägt. Stattdessen fallen sie locker auf ihren dunkelblauen Bademantel und auch ein wenig widerspenstig in ihr Gesicht. „I want people to know more about our lives as Black lesbi-ans who are living in South Africa. We come from families, we have friends, we work, we think, we care, we are con-scious there is so much going on in our lives. So I want peo-ple to know that we are here and we are part and parcel of this democracy. Our history somehow got distorted.“ Mit diesen prägnanten Worten erklärt Zanele Muholi, wel-che Absichten der von ihr und Peter Goldsmid gedrehte Film „Difficult Love“ verfolgt. Zugleich verweist sie damit
aber auch auf die Geschichte einer Nation, in der Demokra-tie unweigerlich mit dem Ende der Apartheid verknüpft ist. Mit der Überwindung des rassistischen Regimes trat 1996 in Südafrika eine neue, ausgesprochen liberale Verfassung in Kraft, die u.a. anderem den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung vorsieht. Südafrika war damit das erste Land weltweit, das die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen rechtlich verankerte. Die Realität Schwarzer Lesben in der sogenannten „Regen-bogennation“ sieht jedoch anders aus. „Schwierige Liebe“ lautet der Filmtitel und will wohl sagen, dass lesbisches Leben und Lieben trotz rechtlicher Legi-timation alles andere als „einfach“ ist. Nur stellt sich die Frage, wie der Film dem Anspruch, diese Realität zu zei-gen, gerecht werden soll? Lässt sich das Leben Schwarzer
Lesben in Südafrika in einen derart knappen Zeitrahmen zwängen? Um dieses nicht gerade simple Unterfangen zu bewerkstelligen, greifen Muholi und Goldsmid auf einen mosaikartigen Erzählstil zurück, bei dem sich einzelne Ge-schichten, Bilder und Aussagen zu einem eindrucksvollen Ganzen fügen. Da gibt es die Femme Viola May, die Geld für ihre künstli-che Befruchtung braucht und daher als Fotomodell posiert: „I am a woman, I am a lady, I am lesbian who is in love with other women, so please adress me as ,she‘ or ,mam‘ for you!“ Dann folgt die Geschichte von Petra und Pra-line, die aufgrund ihrer Liebe eine Obdachloseneinrichtung verlas-sen mussten und nun unter einer Brücke in Kapstadt leben. Die Heilerin Nkunzi Nkabinde erzählt über ihren Beruf und ihre Doppelidentität als Frau, in deren Körper zusätzlich noch der Geist eines männlichen Vorfahren lebt. Im Film wird das Gesicht von Gazi Zuma, auch zu sehen auf dem Cover von Zaneles Fotoband „Faces and Phases“, beweg-lich und erzählt über das Coming-out, die Reaktionen der Mutter und das Leben im Dorf. Und auch Millicent Gaika, die Opfer eines „corrective rape“-Angriffs geworden ist, ist Teil des filmischen Mosaiks.Während Muholi die Zuseher_innen von einem Geschehen zum nächsten führt, erzählt sie von ihrem eigenen Leben, ihrer Kindheit im Township, ihrer Familie, dem Tod ihrer Mutter, die als Hausangestellte bei einem Weißen Ehepaar gearbeitet hatte. Muholi schildert, wie sie die Kunst und die Fotografie für sich entdeckte. Sie führt uns näher an ihre Arbeiten heran, spricht über ihre Visionen und die Not-wendigkeit, die Gedanken in ihrem Kopf zu visualisieren.Zanele Muholi, die sich selbst als „visual activist“ begreift, hat 2009 mit ihrer Ausstellung im Rahmen von „Innovative Women“ in Johannesburg für viel Aufsehen gesorgt. Has-tig hatte Lulu Xingwana, Ministerin für Kunst und Kultur, das Gebäude verlassen, da sie auf Muholis Fotografien „verpönte“ Pornographie zu erkennen meinte. Dass es in den Darstellungen intimer Momente lesbischer Frauen je-doch um weit mehr als deren „erregende“ Wirkung geht bzw. dass vielmehr – wenn schon von „Erregung“ gespro-chen wird – Muholis Fotografien Erregung über soziale Verhältnisse zum Ausdruck bringen, wird im Film „Difficult Love“ deutlich gemacht. In ihren mehrfach ausgezeichneten Arbeiten setzt sich Muholi mit Sexualität, mit Geschlechterrollen und -normen in Südafrika auseinander. Die Apartheid und fortbestehen-de Machtdiskrepanzen zwischen Schwarz und Weiß werden thematisiert, etwa wenn sich Muholi in ihren Bildern selbst als „domestic worker“ inszeniert, um sich dann demonstra-tiv als Schwarze Herrin von einer Weißen Frau bedienen zu lassen. Mit solchen Kontrasten spielen ihre Fotografien, die häufig in Schwarz-Weiß ausgearbeitet sind. Dieser Aspekt wird im Film auch bei ihrer eigenen Bezie-hung zu Liesl Theron nicht ausgeblendet, sondern durch-aus kritisch beleuchtet. Dennoch erscheint das Leben des Paares nahezu luxuriös im Vergleich zu den Verhältnissen,
in denen Petra und Pra-line leben: in einem finsteren Ver-schlag unter der Brücke, den sie sich mit Ratten teilen. Von den Nachbarn werden sie akzeptiert, weil sie sich als Mutter und Tochter ausgeben. Gezeigt wird aber auch hier wiederum Optimismus und ein Vergnügen, welches den Zuseher_innen beinahe noch mehr zusetzt als dramatische Opferinszenierungen, auf die sich Muholi und Goldsmid gar nicht erst einlassen.Die Schnitte sind kalkuliert, manchmal abrupt, beinahe bru-tal, und gestalten sich dann wieder in „sanften“ Übergän-gen. Dies verleiht dem Film einen lebendigen Rhythmus. Auf die sinnlichen Bilder lesbischer Intimitäten folgen Ar-mut, Verstoßung und Ächtung. Aus der Bestürzung über Millicent Gaikas tragisches Schicksal, von dem sie selbst mit würgender Stimme und schwerem Atem berichtet, wer-den die Zuseher_innen von dem antreibenden, fast schon heiteren Geschehen auf dem Fußballfeld mitgerissen, wo Frauen, die ähnliche Gewalttaten erlebt haben, sich or-ganisieren und gegenseitig bestärken. Mal schwenkt die Kamera langsam und nähert sich sachte dem Geschehen, dann folgen flotte Abfolgen von Fotografien oder Intervie-wausschnitten, in denen Menschen ihre Meinung zu Homo-sexualität äußern. Das Kommentieren solcher Szenen sowie der unterschied-lichen Sichtweisen und Situationen wird dabei zumeist der Journalistin und Kritikerin Gail Smith, der Analytikerin für Gender Nomboniso Gasa oder der Menschenrechtsanwäl-tin Wendy Isaacs überlassen. Sie rücken dadurch in eine Expertinnenposition, auch wenn diese nicht explizit ange-führt wird. Muholi hingegen inszeniert sich in der Rolle der emotionalen Künstlerin und quirligen Aktivistin, bei der weder Lachen noch Weinen vor der Kamera ein Tabu sind. „All I wanna see is just beauty. And beauty doesn’t mean that you have to smile, or show your teeth (...) just be!“ Vertraut und authentisch wirkt der Film, selbst wenn in manchen Sequenzen deutlich wird, dass diese Authenti-zität gut vorbereitet wurde. Wut und Frustration werden zwar sichtbar gemacht, lösen sich aber in neckischen Dia-logen und emanzipatorischen Aktionen wieder auf. So ver-bleibt der Film in Anbetracht der zehrenden Realität, die er darstellt, doch mit einem sehr ermutigenden Fazit und der Aufforderung, weiterzumachen und zu lieben, auch wenn das manchmal schwierig ist – difficult love.
Lesetipps: Blackwood, Evelyn/Wieringa, Saskia E. (1999): Fema-le Desires. Same-Sex Relations and Transgender Practices Across Cultures. New York. // Morgan, Ruth/Wieringa, Saskia (2005): Tommy Boys, Lesbian Men and Ancestral Wives. Female Same-Sex practices in Africa. Auckland Park. // Nkabinde, Nkunzi Zandile (2008): Black Bull, Ancestors and Me. My Life as a Lesbian Sangoma. Auckland Park.
Zur Autorin: Johanna Treidl ist Absolventin der Soziologie sowie der Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit „Dangerous Desires“ hat sie gängige Argumente im gegenwärtigen Diskurs über gleichgeschlechtliches Begehren in Südafrika extrahiert und analysiert.
Frauensolidarität 3/2013
40
Frauensolidarität 3/2013
41Frauenrechte / QUERSCHNITT //
FRAUENRECHTE SIND MENSCHENRECHTERückblick und Vorausschau der Vienna+20-Konferenzen
Claudia Dal-Bianco
Im Jahr 1993, bei der zweiten UN-Menschenrechtskonferenz, wurde ein neues Menschenrechtssystem aufgebaut. Die Wiener Erklärung, die damals verfasst
wurde, gilt seitdem als Meilenstein im Bereich der Menschenrechte. Damals wurde deren Universalität festgeschrieben, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
und Frauenrechte wurden erstmals als Menschenrechte anerkannt. Was ist seit 1993 geschehen? Welche Herausforderungen gibt es? Diesen Fragen gingen zwei Konferenzen in Wien Ende Juni 2013 nach: die von zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSO) mit dem Titel „Menschenrechte in der Krise“ und eine
Konferenz des österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) „Advancing the Protection of Human Rights“.
Erkämpfen von Frauenrechten 1993
1993 wurden erstmals alle Formen von Gewalt gegen Frau-en explizit als Menschenrechtsverletzungen anerkannt. Alle 171 teilnehmenden Staaten haben die „Wiener Erklärung“ unterschrieben, in der es heißt: „Geschlechtsspezifische Gewalt und alle Formen von sexueller Belästigung und Aus-beutung, einschließlich solcher, die auf kulturellen Vorurtei-len und dem internationalen Menschenhandel zurückzufüh-ren sind, sind mit der Würde und dem Wert des Menschen unvereinbar und müssen beseitigt werden.“(Punkt 18 der Wiener Erklärung) Auf diese Worte sollten sich seither Frau-en und Menschenrechtsverteidiger_innen in allen Teilen der Welt ihren Regierungen gegenüber berufen können.Parallel zur UN-Menschenrechtskonferenz fand ein Frauen-rechtstribunal statt. Dort berichteten Frauen aus aller Welt über Gewalterfahrungen. Dieses Tribunal und die Berichte von Frauen haben erreicht, dass Gewalt an Frauen explizit als Menschenrechtsverletzung angesehen wurde.Wie ist es damals gelungen, die Themen der NGOs so mas-siv in die Menschenrechtskonferenz zu tragen? Was wurde tatsächlich durch die Konferenz möglich?
Für sich selbst sprechen und sich selbst organisieren
Als eine von vielen trommelte damals Charlotte Bunch, Gründungsdirektorin und leitende Wissenschaftlerin des Center for Women’s Global Leadership, weltweit Frau-en zusammen und startete die Kampagne „Frauenrechte sind Menschenrechte“. In ihrem Vortrag im Frauenminis-terium am 25. Juni diesen Jahres erzählte sie, dass diese Forderung bei anderen Menschenrechtsorganisationen auf großen Widerstand gestoßen sei, weil diese ihre eigenen Themenkataloge und Agenden für Wien gehabt hätten. Frauen hätten aber trotzdem die Wiener Erklärung geän-dert und mitgestaltet.Charlotte Bunch betonte, dass dies nur durch die voran-gehende jahrelange Organisation durch Frauenrechtsakti-vist_innen möglich gewesen sei. Schon in den 80er- und 90er-Jahren entwickelte sich eine globale Frauenbewe-gung, die eine feministische Perspektive auf Menschen-rechte forderte. Nach Charlotte Bunchs Meinung hat die Bewegung ihren Ursprung bei der Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985, bei der Frauen versucht haben, globale Agenden zu beeinflussen. Das Bewusstsein, dass eine glo-
bale Frauenbewegung eine politische Kraft ausüben kann, verbreitete sich.1991 trafen und organisierten sich Frauen global, um die Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ zu planen. Die erste Aktion war eine Petition, um Frauen in die Agen-den von Wien zu inkludieren. 1992 wurden Forderungen von Frauen auf regionalen Konferenzen verbreitet und die Aufnahme auf die Agenden gefordert. Zu Beginn des Jah-res 1993 gab es bereits Treffen, um das Frauenrechtstribu-nal zu organisieren. Ein weiterer Grund für den Erfolg der Konferenz von 1993 war ein von den Frauen eigens organisierter Frauenrechts-raum im Vienna International Center, um einen Platz zu ha-ben, wo sie sich vernetzen. Im Vorfeld wurde auch bei den Organisator_innen eingefordert, dass die Hälfte des Geldes für Reisekosten Frauen zustehen sollte, damit es ihnen mög-lich werde, anwesend zu sein und für sich selbst zu sprechen.Was wurde von den damaligen Forderungen bis jetzt er-füllt? Navi Pillay, UN-Hochkommissarin für Menschenrech-te, meinte in ihrer Rede auf der Konferenz des österreichi-schen Außenministeriums, dass noch viel zu machen sei und nicht alles von der Wiener Erklärung umgesetzt wor-den sei. Vor allem der Zugang zum Recht sei noch immer eine große Hürde.
Aktuelle Herausforderungen
Fundamentalismen nehmen zu – unter dem Deckmantel von Religion und Tradition werden Frauenrechte beschnit-ten. Zentraler Konfliktpunkt heute ist das Recht von Frauen, ihren eigenen Körper zu kontrollieren, ihre Sexualität selbst zu bestimmen.Sexuelle und reproduktive Rechte bedeuten Selbstbestim-mung. Mayra Gomes, Mitbegründerin sowie Co-Direktorin von „The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights“, meinte auf der CSO-Konferenz, dies sei das wich-tigste Recht für die Frauenbewegung. Es sei ein Eckpfeiler und wahrscheinlich die letzte Barriere für die Durchsetzung von Frauenrechten. Innerhalb der Zivilgesellschaft ist das Thema kontroversiell und entzündet oft heftige Debatten. Sexuelle und reproduktive Rechte werden häufig von kon-servativen Stimmen in Frage gestellt. Diese wollen sie be-schränken und opponieren gegen progressive Positionen. Aber diesmal konnten sich die progressiven Stimmen trotz Widerstand durchsetzen und sexuelle und reproduktive Rechte in der CSO-Deklaration festschreiben.Eine weitere Herausforderung ist, dass Menschenrechts-verteidiger_innen, speziell solche im indigenen Bereich, großen Risiken ausgesetzt sind und verfolgt werden. Es wird Rechenschaft von privaten transnationalen Konzernen gefordert, um das wirtschaftliche Überleben besonders von indigenen Gemeinschaften zu sichern, weil diese spezi-ell von Staaten, transnationalen Konzernen und Paramilitärs immer wieder unter Beschuss geraten.
Zivilgesellschaft auf Distanz halten?
Zivilgesellschaftliche Organisationen müssen ein wachsa-mes Auge haben und sich in Diskussionen aktiv einbringen. Die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Organisationen als Akteur_innen für das Vorantreiben von Menschenrechten war schließlich ein zentrales Thema der Konferenz des Au-ßenministeriums. Aber wie werden sie einbezogen?Die Deklaration der zivilgesellschaftlichen Organisationen wurde auf der BMeiA-Konferenz vorgestellt und hat in un-terschiedlichem Ausmaß Einfluss auf die Diskussionen in den jeweiligen Arbeitsgruppen genommen. Auf der Konfe-renz gab es Arbeitsgruppen zu den Themen „Frauenrech-te“, „Post 2015“ und „Rechtsstaatlichkeit“. Zwar nahmen Vertreter_innen der zivilgesellschaftlichen Konferenz in diesen Arbeitsgruppen teil, doch es konnte nur auf Ein-ladung mitdiskutiert werden. Dies zeigt, dass in der Pra-xis die Einbindung von der sogenannten Zivilgesellschaft beschränkt und reguliert wird, obwohl theoretisch deren Wichtigkeit betont wird.Was passiert nun mit dieser angestoßenen Diskussion und den ausgearbeiteten Empfehlungen und Forderungen?
Ein Blick in die Zukunft
Es wird eine Publikation von der Konferenz des Außenmi-nisteriums geben, und die Empfehlungen werden bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates im September in Genf verbreitet. Auch die UN-Vollversammlung im Novem-ber in New York und EU-Foren sollen genutzt werden. Die zivilgesellschaftlichen Forderungen sind auf der Homepage der CSO-Konferenz abrufbar und sollen von NGOs genutzt werden. Die 153 Forderungen der Deklaration können nur weiter verfolgt werden, wenn sich die CSOs weiterhin orga-nisieren. Auf der CSO-Konferenz wurde zudem die Forde-rung einer dritten UN-Weltmenschenrechtskonferenz 2018 beschlossen.
Webtipps: » www.viennaplus20.org // » www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-policy/human-rights/vienna-20-high-level-conference-on-human-rights-on-2728-june-2013.html
Hörtipp: Dal-Bianco, Claudia: Vienna+20: Women’s rights at stake?! http://noso.at/?p=3262
Zur Autorin: Claudia Dal-Bianco ist Projektkoordinatorin bei der Frau-ensolidarität. Sie war bei der Vienna+20-CSO-Konferenz im Austrian Coordination Comitee (ACC) und war in der Vorbereitungsgruppe Frau-enrechte für die Erarbeitung der CSO-Deklaration. Sie lebt in Wien.
Frauensolidarität 3/2013
42
Frauensolidarität 3/2013
43
Auflösung der letzten RätselaufgabeIm letzten Rätsel haben wir nach Sonia Pierre gefragt, der Gründerin und langjährigen Leiterin der dominiko-haitianischen Frauenrechtsorganisation Mudha (Mujeres Dominico-Haitianas). Unter den vielen richtigen Einsendungen haben folgende Leserinnen gewonnen: Hilde Grammel aus Wien, Viola Kolschewski aus Köln und Johanna Mücke aus Graz.
Zur Autorin: Ulrike Lunacek ist Vizepräsiden-tin und Außenpolitiksprecherin der Grünen im Europaparlament; sie ist außerdem Obfrau der Frauensolidarität.
scheidung für oder gegen ein solches Kraftwerk. Wenn die Entscheidung dafür ausfällt, ist das, rechtsstaatlich betrachtet, legitim. Wenn die Re-gierung eine derartig weitreichende Entscheidung trifft, dann muss sie aber auch bei der Überprüfung kon-sequent sein. Es wurden von staat-licher Seite 40 soziale, ökologische und wirtschaftliche Bedingungen for-muliert – aber deren Erfüllung geht nicht mit derselben Geschwindigkeit und Präzision voran wie der Bau des Kraftwerkes.Grundsätzlich sollten bei derartigen Projekten Fragen der Notwendig-keit und Verhältnismäßigkeit, aber auch des „cui bono“ vor Beginn ge-klärt werden – der schale (Nach)Ge-schmack des Vorranges der Interes-sen von Bergbauunternehmen und Großgrundbesitzern vor den Millio-nen Menschen in den Tausende Kilo-meter entfernt liegenden Großstäd-ten bleibt. Antonia Melo, Vorsitzende des Movi-mento Xingu Vivo, betonte, wie wich-tig die Unterstützung durch unseren Besuch sei. Gerade jetzt, wo die ho-hen Kosten für die Fußball-WM 2014 und die Olympischen Sommerspiele 2016 absehbar werden, sei es an der Zeit, kritische Fragen nach dem Ein-satz von Budgetmitteln zu stellen – in Brasilien selbst, aber auch von Seiten der EU im Rahmen von Menschen-rechts- und Umweltdialog.
Zigtausende männliche Arbeiter sind in den letzten eineinhalb Jahren zum Bau des giganto-
manischen Belo-Monte-Staudamms am Xingu im brasilianischen Bundes-staat Pará gekommen – keine Kleinig-keit für die 80.000-Einwohner_innen-Stadt Altamira, die innerhalb von zwei Jahren auf einmal über 120.000 Men-schen zählt.Bei einer Fact-Finding-Mission der Grünen Fraktion im Europaparlament konnte ich mich im Juli gemeinsam mit meinen beiden französischen Kol-leginnen, den Abgeordneten Catheri-ne Grèze und Eva Joly, und unseren Mitarbeiter_innen davon überzeugen, dass – wie bei Großprojekten leider allgemein üblich – auch hier die Inte-ressen und Bedürfnisse von Frauen und Indigenen nicht beachtet wurden. NGOs klagen über massive Zunahme von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigungen und einer Zunah-me an (freiwilliger und erzwungener) Prostitution.Die Betreiberfirma Norte Energia ließ sich erst nach mehrmaligen An-läufen unsererseits am Ende unserer Reise und über Initiative der öster-reichischen Botschafterin Marianne Feldmann dazu herab, ihre PR-Frau zum informellen Gespräch mit uns zu entsenden. Dort schilderte diese ihre Sicht der Dinge, verteilte Hochglanz-broschüren und DVDs, betonte, dass einige Frauen sogar als Baumaschi-nen-Fahrerinnen beschäftigt seien ... Ob die Firma selbst etwas tut, um se-xuelle Belästigungen oder erzwunge-ne Prostitution hintanzuhalten, konn-
te sie nicht beantworten. Wir warten bis heute auf Detailinfos, die sie uns versprochen hat ...Apropos warten: Ich versuche derzeit zum dritten Mal, einen Termin beim Chef des österreichischen Turbinen-herstellers Andritz zu bekommen – bisher hat er Termine mit mir bzw. mit NGO-Vertreterinnen aus der Region mit dem Argument abgelehnt, Brasi-lien sei ein Rechtsstaat, Andritz ver-traue der Regierung in Brasilia.Dieses Argument der rechtsstaatli-chen Verantwortung Brasiliens hat zwar seine Richtigkeit, gleichzeitig sollten sich Firmen, die sich an der-artigen Megaprojekten beteiligen, auch für die Auswirkungen der Pro-jekte interessieren, die es in Brasilien etwa mit der Rechtsstaatlichkeit gibt. So konnte die Volksanwaltschaft des Bundesstaates Pará den Bau 2012 in erster Instanz stoppen, weil sie Män-gel beim verfassungsmäßig veran-kerten Recht auf „consulta previa“, also der Einbeziehung der Indigenen vor der Entscheidung über den Bau, festgestellt hatte. Die zweite Instanz hob dieses Urteil nach drei Monaten auf, der Bau wird seither fortgesetzt. Der Oberste Gerichtshof sollte diesen Punkt seit Monaten auf die Tagesord-nung stellen, tut es aber nicht. Was der Vermutung Nahrung gibt, die In-digenen und die Bewohner_innen von Altamira und der Dörfer am Xingu sollten einfach mit dem Bau vor voll-endete Tatsachen gestellt werden. Die Volksanwältin Thais Santi machte im Gespräch mit uns klar: Die Regie-rung hat zwei Optionen – die Ent-
MEGASTAUDAMM BELO MONTEIN AMAZONIEN
RÄTSEL //// KOMMENTAR
Wer das Lösungswort herausfindet, kann mit ein wenig Losglück eines der folgenden Bücher gewinnen:Zami von Audre Lorde, erschienen 2012 im Unrast-Verlag, Obskure Differenzen. Psychoanalyse und Gender Studies, herausgegeben von Marlen Bidwell-Steiner und Anna Babka, erschienen 2013 im Psychosozial-Verlag oder Solidarische Ökonomie & Commons von Brigitte Kratzwald und Andreas Exner, erschienen 2012 im Mandelbaum Verlag.Bei der Einsendung des Lösungswortes bitte nicht vergessen, das gewünschte Buch und die eigene Adresse anzugeben!» » Einsendung an: [email protected]
Waagrecht4 So zahlt Thek-la dort an-Schein-end für ihren Cocktail / 6 Was als Abgabe fürs Lenkrad zur Fiskus-sion steht, ist mehr als kostspielig / 8 Kommt sie im Back-Office aus dem Rohr ins SPIEL, fühlt sich der Shepherd ver-apple-t / 9 Bildlich gesprochen: Wo fanden Frauen in Schwarz und Weiß bei Zanele Muholi Aufnahme? (Mz) / 10 Kommt dir im kurzen Uni-Seminar sich-er spanisch vor / 11 Achtung, leicht entflammbar: Viehbestand auf Feuer-Land? Dort wird auch nur mit Schnaps gekocht? (Mz) / 13 Mit der Dose einen Blechschaden zu verursachen, bringt dich in den MALUS / 15 Ästhetisieren? Bagatellisieren – das könnte dir so gefallen, meine Hübsche! / 18 Beim Wegwerfen kommts zu Fall – die Sicht ist kein Zufall / 19 Wo Frauen-solidarität drüber geht, wenn Staaten am Ende sind (Mz) / 20 Ist ja Furcht-bar: Ihretwegen trauen wir uns nicht durch die EINGANGSTÜR / 21 Ortsbekannt: Wo sich laut Salomo die Alleinigroßmutter hinter San Pedro stellt?
Senkrecht1 Sie macht Ein- und Aus-Stiege barriereunfrei / 2 Beim Kampf um Kindgerechtigkeit braucht frau als solche zual-lererst Courage / 3 Darin nicht wie mit 2 senkrecht reden zu können, geht Rada Zivadinovic unter die Haut (Mz) / 4 In der Wild-nis ganz erpicht darauf, beim Gig Biere zu kippen? / 5 Du kommst mir nur sauber durch die Tür! / 7 Schlecht-wetterarkade? Er ist am Himmel über Südafrika bunt, doch blind befleckt! / 10 Wo wohl in der GEHALTSTABELLE die Mitarbeiter_innen Stecken? / 11 Kein kurzer Kuss zum lan-gen Abschied: Weil sie so viel busseln muss, / verpasst sie stets den letzten – / 12 Zu chiliger Musik schreibt sie ihre Isabelletristik an den 19 waagrecht des Weltraums auf(!)? / 14 Unter 7 senkrecht: Beim Kampf um Gleichbehandlung gehts frau als solcher um die Exisstenz (Mz) / 16 Im ame-rikanischen Käfigurenkabinett sind auch Nicolas und John zu bewundern / 17 Als Vorbild bestens geeignet
Hinweis: Die Buchstaben auf den orangen Zahlen ergebenein Lösungswort mit Zusammenhalt.
!"#$%&'()*'+*,-%.$/&01,*0#"#2'3%*4$#'5678'!!
!"!#!!!$!%!&"'!!!!(!)!!!!"!!!!!!!!!!!!*!+!!!!!!!!!!*,!!!!!!!!!!!*!!-!!!!!!!!."/0!!!!!!!!!!*1!!2!!!!3!!!"!4!4!4!!4!!4*5!!6!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!*74444!844444*!
!"
#"
$"
%"
&"
'"
("
)"
*"
!+"
!!"
!#"12
9
1 3
8
7 4
11
2
5
6
10
KREUZWORTRÄTSELDie Redaktion der Frauensolidarität freut sich sehr,
unser neues Kreuzworträtsel zu präsentieren!
Ulrike Lunacek
Die Folgen für Frauen werden ignoriert
Dieses heftspezifische Rätsel wird von nun an einmal im Jahr von derphoenixen Rätselwerkstatt für die Frauensolidarität erdacht.
Für Leser_innen, denen diese Art Rätsel fremd ist, gibt es auf der Website derphoenixen Hinweise, wie die querdenkerischen Fragestellungen zu knacken sind:
» www.phoenixen.at/nixtrix.html
© phoenixen
Frauensolidarität 3/2013
44
Frauensolidarität 3/2013
45
Naomi Wolf wollte in ihrer über 400 Seiten starken Abhandlung über die Vagina diePerspektive auf dasw e i b l i c h e G e -schlechtsorgan revo-lutionieren. Sie schafft das nur selten.
Mit dem wenig originellen, aber pla-kativen Titel möchte die Autorin schon vordringlich auf eine nichtdiskriminie-rende Bezeichnung für das weibliche Geschlecht aufmerksam machen. Was zunächst nach feministischer Gesell-schaftskritik anmutet, entpuppt sich allerdings schon auf den ersten Seiten als allzu plumpe und unwissenschaftli-che Recherchesammlung. Wolf stützt ihre Theorien fast ausschließlich auf biologische Vergleiche und verfällt zuweilen in das sprachliche Repertoire belehrender Ratgeberliteratur: Doch auch wenn die Art nicht zur professionellen Auseinandersetzung anregt, so weckt Wolf jedenfalls das Bewusstsein für einen ungezwunge-nen Umgang mit geschlechtsbezoge-ner Sexualität. Dafür bleibt nichtge-schlechtsspezifisches Sexualverhalten völlig außer Acht. Darüber, wie auf so vielen Seiten peinlich darüber ge-schwiegen werden kann, dass Sexu-alität auch jenseits von monogamen, eurozentristischen und heteronorma-tiven Werten eine Rolle spielt, kann man nur staunen.Was bleibt, ist der schale Nachge-schmack von obsolet gewordenen Sexualtheorien, mit denen sich kaum jemand identifizieren kann, und ein mehr als unkritisches Bild von hetero-normativen Beziehungen.
Regina Orter
In ihrem Buch befasst sich die G e s e l l s c h a f t s -wissenschaf ter in M i n n a - K r i s t i i n a Ruokonen-Engler mit Konstruktionen des Migrantinsein. Den empirischen
Gegenstand dieser Studie bildeten narrative biographische Interviews mit in Deutschland lebenden finni-schen Migrantinnen, die als solche von der Öffentlichkeit sowie von der Wissenschaft kaum wahrgenommen werden. Ruokonen-Engler geht da-von aus, dass Migrantinnen einen Transformationsprozess durchleben, und verwendet in ihrer Arbeit eine biographieanalytische Methode, um diese Prozesshaftigkeit der Migration sowie das gesellschaftliche Gewor-densein von Subjekten aus der Per-spektive der Migrantinnen selbst zu erforschen. Die gängigen Konzepte der „Heiratsmigration“ und „Arbeits-migration“ seien oft nicht ausrei-chend. Das Buch bietet einen guten Über-blick über die gegenwärtige Kon-zeptualisierung von Frauenmigration, dabei werden auch die Stereotypisie-rung und die damit verbundene Hie-rarchisierung von Migrantinnen the-matisiert. Spannend ist diesbezüglich die Selbstpositionierung der von der Autorin interviewten finnischen Frau-en als „unauffällig“ und „privilegiert“ im Vergleich zu anderen Migrant_in-nen in Deutschland. Ruokonen-Engler leistet mit ihrem Buch einen wesentlichen Beitrag zu den Debatten über transnationale Biographien sowie vergeschlechtlich-te Migrationsprozesse.
Verena Bauer
Heute führt die Gelbe Straße durch die Wüste. Begangen von An-tipatriden mit dem Einsatz und der Fragilität des gan-zen Lebens selbst, so die Autorin Kat-
ja Schröckenstein in der vorliegenden Anthologie, die eine Hommage an Veza Canetti darstellen. Venetiana Taubner-Calderons – oder kurz Veza Canettis – Gelbe Straße ist die Meta-pher für eine belebte, zentrumsnahe Straße des 2. Wiener Gemeindebe-zirks, der Leopoldstadt, in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Dort traf sich allerlei Menschentum mit den Nöten von Arbeitslosigkeit, Misogynie und selbstverständlich auch jeder Art von Lebenslust. Besonders lange war ihr diese Örtlichkeit – die junge Veza Taubner-Calderon lebte dort tatsäch-lich – als Inspiration nicht gegönnt, dem hinmetzelnden Faschismus ent-kam die unbekannte jüdische Autorin durch die Emigration nach London, wo sie 1963, viele Jahre vor ihrem berühmten Ehemann Elias Canetti, verstarb. Erst 1990 erschien posthum „Die gelbe Straße“, später folgten an-dere Werke, die der nachfolgenden Autor_innenschaft zur Muse gerieten, wie im vorliegenden Band. Die Viel-stimmigkeit der Erinnerungsarbeit an Veza Canetti beinhaltet vierzehn Bei-träge unterschiedlicher literarischer Schreibweisen, bei denen die Spuren-suche der Leserin nach Veza Canetti manchmal besser und manchmal dün-ner gerät, begleitet von einer Bilddo-kumentation des diesjährigen Kunst-projekts „Veza lebt“.
Helga Neumayer
„UNSICHTBARE“ MIGRATION?Transnationale Positionierungen finni-scher MigrantinnenMinna-Kristiina Ruokonen-EnglerBielefeld: transcript Verlag 2012
VAGINAEine Geschichte der WeiblichkeitNaomi Wolf
Reinbeck: Rowohlt 2013
VEZA CANETTI LEBTSozialkritische Literatur zeitgenössischer Autorinnen Ballauf, K., Ganglbauer, P., Moser Wagner, G.
(Hg.); Promedia Wien 2013
BÜCHER //// MUSIK
In Wien erhalten Sie unsere Musikempfehlungen im Weltladenin der Mariahilferstraße 8 in 1070.
Mosambik und Norwegen – wei-ter voneinander entfernt könnten die Breitengrade dieser zwei Länder
wohl kaum liegen. Musikalisch und kulturell gesehen gibt es ebenso we-nige Berührungspunkte, könnte frau meinen. Auf ihrem Debütalbum The Village beweist die World-Jazz-For-mation Monoswezi, dass es ausreichen kann, menschlich auf einer Wellenlän-ge zu sein. Den gemeinsamen musika-lischen Boden dafür bereiteten ihnen die repetitiven Klänge der Minimal Music. Nicht nur sprichwörtlich wird die rhythmische Führung der Band in die Hände der aus Simbabwe stam-menden Sängerin Hope Masike gelegt – virtuos spielt sie das Daumenklavier, die Mbira, ein Instrument, das traditio-nell von Männern gespielt wird. Entlang den schnarrenden und gleich-zeitig glockengleich klingenden Pat-terns ranken sich die jazzigen Klänge ihrer Mitmusiker Calu Tsemane (Per-cussion, Gesang) aus Mosambik, Hall-vard Godal (Saxophon, Klarinette) und Erik Nylander (Drums) aus Norwegen sowie des Schweden Putte Johander (Bass). Während sich der Instrumen-talpart tendenziell am Jazz und an skandinavischen Klängen orientiert, schlagen die Textpassagen in den Tra-ditionen Mosambiks und Simbabwes Wurzeln.Ästhetisch berühren sich diese Klang-welten in ihrer Klarheit, in Struktur, Form und Emotion. Monoswezi hat auf diese Weise einen Bandsound kreiert, der auf jedem Kontinent den Kopf frei macht.
Laura Wösch
THE VILLAGEMonoswezi Riverboat: 2013
Mit ihrem zwei-ten kollaborativen U n t e r n e h m e n , Crazy Blues, lie-fern China Mo-ses und Raphael
Lemonnier ein solides Album, welches alte Soul-, Jazz- und Bluesklassiker in-novativ auffrischt. 2009 nahmen die beiden bereits das Album This One’s for Dinah, ein gelungenes Tribut an Dinah Washington, auf. In ihrem neu-en Album werden neben einem Song von Washington (Resolution Blues) Ti-tel von weiteren Diven aus dem Soul-Umfeld, wie Ma Rainey, Nina Simone und Etta James, sowie auch aus ande-ren Musikrichtungen, wie Janis Joplin oder Donna Summer, mit teils neuen Arrangements durchaus erfolgreich interpretiert. Moses, ihrerseits im üb-rigen Tochter von Jazzlegende Dee Dee Bridgewater, verfügt über eine eindrucksvolle Stimme, welche man-nigfaltig eingesetzt wird, mal rau und bluesig bei Closing Time, einer der zwei Originalnummern auf dem Al-bum, mal energetisch und peppig in dem Lil-Green-Song Why Don’t You Do Right. Die Band hinter ihr, ange-leitet vom französischen Jazzpianis-ten Raphael Lemonnier, erweist sich ebenfalls als allseitig talentiert, wie auch die Duett-Gäste Sly Johnson, Pi-errick Pedron und Hugh Coltman. Al-les in allem ist Crazy Blues zum einen eine ehrwürdige Hommage an die Iko-nen früherer Zeiten, gleichzeitig aber auch ein erfrischendes und modernes Album, das einiges an eigener Ener-gie beweist.
Sam Osborn
CRAZY BLUESChina Moses und Raphael LemonnierEmarcy Records: 2013
Was für ein Glück: Nicht nur ist der Vorgänger Biyo – Water is Love wieder lieferbar – Saba Anglana hat
nun auch ein neues Album herausge-bracht! Das freut uns sehr, denn diese großartige Künstlerin lässt uns mit Life Changanyisha an einer einzigartigen Reise teilhaben, die sie gekonnt musi-kalisch umsetzt. Auf den Spuren von Afrikas größter Gesundheitsorganisa-tion AMREF (African Medical and Re-search Foundation) begibt sich Saba in den kenianischen Busch, in Dörfer und an entlegene Orte, wo AMREF unter extremen Umständen für eine flächen-deckende Gesundheitsversorgung ar-beitet. Aus diesem Eintauchen in den täglichen Überlebenskampf einerseits und der Wärme und Herzlichkeit und Lebendigkeit andererseits entstand Life Changanyisha – Das Leben ist am Brodeln. Die 1976 in Mogadischu/Somalia als Tochter einer äthiopischen Mutter und eines italienischen Vaters geborene und großteils in Italien aufgewachse-ne Sängerin verknüpft ihre Eindrücke und Erfahrungen zu bewegenden Texten und Liedern. Sie lässt sich und uns berühren – beispielsweise von der musikalischen Arbeit mit jugendlichen Slumbewohner_innen Nairobis, die wiederum Einflüsse von modernem Rap und traditionellen kenianischen Instrumenten in ihrer Musik verbin-den; oder von Massai-Chören in der offenen Savanne bei der tansanischen Grenze – und alles ist eine Brücke, die uns miteinander verbindet!Die elf Songs sind auf Englisch, Kisua-heli und Sabas Muttersprache Somali. Das Material besteht u. a. aus origina-len Feldaufnahmen. Gemeinsam mit vielen Künstler_innen gestaltet sich ein buntes und vielfältiges polyphones Album.
Nadia Muerwald
LIFE CHANGANYISHA SabaGalileo: 2013
1/4 Inserat Rema
heldinnenplatz.at
Frauensolidarität 3/2013
46
ZUM WEITERLESEN
Arbeit ohne Papiere, ... aber nicht ohne Rech-te! : arbeits- und sozialrechtliche Ansprüche von MigrantInnen bei undokumentierter Arbeit und die (aufenthaltsrechtlichen) Ge-fahren im Falle ihrer Durchsetzung / [Hrsg.: AK Wien ... . Red.: Johannes Peyrl ...]. - Wien : Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 2012. (AK Infoservice)
Frauen aus Aller Herren Länder: Frauen aus aller Herren Länder : ein Lese- und Bilder-buch zur gleichnamigen Ausstellung / Hrsg.: Arbeitskreis „Frauen aus Aller Herren Län-der“: Mara Rúbia de Andrade .... - Stuttgart : Schmetterling-Verl., 1990.
Grenzgängerinnen : Frauen auf der Flucht, im Exil und in der Migration / Elisabeth Rohr ; Mechthild M. Jansen (Hg.). - Gießen : Psy-chosozial-Verl., 2002. - (Psyche und Gesell-schaft)
Hanak, Ilse: Auf dem Weg zu uns selbst : ent-wicklungspolitische Aussagen afrikanischer Schriftstellerinnen ; eine Untersuchung zu Werken von Ama Ata Aïdoo, Ken Bugul und Amma Darko. - Wien : Verein für Interdiszi-plinäre Forschung u. Praxis/RLI-Verl., 1999.
Migration : Eine Debatte um Globalisierung, Nationalstaat und Menschenrechte, 1997. (Schritte ins Offene ; 6/1997)
Migration, Geschlecht und Staatsbürger-schaft : Perspektiven für eine antirassisti-sche und feministische Politik und Politikwis-senschaft / Bettina Roß (Hrsg.). - Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. (Politik und Geschlecht ; 16)
Migration und Geschlechterkritik : feministi-sche Perspektiven auf die Einwanderungs-gesellschaft. - Leverkusen : Budrich, 2008. (Femina politica ; 17.2008,1)
Milborn, Corinna: Gestürmte Festung Europa : Einwanderung zwischen Stacheldraht und Ghetto ; das Schwarzbuch / Corinna Mil-born. Mit Fotos von Reiner Riedler. - Wien ; Graz ; Klagenfurt : Styria, 2006.
Wenn Heimat global wird ... . - Köln : Verein Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, 2003. (Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis ; 63/64)
Diese und weitere Literatur zum Schwerpunkt „Migration – Arbeit – Asyl“ finden Sie in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik/Bestand Frauensolidarität.
Datenbank:www.centrum3.at/bibliothek
Öffnungszeiten:Mo–Di 9–17 Uhr,Mi–Do 9–19 UhrFr 9–14 Uhr.
NEUZUGÄNGE IN DER BIBLIOTHEK(Auswahl)
Amirpur, Katajun: Den Islam neu denken : der Dschihad für Demokratie, Freiheit und Frau-enrechte. - München : Beck, 2013.
Asian-Pacific Resource and Research Cen-tre for Women: Diabetes : a missing link to achieving sexual and reproductive health in the Asia-Pacific region / Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) ; World Diabetes Foundation (WDF). Coordinating ed.: Ambika Varma. - Kuala Lumpur : ARROW, 2012. - 40 S. : Ill., graph. Darst.
Basi, J. K. Tina: Women, identity and India‘s call centre industry. - London : Routledge, 2009. (Routledge research on gender in Asia series ; 1)
Becker, Zdenka: Der größte Fall meines Va-ters : Roman / Zdenka Becker. - Wien : Deu-ticke, 2013.
Chorus, Silke: Care-Ökonomie im Postfordis-mus : Perspektiven einer integralen Öko-nomietheorie. - Münster : Westfälisches Dampfboot, 2013.
Chuku, Gloria: Igbo women and economic transformation in Southeastern Nigeria, 1900-1960. - London : Routledge, 2013.
Çetin, Zülfukar: Interventionen gegen die deutsche „Beschneidungsdebatte“ / Zül-fukar Çetin ; Heinz-Jürgen Voß ; Salih Ale-xander Wolter. - 1. Aufl.. - Münster : edition assemblage, 2012.
Croll, Elisabeth J.: Feminism and socialism in China. - 1. publ. 1978. - Abington [u.a.] : Routledge, 2011. (Routledge revivals)
D‘Costa, Bina: Nationbuilding, gender, and war crimes in South Asia. - London : Rout-ledge, 2011. (Routledge contemporary Sou-th Asia series ; 29)
Femicide : a global issue that demands action / ed. by Claire Laurent ; Michael Platzer ; Maria Idomir. - Vienna : Academic Council on the United Nations System, 2013.
Fla$ar, Milena Michiko: Ich nannte ihn Krawat-te : Roman / Milena Michiko Fla$ar. - Berlin : Wagenbach, 2012.
Gender, migration and domestic service / edited by Janet Henshall Momsen. - London : Routledge, 1999.
Governing land for women and men : a tech-nical guide to support the achievement of responsible gender equitable governance [of] land tenure / Food and Agriculture Or-ganization of the United Nations. - Rome : FAO, 2013. (Governance of tenure technical guide ; 1)
Gunkel, Henriette: The cultural politics of fe-male sexuality in South Africa / by Henriette Gunkel. - London : Routledge, 2011. (Rout-ledge research in gender and society ; 26)
Hristova, Pepa: Sworn Virgins / Pepa Hristova. [Ed. by F. C. Gundlach. Texts: Sophia Greiff ; Danail Yankov]. - Heidelberg : Kehrer, 2013.
Kerner, Ina: Postkoloniale Theorien : zur Ein-führung / Ina Kerner. - Hamburg : Junius Verl., 2012.
Koch, Elisabeth: „Gastarbeiterinnen“ in Kärn-ten : Arbeitsmigration in Medien und per-sönlichen Erinnerungen / Elisabeth Koch ; Viktorija Ratkovic ; Manuela Saringer ; Ro-semarie Schöffmann. - Klagenfurt ; Wien : Drava, 2013.
Mars, Kettly: Vor dem Verdursten. Übers. von Ingeborg Schmutte. - Trier : Litradukt, 2013.
Montoya, Celeste: From global to grassroots : the European Union, transnational advoca-cy, and combatting violence against women. - New York, NY [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2013.
Pandya, Sophia: Muslim women and Islamic resurgence : religion, education, and identi-ty politics in Bahrain. - London : Tauris, 2012. (Library of modern Middle East studies ; 119)
Robinson, Kathryn May: Gender, Islam and democracy in Indonesia. - London : Rout-ledge, 2009. - (ASAA women in Asia series)
Simm, Gabrielle: Sex in peace operations. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013.
Vaf% , Far%b&: Kellervogel : Roman / Fariba Vafi. Aus dem Pers. von Parwin Abkai. Mit einem Nachw. von SAID. - Dt. Erstausg., 1. Aufl.. - Berlin : Rotbuch-Verl., 2012.
Wanderungen : Migrationen und Transforma-tionen aus geschlechterwissenschaftlichen Perspektiven / Annika McPherson ... (Hg.). - Bielefeld : Transcript-Verl., 2013. (Studien interdisziplinäre Geschlechterforschung ; 8)
Women‘s activism : global perspectives from the 1890s to the present / ed. by Francis-ca de Haan ; Margaret Allen ; June Purvis ; Krassimira Daskalova. - London [u.a.] : Rout-ledge, 2013. (Women‘s and gender history)
Women‘s suffrage in Asia : gender, nationa-lism and democracy / ed. by Louise Edwards and Mina Roces. - London [u.a.] : Routledge-Curzon, 2004. (RoutledgeCurzon studies in the modern history of Asia ; 16)
Zariâb, Chabname: Mein afghanischer Pia-nist / Schabnam Zariâb. Aus dem Franz. von Jutta Himmelreich. - [München] : Kirchheim, [2013?].
// BIBLIOTHEK
LIEFERBARE HEFTE
Abo-BestellungenFrauensolidarität im C3, Sensengasse 3, A-1090 Wien, [email protected] pro Heft: EUR 6,– plus Porto; Jahresabo EUR 20,– (Österreich) bzw. EUR 25,– (andere Länder)Erscheinungsort Wien – DVR 0771023 – Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahltwww.frauensolidaritaet.org
42 Frauenhandel und Prostitutionstourismus43 Auf der Flucht44 Frauenrechte – Menschenrechte46 Bevölkerungspolitik; Frauen-/Lesbenbewegung48 Frauenförderung in der Entwicklungspolitik50 Fundamentalismen52 Wirtschaft international; Algerien53 Maghreb; Weltfrauenkonferenz `9554 Internationale Zusammenarbeit nach Peking56 Kunst in Afrika; Arbeitsmigration57 Genderkontroverse58 Welternährung; Friedenspolitik59 Lesbenbewegung in Lateinamerika60 Migration und Ausgrenzung65 Menschenrechte; Mädchenwelten66 Frauenrechte, Wirtschaft, Kultur69 Frauenpower im Alter70 Globale Ökonomie71 Peking + 572 Feminismen77 Rassismus79 20 Jahre Frauensolidarität83 Informationswesen84 Mutterschaft und Reproduktion
85 Globalisierung ent-wickeln88 Köper(politiken)93 Medien, Blumenindustrie95 Mikrofinanzierung95 EU – Lateinamerika96 Katastrophen und Konfliktsituationen97 Informelle Wirtschaft98 Spiritualität99 Tourismus100 Feminismen101 Islamische Welten102 Arbeitsrechte in der informellen Wirtschaft103 Selbstorganisation von Migrantinnen104 Sport und Ökonomie105 Frauenrechte – Menschenrechte106 Literatur erzählt Kultur107 Nahrungssicherheit und Klimawandel108 Lesbenbewegungen109 Armutsbekämpfung, Wirtschaft, Krise110 Musikerinnen111 Gesundheit112 Sport113 Sexualität und Pornografie114 Filmschaffen115 Frauenrechte116 Sport117 Utopien118 Medien, Demokratie, Bildpolitik119 Vernetzung und Allianzen120 Klimawandel121 Medien und Demokratie122 Bildung, Migration, Kulturschaffen123 Arabische Umbrüche124 Wasser