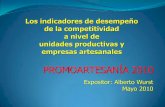Römerstraßenforschung in der Steiermark (2010)
Transcript of Römerstraßenforschung in der Steiermark (2010)
Gerald Grabherr / Barbara Kainrath (Hrsg.)
Innsbruck 2010
conquiescamus! longum iter fecimus
Römische Raststationen
und Straßeninfrastruktur
im Ostalpenraum
Akten des Kolloquiums
zur Forschungslage zu
römischen Straßenstationen
Innsbruck 4. und 5. Juni 2009
Inhaltsverzeichnis
● Vorwort . . . . . . . . . . 6
● Programm . . . . . . . . . . 7
● Raimund KastlerDie römische Tauernstraße − Der Abschnitt Pass Lueg bis nach Iuvavum.Zum Stand der Forschung im Bereich der Trasse und begleitender Infrastruktur . 9
● Bernd SteidlStationen an der Brücke − Pons Aeni und Ad Enum am Inn-Übergangder Staatsstraße Augusta Vindelicum−Iuvavum . . . . . 71 ● Andrea Csapláros, Réka Mladoniczki, Ottó SosztaritsEin topographischer Überblick der Bernsteinstraße zwischen Salla und Scarbantia 111
● Szilvia BíróEine Straßenstation unter militärischer Überwachung Anmerkungenzu einer römischen Station in Nordwestpannonien . . . . . 133
● Stefan Agostinetto, Thomas SchierlAb Aquileia − Archäologische und geophysikalische Prospektionen um Sevegliano bei Aquileia . . . . . . . . 159
● Hubert Steiner, Isabella Harb Römische Straßenstation an der via Claudia Augusta auf der Malser Haide (Vinschgau). Vorbericht . . . . . . . . . . 189
● Barbara KainrathZur Interpretation einer römischen Fundstelle an der Via Claudia Augusta im Gurgltal 215
● Gerald GrabherrDie römische Siedlung in Biberwier in ihrem Kontext mit der Via Claudia Augusta 241
● Jürg RagethDie römische Mutatio von Riom (Graubünden) an der römischen Julier-Route . 275
● Ronald RisyDie Situation der Römerstraßenforschung im Stadtterritorium von Aelium Cetium − Straßenstation oder Straßenkreuzung in der Tabula Peutingeriana? . . 287
● Christoph Hinker, Karl Peitler Die Norische Hauptstraße in der Steiermark unter besonderer Berücksichtigung der Neufunde im Bezirk Judenburg . . . . . . . 305
● Manfred LehnerDreierlei Schreibtischprospektion: Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark . . . . 337
● Verzeichnis der Autoren . . . . . . . . 355
STEIERMARK
Manfred Lehner
Dreierlei Schreibtischprospektion: Beiträge zur Römerstraßenforschung
in der Steiermark
338
Manfred Lehner
Dreierlei Schreibtischprospektion: Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
Manfred Lehner, Graz
Einleitung
Im heute steirischen Teil Noricums ist die archäologische Forschung zu Raststa-tionen und Straßeninfrastruktur, wenn es um konkret erfasste, also ergrabene oder prospek-tierte Objekte und um echte Trassenbefunde entlang der Überlandstraßen geht, noch nicht allzu weit fortgeschritten1. Zwar gibt es einige schöne Geländebefunde von Nebenstraßen2; auch innerhalb der Siedlungen sind (durchwegs nur geschotterte) Straßenkörper dokumen-tiert3. Die noch von Walter Modrijan als „eine der bestgebauten Römerstraßen Steiermarks“4 bezeichnete gepflasterte Straße von Donawitz nach Vordernberg und zum Steirischen Erzberg hat sich bereits vor 10 Jahren endgültig als Neubau aus der Zeit Maria Theresias erwiesen5.
Der konkrete Straßenkörper der sogenannten „Norischen Hauptstraße“ zwischen Virunum und Ovilava ist in ihrem steirischen Teil ein einziges Mal als archäologischer Alt-grabungsbefund nachgewiesen6. Sowohl vom Verlauf dieser Straße als auch von jenen, die jedenfalls entlang der größeren Flusstäler der Mur, der Enns und der Raab führten, gibt es zwar Altwegtrassen, die im dringenden Verdacht stehen, „die Römerstraße“ zu sein; auf den Punkt gebracht sind die römischen Hauptstraßen jedoch nur als Linien am Papier vor-handen, die sich aus der kartographischen Verbindung althistorischer Straßenanzeiger (Mei-lensteine, Itinerare) mit archäologischen Fundpunkten (Siedlungs- Gräber- und Streufunde, Römersteine) entlang eines vernünftigen, durch das rezente Geländerelief vorgegebenen Verlaufs als communis opinio herauskristallisiert haben. So kann z. B. im Barrington-Atlas die Murtalstraße zwischen Solva und Bruck etliche Male den Lauf des Flusses kreuzen, ein rein kartographisches Problem, das ohne Befunde, auf welcher Seite des (heutigen) Flussbettes denn die Straße wirklich verlaufen sei, nicht zu lösen ist und eben nur grob die logische Be-wegungslinie entlang eines Haupttales andeutet7.
Die Ortsnamenkunde kann in der Steiermark beim Auffinden der Stationspunkte der Itinerare nicht helfen, weil kein einziger römischer Siedlungsname auch nur ins Mittelalter überdauert hat8. Für sicher oder mit gutem Grund vermutlich in der heutigen Steiermark ge-legene Straßenstationen stehen folgende neun den antiken Itineraren entstammende Namen zur Verfügung: Ad Pontem, Graviacae, Monate, Noreia, Sabatinca, Stiriate, Surontio, Tartur-sanis und Viscellis9. Dazu kommen vielleicht Garavodurum, Gesodunum und Poedicum aus der
1 Für die sogenannte „Norische Hauptstraße“ vgl. Grabherr u. a. 2009 sowie den Beitrag von Ch. Hinker in diesem Band.2 Grabherr 2001 (Altaussee); Fuchs 2006 (Laßnitztal); Windholz-Konrad 2003 (Grimming).3 heymans 2004 (Flavia Solva); maier 1995, 33−35 (Gleisdorf); lohner-urban 2009, 45 f.; 109−111 (Kalsdorf, in der früheren Phase im platzartig sich erweiternden Siedlungszentrum als Rollsteinpflasterung ausgebildet); sedlmayer/TieFenGraber 2006, 38 f. (Saaz).4 modrijan 1957, 11.5 Klemm 2000.6 schmid 1932, bes. 198. 202 („Poststation Noreia“).7 TalberT/baGnall 2000, 100 (auf Karte 20 ist übrigens Flavia Solva unrichtig am rechten Sulmufer, also im Bereich des Frauenbergs eingezeichnet).8 lochner 2008, 29−31.−31.31.9 Nach zeller 2003, dort auch die primären Quellenangaben und die gängigen Lokalisierungsvorschläge. Dort fehlt zu Recht das manchmal bei Bad Radkersburg lokalisierte Ad Vicesimum der Tabula Peutingeriana, das wohl im heutigen Slowenien liegt; vgl. Redő 2003, 195; schreTTle/Tsironi 2007, 258.
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
339
Geographie des Ptolemaios, sowie das municipium Solva, welch letzterer Ortsname sich als einziger nachweislich mit einer ergrabenen Siedlung in Übereinstimmung bringen lässt10.
Darüber hinaus besteht das Problem, dass nach wie vor unklar ist, wie hier am Alpen-ostrand eine Straßenstation im archäologischen Befund auszusehen hat und wie sie typischerwei-se liegt: Meint der im antiken Itinerar verzeichnete Stationsname einen vicus, der sich an einer bestehenden Straße als Handels- und Produktionszentrum entwickelt? Dient einfach eines oder mehrere seiner Gebäude als mansio und/oder mutatio? Sind diese Gebäude bautypologisch oder in ihrem Fundspektrum von Gebäuden anderer Funktion zu unterscheiden? Oder bezeichnen die Itinerarnamen eigenständige Stationen an einer neu angelegten Straße, die bereits bestehende und in der Römerzeit sich zu vici entwickelnde Siedlungen verbindet? Gerade in der Steiermark gibt es etliche Beispiele von kaiserzeitlichen vici in Höhenlage, die Nachfolger eisenzeitlicher Höhensiedlungen sind11. Diese waren wohl in der Mehrzahl nicht direkt mit dem Verlauf einer Überlandstraße anzufahren; sind die Straßenstationen in diesen Fällen räumlich von der eigent-lichen Siedlung abgesetzt an virulenten Punkten des Straßenverlaufs (z. B. an Abzweigungen12, Kreuzungen, Scheitel- und/oder Fußpunkten von Sattel- und Passsituationen) zu suchen?
Was über die Kartierung von Altfunden und Altwegen hinaus nötig ist, ist die groß-flächige, kontrollierte Fundaufbringung mittels Metallsuchgerät entlang verdächtiger Alt-wegtrassen und daran anschließend punktuelle Grabungen, um die Straßenkörper und Sied-lungsstellen auch als archäologischen Befund vor sich zu haben: Ein teures, zeitintensives Unterfangen, das aber den einzigen Weg zu neuen, gesicherten Straßendaten darstellt13.
Weil Verf. leider nicht über solche Daten verfügt, sei es im Folgenden erlaubt, einige Aspekte herauszustellen, die vielleicht einmal in eine reale Straßen- und Straßenin-frastrukturprospektion münden und auch über die Steiermark hinaus als Arbeitshypothesen von Wert sein könnten.
Erster Aspekt: Die Murtalstraße(n) zwischen dem Flussknie bei Bruck und dem Aichfeld
Meilensteinfunde als handfeste Hinweise sind nur außerhalb dieses grob SW-NO ver-laufenden, östlichsten Abschnitts des oberen Murtales bekannt, nämlich flussabwärts im mitt-leren Murtal bei Feldkirchen und Deutschfeistritz14 sowie flussaufwärts bei Stadl15 und Murau16. Dazwischen klafft eine Lücke, die durch die beiden als römerzeitlich geltenden, kleine Gerinne überspannenden Hangbrücken von Adriach und St. Dionysen etwas verkleinert werden kann17. Adriach liegt rechts, St. Dionysen links der Mur, sodass, wenn man die zwei Brücken als Fixpunkte ein- und derselben Straße annimmt, dazwischen eine Flussüberquerung erfolgt sein muss.
10 Die Identifizierung der römischen Reste in St. Ruprecht bei Bruck an der Mur (dorniG 2009, 99 f.) mit dem „Poidikón“ des Ptolemaios ist nach luGs 2005, 19 keineswegs sicher, ebenso nicht die vom selben Autor vorgeschlagene Übereinstimmung des vicus von Kalsdorf mit „Garauódouron“ oder die von WinKler 1999, 34 vorgenommene Benennung des Frauenbergs bei Leibnitz als „Gesodunum“.11 Zusammengefasst bei bauer 1997.12 Für die Limesstraße vgl. den Beitrag von R. Risy in diesem Band.13 Die als Kooperation zwischen den Universitäten Innsbruck und Graz angelegten Altwegprospektionen entlang der „Norischen Hauptstraße“ am Triebener Tauern und im Paltental, die einige vielversprechende Geländebefunde, aber kaum eindeutige Metallfunde erbrachten, ruhen zur Zeit aus pekuniären Gründen (Insolvenz der Stadtgemeinde Trieben, die die bisherigen Untersuchungen teilfinanziert hat); vgl. zum Bisherigen zusammenfassend Grabherr u. a. 2009.14 WinKler 2000, 16; die Einordnung unter der Überschrift „Straße Celeia-Solva“ ist etwas irreführend, da beide Fundorte deutlich, nämlich 20 bzw. 40 Meilen nördlich von Solva liegen.15 WinKler 2000, 18 (Straße Virunum-Iuvavum).16 Tausend/Tausend 2005.17 heberT 1998 (Adriach); B. heberT, KG Oberdorf-Landskron, Fundber. Österreich 34, 1995, 721 f. (St. Dionysen).
340
Manfred Lehner
18 schmid 1937; dorniG 2009, 11−22. 99 f.−22. 99 f.22. 99 f.19 lehner 2008.20 lehner 2008, 594−59�. Der Münzenberg oder Münzenstein heißt im Volksmund auch Burgstallfeld, weil hier die−59�. Der Münzenberg oder Münzenstein heißt im Volksmund auch Burgstallfeld, weil hier die59�. Der Münzenberg oder Münzenstein heißt im Volksmund auch Burgstallfeld, weil hier die schon in der frühen Neuzeit abgekommene Burg Minczenperg stand. Vom Münzenstein sind etliche kaiserzeitliche und spätantike Münzaltfunde überliefert, sodass die Sigillatascherbe auch als Hinweis auf eine bisher unbekannte römische Höhensiedlung zu werten sein könnte, von der aus das gesamte Leobner Becken zu überblicken ist. Als Denkmodell sollte man also auch die umgekehrte Konstellation, nämlich dass die Siedlungsstelle von Donawitz eine Straßenstation an der Abzweigung ins Vordernbergerbach- und Liesingtal war und der vicus am Münzenberg/Burgstallfeld lag, nicht ausschließen.
Abb. 1: Das mittlere Murtal. B: Römische Hangbrücken bei Adriach und St. Dionysen, X: möglicher Straßendamm bei Proleb-Köllach, Quadrate: vici, Kreise: mögliche Straßenanzeiger auf der der
Hauptstraße gegenüberliegenden Flussseite. Kartengrundlage: ÖK 200 (AMap)
Die bekannten vici im zu besprechenden Talabschnitt sind − von Ost nach West − schnell aufgezählt (Abb. 1):
Bruck-St. Ruprecht18 liegt noch am rechten Murufer; irgendwo zwischen hier und der „Römerbrücke“ von St. Dionysen drei Kilometer westlich sollte der Fluss überquert wor-den sein. 16 Kilometer flussaufwärts von St. Ruprecht lässt sich in Leoben-Donawitz aus al-ten Fundmeldungen eine Siedlungsstelle rekonstruieren19. Halbwegs zwischen diesen beiden Siedlungen wurde erst jüngst bei Proleb-Köllach ein Geländemerkmal erkannt, das möglicher-weise als Straßendamm der römischen Murtalstraße angesprochen werden kann: Auf einer flachen Terrasse links oberhalb der Mur zeigt sich eine lineare Struktur in den Äckern (Abb. 2), die im Luftbild als heller Streifen und sogar im Katasterplan erkennbar ist, weil sich die re-zenten Feldteilungen offensichtlich nach ihr ausrichten. Die in der Josefinischen Kriegskarte von 1787 eingezeichnete Landstraße läuft wie die heutige weiter oberhalb am Hangfuß.
Bevor man in Donawitz ankam, hatte man eine kleine Sattelsituation am Mün-zenberg zu überwinden, dessen Steilabfall ursprünglich direkt über der Leobner Murschleife lag, sodass im Tal kein Platz für die Straße blieb. Genau vom Sattel stammt der Fund einer Rheinzaberner Sigillatascherbe der Form Dragendorff 18/31: Ein leiser Hinweis auf eine vom Donawitzer vicus um etwa anderthalb Kilometer abgesetzte Straßenstation20 (Abb. 3)?
Wenn man von Leoben-Donawitz nach Ovilava und an den Limes weiter wollte, war es besser, das Murtal Richtung Nordwest zu verlassen und die kürzest mögliche Anbin-dung an die „Norische Hauptstraße“ zu suchen, die sich über St. Peter-Freienstein und die sonnige Hochebene von Gai anbietet, um bei Seiz das Liesingtal zu erreichen (Abb. 1). Über
341
den Schoberpass, der mit nur 849 m ü. M. den niedrigsten Übergang über den östlichen Alpenhauptkamm darstellt, war nach gut 50 km die Hauptstraße bei der nördlichen Passfuß-station des Triebener Tauern (Surontio im Raum Trieben) zu erreichen21. Die Fundstreuung entlang dieser logischen und bequemen, aber archäologisch nicht nachgewiesenen Trasse durch das Palten-Liesing-Tal ist leider äußerst schütter22.
Wollte man von der Donawitzer Abzweigung nach Virunum, ging man hingegen weiter das Murtal aufwärts, um nach ca. 38 km den vicus am Rattenberger Kirchbichl23 am Nordrand des breiten Aichfeldes zu erreichen. Von hier aus war der Mur entlang über eine Siedlungsstelle bei Strettweg24 am südöstlichen Fuß des Falkenberges nach weiteren 21 km die Anbindung an die Hauptstraße möglich. Besser und zwei Kilometer kürzer war allerdings der Weg über das Pölstal und damit nördlich am Falkenberg vorbei, wo man bei Pöls25 be-reits halbwegs zwischen den Stationen Monate und Viscellae auf die Hauptstraße traf26; auch konnte man auf diesem Wege die straßenbautechnisch schwierig zu bewältigende Murklamm westlich von Judenburg vermeiden (Abb. 1).
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
21 Grabherr u. a. 2009, 8.22 Für Gai und das Liesingtal modrijan 1957, 11 f. 20 f.; für das Paltental heberT/hinKer 2003.23 ehrenreich u. a. 1997.24 TieFenGraber 200�, 20−22.−22.22.25 brunner 19�5, 40−45.−45.45.26 Beide Stationen − Monate ist im Itinerarium Antonini genannt, Viscellae in der Tabula Peutingeriana − sind− Monate ist im Itinerarium Antonini genannt, Viscellae in der Tabula Peutingeriana − sind Monate ist im Itinerarium Antonini genannt, Viscellae in der Tabula Peutingeriana − sind− sind sind nicht sicher lokalisiert. Gemeinhin wird Monate am linken Murufer gegenüber von St. Georgen ob Judenburg und Viscellae im Pölstal bei Möderbrugg-Unterzeiring angenommen.
Abb. 2: Möglicher Straßendamm der Römerstraße nördlich der Mur in den Feldern bei Proleb-Köllach
342
Die Siedlungsverteilung hier am Westrand des Aichfeldes zeigt deutlich, dass man im Murtal mit mehr als einer Straße zu rechnen hat, liegt doch am heute durch den Auto-bahnzubringer halbierten Grünhübl27 westlich von Judenburg eine weitere Siedlungsstelle südlich, also rechts der Mur. Etwas weiter östlich erreicht man vom flachen Murboden aus über den nur 955 Meter hohen Obdacher Sattel das Lavanttal, das einen in weiterer Folge direkt an die Drau und damit auf kürzestem Wege Richtung Celeia und Poetovio führt. Auch an anderen Stellen des Murtales gibt es Hinweise auf Siedlungsstellen und damit auf Straßen und Wege zu beiden Seiten des Flusses, so etwa durch altgefundene Münzen in St. Lorenzen bei Knittelfeld und Leoben-Göss28 und im mittleren Murtal durch einen Grabbau in Peggau29 (Abb. 1). Diese Situation könnte sich noch an mehreren Stellen ergeben und durchaus mit Siedlungsplätzen in der Art von „Reise- und Transportweseninfrastruktur“ zu erklären sein, wenn man z. B. mit der Einmündung von Zubringerwegen ins und aus dem wirtschaftlich genutzten Bergland (Hochtäler, Almen, Bergbau, Holzwirtschaft) auf der der Hauptstraße ge-genüberliegenden Talseite oder mit für Reit- und Packtiere begehbaren Abkürzungen30 über das Berg- und Hügelland rechnet.
Manfred Lehner
27 S. ehrenreich, KG Judenburg, Fundber. Österreich 38, 1999, 860; B. heberT, KG Judenburg, Fundber. Österreich 46, 2007, 706.28 schachinGer 2006, 220 f.; lehner 2008, 595.29 GuTjahr 2009.30 Zum sogenannten „Diebsweg“ zwischen Rothleiten und Göss über den Almwirt (1190 m) und eine Verbindung aus dem oberen Kainachtal (nördliche Weststeiermark) über den Gleinalmsattel (1586 m) nach St. Lorenzen bei Knittelfeld vgl. lehner 2008, 598.
Abb. 3: Leoben-Donawitz von Süden
343
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
Abb. 4: Gesamtplan der ergrabenen Mauerreste im vicus von Kalsdorf
344
Zweiter Aspekt: Eine römische limitatio im südlichen Grazer Feld?
Der kleinstadtartige vicus von Kalsdorf bei Graz liegt als lokaler Zentralort mit-ten im ebenen Grazer Feld etwa15 km südlich von Graz31. Der Gesamtplan der ergrabenen Mauerreste (Abb. 4) zeigt im Wesentlichen zwei verschiedene Gebäuderichtungen: Die Häu-serblöcke des Siedlungszentrums orientieren sich mehr oder weniger an der am Rand der Murterrasse von SSO Richtung NNW verlaufenden Straße, die innerhalb der Siedlung auch
Manfred Lehner
31 lohner-urban 2009, zur Topographie 1�−22.−22.22.
Abb. 5: Das Grazer Feld zwischen Kalsdorf und Wundschuh. Unmittelbar nördlich des vicus der „Wehrweg“, unmittelbar westlich die „Römerstraße“. Nördliche Fortsetzung der Karte siehe Abb. 6.
Kartengrundlage: ÖK 50 (AMap)
vicus
345
als Befund aufgedeckt worden ist32 und die grob der heutigen B 67 entspricht. Einige wenige Mauerzüge im randlichen Siedlungsbereich sind hingegen ungefähr parallel und rechtwinklig zu zwei SSW-NNO verlaufenden parallelen Linien orientiert (Abweichung von der Nordrich-tung ca. 9°), die sich in der Ebene südlich des vicus in Form von Straßen, Wegen, Waldgren-zen und Gemeindegrenzen erhalten haben und die dem heutigen, an der Fließrichtung der Mur orientierten Felderteilungssystem zuwiderlaufen (Abb. 5)33.
Die westliche dieser Linien verläuft zwischen Abtissendorf und Gradenfeld (Län-ge ca. 4,8 km), die östliche zwischen der „Römerstraße“, der die Grabungsfläche im vicus westlich begrenzt (vgl. Abb. 5), und Wundschuh (Länge ca. 4,9 km). Der mittlere Abstand zwischen diesen beiden Linien, gemessen am aktuellen Katasterplan, beträgt rund 1580 m. Einerseits sind geringe Breitenschwankungen durch leichte Kurvungen im heutigen Verlauf der Straßen und Feldwege bedingt, andererseits streben die Linien von Süden nach Norden um etwas weniger als 1° auseinander. Der breiteste zu messende Abstand beträgt ca. 1615, der schmalste 1540 m. Wo die heutige B 6�, die ja wie oben bemerkt im Vicusbereich den Verlauf einer römischen Straße entlang der Murterrassenkante nachvollzieht, bei Großsulz die Terrassenkante verlässt, um eine Flussbiegung abzuschneiden, schwenkt sie auf einer Länge von 3,7 km von SSO nach SSW um und bildet in einem mittleren Abstand von erstaun-licherweise ebenfalls 1580 m eine dritte östliche Parallele zu den oben beschriebenen Linien (Abb. 5). Im rechten Winkel zu diesen drei Parallelen lassen sich nur drei rudimentäre Struk-turen ausmachen:
1) Der „Wehrweg“, der vom Zentrum des römischen vicus nach Osten auf die untere Mur-terrasse und wohl in Richtung einer ehemaligen Furt (heute Kalsdorfer Au) führt. Entlang dieses Weges wurde römische Bebauung festgestellt34; an seiner gedachten Verlängerung nach Westen lag ein monumentaler Grabbau35.
2) Die Landesstraße zwischen Wundschuh und Werndorf, wo genau am Schnittpunkt mit der gedachten Verlängerung der mittleren der beschriebenen Linien ein einsames Wegkreuz steht.
3) Ein von Weitendorf nach Westen führender Forstweg am äußersten Südrand des Kaiser-waldes, an dem ein großes provinzialrömisches Hügelgräberfeld liegt.
Die Entfernung vom Wehrweg zum Wegkreuz bei Wundschuh beträgt ca. 5,8 km, die vom Wegkreuz zum Forstweg bei Weitendorf ca. 2,9 km, also die Hälfte. Dividiert man hoffnungsfroh durch das Grundmaß der römischen Flureinteilung, den actus mit einer Sei-tenlänge von 120 Fuß (35,5 m), ergibt sich eine Gesamtlänge von 163 plus 82, also 245 actus-Seiten. Das grundlegende Normal-Zenturiationsmodul der römischen Feldvermessung beträgt 20x20 actus (1 centuria, Seitenlänge ca. 710 Meter)36, sodass in dieser Strecke die Seitenlängen von 8 plus 4, also 12 Zenturien (8520 m) mit einem Rest von ca. 180 m enthal-ten sind. Dieser Rest fällt auf die limites bzw. auf die 11 decumani, die als Wege zwischen
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
32 lohner-urban 2009, 45 f.; 109−111.−111.111.33 Eine Entdeckung des feinen Auges von Thuri Lorenz auf einem Satellitenbild. Lorenz ist auch die Beobachtung zu verdanken, dass der Straßenraster der Planstadt Flavia Solva (aktueller georeferenzierter Übersichtsplan bei Karl 2008, 256) , die 25 km murabwärts im Leibnitzer Feld liegt, exakt derselben Ausrichtung folgt; eine Beobachtung mit weitreichenden Interpretationsmöglichkeiten, denen an anderer Stelle nachgegangen werden soll.34 Zuletzt ch. hinKer/i. mirsch, KG Kalsdorf, Fundber. Österreich 44, 2005, 554 f. (mit Plan).35 arTner u. a. 1991, 43 f.36 chouquer/Favory 2001, 170 f.; cranach 2001, 10; GuGl 2005, 64 f. − Die seit brosch 1949 für römisch gehaltenen „norisch-rätischen Quadrafluren“, wie sie noch PurKarThoFer 1997 für das unweit südlich von Kalsdorf gelegene Werndorf postuliert hat, werden mittlerweile frühmittelalterlich datiert, vgl. heiTmeier 2005.
346
den Zenturien angelegt waren, und für deren Breite verschiedene Maße zwischen 12 und 120 Fuß möglich sind37. Trotz aller Unwägbarkeiten ermutigt das Ergebnis, auch die mittleren Abstände von ca. 1580 m zwischen den südlich von Kalsdorf im Gelände erhaltenen Linien (die dann als cardines anzusprechen wären) diesbezüglich zu untersuchen: Dass sich ein quadratisches Modul von 20x20 actus messenden Zenturien (1420 m plus eine Straßenbreite) nicht ausgeht, ist augenfällig. Nun sind aber gerade aus dem nahen Oberitalien Beispiele von Zenturiationen bekannt, etwa bei Oderzo, bei Modena und bei Cremona38, die mit leicht rechteckigen Zenturien von 21 actus am decumanus und 20 actus am cardo arbeiten. Die Seitenlänge von zwei Zenturien mit 21 actus Breite entspricht 1491 m, sodass sich für den Abstand zwischen den Kalsdorfer „Limitationslinien“ ein Zuviel von etwa 90 m ergibt, das, will man die Berechnungen für die NS-Erstreckung auch auf die OW-Erstreckung umlegen, nicht befriedigend mit Aussparungen für limites bzw. nur einem zwischen den Zenturien liegenden cardo aufzufüllen ist. Wenigstens geben Gräberfunde einen Hinweis darauf, dass zumindest die östliche der beiden im Gelände erhaltenen Linien, nämlich jene zwischen dem Westrand des vicus und Wundschuh als römische Straße angelegt war: Neben Altfunden39 er-scheint in der Josefinischen Landesaufnahme von 1�8� ein Grabhügel als Geländemarke an dieser Strecke. Kann sich eine zu große Breite der Linienintervalle dadurch ergeben, dass hier eine öffentliche Straße verlief, für die im Sinne des iter populo debetur ein Streifen aus der Zenturiation ausgenommen wurde40? Ist der Streifen deshalb breiter als gewöhnlich, weil auf bestehende Gräberzeilen Rücksicht zu nehmen war41? Diese Straße trifft unmittel-bar nördlich des römischen Siedlungszentrums im spitzen Winkel auf jene, die entlang der Terrassenkante verläuft. Die römische Staatsstraße durch das Grazer Feld muraufwärts ist dagegen mehrfach nicht direkt im Bereich des vicus, sondern weiter westlich im Grazer Feld vermutet worden, worauf mehrere Indizien hinweisen: Neben der zahlreiche Hügelgräber indizierenden Ortsnamenhäufung Lebernfeld, Leberäcker, Lebern südlich und südwestlich von Feldkirchen42 und Oberflächenbeobachtungen43 spricht vor allem der Fundort der beiden bereits erwähnten Feldkirchner Meilensteine auf der Parzelle 141 der KG Lebern für eine solche Annahme44 (Abb. 6). Anlässlich des Fundes fand 1937 eine Nachgrabung des Lan-desmuseums Joanneum durch Walter Schmid statt, der dort eine geschotterte, 7 m breite Straßentrasse „in nordsüdlicher, leicht gegen Westen abfallender Richtung“45 feststellte. Dieser etwas lakonischen Beschreibung nach könnte der Straßenverlauf durchaus mit der Richtung der beiden beschriebenen „Limitationslinien“ übereinstimmen. Sollte die Straße, falls es sich dabei wirklich um die römische Hauptstraße handelt, gar die Vermessungs-grundlinie, also den cardo maximus darstellen? Nach Norden hin fände eine solche Linie eine plausible Verlängerung in der heutigen „Rudersdorfer Straße“, die zufällig (?) ebenfalls eine Parallele zu den ominösen Kalsdorfer limites bildet und die zufällig (?) genau auf den
Manfred Lehner
37 Auch die Frage, ob die zwischen den einzelnen Servituten liegenden Wege als Teil desselben abzutreten waren und daher in die actus-Rechnung einzubeziehen sind, oder ob sie als im öffentlichen Besitz verbleibend zusätzlich gerechnet werden müssen, ist als Unwägbarkeit in die Überlegungen einzubeziehen: cranach 2001, 12; chouquer/Favory 2001, 262 f. − Bei 11 decumani ergibt sich theoretisch ein Spielraum zwischen etwa 40 und 400 Metern, um den Überhang unterzubringen.38 misurare la Terra 1989, 194; schuberT 1996, 75; cranach 2001, 10.39 Zusammengefasst bei lohner-urban 2009, 25 f.40 Zum Wegerecht chouquer/Favory 2001, 261−263.−263.263.41 Wie bei Hyginus Gromaticus vermerkt, vgl. misurare la Terra 1989, 88 f.; chouquer/Favory 2001, 146. 191.42 Ausführliche Zusammenstellung der dortigen Altfunde bei mirsch 1999, 69−93.−93..43 G. Fuchs, zitiert bei lohner-urban 2009, 22 mit Anm. 27.44 S. ThomaniTsch, Fundber. Österreich 2, 1935−38, 285; W.−38, 285; W.38, 285; W. semeTKoWsKi, Fundber. Österreich 3, 1938/39, 198; zur Lokalisierung des Fundortes mirsch 1999, 94.45 W. schmid, Südost Tagespost von 8. 11. 1937, 5.
347
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
Abb. 6: Das Grazer Feld zwischen Feldkirchen und Kalsdorf. Am unteren Bildrand die nördlichen Teile der „Limitationslinien“, am oberen Bildrand unmittelbar westlich von Feldkirchen
die „Rudersdorfer Straße“. Fundort der Meilensteine auf der langgestreckten, sich in den Rollfeldbereich des Flughafens fortsetzenden Parzelle 141 der KG Lebern. Südliche Fortsetzung der
Karte siehe Abb. 5. Kartengrundlage: ÖK 50 (AMap).
vicus
Meilensteine
villa
348
markanten östlichsten Punkt des Schöcklplateaus zielt46? Der mittlere Abstand dieser Pa-rallele von ca. 900 m zur westlichen der beiden „Limitationslinien“ lässt sich allerdings in gängigen actus-Berechnungsmodellen nicht sinnvoll unterbringen.
Die Frage nach erhaltenen Spuren einer römischen limitatio im Umfeld des vicus von Kalsdorf muss also vorerst unentschieden bleiben. Wie so oft ergibt der Beantwortungs-versuch einer an sich einfachen Fragestellung keine eindeutige Lösung, sondern noch mehr offene Fragen, etwa: Muss man eine „offizielle“ Straßenstation nicht im Bereich des vicus, sondern westlich davon an der möglichen Hauptstraße suchen? Ist eine solche Station infra-strukturell vielleicht im Zusammenhang mit der feudalen villa von Thalerhof-Forst zu sehen47 (Abb. 6), die nur unweit nordöstlich des bei Schachenwald gelegenen Kreuzungspunktes dieser Straße mit der gedachten Verlängerung des Weges zur Murfurt („Wehrweg“) liegt? Ist die Limitation im Grazer Feld, falls es sich wirklich um eine römerzeitliche Struktur handelt, jünger als der vicus, dessen der Limitation zuwiderlaufende Hauptbebauungsrichtung groß-teils bereits in der flavischen Holzbauperiode festgelegt war48? Resultieren die Überbreiten der cardo-Abstände daher aus einer Rücksichtnahme auf zum Zeitpunkt der Vermessungstä-tigkeiten bereits bestehende Gräberfelder und -zeilen?
Vorerst beruhen diese Überlegungen nur auf dem Studium von Karten, Luftbil-dern und rezenten Katasterplänen; dennoch erscheinen die Koinzidenzen auffällig genug, um zukünftig eine GIS-gestützte Auswertung inklusive Georeferenzierung historischer Kataster-pläne49 sinnvoll erscheinen zu lassen50.
Dritter Aspekt: Die Verteilung frühmittelalterlicher curtes als Prospektionshinweis?
Es gibt nur acht sicher in der Steiermark zu lokalisierende römerzeitliche Toponyme:
Solva und die Stationen der „Norischen Hauptstraße“: Ad Pontem, Monate, Vis-cellis, Tartursanis, Surontio, Sabatinca und Stiriate. Wie bereits gesagt, ist nur Solva archäo-logisch lokalisiert. Im Gegensatz dazu steht die Vielzahl durch Funde und Befunde gesicher-ter römerzeitlicher Siedlungsstellen, die namenlos bleiben müssen.
Allein die Urkunde Ludwig des Deutschen, die die Schenkungen an das Erzbistum Salzburg aus dem Jahr 860 aufzählt bzw. dessen ältere Rechte bestätigt, nennt am Gebiet der heutigen Steiermark 14 karolingerzeitliche curtes, die meist aufgrund des Gleichklangs mit re-zenten Fluss- und Ortsnamen ungefähr lokalisierbar sind51: Ad Sabnizam, ad Nezilinpah, ad Ra-pam, ad Tudleipin, ad Sulpam, ad Crazulpam, ad Pelisam, ad Chumbenzam, ad Undrimam, ad Liestnicham, ad Pruccam, ad Morizam, ad Strazinolun und ad Luminicham (Abb. 7). Insgesamt sind jedoch mehr als 20 grob lokalisierbare Ortsnennungen des 9. Jhs. zu vermerken52, wodurch eine der römerzeitlichen mindestens gleichkommende spätkarolingerzeitliche Raumerfassung
Manfred Lehner
46 Der Schöckl ist mit 1445 m die höchste Erhebung des das Grazer Feld nördlich umkränzenden Berglandes. Im Gegensatz zum eigentlichen Gipfel ist der markante östlichste Punkt des Plateaus, der Schöcklkopf (1423 m) von jedem Punkt der Grazer Feldes aus frei sichtbar − er würde sich hervorragend als Fernpunkt für die Orientierung− er würde sich hervorragend als Fernpunkt für die Orientierung er würde sich hervorragend als Fernpunkt für die Orientierung einer Vermessungsgrundlinie eignen. Eine solche Vorgehensweise ist in den gromatischen Schriften, die stets von den Himmelsrichtungen ausgehen, allerdings nicht überliefert, vgl. chouquer/Favory 2001, 89 f.47 Zuletzt heymans/moraWeTz 2008; marKo 2009.48 lohner-urban 2009, 158.49 Wie für Carnuntum von GuGl 2005 vorgenommen.50 Zum archäologischen Nachweis römerzeitlicher Grenzgräbchen, die sich an einem Straßenverlauf orientieren und die sich zwanglos in actus-Einheiten fügen, im 14 km südsüdwestlich von Kalsdorf gelegenen Leitersdorf im Laßnitztal vgl. Fuchs 2008. 51 Posch 1961; jeiTler 1996.52 Vgl. die Karte bei Giesler 1997, 288.
349
zu konstatieren ist. Im Gegensatz zur Römerzeit sieht die Forschungssituation für die früh-mittelalterliche Siedlungsstruktur der Steiermark jedoch düster aus; zu keiner einzigen der genannten Stellen liegen archäologische Daten vor53.
Will man nun die Reihenfolge der Aufzählung der salzburgischen Güter von 860 als geografisch stimmige Bereisungsabfolge begreifen54 und stellt man in Rechnung, dass die karolingische Verwaltung sehr wahrscheinlich Zugriff auf antike, zumindest spätantike Itine-rarien hatte, ist folgendes festzuhalten:
Eine definitive „Trassenkontinuität“ der Römerstraßen ins Mittelalter ist beim derzeitigen Stand der Forschung archäologisch nicht letztgültig nachzuweisen. Eine Kontinui-tät der Bewegungslinien vor allem entlang der Alpentransversalen und entlang der Haupttä-ler mit nach Möglichkeit weitgehender Nutzung der Römerstraßen ist jedoch anzunehmen, weil
1) logische Gründe dafür sprechen und die Verkehrsführungen im bergigen Gebiet meist vom Geländerelief vorgegeben sind;
2) die archäologisch nachweisbare Besiedlungskontinuität ostalpiner Kleinregionen die konti-nuierliche Nutzung der Bewegungslinien zumindest entlang der Haupttäler bedingt und,
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
Abb. �: Im Jahre 860 genannte (Kreise) und im Nahebereich von römischen Siedlungsplätzen (Quadrate) nachzuweisende curtes in der heutigen Steiermark. Kartengrundlage: Microsoft Encarta,
Bearb. St. Karl und Verf.
53 Nicht viel anders ist die Situation in Kärnten, wo nur die curtis Corontana (Karnburg) ergraben ist: schleiF 1939; H. dolenz, KG Karnburg, Fundber. Österreich 45, 2006, 725; ch. baur/h. dolenz, KG Karnburg, Fundber. Österreich 46, 2007, 725; dolenz 2007.54 Von der Donau kommend, führt nach den ost- und weststeirischen Punkten der Weg nach Kärnten − auch dort sind die Orte in einigermaßen stimmiger Reihenfolge genannt −, um mit Ad Crazulpam/Graslupp von Süden her wieder die Steiermark zu betreten und murabwärts fortzufahren.
350
3) als stärkstes Argument, eine Namenskontinuität praktisch sämtlicher Hauptflüsse und et-licher Berge bereits aus vorrömischer Zeit besteht55, die auf einer kontinuierlichen schrift-lichen und/oder mündlichen Weitergabe von Gelände- und damit auch Wegbeschreibungen über Zeit-, Kultur- und Ethnogrenzen hinweg beruhen muss.
Daraus lässt sich die Fragestellung ableiten, ob sich das frühmittelalterliche Siedlungsmuster, namentlich die curtes des karolingerzeitlichen Villikationssystems, die auf-grund der bis heute erhaltenen Toponyme zuverlässiger lokalisierbar sind als die römischen Straßenstationen, als Werkzeug der Römerstraßenprospektion eignet.
In der Steiermark liegen zwar römerzeitliche und frühmittelalterliche Siedlungs-plätze in aller Regel nicht exakt am selben Platz, eine gewisse Nahebeziehung karolinger- und ottonenzeitlicher curtes mit römerzeitlichen Orten innerhalb derselben Siedlungskammer ist in einigen Fällen jedoch archäologisch nachgewiesen oder begründet zu vermuten: Die curtis Vdolenidvor am Ulrichsberg bei Deutschlandsberg liegt oberhalb des vicus von Hör-bing56, die römische Siedlungsstelle von Bruck an der Mur/St. Ruprecht korrespondiert mit Ad Pruccam/Bruck an der Mur, jene von Mürzhofen mit Ad Morizam/St. Lorenzen im Mürztal, der vicus von Gleisdorf mit Ad Rapam/St. Ruprecht an der Raab. Halbwegs zwischen den Straßenstationen Monate und Viscellae an der Norischen Hauptstraße ist Ad Pelisam/Pöls zu suchen. In Murau-St. Egidi und in Graz-Straßgang sind namenlose curtes im Nahebereich römischer Siedlungen mit einiger Sicherheit anzunehmen57 (Abb. 6). Die einzige frühmit-telalterliche civitas-Nennung der Steiermark (civitas Ziub) bezieht sich ausgerechnet auf das Leibnitzer Feld, wo auch das einzige steirische municipium Solva lag58. Es braucht nicht eigens betont zu werden, dass alle genannten Orte in von Römerstraßen durchzogenen Flusstälern liegen. Auch die übrigen bekannten curtes liegen nicht irgendwo am flachen Land, sondern stets leicht erhöht an für Zentralörtlichkeiten geeigneten, verkehrsgünstigen Stellen in Kleinräumen, die auch in der Römerzeit von Bedeutung waren. Darf man auch in deren unmittelbaren oder zumindest näheren Umfeld regelhaft mit römischen Siedlungen und/oder Straßenstationen rechnen?
Manfred Lehner
55 lochner 2008, 19−2�.−2�.27.56 lehner 2004.57 Zusammengefasst bei lehner 2009, 210 f.58 Ausführlich Giesler 199�, 328−339.−339.339.
351
Literaturverzeichnis
arTner u. a. 1991W. arTner/b. heberT/d. Kramer, Die vorläufigen Ausgrabungsergebnisse auf der Parz. 1166/1 in Kalsdorf. Arch. Österreichs 2/2, 1991, 41−44
bauer 1997 I. bauer, Römerzeitliche Höhensiedlungen in der Steiermark mit besonderer Berücksichtigung des archäologischen Fundmaterials. Fundber. Österreich 36, 1997, 71−192
brosch 1949 F. brosch, Romanische Quadrafluren in Ufernoricum, Jahrb. Oberösterr. Musver. Ges. Lan-deskde. 94, 1949, 125−177
brunner 1975 W. brunner, Geschichte von Pöls (Pöls 1975)
chouquer/Favory 2001 G. chouquer/F. Favory, L´arpentage romain. Histoire des textes, droit, techniques (Paris 2001)
cranach 2001 RGA XVIII, 2001, 5−19 s. v. Landvermessung (Ph. v. cranach)
dolenz 2007 H. dolenz, Neue Feldforschungen in der Karnburg − erste Ergebnisse in Kurzform. In: a. oGris/W. Wadl (Hrsg.), Marktgemeinde Maria Saal. Geschichte-Kultur-Gegenwart. Ein Gemeinde-buch für alle (Klagenfurt 2007) 85 f.
dorniG 2009 N. dorniG, Die Römerzeit im Bezirk Bruck an der Mur, Ungedr. Diplomarbeit (Graz 2009)
ehrenreich u. a. 1997 s. ehrenreich/b. heberT/h. heymans/u. schachinGer/h. WeidenhoFFer, Funde vom Kirchbichl bei Rattenberg in der Steiermark aus den Sammlungen Mayer und Stadlober in Fohnsdorf. Fund-ber. Österreich 36, 1997, 193−252
Fuchs 2006 G. Fuchs, Die römische Straße im Laßnitztal, Weststeiermark − ein Forschungsbericht. In: e. Walde/G. Grabherr (Hrsg.), Via Claudia Augusta und Römerstraßenforschung im östlichen Al-penraum. IKARUS 1 (Innsbruck 2006) 440−456
Giesler 1997 J. Giesler, Der Ostalpenraum vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Studien zu archäologischen und schriftlichen Zeugnissen 2: Historische Interpretation. Frühgesch. u. Provinzialröm. Arch. Mat. u. Forsch. 1 (Rahden 1997)
Grabherr 2001G. Grabherr, Michlhallberg. Die Ausgrabungen in der römischen Siedlung 1997−1999 und die Untersuchungen an der zugehörigen Straßentrasse. Schriftenr. Kammerhofmus. Bad Aussee 22 (Bad Aussee 2001)
Grabherr u. a. 2009 G. Grabherr/K. oberhoFer/v. sossau, Auf der Suche nach der norischen Hauptstraße im Bereich des Triebener Tauerns. Der Tauern 56, 2009
GuGl 2005 ch. GuGl, Limitatio Carnuntina. GIS-Analyse der römischen Zenturiation im Raum Carnuntum (Niederösterreich). Anz. Österr. Akad. Wiss. 140/1, 2005, 61−126
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
352
Manfred Lehner
GuTjahr 2009 ch. GuTjahr, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Peggau, Steiermark. Unter Einbezug der drei 1950 geborgenen Gräber aus Waldstein, MG Deutschfeistritz. Fundber. Österreich 48, 2009 (im Druck)
heberT 1998 B. heberT, Frohnleiten, Römerbrücke. In: Gerettet! Denkmale in Österreich. �5 Jahre Denk-malschutzgesetz (Wien 1998) Nr. 43
heberT/hinKer 2003 b. heberT/ch. hinKer, Ein Sigillatascherben aus St. Lorenzen bei Trieben. Überlegungen zur Römerzeit im Paltental. Da schau her 24/4, 2003, 20
heiTmeier 2005 i. heiTmeier, „Quadrafluren“ in Tirol − Relikte aus römischer Zeit? In: G. Grabherr u. a. (Hrsg.), Vis Imaginum. Festschrift für Elisabeth Walde zum 65. Geburtstag (Innsbruck 2005) 128−136
heymans 2004 h. heymans, Abschließender Bericht zur Notgrabung des Bundedenkmalamtes am südlichen Stadtrand von Flavia Solva, Steiermark. Fundber. Österreich 43, 2004, 507−522
heymans/moraWeTz 2008 h. heymans/r. moraWeTz, Die römerzeitliche Villa in Thalerhof. Ergebnisse der Bodenradarun-tersuchung im Jahr 2007. Bl. Heimatkde. 82, 2008, 3−19
jeiTler 1996 m. jeiTler, Das Privileg vom 20. November 860 an die Salzburger Kirche und seine Auswir-kungen. Ungedr. Diplomarbeit (Wien 1996)
Karl 2008 sT. Karl, Kommentar zum Übersichtsplan der archäologischen Grabungen in Flavia Solva, Schild von Steier 21, 2008, 253-256
Klemm 2000 s. Klemm, Neue Comercialstraße und Arzt=fuhr=weg. Untersuchungen von Altstraßen im Ge-meindegebiet von Vordernberg, Bez. Leoben, Steiermark, 199�−1998. Fundber. Österreich 39, 2000, 145−170
lehner 2004 m. lehner, Die frühe Burg auf dem Deutschlandsberger Ulrichsberg. Beitr. Mittelalterarch. Österreich 20, 2004, 99−148
lehner 2008 m. lehner, Die Römer in Leoben. In: ch. FraneK/u. hamPel/s. lamm/T. neuhauser/b. Porod/K. zöh-rer (Hrsg.), Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski, Veröff. Inst. Arch. Karl-Franzens-Univ. Graz 10 (Wien 2008) 591−604
lehner 2009 m. lehner, Binnennoricum − Karantanien zwischen Römerzeit und Hochmittelalter. Ein Bei-trag zur Frage von Ortskontinuität und Ortsdiskontinuität aus archäologischer Sicht. Ungedr. Habilitationsschr. (Graz 2009)
lochner 2008 F. lochner v. hüTTenbach, Steirische Ortsnamen. Zur Herkunft und Deutung von Siedlungs-, Berg-, Gewässer- und Flurbezeichnungen. Grazer vergl. Arbeiten 21 (Graz 2008)
lohner-urban 2009 u. lohner-urban, Untersuchungen im römerzeitlichen Vicus von Kalsdorf bei Graz. Veröff. Inst. Arch. Karl-Franzens-Univ. Graz 9 (Wien 2009)
353
Beiträge zur Römerstraßenforschung in der Steiermark
luGs 2005 W. luGs, Die Geographie des Ptolemäus für den norischen Raum. Röm. Österreich 28, 2005, 7−22
maier 1995 ch. maiermaier in: Th. lorenz/ch. maier/m. lehnermaier/m. lehner (Hrsg.), Der römische vicus von Gleisdorf. Bericht über die Ausgrabungen 1988-1990. Veröff. Inst. Klass. Arch. Karl-Franzens-Univ. Graz 2 (Wien 1995)
marKo 2009 P. marKo, Die römische Villa Thalerhof. In: Mit dem Flugzeug in die Römerzeit. Die Villa Tha-lerhof am Flughafen Graz. Ausstellungsbroschüre (Graz 2009) 4−6
mirsch 1999 i. mirsch, Die Geschichte der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz 1 (Feldkirchen 1999)
misurare la Terra 1989 r. bussi/v. vandelli (Hrsg.), Misurare la terra. Centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso veneto. Ausstellungskat. (Modena 1989)
modrijan 1957 W. modrijan, Vor- und frühgeschichtliche Funde aus dem Bezirk Leoben (2. Teil). Schild von Steier 7, 1957, 5−28
Posch 1961 F. Posch, Zur Lokalisierung des in der Urkunde von 860 genannten Salzburger Besitzes. Mitt. Ges. Salzburger Landeskde. 101, 1961, 243−260
PurKarThoFer 1997 h. PurKarThoFer, Römerzeitliche Quadraflur in Werndorf. In: H. luKas, Chronik der Gemeinde Werndorf (Werndorf 1997) 59−62
Redő 2003 F. Redő, Municipium Aelium Salla. In: M.In: M. ŠaŠel Kos/P. scherrer (Hrsg.), The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I. Situla 41 (Ljubljana 2003) 191−235
schachinGer 2006 u. schachinGer, Der antike Münzumlauf in der Steiermark. Veröff. Num. Komm. 43 (Wien 2006)
schleiF 1939 h. schleiF, SS-Ausgrabungen Karnburg. Carinthia 129, 1939, 261−271.schmid 1932 W. schmid, Die römische Poststation Noreia in Einöd. Jahresh. Österr. Arch. Inst. 27, 1932, Beibl. 193−222
schmid 1937 W. schmid, Bruck an der Mur in der Vorgeschichte, Bl. Heimatkde. 15, 193�, 39−42
schreTTle/Tsironi 2007 b. schreTTle/s. Tsironi, Die Ausgrabungen der Jahre 2005−200� in der Villa Rannersdorf. Kaiser-zeitliche und spätantike Funde und Befunde. Fundber. Österreich 46, 2007, 225−338
schuberT 1996 ch. schuberT, Land und Raum in der römischen Republik. Die Kunst des Teilens (Darmstadt 1996)
sedlmayer/TieFenGraber 2006 h. sedlmayer/G. TieFenGraber, Forschungen im südostnorischen Vicus am Saazkogel (Steiermark). Die Grabungen der Jahre 2002−2005. Jahresh. Österr. Arch. Inst. Sonderschr. 41 (Wien 2006)Arch. Inst. Sonderschr. 41 (Wien 2006)
354
Manfred Lehner
TalberT/baGnall 2000 r. j. a. TalberT/r. s. baGnall (Hrsg.), Barrington Atlas of the Greek and Roman World (Princ-reek and Roman World (Princ-eton u. a. 2000)
Tausend/Tausend 2005 K. Tausend/s. Tausend, Ein neuer Meilenstein aus Murau. Ein Vorbericht. In: F. beuTler/W. hame-Ter (Hrsg.), „Eine ganz normale Inschrift...“ [Festschrift Ekkehard Weber], Althist.-Epigraph. Stud. 5 (Wien 2005) 421−433
TieFenGraber 2007 G. TieFenGraber, Archäologische Funde vom Fuße des Falkenberges bei Strettweg. Ein Beitrag zur Besiedlungsgeschichte des Aichfeldes. Ber. Musver. Judenburg 40, 2007, 3−39
Windholz-Konrad 2003 m. Windholz-Konrad, Römerzeitliche und spätere Funde von einem Altweg am Fuße des Grim-mings, VB Liezen, Steiermark. Fundber. Österreich 42, 2003, 511−524.
WinKler 1999 G. WinKler, Die römischen Siedlungen und Städte im Ostalpen- und Donauraum. In: ch. rohr (Hrsg.), Vom Ursprung der Städte in Mitteleuropa. Jubiläumsschr. zur 1200. Wiederkehr der Erstnennung von Linz (Linz 1999) 29−42
WinKler 2000 G. WinKler, Die römischen Meilensteine von Noricum. Pro Austria Romana 50, 2000/2, 11−21
zeller 2003 b. zeller, Römerzeitliche Orts- und Flurnamen auf dem Gebiet des heutigen Österreich. In: v. Gassner/s. jileK/s. ladsTäTTer, Am Rande des Reiches. Die Römer in Österreich. Österreichische Geschichte 15 v.−378 n. Chr. (Wien 2003) 373−377
Abbildungsnachweis
Abb. 1: Kartengrundlage: ÖK 200 (AMap)Abb. 2 u. 3: Foto Verf.Abb. 4: nach Fundber. Österreich 44, 2005, 555 Abb. 242Abb. 5 u. 6: Kartengrundlage: ÖK 50 (AMap)Abb. �: Kartengrundlage: Microsoft Encarta, Bearb. St. Karl und Verf.