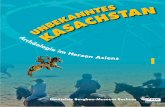Optionen für Indien und Pakistan in Kaschmir: Anatomie eines Konfliktes.
Reinhold Hintereggers Seilanlagen - Entwicklungen eines Pioniers
Transcript of Reinhold Hintereggers Seilanlagen - Entwicklungen eines Pioniers
��������,�����-�'�!�
Reinhold HintereggersSeilanlagen
- Entwicklungeneines Pioniers
September 2000
AutorenMarkus Brunner
Stefano JorioJürg Stückelberger
KoordinationLeo Caminada
Hans R. Heinimann
��������
�� ��������������������������
������������������������
�����������
������ �����
������� �!�"# �# �#"
��$� �!�"# �!!�%"
������ ��������&����'��('
)))� �� *++���'����'��('+ ��
��������
�� �������������������������
�����������������
Reinhold HintereggersSeilanlagen
- Entwicklungeneines Pioniers
September 2000
AutorenMarkus Brunner
Stefano JorioJürg Stückelberger
KoordinationLeo Caminada
Hans R. Heinimann
������� �!�"# �# �#"
I
�
�������
�����������
������ �����
��$� �!�"# �!!�%"
������ ��������&����'��('
)))� �� *++���'����'��('+ ��
Impressum
Herausgeber Professur Forstliches IngenieurwesenDepartement ForstwissenschaftenETH-Zentrum HG G 23CH-8092 Zürich
Projektkoordination Leo CaminadaCaminada & Partners AGChli Ebnet 1CH-6403 Küssnacht [email protected]
Hans R. HeinimannProfessur Forstliches IngenieurwesenETH-Zentrum HG G 23CH-8092 Zü[email protected]
Autoren Markus [email protected]
Stefano Jorio
Jürg Stü[email protected]
Bezugsquelle Professur Forstliches Ingenieurwesenonline http://www.fowi.ethz.ch/piw
© 2000 Professur Forstliches Ingenieurwesen, ETH Zürich, Schweiz
II
Inhalt
Einleitung 1
Beginn des Seilbahnbaus (1946-1948) 2
Seilkräne und Seilwinden (1948 – 1964) 2
Entstehung der Firma „Reinhold Hinteregger“ 2
Entwicklung des Seilbahnbaus in Kärnten 2
Seilbahntypen 3Serienseilbahn 3Umlaufseilbahn 3Pendelseilbahn 4Seilkran 4
Hinteregger-Ausführungen 5Seilkräne 5Seilwinden 12Seiltragwerk 18Stützen 20Weitere besondere Ausführungen 22
URUS-Programm (ab 1964) 24
Neue Tendenzen in der Holzbringung mit Mobilseilkränen 24
Die ersten URUS Prototypen 25
Vom URUS I bis zum URUS Gigant 27URUS I 27URUS II 29URUS III 29
III
URUS IV 30URUS V 31Mini-URUS 31URUS-Geräte im Ausland 33Hibamat-Kräne, Zusammenarbeit mit BACO 35URUS- und Seilkranentwicklung (1969-1992) 36
TAURUS- und neues Laufwagenprogramm (ab 1992) 40
TAURUS-Seilgeräte 40
Laufwagen-Programm 41
Der „Hinteregger Universal-Laufwagen-Automat“ 44
IV
Vorwort
Der Transport von Holz aus schwierigem Gelände ist eine teure und technisch aufwen-dige Operation, die vor allem in Gebirgsgegenden der Welt von grosser Bedeutung ist.Gemessen an den Zahlen im Bau- und Forstmaschinensektor allgemein ist der Markt fürSeilkräne und Seilanlagen klein. Dies mag ein Grund sein, warum die Entwicklung der-artiger Geräte nicht von Grossfirmen, sondern von Einzelpersonen geprägt wurde. Rein-hold Hinteregger ist eine herausragende Persönlichkeit aus Villach, Kärnten, die ihr Le-ben der letzten fünfzig Jahre voll in die Entwicklung forstlicher Seilkräne und –anlagengestellt hat. In akademischen Kreisen ist es üblich, anlässlich des 60. Geburtstages einerPerson Rückschau zu halten. Reinhold Hinteregger ist es vergönnt, am 28. September2000 seinen 80. Geburtstag zu feiern. Dass dieser vorliegende Bericht zu seinem 80.Geburtstag erscheint, hat seinen Grund darin, dass der Jubilar nach wie vor rüstig undvoller Tatendrang und somit noch keineswegs im Ruhestand ist. Wir hoffen, mit diesemBericht das Wirken von Reinhold Hinteregger einem breiteren Kreise bekannt zumachen, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, besonders Gesundheit undZufriedenheit.
Der vorliegende Bericht ist auf Anregung von Leo Caminada, Küssnacht am Rigi, ent-standen. Stefano Jorio hat darauf in umfangreichen Gesprächen mit Reinhold Hintereg-ger das Material gesichtet und dokumentiert. Markus Brunner und Jürg Stückelbergerbesorgten die Bereinigung des Manuskriptes. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herz-lich gedankt. Danken möchten wir aber vor allem Herrn Reinhold Hinteregger, der dasVorhaben mit Interesse und Engagement unterstützt hat.
Zürich, September 2000
Hans Rudolf Heinimann
V
�������������
Reinhold Hinteregger wurde am 28. September 1920 in Edling bei Feldkirchen, Kärn-ten, geboren. Die Volksschule besuchte er in St. Ulrich, und die Hauptschule in Feld-kirchen schloss er mit Auszeichnung ab. Reinhold Hintereggers Wunsch war es,Maschinenbau zu studieren. Die wirtschaftliche Situation in den Zwischenkriegsjahrenwar schwierig, weshalb an eine Finanzierung eines Studiums nicht zu denken war.1937 trat Reinhold Hinteregger als Maschinenschlosserlehrling in die damalige Villa-cher Maschinenfabrik Egger ein, wo er 1940 seine Gesellenprüfung mit Auszeichnungabschloss. Schon während seiner Lehrzeit zeigte sich seine besondere Begabung fürMaschinenbau und Arbeitsvorbereitung. Nach nur zweijähriger Lehrzeit wurde ihmder gesamte Werkzeug- und Vorrichtungsbau im damals zu den vereinigten KärntnerMaschinenfabriken gehörenden Betrieb übertragen, und er war dafür verantwortlich,die erforderlichen Werkzeuge und Vorrichtungen zu bauen. Noch im ersten Gesellen-jahr wurde Hinteregger als Verantwortlicher für die Arbeitsvorbereitung eingesetzt,womit sämtliche Meister aller Abteilungen ihm unterstellt wurden. Diese verantwor-tungsvolle Aufgabe war auch der Grund, dass er nicht in die Wehrmacht eingezogenwurde. Im Jahre 1944 folgte die Meisterprüfung, ebenfalls mit ausgezeichneten Resul-taten. Nach Kriegsende übernahm Hinteregger interimistisch das Arbeitsbüro der Gies-serei den Kärntner Maschinenfabriken. Obwohl er als Werksdirektor vorgesehen warund eigentlich bei den Kärntner Maschinenfabriken bleiben wollte, schied er am 15.September 1946 auf eigenen Wunsch aus dem Betrieb aus. Damit begann eine rund 50-jährige Periode, während der sich Reinhold Hinteregger mit Hingabe der Entwicklungund Herstellung von Seilanlagen widmete.
Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, die wichtigsten Entwicklungen, die aus Hin-tereggers Schaffen hervorgegangen sind, in ihrer zeitlichen Sequenz zu charakterisie-ren. Dabei geht es darum, die wesentlichen Funktionsprinzipien undEntwicklungsschritte darzustellen, während es nicht möglich ist, die vielen Einzelent-wicklungen in Detail zu beleuchten. Durch den Sessellift auf die Gerlitzen kam Hin-teregger mit Seilanlagen für das Bau- und Forstwesen in Kontakt. Ab 1948 entwickelteer eigene Seilkräne und Seilwinden für den Material- und Holztransport. Die grösstePionierleistung Hintereggers ist die Entwicklung des URUS-Mobilseilkranprogramms,das er ab 1964 auf den Markt brachte und das in vielen Ländern rund um die WeltBekanntheit erlangte. Die wirtschaftlichen Probleme, ausgelöst durch eine weltweiteKrise der Forstwirtschaft im Jahre 1984, verschonten auch die Firma Hintereggernicht, worauf die URUS-Produktion nach Südafrika ausgelagert wurde. 1991 trat Rein-hold Hinteregger aus der südafrikanischen Firma aus, um daraufhin in seinem altenBetrieb in Villach seinen nach wie vor sprudelnden Ideenreichtum in die Tat umzuset-zen. Obwohl er damals bereits 71 Jahre alt war, konstruierte er einen neuen Seilkranau-tomaten und verbesserte den URUS-Mobilseilkran zum TAURUS, der durch eineneuseeländische Firma gebaut wurde. Die nachfolgenden Ausführungen versuchen, diewesentlichen Entwicklungen Hintereggers in chronologischer Reihenfolge darzustel-len.
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 1
������������������������������������
Reinhold Hintereggers erste Seilanlage war ein Sessellift auf die „Gerlitzen“. De Pre-tis, ein Skilehrer, der auf der Gerlitzen den englischen Besatzungstruppen Skiunterrichterteilte, kam 1945 mit dem Wunsch zu Hinteregger, einen Schlittenlift zu konstruieren,der auch im Sommer betrieben werden könne. Ein Jahr später trat de Pretis mit demAnliegen an Hinteregger heran, einen Sessellift zu bauen. Hinteregger entschloss sich,aus der Kärntner Maschinenfabrik auszutreten und sich selbständig zu machen. De Pre-tis hatte ihn überzeugt, dass es besser sei, „ein kleiner Herr als ein grosser Diener zusein“. De Pretis definierte einen Sessellift als „ein in die Länge gezogenes Ringel-spiel“, und Hinteregger begann mit der Konstruktion. Bestandteile ausgedienter engli-scher Panzer und Zugmaschinen wie gummigefütterte Laufrollen, Kugellager undSchneckengetriebe dienten als Material für die Stations- und Stützenbauten. Kurz vorWeihnachten 1946 wurde die erste Probefahrt durchgeführt. Am 450 m langen Seil, dassich mit einer Geschwindigkeit von 1.4 m/s vorwärts bewegte, hing alle 20 m ein Ses-sel. In einer Stunde wurden so bis zu 220 Personen befördert. In der „Kärntner Illu-strierten Zeitung“ (Nr. 11/1947) wurde der Sessellift als eine „freudige Überraschung“bezeichnet. Im Auftrag der Kammer für Land- und Forstwirtschaft Klagenfurt kamHerr Schuppe als Seilbahnmonteur auf die Gerlitzen, um das Seil zu spleissen. Er gabReinhold Hinteregger den Anstoss zur Fabrikation von sogenannten Seilkrananlagen.
�������������������� �����������!������
����������������"��#��$%���&���'������(
Die Zusammenarbeit mit de Pretis ging nach dem Bau des ersten Sessellifts 1946 wei-ter, und zwar im Seilbahnbau für die Forst- und Agrarwirtschaft. Die Firma arbeitetebald mit grossem Erfolg. Im Sommer 1948 wurde das erste Patent angemeldet, undweitere folgten. Die Zusammenarbeit mit de Pretis war aber nicht ohne Konflikte. Des-halb gründete Hinteregger eine neue Firma unter dem Namen seiner Frau: „K. Hin-teregger. Maschinenhandel – Agentur – Kommission. Repräsentant der Firma R.Hinteregger und A. de Pretis“. Den Ausschlag für diese Neugründung gab ein grosserAuftrag für Brasilien, den Hinteregger über die Firma Pohlig in Köln erhielt. Am 1.Mai 1960 trennte sich Hinteregger endgültig von de Pretis. Die Firma hiess von nun an„Reinhold Hinteregger Maschinen- und Seilbahnbau“.
�� ���� �)������������������������*����
Gemäss Pestal (1961) wurde die Entwicklung des Seilbahnbaus in Kärnten durch ver-schiedene Gegebenheiten beeinflusst. Einerseits gab es eine grosse Zahl von Militär-seilbahnen, die nach dem ersten Weltkrieg am Nordhang der Karnischen Alpenzurückgeblieben waren. Diese Seilbahnen waren sehr einfach zu benützen; darum wur-den sie sofort für den Holz- und Materialtransport eingesetzt. Das gleiche galt für Mili-tärmaterial aus dem zweiten Weltkrieg (wie z.B. beim Sessellift „Gerlitzen“).Andererseits verschlechterte sich nach dem zweiten Weltkrieg die Lage auf dem Holz-markt zusehends, und die Zahl der Waldarbeiter nahm stetig ab. Dies wiederumbeschleunigte die technische Entwicklung im Bereich des Holztransports.
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 2
Schliesslich führte die rasche Zunahme von Seilbahnanlagen zu Missbräuchen beiInstallation und Betrieb. Die Anlagen mussten durch die Behörden kontrolliert werden,was sich wiederum positiv auf die Entwicklung von neuen und besseren Seilbahnenauswirkte.
������������+,�
������������������
Die erste Serienseilbahn wurde von den Herren Hinteregger, Schuppe und Gosch ent-wickelt (Abbildung 1). Das Seilbahnsystem wurde nach dem Ingenieur M. Goschbenannt als „System Gosch“. Es besteht aus einem Tragseil und einem umlaufendenZugseil. Die Holzstämme werden an Gehängen befestigt, welche durch Rollen auf demTragseil bewegt werden können. Die Gehänge selber sind fix mit dem Zugseil verbun-den. Die Nutzlast wird in kurzen Intervallen talwärts befördert. Nach dem Entladevor-gang werden die Gehänge wieder zur Bergstation hochgezogen.
���� ��-#���.�������
Bei der Umlaufseilbahn (Abbildung 2) werden zwei Tragseile gespannt, wobei daseine die Funktion des Lasttragseils und das andere jene des Leertragseils hat. Am Last-tragseil wird die Nutzlast transportiert, während am Leertragseil die Gehänge wiederhochgezogen werden. Der Durchmesser des Leertragseils ist geringer als jener desLasttragseils. Die Anlage besitzt zudem ein umlaufendes Zugseil. Die Leistung diesesSystems ist grundsätzlich hoch; sie wird aber durch den Zeitaufwand für Be- und Ent-
/�����0������������1��+�#�(2&�)�31�4�������#���#���.��#�5������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 3
laden merklich geschmälert. Ein weiterer einschränkender Faktor sind die oft fehlen-den Lagerplätze.
�������6����������
Pendelseilbahnen (Abbildung 3) können einspurig oder zweispurig sein und ein offe-nes oder geschlossenes Zugseil haben. Das Hauptmerkmal ist, dass sich je Fahrtrich-tung nur ein Laufwagen auf dem Tragseil bewegt. Wenn die Seillinie Längen in derGrössenordnung von 1000 m überschreitet, wird dieses System zusehends unwirt-schaftlich, da die Wartezeiten für die Lademannschaft zu lang werden. Dieser Seil-bahntyp ist der wesentlichste Vorläufer des Seilkrans und ist heute noch verbreitet fürverschiedenste Transportzwecke im Einsatz.
��������������
Beim Einsatz eines Seilkrans (Abbildung 4) kann das geschlagene Holz mit Hilfe desSeilkrans ohne Transportbruch vorgerückt und anschliessend direkt gerückt werden.Nach dem Fällen werden die Stämme zur Seillinie seitlich zugezogen (vorgerückt),angehoben und entlang der Seillinie abtransportiert (gerückt). Durch die Zusammen-fassung von Vorrücken und Rücken in einen ununterbrochenen Arbeitsgang kann einAbhänge- respektive Anhängevorgang eingespart werden. Eigentliche ausgebauteBerg- und Talstationen wie bei Seilbahnanlagen sind nicht nötig. Entsprechend könnenPersonal- und Installationskosten eingespart werden. Das System, das eine Sonderaus-führung und Weiterentwicklung der Pendelseilbahn darstellt, benötigt einen Laufwa-
/���� 0�-#���.��������#��7 ��4��������� 1����������#��#���.����5������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 4
gen. Zur Leistungssteigerung des Systems haben die sukzessive Erhöhung derFahrgeschwindigkeit und der zulässigen Nutzlast der Laufwagen wesentlich beigetra-gen.
Pestal (1961) unterteilt die Seilkräne aufgrund ihrer Seillinienlänge in Lang- und Kurz-streckenseilkräne, wobei er die Abgrenzung zwischen den beiden Kategorien bei 400 –600 m festlegt. Anlagen im Uebergangsbereich von etwa 400 – 600 m bezeichnet er alsMittelstreckenseilkrane. Eine neuere Längeneinteilung der Seilkransysteme unter-scheidet Kurzstrecken- (> 300m), Mittelstrecken- (300 – 800 m) und Langstreckenseil-kräne (800 – 2000 m) (Heinimann 1986, gemäss Betriebszählung).
�����'�������/��.8������
��������������
./�����0���1!�23�
Das Modell System „Gosch“ (Abbildung 5) war der erste Laufwagen, den Hintereggerfür die Forstwirtschaft entwickelt hat. Für dieses Modell bekam er das erste Patent imJanuar 1951. Angemeldet wurde es aber schon im August 1948. Der Laufwagen wurdeim Oktober 1948 am Kumitzberg bei Villach mit grossem Erfolg vorgeführt. Dasgesamte Seilsystem besteht aus einem Tragseil, einem umlaufenden Zugseil, welchesmit dem Seilkran verbunden ist, sowie einem Hubseil zum Heben und Absenken derLast. Der Laufwagen kann die Last an jedem gewünschten Punkt der Seiltrasse anhe-
/�����0�����,�����6�����������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 5
ben oder absenken. Dazu muss er mit einem händisch zu betätigenden Stellapparat, derentlang des Tragseiles verschoben werden kann, fixiert werden.
Innerhalb eines am Hubseil befestigten Kupplungskegels ist ein verschiebbarer, beiBedarf feststellbarer Steuerkegel angeordnet, der mit Steuerflächen zusammenarbeitet,welche im Maul einer am Wagen hängenden Zangenkupplung angeordnet sind. DerKupplungskegel ist mit einem Belastungsgewicht zu einem auf einer Axialebenegeteilten Körper vereinigt und mit dem Belastungsgewicht am Hubseil festgeklemmt.Auf diese Weise wird ein Absenken des Hubseils auch bei unbelastetem Haken ermög-licht. Der Steuerkegel trägt einen Schaft und einen Fuss, mit denen er in einem entspre-chenden Hohlraum des Kupplungskegels geführt wird. Das Hubseil wird durch einezentrale Bohrung durch den Steuerkegel inklusive Schaft und Fuss mit Spiel hindurch-geführt.
Basierend auf diesem Laufwagen wurde in kurzer Zeit ein Langholzlaufwagen alsZusatzgerät entwickelt. Das einachsige Laufwerk ist mit einer Stange am Laufwagenbefestigt. An diesem Langholzlaufwagen wird eine zweite Hubrolle montiert, die eineFlaschenzugfunktion erlaubt.
4��5���������6�����������6�������������7�������7���6�1 �23
Bei diesem System handelt es sich um einen Seilkran mit einem elektrisch angetriebe-nen Hubwerk (Abbildung 6). Der Motor ist auf dem Laufwagen montiert. Die Strom-versorgung erfolgt über den Seilkranwagen und einen fahrbaren Stellwagen mitStromkabel.
/�����0���������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 6
Das wesentliche Merkmal ist der Elektromotor, der das Hubwerk antreibt. Er befindetsich auf dem Laufwagen und wird über Kontaktfinger an Stell- und Laufwagen sowieStromzuleitungskabel bei den Lade- und Entladestellen an eine Stromquelle ange-schlossen. Am Laufwagen ist ein Endschalter angebaut, mit dem der Stromkreis ein-und ausgeschaltet werden kann. Er wird beim Einkuppeln automatisch betätigt (mitoder ohne Last), so dass der Motor ausgeschaltet wird.
Dieser Erfindung war kein grosser Erfolg beschieden, da die damals verfügbaren Bat-terien handlicher Grösse für eine länger anhaltende Stromabgabe zu schwach waren.Ein Generator damaliger Bauart wäre als Stromquelle unhandlich und unwirtschaftlichgewesen.
8����������4��5������.���6����1./����������������3��/ �8�!�1#�23
Der Laufwagen (Abbildung 7) wird durch ein umlaufendes Zugseil bewegt und durcheinen Stellwagen gesteuert. Auf dem Laufwagen befindet sich eine Seiltrommel, wel-che das Hubseil aufnimmt. Der Antrieb dieser Hubseiltrommel erfolgt über eine Seil-scheibe, welche durch das Zugseil in Umdrehung gebracht werden kann. Mit dieserErfindung kann die Anlage auch von der Talseite her angetrieben und gesteuert wer-den. Die Seilscheibe ist ausserhalb des Laufwagens angebracht und mit einer Sperreversehen. Im Innern des Laufwagens ist ein federbelasteter Sperrbolzen vorhanden,welcher mit einem Steuerhebel verbunden ist und mit den Sperrnocken zusammen-wirkt. Der Sperrnocken ragt über den Laufwagen hinaus in Richtung des Stellwagens.Der Seiltrommelantrieb befindet sich im Innern des Laufwagens. Diese Konstruktions-
/����90�:��. ����.8����������$�+�#�2&�)�(�
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 7
art ermöglicht in einem Arbeitsgang das Zurückfahren des leeren Laufwagens an denAnhängeort und das folgende Absenken des Lastgeschirrs, ohne dass angehalten oderumgeschaltet werden muss.
Der Holztransport ist im Bergauf- und Bergabbetrieb möglich. In einer Spezialausfüh-rung eignet sich diese Erfindung auch für den Langholztransport.
.���6��������������(����/ ���
Der Laufwagen dieses Seilkrans wird durch ein offenes Zugseil angetrieben. DieAntriebseinheit befindet sich bei der Bergstation. Die Mindestneigung der Trassebeträgt aufgrund des Gravitationbsbetriebs 15 %. Der Laufwagen besteht aus zweifachwerkartig verstrebten Laufwerken und benötigt zwei halbautomatisch funktionie-rende Stellwagen. Der Steuerungsmechanismus für die Sperrgabel wird von den Lauf-werken getragen. Die Sperrgabel wird beim Anfahren des Laufwagens an denStellwagen automatisch geöffnet, wobei eine Sicherungsklinke gegen Doppelschaltungschützt. Der Stellapparat besitzt einen Verbindungshaken, der unter Federdruck stehtund in den anfahrenden Laufwagen einhakt. Zum Ausklinken ist am rückwärtigenEnde des Stellapparates eine Handleine angebracht. Dieser Seilkran eignet sich beson-ders für Transporte von liegenden länglichen Lasten. Er hat sich auf Baustellen gutbewährt.
/�����0�-��;������������#�������)���������#�'�� ���� �6��
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 8
./�����9������(��/ �9�!
Der Seilkran vom Typ J 1 wird durch ein offenes Zugseil bewegt. Die Antriebseinheitbefindet sich bei der Bergstation; die Trasseneigung muss minimal 10 % betragen. DerSeilkran arbeitet mit einem Stellwagen und kann eine Last nur anheben. Der Laufwa-gen selber kann für Bergab- und Bergauftransport eingesetzt werden. Zum Abhängender Last muss der Laufwagen in Bodennähe gefahren werden können. Folglich ist einAbhängen ohne vorgängiges Nachschleifen der Last über den Boden wie auch dasAbsenken der Last bei dieser Bauart nicht möglich. Das Festhalten des Stellwagenserfolgt mit Hilfsseilen.
./������������������/ ��� �1"�23
Analog dem Typ J 1 wird auch der Laufwagen des Seilkrans (auch “Kranseilbahn”genannt) Typ D 2 (Abbildung 8) durch ein offenes Zugseil angetrieben und benötigteine minimale Trasseneigung von 10 %. Der Seilkran arbeitet mit zwei Stellwagen undkann im Gegensatz zum Typ J 1 eine Last anheben und absenken, ohne sie am Bodennachschleifen zu müssen. Die zwei Stellwagen weisen Klemmapparate auf. Das Fixie-ren der Stellwagen am Tragseil erfolgt durch Schliessen einer Klemme durch eine her-abhängende Kette. Laufwagen wie auch Stellwagen wurden von Hinteregger erfundenund sind patentiert worden.
Mit der Erfindung dieses Seilkrans wurde es möglich, Lasten ohne Umstellung oderUmschaltung sowohl berg- als auch talseits und somit entlang der ganzen Trasse anzu-heben und abzusenken. Die Lastausklinkvorrichtung ist so eingestellt, dass das leere
/����<0���������4+,�/��#���#���.��#�5������������� ����
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 9
Gehänge beim Anfahren an einem Stellwagen sofort ausklinkt und in einem Zug abge-senkt werden kann, wogegen eine Absenkung des belasteten Gehänges erst nach demSpannen des Zugseils erfolgt.
Der Laufwagen besitzt eine Kupplungsglocke, welche die Sperrriegel zum Festhalteneines am Kranseil befestigten Kupplungskegels aufnimmt. Über einen Ring betätigtder Kegel zwei Gestänge. Diese werden zu Sperrklappen geführt, welche sich an bei-den Enden des Laufwagens befinden. Die Sperrklappen sperren die Laufwagenhakenund sind als Widerlager für die Stellwagenhaken ausgebildet. Die zwei Gestänge sindgekoppelt und führen synchron die gleichen Bewegungen aus. Dadurch sind Klink-und Glockenmechanismus miteinander gekoppelt. Beim Anfahren des Laufwagens amStellwagen sichert ein Gestänge den Laufwagen vor dem Ausklinken, währenddem dasandere Gestänge den Kupplungskegel in der Glocke löst. Der Kegel lässt sich nunabsenken, wonach am Lasthaken eine Last angehängt werden kann.
Im Jahr 1962 wurde ein neuer Stellwagen (Abbildung 9) entwickelt. Dieser ist entlangdes Tragseils verschieb- und mittels einer festen und einer beweglichen Klemmbackefeststellbar. Hinteregger schrieb über seine Erfindung:
„Das wesentliche Merkmal des Stellwagens besteht darin, dass die Klemmvorrichtungeine im spitzen Winkel zur Vertikalen liegende Klemmebene aufweist, wobei an derbeweglichen Klemmbacke ein symmetrisch zueinander liegendes Kniehebelpaarangreift. Zur Bewegung des Kniehebelpaares ist eine Schraubenspindel mit gegenläufi-gen Gewinden vorgesehen. Auf dieser Schraubenspindel sind ein Kettenrad, eine Seil-trommel oder ähnliches für eine zum Boden geführte Betätigungskette oder einBetätigungsseil angeordnet. Nach aussen ist dieses Kettenrad durch einen Ketten- oder
/�����0�:��. ����4+,�=� 1��&������(*����������3�
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 10
Seilausspringschutz verkleidet, welcher für jedes Ketten- oder Seiltrum eine zweck-mässig mit Rundmaterial verstärkte Einlauf- bzw. Auslaufführung aufweist.“
Die Laufrollen liegen tiefer als die obere Klemmbacke, damit der Stellwagen auf demTragseil besser bewegt werden kann. Die schräge Lage der Klemmebene zur Vertikalenerlaubt es zudem, das Zugseil durch den Stellwagen hindurchzuführen. Weiters kannder Stellwagen über jeden Seilschuh oder jede Seilkupplung gefahren werden. Wegender schrägen Lage ist eine geringe Öffnung der Klemmbacken nötig, um die obenbeschriebene Bewegung zu ermöglichen.
./�����������������8�
Im Jahr 1964 wurde von Hinteregger ein Seilkran entwickelt, dessen Laufwagen(Abbildung 10) durch ein umlaufendes Zugseil bewegt wird und sich durch zwei Stell-wagen fixieren lässt. Dadurch wird das Anheben und Absenken der Last an An- undAbhängeort berg- und talseits möglich, und das Nachschleifen der Last auf dem Bodenfür den Abhängevorgang entfällt.
Die beiden Steuerhebel, welche an den Enden des Laufwagens angeordnet sind, sindmiteinander gekoppelt. Dies geschieht über je ein zweiteiliges Zuggestänge mit Win-kelhebel auf beiden Seiten des Laufwagens. Die zwei Stangen sind mit Kupplungsha-ken versehen, die miteinander im Eingriff stehen. Die Kupplungshaken sind über einenMitnehmer mit einem Hebel verbunden. Dieser wird über einen Auslösehebel betätigt,der durch den Lasthaken bewegt wird. Durch die Anordnung von zwei miteinandergekuppelten Steuerhebeln, die durch die 2 berg- und talseitigen Stellwagen betätigt
/�����0���� ���1��������)�����4��������������87���&��������,,�������.�����������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 11
werden, kann der die Rotation der Seilscheibe kontrollierende Sperrbolzen an jedemgewünschten Arbeitsort automatisch den Lasthaken freigeben. Der Hubhebel muss mitdem Klinkenmechanismus in Verbindung stehen, damit sich der Laufwagen nach demEinzug des Lasthakens vom Stellwagen lösen kann. Der Hubhebel ist durch einen Len-ker mit einer Welle verbunden, auf der ein Winkelhebel aufgezogen ist. Dieser Winkel-hebel beeinflusst über das Schiebergestänge die Verbindung von Lauf- und Stellwagen.Zentrales Element ist ein Steuernocken, der auf den Lenker einwirkt und durch den derAuslösehebel betätigt wird.
Die Stellwagen sind von der Konzeption her ähnlich den unter “System Janeschitz”beschriebenen und besitzen eine Kniehebel-Schraubklemme. Sie können Stützen undTragseilkupplungen überfahren.
���� ����� ����
Im folgenden Abschnitt werden Winden beschrieben, die von Hinteregger projektiertund in seiner Fabrik hergestellt wurden.
.���������7�������������.���6����./�����:0��;
Die erste für den Verkauf konstruierte Winde besteht nahezu vollständig aus Stahl. Sieist auf Kufen montiert und kann in tragbare Baugruppen zerlegt werden. Die Windebesitzt eine Seilscheibe für ein umlaufendes Zugseil. Seilscheibe und Seiltrommel sindmit drei voneinander unabhängigen Bandbremsen versehen. Die Leistungsdaten sind inder folgenden Tabelle (Tabelle 1) zusammengefasst:
/������0�:��. ����.8����������4+,�/ 1��&���(*����������3�
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 12
4��5������.���7���8�����7��������
In den fünfziger Jahren wurde eine Universal-Seilbahn-Antriebsstation hergestellt(Tabelle 2). Sie besitzt eine Seilscheibe, die eine universelle Verwendung ermöglicht.Die Antriebsstation ist von der Trasse unabhängig aufstellbar. Wie beim ersten Modell(Seilantriebsstation für Seilkran System “Gosch”) ist die Anlage in tragbare Einzel-gruppen zerlegbar. Bei dieser Ausführung kann die Seilscheibe mit dem Umlaufseilvon der Seiltrommel getrennt und abgebremst werden, während mit der Seiltrommelweitergearbeitet werden kann. Zwei Kegelräder dienen zum Umschalten des Antriebsauf Links- oder Rechtslauf.
4�����0�4)����)��=����������������������&�1��+�#�(2&�)�3�
4)����)���>��#�� =�#���&� ?�
Masse der Antriebsstation (inkl. Motor) kg 1200
Motorleistung kW 18
Hubgeschwindigkeit m/s 0.5
Fahrgeschwindigkeit m/s 0.5 - 6.0
Fahrgeschwindigkeit im Leerlauf m/s < 12
Systemproduktivität bei ca. 1000m Fahrstrecke Lastfahrten/h ca 4
4���� 0�4)����)��=������-��;�������������/��������&��
4)����)���>��#�� =�#���&� ?�
Masse der Antriebsstation (inkl. Motor) kg 600
Motorleistung kW 9 - 11
Innendurchmesser der Trommel mm 200
Aussendurchmesser der Trommel mm 750
Breite der Trommel mm 220
Fahrgeschwindigkeit mit Seiltrommel m/s 1 - 3
Fahrgeschwindigkeit mit Seilscheibe m/s < 3.5
Fahrgeschwindigkeit im Leerlauf m/s < 10
Fassungsvermögen der Seiltrommel (Seildurch-messer 8 - 10 mm)
m 800 - 1100
Fassungsvermögen der Seilscheibe Umschlingungen 2.5
Zugkraft der Seiltrommel kN 10
Zugkraft der Seilscheibe kN 2.5 - 3
Nutzlast kN 10
Systemproduktivität bei ca. 1000 m Fahrstrecke Lastfahrten/h ca 10
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 13
Von diesem Windentyp wurde auch eine Spezialausführung hergestellt. Diese unter-scheidet sich von der Normalausführung dadurch, dass sie auf einem Schlitten montiertist sowie eine breitere Seiltrommel und eine höhere Zugkraft aufweist. Die technischenDaten sind in der folgenden Tabelle (Tabelle 3) zusammengestellt:
.������<������.���������7����7��1%�23
Im Jahr 1956 wurde eine Winde entwickelt, welche ein umlaufendes Zugseil antreibenkann. Die Seilantriebsscheibe (Abbildung 11) ist als Parabolscheibe konstruiert. DieWinde weist folgende wesentliche Merkmale auf:
• Die Parabolscheibe ist auf der Seiltrommel zwischen den Trommelflanschen lösbar befestigt.
• Auf der Seiltrommel ist eine Bremsscheibe zwischen Trommelflansch und Seilant-riebsscheibe lösbar befestigt.
• Auf der Seiltrommel ist zwischen dem einen Trommelflansch und der Seilantriebs-scheibe eine Montageseilscheibe lösbar befestigt, die eine breite Lauffläche auf-weist und deren Durchmesser nur wenig grösser als derjenige der Trommel ist.
• Die Seilantriebsscheibe und die Bremsscheibe sind am einen Trommelflansch befes-tigt, währenddem die Montageseilscheibe am anderen Flansch angebaut ist.
• Im Rahmen ist eine verschliessbare Öffnung zur Durchführung des geschlossenen Zugseils vorgesehen.
Die drei Scheiben sind zweiteilig und können einfach montiert oder demontiert wer-den. Die Seilwinde kann zur Montage und zum Betrieb von verschiedenen Seil-Trans-portanlagen im Bergauf-, Bergab- oder Horizontalbetrieb verwendet werden.
4�����0�4)����)��=�������&������.8���������-��;�������������/��������&��
4)����)���>��#�� =�#���&� ?�
Motorleistung kW 9 - 18
Innendurchmesser der Trommel mm 400
Aussendurchmesser der Trommel mm 750
Breite der Trommel mm 5800
Durchmesser der Parabolscheibe mm 700 / 750
Breite der Parabolscheibe mm 80
Fahrgeschwindigkeit mit Seiltrommel m/s 0.8 - 5
Fassungsvermögen der Seiltrommel (Seildurch-messer 8 - 10 mm)
m 1800 - 2800
Fassungsvermögen der Seilscheibe (Seildurch-messer 8 - 10.5 mm)
Umschlingungen 3 - 4
Zugkraft der Seiltrommel (voll) kN 15
Zugkraft der Seilscheibe kN 15
Nutzlast kN 10
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 14
Insbesondere sind verschiedene Betriebsarten ohne wesentliche Einschränkungenbezüglich Strekkenlänge, Montagevorgang oder Leistungsfähigkeit möglich. Bei Ent-fernung der Scheiben steht die ganze Trommel für die Seilaufnahme zur Verfügung.Die Montageseilscheibe ermöglicht praktisch die gleich grossen Zugkräfte wie dieleere Seiltrommel. Beim Zug mit der Montagescheibe, die das Seil nicht aufwickelt,bleiben die maximalen Zugkräfte wegen des gleichbleibenden Radius konstant. Dem-gegenüber nehmen sie bei der Seiltrommel bei zunehmender Seilfüllung und folglichgrösserem erforderlichen Drehmoment ab.
4��5������������������<���1�/ �����=����3
Im Jahr 1957 erschien eine neue Serie von Seilwinden (Tabelle 4). Ihr Hauptmerkmalist, dass die Antriebsstation örtlich unabhängig von der Trassenführung installiert wer-den kann. Die Winde kann somit bei der Berg- oder der Talstation platziert werden,womit sich Holz auch von der Talstation her rücken lässt. Alle Winden sind neben derHauptwinde mit einer Rückholwinde ausgerüstet. Die drei lieferbaren Typen unter-scheiden sich voneinander durch die Zugkraft und die Art der Seilfassung.
Eine weitere Erfindung von Hinteregger war die Seilführung bei Seilwinden mit einerauf einer sogenannten Verteilerwelle laufenden Seilrolle (Abbildung 12). Die Seilfüh-rung war an sich keine Neuheit, aber die bisher üblichen Typen konnten das Heraus-springen des Seils aus der Verteilerwelle nicht verhindern. Ein herausgesprungenesSeil kann zum Durchschleifen bis sogar hin zur Durchtrennung der Verteilerwelle füh-ren.
/������0�?����#������������)�����6����&��)�����
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 15
Bei der Hinteregger-Seilführung wird das Ausspringen durch Ausspringschutzwändeauf der Verteilerrolle verhindert. Diese Wände sind vorzugsweise auf der Rollennabegelagert und gegen Mitdrehen, bei gleichzeitiger axialer Verschiebungsmöglichkeit,gesichert. Die Ausspringschutzwände haben Aussparungen oder Bohrungen, durch dieeine zur Verteilerwelle parallele Führungsstange führt. Die Stange gestattet das Ver-schieben der Ausspringschutzwände auf der Verteilerwelle bei gleichzeitiger Unterbin-dung des Mitdrehens mit der rotierenden Rolle. Eine ständige Beaufsichtigung derWinde wird dadurch überflüssig.
4�����0�4)����)��=������-��;�����"&����� ������4+,��@���@@@1���9<��
�����)��.���������&##� =�#���&�?����+,
"�?�@ "�?�@@ "�?�@@@
Innendurchmesser Hauptwinde mm 350 250 200
Innendurchmesser Rückholwinde mm 250 200 150
Aussendurchmesser Hauptwinde mm 650 490 400
Aussendurchmesser Rückholwinde mm 490 400 300
Breite der Windentrommeln mm 645 645 650
Zugkraft der Hauptwinde kN 25 – 50 15 – 30 7.5 – 25
Motorleistung kW 4.5 - 18 4.5 - 18 4.5 - 18
Fahrgeschwindigeit m/s 0.2 - 6.0 0.2 - 6.0 0.2 - 6.0
/����� 0����.8������#��������.����A���� ������.��������&���
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 16
>�������������<���#!�+ ������<�?@�+?@��
Anfangs der sechziger Jahre erschienen zwei neue Typen von Montageseilwinden(Tabelle 5). Sie sind beide primär für Seilbahnmontagen gedacht, können aber auch für
den Transport von kleinen Holzmengen (310/2000) oder Materialtransporte auf Bau-stellen eingesetzt werden. Der kleinere Typ ist einfach zu transportieren, da er in trag-bare Teile zerlegt werden kann.
������������<���%��+ ���A�%��+#���A�"@�+#���
Diese Winden (Tabelle 6) stellen Weiterentwicklungen der Montageseilwinden (310/
2000 bzw 750/7500) dar, besitzen jedoch keine nennenswerten Neuerungen. DieUnterschiede bestehen einzig in den unterschiedlichen Seilfassungsvermögen und inder Motorleistung. Zudem haben sie Zusatzausrüstungen wie Rückholwinden, Seilver-teilerrollen, Lenkeinrichtungen, Fahrwerke, Wendegetriebe, Windflügelbremsen, Zähl-werke usw.
������������<����.)� @�A�#��A�%��A�@��A�"��A�?��
Diese Universal-Seilbahnantriebe (Tabelle 7) erschienen gleichzeitig mit dem Seilkran„System Hinteregger A2“. Sie sind verbesserte Modelle auf Basis der Forstseilwindedes Typs 400/2000, haben aber viele Zusatzausrüstungen wie Wendegetriebe, Stahlpa-rabolscheiben, Windflügelbremsen, Seilführungseinrichtungen und Fahrbildanzeiger.
4����90�4)����)��=������>&������ ��������B ��������<9�B<9���
��� ����4+, =�#���&� ���B ��� <9�B<9��
Seilfassungsvermögen m 375 300 – 500
bei Durchmesser mm 8.5 24
Zugkraft kN 20 75
Motorleistung kW 6 – 11 29 – 37
Getriebe Gänge 4 5
4�����0�4)����)��=������"&����� ��������B ���1����B����1��9�B�����
4)����)���>��#�� =�#���&�?����+,
400/2000 480/3000 650/3000
Fassungsvermögen m 500 – 750 1000 – 1300 2000 – 2500
bei Seildurchmesser mm 8.5 9.5 10.5
Zugkraft kN 20 30 50
Motorleistung kW 9 – 18 9 – 18 18 – 37
Getriebe Gänge 4 4 5
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 17
8�<����)��<��
Hinteregger hatte auch Seilwinden für Spezialarbeiten entwickelt und produziert, wel-che aber nie einen Schwerpunkt seiner Forschungs- und Entwicklungstätigkeit bilde-ten. Es handelt sich dabei einerseits um Schrapperwinden für den Schrapperbetrieb,wie er beispielsweise bei der Ausbaggerung von Flussbetten oder beim Abbau vonLockermaterial wie Kies oder Sand Verwendung findet. Beim Schrapperbetrieb wirdein Schleppkübel mit Hilfe eines Zug- und eines Rückholseils über den abzubauendenHorizont bewegt, was mit der Arbeitsweise eines Dragline- oder Schürfkübelbaggersverglichen werden kann. Andererseits wurden Schlepperwinden als Anbaugeräte fürlandwirtschaftliche Traktoren hergestellt. Beide Modelle haben Zugkräfte bis 60 kN,und sie wurden in verschiedenen Ausführungen gebaut.
������������� ��
. �����������+�. �������
Durch Spannen der Zugseile mit einer Spannstation wird verhindert, dass das Zugseilvon der Seilscheibe rutscht. Die Spannstation (Abbildung 14) oder der Spannturm(Abbildung 13) werden nur beim Einsatz eines geschlossenen Zugseils verwendet. Erbesteht normalerweise aus einer Stütze, an der eine Last als Spanngewicht aufgehängtwird. Dieses Spanngewicht ist mit einem Seil, das über Umlenkrollen geführt wird, miteiner Rolle am anderen Ende des Seiles verbunden. Durch diese Rolle läuft das Zug-seil, das somit nach oben gezogen wird. Die Spannung des Zugseils ist abhängig vonder Masse des Spanngewichts. Mit diesem System können die während des Betriebsauftretenden Dehnungen des Zugseils oder etwaige Stösse ausgeglichen werden. EineSpannstation hat die gleiche Funktion. Sie besitzt keine Umlenkrollen, sondern eineZugseilspannrolle, welche auf einem Schlitten montiert und mit einem Spanngewichtverbunden ist.
4����<0�4)����)��=������"&����� �����"�?�
>��#�� =�#���&�?����+,
9� ��� ��� 9�� ��� <��
Fassungsvemögen m 140 400 500 1700 2200 1700
bei Seildurchmesser mm 8 8.5 9.5 9.5 10 12
Geschwindigkeit m/s 0.3 – 0.6 0.3 – 2.0 0.3 – 2.5 0.4 – 6.3 0.4 – 7.1 0.7 – 8.0
Zugkraft kN 15 20 25 30 40 50
Motorleistung kW 4.5 11 11 29 29 29
Getriebe Gänge 2 2 2 4 4 4
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 18
��������87�
B�����������������7�������(���1��23
Mit der Entwicklung der Zweibeinstütze (Abbildung 15) versuchte Hinteregger, die
Nachteile der herkömmlichen Rohrstützen (Platzbedarf für die Montage, geringe Trag-seilhöhe von nur 5 m) zu umgehen. Der Schwerpunkt der Entwicklung lag nicht bei derStütze selber, sondern im Verfahren zur Aufstellung der zweibeinigen Stützen. DiesesVerfahren sieht vor, dass die lotrechten Stützmasten abwechselnd angehoben und amunteren Ende des jeweils angehobenen Stützmastes ein oder mehrere Schüsse angesetztwerden. Das ist dank dem Querhaupt möglich, das die zwei Stützbeine verbindet undseitlich überragt. Die Stützen sind mit dem Querhaupt durch Gelenke verbunden, umwelche das Querhaupt bewegt werden kann. Die Enden des Querhauptes, die seitlichüber die Stützbeine herausragen, dienen als Hebelarme.
Dank dieser Erfindung können Seilbahnstützen auch in schwierigem Gelände (Felsge-lände, Gratlagen) montiert werden. Dadurch wird der Bau von Seillinien mit optimale-ren Trassen möglich.
C� ���7��������������D���������
Zur Überwindung starker Gefällsbrüche sind spezielle Kuppenüberführungen erforder-lich. Solche Stützen (Abbildung 16) sind kompliziert und aufwendig im Bau, weshalbsie fast ausschliesslich für stationäre Seilbahnen im landwirtschaftlichen Bereich oder
/�����90�A�.�����7�#�/�.����;&��7 ����������������87��
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 20
in der Industrie errichtet worden sind. In der Landwirtschaft werden keine Seilkräneverwendet, sondern meist Seilbahnen als Punkt-zu-Punkt - Verbindungen. Dabei wer-den in der Regel Transportwagen oder Gondeln eingesetzt, in denen das Transportgutliegend befördert wird. Durch den ruhigen Lauf der Wagen über die Hängeschienenkönnen das Herabfallen von Ladegut oder übermässige Materialbeanspruchung verhin-dert werden.
E�����
Je nach Hersteller und Verwendungszweck gibt es grosse Unterschiede zwischen denverschiedenen Laufrollentypen. Die meisten Rollen werden als Zugseilrollen einge-setzt. Auch von Hinteregger wurden verschiedene Typen von Rollen gebaut, welchenachfolgend kurz beschrieben werden. Etliche weitere Rollentypen werden in Pestal(1961) ab S. 178 ff. beschrieben.
'&)�.8�������&��� sollen verhindern, dass das Zugseil am Boden schleift, was vorallem bei konvexen Gefällsbrüchen zum Problem werden kann. Diese Rollen werdenhäufig an den Hängeschuhen des Tragseils befestigt. Die Rollenhalterungen könnendabei angeschweisst oder angeschraubt werden.
5��������&��� haben den gleichen Zweck, müssen aber nicht notwendigerweise aneinem Hängeschuh befestigt werden. Sie können auf dem Boden liegen, wobei sie aufBlöcken (meistens aus Holz) befestigt sind oder an Fangbügeln aufgehängt werden.
5 ��������&��� sind für einspurige Seilbahnen mit geschlossenem Zugseil gedacht,um das rücklaufende Zugseil zwangszuführen. Dadurch wird verhindert, dass sich bei
/������0�*�,,�8��.8������#��'����)�����
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 21
langen Spannfeldern das Zugseil mit dem ziehenden Strang verwickelt oder es sichdurch Schwingungen oder Seitenwind ungewollt am Laufwerk einhängt. Bei Höchst-spannung läuft das Zugseil auf der Unterseite der oberen Rolle.
Ebenfalls zu den Rollen gehören die �����&�� (Klobenräder), die beispielsweise derFührung und Aufhängung des Leerzugseilstrangs dienen. Früher wurden diese meistmit einem Haken, vergleichbar einer Seilflasche, versehen. Ab den fünfziger Jahrenwurden dann zur Erhöhung der Sicherheit zunehmend Drehschäkel mit Bolzen undeiner kleinen Rolle darauf verwendet.
Schliesslich sind noch die /�� �)��&��� zu erwähnen. Pestal (1961) beschreibt siefolgendermassen: „Bei tiefer Zugseilablage lässt sich die Distanzrolle einsparen, wennunter dem Tragseilschuh der Ablaufstütze eine quer verschiebbare Rolle montiert wird,die das Zugseil wie eine Hochführungsrolle im gewünschten Abstand vom Tragseilhält und beim Überfahren des Gehänges seitlich weggedrückt wird.“
����9��?�����&����/��.8������
.���7���������6�
Unter Seilbahnlaufwerken versteht man die Gehänge, welche vor allem in den Serien-und Umlaufseilbahnen gebräuchlich sind. Es handelt sich um Laufwerke mit einer,zwei oder vier Rollen aus Stahl, die mit Kugellagern mit Dauerschmierung wartungs-arm auf Achsen gelagert sind. Die Tragfähigkeit dieser Laufwerke beträgt meist zwi-schen 5 und 15 kN.
Die Vorrichtungen, welche von Hinteregger entwickelt wurden, betreffen hauptsäch-lich die (Zugseil-)Klemmvorrichtungen. Die Zugseilklemme als Rückführungsklemmedes Leergehänges bewährte sich nicht. Zur Einsparung eines Leertragseils respektivezur Zeiteinsparung wurde in der Folge versucht, die Leergehänge am Leerzugseilstrangzurückzubefördern. Die nötige Zugseilspannung konnte aber dabei nicht erreicht wer-den. Das Zugseil hängt schon bei normalen Bedingungen in der Regel tiefer als dasTragseil. Bei grösseren Spannweiten und ohne eigene Stützen oder Hochführvorrich-tungen schleift das Zugseil dem Boden entlang und die Gehänge verfangen sich inÄsten, Wurzeln und Steinen.
Kurbelklemmen sind eine besondere Ausführung der Handschraubenklemmen. BeimÖffnen und Schliessen der Klemme wird auf die Klemmmutter eine Kurbel aufge-steckt. So können die Gehänge leichter und schneller fixiert und gelöst werden. BeiHebelklemmen ist der Mechanismus noch einfacher. Für das Lösen oder Festklemmender Gehänge ist nur ein Hebel zu betätigen. Damit ist es möglich, die Gehänge automa-tisch, weitgehend ruckfrei und bei laufendem Zugseil zu lösen oder zu klemmen.
������������������
Das Tragseil muss geschmiert werden, um es vor Nässe und Rost zu schützen und umdessen Abnutzung zu reduzieren. Der Tragseilschmierwagen von Hinteregger bestehtaus zwei Teilen: einem Laufwerk und einem Ölbehälter mit eingebauter Pumpe. DerSchmierwagen trägt mit Lösungsmittel verdünnte Schmierfette auf, wobei die
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 22
Ölpumpe durch die Laufrollen angetrieben wird. Der Ölbehälter kann abgeschraubtund das Laufwerk für andere Zwecke verwendet werden.
.��7��F�����<���G����6��
Dieses System (Abbildung 17) wurde und wird vor allem bei Serien- und Umlaufbah-nen beim Einsatz von Gehängen verwendet. Die Ladungen werden über Ketten an
selbstöffnenden Lasthaken befestigt. Eine Feder im Haltebügel dient der selbsttätigenÖffnung des Lasthakens bei Entlastung. Sobald das Ladegut am Boden schleift und dieKetten nicht mehr unter Spannung stehen, öffnet sich der Lasthaken von selbst.
/�����<0�����C..�����:�������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 23
�����-%-��6�&���##����������
�����D��4���7��������'&�7���������#��>&�����������
Die ersten Entwicklungsschritte mobiler Seilkrananlagen heutiger Konzeption fandenan der Westküste von Nordamerika nach dem zweiten Weltkrieg statt. Dort wurdenjedoch bereits um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts sogenannte „tower skidder“von teils enormer Grösse mit Dampfmaschinenantrieb eingesetzt. Diese Geräte warenin der Regel auf Waldbahnwagen aufgebaut; dies nicht zuletzt aufgrund ihrer hohenBetriebsgewichte sowie fehlender Strassenanlagen. Diese Geräte, die nach heutigerNomenklatur als „cable yarder“ bezeichnet würden, arbeiteten zumeist nach demHebeschleifverfahren (“high lead”) ohne Zwischenstützen im Kahlschlagbetrieb. Wiebereits erwähnt, wurden an der amerikanischen Westküste in den fünfziger und sechzi-ger Jahren des letzten Jahrhunderts etliche Typen von Mobilseilkrananlagen modernerBauart auf Raupen- und Pneuchassis eingeführt. Parallel dazu begannen anfangs dersechziger Jahre schliesslich entsprechende Versuche auch in Europa, wobei hier auf-grund der geringeren Baumdimensionen, der Ernte aus Durchforstungsbeständensowie der oft schmalen und wenig tragfähigen Strassen deutlich kleinere Modelle zurAusführung gelangten. In Österreich wurden gleichzeitig zwei bedeutende Mobilseil-kranmodelle entwickelt. Es handelte sich um den „Gösser Seilkran“ und den „URUSMobilseilkran“ von Hinteregger. Der Gösser Seilkran wurde in Frohnleiten im Mayr-Melnhof-Forstbetrieb unter der Leitung von Ingenieur Vyplel konstruiert; die URUS –Geräte werden im Folgenden näher beschrieben.
Das System Mobilseilkran besteht aus drei Grund-Komponenten, welche zusammeneine mobile Einheit bilden (Heinimann, 1986):
• Mast (Kipp-, Gelenk- oder Teleskopmast).
• Windenaggregate.
• Trägerfahrzeug (Anhänger, Lastwagen).
Aufgrund ihrer Tragkraft und Leistung werden die Mobilseilkräne (Tabelle 8) in dreiKategorien eingeteilt (nach Trzesniowski in Heinimann, 1986, verändert):
Der grosse Vorteil des Mobilseilkrans liegt, wie überhaupt bei Seilkran- oder Seilbahn-anlagen, in der weitgehenden Bodenunabhängigkeit des Rückevorgangs. Ab einerHangneigung von etwa 30 % stossen Schlepper und Traktoren mit luftbereiften Rad-fahrwerken, je nach Bodentyp und -zustand, an die Grenzen ihrer Geländemobilität.Fahrzeuge mit Raupenfahrwerken können noch bis zu Hangneigungen in der Grössen-ordnung von 50 % eingesetzt werden, wobei jedoch mit zunehmender Hangneigungdie Bodenschäden immer grösser werden. Ein weiterer Vorteil des Mobilseilkrans liegtdarin, dass Geländeform und Oberflächenrauhigkeit den Einsatz zumindest technischkaum begrenzen. Gräben, Rippen, vernässte Stellen oder Felsblöcke können grundsätz-lich und oft relativ leicht überwunden werden. Der entscheidende Impuls für die Ent-wicklung dieses Transportsystems war der kosten- und erlösbedingteRationalisierungsdruck bei der Holzernte, wobei hier einerseits steigende Lohnkostenund andererseits sinkende Rohholzpreise massgebend beteiligt waren und immer nochsind. Durch die Mechanisierung des Holztransports im unwegsamen Gelände konntenentscheidende Kosteneinsparungen in der Holzernte erzielt werden (Schantl, 1971):
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 24
• Geringerer Zeitaufwand in der Holzbringung, da aufwendiges und kostspieliges Rücken im Bodenseilzugverfahren durch Kurzstreckenseilbringung ersetzt wird.
• Bringung in Rinde in nicht befahrbarem Gelände.
• Bestandesschonende Transportmethoden; insbesondere durch Verzicht auf Erdrie-sen.
• Vermeidung von Qualitätseinbussen am stehenden Bestand und am geernteten Rundholz.
• Vom Wetter weitgehend unabhängige Verfahren.
• Hohe Arbeitsproduktivität der Verfahren.
�� ��=������-%-��6�&&+,�
Der erste Prototyp wurde im Jahre 1964 gebaut. Dies war ein Gösser - Seilkran nachMayr – Melnhof - Plänen, der mit Hinteregger-Seilwinde und Laufwagen ausgerüstetworden ist und im Auftrag eines Schlagunternehmers abgeliefert wurde (Trzesniowski1997). Ein Jahr später wurde bereits der zweite Prototyp fertiggestellt, obwohl Hin-teregger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Es handelt sich dabei umein Kippmastgerät auf einem von Hinteregger selbst konstruierten Trägerfahrzeug mitAllradantrieb und Warchalowski-Dieselmotor (Trzesniowski 1997). Die Maschinewurde in den Waldungen der Ossiacher Forstschule erprobt. Hinteregger bemerktedazu: „Direktor Diplomingenieur Trzesniowski war zufrieden und gab dem ersten pro-duktionsreifen Kippmastseilkran von Österreich den Namen URUS-66.“ Das einpräg-same Kürzel URUS stammt von Trzesniowski und bedeutet „4niversal - Eücke - 4nd -.eilgerät“; die Zahl „66“ bezieht sich auf das Einführungsjahr 1966.
4�����0�4)����)��>��#���;&��>&�����������
Merkmal Dimension Mobilseilkran-Grössenklasse
klein mittel gross
Masthöhe m 7 - 8 ca. 10 11 - 16
Maximale Tragkraft kN ca. 10 ca. 20 25 - 40
Anzahl Winden Anzahl 2 (-3) 3 - 5 4 - 6
Max. Tragseilspannkraft kN 45 - 80 80 - 100 95 - 140
Max. Tragseillänge m < 400 < 600 > 600
Tragseildurchmesser mm 14 - 18 20 - 22 22 - 24
Zugseildurchmesser mm 8 - 11 11 - 12 11 - 12
Motorleistung�17���8�����7�<�����������>����3
kW 40 – 60 75 – 110 150 – 240
Motorleistung ( 7���8�����7�<���>�����<�����D�������(�����3
kW 130 220 330
Masse der Anlage kg < ca. 10000 < ca. 18000 < ca. 35000
Trägerfahrzeuga 1, 2, 3 3, 4 3, 4
a. 1 ���6���, 2 8�D����, 3 �8��GC), 4 #���<���%�8��GC)
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 25
1967 erfolgte die erste Montage eines URUS (Abbildung 18) (Tabelle 9) auf ein Fahr-zeug vom Typ Unimog (n.b.: der Markenname „Unimog“ ist die Abkürzung für „4���versal - >�tor - 0erät“). Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version desModells URUS-66. Bekannt geworden ist er als „Kurzstreckenseilkrananlage mitKippmast Typ URUS, aufgebaut auf Mercedes-Benz Unimog U 80, Typ 416“.
/������0�-%-����.�>�)�����7�-��#&��-��1�4+,�����
4�����0�4)����)��=������-%-��-��������<��
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 8.5
Maximale Tragkraft kN 15
Anzahl Winden Anzahl 4
Tragseilkapazität m 400
Tragseildurchmesser mm 18
Zugseildurchmesser mm 10
Motorleistung, an Winden gemessen kW 37
Masse der Anlage kg 6600 kg
Trägerfahrzeug Unimog U 80 Typ 416
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 26
Gemäss der Tabelle von Heinimann (1986) gehört der URUS U 80 zur kleinsten Klassevon Mobilseilkränen. Nach Tabelle 4.3 entspricht der U 80 einem URUS der Grösse I(-II).
Der URUS U 80 hat keinen hydraulischen Antrieb. Die Kraftübertragung erfolgtmechanisch über einen Kettenantrieb von der Zapfwelle des Unimog aus. Die Motor-leistung des Unimog beträgt 59 kW, wobei durch die Zapfwelle lediglich 37 kW aufdas Windenaggregat übertragen werden können. Über den Zahnkranz der Hauptwinde(Zugseilwinde) werden eine Aufsatzwinde, eine Tragseilwinde und eine Hilfsseilwindeangetrieben.
Kennziffern der Leistungen des URUS U 80 sind kaum vorhanden. Bei einem prakti-schen Versuch in Kärnten wurde mit einem Team von fünf Leuten eine Leistung von10.2 fm (Festmeter = m3) Holz pro Maschinenarbeitsstunde erzielt (mittlere Brin-gungsdistanz 150 m, Rundholzdurchmesser > 24 cm, Rundholzlänge 4 m). In der tech-nischen Beschreibung des URUS U 80 wurde bezüglich Leistung folgendesfestgehalten: „Die durchschnittliche Leistung bei 4 m langem Holz und einem Min-destdurchmesser von ungefähr 20 cm und bei Einsatz einer geschulten Mannschaftkann bei Seillängen bis ca. 200 m ohne seitlichen Zuzug mit ca. 7 fm je Arbeitsstundedes Gerätes angenommen werden. Die Aufstellungs- und Abbauzeit gegenüber Kurz-streckenseilkränen mit Schlittenwinde wird auf ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel ver-ringert.“
�����A&#�-%-��@�����7�#�-%-��2����
Die URUS-Modellpalette, wie sie im Jahre 1988 produziert wurde lässt sich aufgrundder Arbeitsdistanz und der Tragkraft charakterisieren (Tabelle 10). Alle weiteren tech-nischen Daten werden durch diese beiden Grössen bestimmt. Im Laufe der Entwick-lung kamen neue Trägerfahrzeuge zum Einsatz. Wurden die ersten URUS-Krananlagen noch auf Unimog-Trägerfahrzeuge aufgebaut, so mussten mit zunehmen-der Grösse der Anlagen leistungsfähigere und grössere Trägerfahrzeuge verwendetwerden, da das Unimog-Trägerfahrzeug die geforderte Leistung nicht mehr erbringenkonnte.
�������-%-��@
Die Typenreihe URUS I (Tabelle 11) umfasst Geräte mit einer Arbeitsdistanz zwischen300 – 450 m und einer Tragkraft von 8 – 15 kN. Als Trägerfahrzeuge wurden die Uni-mog-Typen 406 oder 403 verwendet. Nachfolgend sind einige technische Kenngrössenaufgelistet, welche die Reihe URUS I charakterisieren. Der ursprüngliche URUS U 80gehört nicht zu dieser Gruppe, da er aufgrund seiner Arbeitsdistanz (400 m) und Trag-kraft (15 kN) eher der Klasse URUS II zuzuordnen ist.
Verschiedene Autoren untersuchten die Produktivitäten von URUS I - Anlagen(Tabelle 12). Das mittlere Stückvolumen der gerückten Sortimentsstücke ist die wich-tigste Einflussgrösse der Systemleistung. Weitere Faktoren sind nach Pestal (1974):
• Mittlere Transportentfernung (Fahrdistanz Laufwagen).
• Mittlere Zuzugsentfernung zum Tragseil.
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 27
4������0�-����)��8�������-%-��6�&���##�
-%-��*���� 4+, /���������7��#� 4������.���D�
I 300-1.5 300 15
I 350-1.2 350 12
I 400-1.0 400 10
I 450-0.8 450 8
II 300-2.5 300 25
II 400-2.0 400 20
II 500-1.5 500 15
II 600-1.0 600 10
III 300-3.5 300 35
III 400-3.0 400 30
III 500-2.5 500 25
III 600-2.0 600 20
IV 500-3.5 500 35
IV 600-3.0 600 30
IV 800-2.5 800 25
IV 900-2.0 900 20
V 500-4.0 500 40
V 600-3.5 600 35
V 700-3.0 700 30
V 1000-2.0 1000 20
4������0�4)����)��=������-%-��*�����@�
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 5 - 6
Maximale Tragkraft kN 8 - 15
Winden Anzahl 3 - 4
Max. Tragseilspannkraft kN 60
Tragseilkapazität m 300 - 400
Tragseildurchmesser mm < 18
Zugseildurchmesser mm < 10
Motorleistung kW 30 - 60
Masse der Anlage kg 5400
TrägerfahrzeugUnimog Typ 406 oder 403;
Anhänger
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 28
• Art des Zuzugs zum Tragseil.
• Durchschnittliches Stückvolumen.
• Transportvolumen pro Fahrt.
• Aufarbeitungsgrad des Holzes.
• Fertigkeiten und “Trainingszustand” der Bedienungsmannschaft.
���� ��-%-��@@
Die Typenreihe URUS II (Tabelle 13) ist nahezu identisch mit der Reihe URUS I. Siewurde in den sechziger Jahren gebaut und verwendet, neben üblichen LKW geeigneterGrösse, ebenfalls Trägerfahrzeuge aus der Unimog-Familie (U 90), besitzt aber im Ver-gleich zur Reihe URUS I eine höhere Leistung.
Leistungsangaben über die Klasse URUS II sind beschrieben in den Publikationen vonStöhr (1973) und Brabeck (1974). Wegen der stärkeren Konstruktion der Geräte sinddie Leistungen der Klasse URUS II geringfügig höher als bei der Klasse URUS I.
�������-%-��@@@
Es gelten analoge Bemerkungen wie für die Klassen URUS I und URUS II. Leider sindkaum Untersuchungsergebnisse über diese Klasse vorhanden. Die wesentlichen techni-schen Daten der Klasse URUS III sind in (Tabelle 14) zusammengestellt.
Gemäss der Klasseneinteilung von Mobilseilkränen nach Heinimann (1986) lässt sichder Typ URUS III in die mittlere Leistungsklasse einordnen. Die Leistungen, die mitdiesem System erreicht werden können, schwanken zwischen 6.5 und 10 fm/MAS.
4����� 0�6�&����;����;&��-%-��*�����@�>&������������
/�&�>����4������
������#�
>�����'&�7���.����,�&���������
�#��
6�&����;��
�#��,�&��6�'D�E�
@�'E��
6�&����;��
�#��,�&�6�'�
Schantl (1971) 213 252 5.6 7.0
Schantl (1971) 200 328 8.0 10.6
Löffler (1972) 238 72.8 2.4 3.5
Brabeck (1972)c 188 215 6.1 7.5
Brabeck (1972)d 186 194 5.4 7.2
Stöhr (1973) 250 80 3.0 4.2
a. PSH Produktive Systemstunde: Zeit, während der gerückt wird, inkl. Unterbrechungen bis 15 min.
b. ISH Indirekte Systemstunde: Zeit, die für das Montieren, Demontieren und das Umsetzen der Anlage benötigt wird, inkl. Unterbrechungen bis 15 min
c. Durchschnittswerte
d. Günstige Werte
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 29
Diese Werte wurden von 1972 bis 1977 im bayerischen Forstdienst ermittelt (Ragot,1978).
�������-%-��@A
Ursprünglich wurde die Bezeichnung Gigant nur für die Mobilseilkräne der KlasseURUS IV verwendet. Später wurde auch die Klasse URUS V mit Gigant bezeichnet. Indiesem Bericht wird mit Gigant nur die Klasse URUS V bezeichnet (Tabelle 10). In derLiteratur aber werden verschiedentlich technische Daten der Klasse URUS IV unterder Bezeichnung URUS Gigant angegeben. Hinteregger bekam aus dem Ausland sehrviele Aufträge aus Regionen, wo erschwerte Bedingungen für die Holzernte herrsch-ten. Entsprechend sind die grösseren URUS-Modelle auch für diese Gebiete konzipiert.In einem Prospekt schrieb Hinteregger: „Dieser URUS wurde besonders für Ganz-baumbringung, für schweres Buchenholz und für den Transport von Tropenhölzern
4������0�4)����)��=������-%-��*�����@@�
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 7 - 8
Maximale Tragkraft kN 15 -25
Winden Anzahl 3 - 4
Max. Tragseilspannkraft kN 80 - 100
Tragseilkapazität m 300 - 500
Tragseildurchmesser mm 18 - 22
Zugseildurchmesser mm 10 - 12
Motorleistung kW ca. 70
Masse der Anlage kg ca. 7000
TrägerfahrzeugUnimog Typ U 90 / 416;
LKW
4������0�4)����)��=������-%-��*�����@@@�
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 8.7
Maximale Tragkraft kN 20-35
Winden Anzahl 3 - 4
Tragseilkapazität m 300 - 600
Tragseildurchmesser mm 18 - 22
Zugseildurchmesser mm 10 -12
Motorleistung kW ca. 110
Masse der Anlage kg ca. 9600
TrägerfahrzeugUnimog ;
LKW
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 30
entwickelt.“ Die Klasse URUS IV wird der mittleren Mobilseilkranklasse gemäss Hei-nimann (1986) zugeordnet (Brabeck, 1979). Die technischen Daten sind nachfolgendzusammengefasst (Tabelle 15):
����9��-%-��A
Der Gigant (Abbildung 19) (Abbildung 20) gehört zur grössten Mobilseilkranklasse,welche von Hinteregger entwickelt wurde. Schon 1971 wurden einige Mobilseilkränegebaut, welche ein Leistungsprofil aufweisen, das mit dem der Reihe URUS V ver-gleichbar ist. Es handelt sich dabei um den URUS 500-5 (500 m Reichweite und 50 kNTragkraft) und den URUS 800-3.5 (800 m Reichweite und 35 kN Tragkraft)(Tabelle 16). Diese Modelle wurden auf Unimog-Trägerfahrzeuge aufgebaut (UnimogU 90/Spezial). Die anderen technischen Angaben entsprechen aber nicht den Typen derKlasse URUS V. Der URUS V weist im Vergleich zu den Vorgängerklassen einehöhere Motorleistung sowie einen höheren Kippmast auf. Er wird vollständig hydrau-lisch angetrieben und verwendet dreiachsige Lastwagen als Trägerfahrzeuge. Versuchemit der Klasse URUS V zeigten, dass die Maschine Leistungen um die 10 fm/MASerbringen kann. Die Parameter, welche die Leistung massgebend beeinflussen, sindwie bei den anderen URUS-Klassen das mittlere Stückvolumen, die Trassenlänge undder Holzanfall pro Seillinie.
�������>����-%-�
Anfang der siebziger Jahre wurde versucht, das Rücken bei Durchforstungsarbeitenmit einem Mobilseilkran der Klasse URUS I durchzuführen. Die Ergebnisse warenaber nicht befriedigend. Nach Löffler-Stöhr (1972) „gehört der Tragseiltransport zuden teuersten Transportarten“. Weiter „vermag ... auch ein perfekter Kippmast-Mobil-seilkran nichts daran zu ändern. Auch zeichnet sich ab, dass Stückvolumen unter 0.10 -0.15 fm kaum zu vertretbaren Kosten geliefert werden können.“ Vier Jahre später(1976) wurden diese Bemerkungen durch Schlaghamersky bestätigt. In der Zusam-menfassung schrieb er:
4�����90�4)����)��=������-%-��*�����@A�
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 10 -12
Maximale Tragkraft kN 25 - 35
Anzahl Winden Anzahl 4
Tragseilkapazität m 400 - 900
Tragseildurchmesser mm 22 - 25
Zugseildurchmesser mm 12 - 14
Motorleistung, an Winden gemessen kW 50 - 90
Masse der Anlage kg 10000 - 12000
TrägerfahrzeugUnimog;
LKW
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 31
/������0�-%-��A��#������.�A�.�����
/���� �0�-%-��A��#�������A�.�����
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 32
• „Infolge Ansteigen der Personalkosten ist der Aufwand an Arbeitskräften beim Ein-satz des URUS-Seilkrans in Durchforstungshieben zu teuer.“
• „Die Anschaffungskosten des Seilkrans und die Betriebskosten beim Poltern sind gemessen an dem geringen Wert des Holzes zu hoch.“
• „Es ist nicht leicht, die jährliche Leistung des Krans auf eine Höhe von 4500 fm zu bringen.“
• „Nach allen Erfahrungen mit dem URUS-Seilkran in Durchforstungshieben scheint der Einsatz in einem Bereich des Mittelstammes 0.1 - 0.15 fm nicht wirtschaftlich oder nur dann, wenn grössere Bestandesflächen vorhanden sind ...“
Um seine Produktereihe zu vervollständigen, entwickelte Hinteregger einen Kleinseil-kran, der den wirtschaftlichen Transport von Holz aus Durchforstungshieben erlaubte.Dieser Kleinseilkran erhielt den Namen Mini-URUS (Abbildung 21). Der Mini-URUSbesitzt einen Hydrostatantrieb. Von dieser Klasse existieren verschiedene Ausführun-gen; sie können auf LKW‘s auf- oder an Traktoren angebaut werden oder mit eigenemMotor auf Anhänger aufgesetzt werden. Der Kippmastseilkran Mini-URUS gehört zuKlasse der kleinsten Mobilseilkräne (Heinimann 1986) und weist entprechende techni-sche Eigenschaften auf (Tabelle 17).
Über die Leistungen des Kippmastseilkrans Mini-URUS machen Willingshöfer (1978),Hauska-Bernhard (1979) und Koidl (1982) verschiedene Angaben, die nachfolgendzusammengestellt sind (Tabelle 18). Bei der Interpretation der Leistung („fm/h“) sinddie möglicherweise unterschiedlichen zugrunde liegenden Zeitkonzepte zu berücksich-tigen.
����<��-%-��2����#�/������
Hinteregger konnte sich auch im amerikanischen Markt durchsetzen. Die ersten Anla-gen wurden im Jahr 1972 exportiert. In Amerika waren Baumstämme sehr grosserGewichte und Volumina zu transportieren. Die URUS Kippmastseilkräne wurden vorallem bei jenen Durchforstungen eingesetzt, bei denen die amerikanischen „Tower-Yarder“ für diese Arbeit zu schwer oder zu teuer waren.
4������0�4)����)��=������-%-��*�����A�
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 10 - 12
Maximale Tragkraft kN 20 - 50
Anzahl Winden Anzahl 4
Tragseilkapazität m 500 - 1000
Tragseildurchmesser mm 24 - 26
Zugseildurchmesser mm 12 - 14
Motorleistung, an Winden gemessen kW 150 - 220
Masse der Anlage kg ca. 17000
Trägerfahrzeug LKW
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 33
/���� �0�>����-%-��
4�����<0�4)����)��=������>����-%-��
>��#�� =�#���&� ?�
Masthöhe m 5
Maximale Tragkraft kN 8 - 10
Winden Anzahl 3
Maximale Tragseilspannkraft kN 64
Tragseilkapazität m 300 - 400
Tragseildurchmesser mm 12 - 14
Zugseildurchmesser mm 8
Motorleistung kW20 - 25
< 37 (LKW)
Masse der Anlage kg 2000 - 2500
Trägerfahrzeug Anhänger, Traktor, LKW
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 34
�����'���#��*���1�5���##������#���/FG
Hier wird über eine Weiterentwicklung der Seilkräne und die Zusammenarbeit vonHinteregger mit der Firma Bachmann (BACO), Steffisburg (Schweiz) berichtet, die1968 begann. Zwei Jahre später wurde der neue Seilkran mit der Markenbezeichnung„Hiba-Allterrain-Seilkran-Automatik“ vorgestellt. Der Hiba-Seilkran (��nteregger-��chmann) besitzt den Klemmapparat des BACO-Automats (der auf die beiden Stell-apparate verzichtet) und das Funktionsprinzip des Hinteregger-Allterrain-Seilkrans,das die Überwindung von Gegensteigungen erlaubt. Zudem arbeitet der Hinteregger-Allterrain-Seilkran mit einem geschlossenen Zugseil.
Dieser Seilkran weist zahlreiche Vorteile auf. Die entscheidende Neuerung ist der Weg-fall der Stellapparate: der Seilkran kann an jeder beliebigen Stelle entlang der Trasseautomatisch geklemmt werden. Der Lasthaken braucht kein Zusatzgewicht, ist daherviel leichter zum Austragen und kann zudem an jeder Stelle automatisch heruntergelas-sen werden. Auch wenn die Ladung am Boden streift, fährt der Laufwagen trotzdemweiter, da in beiden Richtungen mit Motorunterstützung gezogen wird. Dieser Seilkranwurde später „Hibamat“ genannt (Tabelle 18), von dem vier Modelle produziert wur-den. Es gibt davon zwei Ausführungen, die sich voneinander durch die Steuerung
unterscheiden. Die eine wird durch Richtungswechsel, die andere durch Zeitschaltunggesteuert. Die zwei grösseren Modelle sind für den Transport von schwerem Materialeinzusetzen. Die Tragkapazität dieser Seilkräne ist so hoch, dass ihr Einsatz nur fürHolztransport normalerweise unwirtschaftlich ist; deshalb werden sie polyvalent auchfür den Baustellenbetrieb verwendet.
Bei der Ausführung mit Steuerung durch Richtungswechsel fährt der Seilkran um dieeingestellte Schaltwegdistanz (1 - 11 m) über die Stelle hinweg, an der er zum Absen-ken oder Aufnehmen der Last am Tragseil festgeklemmt werden soll. Dann wird derLaufwagen vom Umlaufseil langsam in die Gegenrichtung gezogen, worauf er sichnach Zurücklegen der eingestellten Schaltwegdistanz am Tragseil festklemmt. DerSeilkran mit Zeitschaltung wird an der gewünschten Stelle gestoppt. Bei Stillstandklemmt sich der Kranwagen nach Ablauf der eingestellten Zeit (5 - 25 Sekunden) auto-matisch am Tragseil fest. Der grosse Vorteil dieser Schaltung (heute noch gebräuch-lich, aber nach und nach durch Funksteuerung ersetzt) ist, dass der Laufwagen nach
4������0�4)����)��=������'���#����������>&����
>��#�� =�#���&�*����>&���
Hibamat 2t Hibamat 3t Hibamat 5t Hibamat 8t
Nutzlast kN 20 30 50 80
Nutzlast mit Ladebrücke kN 30 45 75 120
Masse kg 550 780 1250 1900
Tragseil-Durchmesser mm 20-25 22-28 30-38 35-40
Umlaufseil-Durchmesser mm 9.5-11 11-14 14-16 15-18
Hubseil-Durchmesser mm 11-13 15-16 16-18 18-20
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 35
dem Festklemmen in beide Richtungen, ohne Steuerbewegung in die Gegenrichtung,abfahren kann.
��9��-%-��������������� �)��������������� �
Im Jahr 1969 begann Hinteregger mit dem Bau einer neuen Fabrik. Nach sieben JahrenBauzeit fand 1976 der endgültige Einzug statt, und die Fabrikation der grossen URUS(Gigant) lief an. Wie in Kapitel 4.3 angedeutet, wurde schon während der Bauarbeitendas URUS-Programm weiterentwickelt und die Maschinen weltweit vorgestellt.
Eine zweite Bauetappe dauerte vier Jahre. Die überdachte Produktionsfläche derFabrik wurde fast verdoppelt und mit modernsten Maschinen ausgerüstet. Andere Fir-men der Branche begannen sich für die Fabrikation zu interessieren. 1981 gelangteVöest Alpine an Hinteregger mit der Idee einer Zusammenarbeit. Hinteregger wargrundsätzlich dazu bereit. Vöest Alpine wollte die Zusammenarbeit jedoch auch aufweitere Hersteller ausdehnen, und so kam eine Kooperation schliesslich nichtzustande. Dennoch ging Hinteregger wieder mit neuer Begeisterung an die Arbeit. Erschrieb: „… und ich habe meinen Kopf schon wieder voller neuester Ideen, die ichnoch oder erst recht verwirklichen will.“ 1984 führte er eine Untersuchung durch, inder er den Bedarf bis 1995 abzuschätzen versuchte (vgl. Tabellen 20-26).
4������0������7���������.�;&��-%-��/������������&,��
:����-%-��@�E�@@
-%-��@@@ -%-��@A -%-��A
geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf
Österreich 19 100 11 20 2 20 2 10
Westdeutschland 4 100 1 10 2 50 1 10
Ostdeutschland 20 20 30
Frankreich 100 1 20 1 10
Spanien 50 10 1
Schweiz 50 1 20 10
Italien 5 100 2 20
Jugoslawien 9 100 2 20 4 30 10
Griechenland 30 1 10
Bulgarien 20 10
Rumänien 20 10
Ungarn 20 10
Polen 20 10
Sowjetunion 100 1 100 100
Tschechoslowakei
total Europa 37 830 19 190 11 250 3 130
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 36
4���� �0������7���������.�;&��-%-��/���������/����
:���� -%-��@�E�@@ -%-��@@@ -%-��@A -%-��A
geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf
Türkei 50 1 20 14 100
Israel 1 10 5
Iran 1 10 10
Pakistan 10
Indien 10
Malaysia 10 10
China 20
Japan 100 20 30
Taiwan 5
Philippinen 100 150 2 50 20
Indonesien 10 20 5
Tahiti 1 10
total Asien 2 270 2 255 16 210 50
4���� �0������7���������.�;&��-%-��/���������G7�����
:���� -%-��@�E�@@ -%-��@@@ -%-��@A -%-��A
geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf
Australien 20 20 10
Neuseeland 10 10
total Ozeanien 20 20 20 10
4���� 0������7���������.�;&��-%-��/���������/.�����
:���� -%-��@�E�@@ -%-��@@@ -%-��@A -%-��A
geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf
Südafrika 5 50 3 10 10 1
Swaziland 1 10 5 5
Transkei 2 20
total Afrika 8 80 3 15 15 1
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 37
4���� �0������7���������.�;&��-%-��/���������D&��������>���#�����
:���� -%-��@�E�@@ -%-��@@@ -%-��@A -%-��A
geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf
USA 500 100 5 100 50
Kanada 500 100 100 50
Mexiko 20 10 10 3
Honduras 20 10 2
Jamaika 2 2
Guatemala 20
total Nord-/ Mitte-lamerika
1060 2 210 7 220 105
4���� �0������7���������.�;&��-%-��/����������8��#�����
:���� -%-��@�E�@@ -%-��@@@ -%-��@A -%-��A
��������� ,�<��� ��������� ,�<��� ��������� ,�<��� ��������� ,�<���
Peru
Brasilien 7 300 1 50 50 1 30
Argentinien 50 50 10 2
Chile 30 20 30 2
Kolumbien 10 2 2 1
Surinam 10 1
total Südamerika 7 390 1 122 102 1 36
4���� 90������7���������.�;&��-%-��/��������.�������7��?��
:���� -%-��@�E�@@ -%-��@@@ -%-��@A -%-��A
geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf geliefert Bedarf
Europa 37 830 19 190 11 250 3 130
Asien 2 270 2 255 16 210 50
Ozeanien 20 20 20 10
Afrika 8 80 3 15 15 1
Nordamerika 1060 2 210 7 220 105
Südamerika 7 390 1 122 102 1 36
total Weltbedarf 54 2650 27 812 34 817 4 332
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 38
Die weltweite Krise in der Forstwirtschaft war für Hinteregger kein Grund, keineneuen Ideen zu entwickeln. Für den hydraulischen Seilspulenantrieb bekam er einPatent. Die Erfindung sollte die Nachteile herkömmlicher Seilkräne beseitigen. Für dieentsprechenden neuen Seilkräne sind neben dem Tragseil entweder drei Seile (Rück-hol-, Hub- und Ausziehseil) oder eine vom Tragseil angetriebene Hydraulikpumpe mitHydraulik-Druckspeicher vorgesehen.
Der hydraulische Seilausspulantrieb (Abbildung 22) basiert auf einem Hydraulikmo-
tor, der eine Seilspule im Laufwagen oder in einem angekuppelten Zusatzwagenantreibt. Der Motor ist mit einem Druckspeicher verbunden. Er wird sowohl von einereigentlichen Hydraulikpumpe als auch von dem schon erwähnten, als Pumpe betriebe-nen Hydraulikmotor aufgeladen. Die Hydraulikpumpe ist beim Ausspulen des Hub-seils durch Ventile auf Leerlauf schaltbar. Bei dieser Erfindung sind also beim Einzugdes Hubseiles zwei Pumpen zum Laden des Druckspeichers in Betrieb, nämlich dieHydraulikpumpe und der als Pumpe wirkende Hydraulikmotor. Bei der Seilausspulvor-richtung wird somit stets eine genügende Pumpkapazität zum Aufbau des erforderli-chen Betriebsdrucks sichergestellt, da zum Ausspulen nur der Hydraulikmotor arbeitenmuss. Die Anordnung der Ventile gewährleistet, dass der Hydraulikpumpe beim Aus-spulen kein Öl zugeführt wird und sie deshalb stillsteht.
Der deutliche Vorteil besteht darin, dass der Lasthaken leicht ausfallen kann und des-halb von einer Person allein mühelos ausziehbar ist. Es wird vermieden, dass der Last-haken bei grossen Seillängen mit viel Ballast beschwert und deshalb durch zweiPersonen mühsam getragen und ausgezogen werden muss.
/���� 0�'+�������)���������,������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 39
9����4/-%-�����������:��. ���,�&���##�������� �
9����4/-%-��������
Unter Beachtung der nachfolgend aufgelisteten Massnahmen und Prinzipien solltenbereits einsatzbereite Maschinen an neue moderne Anforderungen angepasst werden:
• Möglichst niedrige Anschaffungskosten
• Universelle Verwendbarkeit
• Einfache Anwendung
• Grösste Sicherheit bei der Arbeit
• Einfacher Service- und Wartungsdienst
• Robuste, unverwüstliche und langlebige Konstruktion
Die in der Folge entwickelte Erfindung besteht in einer (an die Dreipunktaufhängungeines Traktors anbaubare) Rückevorrichtung für Langholz, die nach dem Kopfhoch-oder Highlead-Prinzip arbeitet. Grundkomponenten sind ein Mast mit an der Spitze
angebauten Umlenkrollen für Zugseil, Rückholseil und Ankerseile sowie eine hintereinem Rückeschild aufgebaute Seilwinde mit zwei Seiltrommeln für Zug- und Rück-holseil. Die Ankerseile werden durch händisch betätigte, am Mast angebaute Anker-winden aufgenommen. Diese Maschine stellt eine Weiterentwicklung der Mini URUS– Serie dar.
/���� �0�4/-%-����������*�,,#���>&������������.8��:����&�7�
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 40
Eines der Ziele Hintereggers bei der Konzeption dieses Mastseilgerätes war es, dassdurch die Seilwindenbauart Wartungs- und Reparaturarbeiten besonders leicht möglichsein sollen. Das wird erreicht, indem alle antriebsrelevanten Teile wie Naben und Seil-trommeln in einem fest verschweissten, verwindungsfreien Gehäuse untergebracht unddurch einen abschraubbaren Deckel leicht erreichbar sind. Defekte Teile können soeinzeln aus- und eingebaut werden.
Dieses Seilgerät wurde 1992 dem Publikum unter dem Namen TAURUS(Abbildung 23) vorgestellt, wobei der Name TAURUS (TA-URUS) die Weiterent-wicklung der URUS - Geräte symbolisiert. Diese Seilkrangeneration sollte die Lückezwischen den Traktor-Rückegeräten und den Kippmastseilkränen schliessen.
Die technischen Daten lauten wie folgt:
• Einsatzdistanz 200 - 300 m
• Nutzlast: 30 kN, Kopfhochverfahren
• Gesamthöhe: 3.5 m; in Arbeitsstellung 4.0 m
• Eigenmasse 1000 kg
• Trägerfahrzeug: Traktor von 37 – 74 kW mit Dreipunkt-Hydraulik-Anbauvorrich-tung
• Trag-, Zug- und Rückholseil
Das System kann auch bei grossen Ausführungsvarianten angewendet werden (Aufbauauf LKW oder Anhänger). Die Reihe wurde in der Folge von einer neuseeländischenFirma weiterentwickelt. Es existieren somit mindestens sechs verschiedenen TAU-RUS-Modelle, davon fünf normale Kippmastseilkräne. Die technischen Spezifikatio-nen der Ausführungen, die durch die Firma „Brightwater Forest Equipment“ fabriziertworden sind (Archiv Hinteregger; Trzesniowski 1997) (Tabelle 26)
9� ��:��. ����6�&���##
Anfangs der neunziger Jahre wurde ein neuer Laufwagen in einer neuen Form entwik-kelt. Er sollte auch bei tief hängenden Tragseilen beim Gleiten über den Boden pro-blemlos arbeiten können. Hinteregger stellte fest, dass bei den damals üblichenSeilkränen die Kupplungsglocke bzw. das Lastpendel beim Schleifen über den Bodenoft beschädigt wurden oder dass dabei unerwünschte Fehlschaltungen im Laufwagenauftraten. Um diesen Störungsfaktor zu eliminieren, muss entweder das Tragseil mitMehraufwand stärker oder höher (Bau von teuren Zwischenstützen) gespannt werden,oder es ist ein anderer Laufwagentyp zu entwickeln. Hinteregger schlug ein schlitten-förmiges Gehäuse vor, in dem der ganze Schaltmechanismus untergebracht werdenkann. Die Schaltmuffen des Lasthakens werden vollständig in das Gehäuse eingezo-gen, um den Umklemmvorgang zu aktivieren. Das Gehäuse wird zusätzlich durch eineGleitschutzplatte gegen Beschädigung geschützt.
Die Schaltvorrichtung für Klemmsystem (für Tragseil- und Zugseilklemme) bestehtaus einer selbstschliessenden, durch Federkraft in der Klemmlage gehaltenen Seil-klemme, die das Zugseil festklemmt. Die hydraulisch unterstützte Klemmvorrichtungöffnet die Tragseilklemme beim Einfahren des Lasthakens verzögerungsfrei und ohne
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 41
Schaltpause. Durch dieses kontinuierliche Arbeiten werden Zugseilrisse weitgehendvermieden.
Für das Klemmsystem konnten unterschiedliche Steuerungen eingebaut werden: reinmechanische oder (über einen oder zwei am Tragseil verstellbare Stellwagen) hydrauli-sche. Ein paar Jahre später wurde die Schaltvorrichtung für das Klemmsystem geän-dert. Der oben beschriebene Schaltschieber als Schaltsystem erwies sich wegen dervielen Hebel und Klappen als zu kompliziert und störungsanfällig. Aus diesem Grundentwickelte Hinteregger eine neue, robuste und unkomplizierte Schaltvorrichtung mitZwangsführung, die unter allen Umständen und bei jeder Erschütterung zwangsläufigrichtig schalten muss.
Ein geschlossener Block (Abbildung 24) ist mit Seitenwangen am Laufwagengehäusebefestigt. Ein unteres Fach dient zur Führung des Kupplungsschiebers; ein oberes zurFührung des Hydraulikschiebers. Mit einem Mittelsteg mit abgerundeter Kante undeinem unteren Steg mit abgeschrägter Fläche wird die Führung der Schieber sicherge-stellt.
4���� �0�4/-%-��"�������;&������� ���"&����H��,#���I���0�6�&�,��"��#��'������B����� ���������������)�����������������#�%��#�����4�&##�.��������;�#C�����������
>��#��
4+,��7�)�����
4/-%-���9
4/-%-�9��
4/-%-�9��
4/-%-���
4/-%-���
4/-%-� �
Anzahl Winden 4 4 4 3 3 2
Ankerwinden 4 (hyd) 4 (hyd) 4(hyd/Hand) 4 (Hand) 4 (Hand) 4 (Hand)
Masthöhe (m) 12-15 12-15 12 9 7 6.5
Reichweiten (m) 600-900 500-800 300-600 400-600 300-450 200-350
Nutzlast max. (kN) 70 60 50 40 30 25
Masse ohne Seile (kg) 16600 11400 8200 4500 2600 1400
Trägerfahrzeug und minimale Leistung (kW)
LKW
3-achs;
190 - 235
LKW
3-achs;
95 - 130
LKW
2-achs
130
LKW
2-achs;
65 - 95
Anhänger oder LKW 2-
achs;
50 - 65
Traktor;
50 - 65
Kapazität Tragseil bei ... mm Durchmesser (m)
600 (26)650 (24)780 (22)900 (18)
500 (26)600 (24)730 (20)900 (18)
450 (24)550 (22)670 (18)
400 (20)500 (18)600 (16)
250 (16)300 (14)350 (13)
200 (14)300 (13)350 (12)
Kapazität Zugseil bei ... mm Durchmesser (m)
1000 (16)1300 (14)1800 (12)
850 (16)1100 (14)1450 (12)
510 (14)660 (13)700 (12)
500 (12)600 (11)720 (10)
270 (12)380 (10)570 (8)
200 (12)290 (10)450 (8)
Kapazität Rückholseil bei ... mm Durchmesser (m)
1500 (16)2000 (14)2700 (12)
900 (16)1200 (14)1650 (12)
770 (14)900 (13)
1050 (12)
630 (12)750 (11)900 (10)
410 (12)600 (10)930 (8)
310 (12)450 (10)700 (8)
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 42
Dieser Zwangsführungsteil steuert die Umschaltung für Freigabe und Schliessung derSeilklemmen. Beim Umschalten werden somit ein Kupplungsschieber und ein Hydrau-likzylinder zwangsweise gegenseitig ver- und entriegelt.
Eine der letzten Erfindungen von Hinteregger ist ein hydraulischer Antrieb für dieAusspulvorrichtung des Hub- bzw. Zugseils. Die gesamte Laufwagenkomposition(Abbildung 25) besteht aus einem eigentlichen Laufwagen sowie einem daran fixgekuppelten Zusatzwagen mit einem Seilspill aus zwei ein- und zweirilligen Seilschei-ben, einem auch als Pumpe zu betreibenden Hydraulikmotor, einer Hydraulikpumpeund einem Druckspeicher. Die Idee, einen Lasthaken mit geringem Eigengewichtmühelos überall absenken und von einer Person ausziehen zu können, stammt aus denachtziger Jahren (Abbildung 22). Nachteilig bei dieser Ausführung ist, dass das Fahrendes Laufwagens auf dem Tragseil nicht zur Druckerzeugung für den Ausspulmechanis-mus verwendet wird. Dadurch kann es bei über lange Fahrdistanzen arbeitenden Seil-kränen wegen Druckabfall oder einem Leck im Hydrauliksystem zu Störungen beimAusspulen des Seils kommen. Bei anderen Ausführungen, die nach dem 4-Seil-System(Trag-, Zug-, Rückhol- und Hilfsseil) arbeiten, sind aufwendigere und deshalb teureSeilwinden nötig, um die Seile synchron laufen zu lassen. Dies kann mit dem von Hin-teregger entwickelten System umgangen werden.
Mit einem neuen, am Laufwagen anzukuppelnden Zusatzwagen sollte sowohl bei Fahrtdes Laufwagens am Tragseil als auch bei Anheben und Zuzug der Last mit dem Hub-/Zugseil ein Druckspeicher aufgeladen werden. Die Hydraulikanlage des Zusatzwagensist dafür mit der hydraulischen Steuerung des Seilkranwagens verbunden. Ein hydrau-lischer Schaltzylinder am Zusatzwagen ist an den mit einer hydraulischen Schaltungausgestatteten Laufwagen angeschlossen. Ein Sperrventil dient zur Steuerung der
/���� �0�*�##�>)�����#����4������������5���������������������. �����#��5 ����.8������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 43
Hydraulikpumpe sowie des Hydraulikmotors. Die Hydraulikpumpe lädt während derFahrt des Zusatzwagens auf dem Tragseil einen Druckspeicher auf. Die Pumpe wirdvon einer Laufrolle des Zusatzwagens über einen Kettentrieb angetrieben. Bei stillste-hendem Wagen treibt ein Hydraulikmotor über ein Vorgelege die Seilausspulrolle fürdas Hub- bzw. Zugseil an und unterstützt somit die Person, die das Seil auszieht.
Damit sich das Hub- bzw. Zugseil problemlos durch den Seilausspulautomaten führenlässt, pressen zwei aussen angebrachte Umlenkrollen das Hub- bzw. Zugseil an diekeilförmige Klemmrille der Seilausspulrolle an.
9�����=��$'�������-��;�����:��. ����/�&#�(
Dieser Laufwagen ist die letzte Entwicklung von Hinteregger und fasst verschiedeneErfindungen zusammen. Von den Hinteregger-Automat-Seilkranlaufwagen gibt es vierAusführungen (Tabelle 27).
Die Einsatzmöglichkeiten sind in den Abbildungen 27-29 dargestellt.
/���� 90�'+��&#)�����)��������:��. ����#����&,,���5������5 ��������,���A&���)�����
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 44
/���� �0�'+�������)���/�����.8�����5 ��������,������
4���� <0�4)����)��=������('������3���������/�&#���
>��#�� =�#���&� /�&#�� ��� /�&#������:�����)���/��������/�&�#��9���
:�����)���/��������/�&�#�������
Masse kg 230 290 600 800
Nutzlast kN 20 40 50 100
Schaltung -Zeitschaltung hydraulisch oder Funk
Zeitschaltung hydraulisch oder Funk
Zeitschaltung hydraulisch oder Funk
Zeitschaltung hydraulisch oder Funk
Beseilung - Zugseil ZugseilEndloses Zugseil + Hubseil
Endloses Zugseil + Hubseil
Mögliche Zusatzausrüs-tung
-Zugseil-Zwangs-ausspuler (Slack-puller)a
Zugseil-Zwangs-ausspuler (Slack-puller)
Zusatzlaufwagen mit Ladebrücke für Horizontaltrans-port
Zusatzlaufwagen mit Ladebrücke für Horizontaltrans-port
a. Es gibt zwei Typen „Slackpuller“. Normalerweise wird eine Spule mit Rückholseilantrieb für maximal 80 m Zugseilausspulung verwendet. Für besondere Zwecke wird eine Spule mit Motorantrieb und Funksteuerung verwendet. Damit lässt sich auch ohne Rückholseil arbeiten und man kann beliebige Längen Zugseil abspulen.
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 45
/���� <0� ������+�#������.J�:��. ����#��*�##;&���)���������5���7 ����#��#&&��������5 ��������,������
/���� �0�� ��������+�#���������:��. ����#��*�##;&���)���������5���7 ����#��#&&��������5 ��������,�������'+�������#&&�1��&���(���,����3���=������..�$5�����(��7 ��$%8)��&����(� ��������������#���������8���)��;� ����=��A� ���������%8)��&�������������)���������D������;����������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 46
/���� �0��������+�#��:��. ����#��*�##;&���)���������'&��7&�������,&��#�����&�#�5������
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 47
:�����;�7�)����
Brabeck, W. (1972): Erfahrungsbericht über den Einsatz des Kurzstreckenseilkrans URUS beider Hespa-Domäne. Allgemeine Forstzeitschrift (27) 22/23: 473 - 476
Brabeck, W. (1974): Der Komfort-URUS. Sonderdruck aus „Holz-Kurier“ Nr. 25 vom 20. Juni1974. 1 S.
Brabeck, W. (1979): Bergabseilung mit einem Kurzstreckenseilkran der URUS-Mittelklasse.AFZ (90) 12: 383 - 384
Chermak, F. I.; Lloyd, A. H. (1962): Les transports de bois dans les régions tropicales.Unasylva (65): 75 - 103
Gasteiger, J. (1978): Erfahrungen mit dem Mobilseilkran URUS-Gigant. Allgemeine Forstzeit-schrift (33) 29: 826 - 828
Hafner, F. (1954): Neue Entwicklungen im Bau von Seilförderanlagen in Kärnten. AFZ (65)17/18: 214 - 216
Hafner, F. (1964): Der Holztransport. Wien, Österreichischer Agrarverlag. 460 S.
Hauska, E.; Bernhard, A. (1979): Bericht über einen Arbeitseinsatz des mobilen Kippmastseil-kranes Mini URUS in der Schwachholzernte. AFZ (90) 11: 339 - 343
Heinimann, H.-R. (1986): Seilkraneinsatz in den Schweizer Alpen. Eine Untersuchung überdie Geländeverhältnisse, die Erschliessung und den Einsatz verschiedener Seilan-lagen. Diss. Nr. 7929, ETH Zürich. 169 S.
Hinteregger, R. (1976): URUS-Mobilseilkran besteht Feuertaufe in Amerika. AFZ (87) 1: 33 -34
Janeschitz, H. (1960): Der Hinteregger-Seilkran. AFZ (71) 13/14: 151
Kastner, J. (1954): Mehrere Gehänge bei einspurigen Seilbahnen. AFZ (65) 17/18: 216 - 217
Koidl, H. (1982): Holzseilen bergab. Der Mini URUS mit Hydrostatantrieb. Holz-Kurier (31):27 - 28
Löffler, H.; Stöhr v. Holleben, G. (1972): Kurzstrecken-Mobilseilkran in Durchforstungen amSteilhang. Forsttechnische Informationen (24) 10: 78 - 81
Meyr, R. (1971): Übersicht über das derzeitige Angebot an Seilwinden und Seilkränen für dieForstwirtschaft. AFZ (83) 2: 124 -130
Mitterbacher, B. (1990): Ermittlung und Vergleich von Leistungs- und Kostendaten der Berg-auf-Bergab-Seilung mit Kippmastseilgeräten als Entscheidungskriterium für denForsttechniker. Centralblatt f. d. ges. Forstw. (107) 4: 241-258
Pestal, E. (1961): Seilbahnen und Seilkrane für Holz- und Materialtransport. Wien und Mün-chen, Verlag Georg Fromme & Co.. 510 S.
Pestal, E. (1974): Umweltfreundliche Maschinen für den Bergwald. Schweiz. Zeitschrift fürForstwesen (125) 1: 25-43
Ragot, J. (1978): Débardage de bois à l’aide d’une gamme de câbles-grues mobiles sur véhicu-les-mâts URUS HINTEREGGER. Simulation d’emploi d’un câble URUS III pourles exploitations pyrénéennes. Études du courier de l’exploitant et du scieur 3/78.23 S.
Schantl, M. (1971): Die Holzbringung mit dem Kippmast-Seilkran URUS 250/500. AFZ (82)5: 108-110
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 48
Schlaghamersky, C. (1976): Zusammengefasste Erfahrungen zum Einsatz des URUS-Kranesfür Schwachholzbringung. Forsttechnische Informationen (28) 7: 49-53
Seidl, S. (1967): Erfahrungen mit forstlichen Seilanlagen. AFZ (78) 7: 189-191
Stöhr, G. (1975): Der Mobilseilkran als Alternative für Durchforstungen im Gebirgswald.Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen (126) 7: 517-529
Stöhr v. Holleben, G. (1973): Erste Ergebnisse der Untersuchungen mit URUS-Mobilseilkranim Schwachholz. Forstw. Cbl. (92): 297-311
Trzesniowski, A. (1970): Hiba-Allterrain-Seilkran in Serie. Internationaler Holzmarkt (61) 16/17: 30-32
Trzesniowski, A. (1997): Forstmaschinen und Holzbringung II. Schriftenreihe des Instituts fürForsttechnik Band 6. Institut für Forsttechnik der Universität für Bodenkultur,Wien. 173 S.
Willingshöfer, K. (1978): Erfahrungsbericht über den Einsatz des neuen Seilkrans Mini URUSfür Durchforstungen im Schwachholz und mittleren Bauholz. Allgemeine Forst-zeitschrift (33) 18: 531-533
5HLQKROG�+LQWHUHJJHUV�6HLODQODJHQ 49