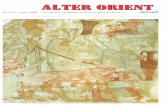Was heißt 'die Würde eines Tieres achten'?
Transcript of Was heißt 'die Würde eines Tieres achten'?
Jahresschriftfür skeptisches Denken
Herausgegeben von derMax Himmelheber-Stiftung
Jahrgang 2014/2015
44
Scheide wege
Sonderdruck
S. Hirzel Verlag
Inhalt
Michael Holzwarth Wasser „to go“ 5
Hansjürgen Bulkowski Voller Energie 24
Ernst Peter Fischer Das schwarze Loch im öffentlichen Diskurs 31
Eduard Kaeser Was zum Teufel ist Kliodynamik? 36
Nora S. Stampfl Die Vermessung der Welt. Von Zahlengläubigkeit und Wunderwaffen 43
Klaus Zierer Post-PISA-Bildung 54
Peter Cornelius Mayer-Tasch Von Bild und Bildung in ganzheitlicher Sicht 59
Florian Schwarz Drachen steigen lassen und Sterne beobachten 71
Nils B. Schulz Vom Gerede zum Gespräch 85
Johano Strasser Über Melancholie und lachende Vernunft 110
Johann Hinrich Claussen Über das Glück einer Seifenblase 123
Hans Wohlgemuth Der Waldspaziergang 134
Ilse Onnasch Zu Fuß! 142
Gerhard Fitzthum Fluchtpunkt Wildnis 156
Walter Sauer 100 Jahre Hoher Meißner 1913 –2013 177
Josef H. Reichholf Nachruf auf einen Winter 186
Jens Soentgen Ökologischer Pluralismus 196
Michael Hauskeller Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 214
Klaus Michael Meyer-Abich Den Tod des Fischs leben 233
Anita Albus Die Gaben der Schildkröte 249
Friedrich Pohlmann Der Schlachthof 254
Karin Kneffel ENDLIcH. Bildwiderspiegelungen 273
Lena Kugler Zukunft denken mit Iguanodon und Überbeutler 293
Günther Bittner „... daß man den Lauf der Dinge kaum bewußt regieren kann.“ 306
Hans-Martin Schönherr-Mann Von der Utopie zur Dystopie und zurück 324
Heinz Theisen Generation ausweglos? 343
Stefan Diebitz Facetten der Gewalt 354
Burkhard Liebsch Andere hassen 374
Biographische Angaben 397
Michael Hauskeller
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten?
A. Ist es mit dem Begriff der Würde vereinbar, Tieren Würde zuzusprechen?
Ich besitze eine alte, etwa hundert Jahre alte photographische Postkarte aus England, welche das Profil eines Hundes zeigt, der gelassen, mit leicht erhobenem Kopf, in die Ferne schaut.
Die Postkarte trägt die Aufschrift „Dignity“, also ‚Würde‘, woraus sich entnehmen lässt, dass es Würde ist, oder eine Verkörperung derselben, die wir aufgefordert sind, im Bild dieses Hundes zu erkennen. Aber wie sollte ausgerechnet das Bild eines Hundes uns Würde zeigen können? Kann ein Hund denn überhaupt so etwas wie Würde besitzen? Und wenn nicht, wie kann er oder sein Bild sie dann zeigen? Von der Würde eines Tieres zu sprechen, ist auch heute noch eher ungewöhnlich und
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 214 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 215
wird nicht selten sogar als unsinnig angesehen. Es hat beinahe den Cha-rakter eines Oxymorons, wenn nicht eines klaren Widerspruchs wie der Begriff eines hölzernen Eisens. Der Begriff der Würde scheint einfach unvereinbar mit dem Begriff des Tieres. Diese Reaktion ist durchaus ver-ständlich, denn der Begriff der Würde ist von seinen Ursprüngen und seiner Geschichte her sehr an die Erfahrungen geknüpft, die Menschen mit sich selbst und mit anderen Menschen machen.
Nun hat der Begriff selbst, wie er herkömmlich verwendet wird, aber zwei verschiedene Aspekte, die sich klar unterscheiden lassen, aber nicht immer klar unterschieden werden, nämlich einen deskriptiven und einen präskriptiven Aspekt. Deskriptiv verstanden bezeichnen wir mit dem Begriff der Würde gewöhnlich erstens eine bestimmte innere Haltung (nämlich Selbstachtung) und zweitens eine bestimmte Fähigkeit oder Disposition (nämlich die Fähigkeit zum vernünftigen Denken und Handeln und eine gewisse Freiheit oder Autonomie). Die würdevolle Haltung ist etwas, was man als Mensch haben oder aber auch nicht haben kann. In diesem Sinne sprechen wir manchen Menschen Würde zu und anderen wiederum Würde ab. Tieren wird man gewöhnlich grundsätzlich nicht einmal die Fähigkeit zur Selbstachtung zusprechen, obwohl sie sich durchaus mitunter in einer Weise verhalten können, als ob sie über Selbstachtung verfügten, oder durch ihr Aussehen, ihren Aus-druck oder ihre Körperhaltung diesen Eindruck vermitteln können. So erweckt der Hund auf der oben gezeigten Postkarte den Anschein eines sich seines eigenen Wertes bewussten Wesens, weil seine Haltung und sein Ausdruck uns an die Haltung und den Ausdruck eines Menschen erinnern, dem wir aufgrund dieser Haltung und dieses Ausdrucks ge-neigt wären, Selbstachtung zuzuschreiben. Würde ließe sich dann im Bild des Hundes finden oder wiedererkennen, ohne dass wir glauben müssten, der Hund besäße tatsächlich Würde im Sinne von echter Selbst-achtung.
Anders als die würdevolle innere Haltung, die wir sowohl Tieren als auch vielen Menschen absprechen, wird die würdeverleihende Fähigkeit üblicherweise (wenn auch nicht notwendig) allen Menschen zugeschrie-ben, da auch ein Mensch, der aktuell der Vernunft ermangelt, diese doch potentiell, nämlich insofern er Mensch ist, besitzen kann. Demnach be-säße also jeder Mensch, unabhängig von seiner Haltung, Würde. Das heißt auch einer, der sich selbst nicht achtet, oder dessen Handeln kei-nerlei Selbstachtung erkennen lässt, besitzt doch Würde vermöge seiner
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 215 22.07.14 10:49
216 Michael Hauskeller
Teilhabe an etwas, das alle Menschen verbindet. Tiere jedoch, so wird wiederum angenommen, tun das nicht. Ihnen fehlt die Freiheit zum vernünftigen Denken und Handeln, und zwar nicht nur als einzelne, sondern ihrer arteigenen Natur nach. Sie gehören nicht zu der Art von Wesen, die über solche Eigenschaften verfügt (während der Mensch eine solche Art ist, auch wenn dem einzelnen Menschen zuweilen diese artbe-stimmenden Eigenschaften fehlen).
Präskriptiv bezeichnet Würde jedoch etwas ganz anderes, nämlich ers-tens das Recht, nicht erniedrigt zu werden, und zweitens das Recht, nicht in elementarer Hinsicht eingeschränkt zu werden, oder genauer gesprochen das, woraus diese Rechte sich angeblich ableiten, nämlich, mit Kant zu sprechen, den absoluten Wert, der einer bestimmten Art von Wesen angeblich zukommt, oder, was dasselbe ist, eine bestimmte Exis-tenzweise, nämlich die eines Selbstzweckes. Bekanntlich haben Kant zu-folge Tiere keinen absoluten Wert, sondern nur einen relativen (bezogen auf bestimmte Zwecke und bestimmte Zweckhaber), und das heißt einen Preis.1 Kant begründet diese Auffassung damit, dass Tiere nicht, und das heißt nicht einmal potentiell, über das verfügen, was einem Wesen aller-erst absoluten Wert verleiht. Das aber sei die Autonomie, oder die Fähig-keit, sich selbst Zwecke zu setzen und moralisch, das heißt aus Achtung vor dem Sittengesetz und der Vernunft, zu handeln. Nun gibt es aber keinen ersichtlichen, oder jedenfalls keinen logisch zwingenden, Grund, jenen angeblichen absoluten Wert (oder die präskriptiv verstandene Wür-de) abhängig zu machen von dem Vorhandensein von Autonomie oder ähnlicher Eigenschaften (also einem deskriptiven Sachverhalt). Dass die Autonomie und nur die Autonomie (deren Existenz ohnehin fraglich ist und eher postuliert als empirisch aufgefunden wird) einen absoluten Wert und die daraus ableitbaren Rechte begründen könne, ist keines-wegs offensichtlich. Es könnte durchaus sein, dass es noch andere Eigen-schaften gibt, die ebenfalls einen absoluten Wert zu begründen vermö-gen, immer vorausgesetzt, dass wir bereit sind zu akzeptieren, dass es überhaupt so etwas wie absolute Werte und entsprechende natürliche Rechte gibt. Aber wenn wir es tun, dann gibt es keinen zwingenden Grund, Tieren einen solchen Wert abzusprechen, nur deshalb weil sie nicht über die Eigenschaften verfügen oder zu verfügen scheinen, in de-nen man gemeinhin den absoluten Wert des Menschen begründet sieht.
Nun gibt es tatsächlich eine Eigenschaft, die Menschen mit Tieren teilen und die mindestens eine ebenso plausible Grundlage für die Zu-
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 216 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 217
sprechung eines absoluten Wertes ist wie die Kantsche Autonomie und verwandte Konzeptionen. Diese Eigenschaft besteht darin, dass jeder Mensch und jedes Tier für sich selbst ein Gut ist. Wir mögen andere Menschen oder Tiere als Mittel zur Erfüllung unserer Zwecke sehen und behandeln, aber kein Mensch und kein Tier erfährt sich selber als Mittel zu einem anderen Zweck. Jedes Tier existiert in erster Linie für sich selbst, ist um seine eigene Existenz besorgt und erfährt diese als ein Gut und einen Zweck an sich.2 Wenn wir diese Art von Selbstbezüglichkeit in den Blick nehmen, dann erscheint die Kantsche Annahme, dass Tiere nur als Mittel existierten (statt einfach so gebraucht zu werden) und ent-sprechend keinen (absoluten) Wert, sondern nur einen Preis hätten, als eine ungerechtfertigte und beinahe willkürliche Setzung, die an der Le-benswirklichkeit der Tiere, und unserer Erfahrung derselben, ganz und gar vorbei geht. Wenn aber Tiere nicht nur als Mittel existieren, sondern immer auch als Zweck ihrer selbst, dann haben sie auch, für sich selbst genommen, keinen Preis, was bedeutet, dass sie nicht ersetzbar oder aus-tauschbar sind (wie alles, das einen Preis hat, denn der Preis einer Sache bezeichnet nichts anderes als die Bedingungen ihrer Austauschbarkeit). Was aber nicht ersetzbar ist, das hat einen absoluten Wert (da die Uner-setzbarkeit das ist, was absoluter Wert meint) und damit (wenn man nämlich mit Kant den Begriff der Würde mit dem des absoluten Wertes gleichsetzt) auch Würde. So ist die dem Menschen allein zugeschriebene Autonomie nur eine von verschiedenen möglichen Gründen, einem We-sen sinnvoll einen absoluten Wert zuzuschreiben. Die animalische Selbst-zweckhaftigkeit ist ein anderer.
Je nach dem, worin sich die Würde gründet, können wir dann unter-scheiden zwischen einer (auf person-konstituierenden Eigenschaften sich gründenden) personalen Würde und einer (auf der individuellen lebend-fühlenden und strebenden Existenz sich gründenden) nicht-personalen Würde. Diese zwei verschiedenen deskriptiven Bestimmun-gen des (normativ identischen) Würdebegriffs lassen sich zwei verschie-denen Denktraditionen zuordnen, einer dignitas-Tradition, in der es darum geht, den Menschen in seiner Besonderheit zu verstehen, und einer bonitas-Tradition, welche gerade die Gemeinsamkeiten zwischen allem Lebendigem betont.3 Dignitas ist die personale Würde (engl.: dignity), die traditionell aus der angeblichen Gottesebenbildlichkeit des Menschen abgeleitet wird, welche wiederum im Besitz von Vernunft, Seele und Moral bewiesen wird. Bonitas ist die nicht-personale Würde,
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 217 22.07.14 10:49
218 Michael Hauskeller
die Menschen genauso wie Tiere besitzen (engl.: worth) und die sich weniger in einem positiven Vermögen zeigt, als vielmehr in deren krea-türlicher Schwäche und Verletzlichkeit, die uns Menschen mit den Tie-ren verbindet.
Nun ist der Begriff eines absoluten Wertes, das heißt der Begriff der Würde, ganz gleich ob diese als dignitas oder als bonitas verstanden wird, aber durchaus nicht unproblematisch. Das Problem besteht darin, dass die Würde ein normativer Begriff ist, der einerseits die Verpflichtungen bezeichnet, die wir (vor jeder vertraglichen Vereinbarung und jeder staat-lichen Sanktionierung) demjenigen, das Würde besitzt, gegenüber haben, andererseits aber den Grund, aus dem diese Verpflichtungen entspringen sollen. Wenn wir einem Wesen Würde zuerkennen, dann meinen wir, dass wir es in bestimmter Weise behandeln bzw. nicht behandeln sollten, aber auch, dass wir es so behandeln sollten, weil es etwas besitzt, das uns dazu verpflichtet. Was aber ist das? Ein absoluter Wert. Aber was ist ein absoluter Wert? Der Begriff ist schon seiner Definition nach weniger eine Eigenschaft, die ein Ding hat, als vielmehr eine Handlungsanwei-sung. Absoluter Wert bezeichnet das Unersetzbare, Nicht-austauschbare. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht ersetzt werden kann, son-dern dass es nicht ersetzt werden soll. Anders gesagt sind Ersetzbarkeit und Unersetzbarkeit in erster Linie keine ontologischen Bestimmungen, sondern unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge, unterschiedliche Weisen, ein Ding anzusehen. Entsprechend ist zu sagen, dass ein Ding Würde habe, im Grunde eine Aufforderung, es auf eine bestimmte Wei-se anzusehen (und entsprechend zu behandeln). Menschen können für mich genauso ersetzbar sein wie Tiere, Tiere genauso ersetzbar wie Din-ge. Die Zuschreibung von Würde kann mir also genau genommen keine Antwort auf die Frage geben, warum ich eine Sache nicht beliebig be-handeln können sollte, sondern sagt mir nur, dass ich es soll.
Warum aber soll ich ihr überhaupt Würde zusprechen? Muss ich das, wenn ich es als autonomiebegabt begreife, oder als für-sich-selbst- ein-Gut? Nein. Der Schluss von der Tatsache auf den Wert ist niemals logisch zwingend. So hängt es letztlich an uns selbst, ob wir Tieren Wür-de zuerkennen wollen oder nicht. Aber dasselbe gilt auch für die Würde des Menschen. Die entscheidende ethische Frage ist nicht, was (objektiv und in sich selbst) wertvoll ist und was nicht, sondern vielmehr, wer wir sein wollen und in was für einer Art von Welt wir leben wollen. Der amerikanische Pragmatist William James meinte zu Recht, dass wir die
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 218 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 219
Welt gestalten gemäß der Art und Weise, wie wir über sie denken und uns ihr gegenüber verhalten.4 Das heißt, die Welt ist nicht einfach eine fertig geformte Gegebenheit, über deren Beschaffenheit wir wahre und falsche Urteile fällen können, sondern indem wir über sie urteilen, schaf-fen wir immer wieder diese Welt mit. Auf die Würde bezogen meint das, dass wir uns weniger den Kopf darüber zerbrechen sollten, ob es denn so etwas wie Würde (einen absoluten Wert) überhaupt geben kann und gibt, sondern vielmehr darüber, was wir tun können, damit die Welt eine wird, in der es Würde gibt.5
B. Was bedeutet die Würde eines Tieres zu achten in der Praxis?
Nehmen wir nun an, dass auch Tiere über Würde verfügen (oder dass wir es richtig, angemessen oder wünschenswert finden, ihnen Würde zuzuerkennen), was genau folgt dann eigentlich hieraus für unser Han-deln? Was genau heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? In Artikel 120 der Schweizer Bundesverfassung wird bekanntlich postuliert, dass der Bund Vorschriften zu erlassen habe, die der Würde der Kreatur Rech-nung tragen, und ganz ähnlich heißt es dann in der gemeinsamen Stel-lungnahme der Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnolo-gie im Außerhumanbereich (EKAH) und der Eidgenössischen Kommis-sion für Tierversuche (EKTV) zur Würde der Kreatur aus dem Jahr 2001, dass wir die Würde eines Tieres dann missachten, „wenn wir seine allfällige Beeinträchtigung nicht zum Gegenstand einer Güterabwägung machen, ihr also nicht Rechnung tragen, sondern selbstverständlich von einem Vorrang der Interessen des Menschen ausgehen.“6 Demnach scheint es, als sei die Würde der Kreatur nichts, das uns direkt bestimm-te Handlungen verbiete. Vielmehr wird von uns verlangt, dass wir dem Leben und dem Wohl des Tieres ein gewisses Gewicht beimessen, was aber nicht ausschließt, dass wir im Einzelfall, im Anschluss an die gefor-derte Güterabwägung, zu dem Schluss kommen, dass es in diesem Fall durchaus vertretbar sei, das Leben und Wohl eines Tieres anderen, das heißt menschlichen Interessen zu opfern, nämlich dann, wenn diese In-teressen für gewichtig genug befunden werden. Dabei bleibt offen, wel-che Interessen für gewichtiger befunden werden können als die elemen-taren Interessen des Tieres. Interessanterweise scheint die Forderung des Rechnung-Tragens dem Begriff der Würde selbst zu widersprechen,
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 219 22.07.14 10:49
220 Michael Hauskeller
nämlich dann, wenn wir diese als absoluten Wert verstehen. Im Gegen-teil scheint hier davon ausgegangen zu werden, dass das Leben und Wohl eines Tieres durchaus einen Preis hat, und es geht nur darum jeweils zu bestimmen, wie hoch dieser Preis in einer gegebenen Situation zu veran-schlagen ist. Insistiert wird lediglich darauf, dass das Leben und Wohl des Tieres nicht umsonst zu haben ist, dass es schon etwas kostet und man nicht davon ausgehen dürfe, dass es völlig wertlos sei. So ist eine Beein-trächtigung der Würde eines Tieres keineswegs verboten, sondern bedarf lediglich einer Rechtfertigung (die im Prinzip immer möglich ist). Trotz-dem ist vielleicht schon viel gewonnen, wenn man nicht mehr selbstver-ständlich davon ausgeht, dass es keine Rolle spielt, wie wir mit Tieren umgehen, dass es dort gar nichts gibt, dem wir Rechnung tragen müss-ten oder sollten oder auch nur sinnvoll könnten.
In der gemeinsamen Stellungnahme der EKAH und EKTV wird dann aber doch noch der Versuch gemacht zu konkretisieren, was denn über-haupt als Würdeverletzung anzusehen sei (deren Erlaubtheit dann freilich immer noch eine Abwägungsfrage bleibt), wodurch interessanterweise ein bestimmtes deskriptives Verständnis der Würde wieder in den Vor-dergrund gerückt wird, nämlich das der Selbstachtung. Eine Beeinträchti-gung der Würde eines Tieres liege nämlich dann vor, so heißt es, wenn a) in sein Erscheinungsbild eingegriffen werde, b) es erniedrigt werde, oder c) es übermäßig instrumentalisiert werde. Das Wohl des Tieres taucht hier gar nicht mehr auf, so dass es durchaus möglich erscheint, die Würde eines Tieres zu verletzen, ohne dass es ihm dadurch im geringsten schlech-ter ginge (jedenfalls dann, wenn wir davon ausgehen, dass Erniedrigung hier einen objektiven Tatbestand meint und nicht das Gefühl des Ernied-rigtseins, das den meisten Tieren wohl fremd sein dürfte). Das bedeutet aber auch umgekehrt, dass ich die Würde eines Tieres nicht notwendig schon dadurch verletzen würde, dass ich ihm Leiden oder anderweitig Schaden zufüge oder ihm gar sein Leben nehme. Das klingt etwas merk-würdig, spiegelt aber doch eine weit verbreitete Intuition wieder, gemäß derer es schlimmer und weniger entschuldbar ist, ein Tier nicht zu achten als es (etwa zu Nahrungszwecken) zu verletzen und zu töten. Aber wie kann so etwas wie Nichtachtung schlimmer sein als der Tod?
Ich will nun versuchen, dieser Frage anhand dreier literarisch-ethi-scher Beispiele nachzugehen, nämlich J.M. Coetzees Roman Disgrace (1999), Cormac McCarthys Roman The Crossing (1994) und schließlich Albert Schweitzers Selbstzeugnissen (1959).
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 220 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 221
I. J.M. Coetzees Disgrace
Disgrace erzählt die Geschichte David Luries, eines südafrikanischen Literaturprofessors, der in Ungnade fällt und seinen Posten an der Tech-nischen Universität von Kapstadt verliert, als er sich auf ein Verhältnis mit einer Studentin einlässt und sich dann auch noch, als die Affäre be-kannt wird, weigert, öffentlich Reue zu bekunden, um die aufgeregten Gemüter zu beschwichtigen. Er verlässt dann Kapstadt, zieht in die Pro-vinz zu seiner erwachsenen Tochter Lucy und beginnt dort, als Freiwilli-ger in einem Tierheim zu arbeiten, in dem es unter anderem auch regel-mäßig die unangenehme Aufgabe zu erledigen gilt, die Hunde, die sich dort ansammeln und für die sich kein Platz zum Leben finden lässt, zu töten und in einer Tierverbrennungsanstalt zu entsorgen, und es ist Lurie, der nun diese Aufgabe der Entsorgung übernimmt, und zwar aus einem merkwürdigen, ihm selbst nicht ganz verständlichen Gefühl der Verant-wortung gegenüber den getöteten Hunden heraus. Bereits zuvor kommt es zu einem Gespräch zwischen Lurie und seiner Tochter, in dem er ihr von einem Erlebnis erzählt, das sich während ihrer Kindheit ereignete und die menschliche Verantwortung gegenüber dem Tier ins Licht rückt:7
„Als du klein warst, (...) hatten unsere Nachbarn einen Hund. Es war ein Rüde. Immer wenn eine Hündin in der Nähe war, geriet er ganz außer sich, und wurde dann mit Pavlovscher Regelmäßigkeit von sei-nen Besitzern geschlagen. Das ging so lange, bis der arme Hund gar nicht mehr wusste, was er tun sollte. Wann immer er eine Hündin roch, rannte er wild im Garten herum, die Ohren zurückgelegt und den Schwanz zwischen die Beine geklemmt, und versuchte jaulend sich zu verstecken. (...) Dieses Spektakel hatte so etwas Unwürdiges (ignoble) an sich, dass ich daran verzweifelte. Man kann, so scheint mir, einen Hund für Dinge bestrafen, wie etwa einen Hausschuh zu zerbeißen. Der Hund wird das als gerecht empfinden: Schläge für Bis-se. Aber Verlangen ist eine ganz andere Sache. Kein Tier wird es als gerecht empfinden, dafür bestraft zu werden, dass es seinen Instinkten gefolgt ist. (...) Was an dem Spektakel so unwürdig war, ist dass der arme Hund angefangen hatte, seine eigene Natur zu hassen. Er muss-te gar nicht mehr geschlagen werden. Er war schon bereit, sich selbst zu strafen. An diesem Punkt wäre es besser gewesen, ihn zu erschie-
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 221 22.07.14 10:49
222 Michael Hauskeller
ßen. (...) Das hätte er wahrscheinlich den Alternativen, die ihm gebo-ten wurden, vorgezogen: entweder seine Natur zu verleugnen, oder aber den Rest seiner Tage damit zuzubringen, im Wohnzimmer her-umzutappen, zu seufzen, die Katze zu beschnüffeln und fett zu wer-den.“
Dies scheint mir tatsächlich eine Situation zu beschreiben, in der mehr als alles andere die Würde eines Tieres verletzt wird. Im Zentrum der Bewertung stehen offenbar Überlegungen darüber, was (a) für das Tier natürlich ist und was nicht, und was (b) von ihm als angemessen und gerechtfertigt verstanden werden kann, und das eine hängt mit dem an-deren zusammen. Das Tier versteht die Welt aus seiner Natur heraus, was bedeutet, dass eine Welt, in der es für diese keinen Platz gibt, unver-ständlich bleiben muss. Man kann den Hund durch Schläge für ein Ver-gehen strafen, ohne seiner Natur Gewalt anzutun, solange dies in seiner Welt Sinn macht und es ihm möglich ist anders zu handeln, als er es tat. Das Tier kann seine Natur nicht verleugnen, und manche Dinge kann man einfach nicht von ihm verlangen, und wenn man diese zu erzwin-gen sucht, macht man ihm seine eigene Natur zum Feind. Eben hierin besteht die Verletzung seiner Würde, die als schlimmer wahrgenommen wird als die körperliche Züchtigung und sogar als schlimmer als der Tod. Angedeutet wird aber auch, dass selbst wenn es gelingen sollte, ihm diese Natur irgendwie auszutreiben (so dass ihm seine Natur nur deshalb nicht zum Feind wird, weil er keine mehr hat), man ihm damit doch seine Identität genommen hätte und damit das, was ihm sein Leben allererst lebenswert macht. Was hier also angesprochen wird, ist was ich an ande-rer Stelle die biologische oder organismische Integrität eines Lebewesens genannt habe.8
In Coetzees Darstellung wird aber die Würde des Tiers noch weiter gefasst, weil zur Achtung der Würde hier nicht nur ein bestimmtes Han-deln erforderlich ist, sondern auch bereits, und vielleicht mehr als alles andere, eine bestimmte Einstellung oder innere Haltung, die man als Betroffenheit oder Anteilnahme bezeichnen kann. Als die Leiterin des Tierheims, Bev Shaw, Lurie in seine Arbeit einweist, kommt es zu fol-gendem Gespräch über das Schicksal der dort untergebrachten Hunde:9
„Werden sie alle sterben?Die, die niemand will. Wir schläfern sie ein.
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 222 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 223
Und Sie erledigen das selbst?Ja.Macht Ihnen das nichts aus?Es macht mir etwas aus. Es macht mir viel aus. Ich würde nicht wol-len, dass das jemand für mich tut, dem es nichts ausmacht. Sie etwa?“
Artikuliert wird hier das Gefühl, dass es irgendwie einen Unterschied für den Hund macht, wer ihn tötet und ob derjenige, der es tut, am Leben und Tod des Hundes Anteil nimmt oder ob es ihm gleichgültig ist. Vom ethischen Standpunkt her ist also nicht das Töten selbst das Hauptprob-lem, sondern das lieblose Töten, was merkwürdig ist, da es nicht klar ist, ob der Hund selbst diesen Unterschied überhaupt bemerkt. Die Frage, worin denn hier eigentlich der (zusätzliche) Schaden besteht, der dem Tier zugefügt wird, verschärft sich noch, wenn in der Folge Lurie die Kadaver der getöteten Hunde zur Verbrennungsanlage fährt und dann darauf besteht, diese selbst hineinzuwerfen, anstatt das den dortigen Arbeitern zu überlassen. Das Ganze wird so beschrieben:10
„Immer wenn eine Tötungsaktion stattgefunden hat, fährt er den voll-geladenen Kombi am nächsten Morgen (...) zur Verbrennungsanlage und übergibt dort die Körper in ihren schwarzen Säcken den Flam-men. Es wäre einfacher, die Säcke gleich nach der Aktion zur Verbren-nungsanlage zu karren und sie dann dort auf dem Abladeplatz liegen zu lassen mit dem restlichen Ausschuss dieses Wochenendes: mit Dreck aus den Krankenhäusern, Aas von den Straßenrändern, übel-riechenden Abfällen aus der Gerberei, – eine Mischung so zufällig wie furchtbar. Er ist nicht bereit, sie solchermaßen zu entwürdigen.“
Die Aufmerksamkeit wird hier auf den Umgang mit dem toten Körper gelenkt, der immer noch eine gewisse Behutsamkeit zu verlangen scheint. Coetzee spricht von der dishonour, die man den Hunden zufüge, indem man ihre toten Körper wie Müll behandelt, was in diesem Kontext am besten mit dem Begriff Entwürdigung zu übersetzen ist. Aber wie kann man einem Wesen die Würde nehmen dadurch, dass man seinem toten Leib etwas antut? Es erscheint unsinnig, wenn man versucht, das Ganze rein rational zu betrachten. Der Hund ist tot; er spürt nichts mehr; was übrig bleibt, ist nur ein Stück schon im Verfallen begriffener Materie, mit der man alles machen kann, was man will, ohne irgendjemandes
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 223 22.07.14 10:49
224 Michael Hauskeller
Würde (und schon gar nicht die des Hundes) zu verletzen. Merkwürdi-gerweise aber denken wir nicht so, wenn es um Menschen geht. Es ist wenn, dann genauso irrational, dass wir unseren Toten Ehre und Respekt erweisen und nicht stattdessen ihr Fleisch zu Hamburgern, ihre Kno-chen zu Seife und ihre Haut zu Lederjacken verarbeiten. Der Grund, dass wir es nicht tun, ja die bloße Vorstellung einigermaßen entsetzlich finden, ist dass wir den toten Körper immer noch mit dem lebenden identifizieren und wir in ihm den Menschen ehren, dessen Leib er einst war. Wir schützen gewissermaßen das Bild des Menschen, das uns auch noch in dem Toten entgegensieht. Wer den Toten nicht mehr als Men-schen zu sehen vermag (der als solcher einen bestimmten Schutz ver-langt), der wird auch bereits Mühe haben, den lebendigen Menschen als etwas anderes als ein beliebig zu gebrauchendes Ding zu betrachten.11 Und bei Tieren verhält es sich genauso. Im Umgang mit dem toten We-sen spiegelt sich die Einschätzung und Bewertung des lebendigen, so dass wir auch dadurch zur Schaffung einer bestimmten Welt beitragen (wie oben mit dem Hinweis auf den Pragmatismus von William James kurz ausgeführt), die vielleicht (hoffentlich) nicht die ist, in der die meis-ten von uns gerne leben würden. „Warum hat er diesen Job angenom-men“, fragt sich David Lurie in Coetzees Roman:12
„Um Bev Shaw ihre Arbeit zu erleichtern? Dazu hätte es genügt, die Säcke zum Abladeplatz zu bringen und dann wieder davonzufahren. Um der Hunde willen? Aber die Hunde sind tot; und was wissen Hunde ohnehin von Würde und Entwürdigung? Dann eben um sei-ner selbst willen. Um der Idee einer Welt willen, in der Menschen nicht Schaufeln benutzen, um Leichen in eine verarbeitungsfreundli-chere Form zu schlagen. (...) Vielleicht kann er sie nicht retten (...), aber er ist doch bereit, sich um sie zu kümmern, wenn sie außerstande sind, gänzlich außerstande, sich um sich selbst zu kümmern.“
Wenn das, was hier auf dem Spiel steht, die Würde des Tieres ist, dann handelt es sich ganz klar nicht um die dignitas-Würde, die immer mit der Vorstellung eines (wirklich oder vermeintlich) besonders hohen Wer-tes verbunden ist. Die dignitas-Würde ist komparativ: sie ist die Würde des Würdenträgers, dem eine hohe Achtung zukommt, die anderen (dem gewöhnlichen Volk, oder eben dem Tier im Unterschied zum Menschen) abgeht. Sie leitet sich aus einem Vermögen ab, einer Macht,
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 224 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 225
die denjenigen, der sie besitzt, über andere erhebt. Womit wir es hier zu tun haben, ist genau das Gegenteil: die völlige Ohnmacht. Es ist gerade die Verletzlichkeit, das Ausgeliefertsein, die Hilflosigkeit, die Abhän-gigkeit von der Freundlichkeit oder Gnade des anderen, das Hängen über dem Abgrund des Nichtseins, von dem Hans Jonas einst sprach,13 was hier den Grund der Verpflichtung darzustellen scheint. Was sich nicht um sich selbst kümmern kann, darum müssen wir uns kümmern. Achtung, verstanden nicht als bewunderndes Aufsehen, sondern als Schonung und Beistand, gebührt nicht dem Starken, sondern dem Schwachen. Das am leichtesten zu Entwürdigende ist dasjenige, was der Achtung seiner Würde am meisten bedarf. Der Zustand des Todes ist aber derjenige, in dem ein Wesen am hilflosesten ist, wo es gar nichts mehr tun kann und alle Verfügungsgewalt bei anderen liegt. Niemals sind wir der Willkür anderer so ausgeliefert und so auf ihre Gnade (oder vielmehr ihre Achtung) angewiesen wie dann, wenn wir tot sind.
Aber die Hilflosigkeit und Verletzlichkeit ist nicht alles. Wir achten das Hilflose und Verletzliche, weil es nur als solches unserer Achtung wirklich bedarf, aber es wäre keine Achtung, wenn wir nicht auch den Wert in ihm erkennen würden, der absolut ist, indem er jenseits jeden Nutzens liegt, den es für uns haben mag. Dies wird deutlicher in dem zweiten Roman, den ich kurz diskutieren möchte, nämlich Cormac Mc-Carthys The Crossing.
II. Cormac McCarthys The Crossing
The Crossing ist der 1994 erschienene zweite Teil von Cormac McCarthys Border Trilogy. Erzählt wird die Geschichte eines sechzehnjährigen Jun-gen namens Billy, der um 1950 in Texas mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder auf einer Ranch lebt und den wir dabei kennenlernen, wie er einen Wolf jagt, der die Rinder in der Gegend tötet und frisst. Als er ihn schließlich erwischt hat und sieht, dass es sich um eine trächtige Wölfin handelt, beschließt er, sie nicht zu töten, sondern sie stattdessen über die Grenze nach Mexiko zu bringen, woher sie seiner Vermutung nach kommt, und sie dort freizulassen. Warum genau er das tut, wird nicht erklärt; über seine Gründe lässt sich nur spekulieren. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Wölfin trächtig ist, aber wenn Wölfe lediglich als Bedrohung wahrgenommen würden, dann sollte man denken, dass
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 225 22.07.14 10:49
226 Michael Hauskeller
dies nur umso mehr ein Grund wäre, die Wölfin zu töten. Jedenfalls schafft er es dann auch tatsächlich nach Mexiko, wo ihm aber dann die Wölfin weggenommen wird. Er findet sie wieder, in einer Arena an einen Pfahl gebunden und dazu gezwungen, gegen Hunde zu kämpfen, die zum Töten gezüchtet und trainiert wurden und denen sie früher oder später unterliegen muss. Ein erster Versuch, sie zu retten, scheitert, und er wird davongejagt. Doch obwohl er dadurch sein eigenes Leben in Gefahr bringt, gibt Billy nicht auf, sondern holt sein Gewehr und kehrt dann wieder zurück zu dem Ort, an dem die Hundekämpfe stattfinden. Dort angekommen, geht er hinein und erschießt die Wölfin:
„Niemand achtete auf ihn. Er bahnte sich seinen Weg durch die Men-ge, und als er die Estacada erreichte, war die Wölfin allein in der Gru-be und ein erbarmungswürdiger Anblick. Sie war wieder an den Pfahl gebunden und lag zusammengekauert daneben, aber ihr Kopf lag im Dreck und ihre Zunge hing im Dreck und ihr Fell war verfilzt mit Dreck und Blut und die gelben Augen schauten ins Leere. Sie hatte beinahe zwei Stunden lang gekämpft, gegen den größeren Teil aller Hunde, die man zu der Veranstaltung gebracht hatte, und immer ge-gen zwei von ihnen zugleich. (...) Er stieg über die Brüstung und ging auf die Wölfin zu und steckte eine Patrone in die Gewehrkammer und hielt zehn Fuß vor ihr an und hob das Gewehr an die Schulter und zielte auf den blutigen Kopf und feuerte.14“
Warum tut der Junge das? Ist es Gnade oder Mitleid? Mir scheint, es ist mehr als das, nämlich eine gewisse Achtung. Es ist nicht der Schmerz, aus dem er das Tier rettet – dieser wäre ohnehin bald vorbeigewesen –, es ist vielmehr eine Situation der Entwürdigung. Was Billy schützt, ist die Würde dieses Tieres. Um diese zu bewahren oder vielleicht wieder-herzustellen, erschießt er die Wölfin. Aber das reicht noch nicht. Auch der tote Leib muss noch geschützt werden. Als sich die Menge, die sich um ein Vergnügen gebracht sieht, wütend auf ihn stürzen will, überlässt er dem Mann, dem das Fell der Wölfin versprochen war, zum Ausgleich sein Gewehr, wodurch es ihm gelingt, unverletzt zu entkommen. Er nimmt dann den toten Körper der Wölfin und bringt ihn zu einem Platz irgendwo in der Wildnis, um ihn dort zu begraben. Und wie McCarthy nun dieses Begräbnis beschreibt, ist so großartig, so voller unsentimenta-ler Zärtlichkeit, und scheint mir so treffend die geheimnisvolle Verbin-
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 226 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 227
dung herauszustellen, die zwischen Mensch und Tier besteht oder doch bestehen kann und die wir mit dem vielleicht allzu dürren Begriff der Würde des Tieres zu bezeichnen versuchen, dass ich die Passage hier ganz (wenngleich in meiner eigenen, unvollkommenen Übersetzung) zitieren möchte:
„Er hockte sich über die Wölfin und berührte ihr Fell. Er berührte ihre kalten und vollkommenen Zähne. Das Auge, das dem Feuer zuge-wandt war, warf kein Licht zurück und er schloss es mit seinem Dau-men und saß neben ihr und legte seine Hand auf ihre blutige Stirn und schloss seine eigenen Augen so dass er sie in den Bergen rennen sehen konnte, rennen im Licht der Sterne wo das Gras nass war und die nahende Sonne noch nicht die reiche Matrix von Geschöpfen auf-gelöst hatte, die in der Nacht vor ihr vorüberzogen. Wild und Hase und Taube und Maulwurf, alle reichhaltig und zu ihrer Lust in die Luft bestellt, alle von Gott gewollten Nationen der möglichen Welt, und sie war eine und nicht getrennt davon. Wo sie rannte, verstumm-ten augenblicklich die Schreie der Koyoten, als ob man eine Tür vor ihnen zugeschlagen hätte, und alles war Furcht und Staunen. Er nahm ihren steifen Kopf aus den Blättern hoch und hielt ihn, oder er ver-suchte zu halten was nicht gehalten werden kann, was schon in den Bergen gerannt war, zugleich furchtbar und voll großer Schönheit, wie Blumen, die von Fleisch sich nähren. Woraus Blut und Knochen ge-macht sind, was diese selbst aber nicht machen können, auf keinem Altar und durch keine Wunde des Krieges. Von dem wir durchaus glauben können, dass es die Macht hat, die dunkle Gestalt der Welt zu schneiden und zu formen und auszuhöhlen, sicherlich, wenn es der Wind kann, wenn es der Regen kann. Was aber nicht gehalten werden kann niemals gehalten und keine Blume ist sondern schnell und eine Jägerin und der Wind selbst hat Angst davor und die Welt kann es nicht verlieren.15“
Wieder ist es nicht Gnade oder Mitleid, sondern Achtung, oder vielleicht besser noch Ehrfurcht, die aus dieser Beschreibung spricht. Da ist das Erstaunen vor dem Wunder, das uns in jedem Lebewesen begegnet, und dessen wir uns bewusst sein können, ohne dass wir es deshalb verharmlo-sen oder gar verniedlichen müssten. Ein Wolf ist ein schreckliches Ding für sein Opfer, und kann dennoch wunderbar sein. Er repräsentiert, oder
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 227 22.07.14 10:49
228 Michael Hauskeller
vielmehr verkörpert, eine Macht in der Welt, die uns vorangeht und übersteigt, das was „nicht gehalten niemals gehalten“ werden kann und „zugleich furchtbar und voll großer Schönheit“ ist. Diese Macht auch noch in dem toten, ganz und gar ohnmächtigen Tier zu finden und in ihm und seinem Leib zu ehren, das heißt die Würde des Tieres zu achten. Albert Schweitzer nannte das die „Ehrfurcht vor dem Leben“, worauf ich dann jetzt zum Schluss noch kurz zu sprechen kommen will.
III. Albert Schweitzers Selbstzeugnisse
Die Ethik Albert Schweitzers gilt oft als unpraktikabel und deshalb dis-kussionsunwürdig, weil sie Forderungen zu erheben scheint, die nie-mand erfüllen kann. Andererseits aber scheint seine Ethik aber doch wieder, nämlich wenn man Schweitzers eigenes Handeln zum Maßstab nimmt, in der Praxis einen großen Spielraum zu lassen, was den Umgang mit Tieren angeht. Was aber auf den ersten Blick wie eine Inkonsistenz aussehen mag, ist recht besehen durchaus schlüssig, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe.16 Bekanntlich versteht Schweitzer die Ehrfurcht vor dem Leben als das ethische Grundprinzip, was bedeutet, dass jede Verlet-zung und insbesondere jede Vernichtung von Leben für sich selbst ge-nommen ein moralisches Übel darstellt. Es ist leicht zu verstehen, war-um eine solche Ethik für unlebbar gehalten werden kann. Tatsächlich scheint Schweitzer selbst sich dessen durchaus bewusst zu sein:
„Die Notwendigkeit, Leben zu vernichten und Leben zu schädigen, ist mir auferlegt. Wenn ich auf einsamem Pfade wandle, bringt mein Fuß Vernichtung und Weh über die kleinen Lebewesen, die ihn bevölkern. Um mein Dasein zu erhalten, muss ich mich des Daseins, das es schä-digt, erwehren. Ich werde zum Verfolger des Mäuschens, das in mei-nem Hause wohnt, zum Mörder des Insekts, das darin nisten will, zum Massenmörder von Bakterien, die mein Leben gefährden kön-nen. Meine Nahrung gewinne ich durch Vernichtung von Pflanzen und Tieren. Mein Glück erbaut sich aus der Schädigung der Neben-menschen.17“
Wenn das aber so ist, wie kann dann das Töten von Lebewesen mora-lisch schlecht sein? Wenn ich gar nicht anders kann als das Leben
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 228 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 229
anderer zu opfern, um mein eigenes Leben leben zu können, muss ich dann nicht notwendig mein eigenes Leben über das anderer stellen, und allgemeiner das Leben von Menschen über das der Tiere? Wie kann ich die Notwendigkeiten des Lebens eingestehen und Tiere ver-letzen und töten, und zugleich daran festhalten, wie es Schweitzer tut, dass alles Leben gleichermaßen zu achten sei, ob Mensch, Tier oder Pflanze? Und vor allen Dingen auch, wie kann Schweitzer selbst eine solche Ethik vertreten und dann handeln, wie er es tut? In seinen auto-biographischen Schriften berichtet er wiederholt von Geschehnissen, in denen er selbst seinen ethischen Prinzipien zuwider zu handeln scheint.
„Ein Heer von Grillen fängt an zu zirpen und begleitet den Choral, der zu uns herüber dringt. Ich sitze auf einem Koffer und höre ergrif-fen zu. Da kriecht ein hässlicher Schatten an der Wand herunter. Ich schaue erschreckt auf und erblicke eine mächtige Spinne. Sie ist viel größer als die stattlichste, die ich je in Europa gesehen. Eine bewegte Jagd, und sie ist erschlagen.18“
Freilich wird die Spinne hier als Bedrohung wahrgenommen, was sie höchstwahrscheinlich (im Dschungel von Lambarene, wo Schweitzer als Missionsarzt tätig war) auch war, aber es ist dennoch erstaunlich, mit welcher Entschiedenheit hier der Mann, der die Ehrfurcht vor allem Leben auf seine Fahnen geschrieben hat, dem Leben eines Tieres ein Ende bereitet. Von Achtung oder einem Bewusstsein für die Schönheit der Kreatur ist in diesen Zeilen nichts zu spüren. Vielleicht kann man sich diese aber auch in einer solchen Situation einfach nicht leisten. Ruckzuck und ganz unsentimental hat man sich des „hässlichen Schat-tens“ entledigt. Auch mit größeren und uns vielleicht näherstehenden Tieren erweist sich Schweitzer als wenig zimperlich. Als ein Leopard den Hühnerbestand im Lager dezimiert, wird er ohne großes Federlesen ver-giftet, was Schweitzer wie folgt kommentiert:
„Während er sich in Krämpfen wand, wurde er von Herrn Morel erschossen. Kurz vor unserer Ankunft war ein anderer Leopard bei Samkita erschienen und hatte etliche Ziegen zerrissen. Bei Herrn Missionar Cadier aßen wir zum ersten Mal Affenfleisch. Herr Cadier ist ein großer Jäger.19“
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 229 22.07.14 10:49
230 Michael Hauskeller
Selbst Affen zu essen, die eigens zu diesem Zweck getötet wurden, ist Schweitzer sich also nicht zu schade. Er scheint daran nichts Besonderes zu finden, obwohl er sich bewusst ist, dass manche andere „Vorurteile“ gegen Affenfleisch haben und es als Beginn der Anthropophagie anse-hen.
„Seit dem Kriege haben wir uns an das Affenfleisch gewöhnt. Ein Missionar der Station hält sich einen schwarzen Jäger und schickt uns regelmäßig von der Jagdbeute. Der Jäger schickt uns gewöhnlich nur Affen, weil sie das am leichtesten zu erlegende Wild sind.20“
Schließlich geht Schweitzer auch selbst auf die Jagd und tötet im We-sentlichen alles, was seiner Mission im Wege ist:
„In der Hauptsache habe ich mein Gewehr nur, um Schlangen zu schießen, von denen es in Lambarene im Grase um mein Haus herum eine Unzahl gibt, und um die Raubvögel zu töten, die die Nester der Webervögel in den Palmen vor meinem Hause plündern.21“
Mir geht es hier nicht darum, Albert Schweitzer, den ich sehr bewunde-re, als Heuchler zu entlarven, sondern vielmehr darum, ein rechtes Ver-ständnis dessen zu erlangen, was es bedeutet, Ehrfurcht vor dem Leben zu haben oder eben, was mir dasselbe zu sein scheint, die Würde der Kreatur zu achten. Auch wenn Schweitzers scheinbare Unbekümmert-heit etwas verwundern mag, so muss dies doch keineswegs als dem Prin-zip der Ehrfurcht vor allem Leben widersprechend angesehen werden, da sich aus diesem Prinzip eben keine absoluten Handlungsregeln ableiten lassen. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist vielmehr das, was uns der Wür-de der Kreatur, um nun wieder an die gemeinsame Stellungnahme der EKAH und EKTV anzuschließen, Rechnung tragen lässt, und wie wir das im Einzelnen tun, müssen wir selbst entscheiden, und die Entscheidung sollte so getroffen werden, dass wir uns ihrer als einer ethischen bewusst sind:
„Auf dem Boden draußen kriecht eine große Spinne. Ich weiß, dass sie viele Insekten in dem Netz, das sie bereiten wird, fangen, martern und töten wird. Ein Tritt von mir zerquetscht sie und schafft in einem Wesen so viel Qual für viele aus der Welt. Darf ich das? Soll ich das?
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 230 22.07.14 10:49
Was heißt es, die Würde eines Tieres zu achten? 231
Hier kann kein Entscheid gegeben werden, sondern du musst in je-dem einzelnen Fall aus Überzeugung, nach deinem Gewissen handeln und wirst vielleicht das eine Mal so, ein anderes Mal anders tun. (...) Die Entscheide können so oder so ausfallen. Wenn du nur nach Ver-antwortung und Gewissen handelst – und nicht nach Gedankenlosig-keit, bist du im Rechte.22“
Um Abwägungen kommt man nicht herum, und das Verletzen oder gar Töten eines Tieres ist nicht schon selbst eine Verletzung seiner Würde. Worauf es ankommt, ist erstens, dass man sich dessen bewusst bleibt, dass auch das Leben des Tieres für dieses einen Wert hat und dass man ihm dieses nicht ohne guten Grund nimmt, dass man seiner und seiner Bedürfnisse gedenkt und es schont und sich seiner annimmt, wenn es möglich ist. Wann es aber möglich ist, dafür gibt es keine allgemeine Regel, vielmehr muss diese Frage jeweils aus der individuellen Verant-wortung heraus beantwortet werden. Zweitens aber kommt es auch dar-auf an, sich bewusst zu sein, dass das Leben des Tieres auch einen Wert in sich selbst hat: dass es gut oder schön ist, dass es solch ein Wesen gibt. Die Würde des Tieres ist immer mehr als nur die Würde des einzelnen Tieres. Es ist immer auch die Würde des Lebendigen selbst, die wir in dem einzelnen Tier achten und die wir auch noch im Akt seiner Vernich-tung und selbst darüber hinaus, im Umgang mit dem toten Tier, noch achten können.
Anmerkungen
1 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Werkausgabe Bd. VII), Frank-furt am Main 1968, B 77.
2 Vgl. Michael Hauskeller, Biotechnologie und die Integrität des Lebens, Zug/Schweiz: Die Graue Edition, S. 152–158.
3 Überzeugend dargestellt in Heike Baranzke, Würde der Kreatur? Die Idee der Würde im Horizont der Bioethik, Stuttgart 2002, S. 53–81.
4 William James, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, New York/ London/Bombay 1897, S. 59.
5 Michael Hauskeller, Believing in the Dignity of Human Embryos, S. 63–64, in: Human Reproduction and Genetic Ethics 17/1 (2012), S. 53–65.
6 http://www.ekah.admin.ch/fileadmin/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Wuerde_des_Tieres_10.08_d_EV1.pdf
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 231 22.07.14 10:49
232 Michael Hauskeller
7 J.M. Coetzee, Disgrace, London 1999, S. 89–90 (meine Übersetzung). 8 Hauskeller, Biotechnologie, a.a.O. 9 Coetzee, a.a.O., S. 85.10 Coetzee, a.a.O., S. 144.11 Vgl. Michael Hauskeller, Von der heiligen Pflicht, die Toten zu essen, und anderen merk-
würdigen Bräuchen, in: Scheidewege 34 (2004/2005), S. 95–109.12 Coetzee, a.a.O., S. 145–146.13 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt am Main 1989, S. 240.14 Cormac McCarthy, The Border Trilogy, New York 1999, S. 121–2 (meine Übersetzung).15 McCarthy, a.a.O., S. 127.16 Michael Hauskeller, Verantwortung für alles Leben? Schweitzers Dilemma, in: Ders.
(Hg.), Ethik des Lebens. Albert Schweitzer als Philosoph, Zug/Schweiz: Die Graue Edition 2006.
17 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik, München 1923, S. 247–8.18 Albert Schweitzer, Selbstzeugnisse, München 1959, S. 89.19 Ebd., S. 125.20 Ebd., S. 189.21 Ebd., S. 125.22 Albert Schweitzer, Was sollen wir tun? 12 Predigten über ethische Probleme, Heidelberg
1974, S. 48–49.
214-232_HAUSKELLER_Was_heisst_es.indd 232 22.07.14 10:49
ScheidewegeJahresschrift für skeptisches Denken
Herausgeber:Max Himmelheber-Stiftung gemeinnützige GmbH, Reutlingen,in Verbindung mit Prof. Dr. Walter Sauer
Redaktion:Michael Hauskeller, Stephan Prehn, Walter Sauer
Anschrift von Redaktion und Stiftung:Scheidewege, Heppstraße 110, 72770 Reutlingen Telefon: 0 71 21/ 50 95 87; Fax: 0 71 21/ 55 07 76E-Mail: [email protected]: www.scheidewege.de
Von der Einsendung unverlangter Besprechungsexemplare bitten wir abzusehen; für die Rücksendung wird keine Gewähr übernommen. Redaktion und Verlag haften nicht für unverlangt eingereichte Manuskripte.
ISSN 0048-9336ISBN 978-3-7776-2456-3
Verlag:S. Hirzel Verlag, Birkenwaldstraße 44, 70191 StuttgartTelefon: 07 11/ 25 82-0; Fax: 07 11/ 25 82-2 90E-Mail: [email protected]: www.hirzel.de
Alle in dieser Jahresschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung des Werkes, oder Teilen davon, außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Übersetzung, Nachdruck, Mikroverfilmung oder vergleichbare Verfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen.
© 2014 Max Himmelheber-Stiftung, ReutlingenAlle Rechte vorbehalten. Printed in GermanySatz und Druck: Kraft Druck, EttlingenEinband: Großbuchbinderei Josef Spinner, Ottersweier
Scheidewege
Überkommenes wird in unserem Denken im gleichen Maße fragwürdig wie Fortschrittsgläubigkeit: Das Gestern ist nicht zu wiederholen, aber das Morgen kann auch nicht einfach eine verbesserte Form des Heute sein. In die Tradition zu retirieren ist so aussichtslos wie die Hoffnung, daß dem Fortschritt, so wie er derzeit betrieben wird, ein zweckmäßiger Mechanismus der Selbstregulation innewohne, der endlich alles zum Guten wenden werde.
In dieser Situation gibt es niemanden, der für sich in Anspruch nehmen dürfte, Gebrauchsanweisungen geben zu können; die gleichwohl im Umlauf befindlichen, die das Heil in der Programmierung und Planung suchen, müs-sen skeptisch geprüft und ihre Fehler müssen benannt werden. Skeptisches Denken ist auf jene gerichtet, die glauben, den Code des Lebens und des Zusammenlebens entschlüsselt zu haben und daraus schnellfertig die Ver -fahren ihres Handelns ableiten zu können. Skeptisches Denken erbringt Einwände und Einsichten, die nicht immer Weg und Ziel, aber doch eine Richtung anzeigen.
Die Prüfung kann überall ansetzen: Dort, wo das Denken als Philosophie betrieben wird, und dort, wo es, formuliert oder nicht, einem Handeln zugrunde liegt – in der Naturwissenschaft und in der Technik, in der Anthropologie und in der Pädagogik, in Politik und Soziologie –, kein Bereich, in dem nicht ältere oder brandneue Gebrauchsanweisungen gültig wären, die der Prüfung bedürfen.
Diese Aufgabe haben sich die „Scheidewege“ gestellt. Die Vielfalt der mög lichen Themen, in denen kein Bereich des Lebens ausgespart sein kann, hat ebensolche Vielfalt der Form zur Folge: sie reicht vom Essay bis zur Polemik, von der Beschreibung bis zur Mahnung, von der Rezension bis zum Bekenntnis – das heißt: von der Meditation bis zum Kampf.
S. Hirzel Verlag
ISSN 0048-9336ISBN 978-3-7776-2456-3