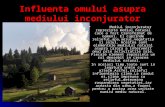Referat Mehringplatz Niklas Kuckeland
-
Upload
udk-berlin -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Referat Mehringplatz Niklas Kuckeland
Der Mehringplatz
Neubau durch Hans Scharoun und Werner Düttmann
Der Mehringplatz ist ein historischer Platz Berlins dessen
Wohnquartier aus den späten 60er Jahren und anfangenden 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Entworfen und geplant
wurde er von Hans Scharoun und Werner Düttmann.1 Der
geschichtliche Kontext des Platzes reicht bis in das 18 Jh. zurück.
Er ist nach dem barocken Stadtkonzept Friedrich Wilhelm I im
Kontext der Friedrichstadterweiterung entstanden. Direkt hinter
der Zollmauer befindlich bildete er zusammen mit dem
Halleschen Tor als Zolltor das südliche Ende der Stadt. Nach
seiner runden Form benannt bildete das damalige Rondell
zusammen mit dem Carrée, heute Pariser Platz und dem Oktogon,
heute Leipziger Platz, ein Platz Ensemble. Der Platz war
Endpunkt für die drei auf ihn zulaufende Straßen, Wilhelmstraße,
Friedrichstraße und Lindenstraße.2 Mit beginn des 19 Jh.
verbreitete sich ein neuer Typus. Die Mietskaserne verwandelte
die Stadt in eine "fünfgeschossige Fläche mit eingeschnittenen
Straßen, Höfen"3 und vereinzelt auch Plätzen wie dem
Mehringplatz. Im zweiten Weltkrieg wurde das Stadtgebiet um
den Mehringplatz jedoch fast vollständig zerstört4, sowie ein
Großteil der restlichen Stadt, zusätzlich wurde ein weiterer Teil
der Bausubstanz im Hinblick auf den Wiederaufbau zerstört5. Es
war ein Wiederaufbau erforderlich, welcher in den ersten Jahren
jedoch unterschiedlich nach alten und neuen Konzepten
ausgeführt wurde. Der Architekt Hans Scharoun sah die
Möglichkeit die Stadt neu zu gestalten und das städtische neu zu
definieren. Als Stadtbaurat bereits 1945 eingesetzt konnte Hans
Scharoun für seine Vision der Stadt aber keinen halt finden und
1 Berlin und seine Bauten 1974 S.5942 Projekt Mehringplatz 1994 S.63 Vgl.: Berlin und seine Bauten 1974 S.24 Siehe Bild 15 Projekt Mehringplatz 1994 S.10
1
wurde schon 1947 wieder abgewählt.6 Er lehrte daraufhin
Städtebau an der TU-Berlin. Im Hauptstadt Berlin Wettbewerb
von 1958 bei dem er den zweiten Preis belegte werden seine
Vorstellungen markant sichtbar. Die Blockrandstruktur der
Mietskaserne welche im vorigen Jahrhundert das Stadtbild prägte
ist völlig verschwunden, an deren stelle sind große Grünanlagen
und freistehende Gebäudekomplexe gerückt. Der Begriff der
bewohnbaren Stadtlandschaft ist charakteristisch geworden für
diese deurbanisierte, gegliederte und aufgelockerte Stadt. Der
Wohnraum sollte als im Zeilenbau ausgeführte Großsiedlungen in
einem Gartenstadtkonzept entstehen. Für die Infrastruktur war im
Stadtzentrum eine Rahmung aus vier Autobahntangenten geplant,
welche eine autogerechte Stadt schaffen sollten.7 8Die
Autobahnplanung war eine Vorgabe des Senats, die noch bis in die
70er Jahre verfolgt wurde. Die Realisierung dieses Stadtplans von
Scharoun sowie der Autobahn blieb jedoch aus.
1962 wurden Scharoun und fünf weitere Preisträger des
Wettbewerbs schließlich zu einem Gutachten für das Gebiet des
Mehringplatzes gebeten.9 Auf dem 12,5 ha großem Gebiet sollten
rein wirtschaftliche Funktionen untergebracht werden. Immer
noch aktuell war die sechsspurige Südtangente der Autobahn,
welche nur ein Stück nördlich des Mehringplatzes entstehen
sollte. Scharoun Entwurf sah die Verwendung der historischen
Kreisform als Zentrum des Projekts vor, eine doppelte niedrige
Ringbebauung um den Mehringplatz, als Ende der Friedrichstraße
und der Friedrichstadt mit angebundenen Hochhäusern und
dazwischen liegenden Parkanlagen.10 Wilhem- und Lindenstraße,
welche ursprünglich auf dem Platz endeten sollten mit jeweils
einem Knick zugunsten einer verkehrsfreien Zone im Westen und
Osten am Gebiet vorbei geführt werden und der Erschließung
dienen, die Friedrichstraße dagegen sollte als Fußgängerzone bis
6 Hans Scharoun 1993 S.87/887 Projekt Mehringplatz 1994 S.118 Siehe Bild 29 Projekt Mehringplatz 1994 S.12
2
auf den Platz weiter geführt werden und eine Art Achse durch das
Quartier bilden. 1966 begann der Bau eines der angebundenen
Hochhäuser, der AOK-Zentrale, als erstes Gebäude des Projekts.
Das an der Wilhelmstraße gelegene 16-geschössige Gebäude ist
das einzige von Scharoun geplante und umgesetzte Gebäude am
Mehringplatz, denn zwei Jahre später also 1968 übernahm Werner
Düttmann die Planung.10 Werner Düttmann, ab 1947 Schüler von
Scharoun an der TU, arbeitete ab 1951 im Entwurfsamt der
Berliner Bauverwaltung. 1953 wurde er zum Regierungsbaurat
und 1960 zum Senatsbaudirektor von West-Berlin berufen, seit
1953 arbeitete er auch mit Unterbrechungen als freier Architekt.11
Unter Düttmanns Planung wechselte die Funktion des
Mehringplatzes grundlegend. Ein Quartier aus sozialem
Wohnungsbau mit Altenheim, Kita und Gemeinschaftshaus war
am entstehen.12 Der Berliner Wohnungsbau bestand zu dieser Zeit
aus rund 90% sozialem Wohnungsbau13 und politische Instanzen
wie jene Düttmanns hatten daher eine sehr große Rolle beim
Wiederaufbau.
Scharouns Straßenführung fand weiter Verwendung, sowie die
historische Kreisform des Platzes mit zwei umschließenden
Ringgebäuden. Nach Norden und Osten sollte der entstehende
Autobahnlärm durch hohe Zeilenbauten abgeschirmt werden. Es
handelt sich also um eine Kreisform, die im Nordosten wie von
einem Quadrat gerahmt wird14. Insgesamt wurde das Gebiet
verdichtet und die Bebauung erhöht. Es war Düttmanns versuch
zu einer neuen stadträumlichen Qualität, abseits der
Großsiedlungen vor der Stadt und der Stadtlandschaft in der Stadt
zu kommen.15 Die Zweiteilung des Platzes, wie sie auch vor dem
Krieg bestand wurde übernommen und stellt eine Weiterführung
der Friedrichstraße als Fußgängerzone dar. Die beiden
10 Projekt Mehringplatz 1994 S.1211 Werner Düttmann 1990 S.15/8812 Projekt Mehringplatz 1994 S.1213 Berlin und seine Bauten 1974 S.7914 Siehe Bild 3/415 Vgl.: Werner Düttmann 1990 S.192
3
entstehenden Hälften sind Begrünt und mit Bäumen bepflanzt,
sodass zwischen Platz und Balkonen der Umbauung, sowie
zwischen den in der Kreisbebauung sich gegenüberliegenden
Parteien eine Sichtbarriere entsteht, die Privatsphäre schafft. Die
Abgrenzung des Platzes und seiner Funktion als Grünfläche zur
angrenzenden Ringstraße entsteht nicht nur durch die
Kreisbebauung sondern auch durch einen geringen
Höhenunterschied der von einem umlaufendem Weg zum Platz als
Gefälle oder Stufen ausgebildet ist. Nach Außen läuft der Platz
unter dem aufgeständertem inneren Kreisgebäude aus und geht
schließlich in die Ringstraße zwischen den Kreisbauten über.
Dieser Ring ist als einseitige Ladenstraße ausgeführt. Während
beim historischen Rondell die im Erdgeschoss der umliegenden
Gebäude befindlichen Geschäfte oder Cafés als zum Platz
dazugehörig gesehen werden können besteht beim modernen
Mehringplatz also eine Differenzierung zwischen Platz und
Ladenstraße, auch wenn sich die Ladenstraße zum platz hin
öffnet. Wie auf dem Platz ist auch in der Ladenstraße der
öffentliche Raum der Fußgängerzone vom privatem Raum der
Balkone und Wohnungen des äußeren Ringes geschickt von
einander getrennt. Oberhalb der Läden im Erdgeschoss springt die
erste Etage hervor, und die darüber liegenden Etagen ziehen sich
ein weites Stück zurück. Die oberen Etagen trete also gegenüber
der Ladenstraße in den Hintergrund, was durch den
vorspringenden Balkonring verstärkt wird. Zusätzlich gibt es
auch hier eine Bepflanzung mit Bäumen, deren Baumkronen auf
Höhe der ersten Etage einen Sichtschutz nach Unten sowie nach
Oben bieten. So bleiben Ladenstraße und Wohnungsbereich
getrennt und sichern sich spürbar ein Stück Privatsphäre. Im
Norden des Kreises, da wo die Friedrichstraße seit gut hundert
Metern als Fußgängerzone verläuft um dann die beiden
Ringbauten zu durchbrechen ist der einzige Punkt, wo Platz,
Ringstraße und verlängerte Friedrichstraße direkt aufeinander
treffen. Hier ist auch der Zugang für die U-Bahnstation Hallesches
4
Tor. Es bildet sich eine Art Zentrum des Quartiers ab, durch das
die verlängerte Friedrichstraße läuft und das gesamte Areal in
zwei teilt. Den nördlichen Zugang bildet ein Spalt aus zwei
Gebäude der umrahmenden Zeilenbauten. Die Wirkung eines
Zugangs bleibt durch fehlende Symmetrie jedoch aus, der
Übergang tritt eher unbewusst ein. Am südlichen Ende der
Fußgängerzone wird der Zugang vom unteren Teil des inneren
Ringgebäudes gebildet. Das Gebäude spannt sich wie eine Brücke
über die Fußgängerzone und bildet so ein Tor mit dem südlichsten
Teil der Fußgängerzone als Vorplatz. Links und Rechts dieses
Zugangs bilden zwei breite Grünstreifen entlang des
Landwehrkanals einen offenen Übergang, ganz im Gegenteil zu
den hohen Zeilenbauten im Norden und Osten. Im Norden
entstehen zwischen der inneren Kreisform und der eckigen
Rahmung der Zeilenbauten Höfe, welche als einzige Weg- oder
Hofflächen nicht in öffentlicher Hand sind.16 Der westliche Hof
öffnet sich zur Wilhelmstraße und dient als Parkplatz und der
Erschließung über eine einfallende Straße. Diese Seite wird vom
AOK-Gebäude dominiert welches hier direkt an der Straße liegt.
Der östliche Hof, von allen Seiten umschlossen, ist eher als
privater Park für die Anwohner zu sehen, vor allem für das
Altenheim, welches den Hof im Süden begrenzt. Trotz
Wegführung und Bepflanzung wirkt der Ort etwas willkürlich und
undefiniert, befindet er sich heute jedoch auch nicht mehr in
seinem originalem Zustand welcher weitaus weniger Begrünung
vorsah. Durch die fehlende Funktion abseits der Parkfläche wirkt
das große Areal unbelebt.
Die Architektur der Gebäude ist insgesamt sehr plastisch,
abgesehen vom AOK-Gebäude, welches auch nicht wie die
anderen als Plattenbau sondern als Stahlskelettbau ausgeführt
wurde ist dies eins der Hauptcharakteristika der Bebauung. Der
innere Viergeschossige Kreisbau setzt sich aus aneinander
16 Projekt Mehringplatz 1994 S.28
5
gereihten Zweispännern zusammen. Insgesamt befinden sich hier
100 3 2/2 Zimmer Wohnungen mit jeweils 106m².1718 Das
Erdgeschoss ist bis auf die Treppenhäuser als Kern aufgeständert
und öffnet so die Ladenstraße zum Platz hin ohne sie zu stark zu
verbinden. Es fehlt diesem Übergang jedoch, wie dem großem
Innenhof an Funktion oder Nutzung und er wirkt leer, kahl und
vor allem dunkel. Die Fassade besteht zur Ladenstraße hin aus
einem Wechsel von verschieden starken Vor- und Rücksprüngen,
die sich horizontal rhythmisch wiederholen.19 So tritt der Kern mit
dem Treppenhaus beziehungsweise den sich links und recht davon
befindlichen Küchen stark hervor was auch im Grundriss gut zu
sehen ist. Die angrenzenden Räume treten wieder zurück und die
danach wieder hervor, so wird der Innenraum nach Außen
abgebildet. Im Bereich der Treppenhäuser ist die Fassade eher
geschlossen, da sich hier Küchen und Badezimmer befinden. Der
aufgeständerte Bereich weist auf beiden Seiten größere Fenster
auf, so dass der Innenraum von Licht durchflutet wird. Auf der
Innenseite befinden sich Balkone, die nach hinten versetzt sind
und sich farblich abtrennen, die Wohnungen werden über sie zum
Platz hin geöffnet.
Der äußere Ring tritt bis auf die erste und zweite Etage wie bereits
erwähnt stark zurück und ist bis auf diese wie der innere Ring
durch rhythmische Vor- und Rücksprünge, welche die innere
Raumsituation widerspiegeln gestaltet. Den Läden im
Erdgeschosses fehlt es am Gegenüber. Die Öffnung zum Platz ist
schön jedoch würden die Ladenstraße wahrscheinlich mehr von
einer beidseitigen Ladensituation profitieren. Die zweite Etage mit
seinem hervorspringenden Balkonring erkauft sich seine Funktion
als Abgrenzung der oberen Etagen zur Ringstraße mit einer im
Vergleich zu den restlichen Wohnungen größeren Raumtiefe von
ca. 15 Metern. Dadurch, und durch die Tatsache, dass die Fenster
von den Bäumen stark verschattet werden könnte es zu
17 Berlin und seine Bauten 1974 S.59718 Siehe Bild 519 Siehe Bild 6
6
Belichtungsproblemen kommen20, worüber ich jedoch keine
weiteren Informationen habe. Die oberen Etagen des
sechsgeschossigen Rings setzten sich aus Dreispännern zusammen
die aus 1 und 3 Zimmer Wohnungen bestehen.2122 Im Süden ist das
Gebäude über ca. 1/3 des Kreises unterbrochen, um Raum für die
Grünstreifen entlang des Landwehrkanals zu schaffen. Im Osten
geht daher das Altenheim in einem Knick nach außen vom Kreis
ab und beendet diesen so bevor er sich schließen kann. Im Westen
geschieht das Gleiche durch das AOK-Gebäude.
Der Schallschutz gegenüber der geplanten Autobahn im Norden
und Osten besteht aus drei großen Zeilenbauten, die das Quartier
dort wie eine Mauer abgrenzen und Rahmen. Eine Zeile beginnt
im Nordwesten von wo sie nach Osten verläuft bis sie auf die
Verlängerung der Friedrichstraße trifft, von der sie orthogonal
geschnitten wird. Auf der gegenüber liegenden Seite setzt ein
zweiter L-förmiger Bau an, der den ersten bis an die Nordöstliche
Kante fortsetzt, wo er seinen Knick hat. Die dritte Zeile setzt von
dort nach Süden fort. Der erste Zeilenbau hat 10-17 Geschosse
und einen höheren Kern der zu den Seiten abfällt, der L-förmige
Bau hat 10-19 Geschosse und erhöht sich von den Seiten her zu
seiner Ecke, die dritte Zeil hat 13-16 Geschosse und fällt nach
Süden hin ab.23 Sie bestehen jeweils aus einer gereihten oder
gestaffelten Form von Blöcken, die durch tiefe Einschlitze zu den
Fluren von einander getrennt sind.24 Die Einschlitze sind farblich
und materiell von den vorstehenden Blöcken getrennt. Die
Zeilenbauten heben sich äußerlich stark von den Ringbauten ab.
Während bei letzteren die Fenster in die Fassade eingesetzt sind
und mit ihr auf einer Ebene liegen sind bei den Zeilenbauten die
Fenster in den Blöcken in einem Gitter aus Decken und
Wandscheiben eingedrückt. So ergibt sich eine sehr offene und
plastische Gestaltung, eine Oberfläche, in der die Fenster als
20 Siehe Bild 721 Berlin und seine Bauten 1974 S.59722 Siehe Bild 823 Berlin und seine Bauten 1974 S.595/59624 Siehe Bild 9-11
7
Einbuchtungen den tragende Rahmen aus Platten hervorheben.25
Dies wird durch eine Verstärkung der Decken- und Wandplatten
mit Hilfe einer vorgesetzten Blende an der Außenseite der
Balkone betont.26 Die gesamte nach innen gewandte Seite dieser
Gebäude besteht daher praktisch aus Balkonen und dahinter
liegenden raumhohen Fenstern. Die Außenseite zeigt sich
geschlossener27, zwar gibt es auch hier Bereiche die mit der
offener Gitterstruktur und Balkonen hervorstehen, jedoch
großteils Zimmer mit kleineren normalen Fenstern, welche auf der
Innenseite gar nicht vorkommen. Außen befindet sich auch die
Erschließung der Gebäude mit Treppenhäusern, vereinzelten
Laubengängen und Gebäudeeingängen.
Insgesamt lässt sich sagen, das die plastische Architektur ihre
Qualitäten hat sich das Gebiet aber nur nach Süden hin öffnet und
nach Norden zu sehr abschottet, was zu einer Abkopplung von der
restlichen südlichen Friedrichstadt führt. Da sich die politische
Situation sowie das städtebauliche Vorgehen seit dem Bau stark
verändert haben wird das Gebiet heute häufig negativ Aufgefasst.
Nicht Blockrandbebauung gilt oft als für den historischen Kontext
unangemessen. Hinzu kommt, dass die geplante
Autobahntangente nie gebaut wurde und die Zeilenbauten daher
ihren Zweck nicht erfüllen können sondern das Gebiet heute nur
unnötig abgrenzen. Außerdem ist der Anschluss an den Rest der
Friedrichstadt noch nicht ganz vollzogen was den Mehringplatz
zusätzlich Isoliert. Trotzdem überwiegen für mich die positiven
Eigenschaften, die vielen Grünflächen, die Ausführung als
verkehrsfreie Zone, die starke Öffnung der Wohnungen durch
große Fensterflächen und Balkone und die Schaffung von
Wohnraum im Stadtzentrum.
25 Siehe Bild 926 Siehe Bild 1227 Siehe Bild 13
8
Bilder
(für genaue angaben zu Buchtiteln und Autoren siehe
Literaturverzeichnis)
1. Luftaufnahme nach den
Abräumarbeiten 1954
aus:
Projekt Mehringplatz S.10,
Berlin 1994
Wettbewerb Hauptstadt Berlin,
Hans Scharoun 1958
aus:
Projekt Mehringplatz S.11,
Berlin 1994
9
Axonometrie
aus:
Werner Düttmann S.198, Basel
1990
Luftaufnahme 1975
Internet:
http://abload.de/image.php?
img=mehringplatz_luftaufn86s76.
jpg
[Zugriff 03.09.2014]
Grundriss Innenring
aus:
Berlin und seine Bauten S.597,
Berlin 1974
10
Fassade des Innenrings zur
Ladenstarße 03.09.2014
Google Streetview Aufnahme der
Ladenstraße Juli 2008
[Zugriff 03.09.2014]
Grundriss Außenring
aus:
Berlin und seine Bauten S.597,
Berlin 1974
11
Innenfassade Zeilenbau an der
Franz-Klühs-Straße (L-förmiger
Bau)
03.09.2014
Grundriss Zeilenbau Ecke
Wilhelmstraße, Franz-Klühs-
Straße
aus:
Berlin und seine Bauten S.595,
Berlin 1974
12
Literaturangaben
Nagel, Wolfgang; Stimmann, Hans; Burtin, Justus: Projekt
Mehringplatz - [kooperatives Planungsverfahren zur Ergänzung
und kritischen Rekonstruktion des Bereiches Mehringplatz,
Lindenstraße, Friedrichstraße, Wilhelmstraße, Hallesches Tor],
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, Berlin
1994
Riedel, Robert; Schmidt-Thomsen, Jörn-Peter; Heinrich, Ernst;
Saar, Heinz; Halbach, Bernd; Cante, Marcus; Lemburg, Peter;
Bodenschatz, Harald: Berlin und seine Bauten. Teil IV
Wohnungsbau; Band B, Die Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser,
Berlin 1974
Ochs, Haila: Werner Düttmann : verliebt ins Bauen ; Architektur
für Berlin 1921-1983, Basel 1990
Geist, Johann Friedrich; Kürvers, Klaus; Rausch, Dieter:
Hans Scharoun, Chronik zu Leben + Werk, Akademie der Künste,
Berlin 1993
15