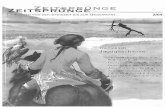Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes von Alsónyék-Bátaszék,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes von Alsónyék-Bátaszék,...
58 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
I. Abhandlungen
István Zalai-Gaál, Erika Gál, Kitti Köhler, Anett Osztás, Kata Szilágyi
Präliminarien zur Sozialarchäologiedes lengyelzeitlichen Gräberfeldesvon Alsónyék-Bátaszék, Südtransdanubien1
Abstract: Im Beitrag wird der südtransdanubische Fund-
platz Alsónyék-Bátaszék (Ungarn) vorgestellt, auf dem in
den Jahren 2006–2009 nahezu 2500 Bestattungen und
60 Langhäuser der spätneolithisch-frühkupferzeitlichen
Lengyel-Kultur ergraben und dokumentiert werden konn-
ten. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht das der
frühkupferzeitlichen Lengyel-Kultur zuzuweisende Grab
5603/927 mit der Bestattung eines Mannes. Dem Toten wa-
ren zahlreiche Beigaben in das Grab gegeben worden, un-
ter anderem eine Steinaxt, ein Steinbeil und Silexmesser
aus Importmaterial, ferner Kollektionen von Silexklingen
und Trapezen sowie Geweih- und Knochengegenstände/-
geräte (Geweihaxt, Schulterblatt und Geweihstab). Die
auftretenden Gerätespektren werden gegliedert und ihre
Stellung in der sozialen Hierarchie dieser wie auch ver-
gleichbarer Gemeinschaften gedeutet. Für die Bestattung
wird der Beleg geführt, dass der hier beigesetzte ältere
Mann zu Lebzeiten sowohl auf örtliche und regionale Roh-
materialbezugszonen als auch auf jene des Fernhandels
Zugriff hatte und wohl als Person zu deuten ist, die im
Gefüge seiner Zeit eine bedeutende soziale Stellung ein-
nahm. 1
Keywords: Südtransdanubien; frühe Kupferzeit; Lengy-
el-Kultur; Hockerbestattung; Häuptlingsgrab; Totenhütte;
Geweihstab; Balgkratzer; Fernhandel.
Abstract: Cet article présente le site d’Alsónyék-Bátaszék
en Transdanubie méridionale (Hongrie) où, de 2006 à
2009, furent fouillées et documentées près de 2500 sépul-
tures et 60 maisons longues de la culture de Lengyel du
Néolithique tardif et du Chalcolithique précoce. Nos ob-
servations visent surtout la sépulture masculine 5603/927
1 Die vorliegende Arbeit ist ein Ergebnis interdisziplinärer Forschun-gen (Urgeschichte, Anthropologie, Archäozoologie und Silexkunde)des neolithischen Teams am Archäologischen Institut der Unga-rischen Akademie der Wissenschaften Budapest. Zeichnungen: Fio-rella Tortoriello und Kata Szilágyi, Fotos: Fanni Fazekas.
que l’on peut attribuer à la phase chalcolithique précoce
de la culture de Lengyel. De nombreux objets avaient été
déposés auprès du défunt, entre autres une hache perfo-
rée en pierre, une hache en pierre et un couteau en silex
importé (de Volhynie), des séries de lames et trapèzes en
silex ainsi que des objets/outils en os et bois de cerf (hache
et bâton en bois de cerf, omoplate). Les éventails d’outils
en présence sont classés et l’on interprète ensuite leur rôle
dans la hiérarchie sociale de cette communauté et d’autres
qui lui sont comparables. Il est établi que l’homme âgé en-
terré ici avait accès de son vivant à des zones de matiè-
res premières locales et régionales ainsi qu’aux réseaux
d’échanges à longue distance. Il s’agit vraisemblablement
d’une personne qui occupait une position influente dans
la société de son époque.
Keywords: Transdanubie méridionale; Chalcolithique
précoce; culture de Lengyel; sépulture contractée; hutte
funéraire; bâton en bois de cerf; grattoir à peau; com-
merce à longue distance.
Abstract: This article presents the South Transdanubian
site of Alsónyék-Bátaszék (Hungary) where nearly 2500
burials and 60 longhouses of the Late Neolithic–Early
Copper Lengyel Culture were excavated and documented
from 2006 until 2009. The focus of the article is on grave
5603/927 – the burial of a man attributed to the Early
Copper Lengyel Culture. Numerous grave goods were
present in his grave, among them a stone axe, a stone adze
and silex knife made from imported material, as well as
collections of silex blades and trapezes, antler and bone
objects/tools (antler axe, scapula and antler staff). The
paper categorises the tools and interprets their signifi-
cance in the social hierarchy of this society and in com-
parable societies. Evidence is presented that the older
man buried here held an important social position during
his lifetime, someone who had access to local and regional
sources of raw materials and also engaged in long-dis-
tance trade.
DOI 10.1515/pz-2012-0004 Praehistorische Zeitschrift 2012; 87(1): 58–82
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 59
Keywords: South Transdanubia; Early Copper Age; Len-
gyel Culture; flexed burial; chieftain’s grave; mortuary
house; antler staff; hide scraper; long-distance trade.
Prof. Dr. István Zalai-Gaál: Forschungszentrum für Humanwissen-schaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Archäolo-gisches Institut. H-1014 Budapest, Úri u. 49. E-mail: [email protected]. Phil. Erika Gál: Forschungszentrum für Humanwissenschaftender Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Archäologisches In-stitut. H-1014 Budapest, Úri u. 49. E-mail: [email protected] Köhler: Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Un-garischen Akademie der Wissenschaften, Archäologisches Institut.H-1014 Budapest, Úri u. 49. E-mail: [email protected] Osztás: Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Un-garischen Akademie der Wissenschaften, Archäologisches Institut.H-1014 Budapest, Úri u. 49. E-mail: [email protected] Szilágyi: Móra Ferenc Múzeum, H-6720 Szeged, Roosevelt tér1.3. E-mail: [email protected]
Zu den Rettungsgrabungen auf demFundplatz Alsónyék-Bátaszék
In den Jahren 2006–2009 wurden bei der Stadt Bátaszék
nahezu 2500 Bestattungen und 60 Langhäuser der spät-
neolithisch-frühkupferzeitlichen Lengyel-Kultur ergraben
und dokumentiert2. Forschergruppen mehrerer Institutio-
nen nahmen Rettungsgrabungen an insgesamt fünf Stel-
len vor. Die Mehrzahl der Funde und Befunde der Lengy-
el-Kultur stammt dabei von den Fundstellen M6-To-10B
und M6-To-5603, die durch das Forschungsteam des Ar-
chäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften ergraben wurden3.
Auf den benannten zwei Fundstellen fanden sich len-
gyelzeitliche Bestattungen über mehrere kleinere Gräber-
ensembles und Gruppierungen verteilt. Die Mehrzahl der
Toten waren – wie es auch sonst üblich ist – in Hockerstel-
lung beigesetzt. Gefäßbestattungen von Säuglingen und
Kleinkindern4, Brandbestattungen und symbolische Be-
2 Die Verfasser dieses Beitrages haben an unterschiedlichen Stel-len bereits mehrfach über den Fundplatz berichtet, doch erlaubendie Grabungen darüber hinaus Antworten auf ein umfangreichesSpektrum wissenschaftlicher Fragestellungen, die bislang nur spo-radisch thematisiert wurden und daher auch an dieser Stelle behan-delt werden sollen: Zalai-Gaál 2010b; ders./Osztás 2009; Zalai-Gaálu.a. 2009; Zalai-Gaál u.a. 2010.3 Rettungsgrabungen an der Autobahntrasse M6 im Komitat Tolna.Koordinaten des Fundortes: x (N-S): 96.100, y (W-O): 623.320.4 Zalai-Gaál 2010b.
stattungen konnten in nur geringer Zahl nachgewiesen
werden. Bei einigen Frauenskeletten wurden Schwanger-
schaften festgestellt5, und in mehreren Fällen gelangen
Nachweise postmortaler Praktiken (Schädelkult)6. Im Fol-
gendem wird Grab 927 von Fundstelle 5603 eingehend
vorgestellt, anthropologische Untersuchungen werden
dargelegt und sich ergebende Schlüsse zur sozialen Stel-
lung des Bestatteten erläutert.
Form und Beigaben von Grab5603/927
Die in Nordost-Südwest-Richtung ausgerichtete, 230 cm
lange und 163 cm breite Grabgrube besaß einen unregel-
mäßig rechteckigen Grundriss mit abgerundeten Ecken.
Die steilwandige Grube wurde bis in die untere Löss-
schicht eingetieft, ihre Grabsohle war eben. Als Beson-
derheit konnte in jeder Grubenecke jeweils eine kleinere
Grube nachgewiesen werden, für die eine Interpretation
als Pfostenloch naheliegt7. Von der Grabsohle aus gerech-
net waren diese noch zwischen 14,9 und 16,0 cm in den
Untergrund eingetieft. Typologisch rechnet die Grabgrube
zur Umrissform A3, Variante A3a und Untervariante A3a1
der Lengyel-Gräber mit Pfostenstellung (Abb. 1)8.
Im Grab lag in linksseitiger Hockerlage das Ost-West-
orientierte, gut erhaltene Skelett eines 50–59 Jahre alten
Mannes. Sein linker Arm war vor die Brust gezogen, wäh-
rend sich der rechte Arm in rechtwinkeliger Beugung auf
den Rippen befand. Die Beine waren parallel zueinander
ausgerichtet und dabei leicht geöffnet. Bedeutsam ist die
Beobachtung, dass das Skelett nicht unmittelbar auf der
Grubensohle platziert war, sondern auf einer mehr als
10 cm hohen, podiumsartigen Schicht ruhte (Abb. 2).
Zum Grabinventar der Bestattung zählen eine Reihe
von Gegenständen. So fand sich hinter dem Schädel des
Mannes eine sehr fein geschliffene, mächtige schwere
5 Ders. 2007b.6 Ders. 2009.7 Ders.u.a. 2011c. Die nordöstliche Pfostengrube besaß eine unre-gelmäßig ovale Form und vertiefte sich mäßig steil in den Löss hinein(Breite oberer Bereich: 70,3 × 67,3 cm, unterer Bereich: 46,7 ×42,2 cm), die südöstliche Pfostengrube wies einen ovalen Grundrissauf (Breite oberer Bereich: 66,3 × 54,2 cm, unterer Bereich: 48,7 ×35,6 cm), die nordwestliche Pfostengrube zeigte eine nahezu rundeForm (Breite oberer Bereich: 65,3 × 60,8 cm, unterer Bereich: 43,2 ×39,6 cm), während die südwestliche Pfostengrube von ovaler Form-gebung war (Breite oberer Bereich: 56,2 × 53,7 cm, unterer Bereich:49,7 × 37,1 cm).8 Ebd.
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
60 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Schaftlochaxt aus dunkelgrauem Gestein. Ihre Form äh-
nelt der einer doppelschneidigen Axt, die Breitseiten sind
nicht gewölbt, die Unter- und Oberseite ist sogar völlig
eben. Ihre breiten Schmalseiten sind gekonnt gerundet.
Die schmale Nackenpartie ist abgenutzt, die Schneide ver-
jüngt sich geschweift (Abb. 3 und 4)9.
Auf der Steinaxt lag ein 92,5 mm langes und 13,8 mm
breites, schwarzes Silexmesser aus Wolhynien-Feuerstein
(Abb. 3; 7,1). In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen,
dass die längste Silexklinge des Fundplatzes – ein Messer
aus ebensolchem Feuerstein – aus dem „Häuptlingsgrab“
10B/3060 stammt und ganze 247 mm lang und 37 mm breit
ist. Im Rücken des Toten lagen ferner ein kleines Ensem-
ble von elf geschlagenen Steingeräten (Abb. 5). Nördlich
davon kam das Fragment eines bearbeiteten Hirschge-
weihs zum Vorschein, dessen östliches Ende auf einem
größeren Tierknochen ruhte (Abb. 3).
9 Absolute Länge: 114,37 mm, größte Breite: 48,12 mm, größteDicke: 37,77 mm, Schaftloch Dm.: 21,69 mm und 20,53 mm.
Weitere 20 der Spaltindustrie zurechenbare Steingeräte
sowie ein zerbrochenes Knochengerät fanden sich neben
dem Becken (Abb. 6). Ein Geweihstück lag teilweise
auf der Steinaxt; ein weiteres, bearbeitetes Geweihstück
konnte hier zusätzlich geborgen werden. Auch ein kleiner
geschliffener weißer Steinkeil gehörte zur Grabausstat-
tung und lag noch hinter diesen Geweihstücken (Abb. 3).
Zur Charakteristik desMännergrabes 5603/927 vonAlsónyék-Bátaszék
Gräber mit Pfostenstellung
Der Grundriss südtransdanubischer Grabgruben der Len-
gyel-Kultur ist meist rechteckig mit abgerundeten Ecken
oder von unregelmäßig ovaler Gestalt. In Alsónyék-Bátas-
zék finden sich aber auch 123 andere Gräber, bei denen
in den Grubenecken weitere Eintiefungen nachgeweisen
Abb. 1: Alsónyék-Bátaszék, Männergrab 5603/927
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 61
Abb. 2: Alsónyék-Bátaszék, Männergrab 5603/927
Abb. 3: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, Skelett und Inventar
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
62 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
werden konnten. Dies war bei 7,72 % aller dokumentierten
Bestattungen der Fall. Auch Grab 5603/927 zählt zu dieser
Gruppe. Grabstrukturen jener Art konnten in der Lengyel-
Kultur bislang nicht festgestellt werden, so dass es nicht
zu weit gegriffen ist, sie als außergewöhnliche Befunde
anzusprechen.
Festzustellen ist, dass diese Befunde unabhängig von
der Skelettlage der Toten auftreten, und auch die Ergeb-
nisse der anthropologischen Untersuchungen weisen auf
keine „Fremdpopulation“ hin, die ihre Toten in diesen
Gräbern mit „inneren Gruben“ beigesetzt hätten10.
In anderen Kontexten wurde bislang meist diskutiert,
ob die Befunde vergleichbarer Gräber als „Totenbretter“
10 Zalai-Gaál u.a. 2011a; 2011b; 2011c.
bzw. „Totenhütten“ gedeutet werden können, wobei die
ersteren eine nur unterirdische, die letzteren unter- und
oberirdische Strukturen aufweisen.
Die überwiegende Mehrzahl innerer Gruben enthielt
weder keramische noch sonstige Beigaben, war also na-
hezu regelhaft fundleer. Dies lässt die Deutung zu, dass
die inneren Gruben ursprünglich nicht für die Deponie-
rung von Grabbeigaben eingetieft wurden. Bei inneren
Gruben mit darin geborgenen Funden lässt sich rekon-
struieren, dass in den Gruben ursprünglich Pfosten
standen, an denen in der Grabgrube Objekte lehnten,
welche nach Verrottung der Hölzer in die Pfostengruben
rutschten.
Wie beschrieben konnte in Alsónyék-Bátaszék mehr-
fach beobachtet werden, dass die Skelette nicht unmittel-
bar auf den Grabsohlen, sondern auf podiumsartigen Flä-
Abb. 4: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, geschliffene Schaftlochaxt
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 63
Abb. 5: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, Gruppe von Silexgeräten
Abb. 6: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, Silex-Ensemble
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
64 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
chen lagen. Anzunehmen ist, dass die Toten in diesen
Fällen auf organischen Materialien ruhten oder aber in
vergängliche Stoffe eingewickelt waren, auch hölzerne
Unterlagen liegen im Bereich des Möglichen.
Bei einigen inneren Gruben konnte ferner beobachtet
werden, dass die Grubenausfüllungen mittig sehr hart wa-
ren, die Konsistenz nach außen hin jedoch deutlich locke-
rer wurde. Auch diese Beobachtung weist auf die Existenz
ehemals dort verankerter, später vergangener Holzpfos-
ten hin. Zusammengefasst halten wir es daher für sehr
wahrscheinlich, dass in den inneren Gruben vier massive
Pfosten steckten, die aus den Grabgruben als Bestandteil
oberirdischer Konstruktionen herausragten. Anzuneh-
men ist, dass die Pfosten ein Dach aus vergänglichen Ma-
terialien (Holz, Gewebe usw.) getragen haben. Insgesamt
bildeten sie so eine rudimentäre Totenhütte. An dieser
Stelle ist noch zu erwähnen, dass das „Häuptlingsgrab
3060“ (Fundstelle 10B) eine Länge von 313 cm und eine
Breite von 284 cm aufwies, wohingegen alle anderen Grä-
ber mit Pfostenstellung deutlich kleiner waren.
Grabinventar
Zu den Grabbeigaben unserer Bestattungen gehören auch
Gegenstände symbolischer Konnotation, die die Hinter-
bliebenen den Toten aus wohl kultischen Gründen ins
Grab legten.
Aus Altgrabungen südtransdanubischer Lengyel-Ne-
kropolen wie bspw. Lengyel, Zengövárkony oder Mórágy
sind eine ganze Reihe von Grabbeigaben bekannt. Insge-
samt gilt dies für 572 Bestattungen. Sie können Keramik-
gefäße, Darstellungen anthropo- und zoomorphen Cha-
rakters, Skelette von Canis familiaris, Schweinemandibel,
Hörner oder vollständige Jagdtrophäen von Bos primige-
nius, Reste von Speisebeigaben (Tierknochen und Schne-
ckenschalen) und Mahl- und Reibsteine sein. Weitere
Objekte des Grabinventars sind als Trachtbestandteile
zu werten, dazu zählen diverse Gerätschaften und auch
Schmuck.
In Alsónyék-Bátaszék stammen aus 63,6 % (1025 Be-
stattungen) der bislang untersuchten 1610 Gräber Ke-
ramikgefäße, einzelne Keramikscherben, Kulttischchen,
Mahl- und/oder Reibsteine, Tierknochen, Hämatit, Ocker-
klumpen, Tierknochen, Eberhauer, Schweinekiefer, Tro-
phäen vom Urrind und Hundeskelette oder Reste von sol-
chen. Keramik stellt auch hier die am häufigsten belegte
Grabbeigabe dar. 705 Bestattungen erlauben Aussagen
zur Verteilung von Grabgefäßen pro Bestattung. Für diese
Zahl liegen auch anthropologische Daten zu Geschlecht
und/oder Sterbealter der Toten vor. In 83,4 % der Fälle
(588 Bestattungen) wurden ein bis drei Gefäße in das Grab
gelegt. Vier bis sechs Gefäße weisen nur noch 15,3 % der
Gräber auf (108 Bestattungen). Unter diesen dominieren
weibliche Bestattungen mit einem Prozentsatz von 17,5 %
(54 Bestattungen), während Männer, Kinder und Skelette
unbekannten Geschlechts (Erwachsene) mit 12,3 % (26 Be-
stattungen), 15,6 % (17 Bestattungen) und 14,1 % (elf Be-
stattungen) vertreten sind. Der Anteil der mit sieben bis
neun Gefäßen versehenen Bestattungen nimmt nur noch
einen Anteil von 1,2 % ein (neun Bestattungen). Zu diesen
gehören fünf Frauen und vier Männer. Beachtenswert ist,
dass dem Toten aus Grab 5603/927 keine Keramikgefäße
beigegeben wurden.
Gerätschaften
Altgrabungen in Nekropolen der südtransdanubischen
Lengyel-Kultur11 erbrachten in 27,5 % der Fälle (181 Bestat-
tungen) geschliffene Steingeräte als Beigabe. Steinerne
Schaftlochäxte sind mit 113 Exemplaren in 17,0 % der
Gräber vorhanden. Unterschiedliche Typen geschliffener
Steinbeile, Keile und Meißel stammen aus 5,7 % der Grä-
ber (52 Bestattungen)12. Einem im Grab 10B/3060 von
Alsónyék-Bátaszék bestatteten Mann wurden vier große
und schwere Stücke geschliffenen Steingeräts beigege-
ben13. Verschiedene Werkzeugartefakte – mindestens 1177
Stück – sind aus 30,2 % der untersuchten Bestattungen
des Gräberfeldes belegt (487 Bestattungen). Steinkeulen
lagen in 2,7 % (22 Bestattungen), Steinäxte in 19,8 % (158
Bestattungen), Keile, Beile oder Meißel in 18,3 % (146 Be-
stattungen), Obsidian nur in 2,0 % (16 Bestattungen),
Silexgeräte in 36,0 % (288 Bestattungen), Knochenwerk-
zeuge in 11,0 % (88 Bestattungen) und Geweihäxte in 1,6 %
(13 Bestattungen) aller Gräber.
Die Mehrzahl steinerner Schaftlochäxte von Alsóny-
ék-Bátaszék gehört zu den gewöhnlichen donauländi-
schen (Lengyel-)Typen. Neu sind hier die in einigen
Bestattungen gefundenen, sehr qualitätsvoll und fein po-
lierten, mit mittigen Längsrippen an den Breitseiten ver-
sehenen Streitäxte, die in ihrer Gestalt frühkupferzeitliche
Axtformen imitieren. Das besonders sorgfältig bearbeitete
und größte Exemplar stammt aus dem bereits erwähnten
Häuptlingsgrab 10B/306014. Es handelt sich dabei um eine
214 mm lange und 55,7 mm breite Streitaxt.
11 Zalai-Gaál 2010a.12 Ebd. 109; Zalai-Gaál u.a. 2011b.13 Dies. 2011a.14 Ebd.
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 65
Eine in Grab 5603/927 entdeckte Schaftlochaxt kann als
neuer Typus geschliffener Steinäxte im Inventar der
südtransdanubischen Lengyel-Kultur angesprochen wer-
den15. Zu den gewöhnlichen Keiltypen der Lengyel-Kultur
zählt hingegen ein kleiner trapezförmiger Steinkeil, der
hinter dem Schädel des Bestatteten lag.
Aufgrund der Daten der anthropologischen Untersu-
chungen ist klar ersichtlich, dass schwere geschliffene
Steingeräte in 87,5 % der Fälle (120 Bestattungen) erwach-
senen Männern und in nur 2,5 % Frauen (drei Bestattun-
gen) beigegeben wurden. Geschliffene Steinkeulen – also
Objekte, die als Macht- oder Statussymbole angesprochen
werden können – stammen nie aus anthropologisch gesi-
cherten Frauenbestattungen, jedoch finden sich diese in
2,9 % aller Kindergräber (vier Bestattungen). Die jüngste
Person mit Steinkeulenbeigabe war 15–16 Jahre alt, für die
Axtbeigabe konnten 6–8 Jahre als jüngstes Kindesalter er-
mittelt werden.
In 65,1 % (433 Bestattungen) alt gegrabener Bestattun-
gen der Lengyel-Kultur finden sich unterschiedliche Ty-
pen geschlagener Steingeräte. Obsidianfunde stammen
aus nur 5,7 % aller Gräber (38 Bestattungen)16.
In Alsónyék-Bátaszék sind verschiedene, typologisch
noch nicht untersuchte Artefakte der Spaltindustrie so-
wie Obsidianfunde zu 2,0 % (16 Bestattungen), Messer mit
8,4 % (67 Bestattungen) und „Silices“ in 36,0 % (288 Be-
stattungen) der 798 Gräber mit beigegebenen Gerätschaf-
ten vertreten.
Unter diesen Geräten fallen besonders lange und
breite Silexmesser aus mehrheitlich ortsfremdem Stein-
material auf. Solche großen Steinmesser treten als charak-
teristische Fundgattung hauptsächlich in frühkupferzeit-
lichen Kulturen auf, und auch im Gräberfeldinventar von
Varna gehören besonders lange Silexmesser zu den mar-
15 Ebd.16 Zalai-Gaál 2010a, 116–117 Tab. 11.
kanten Funden17. Im Gräberfeld von Alsónyék-Bátaszék
wurden Silexmesser bei 58 Bestattungen auf den Schädel
oder in dessen unmittelbare Nähe gelegt.
Die Bestattung 5603/927 enthielt insgesamt 34 ge-
schlagene Steingeräte. Betrachtet man die hier vertrete-
nen Rohmaterialien und Werkzeugtypen, so fällt deren
Homogenität ins Auge. Unter den Rohmaterialien domi-
nieren örtlich und regional anstehende Radiolarite (94 %).
Nicht mehr als zwei Artefakte (6 %) sind ortsfremd und da-
her dem Fernhandel zuzurechnen.
Im Fundmaterial zeigen sich zwei Werkzeugtypen,
ferner Trapeze (13 Exemplare) und Klingen (21 Stück). Die
bereits erwähnte stattliche Klinge fand sich hinter dem
Schädel auf einer Steinaxt deponiert, elf Trapeze lagen
zwischen den rechten Rippenknochen und der Geweih-
beigabe, 20 weitere Klingen kamen nördlich des Beckens
zu Tage, und zwei Trapezfragmente wurden unterhalb des
rechten Beckenknochens entdeckt.
Unter den Rohmaterialien überwiegen mit 79 % Bako-
ny-Radiolarite (27 Stück) vor Mecsek-Radiolariten mit nur
15 % (fünf Stück) (Diagr. 1). Für die Mecsek-Radiola-
rite sind seidenartige, weiß-punktförmige, bordeauxrote,
malvenfarbige und rotbraune Varianten bzw. ihre Kom-
binationen typisch. Sonstige Lokalvarianten wurden bis-
lang nicht definiert18.
Innerhalb der Gruppe der Bakony-Rohmaterialen
können wir zwei weitere lokale Varianten erkennen, näm-
lich Szentgál- (18 Stück, 52 %) und Úrkút-Eplény-Radiola-
rite (fünf Stück, 15 %). Der Szentgál-Radiolarit ist ein cha-
rakteristisch rotes, in sich homogenes und ausgezeichnet
schlagbares Gestein mit Partien von weißer Kortex. Die
Variante Úrkút-Eplény ist ein seidenartiges, schwarz-
punktförmiges und homogenes Rohmaterial von gelb-
brauner Farbe. Vier andere der Spaltindustrie zurechen-
17 Dimitrov 2002, 128; 146.18 Bíró 1988, 264; 1989, 23; 1998, 36.
Diagr. 1: Verteilung von Steingerät-Rohmaterialien in Bestattung 5603/927
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
66 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
bare Exemplare (12 %) können wegen der transitiven Farb-
verläufe nur allgemein als Bakony-Radiolarite angespro-
chen werden19.
Die erwähnte lange Klinge hinter dem Schädel des
Toten wurde aus Wolhynien-Feuerstein (3 %) hergestellt,
ein anderer, ebenso zu 3 % vertretener Feuerstein ist süd-
licher Herkunft. Der erstbenannte Fund ist von brauner,
der zweite von grünbrauner Farbe; das Rohmaterial die-
ser Funde ist seidenartig und homogen20. Hinsichtlich
der Taphonomie der behandelten Spaltgeräte fiel auf,
dass allein Wolhynien-Klingen eine dicke Patinaschicht
zeigten.
Als Quelle Mecsek-Rohmaterialien galt bislang der
östliche Bereich des Mecsek-Gebirges, genauer die Umge-
bung der Gemeinden Komló, Hosszúhetény und Kisújbá-
nya. Diese Stellen dominieren die örtliche Bezugszone,
die einen 30–50 km von Alsónyék-Bátaszék entfernten Be-
reich umfassen21.
Die Bakonyer-Rohmaterialien stammen von Abbau-
stellen im Süden des Bakony-Gebirges (Szentgál-Tüzkö-
veshegy, Bakonycsernye, Pisznice, Úrkút und Eplény). Es
handelt sich in diesen Fällen um Feuersteingattungen aus
regionalen, von Alsónyék-Bátaszék etwa 100–150 km ent-
fernten Bezugszonen22. Die Rohmaterialressource des
Wolhynien-Feuersteines kann in der westlichen Ukraine,
entlang des oberen Dnestr-Verlaufs, in einer Distanz von
600 km Luftlinie verortet werden. Die Quelle des Feuer-
steins südlicher Herkunft ist nicht bekannt, zu rechnen ist
19 Ders. 1988, 260; 1998, 35; Mateibiucová 2008, 49–50.20 Bíró 1988, 270; 1998, 36.21 Ders. 1988, 264; Mester 2009, 242.22 Bíró 1988, 260; Mester 2009, 243.
aber auch in diesem Fall mit einem mehrere hundert Kilo-
meter entfernten Ursprung.
Die beschriebenen zwei Feuersteingattungen können
dem Fernhandel zugerechnet werden23, ferner lässt sich
auf Basis unseres Wissens um die südtransdanubische
Spaltindustrie feststellen, dass jene Artefakte als Fertig-
produkte verhandelt wurden24.
Zum Klingeninventar von Grab 5603/927 zählen nicht
weniger als 21 Klingen (62 % des Steingeräts), aber nur
eine von ihnen ist retuschiert. Je fünf Stücke vertreten die
Szentgál-, Úrkút-Eplény- und Mecsek- bzw. vier andere die
Bakony-Radiolarite.
Wie bereits erwähnt, hatte man jeweils eine Klinge
aus Wolhynien- sowie südlichem Feuerstein hergestellt
(Diagr. 2). Die Wolhynien-Klinge wurde unter Druck vom
Kernstein abgespalten. Darauf deuten parallel verlau-
fende Kanten und Grate, die übereinstimmende Stärke
und der Schlagflächenrest hin, der kleiner ist als die Breite
der Klinge25. Im Fall der übrigen Klingen wurde dagegen
die Meißeltechnik eingesetzt. Deren Merkmale sind flache
Schlagflächenreste und ein sich kaum wölbender Bulbus
bei einem Abhauwinkel von nahezu 90o. Diese Charak-
teristika zeigen sich auch in der Lithik des Siedlungsmate-
rials26.
Die Mehrzahl der Klingen weist flache Schlagflächen-
reste auf, gleichzeitig sind aber auch facettierte, punkt-
förmige und linienartige Schlagflächenreste zu erkennen.
Dabei wurden die Schlagflächen nicht oder nur geringfü-
23 Ebd.24 Bácskay 1989, 7; Bíró 1989, 24; 1998, 36–37; Kaczanowska 1985,151; Mateibiucová 2008, 49–50, 151.25 Inizan u.a. 1999, 79.26 Ebd. 76.
Diagr. 2: Verteilung von Werkzeugtypen und Rohmaterialien
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 67
gig präpariert27. Bei drei Klingen lässt sich der Charakter
des Schlagflächenrestes aufgrund gebrochener bzw. retu-
schierter proximaler Enden nicht bestimmen. Vier Klingen
zeigen Präparationsspuren des Kernsteinrandes in den
proximalen Bereichen.
Versucht man die Strategie der Klingenproduktion zu
rekonstruieren, so sind jene Klingen von Interesse, die
auf der Vorderseite ein oder zwei Grate tragen. Insgesamt
wurden elf Klingen mit je zwei Graten und acht mit nur
einem Grat nachgewiesen. Daraus lässt sich folgern, dass
Gratenstockungen seltener auftraten, was umfangrei-
chere Klingenabtrennungen ermöglichte.
Nur zwei überhangen Klingen weisen jeweils drei
Grate auf. Anzunehmen ist, dass bei jenen Klingen die
Debitageoberflächen erneuert wurden. Bezeugt wird diese
Erneuerung der Debitageoberflächen durch eine im Fund-
material geborgene neue Kernkantenklinge als Nebenpro-
dukt der Grundproduktion28.
27 Ebd. 76–79; 136.28 Ebd. 139.
Abnutzungsspuren sind nur an drei Klingen belegt, so
dass die im Grab geborgenen Klingen vermutlich nicht im
Gebrauch waren. Gebrausspurenanalysen könnten in die-
ser Hinsicht Gewissheit vermitteln.
Obwohl in Alsónyék-Bátaszék die Deponierung von
Klingen auf oder in Schädelnähe nicht ungewöhnlich
ist, dürfte der Wolhynien-Klinge dennoch eine herausra-
gende Rolle beigemessen werden: Ihre Maße, das ver-
wendete Rohmaterial und auch ihre Abtrennung mittels
Drucktechnik kann im Klingeninventar des Fundplatzes
als unikat bezeichnet werden29.
Die einzige retuschierte Klinge des Grabinventars
wurde aus Feuerstein südlicher Herkunft geschlagen. Der
Bruch der Klinge kann als typisch angesehen werden und
erscheint auch im Siedlungsmaterial. Nur vier Klingen
sind noch intakt und weisen ihre ursprüngliche Länge
auf. Bei 17 gebrochenen Klingen findet sich der Bruch re-
gelmäßig im distalen Bereich; es treten aber auch mediale
Brüche auf. Zungenförmige, während der Grundproduk-
29 Bácskay 1989, 9; 17; 1990, 59–60.
Abb. 7: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, Auswahl unretuschierter und retuschierter Klingen
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
68 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
tion entstandene Brüche, liegen keine vor. Daher lässt
sich annehmen, dass die im allgemeinen an den Enden
nachweisbaren schrägen Brüche absichtlich erfolgten30.
Bei den vollständig fragmentierten Geräten finden sich
gerade Brüche an den Grenzen der medialen Bereiche
(Abb. 7).
Die Trapeze (38 % des Steingeräts) zeichnen sich
durch große Einheitlichkeit aus, wurden sie doch mit über-
einstimmender Technik aus identischen Rohmaterialien –
stets Szentgáler-Radiolarit (Diagr. 2) – hergestellt. Eine mit
weißem Kortex bedeckte Partie ist nur in einem Fall sicht-
bar. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte man Trapeze
mit der ‚Kerbrest-Technik‘ her31. Mittels Meißeltechnik ab-
30 Inizan u.a. 1999, 37.31 Mateibiucová 2008, 93.
getrennte Klingen wurden durch schräge Brüche fragmen-
tiert, was bei den 1–2 mm dicken Klingen eher unkompli-
ziert gewesen sein dürfte. Die beabsichtigte Morphologie
wurde dann mittels Retuschen erreicht, wofür man den
medialen und/oder distalen Teil der Klingen heranzog.
Deutlich wird, dass die geformten Trapeze vergleich-
bare Maße aufweisen. Ideal waren Längen von 14–18 mm
und Breiten von 7–10 mm am proximalen Teil, 6–10 mm
am medialen Bereich und 5–10 mm am distalen Abschnitt.
Im Längen-Breiten-Diagramm (Diagr. 3) zeichnen sich
zwei kleine Gruppen ab: Die kleineren Trapeze sind
13–15 mm, die größeren 17–18 mm lang. Hinsichtlich ihrer
Breiten unterscheiden sich die Trapeze nicht wesentlich
voneinander. Bezogen auf ihre proximalen Breiten wei-
sen diese Werkzeuge – mit einer Ausnahme – eine Größe
von 7–10 mm und an der distalen Partie 5–10 mm auf
(Diagr. 4).
Diagr. 3: Streuung der Trapez-Längen und -Breiten
Diagr. 4: Streuung distaler und proximaler Trapez-Breiten
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 69
Hinsichtlich retuschierter Enden sind die Trapeze einheit-
lich. Spuren von Endretuschen sind an insgesamt drei Tra-
pezen greifbar, zweimal an der proximalen und einmal an
der distalen Partie. Diese Retuschenart kann daher für das
behandelte Fundensemble nicht als charakteristisch be-
zeichnet werden. Klingenbruchstücke übereinstimmen-
der Größe und Form wurden bei allen Trapezen an beiden
Enden durch normale Retusche ausgestaltet.
Außerdem lässt sich feststellen, dass die proximalen
Enden teilweise retuschiert waren. Bei fünf Exemplaren
finden sich an den distalen Enden kontinuierliche Retu-
schen und bei vier weiteren Stücken ist dies an beiden En-
den der Fall.
Der Retuschenwinkel ist zumeist steil, es treten aber
auch feine und überkreuzt steile Retuschen auf. Ähnlich
den Klingen tragen auch Trapeze gewöhnlich ein oder
zwei Grate; ein Trapez weist drei Grate auf. Abnutzungs-
spuren lassen sich an keinem Trapez erkennen. Wichtig
ist bei diesen Trapezen, dass sie ein in jeder Hinsicht ge-
schlossenes Ensemble darstellen, denn sowohl Rohma-
terial, Herstellungsweise und Größe als auch die auf
der Vorderseite sichtbare Abtrennungsrichtung der Ab-
schlagnegative stimmen vollkommen miteinander über-
ein (Abb. 8). Bei einer solchen Gleichförmigkeit kann da-
her begründet vermutet werden, dass diese Artefakte von
nur einer einzigen Person hergestellt wurden. Zu jener
Schlussfolgerung tragen ferner acht zusammenpassende
Trapeze bei, aus denen vier Klingen rekonstruiert werden
können (Abb. 9). Die Funktion der Trapeze lässt sich nicht
sicher bestimmen. Aufgrund ihrer nur geringen Größe
Abb. 8: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, Trapeze
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
70 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
und Form ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sie als
Pfeilspitzen verwendet wurden32.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die be-
schriebenen Silexwerkzeuge lagen unmittelbar am Körper
des im Grab 5603/927 beigesetzten Toten. Der am Schädel
deponierten Klinge aus Wolhynien-Feuerstein dürfte eine
herausragende Rolle beigemessen werden, ihr Rohmate-
rial ist als Rarität einzustufen, entsprechend kann das Ar-
tefakt als Prestigeobjekt gedeutet werden33.
Aufgrund der Lage der Klingen und Trapeze in je einer
Gruppierung am Becken des Toten kann auf ein Behältnis
aus organischem Material geschlossen werden, das der
Bestattete ursprünglich bei sich getragen hatte oder wel-
ches dem Toten erst beigegeben wurde. Zwar weist die An-
zahl der am Becken liegenden Klingen auf die Bedeutung
dieses Fundes hin. Im Vergleich zum Siedlungsmaterial
sind große Klingenzahlen jedoch nicht unüblich. In Sied-
lungsbefunden treten Trapeze ganz regulär auf, ihre Nie-
derlegung in den Gräbern kann als symbolisch angesehen
werden. Bedeutsam ist jedoch die Uniformität der gebor-
genen Trapeze, was durch die zusammenpassenden Stü-
cke nur noch weiter unterstrichen wird34.
Tierische Funde
Fünf Tierknochen kamen in Grab 10B/927 zum Vorschein.
Das größte dieser Stücke ist ein sog. „Geweihstab“, der im
Rücken des Toten deponiert war. Er wurde aus der Stange
eines Rothirsches (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) ge-
32 Bácskay 1989, 17–18; 1990, 59–60; Kaczanowska 1985, 156; Ma-teibiucová 2008, 91–95.33 Bácskay 1990, 59–60.34 Dies. 1989, 17–18; 1990, 63.
schnitzt. Die Basis des etwa 480 mm langen und in der
Mitte 23,5 mm dicken, von seiner äußeren Perlung befrei-
ten Geweihstabes lag auf dem Schulterblattfragment eines
Urrindes (Bos primigenius Bojanus, 1827), das sich wie-
derum an der Schulter des Toten befand. Die Geweihstab-
spitze wies in Richtung Hüfte, ihr Bogen folgte der Rü-
ckenlinie des Toten.
Das 114 mm lange Schulterblattfragment vom Urrind
stammt von der linken Seite des Tieres. Die Gelenksober-
fläche war intakt, Kanten und Bruchflächen verwittert.
Die Knochenoberfläche glänzte an einigen Stellen, so dass
zusammenfassend von einem Gebrauch des Stückes aus-
zugehen ist (Abb. 10,a).
Hinter dem Schädel des Toten waren neben dem
Schulterblattfragment und den anderen Gerätschaften
auch zwei Geweihsprossen platziert. Beim ersten Stück
handelt es sich wahrscheinlich um einen aus dem Geweih
eines ausgewachsenen Hirsches herausgeschlagenen
Augspross. Dieser wies eine Länge von 250 mm und an der
Basis eine Breite von 27,1 × 36,3 mm auf. Das Sprossenende
wurde spitz zulaufend geglättet, die Basis und auch die
Spitze zeigten deutliche Verwitterungsspuren (Abb. 10,b).
Bei dem zweiten Exemplar handelte es sich um eine
230 mm lange Endsprosse, die an ihrer Basis stark zemen-
tiertes Sediment ohne Spuren menschlicher Bearbeitung
aufwies. Die Kante der Spitze ist einigermaßen verschlos-
sen, in ihre Spongiosa wurde ein etwa 5 mm tiefes Loch
gebohrt, das vermutlich die Fassung einer dünnen Klinge
gewesen sein dürfte (Abb. 10,c).
Unter der Hüfte des Toten lag das Bruchstück einer
Ahle, die aus dem Mittelfuß- oder Mittelhandknochen
eines kleinen Wiederkäuers – Schaf (Ovis aries Linnaeus,
1758), Ziege (Capra hircus Linnaeus, 1758) oder Reh
(Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) – gefertigt wurde
(Abb. 10,d). Das 86,8 mm lange und 13,5 mm breite Gerät
mit abgebrochener Spitze gehört zu den häufigsten prä-
historischen Werkzeugen überhaupt. Nach der Klassifi-
kation von Schibler ist die Ahle dem Typus mit kleinen
Löchern (1/4) mit Gelenksoberfläche zuzuweisen35. Herge-
stellt wurde das Gerät mit der sog. „Vier-Teile-Technik“.
Hierbei zerteilte man einen intakten Knochen zuerst in
Längsrichtung (dorso-palmar), die so entstandenen Hälf-
ten wurden dann erneut der Länge nach gespalten.
Die proximale Epiphyse bildet den Griff des Gerätes,
die zugespitzte Diaphyse konnte gelocht werden36. Die
Kanten des Gerätes sind abgerundet und glänzen, was wie
auch der Rest der Ahle auf eine länger andauernde Nut-
zung hinweist. Die Spitze der Ahle fehlt infolge eines re-
35 Schibler 1981.36 Camps-Fabrer/D’Anna 1977.
Abb. 9: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, acht zusammen-passende Trapeze, die vier Klingen bilden
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 71
zenten Bruchs. Da für die Anfertigung dieses Ahlentyps
eine sorgfältige Auswahl und Bearbeitung des Rohmate-
rials nötig ist, bewerten wir sie nach der von A. M. Choyke
eingeführten Gliederung als ein Gerät herausragender
Güte37. Die Bestandteile des Grabinventars wie auch ihre
Position innerhalb der Grabgrube stellen für Alsónyék
keine Seltenheit dar, ist doch vergleichbares Material vom
selben Fundplatz bekannt. Solches fand sich etwa im be-
reits erwähnten „Häuptlingsgrab“ 10B/3060. Im Rücken
dieses Toten lagen neben einer Geweihstange, die auf dem
37 Choyke 1984.
Schulterblatt eines Rindes ruhte, die Trophäe eines Urrin-
des sowie Flügelknochen eines Geiers, zudem war auch
dieser Bestattung eine Knochenahle und eine unbearbei-
tete Geweihsprosse beigegeben worden38.
In Alsónyék-Bátaszék, Fundstelle 5603, gelang die
Entdeckung von vier Lengyel-Gräbern, die entweder je-
weils eine jener Beigaben enthielten, die in Bestattung
10B/927 nachgewiesen werden konnten, oder aber es tra-
ten unterschiedliche Beigabenkombinationen auf (Tab. 1).
In den Gräbern 5603/1821 (Abb. 11) und 5603/2795 war
38 Zalai-Gaál et al. 2011a.
Abb. 10: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/927, kleinere Tierknochenfunde: a. Schulterblattfragment vom Ur;b–c. Geweihstücke mit Spuren menschlicher Eingriffe; d. Ahlenbruchstück aus den Mittelfußknochen eines kleinen Wiederkäuers
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
72 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
das Schulterblattfragment eines Rindes mit einer Geweih-
stange vergesellschaftet. In der letzteren Bestattung be-
fanden sie sich jedoch nicht im Rücken des Toten, son-
dern bei dessen Füßen, wobei das Schulterblattfragment
noch unter der Geweihstange lag.
In den Gräbern 5603/1984 und 5603/1991 lagen die
Schulterblattfragmente zwar erneut im Rücken der Toten,
abweichend jedoch wurden sie hier nicht mit einer Geweih-
stange, sondern mit je einem sog. ‚Balgkratzer‘ kombiniert,
welche aus den Mittelfußknochen großer Wiederkäuer ge-
schnitzt waren. In beiden Bestattungen fand sich außerdem
noch jeweils eine Eberhauerlamelle. Diese Gegenstände
konnten noch nicht weiter untersucht werden, so dass vor-
läufig offen bleiben muß, ob es sich bei diesen um tatsäch-
lich verwendete Gerätschaften – z.B. Kratzer oder Schär-
fer –, oder nur um symbolische Beigaben handelt. Zu Füßen
des Toten aus Grab 5603/1991 lag ferner ein ausgewachse-
ner Hund mit einer Widerristhöhe von 462,34 mm39.
Vergleicht man die benannten Gräber der Fundstel-
len 10B und 5603 von Alsónyék-Bátaszék miteinander, so
zeigt sich, dass die Gräber der Fundstelle 10B mit einem
reicheren Beigabenspektrum versehen sind als jene der
Fundstelle 5603. Für alle sechs Bestattungen sind Schul-
terblattfragmente vom Urrind oder Hausrind (Bos taurus
Linnaeus, 1758) typisch, die viermal mit einer etwa 50 cm
langen Geweihstange und zweimal mit Balgkratzern kom-
biniert waren (Tab. 1).
39 Dies. 2011b, 39–40 Abb. 15.
Die Schulterblattfragmente der Gräber 10B/3060, 5603/927
und 5603/1991 weisen Handhabungspolitur sowie mit Aus-
nahme des Stückes aus Grab 5603/1991 gerundete Bruchflä-
chen auf. Die Kanten des Schulterblattfragments aus Grab
5603/2795 sind zwar abgerundet; Handhabungspolitur
zeigt sich auf der Oberfläche jedoch nicht. Vorläufig ist
noch unklar, ob den Geweihstangen und Schulterblattfrag-
menten als Einzelobjekte oder in Kombination miteinan-
der eine symbolische Bedeutung zugerechnet werden darf,
oder ob diese als reine Gerätschaften anzusprechen sind.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Kombination aus
Schulterblattfragment und/oder Geweihstab/Balgkratzer
sich zumeist im Rücken der Toten fand.
Vergleichen wir die Größen der Schulterblattfrag-
mente dieser Gräber miteinander bzw. mit jenen Daten,
die für in das Mesolithikum und Neolithikum Ungarns da-
tierende Funde bekannt sind, so wird ersichtlich, dass es
sich bei den Objekten der Fundstelle 10B sowie aus Grab
5603/2796 um besonders große Exemplare handelt. Anzu-
nehmen ist, dass diese von einem Urstier stammen. Das
Exemplar aus Grab 5603/1991 ist hingegen deutlich klei-
ner, so dass dieses Fragment eher einer Urkuh zugerech-
net werden darf (Abb. 12).
Die benannten Tierknochenbeigaben – Geweihstab,
Schulterblattfragment und Balgkratzer – konnten bislang
nur selten nachgewiesen werden, so dass es vor einer Aus-
sage zu Funktion und Bedeutung dieser Artefakte noch
weiterer Untersuchungen bedarf. Vergleichbare, in die
Urgeschichte Ungarns datierende Funde, liegen aber
durchaus vor. Zu erwähnen sind in diesem Kontext bei-
Tab. 1: Vergleichende Tabelle von Gräbern mit Tierknochen-Beigabe (hellgrau = symbolische Beigabe; weiß = symbolische Beigabe und/oderGerätebeigabe; dunkelgrau = Gerätebeigabe; Tp-Bt = Tiszapolgár-Basatanya)
TierischeBeigaben
Fundst. 10B Fundst. 5603 Tiszapolgár-Basatanya
30607 40–50
9277 45–55
19917 40–50
1821 1984 2795 677 60
357 30–35 + zwei Kinder
29ohne Skelett
Schädel vom Ur ×Vogelflügel ×Hund × ×Schweine-/Ebermandibel × × ×Geweihsprosse × × × × ×Geweihstab × × × × × ×Schulterblattgerät × × × × × × × × ×Eberhauer × × × ×Knochenahle × × ×Geweihaxt ×Durchbohrte Sprosse ׄBalgkratzer“ × × × × ×
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 73
Abb. 11: Alsónyék-Bátaszék, Grab 5603/1821. Oben: Detailaufnahme
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
74 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
pielsweise Funde aus drei Bestattungen des frühkupfer-
zeitlichen Gräberfeldes von Tiszapolgár-Basatanya, näm-
lich die Gräber 29, 35 und 67.
In Grab 67 lag das Skelett eines etwa 60 Jahre alten
Mannes. Ihm beigegeben fanden sich eine Reihe von Tier-
knochen, genauer waren dies das Schulterblatt eines Ur-
rindes, ein aus dem Mittelfußknochen eines Rindes ge-
schnitzter Balgkratzer, Geweihsprossen vom Hirsch und
Reh, eine Geweihaxt mit einer den Alsónyéker „Geweih-
stangen“ ähnlichen Griffschäftung, eine aus dem Mittel-
fußknochen eines kleinen Wiederkäuers gefertigte Kno-
chenahle, Ebermandibel und das Skelett eines zu Füßen
des Toten gebetteten Hundes40.
Aus Grab 35 – der Bestattung eines Mannes und
zweier Kinder – kamen Schulterblattfragmente vom
Urrind ohne Bearbeitungsspuren, Balgkratzer, Geweih-
sprossen, Schweinemandibel und eine Eberhauerlamelle
zum Vorschein41. In das nur symbolische Grab 29 legte
man u.a. Schulterblattfragmente vom Urrind, Balgkratzer
sowie Schweinemandibel und Eberhauer42. Den bislang
bekannten anthropologischen Untersuchungen zufolge
handelt es sich bei den vorgestellten Tierknochenfunden
um für Männergräber charakteristische Beigaben.
Die in Tiszapolgár-Basatanya geborgenen Parallelen
beweisen gleichzeitig, dass diese Beigaben keineswegs re-
gional- oder kulturspezifisch sind, da sie sowohl in Trans-
danubien als auch in der Ungarischen Tiefebene bzw. in
der Lengyel- sowie der Tiszapolgár-Kultur auftreten. Die
40 Bognár-Kutzián 1963, 137–139 Fig. 66 Plate LXXIII; LXXXVI.41 Ebd. 84–86 Fig. 38 Plate XXIX; XXXII.42 Ebd. 77–79 Fig. 34 Plate XXIX; XXXII.
Bedeutung dieser Funde wird noch einmal deutlich unter-
strichen durch die Beigabe solcher Artfakte im nur symbo-
lischen Grab 29 der Tiszapolgár-Kultur.
Anthropologische Ergebnisse zumToten aus Grab 5603/927
Der anthropologische Befund besteht aus einem bruch-
stückhaften, kalkigen Schädel und postkranialen Skelett-
resten, die einem 45–55 Jahre alten Mann (maturus)
zugerechnet werden können43. Das Sterbealter des Toten
wurde anhand der Verknöcherung der Schädelnähte, des
Abnutzungsgrades der Zähne sowie der Veränderung der
Fläche des facies symphyseos des Schambeines bewertet.
Nach seiner absoluten Größe ist der Hirnschädel sehr
lang und schmal, dem Index zufolge hyperdolichokran.
Die breite Stirn zeichnet sich durch einen hypereurymeto-
pem Index aus. Die Kontur des Hirnschädels besitzt in der
norma verticalis eine ellipsoide, in der norma occipitalis
eine hausförmige Gestalt. Die Stirn ist bogenförmig, das
Profil des Hinterhaupts curvooccipital. Das protuberantia
43 Das Sterbealter des Individuums haben wir auf Grund von Ne-meskéri u.a. 1960, Meindl/Lovejoy 1985 und Perizonius 1981, dasGeschlecht auf Basis von Éri u.a. 1963 bestimmt. Die Aufnahme unddie Auswertung der metrischen und morphologischen Daten wurdennach den Vorgaben von Martin/Saller 1957 und Aleksejev/Debec1964 durchgeführt. Die Statur errechneten wir nach den Schätzungs-methoden von Pearson 1899 und Rösing 1988, Sjøvold 1990 sowieBernert 2005. Zur Untersuchung der pathologischen Mutationen be-nutzten wir die Arbeit von Aufderheide/Rodríguez-Martin 1998.
Abb. 12: Verhältnis größter Länge (GLP) und Breite (BG) der Fugenfläche des Schulterblattes.Lineare Trendlinie: neolithischer Ur
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 75
Tab. 2: Schädelmaße und -indizes
Martin No. Grab 5603/927
1. 2155. –8. 1359. 10010. 12111. –12. –17. –20. –23. –24. –25. –26. –27. –28. –29. 10930. (113)31. –40. –43. 10344. –45. –46. –47. –48. –51d –51s –52d –52s –54. 2355. –60. 5961. 6362. 4863. 40?65. –66. 10068. –69. 3770. –71. 2972. –75. –75/1. –79. 13238.8:1 76,017:1 –20:1 –17:8 –20:8 –9:8 67,147:45 –48:45 –52:51d –52:51s –54:55 –61:60 –63:62 –
Tab. 3: Gerüstknochengrößen, Indizes und Statur des Skelettes inGrab 5603/927 von Alsónyék-Bátaszék
Martin No. Grab 5603/927d s
CLAVICULA 1. – –6. – –6:1 – –
HUMERUS 1. 303 –2. 301 –4. 62 –5. 25 236. 19 197. 67 659. 44 4310. – –7:1 22,1 –6:5 76,0 82,6
RADIUS 1. – –2. 221 –4. 17 –3. 43 –5. 13 –
ULNA 1. – –13. 21 2214. 24 2313:14 87,5 95,6
FEMUR 1. – –2. – –6. 28 307. 28 278. 88 889. 33 3710. 26 2618. 44 –19. – –6:7 100,0 111,110:9 78,8 70,319:18 – –
TIBIA 1. – –1b. – –3 – –8a. – –9a. – –9a:8a – –
FIBULA 1. – –COXA 17a. 75 –
15a. 77 –17a:15a 97,4 –14.1. 37 –31. 32 –14.1:31. 115,6 –
STATUR Sjø vold 159,0Rösing 157,0Bernert 162,4
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
76 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
occipitalis externa vertritt den Grad 1 und die glabella den
Grad 3. Der Gesichtsschädel ist leider nicht vermessbar.
Die orbita ist rund, der untere Rand der apertura piriformis
scharf, Prognathie liegt nicht vor (Tab. 2).
Die anhand des humerus berechnete Körperhöhe liegt
nach Pearson und Rösing bei 157,0 cm, nach Sjøvold bei
159,0 cm und nach Bernert bei 162,4 cm. Damit ergibt sich
für diese Person nach allen benannten Schätzungen eine
geringe Körpergröße (Tab. 3).
Anatomische Variation: Zwischen den pars squamosa
und processus mastoideus des linken Schläfenbeins findet
sich eine Verwachsungslinie, ebenso zwischen der sutura
squamomastoidea, die rechte Seite ist nicht analysierbar.
Pathologische Veränderungen: An der Rücken- und
Lendengegend der Wirbelsäule ist ein spondylosis defor-
mans zu registrieren. Für diese Herausbildung dürften
eine mechanische Inanspruchnahme der Wirbelsäule so-
wie Stoffwechselkrankheiten eine Rolle gespielt haben.
An der Rückengegend der Wirbelsäule sind auch Schmorl-
Knorpelknötchen ersichtlich. Diese Veränderungen ent-
stehen, wenn eine degenerierte Zwischenwirbelscheibe
in die Knochensubstanz des Wirbelknochens eindringt
und dort eine Höhlung bildet. An den Halswirbeln kann
außerdem eine Entzündung der Wirbelbogengelenke
(spondylarthrosis deformans) beobachtet werden. Weder
die etiologischen noch die pathomorphologischen Krite-
rien dieser Veränderung sind wissenschaftlich geklärt.
Sie können durch verstärkte körperliche Aktivität oder
das Heben und Tragen schwerer Gegenstände verursacht
werden.
An beiden Fersenbeinen sowie der linken Knie-
scheibe (die rechte fehlt) sind auf enthesopathia verwei-
sende Knochendorne zu erkennen, die sich infolge von
übermäßiger körperlicher Belastung und gravierender
körperlicher Inanspruchnahme herausbilden (Dauermär-
sche etwa).
Am Brustbein, dem manubrium und dem Sternoklavi-
kulargelenk (bei der incisura clavicularis) zeigen sich mit
der Bildung von Kanten am Knochen Entzündungsspu-
ren. Das Kreuzbein ist offen (partielles sacrum bifidum).
Gebiß: Alle 32 Zähne sind erhalten. Am zweiten und
dritten Backenzahn des rechten Oberkiefers finden sich
große kariöse Partien, die Zähne weisen eine hochgradige
Abrasion auf.
Diagr. 5: Verteilung der Geschlechter nach archäologischen Merkmalsgruppen
Tab. 4: Archäologische Merkmalsgruppen nach den anthropologischen Daten der Skelette von Alsónyék-Bátaszék
Geschlechtder Skelette
Archäologische Merkmalsgruppen
ohneInventar
nur Beigaben nur Geräte nur Schmuck Beigaben/Geräte
Beigaben/Schmuck
Geräte/Schmuck
Beigaben/Geräte/Schmuck
7 32 45 41 1 93 2 4 33?7 9 12 12 – 22 1 2 7??7 7 5 1 – 6 – 1 1ß6 61 141 6 8 33 35 1 22?6 27 56 1 3 9 3 – 7??6 14 13 1 – 3 4 1 1Kind 79 86 7 5 18 10 – 6n = 998 229 358 69 17 184 55 9 77
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 77
Zur sozialen Stellung des Mannesaus Grab 5603/927
Aus sozialarchäologischer Sicht gehören anthropologi-
sche Daten zum Geschlecht und Sterbealter der Bestatte-
ten mit zu den wichtigsten Kenngrößen, um prähistori-
sche Gräberfelder und Grabsitten analysieren zu können.
Für eine solche Untersuchung wurden von alt gegra-
benen südtransdanubischen Lengyel-Friedhöfen 629 Be-
stattungen mit 659 Gräbern aus 35 Nekropolen bzw. Grä-
bergruppen herangezogen. So umfangreich, wie diese
Zahlen klingen, so gering ist die tatsächliche Zahl ver-
wertbarer Datensätze, da nur von 209 Bestattungen an-
thropologische Daten vorliegen. Vom Gräberfeld Zengö-
várkony flossen Angaben zu lediglich 45 Skeletten in die
Studie mit ein. Die überwiegende Mehrzahl anthropologi-
scher Werte stammt aus der Altgrabung von Mórágy-Tüz-
ködomb.
Auf Basis dieser Hintergrundzahlen treten die Mög-
lichkeiten deutlich hervor, die sich der Neolithforschung
im Fall des Gräberfeldes von Alsónyék-Bátaszék in der Un-
tersuchung archäologischer Merkmals- und Fundspektren
sowie ihrer Verteilung in den nach Geschlecht und/oder
Sterbealter analysierten Bestattungen bieten, können
doch 1177 Skelette von den zwei hier behandelten Fund-
stellen in die Merkmalsanalyse einbezogen werden.
Folgende Ergebnisse zeigten sich bei 998 Bestattun-
gen hinsichtlich des Auftretens und der Verteilung ar-
chäologischer Merkmalsgruppen nach anthropologischen
Kategorien (Tab. 4, Diagr. 5):
a. In 20,9 % der Gräber ohne Inventar (48 Bestattun-
gen) wurden Männer, in 44,5 % (102 Bestattungen) dage-
gen Frauen beigesetzt. Der Anteil von beigabenlosen Kin-
dern beträgt 34,5 % (79 Bestattungen). Frauen und Kinder
sind bei diesen Bestattungen also mit einem Prozentsatz
von 82,0 % vertreten.
b. Die größte archäologische Merkmalsgruppe bilden
358 Gräber, in denen in überwiegender Zahl keramische
Beigaben gefunden wurden. In 17,3 % (62 Bestattungen)
von ihnen ruhten Männer, in 58,6 % (210 Bestattungen)
aber Frauen. Kinder wurden in 24,0 % der Fälle (89 Bestat-
tungen) ausschließlich mit Keramik ausgestattet. Der An-
teil von Frauen und Kindern, die allein keramische Grab-
beigaben aufwiesen, liegt also bei mindestens 82,6 %.
c. Unter den Bestattungen, in denen ausschließlich
Gerätschaften entdeckt wurden, sind Männer mit 78,2 %
(54 Bestattungen) überrepräsentiert vertreten. Hier er-
scheinen Frauen mit nur 11,5 % und Kinder mit 10,1 % (je-
weils acht Bestattungen).
d. Die Anzahl ausschließlich Schmuckgegenstände
aufweisender Gräber ist sehr niedrig. In 64,7 % von diesen
(elf Bestattungen) wurden Frauen und in 29,4 % (fünf Be-
stattungen) Kinder beigesetzt. Nur eine Männerbestattung
ist in dieser archäologischen Merkmalsgruppe belegt.
e. Zu der drittgrößten archäologischen Merkmals-
gruppe gehören Bestattungen, bei denen Keramik mit Ge-
rätschaften kombiniert erscheint. Männer sind hier mit
einem Anteil von 65,7 % (121 Bestattungen), Frauen aber
nur mit 24,4 % (45 Bestattungen) vertreten, Kinder finden
sich zu 9,7 % (18 Bestattungen).
f. In der Merkmalsgruppe von Bestattungen, die sich
durch die Kombination von sonstigen Beigaben und
Schmuck, aber ohne die Niederlegung von Geräten aus-
zeichnen, treten erneut Frauen mit 76,3% (42 Bestat-
tungen) und Kinder mit 18,1% (zehn Bestattungen) in
den Vordergrund. Männer wurden nur in 5,4% (drei Bestat-
tungen) der Fälle mit solchen Kombinationen versehen.
g. Bestattungen, in denen Geräte mit Schmuckgegen-
ständen vergesellschaftet waren, kommen in sieben Män-
ner- und zwei Frauengräbern vor (0,7 % und 0,2 %).
h. Unter den Bestattungen, die sowohl Grabbeigaben
als auch Geräte und Schmuck aufweisen, sind Männer mit
einem Prozentsatz von 53,9 % (41 Bestattungen) überreprä-
sentiert. In 38,1 % (29 Bestattungen) solcher Gräber wurden
Frauen, in 7,8 % (sechs Bestattungen) Kinder beigesetzt.
Um die Hierarchie oder Rangordnung zwischen den mit
Gerätschaften ausgestatteten Bestattungen besser fassen
zu können, wurden sechs Gruppen und Untergruppen un-
terschiedlicher Fundspektren auf Basis ihrer Kombination
mit geschliffenen Steingeräten definiert (Tab. 5, Diagr. 6):
Gruppe 1
Keulengräber (4,7 %): In der Gruppe von 16 Keulengräbern
erscheint die geschliffene Steinkeule als die wichtigste Ge-
rätschaft („Machtabzeichen“). In 15 von 16 solcher Bestat-
tungen lagen Männerskelette und in einem Grab befand
sich ein Kinderskelett.
Untergruppe 1aIn nur einer Bestattung („Häuptlingsgrab“ 3060) wurde
eine Steinkeule zusammen mit einer geschliffenen stei-
nernen Axt (sowie mit je einem Steinbeil und Steinkeil)
beigesetzt.
Untergruppe 1bIn fünf Gräbern ist die Steinkeule mit Steinkeil/-beil kom-
biniert und mit einem Steinmesser bzw. mit anderen Si-
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
78 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
lexgeräten besonders reich ausgestattet. In diesen Bestat-
tungen lagen vier Männer und ein Kind.
Untergruppe 1cBei einem Männerskelett trat die Kombination von Stein-
keule und -beil ohne weitere Gerätschaften auf.
Untergruppe 1dFünf Männerskelette wiesen eine Kombination von Stein-
keule und Silexgeräten (einmal auch mit einer Angel aus
Knochen) ohne Steinkeil auf. In vier anderen Männerbe-
stattungen erscheint die Steinkeule im Grab als alleinige
Gerätebeigabe. Aufgrund der Kombinationsanalyse kann
demnach festgestellt werden, dass in der Gruppe der Keu-
lengräber eine Hierarchie nach Zahl und Zusammenset-
zung der Geräte klar erkennbar ist.
Gruppe 2
Axtgräber (33,6 %, 114 Bestattungen): In diesen Bestattun-
gen ist die geschliffene steinerne Schaftlochaxt das domi-
nierende Gerät. Ein wichtiges Phänomen ist, dass in 104
solcher Gräber Männer bestattet waren. Frauen wurden
nur in sechs, Kinder nur in vier Fällen mit einer Steinaxt
ausgestattet.
Untergruppe 2aAn der Spitze dieser Gruppe stehen acht Männergräber
und eine Frauenbestattung, in denen die Steinaxt mit
Steinkeil/-beil, -messer und mit Silices bzw. zuweilen mit
Knochen- oder Geweihgeräten vergesellschaftet waren.
Untergruppe 2bBei 19 Männer- und einem Frauengrab treten die Kombi-
nationen von Steinaxt und Steinkeil zusammen mit Silex-
geräten und manchmal auch mit Geweih- und Knochen-
geräten auf. Messer finden sich hier keine.
Untergruppe 2cIn 16 Gräbern fand man nur die Kombination von Stein-
axt und Steinkeil/-beil ohne andere Geräte. Neben 15 Män-
nern wurde auch ein Kind mit jener Kombination ausge-
stattet.
Diagr. 6: Verteilung der Geschlechter nach den für Geräte-Fundspektren definierten Gruppen 1–6
Tab. 5: Geräte-Fundspektren nach den anthropologischen Skelett-Daten von Alsónyék-Bátaszék
Geschlechtder Skelette
Geräte
Gruppe 1Keulengräber
Gruppe 2Axtgräber
Gruppe 3Beilgräber
Gruppe 4Messergräber
Gruppe 5Silexgräber
Gruppe 6Ahlengräber
7 11 81 30 12 33 2?7 3 20 8 1 9 3??7 1 3 2 1 3 16 – 3 2 1 40 17?6 – 3 1 – 6 6??6 – – 1 – 4 –Kind 1 4 3 6 13 4n = 339 16 114 47 21 108 33
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 79
Untergruppe 2dEs handelt sich in diesem Fall um neun Männerskelette,
bei denen die Steinaxt zusammen mit Steinmessern ohne
-keil oder -beil auftritt. Diese Gräber enthielten in einigen
Fällen auch Knochen- oder Geweihgeräte.
Untergruppe 2eIn 22 Männergräbern finden sich Kombinationen von
Steinaxt und Silexgeräten, dreimal auch mit Geweih- und
Knochengeräten.
Untergruppe 2fFür 38 Axtgräber ist das alleinige Vorkommen einer Stein-
axt typisch, dreimal wurden auch Knochengeräte beige-
geben. In 31 solcher Bestattungen lagen Männerskelette,
viermal wurden Frauen und dreimal auch Kinder entspre-
chend ausgestattet.
Hierarchische Abstufungen zwischen diesen Bestattun-
gen zeigen sich anhand der Qualität der Geräte wie auch
in deren Anzahl pro Grab.
Gruppe 3
Beilgräber (13,8 %, 47 Bestattungen): In diesen Gräbern
wurden geschliffene Steinbeile oder Steinkeile ohne Keule
oder Axt beigelegt.
Untergruppe 3aIn fünf Männer- und drei Frauengräbern ist das Beil oder
der Keil mit einem Steinmesser und/oder Silexgeräten,
einmal auch mit einer Geweihaxt vergesellschaftet. Eine
dieser Bestattungen sticht neben der Beigabe eines Stein-
messers durch 20 der Spaltindustrie zurechenbare Arte-
fakte hervor. In vier Gräbern fand sich das Beil mit nur
einem Steinmesser vergesellschaftet.
Untergruppe 3bDie Kombination von Steinbeil-/keil ist für 15 Männer-
und nur für zwei Frauenbestattungen sowie einer Kin-
derbestattung nachgewiesen. Die Zahl der Silexgeräte pro
Grab mag für diese Gräber das ausschlaggebende Ele-
ment einer Hierarchie im Kreis jener Bestatteten gewesen
sein. Bei zwölf Skeletten wurde nur je ein Silexgerät ge-
borgen.
Untergruppe 3c22 Männer und zwei Kinder wiesen ausschließlich je ein
geschliffenes Steinbeil oder einen geschliffenen Steinkeil
ohne weitere Gerätschaften auf.
Gruppe 4
Messergräber (6,1 %): Bei den Toten dieser 21 Bestattungen
können große Silexmesser als „führende“ Gerätschaft be-
zeichnet werden, geschliffene Steingeräte treten nicht
auf. Zwei Untergruppen lassen sich erkennen:
Untergruppe 4aIn Gräbern von neun Männern und drei Kindern sind
die Steinmesser mit kleineren Silexgeräten und/oder Kno-
chengeräten vergesellschaftet. Die Hierarchie unter die-
sen Bestattungen bildet sich anhand der Anzahl der Silex-
geräte pro Grab ab. In vier dieser Männergräber wurde
zudem eine Geweihaxt beigegeben.
Untergruppe 4bBei fünf Männern, einer Frau und drei Kindern erscheint
das Steinmesser ohne weitere Gerätschaften.
Die anthropologischen Untersuchungen weisen da-
rauf hin, dass große Silexmesser überwiegend von er-
wachsenen Männern und nur selten von Frauen getragen
und verwendet wurden. Aus sozialarchäologischer Sicht
ist die Feststellung wichtig, dass Steinmesser auch Kin-
dern – sogar Kleinkindern – in das Grab gegeben wur-
den. Die jüngsten Kinder mit Silexmesser waren 1, 2 bzw.
8–9 Jahre alt. Silexmesser in den Gräbern von Kleinkin-
dern beweisen, dass diesen Gegenständen auch eine Rolle
als Statussymbol zukam.
Gruppe 5
Silexgräber (31,8 %): In den 108 Gräbern dieser Gruppe
spielen verschiedene Typen geschlagenen Steingeräts
eine herausragende Rolle.
Untergruppe 5aSilices, die mit Knochen- oder Geweihgeräten kombiniert
wurden, sind für vier Männer- und drei Frauengräber ty-
pisch. Die Zusammensetzung und Qualität der miteinan-
der kombinierten Geräte kann auch in diesem Fall als Hin-
weis auf eine Hierarchie unter den Bestatteten verstanden
werden.
Untergruppe 5bAm umfangreichsten sind solche Bestattungen, in denen
ausschließlich kleinere Silexgeräte, selten auch Obsidian
gefunden wurde. Die Daten weisen dafür hin, dass die
überwiegende Mehrzahl der Toten in den „Silexgräbern“
mit ein bis drei Silexgeräten ausgestattet war. Vier bis
sechs Silices pro Grab treten schon bei deutlich weniger
Bestattungen auf. In nur 3,1 % der Silexgräber waren sie-
ben bis neun Spaltgeräte beigegeben. Dies schlüsselt sich
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
80 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
auf in fünf Männer- und je eine Frauen- und Kinderbestat-
tung. Zehn und mehr Silexgeräte pro Grab erscheinen in
nur fünf Männergräbern.
Nachweisbar ist also, dass umfangreiche Silexzahlen
pro Grab auch im Gräberfeld von Alsónyék-Bátaszék für
die Bestattung von Männern typisch sind. Dies gilt auch
für solche Gräber, bei denen Silexgeräte in kleineren
Gruppen in Skelettnähe platziert waren. Das bereits vor-
gestellte Grab 5603/927 zeichnet sich sogar durch zwei
Gruppen von Silices (Klingen und Trapeze) aus. Kollektio-
nen geschlagener Steingeräte wurden auch 8–9-jährigen
sowie 13–14 Jahre alten Kindern beigegeben. Anzuneh-
men ist, dass die Silexkollektionen in Behältnissen, even-
tuell in kleinen Gürteltaschen aus organischem Material,
getragen wurden. In 13 von 17 solcher Fälle waren sie
Männern und nur zweimal Frauen sowie einmal einem
Kind beigegeben worden. Für eine Bestattung liegt keine
Angabe zum Geschlecht vor. Sechs von zwölf Gräbern
mit Obsidianbeigabe waren Männerbestattungen, Frauen
wurden zweimal mit Obsidian ausgestattet und auch
einem 3–5 Jahre alten Kind war ein Obsidian beigegeben
worden. Für drei Erwachsenenbestattungen mit dieser
Beigabe ist das Geschlecht unbekannt. Das Männergrab
5603/927 ragt dabei mit einer außergewöhnlich großen
Zahl beigegebener Trapeze und Klingen aus der Zahl der
übrigen mit solchen Funden versehenen Männergräbern
hervor.
Gruppe 6
Gräber, die nur Knochengerätebeigaben aufweisen
(9,7 %): Bei den 33 Skeletten dieser Untergruppe fand man
ausschließlich Knochen- oder Geweihgeräte. In der Regel
lag nur jeweils ein Stück im Grab. Hierarchische Abstufun-
gen unter den Toten dieser Gruppe können nur auf Basis
der Qualität beigegebener Geräte vermutet werden.
Untergruppe 6aEine Geweihaxt wurde in einem Männer- und einem Kin-
dergrab geborgen.
Untergruppe 6bVerschiedene kleinere Knochengeräte sowie Ahlen und
Spitzen stammen aus 23 Frauen-, sechs Männer- und vier
Kinderbestattungen.
10,1 % (67 Gräber) der südtransdanubischen Lengyel-Be-
stattungen weisen Werkzeuge aus Knochen und Geweih
auf, wobei ihr Anteil in Hinsicht auf die sonst bekannten
Gerätschaften wiederum nicht mehr als 10,8 % (97 Bestat-
tungen) beträgt44. In Alsónyék-Bátaszék wurden solche
Gegenstände in 12,6 % (101 Bestattungen) der Gräber mit
Gerätschaften gefunden. Knochenahlen dominieren das
Spektrum vor Knochennadeln und Knochen- oder Ge-
weihspitzen. Geweihäxte stammen aus nicht mehr als
dreizehn Gräbern und Fischangeln aus Knochen oder Ge-
weih wurden in nur sechs Bestattungen entdeckt.
Das Geschlecht und/oder Sterbealter der Bestatteten
mit Geräten aus Knochen- oder Geweih ist in 75 Fällen be-
kannt. Frauen, denen Ahlen/Spitzen beigegeben wurden,
dominieren zu einem Prozentsatz von 54,3 % (25 Bestat-
tungen), Männer und Kinder sind mit 26,0 % (zwölf Bestat-
tungen) und 13,1 % vertreten. Aus sozialarchäologischer
Sicht ist beachtenswert, dass in 22,2 % (acht Bestattungen)
der Gräber mit Geweihaxtbeigabe Männer und einmal ein
Kind lagen. In vier anderen Bestattungen mit Fischangel-
beigabe waren Männer bestattet, bei zwei weiteren Grä-
bern ist das Geschlecht der Bestatteten unbekannt.
Grab 5603/927 von Alsónyék-Bátaszék enthielt keine
Schmuckstücke. Schmuck aus Kupfer, Muscheln, Geweih,
Knochen und anderen Materialen ist hier in 14,6% (235
Bestattungen) der untersuchten Gräber vertreten. Kupfer-
schmuck oder Spuren von solchem lassen sich bei
7,9% (zwölf Bestattungen) feststellen, Spondylusschmuck
konnte in 7,8% (126 Bestattungen) der Gräber nachgewie-
sen werden, während mit Dentaliumperlen ausgestattete
Bestattungen nur zu 5,3% (86 Bestattungen) erscheinen.
Schmuckartefakte aus Knochen, Geweih oder Tierzahn
(Armreife, Hirschgrandel, Eberhauerlamellen) sind in
1,0% (17 Bestattungen), solche aus anderen Materialien gar
nur noch aus 0,1% (drei Bestattungen) der Gräber bekannt.
Das Geschlecht und/oder Sterbealter der solche
Schmuckgegenstände aufweisenden Bestattungen ist in
162 Fällen bekannt: in 31,4 % (51 Bestattungen) lagen Män-
ner, in 49,3 % Frauen (80 Bestattungen) und nur in 11,7 %
Kinder aller Lebensphasen (19 Bestattungen).
Im Kreis der mit Kupferschmuck ausgestatteten Grä-
ber sind Männer mit 26,4 % (28 Bestattungen), Frauen
aber schon zu 55,6 % vertreten (59 Bestattungen). In 8,4 %
(neun Bestattungen) lagen Kinderskelette. Die Daten zei-
gen, dass kupferne Armreife nur von fünf Frauen getra-
gen wurden, in Männer- und Kindergräbern sind solche
Trachtgegenstände nicht belegt. Kupferne Fingerringe
fand man bei 13 Frauen- und nur vier Männerskeletten
bzw. bei zwei Erwachsenen unbekannten Geschlechts.
Die Beigaben Kupferamband- und -ring sind in Kinder-
gräbern nicht nachgewiesen. Unter den Bestattungen mit
Kupferperlen repräsentieren Frauen mit 41 Bestattungen
44 Zalai-Gaál 2010a, 116–117.
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes 81
einen Prozentsatz von 50,0 %, während mit 24 Bestattun-
gen Männer nur zu 29,7 % vertreten sind. Der Anteil von
Kindern und Erwachsenen unbekannten Geschlechts mit
dieser Beigabe beträgt 10,9 % (neun Bestattungen) und
9,7 % (acht Bestattungen).
Meermuschelschmuck findet sich in folgender Vertei-
lung nach Geschlecht und/oder Sterbealter: Den größten
Prozentsatz erreichen Frauen mit 60,1 % (62 Bestattun-
gen), Männer sind zu 27,1 % (28 Bestattungen) und Kinder
mit 8,7 % (neun Bestattungen) vertreten. Das Geschlecht
für vier Erwachsene (3,1 %) mit beigegebenem Muschel-
schmuck ist unbekannt.
Anhand der von uns vorgenommenen anthropologi-
schen Untersuchungen lassen sich ältere sozialarchäolo-
gische Studien widerlegen, deren Ergebnisse auf deutlich
kleineren Skelettserien basieren. So wurden etwa Arm-
reife aus Spondylus nicht nur von Frauen (sechs Bestat-
tungen) und Kindern (zwei Bestattungen), sondern auch
von Männern (zwei Bestattungen) getragen. Nicht einmal
die Deponierung von Spondylusanhängern (durchbohrte
Scheiben) kann als Hinweis auf das Geschlecht des Toten
verstanden werden. Solche Artefakte wurden in fünf Män-
ner- und vier Frauengräbern entdeckt.
Kopfschmuck aus zylindrischen Spondylusperlen
kam häufiger aus Männergräbern (vier Bestattungen) und
seltener aus Frauengräbern (zwei Bestattungen) zum Vor-
schein. Gleichzeitig sind Frauen nach dem Vorkommen
von Spondylusgürteln deutlich überrepräsentiert (zehn
Bestattungen), Männer wiesen nur in zwei Fällen und Kin-
der nur einmal diese Beigabe auf. Auch der Anteil von
Frauen mit beigegebenen scheiben- und fassförmigen
bzw. zylindrischen Spondylusperlen, die meistens Be-
standteile von Halsketten waren, ist um ein vielfaches grö-
ßer (40 Bestattungen), als es bei Männern (15 Bestattun-
gen), Kindern (sechs Bestattungen) sowie Erwachsenen
unbekannten Geschlechts (zwei Bestattungen) der Fall ist.
Vergleichbare Prozentsätze werden auch für Bestattungen
mit beigegebenem Dentaliumschmuck erreicht.
ErgebnisseIm hier vorgestellten lengyelzeitlichen Grab von Alsóny-
ék-Bátaszék wurde ein mit 50–59 Lebensjahren ziemlich
alter Mann beigesetzt. Orientierung und Körperlage des
Skelettes entspricht der allgemeinen Bestattungssitte der
spätneolithisch-frühkupferzeitlichen Lengyel-Kultur. In
anthropologischer Hinsicht kann gesichert festgestellt
werden, dass der Tote sich nicht von der überwiegenden
Mehrheit der in den südtransdanubischen Lengyel-Nekro-
polen untersuchten Individuen unterscheidet. Er war also
kein „Fremder“ oder „Neuankömmling“, wie man dies
vermuten könnte.
Als wichtigstes Merkmal seines Grabes können die in-
neren Gruben an den Ecken der Grabgrube bezeichnet
werden, bei denen es sich um Konstruktionsreste einer
ehemaligen Totenhütte handelt.
Wichtig ist auch die Beobachtung, dass diesem Mann
weder Schmuckgegenstände noch Keramikgefäße beige-
geben waren, obwohl die überwiegende Mehrzahl der
Lengyel-Bestattungen keramische Beigaben aufweist.
Trotz der im Vergleich mit anderen Gräbern zu erken-
nenden Unvollständigkeit der Beigabenausstattung er-
laubt die Zusammensetzung des Grabinventars die gesi-
cherte Annahme, dass der Tote im Sozialgefüge seiner Zeit
eine bedeutende Rolle einnahm.
Bereits die Kombination von Steinaxt, Steinbeil und
Silexmesser aus Importmaterial trägt wesentlich zur Un-
termauerung dieser Vermutung bei. Hinzu gelangen noch
zwei große Ensembles von Silexklingen und Trapezen (in
je einem Beutel), zwei Stück geschlagenen Steingeräts aus
Importmaterial sowie die markante und äußerst seltene
Kombination von Geweih- und Knochengegenständen/-
geräten wie Geweihaxt, Schulterblatt und Geweihstab.
Wie beschrieben dominieren unter den Rohmaterialien
der Silices örtliche und regional anstehende Gesteine und
auch hinsichtlich der Werkzeugtypen fällt ihre Homoge-
nität auf. Die Untersuchungen konnten belegen, dass der
hier bestattete Mann zu Lebzeiten sowohl auf örtliche
und regionale Rohmaterialbezugszonen, als auch auf jene
über Fernhandel Zugriff hatte. Einige Stücke seines Sile-
xinventars sind als Raritäten zu werten. Kein einziger die-
ser Silexfunde weist typologische Merkmale von Pfeilspit-
zen auf. Festgestellt werden konnte auch, dass – mit nur
drei Ausnahmen – alle Klingen sowie die Trapeze keiner-
lei Abnutzungsspuren aufweisen, sie also vor ihrer Nie-
derlegung nicht in Gebrauch waren.
Nur selten belegt ist die Kombination der bereits an-
geführten beigegebenen Tierknochen (Geweihstab, Schul-
terblattfragment und Balgkratzer). Ihr Auftreten in eini-
gen frühkupferzeitlichen Gräbern dürfte auch als Hinweis
auf territoriale und zeitlich begrenzte Beziehungen zwi-
schen der späten Lengyel-Kultur und der Tiszapolgár-Kul-
tur zu verstehen sein.
Nach der hier für den Fundplatz vorgestellten Gliede-
rung von Gerätespektren und deren sozialarchäologische
Deutung zählt die Bestattung 5603/927 zur Fundgruppe 2
(Axtgräber) und Untergruppe 2a mit ihrer Kombination
von Steinaxt-, -beil und -messer sowie Silices und Ge-
weih-/Knochengeräten. Ausgehend von den beigegebe-
nen Stein-, Geweih- und Knochengeräten können wir
begründet annehmen, dass der im Grab 5603/927 von Al-
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14
82 István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
1. ZeileÜberhang
sónyék-Bátaszék beigesetzte ältere Mann im Leben seiner
Gemeinschaft oder sogar in mehreren Gemeinschaften der
späten Lengyel-Kultur eine bedeutende Position als Hand-
werker und/oder Händler gehabt haben dürfte.
Literatur
Alekszejev/Debec 1964: V. P. Alekszejev/G. F. Debec, Kraniometrija(Moszkva 1964).
Aufderheide/Rodriguez-Martin 1998: A. C. Aufderheide/C. Rodri-guez-Martin, The Cambridge Encylopedia of Human Paleopatho-logy (Cambridge 1998).
Bácskay 1989: E. Bácskay, A lengyeli kultúra néhány DK-dunántúlilelöhelyének pattintott köeszközei I. Commun. Arch. Hungariae1989, 5–21.
– 1990: –, A lengyeli kultúra pattintott köeszközei a DK-Dunántú-lon II. Commun. Arch. Hungariae 1990, 59–66.
Bernert 2005: Zs. Bernert, Kárpát-medencei történeti népességekvégtagarányai és testmagassága. In: Z. Korsós (Red.), IV. Kár-pát-medencei Biológiai Szimpózium, Elöadások összefoglalói(Budapest 2005) 35–43.
Bíró 1988: K. T. Bíró, Distribution of lithic raw materials on prehisto-ric sites. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 40, 1988, 251–274.
– 1989: –, A lengyeli kultúra dél-dunántúli pattintott köeszköz-le-letanyagainak nyersanyagáról I. Commun. Arch. Hungariae1989, 22–30.
– 1998: –, Lithic implements and the circulation of the raw mate-rials in the Great Hungarian Plain during the Late NeolithicPeriod (Budapest 1998).
Bognár-Kutzián 1963: I. Bognár-Kutzián, The Copper Age Cemetery ofTiszapolgár-Basatanya. Arch. Hungarica 42 (Budapest 1963).
Camps-Fabrer/D’Anna 1977: H. Camps-Fabrer/A. D’Anna, Fabricationexpérimentale d’outils partir métapodes de mouton et tibias delapin. In: H. Camps-Fabrer (Hrsg.), Méthodologie appliquée àl’industrie de l’os dans la Préhistoire, Deuxième Colloque Inter-national sur l’Industrie de l’os dans la Préhistoire, Abbaye deSénanque (Vaucluse), 9.–12. juin 1976 (Paris 1977) 311–323.
Choyke 1984: A. M. Choyke, An analysis of bone, antler and toothtools from Bronze Age Hungary. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad.Wiss. 12–13, 1984, 13–57.
Dimitrov 2002: K. Dimitrov, Die Artefakte aus Felsstein und ihreNachahmungen. In: H. Todorova (Hrsg.), Durankulak, Band II,Teil 1. Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak. DAIBerlin (Sofia 2002) 207–212.
Inizan u.a. 1999: M.-L. Inizan/M. Reduron-Ballinger/H. Roche/J.Ticier, Technology and Terminology of Knapped Stone. Préhis-toire de la Pierre Taillée (Nanterre 1999).
Kaczanowska 1985: M. Kaczanowska, Rohstoffe, Technik und Typo-logie der neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil desFlussgebietes der Mitteldonau (Warszawa 1985).
Martin/Saller 1957: R. Martin/K. Saller, Lehrbuch der Anthropologie III (Stuttgart 1957).
Mateibiucová 2008: I. Mateibiucová, Talking stones: The ChippedStone Industry in Lower Austria and Moravia and the Beginningsof Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC (Brno 2008).
Meindl/Lovejoy 1985: R. S. Meindl/C. O. Lovejoy, Ectocranial sutureclosure: A revised method for the determination of skeletal age
at death based on the lateral-anterior sutures. American JournalPhysical Anthr. 67, 1985, 51–63.
Mester 2009: Zs. Mester, Nyersanyagbeszerzés és -feldolgozás egyfelsö paleolit telepen: Andornaktálya-Zúgó-dülö. In: G. Ilon(Red.): MVMOS VI. – Öskoros Kutatók VI, 2009. Összejövetelé-nek konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. Kös-zeg, 2009. Március 19.–21. (Szombathely 2009) 239–254.
Nemeskéri/Harsányi/Acsádi 1960: J. Nemeskéri/L. Harsányi/Gy.Acsádi, Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelett-funden. Anthr. Anz. 24, 1960, 70 95.
Pearson 1899: K. Pearson, On the Reconstruction of the Stature ofPrehistoric races. Mathematical Contribution to the Theory ofEvolution, V. Philosoph. Transact. of Royal Soc. Ser. A. CXCII,1899, 169 244.
Perizonius 1981: W. R. K. Perizonius, Diachronic Dental Research onHuman Skeletal Remains excavated in the Netherlands. I. Ber.van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemaderzoek 31,1981, 369 413.
Rösing 1988: F. W. Rösing, Körperhöhenrekonstruktion aus Skelett-massen. In: R. Knussman (Hrsg.), Anthropologie 1 (Stuttgart1988) 586 600.
Schibler 1981: J. Schibler, Typologische Untersuchungen der cortail-lodzeitlichen Knochenartefakte. Die neolithischen Ufersiedlun-gen von Twann (Bern 1981).
Sjøvold 1990: T. Sjøvold, Estimation of stature from long bones utilizingthe line of organic correlation. Human Evolution V, 1990, 431 447.
Zalai-Gaál 2009: I. Zalai-Gaál, Zur Herkunft des Schädelkults im Neo-lithikum des Karpatenbeckens. Archaeolingua Ser. Min. 27(Budapest 2009).
– 2010a: –, Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Süd-transdanubiens. Die Funde und Befunde aus den alten Ausgra-bungen. Varia Arch. Hungarica 24 (Budapest 2010).
– 2010b: –, Die Gefäßbestattungen der Lengyel-Kultur und ihreBeziehungen zum südosteuropäischen Neolithikum. Stud.Praehist. 13, 2010, 213–240.
– /Osztás 2009: –/A. Osztás, Neue Aspekte zur Erforschung desNeolithikums in Ungarn. Ein Fragenkatalog zu Siedlung und Grä-berfeld der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In:V. Becker/M. Thomas/A. Wolf-Schuler (Hrsg.), Zeiten – Kulturen –Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Schr. Zentr. Arch. Kult-gesch. Schwarzmeerraumes 17 (Langenweißbach 2009) 111–139.
Zalai-Gaál u.a. 2009: I. Zalai-Gaál/E. Gál/K. Köhler/A. Osztás, Eber-hauerschmuck und Schweinekiefer-Beigaben in den neolithi-schen und kupferzeitlichen Bestattungssitten des Karpatenbe-ckens. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 60, 2009, 303–355.
– u.a. 2010: K. Köhler/A. Osztás, Zur Typologie und Stellung vonKulttischchen der Lengyel-Kultur im mittel- und südosteuropäi-schen Neolithikum. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 61,2010, 307–385.
– u.a. 2011a: E. Gál/K. Köhler/A. Osztás, Das Steingerätedepotaus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék,Südtransdanubien. Beitr. z. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropas 63= Varia Neolithica 7 (Langenweißbach 2011) 65–83.
– u.a. 2011b: –/–/–/–, „Ins Jenseits begleitend“: Hundemitbe-stattungen der Lengyel-Kultur von Alsónyék-Bátaszék. ActaArch. Acad. Scien. Hungaricae 62, 2011, 29–74.
Zalai-Gaál u.a. 2011c: I. Zalai-Gaál/A. Osztás/K. Köhler, Totenbrettoder Totenhütte? Zur Struktur der lengyelzeitlichen Gräber mitPfostenstellung Südtransdanubiens. Acta Arch. Acad. Scien.Hungaricae (i. Dr.).
István Zalai-Gaál et al., Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 212.87.45.97
Heruntergeladen am | 30.10.12 12:14