Phonische Variation in der weißrussischen „Trasjanka“. Sprachwandel und Sprachwechsel im...
-
Upload
uni-hamburg -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Phonische Variation in der weißrussischen „Trasjanka“. Sprachwandel und Sprachwechsel im...
Studia Slavica Oldenburgensia
hrsg. von Rainer Grübel, Gerd Hentschel und Gun-Britt Kohler
27
BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Phonische Variation in der weißrussischen „Trasjanka“
Sprachwandel und Sprachwechsel im weißrussisch-russischen Sprachkontakt
Jan Patrick Zeller
Oldenburg, 2015
Verlag/Druck/Vertrieb
BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Postfach 2541 26015 Oldenburg E-Mail: [email protected]
Internet: www.bis-verlag.de
ISBN 978-3-8142-2328-5
v
Inhaltsverzeichnis
Vorwort xi Teil I Einleitung – Hintergrund – Methode
1 Einleitung 3
2 Weißrussisch-russische gemischte Rede (WRGR) 13 2.1 Zur Stellung von WRGR innerhalb der Sprachenarchitektur von
Belarus 13 2.2 Zur Entstehung von WRGR 19 2.3 Überlegungen zum linguistischen Status von WRGR 26
3 Phonische Variation in weißrussisch-russischer gemischter Rede – Hintergrund und Fragestellung 37
3.1 Phonische Variation im Sprachkontakt, insbesondere im Kontakt eng verwandter Varietäten 37
3.2 Fragestellung: Phonische Variation in WRGR 44 3.3 Die untersuchten Phänomene 53 3.4 Forschungsstand zur phonischen Variation im Kontakt des
Weißrussischen und des Russischen 61
4 Methodisches 67 4.1 Akustische Phonetik als Methode der Variationslinguistik 67 4.2 Datengrundlage 68 4.2.1 Das Oldenburger Korpus zur WRGR 68 4.2.2 Die untersuchten Städte 70 4.2.3 Methode der Aufnahme und Charakterisierung der Aufnahmen 73 4.2.4 Auswahl und Charakterisierung der Informanten 74 4.2.5 Auswahl, Aufbereitung und Auswertung der Daten 77 4.3 Statistische Methoden 80 4.4 Die erklärenden Variablen 83
vi
Teil II Analysen der Einzelphänomene
5 Variation im Vokalismus 99 5.1 Einleitung 99 5.2 Methode 100 5.2.1 Akustische Eigenschaften von Vokalen 100 5.2.2 Auswahl, Segmentierung und Erhebung der Messwerte 103 5.2.3 Normalisierung 104 5.3 Betonte Vokale 107 5.3.1 Hintergrund 107 5.3.2 Einige allgemeine Beobachtungen zum betonten Vokalismus
in WRGR 110 5.3.3 Eine exemplarische Analyse anhand der Variation von
betontem /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in WRGR 116 5.4 Unbetonte Vokale 123 5.4.1 Hintergrund 123 5.4.2 /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in unmittelbar
vorbetonten Silben – die Variable (Akanje1) 127 5.4.2.1 Dissimilatives Akanje in WRGR 132 5.4.2.2 Zur nicht-dissimilativen Realisierung von (Akanje1) in WRGR 139 5.4.3 /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in weiteren
vorbetonten Silben – die Variable (Akanje2) 146 5.4.4 /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in unmittelbar
vorbetonten Silben – die Variable (Jakanje1) 155 5.4.4.1 Dissimilatives Jakanje in WRGR 162 5.4.4.2 Zur nicht-dissimilativen Realisierung von (Jakanje1) in WRGR 168 5.4.5 /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in weiteren
vorbetonten Silben – die Variable (Jakanje2) 184 5.4.6 /e/ und /o/ nach „verhärteten“ Konsonanten in unmittelbar
vorbetonten Silben – die Variable (e /Š_) 191 5.5 Zusammenfassung zum Vokalismus 194
vii
6 Variation im Bereich der Sibilanten 201 6.1 Einleitung 201 6.2 Variation von affriziertem [ʦ"] und [ʣ"] und plosivem [tʲ] und
[dʲ] – zur Artikulationsart der Variablen (tʲ) und (dʲ) 204 6.2.1 Hintergrund 204 6.2.2 Zur phonetischen Unterscheidung von Affrikaten und Plosiven 206 6.2.3 Zur Dauer von (tʲ) und (dʲ) in WRGR 207 6.3 Variation im Artikulationsort der vorderen palatalisierten
Sibilanten – die Variablen (tʲ), (dʲ) und (sʲ) 212 6.3.1 Hintergrund 212 6.3.2 Methode 215 6.3.2.1 Zur akustisch-phonetischen Unterscheidung von Sibilanten 215 6.3.2.2 Auswahl, Segmentierung und Erhebung der Messwerte 218 6.3.2.3 Normalisierung 220 6.3.3 Ein Vergleich zwischen den vorderen palatalisierten
Sibilanten in WRGR 224 6.3.4 Zum Artikulationsort von (sʲ) in WRGR 227 6.3.5 Zum Artikulationsort von (tʲ) in WRGR 231 6.3.6 Zum Artikulationsort von (dʲ) in WRGR 234 6.3.7 Zusammenfassung zu den vorderen palatalisierten Sibilanten 235 6.4 Variation in der Palatalisiertheit und im Artikulationsort der
postalveolaren Sibilanten – die Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ) 240 6.4.1 Hintergrund 240 6.4.2 Zum Artikulationsort von (ʧʲ) in WRGR 244 6.4.3 Zur Palatalisiertheit von (ʧʲ) in WRGR 248 6.4.4 Zur Palatalisiertheit von (ʃʲ) in WRGR 255 6.4.5 Zusammenfassung zu den postalveolaren Sibilanten 257 6.5 Zusammenfassung zu den Sibilanten 259
7 Variation von palatalisiertem [rʲ] und nicht- palatalisiertem [r] – die Variable (rʲ) 263
7.1 Hintergrund 263 7.2 Methode 266 7.2.1 Zur akustisch-phonetischen Unterscheidung von [r] und [rʲ] 266 7.2.2 Vorgehen 267 7.3 Zur Unterschiedlichkeit von (r) und (rʲ) in WRGR 269 7.4 Zur Realisierung von (rʲ) in WRGR 271 7.5 Zusammenfassung zur Variable (rʲ) 280
viii
8 Variation von [ɣ] und [g] – die Variable (g) 283 8.1 Hintergrund 283 8.2 Zur Realisierung von (g) in WRGR 287 8.3 Zusammenfassung zur Variable (g) 296
9 Variation von [u] und [v] – die Variable (v) 299 9.1 Hintergrund 299 9.2 Zur Realisierung von (v) in WRGR 301 9.3 Zusammenfassung zur Variable (v) 309 Teil III Vertiefung – Zusammenfassung – Fazit
10 Phonische Variation in weißrussisch-russischer gemischter Rede – Zusammenführung und Vertiefung der Ergebnisse 313
10.1 Einleitung 313 10.2 Zum Grad der phonischen Variation in WRGR
im weiteren Sinne 317 10.3 Zum Zusammenhang der phonischen Variation mit strukturell
tieferen Sprachebenen 325 10.4 Zum Grad der phonischen Variation in WRGR
im engeren Sinne 335 10.5 Zum Zusammenhang zwischen den phonischen Variablen 341 10.6 Sprechertypen 348 10.7 Akkommodation an den Gesprächspartner 356
11 Zusammenfassung und Fazit 365
Quellenverzeichnis 389 Korpus 389 Literatur 389 Software 418
ix
Anhang 421 I. Zu Kapitel 5: Vokalismus 421 a. Mittelwerte der „Hauptallophone“ der betonten Vokale 421 b. (Akanje1) 423 c. (Akanje2) 431 d. (Jakanje1) 439 e. (Jakanje2) 447 II. Zu Kapitel 6: Sibilanten 455 a. Zur Dauer von (tʲ) und (dʲ) 455 b. Gravitationszentren der Sibilanten 456 c. Formanteneinstiege nach (ʧʲ) 462 III. Zu Kapitel 7: (rʲ) 470 IV. Zu Kapitel 8: (g) 479 V. Zu Kapitel 9: (v) 480 VI. Zu Kapitel 10: Phonische Variation 481 a. 10.2 Variation 481 b. 10.3 Affinität 483 c. 10.6 Sprechertypen 486 d. 10.7 Akkommodation 489
xi
Vorwort
Die vorliegende Untersuchung ist eine leicht überarbeitete Version meiner Dissertation, die im Jahre 2014 von der Fakultät für Sprach- und Kulturwis-senschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg angenommen wurde. Entstanden ist diese Arbeit im Rahmen des Forschungsprojektes „Die Trasjanka in Weißrussland – eine ‚Mischvarietät’ als Produkt des weißrus-sisch-russischen Sprachkontakts. Sprachliche Strukturierung, soziologische Identifikationsmechanismen und Sozioökonomie der Sprache“. Dieses Pro-jekt wurde in den Jahren 2008–2013 unter der Leitung von Prof. Dr. Gerd Hentschel (Institut für Slavistik, Universität Oldenburg) und Prof. Dr. Bern-hard Kittel (Institut für Sozialwissenschaften, Universität Oldenburg, heute Institut für Wirtschaftssoziologie, Universität Wien) in Kooperation mit Prof. Dr. David Rotman (Zentrum für politische und soziologische Forschungen, Weißrussische Staatsuniversität Minsk) und Dr. Sjarhej Zaprudski (Lehrstuhl für Geschichte der weißrussischen Sprache, Weißrussische Staatsuniversität Minsk) durchgeführt. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine Förderung der VolkswagenStiftung im Rahmen des Programmes „Einheit in der Vielfalt“.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen bedanken, die mich bei der Entstehung der Dissertation unterstützt haben. Zunächst gebührt mein Dank Herrn Prof. Dr. Gerd Hentschel, der meine Arbeit betreut und mich stets mit Rat und Tat unterstützt hat. Auch Herrn Prof. Dr. Jörg Peters und Herrn Prof. Dr. Christian Sappok danke ich für die schnelle Begutachtung der Arbeit und ihre wertvollen Hinweise.
Durch diese Arbeit konnte ich ein faszinierendes Land mit liebenswerten Menschen kennenlernen. Im Wintersemester 2011/2012 erhielt ich durch die Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes die Möglichkeit, ein Semester in Minsk verbringen und damit meine Arbeit entscheidend voranbringen und gleichzeitig das alltägliche Leben in Belarus erleben zu können, wofür ich sehr dankbar bin. Mein besonderer Dank gilt meinem Minsker Betreuer Herrn Prof. Dr. Mikalaj Pryhodzič. Für Rat und Unterstützung während dieser Zeit bedanke ich mich zudem bei Frau Dr. Veronika Kurcova, Frau Dr. Natallja Veremeeva, Herrn Prof. Dr. Henadz’ Cychun, Herrn Prof. Dr. David Rotman und Herrn Dr. Andrej Zinkevič. Ich danke Dr. Taccjana Ramza, Alena und Uladzimir Ljankevič und Julija Šajtar für ihre Gastfreundschaft, für ihre Mühen, mir die weißrussische Sprache beizubringen, und für ihre Hilfe bei den nicht wenigen Behördengängen. Sie
xii
und viele andere, die ich in Minsk, Brėst, Vicebsk, Polack und Hrodna kennenlernen durfte, haben diese Zeit auch persönlich für mich zu einem Gewinn gemacht.
Für das Korrekturlesen verschiedener Teile meiner Arbeit danke ich mei-nen Kollegen Natallja Kraŭčanka, Sviatlana Tesch, Lars Behnke, Sabine Anders-Marnowsky und meinem Bruder Tim. Frau Dr. Dagmar Divjak bin ich für den für mich ersten und – wie man feststellen wird – sehr wichtigen Hinweis auf das statistische Verfahren der Mehrebenenanalyse dankbar. Ich danke meinen zahlreichen „Doktorschwestern“ und „Doktorbrüdern“, „Doktorcousinen“ und „Doktorcousins“ und Kolleginnen und Kollegen in Minsk und Oldenburg für inhaltliche und nicht-inhaltliche Unterstützung, hierunter außer den bereits genannten Oksana Brandes, Marija Bratus, Mark Brüggemann, Beata Chachulska, Kacjaryna Danilava, Lesya Kochubey, Margarete Kandlin, Kristina Kloss, Kristina Kromm, Thomas Menzel, Eva Meyer, Natallja Pachomčyk, Anastasia Reis, Martin Renz und Igor Smirnov.
Frau Prof. Dr. Gun-Britt Kohler, Herrn Prof. Dr. Rainer Grübel und Herrn Prof. Dr. Gerd Hentschel bin ich für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe Studia Slavica Oldenburgensia zu Dank verpflichtet.
Zu guter Letzt und dennoch allen voran danke ich meiner Freundin, meinen Eltern und meiner ganzen Familie.
Oldenburg, im April 2015
3
1 Einleitung
Offiziell ist Belarus ein zweisprachiges Land, mit den beiden gesetzlich gleichberechtigten Staatssprachen Weißrussisch/Belarussisch1 und Russisch. Bekanntlich verdeckt diese offizielle Seite zum einen die Schieflage, die zwischen beiden Sprachen besteht. Das Russische dominiert gegenüber dem Weißrussischen klar sowohl in allen öffentlichen und formellen Bereichen, als auch in halb- und inoffiziellen Kontexten. Dem Weißrussischen kommt vor allem in seiner Standardform insgesamt nur eine marginale Rolle zu. Zum anderen verdeckt der Begriff der Zweisprachigkeit die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung von Belarus zumindest in gewissen Gesprächs-situationen in ihrer Rede „gleichzeitig“ Züge beider offiziell im Lande ge-brauchten Sprachen aufweisen (vgl. z.B. VEŠTORT 1999). Solch „weißrus-sisch-russische gemischte Rede“ (WRGR), das gemeinsame Auftreten von Elementen und Strukturen in engen Skopen der Rede, von welchen einige aus der Außenperspektive der weißrussischen, andere der russischen Sprache (inklusive deren Subvarietäten) zuzuordnen wären, ist der Gegenstand dieser Untersuchung. Es wird die Variation von phonischen (phonologischen und „rein“ phonetischen) Merkmalen der beiden Kontaktsprachen in diesem rezenten Phänomen des Kontakts zweier eng verwandter und strukturell ähnlicher Sprachen untersucht.
In der weißrussischen Gesellschaft und auch in der belorussistischen Sprachwissenschaft bestehen Stereotype zur WRGR und zu deren Sprechern. Gemischte Rede wird mit Metaphern wie „unreines Russisch/Weißrussisch“ versehen und geradezu als Index oder sogar Ursache eines kulturellen Nie-dergangs verstanden.2 Auch wenn auf der anderen Seite auch Anlass zur
1 In dieser Arbeit wird die Bezeichnung „weißrussisch“ benutzt. 2 Dies spiegelt sich auch in der in Belarus üblichen Bezeichnung „Trasjanka“ wider,
ursprünglich eine Bezeichnung für eine Mischung aus Heu und Stroh, d.h. gestrecktes, qualitativ minderwertiges Viehfutter (vgl. CYCHUN 2013 [1998], 19). Die dahinterstehende Metaphorik ist offensichtlich. Aufgrund dieser negativen Konnotation wird im Folgenden auf die Verwendung des Begriffs „Trasjanka“ verzichtet und stattdessen von „weißrussisch-russisch gemischter Rede“ (WRGR) gesprochen. Ähnlich negative Reaktionen sind auch
4
Annahme besteht, dass WRGR mitunter positiver bewertet wird, mithin ein verstecktes Prestige aufweisen kann (vgl. KITTEL et al. 2010, 54), ist die Meinung weit verbreitet, dass WRGR ein Merkmal wenig gebildeter und sozial niedrigerer Schichten sei und dass Sprecher gemischter Rede aktiv nur diese und kein Standardrussisch beherrschten. Neuere Studien wie KITTEL et al. (2010) zeigen dagegen, dass WRGR in allen Bildungsschichten und auch bei Sprechern des Standardrussischen verbreitet ist. Die Entwicklung zu einem solchen Massenphänomen ist eng verbunden mit einer massiven Migration in die Städte in der zweiten Hälfte des 20. Jh., in deren Folge sich eine Vielzahl von bis dahin weitgehend (dialektal) weißrussischsprachigen Menschen dem sozial dominanten Russischen zuzuwenden hatten (vgl. ZAPRUDSKI 2007).
WRGR war bis vor kurzem wohl aufgrund des overt negativen Prestiges nicht systematisch untersucht und eher Gegenstand politischer als linguisti-scher Debatten sowie von Arbeiten zur „Sprachkultur“ bzw. „Redekultur“. Den ersten breiten und fundierten Untersuchungsansatz stellt das von der Volkswagenstiftung geförderte Projekt Die Trasjanka in Weißrussland – Eine Mischvarietät als Folge des weißrussisch-russischen Sprachkontakts. Sprachliche Strukturierung, soziologische Identifikationsmechanismen und Sozioökonomie der Sprache dar, welches von 2008 bis 2013 von Gerd Hentschel (Institut für Slavistik, Universität Oldenburg) und Bernhard Kittel (Institut für Sozialwissenschaften, Universität Oldenburg/Institut für Wirt-schaftssoziologie, Universität Wien) zusammen mit Siarhej Zaprudski (Ab-teilung für Geschichte der Weißrussischen Sprache, Weißrussische Staats-universität Minsk) und David Rotman (Zentrum für Soziale und Politische Forschungen, Weißrussische Staatsuniversität Minsk) durchgeführt wurde. Die Daten, auf denen die vorliegende Arbeit beruht, entstammen diesem Projekt. Es handelt sich dabei um einen Teil des ersten großen Korpus von Instanzen von WRGR. Dieses setzt sich zusammen aus spontanen, familiä-ren, also informellen Gesprächen von Familien aus sieben weißrussischen Städten.
Eine der zentralen Fragen des Projekts ist, inwieweit WRGR auf einem System einer neuen, usuell normierten und fokussierten Varietät beruht. Dies
für die verwandte Erscheinung der ukrainisch-russisch gemischten Rede, des sogenannten Suržyks, zu beobachten. Auch in anderen Kontaktsituationen besitzen Formen gemischter Rede ein negatives Prestige (vgl. AUER 1999). Wie jedoch unter anderem das Beispiel süd-deutscher Städte zeigt, in denen dialektal-standardsprachlich-gemischte Formen keine stig-matisierte Redeweise darstellen, muss dies nicht der Fall sein.
5
ist eine Frage, die – nach Klärung theoretischer Bewertungskriterien – nur empirisch zu beantworten ist, und zwar durch das Aufzeigen stabiler quanti-tativer Verhältnisse in unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Korpora. Aufgrund externer Evidenz – der Weitergabe von WRGR an min-destens eine weitere Generation, der weiten Verbreitung in der belarussischen Gesellschaft – ist eine solche Stabilisierung zu erwarten. Bekannt ist, dass in vergleichbaren Situationen des Kontakts eng verwandter und strukturell ähn-licher sprachlicher Varietäten sich relativ schnell, d.h. im Laufe einiger we-niger Generationen, neue, „gemischte“ Varietäten herausbilden können, die Züge der Ausgangsvarietäten, aber auch neue Merkmale aufweisen können. Die Ergebnisse des Oldenburger Projekts zeigen, dass eine solche Stabilisie-rung in bestimmten Bereichen vorhanden ist (vgl. Abschnitt 2.3).
Als nah verwandte Sprachen unterscheiden sich das Weißrussische und das Russische in vielen phonischen Aspekten nicht voneinander. In einigen Bereichen bestehen jedoch mehr oder weniger deutlich wahrnehmbare Unter-schiede zwischen beiden Sprachen. Es sind diese Merkmale des Weißrussi-schen (inklusive dessen Subvarietäten), deren Variation mit ihren russischen Entsprechungen in dieser Arbeit untersucht wird. Dies soll kurz begründet werden.
Zunächst ist es natürlich so, dass für die Klassifizierung von Rede als „gemischter Rede“ (ebenso wie von Sprachen als „Mischsprachen“) unstritti-gerweise Phänomene der ersten Artikulation im Sinne von MARTINET (1949) einschlägig sind. Die Variation von „rein“ phonischen Merkmalen des Weiß-russischen und des Russischen ist weniger aussagekräftig. Es ist daher ein grundlegender Ansatz des Oldenburger Projekts, die Beschreibungsebenen der morphonemischen Repräsentation und der phonischen Realisierung strikt zu trennen, d.h. streng zwischen Phänomenen der ersten Artikulation und sol-chen der zweiten zu unterscheiden (HENTSCHEL & TESCH 2007, 19f.; HENTSCHEL 2008c, 179–188). Ein „weißrussischer Akzent“ findet sich auch bei Sprechern des russischen Standards in Belarus und zwar nicht nur bei Sprechern, deren Erstsprache das Weißrussische war, das Russische eine später erlernte Sprache. Aussagekräftiger ist die Koexistenz von Merkmalen des Weißrussischen und des Russischen, die die tieferen Ebenen der Lexik, der Morphologie, der (Morpho-)Syntax betreffen, mithin die weniger stark automatisierten und bewussteren Ebenen des „Ausdrucks- und Inhaltsplans“ (vgl. HENTSCHEL 2008c, 194).
Dies heißt jedoch nicht, dass die phonische Seite von WRGR nicht von Relevanz wäre – sowohl für das Verständnis des Phänomens WRGR aus
6
linguistischer Sicht als auch aus Sicht der Sprecher in der Sprachenlandschaft von Belarus. Erstens lässt sich die phonische Seite als Indikator für den Grad des Einflusses des Russischen auf die Rede von Weißrussen im Allgemeinen auffassen. Bekanntlich zeichnen sich phonische Merkmale der Erst- bzw. Ausgangssprache im Sprachkontakt durch eine hohe Resistenz gegenüber Einflüssen einer anderen Sprache aus, in dem Sinne, dass phonische Merk-male der Ausgangssprache in stärkerem Maße als Merkmale anderer sprach-licher Ebenen in die Zielsprache übertragen werden. Aufgrund der Entste-hungsgeschichte der WRGR ist dementsprechend zu erwarten, und dies wird von den meisten Beobachtern auch so eingeschätzt, dass ihre phonische Seite „weißrussisch“, also wenig vom Russischen beeinflusst sei. Das Aufzeigen eines russischen Einflusses im phonischen Bereich selbst der familiären, ungezwungenen Redeweise würde also den beträchtlichen Einfluss des Rus-sischen in der weißrussischen Gesellschaft allgemein abbilden.
Lautliche Korrespondenzen zeichnen sich zweitens durch ihre Regelmä-ßigkeit und hohe Tokenfrequenz aus und sind daher nicht nur in einem kontrastiv-linguistischen Sinn, sondern auch aus der Perspektive der Sprecher selbst gute Unterscheidungsmerkmale zwischen den sprachlichen Varietäten (vgl. FBLM 1989, 314f.). Wie die Variationslinguistik zeigt, sind phonische Phänomene dementsprechend soziolinguistisch relevant und aufgrund ihrer hohen Tokenfrequenz vielleicht sogar von einer höheren Relevanz als Merk-male anderer Ebenen, d.h. sie korrelieren mit sozialen Faktoren und können auch von Sprechern funktional (bei unterschiedlichem Grad der Bewusstheit) zur Akkommodation an Gesprächspartner oder sozial anstrebenswerte Vor-bilder eingesetzt werden. Die soziolinguistische Relevanz von sprachlicher Variation gilt ebenfalls (und vielleicht umso mehr) für kontaktbedingte Vari-ation wie im vorliegenden Fall. Für den Fall Belarus spielt hier der vielzi-tierte Konflikt beider Sprachen in der weißrussischen Gesellschaft eine Rolle, verbunden mit bestimmten Konnotationen, die mit beiden Sprachen bzw. mit deren Merkmalen verbunden werden. Die Variation von phonisch ‚Weißrus-sischem‘ und ‚Russischem‘3 in den in Belarus verbreiteten Sprachen bzw. Varietäten wurde quantitativ-empirisch bisher jedoch kaum untersucht (vgl. MEČKOVSKAJA 1994, 312). Aus vergleichbaren Situationen des Kontakts eng verwandter Sprachen ist bekannt, dass in den ersten Sprechergenerationen der
3 In dieser Arbeit stehen Sprachbezeichnungen in einfachen Anführungszeichen wie ‚rus-
sisch‘ oder ‚weißrussisch‘ für „mit dem Russischen/Weißrussischen übereinstimmend“ (vgl. HENTSCHEL 2008c). Näheres hierzu siehe am Ende dieses Kapitels sowie insbeson-dere in Abschnitt 4.4.
7
entstehenden „Mischvarietät“ ein großes Maß an Variabilität vorliegt, wobei die Wahrscheinlichkeit für die eine oder die andere Variante oder, im Falle von graduellen Unterschieden, die Nähe zu dem einen oder anderen Pol der Variablen von außersprachlichen Faktoren wie der Generation und dem Ge-schlecht oder auch der Gesprächssituation abhängt. Entsprechendes ist auch für WRGR zu erwarten.
Auch wenn phonische Elemente allein nicht als hinreichendes Kriterium für WRGR gesehen werden, so ist drittens unbestritten, dass auch Phäno-mene, die zunächst als Akzenterscheinungen der Erstsprache in einer Art Lernervarietät der Zielsprache vorhanden sind oder als Akkommodation an den Gesprächspartner oder an sozial erstrebenswerte Vorbilder übernommen werden, sich zunächst bei dem individuellen Sprecher und dann über die Generationen hinweg in einer Sprachgemeinschaft verfestigen können, sich letztlich also „gemischte“ phonetisch-phonologische Systeme herausbilden können. Wie in anderen Bereichen auch würde das Aufzeigen von stabilen Mustern, eines überindividuellen Usus – gerade wenn sowohl Elemente aus dem Russischen als auch solche aus dem Weißrussischen auftreten – für die Existenz von Spezifika von WRGR sprechen, die über Phänomene der individuellen Rede hinausgehen, also auf ein überindividuelles System schließen lassen.
Viertens lässt sich die phonische Seite als ein Indikator für die Unter-schiedlichkeit bzw. Eigenständigkeit von Kodes verstehen. Nach AUER (1986, 99) ist von unterschiedlichen eigenständigen Varietäten auszugehen, wenn drei Nachweise erbracht sind: der Nachweis „unterschiedlicher, nicht nur tendenziell formulierbarer situativer Verwendungsbedingungen für die Varietäten“, der Nachweis „einer Interpretation des Repertoires durch die Sprecher selbst, die der linguistischen Einteilung entspricht und diese erst als emisch ausweist“ und schließlich der Nachweis „der internen Kohäsion und Konsistenz der Varietäten als sprachlicher ‚Codes‘ (d.h. die Variation inner-halb einer postulierten Varietät muss deutlich geringer sein als die Variation zwischen den Varietäten)“. Während die ersten beiden Aspekte in der vorlie-genden Arbeit nicht untersucht werden (aber in den einführenden Teilen der Arbeit durchaus angesprochen werden), ließe sich eine phonische Unter-schiedlichkeit von Äußerungen, die auf tieferen Ebenen – der lexikalischen, morphologischen, (morpho-)syntaktischen – als ‚russisch‘, ‚weißrussisch‘ oder ‚weißrussisch-russisch-gemischt‘ betrachtet werden können, als ein Aspekt der Kohärenz und Konsistenz von WRGR und damit als weiteres
8
Argument für deren Status als eigenem Dritten neben dem Weißrussischen und dem Russischen auffassen.
Die genannten vier Punkte sind Aspekte, die das Verständnis des Phäno-mens WRGR betreffen, und deren Behandlung auch das zentrale Ziel dieser Arbeit ist. Darüber hinaus ist abschließend natürlich zu fragen, welche Be-deutung die Ergebnisse für einen allgemeinen kontaktlinguistischen Rahmen haben, was die Analyse des Phänomens WRGR also zum Verständnis von Sprachkontakt, Sprachmischung und „exogenem“ Sprachwandel im Allge-meinen beitragen kann. Dass das Erlernen einer anderen Sprache im Erwach-senenalter von größeren Bevölkerungsgruppen zur Entstehung neuer Varie-täten mit fossilisierten Interferenzerscheinungen führen kann, ist bekannt. Es gibt jedoch kaum Studien, die diesen Entstehungsprozess im Detail zeigen. Es sind zudem in aller Regel entweder nicht bzw. entfernt verwandte sprach-liche Varietäten, die dabei untersucht werden, oder Varietäten, die sehr eng verwandt sind und auf strukturell tieferen Ebenen nur sehr geringe Unter-schiede aufweisen. Wie schon angedeutet, ist das Spezifische des Kontakts von WRGR, dass einerseits die beteiligten Kontaktsprachen gegenseitig rela-tiv verständlich und strukturell ähnlich sind, andererseits aber auch nicht zu vernachlässigende lexikalische, morphologische, morphosyntaktische Unter-schiede zwischen beiden Sprachen bestehen.
Es sind also drei aufeinander aufbauende Fragenkomplexe, die in dieser Ar-beit behandelt werden:
1) Wie fällt die phonische Seite der WRGR dort aus, wo das Weißrussi-sche und das Russische divergieren? Welche sprachlichen und außer-sprachlichen Faktoren spielen dabei eine Rolle?
2) Was sagen die Befunde aus 1) über das Phänomen WRGR aus?
3) Wie lassen sich die Befunde aus 1) und 2) in einen allgemeinen kon-takt- und variationslinguistischen Kontext einordnen? Was tragen die Ergebnisse zu dem Verständnis von Sprachkontakt, Sprachmischung, „exogenem“ Sprachwandel bei?
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:
Kapitel 2 bietet einen kurzen Überblick über die sprachsoziologische Stel-lung von WRGR in der weißrussischen Sprachenlandschaft. Es wird auf die Entstehung von WRGR als das Massenphänomen eingegangen, das es heute ist. Auf diesem Hintergrund und auf den empirischen Ergebnissen des
9
Oldenburger Projekts aufbauend werden einige Überlegungen zum linguisti-schen Status von WRGR angestellt.
Kapitel 3 entwickelt ausgehend von einigen allgemeinen Aspekten der phonischen Variation im Kontakt eng verwandter Varietäten vor dem Hinter-grund der Spezifika von WRGR die bereits angedeuteten Fragestellungen dieser Arbeit. Es werden zudem die in dieser Arbeit untersuchten phonischen Phänomene vorgestellt. Bei diesen handelt es sich um die wichtigsten rein phonetisch-phonologisch (und nicht morphonologisch) beschreibbaren Un-terschiede zwischen den beiden Kontaktsprachen. Anschließend wird auf den Forschungsstand zur phonischen Variation in WRGR und bei anderen Phä-nomenen des Kontakts des Weißrussischen mit dem Russischen eingegangen.
Kapitel 4 stellt die Methoden dieser Arbeit vor. Die Mehrzahl der hier untersuchten Variablen wird instrumentalphonetisch untersucht. Dies ge-währleistet zum einen ein höheres Maß an Objektivität, zum anderen ermög-licht es diese Methode, graduelle und subtile Unterschiede auszumachen. Es werden die Datengrundlage, die Prinzipien der Auswertung und die statisti-schen Methoden der Analyse vorgestellt sowie die Faktoren, deren Einfluss auf die phonische Seite der WRGR überprüft wird.
In den Kapiteln 5 bis 9 wird die Realisierung bzw. Variation der einzel-nen Variablen analysiert. Kapitel 5 behandelt Variation im vokalischen Be-reich, insbesondere im Bereich des unbetonten Vokalismus. Hier sind in beiden Sprachen Neutralisierungen bestimmter Vokaloppositionen zu be-obachten, jedoch mit unterschiedlichen phonetischen Ergebnissen. Kapitel 6 behandelt das Sibilantensystem. Hierbei geht es erstens um die affrizierten palatalisierten4 vorderen Affrikaten [ʦ"] und [ʣ"] des Weißrussischen, denen im Russischen die (evtl. leicht affrizierten) Plosive [tʲ] und [dʲ] entsprechen. Zweitens geht es um die im Vergleich zum Russischen leicht nach hinten versetzte Artikulation der vorderen palatalisierten Sibilanten. Drittens wird die Variation von weißrussischem nicht-palatalisierten [t ʂ] mit dem palatali-sierten [ʧʲ] des Russischen sowie die Variation von weißrussischem [ʂt ʂ] mit russischem [ʃʲː] behandelt. Kapitel 7 geht auf die Variation von palatalisier-tem [rʲ] und nicht-palatalisiertem [r] ein. Im Weißrussischen wurde das histo-rische und im Russischen erhaltene /rʲ/ entpalatalisiert, so dass das Weißrussi-sche nur ein Phonem /r/ aufweist, wo das Russische eine Opposition /rʲ/ vs. /r/ hat. Kapitel 8 zeigt die Variation des stimmhaften Velarphonems als Plosiv
4 Hier und im Folgenden wird das Epitheton „palatalisiert“ im Sinne von „palatal koartiku-
liert“ verwendet.
10
[g] (oder [k]) wie im Russischen oder als Frikativ [ɣ] (oder [x]) wie im Weiß-russischen. Kapitel 9 behandelt die Variation zwischen dem (halb-)vokali-schen [u/u] als Realisierung von /v/ des Weißrussischen mit dem Frikativ [v] (oder [f]) des Russischen.
Im Mittelpunkt dieser Kapitel steht der potentielle Einfluss zweier Fakto-ren. Erstens werden unterschiedliche Sprechergenerationen miteinander ver-glichen. Diese unterscheiden sich nicht nur im Alter, sondern weisen sehr unterschiedliche (Sprach-)Biographien auf, die den demographischen Um-wälzungen der weißrussischen Gesellschaft der zweiten Hälfte des 20. Jh. entsprechen. Zweitens wird der Zusammenhang mit der lexikalisch-morpho-logischen, ggf. morphosyntaktischen Seite der Äußerung oder der Wortform, also mit der „Affinität“ dieser Einheiten auf strukturell tieferen Ebenen zum Russischen und/oder Weißrussischen untersucht. Es wird geprüft, ob die phonische Ausprägung sich unterscheidet, je nachdem ob der Sprecher einen abgesehen von der phonischen Seite mit dem Weißrussischen, dem Russi-schen oder in einigen Teilen mit dem Russischen, in anderen mit dem Weiß-russischen übereinstimmenden, also ‚gemischten/hybriden‘ Satz äußert. Zu-dem werden weitere Faktoren untersucht, die sich in ähnlichen Situationen des Sprachkontakts als einflussreich erweisen, etwa das Geschlecht des Sprechers, der phonische Kontext, die Gebrauchshäufigkeit eines Lexems und dergleichen.
Vor dem Hintergrund der eingangs genannten Aspekte und Fragestellun-gen führt Kapitel 10 die Ergebnisse der Kapitel 5 bis 9 zusammen und er-weitert sie um einige allgemeine Analysen. Es wird zusammengefasst, wel-che erklärenden Faktoren sich als einflussreich erwiesen haben. Auch hier stehen die Faktoren Generation und Affinität der gegebenen sprachlichen Einheit (also deren Übereinstimmung auf tieferen sprachlichen Ebenen mit dem Weißrussischen und/oder Russischen) im Vordergrund. Es wird insbe-sondere auf das Zusammenspiel bzw. auf die Interaktionen beider Parameter eingegangen. Darüber hinaus wird das Ausmaß der Variabilität sowohl zwi-schen den Sprechern als auch im Redeverhalten ein und desselben Sprechers untersucht. Dabei wird unterschieden zwischen der Gesamtmenge an Äußerungen der Sprecher, und solchen, die auf tieferen Ebenen ‚weißrus-sisch-russisch-gemischt‘ sind, also ‚russische‘ und ‚weißrussische‘ Elemente enthalten. Zudem wird untersucht, ob Sprecher auf der phonischen Ebene insgesamt konstant eher zu einer ‚russischen‘ oder zu einer ‚weißrussischen‘ Artikulation tendieren, ob also Zusammenhänge zwischen den phonischen Variablen bestehen, und ob diese Zusammenhänge für einige phonische
11
Variablen stärker sind als für andere, ob also innerhalb der phonischen Vari-ablen bestimmte Gruppen auszumachen sind, für die die Sprecher konstant entweder zum ‚russischen‘ oder zum ‚weißrussischen‘ Pol tendieren. Darauf-hin wird geprüft, ob innerhalb der Sprechergenerationen weitere Unter-schiede bestehen, und zwar zwischen Sprechertypen, die auf den tieferen sprachlichen Ebenen stärker zum Weißrussischen neigen, und solchen, die stärker zum Russischen tendieren. Abschließend wird die Frage in den Blick genommen, ob sich Sprecher in unterschiedlichen Gesprächskonstellationen sprachlich unterschiedlich verhalten, genauer, ob sprachliche Anpassungs-erscheinungen an Vertreter anderer Generationen vorliegen.
Abschließend werden die Ergebnisse im letzten Kapitel zusammengefasst und in einen allgemeinen kontaktlinguistischen Rahmen eingeordnet.
Aus dem Gesagten wird klar, dass in dieser Arbeit eine globale Perspektive eingenommen wird. Phänomene der Mikrostruktur, d.h. pragmatische, emotionale, thematische Aspekte der Gespräche und deren Zusammenspiel mit der phonischen Variation werden nicht untersucht. Dass solche Untersu-chungen auf der Diskursebene lohnenswert sind und die hier gewählte Per-spektive gleichberechtigt ergänzen sollten, ist natürlich unbestritten und wird abschließend an einem Beispiel auch angedeutet. Wie im gesamten Olden-burger Projekt geht es jedoch zunächst um die Erfassung der bis jetzt völlig unbeschriebenen Gesamtverhältnisse der WRGR, die eine Interpretation punktueller Erscheinungen im Gespräch erst möglich macht. Für die Zukunft sind in der Oldenburger Projektgruppe stärker diskursorientierte, syntagmati-sche Analysen geplant.
Schließlich seien noch einige Notationskonventionen erwähnt:
Phonetische Zeichen entsprechen (wenn sie nicht gesondert kommentiert werden) weitestgehend den Konventionen des Internationalen Phoneti-schen Alphabets (IPA 2005). Auf die Darstellung eventueller durch die palatale Koartikulation bedingter Unterschiede im primären Artiku-lationsort, die in dem entsprechenden Zusammenhang nicht relevant sind, wird verzichtet. Der palatalisierte Lateral des Russischen/Weißrus-sischen wird mit [lʲ] gekennzeichnet (und nicht mit [ʎ]), der nicht-pala-talisierte Lateral mit [l], die palatalisierten velaren Plosive mit [kʲ] und [gʲ] (und nicht mit [c] und [ɟ]). In russisch- oder weißrussischsprachigen Zitaten werden die im Original benutzten kyrillischen phonetischen Zei-chen transliteriert oder, im Falle von <ъ>, <ь>, <ʌ>, als phonetische Zei-chen übernommen.
12
Variablen werden der variationslinguistischen Konvention folgend in einfache runde Klammern gesetzt: (g) bezeichnet also die Kontexte, in denen das Russische ein /g/ aufweist, das Weißrussische ein /ɣ/.
Für die Darstellung von etymologischen Lautklassen im Gegensatz zu synchronen Phonemen werden senkrechte Striche benutzt: |e| bezeichnet also diejenigen heutigen Vorkommen von /e/ und /o/, die auf das histori-sche /e/ zurückgehen.
Wie bereits erwähnt stehen Sprachbezeichnungen in einfachen Anführungs-zeichen wie ‚russisch‘ oder ‚weißrussisch‘ für „mit dem Russischen/Weiß-russischen übereinstimmend“, und zwar im Sinne eines expliziten und theore-tisch fundierten Klassifikationsalgorithmus (vgl. HENTSCHEL 2008c). Das Attribut ‚hybrid‘ steht für „in einigen Aspekten/Elementen mit dem Russischen, in anderen mit dem Weißrussischen übereinstimmend“. Als ‚gemeinsam‘ werden Einheiten bezeichnet, die sowohl mit dem Russischen, als auch mit dem Weißrussischen übereinstimmen, für die zwischen den beiden Sprachen also keine Unterschiede bestehen (mehr hierzu in Abschnitt 4.4). Dies gilt auch dann, wenn diese Attribute auf phonische Phänomene bezogen werden.
13
2 Weißrussisch-russische gemischte Rede (WRGR)
2.1 Zur Stellung von WRGR innerhalb der Sprachenarchitektur von Belarus
Wie bereits eingangs erwähnt, ist Belarus offiziell ein bilingualer Staat, mit den beiden offiziell gleichberechtigten Staatssprachen Russisch und Weiß-russisch. Russisch dominiert jedoch gegenüber dem Weißrussischen klar in allen Bereichen. Das Weißrussische ist heute eine bedrohte Sprache, sowohl was die Anzahl ihrer Sprecher angeht, als auch in Bezug auf ihre Polyfunk-tionalität.5 Der Status des Weißrussischen ist geprägt von einer vielzitierten Diskrepanz zwischen dem symbolischen Wert und dem tatsächlichen Ge-brauch: Während sich vergleichsweise viele Menschen zum Weißrussischen als Muttersprache bekennen, geben bedeutend weniger an, Weißrussisch im Alltag zu benutzen. Dieses auf den ersten Blick widersprüchliche Verhalten wird durch den symbolischen Wert des Begriffs ‚Muttersprache‘6 erklärt. Das Bekenntnis zum Weißrussischen als Muttersprache entgegen dem tatsächli-chen Sprachgebrauch drückt die Verbundenheit mit dem eigenen Land aus (vgl. MEČKOVSKAJA 1994, 2002; ZAPRUDSKI 1996, 2007; SJAMEŠKA 1998; GUTSCHMIDT 2000; MOSER 2000; RADZIK 2000, 2004; HENTSCHEL 2003; SCHROEDER 2004; TÖRNQUIST-PLEWA 2005; PAVLENKO 2006; KITTEL et al. 2010; HENTSCHEL & KITTEL 2011 u.a.m.). Allerdings gehen auch in dieser Kategorie die offiziellen Zahlen für das Weißrussische zurück: Die Zahlen des Zensus von 2009 zeigen im Vergleich zum Zensus von 1999 sowohl in der symbolischen als auch in der kommunikativen Funktion herbe Verluste für das Weißrussische zugunsten des Russischen. 1999 gaben noch ein gutes Drittel der Gesamtbevölkerung und vier von zehn „ethnischen“, d.h. ihre „Nationalität“ als weißrussisch (und nicht russisch, ukrainisch, polnisch) bezeichnenden Weißrussen das Weißrussische als „normalerweise zu Hause
5 Das Weißrussische wird auch von der Unesco als „vulnerable“ eingestuft (MOSELEY 2010). 6 Die Entsprechung zum deutschen Wort „Muttersprache“ ist im Weißrussischen „rodnaja
mova“, im Russischen „rodnoj jazyk“. Das Attribut „rodnaja“ bzw. „rodnoj“ ist am ehesten mit ‚leiblich‘ oder ‚Heimat-‘ zu übersetzen und metaphorisch zu interpretieren (vgl. HENTSCHEL & KITTEL 2011, 112).
14
gesprochene Sprache“ („jazyk, na kotorom obyčno razgovarivajut doma“) an. 2009 waren es bei den ethnischen Weißrussen nur noch 26% (PN 1999; PN 2009:3, 355). Deutlich ist auch der Rückgang in der Kategorie „Mutterspra-che“ („rodnoj jazyk“). 1999 gaben knapp 86% der ethnischen Weißrussen Weißrussisch als Muttersprache an, 2009 waren es nur noch 61%. Das Russi-sche hatten 1999 nur 14% der ethnischen Weißrussen als Muttersprache angegeben, 2009 waren es 37% (PN 2009:3, 318). Allerdings sind bereits diese geringen Zahlen für das Weißrussische mit Vorsicht zu genießen. Wie oft betont wird, ist zweifelhaft, dass die Befragten, die „Weißrussisch“ ange-ben, auch tatsächlich die Standardform des Weißrussischen verwenden. Problematisch ist zudem, dass die Möglichkeit der Angabe gemischter Rede nicht gegeben wird. In einer Vielzahl der Fälle verbergen sich hinter der Angabe „Weißrussisch“ sicherlich dialektale Formen, eventuell auch Formen von WRGR (vgl. SADOŬSKI 1982, 176; SCHROEDER 2004, 85; WOOLHISER 2005, 251). KITTEL et al. (2010) und HENTSCHEL & KITTEL (2011), die „ge-mischte Sprache“ als Antwortmöglichkeit zulassen, haben Ergebnisse, die den peripheren Status des Weißrussischen sogar noch dramatischer erschei-nen lassen (s.u. in diesem Abschnitt).
Die sprachliche Seite geht einher mit einer traditionell als schwach aus-geprägt angesehenen nationalen Identität (vgl. z.B. MEČKOVAKAJA 1994; WOOLHISER 1995; SMITH et al. 1998; BEYRAU & LINDNER 2001; TÖRN-QUIST-PLEWA 2005; PAVLENKO 2006). Das Bewusstsein einer Eigenständig-keit und Andersartigkeit gegenüber Russland sei in Belarus im Vergleich etwa zur Ukraine eher schwach ausgeprägt, es bestehe ein Gefühl der Zu-sammengehörigkeit mit Russland (RADZIK 2004, 57; 2006, 94). Neben der lange fehlenden staatlichen Eigenständigkeit spielen sicherlich weitere Fakto-ren eine Rolle, etwa der in Belarus im Vergleich zur Ukraine gegen Null tendierende Einfluss der unierten Kirche (BIEDER 2000). HENTSCHEL & KITTEL (2011, 131–133) deuten jedoch Gegenteiliges an: Die Frage, ob man gleichzeitig Russe und Weißrusse sein könne, beantwortet eine knappe Mehrheit zwar zustimmend. Auf die Frage, „als was sie sich sehen, als Weiß-russe, als Weißrusse und Russe, als Russe“ antworten jedoch mehr als 90% mit „als Weißrusse“.
Was die Gebrauchsdomänen beider Sprachen angeht, so dominiert Rus-sisch gegenüber dem Weißrussischen klar in allen Funktionsbereichen. Rus-sisch überwiegt im öffentlichen Leben, den Massenmedien, dem Bildungs-wesen, dem Buchmarkt, bei den Regierungs- und Verwaltungsorganen, dem Geschäftswesen, der Wissenschaft, während Weißrussisch in diesen Berei-
15
chen keine (in der Wissenschaft abgesehen von der Nationalphilologie und vielleicht den auf Belarus bezogenen Geschichtswissenschaften) oder nur eine marginale (beispielsweise in den Medien) Rolle spielt (MEČKOVSKAJA 2002, 126; ZAPRUDSKI 2007, 98). Im Alltag wird die weißrussische Stan-dardsprache nur von wenigen nationalbewussten Intellektuellen benutzt. Die Wahl des Weißrussischen in der Öffentlichkeit und im Privaten ist damit als Zeichen der Verbundenheit mit der weißrussischen Sprache und evtl. als Ausdruck einer politischen Geisteshaltung symbolisch aufgeladen (ZAPRUDSKI 1996, 193f.; MOSER 2000, 188; MEČKOVSKAJA 2002, 135; RADZIK 2004, 59; TÖRNQUIST-PLEWA 2005, 113f.).
Auf der individuellen Ebene ist Zweisprachigkeit (in einem gewissen Sinne, zu einer differenzierten Diskussion siehe unten 2.3) in Belarus weit verbreitet, die große Mehrheit der Bevölkerung versteht beide Sprachen, wohl auch eine Mehrheit ist zu einem gewissen Grad in der Lage, beide zu sprechen (ŠMELEV 1986, 7; BIEDER 1995a, 406). Russisch wird dabei fast durchgehend beherrscht, für das Weißrussische sieht das Bild differenzierter aus.7 Beide Sprachen sind häufig von Interferenzen aus der anderen Sprache geprägt.8 Das Russische in Belarus zeichnet sich durch eine Reihe von vor allem phonischen Einflüssen aus dem (dialektalen) Weißrussischen aus, und dies nicht nur bei Sprechern, die im Laufe ihres Lebens vom Weißrussischen zum Russischen gewechselt sind, sondern auch bei weitgehend mit dem
7 SCHROEDER (2004) behandelt die Ergebnisse einer Umfrage aus 1999. Ihr Sample von ca.
1000 ausgewerteten Personen stellt einen Querschnitt der Bevölkerung dar. Von ihren Informanten geben 87,8% an, Russisch aktiv zu beherrschen, 96,0% beherrschen ihrer eigenen Auskunft nach Russisch passiv. Während 88,4% angeben, dass sie Weißrussisch mündlich verstehen und 73,6%, dass sie es fließend lesen, geben nur 62,1% an, dass sie es fließend sprechen, und nur 53,0%, dass sie ohne Schwierigkeiten Weißrussisch schreiben. Bereits 1994 konstatiert MEČKOVSKAJA (1994, 311), dass das Vermögen, die weißrussische Standardsprache zu gebrauchen, bei den damals unter 45-jährigen nicht in der Familie, son-dern in der Schule vermittelt worden sei. Angesichts der Tatsache, dass Standardweißrus-sisch sich nie völlig durchgesetzt hat, ist natürlich fraglich, ob dies in größerem Umfang jemals anders gewesen ist. Ein Drittel der Befragten in HENTSCHEL & KITTEL (2011, 128) gibt an, Weißrussisch nie zu verwenden. Junge Weißrussen schätzen ihre aktiven Fähig-keiten im Weißrussischen bedeutend schlechter ein als im Russischen (vgl. HENTSCHEL et al. i. Vorb.).
8 DINGLEY (1989, 186) behauptet, dass in der BSSR grundsätzlich keine Sprache perfekt beherrscht werde. Dies ist aber eher eine konzeptionelle Frage als eine empirische. Sie hängt mit der Variationstoleranz in einer Sprachenlandschaft zusammen, welche in der stark auf die Varietäten der Hauptstadt Moskau und eventuell St. Petersburgs ausgerichte-ten russischen Sprachenlandschaft eher gering war und ist.
16
Russischen sozialisierten Sprechern und bei ethnisch russischer Bevölkerung (SADOŬSKI 1982, 177; SJAMEŠKA 1998, 39).9
Wenn eingangs gesagt wurde, dass das Russische in allen Bereichen klar über das Weißrussische dominiert, so bedeutet dies nicht, dass es in allen Bereichen insgesamt dominiert. Vor allem in inoffiziellen, teilweise aber auch in offiziellen Situationen ist in Belarus zu beobachten, dass Sprecher innerhalb von Äußerungen, Sätzen, Phrasen und teilweise sogar innerhalb von einzelnen Wortformen nicht nur phonische Elemente, sondern auch Elemente (Morpheme, Lexeme) und Strukturen (Rektionsmuster) tieferer Sprachebenen sowohl des Weißrussischen als auch des Russischen aufweisen (ZAPRUDSKI 2007, 111). Solche weißrussisch-russisch gemischte Rede ist anerkanntermaßen „an important part of the linguistic landscape in contem-porary Belarus“ (WOOLHISER 2005, 251) und auf dem gesamten Territorium von Belarus anzutreffen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird in Bela-rus selbst dieses Phänomen alltagssprachlich, aber auch im publizistischen und wissenschaftlichen Diskurs als „Trasjanka“ bezeichnet. Dieser zunächst von sprachbewussten Laien verwendete Begriff bezeichnet, wie bereits ge-sagt, ursprünglich eine Mischung aus Heu und Stroh, d.h. gestrecktes, qualitativ minderwertiges Viehfutter (vgl. CYCHUN 2013 [1998], 19). Die Übertragung dieses Begriffs auf gemischte Rede zeigt bereits deutlich das negative Prestige, das gemischter Rede nach Meinung aller Beobachter anhaftet. Dieses negative Prestige gelte – so die generelle Einschätzung – auch für die Sprecher selbst (CYCHUN 2000; LISKOVEC 2005, 106). Diese Einschätzungen sind unten in gewisser Hinsicht zu revidieren.
Einig sind sich alle Betrachter, dass es sich bei WRGR um ein Massenphänomen handelt, wobei die tatsächlichen Sprecherzahlen bis vor kurzem nur zu erahnen waren. Zudem finden sich (ungeprüfte) Behauptungen zur Verbreitung von WRGR in einzelnen Bevölkerungsschichten, von denen die gängigste ist, dass WRGR vor allem oder ausschließlich bei Sprechern unterer sozialer und Bildungsschichten verbreitet sei (z.B. bei SJAMEŠKA
9 Dieser weißrussische „naciolekt“ des Russischen (MICHNEVIČ 1985, 11) liefert einen
wichtigen Vergleichswert für die phonische Seite der WRGR (vgl. Abschnitt 3.4). Auch beim Gebrauch der weißrussischen Standardsprache finden sich weißrussische dialektale Merkmale, welche auch an nachfolgende Generationen weitergegeben werden (FBLM 1989, 8; KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 10f.). Dementsprechend gibt es regionale Unter-schiede in der Standardsprache, die oft als Abweichungen von der Norm interpretiert wer-den (VYHONNAJA 1982, 169). Auch Interferenzen des Russischen sind natürlich anzuneh-men, werden aber in der Literatur vergleichsweise selten behandelt.
17
1998, 40). Dies steht im Zusammenhang mit der ebenfalls oft anzutreffenden Annahme, dass WRGR auf ein Unvermögen zurückgeht, Russisch und/oder Weißrussisch in deren Standardform zu verwenden. Eine für die Belorussistik typische Aussage ist folgende:
Admetnyja rysy trasjanki paljahajuc’ u nastupnym: 1) na trasjancy razmaŭljajuc’ ljudzi z pačatkovaj abo njapoŭnaj sjarėdnjaj adukacyjaj; 2) nos’bity trasjanki aktyŭna valodajuc’ tol’ki adnym idyëmam – menavita trasjankaj; 3) tamu ljudzi, što razmaŭljajuc’ na trasjancy, faktyčna ne vybirajuc’ [Hervorhebung im Original gesperrt, PZ] movu, ne peraključajucca z koda na kod, ne dbajuc’ pra «čyscinju» i «pravil’nascʼ» ruskaha ci belaruskaha maŭlennja (tamu ŭ ich maŭlenni ne byvae hiperkarėktnych z’jaŭ), ne ihrajuc’ stylistyčnymi kantrastami i ne cytujuc’ klasikaŭ (tamu ŭ ich maŭlenni njama svjadomych zapazyčannjaŭ z ruskaj movy), a prosta razmaŭljajuc’, jak umejuc’.
[Die Erkennungsmerkmale von Trasjanka bestehen in Folgendem: 1) Trasjanka sprechen Menschen mit Grundschulbildung oder nicht abgeschlossener Mittlerer Schulbildung; 2) Träger der Trasjanka beherrschen aktiv nur ein Idiom – eben Trasjanka; 3) Menschen, die Trasjanka sprechen, wählen daher die Sprache faktisch nicht aus, wechseln nicht von einem Kode in den anderen, kümmern sich nicht um die „Reinheit“ oder „Korrektheit“ der russischen oder weißrussischen Rede (daher kommen in ihrer Rede keine hyperkorrekten Formen vor), spielen nicht mit stilistischen Kontrasten und zitieren keine Klassiker (daher gibt es in ihrer Rede keine bewussten Entlehnungen aus dem Russischen), sondern sprechen einfach, wie sie es können.] (MEČKOVSKAJA 2007, 96)10
KITTEL et al. (2010) und HENTSCHEL & KITTEL (2011) belegen dagegen die weite Verbreitung von WRGR in allen Bevölkerungsschichten und Bildungs-schichten:11 In einer Umfrage vom Herbst 2008 in sieben weißrussischen
10 „Pačatkovaja adukacyja“, hier übersetzt mit „Grundschulbildung“, entspricht vier
abgeschlossenen Schuljahren. „Sjarėdnjaja adukacyja“, hier übersetzt mit „Mittlere Schulbildung“, entspricht elf abgeschlossenen Schuljahren.
11 Es gibt einige ältere Umfragen, die ebenfalls Angaben zur Verbreitung von WRGR enthal-ten. Unter Städtern geben Ende der 1970er Jahre jeweils knapp 60% an, WRGR am Arbeitsplatz und zu Hause zu sprechen (SOBOLENKO 1980, 213). ZAPRUDSKI (1996, 240) und LISKOVEC (2005, 94f., Fn. 93) berichten von einer Umfrage aus dem Jahre 2001, in der ein Drittel der Bevölkerung von Belarus angibt, im Alltag WRGR zu gebrauchen. In den Daten von SCHROEDER (2004) wird WRGR (in ihrem Fragebogen: „Russisch-Weißrussisch gemischt“) verhältnismäßig selten angegeben (4,4% geben an, WRGR als erste Sprache gesprochen zu haben, 9,2% geben an, dass WRGR in ihrer Familie gesprochen wird).
18
Städten12 mit insgesamt 1400 zufällig ausgewählten Befragten gaben von denjenigen weißrussischer Nationalität (1230 Fälle) 29,6% Russisch als Muttersprache an, 48,6% Weißrussisch und 37,6% „die gemischte Sprache“ („smešannyj jazyk“), wobei Mehrfachantworten möglich waren. 37,9% ge-ben „die gemischte Sprache“ außerdem als zusätzliche im Alltag gesprochene Sprache an (Weißrussisch 20%, Russisch 44,5%). Insgesamt bekannten sich in dieser Umfrage also drei Viertel der Befragten zur WRGR. Sprecher von WRGR sind in allen untersuchten Städten vertreten (allerdings mit großen Unterschieden, in Minsk und Slonim sind es nur 19%, in Akcjabrski dagegen 59%.). Die Sprecherverteilung auf die Bildungsschichten zeigt entgegen den üblichen Annahmen kaum größere Unterschiede zwischen den Sprachen (KITTEL et al. 2010, 60f.),13 es handelt sich also keineswegs um ein Phäno-men der unteren Bildungsschichten. Die Autoren konstatieren, dass dem Russischen und der WRGR im heutigen Belarus, was die Sprachökonomie angeht, ein beträchtlich höherer Wert als dem Weißrussischen zukomme (KITTEL et al. 2010, 57).14 Die Ergebnisse wiesen auf die Möglichkeit eines kompletten Sprachwechsels auf der Standardebene zum Russischen hin, während auf der Ebene der Subvarietät WRGR die weißrussischen Dialekte ablöse (KITTEL et al. 2010, 66).
Die Ergebnisse aus KITTEL et al. (2010) und HENTSCHEL & KITTEL (2011) zeigen zudem, dass WRGR bzw. „die gemischte Sprache“ im Sprecherbewusstsein der weißrussischen Bevölkerung als eigene Kategorie existiert (was sich auch in dem eigenständigen Glottonym „Trasjanka“ aus-drückt). Von einem großen Teil der Befragten (knapp 40%) wird sie nicht als Varietät des Russischen oder Weißrussischen, sondern als „language in its own right“ betrachtet (KITTEL et al. 2010, 54). Auch LISKOVEC (2005, 75f.) bezeugt, dass im Bewusstsein der Bevölkerung eine klare Unterscheidung
12 Diese sprachsoziologische Umfrage ist ebenfalls Teil des von der Volkswagenstiftung
geförderten Projekts Die Trasjanka in Weißrussland. Die in die Umfrage einbezogenen Städte sind die, aus denen auch die Daten der vorliegenden Arbeit stammen, mit Ausnahme der Stadt Baranavičy. Statt in dieser wurde die Umfrage im benachbarten und vergleichbar großen Slonim durchgeführt.
13 Es findet sich lediglich ein höherer Wert für das Russische als Muttersprache in höheren Bildungsschichten (KITTEL et al. 2010, 61). Auch LISKOVEC (2005, 93 und 105) berichtet anekdotenhaft von „Ärzten und Professoren“, die WRGR sprächen.
14 Auch CYCHUN (2000) stellt fest, dass trotz des negativen Prestiges WRGR in der städti-schen Landschaft von Belarus ein hohes Maß an sprachlicher Integration bedeutete. Vgl. auch ZAPRUDSKI (2008, 70).
19
zwischen „Trasjanka“ einerseits und dem Weißrussischen sowie dem (pho-nisch weißrussisch interferierten) Russischen andererseits besteht.
2.2 Zur Entstehung von WRGR
Die sprachliche Situation in Belarus, d.h. die im Vergleich zu anderen ehe-maligen Sowjetrepubliken schwache Position der Titularsprache und die starke Dominanz des Russischen werden der späten staatlichen Eigenständig-keit und der starken Integration in das Russische Zarenreich, danach in die Sowjetunion zugeschrieben. Als polyfunktionale Sprache hat sich das Weiß-russische nie völlig durchgesetzt (SJAMEŠKA 1998, 25; TÖRNQUIST-PLEWA 2005, 113).15 Das moderne Weißrussisch stand stets „im Schatten“ des Russi-schen, selbst in den kurzen Phasen der Förderung und des „Aufblühens“ des Weißrussischen ab 1905 und vor allem ab 1917 bis in die 1930er Jahre sowie in den ersten Jahren der Unabhängigkeit nach 1991.16 Spätestens ab dem Novemberaufstand 1830/31 setzt eine aktive Russifizierungspolitik der bis zu den Polnischen Teilungen Ende des 18. Jh. polnischen Gebiete ein. Ende des 19. Jh. und Anfang des 20. Jh. bildet sich auf der Basis der weißrussischen Dialekte eine weißrussische Literatursprache. Im Zuge einer liberalen Sprachpolitik wird deren Kodifizierung in dem ersten Jahrzehnt der BSSR weit vorangetrieben, das Weißrussische verbreitet sich in Schulwesen und Verwaltungswesen. Wie stark sich das Standardweißrussische bereits in
15 Die Entwicklung der sprachlichen Situation auf dem Gebiet von Belarus soll hier im Ein-
zelnen nicht wiedergegeben werden. Für mehr Einzelheiten, auch zum 19. Jahrhundert und zu den Entwicklungen nach der Unabhängigkeit 1991 siehe z.B. MICHNEVIČ (1985), PRYHODZIČ (1998), MOSER (2000), TÖRNQUIST-PLEWA (2005), ŽURAŬSKI (1967, 1982), BIEDER (1991, 1992, 1995a/b, 1996a/b, 2001), ZAPRUDSKI (1996, 2007). Die Darstellung hier folgt im Wesentlichen SJAMEŠKA (1998) und ZAPRUDSKI (2007).
16 Nach einer kurzen Phase der Belarussifizierung im Vorfeld und nach der 1991 erfolgten Unabhängigkeit der Republik Belarus setzte sich der Rückgang des Weißrussischen unter der seit 1994 amtierenden Regierung unter Präsident Aljaksandr Lukašenka fort. Obwohl zu Beginn der 1990er Jahre das Weißrussische beispielsweise in Schule und Universität gestärkt wird, stellt Bieder dem Prozess der Belarussifizierung bis dahin einen insgesamt „relativ geringe[n…] Erfolg“ (BIEDER 1995а, 400) aus. Auf Ablehnung stößt er zunächst bei den alten Kadern, den „alten antidemokratischen und großrussischen Kräfte[n]“, wie BIEDER (1995а, 400) sie nennt, die die gewohnte Sprache nicht aufgeben wollen und in Politik, Verwaltung, Medien, Armee die Oberhand haben. Zwar spielt die russische Min-derheit eine große Rolle. Es ist aber weniger ein ethnischer Konflikt zwischen Weißrussen und Russen – Befürworter und Gegner finden sich in beiden Gruppen. Insgesamt stehen breite Schichten der Bevölkerung dem Prozess gleichgültig oder sogar ablehnend gegen-über, auch wenn eine knappe Mehrheit ihn wohl befürwortet (MEČKOVSKAJA 1994, 309; BIEDER 1995a, 398–400; GUTSCHMIDT 2000, 78–80; BRÜGGEMANN 2014).
20
dieser relativ kurzen Zeitspanne unter der Bevölkerung durchgesetzt hat, ist nicht klar. Gegen Ende der 20er Jahre stehen die Zeichen für die weitere Verbreitung des Weißrussischen aber gut: Mehr als 80% der Literatur, die in der BSSR herausgegeben wird, ist auf weißrussisch, 90% der Schulen haben Weißrussisch als Unterrichtssprache (SJAMEŠKA 1998, 30). Zudem steigt das ethnische Selbstbewusstsein. So verdoppelt sich im Vergleich zum ersten allgemeinen Zensus des Russischen Reiches 1897 bis 1926 der Anteil derje-nigen, die sich als Weißrussen bezeichnen, in der Stadtbevölkerung auf 39,3% (SABALENKA 1982, 11).
Ab den späten 1920er Jahren deutet sich einhergehend mit der Stalinisie-rung eine radikale Kehrtwende in der Sprachpolitik hin zur Russifizierung der nichtrussischen Ethnien und Sprachen der Sowjetunion an, die dann ab 1933 vollzogen wird. Im höheren Schulwesen, vor allem in den Städten wird das Weißrussische vom Russischen verdrängt. Den Stalinschen Repressionen fallen unter den weißrussischen Offiziellen und Intellektuellen zahlreiche Förderer des Weißrussischen zum Opfer. Auch in den in der Zwischenkriegs-zeit polnischen Gebieten wurde das Weißrussische behindert.17
Auch wenn aufgrund des sozialen Drucks zugunsten des Russischen schon während dieser Zeit und bereits früher Formen weißrussisch-russischer gemischter Rede auf dem Gebiet von Belarus verbreitet gewesen sein wer-den,18 ist für die massenhafte Verbreitung die Nachkriegszeit entscheidend (CYCHUN 2000). Nach Stalins Tod 1953 wird die Russifizierung zwar weni-ger repressiv, dafür aber umfassender vorangetrieben (JACHNOW 1982, 93; MEČKOVSKAJA 1994, 303). Wichtig ist neben den Medien und der Armee v.a. die weitere Durchsetzung des Russischen als Sprache des Bildungssys-tems auch in Bereichen, die bis dahin weitgehend Weißrussisch geprägt wa-ren, d.h. im Primarschulwesen und später auch in der vorschulischen Bil-
17 Eine Russifizierung setzt 1933 auch auf der Ebene der Sprachplanung ein (vgl. PRYHODZIČ
1998, 18; SJAMEŠKA 1998, 46–50; GUTSCHMIDT 2000, 75; WEXLER 1985; 1992, 42). Mit der 1934 verabschiedeten Resolution Ab zmenach i spraščėnnjach belaruskaha pravapisu (Über Veränderungen und Vereinfachungen der weißrussischen Rechtschreibung) wird die weißrussische Standardsprache in einigen Aspekten an das Russische angenähert. Auch in den Wortschatz gehen zahlreiche Russismen ein. Konsequenz ist die Existenz zweier Nor-men, die bis heute ihre Spuren hinterlässt. Die bis dato gültige Taraškevica wird von Teilen der nationalorientierten Opposition als authentischer eingeschätzt und daher der als russifi-ziert wahrgenommenen offiziellen Norm, der Narkamaŭka vorgezogen (vgl. BRÜGGEMANN 2010, 76–79).
18 CYCHUN (2013 [1998], 22) macht für die Entstehung von WRGR außerdem ein durch den Stalinschen Terror ausgelöstes Gefühl der Angst beim Benutzen des Weißrussischen ver-antwortlich.
21
dung.19 Ende der 1970er Jahre „[existiert] das Weißrussische in den Städten faktisch nicht mehr als Unterrichtssprache in den Schulen […], in den Hoch-schulen nur noch in der Ausbildung von Lehrern des Weißrussi-schen“ (GUTSCHMIDT 2000, 73).20
Zudem erfolgt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die städti-sche Landschaft des Landes weitgehend zerstört worden war, eine rapide Industrialisierung und Urbanisierung von Belarus. Durch Zuzug von Arbeits-migranten in die Städte vor allem aus der näheren Umgebung dieser Städte stieg der Anteil der Stadtbevölkerung ab den 1960er Jahren steil an (vgl. Tab. 1).
Entwicklung der Stadtbevölkerung in Belarus (nach PN 2009:2, 10) Tab. 1
1959 1970 1979 1989 1999 2009 Anteil der Stadtbevölkerung 30,5% 43,3% 54,9% 65,4% 69,3% 74,3%
1959 hatten nur 32 weißrussische Städte mehr als 10 000 Einwohner, davon hatten drei (Vicebsk, Mahilëŭ und Homel’) zwischen 100 000 und 200 000 Einwohner. Nur Minsk wies mehr als 500 000 Einwohner auf. Minsk nimmt nach Angaben von SADOŬSKI (1982, 177) in der zweiten Hälfte des 20. Jh. unter den Städten der gesamten UdSSR den ersten Rang ein, was das Bevöl-kerungswachstum angeht: Von 509 000 im Jahre 1959 über 917 000 Ein-wohnern im Jahre 1970 steigt die Bevölkerungszahl bis 1977 auf 1 230 500 Einwohner (siehe auch IVPN 1963, 13; SJAMEŠKA 1998, 40).
Die Entstehung von WRGR als das Massenphänomen, das es heute ist, gilt als eng verbunden mit dieser rasanten (Re-)Urbanisierung. Massive Bin-nenmigration und schnell wachsende Gemeinschaften sind bekannt dafür, mit rapiden Sprachwandelphänomenen einherzugehen, nicht nur aufgrund des Kontakts mit Sprechern anderer Varietäten, sondern vor allem, da konserva-tiv wirkende, enge dörfliche Beziehungsnetzwerke gelockert bzw. gelöst werden (MILROY & MILROY 1985; WATT & MILROY 1999, 26; MILROY 2002, 10; WATT 2002; MILROY & MILROY 2007, 59–61). Im Falle von Bela-rus kommt das starke soziale Ungleichgewicht zwischen den Kontaktvarie-täten hinzu: In der städtischen Umgebung war ein sozialer Aufstieg ohne das Russische nicht möglich, die Beherrschung des Weißrussischen dagegen
19 1979 empfiehlt das Bildungsministerium Russisch als Sprache der Erziehung in allen
Kindergärten für Kinder ab 5 Jahren. 20 Während im Schuljahr 1953/54 noch vier von fünf Schülern auf weißrussisch unterrichtet
werden, ist das Verhältnis im Schuljahr 1990/91 umgekehrt (vgl. SJAMEŠKA 1998, 36).
22
kaum notwendig (ZAPRUDSKI 2007, 111; JACHNOW 1982, 98, Fn. 7; WOOLHISER 2005, 250). Offizielle Stellen in Staat und Partei waren oft von aus Russland geschickten Personen besetzt, viele Fachkräfte aus Verwaltung, Technik und Wissenschaft kamen ebenfalls aus Russland nach Belarus (ZAPRUDSKI 2007, 105; GUTSCHMIDT 2000, 75).21
Das Russische, das den Land-Stadt-Migranten begegnete, bestand sicher-lich in erster Linie schriftlich in der Standardsprache, mündlich in umgangs-sprachlichen Formen des Standardrussischen, seltener auch in Formen des russischen substandardlichen sogenannten Prostorečie. Obwohl gewisse Kenntnisse des Russischen bei den Migranten natürlich vorhanden waren, geschah der Erwerb des Russischen in den Städten weitgehend ungesteuert im direkten Kontakt mit Sprechern des Russischen (SJAMEŠKA 1998, 40; CYCHUN 2013 [1998], 24). Begünstigt durch die strukturelle Ähnlichkeit und relative gegenseitige Verständlichkeit beider Sprachen, waren es (wie in vergleichbaren Situationen üblich, vgl. CHAMBERS 1998 [1992], 149–152) zunächst lexikalische Elemente, die in die grammatisch und phonetisch-pho-nologisch weißrussisch-dialektal basierte Rede integriert wurden (SADOŬSKI 1982, 180).
Eine gewisse Vorsicht ist angebracht bei der Frage, welche „Sprache“ die Migranten mitbrachten. Die Migranten, die in die Städte zogen, waren in der Regel junge Erwachsene aus der ländlichen Umgebung um die Städte. Da die autochthonen Dialekte in ländlichen Gebieten als noch recht stark gelten (SADOŬSKI 1982, 177; VYHONNAJA 1982, 170; KURCOVA 2005), ist zunächst
21 In der Sowjetzeit stellen Russen die zweitgrößte Ethnie in Belarus (SABALENKA 1982, 11).
1959 stellen sie insgesamt ungefähr 8% der Bevölkerung, wobei sich der russische Bevöl-kerungsanteil in den urbanen Zentren konzentriert (WEXLER 1985, 47). 1959 werden 3% der Landbevölkerung von Russen gestellt, in den Städten ist jeder fünfte Einwohner Russe (19%) (IVPN 1963, 124). Nach SJAMEŠKA (1998, 34) waren Anfang der 1950er Jahre fast 40% des Staats- und Parteiapparates aus Russland in die BSSR versetzte Personen. Die Konzentration von Russen in hohen Positionen hält sich bis zum Ende der BSSR und darüber hinaus: 1995 macht der Anteil der russischen Bevölkerung an der Gesamtbevölke-rung 13,8% aus, stellt aber nach Schätzungen von BIEDER (1995a, 398) 80% der politischen und wirtschaftlichen Führungskräfte, 60% der Führungskräfte in der Wissenschaft (s.a. MOSER 2000, 186). Anders als andere quantitativ relevante Minderheiten verteilte sich die russische Minderheit zu Beginn der 1960er Jahre relativ gleichmäßig über die Bezirke. Ab-gesehen von der Stadt Minsk, wo es knapp 23% waren, schwankte der Anteil zwischen 5,8% (Minsker Bezirk) und 9,3% (Vicebsker Bezirk) (IVPN 1963, 126f.). Der russische Anteil der Bevölkerung ist außerdem sehr sprachloyal, nur ein verschwindender Teil gibt Weißrussisch oder eine andere Sprache als Muttersprache an (IVPN 1963, 124). Auch 2009 geben nur 2,8% der russischen Bevölkerung Weißrussisch als Muttersprache an (PN 2009:3, 318).
23
anzunehmen, dass diese Sprecher mit autochthonen weißrussischen Dialekten aufgewachsen waren (vgl. ZAPRUDSKI 2007, 106; 2008, 69).22 Zudem war die Schulbildung dieser Migranten noch wesentlich im Weißrussischen erfolgt. Neuere Studien legen nahe, dass die Sprache der Sozialisation der Land-Stadt-Migranten bereits vom Russischen beeinflusst war. So gibt ca. ein Drittel der in KITTEL et al. (2010) befragten über 50-jährigen WRGR als Muttersprache an, mehr als die Hälfte benutzen WRGR im Alltag, und diese Informanten geben zu großen Teilen auch an, mit ihren Eltern und Großeltern „gemischt“ zu sprechen bzw. gesprochen zu haben. HENTSCHEL & KITTEL (2011, 117) zeigen, dass von den Informanten, die auf dem Land geboren sind, knapp drei Fünftel WRGR als ihre Erstsprache angeben. Dies ist ein größerer Anteil als bei Informanten, die in Kleinstädten geboren sind (dort sind es ca. zwei von fünf Befragten). Wie die Autoren argumentieren, kann dies höchstens teilweise über eine „Verwechslung“ gemischter Rede mit Dialekten (die in Teilaspekten eher mit dem Russischen als mit dem Stan-dardweißrussischen zusammenfallen können) erklärt werden. Vielmehr deuten die recht hohen Zahlen darauf hin, dass der Einfluss des Russischen auf die weißrussischen Dialekte bereits zu Beginn der Urbanisierungswelle nach dem zweiten Weltkrieg groß war, im östlichen, schon vor dem zweiten Weltkrieg sowjetischen Teil von Belarus sicherlich noch früher. Die im Rahmen des Oldenburger Projekts anhand von konkretem Sprachmaterial entstandenen Studien bestätigen, dass auch ältere Informanten, die ihr ge-samtes Leben oder fast ihr gesamtes Leben auf dem Land verbracht haben, einen beträchtlichen Anteil an ‚russischen‘ Elementen und Strukturen in ihrer Rede aufweisen (HENTSCHEL & TESCH 2007, 22; HENTSCHEL & ZELLER
2012). Zwar sind für sie die Anteile ‚weißrussischer‘ Äußerungen höher als für die Generation ihrer Kinder, ‚hybride‘ Äußerungen stellen aber auch bei ihnen den häufigsten Äußerungstyp dar.23
22 Unter der Landbevölkerung geben 85,8% Weißrussisch als Muttersprache, 62,1% Weißrus-
sisch als zu Hause gesprochene Sprache an, während es unter der Stadtbevölkerung ledig-lich 51,6% bzw. 12,8% sind (PN 2009:3, 341, 348, 363, 370), wobei hier – wie gesagt – WRGR als Antwortoption nicht gegeben wird.
23 HENTSCHEL & ZELLER (2012) zeigen, dass sich Sprecher hinsichtlich der Häufigkeit ‚weiß-russischer‘, ‚russischer‘ und ‚hybrider‘ Äußerungen in vier Sprechertypen einordnen lassen (s.u. 4.4). Die Dorfbewohner und Spätmigranten lassen sich in der Regel dem Typ „HW“ zuordnen, weisen also sowohl eine hohe Anzahl an ‚hybriden‘ als auch an ‚weißrussischen‘ Äußerungen auf. Ein hypothetischer Typ „W“, der vor allem ‚weißrussische‘ Äußerungen produzieren würde, lässt sich empirisch im OK-WRGR nicht feststellen.
24
Anzunehmen ist, dass die ländlichen Strukturen, die im Osten von Bela-rus bereits in der Vorkriegszeit stark verändert worden waren, wohl nicht mehr die konservative Funktion gegenüber externen Einflüssen ausüben konnten, die für enge soziale Netzwerke üblich sind. Insbesondere die Um-organisation in Kolchosen führte sicherlich zu einer Auflockerung der engen sozialen Netzwerke der Zarenzeit, ganz zu schweigen natürlich von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Auch CYCHUN (2013 [1998], 22) datiert wie gesagt die Entstehung von WRGR auf die Periode der Stalinschen Repressionen. Zusammen mit der Präsenz des Russischen in der Armee (ab 1933 ist Russisch Sprache der Armee, vgl. SJAMEŠKA 1998, 33) und der Tatsache, dass auch auf dem Land ein sozialer Aufstieg ohne das Beherr-schen des Russischen nicht möglich war (ZAPRUDSKI 1996, 194), ist es sicherlich unwahrscheinlich, dass die weißrussischen Dialektsprecher Ende der 50er Jahre keine Spuren des Russischen aufwiesen. Bereits SVEŽINSKIJ et al. (1985) beobachten, dass auch in ländlichen Gebieten das Russische oder stark vom Russischen beeinflusste Varietäten des Weißrussischen weit verbreitet sind und viele soziale Funktionen übernommen haben. Wie HENTSCHEL (2013a, 92) berichtet, war bereits in den 1920er Jahren seitens des weißrussischen Linguisten Voŭk-Levanovič ein starker Einfluss des Russischen auf weißrussische Dialekte konstatiert worden. Dass weißrussi-sche Dialekte lexikalisch durch das Russische beeinflusst sind, wird dabei recht häufig konstatiert, während ein Einfluss des Russischen auf andere Ebenen verneint wird (BIEDER 1995a, 407; GUTSCHMIDT 2000, 76; KURCOVA 2010). Einige Autoren wie KRYVICKI & PADLUŽNY (1984, 142) stellen je-doch auch einen deutlichen Einfluss des Russischen auf die grammatische und phonische Seite der ländlichen Varietäten des Weißrussischen fest.24
Auch diese vom Russischen beeinflussten ländlichen Varietäten würden, wie die WRGR der Städte, abwertend „Trasjanka“ genannt (KURCOVA 2010, 19). WOOLHISERs (2005, 260) Daten aus Selbstauskünften aus Dörfern des polnisch-weißrussischen Grenzgebiets deuten in die gleiche Richtung. Wäh-rend vor 1940 geborene Informanten ihre zu Hause gesprochene Sprache pa-prostu, prostaja mova, pa-svojemu, svaja havorka (etwa: ‚einfach‘, ‚einfache Sprache‘, ‚auf die eigene Art‘, ‚der eigene Dialekt‘) nennen, tendieren die
24 Hier sind die Interpretationen aber zuweilen unterschiedlich: So bemerkt SADOŬSKI (1982,
188, Fn. 21), dass bereits seit langem der Einfluss des Russischen auf die phonische Seite des dialektalen Weißrussischen bekannt sei, wobei er sich auf VAJTOVIČ (1968, 70–71) be-ruft. Vajtovič selbst erklärt die phonischen Phänomene, um die es dabei geht, allerdings nicht als russischen Einfluss, sondern als Ergebnis interner phonologischer Prozesse.
25
nach 1940 geborenen zu den Bezeichnungen zmešanaja mova, zmešany jezyk (‚gemischte Sprache‘). WOOLHISER (2005, 260) meint sogar: „mixed Russo-Belarusian forms have largely supplanted the traditional dialects as markers of local solidarity in rural communities“. Auch MEČKOVSKAJA (2007) zeigt für einige ältere Informanten aus ländlichen Gebieten, dass sich in deren Rede russische und weißrussische Elemente wiederfinden.
WRGR entstand also auf der Basis eines im Osten des Landes sicherlich bereits lexikalisch mehr oder weniger stark vom Russischen beeinflussten weißrussisch-dialektalen Substrats mit russischer Umgangssprache als Superstrat im Zuge eines massiven ungesteuerten Zweitspracherwerbs im Erwachsenenalter, wobei diese in den Dörfern begonnene Entwicklung in den sich rasch entwickelnden Städten der zweiten Hälfte des 20. Jh. an Intensität und Extensität gewonnen haben dürfte (vgl. HENTSCHEL & KITTEL 2011, 133). Die weißrussische Standardsprache spielte eher die Rolle eines Adstrats, die in Schule und Medien gegenwärtig war (vgl. HENTSCHEL 2008a, 464). Es ist also, wie LISKOVEC (2005, 96) annimmt, zunächst eine Erschei-nung, die mit einer „Interlanguage“ im Sinne SELINKERs (1972) verglichen werden kann, also eine Lernervarietät, die Züge der Ausgangssprache (dia-lektales) Weißrussisch und der Zielsprache Russisch sowie ggf. eigene, natürlichkeitsbedingte und durch Lernstrategien bedingte Strukturen auf-weist. Wie MATRAS (2009, 75) ausführt, können solche Interlanguages fossi-lisiert werden, wenn der Erwerb nicht weiter vollzogen wird. Dieser Abbruch des Erwerbs muss nicht in einer „Unfähigkeit“ des Lerners begründet sein, möglich ist auch, dass ihm der erreichte Stand ausreicht.
Auch wenn „Interlanguage“ zunächst ein individueller Begriff ist, ist es möglich, dass unter gleichen sozialen Umständen große Sprechergruppen ähnliche Varietäten aufweisen und diese weitergegeben und zu Markern von Identität werden, auch wenn in folgenden Generationen die Zielsprache besser beherrscht wird (vgl. MATRAS 2009, 76f.). Sowohl die Daten aus den sprachsoziologischen Untersuchungen in KITTEL et al. (2010) und HENTSCHEL & KITTEL (2011) als auch die im Oldenburger Projekt entstan-denen Untersuchungen anhand von konkretem Sprachmaterial zeigen tat-sächlich, dass es nicht nur diese Migrantengeneration ist, die WRGR auf-weist. Auch die Generation der Kinder dieser Migranten, heute jüngere und junge Erwachsene, benutzt WRGR. Entscheidend für dieses Faktum war, dass die Migrantengeneration WRGR in der Regel bei der Erziehung bzw. im täglichen Umgang mit ihren Kindern benutzte, ggf. mit der Intention, ihren Kindern soweit wie möglich eine Sozialisation im prestigeträchtigen Russi-
26
schen zu vermitteln.25 Die erste sprachliche Sozialisierung dieser zweiten Sprechergeneration erfolgte also weißrussisch-russisch-gemischt (zu einer detaillierten Diskussion des Spracherwerbs dieser Generation siehe unten 2.3). Für diese zweite Generation war die Schulbildung andererseits bereits viel stärker russisch geprägt, bereits in den untersten Klassen und teilweise schon im Kindergarten. Diese Generation ist daher in der Regel in der Lage, Russisch in seiner Standardform ohne tiefere Interferenzen des Weißrussi-schen zu sprechen. (Die Fähigkeiten im Standardweißrussischen gehen dagegen individuell stark auseinander). Wenn Sprecher dieser Generation WRGR zeigen, so ist dies also keinesfalls auf ein Unvermögen, Standardrus-sisch zu sprechen, zurückzuführen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass diese Generation bei der Kommunikation mit ihren Eltern zur Sprache ihrer ersten Sozialisation zurückkehrt (vgl. HENTSCHEL & TESCH 2007).
Auch wenn dies nicht im Zentrum dieser Arbeit steht, so sei darauf hinge-wiesen, dass auch in der Generation der Enkel der Migrantengeneration, heu-te Kinder im Schulalter, WRGR verwendet wird (vgl. KRAŬČANKA i.Vorb.). Interessanterweise zeigen jüngere Schulkinder mehr ‚weißrussische‘ Ele-mente – und damit eine stärker gemischte Rede – als ältere. Dies lässt sich dahingehend deuten, dass die in der Familie praktizierte WRGR ebenfalls stärker ‚weißrussisch‘ geprägt ist. Durch den Einfluss der Schule wird sie dann bei älteren Kindern stärker ‚russisch‘ geprägt (siehe auch unten 2.3).
2.3 Überlegungen zum linguistischen Status von WRGR
Der Begriff „Gemischte Rede“, der hier in Ermangelung eines besseren Be-griffs verwendet wird, um die negative Konnotation des Begriffes „Tras-janka“ zu vermeiden, suggeriert ungewollt etwas, von dem auch in traditio-nellen Ansätzen zum Sprachkontakt auf der Ebene des mehrsprachigen Indi-viduums ausgegangen wird, nämlich die „existence and autonomy of the two languages in contact“ (AUER 2007, 320; vgl. auch MUYSKEN 2006, 157). Selbst für den typischerweise untersuchten Fall von Mehrsprachigkeit, d.h. für einen Sprecher in Westeuropa, der mit den zwei Sprachen seiner beiden Elternteile aufwächst und von ihnen ein funktional recht klar getrenntes sprachliches Input erhält, ist mit MATRAS (2009, 61–68) davon auszugehen,
25 ŠMELEV (1986, 9) betont, dass Russisch in familiären Situationen vor allem in der Rede
von Eltern an die Kinder verwendet wird. Die Abweichungen vom Standardrussischen wurden von Sprechern von WRGR oft nicht bemerkt (vgl. SJAMEŠKA 1998, 41; LISKOVEC 2005, 101; HENTSCHEL & KITTEL 2011, 112).
27
dass nicht unmittelbar zwei getrennte Systeme, sondern ein Gesamtrepertoire an sprachlichen Möglichkeiten erworben wird. Die Unterscheidung von Sprachsystemen ist dabei als Unterdrücken situativ nicht gebotener Varianten im Gesamtrepertoire eines Kindes zu verstehen, die Herausbildung von un-terschiedlichen Sprachsystemen dementsprechend als Epiphänomen des Erlernens dessen, wann welche Varianten situativ nicht geboten sind, zu verstehen, ähnlich dem Erlernen eines Monolingualen, wann welches Regis-ter angebracht ist und wann nicht (vgl. PARADIS 2004, 207). Wie HENTSCHEL (2013a, 60–62) und HENTSCHEL & ZELLER (2012, 196–200) ausgehend von der oben dargelegten Entstehung von WRGR argumentieren, ist der Fall noch deutlicher im Falle von WRGR. Die Kinder der Land-Stadt-Migranten, und damit große Teile der Bevölkerung, wuchsen überwiegend nicht bilingual weißrussisch-russisch auf, sondern „monolektal-gemischt“ (HENTSCHEL &
ZELLER 2012, 196), also ohne eine klare Trennung der beiden Sprachen nach Funktion oder Gesprächspartner. WRGR bildet daher bei dem Kind den grundlegenden Kode im Sinne eines Gesamtrepertoires sprachlicher Mög-lichkeiten. Erst die Schule machte eine Auswahl aus diesen Gesamtmöglich-keiten nötig: Die Aneignung des Russischen und ggf. des Weißrussischen bestand also in einer Unterdrückung der situativ nicht gebotenen Varianten aus dem Gesamtrepertoire.26
Die Bezeichnung „Gemischte Rede“ erfolgt also von einer analytischen Außenperspektive aus, die an der diachronen Entwicklung von WRGR inte-ressiert ist und nicht der psycholinguistischen Realität des Sprechers ent-sprechen muss. Psycholinguistische Arbeiten wie GREEN (1998), GROSJEAN (2001) oder PARADIS (2004) nehmen entsprechend dem oben zum Sprach-erwerb Gesagten an, dass Zweisprachige nicht komplett zwischen Systemen wechseln, sondern dass bei der Sprachproduktion (und -perzeption) stets Elemente beider Sprachen konkurrieren. In einem Kontext, der ein monolin-guales Sprachverhalten erfordert, ist eine aktive Unterdrückung der nicht passenden Varianten vonnöten. In anderen Situationen ist dies nicht der Fall, so dass Sprecher sich in einem bilingualen Modus (GROSJEAN 2001) bewe-gen können, also keine der beiden Sprachen aktiv unterdrücken. Der Gegen-satz Bilingualer vs. Monolingualer Modus ist dabei als Kontinuum zu verste-hen, d.h. es können Abstufungen der Unterdrückung bzw. Aktivierung der
26 Ganz ähnlich beschreiben SUPRUN & KLIMENKA (1982, 86) und VYHONNAJA (1996, 10)
den typischen Spracherwerb in Belarus als zunächst nicht zwischen Weißrussischem und Russischem differenzierend.
28
jeweiligen Varianten bestehen. Gemischte Rede im Allgemeinen und WRGR im Speziellen kommt demzufolge dann zustande, wenn es nicht notwendig oder sogar unangebracht ist, eine der beiden Sprachen zu unterdrücken.
Ein gewisser Abbau der Variabilität absolut (d.h. systemlinguistisch und soziolinguistisch) gleichwertiger Varianten ist jedoch mit CROFT (2000, 176) als eine „natural human tendency“ zu betrachten. Eine der zentralen Fragen, die sich im Hinblick auf WRGR stellt, ist daher, ob die im vorigen Absatz beschriebene Variation sprachlicher Elemente gewissen probabilistischen oder sogar (quasi-)deterministischen Einschränkungen unterliegt, die zudem überindividueller Natur sind, mithin, ob WRGR ein überindividuelles System zugrunde liegt. In der belorussistischen Literatur wird WRGR auf der über-individuellen Ebene Systemhaftigkeit oft pauschal abgesprochen (z.B. bei SJAMEŠKA 1998, 42) und damit der Status einer eigenen Varietät verneint. Begründet wird dies mit dem hohen Grad an Variation zwischen und inner-halb von Sprechern: „v ‚Trasjanke‘ otsutstvuet uzus: ėto konglomerat idio-lektov [in der ‚Trasjanka‘ fehlt ein Usus. Es ist ein Konglomerat von Idio-lekten]“ (MEČKOVSKAJA 2002, 127).27 Dies sind allerdings erstens Behauptungen, die nicht oder unzureichend empirisch belegt sind. Die Frage nach einem überindividuellen, „fossilisierten“ System lässt sich methodisch nur über das Aufzeigen einer überindividuellen, usuellen Norm, abgebildet in stabilen quantitativen Verhältnissen in einem hinreichend großen Korpus beantworten (HENTSCHEL 2008c, 170). Die Überprüfung darf sich natürlich nicht nur auf die allgemeinen Proportionen von ‚weißrussischen‘ und ‚russi-schen‘ Elementen beziehen (wobei diese natürlich wichtig sind), sondern muss die einzelnen phonetisch-phonologischen, lexikalischen, morphologi-schen, morphosyntaktischen und ggf. syntaktischen Variablen jeweils für sich betrachten. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist also, ob es für einzelne sprachliche Variablen klare, überindividuelle Tendenzen für die ‚russische‘ oder ‚weißrussische‘ Ausprägung dieser Variablen gibt (vgl. HENTSCHEL 2014b). Natürlich muss dabei stets bedacht werden, dass auch in den traditio-nellen Dialekten und in als Standard wahr- und angenommener Rede Varia-
27 Siehe auch MEČKOVSKAJA (1994, 313; 2000, 108; 2007, 91 u. 96). Eine Gegenposition
vertritt KURCOVA (1989; 1990). In ihren Studien zur Rede in einem ruralen Gebiet des Bezirks Homelʼ kommt sie zu dem Schluss, dass sich ungeachtet der Variativität der beobachteten Rede aus dem Kontakt des autochthonen weißrussischen Dialekts mit dem Russischen ein neues System herausgebildet habe. Auch Sadoŭski geht in seinen Beschreibungen der Rede von Land-Stadt-Migranten in Minsk (s. 3.4) von der Heraus-bildung eines neuen Systems aus (vgl. z.B. SADOVSKIJ 1978, 15). Vergleiche auch KLIMAŬ (2014).
29
tion stärker ist, als dies allgemein angenommen wird (GEERARTS 2010; vgl. zu den Implikationen für WRGR auch HENTSCHEL 2011).
Zweitens ist vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2.2 skizzierten Entwicklung davon auszugehen, dass es sich bei WRGR um ein zwar hin-sichtlich vieler Parameter einheitliches, aber sich entwickelndes Phänomen handelt (HENTSCHEL & TESCH 2007, 25). Die Annahme von LISKOVEC (2005, 96), dass WRGR eine Interlanguage, d.h. nicht vollständig gelerntes Russisch sei, ist zum Beispiel mit HENTSCHEL (2008c, 175) als überwiegend plausibel für die erste Sprechergeneration anzusehen, nicht aber für Sprecher, die in der Lage sind, Standardrussisch ohne tiefere Interferenzen des Weiß-russischen zu sprechen (bzw. für diese Sprecher nur in einem „sprachhistori-schen“ Sinne).28 Die Möglichkeit, dass bei unterschiedlichen Sprechern ge-mischter Rede unterschiedliche Grade an Stabilisiertheit zugrunde liegen und dass sich eine Entwicklung von (im oben beschriebenen Sinne) spontan gemischter Rede hin zu einem stabilisierten System vollziehen kann, wird außer Acht gelassen. So ist es mit AUER (1999) sinnvoll, innerhalb von „gemischter Rede“ zu unterscheiden zwischen „Code-Switching“, „Language Mixing“ und „Fused Lects“. Code-Switching ist dabei ein lokal funktionaler Wechsel des Kodes, also ein Wechsel, der durch den Gesprächspartner, die Gesprächssituation, das Thema u.ä. motiviert ist. Im Gegensatz dazu sind im Falle von Language Mixing nicht einzelne Wechsel funktional, sondern die Tatsache, dass überhaupt mehrere Kodes in einer Diskurseinheit gebraucht werden, und zwar in dem Sinne, dass es einen Gegensatz zum monokodalen Sprechen bedeutet. Gemischtes Sprechen an sich erfüllt also eine soziale Funktion der Identitätsstiftung und Abgrenzung (Auer spricht von einer „glo-balen“ Funktionalität der Kodewechsel, vgl. auch MATRAS 2009, 127). Wäh-
28 LISKOVEC (2005, 96) entscheidet sich dafür, WRGR als eine Interlanguage zu bewerten,
also als eine Lernervarietät, die Züge sowohl der Ausgangssprache als auch der Zielsprache sowie auch neue, durch universale Präferenzen und Lernerstrategien bedingte Strukturen aufweist. Dies begründet sie nicht zuletzt auf der Annahme, dass gemischte Rede nicht an die nächste Generation weitergegeben werde, bzw. von dieser nicht benutzt werde, da sie Russisch in der Standardform beherrscht. Die Weitergabe an folgende Generationen wird von Liskovec vielfach verneint, WRGR verschwinde durch das Erlernen des Russischen (LISKOVEC 2005, 107). An anderer Stelle räumt sie jedoch die Möglichkeit ein, dass Kinder von Land-Stadt-Migranten mit ihren Eltern WRGR sprächen, dies jedoch nicht außerhalb der Familie täten (LISKOVEC 2005, 82). Wie gesehen, ist die Annahme der Nicht-Weiter-gabe an folgende Generationen widerlegt, und selbst die Annahme, dass WRGR nur inner-halb der Familie benutzt werde, ist nicht zu halten (vgl. HENTSCHEL & KITTEL 2011). Zudem berichtet Liskovec selbst an verschiedenen Stellen davon, dass Sprecher zwischen WRGR und dem Russischen wechseln (LISKOVEC 2005, 104; 129; 146).
30
rend im Falle von Language Mixing die Wahl eines Elementes aus einem der beiden Kodes nicht deterministisch festgelegt ist, sind Fused Lects stabili-sierte Varietäten, in denen an einer bestimmten Position der Gebrauch eines Elementes aus einer der beiden Kontaktsprachen obligatorisch ist (wobei – wie gesagt – klar sein muss, dass ein gewisses Maß an Variation stets zu erwarten ist). Diese drei Formen gemischter Rede bilden nach Auer ein dia-chrones Kontinuum, wobei der Verlauf von Code-Switching über Language Mixing zu einem Fused Lect geht bzw. gehen kann, aber nicht in die umge-kehrte Richtung. WRGR ist wie dargelegt sicherlich nicht auf ein funktiona-les Code-Switchen von Weißrussisch-Russischen Bilingualen zurückzu-führen, aber auf ein zunächst ebenso lokal-funktionales Akkommodieren an das Russische, und es ist nicht abwegig davon auszugehen, dass für Folge-generationen das Nebeneinander von Weißrussischem und Russischem in familiären Gesprächen ebenso eine globale Funktion hat. AUER (1986, 119) unterscheidet im Falle von Dialekt-Standard-Kontinua, mit denen WRGR eher verglichen werden kann als mit den von AUER (1999) zitierten Beispie-len entfernterer Sprachen (s.u.), ganz ähnlich zwischen lokal-funktionalem „Code-Shifting“ und nicht-lokal-funktionaler „Code-Fluktuation“.
HENTSCHEL (2008a, 464) argumentiert, dass der Kontakt des (dialektalen) Weißrussischen mit dem Russischen trotz der Standardsprachlichkeit beider Kontaktsprachen aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit und relativen gegen-seitigen Verständlichkeit der beteiligten Varietäten strukturell vergleichbar ist mit Phänomenen, die (in der Folge von TRUDGILL 1986) unter dem Schlagwort „Dialektkontakt“ behandelt werden.29 Für den Kontakt eng
29 Natürlich bestehen auch Unterschiede zu den von TRUDGILL (1986) hauptsächlich unter-
suchten Kontaktsituationen englischer lokaler Varietäten. Erstens geht es in Belarus weni-ger um den direkten Kontakt der Migranten untereinander und um den aus diesem direkten Kontakt untereinander entstehenden Ausgleich ihrer jeweiligen Varietäten, sondern um den Kontakt der Migranten mit dem sozial dominanten Standard, d.h. dem Russischen. Zwei-tens ist die empfundene Unterschiedlichkeit von zwei Sprachvarietäten nicht nur durch die strukturelle Distanz der Varietäten bedingt, sondern durch die Einstellung der Sprecher den Varietäten gegenüber (AUER 2007, 323). Zwar schreibt MEČKOVSKAJA (2002, 126), dass die beiden Sprachen in Belarus zwei sich ergänzende Register eines kommunikativen Sys-tems bilden würden. In Belarus werden jedoch beide Sprachen in der Schule vermittelt, haben den Status von Standardsprachen und werden daher sicherlich in der Regel nicht als zwei Varianten einer Sprache wahrgenommen, was für die von Trudgill untersuchten Varietäten eher zutrifft. Hinzu kommt das politische Moment in Belarus, d.h. die starke symbolische Aufgeladenheit des Weißrussischen vor dem Hintergrund des Sprachen-konflikts und mit der Wahl des Weißrussischen (häufig) verbundenen politischen Einstel-lungen, und die starke Stigmatisierung von gemischter Rede in der Öffentlichkeit. Drittens bestehen Unterschiede, was die Unterschiedlichkeit zwischen den beteiligten Varietäten
31
verwandter, strukturell ähnlicher und zumindest teilweise gegenseitig ver-ständlicher sprachlicher Varietäten sind andere Prozesse zu erwarten als im Falle des Kontakts strukturell entfernterer und gegenseitig nicht verständli-cher sprachlicher Varietäten. Im Falle des intensiven Kontakts solch ähnli-cher sprachlicher Varietäten etwa aufgrund von Migrationsbewegungen sind Stabilisierungen und damit die Entstehung neuer, gemischter Varietäten unter dem Begriff „Koineization“ seit langem bekannt. Die Herausbildung einer neuen „gemischten“ Varietät kann schnell, innerhalb weniger Generationen erfolgen. So sind beginnend mit der ersten Generation von Neuankömmlin-gen in einer städtischen Umgebung beim Entstehen neuer Stadtdialekte drei Phasen zu beobachten, die grob mit drei Generationen korrespondieren (vgl. TRUDGILL 1986, 2004; CHAMBERS & TRUDGILL 1998; SIEGEL 2001; MILROY 2002; KERSWILL 2007):
Phasen bei der Entstehung „Neuer Dialekte“ (nach KERSWILL 2007, 679) Tab. 2
Phase Sprechergenerationen Sprachliche Charakteristika I Erwachsene Migranten Rudimentäres Levelling II Erste „eingeborene“ Sprecher Extreme Variabilität, weiteres Levelling III Nachfolgende Generationen Fokussierung, Levelling, Reallokation
Kennzeichnend für die erste Migrantengeneration und die Generation von deren Kindern ist ein hohes Maß an sprachlicher Variabilität. Entscheidend für die Entstehung eines neuen gemischten Dialekts in dieser dementspre-chend im Sinne von LE PAGE & TABOURET-KELLER (1985) diffusen30, durch das Fehlen klarer usueller Normen gekennzeichneten Sprachgemeinschaft ist das sogenannte „Levelling”, d.h. „the eradication of socially or locally marked variants” (WATT & MILROY 1999, 26), welches letztendlich zu grö-ßerer linguistischer Homogenität führt (vgl. TRUDGILL 1986, 98–102; WILLIAMS & KERSWILL 1999; KERSWILL & WILLIAMS 2000; MILROY 2002; WATT 2002; TORGERSEN & KERSWILL 2004).31 Dieser Ausgleich, der vor allem in der Generation der Kinder der Migranten erfolgt, ist dabei das Er-
angeht: Der Grad an lexikalischer und morphologischer Unterschiedlichkeit zwischen dem Weißrussischen und Russischen ist sicherlich höher als im Falle englischer Dialekte, wäh-rend die phonetisch-phonologischen Unterschiede eher gering sind. Zu den Implikationen dieser Unterschiede für WRGR und deren Analyse s.u.
30 Dass die massive Binnenmigration in der weißrussischen städtischen Landschaft der zwei-ten Hälfte des 20. Jh. zu einem hohen Maß an sprachlicher Diffusität geführt hat, wird auch von der weißrussischen Linguistik bestätigt (vgl. SADOŬSKI 1982, 196).
31 Wobei in solchen Situationen auch neue Formen auftreten, die phonetisch zwischen den älteren, markierten Formen liegen (vgl. TRUDGILL 1986, 60–62).
32
gebnis von unzähligen Einzelakten an Akkommodation, d.h. der temporären und graduellen Anpassung der Rede an gewisse sprachliche Charakteristika des Gegenübers (vgl. GILES et al. 1973) und bzw. oder an das prestigeträch-tige Redeverhalten anstrebenswerter sozialer Gruppen. Entscheidend sind dabei Faktoren wie Identität, das Prestige der sprachlichen Varietäten und die Einstellung gegenüber diesen Sprachen, die wichtiger sind als die absoluten Sprecherzahlen. Vermieden werden dementsprechend Varianten mit negati-ver Konnotation (vgl. TORGERSEN & KERSWILL 2004, 46; KERSWILL 2007, 680f.). Universalen Tendenzen des Sprachwandels, wie sie etwa die Natürli-che Phonologie (DONEGAN 1972; STAMPE 1979; DRESSLER 1984) oder die Optimalitätstheorie (PRINCE & SMOLENSKY 1993) beschreibt, wird dagegen eine prinzipiell untergeordnete Rolle zugeschrieben (TORGERSEN & KERSWILL 2004, 47). Jedoch können universale Präferenzen die Schnelligkeit der An-nahme von sprachlichen Merkmalen beeinflussen (TRUDGILL 1986, 19).
Solche zeitlich begrenzten Anpassungen können sich im Idiolekt eines Individuums verfestigen, was angesichts der gleichen sozialen Verhältnisse und gesteuert durch die quantitativen Verhältnisse der Vertreter der unter-schiedlichen Ausgangsdialekte auch zu einer Angleichung der Idiolekte führt (TRUDGILL 1986, 40). Von der nächsten Generation werde diese quantitativ stabilisierte Rede aufgenommen, und es setzt eine Fokussierung ein, d.h. es entsteht ein Bewusstsein für die sprachlichen Verhältnisse in dieser Sprach-gemeinschaft, mithin eine in der Sprachgemeinschaft akzeptierte Norm, deren Brechen mit Sanktionen verbunden ist (LE PAGE & TABOURET-KELLER 1985, 201). Oft drücken die neuen sprachlichen Varianten eine regionale Zugehörigkeit aus, ohne das Stigma als dörflich wahrgenommener lokaler Merkmale (FOULKES & DOCHERTY 1999, 13). Dabei können die systemlin-guistischen oder soziolinguistischen Funktionen von sprachlichen Merkmalen umgedeutet werden („Reallokation“ nach TRUDGILL 1986, 110). So können sprachliche Varianten zuerst innerhalb einer Gemeinschaft „ethnisch“ diffe-renzieren, dann später Zugehörige dieser Gemeinschaft von „Outsidern“ trennen (so zum Beispiel in den von LABOV 1963 und DYER 2002 unter-suchten Fällen; vgl. auch DUBOIS & HORVATH 1999). Dabei ist aus der Außenperspektive nicht immer direkt ersichtlich, welche sprachlichen Merkmale als Ausdruck einer lokal definierten Identität prestigeträchtig sind.
33
Ein offiziell negativ bewertetes Sprachverhalten kann durchaus ein „ver-decktes“ („covert“) Prestige aufweisen (TRUDGILL 1972; DYER 2002, 113).32
Vor diesem Hintergrund und angesichts des Faktes, dass WRGR an min-destens eine zweite Generation weitergegeben wurde, ist es unwahrschein-lich, dass in WRGR keine Tendenzen zu einer Stabilisierung in Richtung eines überindividuellen Systems eingetreten sind (KITTEL et al. 2010, 52).33 Die linguistische Seite von WRGR wurde bis vor wenigen Jahren jedoch nicht empirisch untersucht (und auch nicht für untersuchenswert gehalten, vgl. WOOLHISER 1995, 80). In der weißrussischen Linguistik sind einige Arbeiten entstanden (MEČKOVSKAJA 2006, 2007; CYCHUN 2013 [1998], 2000; KLIMAŬ 2014), die aber nicht an konkretem sprachlichen Material arbeiten (oder nur an einer begrenzten Datenmenge, wie MEČKOVSKAJA 2007). Die Aussagen, die getroffen werden, sind daher eher impressionisti-scher Natur und waren bis vor kurzem nicht verifizierbar.
An empirischen Arbeiten sind die Arbeiten von LISKOVEC (2001, 2002, 2005, 2009) zu nennen sowie die bereits an einigen Stellen erwähnten, im Rahmen des Oldenburger Projekts Die Trasjanka in Weißrussland entstande-nen Arbeiten von HENTSCHEL & TESCH (2006a/b, 2007), HENTSCHEL (2008a/b/c, 2011, 2012, 2013a/b, 2014a/b/c), HENTSCHEL & BRANDES (2009), TESCH & HENTSCHEL (2009), BRANDES (2010), TESCH (2012, 2013, 2014), HENTSCHEL & ZELLER (2012), MENZEL (2013) und MENZEL &
HENTSCHEL (i.Dr.).34 Diese beruhen auf einem Korpus gemischter Rede (im Folgenden: OK-WRGR für „Oldenburger Korpus der weißrussisch-russisch-gemischten Rede“, siehe auch das Quellenverzeichnis) aus unterschiedlichen weißrussischen Städten (Genaueres siehe Abschnitt 4.2.1).
32 Der Begriff „covert prestige“ bezieht sich darauf, dass für Sprecher, die ein hohes Maß an
stigmatisierten Formen benutzen, obwohl sie selbst diese Formen als „schlecht“ einschät-zen, angenommen werden muss, dass sie sie auf einer gewissen Ebene benutzen wollen (CHAMBERS & TRUDGILL 1998, 85). Mit MILROY & MILROY (1985, 368) ist anzunehmen, dass jede sich durchsetzende sprachliche Innovation ihre offene oder versteckte positive Bewertung voraussetzt.
33 Variation wäre in einem neuen überindividuellen System natürlich nicht ausgeschlossen. Bekanntlich ist strukturierte Variabilität ein Kennzeichen jedweden Sprachgebrauchs (MILROY & MILROY 1985, 340; GUY 2008, 371). Und auch auf ein solches neues System kann natürlich wieder ein Einfluss des Russischen erfolgen.
34 Dies sind zunächst die Arbeiten, die sich nicht – oder nicht ausschließlich – mit der phoni-schen Seite von WRGR befassen. Auf Arbeiten zur phonischen Seite wird später in Ab-schnitt 3.4 eingegangen. Eine Liste der Arbeiten mit aktuellen Ergänzungen findet sich auf der Seite http://www.uni-oldenburg.de/slavistik/forschung/sprachwissenschaft/schwer-punkt-mischvarietaeten/publikationen-wrgr/.
34
Die bisherigen Untersuchungen im Rahmen des Oldenburger Projekts zei-gen deutlich, dass Ausgleichstendenzen in der WRGR bestehen, dass also in einigen Konkurrenzfällen bei den untersuchten Sprechern recht stabile quan-titative Verhältnisse der ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Variante vorlie-gen, und zudem oft klare, überindividuelle Tendenzen zugunsten eines der beiden Elemente zu erkennen sind. Die Oldenburger Arbeiten geben zudem über die Verhältnisse von ‚Russischem‘ und ‚Weißrussischem‘ auf den unterschiedlichen sprachlichen Ebenen Aufschluss. Traditionell wird als „Grundlage“ von WRGR das Weißrussische betrachtet. Dies bezieht sich zum einen auf die Entstehung, die ja in einer Hinwendung von Sprechern weißrussischer Dialekte zum Russischen begründet war. Zum anderen be-zieht es sich darauf, dass der Einfluss des Russischen vor allem auf der lexi-kalischen Ebene gesehen wird, auf tieferen Ebenen der Entlehnungshierar-chie von THOMASON & KAUFMANN (1988) und THOMASON (2001) als eher gering eingestuft wird (CYCHUN 2013 [1998], 21; SJAMEŠKA 1998, 40; LISKOVEC 2005, 147f.; MEČKOVSKAJA 2007, 94). Diese Einschätzungen sind zu differenzieren: Zunächst ist es zwar so, dass sich ‚weißrussische‘ Ele-mente im Flexionsbereich stärker halten als im lexikalischen Bereich (HENTSCHEL 2008a, 458; HENTSCHEL & TESCH 2007, 22). HENTSCHEL (2008a/c), HENTSCHEL & BRANDES (2009); BRANDES (2010) und MENZEL & HENTSCHEL (i.Dr.) zeigen aber, dass auch in der Flexionsmorphologie russi-sche Morpheme in einzelnen strukturellen Positionen in nicht unerheblicher Menge vorhanden sind und teilweise sogar überwiegen.35 Im Bereich der Demonstrativpronomina bildet sich ein neues, ‚hybrides‘ System heraus, dass Züge des Weißrussischen und des Russischen vereint (vgl. HENTSCHEL 2008b). Ebenso ist im lexikalischen Bereich eine differenzierte Sichtweise angebracht. Während oft die ‚weißrussische‘ und die ‚russische‘ Variante in vergleichbaren Anzahlen auftreten, überwiegt in einzelnen Konkurrenzfällen das ‚weißrussische‘, in anderen das ‚russische‘ Element. Über die untersuch-ten Städte, Sprechertypen und Teilkorpora hinweg bleibt dabei konstant, welche lexikalischen Elemente stärker ‚russisch‘, welche stärker ‚weißrus-sisch‘ geprägt sind. Es handelt sich also um stabile Hierarchien (HENTSCHEL 2013b, 2014b).
Insgesamt besteht also ein (natürlich Variation nicht ausschließender) überindividueller Usus, mithin starke Evidenz dafür, dass es sich bei WRGR
35 Bei all diesen Aussagen muss bedacht werden, dass eine große Anzahl an Morphemen als
‚gemeinsam‘ einzustufen ist.
35
um einen überindividuellen dritten Kode neben dem Weißrussischen und dem Russischen handelt, der Züge beider Kontaktvarietäten vereint und neue, dritte herausgebildet hat. Unterschiede bestehen wie zu erwarten vor allem zwischen den Generationen, d.h. zwischen Land-Stadt-Migranten, deren Elterngeneration (Dorfbewohnern) und deren bereits in den Städten aufge-wachsenen Kindern. Auch die Elterngeneration der Migranten weist wie gesagt bereits ‚russische‘ Züge und ‚hybride‘ Äußerungen auf, jedoch in geringerem Ausmaß als die folgenden Generationen, wobei die jüngste Generation die höchsten Anteile des Russischen aufweisen (HENTSCHEL &
TESCH 2007, 22; HENTSCHEL & ZELLER 2012).36 Wichtig dabei ist, dass sich zwar in dieser Generation die quantitativen Verhältnisse zugunsten des Rus-sischen verschieben, sich qualitativ aber kaum Unterschiede finden. So ist es nicht etwa so, dass diese Generation weißrussische Elemente in eine russisch-basierte Rede integriert, als Akkommodation an die stärker weißrussische Rede ihrer Eltern. Innerhalb ‚hybrider‘ Äußerungen finden sich kaum Unter-schiede zwischen den Generationen (vgl. TESCH 2014; siehe auch 4.4).
Ein Status als dritter Kode schließt nicht aus, dass auch in der Rede ein und desselben Sprechers Unterschiede bestehen. Einen auf solche Phäno-mene gerichteten Blickwinkel nehmen die Arbeiten von HENTSCHEL (2008c; 2013a), TESCH & HENTSCHEL (2009) und teilweise HENTSCHEL & ZELLER
(2012) ein. Bereits HENTSCHEL & TESCH (2007, 23) nehmen an, dass WRGR ein Kontinuum nicht aus zwei, sondern aus drei Vektoren darstellt, mit den Polen „maximal russisch“, „maximal weißrussisch“, „maximal gemischt“. Zwischen diesen Polen bewege sich das sprachliche Verhalten der Sprecher: Je nach Gesprächssituation nähern sich die Sprecher mal dem „weißrussi-schen“, mal dem „russischen“ Pol, mal dem „gemischten“, d.h. Sprecher zeigen mal ‚weißrussische‘, mal ‚russische‘ Äußerungen sowie in unter-schiedlichem Maße zum ‚Russischen‘ und ‚Weißrussischen‘ tendierende ‚hybride‘ Äußerungen (vgl. HENTSCHEL 2008c). Vergleichbare „konversatio-nelle Standard/Dialekt-Kontinua“, d.h. „allmähliche Übergänge von stan-dardnäherer Sprechweise zu dialektnäherer Sprechweise (oder umgekehrt)“ (AUER 1986, 97f.) sind nichts Ungewöhnliches und z.B. in süddeutschen (bairischen und alemannischen) Sprachgemeinschaften alltäglich und nicht stigmatisiert. Auer benutzt hierfür den Begriff „Code-Shifting“. In diesen
36 Eine Entsprechung zeigt sich bei HENTSCHEL & KITTEL (2011, 63) bei den Selbstauskünf-
ten von Weißrussen: So ordnen in der jüngsten untersuchten Altersgruppe mehr Informan-ten ihre Rede als „Russisch mit einigen weißrussischen Wörtern“ ein, zuungunsten der Ka-tegorie „Russisch-Weißrussisch-gemischt“.
36
Kontinua ist es nicht so, „dass der einzelne Sprecher diese Pole jemals in seiner eigenen Sprachproduktion erreichen müsste, sondern lediglich, dass er diese kennt und Strukturen, auch wenn sie jenseits seines eigenen Variati-onsspielraums liegen, in Richtung auf den einen oder anderen Pol einordnen kann“ (AUER 1986, 98). Dieses Code-Shifting geschieht funktional, d.h. hat eine „interaktive Bedeutung“ in der „sequenziellen Entwicklung der Interak-tion“ (AUER 1986, 113).
Zudem ist – wie AUERs (1999) Ausführungen zeigen – zwischen „alten“ Kontaktvarietäten und einem aus diesen entstandenen neuen gemischten System natürlich wieder funktionales Code-Switching möglich. In der Tat produzieren viele Sprecher im OK-WRGR durchaus längere Blöcke von nur ‚russischen‘ und in einem geringeren Umfang von nur ‚weißrussischen‘ Äußerungen (vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2012). Wenn diese Sprecher auch längere Blöcke ‚hybrider‘ Äußerungen aufweisen, ist daher anzunehmen, dass sie dies zu einem gewissen Grade bewusst tun. Wie Hentschel argumen-tiert, weist dies darauf hin, dass auch pragmatisch WRGR ein neuer, dritter Kode neben dem Russischen und dem Weißrussischen ist (vgl. HENTSCHEL 2013a, 61). Es ist anzunehmen, dass funktionale Kodewechsel zwischen diesen Blöcken vorliegen, es mithin zum Kodewechsel zwischen den „alten“ Kontaktvarietäten und WRGR kommt. Es ist also zu unterscheiden zwischen WRGR im engeren Sinne, d.h. einem gemischten Kode, der sich im satz-internen Wechsel von ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Elementen äußert, und WRGR im weiteren Sinne, d.h. „gemischter Diskurs“, also dem Neben-einander des weißrussischen, gemischten und russischen Kodes im Diskurs, der sich im Wechsel von ‚weißrussischen‘, ‚russischen‘ und ‚hybriden‘ Äu-ßerungen zeigt (vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2012, 200–202).
Was diese sprecherinterne Variation angeht, so sind bisher wenig Versu-che unternommen worden, diese lokal- oder global-funktional zu beschrei-ben. HENTSCHEL (2008c, 212–215) zeigt allerdings am Beispiel des Teilkor-pus aus der Stadt Baranavičy, dass in der Rede von Vertretern der Generation der Land-Stadt-Migranten und in der Rede der Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten der Anteil ‚weißrussischer‘ Elemente deutlich steigt, wenn am Gespräch auch Vertreter der (dialektal-)weißrussisch geprägten Generation der Eltern der Land-Stadt-Migranten teilnehmen.
37
3 Phonische Variation in weißrussisch-russischer gemischter Rede – Hintergrund und Fragestellung
3.1 Phonische Variation im Sprachkontakt, insbesondere im Kontakt eng verwandter Varietäten
Die Rolle der phonischen Ebene im Sprachkontakt ist auf den ersten Blick widersprüchlich. Einerseits ist die phonische Ebene der Erstsprache von einer starken Resistenz gegenüber Einflüssen einer anderen Sprache gekennzeichnet. In der Regel behalten Sprecher die phonischen Merkmale bei, die sie bis zum Erwachsenenalter erworben haben, während das Lexikon auch später für Veränderungen offen ist. So gelten Interferenzerscheinungen der erstsprachlichen Phonetik und Phonologie beim Zweitspracherwerb als wahrscheinlich. Später Zweitspracherwerb einer großen Gruppe mit anschließender Fossilisierung der Lernervarietät führt daher oft zu einer Varietät, die sich lexikalisch kaum von der Zielvarietät unterscheidet, phonetisch-phonologisch jedoch der Ausgangssprache gleicht (vgl. MATRAS 2009, 58). Die phonische Seite der Ausgangssprache hinterlässt also als „letzte Bastion“ der Ausgangssprache bei Sprachwechsel als Substrateinfluss häufig Spuren auch im System der – angenommenen und weitergegebenen – Zielsprache in folgenden Generationen (VAN COETSEM 1988, 56; THOMASON & KAUFMANN 1988, 37–45). Einen ähnlich starken Einfluss kann die auf-nehmende Sprache auf die phonische Gestalt von Lehnwörtern ausüben, diese werden in aller Regel mehr oder weniger stark an das phonetisch-phonologische System der aufnehmenden Sprache angepasst. Wenn in Lehnwörtern nicht der aufnehmenden Sprache entsprechende Phoneme, Phonemkombinationen, Wortakzente übernommen werden, so wird dies durch eine hohe Kompetenz in der Sprache, aus der entlehnt wird, stark begünstigt (neben anderen Faktoren wie dem Prestige der Sprache, vgl. z.B. MATRAS 2009, 222f. und 226–229). Unabhängig von Lehnwörtern erfolgt Entlehnung phonischer Elemente generell seltener und später als Entlehnung auf anderen sprachlichen Ebenen und setzt einen hohen Grad an Zweispra-chigkeit zumindest eines Teils der Bevölkerung voraus (CAMPBELL 1996, 99;
38
THOMASON & KAUFMAN 1988, 74–76; VAN COETSEM 1988, 3; SANKOFF 2007, 644–649; MATRAS 2009, 229–230). Diese Resistenz der phonischen Ebene wird meist mit der Unbewusstheit und hohen Automatisiertheit der Artikulationsmotorik und der starken Strukturiertheit des phonologischen Subsystems in Zusammenhang gebracht (VAN COETSEM 1988, 25–34) sowie mit der aus Sicht des Lerners im Vergleich etwa zum Erwerb der fremdsprachlichen Lexik geringeren Salienz und geringeren Wichtigkeit der phonischen Elemente der Zielsprache (MATRAS 2009, 221f.). All dies passt zu der gängigen Meinung, dass die phonische Seite der WRGR dem Weißrussischen entspricht, ähnlich wie das Standardrussische auf dem Gebiet von Belarus starke phonische Spuren des Weißrussischen enthält.
Andererseits kann sich ein Sprecher – wie aus zahlreichen Arbeiten zu sprachinterner Variation in der Folge von LABOV (1972) und zu Dialekt-kontakt in der Folge von TRUDGILL (1986) hervorgeht – in manchen Berei-chen in seiner Aussprache sehr wohl an die Aussprache seines Gegenübers anpassen bzw. generell phonische Variation aktiv (bei unterschiedlichem Grad an Bewusstheit) kommunikativ-funktional nutzen. Auch lautliche Elemente unterliegen also sprachlicher Akkommodation und stilistischer Variation. Wie in Abschnitt 2.2 (auf einer allgemeineren Ebene) dargestellt wurde, kann dies relativ schnell zu dauerhaften Änderungen des sprachlichen Verhaltens auch von bereits erwachsenen Sprechern führen (‚long-term accommodation‘ im Sinne Trudgills)37 und letztlich zu der Herausbildung von neuen, überindividuellen Systemen führen.
Zwischen phonischen Variablen bestehen dabei Unterschiede, die mit LABOV (1972, 237) mit den Begriffen „Marker“ und „Indikator“ erfasst werden können. Indikatoren sind Merkmale, deren quantitative Verhältnisse sich zwischen sozialen Gruppen unterscheiden, nicht jedoch innerhalb einer Gruppe in unterschiedlichen Gesprächssituationen. Die quantitativen Verhält-nisse von Markern unterscheiden sich dagegen auch innerhalb einer sozialen Gruppe bzw. eines Sprechers je nach Gesprächssituation, etwa dem Gesprächspartner oder dem Offizialitätsgrad. Es ist davon auszugehen, dass Marker im Vergleich zu Indikatoren einen relativ hohen Grad an Bewusstheit bei den Sprechern voraussetzen, was üblicherweise unter dem Begriff der Salienz erfasst wird (TRUDGILL 1986, 37). Dieser Begriff ist sicherlich prob-lematisch und wird mitunter zirkulär und post hoc definiert (vgl. KERSWILL &
37 Dass auch ältere Sprecher dauerhafte Änderungen in ihrem phonischen System aufweisen
können, zeigt HARRINGTON (2007).
39
WILLIAMS 2002). TRUDGILL (1986) und CHAMBERS & TRUDGILL (1998) nennen als Faktoren, die größere Salienz bedeuten, die Stigmatisierung eines Merkmals in einer Sprachgemeinschaft, die Involviertheit in Sprachwandel, eine große phonetische Distanz zwischen den Ausprägungen der Variablen sowie den Phonemstatus der Ausprägungen der Variablen. Des Weiteren werden Diskretheit oder Gradualität des Unterschieds, die Beschränktheit des Merkmals auf ein kleines Areal, die orthographische Wiedergabe des Merk-mals und der Gebrauch des Merkmals bei Kodewechsel genannt (AUER, BARDEN & GROSSKOPF 1998, 167). Den höchsten Grad an Salienz schreibt TRUDGILL (1986, 12) solchen Merkmalen zu, die bei schauspielerischer Nachahmung („Imitation“) eines Akzentes oder einer sprachlichen Varietät benutzt werden.38 Wie AUER, BARDEN & GROSSKOPF (1998, 165) ausführen, sind dies zum einen deutlich subjektive, zum anderen eher objektive Aspekte, wobei anzunehmen ist, dass die subjektiven (wie die Stigmatisierung in einer Sprachgemeinschaft) teilweise durch objektive (phonetische Distanz) begrün-det oder zumindest ermöglicht werden, also eher Symptome als Ursachen von Salienz sind. Dass zwischen den objektiven und subjektiven Gründen aber eine gewisse Unabhängigkeit besteht, belegt die Tatsache, dass Variab-len den Status ändern können, also von Indikatoren zu Markern werden, wenn sich die Einstellung in einer Sprachgemeinschaft ändert (CHAMBERS & TRUDGILL 1998, 75f.).
Während sich die Arbeiten in der Tradition Trudgills stark auf phonische Variation beziehen, ergibt sich ein anderes Bild bei Arbeiten zu sogenannten Mischsprachen und zu bilingualer, gemischter Rede, wenn also deutlichere Unterschiede auf strukturell tieferen Ebenen hinzutreten. Die phonische Seite des Code-Switchens ist relativ unerforscht (vgl. für einen Überblick BULLOCK 2009). Einige wenige experimentelle Ansätze wie TORIBIO et al. (2005) und BULLOCK et al. (2006) zeigen, dass bei einem lexikalischen Kodewechsel ein Einfluss des phonetisch-phonologischen Systems der einen Sprache auf das der anderen erfolgen kann, aber nicht muss.
In der Diskussion sogenannter Mischsprachen („Mixed Languages“) nimmt die phonische Seite allenfalls eine periphere Position ein. MATRAS &
BAKKER (2003) definieren Mischsprache bzw. deren Prototypen als eine
38 Auch wenn Trudgill den Begriff „Imitation“ nur für recht spezielle Kontexte verwendet
(dem Vorspielen eines bestimmten Akzentes bei Popsängern), ist es wahrscheinlich, dass ähnliche „schauspielerische“ Nachahmungen auch bei dem der Fall sein kann, was Trudgill eigentlich unter Akkommodation versteht. Mit anderen Worten: Bei der Anpassung an eine fremde Aussprache können weniger bewusste und absolut bewusste Anpassungen auftreten.
40
Sprache, die einen „lexicon-grammar-split“ aufweist (die grammatischen Elemente und Strukturen dieser Sprache stammen aus einer, das Lexikon aus einer anderen Sprache) oder eine vergleichbare klare Aufteilung auf die ursprünglichen Kontaktsprachen. (Für WRGR besteht eine solch klare Tren-nung bekanntlich nicht, auch wenn in WRGR probabilistische Unterschiede zwischen lexikalischen und grammatischen Einheiten in Bezug auf die Affi-nität dieser Einheiten zum Russischen oder Weißrussischen bestehen, vgl. HENTSCHEL 2008c, 169; 2013a). Die phonische Seite wird – wie bei BAKKER & MOUS (1994, 4–5) – in dieser Definition mit der Morphologie und Syntax unter der Grammatik mitverstanden, spielt jedoch für die Definition einer Mischsprache allein keine Rolle (wie auch rein phonische Einflüsse des Weißrussischen nicht erlauben, von WRGR zu sprechen).
In der Regel wird für Mischsprachen also angenommen, dass ihr phoni-sches System auf die Sprache zurückgeht, auf der auch das morphologische und syntaktische System beruht. Es gibt jedoch auch Fälle, in dem ein Bei-trag beider Ausgangssprachen auf die phonische Seite der Mischsprache angenommen wird. Wenn auch das lexikalische System der Mischsprache einen Split aufweist, so ist die theoretisch interessante Frage, ob für die Ele-mente aus den beiden Sprachen unterschiedliche phonologische Systeme möglich sind. Ein solcher möglicher Fall ist Michif. In Michif entstammt das Nominalsystem fast ausschließlich dem Französischen, das Verbalsystem und Pronominalsystem dem Cree (vgl. BAKKER 1997). BAKKER (1997, 7) vertritt die Meinung, dass diese Teilsysteme auch unterschiedliche phonologische Systeme hätten, sowohl, was das Phoneminventar, als auch was phonologi-sche Regeln angeht. Ähnlich äußert sich EVANS (1982, 159), fügt jedoch hinzu, dass dies ein unikaler Fall sei.
Zu unterscheiden ist in dieser Diskussion zwischen unterschiedlichen Aspekten der Phonologie. Dass in Lexemen unterschiedlicher Etymologie teilweise unterschiedliche Phoneme vorkommen, ist natürlich trivial, gilt auch für Lehnwörter in Nicht-Mischsprachen und spricht nicht bzw. nur in einem bestimmten Sinne für ein gemischtes phonologisches System. Ebenso wie für Lehnwörter in Nicht-Mischsprachen können auch die Ergebnisse phonologischer Regeln in lexikalisierter Form übernommen werden. Dass darüber hinaus aktive phonologische Prozesse unterschiedlich gelten, ist auch für Michif zu bezweifeln (vgl. VAN GIJN 2009, 109). ROSEN (2006) zeigt anhand des Akzentsystems, dass zwar beide Ursprungssprachen ihren Beitrag zu diesem System leisten, aber das System unabhängig von der Etymologie für das gesamte Lexeminventar gilt. PRICHARD & SHWAYDER (2013) zeigen,
41
dass für zwei oft postulierte Unterschiede zwischen Lexemen aus dem Französischen und dem Cree keine Evidenz besteht. Das französische Phäno-men der Liaison (finale Konsonanten fallen aus, wenn kein Wort mit initia-lem Vokal folgt) besteht für beide Lexeminventare. Anhand akustischer Mes-sungen zeigen sie zudem, dass es nicht so ist, dass in Lexemen aus dem Französischen eine Vokalopposition nach der Qualität, in Lexemen aus dem Cree nach der Quantität besteht. Für in einem strengeren Sinne gemischte phonische Systeme in einer Sprache gibt es also keine Evidenz.
An dieser Stelle ist auf einige Spezifika von WRGR im Vergleich zu den bisher genannten Beispielen einzugehen bzw. sind diese noch einmal hervor-zuheben. Es handelt sich zum einen um ein Phänomen des Kontakts nah verwandter, strukturell ähnlicher und in gewissem Maße gegenseitig ver-ständlicher Varietäten. In den klassischen Arbeiten zu Sprachkontakt (WEINREICH 1970; THOMASON & KAUFMANN 1988; MATRAS 2009) wird auf die Spezifika solcher Konstellationen kaum eingegangen. Zum anderen be-stehen aber zwischen dem Weißrussischen und dem Russischen anders oder stärker als bei den in der Tradition TRUDGILLs (1986) vor allem beschriebe-nen Kontakten englischer Varietäten durchaus Unterschiede im lexikalischen, morphologischen und auch morphosyntaktischen Bereich. Wie in Abschnitt 2.3 angedeutet, besteht für den Kontakt des Weißrussischen mit dem Russi-schen in dieser Hinsicht eine deutlichere Nähe zu den von AUER (1986; 1997) und MUYSKEN (2000, 122–153) – bei letzterem unter dem Stichwort „kongruente Lexikalisierung“ – untersuchten Phänomenen. So beobachtet AUER (1986) für süddeutsche Sprachgemeinschaften, dass viele Sprecher nicht abrupt zwischen Dialekt und Standard wechseln, sondern fließende Übergänge aufweisen und auch über längere Strecken in ihrer Rede in schnellem Wechsel oder gleichzeitig (dann auf unterschiedlichen sprachli-chen Ebenen) Züge beider Varietäten zeigen. MUYSKEN (2000) beobachtet ebenso, dass für einige mehrsprachige Sprachgemeinschaften in bestimmten Situationen der schnelle Wechsel von Elementen beider Sprachen charak-teristisch ist. Anders als in den traditionell im Rahmen von Code-Switching behandelten Beispielen ist der Wechsel prinzipiell an allen Stellen möglich, auch innerhalb von Wortformen. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit und des Zusammenfalls vieler Elemente ist keine klare Matrixsprache zu erkennen.
MUYSKEN (2000) und AUER (1986) unterscheiden sich von Arbeiten in der Tradition Trudgills und Labovs zum einen in ihrer syntagmatischen Herangehensweise. Zum anderen unterscheiden sich die Phänomene, die sie
42
untersuchen, da auch Unterschiede in der Lexik und Morphologie eine Rolle spielen. Beides führt dazu, dass sie ein Problem ansprechen, das in der Tra-dition Trudgills und Labovs kaum beachtet wird, jedoch auch für die vorlie-gende Untersuchung gilt, nämlich das Problem des Zusammenhangs zwi-schen verschiedenen Variablen in der Rede.
When Labov identified the linguistic variable as the site of variation in linguistic systems, and then proceeded to analyse the behaviour of lin-guistic variables in isolation, a vision emerged in which individual structural elements: phonemes, grammatical elements, etc. vary in-dependently from another. This vision, again, reinforces our view of variation (involving isolated, loose elements) as being very different from code-mixing (involving stretches of items from different sys-tems). The non-standard pronunciation of a vowel in one word often goes together with the non-standard pronunciation of another sound in the next word. Many linguistic variables enter into patterns of co-variation, however, so that individual cases of variation are closer to code-mixing. The fact that covariation is hard to investigate has made us oblivious to this. (MUYSKEN 2000, 126)
Wenn auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen Variation vorliegt, geht es dabei nicht nur um die Häufung in aufeinanderfolgenden Redeabschnitten (wie in dem obigen Zitat), sondern auch um das Zusammenspiel unterschied-licher sprachlicher Ebenen – etwa der Ebene der ersten und der Ebene der zweiten Artikulation – innerhalb ein und derselben Redeeinheit. Solche Zu-sammenhänge in gemischter Rede sind noch weitgehend unerforscht, auch MUYSKEN (2000) geht darauf nicht ein. In den Ansätzen in der Folge von TRUDGILL (1986) wird auf die Zusammenhänge zwischen sprachlichen Ebenen wie gesagt ebenfalls kaum eingegangen, was natürlich mit den häufig nur geringen Unterschieden im morphologischen Bereich der untersuchten Varietäten zusammenhängt. Gegenbeispiele, die diese Zusammenhänge behandeln, sind KUČERA (1973) und AUER (1986, 107–111; 1997). Sie zei-gen, dass die Phänomene auf unterschiedlichen Ebenen nicht unabhängig voneinander variieren. So walten auf der Ebene des phonologischen Wortes (und darüber hinaus) bestimmte Kookkurrenzrestriktionen, bestimmte Kom-binationen von sprachlichen Merkmalen innerhalb eines phonologischen Wortes sind also ausgeschlossen.
KUČERA (1973) behandelt den tschechischen Sprachraum, wo sich be-kanntlich das in formellen Situationen benutzte Standardtschechische relativ stark von dem in informellen Situationen benutzten Gemeintschechischen
43
(„obecná čeština“) unterscheidet. Hybride Formen sind in der Rede möglich, allerdings sind nicht alle theoretisch möglichen hybriden Formen akzeptabel bzw. gleichermaßen akzeptabel. So variiert beispielsweise das stan-dardsprachliche [i:] mit informellem [ej] als Realisierung des /iː/ (ein phoni-scher Unterschied) sowie das standardsprachliche Morphem {-imi} (als Marker des Instr.Pl. bei Adjektiven) mit dem informellen {-ima} (also ein morphonematischer Unterschied). Neben den nicht-hybriden Formen [mladi:mi] und [mladejma] ‚jung; Instr.PL.‘ kann das standardsprachliche [i:] mit dem informellen {-ima} in einer (hybriden) Wortform [mladi:ma] auf-treten, die theoretisch ebenfalls bildbare Kombination aus informellem [ej] und standardsprachlichem {-imi} ist dagegen ausgeschlossen: *[mladejmi]. KUČERA (1973, 504) bemerkt hierzu, dass dies nicht nur eine Tendenz sei, sondern dass die Kombination aus informellem [ej] und standardsprachli-chem {-imi} für jeden Sprecher des Tschechischen inakzeptabel sei, unab-hängig vom Grad der Offizialität.
AUER (1997), der analoge Beispiele in einer Reihe von konversationellen Standard/Dialekt-Kontinua behandelt, erklärt diese Restriktionen damit, dass die Varianten bestimmter Variablen stärker als dialektal bzw. stan-dardsprachlich wahrgenommen werden als die Varianten anderer Variablen.39 Er nimmt an, dass es die lexikalisch-morphologische Ebene ist, die das Auf-treten phonischer Variablen restringiert, und nicht umgekehrt. Stark lexikali-sierte Dialektmerkmale in einem phonologischen Wort implizieren das rein phonische Dialektmerkmal, schließen das entsprechende standardsprachliche Merkmal also aus. Stark lexikalisierte Merkmale des Standards lassen dage-gen eine standardsprachliche und eine dialektale Aussprache zu. Eine solche Wahrnehmung von sprachlichen Merkmalen als stärker dialektal oder stärker standardsprachlich, und damit auch die Restriktionen der Kookkurrenz gehö-ren nach Auer zur Kompetenz des Sprechers in einer Sprachgemeinschaft, in der konversationelle Standard/Dialekt-Kontinua üblich sind.
Das Spezifikum von WRGR liegt also darin, dass einerseits aufgrund der Ähnlichkeit der beteiligten Kontaktsprachen Phänomene zu erwarten sind, die unter dem Stichwort „Dialektkontakt“ behandelt werden, d.h. durch Ak-
39 Eine ähnliche Erklärung liefert RICKFORD (2007, 147) für die Beobachtung, dass in
gemischter Rede von Englisch- und Kreolsprechern einige Kreolmerkmale bestimmte Merkmale des Standardenglischen ausschließen, andere Kreolmerkmale dies nicht tun. Einige Merkmale des Kreols seien stärker markiert als andere. Hier geht es jedoch nicht um die Kovariation auf der Ebene von Redeeinheiten (dem phonologischen Wort o.ä.), sondern in dem Idiolekt von Sprechern insgesamt.
44
kommodation bedingte lautliche Variation ähnlich „sprachinterner Varia-tion“. Andererseits sind die Unterschiede zwischen den beteiligten Kontakt-sprachen auf tieferen Ebenen nicht zu vernachlässigen, so dass Phänomene zu erwarten sind, die eher unter den Begriffen „Code-Mixing“ (MUYSKEN 2000) und „Code-Shifting“ (AUER 1986) behandelt werden, also die gleich-zeitige Bewegung auf verschiedenen sprachlichen Ebenen in die eine oder andere Richtung.
3.2 Fragestellung: Phonische Variation in WRGR
Gegenstand dieser Arbeit ist die Variation von ‚weißrussischen‘ und ‚russi-schen‘ phonischen Merkmalen in WRGR. Die untersuchten Variablen sind regelmäßige, rein phonetisch-phonologisch beschreibbare Unterschiede zwischen beiden Sprachen unter Einbeziehung der weißrussischen Dialekte.40 Die ‚weißrussischen‘ Ausprägungen dieser Variablen gelten als charakteris-tisch für den weißrussischen Akzent im Russischen bzw. für die weißrussi-sche Varietät des Russischen (BULACHOV 1973; SADOŬSKI 1975, 1982; SADOŬSKI & ŠČUKIN 1977; SADOVSKIJ 1978; VYGONNAJA 1985; KILEVAJA 1986, 1989; MELʼNIKOVA 1999). Aufgrund ihrer Regelmäßigkeit werden sie als „nicht auffällig“ bzw. als nicht störend bei der Kommunikation bezeich-net: „[…] dlja asoby, jakaja dobra valodae belaruskaj i ruskaj movami, hėtyja fanetyčnyja adroznenni stanovjacca jak by neistotnymi. Ich prosta ne zaŭvažajuc’ – ni toj, chto havoryc’, ni toj, chto sluchae [für eine Person, die die weißrussische und die russische Sprache gut beherrscht, sind diese pho-netischen Unterschiede faktisch unbedeutend. Man nimmt sie einfach nicht wahr – weder der, der spricht, noch der, der hört]“ (ŠUBA 1982, 109; vgl. auch ŠMELEV 1986, 13). Diese „Unbemerktheit“ ist zu spezifizieren. Was die Verständlichkeit angeht, so ist Šuba sicherlich zuzustimmen, dass die phoni-sche Variation grundsätzlich einen allenfalls geringen Einfluss ausübt, zumal in der weitverbreiteten Zweisprachigkeit. Geht man also allein von dem Kriterium der Verständlichkeit aus, so war aus Sicht der Land-Stadt-Migran-ten die Übernahme von russischen phonischen Merkmalen weitgehend
40 Es handelt sich um dieselben Erscheinungen, von denen im Oldenburger Projekt zur
WRGR bei der Bestimmung der Affinität einer Wortform abstrahiert wird (vgl. HENTSCHEL 2008c).
45
unnötig, die Aneignung divergenter lexikalischer Elemente ausreichend.41 Aus soziolinguistischer Sicht ist dagegen andererseits sehr wohl wahrschein-lich, dass phonische Merkmale der einen oder anderen Sprache als Index für die soziale und regionale Herkunft wahrgenommen werden. Wie MEČKOVSKAJA (1994, 312) ausführt, unterscheiden sich in Belarus soziale Gruppen hinsichtlich der Anteile weißrussischer Merkmale in ihrer russi-schen Rede, genaue soziolinguistische Angaben lägen hierzu allerdings nicht vor. In Abhängigkeit von der sozialen Bewertung und der Salienz der Merk-male ist auch denkbar, dass sie funktional (mit einem höheren oder geringe-ren Grad an Bewusstheit) eingesetzt werden, mithin als Marker im Labovschen Sinne fungieren können, und dementsprechend auch der Ak-kommodation und stilistischer Variation unterliegen. LISKOVEC (2005, 131) berichtet zum Beispiel von Selbstkorrekturen in russischer Rede im lautli-chen Bereich, SADOŬSKI (1982) von quantitativen Unterschieden in verschie-denen Sprechstilen (mehr dazu in den jeweiligen Kapiteln zu den einzelnen Variablen). Weißrussische phonische Merkmale werden mitunter als grob und „maskulin“ eingestuft und eingesetzt (vgl. LISKOVEC 2005, 134–136; 146). Dass die weißrussischen Merkmale grundsätzlich stigmatisiert sind, ist damit nicht unbedingt gesagt. LISKOVEC (2005, 165f.) geht davon aus, dass ein weißrussischer Akzent im Russischen in der zweiten Hälfte des 20. Jh. die ideale Positionierung in der weißrussischen Gesellschaft darstellte. Wäh-rend die Verwendung des Russischen mit Bildung und Kultur assoziiert würde, signalisierte der gleichzeitige Akzent eine Herkunft „aus dem Volke“ und zudem keine Überlegenheit gegenüber, sondern eine Zusammenge-hörigkeit mit eventuell ebenfalls mit Akzent sprechenden Vorgesetzten. In der Gegenwart stelle ein weißrussischer Akzent im Russischen in Belarus die „unmarkierte“ Redeweise dar (LISKOVEC 2005, 107).
Die sich zunächst aufdrängende Frage – wie sie auf einer allgemeinen Ebene bereits HENTSCHEL & TESCH (2007, 19) stellen – ist, zu welchem Grad welche phonischen Elemente der WRGR ‚weißrussisch‘ oder ‚russisch‘ sind. Bei der Frage, was ‚weißrussisch‘ ist, was ‚russisch‘, ist Folgendes zu be-achten: Der Begriff „weißrussische Phonetik/Phonologie“ stellt eine gewisse Vereinfachung bzw. Verkürzung dar und ist nicht mit der Orthoepie der weißrussischen Standardsprache gleichzusetzen. Generell ist fraglich, inwie-
41 Natürlich kann vereinzelt die Aussprache durchaus die Verständlichkeit beeinflussen, vor
allem, wenn mehrere Merkmale gemeinsam auftreten, etwa wenn reka ‚Fluss‘ statt ‚rus-sisch‘ [rʲɪka] als ‚weißrussisch‘ [raka] artikuliert wird.
46
weit sich die normhafte weißrussische Aussprache auch bei Sprechern des weißrussischen Standards durchgesetzt hat bzw. wie sich deren Aussprache in der Realität darstellt. In der phonetisch-phonologischen Literatur zum Weißrussischen ist zwischen deskriptiven und präskriptiven Aussagen selten zu unterscheiden (vgl. RAMZA 2011). Dass die standardsprachlichen Normen sich bei weitem nicht bei allen Sprechern des Standardweißrussischen finden, sondern sich dort vor allem dialektale Merkmale, evtl. auch Merkmale des Russischen finden, ist belegt (FBLM 1989, 315f.; PADLUŽNY 1990; VBM 1990). Wie die phonetische Seite der mündlichen Varietät des Standardweiß-russischen in nicht-offiziellen, spontanen Situationen aussieht, ist kaum erforscht (SADOŬSKI 1983, 101). SADOŬSKI (1983), RAMZA (2011) und ZELLER (2013c) zeigen, dass sie teilweise stark von den orthoepischen Normen abweicht.42 Darüber hinaus ist für die hier untersuchten Informanten und die prototypischen WRGR-Sprecher generell fraglich, ob die phonische Norm der weißrussischen Standardsprache tatsächlich den sprachlichen Aus-gangspunkt darstellt. Wie in Abschnitt 2.2 dargelegt wurde, ist das weißrussi-sche Substrat in WRGR eher dialektal als standardsprachlich, das Standard-weißrussische ist ein Adstrat, das v.a. in der noch stark weißrussisch gepräg-ten Schulbildung der Migrantengeneration auftritt.
Erschwert wird die Interpretation der zu erwartenden Ergebnisse zudem dadurch, dass es sich bei der Verwendungsdomäne von WRGR um nicht-offizielle Kommunikationssituationen handelt, während Arbeiten zur weiß-russischen und zur russischen Phonetik vor allem auf Introspektion oder (seltener) auf experimentellen Daten beruhen. Die phonische Seite von ungezwungener, spontaner Rede ist generell – nicht nur für das Russische und Weißrussische – schlecht erforscht (RHODES 1996, 243). Generell nimmt die Variation in solchen Stilen zu (EROFEEVA 1997, 18), aufgrund von uni-versalen Lenitionsprozessen, wie sie etwa die Natürliche Phonologie be-schreibt (STAMPE 1979). Wie sich an unterschiedlichen Stellen zeigen wird, stellt dies die vorliegende Untersuchung vor das Problem, zwischen sprach-intern bedingter, „natürlicher“ Variation und sprachextern bedingter, kon-
42 Die ersten Formulierungen der weißrussischen Orthoepie stammen aus den 1950er und
1960er Jahren von M.V. Biryla und F.M. Jankoŭski (BIRYLA 1958; JANKOŬSKI 1976). Sie beziehen sich stark auf die Orthographie und weniger auf Beobachtungen der tatsächlichen Aussprache von Trägern des weißrussischen Standards. Die Normierung der Orthographie wiederum war natürlich auch mit einer Diskussion der tatsächlichen Aussprache verbunden, allerdings bestehen Zweifel, dass diese letztendlich das ausschlaggebende Kriterium bei der Etablierung der orthographischen Normen war. In der Standardisierung ist der Trend erkennbar, den Abstand zum Russischen möglichst groß zu halten (vgl. RAMZA 2011).
47
taktbedingter Variation zu unterscheiden. Ein Abweichen von den ortho-epischen Normen der weißrussischen Standardsprache oder den Beschrei-bungen der weißrussischen Dialekte in Richtung einer mit dem Russischen übereinstimmenden Aussprache kann nicht ohne weiteres eindeutig als russi-scher Einfluss gedeutet werden, wenn aufgrund allgemeiner Gesetzmäßig-keiten des sprachlichen Wandels die ‚russische‘ Variante als die „natürli-chere“ einzustufen ist. 43
Ähnliches gilt auch für den Begriff „russische Phonetik/Phonologie“. Auch für das Russische gibt es natürlich ganz abgesehen von den traditio-nellen Dialekten regionale und diastratische Unterschiede in der umgangs-sprachlichen Standardsprache (vgl. IZS 1987; EROFEEVA 1997; KRAUSE 2010), und auch phonische Beschreibungen des Russischen orientieren sich oft an offiziellen Situationen und an als autoritär eingestuften Sprechern, während die tatsächliche Realisierung selbst bei nicht-spontaner Rede und erst recht bei spontaner Rede erheblich davon abweichen kann und von gro-ßer Variation geprägt ist (BONDARKO 1981, 144–171; FSR 1988, 15–77; KUZNECOV 1991; 1997).
Es kann also nicht darum gehen, anhand der Messwerte kontextlos eine eher ‚russische‘ oder eher ‚weißrussische‘ Aussprache zu „diagnostizieren“. Vielmehr sind Aussagen, dass eine eher ‚russische‘ oder eher ‚weißrussische‘ Aussprache vorliegt, erst durch den Vergleich von Sprechergruppen plausibel zu machen. Erst wenn hier Unterschiede zutage treten, die aufgrund des unterschiedlich starken Einflusses des Russischen auf diese Gruppen plausi-bel sind, ist davon auszugehen, dass eine bestimmte Gruppe eine stärker ‚russische‘ oder ‚weißrussische‘ Aussprache aufweist.
Dies deutet bereits an, dass es weniger darum geht, was in der WRGR ‚weißrussisch‘ und was ‚russisch‘ ist, als darum, welche Faktoren die Varia-tion in Richtung der einen oder anderen Richtung beeinflussen. Diese mögli-chen Faktoren werden im Folgenden kurz angesprochen. Wie sie zu opera-tionalisieren sind, wird in Abschnitt 4.4 besprochen.
Generation: Bei dem Vergleich von unterschiedlichen Sprechergruppen kommt dem Vergleich zwischen den in Abschnitt 2.2 skizzierten Sprecher-
43 So findet KILEVAJA (1989, 7–9) in der russischen Umgangssprache in Vicebsk Beispiele
(in ihrer Notation) wie pjatʼ č’ьk (für pjatʼ čelovek ‚fünf Menschen‘), tak sъtʼ (für tak skazat’ ‚sozusagen‘), mil’cioner (milicioner ‚Polizist‘), komnta (komnata ‚Zimmer‘), prail’na (pravilʼno ‚richtig‘), radosʼ (radostʼ ‚Freude‘). Solche starken Lenitions-erscheinungen sind natürlich nicht auf ein weißrussisches Substrat zurückzuführen, sondern in russischer (Allegro-)Rede generell anzutreffen (vgl. FSR 1988, 15–77 und 240–245).
48
generationen die größte Bedeutung zu, da zwischen ihnen der Einfluss des Russischen, des dialektalen Weißrussisch und auch des weißrussischen Stan-dards in ihrer sprachlichen Sozialisation variiert und der Generationen-vergleich (im Sinne einer „apparent-time“-Studie) entscheidend ist für die Frage, ob eine Entwicklung in WRGR erfolgt. Diese Gruppen unterscheiden sich in erster Linie in ihrer sprachlichen Erstsozialisierung, die für die Migrantengeneration weitgehend weißrussisch-dialektal geprägt war (wie stark auch immer die weißrussischen Dialekte zu diesem Zeitpunkt bereits vom Russischen beeinflusst waren). Für die Generation der Kinder der Migranten ist dagegen von einer weitgehend monolektal weißrussisch-russisch gemischten sprachlichen Erstsozialisierung auszugehen, im schuli-schen und teilweise vorschulischen Bereich dagegen von einem weit stärke-ren Einfluss des Russischen und einem geringeren des Weißrussischen. Die Generation der Eltern der Migranten, die ihr Leben auf dem Land verbracht haben bzw. erst im höheren Alter zu ihren Kindern in die Städte zogen sind, dient dabei als Ausgangspunkt der Beschreibung der Entwicklung der phonischen Seite von WRGR in diesen Familien.44 Dass – und vor allem wie – sich unterschiedliche Generationen bzw. nach dem Kriterium der Binnen-migration unterschiedliche Sprecher in ihrem sprachlichen Verhalten unterscheiden, ist eine wesentliche Erkenntnis der bisherigen Arbeiten zur WRGR (HENTSCHEL & TESCH 2007; HENTSCHEL 2008c; HENTSCHEL 2013; HENTSCHEL & ZELLER 2012).
Geschlecht: Ferner wird in dieser Arbeit geprüft, ob sich Unterschiede zwi-schen dem Sprachverhalten von weiblichen und männlichen Sprechern fin-den. Dass sich die Geschlechter bei der Benutzung sozial markierter Variab-len quantitativ unterscheiden und die soziale und psychologische Seite des Geschlechts oft wichtiger ist als etwa die soziale Klasse, wird häufig fest-gestellt. Die gängige Beobachtung ist, dass Frauen in höherem Maße Stan-dardformen benutzen als Männer, bzw. dass Männer (auch jüngere, gut aus-gebildete) in höherem Maße lokale bzw. eine lokale Identität ausdrückende sprachliche Varianten benutzen (CHAMBERS & TRUDGILL 1998, 61–63; MILROY & MILROY 1998, 55; WATT & MILROY 1999, 37 und 41; GUY 2008, 389–390; LABOV 1972, 243; 2001, 367). Männer geben zudem zuweilen an, häufiger overt stigmatisierte Formen zu benutzen, als sie es tatsächlich tun,
44 Dass für diese Sprecher eine weitgehend vom Russischen unbeeinflusste Aussprache
vorliegt, ist zwar wahrscheinlich, jedoch nicht vorauszusetzen, da ja bereits für diese Spre-cher auf anderen sprachlichen Ebenen ein Einfluss des Russischen festzumachen ist.
49
was dafür spricht, dass diese Formen für sie ein gewisses Prestige aufweisen (TRUDGILL 1972). Für den Fall WRGR wird mitunter angenommen, dass Männer eher zur WRGR neigten als Frauen, insbesondere jüngere Männer eher als jüngere Frauen (vgl. LISKOVEC 2005, 105, die selbst allerdings keine Hinweise in diese Richtung findet). WRGR und „Weißrussisches“ wird zu-weilen bewusst eingesetzt, um als männlich und grob zu gelten (LISKOVEC 2005, 134–136 und 146).45 Für die weißrussische Sprachenlandschaft ist jedoch auch beobachtet worden, dass Männer stärker zu weniger lokalen Formen neigen. Dies wird mit der stärkeren Ortsgebundenheit und geringeren Mobilität von Frauen erklärt (VYHONNAJA 1982, 168).
Dialektaler Hintergrund: Drittens stellt sich die Frage, inwieweit regionale Unterschiede in WRGR auftreten. Für das weißrussische Dialektgebiet wird üblicherweise eine Dreiteilung in ein nordöstliches Gebiet, ein südwestliches Gebiet und ein zentrales Übergangsgebiet angenommen. Die weißrussischen Dialekte unterscheiden sich dabei relativ wenig voneinander und sind gegen-seitig problemlos verständlich (KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 10; FBLM 1989, 7). Die weißrussische Standardsprache beruht auf den Varietäten des zentralen Dialektgebiets, welche oft nicht als eigener Dialekt anerkannt wer-den, sondern als Übergangs- oder Mischgebiet zwischen den beiden anderen Gebieten bezeichnet werden (vgl. KURASZKIEWICZ 1963, 75; BLINAVA &
MJACELʼSKAJA 1969, 160–164; KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 136).46 Für die folgenden Untersuchungen ist diese Dreiteilung nicht pauschal zu über-nehmen. Der dialektale Hintergrund muss vielmehr je nach Variable unter-schiedlich einbezogen werden.
Variation auf anderen sprachlichen Ebenen: Wie in Abschnitt 3.1 dargelegt, ist ein Spezifikum von WRGR, dass Unterschiede auf strukturell tieferen Ebenen zwischen den Kontaktsprachen nicht zu vernachlässigen sind. Dem-entsprechend ist auf den Zusammenhang der tieferen sprachlichen Ebenen
45 Auch der ukrainische Suržyk stellt ein als männlich wahrgenommenes Sprachverhalten dar
(VOSS 2008, 360). 46 Außerdem wird in der belorussistischen Dialektologie eine Einteilung des weißrussischen
Gebietes in sogenannte Dialektzonen vorgenommen, welche quer zu diesen Dialektgebieten verläuft (KRYVYCKI 2003, 215–230). Diese Dialektzonen reflektieren politische Grenz-ziehungen in der Geschichte des Landes. Für die phonische Seite der Dialekte und damit für die vorliegende Untersuchung ist dies unerheblich. Abgesehen wurde in dem Oldenburger Projekt von dem Polessischen im äußersten Südwesten der Republik Belarus, das sich strukturell relativ stark von dem Standardweißrussischen und den übrigen weißrussischen Dialekten unterscheidet. Zudem weist dieses Gebiet auch sprachsoziologisch einige Eigen-heiten auf (vgl. BIEDER 1995a, 407–410).
50
mit der phonischen Ebene einzugehen. Wie von HENTSCHEL & ZELLER
(2012) gezeigt, bewegen sich zumindest einige Sprecher über längere Strecken in einem (auf tieferen sprachlichen Ebenen) ‚russischen‘ oder in einem ‚gemischten‘ Kode. Längere auf tieferen Ebenen rein ‚weißrussische‘ Diskursfragmente sind selten. Es ist zu prüfen, ob die Affinität der Äußerung und ggf. der Wortform auf tieferen Ebenen zum Weißrussischen und/oder Russischen mit der phonischen Seite der Rede korreliert.
Wortfrequenz: Aus Arbeiten zum sprachlichen Wandel ist bekannt, dass die Gebrauchshäufigkeit eines Lexems einen Einfluss darauf hat, wie schnell es einem Wandel unterliegt. Im phonischen Bereich unterliegen im Allgemeinen häufigere Lexeme früher bzw. häufiger einem Wandelprozess als seltenere (BYBEE 2002). Da es dabei in der Regel um Lenitionsprozesse geht, ist dies jedoch nicht direkt auf eine durch Sprachkontakt bedingte Wandelsituation zu übertragen. Es ist also nicht gesagt, dass häufigere Lexeme schneller den Wandel zum Russischen vollziehen als seltene. Sollte die weißrussische Variante die „natürlichere“ sein, so ist eher eine konservative Funktion der Worthäufigkeit zu erwarten.
Phonische Faktoren: Selbstverständlich spielen wie eingangs ausgeführt bei der phonetischen Realisierung einer Variable nicht nur soziale Faktoren eine Rolle, sondern auch universale phonische Tendenzen, d.h. verschiedene Lenitionsprozesse, Phänomene wie Assimilation und Akkommodation (im Sinne der Beeinflussung von Vokalen durch benachbarte Konsonanten). Diese können also die Annahme einer eher ‚russischen‘ Artikulation fördern oder behindern. Auch dies soll in dieser Arbeit gezeigt werden.
Es geht also zunächst darum, zu beschreiben, wie die phonische Seite der WRGR dort ausfällt, wo das Weißrussische und das Russische divergieren und welche sprachlichen und außersprachlichen Faktoren dabei eine Rolle spielen. In einem nächsten Schritt sind die Ergebnisse für die einzelnen Er-scheinungen dahingehend zusammenzuführen (und ggf. zu vertiefen), was sie über das Phänomen WRGR hinsichtlich seiner Stabilisiertheit und Eigenstän-digkeit aussagen. Für die Frage, inwieweit eine Stabilisierung von WRGR hin zu einem überindividuellen System anzunehmen ist, ist letztlich die Frage entscheidend, wie sich die Variation zwischen Sprechern und innerhalb von Sprechern über die Generationen hin entwickelt. Zudem ist zu fragen, ob es phonische Unterschiede gibt zwischen auf tieferen sprachlichen Ebenen ‚russischen‘, ‚weißrussischen‘ und ‚weißrussisch-russisch-gemischten‘ Äußerungen, welche es erlauben, von einer spezifischen Lautung der WRGR
51
zu sprechen. Eine solche phonische Unterschiedlichkeit ließe sich als ein Aspekt der Kohärenz und Konsistenz von WRGR und damit als weiteres Argument für deren Status als eigenem Dritten neben dem Weißrussischen und dem Russischen auffassen.
Dies sind die grundlegenden Fragestellungen bzw. Zielsetzungen dieser Ar-beit. Abschließend sei darüber hinaus die Frage gestellt, wie sich die Befunde in einen allgemeinen kontakt- und variationslinguistischen Kontext einordnen lassen und was die Ergebnisse zu dem Verständnis von Sprachkontakt, Sprachmischung und „exogenem“ Sprachwandel im Allgemeinen beitragen. Einige Aspekte seien hier angedeutet:
In dieser Arbeit werden phonische Variablen behandelt, die sich in einer Reihe von Aspekten unterscheiden. Sie sind aus phonetischer, teilweise auch aus phonologischer Sicht heterogen. Die ‚russischen‘ Ausprägun-gen sind aus Sicht des Weißrussischen artikulatorisch und perzeptiv als unterschiedlich schwierig einzustufen, die Beziehung zwischen den Ent-sprechungen in beiden Sprachen ist unterschiedlich transparent, es beste-hen teilweise spezifische Wertzuweisungen der lautlichen Merkmale. Es stellt sich die Frage, wie sich diese Aspekte auf die Stabilität der phoni-schen Seite im Sprachkontakt auswirken.
Ein weiterer allgemeiner Aspekt betrifft die Zusammenhänge zwischen sprachlichen Variablen. So ist zunächst für die phonische Variation zu fragen, ob bestimmte Sprecher grundsätzlich eher zu einer ‚weißrussi-schen‘ oder ‚russischen‘ Artikulation neigen, ob keine solchen Zusam-menhänge bestehen, oder ob Sprecher vor allem bei bestimmten Gruppen von phonischen Variablen stärker zu einer ‚weißrussischen‘ oder ‚russi-schen‘ Artikulation tendieren.
Es sind jedoch nicht nur die Zusammenhänge der phonischen Merkmale untereinander, die für eine allgemeine kontaktlinguistische Diskussion relevant sind. Wie schon dargelegt, ist das Spezifische an WRGR, dass einerseits die beteiligten Kontaktsprachen gegenseitig relativ verständ-lich und strukturell ähnlich sind, andererseits jedoch nicht zu vernachläs-sigende lexikalische, morphologische und morphosyntaktische Unter-schiede zwischen beiden Sprachen bestehen. Dies setzt das Phänomen in die Nähe von Phänomenen, die unter dem Stichwort des „Kode-Mischens“ behandelt werden. Dieses wenig untersuchte Zusammenspiel zwischen den sprachlichen Ebenen im Sprachkontakt gilt es heraus-
52
zustellen. Auf der Ebene der Äußerung stellt sich wie gesagt die Frage, ob die Sprecher lautlich zwischen den unterschiedlichen Kodes (russisch, weißrussisch und gemischt) unterscheiden. Auf der Ebene des Sprechers stellt sich die Frage, ob der Sprachwandel auf strukturell tieferen Ebenen parallel zum Sprachwandel auf der phonischen Ebene vonstattengeht.
Vor dem Hintergrund dessen, was in Abschnitt 3.1 zum Zusammenhang von Lexik und Phonologie in sogenannten Mischsprachen gesagt wurde, stellt sich zudem die Frage, ob bzw. inwieweit die phonische Variation in gemischter Rede lexikalisch bedingt ist, ob also Unterschiede zwi-schen Wortformen unterschiedlicher „Herkunft“ feststellbar sind.
Schließlich sei die Frage gestellt, ob bzw. inwieweit die phonische Variation in gemischter Rede funktional ist. In der vorliegenden Arbeit wird geprüft, ob die untersuchten Sprecher je nach Gesprächspartner bzw. je nach der Generation des Gesprächspartners in ihrer Aussprache variieren.
Abschließend sei betont, dass in dieser Arbeit eine globale Perspektive ein-genommen wird, die Phänomene der Mikrostruktur der Gespräche, ihre pragmatische, emotionale, thematische Gliederung vernachlässigen muss. Dass solche Untersuchungen auf der Diskursebene lohnenswert sind, d.h. Untersuchungen der punktuellen, lokalen Funktion von soziolinguistischen Variablen, im Sinne der „Dritten Welle soziolinguistischer Studien“ (ECKERT 2010, 2012), zeigen z.B. für Varietäten des Deutschen AUER (1986), für Varietäten des Englischen SCHILLING-ESTES (2004), für Varietäten des Rus-sischen SAPPOK (2010) und für WRGR ZAPRUDSKI & JANENKA (2011). In dieser Arbeit kann eine solche Untersuchung der Diskursstruktur nicht erfol-gen. Die vorliegende Arbeit stellt jedoch die Voraussetzung für solche Unter-suchungen dar, da zum ersten Mal die phonischen Gesamtverhältnisse der WRGR, vor deren Hintergrund die Interpretation punktueller Erscheinungen im Gespräch erfolgen muss, beschrieben werden. Für die Zukunft sind auf der Grundlage des Oldenburger Projektmaterials stärker diskursorientierte, syntagmatische Analysen geplant.
53
3.3 Die untersuchten Phänomene
Folgende Kriterien galten bei der Auswahl der untersuchten Variablen: Ers-tens muss es sich um regelmäßige, rein phonetisch-phonologisch beschreib-bare Unterschiede zwischen beiden Standardsprachen, ggf. zwischen den weißrussischen Dialekten und dem Russischen handeln.47 Zweitens muss es sich nicht nur historisch, sondern auch synchron um phonetisch-phonologi-sche Prozesse handeln, zumindest darf diese Möglichkeit nicht ausgeschlos-sen sein. In einigen Fällen ist davon auszugehen, dass es sich zwar historisch, aber nicht mehr synchron um phonetisch-phonologische Prozesse handelt, dass es sich bei den beobachteten Unterschieden also um Unterschiede in der phonologischen Repräsentation des Morphems, also um morphono-logische/lexikalische Unterschiede handelt. Dies trifft zum Beispiel auf das prothetische [v] des Weißrussischen zu (s.u.) sowie auf die Alternation von ru. [l] und wr. [u]. Drittens muss es sich aus rein praktischen Gründen um Merkmale handeln, die in ausreichender Menge auftreten. Zudem werden nur segmentale Unterschiede zwischen beiden Sprachen behandelt.
Die untersuchten Unterschiede zwischen beiden Sprachen werden im Fol-genden in aller Kürze erläutert, wobei den gängigen Beschreibungen der standardsprachlichen kodifzierten Norm bzw. der dialektalen Norm, wie sie in einschlägigen dialektologischen Arbeiten vorgestellt wird, gefolgt wird. Eine genauere Beschreibung inkl. der Behandlung von Ausnahmen und eventueller abweichender Einschätzungen der Verhältnisse erfolgt dann in den jeweiligen Unterkapiteln.
(Akanje1): Qualitativ „nicht-reduziertes“ Akanje im Weißrussischen vs. qualitativ „reduziertes“ Akanje im Russischen in unmittelbar vorbetonten Silben48 Nach nicht-palatalisierten Konsonanten fallen die Phoneme /o/ und /a/ im Weißrussischen in unmittelbar vorbetonter Position phonetisch in einem
47 Dies schließt zum Beispiel den Unterschied in adjektivischen (unbetonten) Endungen des
Nominativ Singular ru. {-ij} vs. wr. {-i} (phonetisch [ij] oder [ɨj] und [i] oder [ɨ]) aus, der z.B. bei SADOŬSKI (1982) behandelt wird: Im Weißrussischen ist auslautendes [j] möglich, und es ist nicht so, dass einem /ij/ im Russischen im Weißrussischen lautgesetzlich ein /i/ entspricht. Hier handelt es sich also um einen Unterschied in der morphonemischen Reprä-sentation.
48 Die weißrussische Bezeichnung des Phänomens ist „Akanne“, die russische „Akan’e“. In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der „Neutralität“ und der Einheitlichkeit die in der deutschsprachigen Slavistik verbreitete Schreibweise „Akanje“ benutzt. Dies gilt auch für analoge Bezeichnungen lautlicher Phänomene („Ikanje“, „Cekanje“ usw.).
54
„klaren“, d.h. dem Kardinalvokal entsprechenden [a] zusammen, während sie im Russischen als ein „reduzierter“, d.h. zentraler Laut [ɐ] realisiert werden:
Vokale nach nicht-palatalisierten Konsonanten, unmittelbar vorbetonte Silbe: Tab. 3(Akanje1)
wr. /o/ betont: vody /ˈvodi/ [ˈvɔdɨ] ‚Gewässer‘ Akanje1: vada /vaˈda/ [vaˈda] ‚Wasser‘ /a/ betont: upasci /uˈpasʦi/ [uˈpas"ʦ"i] ‚fallen; Inf.‘ Akanje1: upadu /upaˈdu/ [upaˈdu] ‚fallen; 1.Sgl.Fut.‘ ru. /o/ betont: vodu /ˈvodu/ [ˈvɔdu] ‚Wasser; Akk.Sgl.‘ Akanje1: voda /voˈda/ [vɐˈda] ‚Wasser; Nom.Sgl.‘ /a/ betont: upastʼ /uˈpastʲ/ [uˈpasʲtʲ] ‚fallen; Inf. ‘ Akanje1: upadu /upaˈdu/ [upɐˈdu] ‚fallen; 1.Sgl.Fut.‘
In den nordöstlichen Dialekten des Weißrussischen liegt ein dissimilatives Muster vor (dissimilatives Akanje), d.h. die Realisierung von unmittelbar vorbetontem /a/, /o/ erfolgt als [ɨ] oder [ə], wenn unter Betonung ein /a/ steht: /vodi/ [vaˈdɨ] ‚Wasser; Gen.Sgl.‘, aber /voda/ [vɨˈda]/[vəˈda] ‚Wasser; Nom. Sgl.‘.
(Akanje2): Qualitativ „nicht-reduziertes“ Akanje im Weißrussischen vs. qualitativ „reduziertes“ Akanje im Russischen in weiteren vorbetonten Silben Während für das Weißrussische mit Einschränkungen auch in weiteren un-betonten Silben eine Realisierung von /o/ und /a/ als „klares [a]“ angenom-men wird, ist die Realisierung im Russischen [ə], also noch stärker zentriert als in der unmittelbar vorbetonten Silbe. Die vorliegende Arbeit berücksich-tigt nur vorbetonte Silben.
Vokale nach nicht-palatalisierten Konsonanten, weitere vorbetonte Silben: (Akanje2) Tab. 4
wr. /o/ betont: hod /ɣod/ [ɣɔt] ‚Jahr; Nom.Sgl.‘ Akanje2: hadavy /ɣodovi/ [ɣadaˈvɨ] ‚jährlich; Jahres-‘ /a/ betont: maci /ˈmaʦi/ [ˈmaʦ"i] ‚Mutter; Nom.Sgl.‘ Akanje2: macjarėj /maʦʲeˈrej/ [maʦ"aˈrɛj] ‚Mutter; Gen.Pl.‘ ru. /o/ betont: god /god/ [gɔt] ‚Jahr; Nom.Sgl.‘ Akanje2: godovoj /godoˈvoj/ [gədɐˈvɔj] ‚jährlich; Jahres-‘ /a/ betont: matʼ /matʲ/ [matʲ] ‚Mutter; Nom.Sgl.‘ Akanje2: materej /matʲeˈrʲej/ [mətʲɪˈrʲej] ‚Mutter; Gen.Pl.‘
Auch hier bestehen dialektale Abweichungen im Weißrussischen. In den nordöstlichen Dialekten erfolgt die Realisierung als [ə] wie im Russischen, oder als [ɨ].
55
(Jakanje1): Weißrussisches Jakanje vs. russisches Ikanje in umittelbar vorbetonten Silben Nach palatalisierten Konsonanten werden im Standardweißrussischen und den zentralen weißrussischen Dialekten in der unmittelbar vorbetonten Silbe /e/, /a/ und /o/ als ein [a]-ähnlicher Laut realisiert (das sogenannte weißrussi-sche Jakanje). Im Russischen werden die Phoneme /e/, /a/ und /o/ sowie /i/ nach palatalisierten Konsonanten in einem reduzierten, [i]-ähnlichem Laut realisiert, (das sogenannte russische Ikanje).
Vokale nach palatalisierten Konsonanten, unmittelbar vorbetonte Silbe: (Jakanje1) Tab. 5
wr. /a/ betont: pjacʼ /pʲaʦʲ/ [pʲaʦ"] ‚fünf; Nom.‘ Jakanje1: pjaci /pʲaˈʦʲi/ [pʲaˈʦ"i] ‚fünf; Gen.‘ /e/ betont: zemli /ˈzʲemlʲi/ [ˈz"ɛmlʲi] ‚Erde; Nom.Pl.‘ Jakanje1: zjamlja /zʲemˈlʲa/ [z"amˈlʲa] ‚Erde; Nom.Sgl.‘ /o/ betont: vësny /ˈvʲosni/ [ˈvʲɔsnɨ] ‚Frühling; Nom.Pl.‘ Jakanje1: vjasna /vʲosˈna/ [vʲasˈna] ‚Frühling; Nom.Sgl.‘ ru. /a/ betont: pjatʼ /pʲatʲ/ [pʲatʲ] ‚fünf; Nom.‘ Jakanje1: pjati /pʲaˈtʲi/ [pʲɪˈtʲi] ‚fünf; Gen.‘ /e/ betont: zemli /ˈzʲemlʲi/ [ˈzʲɛmlʲɪ] ‚Erde; Nom.Pl.‘ Jakanje1: zemlja /zʲemˈlʲa/ [zʲɪmˈlʲa] ‚Erde; Nom.Sgl.‘ /o/ betont: vesny /ˈvʲosni/ [ˈvʲɔsnɨ] ‚Frühling; Nom.Pl.‘ Jakanje1: vesna /vʲosˈna/ [vʲɪsˈna] ‚Frühling; Nom.Sgl.‘
In den nordöstlichen weißrussischen Dialekten liegt sogenanntes dissimilati-ves Jakanje vor, d.h. unmittelbar vorbetontes /a/, /e/, /o/ wird als [ɪ] realisiert, wenn unter Betonung ein /a/ steht: /zʲemˈlʲi/ [zʲamˈlʲi] ‚Erde; Gen.Sgl.‘, aber /zʲemˈlʲa/ [zʲɪmˈlʲa] ‚Erde; Nom.Sgl.‘. Das russische Ikanʼe und dissimilatives Jakanje sind im Output hier also identisch. In südwestlichen weißrussischen Dialekten erfolgt die Realisierung unabhängig vom betonten Vokal als [e/ɛ].
(Jakanje2): Weißrussisches Jakanje/Ekanje vs. russisches Ikanje in weiteren vorbetonten Silben 49 In anderen unbetonten Silben erfolgt die Realisierung von /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten im Weißrussischen als [e]/[ɛ]-ähnlicher Laut. Für /a/ wird mitunter eine offenere Realisierung notiert. Im Russischen liegt da-gegen ein (reduzierter) [i]-ähnlicher Laut vor. Die vorliegende Arbeit berück-sichtigt nur vorbetonte Silben.
49 Die Bezeichnung Jakanje2 ist insofern nicht ganz zufriedenstellend, als für diese Positionen
auch im Weißrussischen in der Regel nicht [a]-artige Realisierungen angenommen werden, wie es das „ja“ in der Bezeichnung suggeriert.
56
Vokale nach palatalisierten Konsonanten, weitere vorbetonte Silben: (Jakanje2) Tab. 6
wr. /a/ betont: pjaty /ˈpʲati/ [ˈpʲatɨ] ‚fünfter‘ Jakanje2: pjacjarnja /pʲaʦʲerˈnʲa/ [pʲɛʦ"arˈnʲa] ‚Hand (ugs.)‘ /e/ betont: bedny /ˈbʲedni/ [ˈbʲɛtnɨ] ‚arm‘ Jakanje2: bednata /bʲednoˈta/ [bʲɛtnaˈta] ‚Armut‘ /o/ betont: lëd /lʲod/ [lʲɔt] ‚Eis ‘ Jakanje2: ledaxod /lʲodoˈxod/ [lʲɛdaˈxɔt] ‚Eisgang‘ ru. /a/ betont: pjatyj /ˈpʲatij/ [ˈpʲatɨj] ‚fünfter‘ Jakanje2: pjaternja /pʲatʲerˈnʲa/ [pʲɪtʲɪrˈnʲa] ‚Hand (ugs.)‘ /e/ betont: bednyj /ˈbʲednij/ [ˈbʲɛtnɨj] ‚arm‘ Jakanje2: bednota /bʲednoˈta/ [bʲɪtnɐˈta] ‚Armut‘ /o/ betont: led /lʲod/ [lʲɔt] ‚Eis ‘ Jakanje2: ledoxod /lʲodoˈxod/ [lʲɪdɐˈxɔt] ‚Eisgang‘
Dialektal gibt es im Weißrussischen auch hier Unterschiede. Im Nordosten erfolgt die Realisierung als [i] oder [ɪ], im Südwesten überwiegt [e] oder [ɛ], in den zentralen Gebieten [a].
(e /Š_): Unbetontes /e/ und /o/ nach nicht-palatalisierten, insbesondere „verhärteten“ Konsonanten Eine Sonderrolle nehmen die Phoneme /e/ und auf |e|50 zurückgehendes /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten ein. Im nativen Wortschatz sind dies ursprünglich palatalisierte Konsonanten, die historisch entpalatalisiert („ver-härtet“) wurden.51 Im Weißrussischen werden die Phoneme unbetont wiederum als [a] realisiert, im Russischen als [ɨ].
/e/ und /o/ aus |e| nach verhärteten Konsonanten: (e /Š_) Tab. 7
wr. /e/ betont: šėscʼ /ʂesʦʲ/ [ʂɛs"ʦ"] ‚sechs; Nom.‘ vorbetont: šasci /ʂesˈʦʲi/ [ʂas"ˈʦ"i] ‚sechs; Gen.‘ ru. /e/ betont: šestʼ /ʂestʲ/ [ʂɛsʲtʲ] ‚sechs; Nom.‘ vorbetont: šesti /ʂesˈtʲi/ [ʂɨsʲˈtʲi] ‚sechs; Gen.‘
(sʲ): Weißrussisches posterior-alveolares [s"] vs. russisches [sʲ] Der primäre Artikulationsort des palatalisierten vorderen stimmlosen Frika-tivs ist im Weißrussischen in Richtung des Palatums verlagert, d.h. im Ver-gleich zum Russischen leicht nach hinten versetzt, liegt also zwischen [sʲ] und [ɕ] (traditionell angezeigt in der Transkription durch den doppelten Apo-stroph): wr. sila [s"ila] vs. ru. sila [sʲila] ‚Kraft‘. Gleiches gilt für das stimm-
50 Wie in der Einleitung erwähnt, dienen senkrechte Striche zur Darstellung von nur diachron
definierbaren, also historischen Lautklassen. 51 In der slavistischen Tradition werden palatalisierte Konsonanten als „weich“, nicht-palatali-
sierte als „hart“ bezeichnet, die ehemals „weichen“, depalatalisierten dementsprechend als „verhärtet“.
57
hafte Äquivalent: wr. zima [z"ima] vs. ru. zima [zʲima] ‚Winter‘. In der vor-liegenden Arbeit wird aus praktischen Gründen – /z"/ ist relativ selten – je-doch nur die stimmlose Variable untersucht.
(tʲ) und (dʲ): Weißrussisches posterior-alveolares [ʦ"] und [ʣ"] vs. russisches [tʲ] und [dʲ] Bei diesen Variablen sind zwei Aspekte zu beachten: die Artikulationsart und der Artikulationsort. Im Weißrussischen sind die Fortsetzungen der histori-schen palatalisierten Plosive |tʲ| und |dʲ| deutlich affriziert. Der primäre Arti-kulationsort der Friktion dieser Affrikaten ist (wie bei den vorderen palatali-sierten Frikativen) im posterior-alveolaren Bereich, geht also in Richtung [ʨ] bzw. [ʥ]. Im Russischen erfolgt bei /tʲ/ und /dʲ/ sicherlich auch eine leichte palatale Friktion (wobei es eine theoretische Frage ist, ggf. mit arbiträrer Antwort, ob eine sekundäre Engebildung am Palatum mit frikativer Über-windung neben der Plosion als Affrizierung zu bewerten ist). Zumindest fakultativ ist auch eine leichte Friktion im alveolaren Bereich möglich, je-doch nicht – wie im Weißrussischen – am hinteren Bereich des Zahndamms: wr. dzeci [ʣ"eʦ"i] vs. ru. deti [dʲetʲi]/[dˢʲetˢʲi] ‚Kind; Nom.Pl.‘.
(ʧʲ) und (ʃʲ): Weißrussisches [t ʂ] und [ʂt ʂ] vs. russisches [ʧʲ] und [ʃʲː] Im Weißrussischen ist die postalveolare Affrikate nicht-palatalisiert, d.h. nicht mit einer simultanen Anhebung des Zungenrückens zum Palatum ver-bunden. Die russische Entsprechung ist dagegen palatalisiert: wr. časta [ʧasta]/[t ʂasta] vs. ru. často [ʧʲastə]/[ʨastə] ‚oft‘. Das Russische verfügt zu-dem über einen palatalisierten postalvelaren, phonetisch langen Frikativ /ʃʲ/, dem im Weißrussischen die Sequenz /ʃʧ/ entspricht: wr. ščotka [ʃʧɔtka]/[ʂt ʂɔtka] vs. ru. ščetka [ʃʲːɔtkə]/[ɕːɔtkə]. Die Realisierung solcher Fälle mit der Sequenz [ʃʲʧʲ] oder [ɕʨ], auf die [ʃʲː] historisch zurückgeht, ist im Russischen möglich, aber als veraltet anzusehen, so dass in der Regel von einem zugrunde liegenden Phonem /ʃʲ/ ausgegangen wird. (Für einen Über-blick der phonologischen Interpretationen vergleiche KASATKIN 2001).
(rʲ): Weißrussisches [r] vs. russisches [rʲ] Im Weißrussischen wurde das historische Phonem |rʲ| entpalatalisiert und fiel dadurch mit |r| zusammen. Im Russischen ist eine solche Entpalatalisierung nicht erfolgt, so dass wr. /r/ im Russischen sowohl /rʲ/ als auch /r/ entsprechen kann: vgl. rad /rad/ [rat] vs. ru. rjad /rʲad/ [rʲat] ‚Reihe‘ und wr. rady /radi/ [radɨ] vs. ru. rad /rad/ [rat] ‚froh‘.
58
(g): Weißrussisches [ɣ] vs. russisches [g] Das Weißrussische weist als etymologische Entsprechung zum velaren stimmhaften Plosiv /g/ des Russischen einen Frikativ /ɣ/ auf: wr. naha [naɣa] vs. ru. noga [nɐga] ‚Bein‘.
(v): Weißrussisches [u/u] vs. russisches [v/f] [v] und [vʲ] sind als Realisierungen von /v/ und /vʲ/ vor Konsonanten sowie im Auslaut im Weißrussischen ausgeschlossen. Daher alterniert im Weißrus-sischen [v] vor Vokal mit [u] und [u]. Russisch [v/f] als Realisierung von /v/ entspricht daher regelmäßig [u/u] im Weißrussischen: wr. laŭka [lauka] vs. ru. lavka [lafkə] ‚Bank‘, aber wr. lavačka [lavat ʂka] vs. ru. lavočka [lavəʧʲkə] ‚Bänkchen‘.
Insgesamt werden damit 13 phonische Unterschiede bzw. 13 Variablen in dieser Arbeit untersucht. Diese werden, der variationistischen Tradition folgend, in einfachen runden Klammern wiedergegeben. Tabelle 8 liefert eine Übersicht, die in den jeweiligen Kapiteln noch spezifiziert wird.
Übersicht über die Variablen und ihre „Hauptausprägungen“ im Weißrussischen und Tab. 8Russischen
Variable Wr. Ru.
(Akanje1) [a] [ɐ]
(Akanje2) [a] [ə]
(Jakanje1) [a] [ɪ]
(Jakanje2) [e] [ɪ]
(e /Š_) [a] [ɨ]
(sʲ) [s"] [sʲ]
(tʲ) [ʦ"] [tʲ]
(dʲ) [ʣ"] [dʲ]
(ʧʲ) [t ʂ] [ʧʲ]
(ʃʲ) [ʂt ʂ] [ʃʲː]
(rʲ) [r] [rʲ]
(v) [u] [v]
(g) [ɣ] [g]
Folgende Unterschiede, die außerdem oft als phonische Unterschiede zwi-schen beiden Sprachen und/oder als Erscheinungen des weißrussischen Ak-zents im Russischen genannt werden, werden in dieser Arbeit nicht analysiert (vgl. zum Folgenden JANKOŬSKI 1974; KRYVICKI & PADLUŽNY 1984; BIRYLA & ŠUBA 1985; FBLM 1989; BM 2004).
59
Der Laut [u] im Weißrussischen entspricht in einigen Fällen im Russi-schen [l]. Dies betrifft einige Lexeme wie wr. voŭk [vɔuk] vs. ru. volk [vɔlk] ‚Wolf‘ oder wr. poŭny [pɔunɨ] vs. ru. polnyj [pɔlnɨj] ‚voll‘ sowie den Auslaut der maskulinen Präteritalformen (wr. byŭ [bɨu] vs. ru. byl [bɨl] ‚sein; Mask.Sgl.Prät.‘). Dies ist eine rein morphonemisch (im Sinne von HENTSCHEL 2008c) zu bewertende Erscheinung, da [l] im Auslaut und vor Konsonant im Weißrussischen möglich ist: wr. stol [stɔl] ‚Tisch‘, iholka [iɣɔlka] ‚Nadel ‘ (vgl. Kapitel 10).
Eine Morphonologisierung ist auch für die prothetischen Laute im Weiß-russischen anzunehmen. Stärker als das Russische weist das Weißrussische eine Reihe von Prothetisierungen auf. Die regelmäßigste Erscheinung unter ihnen ist das prothetische [v]. Im Weißrussischen steht dieses prothetische [v] nach Vokal oder im Anlaut vor /u/ (vucha ‚Ohr‘, vučycca /ˈvuʧiʦa/ ‚lernen; 3.Sgl.Präs.‘ und vučycca /vuˈʧiʦa/ ‚lernen; Inf.‘) und betontem /o/ (vozera ‚See; Nom.Sgl.‘, vokny ‚Fenster; Nom.Pl.‘ vs. unbetont: azëry ‚See; Nom.Pl.‘, akno ‚Fenster, Nom.Sgl.‘) (vgl. KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 117–119; FBLM 1989, 329; KHBM 2007, 16–19). Im Russischen, das auch Fälle von (ostslavischer) v-Prothese aufweist (vgl. ru. vosem’ vs. pl. osiem ‚Acht‘), ist dies nicht durchgehend der Fall: ru. ucho, učitʼsja, ozero, okna. Prothetisches [v] ist im Weißrussischen sicherlich nicht als Merkmal der zweiten Artikulation anzunehmen, sondern als Teil der jeweiligen morpho-nemischen Repräsentation. Hierfür spricht, dass die Prothese vor /o/ in eini-gen Fällen auf unbetonte Kontexte erweitert wird, in denen sie lautgesetzlich nicht zu erwarten wäre (vgl. vačėj /voˈʧej/, Gen.Pl. zu voka ‚Auge‘, oder die Alternativform vakno zu akno ‚Fenster‘) und dass in Lehnwörtern auch /u/ und betontes /o/ (universitėt, opera) möglich sind, ohne dass eine Tendenz zur Prothetisierung erkennbar wäre. [u] im Anlaut ist außerdem als Allophon von /v/ möglich. Nicht zuletzt ist das „Sprechergefühl“ weißrussischer Linguisten ausschlaggebend, die dieses Phänomen eher selten in phonetisch-phonologischen Arbeiten behandeln. Bezeichnend ist außerdem, dass es in den eingangs zitierten Arbeiten zum weißrussischen Akzent im Russischen nicht erwähnt wird. Dieser starken Lexikalisierung des weißrussischen pro-thetischen [v] entspricht, dass es im OK-WRGR (2014) viel seltener auftritt als die ‚weißrussische‘ Variante bei den anderen, deutlicher phonischen Variablen (vgl. HENTSCHEL 2013a; HENTSCHEL & ZELLER 2014).52
52 Andere prothetische Laute wie die prothetischen Vokale [i] und [a] in imhla ‚Nebel‘ (vgl.
ru. mgla) und aŭtorak ‚Dienstag‘ (vgl. ru. vtornik) oder prothetisches [j] vor betontem /i/
60
Regelmäßige phonische Unterschiede, die jedoch aus praktischen Gründen nicht analysiert werden, sind dagegen die folgenden.
Neben [v/f] und [l] ist eine dritte Entsprechung des weißrussischen Lautes [u] im Russischen anlautendes [u]. Endet die vorherige Wortform auf einen Vokal, und steht /u/ nicht zu Beginn einer Intonationsphrase, so ist anlauten-des /u/ im Weißrussischen nicht-silbisch, bildet also mit dem Auslaut der vorherigen Wortform eine Silbe. Nach Konsonant und zu Beginn einer Intonationsphrase ist es silbisch. Im Russischen ist es dagegen stets silbisch, unabhängig vom vorangehenden Kontext. Hierbei handelt es sich also um ein Phänomen der Silbengrenze, mithin um eine suprasegmentale Erscheinung. Von solchen Phänomenen wird abgesehen. Die Bestimmung der Silben-grenze ist schwierig. In dem vorliegenden Datenmaterial, und wahrscheinlich stets in spontaner Rede, sind die Grenzen zwischen zwei aufeinanderfolgen-den Vokalen im Oszillogramm generell kaum zu bestimmen, Kontraktionen sind häufig. Zudem ist nicht klar, wie eine Quantifizierung erfolgen könnte. Verwiesen sei auf die Analyse der Klassifikationen in den Transkriptionen des OK-WRGR in HENTSCHEL & ZELLER (2014).
Weitere Eigenschaften des Weißrussischen, etwa die Phoneme /ʣ/ und /ʤ/, oder die aus der historischen Verbindung ‚Konsonant vor |ьj|‘ entstande-nen langen Konsonanten sind recht selten, und werden deshalb nicht unter-sucht. Auch auf die stärkere, d.h. auf mehr Kontexte angewandte, regelmäßi-gere und hinsichtlich der Intensität stärkere Palatalisierungsassimilation im Weißrussischen (vgl. PADLUŽNY 1969, 48; ANTIPOVA 1977, 123; FBLM
1989, 324f.; VYHONNAJA 1991, 211–212) kann aufgrund der relativen Sel-tenheit des Merkmals nicht eingegangen werden. Es wird angenommen, dass die Palatalität von Konsonanten im Weißrussischen bei Assimilation vor palatalisierten Konsonanten dieselbe ist, wie vor Vokalen, also bei nicht assimilativ bedingter Palatalität. Das Russische befindet sich diesbezüglich gegenwärtig im Wandel, die Palatalitätsassimilation geht zurück (vgl. ZUBRITSKAYA 1997).
am Wortanfang, prothetisches /ɣ/ in hėty ‚dieser‘ oder im Eigennamen Hanna sind eben-falls lexikalisiert und teilweise zu selten, um hier analysiert zu werden. Das [j] in den Nominativformen der Personalpronomen der dritten Person jon, jana, jano, jany ist keine phonologisch bedingte Prothese, sondern auf analogischen Ausgleich mit den suppletiven obliquen Kasus zurückzuführen.
61
3.4 Forschungsstand zur phonischen Variation im Kontakt des Weißrussischen und des Russischen
Studien, die sich ganz oder zumindest in Teilen explizit der phonischen Seite der WRGR widmen, sind erst in jüngster Vergangenheit entstanden (HENTSCHEL 2008c, 2012, 2013a/b; ZAPRUDSKI & JANENKA 2011; ZELLER & TESCH 2011; HENTSCHEL & ZELLER 2011, 2014; ZELLER 2013a/b). Auf diese Arbeiten wird weiter unten eingegangen. Wertvolle Hinweise auf den phoni-schen Substrateinfluss des Weißrussischen bieten jedoch einige Arbeiten zu vergleichbaren Erscheinungen, worunter an erster Stelle der weißrussische Akzent im Russischen bzw. die weißrussische Variante des Russischen zu nennen ist. Ein Überblick über soziolinguistische Studien zum Kontakt des Weißrussischen mit dem Russischen findet sich bei WOOLHISER (1995).
Phonisch weißrussische Züge (inklusive dialektal-weißrussischer) zeigen sich in der russischen Rede von Weißrussen in unterschiedlichem Maße in allen Schichten und allen Regionen (BULACHOV 1973, 103), und auch bei Sprechern, deren Erstsprache nicht Weißrussisch, sondern Russisch ist. Es handelt sich also um eine für das Gebiet von Belarus als typisch angesehene Variante der russischen Standardsprache, weshalb MICHNEVIČ (1985a) für diese Erscheinung den Terminus ‚Natiolekt‘ vorschlägt (vgl. dazu auch KURCOVA 2001, 2002). Die Merkmalstypen dieser weißrussischen Variante des Russischen sind identisch mit denen, die auch in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Die phonische Seite der weißrussischen Variante des Russischen wurde nach Angaben von VYHONNAJA (1982, 172) zuerst syste-matisch und empirisch fundiert von P.V. Sadoŭski untersucht (SADOŬSKI
1975, 1982; SADOŬSKI & ŠČUKIN 1977; SADOVSKIJ 1978). Weitere Angaben finden sich mit unterschiedlicher empirischer Stützung bei BUCHALOV (1973), VYHONNAJA (1985), ŠMELEV (1986), IZS (1987), MELʼNIKOVA (1999) und KILEVAJA (1986, 1989). Instrumental gestützte Untersuchungen existieren jedoch nicht.
Vor allem die Untersuchungen von Sadoŭski sind für die vorliegende Ar-beit zu beachten. Die Biographie der von Sadoŭski untersuchten Sprecher erinnert stark an die Beschreibung der ersten Generation von Sprechern von WRGR: Es handelt sich um Land-Stadt-Migranten, Männer im Alter zwi-schen 25 und 40 Jahren, die ihre Kindheit und Jugend in ländlicher Umge-bung verbracht hatten und zum Zeitpunkt der Untersuchung, d.h. Ende der 1970er Jahre, bereits nicht weniger als 10 Jahre in Minsk lebten. Diese wur-den verglichen mit Aufnahmen von älteren (50–75 Jahre) in ländlicher Umgebung lebenden Sprechern aus den Ursprungsdialekten der Migranten
62
(die Hälfte der Sprecher stammt aus dem Kreis Minsk, die andere aus dem Kreis Njasviž) sowie mit in Minsk geborenen und lebenden Männern glei-chen Alters (23–40 Jahre). Die Sprecher wurden beim Lesen eines Textes und in spontanen Gesprächen aufgenommen.
Das gängige Abgrenzungskriterium des weißrussischen Akzents bzw. der weißrussischen Variante des Russischen gegenüber der WRGR ist das Fehlen von weißrussischen Merkmalen auf tieferen Sprachebenen. In der Rede der von Sadoŭski untersuchten Migranten scheinen jedoch eben solche Einflüsse des Weißrussischen auf tieferen Ebenen vorzuliegen. So schreibt SADOŬSKI (1982, 180), dass für Weißrussen der Erwerb des Russischen ungesteuert erfolge und vom Weißrussischen ausginge, so dass zunächst alle Bereiche weißrussisch geprägt seien, die Interferenzen in Lexik und Morphologie, später Syntax aber mit der Zeit verschwänden, während phonische Einflüsse blieben.53 Sadoŭskis Informanten sind also wohl faktisch die gleichen Spre-chertypen wie die hier untersuchten, mit dem Unterschied, dass seine Infor-manten von einem externen Exploratoren explizit zum Russischen untersucht wurden, also, so gut sie es vermochten, Russisch sprachen, was für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Informanten nicht der Fall ist.
Als allgemeines Ergebnis findet Sadoŭski sowohl in der Rede der gebür-tigen Minsker als auch in der Rede der Migranten phonisch ‚weißrussische‘ Züge (Jakanje, nicht-reduziertes Akanje, dissimilatives Akanje und Jakanje, affrizierte Realisierungen für russisches /tʲ/ und /dʲ/, posterior-alveolare vor-dere Sibilanten, frikatives [ɦ] oder [γ] für russisches /g/, nicht-palatalisiertes [r] und [ʧ] für russisches /rʲ/ und /ʧʲ/, (halb-)vokalische Realisierungen von russisch /v/). Bei den Migranten sind diese Züge jedoch ausgeprägter. Zudem treten in der Rede der Migranten neue, spezifische Züge auf, die in keiner der beiden Kontaktsprachen zu finden sind (wie die Realisierung von Vokalen in Jakanje-Positionen als [e]/[ɛ], die sporadische Realisierung von unbetontem /o/ als [ɔ], „halb-palatalisierte“ Varianten für /rʲ/ und /ʧʲ/, eine palatalisierte Realisierung von /ʂ/ und /ʐ/). Sadoŭski kommt zu dem Schluss, dass sich bei den Migranten ein neues, gemischtes phonetisch-phonologisches System zu bilden beginnt (SADOVSKIJ 1978, 15). Zudem findet er Unterschiede in der Schnelligkeit des Übergangs zum Russischen zwischen den Variablen. Einige
53 Dies alles deutet an, dass es sich bei der Unterscheidung zwischen einem weißrussischen
Akzent und WRGR in der ersten Sprechergeneration um ein Kontinuum handelt. Auch LISKOVEC (2005, 84) bemerkt, dass es eher eine Frage der Quantität weißrussischer Merk-male ist, ob eine Redeinstanz als „Trasjanka“ oder als „russische Rede mit Akzent“ einge-stuft werde.
63
der untersuchten Variablen unterliegen außerdem stilbedingter Variation, verhalten sich also in spontaner Rede anders als beim Lesen eines Textes.
Relevant ist auch die Arbeit von WOOLHISER (2005), die auf einer Feld-studie (zwischen 1996 und 2000) im polnisch-weißrussischen Grenzraum (um Białystok auf polnischer Seite, um Hrodna auf weißrussischer Seite) beruht. Dieses vor 1945 recht homogene Dialektgebiet war nach 1945 von einer politischen Grenze geteilt, was zur Divergenz zwischen den Dialekten und zur Konvergenz mit den nun unterschiedlichen Dachsprachen führte. Das allgemeine Bild, das Woolhiser findet, ist ein beträchtliches Maß an phoni-scher Innovation in Richtung des Russischen auf weißrussischer Seite und größere Konservativität auf polnischer Seite.
Die umgekehrte Erscheinung, also ein russischer Akzent im Weißrussi-schen, ist dagegen kaum untersucht, obwohl er sicherlich bei einer Vielzahl von Menschen anzutreffen ist. Wie HENTSCHEL & ZELLER (2014) darlegen, war es in Belarus aus sozialen Gründen nicht notwendig (oder erstrebens-wert), ein möglichst „reines“ Weißrussisch zu sprechen. Einige Beobachtun-gen machen VYHONNAJA (1991) und DZERHAČOVA (2001) zum russisch interferierten Weißrussischen im weißrussischen Radio.
Was die phonische Seite der WRGR angeht, so ist die gängige Meinung, dass sie im Allgemeinen „weißrussisch“ ist (SJAMEŠKA 1998, 40; MEČKOVSKAJA 2007, 94). Einige Äußerungen sind vorsichtiger. So nimmt CYCHUN (2013 [1998], 23f.) lediglich an, dass das Weißrussische sich im phonischen Bereich am stärksten halte, und auch LISKOVEC (2005, 84f.) sagt lediglich, dass weißrussische Merkmale überwiegen. Empirisch, wenn auch nicht immer quantitativ, untersuchen dies HENTSCHEL (2008c, 2012, 2013a/b), ZAPRUDSKI & JANENKA (2011), ZELLER & TESCH (2011), HENTSCHEL & ZELLER (2011, 2014) sowie ZELLER (2013a/b). Diese ersten empirischen Arbeiten belegen, dass in Instanzen von WRGR auch im enge-ren Sinne, also in Äußerungen, in denen auf strukturell tieferen Ebenen so-wohl ‚russische‘ als auch ‚weißrussische‘ Elemente vorliegen, durchaus phonisch ‚russische‘ Elemente auftreten. Die detaillierteste und umfassendste Studie ist dabei HENTSCHEL & ZELLER (2014). Ausgehend von den Tran-skriptionen im OK-WRGR zeigen sie, dass es beträchtliche Unterschiede zwischen den Variablen gibt. Während einige Variablen sehr stark ‚weißrus-sisch‘ bleiben, ist für andere ein deutlicher Einfluss des Russischen erkenn-bar. Dabei unterscheidet sich der Einfluss des Russischen zwischen solchen Sprechertypen, die auch auf strukturell tieferen Ebenen eher zum Russischen neigen, und solchen, für die das weißrussische Element noch stark vertreten
64
ist. Die Reihenfolge der Variablen nach der Höhe des Anteils ‚russischer‘ bzw. ‚weißrussischer‘ Realisierungen ist dabei allerdings konstant, unab-hängig davon, ob die Sprecher auf strukturell tieferen Ebenen stärker oder weniger stark zum Russischen tendieren, und findet sich nicht nur in den spontanen Gesprächen des Familienkorpus, sondern auch in sprachsozio-logischen Interviews wieder.
Verteilung im weiteren Sinne phonischer Variablen auf der Basis der Transkriptionen Abb. 1
im Oldenburger Familienkorpus zur WRGR (nach HENTSCHEL & ZELLER 2014)
Den geringsten Einfluss des Russischen weisen dabei die ‚weißrussischen‘ Affrikaten [ʦʲ] und [ʣʲ] und der stimmhafte Velar auf, der fast ausschließlich frikativ ausfällt. Am stärksten zur ‚russischen‘ Variante tendieren Variablen, die bereits als morphonologisiert gelten oder gelten können, d.h. das protheti-sche [v] sowie der Kontrast von ‚russischem‘ [l] und ‚weißrussischem‘ [u].54 Bei den dazwischen liegenden Variablen überwiegt die ‚weißrussische‘ Vari-ante (palatalisiertes [ʧʲ], [ʃʲː] vs. nicht-palatalisiertes [ʧ], [ʃʧ] (oder [t ʂ], [ʂt ʂ]), palatalisiertes [rʲ] vs. nicht-palatalisiertes [r] sowie ‚russisches‘ [v] vs. ‚weiß-russisches‘ [u/u]) oder ist das Verhältnis in etwa ausgeglichen (‚weißrussi-sches‘ Jakanje vs. ‚russisches‘ Ikanje, wenn man [e]-Realisierungen als eher ‚russisch‘ bewertet, sowie ‚russisches‘ [u] vs. ‚weißrussisches‘ [u]).
54 Zumindest in Lexemen wie voŭk, poŭny usw. Im Auslaut der maskulinen Präteritalformen
überwiegt ‚weißrussisches‘ [u].
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
wr. prothetisches [v]
wr. [u] vs. ru. [l]
wr. [u] vs. ru. [u]
wr. Jakanje vs. Ekanje vs. ru. Ikanje
wr. [u]/[u] vs. ru. [v]
wr. [r] vs. ru. [rʲ]
wr. [ʧ], [ʃʧ] vs. ru. [ʧʲ], [ʃʲː]
wr. [ɣ] vs. ru. [g]
wr. [ʦʲ], [ʣʲ] vs. ru. [tʲ], [dʲ]
wr. intermediär ru.
65
Einen ersten Versuch, den Zusammenhang der Affinität einer Wortform auf tieferen strukturellen Ebenen zum Russischen und/oder Weißrussischen mit der Aussprache zu untersuchen, unternehmen ZELLER & TESCH (2011) anhand der Transkriptionen des ersten Teilkorpus (der Stadt Baranavičy). Ausgehend von der Klassifikation der Wortformen in diesem Korpus als ‚rus-sisch‘, ‚weißrussisch‘, ‚gemeinsam‘ oder ‚hybrid‘ zeigen sie, dass bei einem allgemeinen großen Übergewicht einer ‚weißrussischen‘ Aussprache ‚russi-sche‘ Wortformen wahrscheinlicher mit einer ‚russischen‘ Aussprache einhergehen als ‚weißrussische‘. ‚Weißrussische‘ Wortformen sind dagegen fast ausschließlich auch phonisch ‚weißrussisch‘. Der Zusammenhang zwi-schen der Affinität auf tieferen Ebenen und der phonischen Seite wird in der jüngeren Generation stärker. Einen solchen Zusammenhang zwischen den sprachlichen Ebenen stellen auch HENTSCHEL & ZELLER (2014) für das Gesamtkorpus fest (wobei sie sich vor allem auf ‚hybride‘ Äußerungen be-ziehen): Für ‚russische‘ Wortformen gehen die Werte der phonischen Merk-male stärker in Richtung der ‚russischen‘ Ausprägung als für ‚weißrussische‘ Wortformen. ‚Gemeinsame‘ Wortformen liegen dazwischen.
Erste instrumentalphonetische Arbeiten sind HENTSCHEL & ZELLER (2011) und ZELLER (2013a/b). HENTSCHEL & ZELLER (2011) zeigen exemp-larisch, dass sowohl zwischen Sprechern als auch innerhalb eines Sprechers die Realisierung von Vokalen in Jakanje-Positionen stark, d.h. zwischen ‚weißrussischem‘ [a], ‚intermediärem‘ [e] und [ɛ] und ‚russischem‘ [ɪ] variie-ren kann, und deuten an, dass die Generation hier eine Rolle spielt. ZELLER (2013b) zeigt einen solchen Einfluss auch für die Variablen (sʲ) und (tʲ). ZELLER (2013a) schließlich bietet eine knappe Übersicht über die spre-cherbezogenen Messwerte der vorliegenden Untersuchung, ohne dass auf Variation unterhalb der Sprecherebene eingegangen wird.
67
4 Methodisches
4.1 Akustische Phonetik als Methode der Variationslinguistik
Es bestehen zwei Möglichkeiten der Analyse von Variation im phonischen Bereich: die ohrenphonetische und die instrumentalgestützte, d.h. anhand von Messungen akustischer Charakteristika der zu untersuchenden Laute. In der vorliegenden Untersuchung wird nur bei Variablen, für die die relevanten Unterschiede ohrenphonetisch gut feststellbar sind, auf die ohrenphonetischen Qualifizierungen zugegriffen, die in den Transkriptionen des OK-WRGR zugrunde liegen. Diese Transkriptionen wurden von weißrussischen Studenten der Belorussistik der Weißrussischen Staatsuniversität Minsk unter Leitung des Minsker Partners S. Zaprudski sowie im Falle eines der Erhebungsorte von einer Mitarbeiterin der Oldenburger Slavistik erstellt. Die Mehrzahl der in Frage kommenden Variablen wird in dieser Arbeit dagegen instrumental untersucht, d.h. mithilfe von Messungen ihrer akustischen Charakteristika.
Die Initialzündung der Anwendung akustischer Messungen für die Unter-suchung sprachlicher Variation war die Studie von LABOV, YAEGER & STEINER (1972), seither sind Messungen akustischer Parameter in einer Viel-zahl von Studien zum Einsatz gekommen (vgl. für einen Überblick MILROY & GORDON 2003, 145–152 und THOMAS 2007). Akustische Messungen ha-ben gegenüber auditiven Urteilen zwei große Vorteile: Erstens sind sie ge-nauer, indem sie graduelle Unterschiede erfassen, wo auditive Untersuchun-gen das phonetische Kontinuum notwendigerweise in diskrete Stufen auf-teilen müssen. Zweitens gewähren akustische Messungen ein höheres Maß an Objektivität, da bei ohrenphonetischen Klassifizierungen stets die Gefahr der Beeinflussung durch die (phonologischen) Erwartungen des Transkribieren-den besteht (vgl. LABOV 1991, 3), gegebenenfalls auch durch die Graphemik/ Orthographie. Andererseits haben akustische Messungen eigene Nachteile und eigene Schwierigkeiten (vgl. MILROY & GORDON 2003, 148–152). Der praktische Nachteil ist sicherlich der sehr viel größere Aufwand, der vor allem in der Segmentierung des akustischen Signals besteht (siehe 4.2.5), so dass in der Regel weniger Token untersucht werden, als in ohrenphonetisch
68
transkribierenden Studien. Ein entscheidenderes Problem ist, dass, während auditive Untersuchungen den „Gesamteindruck“ eines Lautes zu erfassen suchen, für die Auswertung in akustischen Studien die spektrale Gesamt-information auf einen oder einige wenige Werte heruntergebrochen wird. Eine hiermit verbundene methodologische Schwierigkeit ist, akustische Daten für den Vergleich unterschiedlicher Sprecher zu nutzen. Da zwei Spre-cher niemals identische Vokaltrakte haben, können absolute Messwerte nicht direkt miteinander verglichen werden, sondern müssen normalisiert werden (vgl. LABOV 1994, 56). Für bei der Untersuchung von Vokalen einschlägige Messwerte sind unterschiedliche Techniken entwickelt worden (vgl. THOMAS 2007, 174–175), für Messwerte, die für konsonantische Bereiche einschlägig sind, gibt es kaum solche Techniken.
Generell konzentrieren sich die meisten instrumental arbeitenden variatio-nistischen Studien auf Vokale. Für die Variation von Konsonanten gibt es weniger Untersuchungen, da sie oft auf nicht-graduellen Unterschieden be-ruht und die Varianten auditiv gut unterscheidbar sind, so dass eine instru-mentale Analyse ein „analytical overkill“ (DOCHERTY & FOULKES 1999, 53) wäre. Dass andererseits bei Sprachkontakt bzw. Sprachwandel auch im kon-sonantischen Bereich subtile, mit sozialen Faktoren korrelierende Variation bestehen kann, die ohrenphonetisch nicht auszumachen wäre, zeigen z.B. DOCHERTY & FOULKES (1999; vgl. auch MILROY & GORDON 2003, 150).
Im Rahmen dieser Arbeit werden folgende Messwerte benutzt: Die voka-lischen Variablen sowie die Variable (rʲ) werden mithilfe ihrer Formanten bestimmt. Bei den Sibilanten dienen die spektralen Gravitationszentren als Messwert. Im Falle der Variable (ʧʲ), bei der es um die Palatalisiertheit der Affrikate geht, wird außerdem der Formanteneinstieg des folgenden Vokals gemessen. Für die Variablen (g) und (v), die auf ohrenphonetisch gut fest-stellbaren Gegensätzen beruhen, wird dagegen auf die Transkriptionen des OK-WRGR zurückgegriffen.
4.2 Datengrundlage
Das Oldenburger Korpus zur WRGR 4.2.1
Das Datenmaterial, das in dieser Arbeit verwendet wird, sind Aufnahmen weißrussisch-russischer gemischter Rede, die in den Jahren 2007 bis 2008 im Rahmen des eingangs erwähnten, von der Volkswagenstiftung geförderten Projekts Die Trasjanka in Weißrussland – Eine Mischvarietät als Folge des
69
weißrussisch-russischen Sprachkontakts. Sprachliche Strukturierung, sozio-logische Identifikationsmechanismen und Sozioökonomie der Sprache in sieben weißrussischen Städten aufgezeichnet wurden. Die Transkripte und ein Teil der Audiodateien sind im sogenannten Familienkorpus des Olden-burger Korpus zur weißrussisch-russischen gemischten Rede (OK-WRGR) auf der Seite http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/ok-wrgr/ veröffent-licht (HENTSCHEL, ZELLER & TESCH 2014).55 Es handelt sich hierbei um nicht-offizielle, spontane Gespräche im Familien- und Freundeskreis je einer Familie, in einem Fall (der Stadt Akcjabrski) von zwei Familien aus diesen Städten. Es wurde jeweils nach Möglichkeit nur eine Familie in diesen Städ-ten untersucht, um für die individuellen, unterschiedlichen Sprecher eine für statistische Analysen ausreichende Menge an sprachlichem Material zu gewinnen, und um Gespräche unterschiedlicher Sprecherkonstellation zu erhalten. Insgesamt sind in dem Korpus ca. 212 000 Wortformen bzw. 39 000 Äußerungen vorhanden, die sich gleichmäßig auf die untersuchten Städte verteilen. Die Gesamtzahl an Sprechern beträgt 129, wobei 70 Sprecher mehr als 500 Wortformen beigesteuert haben (was ungefähr 100 Äußerungen entspricht). Diese „zentralen“ Sprecher stellen fast 97% des Korpusmaterials. Für die zentralen Sprecher (mit Ausnahme der Sprecher in der Stadt Šarkoŭščyna, für die aufgrund von datenschutzrechtlich nicht näher erläuter-baren Problemen nur Angaben zu Geburtsjahr und zum Geschlecht bekannt sind) sind Angaben zu sozialen Charakteristika, zur Sprachbiographie und zu sprachlichen Einstellungen erfasst. Ausführlichere Informationen enthält der dokumentarische Teil in HENTSCHEL, ZELLER & TESCH (2014).
Die Gespräche liegen sowohl als Audiodateien als auch in transkribierter Form vor.56 Zudem sind sie nach verschiedenen Kriterien annotiert. Wichtig ist hier vor allem die „sprachliche Affinität“ von sprachlichen Einheiten unterschiedlicher Größe (vgl. HENTSCHEL 2008c, 179–188): Dabei wird bei Abstraktion von den in der vorliegenden Arbeit untersuchten phonetisch-phonologischen Charakteristika die Affinität eines jeden Morphs (verstanden als Kombination von Ausdruck und Inhalt) und darauf aufbauend der Wort-
55 Informationen zum Projekt finden sich unter www.uni-oldenburg.de/trasjanka/. Im OK-
WRGR sind auch einige innerhalb einer Pilotstudie in den Jahren 2004 und 2005 aufge-nommene Familiengespräche enthalten, die aber in der vorliegenden Studie nicht ausge-wertet wurden. Zudem enthält das OK-WRGR ein Teilkorpus aus sprachsoziologischen Interviews.
56 In HENTSCHEL, ZELLER & TESCH (2014) ist das Korpus im CHAT-Format veröffentlicht (vgl. MACWHINNEY 2013). Der vorliegenden Arbeit liegt eine Version als relationale Datenbank zugrunde.
70
formen, syntaktischen Phrasen, Clauses und Äußerungen mit dem Weißrussi-schen und/oder dem Russischen bestimmt. Es geht also darum, ob die festge-haltenen Redeeinheiten in ihren strukturell tieferen Ebenen (morphologi-schen, lexikalischen, morphosyntaktischen Einheiten bzw. Strukturen) – Phänomene der ersten Artikulation im Sinne von MARTINET (1949) – aus-drucks- und inhaltsseitig mit den entsprechenden Elementen und Strukturen des Standardweißrussischen und Standardrussischen, ggf. der weißrussischen Dialekte, übereinstimmen, während von Phänomenen der zweiten Artikula-tion abstrahiert wird.57 Die Klassifikation als ‚weißrussisch‘, ‚russisch‘, ‚ge-meinsam‘ oder ‚hybrid‘ (letzteres, wenn in einer Wortform oder einer Äuße-rung Morphe sowohl ‚russischer‘ als auch ‚weißrussischer‘ Affinität auftre-ten), ist also nicht in dem Sinne zu verstehen, dass ein Sprecher die Wortform in einem gegebenen Sprechakt aus einem der beiden getrennten Systeme abruft. Dass ein Sprecher die gegebene Redeeinheit aus getrennten Systemen des Weißrussischen und Russischen abruft, ist wie gesagt psycholinguistisch in der Regel nicht anzunehmen (vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2012, 196–200).
Im Folgenden wird vereinfacht von „Affinität“ einer Wortform oder Äu-ßerung gesprochen, wenn es um die Affinität der strukturell tieferen sprachli-chen Ebenen – Phänomene der ersten Artikulation nach MARTINET (1949) – geht. Im Gegensatz dazu bezieht sich „phonische Affinität“ auf die Affinität von Phänomenen der zweiten Artikulation. Wenn es um den Gegensatz zwi-schen beiden Ebenen geht, wird mitunter verkürzend von „morphologischer“ vs. „phonischer“ Affinität gesprochen, wobei unter „morphologisch“ flexionsmorphologische, morphonologische, lexikalisch-morphologische und morphosyntaktische Aspekte verstanden werden.
Die untersuchten Städte 4.2.2Bei den untersuchten Städten handelt es sich um sechs kleinere bis mittel-große Städte, die sich auf die drei traditionellerweise angenommenen weiß-russischen Dialektgebiete (Nordosten, Südwesten, zentrales Übergangs-gebiet) verteilen, sowie um die Hauptstadt Minsk. In jedem Gebiet wurde eine eher westlich und eine eher östlich gelegene Stadt untersucht:
57 Syntagmatische Kriterien gehen dabei in die Bestimmung ein (vgl. HENTSCHEL 2008c).
71
Die untersuchten Städte und deren Einwohnerzahl (Stand 2009) Tab. 9
Nordosten Zentral Südwesten
westl. östl. westl. zentral östl. westl. östl.
Šarkoŭ-ščyna (sa)
Chocimsk (ch)
Smarhon’ (sm)
Minsk (mi)
Rahačoŭ (ra)
Barana-vičy (ba)
Akcjabr-ski (ak)
6900 7100 36 300 1 836 800 33 700 168 200 7400
Bezirk Vicebsk
Bezirk Mahilëŭ
Bezirk Hrodna
Bezirk Minsk (Stadt)
Bezirk Homel’
Bezirk Brest
Bezirk Homel’
Auch abgesehen von der Hauptstadt Minsk, das sich als Metropole und Mil-lionenstadt von den anderen extrem abhebt, bestehen einige Unterschiede in der Struktur der untersuchten Städte (vgl. HENTSCHEL & KITTEL 2011). Wäh-rend Smarhon’ und Rahačoŭ mittelgroße Städte sind, und Baranavičy sogar eine im weißrussischen Vergleich relativ große, sind die übrigen drei, Šar-koŭščyna, Chocimsk und Akcjabrski, eher klein und offensichtlich ländlich geprägt. Insgesamt sind diese sieben Städte typisch für die allgemeine demo-graphische Entwicklung in Belarus in der zweiten Hälfte des 20. Jh.
Baranavičy (russisch: Baranoviči) war bereits 1959 mit 58 000 Einwoh-nern eine für weißrussische Verhältnisse größere Stadt (IVPN 1963, 13).58 Innerhalb von nur gut zehn Jahren verdoppelte sich die Einwohnerzahl annähernd auf 102 000 Einwohner im Jahre 1970 (BSĖ 2001), verbunden mit der Ansiedlung von Industrieanlagen, insbesondere im Bereich Maschinen-bau. Auch die beiden anderen mittelgroßen Städte, Rahačoŭ und Smarhon’, erlebten nach dem 2. Weltkrieg einen starken Bevölkerungszuzug. Neben Baranavičy und natürlich Minsk ist Rahačoŭ (russisch: Rogačev) die einzige der untersuchten Städte, die bereits 1959 etwas mehr als 10 000 Einwohner hatte (IVPN 1963, 13). Smarhon’ (russisch: Smorgon’) ist in dem Zensus von 1959 noch nicht als Stadt mit mehr als 10 000 Einwohnern erfasst. 1975 sind es 12 600 Einwohner (BSĖ 2001), auch hier wurde in den 1960er bis 1980er Jahren eine Reihe von industriellen Unternehmen angesiedelt.
Über die Entwicklung der drei Kleinstädte Akcjabrski (russisch: Ok-tjabr’skij), Chocimsk (russisch: Chotimsk) und Šarkoŭščyna (russisch: Šar-
58 Die zehntgrößte, um genau zu sein. Zum Vergleich: Außer Minsk hatten 1959 nur Vicebsk,
Homel’ und Mahilëŭ mehr als 100 000 Einwohner.
72
kovščina) lässt sich wenig in Erfahrung bringen.59 Akcjabrski wird im Jahre 1954 gegründet durch den Zusammenschluss dreier kleinerer Siedlungs-punkte.
Minsk ist mit über 1,8 Millionen Einwohnern die mit Abstand größte Stadt in Belarus (PN 2009:2, 171) und industrielles, kulturelles und wissen-schaftliches Zentrum des Landes. Wie bereits erwähnt, war Minsk die am schnellsten wachsende Stadt der UdSSR der Nachkriegszeit (SADOŬSKI 1982, 177). Vor dem 2. Weltkrieg waren es ca. 240 000 Einwohner. 1959 hatte die Hauptstadt über 500 000 Einwohner, 1970 mehr als 900 000 und 1977 bereits mehr als 1 200 000 (BSĖ 2001).
Was die sprachliche Landschaft angeht, so belegen die Daten des Zensus von 2009, dass Minsk die am stärksten russifizierte Stadt in Belarus ist. Ab-gesehen davon gibt es eher geringe Unterschiede zwischen den Bezirken. Die Bezirke Minsk und weniger stark Hrodna zeigen in den offiziellen Umfragen eine relativ starke Position des Weißrussischen (vgl. PN 2009:3, 341–347 und 363–369).60 In der sprachsoziologischen Umfrage in KITTEL et al. (2010, 60) treten recht große Unterschiede zwischen den Städten zutage: Zur WRGR als Muttersprache bekennen sich in Minsk und Slonim61 knapp 20%, in Rahačoŭ, Šarkoŭščyna und Chocimsk knapp 40%, in Smarhonʼ knapp 50% und in Akcjabrski knapp 60%. Das Weißrussische wird am häufigsten in Slonim angegeben (65%), Russisch wie zu erwarten in Minsk (knapp 60%). HENTSCHEL & KITTEL (2011, 119f.) zeigen zudem, dass WRGR als primäre Gebrauchssprache am häufigsten in den drei kleinen, ländlich geprägten Städten angegeben wird (von etwa 50% der Befragten), etwas seltener in den drei Kleinstädten (knapp 40%) und deutlich am seltensten in Minsk (aber
59 Auch die Kontakte mit den Minsker Soziologen, die am Oldenburger Projekt beteiligt
waren, konnten hier nicht helfen. 60 Die regionalen Unterschiede zwischen „Ost“ und „West“ hinsichtlich Sprachverwendung
und Spracheinstellung, Identität und Einstellung zu Russland sind in Belarus nicht so stark ausgeprägt wie in der Ukraine. Dem Westen wird zuweilen ein größerer Patriotismus, stär-kere Religiösität und eine geringere Nostalgie in Bezug auf die UdSSR zugeschrieben. Nach RADZIK (2006, 100f.), der sich auf einen Artikel des Publizisten Sjarhej Astraŭcoŭ beruft, finden die Unabhängigkeit von Belarus und eine stärkere Anbindung an den Westen im Westen des Landes mehr Unterstützer. In einer aktuellen Umfrage unter 1000 jungen Erwachsenen in Belarus finden sich jedoch hinsichtlich der (selbsteingeschätzten) Kompe-tenz im Weißrussischen keine systematischen Ost-West-Unterschiede (HENTSCHEL et al. i.Dr.).
61 Wie in Abschnitt 2.1 erwähnt wurde, wurde die sprachsoziologische Umfrage in denselben Städten durchgeführt, aus denen auch die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Infor-manten stammen. Die Ausnahme ist die knapp 50 000 Einwohner zählende Stadt Slonim, die in der Umfrage anstelle des benachbarten Baranavičy herangezogen wurde.
73
immer noch bei gut 15% der Befragten). Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass sich solche Unterschiede direkt in dem hier vorliegenden Sprachmaterial niederschlagen. Schließlich wurde im Familienkorpus des OK-WRGR nur eine Familie pro Stadt untersucht und es wurden gezielt Familien ausgewählt, die sich der WRGR bedienen.
Methode der Aufnahme und Charakterisierung der Aufnahmen 4.2.3
Untersuchungen, die instrumental die akustischen Charakteristika von natür-licher Rede zum Gegenstand haben, stehen generell vor einem Dilemma: Eine gute Aufnahmequalität bedingt in der Regel eine eher unnatürliche Gesprächssituation, Aufnahmen in natürlichen Gesprächssituationen weisen oft eine schlechtere Aufnahmequalität auf (vgl. SAPPOK 1999, 1009f.). Dieses Dilemma gilt auch für die vorliegende Untersuchung, und vielleicht aufgrund des overt negativen Prestiges des Untersuchungsobjekts umso mehr, so dass der Gewährleistung einer natürlichen Gesprächssituation der Vorzug vor der Sicherung einer exzellenten Aufnahmequalität gegeben werden musste. Die Aufnahmen von WRGR, die dieser Arbeit zugrunde liegen, wurden von weißrussischen studentischen Hilfskräften, Studentinnen der Belorussistik an der Weißrussischen Staatsuniversität Minsk, im Falle eines Erhebungsortes von einer Mitarbeiterin der Oldenburger Slavistik in ihren eigenen Familien bei teilnehmender Beobachtung durchgeführt. Dabei wurde ein Aufnahme-gerät über einen längeren Zeitraum in einem einschlägigen Kommunikations-raum des Zuhauses der Familien platziert und die Gespräche, die in diesem Raum stattfanden, aufgenommen. Passagen unmittelbar nach Einschalten des Aufnahmegeräts wurden nicht berücksichtigt. Einige der aufgenommenen Personen waren darüber informiert, dass ihre Rede aufgezeichnet wird, an-dere waren es zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, sondern wurden von den Exploratorinnen nachträglich informiert. Insgesamt liegen ca. 36 Stunden an Material vor.
Die beschriebene Methode zur Datengewinnung wurde gewählt, um das Problem des sogenannten Beobachterparadoxons zu reduzieren.62 Sie macht es wahrscheinlich, authentische Gespräche, d.h. Gespräche ohne eine be-sondere metasprachliche Aufmerksamkeit seitens der Informanten auf ihre
62 Das Beobachterparadox ist in einem Land wie Belarus vielleicht noch ausgeprägter.
RADZIK (2006, 95) berichtet von der Erfahrung, dass von vielen, v.a. älteren Personen in Belarus der Soziologe „wie ein potenzieller Vertreter der Behörden“ wahrgenommen werde und dementsprechend „erwartungsgemäß“ geantwortet werde.
74
Rede zu gewinnen, was durch andere Methoden bei der Aufnahme oder durch die Anwesenheit eines auswärtigen Interviewers angesichts des negati-ven overten Prestiges von WRGR nicht gewährleistet wäre (vgl. im Allge-meinen hierzu LABOV 1972, 209). Wie aus dem Gesagten hervorgeht, handelt es sich bei allen Gesprächen um vergleichbare Gesprächssituationen, d.h. nicht-offizielle, familiäre Konversationen.63 Andererseits führt die Methode der Datengewinnung dazu, dass viele Gespräche für eine akustische Analyse keine ausreichende Aufnahmequalität aufweisen, da die Sprecher weit vom Mikrophon entfernt sind, Nebengeräusche vorhanden sind, Sprecher gleich-zeitig sprechen etc.
Mit Ausnahme eines Teils der Daten aus Baranavičy, die in einem Pilot-projekt zwischen 2004 und 2006 gewonnen wurden, wurden alle Aufnahmen mithilfe des integrierten Mikrophons eines WAV-Recorders des Typs Edirol R-09HR mit einer Abtastrate von 44 100 Hz aufgenommen. Die genannten frühen Daten aus Baranavičy wurden mit einem analogen Aufnahmegerät gewonnen. Nach einer nachträglichen Digitalisierung stellten sie sich als für akustische Analysen nicht auswertbar heraus. Einige der späteren, mit dem digitalen Aufnahmegerät in Baranavičy gewonnen Daten wurden außerdem mit einer niedrigeren Abtastrate (von ca. 15 000 Hz) aufgezeichnet, so dass diese Daten nur für einige der akustischen Analysen in Betracht kommen (für Formantenanalysen, aber nicht für die Analyse von Gravitationszentren). Die übrigen Daten aus Baranavičy wurden ebenfalls mit einer Abtastrate von 44 100 Hz aufgenommen.
Auswahl und Charakterisierung der Informanten 4.2.4
Die Verteilung der Sprecher hinsichtlich sozialer Kriterien im OK-WRGR ist naturgemäß kein Abbild der soziodemographischen Verhältnisse in Belarus insgesamt. Die Sprecher sind auch nicht gleichmäßig auf gängige soziale Parameter verteilt, und außerdem mit stark unterschiedlicher Menge an sprachlichem Material vertreten. Es handelt sich um einzelne, in einem ge-wissen Sinne zufällig, aber doch dahingehend gezielt ausgesuchte Familien,
63 Bei einigen Gesprächen wurde ein Familienmitglied beim Telefonat mit einem Bekannten
aufgezeichnet, über dessen Identität nichts bekannt ist. Nach Möglichkeit wurden diese Gespräche in der vorliegenden Untersuchung nicht ausgewertet, nur für einen Sprecher wurde ein solches Gespräch einbezogen.
75
dass nur solche in Betracht kamen, die WRGR regelmäßig sprechen.64 Dies ist, wie dargelegt, zwar weit verbreitet, aber natürlich nicht durchgängig der Fall, in Minsk sogar die Ausnahme (vgl. HENTSCHEL & KITTEL 2011, 119f. und oben 4.2.2).
Die meisten Analysen innerhalb des Oldenburger Projekts zur WRGR be-ruhen auf einer Auswahl dieser Sprecher. Um das Zufallselement zu reduzie-ren, werden nur Sprecher untersucht, die eine hinreichend große Menge an Wortformen oder Äußerungen produziert haben, d.h. in der Regel die er-wähnten 70 „zentralen“ Sprecher mit mehr als 500 geäußerten Wortformen. Aufgrund der Qualität einiger Aufnahmen und der aufwändigen Aufbereitung der Daten (s. 4.2.5) werden in dieser Arbeit nicht alle dieser potentiellen Informanten ausgewertet. Nach Möglichkeit wurden aus jeder der unter-suchten sieben Städte je eine männliche und eine weibliche Person für jede der drei in Abschnitt 2.2 beschriebenen prototypischen Generationen von Sprechern gemischter Rede untersucht, welche auch die Zielgruppen des Oldenburger Projekts waren, d.h. die Generation 1 (Land-Stadt-Migranten) und die Generation 2 (Kinder der Land-Stadt-Migranten).65 Zudem wurden nach Möglichkeit Vertreter der Generation 0 (Dörfler und Spätmigranten, Eltern der Land-Stadt-Migranten) analysiert. Diese Generation stand nicht im Mittelpunkt des Oldenburger Projekts (ebensowenig wie eine „Genera-tion 3“), so dass nur relativ wenige Vertreter aufgenommen wurden. Vertreter einer Generation 3, der Generation der Enkel der Land-Stadt-Migranten, wurden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Jüngere Sprecher sind zwar wichtig, da sie als die phonologisch innovativsten und als Träger von sprachlichem Wandel gelten (ECKERT 1991, 213; LABOV 1994, 47; WATT 2002, 51; KERSWILL 2007, 693). Zudem wäre dies die Generation, für die prototypisch eine Fokussierung der neuen Varietät anzunehmen ist (s. 2.3). In dem vorliegenden Material sind aber zu wenig solcher Sprecher vertreten (insgesamt haben acht Sprecher unter 18 Jahren jeweils mehr als 500 Wortformen beigesteuert, die älteren von diesen gehören aber zur Gene-
64 Die Daten aus Akcjabrski stammen wie gesagt aus zwei unterschiedlichen und nicht mit-
einander bekannten Familien. Die Vertreterin der Generation 0 und der männliche Vertreter der Generation 2 stammen aus einer anderen Familie als die übrigen Sprecher.
65 Allerdings liegen wie gesagt in Šarkoŭščyna keine Angaben zur Migration vor, vgl. dazu und zur genauen Definition der Variable Generation 4.4.
76
ration 2, sind also Kinder, nicht Enkelkinder, von Land-Stadt-Migranten), und diese wenigen Vertreter sind, was das Alter angeht, sehr heterogen.66
Um möglichst viele dieser Kombinationen aus Stadt, Geschlecht und Generation einzubeziehen, mussten auch einige Sprecher einbezogen wer-den, die nicht zu den „zentralen“ Sprechern gehören, die also mit weniger als (den ohnehin willkürlich als Grenzwert angenommenen) 500 Wortformen vertreten sind, was allerdings zur Folge hat, dass nicht für alle Informanten alle Variablen mit einer hinreichend großen Datenmenge vertreten sind.
Wenn in einer Stadt für eine Kombination Generation x Geschlecht meh-rere Sprecher in Betracht kamen (z.B. in Minsk für weibliche Vertreter der Generation 1 und 2), so wurden solche gewählt, die eine möglichst große Altersdistanz zu den Vertretern der anderen Generationen und eine möglichst geringe zu dem anderen Vertreter derselben Generation haben, so dass der Altersunterschied zwischen den Generationen in den einzelnen Städten mög-lichst konstant ist. Weitere soziale Charakteristika wie Bildungsgrad und Beruf wurden aufgrund der geringen Sprecherzahl bei der Auswahl der In-formanten und auch später in der Analyse nicht berücksichtigt.
Abhängig von der jeweiligen Konstellation in der untersuchten Familie sind nicht in allen Städten alle Kombinationen gegeben. In Fällen, wo dies besonders ausgeprägt ist (Šarkoŭščyna und Smarhon’), wurden, wenn mög-lich, zwei Vertreter einer anderen Kombination untersucht. Insgesamt wurden 34 Sprecher in die Analysen einbezogen. Tabelle 10 zeigt die untersuchten Sprecher:
Die untersuchten Sprecher Tab. 10
Stadt Generation männlich weiblich ak 0 - ak_B 1 ak_P ak_M 2 ak_Q ak_D ba 0 - ba_O 1 ba_P ba_A 2 ba_V ba_B ch 0 - ch_P 1 ch_C ch_A 2 ch_R ch_N mi 0 - mi_V 1 mi_B mi_A 2 mi_Y mi_F
66 Verwiesen sei wiederum auf die Arbeit von KRAŬČANKA (i.Vorb.), die sich der gemischten
Rede bei Schülern in Belarus widmet.
77
ra 0 ra_D ra_B 1 ra_S ra_L 2 ra_C ra_A sa 0 - - 1 sa_T sa_M 2 - sa_N, sa_I sm 0 - - 1 sm_B sm_A, sm_C 2 sm_AF -
Oft sind die untersuchten Sprecher die Mitglieder der Kernfamilie, d.h. Groß-eltern, Eltern und Kinder, jedoch nicht ausschließlich. Unter den Vertretern der Generation 2 sind auch die Personen, die die Aufnahmen durchführen (nur in Smarhon’ und Akcjabrski ist dies nicht der Fall).
Aufgrund der variierenden Datenmenge konnten wie gesagt nicht alle Sprecher hinsichtlich aller Variablen ausgewertet werden (vgl. die entspre-chenden Unterkapitel). Insbesondere gilt dies für Sprecherin sa_M, die die einzige weibliche Vertreterin der Generation 1 in Šarkoŭščyna ist. Sie ist vor allem in einem Gespräch vertreten, das aber (als einziges) nur in transkri-bierter Form und nicht als Audio-Datei vorliegt. Deswegen konnte ihre Rede für viele Variablen nicht ausgewertet werden. Dasselbe gilt für Sprecherin ba_O (die Vertreterin der Generation 0 in Baranavičy), die in den auswert-baren Gesprächen aus Baranavičy selten auftritt. Auch der Sprecher ak_Q ist mit nur wenig untersuchten Token präsent.
Auswahl, Aufbereitung und Auswertung der Daten 4.2.5
Die Aufbereitung der Aufnahmen und teilweise die Erhebung der Messwerte geschah in Praat (PRAAT 2013).67 Wo die Erhebung der Messwerte nicht direkt in Praat erfolgte, erfolgte sie mithilfe des Programmes Emu (EMU 2010) und des entsprechenden Packages Emu-R (EMU-R 2012, vgl. auch HARRINGTON 2010) des Statistikprogrammes R (R 2012).
Es wurden nicht alle Token jeder Variable ausgewertet. Die Auswahl der analysierten Gespräche erfolgte zunächst nach dem Kriterium der Qualität der Aufnahme. Die Aufnahmen wurden dann chronologisch durchgearbeitet, d.h. die entsprechenden Phone in der Reihenfolge ihres Auftretens segmen-tiert und annotiert. Sobald eine für die statistische Analyse kritische Menge an Token für einen Sprecher für eine Variable erreicht war, wurde diese nicht
67 Genaue Angaben zur benutzten Software finden sich im Quellenverzeichnis.
78
mehr weiter annotiert. In einigen Gesprächen wurden also beispielsweise nur Jakanje-Phänomene, nicht aber die betonten Vokale annotiert.
Die Aufbereitung der Daten für die Erhebung der akustischen Messwerte umfasste Folgendes: Für jeden zu analysierenden Laut wurde (mithilfe der Annotationsfunktion von Praat) manuell Anfangspunkt und Endpunkt in der entsprechenden Sounddatei bestimmt (zum genaueren Vorgehen bei den einzelnen Lautklassen siehe die entsprechenden Unterkapitel). Die Laute wurden für folgende Werte annotiert:
1) die zugrunde liegende Variable bzw. das zugrunde liegende Phonem;68 2) eine ungefähre ohrenphonetische Transkription (dies rein zu Kontroll-
zwecken); 3) die Angabe, ob die Silbe vortonig oder nachtonig ist und der Abstand der
Silbe zur betonten Silbe des phonologischen Wortes, bzw. die Angabe, dass die Silbe den Wortakzent trägt;
4) die Wortform in der Transkription des Oldenburger Familienkorpus (in einer frühen, nicht korrigierten Version, was aber für die vorliegende Arbeit unerheblich ist);
5) der Sprecher; 6) die Äußerung in der Transkription des Oldenburger Familienkorpus
(auch hier in einer frühen, nicht korrigierten Form); 7) eine Kennzahl für das Gespräch; 8) eine Kennzahl für die Äußerung; 9) ggf. Kommentare zur Qualität der Aufnahme oder andere Auffälligkei-
ten; 10) ggf. Einträge, die die Einstellungen in Praat bei der später automatisch
erfolgenden Erhebung der Messwerte steuern.
Das phonologische Wort wurde nicht explizit notiert, allerdings wurden des-sen Anfangs- und Endpunkt markiert und so gegebenenfalls verschiedene syntaktische Wörter zu einem phonologischen Wort zusammengefasst. Ebenso sind über die zeitliche Information Phone zu Silben und Silben zu phonologischen Wörtern zusammengefasst. Um lautliche Kontexteinflüsse berücksichtigen zu können, wurde außerdem stets der unmittelbar voran-gehende und nachfolgende lautliche Kontext, der nächstvorherige und nächstfolgende Vokal sowie der betonte Vokal innerhalb des phonologischen
68 Es wird also beispielsweise „tj“ eingetragen, unabhängig davon, ob die Variable als [ʦʲ],
[ʦ"] oder [tʲ] realisiert wird; im Falle von unbetontem /o/ wird „o“ notiert, unabhängig da-von, ob die Realisierung etwa als [a], [ɐ] oder [ə] erfolgt usw.
79
Wortes als Phonem bzw. als Variable (also nicht in seiner tatsächlichen Rea-lisierung) notiert. Über die Grenze des phonologischen Wortes hinaus wurde der Kontext nicht notiert.
In Praat sind die Informationen in einzelnen sogenannten „tiers“ fest-gehalten und nur indirekt, d.h. durch die zeitliche Information der Anfangs- und Endpunkte der markierten Intervalle miteinander verknüpft. Aufgrund dieser zeitlichen Hierarchisiertheit sind aus den gemachten Annotationen aber Angaben wie der Silbentyp (offen oder geschlossen) sowie das phonolo-gische Wort ableitbar.
Angestrebt wurde, pro Sprecher pro Variable zwischen 20 und 30 Token zur Analyse zur Verfügung zu haben. Dies wurde für die große Mehrzahl der Sprecher und Variablen erreicht, punktuell sind es aufgrund von mangelndem Material weniger, oft sind es mehr Token (die Angaben für die einzelnen Variablen finden sich im Anhang).
Entwickelt wurden außerdem diverse Praat-Scripts, die die Annotationen nach vorgegebenen Werten durchsuchen und entweder bestimmte Messungen direkt in Praat durchführen (Formantenmessungen, Dauer des Lautes) und die Ergebnisse in Tabellenform speichern, oder Segmentdateien erstellen, also Anfangs- und Endpunkte der gesuchten Token in den jeweiligen Sound-dateien ermitteln.69 Die Messergebnisse wurden dann zur statistischen Ana-lyse in Statistikprogramme (hier R) importiert. Die Segmentdateien stellten einen Zwischenschritt dar. Sie dienten dazu, Analysen in Emu und Emu-R durchzuführen, die für die Bestimmung bestimmter Messwerte (der bei den Sibilanten verwendeten spektralen Gravitationszentren) flexibler sind. Neben diesen Messwerten bzw. Segmentdateien ermitteln die Scripts auch Informa-tionen aus den entsprechenden Annotationen des gefundenen Lautes, etwa den Sprecher, die Entfernung der Silbe zur betonten Silbe des phonologi-schen Wortes oder den lautlichen Kontext. Anhand der Kennwerte des Ge-sprächs, der Äußerung und anhand der transkribierten Wortform wurden diese Angaben anschließend mit den übrigen Annotationen des OK-WRGR abgeglichen und um fehlende Informationen wie die sozialen Charakeristika der Sprecher und die Affinität der Wortform und der Äußerung auf tieferen Ebenen zum Russischen und/oder Weißrussischen im Sinne des in HENTSCHEL (2008c, 179–188; vgl. Abschnitt 4.2.1) beschriebenen Klassifi-kationsalgorithmus ergänzt.
69 Viele dieser Scripts beruhen in Ausschnitten auf den Scripts von Mietta Lennes (SPECT
2011).
80
Anders liegt der Fall wie gesagt bei den Variablen (g) und (v). Hier han-delt es sich um ohrenphonetisch deutlich feststellbare Unterschiede, daher wurde direkt auf die auf ohrenphonetischen Qualifizierungen beruhenden Transkriptionen im OK-WRGR zurückgegriffen.
4.3 Statistische Methoden
Die Struktur der zugrunde liegenden Daten macht spezielle statistische Ana-lysemethoden notwendig. Da diese in der slavistischen Forschungslandschaft bisher kaum verbreitet sind, sollen sie hier kurz vorgestellt werden. Die Be-schreibung folgt im Wesentlichen BAAYEN (2008) und JOHNSON (2008).
Es geht in den folgenden Untersuchungen der einzelnen Variablen zu-nächst um die Frage, welche Faktoren die phonetische Gestalt einer Variab-len beeinflussen (siehe Abschnitt 3.2). Diese Faktoren sind zum einen Eigen-schaften des Sprechers (Generation, Geschlecht, dialektale Herkunft), zum anderen Eigenschaften des Phons bzw. der Wortform, in dem das Phon auftritt (z.B. die Affinität der Wortform auf tieferen Ebenen zum Weißrussi-schen und/oder Russischen, die Dauer des Lautes, der lautliche Kontext).
Es geht also zunächst darum, die Effekte mehrerer Variablen gleichzeitig zu ermitteln. Multivariate Analysen wie multiple Regression – Ordinary Least Squares-Regression (OLS) oder logistische Regression – sind darauf aus-gerichtet, dieser Anforderung nachzukommen und die Effekte mehrerer Fak-toren gleichzeitig festzustellen bzw. den Einfluss eines Faktors bei Kontrolle der übrigen Faktoren zu ermitteln. Sie sind in der variationistischen Sozio-linguistik weit verbreitet (vgl. LABOV 1994, 56–62; GUY 2009 [1993], 75).
Speziell ist an der vorliegenden Untersuchung die Gruppierung der Daten. Die einzelnen Beobachtungen, die Laute, sind nicht unabhängig voneinander, sondern jeweils einem Sprecher zugeordnet. Diese Sprecher sind ebenfalls nicht unabhängig voneinander, sondern gehören mit anderen Sprechern zu einer Familie bzw. zu einem Familienkontext. Beide Faktoren, Sprecher und Familie, werden in der statistischen Literatur als „nicht-wiederholbar“ be-zeichnet. Obwohl sie mit Sicherheit einen Einfluss auf die phonetischen Realisierungen haben (sich also auch Sprecher gleicher sozialer Eigenschaf-ten voneinander unterscheiden), können sie im Gegensatz zu wiederholbaren Faktoren wie Generation, Geschlecht, soziale Klasse usw. nicht dazu dienen,
81
dass sprachliche Verhalten weiterer Sprecher vorherzusagen.70 Andererseits dürfen sie auch nicht ignoriert werden. Andernfalls könnten einzelne Spre-cher, die in ihrem sprachlichen Verhalten individuelle Besonderheiten zeigen, Effekte anderer Variablen verursachen.
Während die üblichen Regressionsverfahren (ob OLS oder logistisch) vo-raussetzen, dass jede Beobachtung statistisch unabhängig von allen anderen ist, lassen sich solche gruppierten Datenstrukturen mithilfe sogenannter Mehrebenenmodelle (auch „Gemischte Modelle“ genannt) analysieren (vgl. zum Hintergrund BAAYEN 2008, 241–302 und JOHNSON 2008, 216–264, für eine konkrete Anwendung PHARAO 2010). Mehrebenenanalysen lassen sich als eine Erweiterung der „einfachen“ OLS-Regression bzw. Logistischen Regression konzeptualisieren, bei der (ähnlich wie bei Varianzanalysen mit Messwiederholung) die Tatsache berücksichtigt wird, dass Beobachtungen unter nicht-wiederholbare Faktoren gruppiert sind, und der Effekt solcher nicht-wiederholbaren Variablen als Zufallsfaktoren („random factors/ effects“) kontrolliert wird, ohne dass sie als erklärende Variablen in die Analyse eingehen. Mehrebenenmodelle stellen sicher, dass die beobachteten statistischen Effekte (also etwa Unterschiede zwischen verschiedenen Gene-rationen) nicht durch einige einzelne Individuen zustande kommen. Mehrebenenmodelle sind geeignet für Samples mit einer ungleichen Anzahl an Beobachtungen für die einzelnen Werte des Zufallsfaktors, wenn die Beobachtungen also nicht gleichmäßig über den Zufallsfaktor verteilt sind (JOHNSON 2008, 233). Sie verhindern, dass Sprecher, für die mehr Beobach-tungen vorliegen, die Analyse stärker beeinflussen als andere.
Mehrebenenmodelle berechnen wie andere Regressionsanalysen Koeffi-zienten für den Achsenabschnitt und die Steigung der Regressionsgeraden der als „Feste Faktoren“ („fixed factors/effects“) bezeichneten erklärenden Variablen. Die Berücksichtigung des Zufallsfaktors geschieht, indem für jeden Wert des Zufallsfaktors, also etwa für jeden einzelnen Sprecher, eine Modifikation des allgemeinen Achsenabschnitts der Regressionsgeraden angenommen wird.
Mehrebenenmodelle ermöglichen es durch die Annahme von individuel-len Steigungen („random slopes“) für jeden Wert des Zufallsfaktors auch, zu überprüfen, ob der Effekt einer erklärenden Variable für einige Sprecher
70 Während sich bei einer hypothetischen weiteren Untersuchung von WRGR die Beobach-
tungen in die gleichen Werte von Geschlecht oder Generation einordnen ließen, wie die Beobachtungen in der vorliegenden Arbeit, trifft es nicht zu, dass sie zu einem der unter-suchten Sprecher oder einer der untersuchten Familie gehören werden.
82
stärker als für andere ausfällt, nicht vorhanden ist oder sogar gegenläufig ist. Auf diese Weise kann ausgeschlossen werden, dass ein Effekt einer Variab-len „unterhalb“ der Ebene des Zufallsfaktors lediglich durch Unterschiede einiger weniger Sprechern verursacht wird. In der vorliegenden Arbeit wird zum Beispiel stets überprüft, ob sich Äußerungen unterschiedlicher Affinität (vgl. Abschnitt 4.4) auf der phonischen Seite unterscheiden. Durch den Test, ob die Annahme einer Zufallssteigung nötig ist, kann ausgeschlossen werden, dass Unterschiede zwischen den Äußerungen nur für einige wenige Sprecher gelten. Ebenfalls wird auf Zufallssteigungen für Generation und Geschlecht im Zufallsfaktor Stadt geprüft. Die Ergebnisse dieser Tests werden im Fol-genden jedoch nur bei Signifikanz angeführt.
Was die Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten (den p-Werten) der Festen Effekte angeht, so ist diese anhand der t-Statistik problematisch, da unklar ist, wie die Freiheitsgrade zu bestimmen sind. Für nicht-logistische Regressionsanalysen werden daher im Folgenden zwar die t-Werte angege-ben, die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte erfolgt jedoch mithilfe des sogenannten Markov Chain Monte Carlo Sampling (MCMC, vgl. BAAYEN 2008, 247f.). Bei logistischen Mehrebenenmodellen ist dieses Verfahren zum Zeitpunkt der Analysen nicht in R implementiert, so dass hier die Wahrscheinlichkeitswerte anhand der z-Statistik berechnet werden.
Kategoriale erklärende Variablen, zu denen die Mehrzahl der hier unter-suchten erklärenden Variablen gehören, werden, wenn sie mehr als zwei Ausprägungen aufweisen, in mehrere binäre Variablen aufgeteilt. Dadurch erhält jede Ausprägung einer kategorialen erklärenden Variable einen eige-nen Regressionskoeffizienten mit einem t-Wert und einem p-Wert. Dieser Koeffizient gibt die geschätzte Veränderung der abhängigen Variable an, wenn die erklärende Variable diesen Wert annimmt, im Vergleich zu einem anderen Wert der erklärenden Variable (dem Referenzwert). Die Höhe der Koeffizienten und deren p-Werte hängen also davon ab, welcher Wert einer mehrwertigen Variable als Referenzwert benutzt wird. Das Verfehlen statisti-scher Signifikanz für die einzelnen Werte einer erklärenden Variable im Output eines Regressionsmodells bedeutet also nicht unbedingt, dass für die Variable insgesamt kein statistisch signifikanter Effekt festzustellen ist. Um-gekehrt bedeuteten einzelne signifikante Werte innerhalb einer mehrwertigen Variable nicht, dass der Effekt der Variablen insgesamt statistisch signifikant ist. Es muss also gegebenenfalls überprüft werden, ob ein Faktor insgesamt das Modell verbessert. Dies geschieht für Mehrebenenmodelle mithilfe eines sogenannten Likelihood-Ratio-Tests, also anhand der Log-Likelihood, einem
83
Kennwert der Passgüte eines statistischen Modells. Verglichen wird die Log-Likelihood eines Modells ohne den fraglichen Faktor mit der Log-Likelihood eines Modells mit dem fraglichen Faktor. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied zwischen zwei Log-Likelihood-Werten von der beobachteten Größe zufällig zustande kommt, lässt sich mithilfe der χ2-Verteilung erfassen: Der mit 2 multiplizierte Unterschied zwischen den Log-Likelihood-Werten beider Modelle folgt der χ2-Verteilung, wobei die Zahl der Freiheitsgrade dem Unterschied in der Anzahl der Parameter der beiden Modelle entspricht. Ist der dem χ2-Wert zuzuordnende p-Wert unter einem festgelegten Signifi-kanzniveau, so ist davon auszugehen, dass die erklärende Variable das Mo-dell signifikant verbessert (vgl. BAAYEN 2008, 253).71 In den folgenden Analysen werden auf Likelihood-Ratio-Tests beruhende p-Werte für die gesamte Variable nur dann gezeigt, wenn die Signifikanzwerte der einzelnen Ausprägungen einer Variablen kein klares Bild liefern, oder wenn es um Interaktionen zweier Variablen geht. Im Falle von Interaktionen werden die Signifikanzwerte der einzelnen Kombinationen von Ausprägungen nicht gezeigt, sondern der auf dem Likelihood-Ratio-Test beruhende Signifikanz-wert der Interaktion insgesamt. Die Interaktion selbst wird mithilfe von Gra-phiken verdeutlicht.
An dieser Stelle wird darauf verzichtet, das Vorgehen anhand einer exem-plarischen Analyse vorzuführen. Stattdessen wird in Abschnitt 5.3.3 mit dem nötigen Hintergrund eine solche Analyse vorgestellt. Auf weitere Methoden wird gegebenenfalls dort, wo sie verwendet werden, eingegangen. Alle sta-tistischen Berechnungen in dieser Arbeit erfolgen in R (R 2012). Mehrebenenmodelle werden mithilfe des R-Packages lme4 berechnet (LME4 2012).
4.4 Die erklärenden Variablen
Wie in Abschnitt 4.3 diskutiert, wird in den statistischen Analysen unter-schieden zwischen erklärenden, sogenannten Festen Faktoren/Effekten („fixed factors/effects“) und Zufallsfaktoren („random factors/effects“). Die
71 Die in dieser Arbeit gezeigten Modelle werden mithilfe der sogenannten Restricted Maxi-
mum Likelihood (REML) Estimation berechnet. Für den Vergleich unterschiedlicher Modelle, genauer gesagt von Modellen, die sich in den Festen Effekten unterscheiden, ist dieses Verfahren jedoch nicht angebracht. Die zu vergleichenden Modelle werden daher für den Vergleich untereinander mithilfe der Maximum Likelihood (ML) Estimation neu berechnet.
84
Festen Faktoren, d.h. die erklärenden Variablen werden hier kurz vorgestellt. Außerdem wird auf theoretisch begründbare mögliche Interaktionen zwi-schen Faktoren eingegangen, d.h. auf die Möglichkeit, dass der Effekt einer Variablen unterschiedlich ausfällt, je nachdem, welchen Wert eine andere Variable annimmt.
Zunächst werden die sprecherbezogenen erklärenden Variablen diskutiert. Aufgrund der geringen Sprecherzahl konzentriert sich die Arbeit auf drei Variablen, und zwar auf Generation, Geschlecht und dialektaler Hinter-grund. Unterhalb der Sprecherebene, also auf der Ebene der Wortform bzw. des Lautes sind die Affinität der Äußerung und der Wortform, die Worthäu-figkeit, phonetisch-phonologische Faktoren (wie der phonische Kontext) und ggf. lexikalische Ausnahmen zu beachten.
a) Generation Wie in Abschnitt 2.2 dargelegt, sind unter den Sprechern von WRGR prototypisch mindestens zwei Generationen zu unterscheiden: Einerseits Personen, die im Zuge der (Re-)Urbanisierung von Belarus in den 1960er, 70er und 80er Jahren aus ländlichen Gebieten in die Städte migriert sind, andererseits deren Kinder. Diese Gruppen unterscheiden sich in erster Linie in ihrer sprachlichen Erstsozialisierung, die für die Migrantengeneration weitgehend weißrussisch-dialektal war, für die Kindergeneration dagegen weitgehend monolektal weißrussisch-russisch gemischt. Zweitens ist im schulischen und teilweise vorschulischen Bereich für die Kindergeneration ein weit stärkerer Einfluss des Russischen und ein geringerer des Weißrussi-schen anzunehmen. Des Weiteren ist das sprachliche Verhalten der Eltern der Land-Stadt-Migranten (der Generation 0), die wie gesagt nicht im Mittel-punkt des Oldenburger Projekts standen, als Vergleichswert interessant. Diese haben ihr Leben auf dem Land verbracht bzw. sind erst im höheren Alter zu ihren Kindern in die Städte gezogen.
Zeitliche Trennlinien, die die in dieser Arbeit untersuchten Sprecher objektiv in drei Gruppen teilen, sind die Geburtsjahrgänge 1945 und 1970. Sprecher, die vor 1945 geboren wurden, gehören zur Generation 0, solche, die nach 1970 geboren sind, zu Generation 2. Wichtiger ist jedoch, dass die Einteilung der Sprecher die Generationsstruktur innerhalb der Familien ab-bildet. Wie in Abschnitt 4.2.4 beschrieben, wurde bei der Auswahl der Spre-cher darauf geachtet, den Altersabstand zwischen den Generationen in den Familien möglichst konstant zu halten.
85
Geburtsjahr der Sprecher. △: weibliche Informanten, ▽: männliche Informanten. Abb. 2
Wie Abbildung 2 zeigt, kann das absolute Alter von Sprechern ein und der-selben Generation zwischen den Städten variieren, so dass die Gruppen je-weils eine Spannweite von ca. 20 Jahren abdecken. So ist zum Beispiel der jüngere Vertreter der Generation 1 in Akcjabrski kaum älter als der ältere Vertreter der Generation 2 in Baranavičy.
Alter der untersuchten Sprecher im Jahre 2008 Tab. 11
Generation Durchschnitt Standardabw. Minimum–Maximum 0 76,5 7,1 69–87 1 48,8 6,0 39–59 2 24,7 5,9 16–35
Entscheidend ist, dass die Biographie derjenigen untersuchten Sprecher, für die soziale Angaben vorliegen, den in Abschnitt 2.2 beschriebenen Genera-tionen von Sprechern von WRGR entsprechen. Alle Vertreter der Genera-tion 0 sind erst im hohen Alter in die Städte gezogen oder leben nach wie vor dauerhaft auf dem Land. Diejenigen, die zwischen 1945 und 1970 geboren sind, sind (soweit dies bekannt ist) in ländlichen Gebieten geboren und später in die Städte gezogen. Die untersuchten Sprecher, die nach 1970 geboren sind, sind (wiederum soweit dies bekannt ist) in den jeweiligen Städten
ak ba ch mi ra sa sm
192
01
940
1960
198
02
000
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△△
▽
▽
▽
▽
▽
▽
▽
▽▽
▽
▽ ▽
▽
▽
Generation 0
Generation 1
Generation 2
86
geboren oder dort aufgewachsen.72 Da diese biographischen Hintergründe jedoch nicht für alle Sprecher bekannt sind (vgl. Abschnitt 4.2.1), wird im Folgenden von „Generation“ gesprochen, und nicht von „Land-Stadt-Migranten“, „Kindern der Migranten“ oder ähnlichem.
Verteilung der Sprecher nach dem Kriterium der Binnenmigration Tab. 12
Generation Spätmigranten und Dorfbewohner
Land-Stadt-Migranten Städter k.A.
0 6 0 0 0 1 0 12 0 3 2 0 0 11 2 gesamt 6 12 11 5
Tabelle 13 zeigt die Angaben der Sprecher zu ihrer Mutter-, Erst- und Fami-liensprache in ihrer Kindheit:
Angaben zu Muttersprache, Erstsprache und der Sprache der Familie in der Kindheit Tab. 13der untersuchten Sprecher. (* Ein Informant gibt hier außerdem Polnisch an.)
Generation Ru WRGR WRGR +Wr
Wr Wr+Ru k.A.
Muttersprache 0 - 1* - 4 - 1 1 - 3 2 5 2 3 2 1 2 1 5 2 2
Erstsprache 0 - 2 1 2 - 1 1 - 7 - 4* 1 3 2 2 6 - - 3 2
Sprache der Familie in der Kindheit
0 - 4* 1 - - 1 1 - 7 - 4* 1 3 2 - 9 - - 2 2
Es fällt auf, dass bereits in der ältesten Generation drei Sprecher WRGR als eine ihrer Erstsprachen angeben, alle fünf, für die Informationen vorliegen, geben WRGR als eine der Sprachen an, die in ihrer Kindheit in ihrer Familie gesprochen wurde. Auch in der mittleren Generation gibt die Mehrzahl WRGR als Erstsprache und Sprache der Familie an, allerdings auch ein Teil Weißrussisch. In der jüngsten Generation ist WRGR deutlich die häufigste Sprache der Familie, in der Kategorie der Erstsprache tritt auch das Russische hinzu. Insgesamt ist diese Verteilung ähnlich derer, die von KITTEL et al. (2010) für die Gesamtbevölkerung der untersuchten Städte
72 Mit der Ausnahme der weiblichen Sprecherin aus Akcjabrski, die zum Zeitpunkt der Auf-
nahmen erst sechs Jahre in Akcjabrski wohnt. Sie ist aber in Salihorsk geboren, einer Stadt mit ca. 100 000 Einwohnern, also keinesfalls als Land-Stadt-Migrantin zu bezeichnen.
87
ausgemacht wird. Was die Kategorie der Muttersprache angeht, so erreicht in allen Generationen das Weißrussische die höchsten Werte, es sind kaum Unterschiede zwischen den Generationen zu erkennen.
HENTSCHEL & ZELLER (2012) zeigen mithilfe einer Clusteranalyse, dass sich die Sprecher des OK-WRGR anhand ihrer Anteile an (bei Abstraktion von phonischen Merkmalen) ‚weißrussischen‘, ‚russischen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen in vier Sprechertypen einteilen lassen:73
Sprecher mit sowohl einem relativ hohen Anteil an ‚weißrussischen‘ als auch an ‚hybriden‘ Äußerungen, wobei ‚hybride‘ überwiegen (Typ HW);
Sprecher mit einem Übergewicht an ‚hybriden‘ Äußerungen (Typ H); Sprecher mit sowohl einem hohen Anteil an ‚russischen‘ als auch an
‚hybriden‘ Äußerungen (Typ HR); Sprecher mit einem Übergewicht an ‚russischen‘ Äußerungen (Typ R).
Ein möglicher fünfter Typ W, der überwiegend ‚weißrussische‘ Äußerungen zeigen würde, und ggf. ‚hybride‘ und ‚russische‘ nur am Rande, ist im Kor-pus nicht feststellbar (vgl. auch Abschnitt 2.2).
Wie zu erwarten, hat das Kriterium der Binnenmigration einen starken Einfluss darauf, zu welchem Sprechertyp die Informanten gehören: Spät-migranten und Dorfbewohner gehören fast ausschließlich dem Typ HW an, Land-Stadt-Migranten verteilen sich vor allem auf die Typen H und HR, bei den Städtern überwiegt der Typ R vor dem Typ HR (HENTSCHEL & ZELLER
2012, 205–207). Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Sprecher sind bis auf zwei
Ausnahmen eine Teilmenge der in HENTSCHEL & ZELLER (2012) untersuch-ten Sprecher. Tabelle 14 zeigt, wie sie sich auf die Sprechertypen verteilen. Die beiden nicht in HENTSCHEL & ZELLER (2012) berücksichtigten Sprecher erhalten keine Angabe („k.A.“).
73 Wie HENTSCHEL & ZELLER (2014) zeigen, unterscheiden sich diese Sprechertypen auch in
phonetisch-phonologischen Charakteristiken. Als erklärende Variable wird der Sprechertyp in dieser Arbeit zunächst nicht berücksichtigt, da die Zugehörigkeit zu einem Sprechertyp selbst von sozialen Faktoren abhängt, in dem Sinne also keine unabhängige Variable ist. Andererseits ist es natürlich für das Verständnis des sprachlichen Verhaltens von Sprechern der WRGR wichtig, ob Sprecher, die auf den strukturell tieferen Ebenen zu einer Sprache neigen, dies auch phonisch tun. Dies wird in einem zweiten Schritt in Kapitel 10 geprüft.
88
Verteilung der hier untersuchten Sprecher auf Sprechertypen (nach der Klassifizie-Tab. 14rung in HENTSCHEL & ZELLER 2012)
Sprechertyp: Generation
HW H HR R k.A.
0 4 1 0 0 1 1 5 6 4 0 0 2 0 1 4 7 1 gesamt 9 8 8 7 2
Die Verteilung fällt ähnlich wie für die Gesamtmenge der Sprecher aus: Während in der älteren Generation Sprecher des Typs HW überwiegen, treten in der Generation 1 gleichermaßen häufig Sprecher des Typs HW, H und HR auf. Für die Generation 2 ist ein klarer Sprung zum Typ R zu verzeichnen.
Der Vergleich der genannten drei Generationen ist wie gesagt von beson-derer Wichtigkeit, gibt er doch Aufschluss darüber, wie sich die phonische Seite von WRGR entwickelt und ob es zu Verfestigungstendenzen kommt. In einigen Analysen werden, wenn zwischen ihnen keine Unterschiede ersicht-lich sind, die beiden älteren Generationen, die beide weitgehend mit (lexika-lisch sicherlich vom Russischen beeinflussten) weißrussischen Dialekten aufwuchsen, zusammengefasst und mit der Generation 2, den (soweit be-kannt) geborenen Städtern, verglichen. Der Vergleich der Generationen bei Einbeziehung der Affinität der Äußerung steht auch im Mittelpunkt der vergleichenden Analysen in Kapitel 10.
b) Geschlecht Tabelle 15 zeigt die Aufteilung der Geschlechter auf die drei Generationen. Während in den jüngeren Generationen das Verhältnis ausgeglichen ist, konnte in der älteren Generation nur ein männlicher Vertreter ausgewertet werden.74
Verteilung der Geschlechter auf die Generationen Tab. 15
Generation männlich weiblich 0 1 5 1 7 8 2 6 7 gesamt 14 20
74 In der Altersgruppe der über 70-Jährigen finden sich in Belarus mehr als doppelt so viele
Frauen wie Männer (vgl. PN 2009:2, 237).
89
In den bisherigen im Rahmen des Oldenburger Projekts entstandenen Arbei-ten zu Phänomenen auf strukturell tieferen Ebenen finden sich allerdings keine Hinweise auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern.75
c) Dialektaler Hintergrund Wie in Abschnitt 4.3 bereits angedeutet wurde, wird hier davon abgesehen, Stadt als erklärende Variable heranzuziehen, da es sich jeweils um Vertreter nur einer Familie in dieser Stadt handelt (mit der erwähnten Ausnahme von Akcjabrski). Familie wird als Zufallsvariable kontrolliert. Stattdessen wird der dialektale Hintergrund eines Sprechers als erklärende Variable heran-gezogen. Der dialektale Hintergrund wird anhand des derzeitigen Wohnortes bestimmt, es sei denn, dass bekannt ist, dass der betreffende Sprecher seine Kindheit und Jugend in einem anderen Dialektgebiet verbracht hat (wie ge-sagt liegen für einige Sprecher hier keine Angaben vor). Dies ist insbeson-dere für die Sprecher aus Minsk wichtig, die teilweise aus einem anderen Dialektgebiet als dem der Minsker Gegend stammen. Für einen Sprecher aus Akcjabrski sowie für alle Sprecher aus Šarkoŭščyna ist nicht bekannt, wo und damit in welchem Dialektgebiet sie aufgewachsen sind. Für sie wird also das Dialektgebiet von Akcjabrski (d.h. das südwestliche) bzw. das von Šar-koŭščyna (das nordöstliche) angenommen.
Anders als bei den Faktoren Generation und Geschlecht wird die dialek-tale Herkunft je nach Variable unterschiedlich (oder auch gar nicht) einbezo-gen. Sie ist nur sinnvoll, wenn bezüglich der jeweiligen Variable gemäß der einschlägigen Literatur dialektale Unterschiede vorliegen.
Akcjabrski: Die Vertreterin der Generation 0 und der männliche Vertre-ter der Generation 1 stammen aus ländlichen Gebieten in der Nähe von Akcjabrski (dem Kreis Akcjabrski bzw. dem Kreis Petrykaŭ). Für die weibliche Vertreterin der Generation 1 liegen keine Angaben zum Her-kunftsort vor. Die weibliche Vertreterin der Generation 2 stammt aus Salihorsk, einer Stadt mit 100 000 Einwohnern ca. 100 km westlich von Akcjabrski, und lebt seit sechs Jahren in Akcjabrski, der männliche Ver-treter stammt aus Akcjabrski.
Baranavičy: Die Vertreterin der Generation 0 aus Baranavičy stammt aus dem Kreis Navahrudak. Die Vertreter der Generation 1 stammen aus
75 Unter den Informanten bei KITTEL et al. (2010, 61), die Weißrussisch und WRGR als
Muttersprache angeben, finden sich etwas mehr Frauen als Männer. Unter den Informanten, die Russisch als Muttersprache angeben, ist das Verhältnis der Geschlechter ausgeglichen.
90
dem Kreis Hrodna, westlich von Baranavičy. Die Vertreter der Genera-tion 2 sind in Baranavičy geboren und aufgewachsen.
Chocimsk: Die Vertreter der Generation 0 und 1 stammen aus dem Kreis Chocimsk. Die Vertreter der Generation 2 stammen aus Chocimsk.76
Minsk: Im Unterschied zu den Vertretern der anderen Städte stammen die Vertreter in Minsk nicht aus der näheren Umgebung ihres derzeitigen Wohnortes. Die Vertreterin der Generation 0 sowie die Vertreterin der Generation 1 stammen aus dem Kreis Vicebsk, also aus dem nordöstli-chen Dialektgebiet. Der männliche Vertreter der Generation 1 stammt aus dem Kreis Čėrven’, der sich am Übergang zum nordöstlichen Dia-lektgebiet befindet. Die Vertreter der Generation 2 sind in Minsk gebo-ren oder haben dort ihr gesamtes Leben verbracht.
Rahačoŭ: Die Vertreter der Generation 0 sowie der männliche Vertreter der Generation 1 stammen aus dem Kreis Homel’, die weibliche Vertre-terin der Generation 1 aus dem Kreis Mahilëŭ. Die Vertreter der Genera-tion 2 sind in Rahačoŭ geboren.
Šarkoŭščyna: Außer zum Geburtsjahr und zum Geschlecht liegen zu den Sprechern keine Angaben vor. Wie bereits erwähnt, kam es hier zu Problemen mit einem der Exploratoren, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erläutert werden können.
Smarhon’: Die Vertreter der Generation 1 stammen aus ländlichen Ge-bieten des Kreises Smarhon’. Der Vertreter der Generation 2 ist in Smarhon’ geboren.
Tabelle 16 gibt einen Überblick über den dialektalen Hintergrund der Spre-cher in Bezug auf die großen weißrussischen Dialektgebiete. Dies ist nur als Überblick zu verstehen, da wie gesagt die Sprecher hinsichtlich des dialekta-len Hintergrundes je nach Variable unterschiedlich aufgeteilt werden.
76 Der männliche Vertreter der Generation 2 ist in Russland geboren, gibt aber an, sein gesam-
tes Leben am derzeitigen Wohnort, also Chocimsk gelebt zu haben. Seine Nationalität sowie die seiner Eltern ist weißrussisch. Er gibt an, dass in seiner Kindheit in seiner Familie Weißrussisch und Russisch gesprochen wurde.
91
Verteilung des dialektalen Hintergrundes auf die Städte Tab. 16
Nordost Zentral Südwest k.A. Akcjabrski - - 4 1 Baranavičy - - 5 - Chocimsk 5 - - - Minsk 2 3 - - Rahačoŭ 1 5 - - Šarkoŭščyna - - - 4 Smarhonʼ - 3 1 - gesamt 8 11 9 6
d) Die Affinität der Wortform und der Äußerung Der Zusammenhang zwischen erster und zweiter Artikulation im Sinne MARTINETs (1949) in Instanzen gemischter Rede, d.h. der Zusammenhang von phonischen Charakteristika einer sprachlichen Einheit mit deren Affinität auf strukturell tieferen Ebenen ist bisher kaum untersucht worden (vgl. Ab-schnitt 3.1). In dieser Arbeit wird dieser Frage nachgegangen: Es wird also überprüft, ob sich die phonische Seite in morphologisch, morphonologisch lexikalisch und morphosyntaktisch77 ‚weißrussischen‘, ‚russischen‘, ‚hybri-den‘ und ‚gemeinsamen‘ Äußerungen unterscheidet. Die Angaben zur Affi-nität der Äußerung stammen aus dem OK-WRGR.78
Der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen sprachlichen Ebenen in gemischter Rede ist sicherlich aus kontaktlinguistischer Sicht grundsätzlich interessant (siehe Abschnitt 3.1 und 3.2), hier aber auch aus methodisch-praktischen Überlegungen heraus zu beachten. Angesichts des Vorhan-denseins längerer, auf strukturell tieferen Ebenen ‚russischer‘, nicht-gemischter Blöcke in dem zugrunde liegenden Korpus argumentiert HENTSCHEL (2013a, 60–62), dass ein Großteil der Sprecher zwischen den Kodes WRGR und Russisch wählen kann.79 Gerade für Vertreter der Genera-
77 Das morphosyntaktische Kriterium ist bei der Klassifikation von Präpositionen relevant,
vgl. TESCH (2013). 78 Die hier zugrunde liegenden Angaben entsprechen dem Stand August 2012. Danach wur-
den im OK-WRGR noch einige Korrekturgänge vorgenommen, die aber das Gesamtbild nicht verändert haben.
79 Ob eine Äußerung als ‚russisch‘ oder ‚weißrussisch‘ klassifiziert ist, kann von nur einem oder wenigen spezifischen Morphen abhängen (wenn alle anderen Morphe der Äußerung ‚gemeinsam‘ sind, wobei die ‚gemeinsamen‘ Morphe insgesamt die zahlenmäßig größte Klasse im Korpus bilden). Die Klassifizierung als ‚russisch‘ oder ‚weißrussisch‘ kann also teilweise zufällig sein. Mit anderen Worten: Eine ‚russische‘ / ‚weißrussische‘ Äußerung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Sprecher sich gerade im russischen Kode bewegt. Außerdem gibt es unterschiedliche Grade an Hybridität, von stärker ‚russisch‘ orientierten Äußerungen mit gelegentlichen ‚weißrussischen‘ Elementen zu stärker ‚weißrussischen‘
92
tion 2 ist davon auszugehen, dass sie sich über längere Strecken in einem russischen Kode bewegen können. Allgemeine Unterschiede zwischen Ver-tretern unterschiedlicher Generationen bedeuten daher noch nicht, dass sie sich voneinander unterscheiden, wenn sie sich in einem gemischten Kode bewegen. Dementsprechend basiert Hentschel einige seiner Untersuchungen nur auf gemischten, ‚hybriden‘ Äußerungen, mit dem Ziel, die typischen strukturellen Charakteristika der WRGR zu erfassen. Wie in Abschnitt 2.3 bereits erwähnt, zeigt TESCH (2014), dass auf tieferen Ebenen in ‚hybriden‘ Äußerungen kaum Unterschiede zwischen den Sprechergruppen bestehen.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Einfluss der Affinität der Äußerung überprüft. Sollte sich herausstellen, dass Unterschiede bestehen, so wird in einem weiteren Schritt die Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen be-schränkt, um auszuschließen, dass Effekte dadurch zustande kommen, dass Sprecher über längere Passagen in einem monolingual-russischen Kode verweilen. Dies ist dann also als die phonische Seite von WRGR im engeren Sinne zu verstehen.
Zudem wird bei der Analyse nur ‚hybrider‘ Äußerungen auch der Einfluss der Affinität einzelner Wortformen einbezogen. Der Effekt der Affinität der Äußerung und der Wortform wird also nicht gleichzeitig überprüft, da nur in ‚hybriden‘ Äußerungen alle Werte der Affinität der Wortform (‚weißrus-sisch‘, ‚russisch‘, ‚gemeinsam‘ und ‚hybrid‘) möglich sind, in ‚weißrussi-schen‘ Äußerungen per definitionem keine ‚russischen‘ Wortformen möglich sind, und umgekehrt. Auch die Affinität der Wortform wird aus dem OK-WRGR übernommen. Für klitische Formen, die als ‚gemeinsam‘ einzustufen sind (wie die Negationspartikel ne, die Präpositionen na, po, bez, dlja und einige andere) wird die Affinität des Autosemantikons genommen, mit dem die klitische Form ein phonologisches Wort eingeht. In ne nado (≈ ‚nicht nötig, man muss nicht‘) wird die Negationspartikel ne also aufgrund des ‚russischen‘ Modalprädikativums nado als ‚russisch‘ klassifiziert, in dem bedeutungsgleichen ne trėba aufgrund des ‚weißrussischen‘ trėba als ‚weiß-russisch‘. Selbstredend geschieht diese Klassifizierung wie stets, so auch hier unabhängig davon, ob die Partikel auch auf der phonischen Ebene ‚weißrus-sische‘ oder ‚russische‘ Merkmale aufweist, ob die Transkription im OK-WRGR also auf ‚russisches‘ Ikanje (ni) oder ‚weißrussisches‘ Jakanje (nja) hinweist.
Äußerungen mit gelegentlichen ‚russischen‘ Elementen (vgl. HENTSCHEL 2008c). Diese Aspekte und Unterschiede können hier nicht berücksichtigt werden.
93
Eine Bemerkung zu den auf strukturell tieferen Ebenen ‚gemeinsamen‘ Wortformen und Äußerungen: Anders als „das Russische“, „das Weißrussi-sche“ und „das Gemischte“ stellt „das Gemeinsame“ natürlich keinen eige-nen Kode dar, sondern entsteht durch den in einem gewissen Sinne zufälligen Zusammenfall der beiden Sprachen in einem sprachlichen Merkmal. Aus der Sprecherperspektive können ‚gemeinsame‘ Wortformen in einer konkreten, vom Sprecher als „russisch“ oder „weißrussisch“ intendierten Äußerung „rus-sisch“ oder „weißrussisch“ sein. In diesem Fall wäre zu erwarten, dass sich die ‚gemeinsamen‘ Wortformen phonisch nicht anders als die ‚russischen‘ oder ‚weißrussischen‘ verhalten. Gleiches gilt auf der Ebene der Äußerung. (Statt von „gemeinsamen“ Wortformen und vor allem „gemeinsamen“ Äuße-rungen, wäre es also wohl glücklicher, von „unspezifischen“ oder „indiffe-renten“ Äußerungen zu sprechen. In dieser Arbeit, wie in den übrigen im Rahmen des Oldenburger Projekts entstandenen Arbeiten, ist ‚gemeinsam‘ also in diesem Sinne zu lesen.)80
Die hier skizzierte Vorgehensweise, also die phonische Affinität eines Lautes statistisch mithilfe der Affinität der Wortform/Äußerung auf struktu-rell tieferen Ebenen zu erklären, scheint zwei Annahmen vorauszusetzen. Erstens ist dies die Annahme, dass die morphologische (flexionsmorphologi-sche, morphonologische, lexikalische) Affinität einer sprachlichen Einheit ihre phonische Affinität beeinflusst (wie auch KUČERA 1973 und AUER 1997 dies annehmen), und nicht umgekehrt. Dies ist auch das, was die meisten Grammatikmodelle nahelegen würden: Phonologische und phonetische Regeln (oder Module) werden in solchen Modellen in der Regel erst nach lexikalisch-morphologischen Regeln abgearbeitet. Wie AUER (1997, 86) bemerkt, würde dies in unserem Zusammenhang bedeuten, dass ein Sprecher zunächst die morphologische Affinität einer Wortform „entscheidet“, und dann ggf. die phonische.
Zweitens (und dem vorangegangenen Absatz logisch vorausgehend) scheint die Vorgehensweise einen Kausalzusammenhang vorauszusetzen. Dies ist jedoch nicht intendiert. Im Falle eines statistischen Zusammenhangs zwischen der morphologischen und der phonischen Ebene ist nicht grund-sätzlich auf einen Kausalzusammenhang zu schließen (wie natürlich ohnehin nicht die Statistik, sondern das theoretische Modell den Kausalzusammen-
80 Aus diesem Grund eignen sich in den folgenden statistischen Analysen ‚gemeinsame‘
Wortformen / Äußerungen gegen die erste Intuition weniger gut als Referenzwert, mit dem die anderen Typen verglichen werden. Stattdessen werden ‚weißrussische‘ Äußerungen bzw. ‚weißrussische‘ Wortformen als Referenzwert genommen.
94
hang liefert). Vielmehr ist denkbar, dass beide Variablen durch dieselben unabhängigen Variablen beeinflusst werden (etwa durch den Gesprächs-partner). Wie gesagt zeigt HENTSCHEL (2008c), dass Sprecher auch auf strukturell tieferen Ebenen ihre Rede an den Gesprächspartner annähern. Im eigentlichen Sinne ist diese Variable also keine unabhängige, erklärende, sondern eine von den gleichen Faktoren abhängige, die eventuell dadurch mit den phonischen Variablen korreliert.
e) Wortfrequenz Im OK-WRGR sind Wortformen zu Lemmata zusammengefasst. Diese Lemmatisierung erfolgt mit Berücksichtigung der Klassifikation des Stam-mes der Wortform als ‚weißrussisch‘, ‚russisch‘, ‚gemeinsam‘ oder ‚hybrid‘. Wortformen mit ‚russischem‘ Stamm werden einem russischen Lemma zu-geordnet, solche mit ‚weißrussischem‘ einem weißrussischen, solche mit ‚gemeinsamen‘ – da keine Entscheidung zu treffen ist – sowohl einem weiß-russischen als auch einem russischen. Wortformen mit ‚hybriden‘ Stämmen werden fallweise unterschiedlich behandelt. In Einzelfällen können Wort-formen ein und desselben weißrussischen oder russischen Lexems zu unter-schiedlichen Lemmata gehören.81 In der vorliegenden Arbeit wird die Kom-bination aus weißrussischem und russischem Lemma als der Type genom-men, dessen Tokenhäufigkeit als Worthäufigkeit gezählt wird. Die anhand des Gesamtkorpus ermittelte Tokenhäufigkeit wird logarithmiert, um die bekannte ungleichmäßige Verteilung von Lexemen auf Häufigkeitsklassen (wenige Lexeme mit hoher Häufigkeit, viele Lexeme mit geringer Häufig-keit) zu relativieren.
f) Der phonische Kontext und weitere phonische Parameter Aufgrund der Heterogenität der untersuchten phonischen Phänomene sind unterschiedliche Aspekte des lautlichen Kontextes zu berücksichtigen. Daher wird hierauf in den entsprechenden Unterkapiteln eingegangen.
81 Dies lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren: Sowohl in der ‚weißrussischen‘ Wort-
form budze als auch in der ‚russischen‘ Wortform budet ‚sein; 3.Sgl.Präs.‘ ist der Stamm als ‚gemeinsam‘ zu werten, da der Unterschied [budʲ] – [buʣʲ] rein phonisch zu erklären ist (affriziertes [ʣʲ] im Weißrussischen vs. plosives [dʲ] im Russischen). Beide Formen würden also sowohl dem weißrussischen Lemma bycʼ als auch dem russischen Lemma bytʼ ‚sein‘ zugeordnet werden. In den Präteritalformen wr. byŭ – ru. byl ‚sein; Mask.Sgl.Prät‘ ist der Stamm dagegen einmal als ‚weißrussisch‘, einmal als ‚russisch‘ zu werten, da der Unter-schied im Suffix {l} – {u} nicht phonisch zu erklären ist. byŭ würde also nur dem weiß-russischen Lemma, byl nur dem russischen Lemma zugeordnet werden.
95
g) Lexikalische Ausnahmen Für einige Variablen sind lexikalische Ausnahmen zu berücksichtigen. So ist beispielsweise [g] (außer als Positionsvariante von /k/) im Weißrussischen auch in einigen Lehnwörtern möglich. Auch für das weißrussische Jakanje gibt es einige lexikalische Ausnahmen, in denen im Output mit dem russi-schen Ikanje weitgehend übereinstimmendes [i] vorliegt. Solche Einzelfälle werden ebenfalls in den entsprechenden Unterkapiteln behandelt.
h) Interaktionen Es besteht zudem die Möglichkeit, dass der Effekt einer erklärenden Variable unterschiedlich ausfällt, je nachdem, welchen Wert eine andere Variable annimmt, dass Variablen also miteinander interagieren. In der vorliegenden Arbeit werden nicht alle prinzipiell möglichen Interaktionen abgeprüft, sondern nur solche, die aus theoretischen Vorerwägungen oder empirischen Arbeiten zur sprachlichen Variation zu erwarten sind.
Eine Interaktion ist denkbar zwischen dem Faktor Geschlecht und dem Faktor Generation. Wenn angenommen wird, dass Frauen stärker prestige-trächtige Formen benutzen, so ist es möglich, dass Unterschiede zwischen den Geschlechtern nur in einigen Generationen auftreten, bzw. dass sich Generationen nicht grundsätzlich unterscheiden, sondern nur eines der Ge-schlechter einen Unterschied aufweist. Zudem kann sich zwischen den Gene-rationen die Orientierung zu den Sprachen ändern (CHAMBERS & TRUDGILL 1998, 86; DUBOIS & HORVATH 1999). Da unter den Vertretern der Genera-tion 0 nur ein männlicher Sprecher vorhanden ist, wird die Interaktion zwi-schen Geschlecht und Generation nur für Vertreter der Generation 1 und 2 geprüft, Vertreter der Generation 0 werden also vorher ausgeschlossen.
Interessant ist zudem, ob der Einfluss der Affinität der Wortform in den Generationen unterschiedlich ausfällt. So deuten die Ergebnisse aus ZELLER & TESCH (2011) in die Richtung, dass sich die Generationen bei der Realisie-rung von ‚russischen‘ und ‚gemeinsamen‘ Wortformen unterscheiden, nicht jedoch bei der Realisierung von ‚weißrussischen‘ Wortformen.
In den folgenden Analysen werden diese erklärenden Variablen in folgender Reihenfolge schrittweise in die Modelle eingegeben. Nicht-signifikante Faktoren werden aus dem Modell ausgeschlossen.
1. Phonetisch-phonologische Faktoren 2. Lexikalische Faktoren 3. Soziale/sprecherbezogene Faktoren 4. Die Affinität der Äußerung/Wortform
99
5 Variation im Vokalismus
5.1 Einleitung
Im Bereich der betonten Vokale werden allenfalls geringe Unterschiede zwi-schen der weißrussischen und der russischen Standardsprache beschrieben. Auch die weißrussischen Dialekte weisen insgesamt nur wenige Abweichun-gen von der weißrussischen Standardsprache auf. Dem Unterschied in der Realisierung bestimmter unbetonter Vokale zwischen dem Russischen und dem Weißrussischen, dem sogenannten Jakanje und „nicht-reduzierten“ Akanje des Weißrussischen im Vergleich zum russischen Ikanje und „redu-ziertem“ Akanje, wird dagegen in kontrastiven Arbeiten und in Arbeiten zur Orthoepie des Weißrussischen eine prominente Stelle eingeräumt. Der Ein-fluss des einen Systems auf das andere wird in allen phonetisch-phonologi-schen Arbeiten zum Kontakt des Weißrussischen und Russischen behandelt und als besonders augenfällig betrachtet.
Erschwert wird die folgende Analyse des unbetonten Vokalismus in WRGR dadurch, dass die konkrete phonetische Realisierung der Vokale in unbetonten Silben insbesondere im Weißrussischen nicht geklärt ist und sich in der Literatur eher vage Angaben finden, für die zudem oft nicht ersichtlich ist, inwieweit es sich um deskriptive oder präskriptive Aussagen handelt (vgl. SADOŬSKI 1983, RAMZA 2011). Häufiger als für andere Bereiche der Phonik des Weißrussischen werden für den unbetonten Vokalismus Zweifel ge-äußert, dass die orthoepischen Normen des Weißrussischen in der Realität anzutreffen sind (PADLUŽNY 1990, 13). Die weißrussische Orthoepie hat sich in diesem Bereich gegenüber den dialektalen Mustern nie völlig durchgesetzt (was natürlich damit zusammenhängt, dass sich die weißrussische Stan-dardsprache als Umgangssprache nicht durchgesetzt hat), so dass der weiß-russischen Norm entsprechende Realisierungen eher „zufällig“ anzutreffen sind, nämlich bei Sprechern, deren Herkunftsdialekte sich mit dem Muster der Standardsprache decken. Für die Vokale des Russischen liegen akustische Untersuchungen von FANT (1970), JONES (1971), LOBANOV (1971), VERBICKAJA (1976), BONDARKO
100
(1977; 1981), PURCELL (1979), BOLLA (1981), ZLATOUSTOVA (1981), KUZNECOV (1991, 1997), KOUZNETSOV (2002), TIMBERLAKE (2004), PADGETT & TABAIN (2005) und KNIAZEV & SHAULSKIY (2007) vor. Für das Weißrussische, insbesondere den unbetonten Vokalismus, sieht die For-schungssituation schlechter aus. Eher grobe akustische Beschreibungen der Vokale unter Betonung finden sich bei PADLUŽNY (1977, 103), CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988, 65–75) und in der FBLM (1989, 89–92). Einige Einzelbe-obachtungen zum unbetonten Vokalismus finden sich bei LOSIK (1983). Eine systematische Untersuchung ist ANDREEV (1983). Eine Untersuchung zur Realisierung von Vokalen in Jakanje-Positionen in spontaner, nicht-offiziel-ler weißrussischer Rede findet sich bei ZELLER (2013c).
5.2 Methode
Akustische Eigenschaften von Vokalen 5.2.1
Zur akustischen Unterscheidung von Vokalen werden üblicherweise deren Formanten, insbesondere die ersten (d.h. niedrigsten) zwei, F1 und F2, heran-gezogen. Formanten sind die Resonanzfrequenzen des Vokaltrakts, die sich je nach Stellung der Artikulationsorgane, und damit von Vokal zu Vokal, unter-scheiden. Diese Resonanzfrequenzen bewirken Modifikationen im Spektrum der von den Stimmbändern produzierten, periodischen Schallwelle: Vielfache der Grundfrequenz (F0), die im Bereich dieser Resonanzfrequenzen liegen, werden verstärkt, andere gedämpft. Es entsteht ein Spektrum mit charakteris-tischen Gipfeln, wobei die niedrigsten zwei bis vier dieser Gipfel die für die Perzeption des Vokals entscheidenden sind (vgl. z.B. COOPER et al. 1952; PETERSON & BARNEY 1952; UNGEHEUER 1958, 1962; PICKETT 1980, 41–55; KENT & READ 1992, 87–105; JOHNSON 2003, 79–119; LADEFOGED 2003, 104–137).82
Die Frequenzwerte der ersten beiden Formanten F1 und F2 korrelieren mit den artikulatorischen Parametern der Zungenhöhe/Kieferöffnung und der Zungenlage. Die Vokalhöhe korreliert mit dem ersten Formanten: Hohe
82 Zuweilen wird der Begriff „Formant“ mit „Gipfel im Spektrum“ gleichgesetzt. Da diese
Gipfel aber auch von den Frequenzen der Vielfachen abhängen, und damit letztlich von der Grundfrequenz, ist es sinnvoll zwischen beidem zu unterscheiden. Anhand des konkreten Spektrums können mithilfe von Verfahren wie dem Linear Predictive Coding die Reso-nanzfrequenzen, d.h. die Filterfunktion des Vokaltrakts, annäherungsweise ermittelt werden.
101
(geschlossene) Vokale wie [i] und [u] haben einen F1 mit einem niedrigen Frequenzwert, während tiefe (offene) Vokale wie [a] einen hohen F1 auf-weisen. Mittlere Vokalhöhe bedeutet auch einen mittleren F1. Die Lage im Mundraum (vorn oder hinten) korreliert mit dem zweiten Formanten. Hintere Vokale wie [u] haben einen niedrigen F2, für vordere Vokale wie [i] ist ein hoher F2 charakteristisch, für Vokale mittlerer Lage wie [a] oder [ɨ] ein mittlerer F2. Weitere Parameter wie Labialisierung und Nasalisierung haben ebenfalls einen Einfluss auf die Formantenstruktur eines Vokals. Die absolu-ten Werte der Formanten sind dabei individuell in Abhängigkeit von der Physiognomie des Sprechers unterschiedlich.
Die folgenden Abbildungen verdeutlichen den Zusammenhang zwischen den ersten Formanten und den artikulatorischen Parametern. Abgebildet sind die durchschnittlichen Werte einiger Phoneme des Sprechers ra_D in beton-ten Silben, genauer gesagt: einige Allophone dieser Phoneme (deren „Haupt-allophone“, s.u. 5.3.1). „a“, „o“, „u“ bezeichnen in dieser und den folgenden Abbildungen die Phoneme /a/, /o/ und /u/ nach nicht-palatalisierten Konso-nanten oder im Anlaut, „i“ bezeichnet /i/ nach palatalisierten Konsonanten oder im Anlaut, „je“ bezeichnet /e/ nach palatalisierten Konsonanten. Abbil-dung 3 zeigt den durchschnittlichen Verlauf der ersten beiden Formanten über die Dauer des Vokals, Abbildung 4 die durchschnittlichen Formantwerte in der zeitlichen Mitte des Vokals sowie die Bereiche, in die eine Einzel-realisierung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% fällt. Die Achsen sind in Abbildung 4 so gewählt, dass der Zusammenhang zur artikulatorischen Be-schreibung deutlich wird, d.h. F1 ist auf der y-Achse in absteigender Skalie-rung abgetragen, F2 auf der x-Achse in absteigender Skalierung. Solche F2/F1-Plots werden auch in den späteren Analysen verwendet.
102
Verlauf der durchschnittlichen ersten beiden Formanten (in Hertz) einiger betonter Abb. 3
Vokalallophone des Sprechers ra_D
Durchschnittliche Formantwerte des Sprechers ra_D in der zeitlichen Mitte des Abb. 4
Vokals und Vertrauensellipsen, in die eine Einzelrealisierung mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit fällt
50
010
0020
00 i
500
1000
2000 je
500
1000
2000 a
500
1000
2000 o
50
010
0020
00 u
je
i
a
uo
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
103
Die Quantifizierung von Vokalunterschieden mithilfe ihrer Formanten stellt natürlich eine Reduktion der spektralen Information dar, wird aber durch die Wichtigkeit der Frequenzwerte der Formanten, vor allem der ersten beiden, bei der Perzeption gerechtfertigt.83 Problematisch wird diese Methodik bei komplexeren Vokalinventaren, in denen weitere Parameter wie Nasalität und Labialität eine Rolle spielen. Hier reichen die ersten zwei Formanten zur Unterscheidung von perzeptiv und artikulatorisch unterschiedlichen Vokalen oft nicht aus. Zudem sind auch in einfachen Vokalsystemen weitere spektrale Parameter (das Verhältnis zur Grundfrequenz F0) für die Perzeption von Vokalen wichtig. Die Quantifizierung von lautlicher Variation mithilfe der ersten beiden Formanten hat sich aber seit der Arbeit von LABOV, YAEGER & STEINER (1972) in diversen Studien zu Sprachwandel und sprachlicher Vari-ation als nutzbringend erwiesen.
Auswahl, Segmentierung und Erhebung der Messwerte 5.2.2
Die in der vorliegenden Untersuchung analysierten Vokaltoken wurden mit-hilfe des Programms Praat manuell segmentiert und wie in Abschnitt 4.2.5 beschrieben annotiert. Im Falle von vorangehenden stimmlosen Konsonanten wurde der Anfang der periodischen Phase als Ausgangspunkt gewählt, ge-nauer gesagt das erste positive Kreuzen des Oszillogramms mit der Nulllinie zu Beginn der periodischen Phase. Nach stimmhaften Elementen wurden Änderungen im Spektrogramm, in der Wellenform und der Anstieg der Amplitude als Kriterien benutzt. Als Endpunkt wurde die letzte den vorange-henden Perioden ähnliche Periode bzw. der Anfang einer nichtperiodischen Phase gewählt. Vokal-Approximant-Sequenzen und Vokal-Vokal-Sequenzen wurden aufgrund der Schwierigkeit der Segmentierung nicht ausgewertet. Approximant-Vokal-Sequenzen (hier: /jV/) wurden dagegen ausgewertet, da sie ein häufiger Typ der Jakanje-Position sind, bei deren Ausschluss für einige Sprecher nicht genügend Token zur Verfügung gestanden hätten. Der Moment, in dem der zweite Formant zu fallen beginnt, wurde als Start des vokalischen Elements gewertet.
Aufgrund schnellen Sprechtempos und der mangelnden Qualität einiger Aufnahmen konnten dennoch bei weitem nicht alle Vokalrealisierungen eines gegebenen Sprechers ausgewertet werden. Fälle, in denen keine klare For-
83 Andere Charakteristika, d.h. Amplitude und Bandbreite der Formanten spielen eine unter-
geordnete Rolle (KLATT 1982).
104
mantenstruktur erkennbar war, wurden nicht ausgewertet. Oft fiel der in Fra-ge kommende Vokal ganz aus. Dies wurde hier nicht quantitativ ausgewertet.
Die Formanten wurden in Praat mithilfe des Linear Predictive Coding-Algorithmus von Burg bestimmt (vgl. ANDERSEN 1978; JOHNSON 2003, 40–44 und 97–100). Alle Werte wurden in der zeitlichen Mitte des Vokals ge-messen. Linear Predictive Coding (LPC) berechnet eine vorgegebene Anzahl an Koeffizienten, die für einen ebenfalls vorzugebenden Frequenzbereich einen Filter definieren, der der Filterfunktion des Vokaltraktes nahekommt. Die Anzahl der Koeffizienten bestimmt die Anzahl der zu findenden For-manten. Dementsprechend hat die Anzahl der vorgegebenen Koeffizienten und der angegebene Frequenzbereich Einfluss auf die ermittelten Frequenzen der Formanten. Als Default wurden zehn Koeffizienten (was fünf zu ermit-telnden Formanten entspricht) im Bereich bis 5000 Hz bei männlichen Informanten, bis 5500 Hz bei weiblichen Informanten ermittelt. Für eine Sprecherin, für die die Ergebnisse nicht der visuellen Inspektion entsprachen, wurden elf Koeffizienten ermittelt. Die Länge des Analysefensters, anhand dessen die Berechnung der Formanten zu einem gegebenen Zeitpunkt im Sprachsignal erfolgt, betrug 0,025 Sekunden. Eine Präemphase ab 50 Hz wurde vorgenommen, Frequenzen über 50 Hz wurden also verstärkt.
Praat bietet anders als andere Programme nicht die Möglichkeit, fehlbe-stimmte Formanten manuell zu korrigieren. Aus diesem Grund mussten die Formanteneinstellungen in einigen Fällen angepasst werden: Wenn in den Default-Einstellungen die ermittelten Werte nicht der visuellen Inspektion des Spektrums entsprachen, keine klare Formantenstruktur erkennbar war oder einzelne Ausreißer im Verlauf des Formanten auftauchten, wurde die Anzahl der zu ermittelnden Koeffizienten um eins, in seltenen Fällen um zwei erhöht oder erniedrigt. Wenn auch dann keine klare Formantenstruktur erkennbar war und/oder nicht dem Spektrum entsprechende Werte ermittelt wurden, wurden die Laute nicht in die Analyse aufgenommen. Insgesamt wurden in der vorliegenden Untersuchung ca. 17 000 Vokaltoken analysiert.
Normalisierung 5.2.3
Ein Problem für variationistische Arbeiten ist, dass die Formantwerte ver-schiedener Sprecher sich allein aufgrund rein physiognomischer Unter-schiede unterscheiden, insbesondere aufgrund der Länge des Vokaltrakts. Zudem sind diese sprecherbedingten Unterschiede nicht uniform, sondern fallen für einige Vokale stärker aus als für andere (FANT 1970; GORDON 2007, 25). Erst nach einer von physiognomisch bedingten Unterschieden
105
abstrahierenden Normalisierung können daher die Werte verschiedener Spre-cher verglichen bzw. statistisch analysiert werden. In dieser Arbeit wird ein Verfahren zur Normalisierung der Daten angewendet, das auf dem von LOBANOV (1971) vorgeschlagenen Verfahren, abgebildet in der Formel Fi
N = (Fi – Mi) / σi, beruht. Fi
N steht für den normalisierten Formanten, Fi ist der absolute Messwert des Formanten. i gibt an, um welchen Formanten es sich handelt (F1, F2 usw.). Die von Lobanov vorgeschlagene Formel (in der Sta-tistik auch als z-Transformation bekannt) rechnet die ersten beiden Momente, d.h. den Mittelwert M und die Standardabweichung σ aus der Verteilung der absoluten Formantwerte heraus: Von den Formantwerten jeder Vokalrealisie-rung eines Sprechers werden die entsprechenden Durchschnittsformanten aller Vokaltoken des Sprechers subtrahiert und anschließend durch die Standardabweichungen der Formanten aller Vokaltoken geteilt. Die Vertei-lung des transformierten Formanten hat einen Mittelwert von Null und eine Standardabweichung von Eins. Die Einheit der Verteilung ist die Stan-dardabweichung vom Mittelwert in der Ausgangsverteilung: Ein Wert von 2 für den transformierten ersten Formanten eines gegebenen Vokals bedeutet also, dass der absolute Wert zwei Standardabweichungen vom Mittelwert abweicht.
Variation zwischen Sprechern kann auf diese Weise stark reduziert wer-den (vgl. LOBANOV 1971, HARRINGTON 2010). Das Verfahren hat zudem den Vorteil, dass es lediglich die Werte der Formanten benötigt, die normalisiert werden, und nicht wie andere Verfahren weitere, höhere Formanten. Auf-grund der Qualität einiger Aufnahmen sind diese höheren Formanten in dem hier verwendeten Material oft nur sehr schwach erkennbar.
Für variationistische Studien hat das Lobanov-Verfahren allerdings den Nachteil, dass eventuelle sprachkontaktbedingte, nicht-anatomisch bedingte Sprecherunterschiede, die für die Untersuchung von Interesse sind, ebenfalls in die Werte, anhand derer normalisiert wird, einfließen. Hier wird daher eine modifizierte Variante dieses Verfahrens angewendet. Für die vorliegende Untersuchung bietet sich an, die Werte, anhand derer normalisiert wird (d.h. Mittelwert und Standardabweichung der Verteilung), nicht auf der Basis aller Vokale zu berechnen, sondern nur auf der Basis von solchen, für die keine Unterschiede zwischen den Kontaktvarietäten beschrieben sind, für die also keine kontaktbedingte Variation zu erwarten ist. Dies sind grundsätzlich die betonten Vokale. Da /a/, /o/ und /u/ nach palatalisierten Konsonanten und /i/ und /e/ nach nicht-palatalisierten stark variieren bzw. keinen stationären Teil aufweisen und/oder auch vergleichsweise selten auftreten, so dass oft keine
106
ausreichende Anzahl analysiert werden konnte, werden nur Realisierungen von /a/, /o/ und /u/ nach nicht-palatalisierten, von /i/ und /e/ nach palatalisier-ten Konsonanten herangezogen. Obwohl darauf geachtet wurde, dass für jeden Sprecher jedes dieser Allophone ausreichend häufig vertreten ist, sind sie bei einzelnen Sprechern unterschiedlich häufig vertreten. Um einen Effekt einer unterschiedlichen Anzahl an Token zu vermeiden, die die Mittelwerte eines gegebenen Sprechers in die eine oder andere Richtung ziehen könnten, wird nicht der Mittelwert und die Standardabweichung der Gesamtmenge der Phone eines Sprechers, sondern der Mittelwert und die Standardabweichung der Mittelwerte der Vokalkategorien pro Sprecher berechnet (jede Vokal-kategorie hat also den gleichen Einfluss auf Mittelwert und Standard-abweichung). Es wird also für jeden Sprecher jeweils der Mittelwert für /i/ Cj_, /e/ Cj_, /a/ C0_, /o/ C0_ und /u/ C0_ berechnet. Anschließend wird der Gesamtmittelwert dieser Mittelwerte sowie die Standardabweichung der Mittelwerte vom Gesamtmittelwert ermittelt. Von den Formantwerten jedes Phons des Sprechers wird der Gesamtmittelwert abgezogen, das Ergebnis durch die Standardabweichung der Mittelwerte dividiert. Diese hier verwen-dete, abgewandelte Version der Normalisierungsprozedur von LOBANOV (1971) lässt sich wie folgt darstellen: Fi
N = (Fi – MiGesamt) / σi
Gesamt. Betrachten wir nun den Effekt der Normalisierung: Abbildung 5 zeigt die
mittleren Formantwerte der genannten Vokalallophone aller untersuchten Sprecher vor und nach der Normalisierung.
Durchschnittliche absolute (links) und normalisierte (rechts) Formantwerte der Abb. 5
betonten Vokale der 33 untersuchten Sprecher
a
aa
aaa
a
aa
a
a
aa
a
a
a
aa
a
aa
a
aa
aa
a
aa
a
aa
a
jeje
je jejeje
je
jejeje
je
jeje
je
jeje
jeje
je
jejeje
jejejeje
je jejeje
jeje
je
i
ii ii
i iii
ii
ii
i
i ii
ii
ii
ii
iii
iii ii
i o
ooo
oo
ooo
oo
oo
o
oo
oo
oooooooo
oooooo
o
uuu
uuuu
uu
u uuu
uuu
uu uuuu
uuuu
uuuuuu
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa a
aa
jejeje jejejeje
jeje
jeje
jejejejejejejejejeje jejejejejejejejejejeje
je
ii iiiiiiiii ii iiiii
iii
i iiiiiii
ii i
oooooooo
ooo
oooooooooo
oooo ooo
ooooo
uuuuuuuuuuuuuuuuuu
uu
uuuuuu uuuuuu
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1
(Lob
ano
v-n
orm
alis
iert
)
107
Die hier benutzte, modifizierte Lobanov-Normalisierung nimmt also einen guten Teil der sprecherbedingten Variation aus den Daten und macht dadurch die Werte anderer, kontaktbedingt variierender Vokale einzelner Sprecher miteinander vergleichbar. Anders als in ihrer nicht-normalisierten Form sind die Vokalkategorien klar voneinander getrennt. Eine gewisse Variation bleibt allerdings in den Daten.
5.3 Betonte Vokale
Hintergrund 5.3.1
Was betonte Vokale angeht, so bestehen phonologisch keine Unterschiede zwischen beiden Standardsprachen.84 Beide Sprachen haben phonologisch ein relativ kleines Vokalinventar. Es werden in der Regel die Vokalphoneme /i, e, a, o, u/ angenommen.85 Auch in Bezug auf die phonetische Realisation werden allenfalls geringe Unterschiede zwischen beiden Standardsprachen angenommen (PADLUŽNY & ČĖKMAN 1973; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988).
In Abhängigkeit von der Palatalität der umgebenden Konsonanten, vor allem des voranstehenden, werden diese Vokalphoneme teils leicht, teils
84 Vgl. hierzu und zum Folgenden AVANESOV (1956); BONDARKO (1981); TIMBERLAKE
(2004); KASATKIN (2009a) für das Standardrussische, PADLUŽNY (1969); KRYVICKI &
PADLUŽNY (1984); PADLUŽNY (1984); BIRYLA & ŠUBA (1985); CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988); FBLM (1989); BM (2004) für das Standardweißrussische.
85 Für die mittelhohen Vokalphoneme werden oft die Zeichen <ɛ> und <ɔ> benutzt. Auf der Phonemebene wird in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet, die phonetische Realisie-rung möglichst genau darzustellen (zumal sich die Realisierung dieser Phoneme in unter-schiedlichen Kontexten recht stark unterscheiden kann). In der sogenannten Leningrader / Petersburger und der Kazaner Schule werden abweichend hiervon [i] und [ɨ], die in beiden Sprachen in der Regel graphemisch unterschieden werden, nicht als Allophone eines Pho-nems, sondern als eigenständige Phoneme unterschieden (vgl. TIMBERLAKE 2004, 40–41). Für das Weißrussische wird eine analoge Position von JANKOŬSKI (1976, 136) vertreten. Begründet wird diese Position damit, dass [ɨ] bei Muttersprachlern als Lautintention existiert (im Sinne der Natürlichen Phonologie, vgl. NATHAN & DONEGAN i.Dr.) und von Muttersprachlern ohne Schwierigkeit in Isolation artikuliert werden kann. Zudem existieren metasprachliche Wörter wie wr. ykac’ ‚[ɨ] sagen‘, die mit ebenso metasprachlichen Wörtern wie ikac’ Minimalpaare bilden. Aufgrund der sonstigen komplementären Distribution mit [i] ([i] steht nach palatalisierten Konsonanten und im Anlaut, [ɨ] nach nicht-palatalisierten) werden [i] und [ɨ] ansonsten als Allophone eines Phonems, das normalerweise mit „/i/“ bezeichnet wird, angesehen (vgl. für das Russische PANOV 1979, 150; AVANESOV 1956, 88; KASATKIN 2009a, 107; für das Weißrussische KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 109–111; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 208f.). Hier wird letztere Position vertreten, wobei dies für die Analyse unwesentlich ist.
108
stark unterschiedlich realisiert.86 Benachbarte palatalisierte Konsonanten äußern sich in [i]-ähnlichen Formanten in der Exkursion bzw. Rekursion des Vokals, und teilweise in Unterschieden in der Haltephase des Vokals im Vergleich zu nicht-palatalisierten Kontexten. Für das Russische wird beobachtet, dass /o/ und /u/ im Kontext von palatalisierten Konsonanten nach vorn verlagert werden, wobei bei besonders aufmerksamer Aussprache diese Bewegung allerdings schwach sein oder ganz ausbleiben kann. Auch für /a/ und /e/ bestehen Unterschiede in den unterschiedlichen Kontexten, mit höherer (dies vor allem bei /e/) und vorderer Artikulation und dementspre-chenden Formantwerten im Kontext von palatalisierten Konsonanten, wobei der phonetische Bereich für /a/ mit [a] - [æ] anzunehmen ist, für /e/ im Bereich [ɛ] - [e] (vgl. AVANESOV 1956, 88–105; JONES 1971; LOBANOV 1971; PANOV 1979, 149–153; ZINDER 1979, 206; BOLLA 1981; KOUZNETSOV 2001; TIMBERLAKE 2004, 29–40). Für das Weißrussische wird dagegen oft nur für /e/ und /a/ ein „bedeutender“ Unterschied festgestellt, während /o/ und vor allem /u/ mehr oder weniger konstant blieben (vgl. KRYVICKI &
PADLUŽNY 1984, 25–27, 88; PADLUŽNY 1984, 26f.; BIRYLA & ŠUBA 1985, 41f.; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 71 und 149; FBLM 1989, 39f., 87; BM 2004, 15). Die Daten von ZELLER (i.Vorb.), die wie im Russischen ein klares Verlagern von /u/ nach palatalisierten Konsonanten nach vorn zeigen, ziehen diese Beobachtung aber in Zweifel. Bei /i/ bedeutet der Einfluss benachbarter palatalisierter Konsonanten dementsprechend einen stabilen Formanten-verlauf, während das Allophon nach nicht-palatalisierten Konsonanten, das hohe zentrale [ɨ], einen diphthongoiden Charakter mit einem kontinuierlich steigenden F2 bei einem stabilen, mit [i] identischen F1 hat.
Für die meisten Vokalphoneme sowie deren Allophone wird wie gesagt explizit festgestellt, dass sich das Weißrussische in deren Realisierung nicht vom Russischen unterscheide. Ausnahmen sind folgende: Für das Weißrussi-sche wird für das Allophon von /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten ([ɨ]) zuweilen eine im Vergleich zum Russischen hintere Artikulation ange-
86 Es wird in der Beschreibung dieser Allophonie oft davon ausgegangen, dass die Realisie-
rung im Anlaut bzw. in Isolation die grundlegende Variante eines Phonems ist. Was /e/ angeht, so wird über die grundlegende Variante debattiert, da /e/ im Anlaut selten ist. Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Realisierungen des Phonems /i/ ein. Im Anlaut werden die Vokale /a, e, o, u/ wie nach nicht-palatalisierten Konsonanten realisiert, /i/ wie nach palatalisierten. In der vorliegenden Arbeit wird gelegentlich vorwissenschaftlich der Begriff „Hauptallophone“ für die Allophone von /a, o, u/ im Anlaut und nach nicht-palatalisierten Konsonanten, von /e/ nach palatalisierten Konsonanten und von /i/ im Anlaut und nach palatalisierten Konsonanten gebraucht.
109
nommen. Darauf wird unten eingegangen. Einige Autoren geben außerdem an, dass /e/ im Anlaut und nach nicht-palatalisierten Konsonanten im Russi-schen geschlossener ausgesprochen werde, im Weißrussischen dagegen mit einer beträchtlichen Kieferöffnung (vgl. PADLUŽNY & ČĖKMAN 1973, 232–238; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 74). Von SADOŬSKI (1982, 196f.) wird diese Aussage auf die Position vor palatalisierten Konsonanten beschränkt. Wir gehen hierauf in dieser Arbeit aus praktischen Gründen nicht ein. In Frage kommende Fälle liegen in den Daten vor allem in dem Demonstrativ-pronomen wr. hėty / ru. ėtot ‚dieser‘ vor. Dies ist jedoch oft stark reduziert und mit dem vokalischen Auslaut vorangehender Wortformen kontrahiert, so dass nicht genügend Daten erhoben werden konnten.
Ebenso wenig bestehen zwischen der Mehrzahl der weißrussischen Dia-lekte und der Standardsprache Unterschiede hinsichtlich der betonten Vokale, sowohl was die phonologische, als auch was die phonetische Seite betrifft. Die Ausnahme sind die südwestlichen Dialekte, in denen zwei Reihen von Vokalen mittlerer Zungenhöhe auftreten: In südwestlichen weißrussischen Dialekten treten als Reflex von |ě| und in geschlossenen Silben, sofern der Vokal nicht auf die historischen Kurzvokale |ь| und |ъ| (die sogenannten Jer-Laute) zurückgeht, stärker geschlossene Vokale auf als in den übrigen Dia-lekten und der Standardsprache (in der belorussistischen Tradition transkri-biert als [ê] und [ô]). Der Grad der Geschlossenheit variiert territorial und kann an [i] bzw. [u] heranreichen, auch Diphthonge sind möglich. (vgl. DABM 1963a, Karten 34 und 35; NPBD 1964, 20–24 und 35–39; BIRYLA & ŠUBA 1985, 41; FBLM 1989, 318; KRYVICKI 2003, 163–165). Die übrigen Entsprechungen von wr./ru. /e/ und /o/ unterscheiden sich in den Dialekten nicht von den Standardsprachen. Allerdings ist dieses Merkmal bereits spä-testens zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jh. auf dem Rückzug: In einigen dieser Dialekte ist ein hohes Maß an Variation mit [ɛ] und [ɔ] zu beobachten, wobei in einigen Fällen in der jüngeren Generation die nicht-geschlossenen Varianten überwiegen (NPBD 1964, 21–22 u. 36). Oft ist die Verteilung lexikalisch gesteuert, die geschlossenen Varianten finden sich in der „tradi-tionellen“ („ŭ leksicy tradycjnaj“), die offeneren in der „neuen“ Lexik („ŭ leksicy novaj“, NPBM 1964, 36). BIRYLA & ŠUBA (1985, 41) beobachten, dass diese dialektalen Züge beim Übergang zur weißrussischen Stan-dardsprache in der Regel schnell aufgegeben werden, sich bei einigen Spre-chern aber hielten. In Sadoŭskis Daten aus Minsk verschwinden [ê] und [ô] in der russischen Rede ehemaliger Dialektsprecher ebenfalls schnell, und
110
zwar nicht nur in ihrer russischen Rede, sondern auch bei der Kommuni-kation mit den dialektsprachigen Eltern (SADOŬSKI 1982, 198).87
Von den sieben untersuchten Städten fallen nur Baranavičy und Akcjabrski in das Gebiet, für das geschlossene mittlere Vokale charakteris-tisch sind, wobei in diesen Gebieten das Merkmal nicht durchgängig auftritt (DABM 1963a, Karten 34 und 35). In den dieser Arbeit zugrunde liegenden Daten findet sich allerdings kein Hinweis darauf, dass dieses Merkmal von Relevanz ist, so dass im Folgenden nicht weiter darauf eingegangen wird.
Einige allgemeine Beobachtungen zum betonten Vokalismus in 5.3.2WRGR
Zunächst seien einige allgemeine Beobachtungen angestellt, die nicht direkt den Kontakt der beiden Systeme betreffen, aber für die Interpretation der weiteren Ergebnisse wichtig sind. Dies sind erstens der akustisch relativ kleine Vokalraum der Sprecher und damit verbunden die phonetische Über-lappung benachbarter Vokalkategorien und zweitens der Einfluss der Palata-lisiertheit des vorhergehenden Konsonanten auf die Vokalrealisierung.
Analyse 1 – Die Größe des Vokalraums: Zunächst sei auf die Größe des Vokalraums eingegangen. Die folgende Abbildung zeigt die Gesamtmittel-werte der Hauptallophone von Männern und Frauen in WRGR in betonter Position88 sowie als Vergleich die Angaben zum Weißrussischen bei PADLUŽNY (1977, 103) und zum Russischen bei BOLLA (1981). Diese Ver-gleichswerte sind experimentell gewonnene Daten.
87 JANKOŬSKI (1976, 22) lässt das geschlossene [ô] als normhaft zu, während die FBLM
(1989, 318) und PADLUŽNY (1990, 7) die geschlossenen Vokale [ê] und [ô] als dialektal und nicht standardsprachlich einstufen.
88 Im Anhang finden sich die Durchschnittswerte aller Sprecher.
111
Gesamtmittelwerte der Hauptallophone betonter Vokale in WRGR im Vergleich zu Abb. 6
experimentellen Daten zum Russischen und Weißrussischen
Insbesondere für männliche Sprecher, aber auch für die weiblichen Informan-ten ist im Vergleich zu den experimentell gewonnenen Daten ein recht klei-ner Vokalraum zu verzeichnen.89
89 Da die Frage der allgemeinen phonetischen Reduktion von Vokalen in spontaner Rede
nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, wird hier auf elaboriertere Verfahren zur Quantifi-zierung des Vokalraums (etwa anhand der euklidischen Distanz zwischen Vokalkategorien, vgl. HARRINGTON 2010, 196–198) verzichtet.
a
e
i
o
u
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
WR (Padlužny 1977)
F2 (Hz)
F1(H
z)
a
je
i
o
u
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
RU (Bolla 1981)
F2 (Hz)
F1(H
z)
a
je
i
o
u
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
WRGR (Männer)
F2 (Hz)
F1(H
z)
a
je
i
o
u
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
WRGR (Frauen)
F2 (Hz)
F1(H
z)
112
Analyse 2 – Überlappung der Vokalkategorien: Wie darüber hinaus in Abbil-dung 7 sichtbar ist, zeigt sich für die Sprecherin (die hier beispielhaft für die anderen Sprecher steht) eine große Überlappung benachbarter Vokalkatego-rien, selbst wenn nur die „Hauptallophone“ berücksichtigt werden. In dieser Abbildung sind die Formantwerte der einzelnen Vokaltoken abgebildet. Darüber hinaus sind Konfidenzellipsen angezeigt. Diese zeigen den Bereich, in den ein Laut des Sprechers mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% fällt.
Realisierungen betonter Vokale der Informantin ak_D Abb. 7
Auch wenn diese Variation zu einem Teil mit Sicherheit auch auf Mess-ungenauigkeiten zurückzuführen ist, die durch die Qualität der Aufnahmen bedingt sind, ist anzunehmen, dass eine solche phonetische Überlappung der Vokalkategorien charakteristisch für natürliche, zusammenhängende Rede ist (HARRINGTON 2010, 173). Für alle Vokalkategorien zeigen sich auch sehr zentrale Realisierungen. Dies ist auf natürliche Lenitionsprozesse zurück-zuführen, die in zusammenhängender, v.a. spontaner, nicht-offizieller Rede stark greifen. Ähnliche Überlappungen der Vokalkategorien, also eine hohe Variation in den Realisierungen, und reduzierte Realisierungen sind auch in spontaner russischer Rede anzutreffen (FSR 1988, 56–67). KUZNECOV (1991, 1997) und BONDARKO (1981) beobachten ähnliches für das Russische bereits beim Vorlesen eines Textes, also bei nicht-spontaner Rede.
oo
o
ooo
o
ooo
oo
o
o oo o
ooo
oo
oo
oo
o
o oo
ooo
oo o
oooo
oojeje
je
je jeje
je
je
jeje
jeje je
jeje
jeje
je
je jeje
je
jeje
je
je
je
je
je
je
je
jei
i iii
i
i
i
i
i
i
ii
i
i
ii
ii
i
i
iii
i
i
aa
a
aaa
a
a
aa
a
a
a
a
a
a
a
aa
a
aa
aa
aa
a
a
a
a
a
a
aa
aaa
a
a
a
a
uu u
uu
uu
u
2500 2000 1500 1000 500
100
08
006
0040
020
0
F2 (Hz)
F1
(Hz)
113
Analyse 3 – Einfluss der Palatalisiertheit: Schließlich sei auf den Einfluss der Palatalisiertheit des vorangehenden Konsonanten eingegangen. Abbildung 8 zeigt die Vertrauensellipsen der Mittelwerte der Sprecher für alle betonten normalisierten Vokalphoneme. Unterschieden wird zwischen der Position nach nicht-palatalisierten und nach palatalisierten Konsonanten (letztere symbolisiert durch das „j“, im Falle von /i/ steht „i“ für die Varianten nach palatalisierten Konsonanten, „y“ für die Variante nach nicht-palatalisierten, in Anlehnung an die wissenschaftliche Transliteration).90 Es ist ein klarer Einfluss des Kontextes zu erkennen: Hintere und vordere Vokale sind nach palatalisierten Konsonanten nach vorn verlagert, vor allem bei /a/ ist außerdem eine Anhebung zu erkennen. Für /o/ nach palatalisierten Konsonanten wurden allerdings wenig Token gemessen, da dieses Allophon nicht im Skopus der Untersuchung steht, und auch nicht für die Normalisierung herangezogen wird (vgl. Abschnitt 5.2.3). In die Abbildung unten gehen für /o/ /Cʲ_ nur Sprecher ein, für die mehr als 5 Token gemessen wurden. Gleiches gilt für /e/ im Anlaut und nach nicht-palatalisierten Konsonanten. /u/ nach palatalisierten Konsonanten ist für die vorliegende Untersuchung ebenfalls irrelevant, es wurden nur sehr wenig Token „en passant“ segmentiert, so dass dieses Allophon nicht gezeigt wird.
90 Anders als in Abbildung 7 zeigen die Ellipsen also nicht den Bereich an, in den ein Laut
mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit fällt, sondern den Bereich, in den der Mittelwert eines Sprechers mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit fällt.
114
Durchschnittliche normalisierte betonte Vokale aller Sprecher Abb. 8
Abbildung 9 zeigt die einzelnen Realisierungen von betontem /a/ des Spre-chers sm_A nach palatalisierten Konsonanten. Im Hintergrund sind als Ver-gleich die Vertrauensellipsen für betontes /i/ Cʲ_, /e/ Cʲ_ und /a/ C0_ abgebil-det. Es zeigt sich, dass für einzelne Token der Einfluss der Palatalität be-nachbarter Konsonanten noch stärker ausfällt, als es die Mittelwerte in Ab-bildung 8 andeuten. Dies gilt insbesondere für grammatische Wörter wie ja ‚ich‘ oder jak ‚wie; als‘. Aber auch lexikalische Wörter (pjatnica ‚Freitag‘, akcjabr ‚Oktober‘) zeigen ein starkes Anheben von /a/ in Richtung des be-tonten /e/ Cʲ_.
a
ja
eje
yi
o
u
jo
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1
(Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
115
Realisierungen von /a/ /Cʲ_ von Sprecher sm_A Abb. 9
Ein ähnliches Anheben wird für /a/ auch bei PADLUŽNY (1983, 86) sowie von ZELLER (2013c) für spontane, schnelle Rede von Sprechern des weißrussi-schen Standards und von KUZNECOV (1991; 1997, 78–94 und 168–172) auch für das Russische festgestellt. Da keine kontaktbedingte Variation anzuneh-men ist, handelt sich also um eine Akkommodation an die Palatalität des vorangehenden Konsonanten, mithin um einen natürlichen Lenitionsprozess, der in spontaner Rede und vor allem bei grammatischen Wörtern, die erstens frequent und zweitens i.d.R. pragmatisch von eher geringem Informations-gehalt sind, stark greift.
a
je
i
3000 2500 2000 1500 1000
1000
800
600
400
200
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
ja
ja
ja
ja
ja
ja
jaja
ja
s'vj*ata
jak
jak
jak
jak
Tryl'j*azh
ja_zhAkc*jabar
akcj*abr
cj*anja
rj*adam
pj*atnicu
klj*apa
zajevlj*ac'sastaj*an'ni
dnja
3000 2500 2000 1500 1000
1000
800
600
400
200
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
116
Zusammenfassung: Festzuhalten ist, dass – wie nicht anders zu erwarten – die hier gemessenen Formantwerte betonter Vokale Merkmale spontaner Rede aufweisen, d.h. phonetische Reduktion und hohe Variation in der Realisie-rung, die sich in einem kleinen Vokalraum, der starken Überlappung benach-barter Vokalkategorien und dem Einfluss vorhergehender palatalisierter Konsonanten zeigen. Solch nicht kontaktbedingte Variation gilt es in den folgenden Analysen der kontaktbedingten Variation zu berücksichtigen.
Im Folgenden soll ein Beispiel möglicher kontaktbedingter Variation im Bereich betonter Vokale untersucht werden. Anhand dieses Beispiels wird das statistische Analyseverfahren, das in Abschnitt 4.3 vorgestellt wurde, exemplifiziert.
Eine exemplarische Analyse anhand der Variation von betontem /i/ 5.3.3nach nicht-palatalisierten Konsonanten in WRGR
Für /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten (also [ɨ]) werden selten Unter-schiede zwischen den beiden Sprachen festgestellt. Dialektal sind im Weiß-russischen im Kontext von Labialen zwar [u]-artige Realisierungen möglich (NPBD 1964, 40). Für die Standardsprache bemerken jedoch lediglich PADLUŽNY & ČĖKMAN (1973, 226), dass dieser Laut im Weißrussischen etwas weiter hinten im Mundraum artikuliert werden kann, also stärker in Richtung [u] bzw. [ɯ] geht. Er sei im Wesentlichen aber sehr ähnlich zum Russischen.
Wenn dieser Befund zuverlässig ist, so ist der Unterschied sicherlich nicht auffällig. Abgesehen von den genannten Autoren wird ein solcher Unter-schied in kontrastiven Arbeiten nicht notiert. In Arbeiten zum weißrussischen Akzent im Russischen wird auf eine auffällig hintere Realisierung von [ɨ] ebenfalls nicht eingegangen. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob sich in WRGR Spuren eines solchen Unterschieds zwischen dem Weißrussi-schen und dem Russischen auffinden lassen. Da genaue Informationen zu akustischen Charakteristika im Weißrussischen und Russischen fehlen (ins-besondere für spontane/zusammenhängende Rede), kann anhand der Mess-werte allein keine Aussage getroffen werden, ob eine ‚weißrussische‘ oder ‚russische‘ Aussprache vorliegt. Allein der Vergleich der Generationen und von Äußerungen unterschiedlicher Affinität ließe eine Aussage zu, und zwar dann, wenn bei diesem Vergleich für jüngere Generationen, die stärker durch das Russische geprägt sind, und/oder in ‚russischen‘ Äußerungen Werte festgestellt würden, die auf eine vordere Realisierung schließen lassen.
117
Analyse 1 – Mittelwerte: Einen Einstieg bietet Abbildung 10. Sie zeigt die durchschnittlichen Formantwerte von betontem /i/ /nach nicht-palatalisierten Konsonanten für die hier untersuchten Sprecher getrennt nach Generationen, aus Vergleichszwecken vor dem Hintergrund der durchschnittlichen Werte der „Hauptallophone“.
Durchschnittliche Realisierungen von betontem /i/ nach nicht-palatalisierten Abb. 10
Konsonanten
Der Vokal [ɨ] nimmt einen breiten phonetischen Bereich ein.91 Es ist jedoch keine Tendenz zu erkennen, dass Generation 2, die bereits in den Städten sozialisierte und dadurch stärker und früher durch das Russische geprägte Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten, eine stärker vordere Reali-sierung aufweist. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Analyse 2 – Mehrebenenanalyse der Token (F2): Wir nutzen dieses Beispiel dennoch, um das für die folgenden Analysen benutzte statistische Verfahren der Mehrebenenanalyse an einem konkreten Beispiel vorzustellen. In der folgenden Analyse wird die Variation auf der Tokenebene untersucht. Die abhängige Variable ist in diesem Fall der normalisierte zweite Formant, der dem artikulatorischen Parameter der Zungenlage entspricht, von Reali-sierungen von /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten (gemessen in der
91 Auf den diphthongoiden Charakter von [ɨ] ist bereits verwiesen worden. Vermutlich hat der
stark diphthongoide Charakter des Lautes seinen Anteil an dieser Variation. Für das Weißrussische wird ein Anstieg des F2 von 1500 auf 2000 Hz angegeben (KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 93f.; FBLM 1989, 91f.). Für das Russische findet PADGETT (2001, 13) einen durchschnittlichen Anstieg von ca. 1800 auf ca. 2600 Hz.
aja
eje
yi
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
●●●●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
Generation 0
aja
eje
yi
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●● ●●●● ●
●●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
Generation 1
aja
eje
yi
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
●● ●
●●●
●●●● ●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21
0-1
-2
Generation 2
118
zeitlichen Mitte des Vokals). Eingeschlossen werden nicht nur Realisierun-gen in betonten Silben, sondern auch in der ersten und der zweiten vorbeton-ten Silbe sowie in der ersten nachbetonten Silbe.
Für folgende Variablen wird getestet, ob sie einen Einfluss auf den zwei-ten Formanten ausüben. Die Spalte Referenzwert gibt an, mit welchem Wert der Variable die übrigen Werte verglichen werden.
Erklärende Variablen für /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten Tab. 17
Erklärende Variable Werte / Messniveau Referenzwert Palatalisiertheit des folgenden Konsonanten („Palatalisiertheit rechts“)
palatalisiert nicht-palatalisiert
nicht-palatalisiert
Artikulationsort des vorher-gehenden Konsonanten („A.-ort links“)
dental labial postalveolar
dental
Artikulationsort des folgen-den Konsonanten („A.-ort rechts“)
Ø (Auslaut) dental labial palatal postalveolar velar
dental
Silbe zweite vorbetonte Silbe unmittelbar vorbetont betont unmittelbar nachbetont
betont
Dauer des Lautes stetig (in 10 Millisekunden) -- Logarithmierte Häufigkeit des Lemmas im Korpus
stetig --
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Dialektherkunft Nordosten Zentral Südwesten
Nordosten
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
Affinität der Äußerung weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
In die Analyse gehen 1043 Token ein. Die Variablen Sprecher (n=33) und Familie (n=8) werden als Zufallsfaktoren kontrolliert, für jeden Sprecher und jede der acht Familien wird also eine Modifikation des allgemeinen Achsen-abschnittes der Regressionsgeraden vorgenommen. Die geschätzten Stan-
119
dardabweichungen für diese Modifikationen sind 0,10 für Sprecher und 0,14 für Familie. Die individuellen Achsenabschnitte der einzelnen Sprecher streuen also um den allgemeinen Achsenabschnitt der Regressionsgeraden (die „Konstante“ in der folgenden Tabelle) mit einer Standardabweichung von 0,10. Die folgende Tabelle zeigt das Output des Mehrebenenmodells für die Festen Faktoren.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von betontem /i/ nach nicht-Tab. 18palatalisierten Konsonanten (n=1043). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,10), Familie (n=8, σ=0,14)
Koeff. SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,25 0,12 2,19 0,0446 Palatalisiertheit rechts palatalisiert 0,36 0,04 8,79 0,0001 A.-ort links labial -0,60 0,05 -12,71 0,0001 postalveolar -0,02 0,04 -0,41 0,6812 A.- ort rechts Auslaut 0,13 0,05 2,55 0,0134 labial -0,12 0,06 -2,05 0,0332 palatal 0,74 0,10 7,39 0,0001 postalveolar 0,01 0,07 0,15 0,8870 velar 0,05 0,07 0,75 0,4524 Silbe unmittelbar vorbetont -0,31 0,05 -6,26 0,0001 zweite vorbet. Silbe -0,28 0,08 -3,50 0,0004 unmittelbar nachbet. -0,32 0,05 -6,33 0,0001 Dauer in 10 Millisekunden 0,03 0,00 6,42 0,0001 Worthäufigkeit -0,02 0,01 -2,48 0,0164 Geschlecht weiblich -0,07 0,05 -1,31 0,1838 Dialektherkunft südwestlich 0,07 0,12 0,59 0,5672 zentral 0,11 0,09 1,20 0,2498 Generation Generation 0 0,06 0,08 0,73 0,4766 Generation 2 -0,06 0,06 -1,08 0,3022 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,13 0,09 1,46 0,1494
hybrid -0,04 0,05 -0,81 0,4112 russisch -0,01 0,06 -0,11 0,9002
Diese Tabelle ist folgendermaßen zu lesen: Zunächst sei auf die Werte der ersten Zeile eingegangen („Konstante“). Der Koeffizient bedeutet hier den ge-schätzten Wert für den zweiten Formanten, wenn alle in das Modell einge-schlossenen Variablen ihren Referenzwert einnehmen. Dies ist ein hypotheti-scher Wert, da der Referenzwert für Dauer und Worthäufigkeit jeweils Null ist. Er gibt also den geschätzten Wert für Realisierungen von /i/ zwischen dentalen Konsonanten an, wobei der nachfolgende nicht-palatalisiert ist, in betonten Silben bei männlichen Sprechern der Generation 1 aus dem Nord-osten in ‚weißrussischen‘ Äußerungen bei einer hypothetischen Dauer von 0 Sekunden und in Lemmata mit der Häufigkeit 0. Hinzu kommen der Stan-
120
dardfehler (SE) des Schätzwertes sowie der t-Wert und der p-Wert. Letztere sind für die Konstante theoretisch uninteressant, sie geben die Wahrschein-lichkeit an, dass der Koeffizient der Konstanten nicht von Null abweicht.
Die übrigen Einträge in der Spalte Koeffizient geben den geschätzten Wert an, um den sich dieser Ausgangswert verändert, wenn die jeweilige Variable den angegebenen Wert annimmt, während alle anderen Variablen auf ihrem Referenzwert bleiben. Der Erwartungswert für den zweiten For-manten vor palatalisierten Konsonanten ist also um 0,36 Einheiten höher als vor nicht-palatalisierten Konsonanten, was darauf schließen lässt, dass der Vokal stärker vorn artikuliert wird, mithin stärker in Richtung [i] geht. Der p-Wert gibt wiederum die Wahrscheinlichkeit an, dass dieser Koeffizient in der Realität gleich Null ist, zeigt also, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Faktor einen signifikanten Effekt auf den zweiten Formanten ausübt. Im Falle der Palatalisiertheit des nachfolgenden Konsonanten ist die Wahrscheinlich-keit, dass die tatsächliche Veränderung im zweiten Formanten gleich Null ist, mit (weniger als) 0,0001 also äußerst gering. Die rechtsseitige Palatalisiert-heit hat also einen höchstsignifikanten Effekt zugunsten eines höheren zwei-ten Formanten.92
Analog lassen sich die Werte der mehrwertigen Variablen deuten. Was den Artikulationsort des vorangehenden Konsonanten angeht, so weisen Vokale nach labialen Konsonanten einen signifikant niedrigeren zweiten Formanten auf als solche nach dentalen Konsonanten (dem Referenzwert). Vokale nach postalveolaren Konsonanten unterscheiden sich dagegen sta-tistisch nicht von solchen nach dentalen Konsonanten. Ebenso bewirken nachfolgende labiale Konsonanten einen niedrigeren zweiten Formanten. Im Auslaut und vor allem vor palatalen Konsonanten (was hier allein /j/ sein kann) steigt der zweite Formant dagegen. In allen unbetonten Silben ist der zweite Formant signifikant niedriger als in betonten Silben. Die Dauer des Lautes übt einen Einfluss aus, und zwar steigt der zweite Formant für jede 10 Millisekunden um 0,3. Je häufiger ein Lemma ist, desto niedriger ist der zweite Formant.
Was die sprachsoziologischen Parameter angeht, so unterscheidet sich keiner der Einzelwerte der einzelnen Faktoren von dem jeweiligen Refe-renzwert. Dies muss jedoch noch nicht heißen, dass die jeweilige Variable nicht insgesamt einen signifikanten Effekt aufweist. Was die Variable
92 Zur Erinnerung sei gesagt, dass die p-Werte hier nicht anhand der t-Statistik berechnet
werden, sondern mithilfe des konservativeren Markov Chain Monte Carlo Sampling.
121
Generation angeht, so zeigt die Tabelle zunächst nur, dass sich die Genera-tionen 0 und 2 nicht signifikant von Generation 1 unterscheiden. Möglich-erweise würde ein signifikanter Unterschied zwischen 0 und 2 zutage treten, wenn Generation 0 oder 2 als Referenzwert gewählt würde. Anstatt alle denkbaren Kombinationen aufzuzeigen, kann, wie in Abschnitt 4.3 dargelegt, der Einfluss des Faktors Generation insgesamt getestet werden. Dazu wird die Log-Likelihood eines Modells mit dem Faktor Generation mit der eines Modells ohne diese Variable verglichen und geprüft, ob sich das Modell bei Einschluss der Variablen signifikant verbessert. In diesem Fall ist die Log-Likelihood ohne Generation -841,60, mit Generation -840,93. Der mit dem Wert 2 multiplizierte Unterschied beträgt 1,33, dieser Wert ist bei zwei Frei-heitsgraden mit p=0,51 nicht signifikant. Es ist also nicht von einem Einfluss des Faktors Generation auszugehen. Da weder für Generation, noch Ge-schlecht, noch Affinität der Äußerung ein signifikanter Effekt zu beobachten ist, ist es nicht nötig, auf Zufallssteigungen („random slopes“) zu testen.
Anhand der Koeffizienten lassen sich die Erwartungswerte für bestimmte Falltypen durch einfaches Summieren berechnen. Für das vorliegende Bei-spiel werden hierzu zunächst die nicht-signifikanten Variablen aus dem Modell ausgeschlossen. Das bereinigte Modell sieht folgendermaßen aus:
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von betontem /i/ nach nicht-Tab. 19palatalisierten Konsonanten, nur signifikante Faktoren (n=1043). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33; σ=0,11), Familie (n=8; σ=0,11)
Koeff. SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,24 0,08 3,09 0,0042 Palatalisiertheit rechts palatalisiert 0,36 0,04 8,92 0,0001 A.-ort links labial -0,62 0,05 -13,01 0,0001 postalveolar -0,03 0,04 -0,59 0,5600 A.- ort rechts Auslaut 0,12 0,05 2,43 0,0154 labial -0,12 0,06 -2,06 0,0358 palatal 0,73 0,10 7,28 0,0001 postalveolar 0,00 0,07 -0,03 0,9900 velar 0,04 0,07 0,64 0,5320 Silbe unmittelbar vorbetont -0,31 0,05 -6,33 0,0001 zweite vorbet. Silbe -0,28 0,08 -3,44 0,0002 unmittelbar nachbet. -0,33 0,05 -6,37 0,0001 Dauer in 10 Millisekunden 0,03 0,00 6,55 0,0001 Worthäufigkeit -0,02 0,01 -2,54 0,0100
Als Beispiel berechnen wir den von diesem Modell vorhergesagten F2-Wert für ein betontes /i/ nach einem labialen Konsonanten vor einem nicht-palata-lisierten dentalen Konsonanten bei einer typischen Dauer und typischen
122
Wortfrequenz (wir nehmen hier den Median). Der Median der Dauer ist 7,80 (in 10 Millisekunden, also 78 Millisekunden), der der Wortfrequenz 4,06. Der Erwartungswert ist also 0,24 – 0,62 + 0,03*7,8 – 0,02*4,06. Das Ergeb-nis ist -0,22. Auf gleiche Weise ergibt sich für Realisierungen nach Dentalen vor nicht-palatalisierten Dentalen der Erwartungswert 0,39, nach Dentalen vor palatalisierten Dentalen der Wert 0,75.
In der folgenden Abbildung werden diese vorhergesagten Werte gezeigt. Im Hintergrund sind als Vergleich die Vertrauensellipsen der betonten „Hauptallophone“ der 33 Sprecher ebenfalls abgebildet. Für den ersten Formanten setzen wir der Einfachheit halber stets dessen Durchschnitts-wert -0,54 an.
Erwartungswerte (●) für betontes /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in unter-Abb. 11
schiedlichen phonischen Kontexten: T_Tj: nach Dentalen vor palatalisierten Denta-len; T_T: nach Dentalen vor nicht-palatalisierten Dentalen; P_T: nach Labialen vor nicht-palatalisierten Dentalen. Im Hintergrund sind als Vergleich die beobachteten Durchschnittswerte einiger betonter Vokalallophone dargestellt.
Um wieder zu einer inhaltlichen Interpretation zu kommen, so legen die Werte einen starken und plausiblen Einfluss des Kontextes nahe. Im Kontext von labialen Konsonanten wird der zentrale hohe Vokal offensichtlich stark nach hinten verlagert und/oder labialisiert, geht also in Richtung [u], vor palatalisierten Konsonanten palatalisiert, geht also in Richtung [i]. Der Be-fund, dass in kürzeren Vokalen, in häufigeren Lemmata und in unbetonten Silben niedrigere zweite Formanten auftreten, deutet daraufhin, dass die
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1
(Lo
ban
ov-
norm
alis
iert
)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1
(Lo
ban
ov-
norm
alis
iert
)
●● ●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
T_TT_Tj P_T
123
Verlagerung nach hinten ein Prozess ist, dessen Unterdrückung einen höhe-ren Artikulationsaufwand bedeutet.
Zusammenfassung: Die Analyse in diesem Abschnitt hatte zwei Ziele. Zum einen – und dies war das Hauptziel – sollte sie das in dieser Arbeit haupt-sächlich verwendete statistische Verfahren an einem Beispiel aufzeigen. Zum anderen bot sich zu dieser Analyse auch aus inhaltlicher, an kontaktbedingter Variation interessierter Sicht Anlass. Wie eingangs vermerkt, wird vereinzelt beobachtet, dass /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten im Weißrussi-schen weiter hinten als im Russischen artikuliert wird. Das Auffinden eines höheren zweiten Formanten für Vertreter der stärker durch das Russische geprägten jüngsten Generation 2 oder das Aufzeigen eines höheren zweiten Formanten in auf strukturell tieferen Ebenen ‚russischen‘ Äußerungen hätte also eine (theoretisch plausible) Tendenz zu einer stärker ‚russischen‘ Arti-kulation bei diesen Sprechern bzw. in diesen Kontexten gezeigt. Die Vertre-ter verschiedener Generationen unterscheiden sich jedoch nicht, auch zwi-schen Äußerungen unterschiedlicher Affinität ist kein Unterschied festzu-stellen. Dieser Nullbefund ist schwierig zu interpretieren. Ob die starke Labialisierung von /i/ im Kontext von labialen Konsonanten ein Spezifikum von WRGR ist, der auf weißrussischem Substrat beruht, bzw. ob die Realisie-rung insgesamt (eher) ,weißrussisch‘ oder (eher) ‚russisch‘ ist, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden. Hierzu müsste ein passender Vergleichswert vorliegen, also etwa ein Vergleich mit spontaner, aber dem Standard zuzu-ordnender weißrussischer Rede und umgangssprachlicher russischer Rede erfolgen, was in dieser Arbeit nicht geleistet werden kann.
5.4 Unbetonte Vokale
Hintergrund 5.4.1
Die wesentlichen Unterschiede im Vokalismus zwischen dem Weißrussi-schen und dem Russischen betreffen den unbetonten Vokalismus. Anders als im Falle der betonten Vokale unterscheiden sich hier auch die weißrussischen Dialekte relativ stark sowohl von der Standardsprache als auch untereinander, so dass der unbetonte Vokalismus als Hauptkriterium für die Dreiteilung in eine nordöstliche, eine zentrale und eine südwestliche Dialektgruppe dient.
Beide Standardsprachen und ihre Subvarietäten haben einen freien und beweglichen Wortakzent. Ihnen ist gemeinsam, dass Vokalalternationen zwi-schen betonten und unbetonten Silben auftreten, wobei einige Vokaloppositi-
124
onen in unbetonten Silben neutralisiert werden.93 Unterschiede zwischen den Sprachen bestehen im phonetischen Resultat dieser Neutralisierungen. Die Tabellen 20 und 21 zeigen die gängigen Darstellungen zum Weißrussischen und zum Russischen (Ausnahmen und hiervon abweichende Darstellungen werden später behandelt). Unterschieden werden dabei die zwei Kontexte, die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden: die unmittelbar vorbetonte Silbe und weitere, nicht unmittelbar vorbetonte Silben. Dies ist eine gewisse Vereinfachung in der Bezeichnung. So verhalten sich in einigen Aspekten etwa nicht unmittelbar vorbetonte Vokale, die jedoch im Anlaut stehen, wie unmittelbar vorbetonte Vokale. Gleiches gilt für Vokale in Hiatusposition. Der Ausdruck „Vokale in nicht unmittelbar vorbetonten Silben“ steht also hier und im Folgenden – sofern nicht anders vermerkt – für „Vokale in nicht unmittelbar vorbetonten Silben, nicht im Anlaut, nicht in Hiatusposition“ (die in der Russistik so genannte „erste Reduktionsstufe“). Eine genauere Diskus-sion erfolgt in den einzelnen Unterkapiteln dieses Kapitels.
Vokalrealisierungen in unbetonten Silben nach nicht-palatalisierten Konsonanten Tab. 20
unmittelbar vorbetont nicht unmittelbar vorbetont
Ru. Wr. Ru. Wr.
/i/ [ɨ] [ɨ] [ɨ] [ɨ]
/e/ [ɨ] [a] [ɨ] [a]
/a/, /o/ [ɐ] [a] [ə] [a]
/u/94 [u] [u] [u] [u]
93 Für das Weißrussische vgl. PADLUŽNY (1969); KRYVICKI & PADLUŽNY (1984); PADLUŽNY
(1984); BIRYLA & ŠUBA (1985); CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988); FBLM (1989); BM (2004); CROSSWHITE (2004). Für das Russische vgl. AVANESOV (1956, 1972); HALLE (1971); WARD (1975); VERBICKAJA (1976); CROSSWHITE (2000); KASATKIN (2003, 2006, 2009a/b); TIMBERLAKE (2004). Hinsichtlich der phonologischen Interpretation dieser Vokalalternationen bestehen unterschiedliche Meinungen. In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Vokale in Silben, auf die in einigen Positionen eines Paradigmas der Wortakzent fällt, in anderen nicht, Realisierungen desselben Phonems sind. Wie es bei vielen Fällen von Neutralisierung der Fall ist, ist in einigen konkreten Beispielen nicht zu entscheiden, welches Phonem zugrunde liegt. Dies ist dann der Fall, wenn die Silbe nie unter Betonung auftritt. In vielen russistischen und belorussistischen Arbeiten wird dagegen davon ausgegangen, dass bei Akzentwechsel im Paradigma eines Lexems Phonem-alternationen stattfinden und einige Phoneme nicht unbetont auftreten können, so dass in unbetonten Silben ein anderes phonologisches System anzunehmen ist als unter Betonung (vgl. hierzu GIGER 2008).
94 Da die Realisierung von /u/ und /i/ sich in beiden Sprachen nicht unterscheidet, wird hier von einer genaueren phonetischen Angabe abgesehen. Es sind unbetont auch zentriertere
125
Vokalrealisierungen in unbetonten Silben nach palatalisierten Konsonanten Tab. 21
unmittelbar vorbetont nicht unmittelbar vorbetont
Ru. Wr. Ru. Wr.
/i/ [i] [i] [i] [i]
/e/, /a/, /o/ [i] [a] [i] [e]
/u/ [u] [u] [u] [u]
Wie eingangs erwähnt bestehen zudem Unterschiede in den weißrussischen Dialekten (vgl. DABM 1963a; KURASZKIEWICZ 1963, 23; NPBD 1964; VAJTOVIČ 1968). Auf diese wird später eingegangen.
Die im Weißrussischen und Russischen greifenden Vokalalternationen zwischen betonten und unbetonten Silben werden in der Regel mit dem Begriff „Vokalreduktion“ erfasst, wobei dieser Begriff zuweilen undifferen-ziert verwendet wird. Für die folgenden Darstellungen ist die Unterscheidung zwischen phonetischer Vokalreduktion und phonologischer Vokalreduktion wichtig (vgl. FOURAKIS 1991; PADGETT & TABAIN 2005). Phonetische Re-duktion bezeichnet eine geringere Dauer und eine geringere Intensität von unbetonten Vokalen (quantitative Reduktion) sowie einen „undershoot of vowel targets“ (PADGETT & TABAIN 2005, 14), der in der geringeren Muskel-anspannung bei der Artikulation begründet ist (qualitative Reduktion). Bei phonetischer Reduktion handelt es sich also um einen Lenitionsprozess, der gradueller Natur ist und von Faktoren wie dem Sprechtempo, dem Forma-litätsgrad, Wortfrequenz, Satzbetonung und dem lautlichen Kontext abhängig ist (vgl. FIDELHOLZ 1975; WOOD & PETTERSON 1988; RHODES 1996, 244f.). Konkret kann phonetische Reduktion unterschiedliche Konsequenzen haben: DONEGAN (1972, 482–484) versteht phonetische Reduktion (sie spricht von „Neutralisierung“) als die Ersetzung von weniger [ə]-artigen Vokalen durch stärker [ə]-artige Vokale, d.h. als Verlust oder Abschwächung von den Merkmalen Palatalität, Labialität und Höhe/Tiefe als Ergebnis einer allge-meinen „tendency toward neutral position“ (DONEGAN 1972, 482; siehe auch BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER 1966, 61). Die zweite mögliche Konse-quenz ist die (stärkere) Akkommodation an benachbarte Konsonanten (LINDBLOM 1963; PADGETT & TABAIN 2005, 16). In diesem Sinne kann pho-netische Reduktion nicht nur den Verlust von Merkmalen wie Vokalhöhe
Varianten möglich. Nach palatalisierten Konsonanten wird /u/ vor allem in nicht unmittel-bar vorbetonter Position stark nach vorn verlagert (AVANESOV 1956, 108; 114; 119).
126
oder Palatalität und Labialität zur Folge haben kann, sondern im Gegenteil auch das Hinzutreten solcher Merkmale.
Unter phonologischer Vokalreduktion wird üblicherweise die Neutralisa-tion von Oppositionen zwischen bestimmten Vokalphonemen in unbetonten Silben oder anderen phonologisch definierbaren Kontexten verstanden. Phonologische Vokalreduktion beruht auf einer „categorical substitution“ (PADGETT & TABAIN 2005, 14) und nicht auf einem graduellen Prozess. Sie ist daher nicht vom Sprechtempo oder dem Grad der Aufmerksamkeit auf die Rede abhängig.95
Während Einigkeit besteht, dass der Zusammenfall der unbetonten Vokalphoneme /o/ und /a/ im Russischen kategorisch ist, ist unklar, ob die phonetische Reduktion des unbetonten /o/ und /a/ zu zentralen Lauten im Russischen und deren unterschiedliche Stärke in unterschiedlichen Silben-typen, die in der Regel kategorisch aufgefasst bzw. beschrieben wird, nicht graduell ist. Für die graduelle Natur spricht zum einen die Beobachtung, dass einige synsemantische Wörter wie einige Pronomina, Zahlwörter, Hilfs-verben etc. stets oder oft kaum betont ausfallen oder sogar völlig unbetont bleiben können und dann auch mit entsprechend phonetisch reduzierten Vari-anten realisiert werden (AVANESOV 1956, 83). Zum anderen handelt es sich bei den Fällen, in denen die Reduktion weniger stark ausfällt (der Anlaut, die unmittelbar vorbetonte Position, vor Vokal, der absolute Auslaut, vgl. Abschnitt 5.4.3) um solche Positionen, die üblicherweise mit einer längeren Vokaldauer einhergehen. BARNES (2002, 102) bestätigt experimentell, dass die qualitativen Unterschiede in der Reduktion abhängig von der Dauer des Vokals sind, und schließt, dass die angenommenen zwei Reduktionsstufen für das Russische keine „repräsentationale“ Grundlage hätten, sondern allein durch die Dauer der entsprechenden Silben zustande kämen. Auch BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER (1966, 61) finden, was die Vokalqualität angeht, keinen Unterschied zwischen den Reduktionsstufen. Bei Hyper-artikulation kann die phonetische Reduktion auch ganz ausbleiben (nicht jedoch der Zusammenfall von /a/ und /o/), in spontaner Rede dagegen noch stärker ausfallen (vgl. FSR 1988, 65–67).
95 Allerdings ist phonologische Reduktion sicherlich ursächlich mit phonetischer Reduktion
verbunden. Das Verkleinern des Vokalraums bei geringerer Dauer der Vokale verringert den perzeptuellen Abstand zwischen Vokalen, so dass einige Oppositionen zugunsten von wenigen, aber dafür deutlicheren Unterschieden aufgegeben werden (PADGETT & TABAIN 2005, 16).
127
Da die Beschreibung der Verhältnisse in den weißrussischen Dialekten die Unterscheidung der beiden beschriebenen Kontexte (unmittelbar vor-betont – nicht unmittelbar vorbetont) voraussetzt, folgt die vorliegende Arbeit der traditionellen Aufteilung in unterschiedliche Reduktionsstufen. Zunächst werden im Folgenden unbetonte Vokale nach nicht-palatalisierten Konso-nanten behandelt, danach solche nach palatalisierten. Im Anschluss wird vorbetontes /e/ nach sogenannten verhärteten Konsonanten behandelt.
/a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in unmittelbar 5.4.2vorbetonten Silben – die Variable (Akanje1)
Tabelle 22 wiederholt die unterschiedlichen Muster in den beiden Standard-sprachen und in den weißrussischen Dialekten:
Realisierung von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten, erste vorbetonte Tab. 22Silbe
Standardweißrussisch, zentrale u. südwestl. wr. Dialekte
Nordöstl. wr. Dialekte Standardrussisch
[a] [ɨ], [ə] (wenn betont /a/ folgt) [a] (in allen anderen Fällen)
[ɐ]
Der Zusammenfall von /a/ und /o/, der im Weißrussischen auch graphema-tisch wiedergegeben wird, wird als Akanje (‚[a]-Sprechen‘) bezeichnet.96 Die Unterschiede zunächst zwischen den Standardsprachen bestehen in dem phonetischen Resultat dieser Neutralisierung.
Für das Russische wird in der sogenannten ersten Reduktionsstufe, die neben den unmittelbar vorbetonten Silben auch den absoluten Anlaut, Hiatus-positionen und finale offene Silben umfasst, üblicherweise ein [ɐ] angenom-men, also ein zentraler Laut, der im Vergleich zum betonten /a/ etwas weni-ger tief bzw. weniger offen ist (AVANESOV 1956, 115; TIMBERLAKE 2004, 45). In der slavistischen Notation wird dieser Laut mit „ʌ“ notiert, allerdings nur vereinzelt (bei JONES & WARD 1969; bei PANOV 1979, 160) auch als halboffener hinterer nicht-labialisierter Vokal, wie er im IPA-System (IPA 2000) sowie bei ŠČERBA (1983 [1912]) durch eben dieses Symbol bezeichnet wird, beschrieben. Die Untersuchungen von BARNES (2002, 90) legen nahe, dass es sich nicht um den durch das IPA-Symbol „ʌ“ bezeichneten Vokal handelt. KASATKIN (2009a, 50) dagegen nimmt an, dass Variation zwischen
96 Die in nordrussischen Dialekten (und im Ukrainischen) verbreitete Aufrechterhaltung der
Opposition von /a/ und /o/ wird als Okanje bezeichnet.
128
dem zentralen [ɐ] und dem hinteren nicht-labialisierten [ʌ] vorliegt, wobei das zentrale [ɐ] (von ihm transkribiert als „[aə]“) die gängigere Variante sei (vgl. auch KASATKIN 2003, 37 und 133–135 sowie KASATKIN 2006, 34 und 150–152) Im Folgenden wird das Symbol [ɐ] benutzt, ohne auszuschließen, dass auch hintere Varianten auftreten können (was akustische Untersuchun-gen nahelegen, s.u. in diesem Abschnitt).
Nach sogenannten „verhärteten“ Konsonanten besteht im Russischen eine gewisse Variation. Als verhärtet werden in Bezug auf die Palatalitätsopposi-tion unpaarige Konsonanten bezeichnet, die synchron nicht-palatalisiert sind, aber historisch auf palatalisierte Konsonanten zurückgehen. Dies sind im Russischen /ʦ/, /ʂ/ und /ʐ/. In älteren Sprachständen verhielt sich /a/ nach diesen Konsonanten im nativen Wortschatz wie /e/ und /o/, wurde also als [ɨ] realisiert. In Lehnwörtern war für „fremdes“ |a| auch [ɐ] analog zu /a/ nach anderen nicht-palatalisierten Konsonanten möglich. Im 20. Jh. besteht eine gewisse Variation mit der Tendenz, [ɐ] in Lexemen zu generalisieren, in deren Paradigma die Silbe auch unter Betonung auftritt, [ɨ] in anderen Fällen: žara [ʐɐˈra] (‚Hitze; Gen.Sgl.‘ zu žar [ʐar]), aber lošadej [ləʂɨˈdʲej] (‚Pferd; Gen.Pl.‘ zu lošadʼ [ˈlɔʂɨdʲ]). AVANESOV (1956, 112) sieht die Realisierung von /a/ als [ɨ] insgesamt als zurückgehend an. In Lehnwörtern mit etymologi-schem |a| tritt [ɨ] vor allem vor palatalisierten Konsonanten auf, anderenfalls [ɐ] (vgl. TIMBERLAKE 2004, 46–48; KASATKIN 2009b, 121).
Akustische Analysen zur Vokalreduktion bestätigen für das Russische erstens den absoluten Zusammenfall von vorbetontem /o/ und /a/ in ihren akustischen Charakteristika (PADGETT & TABAIN 2005) sowie zweitens den quantitativen und qualitativen Unterschied zwischen betonten und vorbeton-ten Silben. Vorbetonte /o/ und /a/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten sind kürzer als die betonten Entsprechungen und haben einen niedrigeren ersten Formanten als betontes /a/ (BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER 1966, 59f.; HALLE 1971, 130; BOLLA 1981, 106). Der zweite Formant unterscheidet sich dagegen nicht vom betonten /a/ C0_, was eine Realisierung als [ɐ] nahelegt (BOLLA 1981, 106). BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER (1966, 61) stellen fest, dass selbst bei langsamer Artikulation für unbetonte Vokale kein statio-närer Teil auszumachen sei. Darüberhinaus hat der lautliche Kontext einen starken Einfluss: Labiale Konsonanten etwa führen zu einem niedrigeren zweiten Formanten, alveolare Konsonanten zu einem höheren F2. Vor allem
129
hat die Palatalität des folgenden Konsonanten einen großen Einfluss und führt zu einer nach vorn verlagerten Artikulation (einem höheren F2).97
Für das Weißrussische wird dagegen angenommen, dass sich das phoneti-sche Resultat der Neutralisierung im Gegensatz zum Russischen qualitativ nicht von der Realisierung eines betonten /a/ unterscheidet, und nur eine starke quantitative Reduktion erfolgt (BIRYLA & ŠUBA 1985, 42f.; FBLM
1989, 319; PADLUŽNY 1990, 8). Bei genauerer Betrachtung sind zwar einige Formulierungen vorsichtiger. So schränkt z.B. VYHONNAJA (1991, 200) ein: „narmatyŭnym ličycca takoe vymaŭlenne, pry jakim huk ne hubljae svaëj asnoŭnaj jakasci [als normativ gilt die Aussprache, bei der der Laut seine grundlegende Qualität nicht verliert; Hervorhebung: JPZ]“, oder es wird von einer „unbedeutenden Reduktion“ („njaznačnaja rėdukcyja“) gesprochen (BM 2004, 15). Dass ein wenn auch geringer, so doch genereller qualitativer Unterschied zu betontem /a/ angenommen wird, ist allerdings selten. Einen solchen nehmen jedoch die Autoren der FBLM (1989, 37) an.
In den südwestlichen und zentralen Dialekten des Weißrussischen herrscht dasselbe Muster wie in der weißrussischen Standardsprache vor. In den nordöstlichen Dialekten dagegen besteht sogenanntes dissimilatives Akanje. /o/ und /a/ werden unmittelbar vorbetont als [ɨ] oder [ə] realisiert, wenn der betonte Vokal des phonologischen Wortes ein /a/ ist, und fallen damit mit vorbetontem /i/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten zusammen: /traˈvu/ [traˈvu] ‚Gras; Akk.Sgl.‘ vs. /traˈva/ [trɨˈva] oder [trəˈva] ‚Gras; Nom.Sgl.‘ (vgl. auch wr. standardsprachlich: trava [traˈva] ‚Gras‘). Die Rea-lisierung als [ɨ] ist dabei vor allem in westlicheren Gebieten des nordöstli-chen Gebiets anzutreffen (v.a. um Mahilëŭ), [ə] eher in östlicheren Gebieten (NESSET 2002, 81). Andernfalls, also bei anderen Vokalen unter Betonung, werden /a/ und /o/ wie in den übrigen weißrussischen Varietäten als [a] reali-siert. Zwischen diesen beiden Gebieten findet sich ein recht breites Über-gangsgebiet, in dem beide Muster anzutreffen sind (vgl. DABM 1963a, Karte 1; NPBD 1964, 42–46; VAJTOVIČ 1968, 10–55; ČEKMONAS 1987).98
97 Dies steht im Gegensatz zu den artikulatorischen Beschreibungen des Russischen, die zwar
sagen, dass die Palatalisiertheit des folgenden Konsonanten zu einer leichten [i]-artigen Re-kursion führe (AVANESOV 1956, 115), insgesamt dem folgenden Konsonanten aber einen geringeren Einfluss als bei betonten Silben zuschreiben, und diesen in der Transkription nicht berücksichtigen (vgl. AVANESOV 1956, 107).
98 Im absoluten Anlaut liegt in den meisten Teilen des nordöstlichen Dialektgebiets [a] vor, unabhängig vom Vokal unter Betonung. Zuweilen werden weitere dialektale Abweichun-gen angenommen, die teilweise assimilatorisch zu erklären sind, etwa [u] nach labialen oder velaren Konsonanten, vor allem im Präfix po-. Außerdem kann /i/ assimilatorisch vor
130
Dialektale Interferenzen des dissimilativen Akanje (und seines Gegen-stücks nach palatalisierten Konsonanten, des dissimilativen Jakanje, vgl. Abschnitt 5.4.4) finden sich häufig auch bei Sprechern der weißrussischen Standardsprache, die ansonsten keine dialektalen Spuren in ihrer Rede zeigen (FBLM 1989, 320; PADLUŽNY 1990, 11; VYHONNAJA 1991, 202), wobei bei vielen Sprechern dissimilatives und nicht-dissimilatives Akanje miteinander variieren (FBLM 1989, 316). Oft werde dieses dialektale Merkmal dabei vom Sprecher selbst nicht bemerkt (BIRYLA & ŠUBA 1985, 43). Interessanterweise bemerkt PADLUŽNY (1990, 11), dass Fälle von dissimilativem Akanje (und Jakanje) auch bei Sprechern, für deren Dialekthintergrund dies nicht charak-teristisch ist, vorkämen (vgl. auch PADLUŽNY 1982, 141). Es bleibt unklar, ob hier nicht mitunter jegliche Reduktion mit dissimilativem Akanje gleichge-setzt wird.
Aber auch abgesehen vom dialektalen Einfluss bestehen Zweifel, dass im Weißrussischen absolut kein qualitativer Unterschied zwischen dem vor-betonten Allophon von /a/ und /o/ einerseits und betontem /a/ andererseits besteht. Akustische Untersuchungen bestätigen, dass sich auch im Weißrussi-schen qualitative Unterschiede finden. So findet ANDREEV (1983) in unmit-telbar vorbetonter Position einen leicht niedrigeren ersten Formanten (508 Hz im Vergleich zu 560 Hz) und einen höheren zweiten Formanten (1 356 gegenüber 1 280 Hz) als unter Betonung (s.u. Tab. 30, S. 147). Ähnliches beobachtet LOSIK (1983) – allerdings am Beispiel nur eines Vokaltokens. Dass im Standardweißrussischen absolut keine phonetische Reduktion vorliegt, wäre angesichts von Beobachtungen, dass unbetonte Vokale im Weißrussischen quantitativ stark reduziert werden, auch unwahrscheinlich. Nach der FBLM (1989, 318) sind sie um 2 bis 2,5 Mal kürzer als betonte (vgl. auch ANDREEV 1983, 8; MIKULA 1998, 4). Auch wenn man nicht wie VYHONNAJA (1998, 126) argwöhnen muss, dass es sich bei solchen redu-zierten Realisierungen um Einflüsse des Russischen handelt, sondern auch universale phonetische Reduktionsprozesse annehmen kann, bleibt das Mo-ment, dass ein „klares“, mit dem Kardinalvokal übereinstimmendes [a] im unbetonten Vokalismus des Weißrussischen nicht immer erreicht wird.
Das in der Belorussistik verbreitete Betonen des Fehlens einer qualita-tiven Reduktion im Weißrussischen lässt sich jedoch als Einigkeit dahin-gehend verstehen, dass die qualitative Reduktion im Russischen als bedeu-
betontem /a/ ebenfalls als [a] realisiert werden (vgl. NPBM 1964, 43–45; BIRYLA & ŠUBA 1985, 43).
131
tend stärker empfunden wird. Die Variation von zentraleren und offeneren Lauten im weißrussisch-russischen Sprachkontakt und das Bevorzugen zentraler Varianten bei stärker durch das Russische beeinflussten Personen ist außerdem belegt (s.u.), so dass das Beharren auf einem Unterschied des Weißrussischen zum Russischen sicherlich nicht nur auf eine außersprachlich motivierte „Übertreibung“ der weißrussischen Normierer (wie sie RAMZA 2011 für andere Bereiche vermutet) zurückzuführen ist.
Die fehlende bzw. geringe qualitative Reduktion des Allophons bzw. phonetischen Stellvertreters von /o/ und /a/ in unbetonten Silben, also eine stärker [a]-artige Realisierung als in der russischen Norm, ist ein typisches Merkmal des weißrussischen Akzentes im Russischen bzw. der weißrussi-schen Variante des Russischen (vgl. BULACHOV 1973, 102; VYGONNAJA 1985, 154–155; KILEVAJA 1989, 8). SADOŬSKI (1982, 199) bemerkt, dass die von ihm untersuchten Land-Stadt-Migranten in Minsk /a/ und /o/ (vor anderen betonten Vokalen als /a/) als ein offenes [a] artikulieren. Vor beton-tem /a/ ist, da die untersuchten Sprecher aus Übergangsgebieten zwischen dissimilativem und nicht-dissimilativem Akanje stammen, Variation mit zentrierten Realisierungen zu beobachten, die quantitativen Verhältnisse der Migrantengeneration gleichen aber denen der weißrussisch-dialektalen Elterngeneration dieser Sprecher. Sadoŭski konstatiert, dass die Migranten die Artikulation ihrer Elterngeneration bzw. des Ausgangsdialekts in ihrer russischen Rede beibehalten (SADOŬSKI 1982, 199). Von stilbedingten Unterschieden berichtet er nicht.
Eine Besonderheit, die Sadoŭski bei seinen Minsker Informanten findet, sind [ɔ]-ähnliche99 Realisierungen anstelle von /o/ und /a/, die weder in den ursprünglichen Dialekten noch in der Minsker Umgangssprache zu finden sind. Entscheidend ist wohl die phonetische Umgebung: [ɔ]-ähnlich sei die Realisierung vor allem im Anlaut, wenn der betonte Vokal ein /o/ oder /u/ ist, oder nach labialen Konsonanten (SADOŬSKI 1982, 201). Allerdings lassen sich nicht alle seiner Beispiele so erklären (vgl. z.B. Wortformen wie ru. katok ‚Walze; Eisbahn‘, atletika ‚Athletik‘, raketka ‚Tennisschläger‘, für die er ebenfalls [ɔ]-ähnliche Realisierungen notiert).
Was die Realisierung in WRGR angeht, so gibt es hierzu keinerlei instru-mental-gestützte oder ohrenphonetisch arbeitende Untersuchungen. In den
99 Sadoŭski benutzt das Zeichen „[o]“. Er verwendet für dieses Phänomen den Terminus
„Okanje“, was insofern unglücklich ist, als dass der Begriff in der russistischen Tradition nicht auf die phonetische Realisierung, sondern auf das Ausbleiben der Neutralisierung, d.h. auf die Unterscheidung von /o/ und /a/ abhebt.
132
Transkripten des OK-WRGR ist der Unterschied zwischen zentrierten und offenen Realisierungen nicht festgehalten. Zu erwarten ist, dass die Verhält-nisse für die Generation 1, die Land-Stadt-Migranten, ähnlich wie für die Informanten von Sadoŭski ausfallen, dass also dialektale ‚weißrussische‘ Muster beibehalten werden. Dies gilt es im Folgenden ebenso zu prüfen wie die Frage, ob für die Generation 2 eine Tendenz zugunsten einer stärker ‚rus-sischen‘ Aussprache festzustellen ist.
5.4.2.1 Dissimilatives Akanje in WRGR
In diesem Abschnitt wird geprüft, ob für einzelne Sprecher dissimilatives Akanje anzunehmen ist, ob also signifikante Unterschiede zwischen den Realisierungen von vorbetontem /a/ und /o/ vor betontem /a/ und vor anderen Vokalen bestehen.100 Dies ist auch eine notwendige Voruntersuchung für die folgende Analyse, in der es um Unterschiede in der Qualität des nicht-dissimilativen Akanje – eher offen und [a]-artig wie im Weißrussischen oder eher zentriert in Richtung [ɐ] wie im Russischen – in unterschiedlichen Sprechergruppen gehen wird. Sollte ein Sprecher /a/ und /o/ vor betontem /a/ unterschiedlich behandeln als in anderen Kontexten, also dann stärker in Richtung [ə] oder [ɨ] realisieren, so müssen diese Fälle aus der weiteren Analyse ausgeschlossen werden.
Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, zeichnet sich grob gesagt der Nord-osten von Belarus durch dissimilative Muster im unbetonten Vokalismus aus. Aus den sieben untersuchten Städten liegen die beiden nordöstlichen klar in diesem Gebiet (Šarkoŭščyna und Chocimsk; vgl. DABM 1963a, Karte 1). Zudem stammen auch einige Minsker Sprecher aus dem Vicebsker Gebiet, für das dissimilatives Akanje charakteristisch ist. Die übrigen nicht in Minsk geborenen Sprecher aus Minsk stammen aus Übergangsgebieten. Für die beiden anderen Städte des zentralen Dialektgebiets ist die Lage nicht klar. Smarhon’ liegt nicht mehr im eigentlichen Bereich des dissimilativen Akanje, es finden sich in unmittelbarer Nähe aber einige Inseln. Rahačoŭ liegt eben-falls etwas außerhalb des Gebietes mit dissimilativem Akanje. Im Kreis Homel’, aus dem die Mehrzahl der in Rahačoŭ untersuchten Informanten ursprünglich stammt, ist es im DABM nur für einen Erhebungsort verzeich-
100 Für eine instrumentale Analyse der Dauer der unbetonten Vokale in südrussischen Dialek-
ten mit dissimilativem Akanje vgl. KASATKINA (1995). Einige Beobachtungen zu spektra-len Charakteristika liefern KASATKINA & SAVINOV (2007) und KNIAZEV & SHAULSKIY (2007).
133
net. Allerdings findet ČEKMONAS (1987, 337–341) in seiner eigenen Feld-arbeit dissimilative Muster um einiges weiter westlich, als es der DABM angibt. Mahilëŭ, aus dem eine weitere Informantin stammt, fällt klar in das Gebiet des dissimilativen Akanje (vgl. DABM 1963a, Karte 1).
Analyse 1 – Dissimilatives Akanje bei den einzelnen Sprechern: Dissimilati-ves Akanje bedeutet wie gesagt die Realisierung von /a/ und /o/ (sowie /e/) als [ɨ] oder [ə] vor betontem /a/ sowie als [a] in allen anderen Fällen. Es geht also um einen Unterschied in der Höhe des Vokals, der sich akustisch in einem Unterschied im ersten Formanten äußern würde. In die folgende Ana-lyse gehen die (nicht-normalisierten) Werte des ersten Formanten aller ge-messenen unmittelbar vorbetonten Realisierungen von /a/ und /o/ ein. Positi-onen im absoluten Anlaut und Silbenanlaut werden ausgeschlossen, ebenso Realisierungen nach den verhärteten Konsonanten /ʂ/, /ʐ/, /ʦ/ und den in WRGR potentiell verhärteten, da nur im Weißrussischen, nicht aber im Rus-sischen verhärteten (ʃʲː), (ʧʲ) und (rʲ). Mithilfe von t-Tests wird für jeden Sprecher aus den genannten fünf nordöstlichen und zentralen Städten geprüft, ob der erste Formant vor /a/ signifikant niedriger ist als vor anderen Vokalen. (Es handelt sich also um einseitige t-Tests). Tabelle 23 zeigt die Ergebnisse der t-Tests bei den einzelnen Sprechern.
Zur Unterschiedlichkeit des F1 von unmittelbar vorbetontem /a/ und /o/ nach nicht-Tab. 23palatalisierten Konsonanten vor betontem /a/ einerseits und vor anderen Vokalen an-dererseits (dissimilatives Akanje) in den nordöstlichen und zentralen Städten
Gen. Geschl. F1 vor /a/ F1 sonst t-Wert df p-Wert ch_P 0 w 537 (n=19) 684 (47) 6,47 33,46 0,000 ch_C 1 m 453 (13) 494 (22) 2,21 26,72 0,018 ch_A 1 w 571 (13) 689 (38) 4,09 16,97 0,000 ch_R 2 m 411 (13) 405 (24) -0,30 30,72 0,619 ch_N 2 w 584 (16) 608 (57) 1,14 33,64 0,131 mi_V 0 w 510 (15) 642 (50) 7,88 41,24 0,000 mi_B 1 m 512 (26) 540 (41) 1,89 47,83 0,032 mi_A 1 w 529 (15) 611 (26) 2,94 35,50 0,003 mi_Y 2 m 445 (18) 478 (26) 2,04 35,86 0,024 mi_F 2 w 601 (17) 577 (41) -0,80 23,68 0,784 ra_D 0 m 534 (24) 548 (35) 0,80 43,62 0,213 ra_B 0 w 589 (23) 666 (37) 2,70 43,34 0,005 ra_S 1 m 477 (19) 529 (27) 3,41 43,00 0,001 ra_L 1 w 543 (28) 605 (68) 3,69 87,95 0,000 ra_C 2 m 463 (24) 494 (44) 2,47 62,97 0,008 ra_A 2 w 556 (19) 575 (66) 0,86 29,28 0,198
134
sa_T 1 m 539 (18) 595 (56) 3,56 27,30 0,001 sa_M 1 w k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. sa_I 2 w 471 (39) 558 (47) 3,83 78,18 0,000 sa_N 2 w 555 (31) 609 (49) 3,37 77,93 0,001 sm_B 1 m 472 (19) 485 (47) 0,41 27,63 0,344 sm_A 1 w 654 (13( 721 (49) 1,81 18,35 0,044 sm_C 1 w 666 (12) 730 (15) 2,10 21,93 0,024 sm_AF 2 m 502 (21) 513 (46) 0,65 35,85 0,261
Deutlich zeigt sich, dass das dialektale dissimilative Muster für die zentralen und nordöstlichen der untersuchten Städte in den älteren Generationen wirkt: Zwölf der 14 Sprecher in den Generationen 0 und 1 haben einen niedrigeren ersten Formanten vor betontem /a/, weisen also höhere Realisierungen als vor anderen betonten Vokalen auf. Auch in Generation 2 gibt es vier Sprecher (von neun), die Vokale vor /a/ im Durchschnitt anders realisieren als in ande-ren Positionen.101 Der Exakte Fisher-Test ergibt, dass zwischen den Generationen marginal signifikante Unterschiede bestehen (p=0,087; werden die beiden älteren Generationen zusammengefasst, ist p=0,066).
Verteilung von Sprechern aus den nordöstlichen und zentralen Städten mit Tab. 24dissimilativem Akanje auf die drei Generationen
Diss. Akanje Generation 0 Generation 1 Generation 2 gesamt ja 3 9 4 16 nein 1 1 5 7 gesamt 4 10 9 23
Dass für einen Sprecher ein signifikanter Unterschied vorliegt, bedeutet je-doch nicht, dass die Realisierungen kategorisch unterschiedlich sind. Ähnlich wie für betonte Vokale gibt es Überschneidungen, wie folgende Abbildung einiger Sprecher aus Minsk deutlich macht (die übrigen Abbildungen befin-den sich im Anhang).
101 Zusätzlich zu diesen Sprechern aus den genannten fünf Orten findet sich bei der weiblichen
Vertreterin der Generation 1 in Baranavičy ein signifikanter Unterschied im F1. Wie dies zu erklären ist, ist unklar. Allerdings wurden für diese Sprecherin sehr viele Token (151) untersucht, was es wahrscheinlich macht, dass unwesentliche Unterschiede statistische Sig-nifikanz erreichen (der Unterschied zwischen beiden Positionen beträgt bei dieser Spreche-rin lediglich 36 Hz). Für alle anderen Sprecher aus den südwestlichen Städten bestehen keine signifikanten Unterschiede.
135
Realisierungen von unmittelbar vorbetontem /o/ und /a/ nach nicht-palatalisierten Abb. 12
Konsonanten vor betontem /a/ (■) und vor anderen Vokalen (○) der Minsker Sprecher
Relativ deutlich ist der Unterschied zwischen Realisierungen vor /a/ und solchen vor anderen Vokalen für mi_V, die älteste Sprecherin. Für die Spre-
uo
a
jei
3000 2500 2000 1500 1000 500
100
080
060
040
02
00
uo
a
jei
3000 2500 2000 1500 1000 500
100
080
060
040
02
00
○○○○○
○
○○○○○○○
○○○
○○
○
○ ○
○○○○○
○ ○○○○
○○
○○
○○○
○○○
○○
○○○○○○○○
○○○
3000 2500 2000 1500 1000 500
100
080
060
040
02
00
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
■
■
■■■■■
■■■
■■■■■ ■
3000 2500 2000 1500 1000 500
100
080
060
040
02
00
mi_V
ije o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
ije o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
○○
○○
○
○○○○○○
○
○
○
○ ○○○
○
○
○○
○
○○
○○○
○○
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
F2 (Hz)F1
(H
z)
■
■■
■■■■
■
■■■
■
■
■■
■■
■■
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
mi_A
uije
a
o
2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
uije
a
o
2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
○ ○
○
○○○
○
○
○○○○
○○
○
○
○○○○○
○○○○
○○○
○○ ○
○
○
○
○
○ ○○○ ○
○
○○
2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
■
■
■
■■
■■■■■
■
■
■
■
■
■
■
■ ■
2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
mi_F
136
cherin mi_A, für die statistisch ebenfalls ein signifikanter Unterschied vor-liegt, ist eine sehr viel größere Überlappung zu beobachten.
Analyse 2 – Entwicklung der Vokalkategorien: Das Zurückgehen der signifi-kanten Unterschiede zwischen Realisierungen vor betontem /a/ und solchen vor anderen Vokalen, das für die Generation 2, die Kinder der Land-Stadt-Migranten, zu verzeichnen ist, kann auf zwei Arten zustande kommen: einerseits durch eine weniger hohe Realisierung von Vokalen vor betontem /a/, also weg vom ‚dialektalen‘ [ɨ] und [ə] hin zum ‚russischen‘ und auch eher dem Standardweißrussischen entsprechenden [ɐ], andererseits durch eine weniger offene Realisierung von Vokalen in anderen Kontexten, also weg von einer deutlich ‚weißrussischen‘ Realisierung als [a] in Richtung einer stärker zentrierten Variante. Möglich ist natürlich auch, dass beide Positionen sich aufeinander zu bewegen. Vor diesem Hintergrund ist zu überprüfen, ob sich über die Generationen die (durchschnittlichen) Realisierungen von Vokalen vor /a/ oder von Vokalen vor anderen Vokalen verändern. Abbildung 13 zeigt Boxplots für die durchschnittlichen ersten Formanten von Vokalen in Akanje-Positionen der einzelnen Sprecher, getrennt nach dem betonten Vokal. Als Vergleich werden auch die durchschnittlichen Realisierungen der Sprecher aus den südwestlichen Städten gezeigt.
137
Durchschnittliche F1-Werte von unmittelbar vorbetontem /a/ und /o/ nach nicht-Abb. 13
palatalisierten Konsonanten, getrennt nach dem Vokal unter Betonung. Vergleich der Generationen und der Dialektgebiete.
Die Abbildungen bestätigen zunächst die Unterschiedlichkeit von Vokalen vor /a/ zwischen älteren Sprechern aus den zentralen und nordöstlichen Städten (Teildiagramm 1) und solchen aus den südwestlichen Städten (3). Sie bestätigen ebenfalls den Unterschied für Sprecher aus den zentralen und nordöstlichen Städten zwischen Vokalen vor /a/ (1) und solchen vor anderen betonten Vokalen (2). Auf die augenscheinlichen Unterschiede der Realisie-rungen von Vokalen zwischen den Generationen – nicht vor /a/ im Zentrum und Nordosten (2) und generell im Südwesten (3 und 4) – wird später ein-
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.5
1.0
0.5
0.0
1) Zentral u. Nordost, vor /a/F1
(no
rm)
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.5
1.0
0.5
0.0
2) Zentral u. Nordost, nicht vor /a/
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.5
1.0
0.5
0.0
3) Südwest, vor /a/
F1 (
norm
)
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.5
1.0
0.5
0.0
4) Südwest, nicht vor /a/
138
gegangen. An dieser Stelle sei nur auf den leichten Anstieg des ersten For-manten (der hier wie im F2/F1-Koordinatensystem absteigend skaliert darge-stellt ist) zwischen der Generation 0 und 1 bzw. 2 bei Realisierungen vor /a/ bei Sprechern aus den nordöstlichen und den zentralen Städten hingewiesen (1). Ein Mehrebenenmodell, in das nur die Sprecher aus zentralen und nord-östlichen Städten eingehen, mit dem ersten Formanten als abhängiger Vari-able, Sprecher (n=24) und Familie (n=5) als Zufallsfaktoren zeigt, dass dieser Unterschied signifikant ist:
Dissimilatives Akanje vor betontem /a/: Mehrebenenmodell für den normalisierten Tab. 25F1 (n=461). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=24, σ=0,08), Familie (n=5, σ=0,08)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,40 0,16 2,45 0,020 A.-ort rechts labial 0,27 0,08 3,51 0,000 palatal -0,87 0,45 -1,93 0,054 postalveolar 0,05 0,14 0,34 0,665 velar 0,30 0,10 3,07 0,002 A.-art links frikativ -0,10 0,12 -0,87 0,359 nasal 0,35 0,13 2,72 0,010 plosiv -0,03 0,10 -0,30 0,707 A.-art rechts frikativ -0,38 0,10 -3,95 0,000 nasal -0,11 0,13 -0,84 0,348 plosiv -0,53 0,10 -5,33 0,000 Dauer in 10 Millisekunden 0,04 0,01 3,20 0,002 Generation Generation 0 -0,26 0,09 -2,84 0,018 Generation 2 -0,07 0,07 -1,06 0,339
An dieser Stelle gehen wir nicht auf die Einflüsse des lautlichen Kontextes und der Dauer ein, sondern nur auf den signifikanten Unterschied zwischen Vertretern der Generation 0 und Vertretern der Generation 1 (dem Referenz-wert). Vertreter der Generation 1 haben einen niedrigeren zweiten Forman-ten, was auf eine offenere Realisierung in Richtung [ɐ] von Vokalen in Posi-tionen, in denen vom Dialekthintergrund ein [ɨ] oder [ə] zu erwarten wäre, schließen lässt. Auch wenn also wie oben gezeigt ein dissimilatives Muster auch bei Sprechern der Land-Stadt-Migranten-Generation bei Sprechern mit entsprechendem Dialekthintergrund absolut überwiegt, so wird eine auffällig hohe Realisierung von diesen Sprechern offensichtlich vermieden. Diese höhere Realisierung der Generation 0 ist jedoch noch stark unterschiedlich zum betonten [ɨ]. Dessen erster Formant hat einen Gesamtmittelwert von -0,60, der Gesamtmittelwert der vier Sprecher in Generation 0 beträgt 0,28. Zwischen Generation 1 und 2 ist bei der Realisierung von Vokalen vor /a/ kein Unterschied erkennbar. Die höhere Anzahl an Sprechern in Genera-
139
tion 2, für die kein dissimilatives Muster feststellbar ist, ist also in einer Bewegung der Vokale vor anderen betonten Vokalen als /a/ begründet. Hie-rauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen.
Zusammenfassung: Es zeigt sich in allen zentralen und nordöstlichen Städten für unmittelbar vorbetonte Realisierungen von /o/ und /a/ nach nicht-palatali-sierten Konsonanten deutlich das dissimilative Akanje der nordöstlichen weißrussischen Dialekte. Für Minsk ist dies wohl ein Spezifikum der unter-suchten Familie, welche aus dem nordöstlichen Vicebsker Gebiet stammt. Das dissimilative Muster findet sich bei der Mehrzahl der Vertreter der älte-ren Generationen, aber auch noch bei vier von neun Vertretern der Genera-tion 2. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, dass die betreffenden Sprecher Kontexte, wo in den Dialekten ein [ɨ]/[ə] vorliegt, absolut von solchen tren-nen, wo in den Dialekten ein [a] vorliegt. Eine solche klare Trennung der phonetischen Bereiche ist noch am ehesten bei einigen Vertretern der ältesten Generation zu beobachten. Bei den meisten Sprechern überlappen sich die phonetischen Bereiche, bleiben aber insgesamt signifikant unterschiedlich.
Für Realisierungen vor betontem /a/ – dort, wo die nordöstlichen weißrus-sischen Dialekte ein [ɨ] oder [ə] aufweisen – ist für die Generation 1 im Ver-gleich zu ihrer Elterngeneration ein leichter Anstieg des ersten Formanten, also eine etwas weniger geschlossene Realisierung, und damit weniger stark ‚weißrussisch-dialektale‘ Realisierung zu verzeichnen, die eher in Richtung [ɐ], also sowohl in Richtung des Standardweißrussischen als auch in Rich-tung des Russischen geht. Es deuten sich bereits große Unterschiede zwi-schen den Generationen bei der Realisierung von Vokalen in nicht-dissimila-tiven Akanje-Positionen an, die offensichtlich für das Zurückgehen der signi-fikanten Unterschiede zwischen den Positionen in Generation 2 verantwort-lich sind. Auf dieses wird im Folgenden eingegangen.
5.4.2.2 Zur nicht-dissimilativen Realisierung von (Akanje1) in WRGR
Mit den in Abschnitt 5.4.2 besprochenen Einschränkungen und Unsicherhei-ten gilt, dass im Weißrussischen in unmittelbar vorbetonter Position /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in einer weniger [ɐ]-artigen, also offeneren [a]-Realisierung zusammenfallen, während im Russischen die Realisierung als [ɐ] erfolgt, also stärker zentriert ist. In der folgenden Analyse wird überprüft, wie die Realisierung bei den hier untersuchten Sprechern in WRGR ausfällt.
140
Analyse 1 – Mittelwerte: Betrachten wir zunächst die durchschnittlichen Realisierungen der einzelnen Sprecher. Ausgeschlossen aus der Analyse werden Realisierungen nach (potentiell) verhärteten Konsonanten. Ebenfalls ausgeschlossen werden der absolute Anlaut und Hiatuspositionen. Für Spre-cher, die einen bei einem Signifikanzniveau von 0,05 signifikanten Unter-schied im ersten Formanten zwischen Realisierungen vor betontem /a/ und vor anderen Vokalen aufweisen (dissimilatives Akanje), werden Vokalreali-sierungen vor betontem /a/ ausgeschlossen. Pro Sprecher wurden durch-schnittlich 57,2 Token ausgewertet (12–165, σ=31,1). Tabelle 122 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token. Abbildung 14 zeigt die durchschnittlichen Realisierungen von Vokalen in Akanje-Positionen, getrennt für die drei Generationen.
Durchschnittliche Realisierung von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten Abb. 14
in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1)
Zunächst fällt auf, dass die durchschnittliche Realisierung von Akanje-Posi-tionen für alle Sprecher deutlich von der mittleren Realisierung von betontem /a/ abweicht, d.h. deutlich zentraler im Bereich [ɐ] ausfällt. Zudem deutet sich ein Unterschied zwischen der Generation 2 und den beiden älteren Generationen an, mit einem niedrigeren ersten Formanten, d.h. einer zentra-leren, [ə]-artigen Realisierung für viele der Vertreter der Generation 2.
Analyse 2 – Mehrebenenanalyse der Token (F1): In dem folgenden Mehrebenenmodell wird überprüft, ob dieser Unterschied statistisch signifi-kant ist und ob weitere Faktoren einen Einfluss auf die Realisierung von
a
ja
je o
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
●●●●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
Generation 0
a
ja
je o
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●
●●
●●●●●●●●●
●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
Generation 1
a
ja
je o
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
●●●●●●
●
●
●●●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
Generation 2
141
Vokalen in Akanje-Positionen ausüben. Folgende erklärende Faktoren wer-den in die Analyse einbezogen:
Erklärende Variablen für die Variable (Akanje1) Tab. 26
Erklärende Variable Werte / Messniveau Referenzwert Zugrunde liegendes Phonem /a/
/o/ /a/
Palatalisiertheit des folgenden Konsonanten
palatalisiert nicht-palatalisiert
nicht-palatalisiert
Artikulationsort des vorher-gehenden Konsonanten
dental labial postalveolar velar
dental
Artikulationsort des folgen-den Konsonanten
dental labial palatal postalveolar velar
dental
Artikulationsart des vorangehenden Konsonanten / des
folgenden Konsonanten102
Approximant/Liquid Nasal Frikativ Plosiv
Approximant/Liquid
Stimmhaftigkeit des vorangehenden / des folgenden Konsonanten
stimmhaft stimmlos
stimmlos
Betonter Vokal des phonologischen Wortes
/a/, /e/, /i/, /o/, /u/ /a/
Silbentyp offen geschlossen
offen
Dauer des Lautes stetig (in 10 Millisekunden) -- Häufigkeit des Lemmas (logarithmiert)
stetig --
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Dialektherkunft Südwesten Nicht aus dem Südwesten
Nicht aus dem Südwesten
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
Affinität der Äußerung/Wortform
weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
102 Vorangehende Affrikaten werden hier und im Folgenden mit Frikativen zusammengefasst,
nachfolgende Affrikaten mit Plosiven.
142
Tabelle 27 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit dem ersten Formanten von Vokalen in Akanje-Position als abhängiger Variable, d.h. die sich als signifikant erweisenden Faktoren. Familie (n=8, σ=0,19) und Spre-cher (n=33, σ=0,17) werden als Zufallsfaktoren berücksichtigt.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisier-Tab. 27ten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1), alle Äußerungen (n=1830)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,65 0,12 5,61 0,0002 Palatalisiertheit rechts palatalisiert -0,16 0,04 -4,26 0,0001 A.-ort links labial 0,17 0,04 4,02 0,0001 postalveolar -0,31 0,11 -2,67 0,0082 velar 0,12 0,05 2,59 0,0096 A.- ort rechts labial 0,11 0,05 2,49 0,0140 palatal -0,19 0,11 -1,73 0,0814 postalveolar -0,04 0,06 -0,61 0,5418 velar -0,04 0,06 -0,71 0,4918 A.- art links frikativ -0,06 0,06 -1,00 0,3204 nasal 0,22 0,07 3,26 0,0014 plosiv -0,19 0,06 -3,36 0,0008 A.- art rechts frikativ -0,25 0,05 -4,53 0,0001 nasal 0,00 0,07 0,07 0,9558 plosiv -0,43 0,05 -8,51 0,0001 Dauer in 10 Millisekunden 0,05 0,01 9,10 0,0001 Generation Generation 0 -0,04 0,11 -0,33 0,7406 Generation 2 -0,31 0,08 -3,97 0,0016
Wie zu erwarten, zeigt sich kein Unterschied zwischen den zugrunde liegen-den Phonemen /o/ und /a/, d.h. es besteht kein Zweifel an der phonologischen Reduktion. Eine Reihe lautlicher Faktoren hat Einfluss auf die Realisierung von Vokalen in Akanje-Positionen. Folgende palatalisierte Konsonanten führen zu einem niedrigeren ersten Formanten, was als Akkommodation an die Palatalisiertheit des Konsonanten interpretiert werden kann. Labiale und vorangehende Velare führen zu einem höheren ersten Formanten. Obstruen-ten (Plosive, Affrikaten und Frikative) bedingen niedrigere erste Formanten, Approximanten/Liquida und voranstehende Nasale höhere. Keinen Einfluss hat dagegen der Silbentyp (offen oder geschlossen), die Stimmhaftigkeit sowie die Qualität des Vokals unter Betonung. Schließlich ist die Dauer des Vokals hochsignifikant: Längere Vokale haben höhere erste Formanten, und zwar für jede 10 Millisekunden um 0,05 Punkte auf der normalisierten Skala. Zwischen Generation 0 und Generation 1 besteht kein Unterschied. Vertreter der Generation 2 weisen dagegen einen niedrigeren ersten Formanten, mithin
143
eine stärker zentrierte Realisierung von Vokalen in Akanje-Positionen auf. Zwischen den Geschlechtern bestehen keine Unterschiede, ebenso unter-scheidet sich die Realisierung in Äußerungen (und auch in Wortformen) unterschiedlicher Affinität nicht. Die Realisierung ist also konstant, unabhän-gig davon, in welchem „Kode“ sich die Sprecher bewegen.
Wird die Generation 0 ausgeschlossen, in der nur ein männlicher Vertre-ter erfasst ist, und die verbleibenden 28 Sprecher auf eine Interaktion zwi-schen Geschlecht und Generation geprüft, so zeigt sich, dass diese das Modell signifikant verbessert (χ2=5,21, df=1, p=0,0224). Abbildung 15 ver-deutlicht diese Interaktion.
Interaktion von Generation und Geschlecht für den normalisierten F1 von /a/ und /o/ Abb. 15
nach nicht-palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Es stellt sich also heraus, dass die im Modell ohne Interaktionen beobachte-ten Unterschiede zwischen Generation 1 und Generation 2 primär durch Unterschiede in den Geschlechtern zustande kommen. Während sich in Generation 1 die Geschlechter nicht unterschiedlich verhalten, ist für weib-liche Vertreter der Generation 2 die Realisierung von Vokalen in Akanje-Positionen zentraler sowohl im Vergleich zu Vertretern der Generation 1 als auch zu männlichen Vertretern der Generation 2. Für männliche Vertreter ändert sich die Realisierung im Vergleich zur Generation 1 kaum.
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
Generation 1
Generation 2
männlichweiblich
144
Analyse 3 – Mehrebenenanalyse der Token (F2): Tabelle 28 zeigt die Ergeb-nisse eines Mehrebenenmodells mit dem zweiten Formanten als abhängiger Variable:
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisier-Tab. 28ten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1), alle Äußerungen (n=1829). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,07), Familie (n=8, σ=0,04)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,49 0,05 -10,12 0,0001 Palatalisiertheit rechts palatalisiert 0,38 0,02 16,65 0,0001 A.-ort links labial -0,37 0,02 -16,40 0,0001 postalveolar 0,04 0,06 0,59 0,5556 velar -0,10 0,03 -4,06 0,0001 A.- ort rechts labial -0,18 0,02 -7,23 0,0001 palatal 0,57 0,06 9,53 0,0001 postalveolar 0,01 0,03 0,31 0,7516 velar -0,03 0,03 -0,99 0,3288 A.- art links frikativ 0,14 0,03 4,49 0,0001 nasal 0,13 0,04 3,54 0,0002 plosiv 0,20 0,03 6,41 0,0001 A.- art rechts frikativ 0,13 0,03 4,61 0,0001 nasal 0,12 0,04 3,38 0,0006 plosiv 0,14 0,03 5,49 0,0001 Silbentyp geschlossen 0,08 0,02 3,50 0,0004 Betonter Vokal /e/ 0,11 0,03 3,32 0,0012 /i/ 0,16 0,03 5,24 0,0001 /o/ -0,04 0,03 -1,58 0,1056 /u/ -0,09 0,03 -2,68 0,0080 Generation Generation 0 0,10 0,05 2,17 0,0404 Generation 2 -0,05 0,03 -1,55 0,1208
Wiederum erweist sich der lautliche Kontext als einflussreich: Labiale Kon-sonanten führen zu einem niedrigeren zweiten Formanten, während dentale (hier der Referenzwert), palatale und postalveolare Konsonanten sowie die Palatalisiertheit des folgenden Konsonanten einen höheren zweiten Forman-ten bedingen. Approximanten und Liquida (hier der Referenzwert) bewirken niedrigere zweite Formanten als andere Konsonanten. Ein schwacher, aber signifikanter Effekt in Richtung eines höheren zweiten Formanten ist für Vokale in geschlossenen Silben zu beobachten. Eine deutliche Assimilation ist an den betonten (und damit den folgenden) Vokal zu beobachten. Betonte Vokale mit hohem zweiten Formanten bedingen auch höhere zweite For-manten im vorbetonten Vokal. Die Dauer des Vokals hat keinen Einfluss.
Verglichen mit den lautlichen Faktoren ist der Einfluss der Generation schwach. Jedoch ist für die Generation 1 ein niedrigerer zweiter Formant als
145
für die Generation 0 zu verzeichnen. Für die Generation 2 ist der zweite For-mant nicht signifikant unterschiedlich zu Generation 1. Ansonsten erreicht kein sozialer Faktor Signifikanzniveau. Ein Einfluss der Affinität der Äuße-rung ist ebenfalls nicht festzustellen. Es ist keine Interaktion festzustellen.
Zusammenfassung: Dieser Abschnitt behandelte nicht-dissimilatives Akanje in WRGR, also die Realisierung von /a/ und /o/ in der unmittelbar vorbeton-ten Silbe nach nicht-palatalisierten Konsonanten. Für das Weißrussische wird in den untersuchten Positionen ein [a] angenommen, für das Russische ein zentrierteres [ɐ]. Als Verdeutlichung der Analysen zeigt Abbildung 16 die durch die Koeffizienten der Modelle vorhergesagten Werte für die ersten beiden Formanten für die drei Generationen 0, 1 und 2, in den jüngeren beiden nach Geschlecht getrennt. Alle anderen Faktoren werden bei ihrem Referenzwert oder dem Median gehalten.103
Vorhergesagte Werte für unterschiedliche Konstellationen von Geschlecht und Abb. 16
Generation für /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
103 Die Werte ergeben sich durch Summierung der entsprechenden Koeffizienten der in diesem
Abschnitt berechneten Modelle für den ersten und den zweiten Formanten (s. Abschnitt 5.3.3). Die Werte für Generation 0 und die F2-Werte für die jüngeren Generationen ergeben sich aus dem Modell ohne Interaktion, die F1-Werte für Generation 1 und 2 stammen aus dem Modell mit Interaktion zwischen Generation und Geschlecht.
a
ja
o
0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●●
●●
0.5 0 -0.5 -1 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
0 1w1m
2w2m
146
Zunächst ist es nicht so, dass die Realisierung von Vokalen in Akanje-Positionen mit betontem /a/ zusammenfällt. Auch für die beiden älteren Sprechergenerationen ist eine phonetische Reduktion in Richtung eines [ɐ]-artigen Lautes zu erkennen, was allerdings entgegen manchen Beschreibun-gen des Weißrussischen auch im weißrussischen Standard der Fall sein dürfte. Es bestehen zudem subtile Unterschiede zwischen den einzelnen Sprechergruppen, die der Erwartung, dass jüngere Sprecher stärker in Rich-tung des russischen Musters gehen, weitestgehend entsprechen. Vertreter der Generation 2 zeigen eine zentriertere Realisierung, die noch stärker mit den lautlichen Mustern des Russischen übereinstimmt und deutlicher von der offenen Realisierung des Weißrussischen abweicht. Hierbei ist zu bedenken, dass es sich um spontane Rede handelt, für die auch im russischen Standard deutlichere Reduktionen als [ɐ] beschrieben werden. Es ist also ein subtiler Lautwandel vom stärker ‚weißrussischen‘ Muster in Generation 0 und 1 in Richtung des ‚russischen‘ Musters bei Generation 2 erkennbar. Dabei sind es die weiblichen Vertreter der Generation 2, die stärker in Richtung des Russi-schen gehen. Dieser Wandel erfolgt unabhängig von der Affinität der Äuße-rung und der Wortform, ist also stabil, egal in welchem der drei Kodes sich der Sprecher bewegt.
/a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in weiteren 5.4.3vorbetonten Silben – die Variable (Akanje2)
Die im Folgenden untersuchten, weiteren unbetonten Kontexte (also abgese-hen von der unmittelbar vorbetonten Silbe, dem absoluten Anlaut, bei Hiatus sowie teilweise im absoluten Auslaut) werden in der Russistik traditioneller-weise als zweite Reduktionsstufe zusammengefasst. Tabelle 29 bietet eine Übersicht über Vokalrealisierungen in dieser Position im Weißrussischen, Russischen sowie in den weißrussischen Dialekten:
Realisierung von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten, weitere vor-Tab. 29betonte Silben
Standardweißrussisch, zentrale u. südwestl. wr. Dialekte
Nordöstl. wr. Dialekte Standardrussisch
[a], evtl. [ɐ] [ɨ], [ə] [ə]
Für das Russische wird als Realisierung von /a/ und /o/ ein noch stärker zent-raler Laut [ə] angenommen als in der ersten vorbetonten Silbe (in der kyrilli-schen Transkription „ъ“), wobei, wie in Abschnitt 5.4.1 erläutert wurde, strittig ist, ob dem messbaren Unterschied zur ersten Reduktionsstufe auch
147
ein repräsentationaler Unterschied zugrunde liegt. Faktisch hängt die Reali-sierung stark vom lautlichen Kontext ab (AVANESOV 1956, 117; BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER 1966, 56).
Was das Weißrussische angeht, so besteht eine gewisse Unsicherheit, wie die Realisierung von /o/ und /a/ in anderen unbetonten Silben als der unmit-telbar vorbetonten ausfällt. In einigen Arbeiten werden innerhalb unbetonter Silben keine Unterschiede in der Realisierung angenommen (JANKOŬSKI 1976, 14 und 27; BM 2004, 15), wobei auch hier wieder zuweilen vorsichtig formuliert wird.104 LOMTEV (1956, 28f.) nimmt dagegen für die zweite vor-betonte Silbe einen reduzierten Vokal mittlerer Lage an.
ANDREEV (1983) zeigt in seiner instrumentalphonetischen Untersuchung, dass auch im Weißrussischen die Formantwerte von weiteren unbetonten Silben ähnlich wie im Russischen eine stärker zentrale Aussprache nahelegen als in der vorbetonten Silbe und im absoluten Anlaut (Tab. 30). Reduzierung ist zudem in geschlossenen Silben wahrscheinlicher als in offenen, und wahr-scheinlicher bei schnellem Sprechtempo (ANDREEV 1983, 19). Die Reduzie-rung tritt auch bei Personen auf, für deren Dialekthintergrund eine Reduzie-rung nicht beschrieben ist.105
Formantwerte in Hertz von Vokalen in Akanje-Positionen im Weißrussischen nach Tab. 30ANDREEV (1983, 18, Tabelle 7). Die Ordinalzahlen geben die Distanz zur betonten Silbe an.
Vorbetont Betont Nachbetont Anlaut 4. 3. 2. 1. 1. 2. 3. Auslaut F1 590 450 456 465 508 560 359 371 367 471 F2 1340 1200 1240 1210 1356 1280 1250 1280 1250 1396
Während für die südwestlichen und zentralen Dialekte des Weißrussischen wie für die Standardsprache eine [a]-Realisierung angenommen wird, werden in nordöstlichen weißrussischen Dialekte /o/ und /a/ (unabhängig von dem betonten Vokal) als [ɨ] oder wie im Russischen als [ə] realisiert, lediglich im absoluten Anlaut liegt in den meisten Teilen des nordöstlichen Dialektgebiets [a] vor. Zudem sind in den nordöstlichen Dialekten im Kontext von labialen Konsonanten vor betontem /a/ auch [u]-artige Realisierungen möglich (vor allem in den Präfixen po-, pod-) (KRYVYCKI 2003, 182; NPBD 1964, 76–78).
104 So geben z.B. BIRYLA & ŠUBA (1985, 42f.) an, dass ein Unterschied zwischen den ver-
schiedenen unbetonten Silben kaum zu hören sei. 105 Leider sagt Andreev nichts über die Auswahl der Stimuli, insbesondere darüber, ob er auch
Kontexte nach palatalisierten Konsonanten einschließt.
148
Was den Kontakt des Weißrussischen mit dem Russischen angeht, so wird die Beobachtung, dass der weißrussische Akzent des Russischen bzw. die weißrussische Variante des Russischen durch offene Realisierungen des Allophons von /a/ und /o/ gekennzeichnet ist, in der Regel auch auf weitere unbetonte Silben ausgedehnt bzw. es wird nicht explizit zwischen beiden Positionen unterschieden. Auch SADOŬSKI (1982, 202) beobachtet in der zweiten vorbetonten und in nachbetonten Silben offene Realisierungen. Wie ANDREEV (1983) findet auch er einen Zusammenhang mit der Silbenstruktur: [ə] tritt eher in geschlossenen Silben, [ɐ]106 und [a] eher in offenen Silben auf.
Analyse 1 – Vergleich (Akanje1) – (Akanje2): Die folgende Abbildung zeigt zunächst die Durchschnittsrealisierungen von Vokalen in der entsprechenden Position bei den einzelnen untersuchten Sprechern. Analysiert werden alle Vokale in der zweiten, dritten und vierten vorbetonten Silbe. Die Mehrzahl der Token stammt jedoch aus der zweiten vorbetonten Silbe. Ausgeschlossen werden Vokale nach /ʂ/, /ʐ/ und /ʦ/ sowie nach (ʃʲː), (ʧʲ) und (rʲ). Pro Sprecher wurden durchschnittlich 28,0 Token ausgewertet (5–54, σ=9,6). Tabelle 123 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.
Durchschnittliche Realisierungen der untersuchten Sprecher von /a/ und /o/ nach Abb. 17
nicht-palatalisierten Konsonanten (1) in unmittelbar vorbetonten Silben (Akanje1) und (2) in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2)
106 Die Notierung „[aъ]“ von Sadoŭski wird hier als [ɐ] gedeutet.
1
1
11 1
1
1
11
11
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1 11 1
1
1
1
11
1
2
2
222
222
2 22
2
22
2
2
22
222
222 2
22
22
2
22
2
0 -0.1 -0.3 -0.5
1.5
10.
50
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
149
Deutlich zeigt sich in Abbildung 17, dass nicht unmittelbar vorbetonte Silben einen niedrigeren ersten und zweiten Formanten aufweisen als unmittelbar vorbetonte Silben. Beide Unterschiede sind hochsignifikant. Vokale in mittelbar vorbetonten Akanje-Positionen werden also weniger offen und weiter hinten gebildet, mithin phonetisch stärker reduziert als Vokale in un-mittelbar vorbetonten Silben.
Analyse 2 – Vergleich der Mittelwerte: Die folgende Abbildung zeigt die durchschnittlichen Realisierungen der 33 untersuchten Sprecher, getrennt nach Generationen.
Durchschnittliche Realisierung von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten Abb. 18
in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2)
Visuell sind zwischen den Generationen kaum Unterschiede zu erkennen, lediglich für Generation 2 deutet sich eine stärkere Konzentration von ge-schlosseneren Realisierungen an.
Analyse 3 – Mehrebenenanalyse der Token (F1): Um den Einfluss der Gene-ration und weiterer Faktoren zu testen, werden im Folgenden Mehrebenen-modelle mit den beiden ersten Formanten als abhängiger Variable durchge-führt. Es werden die gleichen erklärenden Variablen wie für Akanje in der ersten vorbetonten Silbe geprüft (s.o. Tab. 26, S. 141) sowie außerdem die Distanz zur betonten Silbe (zweite, dritte oder vierte vorbetonte Silbe).
Die Analysen für den ersten Formanten liefern unterschiedliche Ergeb-nisse, je nachdem, ob die Dauer des Lautes als erklärende Variable einbezo-gen wird. Tabelle 31 zeigt zunächst die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit F1 als abhängiger Variable, für das Dauer nicht als erklärende Variable
a
ja
je o
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
●
●
●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
Generation 0
a
ja
je o
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●●●
●
●
●●●●
●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
Generation 1
a
ja
je o
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
●● ●●
●●●●●●●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5
Generation 2
150
herangezogen wird. Familie (n=8, σ=0,10) und Sprecher (n=33, σ=0,13) gehen als Zufallsfaktoren in die Analyse ein.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisier-Tab. 31ten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2), ohne Berücksichtigung der Dauer des Lautes (n=990)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,79 0,11 7,37 0,0001 Palatalisiertheit rechts palatalisiert -0,26 0,05 -4,96 0,0001 A.-ort links labial 0,07 0,06 1,26 0,2048 velar 0,32 0,08 4,10 0,0001 A.- ort rechts labial 0,10 0,06 1,58 0,1184 palatal -0,22 0,18 -1,19 0,2432 postalveolar 0,07 0,12 0,54 0,5926 velar 0,21 0,07 3,07 0,0026 A.- art links frikativ -0,33 0,08 -3,94 0,0001 nasal 0,22 0,09 2,47 0,0134 plosiv -0,25 0,09 -2,85 0,0044 A.- art rechts frikativ -0,41 0,07 -6,07 0,0001 nasal -0,32 0,09 -3,39 0,0014 plosiv -0,53 0,07 -7,81 0,0001 Generation Generation 0 0,02 0,10 0,23 0,9016 Generation 2 -0,16 0,07 -2,22 0,0310 Dialektherkunft Nordost -0,16 0,09 -1,89 0,0650
Wird die Dauer des Lautes nicht berücksichtigt, so weisen sowohl Vertreter der Generation 2 als auch Sprecher aus dem Nordosten (letztere marginal signifikant) niedrigere Werte für den ersten Formanten auf. Wie zu erwarten, findet sich kein Effekt für das zugrunde liegende Phonem, auch hier besteht also kein Zweifel an der phonologischen Reduktion. Ebenso ist die Entfer-nung von der Betonung irrelevant, sowie – gegen SADOŬSKI (1982) und ANDREEV (1983) – die Art der Silbe. Wie es auch von BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER (1966) für das Russische festgestellt wurde, zeigt der lautliche Kontext einen starken Einfluss. Wie bereits in der unmittelbar vor-betonten Silbe (Akanje1, vgl. Abschnitt 5.4.2) besteht kein Unterschied zwi-schen Realisierungen in Äußerungen unterschiedlicher Affinität.
Wird dagegen die Dauer des Lautes in das Modell eingeschlossen, so lässt sich kein Effekt für die Dialektherkunft feststellen, Generation 2 unterschei-det sich nur noch marginal signifikant von Generation 1 (Tab. 32). Die Dauer des Lautes weist einen hochsignifikanten Einfluss auf, längere Vokale haben höhere erste Formanten.
151
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisier-Tab. 32ten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2) mit Berücksichtigung der Dauer des Lautes (n=990). Die signifikanten lautlichen Faktoren werden in dem Modell kontrolliert, in dieser Tabelle aber nicht gezeigt.
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,57 0,12 4,58 0,0001 Dauer in 10 Millisekunden 0,03 0,01 3,52 0,0002 Generation Generation 0 0,02 0,10 0,22 0,9052 Generation 2 -0,13 0,07 -1,76 0,0800 Dialektherkunft Nordost -0,11 0,09 -1,31 0,1998
Anders als im Falle von unmittelbar vorbetontem Akanje (Akanje1) lässt sich für Vokale in weiteren vorbetonten Silben kein von der Dauer unabhängiger qualitativer Unterschied zwischen den Generationen feststellen.
Analyse 4 – Mehrebenenanalyse der Token (Dauer des Lautes): Der Befund, dass Generation und Dialektherkunft nur ohne Berücksichtigung der Dauer signifikante Einflüsse aufweisen, legt nahe, dass Vertreter der Generation 2 und Sprecher aus dem Nordosten in nicht unmittelbar vorbetonten Akanje-Positionen kürzere Vokalrealisierungen aufweisen als die übrigen Sprecher. Wie die folgende Analyse mit der Dauer der Laute als abhängiger Variable bestätigt, ist dies tatsächlich der Fall.
Mehrebenenmodell für die Dauer (in Millisekunden) von /a/ und /o/ nach nicht-Tab. 33palatalisierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2) (n=990). Die signifikanten lautlichen Faktoren werden in dem Modell kontrolliert, in dieser Tabelle aber nicht gezeigt. Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=7,5), Familie (n=8, σ=1,9)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 71,5 4,08 17,50 0,0001 Generation Generation 0 0,2 4,51 0,05 0,8708 Generation 2 -7,8 3,36 -2,33 0,0174 Dialektherkunft Nordost -13,9 3,42 -4,07 0,0022
Vertreter der Generation 2 weisen eine um 8 Millisekunden kürzere Realisie-rung auf als Vertreter der Generation 1, Sprecher aus dem Nordosten eine um 14 Millisekunden kürzere Realisierung als Sprecher aus den zentralen und südwestlichen Gebieten. Es drängt sich natürlich die Frage auf, ob dies auf eine generelle kürzere Aussprache von Vokalen (aufgrund einer höheren Redegeschwindigkeit) in der jüngeren Generation und (weniger plausibel) Sprecher aus dem Nordosten zurückzuführen ist. Eine Überprüfung von betontem /a/ ergibt, dass es nicht grundsätzlich der Fall ist, dass jüngere Sprecher kürzere Realisierungen aufweisen (Tab. 34). Auch zwischen Spre-
152
chern aus dem Nordosten und den übrigen Sprechern gibt es für betontes /a/ keine Unterschiede in der Dauer. Dies ändert sich auch nicht, wenn jeweils nur einer der beiden Faktoren – Generation oder Dialektherkunft – in das Modell eingeschlossen wird.
Mehrebenenmodell für die Dauer (in Millisekunden) von betontem /a/ nach nicht-Tab. 34palatalisierten Konsonanten (n=1282). Lautliche Faktoren werden auch hier kontrol-liert, aber in dieser Tabelle nicht wiedergegeben. Ausgeschlossen werden Positionen im absoluten Auslaut und im Silbenanlaut. Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=18,5), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 126,5 7,1 17,9 0,0001 Generation Generation 0 8,4 10,4 0,8 0,3738 Generation 2 -8,4 7,5 -1,1 0,2674 Dialektherkunft Nordost -4,5 7,2 -0,6 0,7076
Es ist also nicht davon auszugehen, dass ein grundsätzlich schnelleres Sprechtempo für die kürzeren Realisierungen von /a/ und /o/ in weiteren vorbetonten Silben bei Vertretern der nordöstlichen Dialekte und bei Vertre-tern der jüngsten Generation verantwortlich ist. Umgekehrt ist also davon auszugehen, dass die Unterschiede in der Dauer durch die qualitativen Unter-schiede bedingt sind, die zwischen den Vokalrealisierungen der Sprecher bestehen. Ein Unterschied in der Dauer wird für das Russische und Weißrus-sische zwar nicht beschrieben. Es ist jedoch plausibel, dass die Artikulation eines qualitativ kaum reduzierten [a] eine gewisse Dauer voraussetzt, bzw. umgekehrt, dass bei einer zentrierten Realisierung eine geringere Dauer vonnöten ist. Dass offenere Vokale intrinsisch länger sind als geschlossene, gilt dementsprechend als phonetische Universalie (MADDIESON 1997). Ähn-liche Unterschiede in der Dauer zwischen qualitativ unterschiedlichen Reali-sierungen in südrussischen Dialekten mit dissimilativem Akanje finden KASATKINA (1995) und KNIAZEV & SHAULSKIY (2007).107 Es ist mithin davon auszugehen, dass Sprecher aus dem Nordosten und jüngere Sprecher eine stärker geschlossene Aussprache aufweisen, was für erstere als Einfluss des dialektalen Hintergrunds gewertet werden kann, für letztere als eine Ten-denz zur russischen Aussprache.
107 Eine Überprüfung der unmittelbar vorbetonten Position, (Akanje1), ergibt, dass auch dort
die jüngste Generation kürzere Realisierungen aufweist. Dort war wie gesehen jedoch auch unter Einbeziehung der Dauer in das Modell eine zentrierte Realisierung zu erkennen. Auch Laute gleicher Dauer werden also von der jüngsten Generation zentrierter ausgesprochen.
153
Analyse 5 – Mehrebenenanalyse der Token (F2): Auf den zweiten Formanten übt – wie Tabelle 35 zeigt – lediglich der phonische Kontext einen Einfluss aus. Soziale Parameter spielen keine Rolle, auch die Dauer des Vokals nicht. Die Affinität der Äußerung hat ebenfalls keinen Einfluss.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisier-Tab. 35ten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2) (n=990). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,08), Familie (n=8, σ=0,04)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,50 0,05 -9,49 0,0001 Palatalisiertheit rechts palatalisiert 0,53 0,03 17,45 0,0001 A.-ort links labial -0,53 0,03 -15,74 0,0001 velar -0,22 0,05 -4,95 0,0001 A.- ort rechts labial -0,41 0,04 -11,55 0,0001 palatal 0,80 0,10 7,72 0,0001 postalveolar -0,10 0,07 -1,39 0,1648 velar -0,24 0,04 -6,32 0,0001 A.- art links frikativ 0,19 0,05 4,04 0,0004 nasal 0,15 0,05 2,93 0,0040 plosiv 0,29 0,05 5,82 0,0001 A.- art rechts frikativ 0,27 0,04 6,90 0,0001 nasal 0,18 0,05 3,29 0,0020 plosiv 0,28 0,04 7,22 0,0001
Zusammenfassung: In diesem Abschnitt ging es um die Realisierung von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in weiteren, also nicht unmit-telbar vorbetonten Silben in WRGR. Für das Weißrussische wird in den untersuchten Positionen ein [a] angenommen, das nicht oder kaum phone-tisch reduziert ist, für das Russische ein klar zentriertes [ə].
In WRGR fällt die Realisierung von /a/ und /o/ hier grundsätzlich klar zentraler und weiter hinten aus als in unmittelbar vorbetonten Silben, geht also in den hinteren Bereich von [ə]. Dies ist ein Muster, das sowohl für das Standardrussische als auch für die nordöstlichen Dialekte des Weißrussischen charakteristisch ist, wobei auch für das Standardweißrussische von einigen Autoren eine stärker zentrale Realisierung angenommen wird.
Darüber hinaus bestehen Unterschiede zwischen den Sprechergruppen: Sprecher aus dem nordöstlichen Dialektgebiet zeigen eine zentralere Reali-sierung, was den dortigen Dialekten entspricht. Generation 2 zeigt ebenfalls zentralere Realisierungen als Generation 0 und 1, was als eine Tendenz in Richtung der ‚russischen‘ Variante interpretiert werden kann. Selbst bei Nicht-Berücksichtigung der Dauer ist der Einfluss des Faktors Generation
154
jedoch sehr gering, wie Abbildung 19 veranschaulicht. Die zentrierte Reali-sierung ist in allen Generationen vorherrschend.
Vorhergesagte Werte für Sprecher unterschiedlicher Generation für /a/ und /o/ nach Abb. 19
nicht-palatalisierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2) vor fri-kativen Konsonanten. Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Die tatsächliche Realisierung ist stark vom lautlichen Kontext und der Dauer des Vokals abhängig, wie dies auch BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER
(1966, 61) für das Russische feststellen. Abbildung 20 zeigt den Effekt des Artikulationsortes des vorangehenden Konsonanten.
Effekt des vorangehenden Kontexts für /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Abb. 20
Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2) vor frikativen Konsonanten (t_: nach dentalen; k_: nach velaren; p_: nach labialen Konsonanten). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
155
Deutlich ist ein niedriger zweiter Formant nach labialen Konsonanten zu erkennen, was auf eine klare Labialisierung hindeutet. In bestimmten phonologischen Kontexten (wie hier vor frikativen Konsonanten) kann dies zu einer [ɔ]-artigen Realisierung für unbetontes /a/ und /o/ führen, wie dies auch SADOŬSKI (1982, 201) in der russischen Rede von Land-Stadt-Migran-ten in Minsk vor allem im Kontext von labialen und velaren Konsonanten feststellt (s.o. 5.4.2).
Unterschiede zwischen Äußerungstypen unterschiedlicher Affinität sind nicht zu beobachten. Die phonetische Reduktion gilt also für alle Kodes, ebenso wie der subtile Lautwandel hin zu einer (noch) stärkeren Reduktion in der jüngsten Generation.
/a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in unmittelbar 5.4.4vorbetonten Silben – die Variable (Jakanje1)
Tabelle 36 zeigt die Realisierung von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Kon-sonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe im Weißrussischen und Russischen sowie in den weißrussischen Dialekten gemäß den einschlägigen Beschreibungen.
Realisierung von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten, erste vorbetonte Tab. 36Silbe
Standardweißrussisch, zentrale wr. Dialekte
Nordöstliche wr. Dialekte
Südwestliche wr. Dialekte
Standardrussisch
[a] [i], [ɪ] (wenn betont /a/ folgt) [a] (in allen anderen Fällen)
[e]/[ɛ]
[i], [ɪ]
Im modernen Standardrussischen fallen nach palatalisierten Konsonanten die Phoneme /a/, /e/ und /o/ mit /i/ in einem [i]-ähnlichen Laut zusammen, was als Ikanje („[i] sagen“) bezeichnet wird.108 Während in den meisten Studien das Allophon als „[i]“ (bzw. kyrillisch als „[и]“) transkribiert wird, handelt es sich um einen im Vergleich zum betonten [i] weniger gespannten, stärker zentralen Laut, mit einem höheren F1 und einem niedrigeren F2 (AVANESOV 1956, 106–113; BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER 1966, 60; VERBICKAJA 1976, 52; PANOV 1979, 157–160; BONDARKO 1981, 73; CROSSWHITE 2000;
108 In einigen wenigen, nicht-nativen Lexemen sind Realisierungen als [ɐ] zugelassen, z.B. in
assimiljativnyj ‚assimilativ‘:[ɐsʲɪmʲɪlʲɐˈtʲifnɨj] (vgl. PANOV 1979, 162).
156
TIMBERLAKE 2004, 44f.; KASATKIN 2009a, 49). In der Slavistik wird in latei-nischer Transkription auch [ɩ] verwendet (z.B. bei TIMBERLAKE 2004, 44).
Das Ikanje ist eine relativ junge Erscheinung. In der Moskauer Standard-sprache ist sie seit Ende des 19. Jh. zu beobachten. Noch Anfang des 20. Jh. steht sie in Konkurrenz mit der älteren Form. Früher schon ist sie in dem Moskauer Substandard Prostorečie vertreten. In der älteren Norm des Russi-schen liegt in der unmittelbar vorbetonten Position sogenanntes Ekanje vor, /a, e, o/ fallen also nicht mit /i/ zusammen, sondern werden als [e]-artiger Laut realisiert. Noch von AVANESOV (1956, 106–113) wird für /a, e, o/ eine zu /i/ unterschiedliche Realisierung als Laut zwischen [i] und [e] als normhaft angesehen. Auch wenn mittlerweile weitgehende Einigkeit besteht, dass ein kompletter Zusammenfall von /a, e, o/ mit /i/ anzunehmen ist (CROSSWHITE 2000; TIMBERLAKE 2004, 44f.; RD 2005, 43; KASATKIN 2005, 150–152; KASATKIN 2009b, 121), was in einigen akustischen Studien bestätigt wird (VERBICKAJA 1976, 52; BONDARKO, VERBICKAJA & ZINDER 1966, 60), fin-den sich gegenläufige Beobachtungen. PADGETT & TABAIN (2005) finden in einer stark kontrollierten Studie keinen kompletten Zusammenfall der unbe-tonten Vokale nach palatalisierten Konsonanten, mit signifikanten Unter-schieden sowohl für den ersten als auch für den zweiten Formanten zwischen allen Phonemen (also nicht nur zwischen /i/ einerseits und den übrigen ande-rerseits, sondern auch beispielsweise zwischen /e/ und /a/). Diese signifi-kanten Unterschiede sind zwar nicht immer groß genug, um perzeptuell rele-vant zu sein, für einige Sprecher allerdings schon, besonders in unmittelbar vorbetonter Position. Die Autoren schließen, dass der unvollständige Zusammenfall einen noch nicht abgeschlossenen lautlichen Wandel im Russischen anzeige, der daher von Faktoren wie Sprechrate und Sprechstil abhängig sei (PADGETT & TABAIN 2005, 40).109
Gemäß der weißrussischen Orthoepie fallen in der ersten vorbetonten Silbe nach palatalisierten Konsonanten die Phoneme /a/, /e/ und /o/, nicht aber /i/, zusammen, und zwar in einem [a]-artigen Laut (vgl. LOMTEV 1956, 28f.; JANKOŬSKI 1976, 29; VYHONNAJA 1987, 27; FBLM 1989, 319). In den weißrussischen Dialekten gibt es drei unterschiedliche Muster (vgl. DABM
109 Allerdings handelt es sich bei ihren Informanten um Sprecher, die teilweise schon recht
lange in der Emigration leben (teilweise dort geboren sind) und zudem aus unterschied-lichsten russischsprachigen Gebieten stammen. Obwohl die Sprecher von anderen Mutter-sprachlern als normhaft empfunden werden, ist daher nicht unwahrscheinlich, dass es sich um Träger der „älteren Norm“ handelt. Möglich ist auch ein Einfluss der Graphematik, in der die Neutralisation nicht wiedergegeben wird.
157
1963a, Karte 4; NPBD 1964, 55–66; VAJTOVIČ 1968, 56–93). „Starkes“, d.h. kontextunabhängiges Jakanje wie in der Standardsprache findet sich in den zentralen Dialekten. Im Nordosten liegt dissimilatives Jakanje vor, d.h. ähn-lich wie nach nicht-palatalisierten Konsonanten wird unterschieden, ob betont ein /a/ steht, oder nicht.110 Vor betontem /a/ werden /a, e, o/ als [i] oder [ɪ] realisiert, andernfalls als [a]. Die Variation zwischen [i] und [ɪ] ist wohl abhängig vom Sprechtempo (NPBD 1964, 58). Dissimilatives Jakanje reicht dabei weiter in zentrale Gebiete hinein als dissimilatives Akanje. In einem Übergangsgebiet zwischen dem zentralen Gebiet und dem Nordosten variie-ren dissimilatives und starkes Jakanje. In Teilen der südwestlichen Bezirke Homel’, Minsk und Brest ist schließlich Ekanje vorherrschend, d.h. /a, e, o/ fallen in einem [e]/[ɛ]-artigen Laut zusammen. Im Übergangsgebiet zwischen starkem Jakanje und Ekanje variieren [e]/[ɛ] und [a], außerdem sind auch intermediäre Varianten („[ea]“) anzutreffen (VAJTOVIČ 1968, 75).
Was die konkrete Realisierung von Vokalen in Jakanje-Positionen im Standardweißrussischen angeht, so herrscht in der Regel entweder dasselbe Meinungsbild wie für die Reduktion nach nicht-palatalisierten Konsonanten, oder es wird nicht explizit zwischen beiden Kontexten unterschieden: Ange-nommen wird eine Realisierung, die sich zwar quantitativ, aber nicht qualita-tiv von der Realisierung von /a/ (nach palatalisierten Konsonanten) unter Betonung unterscheidet.111 Oft wird diese Annahme durch ähnliche Modifikationen wie für das Akanje eingeschränkt oder es finden sich vor-sichtigere Formulierungen, die nur auf den perzeptuellen Unterschied zu vorbetontem /i/ hinweisen (vgl. z.B. FBLM 1989, 319). Es finden sich auch einige Stimmen, die Unterschiede zur Realisierung von /a/ unter Betonung feststellen: Nach der FBLM (1989, 37) macht sich unbetont der Einfluss eines voranstehenden palatalisierten Konsonanten stärker bemerkbar. [a] werde zwar nach palatalisierten generell, aber vor allem in unbetonter Posi-
110 In einigen Gebieten des Vicebsker Bezirks wird auch vor betontem /e/, teilweise vor beton-
tem /o/ ein [i] realisiert (vgl. NPBD 1964, 60–62). 111 Manchmal wird die Einschränkung „nach palatalisierten Konsonanten“ nicht getroffen, so
dass der Eindruck entsteht, dass sich weder betontes /a/ nach palatalisierten Konsonanten, noch Vokale in Jakanje-Position, noch betontes /a/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten voneinander unterscheiden. Dies ist sicherlich nicht der Fall. Nach CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988, 67f.) und der FBLM (1989, 37 und 91) unterscheiden sich die Allo-phone von /a/ nach palatalisierten und nicht-palatalisierten Konsonanten stark voneinander. Nach palatalisierten Konsonanten wird /a/ weiter vorn und geschlossener artikuliert. Diese Unterschiede in der Artikulation zwischen /a/ nach palatalisierten und nicht-palatalisierten Konsonanten würden aber von Sprechern des Weißrussischen nicht wahrgenommen (vgl. auch 5.3.1).
158
tion weiter vorn artikuliert. Wir kommen auf diese Unsicherheit unten zu-rück. Einigkeit herrscht jedoch dahingehend, dass kein Zusammenfall mit betontem /e/ angenommen wird. [e]/[ɛ] (und graphematisch <e>) in der ersten vorbetonten Silbe treten nur in einigen Lehnwörtern auf (benzin ‚Benzin‘, sezon ‚Saison‘, peron ‚Bahnsteig‘, kefir ‚Kefir‘, metal ‚Metall‘, tėlefon ‚Tele-fon‘ etc.). Gerade für frequente Lehnwörter besteht aber die Tendenz, diese auch mit Jakanje zu realisieren (vgl. BIRYLA & ŠUBA 1985, 43; FBLM 1989, 319; VYHONNAJA 1991, 201).
Abgesehen von Lehnwörtern bestehen einige weitere lexikalische Sonder-fälle. Einige orthoepische Arbeiten wie VYHONNAJA (1991, 201) schreiben auch für die proklitische Negationspartikel ne ‚nicht‘ in der ersten vorbeton-ten Silbe ein deutliches [a] vor, was in der älteren kodifizierten Norm des Weißrussischen, der sogenannten Taraškevica, auch graphemisch wieder-gegeben wird.112 Zumindest eine Tendenz zur [a]-Realisierung bestehe auch bei dem proklitischen bez ‚ohne‘. Allerdings finden sich in der Realität oft [e]/[ɛ]-artige Realisierungen.113
Beide Lexeme gehören zudem zu einer nicht umfangreichen Liste von frequenten Lexemen und Wortformen, die in der orthoepischen und phone-tisch-phonologischen Literatur zur Standardsprache (CZEKMAN &
SMUŁKOWA 1988, 208; FBLM 1989, 319; BIRYLA & ŠUBA 1985, 43f.; VYHONNAJA 1991, 201), aber auch in dialektologischen Arbeiten (VAJTOVIČ 1968, 71f.; NPBD 1964, 59 u. 62) immer wieder diskutiert werden, da ihre Realisierung von dem Muster des Jakanje abweichen kann. Obwohl von Autor zu Autor eine unterschiedliche Auswahl dieser Lexeme diskutiert wird, so werden sie stets als eine abgeschlossen Liste behandelt, und evtl. von anderen Fällen mit [i]-Realisierungen abgegrenzt (z.B. bei VAJTOVIČ 1968, 70–71 u. 85–87). Im Einzelnen sind dies folgende Lexeme bzw. Wortformen:
112 Eine zentrale Frage der Orthographiereform von 1933 betraf die Wiedergabe von /e/ und /o/
in unbetonten Silben. Während das Benutzen von <a> in allen Silben vorangetrieben wurde, erfolgte die Schreibung <ja> nur in der ersten vorbetonten Silbe. Auch in ne und bez als Klitika wurde <e> vorgeschrieben (PADLUŽNY 1990, 6).
113 Diese Variation führt in Verbindung mit der unzureichenden Trennung von deskriptiven und präskriptiven Aussagen zu geradezu absurden Aussagen in der Literatur. So schreiben BIRYLA & ŠUBA (1985, 43f.), dass der Vokal in den klitischen ne und bez immer als [e] artikuliert werde. Gleichzeitig schreiben sie jedoch, dass viele Sprecher eine Realisierung als [a] aufwiesen.
159
die Proklitika ne ‚nicht‘ und bez ‚ohne‘ das negierende Existenzprädikativ njama (und das umgangssprachliche
njamašaka bei VAJTOVIČ 1968, 71) der Optativ-/Imperativmarker njachaj dzevjaty ‚neunter‘, dzesjaty ‚zehnter‘ cjaper ‚jetzt‘ die Akkusativ-/Genitivformen der Personalpronomina der ersten und
zweiten Person mjane und cjabe, der dritten Person Femininum jae sowie des Reflexivpronomens sjabe. jae wird allerdings nur bei VAJTOVIČ (1968, 71) aufgelistet und dort nicht weiter behandelt.
jaščė ‚noch‘ (nur bei NPBD 1964, 59)
Für diese lexikalischen Elemente wird beobachtet, dass in der ersten vor-betonten Silbe neben [a] auch [i] auftritt. Für welche von diesen Elementen [i]-Realisierungen als normhaft zugelassen werden, und nach welchen Krite-rien dies geschieht, ist nicht immer ersichtlich.114 Umstritten ist zudem, wie diese Abweichungen vom weißrussischen Jakanje zu erklären sind. RAMZA (2011, 47–65; 2014), die die weite Verbreitung dieser Elemente mit [i] auch in der spontanen, nicht-offiziellen Rede von Vertretern der weißrussisch-sprachigen Intelligenz in Minsk bestätigt, wendet sich gegen die Annahme, dass hier ein Einfluss des russischen Musters vorliege (die sich z.B. bei VYHONNAJA 1991, 201 findet). Stattdessen plädiert sie für eine phonetisch-phonologische Erklärung, d.h. eine Akkommodation an die Palatalität der benachbarten Konsonanten, begünstigt durch die hohe Gebrauchsfrequenz dieser lexikalischen Elemente und ihre in der Regel schwache Betonung im Satz. Bezeichnenderweise wird bei vielen der Elemente (auch nicht von Ramza) nicht auf intermediäre [ɛ]- oder [e]-Realisierungen eingegangen. Dies spricht dafür, dass es sich bei der Variation von [a] und [i] nicht um einen aktiven phonologischen Prozess handelt, sondern um Variation von lexikalisierten Varianten, wobei die Varianten dialektal bereits eine geraume Zeit vorliegen.
Jedoch sind auch abgesehen von lexikalischen Ausnahmen sowohl für die weißrussischen Dialekte als auch für die weißrussische Standardsprache Zweifel angebracht, dass stets eine klare [a]-Realisierung vorliegt. So werden in dialektologischen Arbeiten zuweilen weitere Abweichungen von der
114 Während zum Beispiel BIRYLA & ŠUBA (1985, 43f.) für einige lexikalischen Elemente [i]
als normgerechte Variante zulassen (für njama, dzevjaty und dzesjaty), schließen sie es bei anderen (mjane, cjabe, sjabe, cjaper) aus.
160
„klaren“ [a]-Realisierung bemerkt: VAJTOVIČ (1968, 70) und KURCOVA (2010) beobachten in Positionen, wo die gängigen Dialektbeschreibungen [a] erwarten lassen, Fälle von [i]- oder [e]/[ɛ]-Realisierungen. Sowohl Vajtovič als auch Kurcova führen diese Anhebungen auf interne, kontextbedingte Variation zurück. SADOŬSKI (1982, 188, Fn. 21) interpretiert jedoch unter Bezug auf die Beispiele von Vajtovič [i] als einen Einfluss des Russischen.
Für das Standardweißrussische findet zwar PADLUŽNY (1983, 89) auch bei schnellem Sprechtempo kaum Abweichungen von [a]. VYHONNAJA (1975) zeigt jedoch in einem Perzeptionsexperiment, dass Minimalpaare wie vjali ‚führen; Prät.Pl.‘– vili ‚winden; Prät.Pl.‘ oft nicht unterschieden werden können, was auf einen geringen phonetischen Unterschied des vorbetonten Vokals hindeutet. Akustische Untersuchungen zum Jakanje finden sich in der belorussistischen Literatur allerdings kaum. ZELLER (2013c) untersucht anhand der in RAMZA (2011) veröffentlichten Aufnahmen die Jakanje-Reali-sierungen von fünf Vertretern der weißrussischsprachigen Minsker Intelli-genz in spontanen, nicht-offiziellen Gesprächen. Wie sich zeigt, sind für die erste vorbetonte Silbe angehobene Realisierungen anzutreffen, die in ihren Formantwerten in den phonetischen Bereich des betonten /e/ fallen, und dies nicht nur bei den genannten lexikalischen Ausnahmen. Zudem kann auch betontes /a/ nach palatalisierten Konsonanten angehoben werden, vor allem, wenn es sich um sogenannte schwach-betonte, nicht inhaltstragende Wörter wie ja ‚ich‘ oder jak ‚wie/als‘ handelt. Dies zeigt deutlich, dass auch im Standardweißrussischen, zumindest in spontaner nicht-offizieller Rede, von einer stets [a]-artigen Realisierung selbst bei großzügiger Auslegung nicht auszugehen ist, sondern eine Anhebung in Richtung von [ɛ] oder [e] erfolgt.
Was schließlich die Interferenz des Weißrussischen auf das Russische in Belarus angeht, so sind nicht [i]-artige Varianten in Jakanje-Positionen in der weißrussischen Variante des Russischen weit verbreitet. Oft werden neben den Varianten, die in den Kontaktsprachen vorkommen, auch intermediäre Realisierungen beobachtet (IZS 1987, 80; VYHONNAJA 1987, 27; 1991, 202; KILEVAJA 1989, 8). Die systematischste Studie ist die von Sadoŭski (z.B. SADOŬSKI 1982, 195), der (wie bereits gesagt) Ende der 1970er Jahre drei Gruppen von Sprechern untersucht: Gebürtige Minsker, Land-Stadt-Migran-ten und die dialektsprachige Elterngeneration der Land-Stadt-Migranten. In der Minsker Variante des Russischen (bei gebürtigen Minskern) finden sich nach SADOŬSKI (1982, 195) in der ersten vorbetonten Silbe nach palatali-sierten Konsonanten die Varianten [e] und [ei]. In der russischen Rede der Land-Stadt-Migranten finden sich nach palatalisierten Konsonanten beträcht-
161
liche Unterschiede zum Herkunftsdialekt (anders als nach nicht-palatalisier-ten Konsonanten, nach denen Sadoŭski die gleichen quantitativen Verhält-nisse wie für Dialektsprecher feststellt; s.o. Abschnitt 5.4.2).
Realisierungen nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe Tab. 37in der russischen Rede von Minsker Land-Stadt-Migranten (nach SADOŬSKI 1982, 203)
Herkunftsgebiet Zaslaŭe115
Herkunftsgebiet Haradzeja Dialektsprecher Migranten Dialektsprecher Migranten [a] 12% 0% 38% 0% [ea] 47% 5% 57% 11% [e] 0% 78% 2% 81% [i] 41% 17% 3% 8%
Die [a]-Realisierungen gehen bei den Migranten quantitativ zurück zugunsten von [e]-artigen Realisierungen. [i]-Realisierungen sind selten, und dies auch bei Migranten, in deren Dialekt dissimilatives Jakanje gilt, also vor betontem /a/ [i]-Realisierungen zu erwarten wären. [i] ist dann häufiger, wenn unter Betonung /i/ oder /e/ steht, die Variation ist also wohl kontextuell gesteuert. Insgesamt stellt Sadoŭski fest, dass sich die relativen Häufigkeiten der Vari-anten in beiden Dialektgruppen bereits in der Migrantengeneration einander angleichen. Es stellt sich also in seinem Sample bereits bei der Generation 1 eine stark ausgeglichene Varietät ein, wobei die häufigste Variante in der Rede der Migranten eine zwischen den Kontaktvarietäten intermediäre ist (wenn man die russische Standardaussprache zugrunde legt, und nicht die von Sadoŭski beobachtete [e]-Realisierung der Minsker Varietät, die ihrer-seits als „fudge“ (CHAMBERS & TRUDGILL 1998, 110) zwischen dem Weiß-russischen und dem Russischen anzusehen ist). Von Stilunterschieden berichtet Sadoŭski nicht.
Die Transkriptionen im OK-WRGR deuten auf ein hohes Maß an Varia-tion hin (vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2014). Auch wenn Positionen vor betontem /a/, also dissimilatives Jakanje-Positionen in den Erhebungsorten, wo dieses Merkmal durchschlägt, ausgeschlossen werden, machen auf [i]-artige Realisierungen hinweisende Transkriptionen immer noch ca. 30% aus. Transkriptionen, die auf [e]/[ɛ] hindeuten, sind mit 11% selten, auf [a]-artige Realisierungen hinweisende Transkriptionen machen dementsprechend knapp 60% der Realisierungen aus. Die Realisierung richtet sich stark nach
115 Die Gegend um Zaslaŭe (nordwestlich von Minsk) liegt bereits im Gebiet des dissimilati-
ven Jakanje.
162
der Affinität der Wortform. In ‚hybriden‘ Äußerungen weisen ‚weißrussi-sche‘ Wortformen überwiegend [a]-artige Realisierungen auf. In ‚russischen‘ Wortformen liegen dagegen fast ausschließlich [i]-Realisierungen vor, ledig-lich der konservativste, am stärksten zum Weißrussischen tendierende Sprechertyp HW zeigt noch einen hohen Anteil an [a]-artigen Realisierungen.
HENTSCHEL & ZELLER (2011) zeigen anhand akustischer Messungen für einige Sprecher exemplarisch, dass auch intermediäre Realisierungen im Bereich [e]/[ɛ] eine Rolle spielen und für einige Sprecher sogar überwiegen.
5.4.4.1 Dissimilatives Jakanje in WRGR
In diesem Abschnitt wird analog zu der Analyse des vorbetonten Vokalismus nach nicht-palatalisierten Konsonanten in Abschnitt 5.4.1 zunächst geprüft, bei welchen Sprechern ein dialektales dissimilatives Muster vorliegt. Dies ist wiederum entscheidend für das spätere Vorgehen, in der es um Unterschiede in der Qualität des nicht-dissimilativen Jakanje – eher offen und [a]-artig wie im Weißrussischen oder geschlossen und vorn als [ɪ] wie im Russischen – in unterschiedlichen Sprechergruppen gehen wird. Sollte ein Sprecher /a/, /e/ und /o/ vor betontem /a/ unterschiedlich behandeln als in anderen Kontexten und stärker [i]-artig realisieren, so müssen diese Fälle aus der weiteren Ana-lyse ausgeschlossen bzw. gesondert behandelt werden.116
Unter den sieben untersuchten Städten sind wieder zunächst für die beiden nordöstlichen (Šarkoŭščyna und Chocimsk) dissimilative Muster zu erwarten. Zudem stammen wie gesagt die meisten der Minsker Informanten, die nicht in Minsk geborenen sind, aus dem Vicebsker Gebiet, die übrigen stammen aus Übergangsgebieten. Für die beiden anderen Städte des zentralen Dialektgebiets ist die Lage nicht eindeutig. Dissimilatives Jakanje reicht insgesamt weiter in zentrale Gebiete hinein als dissimilatives Akanje. Das Gebiet des dissimilativen Jakanje geht bis an Smarhon’ heran (DABM, Karten 1 und 4). Rahačoŭ liegt ebenfalls an der Grenze zum Gebiet des dissimilativen Jakanje, ebenso wie das Gebiet Homel’, aus dem die Mehrzahl der Informanten aus Rahačoŭ stammt. Mahilëŭ, aus dem eine weitere Infor-mantin stammt, fällt klar in das Gebiet des dissimilativen Jakanje.
116 Das ebenfalls dialektale Ekanje – die Realisierung als [e]/[ɛ] unabhängig vom betonten
Vokal – muss dagegen an dieser Stelle noch nicht abgeprüft werden, da die Variable hier „isomorph“ mit der Variable bei Sprechern des nicht-dissimilativen Jakanje verlaufen würde.
163
Analyse 1 – Dissimilatives Jakanje bei den einzelnen Sprechern: Wie bereits für das dissimilative Akanje wird mithilfe von t-Tests geprüft, ob für den einzelnen Sprecher zwischen Realisierungen in Jakanje-Positionen vor betontem /a/ und solchen vor anderen betonten Vokalen signifikante Unter-schiede bestehen. Anders als im Falle von Akanje, wo Variation nach dem Parameter der Zungenhöhe vorliegt, ist hier auch die Zungenlage, d.h. ob der Vokal weiter vorn oder weiter hinten artikuliert wird, relevant. Es werden hier daher die ersten beiden Formanten auf Unterschiede überprüft. Für den ersten Formanten wird geprüft, ob der Wert vor betontem /a/ signifikant niedriger ist als in anderen Wortformen. Für den zweiten Formanten wird geprüft, ob der Wert vor betontem /a/ höher ist als in anderen Wortformen (es handelt sich also jeweils um einseitige Tests).
Tabelle 38 fasst zusammen, für welche Sprecher signifikante Unter-schiede im ersten Formanten bestehen.
Zur Unterschiedlichkeit des F1 und des F2 von unmittelbar vorbetontem /a/, /e/ und Tab. 38/o/ nach palatalisierten Konsonanten vor betontem /a/ einerseits und vor anderen Vo-kalen andererseits (dissimilatives Jakanje) in den nordöstlichen und zentralen Städten
Gen. Geschl. F1/F2 vor /a/ F1/F2 sonst t-Wert df p-Wert ch_P 0 w 520 (n=23) 612 (n=34) -2,83 35,06 0,004 2010 2051 -0,54 53,35 0,704 ch_C 1 m 391 (10) 429 (44) -2,62 25,04 0,007 1449 1559 -2,05 15,28 0,971 ch_A 1 w 468 (10) 522 (45) -2,02 20,99 0,028 1939 1886 0,65 14,03 0,263 ch_R 2 m 332 (16) 289 (25) 2,59 25,95 0,992 1873 1890 -0,21 34,05 0,584 ch_N 2 w 427 (3) 439 (14) -0,39 4,78 0,357 2019 2157 -1,28 5,01 0,871 mi_V117 0 w 431 (17) 520 (51) -4,59 31,36 0,000 2093 1841 2,78 30,36 0,005 mi_B 1 m 455 (19) 462 (36) -0,35 40,13 0,363 1648 1529 1,67 24,87 0,054
117 Da die Minsker Informanten aus dem Raum Vicebsk stammen, wurde für diese Informan-
ten außerdem auf sogenanntes dissimilatives Jakanje des Vicebsker Typs, in dem [i] vor betontem /a/ und vor betontem /e/ auftritt, geprüft. Dazu wurde die Realisierung vor /e/ mit denen vor anderen Vokalen als /e/ und /a/ verglichen. Nur die Vertreterin der Generation 2 (mi_F) zeigt hier einen signifikant niedrigeren F1 vor /e/. Da ihre Realisierungen vor /a/ sich jedoch nicht von Realisierungen vor anderen betonten Vokalen als /e/ und /a/ unter-scheiden, ist davon auszugehen, dass hier nicht dissimilatives Jakanje des Vicebsker Typs, sondern eine Assimilation an den betonten Vokal und/oder an den nachfolgenden Konso-nanten, der angesichts des betonten /e/ mit hoher Wahrscheinlichkeit palatalisiert ist.
164
mi_A 1 w 471 (16) 533 (50) -2,53 27,79 0,009 1987 1761 2,44 21,46 0,012 mi_Y 2 m 367 (7) 340 (27) 0,98 9,28 0,824 1724 1731 -0,04 7,26 0,516 mi_F 2 w 475 (12) 485 (23) -0,28 17,75 0,390 1946 2033 -1,06 25,53 0,850 ra_D 0 m 429 (28) 459 (61) -1,94 79,81 0,028 1872 1756 2,61 61,83 0,006 ra_B 0 w 487 (7) 630 (54) -4,01 10,01 0,001 2028 1880 0,70 6,62 0,255 ra_S 1 m 400 (22) 459 (37) -3,15 43,53 0,001 1712 1492 3,81 33,64 0,000 ra_L 1 w 413 (22) 479 (37) -2,92 56,83 0,003 1981 1929 0,67 45,89 0,254 ra_C 2 m 371 (15) 357 (37) 0,56 24,06 0,710 1551 1625 -1,19 42,75 0,879 ra_A 2 w 482 (30) 454 (44) 1,67 70,33 0,950 1883 1893 -0,11 68,26 0,545 sa_T 1 m 424 (21) 552 (60) -8,03 33,85 0,000 1902 1692 2,64 32,95 0,006 sa_M 1 w 460 (4) 615 (15) -1,58 4,33 0,092 2307 1890 3,16 5,08 0,012 sa_I 2 w 400 (19) 488 (42) -4,44 58,42 0,000 1914 1924 -0,19 38,72 0,575 sa_N 2 w 506 (21) 567 (62) -3,84 60,19 0,000 1859 1748 1,73 43,52 0,045 sm_B 1 m 379 (11) 404 (15) -0,86 23,32 0,200 1514 1657 -2,34 24,00 0,986 sm_A 1 w 563 (13) 584 (55) -0,43 18,99 0,337 1900 1990 -1,39 22,19 0,911 sm_C 1 w 483 (10) 599 (17) -2,16 24,90 0,020 2110 1899 1,59 13,13 0,068 sm_AF 2 m 429 (21) 422 (28) 0,31 42,28 0,619 1583 1518 1,38 46,19 0,087
Dissimilative Muster sind bei allen vier Sprechern in der älteren Generation 0 vorhanden und überwiegen auch in der Generation 1 (acht von elf Spre-chern). Bei der Generation 2 sind sie nur bei den Sprechern aus Šarkoŭščyna anzutreffen.118
118 Auch hier bestehen natürlich Unterschiede in der Deutlichkeit der Unterschiede zwischen
den relevanten phonologischen Positionen. So ist für Sprecher sa_T eine recht klare Tren-nung der beiden Positionen zu erkennen, für die anderen Sprecher bestehen große Überlap-pungen (vgl. die Abbildungen der Einzelrealisierungen im Anhang).
165
Verteilung von Sprechern aus den nordöstlichen und zentralen Städten mit Tab. 39dissimilativem Jakanje auf die drei Generationen
diss. Jakanje Generation 0 Generation 1 Generation 2 gesamt ja 4 8 2 14 nein 0 3 7 10 gesamt 4 11 9 24
Der Exakte Fisher-Test belegt, dass signifikante Unterschiede zwischen den Generationen bestehen (p=0,017).119 Es ist also davon auszugehen, dass das dissimilative Jakanje zurückgeht.
Analyse 2 – Zum Zusammenhang von dissimilativem Jakanje und dissimilati-vem Akanje: Es stellt sich natürlich die Frage, ob Sprecher, die dissimilatives Jakanje aufweisen, auch dissimilatives Akanje aufweisen. Wie Tabelle 40 zeigt, ist das Muster für die Mehrzahl der Sprecher konstant in beiden Berei-chen dissimilativ oder nicht dissimilativ.
Zusammenhang der Verteilung von dissimilativem Akanje und dissimilativem Tab. 40Jakanje bei den Sprechern aus den nordöstlichen und zentralen Städten
diss. Jakanje kein diss. Jakanje gesamt diss. Akanje 12 4 16 kein diss. Akanje 1 6 7 gesamt 13 10 23
Nur fünf von 23 Sprechern aus den nicht-südwestlichen Städten zeigen nur in einem der beiden Bereiche ein dissimilatives Muster. Von diesen fünf weisen vier ein dissimilatives Muster nach nicht-palatalisierten Konsonanten, aber nicht nach palatalisierten auf. Nur ein Sprecher zeigt dissimilatives Jakanje, aber kein dissimilatives Akanje.120
Analyse 3 – Entwicklung der Vokalkategorien: Auch für dissimilatives Jakanje sei der Frage nachgegangen, wie das Zurückgehen des dissimilativen Musters in Generation 2 vonstatten geht. Die Frage ist, ob die Realisierung vor betontem /a/ stabil im hohen Bereich als [i]/[ɪ] erfolgt, während sich die Realisierung vor anderen Vokalen an sie annähert, d.h. angehoben wird, oder ob die Realisierung vor anderen Vokalen stabil im Bereich [a] bleibt, wäh-
119 Zusätzlich zu diesen Sprechern findet sich bei der weiblichen Vertreterin der Generation 1
in Akcjabrski ein marginal signifikanter Unterschied im ersten und ein signifikanter Unter-schied im zweiten Formanten. Wie dies zu erklären ist, ist unklar. Für alle anderen Sprecher aus den südwestlichen Städten bestehen keine signifikanten Unterschiede.
120 Sprecherin sa_M wird hier ausgelassen, da sie für die Analyse des dissimilativen Akanje nicht genügend Realisierungen aufweist.
166
rend die Realisierung vor betontem /a/ abgesenkt wird. Für das dissimilative Akanje war von der Generation 0 zur Generation 1 ein leichter Anstieg des ersten Formanten festzustellen, also eine Bewegung vom ‚dialektalen‘ [ɨ]/[ə] in Richtung des ‚weißrussischen‘ [a] und des ‚russischen‘ [ɐ].
Durchschnittliche F1-Werte von unmittelbar vorbetontem /a/, /e/ und /o/ nach Abb. 21
palatalisierten Konsonanten, getrennt nach dem Vokal unter Betonung. Vergleich der Generationen und der Dialektgebiete.
Abbildung 21 (Teildiagramm 1) zeigt, dass nach palatalisierten Konsonanten eine solche Bewegung des Vokals vor betontem /a/ hin zu einer stärker [a]-artigen bzw. weniger [i]-artigen Realisierung bei jüngeren Generationen nicht vorliegt. Dies würde einen höheren F1 bedeuten. Vielmehr bleibt die Realisierung stabil im Bereich [i]. Auch der in Abbildung 21 (Teil-
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.0
0.5
0.0
-0.5
1) Zentral u. Nordost, vor /a/
F1 (
norm
)
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.0
0.5
0.0
-0.5
2) Zentral u. Nordost, nicht vor /a/
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.0
0.5
0.0
-0.5
3) Südwest, vor /a/
F1 (
norm
)
Gen 0 Gen 1 Gen 2
1.0
0.5
0.0
-0.5
4) Südwest, nicht vor /a/
167
diagramm 1) sich andeutende Abfall des ersten Formanten von Generation 0 zu Generation 1 ist nicht signifikant.
Zusammenfassung: Ebenso wie für die entsprechende Position nach nicht-palatalisierten Konsonanten findet sich bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Sprechern in WRGR auch nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Position das dissimilative Muster der nordöstli-chen weißrussischen Dialekte. Bei allen Vertretern der ältesten Generation und bei der Mehrzahl der Vertreter der Generation der Land-Stadt-Migranten aus den zentralen und den nordöstlichen Städten ist die Realisierung vor betontem /a/ stärker [i]-artig, vor anderen Vokalen stärker [a]-artig. In der Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten ist nur für wenige Sprecher ein solcher Unterschied zu erkennen. In der Regel sind es dieselben Sprecher, die auch das Pendant nach nicht-palatalisierten Konsonanten aufweisen.
Während im Falle des dissimilativen Akanje ein Rückgang des dialekta-len, d.h. nicht mit dem weißrussischen Standard übereinstimmenden Merk-mals zu verzeichnen ist, bleibt im Falle des dissimilativen Jakanje die ‚dia-lektale‘ Realisierung als [i] stabil. Die Frage ist, wie dieser Unterschied zwi-schen dem dissimilativen Akanje und dem dissimilativen Jakanje zu erklären ist. Die Vermutung liegt nahe, dass eine offenere Realisierung für Vokale in dissimilativen Jakanje-Positionen im Gegensatz zum Akanje nicht erfolgt, da im Falle des Jakanje anders als beim dissimilativen Akanje die dialektale Realisierung bereits mit der russischen Realisierung zusammenfällt. Das aus Sicht der weißrussischen Standardsprache dialektale Merkmal [i] fällt also anders als im Falle des dissimilativen Akanje im Output mit dem Russischen zusammen.
Man kann also nur in einem gewissen Sinne von einem Rückgang des dissimilativen Jakanje sprechen. Dass die dissimilativen Muster in der Gene-ration 1 und vor allem 2 zurückgehen, ist offensichtlich auf die Realisierung vor anderen Vokalen als /a/ zurückzuführen, die – wie die Teile 2), 3) und 4) der obigen Abbildung nahelegen – in den Generationen 1 und vor allem 2 deutlich weniger offen, d.h. weniger [a]-artig erfolgt. Es ist also ein Rück-gang des Jakanje allgemein, nicht ein Rückgang des dissimilativen Musters. Diesem wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.
Für die praktische Vorgehensweise bedeutet der Befund, dass für viele der untersuchten Sprecher aus den zentralen und den nordöstlichen Gebieten dissimilatives Jakanje vorliegt, wie eingangs dargelegt, dass eine Reduzie-rung des Samples notwendig ist. Für Sprecher, die Vokale vor betontem /a/ anders behandeln und stärker [i]-artig realisieren, können sinnvollerweise nur
168
Vokale, die nicht vor betontem /a/ stehen, mit den Realisierungen anderer Sprecher verglichen werden, für die solche Unterschiede nicht bestehen.
5.4.4.2 Zur nicht-dissimilativen Realisierung von (Jakanje1) in WRGR
In den nun folgenden Analysen werden für Sprecher, bei denen sich für Vo-kale vor betontem /a/ und solche vor anderen betonten Vokalen der erste Formant signifikant oder der erste Formant marginal signifikant und der zweite Formant signifikant voneinander unterscheiden, nur Realisierungen berücksichtigt, die nicht vor betontem /a/ stehen.
Analyse 1 – Vergleich der Mittelwerte in den Generationen: Abbildung 22 zeigt die normalisierten Mittelwerte des ersten und zweiten Formanten der einzelnen Sprecher, getrennt nach Generation. Die Ellipsen zeigen als Ver-gleichswert die Mittelwerte der betonten Vokale der Sprecher an. Pro Spre-cher wurden durchschnittlich 44,0 Token ausgewertet (8–78, σ=17,1). Tabelle 124 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.
Durchschnittliche Realisierung von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten Abb. 22
in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1)
Deutlich zeigen sich Unterschiede zwischen den Generationen: Von den Sprechern der Generation 0 zeigen drei Sprecher durchschnittliche Reali-sierungen, die an der Peripherie des Bereichs des betonten /a/ nach palatali-sierten Konsonanten liegen (die mit „ja“ gekennzeichnete Ellipse in der Abbildung). Für zwei Sprecher gehen die Werte in den Bereich oder in Richtung des betonten /e/ nach palatalisierten Konsonanten. Für die Genera-
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●●
●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●●●●●●●●●●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
●●●●
●●●●●●
●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 2
169
tion 1 zeigen zwar zwei Sprecher Realisierungen, die nahe am Bereich des betonten /a/ nach palatalisierten Konsonanten liegen. Insgesamt zeigt sich jedoch für diese Generation eine deutliche Verschiebung in Richtung des betonten /e/. Für die Generation 2 liegen die Werte der meisten Sprecher im Bereich zwischen denen von /i/ und /e/, nur für zwei Sprecher liegen sie im Bereich zwischen /e/ und /a/, hierbei aber deutlich näher an /e/. Die durch-schnittlichen Werte belegen also einen deutlichen Trend von einer eher offe-nen, noch weitgehend mit den Beschreibungen des Weißrussischen überein-stimmenden Lautung im Bereich [æ] über eine intermediäre Realisierung im Bereich [ɛ]/[e] hin zu einer weitgehend mit dem russischen Muster überein-stimmenden Lautung im Bereich [ɪ]/[i].
Analyse 2 – Der erste Formant: In den folgenden Analysen wird geprüft, welche Faktoren die Realisierung der Vokaltoken beeinflussen. Tabelle 41 gibt eine Übersicht über die erklärenden Variablen, ggf. mit Angabe der Ausprägung, die als Referenzwert dient:
Erklärende Variablen (Jakanje1) Tab. 41
Erklärende Variable Werte / Messniveau Referenzwert Etymologische Klasse |e|
|o| |a|
|e|
Palatalisiertheit des folgenden Konsonanten
palatalisiert nicht-palatalisiert
nicht-palatalisiert
Artikulationsort des vorhergehenden / des folgenden Konsonanten
labial dental palatal postalveolar velar
dental
Artikulationsart des folgenden / des vorhergehenden Konsonanten
Liquid/Approximant121
Nasal Frikativ Plosiv
Liquid/Approximant
Stimmhaftigkeit des vorangehenden / des folgenden Konsonanten
stimmhaft stimmlos
stimmlos
121 Vorangehende Affrikaten werden auch hier mit Frikativen zusammengefasst, nachfolgende
Affrikaten mit Plosiven.
170
Betonter Vokal des phonologischen Wortes
/a/ /e/ [i] [ɨ] /o/ /u/
/a/
Dauer des Lautes stetig (in 10 Millisekun-den)
--
Silbentyp offen geschlossen
offen
Häufigkeit des Lemmas (logarithmiert) stetig -- (Diverse lexikalische Variablen, s.u.) trifft zu
trifft nicht zu trifft nicht zu
[e] im Weißrussischen trifft zu trifft nicht zu
trifft nicht zu
Dialektherkunft Südwest Nicht-Südwest
Nicht-Südwest
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform weißrussisch russisch gemeinsam hybrid
weißrussisch
Hierzu seien folgende Anmerkungen angebracht:
Bei der Etymologischen Klasse erhalten nur die Nominative der Personalpronomina jana ‚3P.Fem.Sgl.‘, jano ‚3P.Neutr.Sgl.‘, jany ‚3P.Pl.‘ den Wert |o|. Hier liegt historisch ein anlautendes /o/, also ein Akanje-Phänomen vor, das heutige anlautende [j] ist durch ana-logischen Ausgleich an die obliquen Kasus bedingt. Synchron liefern die Wortformen jedoch den nötigen Input für weißrussisches Jakanje oder russisches Ikanʼe. Zwischen /e/ und /o/, wenn letzteres historisch auf /e/ zurückgeht, wird dagegen nicht unterschieden, da oft nicht zu entscheiden ist, welches Phonem zugrunde liegt. Dies ist der Fall, wenn die Silbe nie unter Betonung auftritt oder im Para-digma unter Betonung Phonemalternationen vorliegen: njasu ‚tra-gen; 1.Sgl.Präs.‘, bei nës /nʲos/ ‚tragen; Mask.Sgl.Prät.‘ und nesla /nʲesla/ ‚tragen; Fem.Sgl.Prät.‘ (vgl. GIGER 2008, Fn. 23). In solchen Fällen wird also der Wert |e| vermerkt. |a| wird vermerkt, wenn das zugrunde liegende Phonem ein /a/ ist.
171
Die Lexeme bzw. Wortformen (als Type), die in der Literatur als lexikalische Ausnahmen bezeichnet werden, also cjaper/teperʼ122, bez, ne, njama, njachaj, dzevjaty, dzesjaty, sjabe, mjane, cjabe, jaje und jaščė, gehen als eigene Faktoren in die Analyse ein. Der Refe-renzwert ist jeweils, dass die Wortform, in dem der jeweilige Laut auftritt, nicht zu dem entsprechenden Lexem gehört. Gehen alle diese Faktoren in das Modell ein, so werden also die Instanzen der genannten einzelnen Lexeme/Wortformen (als Type) mit allen Wortformen (als Token) verglichen, die nicht zu der Klasse der lexikalischen Ausnahmen gehören (die also nicht einen eigenen Faktor bilden). Wenn sich beispielsweise cjaper/teperʼ und njachaj als nicht-signifikant unterschiedlich zu den anderen Wortformen erwiesen und aus dem Modell ausgeschlossen würden, wäre der Vergleichswert also alle anderen Wortformen inklusive cjaper/teperʼ und njachaj.123
Eine eigene Variable erhält auch das „Interlexem“ ru. sidetʼ bzw. wr. sjadzecʼ ‚sitzen‘ sowie deren Derivate. Beide haben dieselbe Etymologie, der vorbetonte Vokal geht auf |ě| zurück, dem wr. und ru. /e/ entsprechen müsste (vgl. ECKERT, CROME & FLECKENSTEIN 1983, 121; ISAČENKO 1980, 185). Da aber anders als bei anderen Lexemen hier im russischen Schriftbild <i> steht, was auf eine Uminterpretation des vortonigen Phonems hindeutet, ist nicht klar, was als zugrunde liegendes Phonem angenommen werden müsste.
Ebenso geht die proklitische Präposition dlja ‚für‘ als eigener Faktor in das Modell ein. Für dlja wird im Russischen in der unmittelbar vorbetonten Silbe eine Realisierung, die nicht dem Ikanje entspricht, also eine stärker [a]-artige Realisierung beschrieben (OSRJa 1988, 682).
122 Während die anderen Lexeme als ‚weißrussisch‘ einzustufen sind, sich also auf der Ebene
der morphonemischen Repräsentation von den russischen Entsprechungen unterscheiden, oder ‚gemeinsam‘ sind und sich nicht vom Russischen unterscheiden (wie bez und ne), unterscheidet sich das weißrussische cjaper in hier als phonisch gewerteten Unterschieden vom russischen teperʼ. Daher werden für diese lexikalische Variable die weißrussische und die russische Nennform angegeben.
123 Für eine vergleichbare Analyse mit einem Lexem als eigenem Faktor vgl. LABOV (1994, 181f.).
172
In der Variable [e] im Weißrussischen ist vermerkt, ob auch im Standardweißrussischen eine [e]-Realisierung vorliegt, wie dies in einigen Lehnwörtern (kefir, tėlefon usw.) der Fall ist.
Wie gesagt ist in einigen südwestlichen Gebieten von Belarus Ekanje das vorherrschende Muster, vorbetontes /a/, /e/, /o/ werden also als [e]/[ɛ] reali-siert. Es ist daher möglich, dass Informanten aus den südwestlichen Städten Baranavičy und Akcjabrski sich anders verhalten als die übrigen Informan-ten. Dies sind zudem die Städte, in denen keine dissimilativen Muster erkennbar sind. Beide liegen jedoch nicht direkt im Ekanje-Bereich. Bei Baranavičy und auch um Hrodna, woher die Informanten aus Baranavičy stammen, finden sich vereinzelte Inseln mit Ekanje. Um Akcjabrski sind es deutlich mehr (vgl. DABM 1963a, Karte 4).
Tabelle 42 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit dem ersten Formanten als abhängiger Variable. Sprecher (n=33, σ=0,19) und Familie (n=8, σ=0,11) werden als Zufallsfaktoren kontrolliert.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Tab. 42Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1), alle Äußerungen (n=1426)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,24 0,14 1,67 0,1058 Etymolog. Klasse |a| 0,18 0,06 2,92 0,0050 |o| -0,15 0,13 -1,16 0,2516 Palatalität rechts palatalisiert -0,22 0,05 -4,87 0,0001 A.-ort links labial 0,16 0,07 2,14 0,0302 palatal -0,14 0,08 -1,79 0,0694 postalveolar 0,06 0,12 0,55 0,5928 velar -0,01 0,36 -0,02 0,9878 A.-ort rechts labial 0,07 0,06 1,13 0,2746 palatal -0,62 0,13 -4,79 0,0001 postalveolar 0,04 0,07 0,57 0,5822 velar 0,16 0,08 1,99 0,0456 A.-art links frikativ -0,27 0,07 -3,70 0,0002 nasal 0,06 0,10 0,66 0,5092 plosiv -0,30 0,12 -2,58 0,0116 A.-art rechts frikativ -0,43 0,07 -5,94 0,0001 nasal 0,11 0,09 1,19 0,2322 plosiv -0,47 0,07 -7,16 0,0001 Dauer (in 10 Millisek.) 0,05 0,01 8,42 0,0001 Lexikal. Faktoren bez -0,47 0,22 -2,18 0,0294 cjaper/teperʼ -0,29 0,14 -2,04 0,0390 mjane -0,62 0,21 -3,01 0,0022 ne -0,21 0,09 -2,25 0,0266
173
[e] im Weißruss. [e] im Weißruss. -0,44 0,12 -3,68 0,0002 Generation Generation 0 0,22 0,12 1,80 0,0834 Generation 2 -0,33 0,09 -3,77 0,0002 Dialektherkunft Südwesten -0,24 0,11 -2,07 0,0688 Geschlecht weiblich 0,17 0,08 2,09 0,0330 Affinität Äußerung gemeinsam -0,11 0,10 -1,19 0,2398 hybrid -0,17 0,05 -3,24 0,0010 russisch -0,33 0,07 -5,13 0,0001
Interessant ist zunächst der signifikante Unterschied zwischen den zugrunde liegenden Lautklassen |a|, |e|, und |o|, der in keiner der beiden Kontaktspra-chen zu beobachten ist, zumindest nicht in den postulierten Normen. |e| und |o| (letzteres verweist wie gesagt auf die Personalpronomen jana, jano, jany) haben einen niedrigeren F1, was auf eine stärker angehobene, also [i]-artige Realisierung verweist. /a/ bleibt dagegen auch phonetisch näher an [a]. Insge-samt liegt also keine (komplette) Neutralisation vor. Dieser Befund erinnert an die Diskussion um andere unbetonte Silben im Weißrussischen, hier wird von einigen Autoren nur für zugrunde liegendes /a/ eine [a]-artige Ausspra-che angenommen (s.u. 5.4.5). PADGETT & TABAIN 2005 finden wie gesagt für das Russische ebenfalls Unterschiede zwischen den Vokalphonemen, wobei auch bei ihnen /a/ am wenigsten [i]-artig realisiert wird.
Der lautliche Kontext hat einen starken Einfluss auf den ersten Forman-ten. Nachfolgende palatalisierte Konsonanten bedingen einen niedrigen ers-ten Formanten. Das palatale /j/ bewirkt ebenfalls einen niedrigeren ersten Formanten, während Labiale und nachfolgende Velare zumindest tendenziell eine Erhöhung des ersten Formanten bewirken (der Referenzwert sind hier al-veolare Konsonanten). Obstruenten bewirken einen niedrigeren ersten For-manten. Der Silbentyp und die Stimmhaftigkeit der umgebenden Konso-nanten weisen keinen signifikanten Effekt auf. Zudem spielt die Dauer des Vokals eine Rolle, kürzere Vokale haben einen niedrigeren ersten Formanten, wobei – wie im Falle der Variation nach nicht-palatalisierten Konsonanten – zunächst unklar bleiben muss, ob die kürzere Dauer Ursache oder Folge der stärkeren Geschlossenheit des Vokals ist. Die Variation von Vokalen in Jakanje-Position ist also auch durch allgemeine natürliche Faktoren bedingt, niedrigere erste Formanten sind also teilweise Folge einer Akkommodation an die Palatalität der benachbarten Konsonanten.
Einige Lexeme/Wortformen tendieren stärker als die übrigen Lexeme zu einer [i]-artigen Artikulation. Dies sind ne, bez, mjane und tendenziell cjaper/teper’. Die Lexeme njama, njachaj, dzjavjaty, sjabe, cjabe sowie sidet’/sjadzec’ und auch dlja verhalten sich dagegen nicht anders als die
174
übrigen. Lexeme, in denen auch die weißrussische Norm [e]/[ɛ] erlaubt (wie tėlefon usw.), haben auch in WRGR einen niedrigeren ersten Formanten.
Der oben für die durchschnittlichen Realisierungen in Abbildung 22 (S. 168) beobachtete Unterschied zwischen den Generationen bestätigt sich statistisch. Zwar ist der Unterschied zwischen Generation 0 und 1 nur marginal signifikant, dies ist aber bei der geringen Sprecherzahl der Generation 0 nicht verwunderlich. Generation 2 verhält sich deutlich anders als die übrigen Generationen und weist geschlossene, stärker [i]-artige Realisierungen auf. Auch der Faktor Geschlecht ist signifikant: Weibliche Sprecher haben einen höheren ersten Formanten, weisen also offenere Realisierungen auf als männliche. Sprecher aus den südwestlichen Städten haben einen niedrigeren ersten Formanten. Schließlich ist zusätzlich zur Variation zwischen den Spre-chergruppen festzustellen, dass die phonische Affinität anders als im Falle des Akanje nicht unabhängig von der morphologischen Affinität der Äußerung ist. Potentielle Jakanje-Positionen in morphologisch ‚weißrussischen‘ Äußerungen haben einen höheren ersten Formanten als ‚hybride‘ und ‚gemeinsame‘ Äußerungen, letztere einen höheren als solche in ‚russischen‘ Äußerungen.
Analyse 3 – Der zweite Formant: Was den zweiten Formanten angeht, so legte Abbildung 22 (S. 168) nahe, dass hier zwischen der Generation 0 und 1 einerseits und der Generation 2 andererseits ein Unterschied besteht. Auch dies bestätigt sich:
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Tab. 43Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1), alle Äußerungen (n=1426). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,12), Familie (n=8, σ=0,06)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,06 0,09 0,60 0,5352 Etymolog. Klasse |a| -0,07 0,04 -1,70 0,0840 |o| 0,18 0,09 1,91 0,0552 Palatalität rechts palatalisiert 0,36 0,04 9,29 0,0001 A.-ort links labial -0,04 0,05 -0,90 0,3578 palatal 0,09 0,05 1,64 0,1054 postalveolar 0,04 0,08 0,46 0,6396 velar 0,73 0,24 2,97 0,0030 A.-ort rechts labial -0,03 0,04 -0,70 0,4930 palatal 0,85 0,09 9,54 0,0001 postalveolar 0,02 0,05 0,42 0,6666 velar 0,01 0,05 0,15 0,8870 A.-art links frikativ 0,02 0,05 0,38 0,7246 nasal 0,42 0,05 8,04 0,0001 plosiv 0,09 0,07 1,26 0,2122
175
A.-art rechts frikativ 0,19 0,05 4,02 0,0001 nasal 0,11 0,06 1,85 0,0644 plosiv 0,28 0,04 6,30 0,0001 betonter Vokal /e/ 0,09 0,05 1,91 0,0598 [i] 0,17 0,06 3,03 0,0024 /o/ -0,05 0,04 -1,21 0,2256 /u/ -0,07 0,05 -1,38 0,1662 [ɨ] 0,01 0,07 0,17 0,8808 Dauer (in 10 Millisek.) -1,29 0,42 -3,09 0,0014 Lexikal. Faktoren njama 0,34 0,14 2,38 0,0206 [e] im Weißrussischen [e] im Wr. 0,19 0,08 2,37 0,0196 Generation Generation 0 0,00 0,08 -0,05 0,9424 Generation 2 0,19 0,06 3,40 0,0016 Dialektherkunft Südwesten 0,12 0,07 1,71 0,1078 Affinität Äußerung gemeinsam 0,03 0,06 0,47 0,6388 hybrid 0,09 0,03 2,46 0,0154 russisch 0,09 0,04 2,10 0,0344
Es zeigen sich ähnliche Unterschiede zwischen den zugrunde liegenden Laut-klassen wie für den ersten Formanten, wiederum wird |a| offener realisiert (wobei nun negative Werte eine stärkere [a]-Ähnlichkeit bedeuten). Anders als für den ersten Formanten spielt der betonte Vokal eine Rolle, wobei ähn-lich wie beim Akanje Vokale mit niedrigem zweiten Formanten auch einen niedrigeren zweiten Formanten des vortonigen Vokals bedingen. Unter den Generationen besteht nur zwischen der Generation 1 und 2 ein signifikanter Unterschied. Generation 1 artikuliert Vokale in Jakanje-Position also ten-denziell höher als Generation 0, aber nicht weiter vorn. Ein Effekt für Ge-schlecht und auch für das südwestliche Dialektgebiet ist nicht festzustellen. Eine Interaktion zwischen Geschlecht und Generation ist ebenfalls nicht festzustellen. Wiederum deutlich unterschiedlich verhalten sich Äußerungen unterschiedlicher Affinität. ‚Hybride‘ und ‚russische‘ Äußerungen weisen einen [i]-artigeren zweiten Formanten auf.
Um zu überprüfen, ob die Unterschiede zwischen Generationen nicht eventuell nur für bestimmte Äußerungstypen gelten, werden ‚gemeinsame‘ Äußerungen ausgeschlossen und wird auf eine Interaktion zwischen Genera-tion und Affinität der Äußerung geprüft. Weder für den ersten Formanten noch für den zweiten ist diese signifikant (Für F1: Log-Likelihood ohne Interaktion: -1412,4, mit Interaktion: -1411,5, χ2=1,80, df=4, p=0,77; für F2: Log-Likelihood ohne Interaktion: -872,29, mit Interaktion: -870,54, χ2=3,50, df=4, p=0,48). Es ist also nicht der Fall, dass Unterschiede zwischen den Generationen für die Äußerungstypen unterschiedlich ausfallen. In allen Äußerungstypen tendiert Generation 2 stärker zum ‚russischen‘ [i] und in
176
allen Generationen liegt in ‚russischen‘ Äußerungen eine stärker ‚russische‘ Aussprache vor.
Analyse 4 – Analyse der Dauer: Eine Analyse der Dauer der Laute zeigt, dass Unterschiede zwischen den Generationen bestehen. Auch im Falle der Vari-able (Jakanje1) sind also wie im Falle von /a/ und /o/ nach nicht-palatalisier-ten Konsonanten Realisierungen von Vertretern jüngerer Generationen kür-zer. Auch die Affinität der Äußerung hat einen Einfluss: In Äußerungen ‚hybrider‘ und ‚russischer‘ Affinität sind die Realisierungen kürzer.124
Mehrebenenmodell für die Dauer (in Millisekunden) von /a/, /e/ und /o/ nach palatali-Tab. 44sierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1), alle Äußerun-gen (n=1426). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=8,3), Familie (n=8, σ=4,1)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 96,5 5,0 19,1 0,0001 Etymolog. Klasse |a| 6,5 2,7 2,4 0,0136 |o| -11,2 5,5 -2,0 0,0444 A.-ort links labial 5,6 3,0 1,9 0,0654 palatal -11,5 3,4 -3,4 0,0004 postalveolar -7,6 5,0 -1,5 0,1258 velar -24,1 15,4 -1,6 0,1178 A.-ort rechts labial -13,4 2,5 -5,5 0,0001 palatal 16,6 5,4 3,1 0,0030 postalveolar -0,6 3,2 -0,2 0,8450 velar 0,8 3,4 0,2 0,8160 A.-art links frikativ -10,6 3,0 -3,5 0,0002 nasal -8,2 3,3 -2,5 0,0150 plosiv -17,6 4,7 -3,7 0,0001 A.-art rechts frikativ 1,6 3,0 0,5 0,5952 nasal 1,1 3,7 0,3 0,7710 plosiv 14,0 2,8 5,0 0,0001 Generation Generation 0 10,9 5,2 2,1 0,0502 Generation 2 -15,1 3,8 -4,0 0,0004 Geschlecht weiblich 9,4 3,5 2,7 0,0106 Affinität der Äußerung gemeinsam 5,4 4,1 1,3 0,1956 hybrid -6,3 2,3 -2,8 0,0040 russisch -9,5 2,8 -3,4 0,0008
124 Eine Zufallssteigung für Affinität der Äußerung in Sprecher verbessert das Modell (Log-
Likelihood ohne Zufallssteigung: -6882,2; mit Zufallssteigung: -6873,0; χ2=18,35, df=10, p=0,0494). Die Koeffizienten für Affinität der Äußerung ändern sich allerdings kaum (‚ge-meinsam‘: 4,5, ‚hybrid‘: 7,3, ‚russisch‘: 11,0). Der Unterschied zwischen ‚hybriden‘ und ‚weißrussischen‘ Äußerungen bleibt signifikant (t=-2,71, p=0,0136), ebenso wie der Unter-schied zwischen ‚russischen‘ und ‚weißrussischen‘ Äußerungen (t=-2,85, p=0,0077).
177
Da nichts darauf hindeutet, dass die jüngere Generation grundsätzlich kürzere Vokalrealisierungen aufweist, ist dieser Befund als Folge der qualitativen Unterschiede zwischen den Generationen und den Äußerungstypen zu deu-ten. Die kürzere Dauer ist auf den geringeren artikulatorischen Aufwand bei geschlossenen, [i]-artigen Realisierungen zurückzuführen. Dafür, dass es nicht ein grundsätzlich schnelleres Sprechtempo ist, das bei jüngeren Spre-chern zu einer kürzeren Dauer führt, spricht auch der Effekt anderer Variab-len, etwa die signifikant längere Dauer bei zugrunde liegendem |a|.
Analyse 5 – F1 und F2 in ‚hybriden‘ Äußerungen: Vor dem Hintergrund der Unterschiedlichkeit von Äußerungen unterschiedlicher Affinität ist es ratsam, die ‚hybriden‘ Äußerungen einer gesonderten Untersuchung zu unterziehen. Obwohl keine Interaktion zwischen Generation und Affinität der Äußerung festzustellen war, also nichts darauf hindeutet, dass Unterschiede zwischen den Generationen nur in bestimmten Äußerungstypen durchschlagen, ist es ratsam zu prüfen, ob die Unterschiede zwischen den Generationen auch bestehen bleiben, wenn nur ‚hybride‘ Äußerungen einbezogen werden. Zudem ist für ‚hybride‘ Äußerungen zu prüfen, ob die Aussprache in ihnen konstant ist, oder ob Unterschiede zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität bestehen (vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2014). Tabelle 45 zeigt das entsprechende Mehrebenenmodell für den ersten Formanten, Tabelle 46 für den zweiten Formanten für Wortformen nur in ‚hybriden‘ Äußerungen. Aus Platzgründen wird nur auf die sozialen Faktoren und auf die Affinität der Wortform eingegangen, die lautlichen und lexikalischen Faktoren gehen aber in das Modell ein.125
125 Interaktionen zwischen Generation und Affinität der Wortform für den ersten Formanten
sind nicht signifikant, weder, wenn ‚gemeinsame‘ Wortformen eingeschlossen und nur ‚hybride‘ ausgeschlossen werden (χ2=2,93, df=4, p=0,57), noch, wenn ‚gemeinsame‘ Wort-formen ebenfalls ausgeschlossen werden (χ2=0,11, df=2, p=0,95). Gleiches gilt für den zweiten Formanten (χ2=4,56, df=4, p=0,34; χ2=4,16, df=2, p=0,13). Für den ersten For-manten verbessert eine Zufallssteigung für Affinität der Wortform in Sprecher das Modell (Log-Likelihood ohne Zufallssteigung: -772,92; mit Zufallssteigung: -761,87; χ2=22,10, df=10, p=0,0146). Die Koeffizienten bleiben vergleichbar (-0,10 für gemeinsam, -0,17 für hybrid, -0,22 für ‚russisch‘). Der t-Wert für ‚russisch‘ sinkt, lässt aber immer noch auf einen signifikanten Unterschied zu ‚weißrussischen‘ Wortformen schließen (t=-2,54). Der Einfluss der Affinität der Wortform fällt also für die Sprecher unterschiedlich stark aus. Es ist jedoch grundsätzlich eine stärker ‚russische‘ Artikulation bei ‚russischen‘ Wortformen vorhanden.
178
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Tab. 45Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1), nur Realisierungen in ‚hybriden‘ Äußerungen (n=729). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,16), Familie (n=8, σ=0,16)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,44 0,19 2,39 0,0208 Generation Generation 0 0,21 0,13 1,64 0,1046 Generation 2 -0,34 0,10 -3,62 0,0018 Dialektherkunft Südwesten -0,30 0,14 -2,13 0,0332 Geschlecht weiblich 0,22 0,08 2,58 0,0130 Affinität Wortform gemeinsam -0,10 0,08 -1,22 0,2072 hybrid -0,21 0,13 -1,63 0,1048 russisch -0,24 0,07 -3,29 0,0010
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Tab. 46Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1), nur Realisierungen in ‚hybriden‘ Äußerungen (n=729). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,08), Familie (n=8, σ=0,08)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,05 0,11 0,46 0,6818 Generation Generation 0 -0,02 0,07 -0,28 0,7828 Generation 2 0,20 0,05 3,88 0,0008 Dialektherkunft Südwesten 0,16 0,08 2,12 0,0526 Affinität Wortform gemeinsam 0,10 0,05 2,09 0,0340 hybrid 0,14 0,08 1,74 0,0784 russisch 0,17 0,05 3,78 0,0001
Während die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und der dialektalen Herkunft bestehen bleiben, geht der Unterschied im ersten Formanten zwi-schen den Generationen 0 und 1 zurück. Die Unterschiede zwischen Gene-ration 1 und Generation 2 bleiben jedoch bestehen. Für den zweiten Forman-ten besteht ebenfalls ein signifikanter Unterschied. Auch in ‚hybriden‘ Äuße-rungen ist die Aussprache für die jüngere Generation also stärker ‚russisch‘.
Es zeigt sich zudem, dass die Realisierung in ‚hybriden‘ Äußerungen nicht konstant ist. Realisierungen in ‚russischen‘ Wortformen haben einen niedrigeren F1 und einen höheren F2 als in ‚weißrussischen‘ Wortformen, werden also [i]-artiger realisiert.
Analyse 6 – Intermediäre Realisierung oder „Switchen“?: Die Durch-schnittswerte der Vertreter der Generation 1 fallen wie gesehen in den Bereich des betonten /e/. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist, ob Vertreter der Generation 1 auch tatsächlich [e]/[ɛ]-artige Realisierungen zeigen, oder ob die in Abbildung 22 (S. 168) beobachteten durchschnittlichen Werte nur dadurch entstehen, dass die Sprecher sowohl [i]- als auch [a]-artige
179
Realisierungen zeigen, und damit in Bezug auf das sprachliche Verhalten der Sprecher keine deskriptive Relevanz hätten.
Abbildung 23 zeigt als Beispiel die Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Positionen bei Sprecher ba_P, einem Sprecher mit einer durch-schnittlichen [e]/[ɛ]-Realisierung sowie das Histogramm für den ersten und den zweiten Formanten.
Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Positionen, Sprecher ba_P Abb. 23
Für Sprecher ba_P ergibt der Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung keinen Anlass, nicht von einer Normalverteilung auszugehen (W=0,99, p =0,57 für F1; W = 0,99, p = 0,80 für F2). Es zeigt sich also, dass die durchschnittliche Realisierung im Bereich [e]/[ɛ], die als „fudge“ (CHAMBERS & TRUDGILL 1998, 110) zwischen [i] und [a] betrachtet werden kann, nicht bloß ein mathematischer Effekt ist, sondern durchaus das sprachliche Verhalten des Sprechers charakterisiert. Dies ist auch für eine Reihe anderer Sprecher an-zunehmen (s. auch die F2/F1-Plots im Anhang). Für elf der 33 Sprecher weicht die Verteilung des ersten Formanten allerdings signifikant von der Normalverteilung ab. Es fällt auf, dass diese sich in der mittleren Generation häufen, allerdings nach dem Exakten Fisher-Test nicht signifikant (p=0,26).
Verteilung von Sprechern mit normalverteiltem und nicht-normalverteiltem F1 bei Tab. 47Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in unmittelbar vorbetonten Silben (Jakanje1) auf die drei Generationen
F1 normalverteilt Generation 0 Generation 1 Generation 2 ja 4 8 (davon einmal marginal signifikant) 10 nein 1 7 3
a
i
ojeu
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
a
i
ojeu
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
●
●●●●●●
●●●● ●●●●●● ●
●●●●●
●
●●●●●
●●
●
●
●●
●●●
●●●
●
●
●●●● ●●
●●●●●●
●●
●●
●●●
●●
● ●●
●
●●●●
●
●
●●
●
●
●●●
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
ba_P
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
F1
Hz
Hae
ufig
keit
200 300 400 500
05
1015
2025
F2
HzH
aeuf
igke
it
1000 1400 1800
05
1015
180
Für einige der Sprecher mit nicht-normalverteiltem F1 zeigt sich eine relativ deutlich bimodale Verteilung, also zwei Gipfel, wobei entweder der (eher) ‚russische‘ (ra_L) oder der (eher) ‚weißrussische‘ (ra_S) stärker ausfallen kann.
Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Positionen, Sprecher ra_L und ra_S Abb. 24
Dies deutet auf ein „Switchen“ zwischen [i] und [æ] (bzw. einem höheren und einem tieferen Vokal) hin, also darauf, dass die Sprecher mal eine stärker ‚weißrussische‘, mal eine stärker ‚russische‘ Realisierung wählen (bei wel-chem Grad der Bewusstheit auch immer). Wie die folgende Abbildung nahelegt, ist es allerdings nicht so, dass die Affinität der Wortform dabei eine Rolle spielt: Für alle drei Typen von Wortformen (‚weißrussisch‘, ‚gemein-sam‘ und ‚russisch‘) finden sich sowohl Realisierungen im Bereich [i] als auch solche im Bereich [æ].
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
● ●●●
●
●
●●
●
●
●●●●
●
●●
●●
●
●● ●●●●●●
●●
●
●
●
●
●●●
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_L
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
F1
Hz
Hae
ufig
keit
300 400 500 600 700
02
46
810
F2
Hz
Hae
ufig
keit
1200 1600 2000 2400
02
46
810
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
●
●
●●●●●
●
●●
●
●
●
●
●●●●●●●●
●
●●●
● ●
●
●●
●
●
●●●●
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
ra_S
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
F1
Hz
Hae
ufig
keit
300 400 500 600
02
46
810
1214
F2
Hz
Hae
ufig
keit
1200 1400 1600 1800
02
46
8
181
Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Positionen, Sprecher ra_L und ra_S, getrennt Abb. 25
nach der Affinität der Wortform
Für circa zwei Drittel der untersuchten Sprecher ist ein Wechsel zwischen zwei getrennten phonetischen Bereichen nicht festzustellen. Diese Sprecher haben Realisierungen, die sich um ein klares Zentrum gruppieren.
Zusammenfassung: Als Zwischenfazit sei festgestellt, dass für /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in unmittelbar vorbetonten Silben, für die im Weißrussischen [a]-artige Realisierungen erfolgen, eine klare Bewegung in Richtung der mit dem russischen Muster übereinstimmenden [i]-Realisie-rung zu erkennen ist. Während die Realisierungen für die Generation 0 noch teilweise offener im Bereich [æ] ausfallen, ist für die Generation der Land-Stadt-Migranten eine intermediäre Realisierung im Bereich [ɛ]/[e] charakte-
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
●
●●● ●
●●●
●
●
●
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_L: 'weißrussisch'
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
i
a
je ou
3000 2000 100010
0080
060
040
020
0
i
a
je ou
3000 2000 100010
0080
060
040
020
0
●●
●●
● ●●●
●●
●
●●
3000 2000 100010
0080
060
040
020
0
ra_L: 'gemeinsam'
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
●●
●
●●●
●
●●●
●●
●
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_L: 'russisch'
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
●●●
●
●
●●
●●
●●
●
●
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
ra_S: 'weißrussisch'
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
●●●
●
●●
●● ●
●●
●
●●●●
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
ra_S: 'gemeinsam'
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
i u
a
oje
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
●
●
●
●●●
●
2500 2000 1500 1000 500
800
700
600
500
400
300
200
ra_S: 'russisch'
F2 (Hz)
F1 (
Hz)
182
ristisch. Für die Generation 2 ist insgesamt ein klarer Trend in Richtung [i] erkennbar, wobei insbesondere in Generation 2 sich die einzelnen Sprecher individuell deutlich unterschiedlich verhalten. Es bestätigt sich zudem an dem hier untersuchten akustischen Material der von HENTSCHEL & ZELLER (2014) an ohrenphonetischen Transkriptionen beobachtete Einfluss der Affi-nität, nach dem Muster, dass für ‚weißrussische‘ Äußerungen im Vergleich zu ‚hybriden‘ und ‚russischen’ Äußerungen sowie innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen für ‚weißrussische‘ Wortformen im Vergleich zu ‚gemeinsa-men‘ und ‚russischen‘ eine stärker ‚weißrussische‘ Aussprache zu beobach-ten ist. Abbildung 26 verdeutlicht die Unterschiede zwischen den Generatio-nen und zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affinität. Dargestellt sind die vorhergesagten Werte für die einzelnen Kombinationen aus Generation und Affinität, während die anderen Faktoren bei ihrem Median oder Refe-renzwert gehalten werden.126
Effekte der Faktoren Generation und Affinität der Äußerung auf die Realisierung von Abb. 26
/a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
126 Es sind also die vorhergesagten Werte für Realisierungen nach einem dentalen Frikativ vor
einem nicht-palatalisierten dentalen Plosiv bei einer Dauer von 85 Millisekunden.
a
ja
je
i
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
01
2
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
Generation
a
ja
je
i
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
wrhybru
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
Affinität der Äußerung
183
Die Abstände in den Mittelwerten der Sprecher, die oben in Abbildung 22 (S. 168) gezeigt wurden, schienen größer, als die hier abgebildeten Effekte für Generation. Dass der Effekt für Generation kleiner ist, ist zum einen auf den Einfluss einzelner Sprecher zurückzuführen, der hier kontrolliert wird, zum anderen darauf, dass die Affinität der Äußerung, die in den jüngeren Generationen häufiger ‚russisch‘ ist, und die Dauer des Vokals kontrolliert werden.127 In dem hier berechneten Modell beträgt der Unterschied im ersten Formanten zwischen Generation 0 und 2 ungefähr 0,55 Einheiten. Bei Ausschluss dieser beiden Faktoren steigt die Differenz auf 0,84.
Abbildung 26 zeigt die Erwartungswerte, wenn die Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen beschränkt wird.
Effekte der Faktoren Generation und Affinität der Wortform auf die Realisierung von Abb. 27
/a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1), nur ‚hybride‘ Äußerungen. Die anderen Faktoren werden auf dem Refe-renzwert oder dem Median gehalten.
Der Einfluss der Generation ändert sich also nicht im Vergleich zu den Wer-ten für alle Äußerungen. Auch der Einfluss der Wortform ist vergleichbar mit dem der Äußerung. ‚Gemeinsame‘ Wortformen liegen näher an ‚russischen‘ als an ‚weißrussischen‘.
127 Auch der Faktor Geschlecht spielt eine Rolle, da in Generation 0 fast ausschließlich Frauen
untersucht wurden.
a
ja
je
i
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
01
2
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
Generation
a
ja
je
i
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
wrgeru
1.5 1 0.5 0 -0.5
21.
51
0.5
0-1
Affinität der Wortform
184
/a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in weiteren 5.4.5vorbetonten Silben – die Variable (Jakanje2)
Tabelle 48 liefert eine Übersicht über Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in weiteren, d.h. nicht unmittelbar vorbetonten Silben im Weißrussischen, Russischen und in den weißrussischen Dialekten.
Realisierung von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten, weitere vorbetonte Tab. 48Silben
Standard-weißrussisch
Südwestliche wr. Dialekte
Zentrale wr. Dialekte
Nordöstliche wr. Dialekte
Standardrussisch
[e], [ea] [e] [a] [i], [ɪ] [ɪ]
Im Russischen liegt in dieser Position die sogenannte zweite Reduktionsstufe vor, /a, e, o, i/ werden als reduzierter [i]-artiger Laut realisiert, der noch stärker zentralisiert ausfällt als in der unmittelbar vorbetonten Position (vgl. AVANESOV 1956, 115–120).
Was die Realisierung im Standardweißrussischen angeht, so besteht in der Belorussistik Uneinigkeit. Umstritten ist erstens, ob hier die Opposition von /e/ und /o/ vs. /a/ aufrechterhalten wird, und zweitens (und oft damit verbunden), wie die konkrete Realisierung der Phoneme ausfällt (vgl. für einen Überblick GIGER 2008).128 In der Regel wird die Meinung vertreten, dass /a/, /e/ und /o/ in einem Laut zusammenfallen, wobei jedoch oft nicht zwischen den zugrunde liegenden Phänomenen differenziert wird. Aufgrund der gemeinsamen Etymologie wird /o/ nach palatalisierten Konsonanten oft unter /e/ mitverstanden, auf /a/ wird oft nicht gesondert eingegangen. Nach CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988, 229) werden /a/, /e/ und /o/ als Laut zwi-schen [e]/[ɛ] und [a] realisiert. Nur für Lehnwörter sei ein kurzes [e]/[ɛ] möglich, dies aber nur bei aufmerksamer Rede, ansonsten bestehe eine Ten-denz zur gleichen Realisierung wie im nativen Wortschatz. Nach JANKOŬSKI (1976, 29f.) und VYHONNAJA (1991, 202) sind sowohl [e]/[ɛ] als auch ein stärker in Richtung [a] gehender Laut möglich. LOMTEV (1956, 28f.) nimmt dagegen für /a/, /e/, /o/ eine Realisierung als ein reduzierter vorderer Vokal an. Die phonologische Gegenposition, d.h. keine Neutralisierung von /e/ und /o/ einerseits und /a/ andererseits, vertreten BIRYLA (1958, 172), PADLUŽNY (1969, 116), BIRYLA & ŠUBA (1985, 43) und die FBLM (1989, 319). Sie nehmen an, dass /e/ und /o/ als [e] realisiert würden, /a/ als [a]. Mit BIRYLA (1958, 172) nimmt PADLUŽNY (1969) allerdings an, dass diese Opposition
128 Graphematisch steht heute in diesen Positionen <e> für /e/ und /o/, <ja> für /a/.
185
dem Einfluss der Orthographie geschuldet sei, da sie in keinem autochthonen Dialekt vorkomme,129 und deswegen nicht stabil sei. In den weißrussischen Dialekten zeigt sich eine Zweiteilung in einen nordöstlichen Teil und einen zentralen und südwestlichen. In dem nordöstlichen Gebiet, das in etwa mit dem des dissimilativen Jakanje zusammenfällt, werden vor allem [i]- und [ɪ]-Realisierungen notiert, im Zentrum und Südwesten variieren [e]- und [a]-Realisierungen, wobei [e]/[ɛ]-artige Realisierungen zum Süden hin zunehmen (DABM 1963, Karten Nr. 10 und 11; NPBD1964, 80–83).
In Arbeiten zum Kontakt des Weißrussischen mit dem Russischen wird auf weitere vorbetonte Silben zumindest explizit selten eingegangen. Nach SADOŬSKI (1982, 204–205) tritt in der russischen Rede von Migranten der ersten Generation in Minsk in der zweiten vorbetonten Silbe [e], [i] oder [ɪ] auf, offenere Realisierungen im Bereich von [a] oder [ea] bemerkt er also nicht. (Seine Informanten kommen zwar aus Dialektgebieten, für die auch der DABM (1963a, Karten Nr. 10 und 11) vor allem [i]-artige Realisierungen beschreibt, in seiner Vergleichsgruppe der Dialektsprecher findet Sadoŭski jedoch auch [ea]-Realisierungen).130
Analyse 1 – Vergleich (Jakanje1) – (Jakanje2): In den folgenden Analysen werden alle vorbetonten Silben außer der unmittelbar vorbetonten einbezo-gen. Insgesamt wurden 471 Token ausgewertet, davon 395 aus der (von der betonten Silbe aus gezählt) zweiten vorbetonten Silbe, 70 aus der dritten, sechs aus der vierten. Knapp 200 Token werden durch das Klitikon ne ‚nicht‘ gestellt. Für einige Sprecher konnten nur wenige Token ausgewertet werden, für vier Sprecher waren es weniger als fünf Token. Für diese Sprecher wer-den die Durchschnittswerte in den Abbildungen nicht gezeigt, bei der späte-ren tokenbezogenen Analyse werden sie jedoch miteinbezogen. Nach Aus-schluss dieser vier Sprecher sind es pro Sprecher durchschnittlich 15,1 Token, (5–27, σ=5,6). Tabelle 125 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.
Zunächst sei wieder ein Vergleich der durchschnittlichen Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben mit den Entsprechungen in der unmittelbar vorbetonten Silbe durch-
129 Allerdings ist laut NPBD (1964, 81f.) für einige Dialekte eine Realisierung von /a/ als [a],
von /e/ als [e]/[ɛ] zu verzeichnen. 130 Anders als nach nicht-palatalisierten Konsonanten beobachtet Sadoŭski keinen Einfluss des
Silbentyps.
186
geführt. Abbildung 28 zeigt die Mittelwerte der verbleibenden 29 Sprecher im Vergleich zur unmittelbar vorbetonten Silbe:
Durchschnittliche Realisierungen der untersuchten Sprecher von /a/, /e/ und /o/ nach Abb. 28
palatalisierten Konsonanten (1) in unmittelbar vorbetonten Silben (Jakanje1) und (2) in weiteren vorbetonten Silben (Jakanje2)
Ähnlich wie im Falle des Akanje bestehen beträchtliche Unterschiede zwi-schen der Realisierung in der unmittelbar vorbetonten Silbe und in weiteren vorbetonten Silben. Die durchschnittlichen Realisierungen der Sprecher von nicht unmittelbar vorbetonten Vokalen haben einen niedrigeren ersten (t=4,11, df=28, p<0,001) und einen höheren zweiten Formanten (t=-3,96, df=28, p<0,001), sind also [i]-ähnlicher als Realisierungen in der unmittelbar vorbetonten Silbe.
1
1
11
1
1
1
1
1
11
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
11
111
1
11
11
1
22
2
22
222
22
2
2
2
2
2
2 2
22
2
22 2
2 22
22
2
1.4 1 0.8 0.4
10.
50
-0.5
-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
187
Analyse 2 – Vergleich der Mittelwerte in den Generationen: Abbildung 29 zeigt die durchschnittlichen Realisierungen der drei Generationen.
Durchschnittliche Realisierung von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten Abb. 29
in nicht unmittelbar vorbetonten Silben
Es zeigt sich, dass die durchschnittlichen Realisierungen in anderen vorbe-tonten Positionen als der unmittelbar vortonigen bei fast allen Sprechern in den Bereich [ɛ]/[e] – [i] fallen. Bei zwei Sprechern in Generation 1 und einem in Generation 2 ist eine Verlagerung nach hinten zu erkennen.
Analyse 3 – Der erste Formant: Im Folgenden wird geprüft, von welchen Faktoren die Realisierung dieser Vokale abhängt. Die erklärenden Variablen sind dieselben wie für Jakanje-Positionen in der ersten vorbetonten Silbe (s.o. Tab. 41, S. 169), mit folgenden Modifizierungen: Die zugrunde liegende Lautklasse kann nur zwei Werte annehmen, und zwar |e| (/e/ und /o/) und |a|. Zudem wird die Entfernung der Silbe von der betonten Silbe in die Analyse einbezogen, also Realisierungen in der zweiten, dritten und vierten vorbe-tonten Silbe miteinander verglichen.
Die Städte Chocimsk und Šarkoŭščyna sowie das Vicebsker Gebiet fallen in das Gebiet, für das [i]-ähnliche Realisierungen charakteristisch sind (wobei nördlich von der Stadt Šarkoŭščyna einige Inseln mit [ɛ]/[e] verzeichnet sind). Smarhon’ und Rahačoŭ liegen an der Grenze zum zentralen Gebiet mit [ɛ]/[e]. Minsk (knapp), Akcjabrski und Baranavičy befinden sich im Gebiet von [ɛ]/[e], wobei in der Umgebung von Baranavičy auch einige Inseln mit [a]-Realisierung notiert werden (DABM 1963a, Karten 10–11). Es sei
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●
●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●
●●
●●●●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
●
●●●●● ●●●●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 2
188
außerdem daran erinnert, dass die Affinität sich bei den ‚gemeinsamen‘ Klitika ne, bez und dlja auf das Autosemantikon bezieht.
Tabelle 49 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells für den ersten Formanten, bei Kontrolle von Sprecher (n=33, σ=0,15) und Familie (n=8, σ<0,01):
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Tab. 49Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Jakanje2) (n=413). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,15), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,25 0,15 1,60 0,1122 Etymolog. Klasse |a| 0,47 0,14 3,31 0,0006 A.-ort links labial 0,57 0,13 4,53 0,0001 palatal -0,04 0,20 -0,22 0,7796 postalveolar 0,84 0,42 2,02 0,0420 velar 0,60 0,26 2,34 0,0182 A.-art links frikativ -0,44 0,15 -3,03 0,0028 nasal 0,18 0,13 1,38 0,1534 plosiv -0,71 0,20 -3,58 0,0004 A.-art rechts frikativ -0,53 0,08 -6,27 0,0001 nasal -0,51 0,13 -3,96 0,0002 plosiv -0,47 0,08 -5,66 0,0001 Generation Generation 0 -0,22 0,12 -1,77 0,0738 Generation 2 -0,18 0,09 -2,05 0,0320 Dialektherkunft Zentral 0,25 0,10 2,52 0,0620 Südwesten 0,22 0,09 2,39 0,0356
Es zeigt sich zunächst wieder ein Unterschied zwischen zugrunde liegendem |a| und |e|, dieser ist deutlicher als für die unmittelbar vorbetonte Silbe (dort lag der Unterschied bei 0,18). Wiederum wird also /a/ offener artikuliert als /e/ und /o/. Der Einfluss des lautlichen Kontextes fällt anders aus als für die unmittelbar vorbetonte Silbe. Jedoch gehen diejenigen lautlichen Faktoren, die sowohl für Realisierungen in (Jakanje1)-Positionen in unmittelbar vor-betonten Silben als auch für (Jakanje2) signifikant sind, in beiden Fällen in dieselbe Richtung. Dies betrifft den Einfluss von Obstruenten, die einen niedrigeren ersten Formanten bewirken. Nachfolgende palatalisierte Konso-nanten weisen dagegen keinen signifikanten Einfluss auf. Die Dauer des Lautes ist nicht signifikant. Die Lexeme ne, bez und dlja unterscheiden sich nicht von den übrigen Wortformen. Sowohl Generation 2 als auch, was überrascht, Generation 0 haben Mittelwerte, die näher an /i/ liegen, als dies für Generation 1 der Fall ist, wobei für die Generation 0 nur eine Tendenz festzustellen ist. Die dialektale Herkunft aus dem Nordosten hat – wie zu erwarten – einen Einfluss zugunsten einer höheren, stärker [i]-artigen Arti-
189
kulation. Weder Geschlecht noch die Affinität der Äußerung (auch nicht der Wortform, worunter hier bei Klitika wie gesagt die Affinität des nicht-kliti-schen Elements des phonologischen Wortes gemeint ist), hat einen Einfluss. Keine Interaktion erreicht Signifikanzniveau.
Analyse 4 – Der zweite Formant: Ebenso wie beim ersten wurde beim zwei-ten Formant vorgegangen.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Tab. 50Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Jakanje2) (n=413). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,10), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,20 0,14 1,37 0,1730 Etymolog. Klasse |a| -0,39 0,12 -3,18 0,0022 Palatalität rechts palatalisiert 0,39 0,06 6,25 0,0001 A.-ort links labial -0,09 0,11 -0,87 0,3860 palatal 0,20 0,16 1,20 0,2380 postalveolar -0,83 0,34 -2,43 0,0118 velar 0,34 0,21 1,58 0,1132 A.-ort rechts labial 0,02 0,07 0,36 0,7374 postalveolar 0,46 0,13 3,45 0,0004 velar 0,06 0,10 0,62 0,5768 A.-art links frikativ -0,01 0,12 -0,12 0,8790 nasal 0,49 0,11 4,31 0,0001 plosiv -0,02 0,17 -0,09 0,9476 A.-art rechts frikativ 0,30 0,08 3,89 0,0004 nasal 0,41 0,11 3,64 0,0008 plosiv 0,30 0,08 3,65 0,0006 Affinität der Wortform gemeinsam 0,04 0,07 0,62 0,5372 hybrid 0,21 0,12 1,75 0,0698 russisch 0,14 0,07 1,89 0,0582
Auch für den zweiten Formanten stimmen diejenigen lautlichen Faktoren, die sowohl in unmittelbar vorbetonten als auch in anderen vorbetonten Silben einen signifikanten Effekt haben, in der Richtung des Effekts überein (der Einfluss der Palatalisiertheit des folgenden Konsonanten, der Einfluss von vorangehenden Nasalen und der Einfluss von nachfolgenden Frikativen, Nasalen und Plosiven zugunsten eines höheren zweiten Formanten). Außer diesen phonetisch-phonologischen Faktoren ist nur die Affinität der Wort-form tendenziell relevant (für die Affinität der Äußerung ist kein Effekt feststellbar). In ‚russischen‘ und tendenziell in ‚hybriden‘ Wortformen ist eine vordere Realisierung zu verzeichnen.
190
Schließlich ist auch für nicht unmittelbar vorbetonte Silben eine kürzere Dauer für Vertreter der Generation 2 festzustellen. Vertreter der Generation 2 haben um knapp 10 Millisekunden kürzere Realisierungen.
Mehrebenenmodell für die Dauer (in Millisekunden) von /a/, /e/ und /o/ nach palatali-Tab. 51sierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Jakanje2). Lautliche Faktoren werden auch hier kontrolliert, aber nicht wiedergegeben (n=413). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=4,3), Familie (n=8, σ=3,8)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 59,5 6,4 9,2 0,0001 Generation Generation 0 1,5 5,1 0,3 0,7554 Generation 2 -9,5 3,5 -2,7 0,0040
Zusammenfassung: In nicht unmittelbar vorbetonten Silben weist das Russi-sche eine reduzierte [i]-artige Realisierung von /a/, /e/ und /o/ auf. Abgesehen von den nordöstlichen weißrussischen Dialekten, wo eine ähnliche Realisie-rung wie im Russischen vorliegt, fällt die weißrussische Realisierung offener aus, wobei unklar ist, ob sie eher im Bereich [ɛ]/[e] oder [æ] liegt.
Zunächst ist festzustellen, dass sie stärker [i]-artig ausfallen als Vokale in der unmittelbar vorbetonten Position. Im Gegensatz zu Vokalen nach palata-lisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe entsprechen die für Realisierungen in weiteren vorbetonten Silben beobachteten Unterschiede nicht vollständig den Erwartungen. In der Generation 0 sind stark [i]-artige Realisierungen vorhanden, in der Generation 2 gehen diese in Richtung [e], um in Generation 2 wieder in Richtung [i] zu gehen. Der Effekt für Gene-ration 0 könnte allerdings auf der ungünstigen Verteilung der Sprecher beru-hen: Von den fünf Sprechern in dieser Gruppe stammt nur eine Sprecherin aus Akcjabrski, also klar aus einem Gebiet, in dem dialektal keine [i]-Reali-sierung anzunehmen ist (allerdings ist es nicht so, dass diese Sprecherin stärkere [e]-Realisierungen zeigt als die anderen Sprecher). Die übrigen Ver-treter der Generation 0 stammen aus nordöstlichen Dialektgebieten, für die [i]-Realisierungen charakteristisch sind. Insgesamt weisen Sprecher aus dem Nordosten stärker [i]-artige Realisierungen auf (im Gegensatz zur unmittelbar vorbetonten Silbe, wo Sprecher aus dem Südwesten die am stärksten [i]-arti-gen Realisierungen aufwiesen). Die Unterschiede zwischen den weißrussi-schen Dialekten spiegeln sich in den vorliegenden Daten also wider.
Insgesamt ist die Variation zwischen den Generationen geringer als für die unmittelbar vorbetonte Silbe. Die Realisierung im Bereich [e] – [i], die weitgehend mit der Realisierung im Russischen und der Realisierung in nordöstlichen weißrussischen Dialekten übereinstimmt, ist recht konstant.
191
Auch Unterschiede zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affinität beste-hen nicht, nur für die Affinität der Wortform ist ein geringer Einfluss auf den zweiten Formanten erkennbar.
/e/ und /o/ nach „verhärteten“ Konsonanten in unmittelbar 5.4.6vorbetonten Silben – die Variable (e /Š_)
Die Vokalalternationen nach sogenannten „verhärteten“ Konsonanten müssen gesondert betrachtet werden. Als verhärtet werden in der Slavistik traditionell in Bezug auf die Palatalitätsopposition unpaarige Konsonanten bezeichnet, die synchron nicht-palatalisiert sind, aber historisch auf palatalisierte Konso-nanten zurückgehen. Dies sind im Russischen /ʦ/, /ʂ/ und /ʐ/, im Weißrussi-schen /ʦ/, /t ʂ/, /ʂ/ und /ʐ/ sowie /r/, sofern es auf |rʲ| und nicht |r| zurückgeht (von den seltenen /ʣ/ und /dʐ/ kann abgesehen werden). Die Position nach diesen Konsonanten ist abgesehen von Lehnwörtern in beiden Sprachen der einzige Kontext, in dem das Phonem /e/ nach nicht-palatalisierten Konso-nanten auftritt.
Realisierung von /e/ und /o/ nach verhärteten Konsonanten, erste vorbetonte Silbe Tab. 52
Standardweißrussisch, zentrale wr. Dialekte
Nordöstliche wr. Dialekte Standardrussisch
[a] [ɨ], [ə] (wenn betont /a/ folgt); [a] (in allen anderen Fällen)
[ɨ]
Die Lehrmeinung ist folgende: Im Russischen fallen /e/ und /o/ mit /i/ in einem Laut zusammen, der leicht zentraler (tiefer) als [ɨ] unter Betonung ausfällt (AVANESOV 1956, 114): ženy /ˈʐoni/ [ˈʐɔnɨ] ‚Ehefrau; Nom.Pl.‘ vs. žena /ʐoˈna/ [ʐɨˈna] ‚Ehefrau; Nom.Sgl.‘. Im Russischen ist das Muster also prinzipiell wie nach palatalisierten Konsonanten, wobei das phonetische Resultat mit [ɨ] das übliche Äquivalent nach nicht-palatalisierten Konsonan-ten zu [i] nach palatalisierten Konsonanten ist.
Im Weißrussischen wird dagegen (ähnlich wie /a/ und /o/ grundsätzlich nach nicht-palatalisierten Konsonanten) unbetontes /e/ nach verhärteten Kon-sonanten und (in Lehnwörtern) nach anderen nicht-palatalisierten Konso-nanten wie /a/ und /o/ als [a] realisiert.131 Ausnahmen sind (ganz ähnlich wie im Falle von /e/ nach palatalisierten Konsonanten) einige nicht-integrierte
131 Lehnwörter mit /e/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten sind im Weißrussischen um
einiges häufiger als im Russischen, das russische Äquivalent enthält häufig einen palatali-sierten Konsonanten.
192
Lehnwörter, in denen auch graphematisch ein <э> steht: žėton ‚Wertmarke‘, rėkord ‚Rekord‘, tėatr ‚Theater‘, dėkada ‚Dekade‘ (BIRYLA & ŠUBA 1985, 43). In den weißrussischen Dialekten ist die Situation parallel zu den Mustern nach palatalisierten und nicht-palatalisierten Konsonanten, d.h. es liegen dissimilative und nicht-dissimilative Muster vor. Die Isoglosse fällt mit der des dissimilativen Akanje zusammen (NPBD 1964, 72–74).
In Arbeiten zum weißrussischen Akzent im Russischen bzw. zur weißrus-sischen Variante des Russischen wird auf dieses Merkmal nicht eingegangen, offenbar wird es unter Akanje mitverstanden.
Analyse des ersten Formanten: Der Unterschied zwischen dem Weißrussi-schen [a] und dem Russischen [ɨ] verläuft also anhand desselben phoneti-schen Parameters wie im Falle des Akanje (/a/ und /o/ nach nicht-palatali-sierten Konsonanten), d.h. anhand der Zungenhöhe, mit offeneren Realisie-rungen im Weißrussischen, die sich akustisch in einem höheren ersten For-manten äußern würden. Im Vergleich zum Akanje ist der artikulatorische Unterschied jedoch größer.
In die folgende Analyse werden alle unmittelbar vorbetonten Realisierun-gen von /e/ und /o/ nach /ʦ/, /ʂ/ und /ʐ/ einbezogen, also nach Konsonanten, die in beiden Standardsprachen (und in deren Subvarietäten) nicht-palatali-siert sind. Kontexte nach (rʲ) und (ʧʲ), die im Weißrussischen verhärtet sind, werden nicht behandelt, da zu erwarten ist, dass diese Konsonanten selbst kontaktbedingt zwischen einer palatalisierten und einer nicht-palatalisierten Realisierung variieren. Gleiches gilt für Lehnwörter, in denen im Weißrussi-schen, teilweise auch im Russischen /e/ nach nicht-palatalisierten Konsonan-ten auftreten kann. Für Sprecher, die dissimilatives Akanje oder Jakanje aufweisen, wurden zudem Realisierungen vor betontem /a/ ausgeschlossen.
Aufgrund der geringen Frequenz dieser Positionen konnten insgesamt nur 49 Token und dementsprechend für den einzelnen Sprecher nur wenige Token ausgewertet werden (maximal acht), so dass eine Abbildung der Durchschnittswerte nicht gerechtfertigt ist. Stattdessen beschränkt sich die Analyse auf die Token. Abbildung 30 zeigt die normalisierten Messwerte aller Token getrennt für die Generationen, sowie Boxplots für den ersten Formanten.
193
Realisierung von /e/ und /o/ in unmittelbar vorbetonten Silben nach /ʂ/, /ʦ/, /ʐ/ Abb. 30
getrennt für die Generationen; Boxplots des ersten Formanten (unten rechts)
Deutlich zeigt sich ein Unterschied zwischen den Generationen, mit einem hohen ersten Formanten für die Generation 0, einem niedrigen ersten For-manten für die Generation 2 und intermediären Realisierungen für Genera-tion 1.
Tabelle 53 zeigt, dass sowohl ein marginaler Einfluss der Generation als auch ein signifikanter Einfluss der Affinität der Wortform auf den ersten Formanten besteht. In diesem Mehrebenenmodell wird nur der Effekt des Sprechers (n=19) kontrolliert. Weitere Faktoren können aufgrund der gerin-gen Fallzahl nicht getestet werden.
a
e
yi
o
u
2 1.5 1 0.5 0 -1
21
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●
●
●●●
●
2 1.5 1 0.5 0 -1
21
0-1
Generation 0
a
e
yi
o
u
2 1.5 1 0.5 0 -1
21
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●
●●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●●
●
●
● ●
●●
●
●
●●
2 1.5 1 0.5 0 -1
21
0-1
Generation 1
a
e
yi
o
u
2 1.5 1 0.5 0 -1
21
0-1
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●●
●●●●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
2 1.5 1 0.5 0 -1
21
0-1
Generation 2
0 1 2
2.0
1.0
0.0
-1.0
Vergleich F1
Generation
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
194
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von /e/ und /o/ nach verhärteten Konso-Tab. 53nanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje2) (n=49). Zufallsfaktor: Sprecher (n=19, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,63 0,31 2,02 0,0504 Generation Generation 0 -0,24 0,31 -0,77 0,4560 Generation 2 -0,60 0,33 -1,83 0,0712 Affinität der Wortform gemeinsam -0,22 0,24 -0,92 0,3574 hybrid -0,72 0,51 -1,42 0,1620 russisch -0,63 0,26 -2,45 0,0150
Zusammenfassung: Nach verhärteten Konsonanten ist im Weißrussischen für /e/ und /o/ eine Realisierung als [a] zu beobachten. Im Russischen liegt dagegen eine Realisierung als [ɨ] vor.
Die geringe Tokenzahl mahnt natürlich zur Vorsicht bei der Verallgemei-nerung der Ergebnisse. Es sind jedoch trotz der geringen Tokenzahl Unter-schiede zwischen den Generationen zu erkennen, mit (stark abstrahierend) ‚weißrussischem‘ [ɐ] für die ältere Generation, intermediärem [ə] für die mittlere Generation und ‚russischem‘ [ɨ] (wohl zentraler, weiter hinten ge-bildet als das betonte) für die jüngere Generation. Auch die Affinität der Wortform spielt eine Rolle, in ‚russischen‘ Äußerungen ist eine stärker ‚rus-sische‘ Aussprache zu beobachten.
5.5 Zusammenfassung zum Vokalismus
Dieses Kapitel untersuchte Variation im vokalischen Bereich der WRGR. Während sich die beiden Sprachen im betonten Vokalismus nicht bzw. kaum unterscheiden und auch in nur wenigen weißrussischen Dialekten Unter-schiede zu den beiden Standardsprachen bestehen, liegen im unbetonten Vokalismus verschiedene Unterschiede zwischen den Kontaktsprachen und ihren Subvarietäten vor: Beide Sprachen und die hier relevanten weißrussi-schen Dialekte neutralisieren in unbetonten Positionen bestimmte Vokal-oppositionen, jedoch mit jeweils unterschiedlichen phonetischen Resultaten. Die Frage, wie die Realisierung in WRGR ausfällt – ob (eher) mit dem Rus-sischen oder (eher) mit dem Weißrussischen übereinstimmend – bzw. welche Faktoren die Realisierung beeinflussen, war zentraler Gegenstand dieses Kapitels. Die Variation im Vokalismus wurde mithilfe von Formanten-messungen untersucht.
Anhand des betonten Vokalismus wurden zunächst einige allgemeine Beobachtungen angestellt. Diese betrafen Phänomene in WRGR, die nicht
195
auf den Kontakt des Weißrussischen mit dem Russischen zurückzuführen sind, sondern für spontane Rede allgemein typisch sind, die aber für das Ver-ständnis und die Interpretation der späteren Ergebnisse zur kontaktbedingten Variation im unbetonten Vokalismus relevant sind: In WRGR wie sicherlich allgemein in spontaner Rede sind ein relativ kleiner akustischer Vokalraum, d.h. eine phonetische Reduktion auch betonter Vokale, die große Überlap-pung benachbarter Vokalkategorien und ein starker Einfluss der Palatalisiert-heit des vorangehenden Konsonanten zu beobachten.
Anhand des Beispiels des betonten /i/ nach nicht-palatalisierten Konso-nanten wurde daraufhin die statistische Methode vorgestellt. Einige Beschreibungen des Weißrussischen legen für diesen Vokal einen Unter-schied zum Russischen nahe. Jedoch konnte in der vorliegenden Untersu-chung kein Unterschied beobachtet werden, der auf kontaktbedingte Varia-tion schließen lässt (also etwa ein Unterschied zwischen den Generationen oder zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affinität), wohl aber ein großer Einfluss des phonischen Kontextes.
Innerhalb des unbetonten Vokalismus bestehen wie gesagt recht große Unterschiede zwischen den beiden Sprachen. Es wurden fünf relevante Kon-texte – fünf Variablen – untersucht: /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1), /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2), /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbeton-ten Silbe (Jakanje1), /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in wei-teren vorbetonten Silben (Jakanje2) sowie /e/ und /o/ in der unmittelbar vor-betonten Silbe nach sogenannten verhärteten Konsonanten (e /Š_).
Für die unmittelbar vorbetonten Positionen – (Akanje1), (Jakanje1) und auch die Position nach verhärteten Konsonanten – war zunächst Folgendes zu beachten: Während im Standardweißrussischen, den zentralen und südwestli-chen Dialekten und auch im Standardrussischen die Realisierung unabhängig vom Vokal unter Betonung erfolgt, unterscheiden die nordöstlichen Dialekte zwischen Positionen vor betontem /a/ und vor anderen betonten Vokalen (sogenanntes dissimilatives Akanje und Jakanje). Dies spiegelte sich in den vorliegenden Daten wider. Vor allem in den älteren Generationen sind bei Sprechern aus den zentralen und nordöstlichen Städten diese dissimilativen Muster zu erkennen. In der jüngsten untersuchten Generation finden sich weniger Sprecher, die signifikante Unterschiede zwischen den relevanten Positionen aufweisen. Dies ist allerdings – wie gleich deutlich wird – nur bedingt auf ein Verschwinden des aus Sicht des Weißrussischen dialektalen
196
Merkmals zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine allgemeine Tendenz zum Russischen im vorbetonten Vokalismus.
(Akanje1): Diese Variable umfasst unmittelbar vorbetonte Realisierungen von /o/ und /a/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten, wobei für Respon-denten, für die dissimilatives Akanje charakteristisch ist, nur Positionen vor anderen betonten Vokalen als /a/ berücksichtigt wurden. Für das Weißrussi-sche wird in diesen Positionen eine phonetisch nicht reduzierte Realisierung als [a] beschrieben (wobei jedoch Zweifel angebracht sind, ob in der Realität tatsächlich absolut keine phonetische Reduktion stattfindet). In den nordöstli-chen Dialekten gilt die Realisierung als [a] für die Position vor anderen betonten Vokalen als /a/. Im Russischen erfolgt dagegen mit [ɐ] eine stärker zentrierte Realisierung.
In den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Instanzen von WRGR zei-gen sich auch in den älteren Generationen klare Unterschiede zu betontem /a/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten. Eine gewisse phonetische Reduktion ist also vorhanden. Zwischen den Generationen 0, der Generation der Eltern der Land-Stadt-Migranten, und der Generation 1, den Land-Stadt-Migranten, bestehen keine Unterschiede, die Realisierung bleibt also stabil. Damit bestä-tigt sich SADOŬSKIs (1982) Beobachtung zu Migranten in Minsk Ende der 1970er Jahre, dass nach nicht-palatalisierten Konsonanten keine Veränderun-gen zur älteren, weißrussisch-dialektalsprachigen Generation vorliegen.
In der Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten, genauer gesagt für weibliche Vertreter dieser Generation 2, ist dagegen eine noch stärker zentrierte Aussprache im Bereich [ə] festzustellen. Angesichts dessen, dass in russischer spontaner Rede auch stärkere Reduktionen als das in den einschlä-gigen Arbeiten beschriebene [ɐ] vorliegen, ist dies als ein Lautwandel in Richtung des russischen Musters zu werten. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Laut in einer Äußerung geäußert wird, die auf strukturell tieferen Ebenen mit dem Weißrussischen oder dem Russischen übereinstimmt, oder ob die Äußerung ‚russische‘ und ‚weißrussische‘ Elemente enthält, mithin ‚hybrid‘ ist. Die Realisierung des Lautes und damit auch der Lautwandel [ɐ] zu [ə] ist also unabhängig davon, in welchem Kode sich der Sprecher bewegt, dem russischen, dem weißrussischen oder dem gemischten. Dies spricht dafür, dass die Variable (Akanje1) als Indikator, nicht aber als Marker im Labov-schen Sinne fungiert.
(Jakanje1): Deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Generati-onen bestehen für Vokale in Jakanje-Positionen. Das Weißrussische (die nordöstlichen Dialekte wiederum nur in Positionen vor anderen betonten
197
Vokalen als /a/) hat hier eine [a]-ähnliche Realisierung, während im Russi-schen eine [i]-ähnliche Realisierung erfolgt. In einigen südwestlichen weiß-russischen Dialekten erfolgt eine Realisierung als [e]/[ɛ].
In den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Instanzen von WRGR ist für einige Vertreter der Generation 0 eine [æ]-ähnliche Realisierung zu ver-zeichnen, die Generation 1 hat deutlich [e]/[ɛ]-artigere Realisierungen als die Generation 0, Generation 2 wiederum [i]-artigere als die Generation 1. Auch hier ist also eine deutliche Bewegung in Richtung des russischen Musters festzustellen, die anders als im Falle der Variable (Akanje1), der Entspre-chung nach nicht-palatalisierten Konsonanten, bereits in der Generation der Land-Stadt-Migranten mit einer aus Sicht der Kontaktsprachen intermediären Aussprache beginnt. Auch dies bestätigt die Analyse von SADOŬSKI (1982).
Ebenfalls anders als im Falle der Variable (Akanje1) ist für (Jakanje1) die Affinität der Äußerung relevant. Für alle Generationen ist die Aussprache in auf tieferen Ebenen ‚weißrussischen‘ Äußerungen stärker ‚weißrussisch‘, in ‚russischen‘ stärker ‚russisch‘. Die Werte in ‚hybriden‘ Äußerungen liegen dazwischen. Innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen tendieren ‚russische‘ und ‚gemeinsame‘ Wortformen zu einer stärker ‚russischen‘ Aussprache, ‚weiß-russische‘ zu einer stärker ‚weißrussischen‘.
Um wieder auf das Zurückgehen des dissimilativen Akanje und Jakanje zurückzukommen: Bezeichnend ist der Vergleich der Positionen, in denen die Dialekte nicht mit der weißrussischen Standardsprache übereinstimmen. Im Falle des dissimilativen Jakanje ist das Zurückgehen auf den Rückgang des Jakanje allgemein zurückzuführen. Vorbetontes [a] ([æ]) verschwindet zu-gunsten von [ɪ], während das aus Sicht der weißrussischen Standardsprache dialektale Merkmal – die Realisierung als [i]/[ɪ] – stabil bleibt. Im Falle des dissimilativen Akanje wird dagegen auch das aus Sicht des weißrussischen Standards dialektale Merkmal [ɨ]/[ə] abgebaut, das in diesem Fall auch mit dem Russischen nicht übereinstimmt. Es ist also der Einfluss des russischen, nicht des weißrussischen Standards, der für den Rückgang der dialektalen Merkmale verantwortlich ist.
(e /Š_): Nach verhärteten Konsonanten ist ein ähnlicher Einfluss der Generation festzustellen wie für die Variable (Jakanje1). Zwar konnten für diese Variable nur wenige Token untersucht werden. Es zeigt sich jedoch, dass Generation 0 relativ offene, mit dem Weißrussischen weitgehend über-einstimmende Realisierungen im Bereich [ɐ] aufweist, Generation 2 geschlossene, die in Richtung des ‚russischen‘ [ɨ] gehen. Generation 1 zeigt vor allem intermediäre Realisierungen im Bereich [ə]. Auch ein Einfluss der
198
Affinität der Äußerung ist zu beobachten: In ‚weißrussischen‘ Äußerungen zeigen die Werte eine stärker ‚weißrussische‘ Aussprache an, in ‚russischen‘ eine stärker ‚russische‘. Die Werte ‚hybrider‘ Äußerungen liegen dazwi-schen. Aufgrund der geringen Tokenzahl konnte die Affinität der Wortform innerhalb ‚hybrider‘ Äußerungen nicht untersucht werden.
(Akanje2): Nach nicht-palatalisierten Konsonanten in nicht unmittelbar vorbetonten Silben wird für die Phoneme /a/ und /o/ im Weißrussischen und seinen zentralen und südwestlichen Dialekte in der Regel ebenfalls eine nicht-reduzierte, mit dem betonten /a/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten übereinstimmende Realisierung als [a] beschrieben. Noch stärker als für die unmittelbar vortonige Position sind hier allerdings Zweifel angebracht, dass in der Realität keine phonetische Reduktion anzutreffen ist. Im Russischen wird in der entsprechenden Position der zentrale Vokal [ə] angenommen. In den nordöstlichen weißrussischen Dialekten ist neben [ə] auch [ɨ] möglich.
In den untersuchten Instanzen von WRGR ist eine deutlich zentriertere Realisierung im Vergleich zur unmittelbar vortonigen Position festzustellen. Es ist kein Unterschied zwischen den älteren Generationen feststellbar. Generation 2 weist dagegen wiederum eine leicht stärker zentrierte Realisie-rung auf, welche mit einer kürzeren Dauer des Vokals einhergeht. Auch Sprecher aus dem Nordosten weisen eine stärker zentrierte Realisierung als Sprecher aus anderen Gebieten auf. Die Unterschiede sind allerdings sehr gering, die zentrierte Realisierung ist relativ konstant. Ein Unterschied zwi-schen den verschiedenen Äußerungstypen besteht nicht.
(Jakanje2): Für Vokale nach palatalisierten Konsonanten in nicht unmit-telbar vorbetonten Silben weisen das Weißrussische und seine zentralen und südwestlichen Dialekte Realisierungen im Bereich [e] – [a] auf. Für die nord-östlichen weißrussischen Dialekte und das Russische sind Realisierungen im Bereich [i]/[ɪ] charakteristisch.
In WRGR ist insgesamt eine recht konstante Realisierung im Bereich [i] – [e] zu verzeichnen, also eine deutlich stärker [i]-artige Realisierung als im unmittelbar vortonigen Bereich, die auch klar mehr in den Bereich [i] geht, als es die traditionellen Beschreibungen des Weißrussischen nahelegen. Es ist zudem ein Unterschied zwischen Generation 1 und 2 hin zu einer [i]-artigeren Realisierung bei den jüngeren Sprechern festzustellen. Jedoch wei-sen auch Vertreter der Generation 0 [i]-artigere Realisierungen auf. Dies ist vermutlich ein Seiteneffekt der ungünstigen Verteilung der Sprecher auf die Dialektgebiete. Die Vertreter der Generation 0 stammen weitestgehend aus
199
Gebieten, in denen dialektal [i]/[ɪ] vorliegt. Generell weisen Sprecher aus diesen Gebieten stärker [i]-artige Realisierungen auf
Gehen wir abschließend die einzelnen erklärenden Faktoren durch. Für alle Variablen ist ein Einfluss der Generation festzustellen, mit einer Tendenz zu einer stärker ‚russischen‘, weniger ‚weißrussischen‘ Realisierung für die Generation 2, die Generation der bereits mit WRGR und in den sprachlich russisch dominierten Städten aufgewachsenen Kinder der Land-Stadt-Migranten. Für die Generation 1, die auf dem Land aufgewachsenen Mig-ranten, sind nur für (Jakanje1) und für die Position nach verhärteten Konso-nanten Unterschiede zur Rede ihrer Eltern zu verzeichnen.
Die Variable Geschlecht hat keinen eindeutigen Einfluss zugunsten einer ‚russischen‘ oder ‚weißrussischen‘ Aussprache. Neben der schon angespro-chenen Interaktion mit Generation für Akanje1-Positionen, in der jüngere, weibliche Sprecher zu einer stärker ‚russischen‘ Aussprache neigen, hat das Geschlecht auch Einfluss auf die Realisierung von Vokalen nach palatali-sierten Konsonanten in unmittelbar vorbetonten Positionen. Während im ersten Fall jedoch (junge) Frauen zu einer stärker ‚russischen‘ Realisierung tendieren, ist es für Jakanje-Positionen umgekehrt. Hier tendieren weibliche Respondenten eher zu einer offeneren, in Richtung des Weißrussischen gehenden Realisierung.
Der dialektale Hintergrund hat einen starken Einfluss. Dieser äußert sich im unmittelbar vorbetonten Vokalismus vor allem in den dissimilativen Mustern in den nordöstlichen und den zentralen Städten. Darüber hinaus ist im Falle der Variable (Jakanje1) in den südwestlichen Städten eine stärker angehobene Realisierung festzustellen, die eventuell mit dem dialektalen Ekanje in Verbindung steht. In den nicht unmittelbar vorbetonten Silben sind in den nordöstlichen Städten die stärker angehobenen Realisierungen der dortigen Dialekte anzutreffen. In der jüngeren Generation werden diese dia-lektalen Unterschiede allerdings zunehmend von dem Einfluss des Russi-schen überdeckt.
Schließlich ist festzustellen, dass die Sprecher in WRGR für Vokale nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe und für Vokale nach verhärteten Konsonanten zwischen einer stärker ‚russischen‘ und einer stärker ‚weißrussischen‘ Realisierung variieren, in Verbindung damit, ob die jeweilige Äußerung auf tieferen Ebenen mit dem Russischen und/oder dem Weißrussischen übereinstimmt. Dies sind die beiden Variablen mit der größten phonetischen Distanz zwischen der ‚weißrussischen‘ und der ‚russischen‘ Variante. Für die Variable (Jakanje1) ist außerdem innerhalb von
200
‚hybriden‘ Äußerungen festzustellen, dass ‚russische‘ Wortformen zu einer stärker ‚russischen‘ Realisierung tendieren, ‚weißrussische‘ zu einer stärker ‚weißrussischen‘. Abgesehen von einem Zusammenhang der Affinität der Wortform mit dem zweiten Formanten im Falle von nicht unmittelbar vorbetonten Silben nach palatalisierten Konsonanten sind für die anderen Variablen keine solchen Zusammenhänge feststellbar, die Realisierung des Vokals unterscheidet sich also nicht in Äußerungen oder Wortformen unter-schiedlicher Affinität.
201
6 Variation im Bereich der Sibilanten
6.1 Einleitung
Die Variation von Sibilanten – wie von Konsonanten generell – wird in kon-takt- oder soziolinguistischen Studien seltener untersucht als Variation im vokalischen Bereich. Insbesondere sind instrumentale Untersuchungen selten. Dabei können zwischen Sibilanten innersprachlich und zwischensprachlich subtile artikulatorische Unterschiede bestehen (vgl. LADEFOGED &
MADDIESON 1996; DART 1998), und diese Unterschiede können mit sozialen Parametern korrelieren (vgl. STUART-SMITH, TIMMINS & WRENCH 2003; HEFFERNAN 2004).132
Sowohl das Weißrussische als auch das Russische verfügen über sibilante Frikative und Affrikaten, die sich untereinander phonologisch durch den Artikulationsort, Stimmbeteiligung und Palatalisiertheit unterscheiden. Die phonologischen Inventare sind „lückenhaft“: Aus historischen Gründen sind einige der Phoneme, was die Palatalisiertheit und die Stimmbeteiligung an-geht, unpaarig. Einige der Stellen im Sibilanteninventar sind zudem von nur niedrigfrequenten Phonemen besetzt. Tabelle 54 gibt eine erste Übersicht über das phonologische Sibilantensystem und die phonetischen Realisierun-gen beider Standardsprachen, wobei für einige Positionen eine gewisse Un-sicherheit besteht, was die phonetische Realisierung angeht. Dies wird später näher zu erläutern sein (vgl. zum Weißrussischen PADLUŽNY 1969, 55–86; KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 39–42; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 127–129; FBLM 1989, 51–53, 55–59; zum Russischen AVANESOV 1956, 134–158; PANOV 1979, 25; TIMBERLAKE 2004, 52–74).
132 Ähnliches gilt für Plosive, vgl. KIRKHAM (2011).
202
Die Sibilantensysteme des Weißrussischen und Russischen Tab. 54
Russisch Weißrussisch nicht-
palatalisiert palatalisiert nicht-
palatalisiert palatalisiert
dental- alveolar
Frik. /s/ [s]
/z/ [z]
/sʲ/ [sʲ]
/zʲ/ [zʲ]
/s/ [s]
/z/ [z]
/sʲ/ [s"]
/zʲ/ [z"]
Affr. /ʦ/ [ʦ]
--
(/tʲ/: [tˢʲ])
(/dʲ/: [dˢʲ])
/ʦ/ [ʦ]
/ʣ/133 [ʣ]
/ʦʲ/ [ʦ"]
/ʣʲ/ [ʣ"]
post- alveolar
Frik. /ʂ/ [ʂ]
/ʐ/ [ʐ]
/ʃʲ/ [ʃʲː]/[ɕː]
(/ʒʲ/)134
/ʂ/ [ʂ]
/ʐ/ [ʐ]
-- --
Affr. -- -- /ʧʲ/ [ʧʲ]/[ʨ]
-- /t ʂ/ [t ʂ]
/dʐ/ [dʐ]
-- --
Es bestehen also einige Unterschiede zwischen dem Weißrussischen und dem Russischen. Die Variation dieser Merkmale ist Gegenstand dieses Kapitels:
1) Die Variable (sʲ): Wr. posterior-alveolares palatalisiertes [s''] vs. ru. [sʲ]:
Der weißrussische palatalisierte vordere Sibilant [s''] ist im Vergleich zu der russischen Entsprechung [sʲ] leicht nach hinten versetzt. Gleiches gilt für den Unterschied zwischen wr. [z"] und ru. [zʲ], wel-cher aber aufgrund der geringeren Häufigkeit dieser Phone in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht wird. Im Weißrussischen unter-scheiden sich also die vorderen palatalisierten Sibilanten von ihren nicht-palatalisierten Entsprechungen nicht nur durch eine palatale Koartikulation, sondern auch im primären Artikulationsort.135 Im Russischen liegt der Unterschied dagegen nur in der palatalen Koartikulation.
133 Das Phonem /ʣ/ ist selten, es tritt in lautmalerischen Wörtern (wie dzynkacʼ ‚klirren, sum-
men‘) und einigen Lehnwörtern auf (nėndza ‚Elend‘; pėndzalʼ ‚Pinsel‘). Ebenso ist /ʤ/ selten, es kommt vor allem in einigen Verbformen und deverbalen Substantiven vor (KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 34–39; BIRYLA & ŠUBA 1985, 46; FBLM 1989, 323; VYHONNAJA 1991, 206).
134 Von einigen Autoren (wie AVANESOV 1956, 135) wird ein stimmhafter palatalisierter post-alveolarer Frikativ als Phonem angenommen. Dieses tritt nur in wenigen Lexemen/Wort-formen auf, wie z.B. ezžu /jeʒʲu/ ‚fahren, 1.Sgl.Präs.‘. Für eine kritische Diskussion verglei-che KASATKIN (2001).
135 In der vorliegenden Arbeit wird für die weißrussischen Laute der Begriff „posterior-alveo-lar“ benutzt, in Abgrenzung zum russischen alveolaren [sʲ] und zum polnischen alveolo-palatalen [ɕ].
203
2-3) Die Variablen (tʲ) und (dʲ): Wr. posterior-alveolare palatalisierte Af-frikaten [ʦ''] und [ʣ''] vs. ru. Plosive [tʲ] und [dʲ] oder leicht affri-zierte Plosive [tˢʲ] und [dˢʲ]:
Im Weißrussischen sind die historischen palatalisierten dental-alveo-laren Plosive affriziert worden (das sogenannte Cekanje/Dzekanje). Im Russischen sind die Plosive prinzipiell erhalten geblieben, können aber unter Umständen auch leicht alveolar affriziert werden. Die bereits unter 1) angesprochene, leicht posteriore Artikulation der „vorderen“ Sibilanten umfasst im Weißrussischen auch die palatali-sierten alveolaren Affrikaten. Für das Russische ist eine solche Reali-sierung unbekannt, selbst wenn die dental-alveolaren Plosive affri-ziert werden. Die weißrussischen /ʦʲ/ und /ʣʲ/ unterscheiden sich also in zwei Dimensionen – Artikulationsart und Artikulationsort – von ihren russischen Entsprechungen.
4) Die Variable (ʧʲ): Wr. nicht-palatalisiertes [t ʂ] vs. ru. palatalisiertes [ʧʲ]:
Im Weißrussischen existiert nur eine nicht-palatalisierte postalveolare Affrikate, die in der Regel als Retroflex ([t ʂ]) eingestuft wird. Die russische etymologische Entsprechung ist dagegen stets palatalisiert ([ʧʲ]) und oft mit einer stärker alveolo-palatalen Artikulation verbun-den ([ʨ]).
5) Die Variable (ʃʲ): Wr. nicht-palatalisiertes [ʂt ʂ] vs. ru. palatalisiertes [ʃʲː]:
Das Russische hat einen phonetisch langen palatalisierten postalveo-laren Frikativ [ʃʲː], der ebenfalls oft mit einer stärker alveolo-palata-len Artikulation ([ɕː]) realisiert wird. Die etymologische Entspre-chung im Weißrussischen ist das Konsonantencluster [ʂt ʂ].
Diese fünf Variablen lassen sich drei Phänomenbereichen zuordnen:
a) Die Affrizierung der historischen palatalisierten dental-alveolaren Plo-sive im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (tʲ) und (dʲ).
b) Die posterior-alveolare Artikulation der palatalisierten vorderen Sibilan-ten im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (sʲ), (tʲ) und (dʲ)
c) Die Entpalatalisierung aller postalveolaren Sibilanten im Weißrussi-schen. Dies betrifft die Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ).
204
Der Aufbau dieses Kapitels entspricht diesen drei Phänomenbereichen. Zuerst wird die Artikulationsart (Affrikate oder Plosiv) der vorderen palatali-sierten historischen Plosive behandelt, anschließend die posterior-alveolare Artikulation der vorderen Sibilanten, abschließend die Palatalisiertheit der hinteren Sibilanten. Mit Ausnahme von ZELLER (2013b), der einige erste Beobachtungen zu dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten Material anstellt, wurde die Variation, die aus dem Kontakt der Systeme der Sibilanten des Weißrussischen und des Russischen entsteht, instrumentalphonetisch bisher nicht untersucht. Systematische ohrenphonetische Untersuchungen sind die von SADOǓSKI (SADOŬSKI & ŠČUKIN 1977; SADOVSKIJ 1978; SADOǓSKI 1982) sowie für die Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ) in WRGR die von HENTSCHEL & ZELLER (2014).
In den folgenden Analysen wird geprüft, wie die Realisierung dieser Sibi-lanten in WRGR ausfällt und ob die in Abschnitt 4.4 vorgestellten Faktoren (Generation, Geschlecht, Affinität der Äußerung usw.) einen Einfluss auf die Realisierung ausüben. Für die Analyse dieser Variation werden unterschied-liche Parameter herangezogen (Dauer, spektrale Gravitationszentren, For-manteneinstiege folgender Vokale). Zunächst werden die vorderen Sibilanten betrachtet. Dabei wird als erstes auf den Grad der Affriziertheit der Variablen (tʲ) und (dʲ) eingegangen, anschließend auf den Artikulationsort der vorderen Sibilanten. Anschließend wird auf den Artikulationsort und insbesondere die Palatalisiertheit der postalveolaren (ʧʲ) und (ʃʲ) eingegangen.
6.2 Variation von affriziertem [ʦ"] und [ʣ"] und plosivem [tʲ] und [dʲ] – zur Artikulationsart der Variablen (tʲ) und (dʲ)
Hintergrund 6.2.1
Die Phoneme /tʲ/ und /dʲ/ werden für das Russische in der Regel als Plosive bezeichnet. Sicherlich erfolgt auch eine leichte palatale Affrizierung, wobei es eine theoretische Frage ist, ob eine sekundäre Engebildung am Palatum mit frikativer Überwindung neben der Plosion als Affrizierung zu bewerten ist. Allerdings besteht zumindest eine Tendenz, diese Phoneme als Affrikaten mit einer alveolaren Friktion zu realisieren. Vor allem vor [i] können /tʲ/ und /dʲ/ (leicht) affriziert werden zu [tˢʲ] und [dˢʲ], was aber von den Sprechern normalerweise nicht bemerkt werde (AVANESOV 1968, 109; ZINDER 1979, 133f.; TIMBERLAKE 2004, 54). In einigen Werken wird die leicht affrizierte Realisierung nicht als fakultative Variante, sondern als kennzeichnend für die
205
russische Standardsprache betrachtet, während die plosive Realisierung als dialektal angesehen wird (RD 2005, 70). Zuweilen wird auch eine stärkere Affrizierung beobachtet.136 Im Weißrussischen ist eine deutliche alveolare bzw. posterior-alveolare Affrizierung – das sogenannte Cekanje/Dzekanje – dagegen obligatorisch.137 Nur in einigen südlichen Dialekten sind die Plosive [tʲ] und [dʲ] vorhanden (NPBM 1964, 117–124).
Die Affrizierung von (tʲ) und (dʲ) ist ein einschlägiger Charakterzug des weißrussischen Akzentes des Russischen bzw. der weißrussischen Variante des Russischen (vgl. KILEVAJA 1989, 9; BULACHOV 1973, 104; MELʼNIKOVA 1999, 56f.). Neben (sʲ) und (zʲ) sind unter allen Variablen (tʲ) und (dʲ) die einzigen, für die Sadoǔski in der russischen Rede von Minsker Land-Stadt-Migranten in den 1970er Jahren ausnahmslos absolut mit dem Weißrussi-schen übereinstimmende Realisierungen notiert (SADOŬSKI 1982, 212). Diese affrizierten Realisierungen würden von Sprecher und Hörer kaum bemerkt werden, was Sadoŭski der oben genannten Tatsache zuschreibt, dass das Russische Affrizierungen zulässt. Das weißrussische Cekanje/Dzekanje ist also im Sprachkontakt mit dem Russischen äußerst stabil.138
Affrizierung von Plosiven ist generell ein Fall von Lenition (vgl. LASS 1981, 177–183). Zudem ist gerade bei palatalisierten dentalen Plosiven wohl davon auszugehen, dass die affrizierte Variante die (im Sinne etwa der Natürlichen Phonologie) natürlichere Variante ist. Palatalisierung bedeutet eine hohe Lage des Zungenrückens, also eine Annäherung an den Gaumen. Ein nachfolgender hoher vorderer Vokal ermöglicht (so ZINDER 1979, 133f.), dass die Auflösung des Verschlusses nicht plötzlich, sondern „fließend“ („plavnoe“) ausfallen kann. Um eine solche Affrizierung zu vermeiden,
136 Zum Beispiel von HALLE (1959, 150). Auch die Abbildungen bei BOLLA (1981, Schaubild
41 u. 43) zeigen eine starke frikative Phase, die ähnliche Spektren aufweist wie die von /sʲ/ und /zʲ/.
137 Dieser Lautwandel |tʲ, dʲ| > |ʦ", ʣ"| wird von Karski (KARSKIJ 2006 [1908], 347) und JANKOŬSKI (1974, 116f.) für das 14. Jh. oder sogar früher angesetzt. WEXLER (1977, 169–173) nimmt einen Zeitraum zwischen dem 14. und dem 16. Jh. an.
138 Umgekehrt scheint ein Einfluss des Russischen auf das Weißrussische weniger ausgeprägt: Nur einige Autoren wie VYHONNAJA (1991, 207) beobachten, dass plosives [tʲ] und [dʲ] bei einigen Sprechern im weißrussischsprachigen Radio zu hören sei, andere, wie DZERHA-ČOVA (2001), erwähnen plosives [tʲ] und [dʲ] nicht, im Gegensatz zu Interferenzen des Rus-sischen für unbetonte Vokale, (rʲ), (g) und (ʧʲ). Dabei kann das Russische in diesem Aspekt durchaus einen Einfluss ausüben. So berichtet WEXLER (1977, 169), dass östlich von Homelʼ und im Gebiet von Smolensk [tʲ] und [dʲ]-artige Realisierungen in der zweiten Hälfte des 19. Jh./Anfang des 20. Jh. zunehmen, was er russischem Einfluss zuschreibt.
206
müsste der Verschluss schneller, d.h. mit größerem artikulatorischem Auf-wand gelöst werden (vgl. OHALA 2005, 27–29; BAUER 2008, 610).
Von einer Stigmatisierung des Cekanje/Dzekanje in der weißrussischen Gesellschaft, die dieser natürlichen Tendenz zur Affrizierung entgegenwirken würde, ist angesichts der geringen Bemerkbarkeit der Affrizierung, die von Sadoŭski für das Russische in Belarus (und ähnlich von Avanesov für die russische Variante des Russischen) bemerkt werden, nicht auszugehen. Dementsprechend verwundert es nicht, dass in den Transkripten des OK-WRGR auf affrizierte Realisierungen hindeutende Transkriptionen deutlich überwiegen (HENTSCHEL 2012, 226; HENTSCHEL & ZELLER 2014). Für die zentralen Sprecher des Korpus sind es in ‚hybriden‘ Äußerungen ca. 96%. Auch in ‚russischen‘ Äußerungen fällt der Wert nur gering auf 92%. HENTSCHEL & ZELLER (2014) schließen, dass es sich bei der Affrizierung der palatalisierten dental-alveolaren Plosive um einen aktiven phonetischen Prozess handelt, für dessen Unterdrückung kein sozialer Anlass besteht.
Im Folgenden werden diese anhand der binären Transkriptionen getroffe-nen Einschätzungen anhand exakter Messungen überprüft. Dabei geht es nicht darum, ob eine Affrizierung vorliegt, sondern eher darum, wie stark diese ausfällt.
Zur phonetischen Unterscheidung von Affrikaten und Plosiven 6.2.2
Affrikaten wie Plosive bestehen aus drei Phasen: der Phase des Verschlies-sens, des Haltens des Verschlusses sowie der Öffnung des Verschlusses. Im Gegensatz zu Plosiven weist die Öffnungsphase bei Affrikaten Friktion auf. Diese ergibt sich dadurch, dass die Verschlusslösung langsamer erfolgt und dadurch eine Enge gebildet wird (JOHNSON 2003, 144; ZINDER 1979, 140). Mit LADEFOGED & MADDIESON (1996, 90) kann angenommen werden, dass das Lösen eines Verschlusses stets in einer kurzen Phase der Engebildung resultiert, in der Friktion entsteht, so dass der phonetische Unterschied zwi-schen Plosiven und Affrikaten gradueller Natur ist. Auch perzeptiv ist der Unterschied eher gradueller Natur: Ob ein Laut als Plosiv oder als Affrikate wahrgenommen wird, hängt von der Dauer des Lautes ab, ist also eine Frage der Quantität und nicht der Qualität.139
139 HALLE (1959, 148) gibt als Grenzwert für das Russische 40 Millisekunden an. Ist das
Zeitintervall, in dem die Amplitude der Schallwelle unter 70% der Maximalamplitude des Lautes bleibt, kürzer als 40 Millisekunden, so werde der Laut als Plosiv wahrgenommen, andernfalls als Affrikate.
207
Wenn die palatalisierten dental-alveolaren Plosive des Russischen als nur leicht affriziert beschrieben werden, so ist davon auszugehen, dass dies in einer recht kurzen Dauer des frikativen Elements und/oder einer geringeren Intensität des frikativen Elements begründet ist. Auf eine Untersuchung der Intensität des frikativen Elements in WRGR muss hier aufgrund der unter-schiedlichen Qualität der einzelnen Aufnahmen verzichtet werden. Die Frage ist daher, ob sich zwischen den hier untersuchten Informantengruppen Unter-schiede in der Dauer finden, ob sich ein Einfluss des Russischen also in einer verkürzten Dauer der Affrikaten widerspiegelt. Direkte Vergleiche der Dauer im Russischen und Weißrussischen finden sich in der Literatur jedoch nicht, und auch nicht-kontrastive Angaben sind selten. CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988, 101) geben an, dass die Öffnungsphase im Falle von /ʦʲ/ bis zu 190 Millisekunden lang sein kann. Für das Russische /tʲ/ gibt BOLLA (1981, 121) eine Gesamtdauer von 190 Millisekunden an. Diese Angaben beziehen sich aber nicht auf natürliche Rede, so dass sie für die folgende Untersuchung keinen möglichen Vergleichswert darstellen.
Zur Dauer von (tʲ) und (dʲ) in WRGR 6.2.3
Im Folgenden wird geprüft, ob die Dauer von (tʲ) und (dʲ) sich in unter-schiedlichen Sprechergruppen und Äußerungstypen oder nach anderen Fakto-ren unterscheidet, insbesondere ob sie für jüngere Sprecher und in ‚hybriden‘ und vor allem ‚russischen‘ Äußerungen kürzer ausfällt. Da der Endpunkt von Affrikaten ähnlich wie bei Frikativen im Auslaut nicht oder kaum zu erken-nen ist (vgl. LADEFOGED 2003, 142), werden in der folgenden Analyse solche Positionen ausgeschlossen. Vor Konsonanten ist oft eine Verkürzung der Affrikaten zu beobachten (FBLM 1989, 330). Um den Einfluss des Kontextes möglichst gering zu halten, werden bei der Bestimmung der Durchschnitts-werte der Sprecher daher nur Realisierungen vor Vokal berücksichtigt. Auch in solchen Positionen ist jedoch die Bestimmung der Dauer mit Schwierig-keiten und Unsicherheiten verbunden. So kann die Dauer eines stimmlosen Frikativs zwischen zwei Vokalen abhängig gemacht werden von dem Vor-handensein bzw. der Abwesenheit entweder der Stimmbeteiligung oder der Friktion (vgl. LADEFOGED 2003, 142f.). In der vorliegenden Arbeit wird die Dauer des Lautes bei (tʲ) bestimmt als das Intervall zwischen dem Beginn der Verschlusslösung, markiert durch den Anstieg der Amplitude, ggf. eine leichte Plosion, und dem Beginn des vokalischen Elements. Für (dʲ) und auch bei sonoriertem (tʲ) wird der Beginn und das Ende der frikativen Phase als Beginn und Ende des Lautes angenommen.
208
Um zu überprüfen, ob Unterschiede zwischen den Sprechergruppen nicht auf allgemeine Unterschiede im Sprechtempo der Sprecher (etwa ein schnel-leres Sprechtempo bei jüngeren Sprechern) zurückgehen, wird zudem die Dauer von /s/ und /ʂ/ ermittelt. Für diese Sibilanten sind keine Unterschiede in der Dauer zwischen dem Russischen und Weißrussischen anzunehmen.
Abbildung 31 zeigt die durchschnittliche Dauer von (tʲ) und (dʲ) der ein-zelnen Sprecher getrennt für die Generationen. Pro Sprecher wurden für (tʲ) durchschnittlich 24,8 Token ausgewertet (7–51, σ=7,8), für (dʲ) durchschnitt-lich 21,1 Token (9–41, σ=8,7). Tabelle 126 im Anhang zeigt die Durch-schnittswerte pro Sprecher, sowie die Anzahl der in die Analyse eingegan-genen Token.
Durchschnittliche Dauer von (tʲ) und (dʲ), nur Realisierungen vor Vokal Abb. 31
Zunächst fällt auf, dass die durchschnittliche Dauer der frikativen Phase von (tʲ) und (dʲ) bei den einzelnen Sprechern stark variiert. Für (tʲ) schwankt sie zwischen 0,048 und 0,105 Sekunden (Gesamtmittelwert=0,069, σ=0,015). Für (dʲ) schwankt sie zwischen 0,028 und 0,065 (Gesamtmittelwert=0,045, σ=0,009). Die frikative Phase von (dʲ) ist kürzer als die von (tʲ) (t=-7,53; df=47,47; p<0,0001). Es deutet sich an, dass Generation 2 leicht längere Realisierungen beider Affrikaten als die beiden übrigen Generationen auf-weist, Generation 1 die kürzesten. Dies überrascht: Angesichts der stärkeren Beeinflussung der Generation 2 durch das Russische wäre zu erwarten, dass, wenn Unterschiede auftreten, diese in kürzeren Realisierungen für die jün-gere Generation bestehen würden.
0 1 2
0.00
0.04
0.08
0.12
(tʲ)
Generation
Mitt
lere
Dau
er
0 1 2
0.00
0.04
0.08
0.12
(dʲ)
Generation
Mitt
lere
Dau
er
209
Wie die Überprüfung der Sibilanten /s/ und /ʂ/ erweist, zeigt Generation 2 allerdings auch längere Realisierungen von anderen Sibilanten. Abbildung 32 zeigt zudem, dass bei den Sprechern ein starker Zusammenhang zwischen der Dauer von (tʲ) und (dʲ) und dem Mittelwert der durchschnittlichen Dauer von /s/ und /ʂ/ besteht (für (tʲ): r=0,80, p<0,001; für (dʲ): r=0,66, p<0,001).
Zusammenhang der Dauer von (tʲ) und (dʲ) mit der Dauer anderer Sibilanten Abb. 32
Es ist also nicht davon auszugehen, dass die längeren Realisierungen in Ge-neration 2 eine stärker ‚weißrussische‘ Realisierung bedeuten. Vielmehr ist es ein Unterschied, der zwischen den Generationen für alle Sibilanten gilt: Sprecher, die (tʲ) länger realisieren, weisen auch längere Realisierungen an-derer Sibilanten auf. Warum jüngere Sprecher längere Sibilanten aufweisen, ist unklar. (Für betontes /a/ waren keine Unterschiede in der Dauer zwischen den Generationen festzustellen, vgl. Abschnitt 5.4.3.)
Es ist davon auszugehen, dass die durchschnittliche Realisierung von (tʲ) und (dʲ) in quantitativer Hinsicht über die Generationen hinweg stabil ist, was als Beleg gewertet werden kann, dass die Affrizierung von (tʲ) und (dʲ) über die Generationen hinweg eine stabile Erscheinung ist. Dies bestätigt auf instrumentaler Basis die anhand der Transkriptionen im OK-WRGR gewon-nenen Befunde in HENTSCHEL & ZELLER (2014) sowie die Beobachtungen von Sadoŭski zur russischen Rede von Minsker Land-Stadt-Migranten.
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob sich die Dauer in unter-schiedlichen Äußerungstypen unterscheidet, ob also zum Beispiel Realisie-rungen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen eine längere Dauer aufweisen, was auf eine stärkere Affrizierung hinweisen würde.
0.07 0.09 0.11
0.05
0.07
0.09
(tʲ)
Mittlere Dauer von /s/ und /ʂ/
Mitt
lere
Dau
er (
tʲ)
0.07 0.09 0.110.
030.
040.
050.
06
(dʲ)
Mittlere Dauer von /s/ und /ʂ/
Mitt
lere
Dau
er (
dʲ)
210
Erklärende Variablen zu (tʲ) und (dʲ) Tab. 55
Erklärende Variable Werte / Messniveau Referenzwert Nachfolgender Kontext Vokal
Plosiv Vokal
Häufigkeit des Lemmas (logarithmiert) stetig -- Generation Generation 0
Generation 1 Generation 2
Generation 1
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform weißrussisch russisch gemeinsam hybrid
weißrussisch
Tabelle 56 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit der Dauer als abhängiger Variable. Es werden nur Realisierungen vor Vokalen und vor Plosiven einbezogen, da wie gesagt das Ende von frikativen Elementen im Auslaut nicht zu bestimmen ist, und andere konsonantische nachfolgende Kontexte kaum vorkamen. Zufallsfaktoren sind Familie (n=8) und Sprecher (n=33).
Mehrebenenmodell für die Dauer (in Millisekunden) von (tʲ), alle Äußerungen Tab. 56(n=796). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=6,3), Familie (n=8, σ=7,5)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 59,0 3,9 14,95 0,0001 Kontext rechts plosiv 12,0 3,9 3,06 0,0026 Generation Generation 0 -0,6 4,3 -0,15 0,8516 Generation 2 7,2 3,1 2,32 0,0216 Affinität der Äußerung gemeinsam 5,7 5,7 1,01 0,3208 hybrid 2,8 2,4 1,17 0,2448 russisch 4,4 2,8 1,56 0,1172
Zunächst ist festzustellen, dass Realisierungen vor Plosiven länger sind als vor Vokalen. Der Unterschied zwischen Generation 2 und den übrigen Ge-nerationen, der – wie oben gezeigt – auch für andere Sibilanten gilt, bleibt bestehen. Es zeigt sich, dass Realisierungen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen (dem Referenzwert) nicht länger, sondern sogar leicht kürzer als Realisierun-gen in anderen Äußerungen erfolgen. Der Unterschied zwischen ‚weißrussi-
211
schen‘ Äußerungen und ‚russischen‘ Äußerungen ist jedoch nicht signifi-kant.140
Mehrebenenmodell für die Dauer (in Millisekunden) von (dʲ) (n=663). Tab. 57Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=5,5), Familie (n=8, σ=5,1)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 48,1 3,3 14,81 0,0001 Kontext rechts plosiv 13,2 4,6 2,86 0,0042 Worthäufigkeit -0,7 0,3 -2,21 0,0276 Generation Generation 0 0,0 3,6 -0,01 0,9614 Generation 2 2,4 2,6 0,92 0,3148 Affinität der Äußerung gemeinsam -1,4 2,9 -0,48 0,5986 hybrid -4,0 1,6 -2,44 0,0198 russisch -3,7 2,0 -1,87 0,0580
Für die Dauer von (dʲ) ist ein Effekt der Worthäufigkeit festzustellen, häufi-gere Lexeme weisen signifikant kürzere Realisierungen auf. Der Einfluss von nachfolgenden Plosiven fällt wie für das stimmlose Äquivalent aus. Es beste-hen keine Unterschiede zwischen den Generationen. Realisierungen in ‚hyb-riden‘ Äußerungen sind signifikant, solche in ‚russischen‘ Äußerungen mar-ginal signifikant kürzer als Realisierungen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen. Der Unterschied ist jedoch mit ca. 4 Millisekunden äußerst gering. Anderer-seits ist die Dauer von (dʲ) generell sehr kurz.
Zusammenfassung: Die Analyse der Dauer der Variablen (tʲ) und (dʲ) liefert also letztlich kein klares Bild. Ihre Dauer kann zwischen verschiedenen Spre-chern stark schwanken, was jedoch auch für andere Sibilanten der Fall ist. Zwischen der Dauer von (tʲ) und (dʲ) und der Dauer anderer Sibilanten der Sprecher besteht ein klarer Zusammenhang, so dass nicht davon auszugehen ist, dass die Dauer der beiden Variablen durch den Kontakt mit dem Russi-schen beeinflusst ist. Für (tʲ) finden sich zwischen Äußerungen unterschiedli-cher Affinität keine Unterschiede. Nur für (dʲ) findet sich ein Hinweis, dass die Dauer in ‚weißrussischen‘ Äußerungen länger ausfällt als in ‚russischen‘ und ‚hybriden‘. Diese Unterschiede sind zwar (marginal) signifikant, aber äußerst gering. Vor dem Hintergrund der in HENTSCHEL & ZELLER (2014)
140 Zudem verbessert eine Zufallssteigung für Affinität der Äußerung in Generation das Modell
marginal signifikant (Log-Likelihood ohne Zufallssteigung: -2714,2; mit Zufallssteigung: -2705,8; χ2=16,86, df=10, p=0,0776). In einem Modell mit Zufallssteigung sinken die t-Werte leicht für ‚russisch‘ (auf -1,81) und stärker für ‚hybrid‘ (auf -1,86). Es ist also davon auszugehen, dass der Unterschied zwischen den Äußerungstypen nicht für alle Sprecher gilt.
212
analysierten Transkriptionen des OK-WRGR ist also davon auszugehen, dass die affrizierte Realisierung des Weißrussischen über die Generationen und Äußerungstypen hinweg stabil bleibt.
6.3 Variation im Artikulationsort der vorderen palatalisierten Sibilanten – die Variablen (tʲ), (dʲ) und (sʲ)
Hintergrund 6.3.1
/sʲ/ und /zʲ/ sind im Russischen Alveolare, die sich von /s/ und /z/ in der pala-talen Koartikulation, nicht aber im primären Artikulationsort (AVANESOV 1956, 134; ZINDER 1979, 132; KOCHETOV 2009, 66).141 Während das Russi-sche bei den vorderen Frikativen also eine nur auf Palatalität aufgebaute Opposition aufweist, unterscheiden sich die vorderen Sibilanten im Weißrus-sischen (ähnlich wie im Polnischen) dagegen zusätzlich im Artikulationsort. Im Weißrussischen erfolgt die Engebildung bei den palatalisierten Konso-nanten /sʲ/, /zʲ/ im Vergleich zu /s/ und /z/ sowie zu /sʲ/ und /zʲ/ im Russischen weiter hinten, in der „nachalveolaren (präpalatalen) Zone“ („ŭ zaal’vealjarnaj (prėpalatal’naj) zone“, FBLM 1989, 57), sowie durch eine stärker dorsale Artikulation.142 Der Klangeindruck dieser als „gelispelt“ („šapjaljavyja“) bezeichneten Laute wird oft als im Vergleich zum Russischen „weicher“143 und eher in Richtung von [ʃ] und [ʒ] oder der polnischen alveolo-palatalen [ɕ]
141 Dass die palatale Koartikulation völlig ohne Unterschiede im primären Artikulationsort
bleibt, ist unwahrscheinlich. Eine [i]-artige „reine“ Koartikulation ist am besten möglich bei Konsonanten ohne Zungenbeteiligung, d.h. bei bilabialen. Bei koronalen Lauten bestehen aufgrund der Gleichzeitigkeit zweier Artikulationsbewegungen dagegen oft auch geringe Unterschiede zu nicht-palatalisierten Konsonanten im primären Artikulationsort. Als quasi unausweichlich gelten Unterschiede im primären Artikulationsort bei dorsalen Konsonan-ten (LADEFOGED & MADDIESON 1996, 365). Auch SKALOZUB (1963, 28–32) beobachtet, dass bei den palatalisierten vorderen Sibilanten im Russischen ein größerer Teil des Zun-genrückens an der Artikulation beteiligt ist.
142 Vgl. hierzu und zum Folgenden KARSKIJ (2006 [1908], 45–47); ČĖKMAN (1970, 94–105), PADLUŽNY & ČĖKMAN (1973, 72–100 und 107–123), ANTIPOVA (1977, 115), KRYVICKI &
PADLUŽNY (1984, 48–55 und 147), BIRYLA & ŠUBA (1985, 45f.), CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988, 99–105), FBLM (1989, 57f. u. 323–327), VYHONNAJA (1991, 207f.). Der Zeitraum dieser Palatalisierung des primären Artikulationsortes im Weißrussischen wird wie der Zeitraum der Affrizierung von (tʲ) und (dʲ) für das 15. und 16. Jh. angesetzt. Als Auslöser oder Vorbedingung wird die Entpalatalisierung von |ʃʲ|, |ʒʲ| und |ʧʲ| angenommen (vgl. ČĖKMAN 1970, 66).
143 In der slavistischen Tradition werden – wie oben dargelegt – palatalisierte Konsonanten als „weich“, nicht-palatalisierte als „hart“ bezeichnet, die ehemals „weichen“, depalatalisierten als „verhärtet“.
213
und [ʑ] gehend bezeichnet, wobei in der Regel die Andersartigkeit gegenüber den polnischen Lauten betont wird. Der Artikulationsort liegt also zwischen dem alveolaren und dem alveolo-palatalen Bereich. Traditionell werden die weißrussischen Laute mit einem Doppelapostroph transkribiert: [s"] und [z"].144 Wie bereits erwähnt, werden sie in dieser Arbeit als „posterior-alveo-lar“ bezeichnet.
Eine posterior-alveolare Artikulation wird im Weißrussischen auch für /ʦʲ/ und /ʣʲ/ angenommen.145 Dieses Urteil wird allerdings oft eingeschränkt und die posterior-alveolare Artikulation als schwächer ausgeprägt als bei den Frikativen eingeschätzt. Für das Russische, wo, wie beschrieben, affrizierte Realisierungen von /tʲ/ und /dʲ/ möglich sind, wird eine vergleichbare poste-rior-alveolare Artikulation verneint (CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 101).
Umstritten ist, ob die posterior-alveolare Realisierung der vorderen pala-talisierten Sibilanten im Weißrussischen normhaft ist (bzw. sein sollte). Wäh-rend ČĖKMAN (1970, 99) sie als Dialektmerkmal und als nicht der Norm der Standardsprache entsprechend betrachtet, beschreibt VYHONNAJA (1991, 208) sie als Teil der weißrussischen Orthoepie, Abweichungen von ihr seien Fol-gen der „Zweisprachigkeit“ der Sprecher, mit anderen Worten Interferenzen des Russischen. Auch in sprachdidaktischen Werken wird die im Vergleich zum Russischen unterschiedliche Aussprache erwähnt (KRIVICKIJ, MICHNEVIČ & PODLUŽNYJ 1990, 37). Es bestehen aber auch viele orthoepi-sche oder phonetisch-phonologische Arbeiten, in denen auf dieses Merkmal nicht eingegangen wird, z.B. JANKOŬSKI (1976) und BM (2004).146 In der Realität ist bei Trägern des weißrussischen Standards wohl Variation zu be-obachten, wie dies bereits bei den wenigen Informanten, die PADLUŽNY & ČĖKMAN (1973, 107–123) untersuchen, zu finden ist: Bei einigen Sprechern wird die Enge des Frikativs prädorsal, bei anderen koronal gebildet, bei ei-nem der Informanten variieren prädorsale und koronale Bildung.
144 Palatalisiertheit wird in slavistischen Arbeiten traditionell durch einen einfachen Apostroph
gekennzeichnet. 145 Eine posterior-alveolare Artikulation wird auch für den alveolaren Nasal /nʲ/ angenommen,
nicht aber für das alveolare /lʲ/ (PADLUŽNY & ČĖKMAN 1973, 251). Eine Verlagerung des primären Artikulationsortes nach hinten wird außerdem als Ursache für den Wandel /rʲ/ > /r/ angenommen (ČĖKMAN 1970, 105–108).
146 Unterschiedliche Aussagen finden sich teilweise in einem Werk. So schreiben KRYVICKI & PADLUŽNY (1984, 50), dass die vorderen palatalisierten Affrikaten im Weißrussischen zu den „gelispelten” Konsonanten gehörten, schreiben an anderer Stelle (1984, 147) jedoch, dass dies eine dialektale Erscheinung sei, die die Dialekte von der Standardsprache unter-scheide.
214
Ebenfalls nicht endgültig geklärt ist, ob bzw. in welchem Maße die posterior-alveolare Artikulation der genannten Konsonanten ein Merkmal aller weißrussischen Dialekte ist (vgl. ČĖKMAN 1970, 94–97 für einen Über-blick über die dialektologischen Meinungen). Im DABM (1963a) sowie in NPBD (1964, 117–125) wird eine posterior-alveolare Artikulation der Sibi-lanten nicht erwähnt. ČĖKMAN (1970, 97) findet das Merkmal bei seiner eigenen Feldarbeit dagegen in allen untersuchten, über das gesamte Gebiet von Belarus verstreuten Siedlungspunkten. Es sei nicht nur bei vereinzelten Sprechern anzutreffen, sondern gelte generell für alle weißrussischen Dia-lekte. Wie KRYVICKI & PADLUŽNY (1984, 147) bemerkt er aber im Nord-osten147 und vor allem im Osten des Landes eine stärker nach hinten verla-gerte Artikulation als in zentralen und südwestlichen Gebieten.
In Arbeiten zur weißrussischen Variante des Russischen bzw. zum weiß-russischen Akzent im Russischen wird auf eine posterior-alveolare Artikula-tion selten eingegangen. In Abschnitt 6.2 wurde bereits erwähnt, dass in der Rede von Minsker Land-Stadt-Migranten unter allen Variablen (sʲ), (zʲ), (tʲ) und (dʲ) die einzigen sind, für die SADOǓSKI (1982, 212) bei seinen Infor-manten ausnahmslos in allen Belangen mit dem Weißrussischen überein-stimmende Realisierungen notiert.148 (tʲ) und (dʲ) werden zwar auch in der russischen Rede gebürtiger Minsker affriziert, aber anders als bei den Mi-granten eben nicht posterior-alveolar artikuliert (SADOŬSKI 1982, 198). Diese Unterschiede würden von den Informanten nicht wahrgenommen.
Während Sadoŭski also eine konstant ‚weißrussische‘ Artikulation fest-stellt, finden sich bei Čėkman auch sporadische Hinweise darauf, dass der Kontakt mit dem Russischen die Artikulation beeinflussen kann (ČĖKMAN 1970, 97) und auch graduelle, sprecherinterne und sprechsituationsabhängige Variation zwischen [s"] und [sʲ] vorliegen kann (ČEKMONAS 1997, 263, allerdings in Bezug auf die Pskover Dialekte des Russischen, für die wie für das Weißrussische eine posterior-alveolare Realisierung charakteristisch ist).
Im Folgenden wird die Variation von eher ‚weißrussischen‘ posterior-alveo-laren Realisierungen mit eher ‚russischen‘ alveolaren Realisierungen in WRGR untersucht. Es wird dabei nur auf die Sibilanten (sʲ), (tʲ) und (dʲ) ein-gegangen, da /zʲ/ insgesamt zu selten in auswertbarem Material vorliegt. In
147 Posterior-alveolare Sibilanten sind auch für die angrenzenden Dialekte auf russischer Seite
im Gebiet von Pskov charakteristisch (vgl. ČEKMONAS 1997; DARJa 1986, Karte 64). 148 Ähnlich äußert sich ČEKMONAS (1997, 252).
215
den Transkripten des OK-WRGR wurde das Merkmal der posterioren Arti-kulation nicht wiedergegeben.
Insgesamt ist die Stabilität der posterior-alveolaren Artikulation in WRGR schwer vorherzusehen. Was die Natürlichkeit der posterior-alveola-ren Artikulation angeht, so ist die (Alveolo-)Palatalisierung des primären Artikulationsorts von palatalisierten Dentalen als eine Vereinheitlichung der primären und der sekundären Artikulationsgeste zu betrachten. Sie ist ein häufiger Wandel, der (wie schon mehrfach angedeutet) für die historischen Äquivalente der weißrussischen und russischen Phoneme auch im Polnischen und in einigen russischen Dialekten zu beobachten ist. Ähnliche Prozesse finden sich in einer Reihe von weiteren Sprachen (vgl. PADGETT & ŻYGIS 2007, 295), während die umgekehrte Richtung, d.h. die Trennung in eine primäre dentale Artikulation und eine gleichzeitige sekundäre palatale Arti-kulation, wohl kaum belegt ist.
Methode 6.3.2
6.3.2.1 Zur akustisch-phonetischen Unterscheidung von Sibilanten
Frikative und der frikative Teil von Affrikaten werden durch eine Enge im Vokaltrakt gebildet, in der die ausströmende Luft sich mit erhöhter Ge-schwindigkeit fortbewegt. Die Geräuschquelle von Frikativen sind Luft-stromturbulenzen, die dadurch entstehen, dass der aus diesem Kanal austre-tende, schnelle Luftstrom auf die dahinter befindliche, sich in Ruhe befin-dende Luft trifft. Die Bewegung der entstehenden Luftwirbel ist irregulär und chaotisch, die Bewegung der Schalldruckwelle dementsprechend zufällig und aperiodisch (vgl. hierzu und zum Folgenden PICKETT, 1980, 128–131; KENT
& READ 1991, 121–136; JOHNSON 2003, 120–133; LADEFOGED & MADDIESON 1996, 173–179).
Der spektrale Unterschied und damit der unterschiedliche Höreindruck von verschiedenen Sibilanten entsteht durch die Filterwirkung des Vokal-trakts. Entscheidend ist dabei der aufgrund der Stellung der Artikulations-organe unterschiedlich lange Bereich zwischen der Engebildung und der Öffnung der Mundhöhle, d.h. den Lippen. Dieser „Vorderraum“ (die „front cavity“) fungiert als Resonanzraum, der bestimmte Frequenzbereiche ver-stärkt: Je weiter hinten im Mundraum die Engebildung erfolgt, desto länger ist dieser Resonanzraum (insbesondere wenn die Engebildung so weit hinten erfolgt, dass der Raum unter der Zunge, die „sublingual cavity“, zum vorde-ren Resonanzraum hinzukommt), wodurch jeweils andere Frequenzen ver-
216
stärkt werden und ein für den Frikativ spezifisches Spektrum entsteht. Da lange Resonanzräume niedrigere Resonanzfrequenzen aufweisen, kurze dementsprechend hohe, gilt, dass bei einem hinteren Artikulationsort tiefere Frequenzbereiche am stärksten ausgeprägt sind, d.h. die höchsten Amplitu-den aufweisen (HUGHES & HALLE 1956, 306). So hat ein [s] beispielsweise hohe Amplituden zwischen 6000 und 9000 Hz, [ʃ] zwischen 2000 und 4000 Hz (vgl. HUGHES & HALLE 1956; BEHRENS & BLUMSTEIN 1988; JOHNSON 2003, 130; LADEFOGED 2003, 152f., wobei die Angaben in den einzelnen Untersuchungen schwanken). Dies gilt auch für die stimmhaften Äquivalente, wobei diese sich außer durch das Vorhandensein des Stimmtons durch weni-ger ausgeprägte Gipfel und insgesamt eine niedrigere Amplitude auszeichnen (JESUS & SHADLE 2002; MANIWA et al. 2009). 149
Für das Russische finden sich akustische Untersuchungen zu Sibilanten bei HALLE (1971), BOLLA (1981), ZSIGA (2000), ŻYGIS (2003) und PADGETT & ŻYGIS (2007). Für das russische [sʲ] ist die starke Ausprägung zweier Fre-quenzbereiche charakteristisch: Neben einer Konzentration hoher Ampli-tuden in höheren Frequenzbereichen, die denen von [s] entsprechen, findet sich auch zwischen 2000 und 3000 Hz, also im Bereich des zweiten For-manten von [i], ein Bereich mit ausgeprägten Amplituden, die durch die palatale Koartikulation bedingt sind. Ansonsten finden sich während der Dauer der Engebildung keine spektralen Unterschiede zu [s] (HALLE 1971, 132 und 150; BOLLA 1981, Schaubild 57; ZINDER 1979, 132f.; ZSIGA 2000, 94). Diese Trennung zweier ausgeprägter Bereiche im Spektrum wird als akustische Entsprechung der artikulatorischen Unabhängigkeit beider Arti-kulationsgesten gedeutet. Es erfolge also ein “overlap without weakening and blending of the primary /s/ gesture” (ZSIGA 2000, 95).
Angaben zu akustischen Eigenschaften der Sibilanten des Weißrussischen finden sich bei KRYVICKI & PADLUŽNY (1984), CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988) und in der FBLM (1989). In vielen dieser – älteren – Untersuchungen werden allerdings nur relativ niedrige Frequenzbereiche (bis 5000 Hz) unter-sucht, wodurch bei den vorderen Sibilanten, für die wie gesagt höhere Fre-quenzbereiche ausgeprägt sind, einige Charakteristika unbeobachtet bleiben. Für die weißrussischen /sʲ/ und /ʦʲ/ werden als Unterschied zu [s] und [ʦ] in der Regel ähnlich wie für das Russische nur hohe Amplituden im Bereich
149 Dentale und labiale Frikative haben recht flache Spektren ohne klare Gipfel, eine höhere
Standardabweichung, eine geringere Amplitude und eine kürzere Dauer als Sibilanten (MANIWA et al. 2009, 3963).
217
von 2000–3000 Hz, teilweise auch im Bereich von ca. 300 Hz bemerkt (KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 88f.; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 101–105). Die Autoren der FBLM (1989, 88) schließen analog zu Beschreibungen des Russischen, dass die Palatalisiertheit sich akustisch in ausgeprägten Frequenzbereichen äußert, die im Bereich der Formanten von [i] liegen. Unterschiede im Spektrum zwischen /sʲ/ und /zʲ/ einerseits und /s/ und /z/ andererseits, die auf unterschiedliche Artikulationsorte hinweisen würden, werden dagegen nicht beobachtet.
Klare Unterschiede zwischen den Spektren von Realisierungen von /s/ und /sʲ/ beobachtet dagegen ČEKMONAS (1997) für den Pskover Dialekt des Russischen, in denen /sʲ/ wie gesagt ebenfalls posterior-alveolar als [s"] realisiert wird. Während Realisierungen von /s/ in seinen Analysen hohe Amplituden oberhalb von 6000 Hz aufweisen und Realisierungen von /ʂ/ im Bereich von 2440 bis 3000 Hz, liegen die ausgeprägtesten Frequenzen bei /sʲ/ im Bereich von 3000 bis 4000 Hz, also in Bereichen, die denen von /ʂ/ nahe-kommen (ČEKMONAS 1997, 255–257). Dies deutet auf eine deutlich posteri-ore Artikulation hin. 150
Die Frage ist nun, wie solche spektralen Unterschiede am besten zu quantifi-zieren sind.151 Spektren von Frikativen haben anders als die Spektren von Vokalen keine klaren Gipfel, die in einer LPC-Analyse bestimmt werden könnten (wie die Formanten bei Vokalen), bzw. die ermittelten Gipfel kön-nen bei ein und demselben Sprecher stark schwanken. Als verlässlicher hat sich die Berechnung des ersten spektralen Momentes bzw. des sogenannten Gravitationszentrums (im Folgenden „CoG“ nach der englischen Bezeich-nung „Center of Gravity“) der spektralen Kurve erwiesen (FORREST et al. 1988; GORDON, BARTHMAIER & SANDS 2002; JOHNSON 2003, 130; LADEFOGED 2003, 156–157). Der CoG-Wert ist die Summe der einzelnen Frequenzen (in Hz) jeweils multipliziert mit ihrer relativen Intensität (in dB), dividiert durch die Summe der relativen Intensitäten.152 Große Mengen an akustischer Energie in niedrigen Frequenzbereichen bewirken also einen niedrigen CoG-Wert, große Mengen in hohen Frequenzbereichen bewirken einen hohen CoG-Wert. Dementsprechend haben vordere Frikative wie [s]
150 Ein ähnliches Bild ergibt sich für das polnische [ɕ], dessen stärkste Frequenzbereiche
ebenfalls zwischen denen von [s] und [ʂ] liegen, vgl. JASSEM (1968). 151 Vgl. MANIWA et al. (2009, 3963) für einen Überblick über akustische Studien zu Sibilanten
und die dabei benutzten Messwerte. 152 D.h. relativ zur geringsten Intensität des Spektrums. Diese wird gleich Null gesetzt.
218
einen hohen CoG-Wert, hintere wie [ʃ] oder [ʂ] einen niedrigen. Artikulato-risch „mittlere“ Sibilanten wie das polnische [ɕ] weisen einen mittleren CoG-Wert auf. Während sich die CoG-Werte von [s] deutlich von den postalveola-ren [ɕ], [ʃ] oder [ʂ] unterscheiden, liegen bei letzteren die Werte jedoch zu-weilen dicht beieinander und überlappen sich teilweise (vgl. ŻYGIS &
HAMANN 2003; ŻYGIS 2010). Sekundäre Palatalisiertheit hat dagegen keinen oder nur einen geringen Einfluss auf den CoG-Wert eines Sibilanten. ŻYGIS (2010) für das Bulgarische und HAMANN & AVELINO (2007) für Ocotepec-Mixe finden keine Unterschiede zwischen [s] und [sʲ]. ŻYGIS (2003) findet für das Bulgarische und das Russische leicht niedrigere CoG-Werte für [sʲ] als für [s]. Ausgehend von Daten aus drei Sprachen (Polnisch, Bulgarisch, Russisch) stellen PADGETT & ŻYGIS (2007, 305) folgende Reihung hinsicht-lich der Höhe des CoG-Wertes fest: [s]/[sʲ] > [ɕ] >[ʃ]/[ʃʲ] > [ʂ].
6.3.2.2 Auswahl, Segmentierung und Erhebung der Messwerte
In dieser Arbeit wird der CoG-Wert der einzelnen Realisierungen der Va-riablen gemessen, um auf Unterschiede im primären Artikulationsort zu schließen. Der Einsatz und das Aussetzen der Frikativität wurden als Beginn und Ende des Lautes bestimmt. Bei zwei aufeinanderfolgenden Frikativen sind die Grenzen zwischen den Lauten oft nicht festzustellen; oft treten Assimilationserscheinungen auf (FBLM 1989, 97 und 327; BIRYLA & ŠUBA 1985, 30). Daher wurden Sibilanten in solchen Kontexten nur berücksichtigt, wenn durch eine Phase von geringer Amplitude zwischen den Lauten klar zwei unterschiedliche Laute zu erkennen waren. Für (tʲ) und (dʲ) wurden nur Laute mit einer Öffnungsdauer von mindestens 40 Millisekunden und außer-dem einer auditiv feststellbaren Frikativität analysiert, die seltenen Realisie-rungen als [tʲ] oder [dʲ] gehen also nicht in die Analyse ein. Die CoG-Werte wurden für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 12 000 Hz berechnet. Die niedrigen Frequenzen unter 1000 Hz gehen nicht in die CoG-Werte ein, da erstens die relevanten Unterschiede zwischen den Lauten sich in höheren Frequenzbereichen befinden, zweitens in den untersuchten Gesprächen oft Lärm in niedrigeren Frequenzbereichen auftritt. Die Berechnung der CoG-Werte geschah mithilfe des Emu-Package von R (EMU-R 2012; vgl. HARRINGTON 2010).
Zwischen den hier untersuchten Aufnahmen bestehen Unterschiede in der Qualität, die sich auf die CoG-Werte auswirken. In Aufnahmen besserer Qualität sind die Unterschiede zwischen den Sibilanten deutlicher. Diesen Artefakten wird dadurch entgegengewirkt, dass in jeder Aufnahme stets alle
219
Sibilantenklassen analysiert werden (also auch /s/ und /ʂ/, die für die Nor-malisierung herangezogen werden, vgl. Abschnitt 2.3.2.3). Die Verteilung der Sibilantenklassen auf die Gespräche ist also in etwa gleich. Aufgrund der unten beschriebenen Normalisierung ist davon auszugehen, dass dadurch die qualitätsbedingten Unterschiede weitgehend herausgerechnet werden.
Es stellt sich zunächst die Frage, die CoG-Werte welcher Phase des Sibi-lanten sinnvollerweise für den Sprechervergleich herangezogen werden sollten. Abbildung 33 zeigt die Entwicklung der CoG-Werte von /s/, (tʲ), (sʲ), (ʧʲ) sowie /ʂ/ über die Dauer des Lautes, d.h. gemessen nach einem Zehntel seiner Dauer, nach zwei Zehnteln usw. Es handelt sich dabei um Gesamt-mittelwerte, also den Mittelwert der Mittelwerte der einzelnen Sprecher.
Entwicklung der CoG-Werte in Hertz über die Dauer der Sibilanten. Die Daten-Abb. 33
punkte zeigen die Gesamtmittelwerte aller Sprecher
Die CoG-Werte ändern sich über die Dauer des Lautes mehr oder weniger stark, was auf spektrale Unterschiede in unterschiedlichen Phasen der Laute schließen lässt. Für /s/ und (sʲ) ist zunächst ein starker Anstieg zu verzeich-nen, zum Ende hin ein leichter Abstieg. Insgesamt verlaufen die Kurven relativ parallel. /ʂ/ ist recht stabil, allerdings ist auch hier ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Für die Affrikaten sind dagegen nur ein leichter Anstieg und ein verhältnismäßig stärkeres Abfallen zu verzeichnen.
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
/s/
(tʲ)
(sʲ)
(ʧʲ)
/ʂ/
220
Bezogen auf das mittlere Drittel ist die Reihenfolge der CoG-Werte /s/ > (tʲ) > (sʲ) > (ʧʲ) > /ʂ/. Dies entspricht angesichts der in Abschnitt 6.3.1 dargelegten Zusammenhänge zwischen dem Artikulationsort und dem CoG-Wert den artikulatorischen Beschreibungen der ‚weißrussischen‘ Sibilanten: Der nicht-palatalisierte alveolare Sibilant /s/ hat den höchsten CoG-Wert. Der niedrigere CoG-Wert für (tʲ) deutet auf eine im Vergleich insgesamt posteri-ore Artikulation hin. Der wiederum niedrigere CoG-Wert von (sʲ) deutet darauf hin, dass dieser Laut durchschnittlich stärker posterior-alveolar ist als (tʲ). Dies entspricht, wie oben dargelegt, den Beschreibungen der Verhältnisse im Weißrussischen. Die Werte von (ʧʲ) und /ʂ/ sind gemäß ihrer postalveola-ren Artikulation deutlich niedriger, wobei (ʧʲ) leicht höhere Werte hat als /ʂ/. Gegen Ende hin nähern sich die Werte von (tʲ) denen von (sʲ) an, die von (ʧʲ) erreichen die von /ʂ/.
Angesichts dieser Verhältnisse wird für die Analysen bei Frikativen der CoG-Wert des Durchschnittsspektrums des mittleren Drittels des Sibilanten herangezogen. Bei Affrikaten ist angesichts von Abbildung 33 davon auszu-gehen, dass zunächst der alveolare Ort des Verschlusses eine Rolle spielt, und erst zum Ende hin das phonetische Ziel der frikativen Phase erreicht wird, so dass sich das Merkmal der posterior-alveolaren Artikulation erst am Ende auswirken kann. Von daher wird für die Affrikaten der CoG-Wert des letzten Drittels des Lautes für die Analyse genutzt.
6.3.2.3 Normalisierung
Bereits HUGHES & HALLE (1956) bemerken, dass die spektralen Unter-schiede zwischen Sibilanten bei unterschiedlichen Sprechern zwar stets in die gleiche Richtung gehen, die Spektren für ein und dasselbe Sibilantenphonem bei unterschiedlichen Sprechern jedoch stark unterschiedlich ausfallen kön-nen. Diese sprecherindividuellen Unterschiede schlagen sich auch auf die CoG-Werte nieder, was den Vergleich zwischen Sprechern und Sprecher-gruppen erschwert. Abbildung 34 verdeutlicht diese Problematik. Gezeigt werden zwei Boxplots für die CoG-Werte (in Hertz) der Sibilanten /s/, (sʲ) und /ʂ/ von zwei weiblichen Vertretern der Generation 2.
221
Zur Normalisierung: Absolute CoG-Werte (in Hz) von /s/, (sʲ) und /ʂ/ zweier Abb. 34
Sprecher
Die absoluten CoG-Werte von (sʲ) sind für die Sprecherin ra_A niedriger als für die Sprecherin sa_I. Deutlich sichtbar ist jedoch, dass die Werte für (sʲ) von ra_A näher an denen von /s/ liegen, relativ gesehen also höher sind als die von sa_I. Für sa_I liegen die Werte von (sʲ) eher in der Mitte zwischen /s/ und /ʂ/, was auf eine stärker posterior-alveolare Artikulation hinweist.
Wie Abbildung 35 zeigt, sind die CoG-Werte für die jüngere Generation für alle Sibilanten durchschnittlich höher als für die älteren Generationen.
Durchschnittliche absolute CoG-Werte für die stimmlosen Sibilanten in den drei Abb. 35
Generationen
5000
6000
7000
8000
sa_I
CoG
(H
z)/s/ (sʲ) /ʂ/
5000
6000
7000
8000
ra_A
CoG
(H
z)
/s/ (sʲ) /ʂ/
5500
6000
6500
7000
CoG
(H
z)55
0060
0065
0070
0055
0060
0065
0070
00
/s/ (t ʲ) (sʲ) (ʧʲ) /ʂ/
Generation 0Generation 1Generation 2
222
Zumindest für /s/ ist nicht zu erwarten, dass die höheren Werte in Genera-tion 2 auf einen Einfluss des Russischen zurückzuführen sind. Von solchen nicht-kontaktbedingten Unterschieden gilt es zu abstrahieren, bevor Spre-cher- oder Sprechergruppenvergleiche angestellt werden.
Im Gegensatz zu Vokalen, wo Sprechernormalisierungen gängig sind, sind für Sibilanten in der einschlägigen Literatur bislang keine Normalisie-rungsprozeduren vorgeschlagen. Für die vorliegende Untersuchung wurde daher eine Methode entwickelt, die sich an die von LOBANOV (1971) vorge-schlagene Prozedur im Bereich der Vokale anlehnt (vgl. Abschnitt 5.2.3). Die Grundidee ist, dass die durchschnittlichen CoG-Werte der Phoneme /s/ und /ʂ/ eines einzelnen Sprechers als Fixpunkte genommen werden, anhand derer die übrigen CoG-Werte dieses Sprechers normalisiert werden. Ähnlich wie die Lobanov-Normalisierung setzt die Formel in Abbildung 36 das „Zen-trum“ der Verteilung (hier verstanden als der Mittelwert der Mittelwerte von /s/ und /ʂ/) auf den Wert 0, indem von den beobachteten Werten der Mittel-wert der Mittelwerte von /s/ und /ʂ/ subtrahiert wird. Die „Variation“ der Verteilung (hier die Abweichung von /s/ und /ʂ/ von dieser Mitte) wird auf den Wert 1 gesetzt, indem durch die Hälfte des Abstandes von /s/ und /ʂ/ dividiert wird. Die CoG-Werte der übrigen Sibilanten werden dadurch relativ zu den Mittelwerten von /s/ und /ʂ/ gesetzt. Ein Wert von 0 bedeutet einen CoG-Wert genau in der Mitte zwischen dem von /s/ und /ʂ/,153 ein Wert von 1 einen Zusammenfall mit dem Mittelwert von /s/, ein Wert von -1 einen Zusammenfall mit dem Mittelwert von /ʂ/.
ʂ2
ʂ2
Formel zur Normalisierung von CoG-Werten für Sibilanten. x ist der absolute CoG-Abb. 36Wert eines Sibilanten. und ʂsind die Mittelwerte der CoG-Werte von /s/ und /ʂ/ des jeweiligen Sprechers.
Abbildung 37 zeigt die CoG-Werte der beiden oben als Beispiel gezeigten Sprecher nach dieser Normalisierung. Die normalisierten Werte für (sʲ) von
153 Was natürlich keinesfalls bedeuten soll, dass sich auch der Artikulationsort in der Mitte
zwischen dem von /s/ und dem von /ʂ/ befindet. Wie der von ŻYGIS & HAMANN (2003) beobachtete geringe Unterschied im CoG-Wert zwischen polnischem [ɕ], [ʃ] und [ʂ] und der recht große Unterschied zwischen diesen drei einerseits und [s] andererseits andeutet, besteht keine lineare Beziehung zwischen dem Artikulationsort und dem CoG.
223
Sprecherin ra_A sind nun durchschnittlich höher als die von Sprecherin sa_I, was der relativen Nähe von (sʲ) zu /s/ bei dieser Sprecherin entspricht.
Zur Normalisierung: Normalisierte CoG-Werte von /s/, (sʲ) und /ʂ/ zweier Sprecher Abb. 37
Diese sprecherbezogene Normalisierung beruht auf der Voraussetzung, dass /s/ und /ʂ/ in der untersuchten Gruppe stabil sind, also vom Sprachkontakt nicht betroffen sind. Für /s/ ist diese Annahme unproblematisch, für /ʂ/ dage-gen nicht: Vereinzelt wird für das Weißrussische /ʂ/ eine stärker velarisierte Realisierung beschrieben als für das Russische (PADLUŽNY & ČĖKMAN 1973, 180). Für das Russische von Land-Stadt-Migranten werden sogar palatali-sierte Varianten beobachtet (SADOŬSKI 1982, 213; vgl. unten 6.4.1). Aller-dings verhält sich die Normalisierung in Bezug auf (sʲ) und (tʲ) konservativ: Wenn die Artikulation von (sʲ) beispielsweise über die Generationen konstant bliebe, während /ʂ/ für jüngere Sprecher weniger stark velarisiert würde, würde die weniger starke Velarisierung einen erhöhten CoG-Wert von /ʂ/ bedeuten. (sʲ) wäre dementsprechend relativ näher an /ʂ/ und hätte niedrigere normalisierte Werte. Sollten sich also für jüngere Sprecher umgekehrt höhere CoG-Werte für (sʲ) ergeben, so wäre dies ein zuverlässiger Befund.
-3-2
-10
12
3sa_I
CoG
(no
rmal
isie
rt)
/s/ (sʲ) /ʂ/
-3-2
-10
12
3
ra_A
CoG
(no
rmal
isie
rt)
/s/ (sʲ) /ʂ/
224
Wenden wir diese Normalisierungsprozedur auf die Daten an, so ergibt sich folgendes Bild.
Durchschnittliche normalisierte CoG-Werte in den drei Generationen Abb. 38
Es deuten sich Unterschiede zwischen den Generationen an. Für Generation 2 liegen die durchschnittlichen normalisierten CoG-Werte für (sʲ) und (tʲ) höher als für die anderen Generationen, was eine Entwicklung in Richtung des Russischen nahelegt. Für (ʧʲ) liegt der durchschnittliche CoG-Wert der Gene-ration 2 dagegen niedriger als bei den älteren Generationen, was auf eine stärker ‚weißrussische‘ Artikulation hindeuten würde und ein überraschender Befund wäre. Dieses wird im Folgenden näher untersucht.
Ein Vergleich zwischen den vorderen palatalisierten Sibilanten in 6.3.3WRGR
In diesem Abschnitt werden die drei in der vorliegenden Arbeit untersuchten vorderen palatalisierten Sibilanten – also (tʲ), (dʲ) und (sʲ) – untereinander verglichen. Abbildung 38 deutete (wie auch bereits Abbildung 33 und Abbil-dung 35 oben) an, dass die CoG-Werte für (tʲ) höher sind als für (sʲ). (Hierbei darf nicht vergessen werden, dass die Werte von (sʲ) auf dem mittleren Drittel des Lautes beruhen, die für (tʲ) wie auch die für (dʲ) auf dem letzten Drittel.) Abbildung 39 zeigt Boxplots für die Sprechermittelwerte der drei Sibilanten, die diese Beobachtung bestätigen. Das stimmhafte (dʲ) hat insgesamt die niedrigsten CoG-Werte.
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
CoG
(no
rmal
isie
rt)
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
/s/ (t ʲ) (sʲ) (ʧʲ) /ʂ/
Generation 0Generation 1Generation 2
225
Durchschnittliche CoG-Werte der untersuchten Sprecher für (sʲ), (tʲ) und (dʲ) Abb. 39
Eine einfaktorielle Anova mit Messwiederholung bestätigt, dass signifikante Unterschiede zwischen den Lauten bestehen (F(1,52; 45,69)=22,07, p<0,001; Greenhouse-Geisser-korrigiert). Post-hoc-Vergleiche (mit Bonferroni-Kor-rektur) bestätigen, dass die normalisierten CoG-Werte von (tʲ) im letzten Drittel des Lautes mit einem Mittelwert von 0,43 immer noch höher sind als für (sʲ) im mittleren Drittel des Lautes mit einem Mittelwert von 0,15 (p=0,001). Dies entspricht den gängigen Beschreibungen des Weißrussi-schen, die eine im Vergleich zu (sʲ) weniger stark posterior-alveolare Artiku-lation der Affrikate bemerken. (dʲ) weist mit einem Mittelwert von -0,10 marginal signifikant niedrigere CoG-Werte auf als (sʲ) (p=0,053). Für (dʲ) ist jedoch bei einem direkten Vergleich mit den Werten der stimmlosen Laut-klassen natürlich Vorsicht geboten, da mit der Stimmhaftigkeit einherge-hende Unterschiede im Spektrum – weniger ausgeprägte Gipfel und insge-samt eine niedrigere Amplitude – Einfluss auf den CoG-Wert haben können (vgl. Abschnitt 6.3.2). Der Befund muss also nicht heißen, dass (dʲ) eine stärker posterior-alveolare Artikulation als (sʲ) aufweist.
Zudem gibt es einen Zusammenhang zwischen den normalisierten durch-schnittlichen CoG-Werten der einzelnen Sprecher. Sprecher, die hohe Werte für (tʲ) aufweisen, weisen auch hohe Werte für (sʲ) (r=0,71, p<0,001) und für (dʲ) auf (r=0,74, p<0,001). Auch zwischen den Realisierungen von (sʲ) und denen von (dʲ) besteht ein Zusammenhang, wenn auch nicht so stark (r=0,45, p=0,011). Da bei diesen Werten allgemeine Unterschiede zwischen den Si-bilanten der Sprecher herausgerechnet sind, kann es sich nicht um Zusam-
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(dʲ) (s ʲ) (tʲ)
226
menhänge handeln, die durch allgemeine, physiognomische Unterschiede der Sprecher verursacht sind.
Zusammenhang der normalisierten durchschnittlichen CoG-Werte der einzelnen Abb. 40
Sprecher
Zusammenfassung: Sprecher verhalten sich hinsichtlich des Merkmals der posterioren Artikulation also relativ konstant für alle drei hier untersuchten Sibilanten, tendieren also für die vorderen palatalisierten Sibilanten entweder
-0.5 0.0 0.5 1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(tʲ) und (s ʲ)
CoG (sʲ)
CoG
(tʲ)
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0-0
.50.
00.
51.
0
(tʲ) und (dʲ)
CoG (dʲ)
CoG
(tʲ)
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(s ʲ) und (dʲ)
CoG (dʲ)
CoG
(sʲ)
227
insgesamt eher zu einer ‚weißrussischen‘ posterior-alveolaren oder insgesamt eher zu einer ‚russischen‘ alveolaren Artikulation. Im Folgenden wird unter-sucht, ob die Realisierung in den untersuchten Generationen unterschiedlich ausfällt und welche weiteren Faktoren einen Einfluss auf die Artikulation der palatalisierten vorderen Sibilanten haben. Zunächst werden die drei Variab-len einzeln untersucht, abschließend wird ein Vergleich vorgenommen.
Zum Artikulationsort von (sʲ) in WRGR 6.3.4
Als Einstieg seien zunächst die Durchschnittswerte der normalisierten Gra-vitationszentren der einzelnen Sprecher betrachtet. Wie in Abschnitt 6.3.2 beschrieben, wurden die Gravitationszentren für das mittlere zeitliche Drittel der Sibilanten gemessen und anhand der ebenfalls im mittleren zeitlichen Drittel ermittelten Werte von /s/ und /ʂ/ normalisiert. Ausgeschlossen werden die Sprecher sa_M und ra_D. Die Sprecherin sa_M weist zu wenig Token für die Sibilanten /s/ und /ʂ/ auf, anhand deren Mittelwerte die CoG-Werte der sibilantischen Variablen normalisiert werden. Sprecher ra_D zeigt eine unge-wöhnliche Realisierung von /s/ als [ʃ]. Abbildung 41 zeigt die Durch-schnittswerte für (sʲ) der übrigen 31 Sprecher, unterschieden nach Generatio-nen. Für (sʲ) beruhen diese Mittelwerte auf durchschnittlich 37,7 Token pro Sprecher (20–77, σ=11,4). Tabelle 129 im Anhang zeigt die Durchschnitts-werte pro Sprecher und die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.
Durchschnittliche normalisierte Gravitationszentren von (sʲ) Abb. 41
Die Werte der Generationen 0 und 1 konzentrieren sich um den Wert 0, ha-ben also absolute Gravitationszentren, die sich im Durchschnitt recht genau
0 1 2
-1.0
0.0
1.0
Generation
CoG
(no
rmal
isie
rt)
228
zwischen denen von /s/ und /ʂ/ befinden. Allerdings ist ein hohes Maß an Variation zwischen den Sprechern der Generation 1 zu verzeichnen. Während für einige Sprecher Werte zu beobachten sind, die nahe an denen von /s/ liegen, gehen für andere die Werte in Richtung des CoG-Wertes von /ʂ/, was nicht nur auf eine leichte, sondern auf eine deutlich nach hinten verlagerte Artikulation hindeutet.154 Mit der Ausnahme eines Sprechers bewegen sich die Werte der Generation 2 dann in Richtung der Werte von /s/, was auf eine weniger stark posterior-alveolare Artikulation hindeutet.
Die im Folgenden vorgestellte Tokenanalyse liefert jedoch ein abwei-chendes Ergebnis. In dieser Analyse sind die jeweiligen normalisierten Messwerte der einzelnen Laute die abhängige Variable. Folgende erklärende Variablen werden untersucht:
Erklärende Variablen zum CoG-Wert von (sʲ) Tab. 58
Erklärende Variable Werte Referenzwert Nachfolgender Artikulationsort Ø (Auslaut)
labial dental velar [a], [e], [i], [o], [u]
[a]
Dauer des Lautes (in 10 Millisekunden) -- Worthäufigkeit (logarithmiert) -- Generation oder Land/Stadt Generation 0
Generation 1 Generation 2 oder Land (=Generation 0 und 1) Stadt (=Generation 2)
Generation 1/Land
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Dialektherkunft Nordosten Nicht aus dem Nordosten
Nicht aus dem Nordosten
Affinität der Äußerung/Wortform weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
Hierzu seien folgende Erläuterungen angebracht:
154 Vielleicht sogar im Bereich von [ɕ]: [ɕ] und [ʃ] haben wie gesagt ähnliche CoG-Werte. Dies
entspricht auch dem Höreindruck. Allerdings ist Vorsicht geboten bei Rückschlüssen vom CoG-Wert auf den absoluten Artikulationsort.
229
Als lautlicher Parameter wird der Artikulationsort des nachfolgen-den Kontextes einbezogen, und zwar nicht das zugrunde liegende Phonem, sondern die tatsächliche Realisierung, wie sie in den Tran-skripten des OK-WRGR angegeben ist (was aufgrund der Vokal-alternationen in unbetonten Silben im Weißrussischen und Russi-schen von Belang ist).155
Besondere lexikalische Ausnahmen sind nicht zu beachten.
Was den dialektalen Hintergrund angeht, so wird geprüft, ob Spre-cher aus dem nordöstlichen Dialektgebiet stärker posterior-alveolare Realisierungen aufweisen, wie es aufgrund der oben diskutierten Beschreibungen der weißrussischen Dialekte zu vermuten ist.
Tabelle 59 zeigt die Ergebnisse des Mehrebenenmodells mit dem normali-sierten CoG-Wert von (sʲ) als abhängiger Variable, Sprecher (n=31; σ=0,42) und Familie (n=8; σ=0,08) als Zufallsfaktoren.
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (sʲ), alle Äußerungen Tab. 59(n=1154). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31; σ=0,42), Familie (n=8; σ=0,08)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,53 0,17 -3,12 0,0044 Kontext rechts Auslaut 0,09 0,13 0,74 0,4482 [e] -0,06 0,12 -0,54 0,6018 [i] 0,29 0,11 2,56 0,0094 [o] -0,26 0,12 -2,15 0,0338 [u] 0,03 0,23 0,12 0,8922 dental 0,32 0,11 2,79 0,0060 labial 0,41 0,14 2,90 0,0032 velar -0,10 0,46 -0,22 0,8494 Dauer (in 10 Millisek.) 0,03 0,01 2,89 0,0060 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,35 0,18 1,92 0,0508 hybrid 0,22 0,11 2,10 0,0344 russisch 0,44 0,12 3,58 0,0004
Zunächst sei auf die geschätzte Standardabweichung der Modifikationen des Achsenabschnitts für den Zufallsfaktor Sprecher verwiesen. Dieser Wert ist mit 0,42 in etwa so hoch wie der stärkste Faktor im Modell, der Effekt für ‚russische‘ Äußerungen im Vergleich zu ‚weißrussischen‘. Hier bestätigt sich also, dass es eine große sprecherbedingte Variation gibt, die nicht von ande-
155 Von einer genauen Transkription wird dabei abgesehen. Auch die Transkription im
OK-WRGR ist eine grobe. „[e]“ steht also auch für [ɛ], „[o]“ für [ɔ].
230
ren Faktoren wie Generation, Geschlecht oder dialektaler Hintergrund er-klärt werden kann.
Was zunächst den lautlichen Kontext angeht, so ist festzustellen, dass der CoG-Wert für (sʲ) vor Dentalen und Labialen höher ist, die Artikulation vor solchen Konsonanten also stärker [s]-artig ist. Gleiches gilt für Realisierun-gen vor [i]. Dies kann als eine Assimilation an den Artikulationsort des Folgekonsonanten bzw. an die Palatalität des Vokals gewertet werden. Die wenigen Velare (n=6) können vernachlässigt werden. Am niedrigsten sind die Werte vor [o].156 Einen Einfluss übt zudem die Dauer des Lautes aus. Längere Realisierungen führen zu höheren CoG-Werten, und zwar steigt der Wert für alle 10 Millisekunden um 0,03. Längere Realisierungen sind also [sʲ]-artiger bzw. weniger posterior-alveolar.
Für keinen der sprachsoziologischen Faktoren ist ein Effekt zu beobach-ten, sobald die Affinität der Äußerung einbezogen wird. Auch wenn die in ländlichen Gebieten und damit weitgehend mit weißrussischen Dialekten aufgewachsenen Generationen 0 und 1 zusammengefasst werden und in der Variable Land/Stadt mit den in den Städten aufgewachsenen Vertretern der Generation 2 verglichen werden, ergibt sich im Gegensatz zur Analyse der Mittelwerte in ZELLER (2013b) kein signifikanter Effekt.157 Für die Affinität der Äußerung ist allerdings ein signifikanter Effekt zu beobachten: Alle Äu-ßerungstypen zeigen signifikante oder marginal signifikante Unterschiede zu ‚weißrussischen‘ Äußerungen, bei denen die CoG-Werte tiefer, d.h. [s"]-artiger sind. Am höchsten sind die Werte für ‚russische‘ Äußerungen, gefolgt von den (relativ seltenen) ‚gemeinsamen‘ (n=54). ‚Hybride‘ Äußerungen liegen zwischen ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ (vgl. Abb. 43). Keine Interaktion erreicht Signifikanzniveau (siehe auch 6.3.7).
Beschränkt sich die Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen und wird die Af-finität der Wortform mit einbezogen, so ergibt sich folgendes Bild:
156 Dies ist eventuell auf das hochfrequente wr. usë / ru. vsë ‚alles‘ zurückzuführen. Wird der
nachfolgende Kontext nicht in das Modell aufgenommen, so ergibt sich ein signifikanter Effekt für Worthäufigkeit, mit niedrigeren CoG-Werten für häufigere Lexeme. Wie im fol-genden Abschnitt gezeigt wird, ist für (tʲ) ebenfalls ein signifikanter Effekt der Worthäufig-keit festzustellen.
157 Für Generation 2 ist t=1,09, p=0,25. Wird die Affinität der Äußerung nicht berücksichtigt, ist ein marginal signifikanter Unterschied festzustellen, mit höheren CoG-Werten für die Generation 2 (Koeffizient=0,30, t=1,81, p=0,0616).
231
Mehrebenenmodell für den CoG-Wert von (sʲ), nur ‚hybride‘ Äußerungen (n=589). Tab. 60Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,38), Familie (n=8, σ=0,08)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,48 0,21 -2,32 0,0256 Kontext rechts Auslaut 0,12 0,18 0,68 0,4728 [e] -0,12 0,16 -0,74 0,4776 [i] 0,40 0,16 2,48 0,0142 [o] -0,44 0,18 -2,54 0,0110 [u] 0,20 0,33 0,62 0,5128 dental 0,28 0,15 1,81 0,0670 labial 0,28 0,20 1,43 0,1442 velar -1,51 0,80 -1,89 0,0686 Dauer (in 10 Millisek.) 0,03 0,02 2,16 0,0306 Affinität der Wortform gemeinsam 0,18 0,13 1,35 0,1738 hybrid -0,16 0,20 -0,84 0,3846 russisch 0,26 0,14 1,84 0,0614
Die Effekte des lautlichen Kontextes sowie der Dauer des Lautes ähneln denen für die Gesamtmenge. Wiederum ergibt sich für keinen der sozialen Parameter ein signifikanter Effekt. Ein marginal signifikanter Unterschied zeigt sich zwischen ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Wortformen. ‚Gemein-same‘ Wortformen liegen dazwischen (allerdings näher an den ‚russischen‘). ‚Hybride‘ Wortformen weisen noch niedrigere CoG-Werte auf als die ‚weiß-russischen‘, wobei der Unterschied zwischen beiden nicht signifikant ist. Insgesamt verbessert der Faktor Affinität der Wortform das Modell signifi-kant. Die Log-Likelihood ohne den Faktor ist -922,03, mit dem Fak-tor -908,18 (χ2=27,69, df=3, p<0,0001). Es besteht keine Interaktion zwi-schen Land/Stadt und der Affinität der Wortform, weder wenn ‚gemeinsame‘ Wortformen ausgeschlossen werden (χ2=0,02, df=1, p=0,88), noch wenn sie einbezogen werden (χ2=1,15, df=2, p=0,56). Beide Gruppen unterscheiden sich also nicht signifikant voneinander und differenzieren beide gleicherma-ßen zwischen ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Wortformen.
Zum Artikulationsort von (tʲ) in WRGR 6.3.5
Analyse 1 – Mittelwerte: Aufgrund der affrikativen zweiphasigen Struktur der Laute [ʦʲ] bzw. [ʦ"] beruhen die Gravitationszentren anders als für (sʲ), wo das mittlere zeitliche Drittel zugrunde lag, wie gesagt auf dem letzten zeitlichen Drittel. Normalisiert wurden die Laute wie in Abschnitt 6.3.2.3 beschrieben anhand des letzten Drittels der Durchschnittswerte von /s/ und /ʂ/. Ausgeschlossen werden die Sprecher sa_M und ra_D aus den in Ab-schnitt 6.3.4 genannten Gründen.
232
Abbildung 42 zeigt die Durchschnittswerte für (tʲ) der Sprecher, unter-schieden nach Generationen. Pro Sprecher wurden durchschnittlich 34,1 Token ausgewertet (17–65, σ=13,6). Tabelle 130 im Anhang zeigt die Durch-schnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegange-nen Token.
Durchschnittliche normalisierte Gravitationszentren von affriziertem (tʲ) Abb. 42
Für die durchschnittlichen CoG-Werte deuten sich keine Unterschiede zwi-schen den Generationen an (allenfalls eine leichte Verschiebung zwischen Generation 1 und 2, mit mehr Sprechern mit höherem CoG-Wert in Gene-ration 2; vgl. die den Median kennzeichnende Linie in den Boxplots, die für Generation 2 höher liegt als für Generation 1). Wie schon für (sʲ), so sind auch hier innerhalb der Generationen große Unterschiede zu verzeichnen.
Analyse 2 – Mehrebenenanalyse: In den folgenden Analysen sind wiederum die jeweiligen normalisierten CoG-Werte der einzelnen Laute die abhängige Variable. Es wurden dieselben erklärenden Variablen wie für (sʲ) einbezogen. Der lautliche Kontext meint auch hier wieder nicht das zugrunde liegende Phonem, sondern bezieht sich auf die Transkription im OK-WRGR.158 Tabelle 61 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit dem normali-sierten CoG-Wert von (tʲ) als abhängiger Variable, Sprecher (n=31) und Familie (n=8) als Zufallsfaktoren.
158 Bei dem nachfolgenden Kontext wurden [o] und [u] zusammengezählt, da [u] nur sehr
selten vertreten ist (n=6).
0 1 2
-1.0
0.0
1.0
Generation
CoG
(no
rmal
isie
rt)
233
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (tʲ), alle Äußerungen Tab. 61(n=1225). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,35), Familie (n=8, σ=0,16)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,12 0,17 0,71 0,4946 Kontext rechts Auslaut -0,28 0,11 -2,59 0,0116 [e] 0,11 0,12 0,89 0,3868 [i] 0,26 0,11 2,40 0,0166 [o/u] -0,38 0,22 -1,76 0,0782 dental -0,32 0,39 -0,83 0,3968 labial 0,04 0,23 0,18 0,8480 velar -0,08 0,26 -0,30 0,7628 Dauer (in 10 Millisek.) 0,03 0,99 2,90 0,0048 Worthäufigkeit -0,03 0,01 -2,08 0,0390 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,28 0,20 1,39 0,1704 hybrid 0,11 0,09 1,18 0,2306 russisch 0,24 0,11 2,20 0,0250
Insgesamt ähneln die Ergebnisse stark denen von (sʲ). Es fällt zunächst der hohe Wert von 0,35 für die geschätzte Standardabweichung der Modifikatio-nen für den Zufallsfaktor Sprecher auf. Es gibt also eine starke sprecherbe-dingte Variation, die nicht über Generation, Geschlecht oder dialektaler Hintergrund erklärt werden kann. Realisierungen vor den vorderen Vokalen [a], [e], [i], vor allem den letzten beiden, haben höhere CoG-Werte als solche im Auslaut und vor [u] oder [o]. Eine längere Dauer des Konsonanten führt zu höheren CoG-Werten. Anders als bei (sʲ) spielt die Häufigkeit der Wort-form eine Rolle: Frequente Wortformen haben niedrigere CoG-Werte, tendie-ren also zu einer ‚weißrussischen‘, [ʦ"]-artigen Artikulation.159
Soziale Faktoren spielen keine Rolle, allerdings verfehlt eine Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung nur knapp Signifikanz-niveau. Diese tendenzielle Interaktion wird außer Acht gelassen und später in Abschnitt 6.3.7 aufgegriffen. Realisierungen in ‚russischen‘ und ‚gemeinsa-men‘ Äußerungen haben höhere CoG-Werte als solche in ‚weißrussischen‘, was für eine stärker [ʦʲ]-artige Artikulation in erstgenannten spricht. ‚Hyb-ride‘ Äußerungen liegen wie schon bei (sʲ) dazwischen.
159 Wie gesehen war auch für (sʲ) die Frequenz des Wortes signifikant, sobald der nachfol-
gende Kontext nicht in das Modell einbezogen wurde.
234
Analyse 3: Mehrebenenanalyse für ‚hybride‘ Äußerungen: Beschränken wir nun die Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen und überprüfen, ob die Affinität der Wortform einen Einfluss hat:
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (tʲ), nur ‚hybride‘ Äußerun-Tab. 62gen (n=625). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,40), Familie (n=8, σ=0,16)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,20 0,20 -1,02 0,3348 Kontext rechts Auslaut -0,30 0,16 -1,85 0,0592 [e] 0,10 0,18 0,55 0,6068 [i] 0,27 0,16 1,70 0,1102 [o, u] -0,45 0,29 -1,56 0,1264 dental -1,01 0,64 -1,59 0,1118 labial -0,23 0,35 -0,65 0,5190 velar -0,13 0,35 -0,38 0,6876 Dauer (in 10 Millisek.) 0,04 1,44 2,88 0,0038 Affinität der Wortform gemeinsam 0,28 0,12 2,32 0,0208 hybrid 0,08 0,17 0,50 0,6386 russisch 0,37 0,12 3,16 0,0012
Die Ergebnisse ähneln denen für die Gesamtmenge an Daten. Für Worthäu-figkeit ist allerdings kein Einfluss mehr feststellbar. Wie zu erwarten beste-hen weiterhin keine Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen. Einen Einfluss hat dagegen die Affinität der Wortform: ‚Gemeinsame‘ und ‚russi-sche‘ Wortformen haben signifikant höhere CoG-Werte als weißrussische Wortformen.
Es besteht weder eine Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Wortform, wenn ‚gemeinsame‘ Wortformen ausgeschlossen werden (χ2=0,18, df=1, p=0,68), noch besteht eine Interaktion, wenn sie einbezogen werden (χ2=1,65, df=2, p=0,44). Beide Gruppen behandeln ‚weißrussische‘, ‚gemein-same‘ und ‚russische‘ Wortformen gleichermaßen unterschiedlich.
Zum Artikulationsort von (dʲ) in WRGR 6.3.6
Für die Variable (dʲ) wurden insgesamt weniger Token analysiert als für die beiden stimmlosen Variablen. Es wird hier auf die Darstellung der Sprecher-durchschnittswerte verzichtet und stattdessen nur die tokenbezogene Analyse gezeigt. Es wurden dieselben erklärenden Variablen wie für (sʲ) und (tʲ) ein-bezogen. Der CoG-Wert wurde wie für (tʲ) im letzten Drittel des Lautes ge-messen. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse des Mehrebenenmodells mit dem normalisierten CoG-Wert von (dʲ) als abhängiger Variable, Sprecher (n=31) und Familie (n=8) als Zufallsfaktoren. Pro Sprecher wurden durch-
235
schnittlich 23,6 Token ausgewertet (9–44, σ=9,9). (Tabelle 131 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.)
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (dʲ), alle Äußerungen Tab. 63(n=710). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,43), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -1,20 0,22 -5,54 0,0001 Kontext rechts Auslaut 0,49 0,28 1,75 0,0832 [e] 0,37 0,17 2,22 0,0280 [i] 0,39 0,17 2,27 0,0246 [o, u] -0,52 0,25 -2,04 0,0340 dental 0,46 0,32 1,43 0,1678 labial -0,56 0,31 -1,78 0,0778 velar -0,55 0,57 -0,96 0,3234 Dauer (in 10 Millisek.) 0,13 0,02 6,27 0,0001 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,18 0,21 0,85 0,3790 hybrid 0,19 0,12 1,57 0,1138 russisch 0,30 0,14 2,14 0,0344
Es ist ein Einfluss des lautlichen Kontextes und der Dauer des Lautes festzu-stellen. Wie bereits für die anderen sibilantischen Variablen ist kein Einfluss sozialer Faktoren zu verzeichnen. Eine Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung verfehlt knapp marginales Signifikanzniveau. Jedoch ist wiederum die Affinität der Äußerung von Belang. Realisierungen von (dʲ) in ‚russischen‘ Äußerungen weisen höhere CoG-Werte auf, was auf eine we-niger stark ‚weißrussische‘ posterior-alveolare Artikulation schließen lässt.
Innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen ist kein Unterschied zwischen Realisierungen in Wortformen unterschiedlicher Affinität feststellbar. Aller-dings ist die Anzahl der Beobachtungen mit n=366 angesichts von 31 unter-suchten Sprechern relativ gering.
Zusammenfassung zu den vorderen palatalisierten Sibilanten 6.3.7
In diesem Abschnitt ging es um die Variation von stärker posterior-alveola-ren Realisierungen mit weniger stark posterior-alveolaren, also stärker dental-alveolaren Realisierungen bei den vorderen palatalisierten Sibilanten (sʲ), (tʲ) und (dʲ). Die stärker posterior-alveolare Realisierung ist charakteris-tisch für das Weißrussische, während im Russischen eine dental-alveolare Realisierung vorliegt.
Der in den Abbildungen der Sprechermittelwerte sowie in ZELLER (2013b) – dort anhand im zeitlichen Mittelpunkt des Sibilanten ge-
236
messener CoG-Werte – beobachtete Unterschied zwischen den durchschnitt-lichen CoG-Werten der Sprechergenerationen (bzw. zwischen auf dem Land aufgewachsenen und in der Stadt aufgewachsenen Sprechern) für (sʲ) und (tʲ) ist nicht festzustellen, sobald auf der Tokenebene analysiert wird und die Affinität der Äußerung mit einbezogen wird.160 Er ließe sich also als Seiteneffekt davon behandeln, dass Vertreter der Generation 2 häufiger ‚russische‘ Äußerungen aufweisen. Für alle drei Variablen ist ein Effekt der Affinität der Äußerung feststellbar. Für (sʲ) und (tʲ) ist zudem innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen ein Effekt der Wortform feststellbar. Wie schon an anderer Stelle erläutert, muss dies nicht heißen, dass die „morphologische“ Seite die phonische Seite direkt beeinflusst, sondern es besteht die Möglich-keit, dass außersprachliche Faktoren (Gesprächssituation, Thema usw.) die beiden sprachlichen Ebenen gleichermaßen beeinflussen.
Es finden sich Indizien, dass die Unterdrückung des Prozesses der poste-rioren Artikulation, die eine Palatalisierung des primären Artikulationsortes und damit eine tendenzielle Vereinheitlichung des primären und des sekundä-ren Artikulationsortes ist, einen gewissen artikulatorischen Aufwand bedeu-tet. Längere Realisierungen sind für alle Variablen weniger stark posterior-alveolar, für (tʲ) ist zudem zu beobachten, dass in häufigeren Lemmata eine stärker posterior-alveolare Artikulation erfolgt.
Auch wenn zwischen den Generationen keine von anderen Faktoren unabhängigen Unterschiede bestehen, zeigt der Einfluss der Affinität deut-lich, dass die Variation innerhalb der Sibilanten zwischen einer stärker poste-rior-alveolaren und einer stärker dentalen Realisierung in WRGR relevant ist. Abbildung 43 zeigt die anhand der in den vorherigen Abschnitten vorgestell-ten Modelle berechneten Erwartungswerte für die normalisierten CoG-Werte in den unterschiedlichen Äußerungstypen, wenn alle anderen Variablen auf ihrem Referenzwert oder ihrem Median gehalten werden.161
160 In Abschnitt 10.6 wird gezeigt, dass es durchaus Unterschiede zwischen Sprechern gibt,
und zwar zwischen solchen, die auf strukturell tieferen sprachlichen Ebenen stärker zum Russischen neigen, und solchen, die überwiegend oder zu einem großen Teil ‚hybride‘ Äußerungen zeigen.
161 Zur Absicherung, dass nicht doch allgemeine Unterschiede zwischen den Äußerungstypen zugrunde liegen, wurde eine ebensolche Analyse wie für (sʲ), (tʲ) und (dʲ) auch für die Reali-sierungen von /s/ durchgeführt. Hier finden sich keine Unterschiede zwischen den Äuße-rungstypen, unabhängig davon, ob die normalisierten oder die absoluten CoG-Werte heran-gezogen werden.
237
Effekt der Affinität der Äußerung auf den CoG-Wert von (sʲ), (tʲ) und (dʲ), Modelle Abb. 43
ohne Interaktionen. Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Sehen wir von den ‚gemeinsamen‘ Äußerungen ab, welche – wie in Abschnitt 4.4 dargelegt – keinen eigenen Kode darstellen, sondern nicht zuzuordnen und extrem kurze „Zufallsprodukte“ sind, also gewissermaßen fehlende Werte darstellen, so sind die Muster der einzelnen Variablen iden-tisch. ‚Weißrussische‘ Äußerungen weisen die niedrigsten CoG-Werte auf, ‚russische‘ die höchsten. Dies deutet auf eine stärker posterior-alveolare, ‚weißrussische‘ Artikulation in ‚weißrussischen‘ Äußerungen hin, eine stärker alveolare, ‚russische‘ in ‚russischen‘ Äußerungen. Die Erwartungs-werte sind allerdings auch in ‚russischen‘ Äußerungen stets deutlich vom Wert 1 unterschiedlich, was auf eine insgesamt noch posterior-alveolare Artikulation hindeutet.162 ‚Hybride‘ Äußerungen liegen stets zwischen den ‚weißrussischen‘ und den ‚russischen‘.
Werden die Generationen 0 und 1 als die Generationen, die in ländlichen Gebieten aufgewachsen sind, zusammengefasst und (in einer neuen Variab-len Land/Stadt) den geborenen Städtern in Generation 2 gegenübergestellt, so ergibt sich – wie in den vorherigen Analysen bereits angedeutet – für die Variable (tʲ) die marginal signifikante Tendenz einer Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung (p=0,070). Werden die nicht einzu-
162 Zur Erinnerung: Der Wert 1 bedeutet ein Zusammenfall mit dem CoG-Wert von /s/, -1 den
Zusammenfall mit /ʂ/. Für (dʲ) ist bei einem direkten Vergleich mit den Werten der stimm-losen Lautklassen Vorsicht geboten, da Nebeneffekte der Stimmhaftigkeit Einfluss auf den CoG-Wert haben können.
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(s ʲ)
CoG
w
gh
r
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(tʲ)
CoG
w
gh
r
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(dʲ)
CoG
wg h
r
238
stufenden ‚gemeinsamen‘ Äußerungen ausgeschlossen, so sinkt dieser Wert bis knapp über Signifikanzniveau (Log-Likelihood ohne Interaktion: -1759,5; mit Interaktion: -1756,6; χ2=5,85; df=2; p=0,0537). Es ist also mit Vorsicht davon auszugehen, dass der Einfluss der Generation in Äußerungen unter-schiedlicher Affinität unterschiedlich ausfällt. Für (dʲ) erreicht die Interaktion mit p=0,107 nicht Signifikanzniveau. Bei Ausschluss der ‚gemeinsamen‘ Äußerungen ist die Interaktion marginal signifikant (Log-Likelihood ohne Interaktion: -1017,0; mit Interaktion: 1014,3; χ2=5,39; df=2; p=0,0675). Nur für (sʲ) lässt sich auch bei Ausschluss der ‚gemeinsamen‘ Äußerungen keine Tendenz zu einer Interaktion erkennen (χ2=1,44; df=2; p=0,49). Wie Abbil-dung 44 zeigt, sind die marginal signifikanten Interaktionen für (tʲ) und (dʲ) gegenläufig:
. Interaktionen zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung für (sʲ) (nicht signifi-Abb. 44
kant), (tʲ) und (dʲ). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Für (sʲ) weisen also sowohl Vertreter der Generationen 0 und 1 als auch Ver-treter der Generation 2 analoge Unterschiede zwischen den drei Äußerungs-typen auf, wobei wie oben gezeigt insgesamt kein signifikanter Unterschied zwischen den Sprechergruppen besteht. Für (tʲ) und (dʲ) ist dies nicht so: Während Vertreter der Generationen 0 und 1 bei der Artikulation von (tʲ) nicht zwischen ‚weißrussischen‘, ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungen unterscheiden, liegen für Vertreter der Generation 2 die Werte nur für ‚russi-sche‘ Äußerungen über denen der Generationen 0 und 1, für ‚weißrussische‘ Wortformen weisen sie sogar eine stärker posterior-alveolare Realisierung als
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(s ʲ)
CoG
w h r
LandStadt
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(tʲ)
CoG
w h r
LandStadt
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(dʲ)
CoG
w h r
LandStadt
239
die älteren Sprecher auf. Für (dʲ) sind die Verhältnisse umgekehrt: Nun zei-gen Vertreter der Generation 2 ein konstantes Verhalten. Nur für ‚weißrussi-sche‘ Äußerungen weisen Vertreter der Generationen 0 und 1 niedrigere Werte als Vertreter der Generation 2 auf, für ‚russische‘ Äußerungen liegen sie sogar über denen von den jüngeren Sprechern. Offensichtlich ist für jüngere Sprecher die stimmlose Affrikate (tʲ) ein Marker „des Weißrussi-schen“, während es für ältere Sprecher die stimmhafte Affrikate (dʲ) ist.
Es fällt auf, dass sich für ‚hybride‘ Äußerungen die Werte der beiden Sprechergruppen stets decken oder zumindest stark einander annähern. Es stellt sich also die Frage, ob es eine über die Generationen hinweg konstante Aussprache in ‚hybriden‘ Äußerungen gibt, die sich ggf. von der Artikulation in anderen Äußerungen unterscheidet und intermediär ist. Jedoch finden sich wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt innerhalb von ‚hybriden‘ Äuße-rungen für (sʲ) und (tʲ) Einflüsse der Affinität der Wortform. Für (dʲ) sind solche Unterschiede nicht feststellbar:
Effekt der Affinität der Wortform auf den CoG-Wert von (sʲ), (tʲ) und – nicht signifi-Abb. 45
kant – (dʲ) in ‚hybriden‘ Äußerungen. Die anderen Faktoren werden auf dem Refe-renzwert oder dem Median gehalten.
Es ist also zunächst davon auszugehen, dass die intermediären Werte für ‚hybride‘ Äußerungen sich nicht daraus ergeben, dass Wortformen in ‚hybri-den‘ Äußerungen „intermediär“ artikuliert werden, sondern dadurch, dass in ihnen sowohl ‚weißrussische‘ als auch ‚russische‘ Wortformen auftreten. Wie in Abschnitt 10.4 gezeigt werden wird, der unter anderem der Frage nach der Eigenständigkeit des gemischten Kodes nachgeht, ist diese Aussage jedoch noch zu modifizieren.
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(s ʲ)
CoG
w
g
h
r
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(tʲ)
CoG
w
g
h
r-1
.0-0
.50.
00.
51.
0
(dʲ)
CoG
w g
hr
240
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die hier unter-suchten Werte auf einer Normalisierung beruhen, die erstens in der vorlie-genden Untersuchung zum ersten Mal eingesetzt wird und die zweitens auf der Vorannahme beruht, dass die Realisierung von /s/ und /ʂ/ über die Spre-cher hinweg abgesehen von anatomisch bedingten Unterschieden stabil bleibt. Da im Falle von /ʂ/ gewisse Zweifel angebracht sind (s.u. 6.4), ist auch das Fehlen von signifikanten Unterschieden keine eindeutige Evidenz dafür, dass keine von der Affinität der Äußerung/Wortform unabhängigen Unter-schiede zwischen den Sprechergruppen bestehen (wobei natürlich generell das Fehlen eines signifikanten Unterschieds nicht bedeutet, dass von Gleich-heit der verglichenen Gruppen ausgegangen werden kann).
Dass keine Unterschiede zwischen den hier als erklärende Variablen her-angezogenen Sprechergruppen gefunden wurden, bedeutet zudem nicht, dass sich die Sprecher gleich verhalten. Im Gegenteil, Abbildung 41 und Abbil-dung 42 oben zeigen, dass innerhalb der Generationen große Unterschiede bestehen. Während für einige Vertreter der Generationen 1 und 2 die CoG-Werte auf eine weitgehend mit der russischen Norm übereinstimmende Arti-kulation schließen lassen, deuten die CoG-Werte für andere auf eine deutlich weißrussische Artikulation hin. Wir widmen uns diesen Unterschieden in Abschnitt 10.6, wenn es um den Zusammenhang der phonischen Seite mit dem Sprechertyp geht.
6.4 Variation in der Palatalisiertheit und im Artikulationsort der postalveolaren Sibilanten – die Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ)
Hintergrund 6.4.1
Die postalveolaren Sibilanten wr. /t ʂ/ bzw. ru. /ʧʲ/, ru. /ʃʲ/ (und dessen wr. Äquivalent, die Phonemfolge /ʂt ʂ/) sowie wr./ru. /ʂ/ und /ʐ/ sind in beiden Sprachen Fortsetzungen der Ergebnisse der urslavischen Palatalisierungen, waren also zunächst palatal koartikulierte Laute, die teilweise entpalatalisiert wurden.
Was /ʂ/ und /ʐ/ angeht, so sind diese in beiden Sprachen entpalatalisiert worden. Sie unterliegen zudem nicht der Palatalitätsassimilation (AVANESOV 1956, 185). Sie werden als stark velarisierte und labialisierte Laute beschrie-
241
ben, die relativ weit hinten am Palatum gebildet werden.163 Die dadurch bedingte relative Größe des sublingualen Bereichs äußert sich akustisch in einer stärkeren Ausprägung tiefer Frequenzbereiche und in niedrigeren F2-Übergängen (BOLLA 1981, 90; KOCHETOV 2006, 104), was die Laute „dunk-ler“ klingen lässt als beispielsweise das deutsche [ʃ]. HAMANN (2002; 2004) aufgrund von Röntgenaufnahmen und ŻYGIS (2010) aufgrund von akusti-schen Messungen sprechen sich dafür aus, die russischen Laute als Retro-flexe [ʂ] und [ʐ] zu klassifizieren, dies allerdings nicht im Sinne der „klassi-schen“ Retroflexe, sondern als Berücksichtigung der stärkeren Velarisierung und des hinteren Artikulationsortes. (Jedoch wird für das Russische eine generelle Velarisierung aller nicht-palatalisierten (nicht-velaren) Konsonan-ten, wie sie beispielsweise von ZINDER (1979, 136) angenommen wird, von LADEFOGED & MADDIESON (1996, 361) angezweifelt.) ŻYGIS (2003, 191f.) deutet an, dass auch im Weißrussischen in dem oben beschriebenen Sinne Retroflexe vorliegen. Für das Weißrussische wird zuweilen sogar explizit eine stärkere Velarisierung als für das Russische beschrieben (PADLUŽNY &
ČĖKMAN 1973, 180; SADOŬSKI 1982, 212; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 109). Akustische Studien, die eine Unterschiedlichkeit von /ʂ/ und /ʐ/ in beiden Sprachen nahelegen, existieren allerdings nicht. Systematische Unter-schiede in weißrussischen Dialekten bestehen nicht, allerdings sind in einigen Inseln in den Bezirken Homel’, Vicebsk und Mahilëŭ vor /i/ und /e/ palatali-sierte Varianten möglich (NPBD 1964, 132).
Die postalveolare Affrikate (ʧʲ) ist dagegen nur im Weißrussischen ent-palatalisiert worden, die Artikulation wird analog zu der von /ʂ/ als stark velarisiert beschrieben, d.h. als [t ʂ]. Im Russischen ist eine solche Entpalatali-sierung nicht eingetreten, die Affrikate /ʧʲ/ ist also stets palatalisiert. Der primäre Artikulationsort der frikativen Phase kann im Vergleich zu /ʂ/ weiter vorn ausfallen und in den alveolo-palatalen Bereich reichen. Zuweilen wird der Laut auch als ausschließlich alveolo-palatal beschrieben (z.B. bei BOLLA 1981, 143). In weißrussischen Dialekten ist die postalveolare Affrikate wie in der weißrussischen Standardsprache entpalatalisiert. In einigen Inseln in den
163 Vgl. hierzu und zum Folgenden für das Russische AVANESOV (1956, 154f.), JONES &
WARD (1969, 134), BOLLA (1981), LADEFOGED & MADDIESON (1996, 361), HAMANN (2002; 2004), PADGETT & ŻYGIS (2007), ŻYGIS (2003), TIMBERLAKE (2004, 54–55 und 65–67); für das Weißrussische PADLUŽNY & ČĖKMAN (1973, 169–192), CZEKMAN &
SMUŁKOWA (1988, 107–111 und 131–133), FBLM (1989, 51–53 und 79–82).
242
Bezirken Homel’, Vicebsk und Mahilëŭ sind sporadisch palatalisierte und „halb-palatalisierte“ Varianten möglich (NPBD 1964, 133f.).164
Anders als das Weißrussische hat das Russische zwei stimmlose post-alveolare Sibilanten; neben dem retroflexen /ȿ/ das laminale, phonetisch lange /ʃʲ/. ŻYGIS (2010) deutet an, dass im Russischen für diesen Sibilanten wohl ebenfalls eine Verschiebung des primären Artikulationsortes nach vorn in den alveolaren Bereich vorliegt (vgl. auch AVANESOV 1956, 154). Auch die Abbildungen bei BOLLA (1981, Schaubild 62) zeigen, dass der ausge-prägteste Bereich im Spektrum in leicht höheren Frequenzbereichen liegt als derjenige von /ʂ/. Etymologisch entspricht dem russischen /ʃʲ/ im Weißrussi-schen die Lautfolge /ʂt ʂ/.
In der weißrussischen Variante des Russischen ist nicht-palatalisiertes [t ʂ] für (ʧʲ) weit verbreitet (BULACHOV 1973, 103; IZS 1987, 83; KILEVAJA 1989, 9). Zudem werden Zwischenstufen zwischen der palatalisierten und der nicht-palatalisierten Variante beobachtet (PADLUŽNY 1982, 139; FBLM 1989, 315). Halb-palatalisierte und palatalisierte Varianten machen in der von SADOŬSKI & ŠČUKIN (1977, 118) untersuchten russischen Rede der Minsker Land-Stadt-Migranten zusammen 41% aller Realisierungen aus, die ‚weiß-russische‘ nicht-palatalisierte Aussprache überwiegt also leicht. SADOŬSKI (1982, 209) beobachtet die plausible Tendenz, dass die (halb-)palatalisierte Variante häufiger vor vorderen Vokalen auftritt. Unterschiede zwischen Sprechstilen (Lesen eines Textes vs. freies Gespräch) findet er nicht.
Auch Ersetzungen für /ʃʲ/ sind Kennzeichen des weißrussischen Akzentes im Russischen (BULACHOV 1973, 103; KILEVAJA 1989, 9). In russischer Rede der Minsker Land-Stadt-Migranten finden sich die Varianten [ʂt ʂ], [ʃʲʧʲ] und [ʂ], wobei erstere Variante überwiegt. Die palatalisierten Realisierungen machen nur 19% aus (SADOŬSKI & ŠČUKIN (1977, 118).
Interessant ist zudem, dass Sadoŭski in der russischen Rede der Minsker Land-Stadt-Migranten und gebürtiger Minsker für /ʂ/ und /ʐ/ in einer Reihe von Fällen (45% bzw. 30%) vor vorderen Vokalen palatalisierte Varianten notiert (SADOŬSKI & ŠČUKIN 1977, 118). SADOŬSKI (1982, 213) erklärt dies damit, dass die weniger velarisierten Konsonanten des Russischen als palata-lisiert uminterpretiert werden, evtl. in Analogie zum Russischen /ʧʲ/ und /ʃʲ/.
164 Sogenanntes Cokanje, d.h. der Übergang von |ʧʲ| zu [ʦ] findet sich abgesehen von einigen
lexikalisierten Fällen nur sporadisch im Nordosten des Vicebsker Gebiets (NPBD 1964, 149f.).
243
Anhand der Transkriptionen im OK-WRGR beobachten HENTSCHEL & ZELLER (2014), ohne zwischen (ʧ) und (ʃʲ) zu differenzieren, insgesamt ein klares Übergewicht der ‚weißrussischen‘, nicht-palatalisierten Varianten. Allerdings ist dies eine der Variablen, für die die Verhältnisse abhängig vom Sprechertyp und von der Affinität der Wortform und der Äußerung enorm schwanken. Sprecher, die eine relativ hohe Anzahl an auf strukturell tieferen Ebenen ‚weißrussischen‘ Äußerungen zeigen, weisen quasi ausschließlich die ‚weißrussische‘ Variante auf. Auch bei Sprechern, bei denen ‚hybride‘ Äuße-rungen die ‚russischen‘ deutlich überwiegen, überwiegt die ‚weißrussische‘ Realisierung selbst in ‚russischen‘ Wortformen in ‚russischen‘ Äußerungen. Bei Sprechern, die auf strukturell tieferen Ebenen deutlich zum Russischen neigen, überwiegt die ‚weißrussische‘ Aussprache klar bei ‚weißrussischen‘ Wortformen. Bei nicht-‚weißrussischen‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerun-gen ist das Verhältnis ‚weißrussischer‘ und ‚russischer‘ Varianten ausgegli-chen. In ‚russischen‘ Wortformen in ‚russischen‘ Äußerungen überwiegt bei diesen Sprechern die ‚russische‘ Variante.
Da es bei dem Unterschied [ʧʲ] vs. [t ʂ] um eine regelmäßige, eineindeu-tige Beziehung zwischen dem Russischen und dem Weißrussischen geht, sind keine Regeln der Anwendung zu erlernen. Aufgrund der allgemeinen Palata-litätskorrelation in beiden Sprachen ist es sicherlich ein perzeptiv recht deut-liches Merkmal. Das von SADOŬSKI (1982) attestierte Fehlen eines Unter-schiedes zwischen Sprechstilen und der von HENTSCHEL & ZELLER (2014) beobachtete geringe Unterschied zwischen Äußerungstypen bei Sprechern mit hoher Anzahl an ‚hybriden‘ Äußerungen deuten jedoch an, dass dieses Merkmal in der russischen Rede von Land-Stadt-Migranten kaum als Marker im Labovschen Sinne dient, also nicht innerhalb eines Sprechers in Abhän-gigkeit vom Offizialitätsgrad, dem Gesprächspartner und/oder dem Kode der Äußerung variiert. Die Befunde von HENTSCHEL & ZELLER (2014) für Spre-cher, die v.a. ‚russische‘ Äußerungen aufweisen – dies sind wie gesagt vor allem Vertreter der Generation 2 – gehen in eine andere Richtung. Sie zeigen klar, dass diese Sprecher in ihrer Aussprache je nach Kode (russisch, weiß-russisch oder gemischt) variieren.
Im Folgenden wird zunächst die Variation von (ʧʲ) untersucht. Es sind hier, wie oben dargelegt, zwei Dimensionen, die eine Rolle spielen könnten: Zum einen geht es um die Palatalisiertheit der Affrikate, zum anderen um Unterschiede im primären Artikulationsort, die sich als [ʨ], [ʧ], [t ʂ] fassen lassen. Im Folgenden werden daher zwei Messwerte erhoben. Für die Ana-lyse der Palatalisiertheit wird der Formanteneinstieg gemessen. Zur Analyse
244
des primären Artikulationsortes wird wie in Abschnitt 6.3 das Gravitations-zentrum des Spektrums (der CoG-Wert) benutzt.
Zum Artikulationsort von (ʧʲ) in WRGR 6.4.2
Neben dem Unterschied in der Palatalisiertheit wird für die hier zu unter-suchende Affrikate zwischen dem Weißrussischen und dem Russischen ein Unterschied im primären Artikulationsort beschrieben. Für das Russische wird eine stärker alveolo-palatale Artikulation beobachtet (s.o., Abschnitt 6.4.1), für das Weißrussische eine klar postalveolare und zudem stark velari-sierte. Da ein vorderer Artikulationsort in stärker ausgeprägten höheren Fre-quenzbereichen resultiert und eine Velarisierung eine Absenkung des ausge-prägten Frequenzbereiches bewirkt, sind für eine stärker ‚russische‘ Artiku-lation höhere CoG-Werte zu erwarten als für eine stärker ‚weißrussische‘. Jedoch sind retroflexes [t ʂ] und [ʃ] oder [ʃʲ] mithilfe von CoG-Messungen nur schwer zu unterscheiden (ŻYGIS 2003, 208). Direkte akustische Vergleiche zwischen beiden Sprachen bestehen nicht. Für das Weißrussische /t ʂ/ werden intensive Bereiche zwischen 1500 und 2000 Hz, sowie zwischen 2700 und 4000 Hz angegeben (CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 111). Für das russische /ʧʲ/ notiert BOLLA (1981, 144) Gipfel bei ca. 2600, 5650 und 6900 Hz, wobei der frequentiell niedrigste (und ausgeprägteste) dieser Gipfel in leicht, aber erkennbar höheren Frequenzbereichen liegt als der frequentiell niedrigste Gipfel bei /ʂ/ (dort liegt er bei ca. 2000 Hz) (vgl. BOLLA 1981, Schaubilder 60 u. 74). Diese Unterschiede stützen also die These, dass ru. /ʧʲ/ einerseits und ru./wr. /ʂ/ sowie wr. /t ʂ/ andererseits sich auch im primären Artiku-lationsort unterscheiden.
Die Berechnung der CoG-Werte erfolgt wie für die Variable (tʲ), d.h. die CoG-Werte wurden zwischen 1000 und 12 000 Hz im letzten Drittel des Lautes ermittelt und anschließend wie in Abschnitt 6.3.2.3 geschildert anhand der Werte von /s/ und /ʂ/ normalisiert. Ausgeschlossen werden aus den in Abschnitt 6.3.4 genannten Gründen die Sprecher sa_M und ra_D, sowie auch sm_AF. Letzterer zeigt bei der Affrikate (ʧʲ) oft eine Realisierung als [ʦ].
Analyse 1 – Mittelwerte: Als einen ersten Einstieg zeigt Abbildung 46 die Gesamtmittelwerte der Generationen vor und nach der Normalisierung neben den Werten von /ʂ/ (wiederholt also die Informationen aus Abbildung 35 und Abbildung 38 oben).
245
Absolute und normalisierte Gesamtmittelwerte für den CoG-Wert von (ʧʲ) in den Abb. 46
Generationen 0, 1 und 2
Die Normalisierung bewirkt also, dass Generation 2 niedrigere Werte auf-weist als die übrigen beiden Generationen, obwohl absolut gesehen die Werte in Generation 2 höher sind. Relativ gesehen zu /s/ und /ʂ/ hat Generation 2 also niedrigere CoG-Werte für (ʧʲ) als die beiden älteren Generationen. Abbildung 47 zeigt die durchschnittlichen normalisierten CoG-Werte der einzelnen Sprecher getrennt nach Generation. Pro Sprecher wurden durch-schnittlich 33,6 Token ausgewertet (10–49, σ=10,0). Tabelle 132 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Ana-lyse eingegangenen Token.
Durchschnittliche normalisierte Gravitationszentren von (ʧʲ) Abb. 47
Auch in dieser Ansicht ist sichtbar, dass Generation 2 tiefere normalisierte CoG-Werte aufweist. Für ca. die Hälfte der Vertreter der Generation 2 sind
0 0
5600
6000
6400
1 1
5600
6000
6400
2 2
5600
6000
6400
(ʧʲ) /ʂ/
0
0
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
1
1
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
2 2
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
(ʧʲ) /ʂ/
0 1 2
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
Generation
CoG
(no
rmal
isie
rt)
246
die Werte tiefer als -1, d.h. tiefer als die von /ʂ/. Dies ist ein überraschender Befund. Zu erwarten wäre, dass, wenn Unterschiede vorliegen, diese in einer stärker [ʨ]-artigen Artikulation für die jüngere Generation und dementspre-chend höheren CoG-Werten im Vergleich zu den älteren Generationen und im Vergleich zu /ʂ/ bestünden.
Analyse 2: Die tokenbezogene Analyse bringt etwas mehr Licht ins Dunkel. Folgende Variablen werden als erklärende Faktoren herangezogen:
Erklärende Variablen, CoG-Wert von (ʧʲ) Tab. 64
Erklärende Variable Werte / Messniveau Referenzwert Artikulationsort des nachfolgenden Lautes Ø (Auslaut)
labial dental velar /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ unbetontes /a, e, o/
/a/
Dauer stetig (in 10 Millisekunden) -- Worthäufigkeit logarithmiert stetig -- Generation Generation 0
Generation 1 Generation 2
Generation 1
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
Zu den erklärenden Variablen seien folgende Erläuterungen angeführt:
Der nachfolgende Kontext bezieht sich auf das zugrunde liegende Pho-nem. In unbetonten Silben werden nachfolgendes /a/, /e/ und /o/ zusam-mengefasst. Dies geschieht aus dem Grund, dass deren Realisierung zum einen von der Palatalisiertheit des vorangehenden Konsonanten, also in diesem Fall der Variable (ʧʲ) abhängt, zum anderen die Realisierung die-ser Phoneme in beiden Kontaktsprachen in dieser Position unterschied-lich ist und daher möglicherweise von der Realisierung der Affrikaten (palatalisiert vs. nicht-palatalisiert) abhängt.
247
Dialektale Unterschiede oder lexikalische Besonderheiten sind nicht zu berücksichtigen.
Tabelle 65 zeigt die Ergebnisse für ein Mehrebenenmodell mit dem norma-lisierten CoG-Wert als abhängiger Variable, Sprecher (n=30) und Familie (n=8) als Zufallsfaktoren:
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (ʧʲ) (n=990). Zufallsfakto-Tab. 65ren: Sprecher (n=30, σ=0,34), Familie (n=8, σ=0,03)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -1,19 0,14 -8,28 0,0001 Kontext rechts Auslaut 0,40 0,16 2,51 0,0134
/e/ 0,34 0,13 2,59 0,0096 /i/ 0,19 0,10 1,91 0,0596 /o/ 0,04 0,12 0,29 0,8006 /u/ -0,06 0,15 -0,42 0,6534 unbetontes /a, e, o/ 0,09 0,10 0,91 0,3740 dental 0,76 0,12 6,27 0,0001 labial -0,25 0,52 -0,49 0,6332 velar -0,22 0,13 -1,66 0,0936 Generation Generation 0 0,01 0,21 0,06 0,8874 Generation 2 -0,38 0,15 -2,54 0,0108 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,40 0,18 2,15 0,0382
hybrid 0,21 0,09 2,33 0,0180 russisch 0,33 0,10 3,20 0,0012
Die Einflüsse des lautlichen Kontextes sind plausibel. Realisierungen von (ʧʲ) vor dentalen Konsonanten und vorderen Vokalen haben höhere CoG-Werte, was auf eine vordere Realisierung des Sibilanten, also auf eine Assimila-tion/Akkommodation an den Artikulationsort des folgenden Lautes schließen lässt. Abgesehen von der Position vor dentalen Konsonanten sind die CoG-Werte im Auslaut am höchsten. Vor Velaren und /u/ sind die CoG-Werte niedriger. Ein solcher Einfluss benachbarter Vokale wird oft bemerkt: [o] und [u] labialisieren (FBLM 1989, 95), was sich bei Frikativen in intensiven niedrigeren Frequenzbereichen ausdrückt, da die Lippenrundung eine Ver-längerung des vorderen Resonanzraumes bedeutet (JOHNSON 2003, 127). Die Dauer des Lautes spielt keine Rolle, ebenso wenig wie die Häufigkeit des Lemmas. Geht man davon aus, dass höhere Worthäufigkeit und schnellere Aussprache natürlichkeitsbedingte phonologische Prozesse begünstigen, ist es also unwahrscheinlich, dass die eine oder andere Variante als artikulato-risch schwieriger einzustufen ist. Das Geschlecht hat keinen Einfluss auf den normalisierten CoG. Für den Faktor Generation bestätigt sich dagegen der sich in den Abbildungen oben andeutende überraschende Effekt: Genera-
248
tion 2 hat signifikant niedrigere CoG-Werte als Generation 1. Zwischen Generation 1 und Generation 0 bestehen keine Unterschiede.
Zudem sind Effekte der Affinität der Äußerung zu erkennen, und zwar diesmal in die erwartete Richtung. Die Realisierungen von (ʧʲ) in ‚gemeinsa-men‘, ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungen weisen sämtlich signifikant höhere CoG-Werte als solche in ‚weißrussischen‘ Äußerungen auf, was da-rauf schließen lässt, dass sie weniger stark velarisiert sind bzw. weiter vorn artikuliert werden. In ‚weißrussischen‘ Äußerungen ist die Aussprache also stärker ‚weißrussisch‘, in allen anderen, vor allem in ‚gemeinsamen‘ und ‚russischen‘ Äußerungen ist sie stärker ‚russisch‘. Es sind keine Interaktionen festzustellen.
Zusammenfassung: Es bleibt zu diskutieren, wie der Trend in die ‚weißrussi-sche‘ Richtung in der Generation 2 zu erklären ist. Dass diese Generation zu stärker ‚weißrussischen‘ Realisierungen neigt als die beiden übrigen Grup-pen, ist angesichts der bisherigen Befunde wenig wahrscheinlich. Offensicht-lich haben wir es bei den niedrigeren CoG-Werten für Generation 2 mit einem Effekt der Normalisierung zu tun. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Generation /ʂ/ weniger velarisiert als die älteren Generationen, so dass die Werte von (ʧʲ) und /ʂ/ für sie näher beieinander liegen. Dies zeigt der hier eingesetzten Normalisierung ihre Grenzen auf.
Für die Affinität der Äußerung geht es dagegen um Vergleiche unterhalb der Sprecherebene, d.h. innerhalb eines Sprechers. Es ist also unerheblich, ob die Werte von (ʧʲ) für den einzelnen Sprecher insgesamt näher an /ʂ/ liegen oder nicht. Hier verlaufen die Effekte in die erwartete Richtung: In ‚russi-schen‘ Äußerungen, aber auch in ‚hybriden‘ Äußerungen (wenn auch weni-ger stark) liegt eine stärker ‚russische‘ Aussprache vor. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Tendenz zu einer stärker ‚russischen‘ Aussprache in den Generationen unterschiedlich ausfällt.
Zur Palatalisiertheit von (ʧʲ) in WRGR 6.4.3
Was Unterschiede im Artikulationsort zwischen den Generationen angeht, ist also keine klare Aussage möglich. Im Folgenden wird geprüft, ob dies für die Palatalisiertheit der Affrikate anders ist. Palatal koartikulierte Laute unter-scheiden sich von ihren nicht-palatalisierten Entsprechungen darin, dass der Zungenrücken zu einer Position ähnlich der Position bei der Artikulation eines [i] angehoben wird (LADEFOGED & MADDIESON 1996, 363). Was pala-talisierte Konsonanten von nicht-palatalisierten unterscheidet, ist also vor
249
allem der Bereich der Mundhöhle hinter dem Hindernis (die „back cavity“). Wie bereits bei der Diskussion von (sʲ) angedeutet, äußert sich dieser Unter-schied akustisch kaum, solange der Bereich vor dem Hindernis von dem Bereich hinter dem Hindernis getrennt ist, d.h. in der Phase des Verschlusses oder der Engebildung. Ein Einfluss des Hinterraums wird erst deutlich, wenn der Verschluss gelöst bzw. die Enge geweitet ist, d.h. vor allem bei der Ver-schlusslösung und teilweise bei der Verschlussbildung. Auf palatalisierte Konsonanten folgende Vokale weisen daher [i]-artige Formanteneinstiege auf, haben also zu Beginn einen niedrigen F1 und einen hohen F2. Erst nach dieser Phase bewegen sich die Formanten in Richtung der Werte nach nicht-palatalisierten Konsonanten, ohne sie jedoch stets zu erreichen (vgl. z.B. FBLM 1989, 87–89, s.a. Abschnitt 5.3).
Im Folgenden werden die Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ) analysiert. Gemessen werden diese in Praat nach einem Fünftel der Dauer des Vokals auf dieselbe Art und Weise wie die vokalischen Variablen in Kapitel 5, d.h. mithilfe einer LPC-Analyse, mit denselben Einstellungen wie in Abschnitt 5.2.2 beschrieben. Um von allgemeinen, anatomisch bedingten Sprecherunterschieden zu abstrahieren, werden diese Formantwerte anhand der Durchschnittswerte der Hauptallophone der betonten Vokale des jeweili-gen Sprechers auf die gleiche Art und Weise normalisiert, wie die Formant-werte der vokalischen Variablen (vgl. Abschnitt 5.2.3). Die Sprecher sa_M, ra_D und sm_AF werden ausgeschlossen.
Analyse 1 – Mittelwerte: Abbildung 48 zeigt die durchschnittlichen Forman-teneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ) getrennt nach Generationen. Da für Spre-cher ak_Q nur fünf Token analysiert werden konnten, wird dessen Durch-schnittswert nicht berechnet. Für die übrigen Sprecher wurden durchschnitt-lich 26,9 Token ausgewertet (11–67, σ=9,5). Tabelle 133 im Anhang zeigt die Durchschnittswerte pro Sprecher sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token. Abbildung 49 zeigt zusätzlich die Euklidische Distanz des durchschnittlichen Formanteneinstiegs nach (ʧʲ) zu den Durchschnitts-werten von /i/ des einzelnen Sprechers.165 Je höher der Wert, desto größer ist die Distanz in F1 und/oder F2 zu /i/. Ein Wert von 0 würde einen Zusammen-fall mit dem Mittelwert von /i/ anzeigen.
165 Die Euklidische Distanz ist die Quadratwurzel der Summe des quadrierten „vertikalen“
Abstandes (dem Unterschied in F1) und des quadrierten „horizontalen“ Abstandes (dem Unterschied in F2) zwischen zwei Punkten im F2/F1-Koordinatensystem (vgl. HARRINGTON 2010, 190–195).
250
Durchschnittliche Formantwerte von Vokalen nach (ʧʲ) nach einem Fünftel der Dauer Abb. 48
des Vokals
Euklidische Distanz des durchschnittlichen Formanteneinstiegs von Vokalen nach Abb. 49
(ʧʲ) zu /i/ bei den einzelnen Sprechern
In Abbildung 48 sind noch keine Unterschiede zwischen Generation 0 und Generation 1 erkennbar. Abbildung 49, die, da stets die euklidische Distanz zu den Mittelwerten von /i/ des jeweiligen Sprechers berechnet wird, gewisse von der Normalisierung nicht erfasste Unterschiede berücksichtigt, deutet dagegen an, dass bereits die Formanteneinstiege einiger Vertreter der Gene-ration 1 näher an /i/ heranreichen als es bei der Generation 0 der Fall ist. Auf die Gruppen insgesamt bezogen sind jedoch auch hier kaum Unterschiede erkennbar. Deutlich erkennbar in beiden Abbildungen sind die Unterschiede dann zu Generation 2. Für fünf Sprecher gehen die Werte deutlich näher in Richtung von /i/, was auf einen deutlich [i]-artigen Formanteneinstieg der untersuchten Vokale und dementsprechend auf eine palatalisierte Realisie-
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
● ●●
●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.52
1.5
10.
50
-0.5
-1-1
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●
●
●●●
●●●
●●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.52
1.5
10.
50
-0.5
-1-1
.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
●
●● ●●
●●●
● ●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 20.
00.
51.
01.
52.
0
Generation 0
Euk
lidis
che
Dis
tanz
zu
/i/
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 2
251
rung von (ʧʲ) hindeutet. Für die sieben übrigen Sprecher ähneln die Werte dagegen der Generation 1.
Analyse 2 – Tokenbezogene Analyse: Der Einfluss der Generation und der Einfluss weiterer Faktoren werden im Folgenden überprüft. Folgende Vari-ablen werden in die Analyse der Token einbezogen:
Erklärende Variablen, Analyse des Formanteneinstiegs folgender Vokale für (ʧʲ) Tab. 66
Erklärende Variable Werte Referenzwert Vokalphonem /a/
/e/ /i/ /o/ /u/ unbetontes /a, e, o/
/a/
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform
weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
Als abhängige Variable eignet sich die Distanz zu dem Mittelwert von /i/ in einer tokenbezogenen Analyse weniger gut, da für einzelne Token die Werte auch über die von /i/ hinausgehen können, d.h. einen niedrigeren F1 und einen höheren F2 aufweisen können. Diese Token hätten dann, trotz starker [i]-Artigkeit, Werte wie solche mit gleich stark in die Gegenrichtung abwei-chenden Formanten, also solche mit einem höheren F1 und einem niedrigeren F2. Stattdessen werden als abhängige Variablen wieder die ersten beiden Formanten genommen. Dem zweiten Formanten kommt dabei größere Be-deutung zu, da der Einfluss eines palatalisierten Kontextes für den zweiten Formanten üblicherweise als stärker als für den ersten angenommen wird.
252
Tabelle 67 zeigt die Ergebnisse für ein Mehrebenenmodell mit dem nor-malisierten ersten, Tabelle 68 mit dem normalisierten zweiten Formanten als abhängiger Variable.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von Vokalen nach (ʧʲ), alle Äußerun-Tab. 67gen (n=867). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=30, σ=0,11), Familie (n=8; σ=0,14)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 1,15 0,11 10,42 0,0001 Vokal /e/ -1,02 0,10 -9,97 0,0001
/i/ -1,46 0,08 -17,85 0,0001 /o/ -1,10 0,09 -11,85 0,0001 /u/ -1,47 0,11 -12,85 0,0001 unbetontes /a, e, o/ -1,06 0,08 -13,69 0,0001 Generation Generation 0 0,13 0,11 1,21 0,2146 Generation 2 -0,10 0,08 -1,32 0,2062 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,24 0,16 -1,52 0,1300 hybrid -0,28 0,07 -3,74 0,0001 russisch -0,35 0,09 -4,06 0,0001
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von Vokalen nach (ʧʲ), alle Äußerun-Tab. 68gen (n=867). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=30, σ=0,23), Familie (n=8; σ=0,09)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,05 0,11 -0,46 0,6602 Vokal /e/ 0,39 0,09 4,53 0,0001
/i/ 0,50 0,07 7,17 0,0001 /o/ -0,41 0,08 -5,27 0,0001 /u/ -0,22 0,10 -2,23 0,0278 unbetontes /a, e, o/ 0,13 0,07 1,92 0,0556 Generation Generation 0 -0,11 0,15 -0,75 0,4118 Generation 2 0,25 0,11 2,32 0,0200 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,07 0,13 0,55 0,6168 hybrid 0,09 0,06 1,37 0,1876 russisch 0,18 0,07 2,45 0,0140
Deutlich zeigt sich ein Effekt des lautlichen Kontextes: Vokalkategorien mit niedrigem ersten bzw. zweiten Formanten haben auch dementsprechend niedrigere Formanteneinstiege.166 Davon abgesehen bestehen Unterschiede zwischen Generation 2 und Generation 1 im zweiten Formanten, mit stärker [i]-artigen Formanteneinstiegen für Generation 2. Schließlich zeigt sich wie-
166 Für einige Sprecher ist sogar eine klar palatalisierte Realisierung vor /i/ zu beobachten.
Dies ist nicht nur bei jüngeren Sprechern, sondern bereits bei Vertretern der Generation 0 zu beobachten. Vgl. z.B. die Abbildungen zu mi_V und ak_B im Anhang. Auch von SADOŬSKI (1982, 209) waren stärker palatalisierte Realisierungen vor hohen vorderen Vokalen beobachtet worden.
253
der ein Einfluss der Affinität der Äußerung: In ‚russischen‘ Äußerungen ist der Formanteneinstieg [i]-ähnlicher als in ‚weißrussischen‘ Äußerungen. ‚Hybride‘ liegen dazwischen. Dies gilt sowohl für den ersten als auch für den zweiten Formanten.
Es zeigt sich zudem, dass sowohl für den ersten als auch für den zweiten Formanten eine insgesamt marginal signifikante Interaktion zwischen Gene-ration und der Affinität der Äußerung besteht, wenn die Generationen 0 und 1 als die in ländlichen Gebieten aufgewachsenen Sprecher zusammengefasst werden. Die wenigen ‚gemeinsamen‘ Äußerungen (n=26) werden dabei aus-geschlossen. Für den ersten Formanten ist die Log-Likelihood eines Modells ohne Interaktion -916,94, die eines Modells mit Interaktion -914,51 (χ2=4,88, df=2, p=0,0873). Für den zweiten Formanten ist die Log-Likelihood eines Modells ohne Interaktion -779,98, die eines Modells mit Interaktion -777,53 (χ2= 4,90, df=2, p=0,0864). Abbildung 50 verdeutlicht diese Tendenzen von Interaktionen.
Marginal signifikante Interaktionen von Land/Stadt und Affinität der Äußerung Abb. 50
(w, h, r), Formanteneinstiege nach (ʧʲ). Die anderen Faktoren werden auf dem Refe-renzwert oder dem Median gehalten.
Vertreter der Generation 2 weisen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen nach (ʧʲ) Formanteneinstiege auf, die gleich stark (oder noch stärker) in Richtung des Weißrussischen gehen, wie die von Vertretern der übrigen Generationen. Generation 2 variiert in ihrer Aussprache also je nach Kode, was für die älte-ren Sprecher nur bedingt der Fall ist. Dieser Befund geht in die gleiche
0.5
1.0
1.5
2.0
F1
LandStadt
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
F2
LandStadt
254
Richtung wie der von HENTSCHEL & ZELLER (2014) anhand der Transkripti-onen im OK-WRGR festgestellte starke Einfluss der Affinität bei Sprechern, die auf strukturell tieferen Ebenen stark zum Russischen neigen. Es deutet sich aber auch für die älteren Sprecher eine leichte Differenzierung nach Äußerungstypen an, was ebenfalls den Zahlen HENTSCHEL & ZELLER (2014) entspricht.
Analyse 2 – Tokenbezogene Analyse, ‚hybride‘ Äußerungen: Beschränken wir nun die Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen:
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von Vokalen nach (ʧʲ), nur ‚hybride‘ Tab. 69Äußerungen (n=417). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=30, σ=0,12), Familie (n=8, σ=0,11)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 1,02 0,13 7,66 0,0001 Vokal /e/ -1,15 0,14 -7,98 0,0001
/i/ -1,42 0,12 -11,95 0,0001 /o/ -1,10 0,14 -8,11 0,0001 /u/ -1,63 0,18 -8,90 0,0001 /a, e, o/ unbetont -1,13 0,11 -10,28 0,0001 Affinität der Wortform gemeinsam -0,10 0,11 -0,86 0,3922 hybrid -0,23 0,13 -1,78 0,0766 russisch -0,18 0,10 -1,86 0,0634
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von Vokalen nach (ʧʲ), nur ‚hybride‘ Tab. 70Äußerungen (n=417). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=30, σ=0,23), Familie (n=8, σ=0,04)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,06 0,12 -0,51 0,6354 Vokal /e/ 0,36 0,11 3,29 0,0012
/i/ 0,48 0,09 5,20 0,0001 /o/ -0,44 0,10 -4,24 0,0001 /u/ 0,00 0,14 0,01 0,9752 /a, e, o/ unbetont 0,13 0,09 1,48 0,1420 Generation Generation 0 -0,11 0,16 -0,72 0,4012 Generation 2 0,26 0,11 2,31 0,0188 Affinität der Wortform gemeinsam 0,18 0,09 2,10 0,0422 hybrid -0,15 0,10 -1,50 0,1204 russisch 0,16 0,07 2,22 0,0252
Der Unterschied der Generationen im zweiten Formanten bleibt auch in ‚hyb-riden‘ Äußerungen bestehen, die Koeffizienten ähneln stark denen für das Gesamtsample. Zudem ist in ‚hybriden‘ Äußerungen ein Einfluss der Affini-tät der Wortform zu beobachten. ‚Russische‘ und ‚gemeinsame‘ Wortformen
255
weisen [i]-artigere Formanteneinstiege auf als ‚weißrussische‘ und ‚hybride‘ (letztere sind mit n=48 hier nicht zu vernachlässigen).
Werden ‚gemeinsame‘ und ‚hybride‘ Wortformen ausgeschlossen und die Generationen 0 und 1 zusammengefasst, so verfehlt eine Interaktion zwi-schen Land/Stadt und Affinität der Wortform für den zweiten Formanten Signifikanzniveau (Log-Likelihood ohne Interaktion: -240,83, mit Interak-tion: -239,61; χ2=2,43, df=1, p=0,12). Der Trend deutet aber in eine plausible Richtung, wie Abbildung 51 zeigt:167
Nicht-signifikante Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Wortform in Abb. 51
‚hybriden‘ Äußerungen für den Einstieg des zweiten Formanten von Vokalen nach (ʧʲ). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Zur Palatalisiertheit von (ʃʲ) in WRGR 6.4.4
Aufgrund der Schwierigkeit der Analyse der CoG-Werte, die bei der Variable (ʧʲ) auftrat, werden für (ʃʲ) lediglich die Formanteneinstiege von nachfolgen-den Vokalen untersucht. Es wird zudem auch nicht auf Unterschiede einge-gangen, die die Gegliedertheit der Variable betreffen, es wird also nicht un-terschieden, ob die Realisierung als [ʂt ʂ] oder als [ʂː], als [ʃʲʧʲ] oder als [ʃʲː] erfolgt.
167 Wenn ‚gemeinsame‘ Wortformen nicht ausgeschlossen werden, ist die Interaktion klar
nicht signifikant (χ2=3,02, df=2, p=0,22). Für den ersten Formanten ergibt sich weder bei Einschluss von ‚gemeinsamen‘ Wortformen (χ2=3,17, df=2, p=0,21) noch bei deren Aus-schluss (χ2=1,13, df=1, p=0,29) eine Tendenz zu einer Interaktion.
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
F2
LandStadt
256
Analyse: Gemessen werden die Formanteneinstiege nach einem Fünftel der Dauer des Vokals. Anschließend werden die Messwerte anhand der Durch-schnittswerte der Hauptallophone der betonten Vokale des jeweiligen Spre-chers normalisiert (vgl. Abschnitt 5.2.3). Die Analyse beschränkt sich auf den zweiten Formanten. Die Sprecher sa_M, ra_D und sm_AF werden ausge-schlossen. Die bei weitem meisten Token werden von den Lexemen wr. jaščė (n=98) und ru. eščë (n=48) ‚noch‘ gestellt.
Es ist zu erwarten, dass Vertreter der jüngsten Generation die Variable (ʃʲ) stärker palatalisieren und dass Realisierungen in ‚russischen‘ Äußerun-gen/Wortformen stärker palatalisiert sind. Dies würde sich in einem höheren zweiten Formant und eventuell in einem niedrigeren ersten Formant äußern. Es werden dieselben erklärenden Variablen wie für die Variable (ʧʲ) geprüft.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von Vokalen nach (ʃʲ) (n=276). Zufalls-Tab. 71faktoren: Sprecher (n=30, σ= 0,21), Familie (n=8; σ=0,15)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,12 0,21 0,56 0,574 Vokal /e/ 0,47 0,17 2,82 0,007
/i/ 0,69 0,20 3,44 0,000 /o, u/ -0,07 0,18 -0,42 0,627 unbetontes /a, e, o/ 0,30 0,19 1,56 0,132 Generation Generation 0 -0,09 0,19 -0,46 0,602 Generation 2 0,27 0,15 1,84 0,086 Affinität der Äußerung hybrid -0,16 0,14 -1,11 0,309 russisch -0,22 0,17 -1,27 0,299
Wie Tabelle 71 zeigt, ist eine Tendenz für Vertreter der Generation 2 zu [i]-artigeren Formanteneinstiegen zu beobachten (was den Erwartungen ent-spricht) sowie (nicht-signifikant) zu weniger [i]-artigen Realisierungen in ‚russischen‘ und in ‚hybriden‘ Äußerungen, was gegen die Erwartungen ist. Es ist jedoch anzunehmen, dass die häufigen Lexeme wr. jaščė / ru. eščë ‚noch‘ eine Rolle spielen, wo im Weißrussischen mit [ɛ] ein Vokal mit einem hohen zweiten Formanten, im Russischen mit [ɔ] ein Vokal mit einem niedri-gen zweiten Formanten folgt. Auch wenn der lautliche Kontext im Modell berücksichtigt wird, führt diese Konstellation offensichtlich zu nicht zuver-lässigen Ergebnissen. Werden die genannten Lemmata ausgeschlossen, so ergibt sich ein marginal-signifikanter Effekt für Generation 2, zwischen den beiden älteren Generationen sind keine Unterschiede feststellbar.
257
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von Vokalen nach (ʃʲ) ohne wr. jaščė / Tab. 72ru. eščë (n=162). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=28, σ<0,01), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,05 0,18 -0,27 0,7857 Vokal /e/ 0,38 0,19 2,01 0,0460
/i/ 0,62 0,20 3,09 0,0024 /o, u/ -0,31 0,24 -1,27 0,2048 unbetontes /a, e, o/ 0,16 0,19 0,85 0,3974 Generation Generation 0 0,15 0,26 0,60 0,5523 Generation 2 0,34 0,16 2,05 0,0546
Zusammenfassung: Abgesehen von den plausiblen kontextbedingten Unter-schieden ist also auch für (ʃʲ) eine Entwicklung in Richtung der ‚russischen‘ palatalisierten Variante zu verzeichnen. Vertreter der Generation 2 weisen höhere, stärker [i]-artige Einstiege des zweiten Formanten nach (ʃʲ) auf, was für eine Palatalisierung des Sibilanten spricht. Was den Vergleich der beiden Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ) angeht, so sind sowohl die Koeffizienten für die Gene-ration 1 (die Konstante: -0,08 für (ʧʲ), -0,05 für (ʃʲ)) als auch der Unterschied zwischen Generation 1 und Generation 2 (0,27 im Vergleich zu 0,33) nahezu identisch, was darauf hindeutet, dass die Variation ähnlich verläuft. Aller-dings ist für (ʃʲ) keine Interaktion mit der Affinität der Äußerung feststellbar, und auch generell sind keine Unterschiede zwischen Äußerungen unter-schiedlicher Affinität erkennbar. Dies mag jedoch auch an der geringen Zahl an Beobachtungen liegen.
Zusammenfassung zu den postalveolaren Sibilanten 6.4.5
In diesem Unterkapitel wurde die Variation von ‚russischem‘ [ʧʲ]/[ʨ] und ‚weißrussischem‘ [t ʂ] sowie von ru. [ʃʲː]/[ɕː] und wr. [ʂt ʂ] in WRGR unter-sucht. Die ‚weißrussische‘ und die ‚russische‘ Variante unterscheiden sich in zwei Parametern: in der Palatalisiertheit und im Artikulationsort. Um Varia-tion im Artikulationsort zu untersuchen, wurden die Gravitationszentren des Spektrums untersucht. Zur Analyse der Palatalisiertheit wurden die Forman-teneinstiege des auf den Sibilanten folgenden Vokals bestimmt.
Die Ergebnisse für (ʧʲ) sind schwierig zu interpretieren. Die niedrigeren normalisierten CoG-Werte für Generation 2 deuten zunächst in eine un-erwartete Richtung. Für Generation 2 sind sie niedriger als in den beiden anderen Generationen, was zunächst auf eine stärker velarisierte, stärker ‚weißrussische‘ Artikulation hindeutet. Dies ist aber wohl ein Effekt der Normalisierung. In ‚weißrussischen‘ Äußerungen fallen die CoG-Werte nied-riger als für /ʂ/ aus, in ‚russischen‘ höher, was zeigt, dass in ‚russischen‘
258
Äußerungen eine Tendenz zu einer vorderen, weniger velarisierten Artikula-tion besteht.
Effekt der Affinität der Äußerung auf den CoG. Die anderen Faktoren werden auf Abb. 52
dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Wie die CoG-Werte zeigen auch die Formanteneinstiege, dass (ʧʲ) in ‚russi-schen‘ Äußerungen stärker ‚russisch‘ realisiert wird, in ‚weißrussischen‘ stärker ‚weißrussisch‘. Ebenso wie für (ʃʲ) sind hier zudem Unterschiede zwischen den Generationen erkennbar. Die Analyse der Formanteneinstiege belegt also, dass auch für (ʧʲ) und (ʃʲ) für die Generation 2 eine Bewegung in Richtung des Russischen vorliegt.
Jedoch besteht die Tendenz zu einer stärker ‚russischen‘ Realisierung für Generation 2, zumindest was (ʧʲ) angeht, nur in ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungen. In ‚weißrussischen‘ Äußerungen ähneln die Werte denen der älteren Generationen. Folgende Abbildung verdeutlicht diese Interaktion.
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
(ʧʲ)
CoG
wg h
r
259
Vorhergesagte Werte für Formanteneinstiege von /i/ nach (ʧʲ) in ‚weißrussischen‘, Abb. 53
‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungen für Vertreter der Generationen 0 und 1 (L, für Land) und Vertreter der Generation 2 (S, für Stadt), mit Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung. Die anderen Faktoren werden auf dem Refe-renzwert oder dem Median gehalten.
Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass die Nicht-Palatalisiertheit der Affri-kate (ʧʲ) in WRGR im weiteren Sinne für Vertreter der Generation 2 als Mar-ker des Weißrussischen fungiert.
Für die Variable (ʃʲ) konnten nur vergleichsweise wenige Token analysiert werden. Was den Generationsunterschied angeht, so stellten sich aber ver-gleichbare Ergebnisse heraus: Für Generation 2 besteht eine Tendenz zu einer stärker palatalisierten, also stärker ‚russischen‘ Aussprache.
6.5 Zusammenfassung zu den Sibilanten
Dieses Kapitel behandelte die Variation im Bereich der Sibilanten in WRGR. Es wurden fünf Variablen untersucht:
1) Die Variable (sʲ): Wr. posterior-alveolares palatalisiertes [s''] vs. ru. [sʲ]:
2) Die Variable (tʲ): Wr. posterior-alveolare palatalisierte Affrikate [ʦ''] vs. ru. Plosiv [tʲ] oder leicht affrizierter Plosive [tˢʲ]
3) Die Variable (dʲ): Wr. posterior-alveolare palatalisierte Affrikate [ʣ''] vs. ru. Plosiv [dʲ] oder leicht affrizierter Plosiv [dˢʲ]
4) Die Variable (ʧʲ): Wr. nicht-palatalisiertes [t ʂ] vs. ru. palatalisiertes [ʧʲ]:
5) Die Variable (ʃʲ): Wr. nicht-palatalisiertes [ʂt ʂ] vs. ru. palatalisiertes [ʃʲː]
260
Diese fünf Variablen lassen sich drei Phänomenbereichen zuordnen:
a) Die Affrizierung der historischen palatalisierten dental-alveolaren Plo-sive im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (tʲ) und (dʲ).
b) Die posterior-alveolare Artikulation der palatalisierten vorderen Sibilan-ten im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (sʲ), (tʲ) und (dʲ).
c) Die Entpalatalisierung aller postalveolaren Sibilanten im Weißrussi-schen. Dies betrifft die Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ).
Im Folgenden werden die Ergebnisse gemäß diesen drei Phänomenbereichen zusammengefasst.
a) Was zunächst die Variation von deutlich affriziertem ‚weißrussischen‘ [ʦ"] und [ʣ"] und allenfalls leicht affriziertem ‚russischen‘ [tʲ] und [dʲ] an-geht, so legen bereits die in HENTSCHEL & ZELLER (2014) analysierten Tran-skriptionen des OK-WRGR nahe, dass die ‚weißrussische‘ Ausprägung, das sogenannte Cekanje, in WRGR äußerst stabil ist. Dies bestätigte sich in der Untersuchung der Dauer der frikativen Phase der Laute. Es findet sich kein Hinweis darauf, dass für jüngere Sprecher eine kürzere, folglich weniger stark affrizierte Realisierung erfolgt. Für (tʲ) deutet auch nichts auf eine we-niger stark affrizierte Realisierung in ‚russischen‘ Äußerungen hin. Lediglich für (dʲ) erfolgt in ‚weißrussischen‘ Äußerungen eine längere Realisierung, der Unterschied ist aber äußerst gering.
b) Für die Analyse der Variation der ‚weißrussischen‘ posterior-alveola-ren Artikulation und der ‚russischen‘ alveolaren Artikulation der vorderen palatalisierten Sibilanten (sʲ), (tʲ) und (dʲ) wurden die spektralen Gravitations-zentren (die CoG-Werte) dieser Laute berechnet. Da zwischen Sprechern auch unabhängig von soziolinguistischen oder kontaktlinguistischen Einflüs-sen Unterschiede in den CoG-Werten bestehen, wurde ein Normalisierungs-verfahren entwickelt und erprobt. Dazu wurde die relative Lage der CoG-Werte der in Frage kommenden Sibilanten in Bezug zu den Messwerten von /s/ und /ʂ/ berechnet. Die normalisierten CoG-Werte belegen, dass zwischen den Sprechern große Unterschiede bestehen. Für einige Sprecher legen die Messwerte eine stark posteriore Artikulation nahe, für andere eine weitge-hend mit /s/ übereinstimmende, d.h. nicht posteriore. Wie im Weißrussischen ist die posteriore Artikulation auch in WRGR für (sʲ) stärker als für (tʲ). All-gemeine Unterschiede zwischen den Generationen sind nicht festzustellen, auch dann nicht, wenn die beiden älteren Generationen zusammengefasst werden (beide haben ihre sprachliche Sozialisierung in ländlichen Gebieten
261
erfahren) und mit den Vertretern der Generation 2 verglichen werden. Es war jedoch ein Einfluss der Affinität der Äußerung festzustellen: Bei der Variable (sʲ) gilt für alle Generationen, dass die ‚weißrussische‘ posteriore Artikulation in ‚weißrussischen‘ Äußerungen am stärksten ist. In ‚hybriden‘ und ‚russi-schen‘ Äußerungen ist sie weniger ausgeprägt. Für die beiden anderen Vari-ablen ist nach Generationen zu differenzieren: Vertreter der Generationen 0 und 1 weisen für (dʲ) in ‚weißrussischen‘ Äußerungen stärker ‚weißrussische‘ Realisierungen auf, in ‚russischen‘ stärker ‚russische‘. Das Gleiche gilt für Generation 2 für die Variable (tʲ). Warum dieser Unterschied zwischen (tʲ) und (dʲ) besteht, ist unklar und für die Zukunft sicherlich eine lohnenswerte Fragestellung. In der Literatur weist nichts auf einen Unterschied zwischen (dʲ) und (tʲ) hin, was die Salienz und/oder die soziale Bewertung der phoneti-schen Varianten angeht.
Die Werte für ‚hybride‘ Äußerungen liegen stets zwischen denen von ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Äußerungen. In einem nächsten Schritt wurde die Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen beschränkt. Innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen weisen (tʲ) und (sʲ) in ‚weißrussischen‘ Wortformen stärker ‚weißrussische‘ Realisierungen auf, in ‚russischen‘ stärker ‚russi-sche‘. Für (dʲ) war kein solcher Effekt festzustellen. Allerdings war die Zahl der Beobachtungen für diese Variable geringer als für die beiden stimmlosen Variablen.
c) Für die postalveolare Affrikate (ʧʲ) wurden zwei Aspekte der Variation untersucht: die Palatalisiertheit und der Artikulationsort. Die ‚weißrussische‘ Variante der Variable ist nicht-palatalisiert, die ‚russische‘ Entsprechung palatalisiert. Die ‚russische‘ Variante wird darüber hinaus stärker alveolo-palatal artikuliert.
Für die Analyse der Variation im Artikulationsort erwies sich das hier verwendete Normalisierungsverfahren bzw. die Analyse der CoG-Werte als problematisch. Gegen die Erwartungen zeigte Generation 2 niedrigere CoG-Werte als die älteren Generationen, was auf eine stärker ‚weißrussische‘, hintere Artikulation hindeutet. Dies ist aber wohl ein Effekt der Normalisie-rung. Die Ergebnisse der Analyse der Affinität der Äußerung deuteten dage-gen wie zu erwarten auf eher vordere/weniger stark velarisierte Realisierun-gen in ‚hybriden‘ und vor allem in ‚russischen‘ Äußerungen hin.
Für (ʧʲ) und auch für (ʃʲ) zeigte dann die Analyse der Formanteneinstiege nachfolgender Vokale, dass in Generation 2 palatalisierte, ‚russische‘ Reali-sierungen zunehmen. Was (ʧʲ) angeht, so gilt dieser Generationsunterschied jedoch nicht für ‚weißrussische‘ Äußerungen, sondern für ‚hybride‘ und vor
262
allem für ‚russische‘. In ‚weißrussischen‘ Äußerungen tendiert dagegen auch die jüngere Generation stark zu einer ‚weißrussischen‘ Artikulation. Während auch bei den älteren Sprechern leichte Unterschiede zwischen den Äuße-rungstypen bestehen, neigt die jüngste Generation in ‚hybriden‘ und ‚russi-schen‘ Äußerungen deutlich stärker zu einer ‚russischen‘ Realisierung. Innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen ist die palatalisierte ‚russische‘ Arti-kulation in ‚russischen‘ Wortformen stärker als in ‚weißrussischen‘ Wort-formen. Diese Befunde deuten darauf hin, dass der Unterschied zwischen dem ‚weißrussischen‘ [t ʂ] und dem ‚russischen‘ [ʧʲ] als Marker des Weißrus-sischen/Russischen in der WRGR vor allem jüngerer Sprecher fungiert.
263
7 Variation von palatalisiertem [rʲ] und nicht-palatalisiertem [r] – die Variable (rʲ)
7.1 Hintergrund
Das historische palatalisierte |rʲ| ist im Weißrussischen entpalatalisiert worden und dadurch mit dem nicht-palatalisierten |r| zusammengefallen. Im Russi-schen dagegen ist die Opposition zwischen beiden Vibranten aufrecht-erhalten: Vergleiche ru. rad (/rad/) ‚froh‘ vs. rjad (/rʲad/) ‚Reihe‘ mit wr. rady (/radi/) ‚froh‘ vs. rad (/rad/) ‚Reihe‘.168 Dem Weißrussischen ist dabei nicht nur das Phonem /rʲ/ fremd, sondern auch [rʲ], d.h. /r/ unterliegt im Weißrussi-schen anders als der Großteil der anderen Konsonantenphoneme niemals der Palatalitätsassimilation (ANTIPOVA 1977, 130). Was die weißrussischen Dia-lekte angeht, so ist /rʲ/ im Osten des Bezirks Vicebsk und des Bezirks Mahilëŭ erhalten. In einigen Inseln der Bezirke Minsk und Homel’ variieren [rʲ] und [r] anstelle des etymologischen |rʲ| (DABM 1963a, Karte 42; NPBD 1964, 127–130; ČĖKMAN 1970, 107).
Die Variation von [r] und [rʲ] als Realisierungen von (rʲ) in WRGR, die im Folgenden analysiert wird, ist von einer anderen Natur als die übrigen in dieser Arbeit behandelten Beispiele. Während in den bisherigen Beispielen die Variable in beiden Kontaktsprachen isomorph mit jeweils einem Phonem oder einer Stellungsvariante eines bzw. mehrerer Phoneme zusammenfällt, und sich lediglich die phonetische Realisierung dieser Einheiten unterschei-det, umfasst die Variable (rʲ) im Russischen ein Phonem, im Weißrussischen
168 Vgl. hierzu und zum Folgenden PADLUŽNY (1969), KRYVICKI & PADLUŽNY (1984),
BIRYLA & ŠUBA (1985), CZEKMAN & SMUŁKOWA (1988), FBLM (1989), BM (2004). Erste Schreibungen, die auf eine Entpalatalisierung hindeuten, finden sich in Schriftdenkmälern Ende des 14. Jh. (vgl. KARSKIJ 2006 [1908], 309; JANKOŬSKI 1974, 121–122). ČĖKMAN (1970, 105–111) bringt den historischen Prozess der Entpalatalisierung in Zusammenhang mit der Verlagerung des primären Artikulationsortes in den posterior-alveolaren Bereich aller sekundär palatalisierten dentalen Laute im Weißrussischen. Wie bei /sʲ/, /zʲ/, /ʦʲ/, /ʣʲ/ und /nʲ/ sei dies auch bei /rʲ/ geschehen. Der Wechsel des Artikulationsortes habe dazu geführt, dass ein größerer Teil der Zunge an der Vibration beteiligt gewesen sei, was die Vibration erschwert habe.
264
dagegen eine nur etymologisch definierbare Teilklasse eines Phonems. Die Interferenz des Weißrussischen auf das Russische würde also im Sinne WEINREICHs (1970) nicht in einer Lautersetzung, sondern in einer Unterdiffe-renzierung bestehen.
Bei vergleichbaren Konstellationen, also beim Kontakt zweier sprachli-cher Varietäten, von denen in der einen zwei Phoneme zusammengefallen sind, in der anderen dagegen nicht, wird generell eine Tendenz zugunsten der Varietät mit der Aufhebung der Opposition beobachtet (LABOV 1991, 29). Im Falle der WRGR würde dies eine Stabilität des weißrussischen Musters bedeuten. Aufgrund der skizzierten sozialen Situation (und der Befunde in den anderen Kapiteln) ist aber eine Hinwendung zum Russischen seitens jüngerer Sprecher wahrscheinlich. Eine Entwicklung hin zur russischen Variante würde das Rückgängigmachen eines Mergers bedeuten. Anders gesagt erfordert die „korrekte Anwendung“ von /rʲ/ anders als etwa bei (ʧʲ), wo der phonetische Unterschied zwischen der ‚weißrussischen‘ und der ‚rus-sischen‘ Ausprägung ebenfalls in der Palatalisiertheit besteht, lexikalisches Wissen. Dies ist etwas, was für den Erwerb einer sprachlichen Varietät nach der kritischen Periode als äußerst schwierig erachtet wird (LABOV 1991, 28; AUER, BARDEN & GROSSKOPF 1998, 168). Als Konsequenz teilen solche Variablen stärker als ohne lexikalisches Wissen anwendbare Variablen die Sprecher in „late acquirer“, die nur eine geringe Menge an zielsprachlichen Varianten aufweisen, und „early acquirer“, für die die Anzahl der zielsprach-lichen Varianten beträchtlich höher ist (CHAMBERS 1998 [1992], 152f. und 160). Auch im Falle des Erwerbs des Russischen von Weißrussen wird beobachtet, dass (rʲ) größere Schwierigkeiten bereitet, als (ʧʲ), obwohl der phonetische Unterschied in beiden Fällen wie gesagt die palatale Koartikula-tion im Russischen ist (SADOŬSKI 1982, 209). Dementsprechend ist auch hyperkorrektes Verwenden von [rʲ] möglich und für das Russische in Belarus in Lexemen wie kryša ‚Dach‘, ryba ‚Fisch‘, topor ‚Beil‘ auch bezeugt (vgl. SADOVSKIJ 1978, 15; SADOŬSKI 1982, 208).
Die Intransparenz, ob einem [r] im Weißrussischen ein [r] oder ein [rʲ] im Russischen entsprechen würde, gilt allerdings nur eingeschränkt, da sich die Distribution von |r| und |rʲ| auf folgende Vokalphoneme im Weißrussischen wie die Verteilung von /r/ und /rʲ/ im Russischen teilweise komplementär verhält, teilweise probabilistisch unterscheidet. Da im Russischen /r/ nicht vor /e/ auftreten kann, ist in solchen Fällen eine Unterscheidung aufgrund von phonischen Kriterien möglich (wobei auch diese Regel aufgrund anderer Prozesse aus Sicht des Weißrussischen opak sein kann, vgl. wr. raka /reka/
265
[raka] bei ru. reka /rʲeka/ [rʲɪka] ‚Fluss‘). Bei den übrigen Vokalphonemen gibt es keine solch absoluten Restriktionen, aber gewisse Tendenzen: /rʲ/ tritt außer vor /e/ vor allem vor /i/ auf, vor /a/ und vor allem /o/ und /u/ ist es um einiges seltener als /r/ (vgl. BONDARKO 1981, 145–147).
Wie bereits erwähnt ist das nicht-palatalisierte [r] anstelle des russischen /rʲ/ eine häufige Interferenzerscheinung des Weißrussischen auf das Russi-sche (BULACHOV 1973, 103; KILEVAJA 1989, 9). Trotz der genannten relati-ven Intransparenz zeigt in SADOŬSKIs Daten (1982, 208) jedoch bereits die erste Migrantengeneration in Minsk in ihrer russischen Rede für /rʲ/ einen be-trächtlichen Anteil an palatalisierten und „halb-palatalisierten“ (s.u.) Varian-ten (37% bzw. 45% in den beiden untersuchten Gruppen), was sich nicht von den Verhältnissen für (ʧʲ) unterscheidet. Sadoŭski findet keinen Unterschied zwischen unterschiedlichen Stilen (Lesen vs. spontanes Gespräch).
Auch die Transkriptionen im OK-WRGR zeigen, dass (rʲ) und (ʧʲ) gleichermaßen vom Einfluss des Russischen betroffen sind (vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2014). Die relativen Anteile insgesamt sind mit jeweils knapp 20% quasi identisch, auch die Verteilung auf Sprechertypen und Äußerungs-typen unterscheidet sich nicht. Wie bereits bei (ʧʲ), so schwanken Sprecher-typen, die auf strukturell tieferen Ebenen zum Russischen tendieren, je nach Affinität der Äußerung stark zwischen [r] und [rʲ], während relativ stark zum Weißrussischen tendierende Sprecher auch in ‚russischen‘ Äußerungen kaum [rʲ]-artige Realisierungen aufweisen. Es ist also davon auszugehen, dass das Merkmal bei stärker und früher vom Russischen beeinflussten Sprechern als Marker fungieren kann. Auch LISKOVEC (2005, 131) berichtet von Selbstkor-rekturen in russischer Rede von Weißrussen: [r] für /rʲ/ wird korrigiert, was ebenfalls für einen hohen Grad der Bewusstheit dieser Variable spricht.
Auch wenn die Opposition /r/ vs. /rʲ/ phonologisch privativ ist, so besteht Anlass zur Vermutung, dass der Übergang von [r] zu [rʲ] ähnlich wie bei (ʧʲ) phonetisch graduell erfolgt. Oft wird in Arbeiten zum weißrussisch-russi-schen Sprachkontakt von im Vergleich zum Russischen weniger stark palata-lisierten Varianten berichtet (SADOVSKIJ 1978, 9; SADOŬSKI 1982, 206; FBLM 1989, 315). Es ist also davon auszugehen, dass die Artikulation von [rʲ] eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Dass die Unterscheidung zwischen [rʲ] und [r] infolge eines unterschiedlichen „phonematischen Siebes“ (im Sinne TRUBETZKOYs (1977, 47) für die Land-Stadt-Migranten eine perzeptu-elle Schwierigkeit darstellte, ist angesichts der allgemeinen Palatalitätskorre-lation im Weißrussischen nicht unbedingt anzunehmen. Von Bedeutung für die perzeptuelle Salienz sind sicherlich die unterschiedlichen Vokalallophone
266
nach /r/ bzw. /rʲ/. Als Folge der Entpalatalisierung treten im Weißrussischen nach dem historischen /rʲ/ die nach nicht-palatalisierten üblichen Vokal-allophone auf, besonders auffällig sicherlich bei /i/ (vgl. wr. pry [prɨ] vs. ru. pri [prʲi] ‚bei‘), aber auch vor unbetonten Vokalen, die im Russischen dem Ikanje unterliegen (vgl. das schon erwähnte Beispiel wr. raka [raka] vs. ru. reka [rʲɪka] ‚Fluss‘). In einem eigentlich auf die „halbpalatalisierten“ Varian-ten abzielenden Unterscheidungsexperiment wird von Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von /rʲ/ als „vollpalatalisiertes“ [rʲ] und /r/ seitens der weißrussischen Informanten nicht berichtet (SADOŬSKI 1982, 207–208). Da die meisten dieser Informanten auch halbpalatalisiertes (rʲ) von dem nicht-palatalisierten (r) unterscheiden, scheint die Unterscheidung [rʲ] vs. [r] keine Schwierigkeiten zu bereiten.
7.2 Methode
Zur akustisch-phonetischen Unterscheidung von [r] und [rʲ] 7.2.1
Vibranten bestehen aus einem wiederholten Öffnen und Schließen des Luft-stromkanals (LADEFOGED & MADDIESON 1996, 217). Die Artikulation von /r/ unterscheidet sich in beiden Standardsprachen und ihren Subvarietäten nicht. Die Zungenspitze wird zu den Alveolen angehoben, (eventuell auch zum harten Gaumen) und bildet eine Enge oder einen Verschluss, der sofort wie-der gelöst wird. Die Intensität des Lautes variiert dementsprechend, bei grö-ßerer Entfernung ist sie so stark wie die der umliegenden Vokale, bei der Annäherung an den Gaumen wird sie schwächer. Dieser Wechsel zwischen starker und schwacher Intensität wird als Vibrieren wahrgenommen.
Gemäß der dreistufigen Bildung lassen sich auch im Oszillogramm drei Phasen erkennen. Die erste Phase, die Annäherung der Zunge an den Gaumen, ist ein fließender Übergang vom vorhergehenden Vokal. In der relativ kurzen Phase, in der die Zunge den harten Gaumen berührt oder ihm nahe ist, entsteht ein Geräusch, das als [ʃ]-ähnlich beschrieben wird (AVANESOV 1956, 155; HALLE 1971, 148f.; FBLM 1989, 84), die Formanten sind in diesen Phasen nur schwach oder nicht zu erkennen (LADEFOGED & MADDIESON 1996, 218). Eine charakteristische Formantenstruktur hat der ca. 25 Millisekunden dauernde vokalische Teil zwischen zwei Vibrationen. Dieser vokalische Teil ähnelt in seiner Formantenstruktur dem neutralen Schwa-Vokal, ist allerdings beeinflusst vom lautlichen Kontext (HALLE 1971, 125).
267
Das palatalisierte [rʲ] des Russischen unterscheidet sich von [r] zum einen darin, dass der Zungenrücken zum Palatum angehoben wird, zum anderen bestehen auch Unterschiede im primären Artikulationsort. SKALOZUB (1963, 46–48) beobachtet einen postalveolaren Verschluss für [r] und einen dental-alveolaren für [rʲ]. Zudem habe [rʲ] oft nur einen Verschluss, während ein [r] drei bis vier habe, was schließen lässt, dass das Anheben der Zunge bei der Palatalisierung eine Schwierigkeit für die Vibration bedeute (vgl. auch LADEFOGED & MADDIESON 1996, 221–223). (Jedoch wird auch für das weiß-russische und russische [r] häufig nur eine Vibration beobachtet, vgl. AVANESOV 1956, 155; FBLM 1989, 51).
Was spektrale Unterschiede angeht, so unterscheidet sich [rʲ] zunächst wie generell palatalisierte Konsonanten von ihren nicht-palatalisierten Entspre-chungen in den Formantenübergängen im folgenden Vokal, mit [i]-ähnlichen Formanteneinstiegen nach palatalisierten Konsonanten (HALLE 1971, 137). Andererseits werden aber auch in dem Konsonanten selbst andere Formanten beobachtet als bei [r]. Unterschiede werden v.a. für den zweiten und dritten Formanten mit jeweils höheren Frequenzen für vordere Artikulationen be-merkt. [rʲ] hat einen F2 bei oder über 2000 Hz und einen F3 über 2500, wäh-rend das nicht-palatalisierte [r] einen F2 bei 1400 und einen schwachen F3 unter 2500 Hz aufweist (HALLE 1971, 150; BOLLA 1981, 99–100; LADEFOGED & MADDIESON 1996, 222).169
Vorgehen 7.2.2
Vibranten weisen also wie Vokale eine charakteristische Formantenstruktur auf, wobei für [rʲ] eine [i]-ähnliche Formantenstruktur beschrieben wird, für [r] eine [ə]-ähnliche. Eine ‚russische‘ Artikulation sollte sich also in einem höheren zweiten Formanten und eventuell in einem niedrigeren ersten For-manten ausdrücken. Für die folgende Analyse wurden daher die ersten beiden Formanten der Vibranten (rʲ) und (r) gemessen, jeweils in der Mitte der Dauer des Vibranten. (rʲ) umfasst Positionen, in denen im Russischen ein /rʲ/ vorliegt bzw. vorliegen würde. Der Vergleichswert (r) ist dagegen im eigentlichen
169 Für das Weißrussische werden andere Angaben für /r/ gemacht, nämlich ein F1 bei ca. 380
Hz, der F2 bei ca. 1000 Hz. Oft wird ein dritter Formant bei ca. 1500 Hz beobachtet (vgl. KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 86 sowie CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 89). Dies sind sicherlich messungsbedingte Unterschiede, die nicht als phonetische Unterschiede zwischen dem Russischen und dem Weißrussischen zu deuten sind.
268
Sinne keine Variable, es umfasst dementsprechend Positionen, in denen im Russischen /r/ vorliegen würde.
In aller Regel war für die Laute jeweils nur ein Verschluss (d.h. eine kurze Phase mit geringer Amplitude) erkennbar. In diesem Fall wurde diese Phase als das zu untersuchende Intervall herangezogen. In seltenen Fällen, in denen zwei Vibrationen erkennbar waren, wurde das Intervall vom Beginn der ersten Vibration bis zum Ende der zweiten Vibration als Intervall ge-nommen. Fälle, in denen der Vibrant entsonorisiert wurde, wurden nicht berücksichtigt. Berücksichtigt wurden nur Realisierungen, in denen eine klare Formantenstruktur erkennbar war. Wie für Vokale, wurden die Formanten in Praat mithilfe des LPC-Algorithmus von Burg in der Mitte des Intervalls des Vibranten bestimmt. Als Default wurden dieselben Einstellungen wie bei Vokalen vorgenommen, d.h. es wurden im Bereich bis 5000 Hz bei männli-chen Informanten, bis 5500 Hz bei weiblichen Informanten fünf Formanten ermittelt (was zehn zu ermittelnden Koeffizienten entspricht). Für eine Spre-cherin wurden elf Koeffizienten ermittelt. In Fällen, in denen die gefundenen Formanten nicht dem visuellen Eindruck entsprachen oder einzelne Ausreißer in der Formantenstruktur erschienen, wurde die Anzahl der zu ermittelnden Koeffizienten um einen, in seltenen Fällen um zwei erhöht. Die Länge des Analysefensters betrug 0,025 Sekunden. Frequenzen ab 50 Hz wurden für die Formantenanalyse verstärkt.
Der Frage, ob in WRGR eine Variation von [r] und [rʲ] für (rʲ) vorliegt, und einige Sprecher eher zu einer ‚russischen‘ Aussprache tendieren, andere zu einer ‚weißrussischen‘, lässt sich auf zwei Wegen nachgehen. Zunächst kann geprüft werden, ob sich für einen individuellen Sprecher die Formanten für (rʲ) von denen für (r) unterscheiden. Dies birgt allerdings die Gefahr in sich, Seiteneffekte des phonischen Kontextes zu verallgemeinern. Tabelle 73 zeigt, dass sich die in die Analyse einfließenden Phone deutlich unterschied-lich auf nachfolgende Vokalphoneme verteilen, wie dies aus den oben bereits angesprochenen Distributionsunterschieden der Phoneme /r/ und /rʲ/ im Russischen auch zu erwarten ist. Dies ist problematisch, da die Formantwerte von [r] nicht unabhängig von benachbarten Vokalen sind (s.o.).
Verteilung von (r) und (rʲ) nach nachfolgendem Kontext Tab. 73
/a/ /e/ /i/ /o/ /u/ Konsonant Auslaut gesamt (r) 420 0 69 360 100 116 35 1100 (rʲ) 51 343 349 20 30 7 15 815
269
Die zweite Möglichkeit ist, zu überprüfen, ob sich die Messwerte von (rʲ) zwischen den Generationen (und anderen sozialen Gruppierungen) unter-scheiden. Ähnlich wie bei Vokalen bedingt dies die Notwendigkeit, die Daten zu normalisieren. Um allgemeine anatomisch bedingte Unterschiede zwi-schen den Sprechern auszuschließen, wurde dieselbe Normalisierungsproze-dur wie für Vokale vorgenommen (vgl. Abschnitt 5.2.3). Von jedem For-mantwert wurde der Gesamtmittelwert dieses Formanten der Hauptallophone der betonten Vokale des entsprechenden Informanten subtrahiert und die Verteilung so auf Null zentriert. Anschließend wurde durch die Standard-abweichung der Mittelwerte der Hauptallophone der betonten Vokale divi-diert, und so die Streuung um diesen Mittelwert normalisiert.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Chocimsk in das Gebiet fällt, in dem dialektal /rʲ/ und /r/ unterschieden werden. In der Nähe von Akcjabrski finden sich einige Inseln, in denen dies ebenfalls der Fall ist (vgl. DABM 1963a, Karte 42).
7.3 Zur Unterschiedlichkeit von (r) und (rʲ) in WRGR
Die Tabellen 74 und 75 geben zunächst die Ergebnisse von t-Tests auf Unter-schiede zwischen den Formanten von (r) und (rʲ) pro Sprecher wieder. Dabei handelt es sich um einseitige t-Tests. Für einige Sprecher konnten nur wenig Token analysiert werden, so dass sie nicht in die sprecherbezogenen Analy-sen einfließen. Dies sind die Sprecher sa_M und sm_C. Für den ersten For-manten wurde geprüft, ob die Werte von (rʲ) niedriger sind als die von (r). Für den zweiten Formanten wurde geprüft, ob sie höher sind als die Werte von (r). Eingeschlossen wurden nur Realisierungen vor Vokal.
Unterschiede zwischen (r) und (rʲ) in F1 Tab. 74
Spr Gen. Geschlecht F1 (rʲ) F1 (r) t-Wert df p-Wert ak_B 0 w 415 (n=16) 438 (23) -0,81 25,98 0,2120 ak_P 1 m 502 (33) 536 (37) -2,18 62,09 0,0166 ak_M 1 w 487 (23) 516 (21) -0,89 40,55 0,1888 ak_Q 2 m 359 (11) 467 (14) -6,11 21,86 0,0000 ak_D 2 w 470 (17) 525 (16) -1,56 30,56 0,0646 ba_P 1 m 401 (39) 413 (66) -1,08 66,72 0,1418 ba_A 1 w 454 (42) 481 (74) -1,96 86,48 0,0264 ba_V 2 m 363 (19) 448 (41) -5,64 55,62 0,0000 ba_B 2 w 506 (17) 535 (55) -1,15 22,10 0,1309 ch_P 0 w 504 (33) 578 (23) -2,73 51,04 0,0044 ch_C 1 m 413 (35) 466 (27) -3,80 46,99 0,0002 ch_A 1 w 506 (21) 589 (22) -4,28 40,59 0,0001
270
ch_R 2 m 324 (20) 341 (21) -0,73 38,98 0,2355 ch_N 2 w 450 (15) 556 (35) -4,11 42,88 0,0001 mi_V 0 w 532 (19) 525 (22) 0,26 35,65 0,6017 mi_B 1 m 439 (24) 493 (22) -2,77 35,45 0,0044 mi_A 1 w 482 (21) 526 (22) -1,83 32,35 0,0381 mi_Y 2 m 384 (33) 430 (21) -3,66 49,29 0,0003 mi_F 2 w 469 (25) 551 (28) -4,39 48,72 0,0000 ra_D 0 m 426 (26) 456 (15) -1,65 21,46 0,0569 ra_B 0 w 471 (13) 492 (27) -0,62 30,06 0,2709 ra_S 1 m 379 (20) 409 (19) -2,50 36,83 0,0086 ra_L 1 w 481 (41) 505 (35) -1,39 73,74 0,0849 ra_C 2 m 367 (36) 430 (38) -2,34 49,57 0,0117 ra_A 2 w 470 (33) 527 (34) -3,26 63,09 0,0009 sa_T 1 m 502 (21) 487 (43) 0,98 48,73 0,8336 (sa_M) 1 w 638 (3) 619 (7) 0,33 4,40 0,6208 sa_I 2 w 462 (51) 474 (35) -0,50 77,82 0,3101 sa_N 2 w 525 (15) 548 (29) -1,07 31,84 0,1469 sm_B 1 m 447 (15) 431 (12) 0,47 24,12 0,6783 sm_A 1 w 600 (27) 620 (29) -0,59 53,05 0,2796 (sm_C) 1 w 604 (8) 582 (7) 0,38 11,19 0,6455 sm_AF 2 m 426 (18) 487 (36) -4,43 30,48 0,0001
Unterschiede zwischen (r) und (rʲ) in F2 Tab. 75
Spr Gen Geschlecht F2 (rʲ) F2 (r) t-Wert df p-Wert ak_B 0 w 1595 (n=16) 1427 (23) 2,20 27,71 0,0183 ak_P 1 m 1335 (33) 1187 (37) 4,18 66,94 0,0000 ak_M 1 w 1492 (23) 1370 (21) 2,33 40,50 0,0124 ak_Q 2 m 1494 (11) 1191 (14) 3,91 21,60 0,0004 ak_D 2 w 1889 (17) 1373 (16) 9,30 30,46 0,0000 ba_P 1 m 1304 (39) 1210 (66) 3,26 73,96 0,0009 ba_A 1 w 1608 (42) 1497 (74) 2,69 65,49 0,0045 ba_V 2 m 1536 (19) 1077 (41) 6,03 23,35 0,0000 ba_B 2 w 1401 (17) 1258 (55) 2,88 30,45 0,0036 ch_P 0 w 1996 (33) 1434 (23) 9,66 53,23 0,0000 ch_C 1 m 1508 (35) 1309 (27) 6,03 48,60 0,0000 ch_A 1 w 1794 (21) 1485 (22) 5,26 29,05 0,0000 ch_R 2 m 1695 (20) 1365 (21) 4,55 38,01 0,0000 ch_N 2 w 1919 (15) 1607 (35) 5,43 25,29 0,0000 mi_V 0 w 1635 (19) 1423 (22) 3,46 38,70 0,0007 mi_B 1 m 1349 (24) 1176 (22) 4,65 37,87 0,0000 mi_A 1 w 1562 (21) 1392 (22) 3,12 37,97 0,0017 mi_Y 2 m 1291 (33) 1157 (21) 2,70 45,01 0,0049 mi_F 2 w 1906 (25) 1378 (28) 7,81 49,15 0,0000 ra_D 0 m 1551 (26) 1347 (15) 4,23 25,45 0,0001 ra_B 0 w 1629 (13) 1419 (27) 2,71 19,02 0,0070 ra_S 1 m 1372 (20) 1272 (19) 3,02 36,49 0,0023 ra_L 1 w 1656 (41) 1394 (35) 5,02 73,92 0,0000 ra_C 2 m 1534 (36) 1279 (38) 6,26 71,09 0,0000
271
ra_A 2 w 1648 (33) 1486 (34) 3,52 57,10 0,0004 sa_T 1 m 1420 (21) 1335 (43) 1,49 50,09 0,0719 (sa_M) 1 w 1666 (3) 1618 (7) 0,65 7,02 0,2687 sa_I 2 w 1728 (51) 1595 (35) 3,65 84,00 0,0002 sa_N 2 w 1309 (15) 1342 (29) -0,50 35,25 0,6898 sm_B 1 m 1349 (15) 1220 (12) 2,31 24,36 0,0148 sm_A 1 w 1681 (27) 1495 (29) 3,59 48,40 0,0004 (sm_C) 1 w 1443 (8) 1493 (7) -0,49 12,43 0,6845 sm_AF 2 m 1416 (18) 1234 (36) 3,35 33,64 0,0010
Es zeigt sich, dass die zweiten Formanten von (r) und (rʲ) fast durchgehend unterschiedlich sind (bis auf die Sprecherin sa_N und die beiden Informanten mit geringer Tokenzahl). Was den ersten Formanten angeht, so ist das Bild differenzierter. Die Sprecher aus Chocimsk ausgenommen, für die ein dia-lektaler Hintergrund angenommen werden kann, weisen 15 von 26 Sprechern einen signifikanten oder marginal-signifikanten Unterschied auf. Wie Tabelle 76 zeigt, weist die Mehrzahl der (wenigen) Sprecher in Generation 0 keinen signifikanten Unterschied auf, während das Bild in Generation 1 aus-geglichen ist, und in Generation 2 Sprecher mit signifikantem Unterschied überwiegen. Zwei der drei Sprecher aus dieser jüngsten Generation, die kei-nen Unterschied aufweisen, stammen aus der Stadt Šarkoŭščyna.170
Sprecher mit signifikanten oder marginal signifikanten Unterschieden in (rʲ) und (r) Tab. 76
F1 (rʲ) < F1 (r): ja nein gesamt Generation 0 1 3 4 Generation 1 6 5 11 Generation 2 8 3 11 gesamt 15 11 26
Der Exakte Fisher-Test weist allerdings keine signifikanten Unterschiede zwischen den Generationen aus (p=0,320).
7.4 Zur Realisierung von (rʲ) in WRGR
Es sind also bei vielen der Sprecher Unterschiede zwischen (r) und (rʲ) fest-zustellen. Es bestehen jedoch individuell große Unterschiede, wie stark die Unterschiedlichkeit von (r) und (rʲ) ausfällt. Exemplarisch sei dies an drei
170 Diese beiden Sprecher zeichnen sich auch in anderen Bereichen durch stark ‚weißrussische‘
Phonetik aus, etwa durch dissimilatives Akanje und Jakanje. Zu solchen Zusammenhängen zwischen den Variablen, also den allgemeinen Tendenzen bei Sprechern kommen wir in Kapitel 10.
272
Informanten aus der Stadt Minsk verdeutlicht (vgl. auch die Abbildungen zu den übrigen Sprechern im Anhang).
Realisierungen von (r) (=○) und (rʲ) (=▲), mi_V (weiblich, Generation 0) Abb. 54
Realisierungen von (r) (=○) und (rʲ) (=▲), mi_A (weiblich, Generation 1) Abb. 55
u
a
i
3000 2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
○○
○○○○○
○○○○○○
○
○
○
○○○
○○○
3000 2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
▲
▲
▲▲
▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲
▲
▲▲
▲
3000 2500 2000 1500 1000 500
1000
800
600
400
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
i
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
○○
○○○○○
○ ○○○○
○
○ ○○○
○
○ ○○○
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
▲
▲▲▲▲
▲
▲
▲
▲▲▲▲
▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
2500 2000 1500 1000 500
900
800
700
600
500
400
300
200
F2 (Hz)
F1
(Hz)
273
Realisierungen von (r) (=○) und (rʲ) (=▲) , mi_F (weiblich, Generation 2) Abb. 56
Für alle Minsker Informanten sind die Werte des zweiten Formanten von (r) und (rʲ) signifikant unterschiedlich, für alle außer für die Vertreterin der Ge-neration 0 auch die Werte des ersten Formanten. Für keinen der Sprecher gibt es eine komplette Trennung der phonetischen Bereiche beider Variablen. Für einige Sprecher unterscheiden sich die phonetischen Bereiche dem Augen-schein nach stärker (z.B. mi_F) voneinander als für andere (z.B. mi_A). Be-sonders, was die Unterschiedlichkeit des zweiten Formanten angeht, bestehen große Unterschiede.
Analyse 1 – Mittelwerte: Die folgenden Abbildungen deuten an, dass ein Unterschied zwischen den Generationen vorliegt. Die Sprecher aus Chocimsk sind hier nicht abgebildet. Pro Sprecher wurden für (rʲ) durchschnittlich 26,0 Token ausgewertet (11–58, σ=10,9), für (r) durchschnittlich 36,1 Token (15–93, σ=19,1). Die Tabellen 134 und 135 im Anhang zeigen die Durch-schnittswerte pro Sprecher, sowie die Anzahl der in die Analyse eingegange-nen Token. Während, wie zu erwarten, die durchschnittlichen Realisierungen von (r) zwischen den Generationen konstant bleiben (Abb. 57), verschieben sich die Durchschnittswerte für (rʲ) für einige Vertreter der Generation 2 deutlich in Richtung /i/ (Abb. 58).
ui
a
2500 2000 1500 1000 500
100
080
06
004
002
00
○○
○○
○○○
○
○○○ ○○○○○
○
○○○
○○○○○○
○○
2500 2000 1500 1000 500
100
080
06
004
002
00
F2 (Hz)
F1
(Hz)
▲
▲▲
▲▲▲▲ ▲ ▲▲
▲▲ ▲▲
▲▲▲
▲▲
▲▲▲▲▲▲
2500 2000 1500 1000 500
100
080
06
004
002
00
F2 (Hz)
F1
(Hz)
274
Durchschnittliche Formantwerte für (r), ohne die Informanten aus Chocimsk Abb. 57
Durchschnittliche Formantwerte für (rʲ), ohne die Informanten aus Chocimsk Abb. 58
Dementsprechend ist der phonetische Abstand zwischen (rʲ) und (r) in Gene-ration 2 größer als in den anderen beiden Generationen. Die folgende Abbil-dung zeigt die euklidische Distanz zwischen dem normalisierten Mittelwert von (rʲ) und dem normalisierten Mittelwert von (r) (vgl. HARRINGTON 2010, 190–195).
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.52
1.5
10.
50
-0.5
-1-1
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●●●●●●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.52
1.5
10.
50
-0.5
-1-1
.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
●
●●●●●●●●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 2
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●
●●●●●
●
●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
● ●
●●
●●●●
●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 2
275
Euklidische Distanz von (rʲ) zu (r), ohne die Informanten aus Chocimsk Abb. 59
Vertreter der Generation 2 weisen einen deutlich größeren phonetischen Abstand zwischen (r) und (rʲ) auf als Vertreter der Generation 1, während zwischen den beiden älteren Generationen kein Unterschied besteht. Dies mag angesichts der bereits getroffenen Feststellung, dass in der jüngeren Generation mehr Sprecher sind, die überhaupt in einem statistischen Sinne zwischen beiden Variablen unterscheiden, nicht mehr überraschen. Interes-santer ist, dass auch unter den Sprechern, die zwischen beiden Variablen unterscheiden, Unterschiede zwischen den Generationen bestehen. Wiederum haben Vertreter der Generation 2 einen größeren Abstand als Vertreter der Generation 1. Da nur ein Vertreter der Generation 0 einen signifikanten Unterschied in F1 zwischen (r) und (rʲ) aufweist, wird Generation 0 in der Abbildung nicht berücksichtigt.
Euklidische Distanz von (rʲ) zu (r) bei Sprechern mit signifikant unterschiedlichem Abb. 60
F1, ohne die Informanten aus Chocimsk
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 0E
uklid
isch
e D
ista
nz z
u (r
)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 1
Euk
lidis
che
Dis
tanz
zu
(r)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 1
Euk
lidis
che
Dis
tanz
zu
(r)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Generation 2
276
Auch wenn auch Vertreter der Generation 1 zwischen (r) und (rʲ) unterschei-den, fällt die Unterschiedlichkeit bei Vertretern der Generation 2 also deutli-cher aus.
Analyse 2 – F1 und F2: In dem folgenden Mehrebenenmodell wird der Ein-fluss der Generation, der Affinität der Äußerung und weiterer Faktoren ge-prüft. Als erklärende Variablen werden folgende Parameter geprüft:
Erklärende Variablen (rʲ) Tab. 77
Erklärende Variable Werte Referenzwert Nachfolgender Kontext Ø (Auslaut)
/a/ /e/ /i/ /o/ /u/ unbetontes /a, e, o/ Konsonant
/a/
Vorangehender Kontext Ø (Anlaut) [a] [e] [i] [ɨ] [o/u] dental labial velar
[a]
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform
weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
Hierzu seien folgende Erläuterungen angebracht:
Wie bereits für (ʧʲ) ist beim nachfolgenden Kontext der Zusammen-hang mit der Variation im unbetonten Vokalismus zu beachten. Da die Realisierung von /a, e, o/ ebenfalls der kontaktbedingten Varia-tion unterliegt, werden /a/, /e/ und /o/ in unbetonten Silben als „un-betontes /a/, /e/ und /o/“ zusammengefasst.
277
Der vorangehende Kontext bezieht sich auf die phonetische Reali-sierung, wie sie im OK-WRGR transkribiert ist.
Da Sprecher aus Chocimsk ausgeschlossen werden, ist der dialektale Hintergrund nicht zu berücksichtigen.
Die abhängigen Variablen sind die normalisierten Formantwerte der Realisie-rungen von (rʲ). Sprecher aus Chocimsk werden aus der Analyse ausgeschlos-sen. Tabelle 78 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit den Zufallsfaktoren Familie (n=7) und Sprecher (n=28) und dem ersten Forman-ten als abhängiger Variable.
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von (rʲ), alle Äußerungen (n= 674). Tab. 78Zufallsfaktoren: Sprecher (n=28, σ=0,17), Familie (n=7, σ=0,07)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,80 0,15 5,31 0,0001 Kontext rechts Auslaut -0,23 0,22 -1,04 0,3174
/e/ -0,25 0,13 -1,91 0,0628 /i/ -0,38 0,13 -3,02 0,0026 /o/ -0,03 0,20 -0,16 0,8778 /u/ -0,73 0,18 -4,12 0,0002 unbetontes /a, e, o/ -0,21 0,14 -1,54 0,1330 Konsonant 0,03 0,34 0,10 0,8974 Kontext links Anlaut -0,34 0,11 -3,03 0,0020 [e] -0,58 0,11 -5,10 0,0001 [i] -0,79 0,12 -6,39 0,0001 [o/u] -0,62 0,16 -3,97 0,0001 [ɨ] -0,89 0,18 -4,96 0,0001 dental -0,69 0,08 -8,27 0,0001 labial -0,57 0,08 -7,47 0,0001 velar -0,67 0,14 -4,76 0,0001 Generation Generation 0 -0,08 0,13 -0,63 0,6162 Generation 2 -0,21 0,09 -2,31 0,0226 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,14 0,13 -1,07 0,2770
hybrid -0,02 0,07 -0,23 0,8596 russisch -0,13 0,08 -1,52 0,1362
Der Effekt des Kontextes ist deutlich: Vokale mit einem niedrigen ersten Formanten bewirken ebenfalls einen niedrigen ersten Formanten des Vibran-ten, ebenso vorangehende Konsonanten. Für die Variable Generation besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Generation 1 und Generation 2, letz-tere hat niedrigere Formantwerte. Das Geschlecht hat keinen Einfluss. Zwi-schen den Werten der Affinität der Äußerung sind keine signifikanten Unter-schiede zu erkennen. Die Koeffizienten gehen jedoch in die erwartete Rich-tung, mit einem niedrigeren F1 für ‚russische‘ Äußerungen. ‚Hybride‘ Äuße-
278
rungen liegen im Bereich ‚weißrussischer‘ Äußerungen. Insgesamt verbessert der Faktor das Modell signifikant (Log-Likelihood ohne Affinität der Äuße-rung: 647,93; mit Affinität der Äußerung: 636,90; χ2=22,07, df=3, p<0,0001).
Für den zweiten Formanten liefert das Modell folgende Ergebnisse:
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von (rʲ), alle Äußerungen (n= 674). Tab. 79Zufallsfaktoren: Sprecher (n=28, σ=0,17), Familie (n=7, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,17 0,09 -1,78 0,0930 Kontext rechts Auslaut 0,16 0,13 1,21 0,2334
/e/ 0,29 0,08 3,82 0,0001 /i/ 0,17 0,07 2,24 0,0256 /o/ -0,21 0,12 -1,82 0,0750 /u/ -0,30 0,10 -2,95 0,0032 unbetont 0,11 0,08 1,40 0,1542 Konsonant 0,32 0,20 1,64 0,1132 Kontext links Anlaut 0,06 0,07 0,94 0,3510 [e] 0,23 0,07 3,44 0,0008 [i] 0,31 0,07 4,27 0,0001 [o/u] -0,34 0,09 -3,79 0,0002 [ɨ] 0,43 0,10 4,15 0,0001 dental 0,10 0,05 2,17 0,0342 labial -0,15 0,04 -3,47 0,0004 velar 0,07 0,08 0,81 0,4122 Generation Generation 0 0,08 0,11 0,76 0,6554 Generation 2 0,25 0,08 3,17 0,0012 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,01 0,08 -0,08 0,9282
hybrid -0,03 0,04 -0,69 0,4798 russisch 0,09 0,05 1,92 0,0514
Abgesehen von den lautlichen Einflüssen, die auch hier plausibel sind, neigt also die Generation 2 zu einem höheren zweiten Formanten. In ‚russischen‘ Äußerungen hat (rʲ) ebenfalls tendenziell einen leicht höheren zweiten For-manten als in ‚weißrussischen‘.
Werden ‚gemeinsame‘ Äußerungen ausgeschlossen und die beiden älteren Generationen zusammengefasst, so ist für den ersten Formanten keine Inter-aktion zu verzeichnen, wohl aber für den zweiten. Die Log-Likelihood ohne die Interaktion beträgt 261,78, mit Interaktion 258,48 (χ2=6,61, df=2, p=0,0368). Abbildung 61 verdeutlicht diese Interaktion:
279
Interaktion von Land/Stadt und Affinität der Äußerung (w, h, r) für den zweiten Abb. 61
Formanten von (rʲ). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Es zeigt sich, dass in ‚weißrussischen‘ Äußerungen keine Unterschiede zwi-schen den Sprechergruppen bestehen. Während die älteren Generationen in allen Äußerungstypen bei einem niedrigen F2 bleiben, steigt der F2 für die Generation 2 in ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungstypen an.
Analyse 3 – F1 und F2 in ‚hybriden‘ Äußerungen: Wird die Analyse auf die ‚hybriden‘ Äußerungen beschränkt, so bleiben die Unterschiede zwischen den Generationen bestehen. Zwischen Wortformen unterschiedlicher Affini-tät bestehen in ‚hybriden‘ Äußerungen keine Unterschiede.171 (Der lautliche Kontext geht auch in diese Modelle mit ein, wird in den folgenden Tabellen aber nicht abgebildet):
Mehrebenenmodell für den normalisierten F1 von (rʲ), nur ‚hybride‘ Äußerungen Tab. 80(n=339). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=27, σ=0,13), Familie (n=7, σ=0,02)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,86 0,18 4,94 0,0002 Generation Generation 0 -0,14 0,11 -1,15 0,2625 Generation 2 -0,21 0,08 -2,11 0,0456
171 Der Unterschied zwischen ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Wortformen ist für den ersten
Formanten (t=-0,49, p=0,63) wie für den zweiten Formanten (t=0,78, p=0,44) fern jeder Signifikanz.
-0.6
-0.2
0.2
0.4
0.6
F2
w h r
LandStadt
280
Mehrebenenmodell für den normalisierten F2 von (rʲ), nur ‚hybride‘ Äußerungen Tab. 81(n=339). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=27, σ=0,10), Familie (n=7, σ=0,09)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,21 0,10 -2,02 0,0666 Generation Generation 0 0,01 0,09 -0,06 0,9208 Generation 2 0,21 0,06 3,18 0,0014
Realisierungen in ‚russischen‘ und in ‚weißrussischen‘ Wortformen unter-scheiden sich in ‚hybriden‘ Äußerungen nicht voneinander. Auch wenn Ge-neration 0 und 1 zusammengefasst werden und ‚gemeinsame‘ und ‚hybride‘ Wortformen ausgeschlossen werden, ist keine Interaktion erkennbar (χ2=0,00, df=1, p=0,98). Es gilt also für beide Altersgruppen, dass sich ‚weißrussische‘ und ‚russische‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen nicht unterschiedlich verhalten.
7.5 Zusammenfassung zur Variable (rʲ)
In diesem Kapitel ging es um die Variation von [rʲ] und [r] in WRGR in Positionen, in denen das Russische ein /rʲ/ und dementsprechend ein [rʲ] auf-weist. Das Weißrussische weist in diesen Positionen aufgrund des histori-schen Zusammenfalls der Phoneme /rʲ/ und /r/ ein nicht-palatalisiertes [r] auf. Die Variation von (stärker) palatalisierten und nicht-palatalisierten Realisie-rungen in den dieser Arbeit zugrunde liegenden Instanzen von WRGR wurde mithilfe von Formantmessungen untersucht.
Zunächst wurde für jeden Sprecher einzeln getestet, ob sich seine Realisierungen von (rʲ), also der Positionen, an denen im Russischen ein /rʲ/ steht, von den Realisierungen in den Positionen unterscheidet, an denen das Russische ein /r/ hat (Letztere Positionen wurden mit (r) abgekürzt, obwohl es sich dabei nicht im eigentlichen Sinne um eine Variable handelt). Es zeigte sich, dass mit einer Ausnahme für alle Sprecher Unterschiede im F2 be-stehen. Dies ist allerdings möglicherweise ein Seiteneffekt der ungleichen Distribution von (r) und (rʲ) auf lautliche Kontexte: (rʲ) tritt häufig vor /e/, also einem Vokal mit einem relativ hohen F2 auf, seltener vor /o/ und /u/. Für den ersten Formanten sah das Bild differenzierter aus. Abgesehen von Spre-chern, für deren Herkunftsdialekte dieselbe Opposition zwischen /r/ und /rʲ/ wie für das Russische charakteristisch ist, zeigte sich in der Generation 0 für die Mehrzahl der Sprecher kein Unterschied zwischen beiden Variablen. In Generation 1 war das Verhältnis ausgeglichen. In Generation 2 überwogen Sprecher mit einem signifikanten Unterschied.
281
In den Abbildungen der durchschnittlichen Realisierungen von (rʲ) zeigte sich, dass für einige Vertreter der Generation 2 eine palatalisierte, stärker mit dem Russischen übereinstimmende Realisierung vorliegt. Damit verbunden nahm für Vertreter der Generation 2 die phonetische Distanz zu den durch-schnittlichen Realisierungen von (r) zu. Dies galt auch dann, wenn nur Spre-cher berücksichtigt wurden, die einen signifikanten Unterschied zwischen (rʲ) und (r) im ersten Formanten aufwiesen. Wenn also ältere Sprecher zwischen beiden Variablen unterscheiden, so tun sie dies weniger stark als jüngere Sprecher.
Die Analyse der Einzelrealisierungen bestätigte im Großen und Ganzen die stärker palatalisierte Realisierung für Vertreter der Generation 2. Jedoch zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dem Faktor Land/Stadt und Affinität der Äußerung, die in der folgenden Abbildung noch einmal verdeutlicht wird. Abbildung 62 zeigt die vorhergesagten Werte für die zusammengefassten Generationen 0 und 1 und die Generation 2 in den einzelnen Äußerungstypen.
Vorhergesagte Werte für Formanten von (rʲ) vor /i/ in ‚weißrussischen‘, ‚hybriden‘ Abb. 62
und ‚russischen‘ Äußerungen für Vertreter der Generationen 0 und 1 (L, für Land) und Vertreter der Generation 2 (S, für Stadt), mit Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung. Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
In ‚weißrussischen‘ Äußerungen unterscheiden sich die Generationen nicht. Auch Vertreter der jüngeren Generation bleiben bei der ‚weißrussischen‘ Aussprache als [rʲ]. In ‚hybriden‘ und in ‚russischen‘ Äußerungen neigen Vertreter der jüngeren Generation zu einer etwas stärker palatalisierten Vari-ante, gehen also in Richtung des ‚russischen’ [r]. Die beiden älteren Genera-tionen bleiben auch in ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungen weitest-
282
gehend bei einer ‚weißrussischen‘ nicht-palatalisierten Realisierung. Es zeigte sich auch, dass innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen keine Unter-schiede zwischen ‚russischen‘ und ‚weißrussischen‘ Wortformen vorliegen.
Dass die älteren Generationen im Unterschied zu (ʧʲ) keine Tendenz zei-gen, phonisch zwischen den Äußerungstypen zu differenzieren, mag auf die eingangs besprochene, aus Sicht des Weißrussischen undurchsichtige Ver-teilung der russischen Phoneme /r/ und /rʲ/ zurückzuführen sein. Andererseits belegt wie eingangs erwähnt SADOŬSKI (1982 u.a.), dass bereits die Genera-tion der Land-Stadt-Migranten in ihrer russischen Rede /r/ und /rʲ/ tendenziell unterscheiden und einen beträchtlichen Anteil an palatalisierten Varianten realisieren. Der Unterschied zu seinen Sprechern ist wohl in dem Bestreben seiner Informanten, „korrektes Russisch“ zu sprechen, gegeben.
283
8 Variation von [ɣ] und [g] – die Variable (g)
8.1 Hintergrund
Das Weißrussische weist als etymologische Entsprechung zum russischen velaren Plosiv /g/ den stimmhaften velaren Frikativ /ɣ/ auf.172 Nur einige Lehnwörter im Weißrussischen enthalten einen stimmhaften Plosiv /g/. Die Isoglosse /g/ vs. /ɣ/ oder /ɦ/ ist eine der Hauptisoglossen innerhalb des Ost-slavischen. Wie das Weißrussische, so hat auch das Ukrainische einen Frika-tiv. Sie ist außerdem das Kriterium, anhand dessen die nord- und mittelrussi-schen Dialekte einerseits von den südrussischen andererseits geteilt werden, /ɣ/ ist konstitutives Merkmal der südrussischen Dialekte (RD 2005, 55–56). Auch in südrussischen regional gefärbten Varianten der russischen Umgangs-sprache finden sich frikative Realisierungen (vgl. BONDARKO 2000, 59; KASATKIN 2009b, 120). Die phonologischen Subsysteme der Velare beider Standardsprachen, die also beide eine phonologische Lücke bzw. nur margi-nal vertretene Position aufweisen, lassen sich wie folgt wiedergeben.
Velare Konsonantenphoneme im Standardweißrussischen und Standardrussischen Tab. 82
Weißrussisch Russisch stimmlos stimmhaft stimmlos stimmhaft Plosiv /k/ (/g/) /k/ /g/ Frikativ /x/ /ɣ/ /x/ --
Ob [kʲ] und [gʲ] bzw. [ɣʲ] als eigenständige Phoneme aufzufassen sind, ist strittig. Aufgrund verschiedener Palatalisierungsprozesse im Slavischen sind
172 Vgl. hierzu und zum Folgenden KARSKIJ 2006, 371–375; WEXLER 1977, 162–163;
KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 44; BIRYLA & ŠUBA 1985, 45; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 159f; FBLM 1989, 322; VYHONNAJA 1991, 203). Nach Karski (KARSKIJ 2006 [1908], 371) war der stimmhafte Velar in den ostslavischen Dialekten auf weißrussischem Gebiet bereits in vorschriftlicher Zeit frikativ. In späterer Zeit wird [g] in Lehnwörtern in Sprachdenkmälern mit <кг>, <к>, <гг>, <ґ>, <г> wiedergegeben. In der Latinica werden graphemisch <h> und <g> unterschieden (vgl. JANKOŬSKI 1974, 118f.). Außer als etymo-logische Entsprechung zu ru. /g/ findet sich /ɣ/ als prothetischer Konsonant in dem Demonstrativpronomen hėty ‚dieser‘ und einigen weiteren Lexemen.
284
diese vor anderen Vokalen als /i/ selten. Vor /i/ treten wiederum nur palatali-siertes [kʲ] und [gʲ] bzw. [ɣʲ] auf, so dass [kʲ] und [gʲ] bzw. [ɣʲ] in der Regel als Stellungsallophone von /k/ und /g/ bzw. /ɣ/ beschrieben werden, und damit die herrschende Palatalitätskorrelation unterbrochen wird. Anders-lautende Interpretationen begründen sich auf wenige Ausnahmen, wie z.B. ru. tkeš’ [tkʲɔʂ] ‚weben; 2.Sgl.Präs.‘, und auf einige Lehnwörter. Für die vor-liegende Untersuchung ist diese Frage unerheblich.
Wie die übrigen stimmhaften Obstruenten unterliegen /g/ und /ɣ/ der Aus-lautverhärtung und vor stimmlosen Konsonanten der Stimmtonassimilation, so dass im Weißrussischen [ɣ] mit [x] wechselt, im Russischen [g] mit [k]. Umgekehrt tritt nicht nur im Russischen, sondern auch im Weißrussischen [g] als Allophon von /k/ als Folge der Assimilation an folgende stimmhafte Obstruenten auf (va[g]zal /vokzal/ ‚Bahnhof‘, ė[g]zamen /ekzamʲen/ ‚Exa-men‘, vgl. FBLM 1989, 54, 180 und 326; VYHONNAJA 1991, 204; RAMZA 2011, 69f.).173
Die bereits angedeuteten Ausnahmen, in denen [g] im Weißrussischen nicht assimilatorisch bedingt ist, sind einige wenige, aus dem Polnischen oder über das Polnische und Litauische entlehnte Lexeme: agrėst ‚Stachelbeere‘, gaza ‚Petroleum‘, ganak ‚Freitreppe‘, guz ‚Beule‘, guzik ‚Knopf‘, gvalt ‚Lärm; Gewalt‘, garnec ‚Harnez‘, smaragd ‚Smaragd‘, švager ‚Schwager‘ u.a.m. Außerdem tritt [g] in wenigen Lexemen/Wortformen nach /z/ auf: mazgi ‚Verstand‘, rozgi ‚Rute‘ und einigen anderen. Aufgrund der geringen Anzahl an Vorkommen ist die mögliche Opposition /g/ vs. /ɣ/ funktional kaum ausgenutzt, als einziges (oder eines von wenigen) Minimalpaar findet sich gaze (Lok.Sgl. von gaza ‚Petroleum‘) vs. haze (Lok.Sgl. von haz ‚Gas‘). Das nicht positionell bedingte, entlehnte [g] variiert im Weißrussischen sowohl synchron als auch diachron mit [ɣ]. In einer Reihe von Lexemen, in denen die Norm heute [ɣ] postuliert, war früher [g] die Regel (z.B. in haz ‚Gas‘, hazeta ‚Zeitung‘, harnizon ‚Garnison‘, hranica ‚Grenze‘, hrošy ‚Geld‘, heroj ‚Held‘, intėlihencyja ‚Intelligenz‘). Zudem werde auch in den oben angeführten Beispielen, in denen heute noch [g] normhaft ist, oft [ɣ] gesprochen (SADOŬSKI 1983, 136; KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 101;
173 Dass diese Regel wiederum die Spirantisierung füttern kann, wird durch einige Beispiele
bei SADOŬSKI (1983, 131) belegt: Er beobachtet in Lexemen wie ėkzamen ‚Examen‘, ėkzemplar ‚Exemplar‘ und vakzal ‚Bahnhof‘ auch frikative Realisierungen des velaren Elements. Im OK-WRGR liegt nur ein Beispiel vor, in dem eine Umdeutung von /k/ zu (g) mit anschließender Spirantisierung anzunehmen ist, und zwar ihzaminy, Nom.Pl. zu ru./wr. ėkzamen.
285
FBLM 1989, 322; RAMZA 2011, 67). VYHONNAJA (1991, 205) schließt, dass das plosive [g] insgesamt aus dem Sprachgebrauch verschwinde, allenfalls als stilistisch markierte Variante gebraucht werde.
Was die Frikativität des Phonems angeht, so bestehen in weißrussischen Dialekten keine Unterschiede, allerdings sind Unterschiede im Artikulations-ort vorhanden. Bei einigen Sprechern des Weißrussischen wird ein „pharyn-galer Laut“ beobachtet, der durch eine Annäherung der hinteren Zunge an die Rückseite des Pharynx gebildet werde (NPBD 1964, 134f.).174 Die Verbrei-tung dieser Erscheinung in der Literatursprache und in weißrussischen Dia-lekten gilt als schlecht erforscht (KRYVICKI & PADLUŽNY 1984, 87; BIRYLA
& ŠUBA 1985, 45; CZEKMAN & SMUŁKOWA 1988, 116–118; FBLM 1989, 55). Nach den Autoren der FBLM (1989, 55) tritt die „pharyngale“ Realisie-rung v.a. vor [a] auf und ist häufiger bei Sprechern südlicher Dialekte. VYHONNAJA (1991, 203) schreibt dies dem Einfluss des Polessischen zu. Der nicht-velare Laut wird nicht als Abweichung von der Norm, sondern als normhafte freie Variante eingestuft (BIRYLA & ŠUBA 1985, 45). Beide Vari-anten sind in der Wahrnehmung schwer zu unterscheiden.
Ähnlich zur Situation im Weißrussischen, wo [g] als Stellungsvariante von /k/ möglich ist, ist im Russischen [ɣ] als Variante von /x/ vor stimm-haften Obstruenten möglich. Abgesehen davon ist dem Standardrussischen [ɣ] fremd, mit Ausnahme einiger Lexeme wie blago ‚Wohl‘, bogatyj ‚reich‘, in denen es stilistisch als kirchlich-sakral markierte freie Variante zu [g] möglich ist. In Bog [bɔx] ‚Gott‘ alterniert [x] im Auslaut des Nominativ Singular mit [g] in den obliquen Kasus (boga [bɔgə] ‚Gott; Gen.Sgl.‘). In einigen Interjektionen wie aga, ogo liegen Frikative vor, die entweder als „pharyngales [h]“ (AVANESOV 1956, 144f.) oder als velares [ɣ] (RD 2005, 56) beschrieben werden. Als lexikalisierte Folge von Dissimilation tritt frika-tives [x] als Entsprechung zu etymologischem |g| bzw. graphematischem <g> in den Lexemen legkij [lʲɔxkʲij] ‚leicht‘ und mjagkij [mʲaxkʲij] ‚weich‘ auf. Umgangssprachlich fällt /g/ vor Konsonant in einigen Lexemen häufig aus, z.B. in togda ‚dann‘ oder vsegda ‚immer‘ (vgl. FSR 1988, 240–245). Aller-
174 Ob dieser Laut stimmhaft oder stimmlos ist, wird nicht gesagt. Wiedergegeben wird er in
belorussistischen Arbeiten zumeist durch das lateinische <h>, der velare Frikativ mit <ɣ>. Ob die Beschreibung als pharyngal tatsächlich zutrifft, darf bezweifelt werden. Pharyngale Frikative sind höchst selten (MADDIESON 2005), auch die „klassischen“ Pharyngale im Arabischen und Hebräischen werden von LADEFOGED & MADDIESON (1996, 37; 167–170) als „epiglottal“ beschrieben. Innerhalb Europas werden pharyngale Frikative i.d.R. nur für Kaukasische Sprachen angenommen (vgl. TERNES 1998, 145; STOLTZ, URDZE & OTSUKA 2011, 102f.).
286
dings ist /ɣ/ wie eingangs erwähnt in südrussischen Dialekten (die geogra-phisch an Belarus anschließen) die reguläre Entsprechung zu standardsprach-lichem /g/ und in südrussischen Varianten der Standardsprache eine häufige Erscheinung. BONDARKO (2000, 59) gibt die Frequenz des Frikativs im regionalen Standard im Südrussischen mit 70–80% an (vgl. auch die entspre-chenden Kapitel im IZS 1987).
Für das Weißrussische wird zuweilen die Nicht-Realisierung bzw. der Ausfall von intervokalischem /ɣ/ beobachtet (VYHONNAJA 1991, 191), was sicherlich als normale Lenitionserscheinung betrachtet werden kann. Anders liegt der Fall eventuell bei der Variation des Demonstrativpronomens hėty/ėty ‚dieser‘ und Lexemen mit der gleichen Wurzel, die RAMZA (2011, 70–73) für Sprecher des weißrussischen Standards beobachtet. Der Frikativ ist hier his-torisch eine Prothese. Nicht-prothetisierte Formen finden sich als Varianten auch in weißrussischen Dialekten (vgl. DABM 1963b, 440–457), so dass auch angenommen werden kann, dass hier eine lexikalische Variation zwi-schen prothetisierten und nicht-prothetisierten Formen erfolgt. Historisch sind auch die weißrussischen Formen tady ‚dann‘ und dze ‚wo‘ auf die Elision des velaren Elements zurückzuführen.
Der Unterschied zwischen dem russischen [g] und dem weißrussischen [ɣ] wird sowohl als perzeptiv gut wahrnehmbar als auch als produktiv leicht erlernbar eingestuft, dies aufgrund der Tatsache, dass [g] wie gesagt in eini-gen Lehnwörtern des Weißrussischen vorkommt und dass im Weißrussischen das stimmlose Korrelat zu [g] Phonemstatus hat. Zudem seien sich die Spre-cher der Zugehörigkeit der einen Variante zur russischen Sprache, der ande-ren zur weißrussischen bewusst (SADOŬSKI 1982, 210). Dennoch ist [ɣ] anstelle von ru. /g/ eine häufige Interferenzerscheinung im Russischen in Belarus (BULACHOV 1973, 104; IZS 1987, 83; KILEVAJA 1989, 9). In der russischen Rede der bei SADOŬSKI (1982) untersuchten Land-Stadt-Migran-ten kommen drei Varianten vor: [g], [ɣ] und [h].175 Das plosive [g] ist mit 14% insgesamt um einiges seltener als [ɣ] mit 79%, [h] wird in 7% der Fälle realisiert (SADOŬSKI & ŠČUKIN 1977, 118). Die Realisierung ist dabei indivi-duell stark unterschiedlich, auf die einzelnen Sprecher bezogen teilt die Vari-able (g) Sadoŭskis Migranten in drei Gruppen: Von 40 Informanten bevorzu-gen 21 in ihrer russischen Rede deutlich die frikativen Varianten [ɣ], 14 bevorzugen [g], die übrigen fünf benutzen beide Varianten gleichermaßen
175 Im Folgenden wird „h“ für den in den belorussistischen Arbeiten als pharyngal bezeichne-
ten Laut benutzt.
287
oft. Es deutet sich in dieser Beschreibung also die bekannte S-Kurve sprach-lichen Wandels an (vgl. LEOPOLD 2008).
PEN’KOVSKIJ (1967), der das Erlernen der russischen Standardsprache bei Sprechern des Weißrussischen, Ukrainischen und von südrussischen Dialek-ten untersucht, nimmt an, dass phonische Aspekte eine Rolle spielen: [g] käme beim Erlernen des Russischen häufiger bzw. früher nach Vokalen vor Konsonanten, und häufiger in der ersten und betonten Silbe vor hohen Vokalen. Intervokalisch halte sich [ɣ] länger. SADOŬSKI (1982, 210f.) findet einen solchen Zusammenhang in seinen Daten jedoch nicht.
Es finden sich Indizien, dass (g) in der russischen Rede von Weißrussen als Marker fungiert, also die quantitativen Verhältnisse in verschiedenen Sprechstilen unterschiedlich ausfallen. In Sadoŭskis Daten ist in der Lese-aufgabe [g] häufiger als [ɣ] (um 25 Prozentpunkte), die Wahl hängt also von Register und der Aufmerksamkeit ab (SADOŬSKI 1982, 210). LISKOVEC (2005, 135) berichtet umgekehrt von Fällen, in denen junge Frauen eine frikative Realisierung wählen, um maskulin zu klingen.
8.2 Zur Realisierung von (g) in WRGR
Anders als bei den anderen Variablen handelt es sich bei (g) um eine auch phonetisch sinnvoll als kategorial aufzufassende Variable. Diese wird hier zudem als binär aufgefasst mit den Werten plosiv und frikativ.176 Der Unter-schied zwischen Plosiv und Frikativ ist auditiv gut feststellbar, so dass sich auf die Transkripte im OK-WRGR gestützt werden kann. Variation innerhalb der Frikative zwischen einem velaren und einem pharyngalen/glottalen Arti-kulationsort, wie sie für das Weißrussische bzw. seine Dialekte angenommen wird, sind in den Transkriptionen nicht wiedergegeben und ohne auditiv-phonetische Ausbildung sicherlich nicht zuverlässig feststellbar. Das Zeichen h in den Transkripten steht also sowohl für velares [ɣ] als auch für weitere frikative Realisierungen. Aufgrund der Qualität der Aufnahmen, die wie beschrieben in authentischen Gesprächssituationen und dementsprechend nicht unter Laborbedingungen stattgefunden haben, sind solche Unterschiede in den Aufnahmen auch instrumental nicht feststellbar. Im Folgenden wird verallgemeinernd „[ɣ]“ geschrieben, wenn es um frikative Realisierungen geht, „[g]“, wenn es um plosive Realisierungen geht.
176 Natürlich ist dies eine Vereinfachung. In der Realität kann der Übergang zwischen [g] und
[ɣ] sicherlich auch graduell sein, z.B. affrikativ.
288
Analyse 1 – Gesamtverhältnisse und sprecherbezogene Häufigkeiten: Aus Gründen der Einheitlichkeit beschränkt sich die Analyse auf die in Ab-schnitt 4.2.4 begründete Auswahl an Informanten sowie die Sprecherin ba_O, als Vertreterin der Generation 0 in Baranavičy, die in den akustischen Analy-sen nicht ausgewertet werden konnte. Ausgeschlossen werden Realisierungen in Endungen, was konkret heißt, dass die adjektivische ‚weißrussische‘ Endung {-oɣo} ausgeschlossen wird. Die Entsprechung im Russischen ist „nicht lautgesetzlich“ {-ovo}. [g] liegt in dieser Endung nur ein einziges Mal vor, 666 Mal dagegen [ɣ]. Ausgeschlossen werden außerdem Interjektionen wie aha, oho, ha, in denen auch das Russische frikative Realisierungen hat, sowie legkij, mjagkij usw. und das Demonstrativpronomen wr. hėty.
Einen ersten Eindruck zur Variation von [g] und [ɣ] in Wortstämmen bei den untersuchten 34 Sprechern vermittelt die Tabelle 83. Wie auch HENTSCHEL & ZELLER (2014) für das Gesamtkorpus zeigen, bilden plosive Realisierungen also nur einen geringen Bruchteil der möglichen Realisierun-gen, insgesamt ist die weißrussische Variante bedeutend stärker vertreten. Wenn also überhaupt Tendenzen in der Variation ausgemacht werden kön-nen, dann müssen sie sehr gering ausfallen. Insgesamt ist über die Generatio-nen ein Anstieg zu verzeichnen. Deutlich ist der Anstieg zwischen Genera-tion 1 und Generation 2:
Plosive und frikative Realisierungen von (g) in den drei Generationen Tab. 83
Generation plosiv frikativ Gesamt Anteil plosiver Realisierungen 0 6 409 415 1,4% 1 85 3290 3375 2,5% 2 231 1757 1988 11,6% gesamt 322 5456 5778 5,6%
Betrachtet man die relativen Häufigkeiten von plosiven Realisierungen der individuellen Sprecher (Abb. 63), so fallen deutliche Unterschiede zwischen den Sprechern auf. Pro Sprecher wurden durchschnittlich 226,5 Token ausge-wertet (16–989, σ=213,0). Tabelle 136 im Anhang zeigt die relativen Häufig-keiten pro Sprecher, sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.
289
Relative Häufigkeit von plosiven Realisierungen von (g) der einzelnen Sprecher Abb. 63
Die allermeisten Sprecher weisen kaum plosive Realisierungen auf, lediglich in Generation 2 finden sich einige Sprecher mit nennenswertem Anteil. Je-doch weisen auch in Generation 2 einige Sprecher überhaupt keine plosiven Realisierungen auf. Der beobachtete leichte Anstieg von plosiven Realisie-rungen in der jüngsten Generation ist also auf einige wenige Sprecher zu-rückzuführen. Wie bei SADOŬSKI (1982), so deutet sich auch hier eine S-Kurve an.
Analyse 2 – Lexikalische Besonderheiten: Zunächst sei ein Blick darauf geworfen, ob es einzelne Lexeme sind, die für das Auftreten von [g] verant-wortlich sind. Nur 18 der insgesamt 47 Lemmata, die mit 20 oder mehr Token vertreten sind, haben mehr als 5% plosive Realisierungen.177
Realisierung von (g) in Lemmata mit 20 oder mehr Token Tab. 84
Lemma plosiv frikativ Gesamt plosiv (%) ru. gorod/wr. horad ‚Stadt‘ 3 54 57 5,26 mnogo/mnoha ‚viel‘ 8 140 148 5,41 dorogoj/darahi ‚lieb; teuer‘ 2 26 28 7,14 gostʼ/hoscʼ ‚Gast‘ 3 34 37 8,11 drugoj/druhi ‚andere(r)‘ 3 28 31 9,68 denʼgi/Ø ‚Geld‘ 7 65 72 9,72 guljatʼ/huljacʼ ‚spazieren‘ 2 18 20 10,00 gotovitʼ/Ø ‚kochen‘ 4 32 36 11,11
177 Die Zuordnung zu Lemmata im OK-WRGR bezieht sich auf die Affinität des Stammes.
Wortformen der Lexeme wr. horad / ru. gorod ‚Stadt‘ haben einen ‚gemeinsamen‘ Stamm, sind daher einem russischen und einem weißrussischen Lemma zugeordnet. Realisierungen des Lexems denʼgi ‚Geld‘ haben dagegen einen ‚russischen‘ Stamm und sind daher keinem wr. Lemma zuzuordnen. „Lemma“ bezeichnet hier also die Kombination aus weißrussi-schem und russischem Lemma.
020
4060
Generation 0A
ntei
l [g]
(%
)
020
4060
Generation 1
020
4060
Generation 2
290
razgovarivatʼ/Ø ‚sich unterhalten‘ 3 24 27 11,11 fotografija/fatahrafija ‚Fotografie‘ 3 23 26 11,54 magazin/mahazin ‚Geschäft‘ 9 63 72 12,50 gljadetʼ/Ø ‚schauen‘ 3 18 21 14,29 kogda/Ø ‚als; wann‘ 10 57 67 14,93 govoritʼ/Ø ‚reden‘ 3 17 20 15,00 drug druga/Ø ‚einander‘ 5 17 22 22,73 gde/Ø ‚wo‘ 16 49 65 24,62 vsegda/Ø ‚immer‘ 12 36 48 25,00 figa/fiha (s.u.) 22 3 25 88,00
Deutlich fällt das Lexem figa (wörtlich: ‚Feige‘) auf, dass als Element der kolloquialen Ausdrücke ni figa (sebe) ≈ ‚nicht die Bohne‘, fig jego znaet ≈ ‚weiß der Teufel‘ u.ä. auftritt.
Unter den Wortformen mit mehr als fünf Token haben weitere folgende neun mehr als 20% Realisierungen mit [g]. Für die beiden mit dem mit Abstand höchsten Anteil an [g]-Realisierungen (gips und švager) ist auch im Standardweißrussischen [g] normhaft. Diese Lexeme werden nicht ausge-schlossen, da das Faktum, dass im Weißrussischen [g] normhaft ist, als erklä-rende Variable geprüft wird.
Weitere Lemmata mit fünf oder mehr Token und mehr als 20% plosiven Realisierun-Tab. 85gen von (g)
Lemma plosiv frikativ Gesamt plosiv (%) gde-to/Ø ‚irgendwo‘ 4 13 17 23,53 bežatʼ/behčy ‚laufen‘ 2 5 7 28,57 gora/hara ‚Berg‘ 2 5 7 28,57 kategorija/Ø ‚Kategorie‘ 2 5 7 28,57 gotovitʼsja/Ø ‚sich vorbereiten‘ 3 6 9 33,33 priglasitʼ/Ø ‚einladen‘ 2 4 6 33,33 ogonʼ/ahonʼ ‚Feuer‘ 4 6 10 40,00 gips/gips ‚Gips‘ 7 1 8 87,50 Ø/švager ‚Schwager‘ 8 1 9 88,89
Diese 27 Lemmata aus den Tabellen 84 und 85 (von insgesamt 150 mit mehr als fünf Token) machen mit 149 [g]-Realisierungen knapp die Hälfte der 333 [g]-Realisierungen aus. Abbildung 64 zeigt, dass die allermeisten Lemmata keine oder kaum plosive Realisierungen aufweisen.
291
Häufigkeit von Lexemen (mit mehr als fünf Token) mit unterschiedlichen Anteilen Abb. 64
an plosivem [g]
Es ist also durchaus davon auszugehen, dass die Variation von [g] und [ɣ] auch lexikalisch gesteuert ist.
Analyse 3 – Mehrebenenmodell: Im Folgenden wird geprüft, welche Faktoren einen Einfluss auf die Realisierung als Frikativ oder als Plosiv haben. Fol-gende erklärende Faktoren werden berücksichtigt:
Erklärende Variablen für die Variable (g) Tab. 86
Erklärende Variable Werte Referenzwert Palatalisiertheit des Velaren ja
nein nein
Artikulationsart des vorher-gehenden / des folgenden Konsonanten
Anlaut bzw. Auslaut Frikativ Plosiv Liquid Nasal Vokal
Anlaut bzw. Auslaut
Worthäufigkeit (logarith-miert)
stetig --
[g] im Weißrussischen ja nein
nein
[g] als veraltete Variante im Weißrussischen
ja nein
nein
Anteil von [g]
Häu
figk
eit
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
020
4060
8010
012
0
292
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform
weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
Hierzu seien folgende Erläuterungen angebracht:
Die Variable [g] im Weißrussischen gibt an, ob es sich um ein Lexem handelt, für das auch die weißrussische Norm eine plosive Realisierung zulässt (vgl. SBM 1987). Im vorliegenden Material sind dies allerdings nur die Lexeme gips ‚Gips‘ (n=8) und gipsa-karton ‚Gipskarton‘ (1), cėgla ‚Ziegel‘ (2), mazgi ‚Verstand‘ (4) und švager ‚Schwager‘ (9).
In einigen anderen Lexemen ist [g] wie gesagt als stilistisch markierte Alternative zugelassen bzw. wurde in älteren Normen des Weißrussi-schen zugelassen (z.B. in haz, hazeta, hrošy, hranica). Dies wird in einer weiteren Variablen festgehalten.
Auf die Berücksichtigung des Artikulationsortes wird verzichtet, da dies für die Varianten Anlaut und Auslaut zum kompletten Zusam-menfall mit den entsprechenden Varianten bei der Artikulationsart führen würde.
Dialektale Unterschiede im Weißrussischen, die es abzuklären gelte, bestehen wie gesagt nicht, da nicht auf im Artikulationsort unter-schiedliche Frikative eingegangen wird.
Ausgeschlossen aus der Analyse wird das Lexem figa, das sich stark von anderen Lexemen unterscheidet, wie die lexikalische Voranalyse gezeigt hat. Ausgeschlossen werden auch die Interjektionen wie aha, oho, das Lexem hėty und Lexeme gleichen Stamms sowie alle Vorkommen in Endungen. Dies betrifft wie gesagt nur die weißrussische adjektivische Endung {-oɣo}.
Tabelle 87 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit Sprecher (n=34) und Familie (n=8) als Zufallsfaktoren. Anders als bei den übrigen Analysen handelt es sich hier bei der abhängigen Variable um eine binäre Variable mit den Werten [g] und [ɣ] bzw. plosiv und frikativ. Wie bei einer einfachen logistischen Regression entsprechen die Koeffizienten im Modell
293
unten also Veränderungen in den Logits (vgl. BAAYEN 2008).178 Der Referenzwert der abhängigen Variable ist frikativ, positive Koeffizienten bedeuten also, dass der entsprechende Faktor die Wahrscheinlichkeit einer plosiven Realisierung erhöht.
Mehrebenenmodell zur Realisierung von (g), alle Äußerungen (n=5721). Tab. 87Zufallsfaktoren: Sprecher (n=34, σ=1,28), Familie (n=8, σ=2,39)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -5,75 1,16 -4,95 0,0000 Vorangehender Kontext Frikativ 0,24 0,46 0,52 0,6018 Liquid -0,54 0,47 -1,16 0,2452 Nasal 1,48 0,44 3,34 0,0008 Plosiv -0,04 1,17 -0,03 0,9728 Vokal -0,11 0,16 -0,71 0,4756 Nachfolgender Kontext Frikativ -12,80 833,05 -0,02 0,9877
Liquid -0,32 0,46 -0,69 0,4888 Nasal -0,02 0,70 -0,03 0,9795 Plosiv 1,08 0,48 2,28 0,0227
Vokal -0,12 0,43 -0,29 0,7725 Worthäufigkeit -0,22 0,04 -6,02 0,0000 [g] im Wr. ja 3,44 0,57 5,99 0,0000 Generation Generation 0 0,13 1,15 0,11 0,9107 Generation 2 1,15 0,61 1,90 0,0576 Geschlecht weiblich 1,28 0,62 2,07 0,0389 Affinität der Äußerung gemeinsam 1,15 0,36 3,17 0,0015 hybrid 0,41 0,27 1,52 0,1285 russisch 1,45 0,28 5,23 0,0000
Was den lautlichen Kontext angeht, so zeigen sich nur geringe Unterschiede. Nach Nasalen und vor Plosiven ist die Wahrscheinlichkeit einer plosiven Realisierung höher. Lexeme, in denen auch die weißrussische Norm [g] zu-lässt, haben auch in WRGR eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit [g] realisiert zu werden. Plosive sind wahrscheinlicher in weniger frequenten Lemmata. Vertreter der Generation 2 haben eine marginal höhere Wahrscheinlichkeit einer plosiven Realisierung.179 Zwischen den beiden älteren Generationen besteht kein Unterschied. Für weibliche Sprecher ist eine plosive Realisie-rung wahrscheinlicher als für männliche. Schließlich erweist sich die Affini-
178 Die in den Tabellen dargestellten Koeffizienten stellen die geschätzten Veränderungen in den
Logits, d.h. dem Logarithmus der „Odds“ dar, im Vergleich zu dem Logit, wenn alle Faktoren ihren Referenzwert einnehmen. Die Odds eines Ereignisses sind die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses p dividiert durch die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses (1–p).
179 Wird das Lexem figa nicht ausgeschlossen, ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwi-schen Generation 1 und 2 (Koeff.=1,32; Standardfehler=0,57; t=2,31; p=0,0211).
294
tät der Äußerung als signifikant: ‚Gemeinsame‘ und ‚russische‘ Äußerungen begünstigen eine plosive Realisierung im Vergleich zu ‚weißrussischen‘ Äußerungen. ‚Hybride‘ Äußerungen liegen dazwischen.
Werden die in ländlichen Gebieten sprachlich sozialisierten Generationen 0 und 1 zusammengefasst und ‚gemeinsame‘ Äußerungen ausgeschlossen, so ergibt sich eine signifikante Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung. Die Log-Likelihood eines Modells ohne Interaktion ist -716,79, die des Modells mit Interaktion beträgt -713,41 (χ2=6,76; df=2; p=0,0341). Abbildung 65 verdeutlicht diese Interaktion anhand der vorher-gesagten Wahrscheinlichkeiten für männliche und weibliche Informanten:
Interaktion von Land/Stadt und Affinität der Äußerung (‚weißrussisch‘, ‚hybrid‘, Abb. 65
‚russisch‘) für die Realisierung von (g). Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten für plo-sives (g) von männlichen und weiblichen Informanten unterschiedlicher Generatio-nen (0 und 1 = Land vs. 2 = Stadt) in unterschiedlichen Äußerungstypen. Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Eine höhere Frequenz ‚russischer‘ plosiver Realisierungen bei jüngeren Spre-chern ist also fast ausschließlich nur in ‚russischen‘ Äußerungen zu finden, was sich vor allem bei weiblichen Sprechern bemerkbar macht. Auch jüngere Sprecher bleiben in ‚weißrussischen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen bei der ‚weißrussischen‘ frikativen Realisierung.
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
weiblich
w h
r
LandStadt
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
männlich
w h
r
LandStadt
295
Analyse 4 – Mehrebenenmodell ‚hybride‘ Äußerungen: Beschränken wir uns nun auf die gut 3000 Token in ‚hybriden‘ Äußerungen, so ergibt sich folgen-des Bild:
Mehrebenenmodell zur Realisierung von (g), nur ‚hybride‘ Äußerungen (n=3025). Tab. 88Zufallsfaktoren: Sprecher (n=34, σ=1,42), Familie (n=8, σ=2,33)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -7,19 1,58 -4,56 0,0000 Vorangehender Kontext Frikativ 0,18 0,79 0,23 0,8220 Liquid -0,70 0,86 -0,81 0,4162 Nasal 1,36 0,72 1,90 0,0581 Plosiv -13,36 1661,72 -0,01 0,9936 Vokal -0,18 0,27 -0,65 0,5151 Nachfolgender Kontext Frikativ -11,86 1891,35 -0,01 0,9950
Liquid 0,91 1,09 0,83 0,4044 Nasal 1,13 1,49 0,76 0,4482 Plosiv 2,99 1,13 2,65 0,0081
Vokal 1,17 1,05 1,12 0,2623 Worthäufigkeit -0,23 0,06 -3,58 0,0003 [g] im Wr. ja 5,09 0,87 5,86 0,0000 Geschlecht weiblich 1,29 0,74 1,74 0,0826 Affinität der Wortform gemeinsam 1,27 0,43 2,98 0,0029 hybrid -0,32 1,11 -0,29 0,7714 russisch 1,42 0,45 3,14 0,0017
In ‚hybriden‘ Äußerungen besteht also noch eine marginal signifikante Ten-denz für das weibliche Geschlecht, häufiger plosive Realisierungen aufzu-weisen. Zwischen den Generationen besteht kein Unterschied.180 Die Affini-tät der Wortform hat einen Einfluss: ‚Gemeinsame‘ und ‚russische‘ Wort-formen weisen mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Plosiv auf. Faktisch sind dies jedoch minimale Unterschiede, wie die folgende Abbildung zeigt:
180 Der Koeffizient für Generation 2 wäre 1,02 (Standardfehler=0,69; t=1,48; p=0,14).
296
Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten von plosivem (g) in ‚hybriden‘ Äußerungen in Abb. 66
Wortformen unterschiedlicher Affinität bei weiblichen Informanten. Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
In ‚hybriden‘ Äußerungen bleibt die Wahrscheinlichkeit einer plosiven ‚rus-sischen‘ Realisierung selbst bei weiblichen Informanten in ‚gemeinsamen‘ und ‚russischen‘ Wortformen weit unter einem Prozent. Faktisch ist der Unterschied zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität also zu ver-nachlässigen: Die Aussprache bleibt konstant ‚weißrussisch‘.181
8.3 Zusammenfassung zur Variable (g)
In diesem Kapitel wurde die Variation von ‚weißrussischem‘ [ɣ] (positions-bedingt [x]) und ‚russischem‘ [g] (positionsbedingt [k]) untersucht. Die Vari-ation wurde als binär aufgefasst, es wurde also geprüft, wie häufig frikative ‚weißrussische‘ und wie häufig plosive ‚russische‘ Realisierungen sind und welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit der Realisierung eines Plosivs bzw. eines Frikativs erhöhen oder verringern. Dies geschah anhand der ohrenphonetischen Klassifikationen in den Transkriptionen des OK-WRGR.
Es sei zunächst wiederholt, dass insgesamt nur knapp über 5% aller mög-lichen Realisierungen plosiv ausfallen. Insgesamt ist also die ‚weißrussische‘ Realisierung sehr stabil, obwohl die ‚russische‘ Realisierung, wie oft bemerkt
181 Es ergibt sich keine signifikante Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Wort-
form, weder wenn ‚gemeinsame‘ und ‚hybride‘ Wortformen ausgeschlossen werden (χ2=2,11, df=1, p=0,15), noch wenn ‚gemeinsame‘ Wortformen eingeschlossen sind (χ2=1,31, df=2, p=0,52).
0.00
00.
010
0.02
00.
030
wg
hr
297
wird, für Erstsprachler des Weißrussischen keine artikulatorische Schwierig-keit darstellt und die ‚weißrussische‘ und ‚russische‘ Variante perzeptiv gut unterscheidbar sind. In den hier vorliegenden Daten sind für die Migranten-generation kaum plosive Realisierungen feststellbar. Insgesamt war ein An-stieg des Anteils plosiver Realisierungen in Generation 2 zu verzeichnen. Jedoch variiert der Anteil plosiver Realisierungen in dieser Generation stark, viele Vertreter der Generation 2 weisen keine plosiven Realisierungen auf.
Die Analyse der Token ergab, dass die Wahrscheinlichkeit von plosiven Realisierungen in Generation 2 und bei Vertretern des weiblichen Ge-schlechts steigt. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit in ‚hybriden‘ und ‚rus-sischen‘ Äußerungen. Es zeigte sich, dass eine Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung besteht. In ‚weißrussischen‘ Äußerun-gen bleiben auch Vertreter der Generation 2 konsequent bei einer frikativen Realisierung. Während bei Vertretern der älteren Generationen auch in ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerungen plosive Realisierungen praktisch nicht auftreten, steigt für Generation 2 die Wahrscheinlichkeit plosiver, ‚russischer‘ Realisierungen in ‚russischen‘ Äußerungen. Selbst bei weibli-chen Vertretern übersteigt die Wahrscheinlichkeit in ‚russischen‘ Äußerun-gen (bei den übrigen Werten auf dem Referenzwert oder Median) jedoch nicht 10% (s.o. Abb. 65). Innerhalb ‚hybrider‘ Äußerungen ist die Wahr-scheinlichkeit einer ‚russischen‘ Realisierung zwar etwas höher als in ‚weiß-russischen‘ Äußerungen. Aber selbst in ‚russischen‘ Wortformen bei weibli-chen Vertretern ist sie äußerst gering und bleibt (bei den übrigen Werten auf dem Referenzwert oder Median) unter einem Prozent.
Die ‚weißrussische‘ frikative Realisierung der Variable (g) ist also, wie bereits von HENTSCHEL & ZELLER (2014) festgestellt, insgesamt äußerst stabil. Jedoch bestehen individuell erhebliche Unterschiede zwischen den Informanten in der jüngeren Generation. Ältere Sprecher zeigen auch in ‚rus-sischen‘ Äußerungen keine Tendenz zu einer plosiven Realisierung. Dies ist ein Unterschied zu den Daten von SADOŬSKI (1982), der in der russischen Rede bereits der Migrantengeneration in Minsk insgesamt einen gewissen Anteil an plosiven Realisierungen feststellt. Der Unterschied zwischen dem Befund von SADOŬSKI (1982) und dem Befund in der vorliegenden Arbeit ist sicherlich darin begründet, dass Sadoŭskis Informanten bemüht waren, kor-rektes Russisch zu sprechen. Sein Befund bedeutet zudem, dass die geringe Häufigkeit der ‚russischen‘ Variante in WRGR nicht auf eine perzeptive oder artikulatorische Schwierigkeit zurückzuführen ist.
299
9 Variation von [u] und [v] – die Variable (v)
9.1 Hintergrund
Den russischen Realisierungen von /v/ vor Konsonanten und im Auslaut, positionsbedingt [v] oder [f], entspricht im Weißrussischen [u] oder [u]. Die silbische Variante [u] des Weißrussischen tritt im Anlaut nach einem Konso-nanten in der vorhergehenden Wortform auf, sowie am Anfang einer Intona-tionsphrase, das unsilbische [u] tritt dementsprechend in nicht-initialer Posi-tion sowie initial nach einem Vokal in der vorherigen Wortform auf. Vor Vokal steht auch im Weißrussischen [v], vgl. wr. laŭka [lauka] ‚Bank‘ vs. lavačka [lavat ʂka] ‚Bänkchen‘ und ru. lavka [lafkə] vs. lavočka [lavəʧʲkə]. Im Weißrussischen sind [u], [u] und [v] also als Positionsvarianten von /v/ anzusehen. Dies gilt nicht nur für die weißrussische Standardsprache (vgl. z.B. ANTIPOVA 1977, 121), sondern auch für alle weißrussischen Dialekte (vgl. NPBD 1964, 138).
Das unsilbische [u] des Weißrussischen hat zwei weitere Entsprechungen im Russischen, dem dieser Laut fremd ist. Auf diese sei zur Abgrenzung kurz eingegangen.
Zunächst entspricht weißrussisches [u] in einigen Kontexten russi-schem /l/. Dies sind zum einen Kontexte nach /o/ vor Konsonant in einigen Lexemen: wr. voŭk ‚Wolf‘, doŭh ‚Schuld‘, poŭny ‚voll‘, toŭsty ‚dick‘ vs. ru. volk, dolg, polnyj, tolstyj. Die Verbindungen [ou] bzw. [ol] sind hier reguläre Reflexe des silbischen |l| des Urslavischen. Synchron ist [u] jedoch im Weißrussischen auch in diesen Kontexten als Realisierung von /v/, und nicht als Positionsvariante von /l/ zu werten (KHBM 2007, 11–12). Erstens ist im Weißrussischen vor Konsonant und nach /o/ auch /l/ möglich: bolt ‚Bolzen‘, iholka ‚Nadel‘, polk ‚Regiment‘, tolk ‚Sinn‘. Zweitens alterniert [u] mit [v] und nicht mit [l], wenn es innerhalb eines Paradigmas vor einem Vokal auftritt: poŭny ‚voll; Langform, Mask.Sgl.Nom.‘ – poven ‚voll; Kurzform, Mask.Sgl.‘.
Der zweite Kontext, in dem weißrussisches [u] russischem [l] entspricht, ist das Präteritalsuffix im Auslaut der maskulinen Präteritalformen. Hier
300
alterniert [u] auch im Weißrussischen mit [l] in den übrigen Präteritalformen, in denen ein Vokal folgt: byŭ ‚sein; Mask.Sgl.Prät.‘ vs. byla ‚sein; Fem.Sgl.Prät.‘. Jedoch ist im Weißrussischen /l/ im Auslaut möglich bzw. umgekehrt [u] als Entsprechung zu russisch /l/ im Auslaut ansonsten nicht zu beobachten, vgl. stol ‚Tisch‘, padzel ‚Teilung‘, mil ‚lieb (Kurzform)‘. Anders als im Falle der Lexeme des Typs voŭk liegt bei [u] in den Präteritalformen auch historisch kein phonisch bedingter Wechsel vor, sondern ein Ausgleich mit dem Adverbialpartizip der Vorzeitigkeit, in dem [u] aus |v| vorliegt (vgl. JANKOŬSKI 1974, 94–95; WEXLER 1977, 93–94 und 165–166).
In beiden Fällen ist der Unterschied wr. [u] / ru. [l] also nicht auf der phonischen, sondern auf der morphonematischen Ebene anzusiedeln. HENTSCHEL & ZELLER (2014) zeigen, dass für den erstgenannten Kontext (Lexeme wie voŭk/volk, tolstyj/toŭsty) das russische [l] überwiegt, was ange-sichts des starken Einflusses des Russischen im lexikalischen Bereich nicht verwundert. In den Präteritalformen überwiegt dagegen das ‚weißrussische‘ [u] gegenüber ‚russischem‘ [l], was angesichts der relativen Stärke des weißrussischen Elements im flexionsmorphologischen Bereich ebenfalls ins Gesamtbild passt.
Des Weiteren kann wr. [u] im Russischen [u] entsprechen, und zwar im Anlaut nach Vokal in der vorhergehenden Wortform: wr. jana ŭžo… [janauʐɔ] ‚Sie […] schon […]‘ vs. ru. ona uže… [ɐna uʐɛ]. Diese Kontexte sind im Weißrussischen aufgrund der häufigen v-Prothese vor historisch silbeninitialem /u/ typenfrequentiell selten, tokenfrequentiell aber häufig, da vor allem frequente Funktionswörter betroffen sind: neben užo vor allem die Präposition u als Entsprechung zu ru. u ‚bei (u.a.)‘. Nach Konsonant steht in beiden Sprachen silbisches [u]: wr. ën užo… vs. ru. on uže… ‚Er […] schon […]‘. Es handelt sich hier also um ein suprasegmentales, die Silbe betreffen-des Phänomen. Dies wird im Folgenden nicht behandelt (wie auch für (v) die silbisch bedingte Variation nicht behandelt wird).182
Es ist nicht anzunehmen, dass die Artikulation von [v] oder [f] vor Konsonant oder im Auslaut aus weißrussischer Sicht eine artikulatorische Schwierigkeit darstellt. [f] als Realisierung von /f/, das im Slavischen ein entlehntes Phonem ist, ist im Weißrussischen auch vor Konsonanten und im Auslaut möglich (kofta ‚Jacke‘, šyfr ‚Chiffre‘, šėf ‚Chef‘). Das vokalische
182 Auch in einigen Lehnwörtern (wr. aŭdytoryja vs. ru. auditorija ‚Hörsaal‘) entspricht dem
unsilbischen [u] des Weißrussischen zumindest graphemisch <u> im Russischen. Ob hier artikulatorische Unterschiede vorliegen, ist nicht sicher.
301
[u]/[u] anstelle von [v]/[f] ist jedoch eine häufige Interferenzerscheinung in russischer Rede in Belarus (vgl. z.B. MELʼNIKOVA 1999, 57). SADOŬSKI (1982, 214) beobachtet in russischer Rede von Land-Stadt-Migranten Unter-schiede zwischen Redestilen. Im spontanen Gespräch überwiegt die vokali-sche Realisierung, beim Lesen eines Textes dagegen die frikative Realisie-rung, was für die Salienz dieses Merkmals spricht.
HENTSCHEL & ZELLER (2014) zeigen anhand der Transkripte im OK-WRGR, dass in ‚hybriden‘ Äußerungen insgesamt eine ‚weißrussisch‘ voka-lische Aussprache deutlich überwiegt, ein Einfluss des Russischen aber fest-stellbar ist. Sprecher, die kein deutliches Übergewicht ‚russischer‘ Äußerun-gen zeigen, weisen in ‚weißrussischen‘ Wortformen fast ausschließlich die vokalische Variante auf. In ‚russischen‘ Wortformen steigt der Anteil frikati-ver Realisierungen bei den Sprechern, die vor allem ‚hybride‘ oder gleicher-maßen ‚hybride‘ und ‚russische‘ Äußerungen produzieren, auf ca. 40% an. Bei Sprechern, die noch relativ viele ‚weißrussische‘ Äußerungen zeigen, bleibt die ‚russische‘ Aussprache auch in ‚russischen‘ Wortformen relativ stabil. Auch für Sprecher, die vor allem ‚russische‘ Äußerungen aufweisen, liegt in ‚weißrussischen‘ Wortformen ein deutliches Übergewicht der ‚weiß-russischen‘ Variante vor, in ‚russischen‘ und ‚gemeinsamen‘ Wortformen überwiegt knapp die ‚russische‘ Realisierung.
9.2 Zur Realisierung von (v) in WRGR
Wie bereits für (g) wird für die Analyse von (v) auf die auf ohrenphoneti-schen Klassifikationen beruhenden Transkripte des OK-WRGR zurückgegrif-fen. Natürlich geht es hier nur um Kontexte im Auslaut und vor Konsonant, also um Kontexte, in denen das Weißrussische vokalische Realisierungen aufweist: Vor Vokal weisen beide Sprachen ein [v] auf. Die Analyse beschränkt sich auf Entsprechungen zu ru. [v]/[f] als Realisierungen von /v/. Entsprechungen zu ru. /l/ und /u/ werden ausgeschlossen. Ausgeschlossen wird außerdem die Präposition wr. u/ŭ / ru. v ‚in‘: Auch wenn auch in dieser klitischen Präposition oberflächlich betrachtet [u]/[u] im Weißrussischen als Entsprechung zu russisch /v/ auftritt, ist dieser Fall anders, und zwar als morphonematischer Unterschied zu werten. Im Weißrussischen alterniert die Präposition u/ŭ vor Vokalen nicht mit *v ([v]), was für übrige Instanzen von [u]/[u] der Fall ist. Vor Vokal steht u/ŭ (also [u]/[u]) oder satzinitial va, nicht aber *v [v]: jon u aŭdytoryi ‚Er ist im Hörsaal‘, jana ŭ aŭdytoryi ‚Sie ist im Hörsaal‘, Va aŭdytoryi ‚Im Hörsaal‘, aber: *v aŭdytoryi.
302
Der Unterschied zwischen vokalischen und frikativen Realisierungen ist auditiv gut feststellbar. Unterschieden wird nur zwischen frikativen Realisie-rungen einerseits ([v] und [f]) und vokalischen ([u] und [u]) andererseits. Auf eine (akustische) Analyse von Unterschieden zwischen den vokalischen Va-riablen kann daher verzichtet werden. Angesichts von starken Kontraktions-prozessen zwischen aufeinanderfolgenden Vokalen, die für zusammen-hängende Rede typisch sind und dementsprechend in dem vorliegenden Datenmaterial nicht nur bei (v) vorliegen, und der oft kaum erkennbaren Formantenstruktur wäre eine solche auch nur schwer durchführbar.
Analyse 1 – Gesamtverhältnisse und sprecherbezogene Häufigkeiten: Als erster Einstieg seien wieder das Gesamtverhältnis und die Verhältnisse in den drei Generationen betrachtet. Die Analysen beziehen sich auf die 34 Spre-cher, die auch für die Variable (g) untersucht wurden.
Vokalische und frikative Realisierungen von (v) in den drei Generationen Tab. 89
Generation frikativ vokalisch Gesamt Anteil frikativer Realisierungen 0 49 224 273 17,9 1 598 2172 2770 21,6 2 821 888 1709 48,0 gesamt 1468 3284 4752 30,9
‚Russische‘ Realisierungen machen also bereits in Generation 0 einen nicht unbeträchtlichen Anteil aus. Für die Generation 2 ist ein klarer Anstieg zu verzeichnen. Abbildung 67 zeigt die relativen Anteile der ‚russischen‘ frika-tiven Realisierung bei den einzelnen Sprechern getrennt nach Generation:
Relative Häufigkeit von frikativen Realisierungen von (v) bei den einzelnen Abb. 67
Sprechern
020
6010
0
Generation 0
Ant
eil [
v] (
%)
020
6010
0
Generation 1
020
6010
0
Generation 2
303
Pro Sprecher wurden durchschnittlich 130,1 Token ausgewertet (10–402, σ=112,5). Tabelle 137 im Anhang zeigt die relativen Häufigkeiten pro Sprecher, sowie die Anzahl der in die Analyse eingegangenen Token.
Es ist also lediglich ein Sprecher in Generation 0, der eine hohe Anzahl an frikativen Realisierungen aufweist. Bis auf die Ausnahme dieses Sprechers bleibt die vokalische Realisierung in der Generation 0 stabil. In Generation 1 sind ebenfalls Sprecher mit kaum frikativen Realisierungen zu beobachten, aber auch solche mit leicht höheren Anteilen. Jedoch reichen die Werte nur für einen Sprecher an 50% heran. Für Generation 2 schließlich sind sowohl Sprecher mit sehr niedrigen Anteilen als auch solche mit sehr hohen Anteilen an frikativen Realisierungen festzustellen. Insgesamt sind für die meisten Sprecher entweder recht niedrige oder recht hohe Werte (unter 30% oder über 70%) anzutreffen, es handelt sich also um eine S-förmige Kurve, wie sie für Sprachwandelphänomene typisch ist (vgl. LEOPOLD 2008).
Analyse 3 – Mehrebenenmodell: Im Folgenden wird geprüft, welche Faktoren einen Einfluss auf die Realisierung der Variable (v) als Frikativ oder als Plosiv haben. Folgende erklärende Variablen werden geprüft:
Erklärende Variablen für die Variable (v) Tab. 90
Erklärende Variable Werte Referenzwert Vorangehender Kontext Anlaut satzinitial
Anlaut nach Konsonant in vorheriger Wortform
Anlaut nach Vokal in vorheriger Wortform
nicht im Anlaut, nach [a] nicht im Anlaut, nach [e] nicht im Anlaut, nach [i] nicht im Anlaut, nach [o] nicht im Anlaut, nach [u] nicht im Anlaut, nach [ɨ]
[a]
Nachfolgender Kontext Auslaut Frikativ Plosiv Liquid Nasal
Plosiv
Worthäufigkeit (logarith-miert)
stetig --
Morphemtyp Stamm Endung
Stamm
Generation Generation 0 Generation 1 Generation 2
Generation 1
304
Geschlecht männlich weiblich
männlich
Affinität der Äußerung/Wortform
weißrussisch gemeinsam hybrid russisch
weißrussisch
Tabelle 91 zeigt die Ergebnisse eines Mehrebenenmodells mit Sprecher (n=34) und Familie (n=8) als Zufallsfaktoren. Der Referenzwert der abhän-gigen Variable ist vokalisch, positive Koeffizienten zeigen also an, dass der entsprechende Faktor die Wahrscheinlichkeit einer frikativen, ‚russischen‘ Realisierung erhöht. Da eine Zufallssteigung von Affinität der Äußerung in Sprecher das Modell signifikant verbessert (χ2=39,57, df=10, p<0,0001), wird diese in das Modell eingeschlossen.
Mehrebenenmodell zur Realisierung von (v), alle Äußerungen (n=4680). Tab. 91Zufallsfaktoren: Sprecher (n=34, σ<0,01), Familie (n=8, σ=0,93) mit Zufallssteigung von Affinität der Äußerung in Sprecher
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -4,82 0,62 -7,82 0,0000 Kontext links Anlaut Phrase 1,97 0,16 12,01 0,0000 Anlaut C_ 2,39 0,21 11,42 0,0000 Anlaut V_ 1,87 0,17 10,82 0,0000 [e] 0,70 0,23 3,06 0,0022 [i] 1,16 0,30 3,91 0,0001 [o] 0,19 0,22 0,86 0,3878 [u] 1,58 1,14 1,39 0,1654 [ɨ] 0,70 0,54 1,29 0,1970 Kontext rechts Auslaut -0,41 0,32 -1,28 0,1993
Frikativ -0,86 0,14 -6,23 0,0000 Liquid 1,58 0,16 9,99 0,0000 Nasal -0,04 0,17 -0,21 0,8311 Worthäufigkeit 0,06 0,02 2,52 0,0116 Morphemtyp Endung -0,73 0,36 -2,03 0,0429 Generation Generation 0 -1,17 0,65 -1,80 0,0718 Generation 2 1,31 0,64 2,06 0,0398 Affinität der Äußerung gemeinsam 2,05 0,41 5,05 0,0000 hybrid 1,71 0,35 4,83 0,0000 russisch 2,99 0,43 6,95 0,0000
Wie der stark negative Koeffizient des Achsenabschnittes zeigt, ist die frikative Realisierung weniger wahrscheinlich als die vokalische, wenn alle Faktoren auf ihrem Referenzwert gehalten werden. Es sind Einflüsse des phonischen Kon-textes zu erkennen. Im Anlaut steigt die Wahrscheinlichkeit einer frikativen Realisierung. Dies ist plausibel: Eine vokalische Realisierung im Anlaut führt
305
entweder zu einer zusätzlichen Silbe oder dazu, dass sich die Grenzen des morphologischen und des phonologischen Wortes nicht decken, da der Anlaut als Halbvokal artikulatorisch mit dem auslautenden Vokal der vorherigen Wortform verbunden würde. Dies wäre also eine Verletzung des in der Opti-malitätstheorie so genannten „alignment constraint“ (vgl. MCCARTHY & PRINCE 1993). Innerhalb einer Wortform ist die Wahrscheinlichkeit eines Halbvokals am höchsten nach dem Referenzwert [a]. Was den nachfolgenden Kontext angeht, so sind frikative Realisierungen am wahrscheinlichsten vor Liquiden. Beides könnte durch universale phonologische Tendenzen bedingt sein: [au] ist ein universal bevorzugter Diphthong, der das „dissimilative or polarizing principle“ der beiden vokalischen Elemente des Diphthongs erfüllt (DONEGAN 1978, 114). Eine frikative Realisierung vor Liquida führt im Gegensatz zu einer frikativen Realisierung vor Plosiven zu einer aufsteigenden Sonoritätswelle, also zu einer bevorzugten Silbenstruktur. Frikative Realisie-rungen sind wahrscheinlicher in häufigeren Lemmata, was überrascht, da diese im Vergleich zum ‚weißrussischen‘ Vokal oder Halbvokal eine Fortition dar-stellen.183 Ein Effekt zeigt sich auch für den Morphemtyp. In Endungen (d.h. konkret in der Endung {-ov}) ist die Wahrscheinlichkeit einer frikativen ‚russischen‘ Realisierung geringer. Dies lässt sich in Zusammenhang bringen mit der im Vergleich zum lexikalischen Bereich relativ starken Präsenz des Weißrussischen in flexionsmorphologischen Elementen in WRGR.
Schließlich bestätigt sich der Unterschied zwischen Generation 2 und den älteren Generationen: Bei den Vertretern der Generation 2 ist eine ‚russische‘ Realisierung wahrscheinlicher. Der Unterschied zwischen Generation 0 und 1 ist nicht signifikant. Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen nicht. Zusätzlich sind deutliche Unterschiede zwischen Äußerungen unter-schiedlicher Affinität festzustellen: Auch wenn – wie die Zufallssteigung von Affinität der Äußerung in Sprecher deutlich macht – der Einfluss der Affinität für die Sprecher individuell unterschiedlich ausfällt, gilt grundsätzlich, dass Realisierungen in ‚russischen‘, ‚gemeinsamen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen mit höherer Wahrscheinlichkeit frikativ sind als Realisierungen in ‚weißrus-sischen‘ Äußerungen. ‚Russische‘ Äußerungen erhöhen die Wahrscheinlich-keit am stärksten, gefolgt von ‚gemeinsamen‘ und ‚hybriden‘.
183 Ein Befund, der in eine ähnliche Richtung deutet, findet sich bei VYHONNAJA (1991, 205):
Sie beobachtet, dass in weißrussischer Rede bei schnellem Tempo vokalische Realisierun-gen mit frikativen Realisierungen alternieren.
306
Werden ‚gemeinsame‘ Äußerungen ausgeschlossen und Generation 0 und 1 zusammengefasst, zeigt sich, dass eine Interaktion zwischen Land/Stadt und Affinität der Äußerung besteht (Log-Likelihood ohne Inter-aktion: -1674,2; mit Interaktion: -1667,2; χ2=13,90, df=2, p=0,0010). Abbil-dung 68 verdeutlicht diese Zusammenhänge:
Interaktion von Land/Stadt und Affinität der Äußerung (w, h, r) für die Realisierung Abb. 68
von (v). Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten frikativer Realisierungen von (v) unter-schiedlicher Generationen (0 und 1 = Land, 2 = Stadt) in Abhängigkeit von der Affi-nität der Äußerung. Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
In ‚weißrussischen‘ Äußerungen unterscheiden sich die Generationen also nicht, sondern bleiben konsequent bei der ‚weißrussischen‘ vokalischen Realisierung. In ‚hybriden‘ Äußerungen ist ein deutlicherer Unterschied feststellbar, bei einer mit über 20% deutlich höheren Wahrscheinlichkeit von ‚russischen‘ Realisierungen für Generation 2. In ‚russischen‘ Äußerungen sind die Unterschiede dann sehr deutlich. Für die älteren Generationen hat die Affinität der Äußerung kaum einen Einfluss, bei Generation 2 erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer ‚russischen‘ Realisierung enorm: ‚Russische‘ Reali-sierungen sind – wenn die anderen Faktoren auf dem Referenzwert oder Median gehalten werden – sogar wahrscheinlicher als ‚weißrussische‘.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
wh
r
LandStadt
307
Analyse 4 – ‚hybride‘ Äußerungen: Bei Beschränkung der Analyse auf ‚hyb-ride‘ Äußerungen ergibt sich folgendes Bild:
Mehrebenenmodell zur Realisierung von (v), ‚hybride‘ Äußerungen (n=2413). Tab. 92Zufallsfaktoren: Sprecher (n=34, σ=1,06), Familie (n=8, σ=1,17)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -6,14 0,66 -9,30 0,0000 Kontext links Anlaut Phrase 2,78 0,31 9,01 0,0000 Anlaut C_ 2,71 0,26 10,59 0,0000 Anlaut V_ 2,03 0,22 9,33 0,0000 [e] 0,82 0,33 2,49 0,0128 [i] 1,27 0,42 3,00 0,0027 [o] 0,12 0,35 0,36 0,7230 [u] -10,80 803,87 -0,01 0,9893 [ɨ] 0,65 0,70 0,92 0,3553 Kontext rechts Auslaut -1,08 0,36 -3,04 0,0024
Frikativ -0,57 0,20 -2,91 0,0036 Liquid 1,52 0,22 6,81 0,0000 Nasal -0,28 0,26 -1,07 0,2866 Generation Generation 0 -0,81 0,73 -1,11 0,2661 Generation 2 2,13 0,48 4,48 0,0000 Affinität der Wortform gemeinsam 2,38 0,35 6,73 0,0000 hybrid 3,20 0,42 7,56 0,0000 russisch 3,36 0,36 9,41 0,0000
Auch in ‚hybriden‘ Äußerungen besteht – wie sich in der Analyse zuvor bereits angedeutet hat – ein Unterschied zwischen den Generationen: In Generation 2 steigt die Wahrscheinlichkeit ‚russischer‘ Realisierungen. Zudem bestehen auch in ‚hybriden‘ Äußerungen Unterschiede zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität. In ‚weißrussischen‘ Wortformen ist die Wahrscheinlichkeit einer ‚russischen‘ Realisierung am geringsten, in ‚russischen‘ am höchsten. Ein Effekt der Worthäufigkeit und des Morphemtyps ist nicht festzustellen. Zwischen Generation oder Land/Stadt und der Affinität der Wortform besteht keine Interaktion, auch dann nicht, wenn nur ‚russische‘ und ‚weißrussische‘ Wortformen einbezogen werden (χ2=0,23, df=1, p=0,63). Dies überrascht angesichts der in folgender Abbil-dung dargestellten vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten:
308
Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten von frikativem (v) in ‚weißrussischen‘ und Abb. 69
‚russischen‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen bei Informanten unterschiedli-cher Generationen (0 und 1 = Land vs. 2 = Stadt)
Dargestellt sind in Abbildung 69 wohlgemerkt die vorhergesagten Wahr-scheinlichkeiten ohne Interaktion. Auch wenn proportional gesehen ‚russi-sche‘ Wortformen die Wahrscheinlichkeit einer ‚russischen‘ Realisierung von (v) in beiden Sprechergruppen ähnlich stark erhöhen (bzw. in den älteren Generationen sogar stärker: von 0,1% auf 5,2% um das 50-fache, im Gegen-satz zum Anstieg um das 25-fache von 1,3% auf 33,4% für die Generation 2), sind die tatsächlichen Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit für die Gene-ration 2 zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität mit 32,1 Prozent-punkten um einiges größer als für die älteren Generationen (dort sind es 5,1 Prozentpunkte). Die Tendenz geht in dieselbe Richtung wie etwa bei der Variable (g). Für ‚weißrussische‘ Wortformen ist für beide Altersgruppen gleichermaßen eine ‚weißrussische‘ Realisierung vorhanden, die jüngeren Sprecher weisen in ‚russischen‘ Wortformen bedeutend häufiger ‚russische‘ Realisierungen auf als Vertreter der Generationen 0 und 1.184
184 Diese Überlegungen entsprechen nicht direkt der mathematischen Vorgehensweise der
logistischen Mehrebenenmodelle, die den Einfluss der erklärenden Variablen auf die Logits des abhängigen Ereignisses schätzen. Sie verdeutlichen aber, warum der beobachtete abso-lut stärkere Anstieg der Wahrscheinlichkeit in Generation 2 nicht auf unterschiedlichen Einflüssen des Faktors Affinität der Wortform beruhen muss.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
w
r
LandStadt
309
9.3 Zusammenfassung zur Variable (v)
In diesem Kapitel wurde die Variation von /v/ vor Konsonant und im Auslaut untersucht. Während das Russische in diesen Positionen einen Frikativ [v] oder [f] aufweist, erfolgt im Weißrussischen eine vokalische (vokalische oder halbvokalische) Realisierung als [u] oder [u]. Für diese Variable zeigen sich bereits in den älteren Generationen nennenswerte Anteile der ‚russischen‘ Ausprägung, wobei dies für die Generation 0 nur auf einen Sprecher zurück-zuführen ist. In der Generation 2 finden sich sowohl Sprecher, die fast aus-schließlich ‚weißrussische‘ vokalische Realisierungen aufweisen, als auch solche, die fast ausschließlich ‚russische‘ frikative Realisierungen zeigen.
Die Analyse der Token bestätigte zunächst diesen Trend zu einer ‚russi-schen‘ Realisierung in der jüngsten Generation. Es zeigte sich allerdings, dass dieser kaum für ‚weißrussische‘ Äußerungen gilt. Unterschiede zwi-schen den Generationen bestehen in ‚hybriden‘ und vor allem in ‚russischen‘ Äußerungen. In diesen zeigt Generation 2 vermehrt ‚russische‘ Realisierun-gen, während sich die Wahrscheinlichkeit ‚russischer‘ Realisierungen für die älteren Generationen auch in ‚russischen‘ Äußerungen kaum erhöht.
Bei der Beschränkung der Analyse auf ‚hybride‘ Äußerungen blieb der Unterschied zwischen den Generationen bestehen, auch in ‚hybriden‘ Äuße-rungen ist die Wahrscheinlichkeit ‚russisch‘ frikativer Realisierungen für die jüngere Generation höher. Für Wortformen ‚russischer‘ Affinität in ‚hybri-den‘ Äußerungen steigt die Wahrscheinlichkeit ‚russischer‘ Realisierungen von (v) sowohl für die Generationen 0 und 1 einerseits, als auch für die Generation 2 andererseits. Da dieser Anstieg für die älteren Generationen in Prozentpunkten aber nur gering ausfällt, besteht nur innerhalb der ‚russi-schen‘ Wortformen der jüngeren Generation eine nennenswerte Wahrschein-lichkeit einer ‚russischen‘ Realisierung. Innerhalb von ‚weißrussischen‘ Wortformen der jüngeren Generation und sowohl in ‚weißrussischen‘, als auch in ‚russischen‘ Wortformen der älteren Generationen sind ‚russische‘ Realisierungen sehr selten bzw. sehr unwahrscheinlich.
An dieser Stelle muss jedoch noch einmal auf die eingangs angegebenen sprecherbezogenen Häufigkeiten erinnert werden. Der Übergang zu einer ‚russischen‘ Realisierung ist klar individuell unterschiedlich: Auch in Gene-ration 2 zeigen wie gesagt einige Sprecher kaum ‚russische‘ Realisierungen, andere dagegen fast ausschließlich. Zudem ist die Variation phonisch geregelt. Bestimmte Kontexte wie der Anlaut und die Position vor Liquiden fördern eine ‚russische‘ Realisierung, andere hemmen diesen Trend.
313
10 Phonische Variation in weißrussisch-russischer gemischter Rede – Zusammenführung und Vertiefung der Ergebnisse
10.1 Einleitung
In Abschnitt 3.2 wurde ausgeführt, dass die vorliegende Arbeit neben der Beschreibung des Verhaltens der einzelnen Variablen zwei weitere Ziele verfolgt. Erstens soll gefragt werden, was die Art der phonischen Variation in WRGR über das Phänomen WRGR aussagt. Zweitens soll gefragt werden, was das Phänomen WRGR zur allgemeinen kontaktlinguistischen Diskussion über die Entstehung neuer, gemischter Varietäten beitragen kann. Im Folgen-den werden daher einige mit diesen Fragen verbundene übergeordnete Phä-nomene angesprochen, die Ergebnisse der Einzelanalysen vor diesem Hinter-grund zusammengeführt und gegebenenfalls durch einige vertiefende und vergleichende Analysen erweitert.
Die ersten zwei Punkte, die behandelt werden, sind miteinander ver-knüpft: Erstens geht es um das Ausmaß der phonischen Variabilität in WRGR und darum, ob über die Generationen hinweg die Variation auf der phonischen Ebene zunimmt, abnimmt oder stabil bleibt. Dabei wird differen-ziert nach WRGR „im engeren Sinne“ und WRGR „im weiteren Sinne“. Zweitens geht es um die phonische Unterschiedlichkeit der Kodes Weißrus-sisch, Russisch und WRGR, also darum, ob sich Rede, die auf tieferen Ebe-nen als ‚gemischt‘ bezeichnet werden kann, auf der phonischen Ebene von Rede unterscheidet, die auf tieferen Ebenen nur ‚russische‘ bzw. nur ‚weiß-russische‘ Elemente enthält.
Hinter den Begriffen „WRGR im engeren Sinne“ und „WRGR im weite-ren Sinne“ steht Folgendes: Die Analysen im Rahmen des Oldenburger Projekts zur WRGR zeigen, dass innerhalb des OK-WRGR zumindest einige Sprecher sowohl längere auf strukturell tieferen Ebenen ‚russische‘ Rede-einheiten als auch längere auf strukturell tieferen Ebenen ‚hybride‘ Äußerun-gen produzieren. Längere ‚weißrussische‘ Einheiten sind seltener (HENTSCHEL 2008c; HENTSCHEL & ZELLER 2012). Dieser Wechsel von län-
314
geren ‚russischen‘, ggf. ‚weißrussischen‘ und ‚hybriden‘ Diskurseinheiten soll als WRGR „im weiteren Sinne“ bezeichnet werden. Klare Instanzen von WRGR „im engeren Sinne“, also des gemischten Kodes, sind dagegen nur ‚hybride‘ Äußerungen. Wie HENTSCHEL (2013a, 61) argumentiert, weist dieser Wechsel darauf hin, dass es zum funktionalen Kodewechsel zwischen WRGR „im engeren Sinne“ (manifestiert in ‚hybriden‘ Äußerungen) und den alten Kontaktvarietäten kommt, was bedeutet, dass auch pragmatisch WRGR „im engeren Sinne“ ein neuer, dritter Kode neben dem Russischen und dem Weißrussischen ist.
Wie in der vorangegangenen Diskussion gezeigt wurde, korreliert die Affinität der Äußerung mit einigen Phänomenen auf der phonischen Ebene. Daher konzentriert sich dieses Kapitel stärker auf die ‚hybriden‘ Äußerungen bzw. auf die Unterschiede zwischen den Variablen in Äußerungen unter-schiedlichen Typs. Diese Konzentration auf Äußerungen mit interner Hybri-dität erfolgt, um an den „Kern“ der gemischten Rede zu gelangen, der bei nah verwandten Sprachen nur schwer, in Einzelinstanzen oft gar nicht vom gemischten Diskurs bzw. von Instanzen der beteiligten Kontaktvarietäten zu unterscheiden ist (vgl. z.B. MUYSKEN 2000). Dabei muss natürlich klar sein, dass diese analytische Trennung eine relativ große Unschärfe aufweist. ‚Hyb-ride‘ Äußerungen sind weitestgehend zweifelsfrei Instanzen gemischter Rede (WRGR im engeren Sinne). Eine relativ sichere Instanz der nicht-gemischten Rede (ob weißrussisch oder russisch) wäre aber nur eine solche, die in einem längeren nicht-gemischten Diskursteil auftritt. Viele ‚russische‘ und ‚weiß-russische‘ Äußerungen, insbesondere kürzere mit nur wenigen spezifischen, in beiden Sprachen unterschiedlichen Morphemen, an denen sich ein gemischter Kode äußern könnte, sind in der Realität Instanzen von WRGR im engeren Sinne.
Bei der Frage, wie stabilisiert bzw. fokussiert eine Mischvarietät ist, sind zwei Aspekte zu beachten: der Grad an sprecherinterner Variation, also der Grad der Variation in der individuellen Rede der Sprecher, und der Grad an sprecherexterner Variation, also der Grad an Variation zwischen unter-schiedlichen Sprechern. In der Diskussion um die Entstehung neuer Misch-dialekte wird ein Rückgang der Variation in beiden Dimensionen bei jünge-ren Generationen als eine Stabilisierung der neuen gemischten Varietät gedeutet (vgl. Abschnitt 2.3). Dem Rückgang in der Variation zwischen Sprechern wird dabei eine Priorität eingeräumt: Es sind ähnliche Proportio-nen an sprachlichen Varianten, die Varietäten innerhalb einer Sprache unter-scheiden (für Sprecher also ähnlich ausfallen), und nicht, dass Sprecher stets
315
nur eine Variante benutzen. Bekanntlich ist Variation auch in den traditio-nellen Dialekten und in als Standard wahr- und angenommener Rede stärker als erwartet (GEERARTS 2010; vgl. zu den Implikationen für WRGR auch HENTSCHEL 2011).
Wie in Kapitel 2 dargelegt, bestehen auf tieferen strukturellen Ebenen und in der Diskursgestaltung hinreichend Belege einer Eigenständigkeit eines gemischten Kodes. Würde sich keine phonische „Andersartigkeit“ von WRGR gegenüber dem Weißrussischen und Russischen herausstellen, so würde dies der Eigenständigkeit von WRGR im Sinne eines neuen gemisch-ten Systems also nicht widersprechen. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass in der Rede vieler Weißrussen keine oder kaum phonische Unterschiede zwischen dem Weißrussischen und dem Russischen bestehen. Ebenso wie für die Klassifizierung von Rede als „gemischter Rede“ unstritti-gerweise Phänomene der ersten Artikulation im Sinne von MARTINET (1949) einschlägig sind und daher die Variation von phonischen Merkmalen des Weißrussischen und des Russischen weniger aussagekräftig ist, so ist auch die Eigenständigkeit eines linguistischen Systems nicht an phonische Unter-schiede gebunden. So ist trotz eines phonischen Akzentes im Russischen bei vielen Weißrussen natürlich von zwei getrennten Systemen Weißrussisch und Russisch auszugehen.
Zur Beantwortung der eingangs gestellten Fragen wird zunächst als Einstieg in Abschnitt 10.2 geprüft, wie es sich im Vergleich der Generationen mit dem Ausmaß der Variabilität verhält. Es wird sowohl die sprecherinterne Varia-tion als auch die Variation zwischen Sprechern berücksichtigt. Dabei geht es zunächst um die phonische Variation in allen Äußerungen, unabhängig von ihrer Affinität, also um phonische Variation von WRGR im weiteren Sinne. Es wird geprüft, ob die Variation über die Generationen hinweg zunimmt oder abnimmt.
In Abschnitt 10.3 wird eine zusammenfassende Übersicht über die phoni-schen Variablen gegeben. Es wird dabei auf das Zusammenspiel der Affinität der Äußerung mit dem Faktor Generation eingegangen. Wie bereits in den Einzelanalysen gezeigt wurde, fallen die Unterschiede zwischen den Genera-tionen in Äußerungen unterschiedlicher Affinität unterschiedlich aus bzw. fehlen manchmal ganz. Es wird daraufhin die Variation innerhalb von ‚hyb-riden‘ Äußerungen in den Blick genommen und geprüft, ob sich zum einen ‚weißrussische‘ Wortformen in ‚weißrussischen‘ und ‚hybriden‘ Äußerun-gen, zum anderen ‚russische‘ Wortformen in ‚russischen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen phonisch voneinander unterscheiden. Sollten sich Wortformen
316
gleicher Affinität in Äußerungen unterschiedlicher Affinität voneinander unterscheiden, so würde dies die Eigenständigkeit bzw. Andersartigkeit der phonischen Seite von WRGR im engeren Sinne gegenüber dem Weißrussi-schen und Russischen, mithin einen phonischen Usus der WRGR bedeuten. Es wäre also ein weiterer Beleg für die Eigenständigkeit des gemischten Kodes.
Auf Basis der Befunde in Abschnitt 10.3 wird in Abschnitt 10.4 der Ver-gleich des Grades an Variation in unterschiedlichen Generationen wiederholt. Es wird geprüft, ob die Variabilität (in beiden Dimensionen, der sprecher-internen und -externen) zu- oder abnimmt, wenn nur ‚hybride‘ Äußerungen, d.h. nur klare Instanzen von WRGR im engeren Sinne betrachtet werden.
Nach diesen Aspekten, dem Ausmaß der Variabilität und der Unterschied-lichkeit der Kodes, werden Punkte angesprochen, die die Mechanismen des kontaktbedingten Sprachwandels näher beleuchten.
In Abschnitt 10.5 wird der Fokus auf die phonischen Variablen gelenkt. Es wird geprüft, ob Zusammenhänge zwischen den Variablen bestehen, ob also Sprecher gleichermaßen für alle Variablen entweder zum ‚Russischen‘ oder ‚Weißrussischen‘ tendieren. Dabei wird gezeigt, dass sich unter den Variablen Gruppen ausmachen lassen, dass also bestimmte Sprecher für einige Variablen eher zu einer ‚weißrussischen‘/‚russischen‘ Lautung tendie-ren, andere Sprecher für andere Variablen. Dies ermöglicht eine Gruppierung der phonischen Variablen.
Auch auf anderen sprachlichen Ebenen verhalten sich Sprecher ein und derselben Generation stark unterschiedlich. Es wird daher in Abschnitt 10.6 geprüft, ob die Einordnung der Respondenten in phonisch eher zum ‚Russi-schen‘ oder eher zum ‚Weißrussischen‘ neigende Sprecher mit der von HENTSCHEL & ZELLER (2012) vorgestellten Klassifizierung von Sprecher-typen zusammenfällt. Diese Sprechertypen beruhen auf den quantitativen Verhältnissen innerhalb der strukturell tieferen Ebenen der Lexik, Morpholo-gie, Morphonologie und Morphosyntax. Insbesondere wird geprüft, ob sich Sprecher ein und derselben Generation im phonischen Bereich voneinander unterscheiden, je nachdem, zu welchem Sprechertyp sie gehören.
In Abschnitt 10.7 wird geprüft, ob Phänomene der sprachlichen Akkom-modation (GILES, TAYLOR & BOURHIS 1973; GILES & SMITH 1979), also temporäre Anpassungserscheinungen an die Rede des Gesprächspartners vorliegen: Es wird dazu eine weitere Analyse eines Teilsamples vorgenom-men, und zwar von Rede solcher Sprecher, die an Gesprächen unterschiedli-cher Generationskonstellation teilnehmen.
317
10.2 Zum Grad der phonischen Variation in WRGR im weiteren Sinne
Variation zwischen Sprechern in WRGR im weiteren Sinne: In den von Trudgill und in dessen Tradition üblicherweise untersuchten Fällen des intensiven Kontakts von Sprechern nah verwandter sprachlicher Varietäten – etwa in dem britischen Milton Keynes oder in Neuseeland – kommt sprachli-che Variation durch die unterschiedlichen Ausgangsvarietäten von Migranten zustande. Der Rückgang einer solchen Variabilität lässt sich als Stabilisie-rung und Herausbildung einer neuen Varietät interpretieren. Diese Stabilisie-rung wird in solchen Studien nachgewiesen, indem gezeigt wird, dass die Kennwerte der einzelnen Sprecher (durchschnittliche Formantwerte, relative Häufigkeiten eines Merkmals o.ä.) in jüngeren Generationen näher beieinan-derliegen als in älteren Generationen. Üblicherweise ist es die Akkommoda-tion an Sprecher anderer Varietäten, die auf lange Sicht zu einem Ausgleich zwischen den Sprechern führt, wobei die quantitativen Relationen der Spre-cher der einzelnen Varietäten und das Prestige eine Rolle dabei spielen, in welche Richtung sich die Variation stabilisiert (vgl. TRUDGILL 1986, 98–102; WILLIAMS & KERSWILL 1999; KERSWILL & WILLIAMS 2000; MILROY 2002; WATT 2002; TORGERSEN & KERSWILL 2004).
Für den Fall Belarus liegt der Fall, wie in Abschnitt 2.3 dargelegt, anders. In den weißrussischen Städten treffen zwar auch Sprecher unterschiedlicher weißrussischer Dialekte zusammen, wobei zumindest für die kleineren hier untersuchten Städte davon auszugehen ist, dass die Migranten weitgehend aus der näheren Umgebung kamen. Für Minsk und auch für den Eisenbahn-knotenpunkt Baranavičy mit seiner Industrie und militärischen Ballung ist sicherlich auch Zuzug aus entfernteren Gebieten erfolgt. Das große Ausmaß an Variation ist aber nicht dem Kontakt zwischen den Ausgangsvarietäten dieser Sprecher untereinander geschuldet, sondern dem Kontakt mit dem Russischen.
Bei einem Vorgehen analog zu KERSWILL & WILLIAMS (2000) in Milton Keynes wären in einer Stadt Vertreter verschiedener Ausgangsvarietäten inklusive des Russischen zu untersuchen und zu prüfen, ob sich dabei für jüngere Generationen die quantitativen Verhältnisse in der Rede aneinander angleichen. Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Sprecher in einer Stadt stammen jedoch weitestgehend aus je einer Familie, dementsprechend weisen sie weitestgehend den gleichen Dialekthintergrund auf. Es ist also bei den hier untersuchten Sprechern für die Migrantengeneration in den einzel-nen Städten nicht von einer hohen Variation zwischen Sprechern auszugehen.
318
Über die Städte hinweg gibt es natürlich auch bei den hier untersuchten Spre-chern dialektal-bedingte Unterschiede. Wenn diese in jüngeren Generationen geringer ausfallen, dann aber nicht aufgrund des Kontakts der Vertreter der Dialekte untereinander (auf der „horizontalen“ Achse), sondern aufgrund des Kontakts auf der „vertikalen“ Achse, also aufgrund des für alle Sprecher in allen Städten geltenden Einflusses des Russischen. Wenn also die Variabilität über die Städte hinweg betrachtet weniger wird, dann nicht durch eine Ak-kommodation untereinander und den dadurch zu erwartenden Ausgleich der dialektalen Merkmale, sondern durch die eng verbundene Erscheinung der Dialektkonvergenz, also von Sprachwandelphänomenen in relativ getrennten Sprachgemeinschaften mit gleichen Resultaten aufgrund desselben Super-strats (vgl. TORGERSEN & KERSWILL 2004, 24).
Wie gezeigt wurde, zeichnen sich in der Tat solche Entwicklungen ab: Die dialektal-bedingten Unterschiede zwischen den Städten gehen zurück. Dies sind dissimilatives Akanje und Jakanje vs. nicht-dissimilatives Akanje und Jakanje, Unterschiede in weiteren vorbetonten Silben und die Opposition /r/ vs. /rʲ/ in den Dialekten um Chocimsk im Vergleich zu deren Zusammen-fall zu /r/ in den übrigen Dialekten. Bezeichnend ist, dass diejenigen Dia-lektmerkmale, die mit dem Russischen übereinstimmen, über die Generatio-nen hinweg konstant bleiben, diejenigen, die nicht mit dem Russischen über-einstimmen, einem Wandel unterliegen:
So geht der Unterschied zwischen Vokalen in dissimilativen Jakanje-Positionen und solchen in nicht-dissimilativen Jakanje-Positionen zurück, obwohl die aus Sicht der weißrussischen Stan-dardsprache dialektale Abweichung – die mit dem Russischen über-einstimmende Realisierung als [ɪ] vor betontem /a/ – konstant bleibt. Für das Zurückgehen des Unterschieds ist also der allgemeine Rückgang des Jakanje zugunsten des russischen Ikanje verantwort-lich.
Auch das dissimilative Akanje geht zurück. In Dialekten mit dissi-milativem Akanje wird vorbetontes /a, e, o/ nach nicht-palatalisier-ten Konsonanten vor betontem /a/ als [ɨ] oder [ə] realisiert, was nicht nur nicht der weißrussischen Standardsprache und den übrigen weißrussischen Dialekten entspricht, sondern auch nicht dem russi-schen Muster. Im Gegensatz zu dem stabilen Äquivalent nach pala-talisierten Konsonanten geht hier das dialektale Merkmal zurück.
319
Auch das Zurückgehen des Unterschieds zwischen Dialekten mit einem Zusammenfall von |r| und |rʲ| und solchen mit der Opposition /r/ vs. /rʲ/ erfolgt nicht aufgrund des Rückgangs des (aus Sicht des Standardweißrussischen) dialektalen Merkmals. Vielmehr weitet sich zumindest in ‚russischen‘ Äußerungen zunehmend das Muster des Russischen aus, das mit den von der weißrussischen Stan-dardsprache abweichenden Dialekten übereinstimmt.
Auch im Falle der nicht unmittelbar vorbetonten Silben – (Jakanje2) und (Akanje2) – tendieren vor allem jüngere Sprecher zu den Vari-anten, die mit dem Russischen übereinstimmen.
Es wäre unsinnig anzunehmen, dass diesen Tendenzen ein Ausgleich zwi-schen den weißrussischen Dialekten zugrunde liegt. Die Stadtdialekte kon-vergieren vielmehr aufgrund des Einflusses der russischen Sprache.
Abgesehen von diesen dialektalen Unterschieden zwischen den Städten deu-ten die Abbildungen der Sprechermittelwerte bzw. -häufigkeiten an, dass die Variation zwischen den Sprechern für einige Variablen in Generation 2 zunimmt. Für einige Sprecher in Generation 2 ist eine stärker ‚russische‘, für andere eine stärker ‚weißrussische‘ Realisierung zu beobachten. Dies betrifft die Variablen (rʲ) und (ʧʲ) sowie (g) und (v). Bei anderen Variablen sind zwar zwischen den Generationen Unterschiede in der Lage der Werte zu beobach-ten, das Ausmaß der Streuung der Werte in den Generationen scheint aber recht konstant, etwa bei (Jakanje1) oder bei (sʲ) und (tʲ).
Dass für die Variablen (rʲ) und (ʧʲ) sowie (g) und (v) zwischen den Gene-rationen Unterschiede im Ausmaß der sprecherexternen Variation bestehen, bestätigt sich statistisch. Die folgende Analyse untersucht die Variation der Durchschnittswerte oder der relativen Häufigkeiten der Variablen der einzel-nen Sprecher. Folgende Werte werden als Kennzahlen genommen:185
Für (Akanje1): Die euklidische Distanz186 zu /a/ /C0_. Der Wert gibt also an, wie „weit“ für einen bestimmten Sprecher die durchschnitt-liche Realisierung von Vokalen in Akanje-Positionen von der durch-
185 Die Tabelle findet sich im Anhang (Tab. 138). Für die Variable (rʲ) werden Sprecher aus
Chocimsk ausgeschlossen, da für diese ein dialektaler Hintergrund mit der Opposition /r/ vs. /rʲ/ vorliegt.
186 Die Euklidische Distanz ist die Quadratwurzel der Summe des quadrierten „vertikalen“ Abstandes (dem Unterschied in F1) und des quadrierten „horizontalen“ Abstandes (dem Unterschied in F2) zwischen zwei Punkten im F2/F1-Koordinatensystem (vgl. HARRINGTON 2010, 190–195).
320
schnittlichen Realisierung von betontem /a/ nach nicht-palatalisier-ten Konsonanten „entfernt“ ist.
Für (Jakanje1): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (ʧʲ): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (rʲ): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (sʲ), (tʲ) und (dʲ): Der normalisierte CoG-Wert Für (v) und (g): Die relative Häufigkeit der ‚russischen‘ Realisie-
rung
Die Variablen (Akanje2) und (Jakanje2), für die nur geringe Unterschiede zwischen den Sprechern festgestellt wurden, sowie das wenig frequente (ʃʲ) und das wenig frequente /e/ und /o/ nach verhärteten Konsonanten werden hier nicht einbezogen. Mithilfe des Levene-Tests187 wird geprüft, ob sich die Standardabweichungen der Kennwerte der Sprecher in den Generationen unterscheiden. Es sei betont, dass die Werte auf allen untersuchten Äußerun-gen des Sprechers beruhen.
Standardabweichungen der Sprecherkennwerte in den unterschiedlichen Tab. 93Generationen
Standardabweichung in den Generationen
Generation 0 vs. Generation 1
Generation 1 vs. Generation 2
0 1 2 Levene-Statistik
p-Wert Levene-Statistik
p-Wert
(Akanje1) 0,06 0,28 0,27 0,90 0,3557 0,19 0,6675 (Jakanje1) 0,24 0,32 0,39 0,23 0,6374 1,44 0,2413 (sʲ) 0,28 0,55 0,55 1,37 0,2582 0,13 0,7228 (tʲ) 0,18 0,43 0,48 0,08 0,7799 0,01 0,9150 (dʲ) 0,09 0,46 0,68 0,60 0,4515 2,65 0,1161 (ʧʲ) 0,15 0,29 0,45 0,83 0,3748 4,17 0,0522 (rʲ) 0,23 0,21 0,40 0,18 0,6824 7,04 0,0152 (g) 0,02 0,03 0,21 2,30 0,1466 14,33 0,0008 (v) 0,05 0,12 0,27 0,97 0,3365 26,13 0,0000
Die Standardabweichungen sind für die Generation 1 zwar in der Regel höher als in Generation 0, jedoch ist keiner der Unterschiede bei einem Niveau von p<0,05 statistisch signifikant. Zwischen Generation 1 und 2 bestehen dage-gen Unterschiede bei den Variablen (rʲ), (v) und (g) sowie tendenziell bei (ʧʲ). Bei diesen vier Variablen weichen die Vertreter der Generation 2 also signi-fikant oder marginal signifikant stärker untereinander ab, als dies in Genera-tion 1 der Fall ist. Die Variation zwischen Sprechern nimmt also in der
187 Mithilfe des R-Package Lawstat (LAWSTAT 2013).
321
zweiten Generation zu. Es bestätigt sich damit, dass in Generation 2 Unter-schiede zwischen Sprechern, die (bereits) in Richtung des ‚russischen‘ Mus-ters gehen, und solchen, die (noch) weitgehend ‚weißrussisch‘ orientiert sind, bestehen. In den älteren Generationen sind solche Unterschiede zwischen einzelnen Sprechern weniger ausgeprägt, was damit in Zusammenhang ge-bracht werden muss, dass die Sprecher im Großen und Ganzen eine ‚weißrus-sische‘ Lautung beibehalten (vgl. das folgende Unterkapitel).
Sprecherinterne Variation in WRGR im weiteren Sinne: Wenden wir uns nun der Frage zu, wie stark die individuelle Variation der Sprecher ist, und ob Vertreter der einen Generation stärker individuell in ihrer Rede variieren als Vertreter einer anderen. Zu erwarten ist, dass die individuelle Variation für Generation 1 und vor allem Generation 2 größer ist als für Generation 0, dass diese Sprecher also in ihrer Rede zwischen eher ‚russischen‘ und eher ‚weiß-russischen‘ Realisierungen schwanken. Als Messwert für die sprecherinterne Variation wird für die vorgestellten Variablen die Standardabweichung geeigneter Messwerte bei den einzelnen Sprechern berechnet, dann wird geprüft, ob die Standardabweichungen in bestimmten Generationen höher oder niedriger ausfallen.188 Die sibilantischen Variablen (sʲ), (tʲ) und (dʲ) werden dabei nicht untersucht. Wie in Abschnitt 6.3.2 erwähnt wurde, sind aufgrund der unterschiedlichen Qualität der Gespräche die Unterschiede zwischen den CoG-Werten unterschiedlich deutlich. Die Variation für einen Sibilanten ist daher abhängig von der Qualität der Aufnahme(n). Es bleiben folgende Variablen:
(Akanje1): F1 (normalisiert) (Jakanje1): F1 (normalisiert) (rʲ): F2 (normalisiert) (ʧʲ): F2 (normalisiert, zu Beginn des folgenden Vokals)
188 Für die binären Variablen (v) und (g) ist eine Angabe der sprecherinternen Variation natür-
lich nicht möglich bzw. hier geben die relativen Häufigkeiten selbst Aufschluss über den Grad der Variation.
322
Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse.
Variation in der Rede der einzelnen Sprecher in den Generationen 0, 1 und 2: Abb. 70
Standardabweichungen der Sprecher im F1 für (Akanje1), (Jakanje1), im F2 für (ʧʲ) und (rʲ)
Jeder einzelne Datenpunkt gibt die Standardabweichung der Variable (also in der ersten Abbildung die des ersten Formanten von Vokalen in Jakanje-Positionen) eines Sprechers wieder, zeigt also, wie stark die Realisierungen des Sprechers um dessen mittlere Realisierung streuen. Unterschiede zwi-schen den Generationen in den Abbildungen und Statistiken bedeuten somit, dass die Sprecher unterschiedlicher Generationen individuell stärker oder schwächer variieren. Es wird keine Aussage darüber getroffen, ob sich die
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(Akanje1)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F1
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(Jakanje1)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F1
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(ʧʲ)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F2
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(rʲ)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F2
323
durchschnittliche Realisierung ändert oder ob die Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Realisierungen in den Generationen größer oder geringer werden.
Die Abbildungen deuten auf Unterschiede zwischen den Generationen hin. Zur statistischen Absicherung werden Regressionsanalysen mit Genera-tion als erklärender Variable, der Standardabweichung der einzelnen Spre-cher als abhängiger Variable durchgeführt.189
Regressionsanalysen für die Standardabweichungen der einzelnen Sprecher Tab. 94
1. (Akanje1), Standardabweichung F1 (n=33):
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,71 0,04 19,52 <0,0001 Generation Generation 0 -0,11 0,07 -1,48 0,1492
Generation 2 0,01 0,05 0,28 0,7824
2. (Jakanje1), Standardabweichung F1 (n=33):
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,83 0,04 20,62 <0,0001 Generation Generation 0 -0,16 0,08 -1,98 0,0568
Generation 2 -0,15 0,06 -2,57 0,0154
3. (ʧʲ), Standardabweichung F2 (n=29):
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,52 0,04 12,78 <0,0001 Generation Generation 0 0,03 0,09 0,40 0,6949
Generation 2 0,16 0,06 2,58 0,0160
4. (rʲ), Standardabweichung F2 (n=26):
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,38 0,02 18,04 <0,0001 Generation Generation 0 0,00 0,04 0,02 0,9824
Generation 2 0,06 0,03 1,87 0,0749
Für (Akanje1) sind keine Unterschiede zwischen den Generationen zu er-kennen. Die Realisierungen der Vertreter aller Generationen streuen also relativ gleich stark. Für Vokale in Jakanje-Positionen ist dies nicht so: Ver-
189 Um auszuschließen, dass es nur wenige Familien sind, die stärker variieren als andere,
wurde ebenfalls eine Mehrebenenanalyse mit Familie (n=8) als Zufallsfaktor durchgeführt. Da keine wesentlichen Unterschiede zu Tage treten, werden hier die einfachen Regressi-onsanalysen gezeigt.
324
treter der Generation 1 haben eine höhere Standardabweichung des F1190 als Vertreter der Generationen 0 und 2 (im letzteren Fall sind die Unterschiede allerdings nur marginal signifikant). Auch wenn, wie die Abbildungen zei-gen, die Unterschiede zwischen den Standardabweichungen der Sprecher recht groß sind, einige Sprecher also eine recht große Variation aufweisen, andere nicht, ist für die Generation 1 für diese Variable also insgesamt eine Zunahme der Variation in der Rede der einzelnen Sprecher zu verzeichnen. In der Generation 2 nimmt die Variation in der Rede der einzelnen Sprecher ab, was auf eine Stabilisierung in dieser Generation hindeutet. Dies lässt sich so deuten, dass Generation 0 weitgehend beim ‚weißrussischen‘ Muster bleibt, Generation 1 ein Spektrum von ‚weißrussischen‘ zu ‚russischen‘ Rea-lisierungen zeigt, während Generation 2 weitgehend ‚russische‘ Realisierun-gen zeigt (vgl. dazu auch die Abbildungen der Einzelrealisierungen im An-hang). Wie in Abschnitt 5.4.4 gezeigt wurde, ist es in der Regel nicht so, dass die Vertreter der Generation 1 zwischen ‚russischen‘ und ‚weißrussischen‘ Realisierungen wechseln (in Einzelfällen schon), sondern ihre Verteilung weist in der Regel klare, intermediäre Zentren auf.
Dagegen zeigt sich für die Variablen (ʧʲ) und weniger deutlich für (rʲ) eine Zunahme der Variation in der Rede der einzelnen Sprecher in der Genera-tion 2. Hier sieht es also so aus, dass Vertreter der Generationen 0 und 1 beim ‚weißrussischen‘ Muster bleiben, während Vertreter der Generation 2 zwi-schen ‚weißrussischen‘ und stärker ‚russischen‘ Realisierungen variieren. Für diese Variablen waren auch die Unterschiede zwischen den Sprechern größer als in den älteren Generationen. Hier ist in WRGR im weiteren Sinne also eine größere Variation bei jüngeren Sprechern zu verzeichnen, sowohl zwi-schen Sprechern als auch in der individuellen Rede der Sprecher. Stark vereinfachend lässt sich die Bandbreite der sprecherinternen Variation in den einzelnen Generationen folgendermaßen darstellen.
Grad der sprecherinternen Variation einiger Variablen Tab. 95
Generation 0 Generation 1 Generation 2 (Akanje1) wr wr wr (männlich) /ru (weiblich) (Jakanje1) wr wr – ru ru (ʧʲ) wr wr wr – ru (rʲ) wr wr wr – ru
190 Für den zweiten Formanten bestehen keine Unterschiede zwischen den Generationen. Die
Sprecher aller Generationen variieren, was die Zungenlage angeht, also gleich stark.
325
Bei bzw. vor der Interpretation dieses Befundes muss Folgendes bedacht werden: Üblicherweise wird bei Untersuchungen zum Dialektkontakt (etwa im englischsprachigen Raum) die Frage nicht berücksichtigt (oder ist die Frage weniger von Belang), ob in der Rede eines Sprechers Instanzen von gemischter Rede / der neuen Mischvarietät mit Instanzen der „alten“ Kon-taktvarietäten wechseln. Die Frage stellt sich in den Fällen des Kontakts englischer Varietäten weniger, da es vor allem phonische Merkmale sind, die variieren, Variation auf tieferen Ebenen dagegen zu vernachlässigen ist. Nun ist für den Fall der WRGR zu bedenken, dass zumindest die jüngere Genera-tion des Russischen auch in seiner Standardform ohne Interferenzen des Weißrussischen auf tieferen Ebenen mächtig ist. Es muss bei der Messung der Variabilität also berücksichtigt werden, dass es zu einem Nebeneinander der „neuen“ und der „alten“ Varietäten in der Rede der Sprecher kommen kann. Eine Zunahme der Variation gerade in Generation 2 kann also dadurch bedingt sein, dass Sprecher zwischen zwei Varietäten wechseln, in der einen – der gemischten – die phonische Seite ihrer Rede eher ‚weißrussisch‘, in der anderen – der russischen – eher ‚russisch‘ gestalten. Die Zunahme der Varia-tion dürfte dann nicht als Abnahme der Stabilisiertheit des gemischten Kodes gedeutet werden, sondern im Gegenteil als ein weiterer Aspekt seiner Eigen-ständigkeit. Es ist daher nötig, auf den Zusammenhang zwischen der Affinität der Äußerung auf strukturell tieferen Ebenen und der phonischen Seite einzugehen.
10.3 Zum Zusammenhang der phonischen Variation mit strukturell tieferen Sprachebenen
In den Kapiteln 5 bis 9 wurden für die einzelnen phonischen Variablen die Zusammenhänge der Generation und der Affinität der sprachlichen Einheiten auf strukturell tieferen Ebenen (der lexikalischen, morphologischen, morpho-nologischen und morphosyntaktischen Ebene) einerseits mit der Realisierung der phonischen Variablen andererseits festgestellt. Die Ergebnisse sollen an dieser Stelle zusammengefasst werden.
Der Zusammenhang von Affinität der Äußerung und Generation in WRGR im weiteren Sinne: Tabelle 96 gibt wieder, ob sich in den untersuchten Generati-onen Äußerungen unterschiedlicher Affinität voneinander unterscheiden, und ob sich in Äußerungen derselben Affinität die Generationen unterscheiden. Wenn in den Analysen in den bisherigen Kapiteln keine Unterschiede zwi-schen den älteren Generationen – Generation 0 und Generation 1 – festge-
326
stellt wurden, werden sie in der Übersicht unter Land zusammengefasst. Beide Generationen haben gemein, in ländlichen Gebieten weitgehend mit weißrussischen Dialekten aufgewachsen zu sein, im Gegensatz zur jüngsten Generation 2, den bereits in den Städten großgewordenen Kindern der Land-Stadt-Migranten (die dann in der Übersicht als Stadt gekennzeichnet sind). Nur für (Jakanje1) besteht ein Unterschied zwischen den älteren Generatio-nen, nur für (Jakanje1) sind also auch die Unterschiede zwischen den älteren Generationen zu zeigen. Die nicht unmittelbar vorbetonten Vokale, /e/ und /o/ nach verhärteten Konsonanten und (ʃʲ) werden nicht weiter behandelt.
Zusammenhänge von Generation oder Land/Stadt und Affinität der Äußerung Tab. 96
Akanje1 Land wr = hy = ru (<) (<) (<) Stadt wr = hy = ru Jakanje1 Generation 0 wr < hy < ru < < < Generation 1 wr < hy < ru < < < Generation 2 wr < hy < ru (sʲ) Land wr < hy < ru = = = Stadt wr < hy < ru (tʲ) Land wr = hy = ru > (!) = < Stadt wr < hy < ru (dʲ) Land wr < hy < ru < = > (!) Stadt wr = hy = ru (ʧʲ) Land wr (<) hy (<) ru = < < Stadt wr < hy < ru (rʲ) Land wr = hy = ru = < < Stadt wr < hy < ru (g) Land wr = hy = ru = (<) < Stadt wr (<) hy < ru (v) Land wr (<) hy (<) ru (<) < < Stadt wr < hy < ru
Diese Tabelle ist folgendermaßen zu lesen: Der Operator „<“ zeigt an, dass das rechtsseitige Argument des Operators stärker zu einer ‚russischen‘ Reali-sierung neigt. Der Operator „>“ zeigt an, dass das rechtsseitige Argument stärker zu einer ‚weißrussischen‘ Realisierung neigt. Das „=“ wird gesetzt,
327
wenn kein (signifikanter) Unterschied besteht. In Klammern wird der Ope-rator gesetzt, wenn die Unterschiede nur schwach sind oder sonstige Ein-schränkungen bestehen. Ein Ausrufezeichen deutet an, dass der Trend hier entgegen den Erwartungen ist.
Für (Akanje1) waren keine allgemeinen Unterschiede zwischen den älteren Generationen festzustellen: Nur weibliche Vertreter der Generation 2 zeigten eine stärker zentrierte Realisierung wie im Russischen (daher die Klammern um „<“). Es zeigte sich kein Unterschied zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affinität (es gilt also in beiden Sprechergruppen „wr = hy = ru“).
Für (Jakanje1) waren dagegen Unterschiede zwischen allen Genera-tionen festzustellen, mit jeweils stärker in Richtung des Russischen gehenden Werten in der nächstjüngeren Generation, und es waren Unterschiede zwischen den Äußerungstypen festzustellen. Dabei gab es keine Evidenz dafür, dass die Unterschiede zwischen den Äußerungen nur für bestimmte Generationen gelten, bzw. dass sich die Generationen nur in bestimmten Äußerungstypen unterscheiden. Realisierungen in ‚russischen‘ Äußerungen sind also in der Tendenz für alle Generationen stärker ‚russisch‘, also stärker [i]-artig. Für alle Äußerungstypen weist Generation 2 stärker ‚russische‘, stärker [i]-artige Realisierungen auf als die älteren Generationen.
Für (sʲ) bestanden zwischen den Sprechergruppen im Mehrebenen-modell keine signifikanten Unterschiede. (ZELLER (2013b) fand für die Mittelwerte der Sprecher dagegen Unterschiede. Auch Abbil-dung 41 (S. 227) deutete an, dass bei einer größeren Anzahl an untersuchten Sprechern ein signifikanter Unterschied zutage treten könnte.) Zwischen den Äußerungstypen bestanden hingegen Unter-schiede. Die Messwerte deuten auf eine stärker ‚russische‘ alveolare Artikulation in ‚russischen‘ Äußerungen hin, eine stärker [s"]-artige, d.h. ‚weißrussisch‘ posterior-alveolare in ‚weißrussischen‘ Äuße-rungen.
Für die übrigen Variablen waren Interaktionen festzustellen, d.h. es bestehen Unterschiede zwischen den Generationen, diese galten aber nur oder vor allem in bestimmten Äußerungstypen.
Für (tʲ) bestanden keine allgemeinen Unterschiede zwischen den Generationen. Für die älteren Generationen waren zudem keine
328
Unterschiede zwischen den Äußerungstypen zu erkennen. Genera-tion 2 wies dagegen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen stärker [ʦ"]-artige, d.h. stärker ‚weißrussisch‘ posterior-alveolare Realisierungen auf, in ‚russischen‘ dagegen eine stärker [ʦʲ]-artige Realisierung, ‚hybride‘ Äußerungen lagen dazwischen. In ‚weißrussischen‘ Äuße-rungen wies Generation 2 dementsprechend eine stärker ‚weißrussi-sche‘ Artikulation als die älteren Generationen auf, in ‚russischen‘ Äußerungen dagegen eine stärker ‚russische‘ als die älteren Genera-tionen.
Für (dʲ) war das Muster umgekehrt: Hier zeigt die jüngere Genera-tion keine Unterschiede zwischen den Äußerungstypen, die älteren Generationen zeigen dagegen in ‚russischen‘ Äußerungen eine stär-ker ‚russische‘ Realisierung als in ‚weißrussischen‘ Äußerungen.
Die übrigen Variablen zeigten mehr oder weniger ein und dasselbe Muster, d.h. keine oder geringe Unterschiede zwischen den Generationen in ‚weiß-russischen‘ Äußerungen, keine oder geringe Unterschiede zwischen den Äußerungstypen bei den älteren Generationen, aber stärker ‚russische‘ Reali-sierungen für die jüngere Generation in ‚hybriden‘ und vor allem ‚russischen‘ Äußerungen und dementsprechend Unterschiede zwischen den Generationen in ‚hybriden‘ und vor allem ‚russischen‘ Äußerungen.
Für (ʧʲ) wiesen alle Generationen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen eine nicht-palatalisierte, ‚weißrussische‘ Realisierung auf. Die älte-ren Generationen zeigten nur leichte Unterschiede zwischen den Äußerungstypen. Generation 2 zeigte dagegen in ‚hybriden‘ und vor allem ‚russischen‘ Äußerungen stärker palatalisierte, stärker ‚russi-sche‘ Realisierungen.
Für (rʲ) wiesen ebenfalls alle Generationen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen eine nicht-palatalisierte, ‚weißrussische‘ Realisierung auf. Die älteren Generationen zeigten keine Unterschiede zwischen den Äußerungstypen. Generation 2 zeigte dagegen in ‚hybriden‘ und vor allem ‚russischen‘ Äußerungen stärker palatalisierte, stärker ‚russische‘ Realisierungen.
Für (g) wiesen alle Generationen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen quasi ausschließlich ‚weißrussisch‘ frikative Realisierungen auf. Vertreter der älteren Generationen blieben auch in den anderen Äu-ßerungstypen konsequent bei der ‚weißrussischen‘ Lautung, wohin-
329
gegen für Generation 2 eine leichte Erhöhung der Wahrscheinlich-keit eines ‚russischen‘ Plosivs in ‚russischen‘ Äußerungen zu be-obachten war.
Für (v) wies Generation 2 in ‚weißrussischen‘ Äußerungen nur leicht mehr ‚russische‘ frikative Realisierungen auf, als die bei der ‚weißrussischen‘ Lautung bleibenden Generationen 0 und 1. Für die beiden älteren Generationen erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit einer ‚russischen‘ Realisierung in ‚hybriden‘ und vor allem ‚russi-schen‘ Äußerungen leicht, für die Generation 2 dagegen deutlich.
Die Unterschiede zwischen den Generationen gelten also für viele Variablen nur oder stärker für ‚hybride‘ und vor allem ‚russische‘ Äußerungen. In ‚weißrussischen‘ Äußerungen sind die Werte der Generationen für viele Variablen nicht unterschiedlich. Hier gestalten jüngere Sprecher ihre Rede auch phonisch ‚weißrussisch‘. Im Falle von (tʲ) weist die Generation 2 sogar stärker ‚weißrussische‘ Werte auf als die älteren Sprecher. Während jedoch die älteren Sprecher auch in ‚russischen‘ Äußerungen weitestgehend bei einer ‚weißrussischen‘ Lautung bleiben, wird hier bei jüngeren Sprechern das ‚russische‘ Moment stärker. Jüngere Sprecher trennen also zwischen Äuße-rungen unterschiedlicher Affinität, während die älteren dies nicht oder weni-ger tun191 (die einzige Ausnahme ist die Variable (dʲ)). Diese Trennung ist natürlich keine absolute: Von einer durchgehend ‚russischen‘ Lautung in ‚russischen‘ Äußerungen kann für keine der Variablen die Rede sein (vgl. dazu auch HENTSCHEL & ZELLER 2014).
Der Zusammenhang von Affinität der Wortform und Generation in WRGR im engeren Sinne: In ‚hybriden‘ Äußerungen – WRGR im engeren Sinne – ist der Trend für Generation 2 zur russischen Lautung weniger deutlich als in ‚russischen‘ Äußerungen. Es ist allerdings an dieser Stelle nicht klar, ob dies ein Epiphänomen davon ist, dass in ‚hybriden‘ Äußerungen sowohl ‚weißrus-sische‘ als auch ‚russische‘ Wortformen vorkommen, in ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ per definitionem nur ‚weißrussische‘ bzw. ‚russische‘. Innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen neigen ‚weißrussische‘ Wortformen
191 KURCOVA (2010, 22) beobachtet für die weißrussischen Dialekte einen massiven lexikali-
schen Einfluss des Russischen, die entlehnten Wörter würden aber ganz ähnlich wie bei den älteren Sprechern in der vorliegenden Untersuchung den phonetisch-phonologischen Regeln des Dialekts unterstellt.
330
auf der phonischen Ebene stärker zum ‚Weißrussischen‘, ‚russische‘ stärker zu einer ‚russischen‘ Lautung. Dies fasst folgende Tabelle zusammen:
Zusammenhänge von Generation oder Land/Stadt und Affinität der Wortform in Tab. 97‚hybriden‘ Äußerungen
Akanje1 Land wr = ru (<) (<) Stadt wr = ru Jakanje1 Generation 0 wr < ru (<) (<) Generation 1 wr < ru < < Generation 2 wr < ru (sʲ) Land wr < ru = = Stadt wr < ru (tʲ) Land wr < ru = = Stadt wr < ru (dʲ) Land wr = ru = = Stadt wr = ru (ʧʲ) Land wr (<) ru (<) < Stadt wr < ru (rʲ) Land wr = ru < < Stadt wr = ru (g) Land wr = ru = (<) Stadt wr (<) ru (v) Land wr (<) ru (<) < Stadt wr < ru
Diese Tabelle ist folgendermaßen zu lesen:
Für (Akanje1), für das auch zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affinität keine Unterschiede festgestellt wurden, sind auch keine Unterschiede zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität fest-stellbar (anders als für die anderen Variablen wurden bei der Ana-lyse dieser Variable alle Äußerungen einbezogen, da sich ‚hybride‘ Äußerungen nicht von den anderen unterscheiden). Die Stärke der Reduktion des unbetonten /a/ und /o/ ist also unabhängig von der Affinität der Wortform.
331
Für (Jakanje1) zeigten sich dagegen auch in ‚hybriden‘ Äußerungen Unterschiede zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität, mit tendenziell stärker [i]-artiger Realisierung in ‚russischen‘ Wort-formen.
Auch für (tʲ) und (sʲ) wiesen die CoG-Werte auf eine weniger stark posterior-alveolare ‚weißrussische‘ Artikulation in ‚russischen‘ Wortformen hin. Für (dʲ) waren dagegen keine Unterschiede erkennbar.
Für (ʧʲ) verfehlte eine Interaktion von Land/Stadt und Affinität der Wortform knapp marginales Signifikanzniveau. Der Trend deutete aber in eine plausible Richtung: In ‚weißrussischen‘ Wortformen wiesen beide Sprechergruppen eine ‚weißrussische‘ nicht-palatali-sierte Realisierung auf, in ‚russischen‘ Wortformen zeigten sich dagegen vor allem bei jüngeren Sprecher auch ‚palatalisierte‘ Reali-sierungen.
Für (rʲ) waren dagegen in ‚hybriden‘ Äußerungen keine Unter-schiede zwischen Wortformen unterschiedlicher Affinität zu finden, jedoch blieben die Werte für die Sprechergruppen leicht unter-schiedlich.
Für (g) und für (v) zeigten beide Sprechergruppen in ‚weißrussi-schen‘ Wortformen quasi ausschließlich ‚weißrussische‘ Reali-sierungen, also [ɣ] bzw. [u], für Generation 2 stieg in ‚russischen‘ Wortformen die Wahrscheinlichkeit eines ‚russischen‘ [g] leicht, die eines ‚russischen‘ [v] dagegen stärker an.
Es finden sich in WRGR im engeren Sinne also Spuren der „Etymologie“ der Wortformen. Es ist jedoch natürlich nicht so, dass eine ‚russische‘ Wortform stets mit einer ‚russischen‘ Lautung einhergeht. Vielmehr ist für solche Wort-formen eine ‚russische‘ und eine ‚weißrussische‘ Aussprache möglich. ‚Weißrussische‘ Wortformen sind dagegen in aller Regel auch auf der phoni-schen Ebene ‚weißrussisch‘.
Zur phonischen Eigenständigkeit der WRGR im engeren Sinne: Diese Befunde werfen die Frage auf, ob sich ‚weißrussische/russische‘ Wortformen in ‚weißrussischen/russischen‘ Äußerungen anders als ‚weißrussi-sche/russische‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen verhalten, ob es also phonische Spezifika für ‚hybride‘ Äußerungen (die WRGR „im engeren
332
Sinne“ im Sinne von HENTSCHEL 2013 und HENTSCHEL & ZELLER 2012) gibt. Würden ‚russische‘ Wortformen in WRGR im engeren Sinne stärker zu einer ‚weißrussischen‘ Lautung tendieren als ‚russische‘ Wortformen in ‚rus-sischen‘ Äußerungen, so wäre dies ein weiteres Argument für den Status von WRGR als eigener Varietät. Um dies zu beantworten, werden für jede Vari-able zwei Mehrebenenanalysen durchgeführt, jeweils eine nur für ‚russische‘ und eine nur für ‚weißrussische‘ Wortformen, mit der Affinität der Äußerung als erklärender Variable. Es werden bei diesen Analysen wieder die phoni-schen und ggf. lexikalischen erklärenden Variablen eingeschlossen, die sich in den Modellen in den Kapiteln 5 bis 9 als signifikant herausgestellt haben. Von den anderen in das Modell eingegangenen Faktoren wird nur Generation gezeigt. Die Variable (Akanje1) wird nicht geprüft, da in keiner Konstellation Unterschiede zwischen den Äußerungstypen vorlagen. Die Variable (dʲ) wird ausgelassen, da hier nur wenig Token analysiert werden konnten. Die ent-sprechenden Einzelanalysen finden sich im Anhang. Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Ergebnisse.
Übersicht: Wortformen derselben Affinität im gemischten und nicht-gemischten Tab. 98Kode. Der Operator „<“ zeigt, dass das rechtsseitige Argument des Operators für die jeweilige phonische Variable stärker zum Russischen neigt (Signifikanzniveaus: *: ≤0,05; **: ≤0,01; ***: ≤0,001:). Der Operator „=“ zeigt, dass kein signifikanter Unterschied besteht.
‚Weißrussische‘ Wortformen ‚Russische‘ Wortformen ‚Wr.‘ Äußerungen vs. ‚hyb.‘
Äußerungen ‚Ru.‘ Äußerungen vs. ‚hyb.‘ Äußerungen
(Jakanje1): F1/F2 wr=hyb/wr=hyb hyb=ru/hyb=ru (sʲ): CoG wr=hyb hyb<ru* (Interaktion Generation) (tʲ): CoG wr=hyb hyb=ru (ʧʲ): F2 wr=hyb hyb=ru (rʲ): F2 wr=hyb hyb<ru* (g) wr=hyb hyb<ru** (v) wr=hyb hyb<ru***
‚Weißrussische‘ Wortformen in ‚weißrussischen‘ Äußerungen und ‚weißrus-sische‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen unterscheiden sich für keine der phonischen Variablen. Die Realisierung bleibt also stets gleichermaßen stark ‚weißrussisch‘.
Auch beim Vergleich der ‚russischen‘ Wortformen in ‚russischen‘ und in ‚hybriden‘ Äußerungen ergeben sich für einige Variablen keine Unter-schiede. Dies sind die Variablen (Jakanje1), (tʲ), und (ʧʲ). Für (rʲ), (sʲ), (g) und (v) zeigen sich jedoch folgende Unterschiede:
333
Der zweite Formant von (rʲ) ist bei ‚russischen‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen leicht, aber signifikant niedriger („weißrus-sischer“) als bei ‚russischen‘ Wortformen in ‚russischen‘ Äußerun-gen.
Eine plosive Realisierung von (g) ist für ‚russische‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen weniger wahrscheinlich als in ‚russischen‘ Äußerungen. Es besteht zwar keine Interaktion zwischen der Affi-nität der Äußerung und Land/Stadt (χ2=1,73, df=1, p=0,19). Da die Generationen 0 und 1 kaum plosive Realisierungen aufweisen, ist es jedoch legitim anzunehmen, dass die bedeutenderen Unterschiede für Generation 2 gelten.
Für (v) ist in ‚russischen‘ Wortformen in ‚russischen‘ Äußerungen eine frikative, ‚russische‘ Artikulation wahrscheinlicher als in ‚hyb-riden‘ Äußerungen.
Für (sʲ) ist für ‚russische‘ Wortformen eine Interaktion zwischen der Affinität der Äußerung und Land/Stadt festzustellen (Log-Likelihood ohne Interaktion: -585,99; mit Interaktion: -583,22, χ2=5,53, df=1, p=0,0190). Die ‚russischen‘ Wortformen von den Vertretern der Generation 2 einerseits und den Vertretern der Gene-ration 0 und 1 andererseits unterscheiden sich in ‚hybriden‘ Äuße-rungen nicht. Für Generation 2 ist in ‚russischen‘ Äußerungen eine weniger posterior-alveolare und damit stärker ‚russische‘ Ausspra-che zu verzeichnen. Jüngere Sprecher realisieren (sʲ) also in ‚russi-schen‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen stärker ‚weißrussisch‘ [s"]-artig, in ‚russischen‘ Wortformen in ‚russischen‘ Äußerungen stärker [sʲ]-artig. Bei Generation 0 und 1 ist dies nicht der Fall, die CoG-Werte sind in ‚russischen‘ Äußerungen sogar leicht niedriger.
334
Geschätzter CoG-Wert von (sʲ) in ‚russischen‘ Wortformen, abhängig von der Affini-Abb. 71
tät der Äußerung (h = ‚hybrid‘, r= ‚russisch‘). Die anderen Faktoren werden auf dem Referenzwert oder dem Median gehalten.
Es zeigt sich also, dass in allen Fällen zwischen ‚weißrussischen‘ Wortfor-men in ‚weißrussischen‘ Äußerungen und solchen in ‚hybriden‘ Äußerungen kein Unterschied besteht. Auf strukturell tieferen sprachlichen Ebenen ‚Weißrussisches‘ ist auch auf der phonischen Ebene für alle Generationen ‚weißrussisch‘ (vgl. auch ZELLER & TESCH 2011). Auch für ‚russische‘ Wort-formen bestehen in einigen Fällen keine Unterschiede zwischen solchen in ‚russischen‘ und solchen in ‚hybriden‘ Äußerungen. Dies spricht für eine Lexikalisierung des phonischen Merkmals, also des ‚russischen‘ Ikanje, des (eher) ‚russischen‘ [tˢʲ] und des ‚russischen‘ [ʧʲ]. Für einige Variablen lässt sich aber doch ein Unterschied ausmachen. ‚Russische‘ Wortformen in ‚rus-sischen‘ Äußerungen neigen phonisch stärker zum Russischen. Es sind vor allem die jüngeren Sprecher, für die diese Unterschiede bestehen. Für Gene-ration 2 lassen sich für (rʲ), (g), (sʲ) und (v) die Befunde folgendermaßen darstellen:
Affinität der Wortform und der Äußerung und Realisierung von (rʲ), (g), (sʲ) und (v) Tab. 99in Generation 2
Affinität der Wortform Affinität der Äußerung Phonische Realisierung ru ru stärker ru ru hy wr wr hy wr wr wr wr
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
CoG h
rLandStadt
335
Wie sind die Kombinationen zwischen der Affinität auf strukturell tieferen Sprachebenen und der phonischen Seite zu erklären? Wenn man mit AUER (1997) davon ausgeht, dass bestimmte Kookkurrenzrestriktionen zur Kom-petenz eines Sprechers gehören, heißt dies, dass die ‚russische‘ Aussprache von auf strukturell tieferen Ebenen ‚weißrussischen‘ Äußerungen und Wort-formen etwas ist, dass nicht der (natürlich usuellen) Norm der jüngeren Spre-cher entspricht. Bei ‚russischen‘ Äußerungen und Wortformen variieren die jüngeren Sprecher dagegen und gestalten ihre Rede entweder stärker ‚weiß-russisch‘ oder stärker ‚russisch‘. In ‚hybriden‘ Äußerungen werden ‚russi-sche‘ Wortformen nicht so stark bzw. häufig ‚russisch‘ ausgesprochen, wie dies in ‚russischen‘ Äußerungen der Fall ist. Zumindest tendenziell können die Sprecher ihre Rede phonisch also stärker ‚russisch‘ gestalten. In dem gemischten Kode tun sie dies aber nicht. Wenn diese Sprecher in WRGR im engeren Sinne eine eher ‚weißrussische‘ Lautung beibehalten als in ‚russi-schen‘ Äußerungen, ist dies offensichtlich nicht darin begründet, dass sie es nicht anders können. Die Vertreter der Generation 2 unterscheiden demnach in ihrer Aussprache zwischen Kodes. Es sind also Tendenzen zu einer spezi-fischen Lautung von WRGR im engeren Sinne auszumachen.
10.4 Zum Grad der phonischen Variation in WRGR im engeren Sinne
Variation zwischen Sprechern in WRGR im engeren Sinne: Kehren wir nun zurück zur Frage, ob die Variabilität in WRGR im engeren Sinne stabil bleibt oder sich über die Generationen hinweg verändert. In Abschnitt 10.2 wurde gezeigt, dass für die Variablen (rʲ), (ʧʲ), (g) und (v) die Variation zwischen Sprechern in der jüngsten Generation zunahm, wenn die Rede dieser Spre-cher insgesamt, also der gemischte Diskurs bzw. WRGR im weiteren Sinne betrachtet wurde. Im Folgenden wird geprüft, ob diese Unterschiedlichkeit auch Bestand hat, wenn die Durchschnittswerte/Häufigkeitswerte der Spre-cher nur auf ‚hybriden‘ Äußerungen, also auf der WRGR im engeren Sinne beruhen. Es geht um die Variation der gleichen Parameter wie in Abschnitt 10.2, also des Euklidischen Abstands zu /i/ /Cʲ_ für (rʲ) und (ʧʲ) und der relati-ven Häufigkeit der ‚russischen‘ Realisierung für (v) und (g).
336
Standardabweichungen der Sprecherkennwerte in den unterschiedlichen Generatio-Tab. 100nen in ‚hybriden‘ Äußerungen
Standardabweichung in den Generationen
Generation 1 vs. Generation 2
1 2 Levene-Statistik p-Wert (ʧʲ) 0,29 0,26 0,45 0,5104 (rʲ) 0,22 0,10 3,89 0,0672 (g) 0,06 0,15 1,95 0,1748 (v) 0,10 0,29 20,09 0,0002
Es zeigt sich, dass die Generationsunterschiede in der Variation für (g), für (rʲ) und für (ʧʲ) in WRGR im engeren Sinne weniger stark sind als in WRGR im weiteren Sinne (vgl. Abschnitt 10.2). Es besteht kein signifikanter Unter-schied zwischen den Generationen mehr, für (rʲ) besteht sogar die Tendenz zu einer geringeren Variation in Generation 2. Da in Generation 2 für (rʲ) nur sechs Sprecher mit genügend Token (n>10) verbleiben, sollte der Abfall der Variation jedoch hier nicht überbewertet werden. Diese Befunde deuten darauf hin, dass die Sprecher sich in ‚hybriden‘ Äußerungen weniger stark voneinander unterscheiden. Dies ist natürlich ein Epiphänomen davon, dass auch Sprecher, die in ‚russischen‘ Äußerungen stark zur ‚russischen‘ Aus-sprache neigen, in ‚hybriden‘ noch eine recht deutlich ‚weißrussische‘ Aus-sprache zeigen. Die folgenden Abbildungen zeigen die Sprechermittelwerte von (rʲ) und für (ʧʲ) nur in ‚hybriden‘ Äußerungen. Sie bestätigen, zum einen, dass die Sprecher der Generation 2 sich in WRGR im engeren Sinne unter-einander weniger stark unterscheiden als in WRGR im weiteren Sinne (vgl. die Abbildungen in den entsprechenden Kapiteln). Zum anderen bestätigen sie, dass dies daran liegt, dass die Aussprache im Wesentlichen ‚weißrus-sisch‘ ist.
337
Durchschnittliche Formantwerte von Vokalen nach (ʧʲ) nach einem Fünftel der Dauer Abb. 72
des Vokals in ‚hybriden‘ Äußerungen (nur Sprecher mit mehr als zehn Realisierun-gen)
Durchschnittliche Formantwerte von (rʲ) in ‚hybriden‘ Äußerungen (nur Sprecher mit Abb. 73
mehr als zehn Realisierungen)
Die Tendenz zu einer ‚russischen‘ Realisierung für (v) gilt auch in ‚hybriden‘ Äußerungen. Auch in WRGR im engeren Sinne nimmt also die Variation zwischen einzelnen Sprechern in Generation 2 zu. Für (g) hingegen bleibt die ‚weißrussische‘ Realisierung in ‚hybriden‘ Äußerungen auch in der Genera-tion 2 bis auf die Ausnahme eines Sprechers recht stabil. Dementsprechend ist auch die Variation zwischen Sprechern gering.
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●●●
●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.52
1.5
10.
50
-0.5
-1-1
.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●
●
●●
●
●●
●
●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.52
1.5
10.
50
-0.5
-1-1
.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
●● ●●
●●●● ●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 2
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
●
●
●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 0
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
F2 (Lobanov-normalisiert)
●●●●●●●
●
●
●
●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 1
aja
je
i
o
u
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
●●●●●●
1.5 1 0.5 0 -0.5 -1.5
21.
51
0.5
0-0
.5-1
-1.5
Generation 2
338
Relative Häufigkeiten von [v] in ‚hybriden‘ Äußerungen (nur Sprecher mit mehr als Abb. 74
zehn Realisierungen)
Relative Häufigkeiten von [g] in ‚hybriden‘ Äußerungen (nur Sprecher mit mehr als Abb. 75
zehn Realisierungen)
Während im gemischten Diskurs – WRGR im weiteren Sinne – die Variation zwischen Sprechern in Generation 2 größer wird, bleibt die Variation zwi-schen Sprechern in WRGR im engeren Sinne also insgesamt stabil. Lediglich für die Variable (v) werden die Unterschiede zwischen einzelnen Sprechern größer.
Sprecherinterne Variation in WRGR im engeren Sinne: Kommen wir nun zur Variabilität innerhalb der Rede eines Sprechers. Die in Abschnitt 10.2 erziel-ten Befunde dürfen wie gesagt nicht von Vornherein so verstanden werden, dass die Rede von Vertretern der stärker variierenden Generation weniger „fokussiert“ sei. Dass im gemischten Diskurs, d.h. in WRGR im weiteren Sinne die Variation in der Rede von Generation 2 bei (ʧʲ) und (rʲ), in der Rede von Generation 1 bei (Jakanje1) und (tʲ) zunimmt, kann daran liegen, dass die Vertreter der Generationen zwischen ‚hybriden‘ und ‚russischen‘ Äußerun-
020
6010
0
Generation 0A
ntei
l [v]
(%
)
020
6010
0
Generation 1
020
6010
0
Generation 2
020
4060
80
Generation 0
Ant
eil [
g] (
%)
020
4060
80
Generation 1
020
4060
80
Generation 2
339
gen, mithin zwischen einem ‚gemischten‘ und einem ‚russischen‘ Kode unterscheiden. Im Folgenden wird überprüft, ob die Unterschiedlichkeit der Generationen auch Bestand hat, wenn wiederum nur die Variation innerhalb von ‚hybriden‘ Äußerungen, d.h. in gemischter Rede im engeren Sinne unter-sucht wird. Es wird für jeden Sprecher die Standardabweichung der Variab-len in ‚hybriden‘ Äußerungen gemessen. Anschließend werden diese Werte für die drei Generationen miteinander verglichen. Es wird also geprüft, ob die Vertreter der Generationen in ‚hybriden‘ Äußerungen individuell unter-schiedlich stark variieren.
Zunächst kommen wir zu der Variable, für die Generation 1 stärkere Variation aufwies als die anderen Generationen, also zu (Jakanje1).
Standardabweichungen des ersten Formanten der einzelnen Sprecher für (Jakanje1) Abb. 76
nur in ‚hybriden‘ Äußerungen in den Generationen 0, 1 und 2
Werden die Standardabweichungen nur anhand der ‚hybriden‘ Äußerungen berechnet, so bleibt das Gesamtbild zwar ähnlich wie bei der Einbeziehung aller Äußerungen, die Unterschiede zwischen den Generationen sind jedoch nicht mehr signifikant.
Regressionsanalyse für die Standardabweichung des F1, (Jakanje1) (n=32) Tab. 101
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,79 0,05 16,42 0,0001 Generation Generation 0 -0,12 0,10 -1,25 0,2214
Generation 2 -0,12 0,07 -1,59 0,1226
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(Jakanje1)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F1
340
Beim direkten Vergleich der Standardabweichungen auf der Basis aller Äu-ßerungen mit den Standardabweichungen auf der Basis nur ‚hybrider‘ Äuße-rungen zeigt sich, dass die individuellen Standardabweichungen der Vertreter der Generation 1 für (Jakanje1) in ‚hybriden‘ Äußerungen marginal signifi-kant niedriger sind als die Standardabweichungen dieser Sprecher in der Gesamtmenge der Äußerungen (t=1,90; df=14; p=0,0784). Es besteht also eine Tendenz, dass Vertreter der Generation 1 in ‚hybriden‘ Äußerungen weniger stark variieren als in der Gesamtmenge der Äußerungen.
Kommen wir nun zu den Variablen, für die Generation 2 stärkere Varia-tion aufwies als die anderen Generationen, also zu (rʲ) und (ʧʲ).
Standardabweichungen der einzelnen Sprecher für den zweiten Formanten von (ʧʲ) Abb. 77
und (rʲ) nur in ‚hybriden‘ Äußerungen in den Generationen 0, 1 und 2
Auch für die Variablen (ʧʲ) und (rʲ) findet sich, was die Höhe der Stan-dardabweichungen angeht, zwischen den Generationen kein Unterschied mehr, wenn die Standardabweichung nur anhand ‚hybrider‘ Äußerungen berechnet wird.
Regressionsanalyse für die Standardabweichungen des F2, (ʧʲ) (n=26) Tab. 102
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,50 0,04 11,10 0,0001 Generation Generation 0 0,05 0,10 0,54 0,5628
Generation 2 0,11 0,07 1,43 0,1686
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(ʧʲ)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F2
0 1 2
0.0
0.4
0.8
1.2
(rʲ)
Sta
ndar
dabw
eich
ung
F2
341
Regressionsanalyse für die Standardabweichungen des F2, (rʲ) (n=21) Tab. 103
Koeffizient SE t-Wert p-Wert (Konstante) 0,36 0,02 18,27 0,0001 Generation Generation 0 0,02 0,04 0,42 0,7072
Generation 2 -0,01 0,03 -0,32 0,7486
Allerdings wird im direkten Vergleich nur für (rʲ) in ‚hybriden‘ Äußerungen die Standardabweichung der Generation 2 marginal signifikant niedriger (t=2,32, df=6, p=0,0592). Für (ʧʲ) ist kein solcher Unterschied festzustellen.
Der Befund, dass die jüngere Generation in ihrer Rede für (rʲ) und (ʧʲ) stärker variiert als die älteren Generationen, verschwindet also, wenn nur die Variation in ‚hybriden‘ Äußerungen betrachtet wird. Gleiches gilt für (Jakanje1) in Bezug auf die Generation 1, für das Vertreter der Generation 1 in der Gesamtmenge der Äußerungen stärker individuell variierten. Für (Jakanje1) und (rʲ) bestätigt sich (bei marginaler Signifikanz) auch im direk-ten Vergleich von ‚hybriden‘ Äußerungen mit der Gesamtmenge an Äuße-rungen, dass Generation 1 für (Jakanje1), Generation 2 für (rʲ) in ‚hybriden‘ Äußerungen weniger stark variiert als in der Gesamtmenge der Äußerungen. Dies lässt darauf schließen, dass extreme Werte für diese Variablen vor allem in ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Äußerungen auftreten, in ‚hybriden‘ die Realisierungen der phonischen Variablen weniger stark in Richtung des ‚rus-sischen‘ oder ‚weißrussischen‘ Pols gehen. Auch dies ist ein Indiz für die Eigenständigkeit des gemischten Kodes.
10.5 Zum Zusammenhang zwischen den phonischen Variablen
Eine Frage, der in kontaktlinguistischen Arbeiten selten nachgegangen wird, ist, ob die Variation der einzelnen untersuchten Variablen unabhängig von-einander erfolgt oder ob es Zusammenhänge zwischen ihnen gibt. In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, ob Sprecher, die für eine der hier untersuchten phonischen Variablen eher zum ‚Russischen‘ oder zum ‚Weiß-russischen‘ tendieren, dies auch für die anderen Variablen tun, bzw. für wel-che Variablen sie dies auch tun.
Dies erlaubt zunächst eine Klassifizierung der phonischen Variablen nach dem Grad des Zusammenhangs untereinander, die sich – wie gezeigt werden wird – nach der phonetischen Natur der Variable richtet. Es stellt sich also heraus, dass es gewisse „Metavariablen“ (etwa „posteriore Artikulation von vorderen Sibilanten“) gibt. Aus einer sprecherbezogenen Perspektive zeigt diese Analyse, dass es auch innerhalb ein und derselben Generation Unter-
342
schiede zwischen den Sprechern gibt, die bisher nicht erfasst wurden, dass einige Sprecher insgesamt phonisch stärker zum Russischen neigen als andere. Dies leitet dann zum nächsten Abschnitt über, in dem es um den Zusammenhang mit „Sprechertypen“ geht.
Für diese Analyse wird für jeden Sprecher für jede Variable ein Messwert genommen, der die Nähe des Sprechers zum ‚Russischen‘ bzw. ‚Weißrussi-schen‘ abbildet. Diese Messwerte bilden eine Skala, die auf Korrelationen mit anderen Skalen geprüft wird. Dies wird zunächst für alle Sprecher, dann für die Generationen getrennt vorgenommen. Folgende Werte werden als Kennzahlen genommen (vgl. Tabelle 138 im Anhang):
Für Akanje1 und Akanje2: Die euklidische Distanz zu /a/ /C0_ Für Jakanje1 und Jakanje2: Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (ʧʲ): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (rʲ): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (sʲ), (tʲ) und (dʲ): Der normalisierte CoG-Wert Für (v) und (g): Die relative Häufigkeit der ‚russischen‘ Realisie-
rung
Die Werte für (Akanje1) und (Akanje2), die Sibilanten, (v) und (g) wurden mit -1 multipliziert, so dass für alle Variablen niedrigere Werte stärker ‚russi-sche’ Realisierungen bedeuten. Positive Koeffizienten bedeuten dadurch in den folgenden Tabellen stets, dass eine stärker ‚weißrussische‘ Realisierung der einen Variable bei den Sprechern mit einer stärker ‚weißrussischen‘ bei der anderen Variable einhergeht, eine stärker ‚russische‘ mit einer stärker ‚russischen‘. Für die Variable (rʲ) werden die Sprecher aus Chocimsk auf-grund des abweichenden dialektalen Hintergrunds ausgelassen.192
Tabelle 104 zeigt die Korrelationsmatrix der elf untersuchten Variablen (oben Pearsons Korrelationskoeffizient r, darunter der dazugehörige p-Wert):
192 Die Zusammenhänge zwischen den sibilantischen Variablen waren in Abschnitt 6.3 schon
gezeigt worden. Sie werden hier wiederholt. Jedoch werden hier die Sprecher sa_M und ra_D aus den in Abschnitt 6.3 genannten Gründen ausgeschlossen.
343
Zusammenhänge zwischen den elf untersuchten Variablen, alle Sprecher. Die Grau-Tab. 104töne beziehen sich auf die Stärke des Zusammenhangs (r>0,3; >0,4; >0,5; >0,6; >0,7).
Ak1 Ak2 Jak1 Jak2 rʲ ʧʲ g v sʲ tʲ dʲ Ak1 r 0,32 0,65 0,17 0,36 0,51 0,50 0,45 -0,09 0,10 -0,05 p 0,07 0,00 0,38 0,07 0,00 0,00 0,01 0,64 0,60 0,80Ak2 r 0,32 0,08 0,14 -0,10 0,11 0,06 0,08 -0,12 0,02 0,17 p 0,07 0,65 0,48 0,64 0,56 0,73 0,67 0,51 0,93 0,37Jak1 r 0,65 0,08 -0,01 0,49 0,57 0,38 0,56 0,33 0,44 -0,04 p 0,00 0,65 0,95 0,01 0,00 0,03 0,00 0,07 0,01 0,85Jak2 r 0,17 0,14 -0,01 0,38 0,11 0,11 -0,27 -0,05 -0,24 -0,15 p 0,38 0,48 0,95 0,07 0,56 0,59 0,16 0,82 0,23 0,45rʲ r 0,36 -0,10 0,49 0,38 0,67 0,56 0,44 0,44 0,39 -0,08 p 0,07 0,64 0,01 0,07 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 0,72ʧʲ r 0,51 0,11 0,57 0,11 0,67 0,55 0,61 0,30 0,41 0,04 p 0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,11 0,03 0,84g r 0,50 0,06 0,38 0,11 0,56 0,55 0,60 0,10 0,18 -0,31 p 0,00 0,73 0,03 0,59 0,00 0,00 0,00 0,60 0,34 0,09v r 0,45 0,08 0,56 -0,27 0,44 0,61 0,60 0,46 0,47 -0,06 p 0,01 0,67 0,00 0,16 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,75sʲ r -0,09 -0,12 0,33 -0,05 0,44 0,30 0,10 0,46 0,71 0,41 p 0,64 0,51 0,07 0,82 0,03 0,11 0,60 0,01 0,00 0,02tʲ r 0,10 0,02 0,44 -0,24 0,39 0,41 0,18 0,47 0,71 0,52 p 0,60 0,93 0,01 0,23 0,06 0,03 0,34 0,01 0,00 0,00dʲ r -0,05 0,17 -0,04 -0,15 -0,08 0,04 -0,31 -0,06 0,41 0,52 p 0,80 0,37 0,85 0,45 0,72 0,84 0,09 0,75 0,02 0,00
Zwischen vielen der Variablen bestehen Zusammenhänge. Am deutlichsten sind die „binären“ Zusammenhänge zwischen (Jakanje1) und (Akanje1), zwischen (rʲ) und (ʧʲ), (v) und (ʧʲ), (v) und (g), sowie zwischen (sʲ) und (tʲ). Sprecher, die für eine der Variablen zum ‚Russischen‘ tendieren, tun dies also auch für die andere. Zwischen (Akanje1), (Jakanje1), (rʲ), (ʧʲ), (v), (g) bestehen ansonsten durchgehend mittelstarke Zusammenhänge. (sʲ) und (tʲ) weisen auch mit (dʲ) einen Zusammenhang auf, das sonst mit keiner Variab-len korreliert. Zwischen den sibilantischen Variablen einerseits und den übrigen Variablen andererseits bestehen eher schwächere Zusammenhänge, zwischen den Sibilanten einerseits und (g) und (Akanje1) andererseits sind keine Zusammenhänge erkennbar. Die vokalischen Variablen in nicht un-mittelbar vorbetonten Silben weisen kaum Zusammenhänge mit anderen Variablen auf. Dies mag zum einen daran liegen, dass dialektale Gegeben-heiten des Weißrussischen mit dem Russischen zusammenfallen und daher auch Sprecher, die sonst phonisch eher zum Weißrussischen tendieren, eine
344
mit dem Russischen zusammenfallende Artikulation aufweisen. Zum anderen waren hier nur geringe Unterschiede zwischen den Sprechern festzustellen.
Die Mehrdimensionalität dieser Zusammenhänge zwischen den Variablen lässt sich mithilfe einer Clusteranalyse reduzieren und visualisieren.193
Hierarchische Struktur der elf untersuchten Variablen, mit Pearsons r2 als Zusam-Abb. 78
menhangsmaß
Es zeigen sich deutlich drei Cluster bzw. Gruppen von Variablen: die nicht unmittelbar vorbetonten Vokale (I), die sibilantischen Variablen (II) und die übrigen Variablen (III). Ob eine Person für die Variable (sʲ) zu einer ‚russi-schen‘ oder ‚weißrussischen‘ Aussprache neigt, hängt also stark damit zusammen, ob sie für (tʲ) zu einer ‚russischen‘ Aussprache neigt. Ob eine Person bei den Sibilanten eher zu einer ‚russischen‘ oder ‚weißrussischen‘ Realisierung neigt, hängt insgesamt betrachtet dann weniger damit zusam-men, wohin sie für die Variablen des Clusters III tendiert. Innerhalb des Clusters III bilden die beiden vokalischen Variablen eine Gruppe, die Vari-ablen (rʲ) und (ʧʲ) eine zweite, und (g) und (v) eine dritte. Auch in dieser Ansicht bestätigt sich, dass die vorbetonten Vokale kaum mit den übrigen
193 Diese Analyse geschieht mithilfe der Funktion varclus des Hmisc-Packages in R (HMISC
2012). Diese Funktion nutzt bestimmte Maßzahlen für Korrelationen zwischen Variablen (hier: Pearsons r2), um Variablen in Cluster zusammenzufügen (vgl. BAAYEN 2008, 182f.).
(Aka
nje
2)
(Jak
anje
2)
(dʲ)
(sʲ)
(tʲ)
(Jak
anje
1)
(Aka
nje
1)
(rʲ)
(ʧʲ)
(g)
(v)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Pea
rsonr2
I II III
345
Variablen zusammenhängen, wobei natürlich wie oben gesehen Korrelatio-nen mit einzelnen Variablen der anderen Cluster vorhanden sind.
Es fällt auf, dass die Cluster bzw. Variablenpaare sich mit der phoneti-schen Natur des Merkmals, auf denen die Variablen operieren, in Verbindung bringen lassen.
Die Variablen (tʲ) und (sʲ) – und auch (dʲ), das am ehesten mit diesen korreliert – betreffen das Merkmal der posterior-alveolaren Artiku-lation der palatalisierten vorderen Sibilanten.
Bei den vokalischen Variablen (Jakanje1) und (Akanje1) geht es jeweils um eine Reduktion des Vokals im Sinne einer zentraleren Realisierung oder einer stärkeren Akkommodation an die Palatalität des benachbarten Konsonanten.
Trotz ihrer phonologischen Unterschiedlichkeit betreffen (rʲ) und (ʧʲ) beide die Palatalität: In beiden Fällen ist die ‚russische‘ Variante palatalisiert.
Das gemeinsame Moment von (g) und (v) ist die konsonantische Stärke (LASS 1984, 177). In beiden Fällen ist die ‚russische‘ Vari-ante die konsonantisch stärkere, der Übergang zum ‚russischen‘ Muster stellt also eine Fortition dar.
Letztlich geben diese Cluster das Verhalten der Sprecher wieder. Auch wenn insgesamt zwischen vielen einzelnen Variablen Zusammenhänge bestehen, die Tendenz der Sprecher zum Russischen/Weißrussischen also relativ unabhängig von der phonetischen Natur der Variablen ist, zeigt sich ein Ein-fluss der Phonetik darin, welche Variablen stärker miteinander korrelieren. Gerade bei phonetisch verwandten Variablen verhalten sich die Sprecher also recht einheitlich. Ob solche phonetischen Faktoren auch in anderen Konstel-lationen eine Rolle spielen, wäre an anderen (nicht-slavischen) Kontaktsitua-tionen zu überprüfen.
Angesichts der Tatsache, dass mit Generation für die meisten Variablen zumindest eine gemeinsame signifikante erklärende Variable besteht, ist nicht überraschend, dass Zusammenhänge zwischen den Variablen bestehen. Interessanter ist es, ob innerhalb einer Generation einige Sprecher stets zum Russischen, andere zum Weißrussischen tendieren, ob es also Zusammen-hänge gibt, die über die bisher erfassten hinausgehen. Dies gilt vor allem für die Generation 2, da vor allem für diese Unterschiede in der Realisierung zur
346
älteren Generation zu beobachten sind. (Akanje2) und (Jakanje2) werden im Folgenden nicht mehr berücksichtigt.
Zusammenhänge zwischen den Variablen in Generation 2. Die Grautöne beziehen Tab. 105sich auf die Stärke des Zusammenhangs bei wenigstens marginaler Signifikanz (r>0,3; >0,4; >0,5; >0,6; >0,7; >0,8).
Ak1 Jak1 rʲ ʧʲ g v sʲ tʲ dʲ Ak1 r 0,41 0,56 0,46 0,62 0,01 -0,16 0,06 -0,20 p 0,161 0,076 0,133 0,025 0,970 0,610 0,837 0,514 Jak1 r 0,41 0,74 0,57 0,26 0,16 0,50 0,55 0,18 p 0,161 0,010 0,053 0,384 0,591 0,083 0,051 0,564 rʲ r 0,56 0,74 0,87 0,61 0,31 0,16 0,34 -0,07 p 0,076 0,010 0,001 0,046 0,361 0,643 0,302 0,844 ʧʲ r 0,46 0,57 0,87 0,62 0,54 0,32 0,43 -0,01 p 0,133 0,053 0,001 0,031 0,067 0,316 0,163 0,980 g r 0,62 0,26 0,61 0,62 0,59 -0,02 0,18 -0,43 p 0,025 0,384 0,046 0,031 0,033 0,954 0,550 0,146 v r 0,01 0,16 0,31 0,54 0,59 0,47 0,53 -0,01 p 0,970 0,591 0,361 0,067 0,033 0,106 0,061 0,978 sʲ r -0,16 0,50 0,16 0,32 -0,02 0,47 0,83 0,70 p 0,610 0,083 0,643 0,316 0,954 0,106 0,000 0,007 tʲ r 0,06 0,55 0,34 0,43 0,18 0,53 0,83 0,70 p 0,837 0,051 0,302 0,163 0,550 0,061 0,000 0,008 dʲ r -0,20 0,18 -0,07 -0,01 -0,43 -0,01 0,70 0,70 p 0,514 0,564 0,844 0,980 0,146 0,978 0,007 0,008
Wiederum bestehen unter den Variablen (Jakanje1), (Akanje1), (rʲ), (ʧʲ), (v) und (g) signifikante oder marginal-signifikante Korrelationen, jedoch nicht durchgängig. Keine Korrelationen bestehen zwischen (Akanje1) und (Jakanje1), (Akanje1) und (ʧʲ), (Akanje1) und (v), (Jakanje1) und (g), (Jakanje1) und (v) und zwischen (rʲ) und (v). Unter den Sibilanten bestehen ebenfalls Korrelationen. (sʲ) und (tʲ) korrelieren zudem marginal signifikant mit (Jakanje1), (tʲ) außerdem marginal signifikant mit (v). Die Signifikanz-werte fallen etwas schlechter aus, was natürlich auch daran liegt, dass weni-ger Fälle in die Korrelationsanalyse eingehen (n=13). Die Korrelationskoeffi-zienten der signifikanten Korrelationen sind jedoch höher als für das gesamte Sample, die Zusammenhänge sind in Generation 2 also stärker. Es gibt also auch in ein und derselben Generation Unterschiede zwischen Sprechern, die für einige Variablen relativ konstant zum Russischen tendieren, und solchen, die dies nicht tun. Dies deutet an, dass neben der Generation weitere Faktoren eine Rolle spielen. Hierauf wird im Folgenden Abschnitt näher eingegangen. Es zeichnet sich wieder die Aufteilung in die sibilantischen Variablen einer-seits und die übrigen andererseits ab.
347
Folgende Tabelle zeigt die Korrelationsmatrix für Generation 1:
Zusammenhänge zwischen den Variablen in Generation 1. Die Grautöne beziehen Tab. 106sich auf die Stärke des Zusammenhangs bei wenigstens marginaler Signifikanz (>0,5; >0,6).
Ak1 Jak1 rʲ ʧʲ g v sʲ tʲ dʲ Ak1 r 0,57 -0,22 0,27 0,05 0,24 -0,56 -0,25 0,12 p 0,026 0,525 0,348 0,849 0,380 0,036 0,391 0,676 Jak1 r 0,57 0,12 0,22 0,05 0,56 -0,14 0,17 -0,27 p 0,026 0,722 0,444 0,852 0,029 0,624 0,557 0,342 rʲ r -0,22 0,12 0,28 -0,40 0,08 0,63 0,36 -0,09 p 0,525 0,722 0,397 0,219 0,810 0,039 0,270 0,801 ʧʲ r 0,27 0,22 0,28 -0,04 0,34 -0,01 0,22 0,31 p 0,348 0,444 0,397 0,890 0,232 0,962 0,458 0,287 g r 0,05 0,05 -0,40 -0,04 -0,16 -0,21 -0,31 -0,10 p 0,849 0,852 0,219 0,890 0,558 0,480 0,285 0,739 v r 0,24 0,56 0,08 0,34 -0,16 0,09 0,25 -0,32 p 0,380 0,029 0,810 0,232 0,558 0,769 0,396 0,269 sʲ r -0,56 -0,14 0,63 -0,01 -0,21 0,09 0,59 0,04 p 0,036 0,624 0,039 0,962 0,480 0,769 0,028 0,880 tʲ r -0,25 0,17 0,36 0,22 -0,31 0,25 0,59 0,28 p 0,391 0,557 0,270 0,458 0,285 0,396 0,028 0,325 dʲ r 0,12 -0,27 -0,09 0,31 -0,10 -0,32 0,04 0,28 p 0,676 0,342 0,801 0,287 0,739 0,269 0,880 0,325
Sofort wird deutlich, dass für Generation 1 weniger Zusammenhänge zwi-schen den Variablen bestehen. Dies ist plausibel, ist doch die Variation zwi-schen den Sprechern gering. Es sind bezeichnenderweise wieder einerseits phonisch ähnliche Variablen, die miteinander korrelieren: (Akanje1) und (Jakanje1), (sʲ) und (tʲ). Andererseits korrelieren mit (Jakanje1) und (v) zwei Variablen, für die auch für Generation 1 ein relativ deutlicher Einfluss des Russischen zu erkennen ist. Warum ein Zusammenhang zwischen (sʲ) und (rʲ) besteht, ist unklar. Auch die negative Korrelation zwischen (Akanje1) und (sʲ) kann nicht erklärt werden.
Zusammenfassung: In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass die phonischen Variablen miteinander korrelieren. Dies bedeutet, dass bei Sprechern, die für eine Variable eher zu einer ‚russischen‘ Realisierung tendieren, auch für andere Variablen eine eher ‚russische‘ Aussprache wahrscheinlich ist. Dies gilt nicht nur für die Gesamtmenge der Sprecher, sondern auch innerhalb von Generation 2. Bei Generation 1 sind die Zusammenhänge dagegen weniger ausgeprägt, was plausibel ist, da hier die Sprecher größtenteils bei einer ‚weißrussischen‘ Lautung bleiben. Es wurde zudem gezeigt, dass die
348
Zusammenhänge zwischen denjenigen Variablen am stärksten sind, die auf ein und demselben phonetischen Parameter oder auf verwandten phoneti-schen Parametern beruhen. Dies bedeutet, dass Sprecher nicht für alle Vari-ablen gleichermaßen zum Russischen tendieren, sondern dass sie dies vor allem für phonetisch ähnliche Variablen tun. Es stellen sich also „Meta-variablen“ heraus: Posteriore Artikulation von vorderen palatalisierten Sibi-lanten, Vokalreduktion, Palatalisierung und Lenition. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass im Verhalten der Variablen einer Metavariable Unterschiede bestehen können, wenn nach den Kodes Weißrussisch, Rus-sisch und WRGR differenziert wird.
Dass auch Sprecher ein und derselben Generation sich untereinander unterscheiden, soll im Folgenden näher untersucht werden. Hierbei wird auf den Zusammenhang mit dem Sprachverhalten der Sprecher auf strukturell tieferen Sprachebenen eingegangen.
10.6 Sprechertypen
Der in dem vorangehenden Abschnitt beschriebene Befund, dass Korrelatio-nen zwischen Messwerten der Variablen bestehen, bedeutet, dass einige Sprecher grundsätzlich phonisch eher zu einer ‚russischen‘, andere eher zu einer ‚weißrussischen‘ Lautung neigen. Dies war zu erwarten, da mit Gene-ration für die meisten Variablen zumindest ein gemeinsamer erklärender Faktor besteht. Darüber hinaus bestehen auch innerhalb von Generation 2 Korrelationen zwischen den Variablen. Dies sind also systematische Unter-schiede, die unabhängig (bzw. innerhalb) von der Sprechergeneration be-stehen. In diesem Abschnitt wird geprüft, ob diese Unterschiede innerhalb der Generationen damit zusammenhängen, ob die Sprecher auf strukturell tieferen Sprachebenen eher zum ‚Russischen‘ oder zum ‚Hybriden‘ und ‚Weißrussischen‘ neigen.
Auch wenn solche Zusammenhänge natürlich plausibel sind, gibt es er-staunlich wenige Untersuchungen, die der Frage nachgehen, ob Sprecher oder Sprechergruppen, die auf der einen Sprachebene zu einer Varietät nei-gen, auch auf anderen Sprachebenen zu dieser Varietät tendieren. CHESHIRE, KERSWILL & WILLIAMS (2005, 135) bemerken:
We still do not know […] whether generalisations concerning the spread of sound change apply equally well to other types of language change, nor whether stable linguistic variation in phonology, gram-
349
mar, and discourse features has a similar sociolinguistic distribution within a community. (CHESHIRE, KERSWILL & WILLIAMS 2005, 135)
In ihrer eigenen Untersuchung finden CHESHIRE, KERSWILL & WILLIAMS (2005) auf der Ebene von sozialen Gruppen einen solchen Zusammenhang zwischen der Variation auf der morphologischen und der Variation auf der phonischen Ebene.
HENTSCHEL & ZELLER (2012) zeigen, dass sich die zentralen Sprecher des OK-WRGR anhand der relativen Häufigkeiten ihrer ‚weißrussischen‘, ‚russi-schen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen in vier Cluster bzw. Sprechertypen teilen.
Sprecher mit sowohl einem relativ hohen Anteil an ‚weißrussischen‘ als auch an ‚hybriden‘ Äußerungen (Typ HW), wobei ‚hybride‘ überwiegen;
Sprecher mit einem Übergewicht an ‚hybriden‘ Äußerungen (Typ H);
Sprecher mit sowohl einem hohen Anteil an ‚russischen‘ als auch an ‚hybriden‘ Äußerungen (Typ HR);
Sprecher mit einem deutlichen Übergewicht an ‚russischen‘ Äuße-rungen (Typ R).
Bei der Klassifikation der Äußerungen als ‚weißrussisch‘, ‚russisch‘, ‚hybrid‘ und ‚gemeinsam‘ – und damit auch bei der Einteilung in Sprechertypen – wurde von der phonischen Seite der Äußerung abstrahiert. Berücksichtigt wurden nur die strukturell tieferen Sprachebenen der Lexik, Morphologie, Morphonologie und Morphosyntax. Die Zugehörigkeit zu diesen Typen kor-reliert mit dem Kriterium der Binnenmigration bzw. der Generation, also damit, ob die Sprecher (annähernd) ihr gesamtes Leben in ländlichen Gebie-ten verbracht haben, als junge Erwachsene in die Städte gezogen sind oder bereits in den Städten aufgewachsen sind. Die Verteilung dieser Sprechertypen auf die hier untersuchten Sprecher der drei Generationen wurde bereits in Tabelle 14 (Abschnitt 4.4) gezeigt, die hier als Tabelle 107 wiederholt wird.
Verteilung der hier untersuchten Sprecher auf Sprechertypen (nach der Klassifizie-Tab. 107rung in HENTSCHEL & ZELLER 2012)
Sprechertyp: Generation
HW H HR R k.A.
0 4 1 0 0 1 1 5 6 4 0 0 2 0 1 4 7 1 gesamt 9 8 8 7 2
350
In diesem Abschnitt wird zwei Fragen nachgegangen: Erstens, ob sich Ver-treter der gleichen Generation im phonischen Bereich unterscheiden, je nach-dem, zu welchem Sprechertyp sie gehören.194 Zweitens, ob sich Sprecher des gleichen Typs unterscheiden, je nachdem, zu welcher Generation sie gehören. Die Analyse konzentriert sich auf die Generationen 1 und 2.
Unterschiede zwischen unterschiedlichen Sprechertypen der gleichen Gene-ration: Zunächst sei auf die Frage eingegangen, ob diejenigen Sprecher in Generation 2, die auf strukturell tieferen Ebenen verhältnismäßig stärker zum ‚Weißrussischen‘ bzw. ‚Hybriden‘ neigen, auch zu einer stärker ‚weißrussi-schen‘ Artikulation tendieren. Einen ersten Hinweis liefert die folgende Tabelle. Sie zeigt die Ranglisten der Sprecher für die einzelnen Variablen, wobei höhere Ränge eher ‚russische‘, niedrigere eher ‚weißrussische‘ Werte bedeuten. Die nicht unmittelbar vorbetonten Vokale werden nicht berück-sichtigt. Anders als in ZELLER (2013a) werden folgende Werte zur Berech-nung der Rangfolgen gewählt (dieselben wie im vorangegangenen Abschnitt, vgl. Tabelle 138 im Anhang).
Für (Akanje1): Die euklidische Distanz zu /a/ /C0_ Für (Jakanje1): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (ʧʲ): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (rʲ): Die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_ Für (sʲ), (tʲ) und (dʲ): Der normalisierte CoG-Wert Für (v) und (g): Die relative Häufigkeit der ‚russischen‘ Realisie-
rung
Diese Werte beruhen auf allen Äußerungen (wie auch die Sprechertypen notwendigerweise auf allen Äußerungen beruhen). Bei Ranggleichheit wird der Durchschnittsrang genommen:
194 Der Sprecher in Generation 2, für den „keine Angabe“ notiert ist, ist Sprecher ak_Q. Als
nicht-zentraler Sprecher mit nur 108 Äußerungen ist dieser nicht in die Clusteranalyse bei HENTSCHEL & ZELLER (2012) eingegangen. Mit einem Anteil von 8,3% ‚weißrussischen‘ Äußerungen (n=9) und einem ausgeglichenen Verhältnis von ‚hybriden‘ (39,8%, n=43) und ‚russischen‘ (37,9%, n=40) wird er in den folgenden Analysen dem Typ HR zugeordnet (dessen Clusterzentren sind 11,0% ‚weißrussische‘ Äußerungen, 34,1% ‚hybride‘ und 39,7% ‚russische‘ Äußerungen, vgl. HENTSCHEL & ZELLER 2012, 203).
351
Rangfolgen der Vertreter der Generation 2 bei den einzelnen Variablen und Zusam-Tab. 108menhang mit dem Sprechertyp
Sprecher Typ Jak1 Ak1 rʲ ʧʲ g v sʲ tʲ dʲ Mittlerer Rang
ak_D R 2 1 1 1 2 2 5 8 11 3,67 ba_V R 4 9 4 2 3 6 2 2 5 4,11 mi_F R 6 2 2 3 1 1 9 5 10 4,33 ch_N R 1 5 k.A. 4 9 9 4 3 3 4,75 mi_Y R 5 12 9 11 8 5 1 1 1 5,89 ak_Q HR 7 3 3 k.A. 11,5 12 10 4 2 6,56 ba_B R 9 4 10 6 4 4 7 7 9 6,67 ra_A HR 8 7 6 8 11,5 7 3 6 4 6,72 ra_C R 10 13 5 5 11,5 3 6 9 6 7,61 sa_I HR 13 11 7 9 6 10 8 10 8 9,11 sa_N HR 11 6 11 7 7 11 11 11 7 9,11 ch_R HR 3 8 k.A. 10 11,5 13 12 12 12 10,19 sm_AF H 12 10 8 12 5 8 13 13 13 10,44
Die fünf Vertreter der Generation 2 mit den „stärksten russischen“ Rangzah-len gehören zum Typ R. Die vier Sprecher mit den „stärksten weißrussi-schen“ Rangzahlen gehören zum Typ HR oder H. Es ist also ein Zusammen-hang erkennbar: Sprecher, die auf strukturell tieferen Sprachebenen zum Russischen tendieren, tun dies auch auf der phonischen Ebene.195
Für die Generation 1 ist kein solcher Zusammenhang feststellbar.196 Zwar treten Vertreter des auf strukturell tieferen Ebenen am stärksten zum Weiß-russischen neigenden Typs HW nicht in der oberen Hälfte der Rangfolge auf. Unter den fünf Sprechern mit den „stärksten weißrussischen“ Rängen sind jedoch drei Vertreter des Typs HR.
195 Eine Regressionsanalyse mit der mittleren Rangzahl als abhängiger Variable und dem
Sprechertyp als ordinalskalierter Variable ergibt, dass stärker ‚russische‘ Sprechertypen niedrigere Ränge einnehmen (Koeffizient=-3,64; Standardfehler=1,15; t=-3,16; p=0,0102). Nebenbei bemerkt findet sich kein Hinweis, dass die fünf Exploratorinnen, die die Auf-nahmen durchführten und der Generation 2 zuzurechnen sind, sich anders verhalten als die übrigen Vertreter der Generation 2 (t=0,65; p=0,53).
196 Eine Regressionsanalyse mit der mittleren Rangzahl als abhängiger Variable und dem Sprechertyp als ordinalskalierter Variable ergibt keinen Zusammenhang (Koeffi-zient=-0,09; Standardfehler=0,84; t=-0,11; p=0,91).
352
Rangfolgen der Vertreter der Generation 1 bei den einzelnen Variablen und Zusam-Tab. 109menhang mit dem Sprechertyp
Spr. Typ Jak1 Ak1 rʲ ʧʲ g v sʲ tʲ dʲ Mittlerer Rang
ba_A HR 4 7 4 2 9 1 2 3 10 4,67 ra_L H 6 5 3 3 13,5 5 5 2 1 4,83 ak_M H 1 1 5 5 3 11 10 6 6 5,33 ba_P H 7 4 7 1 11 6 11 4 3 6,00 mi_A H 10 9 2 4 8 3 8 7 13 7,11 sm_A H 13 13 9 10 2 8 3 5 4 7,44 ra_S HW 12 8 1 8 13,5 12 1 9 5 7,72 sm_C HW 3 11 k.A. 7 1 10 9 10 11 7,75 sm_B HW 5 3 8 14 4 4 12 13 7 7,78 ak_P H 2 2 10 6 10 2 14 14 12 8,00 mi_B HR 9 12 6 12 7 7 7 11 9 8,89 ch_A HR 8 15 k.A. 13 13,5 9 4 1 8 8,94 sa_M HW 14 6 k.A. k.A. 5 13 k.A. k.A. k.A. 9,50 sa_T HW 15 10 11 9 6 15 13 12 2 10,33 ch_C HR 11 14 k.A. 11 13,5 14 6 8 14 11,44
Noch stärker als in Generation 2 beruhen die Rangzahlen für Generation 1 auf kleinen Unterschieden. In Abschnitt 10.2 war gezeigt worden, dass die Variation in (rʲ), (ʧʲ), (g) und (v) in Generation 1 geringer ist als in Genera-tion 2. Auch das weitgehende Fehlen von signifikanten Unterschieden zu Generation 0 deutete an, dass Generation 1 unabhängig vom Sprechertyp bei einer stark ‚weißrussischen‘ Lautung bleibt. Dies bestätigt sich hier. Es ist ein großer Zufallsfaktor bei der Ermittlung der Ränge dabei, der Unterschied zwischen benachbarten Rängen hat wenig Aussagekraft, so dass die mittlere Rangzahl ebenfalls einem hohen Zufallsfaktor unterliegt.
Für Generation 2, für die anders als für Generation 1 ein Zusammenhang mit dem Sprechertyp vorliegt, gilt es zu überprüfen, wo die Zusammenhänge im Einzelnen liegen. Dazu werden die Modelle aus den Einzelanalysen in den Kapiteln 5 bis 9 auf Sprecher der Generation 2 reduziert und um die Angabe des Sprechertyps erweitert. In die Mehrebenenmodelle in diesem Abschnitt gehen wieder dieselben Faktoren wie in den bisherigen Analysen in den Einzelkapiteln ein. Da Typ H nur durch einen Sprecher vertreten ist, werden Sprechertyp HR und H zusammengefasst und als Referenzwert mit Sprechern
353
des Typs R verglichen.197 Aus Platzgründen finden sich die einzelnen Analy-sen im Anhang. Hier wird nur eine Übersicht der Ergebnisse gezeigt:
Unterschiede zwischen Sprechertypen in Generation 2. Der Operator „<“ zeigt, dass Tab. 110das rechtsseitige Argument des Operators für die jeweilige phonische Variable stär-ker zum Russischen neigt (Signifikanzniveaus: +: ≤0,10; *: ≤0,05; **: ≤0,01; ***: ≤0,001). Der Operator „=“ zeigt, dass kein signifikanter Unterschied besteht.
HR/H vs. R (Akanje1): F1 HR/H = R (Jakanje1): F1; F2 HR/H < R+; HR/H < R+ (sʲ): CoG HR/H < R** (tʲ): CoG HR/H < R** (dʲ ): CoG HR/H = R (ʧʲ): F2 HR/H < R* (rʲ): F2 HR/H = R (g) HR/H = R (v) HR/H < R***
(Marginal) signifikante Unterschiede zwischen den Sprechertypen finden sich für (Jakanje1), (ʧʲ), (sʲ), (tʲ) und (v). Diese Unterschiede zwischen den Sprechertypen sind wohlgemerkt kein mathematischer Nebeneffekt davon, dass diese Sprecher mit unterschiedlicher Häufigkeit ‚weißrussische‘, ‚hyb-ride‘ und ‚russische‘ Äußerungen produzieren. Die Affinität der Äußerung wird in den Modellen kontrolliert. Auch unabhängig vom Typ der Äußerung produzieren Sprecher des Typs R also stärker [i]-artige Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Position, [i]-artige Formanteneinstiege nach (ʧʲ), häufiger frikative Realisierungen von (v) und weniger stark posterior-alveolare Sibi-lanten als Vertreter des Typs HR. Es zeigt sich also, dass die erste eingangs gestellte Frage, ob sich Vertreter der gleichen Generation im phonischen Bereich unterscheiden, je nachdem, zu welchem Sprechertyp sie gehören, für diese Variablen zu bejahen ist.
Unterschiede zwischen gleichen (bzw. vergleichbaren) Sprechertypen unter-schiedlicher Generation: Kommen wir nun zur zweiten eingangs gestellten Frage: Verhalten sich Sprecher des gleichen Typs, die zu unterschiedlichen Generationen gehören, auf der phonischen Ebene unterschiedlich? Hierzu werden Vertreter des Sprechertyps HR in Generation 2 mit Vertretern der Generation 1 verglichen. In der Generation 1 wird nicht nach Sprechertypen
197 Da hier nur ein oder zwei Sprecher pro Familie in die Modelle einfließen, wird Familie in
diesen Analysen nicht als Zufallsfaktor in die Modelle eingeschlossen. Es werden dem-entsprechend auch keine Zufallssteigungen für Sprecher in Familie getestet.
354
differenziert, da der Sprechertyp in dieser Generation keinen Einfluss auf die Aussprache hatte. Die Frage ist also, ob jüngere Sprecher, die noch zu großen Teilen ‚hybride‘ Äußerungen zeigen, sich phonisch von älteren Sprechern unterscheiden. Dies wird nur für Variablen geprüft, für die auch unabhängig von Interaktionen Unterschiede zwischen den Generationen erkennbar waren, also für (Jakanje1), (rʲ) und (ʧʲ), (g) und (v).
Unterschiede zwischen Vertretern des Sprechertyps HR in Generation 1 und Vertre-Tab. 111tern der Generation 2. Der Operator „<“ zeigt, dass das rechtsseitige Argument des Operators für die jeweilige phonische Variable stärker zum Russischen neigt (Signi-fikanzniveau: *: ≤0,05). Der Operator „=“ zeigt, dass kein signifikanter Unterschied besteht.
Generation 1 vs. Generation 2 (Jakanje1): F1 Generation 1 < HR in Generation 2* (ʧʲ): F2 Generation 1 = HR in Generation 2 (rʲ): F2 Generation 1 = HR in Generation 2 (g) Generation 1 = HR in Generation 2 (v) Generation 1 = HR in Generation 2
Für (Jakanje1) bestehen also auch zwischen Sprechern der Generation 2, die auf strukturell tieferen Sprachebenen noch relativ stark zum ‚Weißrussi-schen‘/‚Hybriden‘ neigen und Sprechern der Generation 1 Unterschiede: Vertreter des Sprechertyps HR in der Generation 2 weisen eine stärker [i]-artige Realisierung auf als Vertreter der älteren Generation. Für die anderen Variablen unterscheiden sich die jüngeren Sprecher jedoch nicht von den älteren. Sie neigen also für (rʲ) und (ʧʲ), (g) und (v) gleich stark zum Weißrus-sischen wie Vertreter der älteren Generation.
Die folgende Tabelle fasst die bisherigen Befunde aus diesem Abschnitt zusammen:
Übersicht zum Einfluss des Sprechertyps Tab. 112
Unterschiede in Generation 2 bei unterschiedlichen Sprechertypen
Unterschiede zwischen Vertretern des Typs HR der Generation 2 und
älteren Sprechern (Akanje1) nein (-) (Jakanje1) ja ja (sʲ) ja (-) (tʲ) ja (-) (dʲ) nein (-) (ʧʲ) ja nein (rʲ) nein nein (g) nein nein (v) ja nein
355
Eindeutig ist die Lage bei (v) und (ʧʲ). Hier ist Sprechertyp R offensichtlich verantwortlich für die Unterschiede zwischen den Generationen. Zwischen den noch stark zum ‚Weißrussischen‘/‚Hybriden‘ neigenden jüngeren Spre-chern und den Vertretern der Generation 1 finden sich keine Unterschiede. Im Falle der Variable (Jakanje1) spielt sowohl der Sprechertyp als auch der Generationsunterschied eine Rolle. Unklar ist der Fall dagegen bei (rʲ) und bei (g). Einerseits finden sich in Generation 2 keine Unterschiede zwischen den Typen, andererseits unterscheiden sich jüngere Sprecher des Typs HR nicht von älteren Sprechern. Für (Akanje1) und (dʲ) findet sich kein Hinweis, dass der Sprechertyp eine Rolle spielen könnte. Für (sʲ) und (tʲ) waren keine Unterschiede zwischen den Generationen festzustellen (vgl. Abschnitt 6.3), der Sprechertyp hat dagegen einen Einfluss.
Reanalyse für (sʲ) und (tʲ): Für (sʲ) und (tʲ) ist daher eine Reanalyse des gesamten Samples, also bei Einbeziehung aller Sprecher, angebracht, in die der Sprechertyp als erklärende Variable einbezogen wird. Dies war in der ersten Analyse in Kapitel 6 nicht geschehen, da dem Faktor Generation bzw. den damit verbundenen Unterschieden in der (Sprach-)Biographie der Spre-cher eine theoretische Priorität eingeräumt wurde, da angenommen wurde, dass er sowohl die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einem Spre-chertypen als auch die Realisierung der lautlichen Variablen beeinflusst.
Die Analyse ergibt, dass nicht nur in Generation 2, sondern generell Unterschiede zwischen den Sprechertypen bestehen, was die Realisierung von (sʲ) und (tʲ) angeht:
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (sʲ): Unterschiede zwischen Tab. 113Sprechertypen (n=1154). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,37), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,65 0,20 -3,24 0,0018 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,33 0,18 1,79 0,0732 hybrid 0,21 0,11 2,02 0,0442 russisch 0,38 0,12 3,05 0,0022 Sprechertyp H -0,14 0,22 -0,64 0,4932 HR 0,13 0,21 0,65 0,5040 R 0,54 0,22 2,51 0,0142
356
Mehrebenenmodell für den normalisierten CoG-Wert von (tʲ): Unterschiede zwischen Tab. 114Sprechertypen (n=1225). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,36), Familie (n=8, σ<0,07)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,06 0,20 -0,32 0,7402 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,25 0,20 1,21 0,2256 hybrid 0,09 0,09 0,95 0,3404 russisch 0,19 0,11 1,64 0,1018 Sprechertyp H 0,23 0,22 1,07 0,2960 HR 0,17 0,20 0,86 0,3962 R 0,50 0,21 2,40 0,0258
Was die Sibilanten (sʲ) und (tʲ) angeht, so ist es also der Faktor Sprechertyp und nicht der Faktor Generation, der entscheidend ist. Sprecher, die auf strukturell tieferen Sprachebenen stärker zum ‚Weißrussischen‘ bzw. ‚Hybri-den‘ neigen, weisen eine stärker posterior-alveolare Artikulation auf. Bei Sprechern, die weitgehend ‚russische‘ Äußerungen aufweisen, geht diese ‚weißrussische‘ Artikulation zurück.
Zusammenfassung: Die Befunde in diesem Abschnitt bestätigen auf der Ebene des individuellen Sprechers die Ergebnisse von CHESHIRE, KERSWILL
& WILLIAMS (2005), die auf der Ebene von sozialen Gruppen einen Zusam-menhang zwischen morphologischer und phonischer Variation zeigen. Auch dort geht eine Tendenz auf der einen sprachlichen Ebene mit einer entspre-chenden Tendenz auf der anderen sprachlichen Ebene einher. Die Befunde werfen natürlich die Frage auf, welche sozialen Charakteristika, abgesehen von der Binnenmigration, den Sprechertyp beeinflussen. Dies ist eine Frage, die sich nicht nur für diese Arbeit stellt. Die geringe Sprecherzahl führt die vorliegende Untersuchung an dieser Stelle jedoch an eine Grenze.
10.7 Akkommodation an den Gesprächspartner
Auch die letzte Frage, die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden soll, behandelt einen Aspekt der Fokussiertheit bei Sprechern von WRGR. Wäh-rend bisher lediglich gezeigt wurde, dass Sprecher in ihrer Rede variieren und dass dabei die tieferen Strukturebenen mit der phonischen Seite korrelieren, wird im Folgenden mit der sprachlichen Anpassung an den Gesprächspartner ein möglicher Auslöser dieser sprecherinternen Variation in den Blick genommen.
HENTSCHEL (2008c, 212–215) stellt anhand der Daten des Pilotprojekts, d.h. für die Informanten aus Baranavičy fest, dass Vertreter der Generatio-
357
nen 1 und 2 sich sprachlich stärker in Richtung des Weißrussischen bewegen, wenn Vertreter der Generation 0, d.h. der Großelterngeneration zugegen sind. Im Gespräch mit der Großelterngeneration erhöht sich auf der lexikali-schen/morphologischen Ebene der Anteil an ‚weißrussischen‘ Elementen signifikant. Zu erwarten ist auch, dass umgekehrt im Gespräch nur unter Vertretern der Generation 2 sich der Anteil ‚russischer‘ Elemente erhöht. In diesem Abschnitt soll überprüft werden, ob eine solche Akkommodation an den Gesprächspartner auch auf der phonischen Ebene feststellbar ist. Ausge-hend von den statistischen Modellen in den Kapiteln 5 bis 9 wird im Folgen-den für die wichtigsten phonischen Variablen geprüft, ob sich die Sprecher in diesen verschiedenen Gesprächskonstellationen unterschiedlich verhalten.
Von den 34 hier untersuchten Sprechern nehmen nur zwölf an Gesprä-chen unterschiedlicher Generationskonstellation teil. Dies sind in Genera-tion 1 die fünf Sprecher ba_A, ch_C, mi_B, ra_L und ra_S, in Generation 2 die sieben Sprecher ak_D, ba_B, ba_V, ch_N, mi_F, ra_A und sa_N. Da die Exploratorinnen aus der jüngsten Generation stammen und in aller Regel an den Gesprächen teilnehmen, zumindest aber anwesend sind, fehlen Gesprä-che, an denen nur Vertreter der Generation 1 und/oder Generation 0 teilneh-men. Es können also nicht alle denkbaren Konstellationen miteinander ver-glichen werden. Für die Generation 2 kann verglichen werden zwischen Gesprächen, an denen nur Vertreter der Generation 2 teilnehmen, solchen, an denen auch solche der Generation 1, nicht aber der Generation 0 teilnehmen, und schließlich solchen, an denen auch Vertreter der Generation 0 teilneh-men.198 Für die Generation 1 kann geprüft werden, ob zwischen Gesprächen, an denen Vertreter der Generation 0 zugegen sind, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist, Unterschiede bestehen.
Dies ist natürlich eine sehr grobe Analyse. Innerhalb eines Gesprächs wechseln die Binnenkonstellationen. So wäre sicherlich innerhalb eines Gespräches nach dem jeweils Angesprochenen zu differenzieren. Zudem spielen in der Diskursstruktur natürlich Faktoren wie das Gesprächsthema, pragmatische und emotionale Faktoren eine Rolle. Dass eine solche Mikro-analyse, wie sie z.B. für das Varietäten des Deutschen AUER (1986), für Varietäten des Englischen SCHILLING-ESTES (2004), für Varietäten des Rus-
198 Natürlich wäre es wünschenswert, noch feiner zu differenzieren. In den letzteren Fällen
wäre prinzipiell zu unterscheiden, ob dies Gespräche nur zwischen Vertretern unterschied-licher Generationen sind, oder ob noch weitere Vertreter der Generation 2 teilnehmen. Da Gespräche mit Vertretern der ältesten Generation jedoch selten sind, wird dies nicht geprüft.
358
sischen SAPPOK (2010) und für WRGR ZAPRUDSKI & JANENKA (2011) zei-gen, lohnenswert ist und den globalen, stark abstrahierenden Ansatz der vorliegenden Arbeit ergänzen sollte, wird zum Schluss dieses Abschnitts an einem Beispiel angedeutet. Eine solche Analyse kann hier jedoch wie ein-gangs erwähnt nicht durchgängig erfolgen.
Bei der Frage nach phonischer Variation in Abhängigkeit von Charakte-ristika der Gesprächssituation spielt die bereits in Abschnitt 4.4 angespro-chene Problematik des Zusammenhangs zwischen der Affinität einer Äuße-rung auf strukturell tieferen Ebenen und der phonischen Ebene eine Rolle. Wie die Analysen in den Kapiteln 5 bis 9 gezeigt haben, besteht für die Mehrzahl der Variablen zumindest in Generation 2 ein Zusammenhang zwischen der Affinität und der Realisierung der phonischen Variable. Wie bereits in Abschnitt 4.4 diskutiert wurde, ist dies nicht notwendigerweise so zu interpretieren, dass die Affinität auf tieferen Ebenen die phonische Seite bestimmt. Möglich (und diese Möglichkeit ist plausibel) ist auch, dass beide Ebenen von denselben, „dritten“ Faktoren beeinflusst werden. Zunächst wird daher in den folgenden Analysen die Affinität der Äußerung weiterhin als erklärender Faktor einbezogen. Sollte sich kein signifikanter Effekt für die Gesprächskonstellation ergeben, aber für die Affinität der Äußerung, so wird die Affinität der Äußerung ausgeschlossen. Sollte sich dann ein signifikanter Einfluss der Gesprächskonstellation ergeben, so ist dieser Befund so zu inter-pretieren, dass die Akkommodation auf der phonischen Ebene mit entspre-chenden Tendenzen auf strukturell tieferen Ebenen einhergeht. Ein solches Ergebnis sagt dann aus, dass die Sprecher in Gesprächen mit älteren Genera-tionen die Variable stärker bzw. häufiger ‚weißrussisch‘ realisieren, dass dies aber auch über allgemeine Unterschiede zwischen den Äußerungstypen erklärt werden könnte und dass sich die Anteile dieser Äußerungstypen in den Gesprächen unterscheiden.
Für die Sibilanten zeigt sich ein Problem, dass bereits in Abschnitt 4.2.3 angesprochen wurde, nämlich die variierende Qualität der Aufnahmen. Zwar zeigen die Sprecher der jüngeren Generation signifikante Unterschiede zwi-schen Gesprächen mit Gleichaltrigen und solchen mit Vertretern der älteren Generation. Jedoch sind solche Unterschiede (wenn auch nicht so stark) auch für /s/ zu beobachten, für das keine sprachkontaktbedingte Variation anzu-nehmen ist. Es handelt sich also wohl zumindest teilweise um Unterschiede, die in der Qualität der Aufnahmen begründet sind. Viele der Aufnahmen, in denen nur jüngere Sprecher teilnehmen, zeichnen sich durch eine bessere Qualität aus, so dass in ihnen Unterschiede zwischen den Sibilanten deutli-
359
cher festzustellen sind.199 Für die Sibilanten kann also keine Analyse durch-geführt werden.
Akkommodation in Generation 1: Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu Unterschieden in Gesprächen unterschiedlicher Generationskonstellation für die Generation der Land-Stadt-Migranten. Die entsprechenden Analysen finden sich im Anhang. Geprüft wird, ob in Gesprächen, an denen Vertreter der Generation 0 anwesend sind, Vertreter der Generation 1 für die jeweilige Variable stärker zu einer ‚weißrussischen‘ Artikulation neigen (bzw. umge-kehrt, ob sie zu einer stärker ‚russischen‘ Artikulation neigen, wenn keine Vertreter der Generation 0 zugegen sind.) Von den 1305 Instanzen der Vari-able (g) bei den Vertretern der Generation 1 sind nur elf plosiv, so dass auf eine statistische Analyse dieser Variable verzichtet wird. Offensichtlich ver-wenden diese Sprecher obligatorisch frikative Realisierungen, nicht nur im Gespräch mit der Generation 0, sondern auch im Gespräch mit Generation 2.
Unterschiede in der Rede von Generation 1 zwischen Gesprächen mit Vertretern der Tab. 115Generation 0 und Gesprächen ohne Vertreter der Generation 0. Der Operator „<“ zeigt, dass das rechtsseitige Argument des Operators für die jeweilige phonische Va-riable stärker zum Russischen neigt (Signifikanzniveaus: *: ≤0,05; **: ≤0,01; ***: ≤0,001). Der Operator „=“ zeigt, dass kein signifikanter Unterschied besteht.
Gespräche mit Generation 0 vs. Gespräche ohne Generation 0 (Akanje1): F1 mit Generation 0 = ohne Generation 0 (Jakanje1): F1 mit Generation 0 < ohne Generation 0** (ʧʲ): F2 mit Generation 0 < ohne Generation 0*** (rʲ): F2 mit Generation 0 = ohne Generation 0 (g) mit Generation 0 = ohne Generation 0 (v) mit Generation 0 < ohne Generation 0*
Für (Akanje1) sind keine Unterschiede zwischen verschiedenen Genera-tionskonstellationen festzustellen. Die Analyse ergibt einen signifikant höhe-ren ersten Formanten für die Variable (Jakanje1) bei den Vertretern der Ge-neration 1 im Gespräch mit Vertretern der Generation 0 im Vergleich zu Gesprächen mit Gleichaltrigen oder jüngeren Sprechern. In Gesprächen mit Vertretern der Generation 0 weist Generation 1 also offenere, stärker ‚weiß-russische‘ Realisierungen auf. Vertreter der Generation 1 haben in Gesprä-chen mit ihrer Elterngeneration außerdem weniger [i]-artige Formanten-
199 Es stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Befund Einfluss auf die Ergebnisse in Abschnitt
6.3 hat. Da aber in allen Gesprächen eine etwa gleich große Menge an allen Sibilantentypen analysiert wurde und in allen Gesprächen Äußerungen unterschiedlicher Affinität vorkom-men, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse zuverlässig sind.
360
einstiege von (ʧʲ), und produzieren (noch) weniger ‚russische‘ frikative Reali-sierungen von (v).
Bereits die Generation der Land-Stadt-Migranten variiert also funktional in phonischen Charakteristika. Für einige Variablen gestalten ihre Vertreter ihre Rede stärker ‚weißrussisch‘, wenn sie mit älteren Sprechern sprechen.
Akkommodation in Generation 2: Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu Unterschieden in Gesprächen unterschiedlicher Generationskonstellation für die Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten. Die entsprechenden Analysen finden sich im Anhang. Geprüft wird, ob sich Gespräche, an denen nur Vertreter der Generation 2 beteiligt sind, sich unterscheiden von Gesprä-chen, an denen Vertreter der Generation 1, nicht aber der Generation 0 anwe-send sind, und von Gesprächen, in denen auch Vertreter der Generation 0 teilnehmen.
Unterschiede in der Rede von Generation 2 zwischen Gesprächen mit Vertretern der Tab. 116Generationen 1 und 0 und Gesprächen ohne Vertreter dieser Generationen. Der Ope-rator „<“ zeigt, dass das rechtsseitige Argument des Operators für die jeweilige pho-nische Variable stärker zum Russischen neigt (Signifikanzniveaus: +: ≤0,10; *: ≤0,05; **: ≤0,01; ***: ≤0,001). Der Operator „=“ zeigt, dass kein signifikanter Unterschied besteht.
Unterschied Gesprächskonstellation (Akanje1): F1 mit Gen 1 = ohne Gen 0 und 1 mit Gen 0 = ohne Gen 0 und 1 (Jakanje1): F1 mit Gen 1 = ohne Gen 0 und 1 mit Gen 0 = ohne Gen 0 und 1 (ʧʲ): F2 mit Gen 1 < ohne Gen 0 und 1* mit Gen 0 < ohne Gen 0 und 1*** (rʲ): F2 mit Gen 1 = ohne Gen 0 und 1 mit Gen 0 < ohne Gen 0 und 1* (g) mit Gen 1 < ohne Gen 0 und 1+ mit Gen 0 = ohne Gen 0 und 1 (v) mit Gen 1 < ohne Gen 0 und 1*** mit Gen 0 < ohne Gen 0 und 1***
Die Vertreter der Generation 2 zeigen in einer ganzen Reihe von phonischen Merkmalen Unterschiede, je nachdem, welche Generationen im Gespräch vertreten sind. Für (Akanje1) und auch für (Jakanje1) sind für Generation 2 zunächst keine Unterschiede festzustellen.200 Dies ändert sich auch nicht, wenn die Affinität der Äußerung ausgeschlossen wird. Die Affrikate (ʧʲ) ist am stärksten palatalisiert im Gespräch unter Vertretern der Generation 2, am wenigsten im Gespräch mit Vertretern der Generation 0. (rʲ) weist im Gespräch mit der Großelterngeneration einen niedrigeren zweiten Formanten auf, die Realisierung ist also weniger palatalisiert. In Gesprächen mit Vertre-tern der Generation 1 deuten die Werte leicht in Richtung des ‚Weißrussi-
200 Ebensowenig ist für die Generation 2 für den zweiten Formanten von Vokalen in Jakanje-
Positionen ein Einfluss der Gesprächskonstellation festzustellen.
361
schen‘, sind jedoch nicht signifikant unterschiedlich zu Gesprächen unter Gleichaltrigen. Für (v) zeigt Generation 2 in Gesprächen mit älteren Genera-tionen, vor allem mit Generation 0, mehr ‚weißrussische‘ Realisierungen. Für (g) ergibt sich bei Einbeziehung der Affinität der Äußerung nur ein marginal signifikanter Unterschied zwischen Gesprächen unter Gleichaltrigen und solchen mit Vertretern der Generation 1. Wird die Affinität der Äußerung ausgeschlossen, so ist auch die Generationskonstellation klar signifikant:
Effekt unterschiedlicher Gesprächskonstellationen in Generation 2 ohne Tab. 117Berücksichtigung der Affinität der Äußerung: (g) (n=945). Zufallsfaktor: Sprecher (n=7, σ=2,33)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,20 1,08 0,20 0,8543 Gesprächskonstellation mit Generation 1 -0,71 0,28 -2,33 0,0122 mit Generation 0 -1,20 0,40 -2,89 0,0027
Die Variation von [g] und [ɣ] geht also einher mit Unterschieden auf struktu-rell tieferen Ebenen.201
Zusammenfassung: Es ist also festzustellen, dass Sprecher in ihrer Ausspra-che variieren, je nachdem, ob Vertreter der älteren Generationen anwesend sind oder nicht. Ist dies der Fall, so tendiert die Aussprache in Richtung des Weißrussischen. Allerdings ist dies nicht für alle Sprecher und für alle Vari-ablen gleichermaßen gegeben. Generation 1 passt ihre Aussprache bei den Variablen (Jakanje1), (v) und (ʧʲ) an. Dies waren auch die Variablen, für die in dieser Generation eine allgemeine oder in ‚russischen‘ Äußerungen beste-hende Tendenz zu einer stärker ‚russischen‘ Realisierung beobachtet wurde. (Jakanje1) und (v) sind auch zwei der wenigen Variablen, die innerhalb der Generation 1 miteinander korrelieren, für die also Vertreter der Generation 1 gleichermaßen entweder mehr bzw. stärker ‚weißrussische‘ oder ‚russische‘ Realisierungen aufweisen.
Für Generation 2 ist eine solche allgemeine Tendenz für (Jakanje1) nicht feststellbar (in Einzelfällen jedoch schon, siehe unten). Diese Generation variiert ebenfalls für (ʧʲ) und (v) sowie außerdem für (rʲ) und (g). Diese Vari-ablen dienen also in den jeweiligen Generationen als Marker, die im Diskurs funktional (bei sicherlich unterschiedlichen Graden an Bewusstheit) einge-setzt werden. Für (Akanje1), für das auch keine Unterschiede zwischen Äu-
201 Eine Überprüfung ergibt, dass auch in Gesprächen allein unter Vertretern der Generation 2
in ‚weißrussischen‘ Wortformen bei 50 Fällen keine einzige plosive Realisierung erfolgt.
362
ßerungen unterschiedlicher Affinität festgestellt wurden, ist dies nicht der Fall.
Übersicht zur Akkommodation Tab. 118
Unterschiede in Generation 1 (Gleichaltrig/„Kinder“ vs.
„Eltern“)
Unterschiede in Generation 2
(Gleichaltrig vs. „Eltern“)
Unterschiede in Generation 2
(Gleichaltrig vs. „Großeltern“)
(Akanje1) nein nein nein (Jakanje1) ja nein nein (ʧʲ) ja ja ja (rʲ) nein nein ja (g) nein ja ja (v) ja ja ja
Es sei wiederholt, dass hier eine sehr grobe Analyse vorgenommen wurde. Es wurde lediglich kontrolliert, welche Generationen insgesamt am Gespräch teilnehmen. Selbstverständlich ist es möglich, dass in einem Gespräch punk-tuelle Akkommodationen an einzelne Gesprächspartner vorliegen und dass die Akkommodation in Abhängigkeit von pragmatischen und emotionalen Faktoren mal stärker, mal weniger stark ausfällt (vgl. SCHILLING-ESTES 2004). So wurde zum Beispiel für die Variable (Jakanje1) bei der Genera-tion 2 insgesamt kein Unterschied zwischen Gesprächen mit unterschiedli-cher Generationskonstellation festgestellt. Bei detaillierten Analysen auf der Diskursebene treten punktuelle Akkommodationen jedoch zutage. Abbil-dung 79 zeigt die individuellen Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Position von Sprecherin ba_B. In der Abbildung links wird unterschieden nach der Generationskonstellation im Gespräch. Insgesamt sind keine Unter-schiede zu verzeichnen. In der Abbildung rechts werden dieselben Realisie-rungen gezeigt, jedoch wird für Realisierungen in Gesprächen, in denen ein Vertreter der Generation 0 anwesend ist, ebenfalls unterschieden, wer der angesprochene Sprecher ist. „+“ zeigt an, dass der nächste andere Sprecher, der eine Äußerung tätigt, ein Vertreter der Generation 0 ist.
363
Realisierungen von Vokalen in Jakanje-Positionen von Sprecherin ba_B, unterschie-Abb. 79
den nach Generationskonstellation (links) und Angesprochenem (rechts). (2: nur Vertreter der Generation 2; 1: Vertreter der Generation 1; 0: Vertreter der Genera-tion 0; +: Äußerung an einen Vertreter der Generation 0)
Wie sich zeigt, sind die zwei am stärksten ‚weißrussischen‘ Realisierungen in Äußerungen zu finden, die sich direkt an die Vertreterin der Generation 0 richten. Die dritte, hohe Realisierung ist die Wortform cjabe ‚du; Gen./Akk.‘), für die auch dialektal und weißrussisch-standardsprachlich mitunter [i]-artige Realisierungen beschrieben werden (vgl. Abschnitt 5.4.4). Es ist also davon auszugehen, dass für die beiden anderen Realisierungen eine funktionale Akkommodation vorliegt. Die Notwendigkeit einer solchen syntagmatischen, diskursorientieren Analyse kann hier jedoch nur beispiel-haft aufgezeigt werden und ihre systematische Durchführung muss späteren Untersuchungen überlassen werden.
2
2 1 0 -1 -2
21
0-1
-2
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
1
1
1
1
11
1 1 11
1
1
1
111
1
1
111 1
1
2 1 0 -1 -2
21
0-1
-2
0
0
0
0
2 1 0 -1 -2
21
0-1
-2
-
-
--
-
--
- -- --
-
-
-
---
-
-
--- -
-
2 1 0 -1 -2
21
0-1
-2F1
(L
oban
ov-n
orm
alis
iert
)
+
+
+
2 1 0 -1 -2
21
0-1
-2
F2 (Lobanov-normalisiert)
F1 (
Lob
anov
-nor
mal
isie
rt)
365
11 Zusammenfassung und Fazit
Gegenstand dieser Arbeit war die kontaktbedingte phonische Variation in einem rezenten Phänomen des Kontakts zweier eng verwandter und struktu-rell ähnlicher Sprachen, dem Weißrussischen und dem Russischen. Diese weißrussisch-russisch-gemischte Rede (WRGR), also Rede, in der in engen Skopen Elemente und Strukturen auftreten, von welchen einige aus der Außenperspektive der weißrussischen, andere der russischen Sprache (inklu-sive deren Subvarietäten) zuzuordnen wären, ist bis vor kurzem nicht syste-matisch untersucht gewesen. In dieser Arbeit waren drei aufeinander aufbau-ende Fragenkomplexe zu beantworten:
1) Wie fällt die phonische Seite der WRGR dort aus, wo das Weißrussi-sche und das Russische divergieren? Welche sprachlichen und außer-sprachlichen Faktoren spielen dabei eine Rolle?
2) Was sagen die Befunde aus 1) über die WRGR aus?
3) Wie lassen sich die Befunde aus 1) und 2) in einen allgemeinen kon-takt- und variationslinguistischen Kontext einordnen? Was tragen die Ergebnisse zu dem Verständnis von Sprachkontakt, Sprachmischung und „exogenem“ Sprachwandel bei?
Nach den einführenden Kapiteln 2 bis 4 wurde dem ersten Fragenkomplex in dem zweiten Abschnitt dieser Arbeit, den Einzelanalysen in den Kapiteln 5 bis 9, nachgegangen. Der zweite Fragenkomplex, die Frage nach der Bedeu-tung der Befunde für das Verständnis von WRGR, wurde in Kapitel 10 an-gegangen und soll in diesem Kapitel vertieft werden. Abschließend wird auf den dritten Fragenkomplex eingegangen.
In Kapitel 2 wurde zunächst die Stellung von WRGR in der Sprachen-landschaft bzw. Sprachenarchitektur von Belarus dargelegt. Dass WRGR ein Massenphänomen im heutigen Belarus ist, ist unbestritten. In den belorussis-tischen Arbeiten zum Thema finden sich jedoch einige ungeprüfte Behaup-tungen: WRGR werde nur von ungebildeten Sprechern benutzt, werde nicht an folgende Generationen weitergegeben bzw. nach dem Erwerb des Russi-
366
schen in seiner Standardform aufgegeben und habe auch bei den Sprechern selbst ein negatives Prestige. Die Arbeiten von KITTEL et al. (2010) und HENTSCHEL & KITTEL (2011) zeigen jedoch, dass diese Annahmen nicht haltbar sind. WRGR wird gleichermaßen in allen Bildungsschichten gebraucht, ist inzwischen an mindestens eine Generation weitergegeben worden und wird auch von Sprechern benutzt, die des Russischen in seiner Standardform mächtig sind. Dies – zusammen mit anderen Indizien, wie etwa der Tatsache, dass WRGR von Informanten auch als Muttersprache angege-ben wird – spricht dafür, dass WRGR zumindest ein verstecktes Prestige aufweist.
Anschließend wurde auf die Entstehung von WRGR eingegangen. Auch wenn Formen gemischter Rede sicherlich schon lange auf dem Gebiet des heutigen Belarus existierten, ist für die Entstehung von WRGR als Massen-phänomen der enorme Zuzug von Arbeitsmigranten in die Städte in der zweiten Hälfte des 20. Jh. ausschlaggebend. Dies waren Sprecher (sicherlich bereits vom Russischen beeinflusster) weißrussischer Dialekte, die sich dort in einer russisch-dominierten Umgebung dem Russischen zuzuwenden hatten und dementsprechend vor allem lexikalische Elemente des Russischen in ihre Rede integrierten. Für die vorliegende Untersuchung stellte sich daher der Vergleich dreier Generationen als entscheidend heraus: Generation 0 ist die Generation der Eltern von Land-Stadt-Migranten, deren Vertreter ihr gesam-tes Leben auf dem Land verbracht haben oder erst im höheren Alter zu ihren Kindern in die Städte gezogen sind. Generation 1 sind Menschen, die in den 1960er und 1970er, eventuell 1980er Jahren im jungen Erwachsenenalter als Arbeitsmigranten aus weißrussisch-dialektal geprägten ländlichen Gebieten in die sich rasch entwickelnden Städte zogen. Ihre schulische Ausbildung war noch wesentlich weißrussisch geprägt, wobei das Russische natürlich auch unterrichtet wurde. Ihre WRGR ist zunächst im Wesentlichen ein „Wandel in der Rede“ (HENTSCHEL 2008a, 464), d.h. ein temporärer quantitativer Rück-gang ‚weißrussischer‘ Elemente zugunsten ‚russischer‘ Elemente. Genera-tion 2 sind die Kinder dieser Migranten, die bereits in den Städten zur Welt gekommen sind oder dort zumindest den größten Teil ihrer Kindheit ver-bracht haben. Ihre erste sprachliche Sozialisierung erfuhren sie durch die gemischte Rede ihrer Eltern, d.h. gemischt-monolektal, ohne eine Differen-zierung des sprachlichen Inputs. Anders als ihre Eltern wurde diese Genera-tion allerdings in der schulischen Ausbildung, teilweise bereits im vorschuli-schen Bereich viel früher und intensiver im Russischen sozialisiert und ist daher in aller Regel in der Lage, Russisch in seiner Standardform ohne tiefere
367
Interferenzen des Weißrussischen zu sprechen. Für diese Generation stellt WRGR daher keine Akkommodation an das Russische bzw. keine Inter-language im Sinne einer Lernervarietät mehr dar, sondern bedeutet die „Ver-wendung der vertrauten familiären Redeweise“ (HENTSCHEL 2008a, 465). Der Kontakt zum dialektalen Weißrussischen ist für diese Generation schwächer.
Nicht nur, was die Bewertung der Sprecher von WRGR, sondern auch was den linguistischen Status von WRGR angeht, finden sich in der Belo-russistik einige ungeprüfte Behauptungen, von denen die einschlägigste ist, dass WRGR kein überindividuelles System aufweise, was damit begründet wird, dass es keinen überindividuellen Usus gebe. Vor dem Hintergrund dessen, was zu verwandten Erscheinungen beispielsweise im angelsächsi-schen oder skandinavischen Raum zur Entstehung neuer, gemischter Varie-täten bekannt ist, wurde dies in Abschnitt 2.3 angezweifelt. Die im Rahmen des Oldenburger Projekts entstandenen Arbeiten belegen die Eigenständig-keit von WRGR in ihren tieferen strukturellen Ebenen und ihre Eigenstän-digkeit im Diskurs als drittem Kode neben dem Weißrussischen und dem Russischen.
In Kapitel 3 wurde die Fragestellung der Arbeit dargelegt. Was die phoni-sche Seite von WRGR angeht, so war aufgrund der Entstehungsgeschichte der WRGR zu erwarten, dass sie durch den Erstsprachenhintergrund der ersten Sprechergeneration von WRGR weißrussisch-dialektal geprägt ist und russische Einflüsse (im Vergleich zu anderen sprachlichen Ebenen) gering ausfallen. Darüber hinaus ist zum einen Variation im Sinne „sprachinterner“ Variation zu erwarten, wie sie für Situationen des Dialektkontakts in der Tradition TRUDGILLs (1986) beschrieben wird. Jedoch bestehen zum anderen Unterschiede zu prototypischen Dialektkontaktsituationen: So handelt es sich auch aus Sicht des Laien nicht um Variation innerhalb einer Sprache: Weiß-russisch und Russisch sind natürlich anerkannte Standardsprachen, werden beide in der Schule unterrichtet und sind in den Medien vertreten. Darüber hinaus sind die Unterschiede zwischen dem Weißrussischen und dem Russi-schen in Morphologie und Lexik nicht zu vernachlässigen. Dies rückt WRGR eher in Richtung von Phänomenen, die unter dem Begriff des „Kode-mischens“ gefasst werden, und macht es nötig, die Kovarianz mit anderen sprachlichen Ebenen zu berücksichtigen, was im Übrigen auch im Hinblick auf die allgemeine Diskussion über den Kontakt nah verwandter Varietäten ein Desiderat ist: Solche Zusammenhänge zwischen erster und zweiter Arti-kulation im Sinne MARTINETs (1949) in Instanzen gemischter Rede, d.h. der Zusammenhang der Affinität einer sprachlichen Einheit abstrahiert von rein-
368
phonischen Charakteristika mit dessen phonischer Seite, sind bisher kaum untersucht worden. Die zunächst formulierte Fragestellung, was ‚weißrus-sisch‘ und was ‚russisch‘ an der phonischen Seite der WRGR ist, wurde dahingehend modifiziert, dass gefragt wurde, welche Faktoren die phonische Seite der WRGR in Richtung einer eher ‚weißrussischen‘ oder eher ‚russi-schen‘ Lautung beeinflussen. Hier sind Generation, Geschlecht und dialekta-ler Hintergrund des Sprechers sowie die Affinität der sprachlichen Einheit auf strukturell tieferen Ebenen zu nennen.
Darüber hinaus wurde herausgestellt, was die phonische Seite von WRGR zum Verständnis des Phänomens WRGR beitragen kann, insbesondere hin-sichtlich ihrer Stabilisiertheit und Eigenständigkeit. Für die Beurteilung der Stabilisierung von WRGR hin zu einem überindividuellen System wurde die Frage als entscheidend herausgestellt, wie sich die Variation zwischen Spre-chern und innerhalb von Sprechern über die Generationen hin entwickelt. Was die Eigenständigkeit angeht, so galt es zu prüfen, ob zwischen Äußerun-gen, die auf strukturell tieferen sprachlichen Ebenen als ‚russisch‘, ‚weißrus-sisch‘ und ‚weißrussisch-russisch-gemischt‘ zu klassifizieren sind, Unter-schiede bestehen, welche es erlauben, von einer spezifischen Lautung der WRGR zu sprechen. Eine solche phonische Unterschiedlichkeit würde auf einen phonischen Usus der WRGR hinweisen und wäre ein weiteres Argu-ment für den Status von WRGR als eigenem Dritten neben dem Weißrussi-schen und dem Russischen.
Kapitel 4 stellte den methodischen Hintergrund vor. Das Datenmaterial, das in dieser Arbeit verwendet wurde, stammt aus Aufnahmen weißrussisch-russischer gemischter Rede, die in den Jahren 2007 bis 2008 im Rahmen des von der Volkswagenstiftung geförderten Projekts Die Trasjanka in Weiß-russland – Eine Mischvarietät als Folge des weißrussisch-russischen Sprach-kontakts. Sprachliche Strukturierung, soziologische Identifikationsmechanis-men und Sozioökonomie der Sprache in sieben weißrussischen Städten auf-gezeichnet wurden. Es handelt sich hierbei um nicht-offizielle, spontane Gespräche im Familien- und Freundeskreis je einer Familie, in einem Fall von zwei Familien aus diesen Städten. Von den in diesen Aufnahmen vertre-tenen Sprechern wurden in der vorliegenden Arbeit 34 untersucht. Die Mehr-zahl der untersuchten Variablen wurde instrumentalphonetisch analysiert, was eine größere Genauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet als ohren-phonetische Untersuchungen. Die Struktur der zugrunde liegenden Daten machte spezielle statistische Analysemethoden notwendig, und zwar soge-nannte Mehrebenenmodelle.
369
Die folgenden Kapitel 5 bis 9 behandelten die phonischen Variablen. Insgesamt wurden 13 Phänomene untersucht:
1. (Akanje1): ‚Weißrussisches‘ [a] vs. ‚russisches‘ [ɐ] für unmittelbar vorbetontes /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten
2. (Akanje2): ‚Weißrussisches‘ [a] vs. ‚russisches‘ [ə] für /a/ und /o/ in weiteren vorbetonten Silben nach nicht-palatalisierten Konsonanten
3. (Jakanje1): ‚Weißrussisches‘ [a] vs. ‚russisches‘ [ɪ] für unmittelbar vorbetontes /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten
4. (Jakanje2): ‚Weißrussisches‘ [ɛ] vs. ‚russisches‘ [ɪ] für /a/, /e/ und /o/ in weiteren vorbetonten Silben nach palatalisierten Konsonanten
5. (e /Š_): ‚Weißrussisches‘ [a] vs. ‚russisches‘ [ɨ] für unmittelbar vor-betontes /e/ und /o/ nach „verhärteten“ Konsonanten
6. (sʲ): ‚Weißrussisches‘ posterior-alveolares [s"] vs. ‚russisches‘ [sʲ] 7. (tʲ): ‚Weißrussisches‘ posterior-alveolares und stark affriziertes [ʦ"]
vs. ‚russisches‘ [tʲ] 8. (dʲ): ‚Weißrussisches‘ posterior-alveolares und stark affriziertes [ʣ"]
vs. ‚russisches‘ [dʲ] 9. (ʧʲ): ‚Weißrussisches‘ [t ʂ] vs. ‚russisches‘ [ʧʲ] 10. (ʃʲ): ‚Weißrussisches‘ [ʂt ʂ] vs. ‚russisches‘ [ʃʲː] 11. (rʲ): ‚Weißrussisches‘ [r] für etymologisches |rʲ| vs. ‚russisches‘ [rʲ] 12. (g): ‚Weißrussisches‘ [ɣ] vs. ‚russisches‘ [g] 13. (v): ‚Weißrussisches‘ [u/u] vs. ‚russisches‘ [v/f] für /v/ im Auslaut
und vor Konsonant
In Bezug auf die erste in der vorliegenden Arbeit gestellte Frage, wie die phonische Seite der WRGR dort ausfällt, wo das Weißrussische und das Russische divergieren und welche sprachlichen und außersprachlichen Fakto-ren dabei eine Rolle spielen, zeigten die Analysen zunächst, dass grundsätz-lich ein Einfluss des Russischen feststellbar ist. Dies ist einerseits nicht ver-wunderlich, andererseits vor dem Hintergrund der Stabilität der phonischen Merkmale der Erst- bzw. Ausgangssprache im Zweit- und Fremdsprach-erwerb und bei Sprachwechsel sowie vor dem Hintergrund, dass auch für die weißrussische Variante des Standardrussischen starke phonische Einflüsse des Weißrussischen beschrieben werden, durchaus ein Befund, der in vielem der bisherigen Lehrmeinung von der weißrussischen „Dominanz“ im phoni-schen Bereich widerspricht. Es findet sich für alle Variablen Variation zwi-schen (eher) ‚weißrussischen‘ und (eher) ‚russischen‘ Ausprägungen. Ange-sichts der erwähnten hohen Resistenz der phonischen Ebene gegenüber kon-
370
taktbedingten Einflüssen, angesichts der Tatsache, dass WRGR als eine zu-nächst vor allem lexikalische Bewegung vom dialektalen Weißrussischen zum Russischen entstanden ist, und letztlich angesichts dessen, dass es sich um familiäre, nicht-offizielle Gespräche handelt, in denen von außen betrachtet kein Anlass für eine möglichst ‚russische‘ Aussprache besteht, ist dies als ein Reflex der unbestrittenen Stärke der russischen Sprache in der weißrussischen Gesellschaft zu werten. Es gibt jedoch zwischen den phoni-schen Variablen Unterschiede hinsichtlich dessen, welche Faktoren eine stärker ‚russische‘ Lautung begünstigen. Dies wird im Folgenden kurz zusammengefasst.
1) Generation: Wir beginnen mit dem Einfluss der Generation des Sprechers, wobei die Befunde später noch zu revidieren und hinsichtlich des Einflusses der Generation in unterschiedlichen Kodes zu differenzieren sind. Hinter dem Begriff „Generation“ verbergen sich wie gesagt nicht nur Altersunterschiede, sondern auch erhebliche Unterschiede in der Sprachbiographie. Dieser Faktor erweist sich für fast alle Variablen als einflussreich, was auf einen Sprach-wandel in der substandardlichen Rede in Weißrussland hindeutet.
(Akanje1): Für die im Bereich des unbetonten Vokalismus in Kapitel 5 zunächst untersuchte Variable (Akanje1), d.h. der Realisierung von /a/ und /o/ in unmittelbar vorbetonten Silben nach nicht-palatalisierten Konsonanten, die im Weißrussischen weniger zentralisiert (als [a]), im Russischen stärker zentralisiert (als [ɐ]) erfolgt, wurden keine Unterschiede zwischen den Gene-rationen 0 und 1 festgestellt. Dies heißt jedoch nicht, dass die Realisierung in den älteren Generationen mit dem Weißrussischen übereinstimmt – zumin-dest nicht, wenn man von den postulierten Normen ausgeht. Die Realisierung von /a/ und /o/ bereits in unmittelbar vorbetonten Silben ist deutlich zentraler als /a/ unter Betonung. Allerdings lässt eine Reihe von Studien auch für das Standardweißrussische vermuten, dass ein qualitativer Unterschied zwischen betontem /a/ und den Realisierungen in unbetonten Silben besteht. Zwischen den Generationen 0 und 1 einerseits und Generation 2 andererseits zeigten sich dann leichte Unterschiede, wobei diese Unterschiede von weiblichen Sprechern in Generation 2 hervorgerufen wurden. Die weiblichen jüngeren Sprecher weisen eine noch stärker zentrierte Realisierung auf, was deutlicher dem Russischen (zumindest in ungezwungener, spontaner Rede) entspricht.
(Akanje2): In weiteren vorbetonten Silben werden /a/ und /o/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten im Russischen noch stärker, d.h. zu [ə] reduziert. Für das Weißrussische wird wiederum eine phonetisch nicht reduzierte Reali-sierung als [a] angegeben. In WRGR fällt die Zentralisierung von /a/ und /o/
371
nach nicht-palatalisierten Konsonanten noch deutlicher aus. Auch hier zeigen jüngere Sprecher stärker zentralisierte (und kürzere) Realisierungen.
(Jakanje1): Die Variable (Jakanje1) umfasst die Realisierung von /a/, /e/, und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe, die im Weißrussischen [a]-artig erfolgt, im Russischen als [ɪ]. In WRGR waren nur für wenige Sprecher Durchschnittswerte zu beobachten, die mit den Beschreibungen der weißrussischen Norm übereinstimmen. Lediglich einige Vertreter der Generation 0 weisen Realisierungen auf, die nahe am Bereich des betonten /a/ nach palatalisierten Konsonanten liegen. Auch hier bestehen jedoch Zweifel, ob die Realisierung im Standardweißrus-sischen, zumal in spontaner Rede, tatsächlich den von der weißrussischen Belorussistik postulierten Normen entspricht. Für die Generation der Land-Stadt-Migranten gehen die Werte deutlich in den intermediären Bereich des betonten /e/. Dies präzisiert die auf Basis der Transkripte gewonnenen Erkenntnisse in HENTSCHEL & ZELLER (2014), in denen intermediäre Nota-tionen selten waren. In der jüngsten Generation ist insgesamt und für einige Sprecher insbesondere ein deutlicher Schritt in Richtung des ‚russischen‘ [ɪ] zu verzeichnen.
(Jakanje2): Die Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben, die für das Standardweißrussi-sche üblicherweise im Bereich zwischen [e] und [a] beschrieben wird, für das Russische als [ɪ], erfolgt in WRGR stärker im Bereich [ɪ] als für die Variable (Jakanje1). Auch die älteren Sprecher zeigen vor allem [ɪ]-artige Realisierun-gen, was wohl (auch) ein dialektaler Einfluss ist (s.u.). Für die Migranten-generation gehen die Realisierungen etwas stärker in Richtung des betonten /e/. Für die Generation deren Kinder fallen sie dann wieder deutlich in den Bereich [ɪ].
(e /Š_): Für die Realisierung von /e/ und /o/ nach sogenannten verhärteten Konsonanten ergab sich ein ähnliches Bild wie für (Jakanje1). Im Weißrussi-schen erfolgt eine [a]-artige Realisierung, im Russischen eine Realisierung als [ɨ]. Auch hier gehen die Werte der älteren Generation in WRGR stärker in Richtung des Weißrussischen, die der jüngeren in Richtung des Russischen. Die Realisierungen der Migrantengeneration liegen dazwischen.
Die sibilantischen Variablen (sʲ), (tʲ), (dʲ), (ʧʲ) und (ʃʲ) betrafen drei Phänomenbereiche:
a) Die Affrizierung der historischen palatalisierten dental-alveolaren Plo-sive im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (tʲ) und (dʲ).
372
b) Die posterior-alveolare Artikulation der palatalisierten vorderen Sibilan-ten im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (sʲ), (tʲ) und (dʲ).
c) Die Entpalatalisierung der postalveolaren Sibilanten im Weißrussischen. Dies betrifft die Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ).
Was zunächst das Phänomen unter a) – die Affriziertheit von (tʲ) und (dʲ) – angeht, so war festzustellen, dass die Dauer der frikativen Phase der Variab-len (tʲ) und (dʲ) sich über die Generationen hinweg nicht unterscheidet. Wie HENTSCHEL & ZELLER (2014) zeigen, sind auch in den Transkriptionen des OK-WRGR fast ausschließlich Affrikaten notiert. Die ‚weißrussische‘ starke Affrizierung bleibt also stabil.
Was das Phänomen b) – die posterior-alveolaren Artikulation der palatali-sierten vorderen Sibilanten – angeht, so zeigten die Messungen der Gravitati-onszentren ein Bild, das insgesamt dem Weißrussischen entspricht. Das affrizierte (tʲ) und noch stärker (sʲ) weisen niedrigere Werte auf als /s/, was auf eine posteriore Artikulation dieser Sibilanten hinweist. Auch für (dʲ) ist eine posteriore Artikulation anzunehmen. Zwischen den Generationen waren keine Unterschiede festzustellen. Die Variation zwischen den Sprechern ist allerdings sehr groß, es gibt in den beiden jüngeren Generationen (bei den Land-Stadt-Migranten und deren Kindern) Sprecher mit Werten, die auf eine dem Russischen entsprechende Artikulation schließen lassen. (Gerade für diese Variablen ist die Aussage aber zu revidieren, wenn nach den Unter-schieden zwischen den Generationen in den drei Kodes Weißrussisch, Rus-sisch und Gemischt differenziert wird, s.u. Auch ist ein Einfluss des Sprechertyps zu finden, mit stärker ‚russischer‘ Aussprache bei dem vor allem in der Generation 2 vertretenen Typ R, der auf strukturell tieferen Ebe-nen stark zum Russischen neigt, s.u.)
Bei den Variablen (ʧʲ) und (ʃʲ) ging es um die Variation zwischen nicht-palatalisierten Realisierungen wie im Weißrussischen und palatalisierten Realisierungen wie im Russischen. Vertreter der Generationen 0 und 1 zeigen Formanteneinstiege nach diesen Konsonanten, die auf überwiegend nicht-palatalisierte Realisierungen schließen lassen. Vertreter der Generation 2 weisen eine Tendenz zu stärker ‚russischen‘, d.h. stärker palatalisierten Varianten auf.
(rʲ): Dies gilt auch für die Variable (rʲ), also bei der Variation von ‚russi-schem‘ [rʲ] und ‚weißrussischem‘ [r] anstelle des etymologischen |rʲ|. Zwar weisen auch Vertreter der Migrantengeneration teilweise Unterschiede zwi-schen (rʲ) und Positionen auf, in denen auch das Russische ein nicht-palatali-
373
siertes [r] hat. In den Mittelwerten und bei der Tokenanalyse war aber insge-samt kein Unterschied zur Generation 0 erkennbar. Auch für (rʲ) zeigen dann Vertreter der Generation 2 eine Tendenz zu stärker ‚russischen‘ d.h. stärker palatalisierten Varianten.
(g): Für (g), die Variation von ‚russischem‘ [g] und ‚weißrussischem‘ [ɣ] waren für die älteren Generationen kaum plosive, ‚russische‘ Realisierungen festzustellen. In der jüngsten Generation nehmen ‚russische‘ Realisierungen insgesamt zu, wobei sich die Sprecher individuell stark unterscheiden. Für die Mehrzahl bleibt die frikative Realisierung des Weißrussischen stabil.
(v): Häufiger ‚russisch‘ bereits in den älteren Generationen fällt dagegen die Realisierung bei (v) aus, wo das Russische einen Frikativ [v] (oder [f]) aufweist, das Weißrussische ein (halb-)vokalisches [u]/[u]. Auch in der Migrantengeneration und sogar der Generation 0 finden sich Sprecher mit einem nicht zu vernachlässigenden Anteil an ‚russischen‘ Realisierungen. In der jüngsten Generation nehmen ‚russische‘ Realisierungen zu, mit großen Unterschieden zwischen den Sprechern. Einige weisen fast ausschließlich die ‚russische‘ frikative Realisierung auf, andere die ‚weißrussische‘ vokalische, bei anderen variieren beide Formen.
Zwischen der Generation der Land-Stadt-Migranten und der ihrer Eltern finden sich also insgesamt wenige Unterschiede. Insbesondere sind es das Jakanje und Vokale nach verhärteten Konsonanten, wo die Vertreter der Generation der Land-Stadt-Migranten intermediäre Varianten aufweisen, intermediär sowohl aus Sicht der älteren und jüngeren Generation, als auch aus Sicht der Systeme der Kontaktvarietäten. Fast durchgehend finden sich dagegen Unterschiede zwischen den beiden älteren Generationen und Gene-ration 2, der Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten. Ausnahmen sind die Sibilanten (sʲ), (tʲ) und (dʲ), wo keine allgemeinen Unterschiede fest-stellbar waren, sowie (Akanje1), wo nur die weiblichen Vertreter eine stärker ‚russische‘ Realisierung aufwiesen. Für (Jakanje1), (Akanje2), (Jakanje2), (rʲ), (ʧʲ), (g) und (v) fällt die Realisierung in den familiären Gesprächen bei jüngeren Sprechern stärker ‚russisch‘ aus. Es muss jedoch an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass diese Aussagen sich auf die Gesamtmenge der Äußerungen beziehen, also auch ‚russische‘ Äußerungen einschließen, und die Befunde noch hinsichtlich des zugrunde liegenden Kodes zu diffe-renzieren sind.
2) Dialektaler Hintergrund: Der dialektale Hintergrund der Sprecher spielt ebenfalls eine große Rolle. Mit Ausnahme der sibilantischen Variablen, wo mitunter für den Nordosten eine stärker posterior-alveolare Artikulation
374
festgestellt wird, diese sich in den vorliegenden Daten aber nicht bestätigen lässt, finden sich dort, wo für die untersuchten Variablen dialektale Unter-schiede bestehen, diese auch in WRGR wieder. Dies ist plausibel angesichts der Entstehungsgeschichte der WRGR und der individuellen Sprachbiogra-phien der untersuchten Sprecher. Wie gesagt entstand WRGR durch die Aufnahme vor allem lexikalischer Elemente in die weißrussisch-dialektal basierte Rede. Im Einzelnen geht es um Folgendes:
Für die unmittelbar vorbetonten vokalischen Variablen sind die dissimi-lativen Muster der nordöstlichen weißrussischen Gebiete bis in die jüngste Generation erkennbar, nehmen aber ab. In den nordöstlichen Gebieten wer-den /a/, /e/ und /o/ als [a] realisiert, wenn unter Betonung kein /a/ steht. Steht unter Betonung ein /a/, so erfolgt die Realisierung nach palatalisierten Kon-sonanten als [ɪ] (dissimilatives Jakanje) und nach nicht-palatalisierten Kon-sonanten als [ə] oder [ɨ] (dissimilatives Akanje). Diese Muster sind in allen Generationen auffindbar, in der jüngsten jedoch insgesamt schwächer und seltener. Im Falle des dissimilativen Jakanje geht der Unterschied dadurch zurück, dass das dialektale [ɪ] vor betontem /a/, das nicht mit der weißrussi-schen Standardsprache, jedoch mit dem Russischen übereinstimmt, stabil bleibt, während das [a] in den anderen Positionen, das mit der weißrussischen Standardsprache übereinstimmt, aber nicht mit dem Russischen, sich in Richtung des ‚russischen‘ [ɪ] bewegt. Im Falle des dissimilativen Akanje wird dagegen auch das dialektale [ɨ]/[ə], das weder mit dem Russischen, noch mit dem Standardweißrussischen übereinstimmt, abgebaut. Es wird damit deutlich, dass es die Bewegung in Richtung des Russischen ist, die für das Zurückgehen der Unterschiede zwischen dissimilativen und nicht-dissimilati-ven Positionen verantwortlich ist, nicht etwa ein Ausgleich der Dialekte untereinander oder ein Annähern an den weißrussischen Standard.
Die von den übrigen Dialekten und dem weißrussischen Standard abwei-chenden Realisierungen von Vokalen in weiteren vorbetonten Silben im nordöstlichen Dialektgebiet schlagen ebenfalls in der WRGR durch. Sprecher aus dem Nordosten weisen stärker [ɪ]-artige Realisierungen nach palata-lisierten und stärker [ə]-artige Realisierungen nach nicht-palatalisierten Kon-sonanten auf. Auch hier stimmt das russische Muster mit dem weißrussischen Dialektmerkmal überein.
Auch das palatalisierte [rʲ] der Gebiete um Chocimsk, das mit dem Russi-schen übereinstimmt, findet sich bei den Sprechern dieser Region. Anders als in den übrigen Städten unterscheiden in dieser Stadt auch Vertreter der älte-ren Generation zwischen |r| und |rʲ|.
375
Auch hier nehmen die Dialektunterschiede ab, indem für jüngere Spre-cher die Tendenz allgemein in Richtung des Russischen geht, also häufiger [rʲ]-artige Realisierungen auftreten und alle vorbetonten Vokale als [ɪ] bzw. [ə] artikuliert werden. Dies führt natürlich letztlich zu einer Konvergenz der Rede in den einzelnen Städten.
3) Geschlecht: Das Geschlecht spielt insgesamt keine große Rolle. Unter-schiede finden sich bei den Variablen (Jakanje1), (Akanje1) und (g). Für (Jakanje1) neigen weibliche Informanten zu stärker ‚weißrussischen‘ Reali-sierungen. In den beiden anderen Fällen neigen Frauen zu stärker ‚russi-schen‘ Realisierungen, wobei dies nur oder vor allem für Vertreterinnen der jüngsten Generation gilt. Warum diese Unterschiede bestehen, kann hier nicht gesagt werden. Für (g) ist allenfalls zu bemerken, dass eine frikative, ‚weißrussische‘ Realisierung mitunter mit „Männlichkeit“ assoziiert wird (vgl. LISKOVEC 2005; 134–136 und 146), was mit der stärkeren Neigung von Frauen zum ‚russischen‘ Plosiv in den hier untersuchten Daten überein-stimmt. Hier müssten experimentelle Studien, die die Bewertung der Merk-male in der weißrussischen Gesellschaft prüfen, Klarheit verschaffen.
4) Phonischer Kontext, Dauer des Lautes, Wortfrequenz: Der phonische Kontext erweist sich in allen Analysen als einflussreich, in vielen Bereichen spielt auch die Dauer des Lautes und die Wortfrequenz eine Rolle. Was den lautlichen Kontext angeht, so sind dies Aspekte, die für spontane Rede gene-rell gelten, d.h. Assimilationserscheinungen, Reduktionserscheinungen und andere Lenitionsprozesse, die in einigen Fällen in Richtung des Russischen gehen, in anderen Fällen in Richtung des Weißrussischen. So beeinflusst die Palatalisiertheit, die Artikulationsart und der Artikulationsort umgebender Konsonanten die Realisierung von Vokalen, auch der nachfolgende Vokal spielt eine Rolle. Bei den vorderen Sibilanten bedingen vordere hohe Vokale und vordere (dentale) Konsonanten eine vordere Artikulation. Bei den Vari-ablen (rʲ), (ʧʲ), und (ʃʲ) ist die Formantenstruktur des folgenden Vokals ein maßgeblicher Faktor, mit stärker palatalisierten Realisierungen vor vorderen Vokalen. Bei (v) ist ebenfalls ein deutlicher Einfluss des Kontextes zu ver-zeichnen. Im Anlaut steigt die Wahrscheinlichkeit einer frikativen Realisie-rung. Innerhalb einer Wortform ist die Wahrscheinlichkeit eines Halbvokals am höchsten nach einem [a], so dass mit [au] ein universal bevorzugter Diph-thong vorliegt. Vor Liquida steigt die Wahrscheinlichkeit einer frikativen Realisierung, was über Vorzüge in der Silbenstruktur erklärt werden kann.
376
Geringere Dauer des Lautes korreliert mit weniger offeneren Realisierun-gen von Vokalen. Hierbei ist allerdings davon auszugehen, dass es die reduzierte bzw. angehobene Realisierung der Vokale ist, die eine kürzere Dauer hervorruft, und nicht umgekehrt. Bei den vorderen Sibilanten korre-lieren längere Realisierungen mit einer vorderen Artikulation.
Auch die Worthäufigkeit hat im Falle von (tʲ) einen Einfluss, mit stärker posterior-alveolaren Realisierungen in häufigeren Lexemen. Für (g) ist eben-falls ein Einfluss der Worthäufigkeit festzustellen, mit einer (noch) geringe-ren Wahrscheinlichkeit der plosiven, ‚russischen‘ Variante in frequenten Lexemen. Bei (v) sind frikative, ‚russische‘ Realisierungen wahrscheinlicher in häufigeren Lexemen.
Es sind also sicherlich auch universale, im Sinne etwa der Natürlichen Phonologie natürliche Tendenzen, die die Variation mitbedingen und die An-nahme der ‚russischen‘ Variante beschleunigen oder abbremsen. So ist zum Beispiel die Anhebung von Vokalen in Jakanje-Positionen sicherlich auch ein natürlicher Prozess, eine Akkommodation an die Palatalisiertheit des voran-gehenden Konsonanten, der bei kürzeren Realisierungen stärker ausgeprägt ist als bei längeren. Die Tatsache, dass Unterschiede zwischen den Generati-onen bestehen, zeigt aber, dass dieser nicht allein für die Variation in WRGR verantwortlich ist, sondern dass der Einfluss des Russischen maßgeblich ist.
Kommen wir nun zur zweiten in der vorliegenden Arbeit gestellten Frage: Was sagt die phonische Seite von WRGR über WRGR hinsichtlich ihrer Stabilisiertheit und ihrem Status als drittem Kode neben dem Weißrussischen und dem Russischen aus? Es stellte sich zunächst heraus, dass in den hier untersuchten Instanzen von familiären Gesprächen Unterschiede zwischen Äußerungen bestehen, die auf strukturell tieferen Ebenen mit dem Russischen oder dem Weißrussischen übereinstimmen oder „gemischt sind“, also in einigen Aspekten/Elementen mit dem Russischen, in anderen mit dem Weiß-russischen übereinstimmen. Besonders deutlich sind die Unterschiede für die Vertreter der jüngeren Generation. Die Variablen (Jakanje1), (sʲ), (tʲ), (ʧʲ), (rʲ), (g) und (v) werden in der jüngeren Generation in ‚weißrussischen‘ Äußerun-gen stärker ‚weißrussisch‘ realisiert, in ‚russischen‘ stärker ‚russisch‘. Die Werte der ‚hybriden‘ Äußerungen liegen zwischen diesen beiden. Die älteren Sprecher zeigen für einige Variablen, für die die jüngeren Sprecher Unter-schiede zwischen den Äußerungen unterschiedlicher Affinität aufweisen, keine oder deutlich geringere Unterschiede. Dies ist bei (tʲ), (ʧʲ), (rʲ), (v) und (g) der Fall. Für (Jakanje1) und bei (sʲ) sowie – anders als für die jüngeren Sprecher – auch bei (dʲ) bestehen dagegen auch in den älteren Generationen
377
Unterschiede zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affinität. Bei den Variablen (Akanje1), (Akanje2) und (Jakanje2) bestehen in keiner Genera-tion Unterschiede zwischen den Äußerungen.
Dementsprechend müssen die bisher postulierten Unterschiede zwischen den Generationen relativiert werden. Sie bestehen nicht oder weniger stark in Äußerungen, die auf strukturell tieferen Ebenen mit dem Weißrussischen übereinstimmen. Hier weisen auch die jüngeren Sprecher eine ‚weißrussi-sche‘ Lautung auf und unterscheiden sich für eine Reihe von Variablen nicht von den älteren Sprechern. In ‚hybriden‘ Äußerungen und vor allem in ‚russi-schen‘ Äußerungen finden sich dagegen Unterschiede zwischen den Genera-tionen. Generation 2 weist hier eine stärker ‚russische‘ Aussprache auf. Es steigt also in dieser Generation das Vermögen (oder auch das Bedürfnis), zwischen den Kodes zu differenzieren.
Hier stellt sich die Frage, wie es mit den ‚hybriden‘ Äußerungen steht, ob sich also auch auf der phonischen Ebene Reflexe der pragmatischen und strukturellen Eigenständigkeit des gemischten Kodes gegenüber dem Weiß-russischen und dem Russischen aufzeigen lassen. Wie in Kapitel 1 erwähnt wurde, nennt AUER (1986) drei Aspekte einer neuen Varietät: Sie bildet im Bewusstsein der Sprecher eine eigene Kategorie, es bestehen situative Regelmäßigkeiten der Anwendung und die Variation innerhalb der poten-tiellen neuen Varietät ist geringer als die zwischen den „alten“ Varietäten. Der erste Punkt war nicht Gegenstand dieser Arbeit, lässt sich aber anhand der in Kapitel 2 vorgestellten Literatur bejahen. Gleiches gilt für den zweiten Punkt: Wie die Arbeiten von KITTEL et al. (2010) und HENTSCHEL & KITTEL (2011) zeigen, bestehen recht klare Domänen des Gebrauchs von WRGR. Was den dritten von Auer genannten Aspekt angeht, so zeigt sich, dass inner-halb von ‚hybriden‘ Äußerungen zwar für einige Variablen tendenzielle Unterschiede zwischen Wortformen ‚weißrussischer‘ und solcher ‚russischer‘ Affinität bestehen.202 Allerdings zeigt der Vergleich mit Wortformen in nicht-gemischten Äußerungen, dass ‚russische‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen bei einigen Variablen stärker ‚weißrussisch‘ realisiert werden. In ‚russischen‘ Wortformen in ‚hybriden‘ Äußerungen neigen (rʲ), (sʲ), (g) und (v) weniger zu einer ‚russischen‘ Aussprache, als sie es in ‚russischen‘ Äußerungen tun. Diese Unterschiede finden sich vor allem bei Generation 2.
202 Auch diese Unterschiedlichkeit spricht nicht gegen eine Eigenständigkeit von WRGR – in
einer stabilisierten Varietät wären zwar aktive phonologische Regeln unabhängig von der Etymologie des Inputs; lexikalisierte Regeln, Morphonologisierungen ursprünglich phono-logischer Regeln können sich jedoch unterscheiden, s.u.
378
Zudem zeigt sich, dass die Variation innerhalb und zwischen Sprechern geringer wird oder sich zwischen den Generationen nicht unterscheidet, wenn nur WRGR im engeren Sinne betrachtet wird, also die Menge der ‚hybriden‘ Äußerungen als klare Instanzen des gemischten Kodes. Dies lässt darauf schließen, dass extreme Werte für diese Variablen vor allem in ‚weißrus-sischen‘ und ‚russischen‘ Äußerungen auftreten, in ‚hybriden‘ die Realisie-rungen der phonischen Variablen hingegen weniger stark zwischen dem ‚russischen‘ und dem ‚weißrussischen‘ Pol schwanken.
Auch auf der phonischen Seite zeigt sich also der Status von WRGR als dritter Kode neben dem ‚Weißrussischen‘ und dem ‚Russischen‘. Die Ergeb-nisse zeigen, dass Sprecher die phonische Seite ihrer Rede „russischer“ ge-stalten können, wenn es nötig oder wünschenswert ist. Wenn sie dies in ‚hyb-riden‘ Äußerungen nicht tun, ihre Rede dann also „weißrussischer“ gestalten, ist davon auszugehen, dass dies zu einem gewissen Grad intentional geschieht. Es besteht also ein gewisser phonischer Usus von WRGR und damit eine Eigenständigkeit der phonischen Seite der WRGR. Dabei ist zu bedenken, dass erstens die Unterscheidung der drei Kodes einem gewissen Messfehler unterliegt (s. Abschnitt 4.4) und zweitens die Äußerungen unter-schiedlicher Affinität in ein und demselben familiären und damit inoffiziellen Gesprächskontext geschehen. Wenn in der vorliegenden Untersuchung nur geringe Unterschiede innerhalb der Rede festgestellt werden, so heißt dies nicht, dass die Sprecher nicht in anderen, nicht-familiären Gesprächssituatio-nen, wenn eine stärkere Nähe zum Russischen angezeigt ist, auch phonisch deutlich mehr in Richtung des Russischen gehen. Die Tatsache, dass jüngere Sprecher untereinander eine stärker in Richtung des Russischen gehende Aussprache zeigen, deutet in diese Richtung.
Einen Hinweis, dass dies nicht nur für die im schulischen Bereich stark russisch geprägten Kinder der Land-Stadt-Migranten gilt, sondern auch für die Migranten selbst, liefern die Unterschiede zu den Ergebnissen von SADOŬSKI (1982). Er untersuchte dezidiert russisch intendierte Rede von Minsker Land-Stadt-Migranten und zeigt, dass in dieser Rede für einige Variablen – für (ʧʲ), (rʲ) und (g) – für die in der vorliegenden Arbeit in der Migrantengeneration eine ‚weißrussische‘ Lautung festgestellt wurde, zwar weißrussische Einflüsse, aber auch deutlichere Tendenzen zur ‚russischen‘ Variante bestehen. Dies heißt, dass Vertreter der Land-Stadt-Migranten phonisch zwischen WRGR im weiteren Sinne (gemischtem Diskurs) und russischem Diskurs unterscheiden, nicht aber innerhalb des gemischten Dis-kurses. Die Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten unterscheidet
379
innerhalb des gemischten Diskurses zwischen den Kodes Russisch und WRGR im engeren Sinne (und ggf. Weißrussisch).
Lassen sich Indizien für ein eigenes „drittes“, „gemischtes“ phonisches System feststellen, das Züge beider Kontaktvarietäten und ggf. eigene Charakteristika aufweist? Da einige Variablen stabil ‚weißrussisch‘ bleiben, andere dagegen in Richtung des Russischen gehen, deutet sich ein solches an.
Bei den Vokalen sind klare Trends zum Russischen zu erkennen. Die Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ in vorbetonten Silben, also die Variablen (Akanje1), (Akanje2), (Jakanje1), (Jakanje2) und (e /Š_), gehen zumindest bei jüngeren Sprechern stärker in Richtung des Russischen, und zwar nicht nur in ‚russischen‘ Äußerungen, sondern auch (wenn auch teilweise nicht so stark) im gemischten Kode.
Die Konsonanten neigen dagegen im gemischten Kode stärker zur ‚weiß-russischen‘ Seite. Zwar finden sich im gemischten Kode Unterschiede zwi-schen ‚russischen‘ und ‚weißrussischen‘ Wortformen. Die konsonantischen Variablen neigen für ‚russische‘ Wortformen im gemischten Kode aber stark zur ‚weißrussischen‘ Variable. Als Ausnahme ist (ʧʲ) zu nennen, für das ‚russische‘ Wortformen im gemischten Kode und ‚russische‘ Wortformen im russischen Kode nicht unterschieden werden. Hier deutet sich also eine „ety-mologisch“ bedingte Lexikalisierung an. Für (v) ist die Häufigkeit der ‚russi-schen‘ Variante nicht unerheblich, aber geringer als im russischen Kode.
Letztlich hängt die Stabilisierung, Beibehaltung oder Übernahme von sprachlichen Merkmalen in Fällen des Sprachkontakts von dem Prestige dieser Merkmale ab. Damit hängt auch das Überleben der hier untersuchten ‚weißrussischen‘ phonischen Merkmale von dem Prestige der sogenannten „Trasjanka“ insgesamt ab. Wie eingangs dargelegt, sind Indizien vorhanden, dass WRGR für einige Sprecher ein verstecktes Prestige genießt: Sie wird auch von Personen benutzt, die zweifellos des Russischen mächtig sind, sie wird von vielen Menschen als Muttersprache angegeben, in individuellen Äußerungen finden sich auch neutrale und positive Bewertungen. Die Tatsa-che, dass einige phonische Merkmale des Weißrussischen stabil bleiben, auch wenn die ‚russische‘ Variante keine artikulatorische Schwierigkeit darstellt und von den jüngeren Sprechern untereinander praktiziert wird, deutet in dieselbe Richtung. Wenn die phonischen Merkmale des Weißrussischen als positiv bewerteter Marker einer weißrussischen Andersartigkeit gegenüber Russland dienen, kann „Weißrussisches“ in der substandardlichen Rede überdauern.
380
Es sei abschließend eine stark abstrahierende Übersicht über die phoni-sche Seite von WRGR im engeren Sinne gezeigt. Natürlich liegt dabei in WRGR Variation vor, was aber für jegliche sprachliche Varietät inklusive traditioneller Dialekte und Standardvarietäten gilt.
Die phonische Seite von WRGR im engeren Sinne im Vergleich zum Weißrussischen Tab. 119und Russischen.
Variable Weißrussische „Haupt-Ausprägung“
Russische „Haupt-Ausprägung“
WRGR
(Akanje) [a] [ɐ] [ɐ]
(Akanje2) [a] [ə] [ə]
(Jakanje) [a] [ɪ] [e/ɛ], Tendenz zu [ɪ]
(Jakanje2) [e] [ɪ] [ɪ]
(e /Š_) [a] [ɨ] [ə], Tendenz zu [ɨ]
(sʲ) [s"] [sʲ] [s"]
(tʲ) [ʦ"] [tʲ] [ʦ"]/[ʦʲ]
(dʲ) [ʣ"] [dʲ] [ʣ"]/[ʣʲ] (ʧʲ) [t ʂ] [ʧʲ] [t ʂ]/[ʧʲ]
(ʃʲ) [ʂt ʂ] [ʃʲː] [ʂt ʂ]
(rʲ) [r] [rʲ] [r]
(v) [u] [v] [u] (/[v])
(g) [ɣ] [g] [ɣ]
Auch wenn die Arbeit in erster Linie ein deskriptives Ziel hatte, seien ab-schließend die Ergebnisse herausgestellt, die in einem größeren kontaktlin-guistischen Zusammenhang relevant sind und zum Verständnis von Sprach-kontakt, Sprachmischung und „exogenem“ Sprachwandel beitragen können. Es sei noch einmal auf das Spezifikum von WRGR hingewiesen: WRGR ver-eint Züge des prototypischen „Dialektkontakts“ und des prototypischen „Sprachkontakts“. Wie eingangs angedeutet, ist der Kontakt zum Weißrussi-schen und Russischen in vielerlei Hinsicht mit Dialektkontakt vergleichbar. Wie beim prototypischen Dialektkontakt ermöglicht die strukturelle Nähe und relative gegenseitige Verständlichkeit Variation, die „sprachinterner“ Variation gleicht. Andererseits sind die strukturell tieferen flexions-, derivations- und lexikalisch-morphologischen Unterschiede zwischen den Kontaktvarietäten größer. Anders als beim prototypischen Dialektkontakt ermöglichen die stärkeren Unterschiede auf strukturell tieferen Ebenen Phänomene des Kodemischens.
381
1) Die Existenz von Sprechertypen: Es zeigt sich, dass sich Sprecher im Falle des Kontakts nah verwandter Varietäten auf der phonischen Ebene relativ konstant verhalten, also für die Mehrzahl der Variablen gleichermaßen zu dem einen oder anderen Bezugspunkt (hier dem Russischen oder Weißrussi-schen) tendieren. Es bestehen hinsichtlich des kontaktbedingten Einflusses auf die Aussprache auch innerhalb ein und derselben Generation unterschied-liche Sprechertypen. Die vorliegende Arbeit liefert damit einen Beitrag zum besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen Variablen auf unter-schiedlichen Ebenen, die – wie bereits angesprochen – bisher wenig erforscht sind: Es gibt kaum Untersuchungen, die der Frage nachgehen, ob Sprecher oder Sprechergruppen, die auf der einen Sprachebene zu einer Varietät neigen, auch auf anderen Sprachebenen zu dieser Varietät tendieren (vgl. CHESHIRE, KERSWILL & WILLIAMS 2005, 135).
In WRGR fallen auf der Ebene des Sprechers die Zusammenhänge zwi-schen der Variation auf der phonischen Ebene und der Variation auf struktu-rell tieferen Ebenen in Generation 2 sehr deutlich aus. Es zeigt sich also, dass sich die Vertreter der Generation 2 in unterschiedliche Typen trennen. Die-jenigen, die auf der phonischen Ebene stärker zum Russischen tendieren, sind solche, die auch auf strukturell tieferen Ebenen bereits überwiegend ‚rus-sisch‘ orientiert sind. Andere behalten auf tieferen Ebenen noch ein relativ starkes ‚weißrussisches‘ Element bei und weisen dementsprechend viele ‚hybride‘ Äußerungen auf. Diese Sprecher bleiben auf der phonischen Ebene stark ‚weißrussisch‘ orientiert. Die Beobachtung, dass die Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten zum Russischen tendiert, ist also noch einmal zu relativieren. Es sind vor allem Sprecher, die auf strukturell tieferen Ebenen zum Russischen tendieren, die eine stärker ‚russische‘ Artikulation aufweisen. In Generation 1 gibt es dagegen kaum Zusammenhänge zwischen den Variablen, und es zeigt sich lediglich für eine Variable – die Variable (tʲ) – ein Einfluss des Sprechertyps.
Zwischen den Sprechertypen finden sich auch für Variablen Unter-schiede, für die zwischen den Generationen keine Unterschiede festgestellt werden konnten, d.h. für die Sibilanten (sʲ) und (tʲ). Hier zeigen Sprecher, die auf strukturell tieferen Ebenen weitgehend zum Russischen übergegangen sind, eine stärker mit dem Russischen übereinstimmende Realisierung, während stärker ‚weißrussisch‘ und ‚gemischt‘ geprägte Typen die posterior-alveolare Artikulation des Weißrussischen beibehalten. Der Sprechertyp ist also wichtiger als die Generation, wodurch sich die Frage aufdrängt, womit es zusammenhängt, dass sich innerhalb ein und derselben Generation unter-
382
schiedliche Sprechertypen herauskristallisieren. Denkbar wären Faktoren wie Identität und Spracheinstellungen, was aber in der vorliegenden Arbeit auf-grund der geringen Sprecherzahl nicht weiter untersucht werden konnte
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Frage nach der Parallelität von Varia-tion auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen auf der Ebene des Sprechers nach Generationen differenziert beantwortet werden muss. In der ersten Generation, für die der phonische Einfluss gering ist, bestehen keine oder kaum Zusammenhänge zwischen der Neigung der Sprecher auf strukturell tieferen Ebenen zu einer der beiden Kontaktsprachen und ihrer Aussprache. Dies gilt auch bei den Variablen, für die in dieser Generation bereits ein kontaktbedingter Einfluss erkennbar ist, etwa beim (Jakanje1). In der zweiten Generation korreliert dagegen die phonische Seite mit den strukturell tieferen Ebenen. Damit ist auch gezeigt, dass der phonische Wandel zeitversetzt zum lexikalischen und morphologischen passiert.
2) Metavariablen: Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass Sprecher vor allem für solche Variablen gleichermaßen zum ‚Russischen‘ oder ‚Weiß-russischen‘ tendieren, bei denen sich die ‚weißrussische‘ und die ‚russische‘ Ausprägung anhand des gleichen oder eines vergleichbaren phonetischen Merkmals unterscheiden. Dabei können die Variablen selbst phonetisch und phonologisch ganz unterschiedlicher Natur sein. So sind die Zusammenhänge nicht nur für die vorderen Sibilanten besonders stark (die ja selbst eine pho-netische und phonologische Klasse bilden), sondern auch zwischen den Vari-ablen (rʲ) und (ʧʲ), zwischen (Jakanje1) und (Akanje1) und zwischen (g) und (v). Im Falle von (rʲ) und (ʧʲ) unterscheiden sich die ‚russische‘ und die ‚weißrussische‘ Ausprägung in der Palatalisiertheit, im Falle von (Jakanje1) und (Akanje1) im Öffnungsgrad des Vokals und im Falle von (g) und (v) in der konsonantischen Stärke. Ob die Existenz solcher Metavariablen (posteri-ore Artikulation von palatalisierten vorderen Sibilanten, Vokalreduktion, Palatalisierung, Lenition) ein generelles Phänomen ist, müsste an einer brei-teren typologischen Untersuchung geprüft werden.
3) Unterschiede in der Geschwindigkeit des Wandels: Wie ist es zu erklären, dass einige Variablen stärker, einige schwächer, einige bereits in der ersten Generation beeinflusst sind, einige sich in den Kodes unterscheiden, einige zur Akkommodation verwendet werden? Was die sprecherübergreifenden Unterschiede in der Neigung der einzelnen phonischen Variablen zu den jeweiligen Bezugsgrößen, ihre geringere oder stärkere Konservativität im Sprachkontakt angeht, so zeigen die Ergebnisse, dass unterschiedliche
383
Aspekte eine Rolle spielen: a) universale phonetisch-phonologische Präfe-renzen, b) die Frage der Salienz der Merkmale sowie c) für die Sprachsitua-tion spezifische soziale Bewertungen der einzelnen Merkmale.
a) Gerade die Variablen, für die eine größere Affinität zum Russischen zu beobachten ist, zeigen vergleichbare Tendenzen auch in der weißrussischen Standardsprache. Es spricht vieles dafür, dass der Wandel [a] zu [ɪ] bei Vokalen in Jakanje-Positionen ein Wandel ist, der zwar für bestimmte Konstellationen (etwa in ‚russischen‘ Äußerungen) besonders stark ist, der aber grundsätzlich für die weißrussische Gesellschaft gilt. Unterschiede bestehen erstens zwischen allen Generationen, also auch zwischen Genera-tion 0 und 1, und zweitens für alle Äußerungstypen. Auch jüngere Sprecher, die nicht überwiegend ‚russische‘ Äußerungen zeigen, unterscheiden sich hier von älteren Sprechern. Stark angehobene Realisierungen waren auch von ZELLER (2013c) bei Sprechern des weißrussischen Standards festgestellt worden. Auch eine Reduktion von Vokalen in Akanje-Positionen besteht im weißrussischen Standard (ANDREEV 1983), und auch eine Spirantisierung von [u] zu [v] ist zu beobachten (VYHONNAJA 1991, 205). Auch (tʲ) wird im Weißrussischen nicht so stark posterior-alveolar artikuliert wie (sʲ). Natürlich ist für die genannten Phänomene zumindest teilweise auch im Standardweiß-russischen ein Einfluss des Russischen plausibel, möglich ist aber auch, dass hier allgemeine, sprachinterne Prozesse ablaufen. Zumindest ist eine sich gegenseitig katalysierende Wirkung sprachinterner Entwicklungen und sprachexterner Einflüsse denkbar.
Es fällt zudem auf, dass in WRGR (zumindest in WRGR im engeren Sinne) die konsonantischen Variablen insgesamt (mit Einschränkungen) recht stabil ‚weißrussisch‘ bleiben, während für die vokalischen Variablen Verän-derungen in Richtung des Russischen feststellbar sind. Für Sprachwandel ist die größere Stabilität von Konsonanten bekannt. Dass sich auch im Sprach-kontakt und Sprachwechsel Konsonanten als stabiler erweisen, ist in dieser Pauschalität wohl bisher nicht angenommen worden. MATRAS (2009, 231f.) deutet jedoch an, dass Ähnliches der Fall sein könnte. Er beobachtet für Varietäten des Romani in Zentraleuropa, dass Vokale der jeweiligen Kontakt-sprache schneller in das native Lexikon übernommen werden als Kon-sonanten. Unter den ererbten Konsonanten gehören Halbvokale (und Liqui-de) zu den am schnellsten veränderten. Auch Letzteres passt ins Bild. So ist auch die Variable (v), die im Weißrussischen als Vokal oder Halbvokal reali-siert wird, recht stark durch das Russische beeinflusst. Auch hier müsste ein Vergleich mit anderen Kontaktsituationen Klarheit schaffen.
384
b) Was den Aspekt der Salienz angeht, so bestätigt sich, dass eine gewisse phonetische Distanz bestehen muss, damit Sprecher nicht nur untereinander, sondern auch individuell in unterschiedlichen Stilen bzw. hier in unter-schiedlichen Kodes variieren. Bei den vokalischen Variablen, bei denen sich die Ausprägungen in den Kontaktsprachen phonetisch nur geringfügig unter-scheiden (Akanje1, Akanje2, Jakanje2), spielt die Affinität der Äußerung keine Rolle. Für (Jakanje1) und für (e /Š_), wo die Distanz größer ist, be-stehen dagegen Unterschiede zwischen Äußerungen unterschiedlicher Affi-nität. (Jakanje1) und (e /Š_) sowie die dialektale Realisierung von /o/ und /a/ nach nicht-palatalisierten Konsonanten vor betontem /a/ als [ɨ] oder [ə] unterliegen zudem bereits in der Migrantengeneration einem Wandel. Für (Jakanje1) zeigt sich auch, dass ältere Sprecher sich in ihre Aussprache an den Gesprächspartner anpassen. Es sind also zunächst und vor allem die auffälligen Merkmale, die abgebaut werden und der sprecherinternen Varia-tion unterliegen.
c) Mit HENTSCHEL (2013a, 59) ist zudem davon auszugehen, dass für Phänomene des Sprachkontakts für die jeweiligen Sprachen spezifische soziale Bewertungen der einzelnen Merkmale eine Rolle spielen. So stellt die ‚russische‘ Variante von (g) – der Plosiv [g] – auch aus „weißrussischer Sicht“ sowohl perzeptiv als auch artikulatorisch keine Schwierigkeit dar. Die ‚weißrussische‘ Variante ist jedoch nicht negativ konnotiert (oder sogar posi-tiv, denn sie tritt auch im Russischen als Variante in einigen Lexemen sakra-ler Konnotation auf) und wird dementsprechend nicht unterdrückt. Anderer-seits gilt sie als „männlich“. Diese Bewertungen einzelner Variablen und ihre punktuelle Bedeutung im Redeverlauf verdienen weitere Untersuchungen, nicht nur für den Fall WRGR (vgl. ECKERT 2010; 2012). Soziale Bewertun-gen und phonische Präferenzen können auch zusammenfallen. So ist bei der Affrizierung von (tʲ) und (dʲ) davon auszugehen, dass deren Unterdrückung eine artikulatorische Schwierigkeit darstellt und sie außerdem auch nicht sozial stigmatisiert ist, da im Russischen ähnliche Realisierungen erfolgen. Dementsprechend stabil ist dieses Merkmal auch in ‚russischen‘ Äußerungen und auch bei Sprechern, die auf tieferen Ebenen stark zum ‚Russischen‘ tendieren. Die posteriore Artikulation der Affrikaten, die ein deutliches Merkmal des Weißrussischen ist, geht dagegen im russischen Kode und bei Sprechern, die auf tieferen Ebenen zum ‚Russischen‘ neigen, zurück.
4) Zum Einfluss der Lexik: Es ist eine alte Frage, ob sich Lautwandel lexika-lisch gesteuert vollzieht. Auch im Falle von Dialektkontakt wird diese Frage aufgeworfen. So bemerkt TRUDGILL (1999, 136), dass der kontaktbedingte
385
phonologische Wandel von Dialekten häufig auf lexikalische Transfers zurückzuführen ist. In der Diskussion über sogenannte Mischsprachen wurde die Frage gestellt, ob für die etymologisch unterschiedlichen Teile des Wort-schatzes auch unterschiedliche phonologische Systeme möglich sind. Natür-lich harren daher die Befunde zum Zusammenhang der phonischen Ebene mit der Lexik im gemischten Kode einer Diskussion. Dies gilt vor allem für die Variablen, die in ‚russischen‘ Wortformen im gemischten Kode gleich stark ‚russisch‘ artikuliert werden wie in ‚russischen‘ Wortformen im russischen Kode, d.h. für (Jakanje1), (tʲ), und (ʧʲ). Für diese Variablen erfolgt also keine Adaption an den gemischten Kode, wobei stets bedacht werden muss, dass die Realisierung auch im russischen Kode noch stark ‚weißrussisch‘ geprägt ist. Dieser Befund zeigt, dass phonische Variation im Kontakt eng verwand-ter Sprachen auch lexikalisch bedingt ist – nicht nur in dem Sinne, dass die Worthäufigkeit eine Rolle spielt, sondern auch, dass die „Etymologie“ eine Rolle spielt (vgl. TRUDGILL 1999, 136). Wenn sich WRGR weiter stabilisie-ren sollte, wäre es also denkbar, dass /ʧʲ/ in Lexemen russischer Herkunft steht, /t ʂ/ in Lexemen weißrussischer Herkunft.
Werfen wir zunächst einen Blick auf zwei Variablen, die in der vorlie-genden Arbeit nicht behandelt wurden. Bringt man zunächst die in der vor-liegenden Arbeit erhaltenen Befunde mit den Ergebnissen bei HENTSCHEL & ZELLER (2014) zur lexikalisch bedingten Variation von [l] und [u] in Lexe-men wie wr. poŭny vs. ru. polnyj ‚voll‘ sowie des prothetischen [v] in Lexe-men wie wr. vosenʼ vs. osenʼ ‚Herbst‘ zusammen, ergibt sich ein interessan-tes Bild: Diese lexikalisierten Merkmale des Russischen werden schneller übernommen als die rein phonischen Unterschiede. Dies ist einerseits plausi-bel. Beide Laute des Russischen stellen aus Sicht des Weißrussischen keine artikulatorische Schwierigkeit dar. Andererseits sind bei beiden Phänomenen die Entsprechungen zwischen den Sprachen aus Sicht des Weißrussischen undurchsichtig: Ob einem weißrussischen [ŭ] im Russischen ein [l] oder ein [v] entspricht (oder ein [u]), erfordert lexikalisches Wissen (vgl. wr. poŭny vs. ru. polnyj ‚voll‘ mit wr. roŭny vs. ru. rovnyj ‚glatt‘). Auch bei dem pro-thetischen [v] ist aus Sicht des Weißrussischen nicht ersichtlich, ob im Russi-schen ein [v] steht oder nicht (vgl. wr. vosenʼ vs. ru. osenʼ ‚Herbst‘ mit wr. vosemʼ vs. ru. vosemʼ ‚Acht‘). Der Erwerb solcher nicht eindeutiger, un-durchsichtiger Entsprechungen im späteren Alter wird als äußerst schwierig eingeschätzt (LABOV 1991, 28; AUER, BARDEN & GROSSKOPF 1998, 168). Als Konsequenz teilen solche Variablen stärker als ohne lexikalisches Wis-sen anwendbare Variablen die Sprecher in „late acquirer“, die nur eine
386
geringe Menge an zielsprachlichen Varianten aufweisen, und „early acquirer“, für die die Anzahl der zielsprachlichen Varianten beträchtlich höher ist (CHAMBERS 1998 [1992], 152f. und 160). Im Falle von WRGR scheint die Übernahme solcher Merkmale aber keine Probleme zu bereiten. Dies könnte ein Spezifikum einer Situation sein, in dem die Sprecher auf den Erwerb von Lexik, und nicht eines „Akzentes“ achten.
Es ist anzunehmen, dass die für einige Variablen beobachtete Identität in der „Aussprache” von ‚russischen‘ Wortformen im gemischten und im russi-schen Kode und ihre Unterschiedlichkeit zu ‚weißrussischen‘ Wortformen im gemischten Kode ebenso auf lexikalisierten Übernahmen beruht. Dies ist vor allem für die Variable (Jakanje1) plausibel. Diese stellt zwar aus Sicht des Weißrussischen, nicht aber aus Sicht des Russischen eine durchsichtige Korrespondenz dar. Zwar entspricht jedem vorbetonten [a] nach palatalisier-ten Konsonanten des Weißrussischen ein [ɪ] im Russischen, aber umgekehrt entspricht nicht jedem vorbetonten [ɪ] des Russischen ein vorbetontes [a] im Weißrussischen: Vorbetontes [ɪ] als Realisierung von /i/ ist auch im Weißrus-sischen möglich. Von daher ist es plausibel, dass hier eine Uminterpretation des russischen vorbetonten [ɪ] zu /i/ erfolgt. Dies erklärt auch, warum in der jüngeren Generation aus einer globalen Perspektive keine Akkommodations-erscheinungen festgestellt wurden. Es sei an die Diskussion der phonischen Seite von Mischsprachen erinnert: Unterschiedliche phonologische Systeme im engeren Sinne für die etymologisch unterschiedlichen Teile der Lexik sind ungewöhnlich, was jedoch nicht heißt, dass nicht phonologische Regeln in lexikalisierter Form aus beiden Kontaktsprachen übernommen werden. Ande-rerseits zeigt für (Jakanje1) der Befund, dass für die Mehrzahl der Sprecher eine Normalverteilung um einen intermediären Wert [e]/[ɛ] vorliegt, dass hier auch ein „neogrammatischer“ allgemeiner und gradueller Lautwandel von vorbetontem [a] zu [ɪ] erfolgt.
Ein weiterer Aspekt spielt sicherlich bei der tendenziellen Unterschiedlichkeit von ‚weißrussischen‘ und ‚russischen‘ Wortformen im gemischten Kode eine Rolle: AUER (1997) beobachtet, dass im Falle von Dialekt/Standard-Kontinua stärker lexikalisierte dialektale Merkmale den vom Standard abweichenden phonologischen Prozess implizieren. Das dem-entsprechende standardsprachliche lexikalisierte Merkmal erlaubt sowohl das Unterdrücken als auch das Zulassen des Prozesses. Im Bewusstsein der Unterschiede zu Auers viel stärker differenzierenden Untersuchung lässt sich Ähnliches auch für WRGR feststellen. In WRGR ist es so, dass auf struktu-rell tieferen Sprachebenen ‚Weißrussisches‘ ‚weißrussisch‘ ausgesprochen
387
wird, ‚Russisches‘ dagegen hinsichtlich der Aussprache variabel ist (vgl. auch ZELLER & TESCH 2011). Eine Parallele findet sich dazu im morphologi-schen Bereich: Während ‚russische‘ Wurzeln sich sowohl mit ‚weißrussi-schen‘ als auch mit ‚russischen‘ Endungen verbinden (letzteres häufiger), finden sich kaum Verbindungen einer ‚weißrussischen‘ Wurzel mit einer ‚russischen‘ Endung (HENTSCHEL & TESCH 2007, 22; HENTSCHEL 2008a, 459). Lexikalisch ‚Weißrussisches‘ ist, so kann man es deuten, markierter, lexikalisch ‚Russisches‘ dagegen weniger markiert.
AUER (1997) geht davon aus, dass Kookkurrenzrestriktionen Teil der Kompetenz eines Sprechers sind. Dies bedeutet, dass die ‚russische‘ Aus-sprache von Äußerungen und Wortformen, die auf strukturell tieferen Ebenen als ‚weißrussisch‘ zu klassifizieren sind, nicht der (natürlich usuellen) Norm des gemischten Kodes entspricht. In ‚russischen‘ Wortformen und Äußerun-gen ist dagegen Variation möglich. Ausnahmen sind das Jakanje und das Akanje. Hier ist anzunehmen, dass die Prozesse der Anhebung und Zentrali-sierung für das gesamte Lexikon gelten.
Die Ergebnisse zeigen also, dass in Fällen gemischter Rede im phoni-schen Bereich gleichzeitig unterschiedliche und sich teilweise überlagernde Phänomene vorliegen können: lexemgebundene Variation, allgemeiner Lautwandel und Kookkurrenzrestriktionen.
5) Funktionalität: Die phonische Variation in WRGR ist in bestimmten Grenzen funktional – in Gesprächen mit Vertretern der Generation 1 und vor allem mit Generation 0 zeigen Vertreter der jüngsten Generation für einige Variablen eine stärker ‚weißrussische‘ Aussprache, bzw. umgekehrt im Gespräch untereinander eine stärker ‚russische‘. Die Beobachtung, dass die Generation der Kinder der Land-Stadt-Migranten zum Russischen tendiert, ist also noch ein drittes Mal zu relativieren. Im Gespräch mit der Elterngene-ration, der Generation der Land-Stadt-Migranten, und vor allem mit der Generation der Großeltern, den Sprechern, die ihr Leben zumindest bis ins hohe Alter auf dem Land verbracht haben, verstärkt sich das ‚weißrussische‘ Element. Überraschender ist sicherlich der Befund, dass dies bereits für die Generation 1, die Generation der Land-Stadt-Migranten gilt. Bei einigen Variablen findet sich eine stärker ‚weißrussische‘ Aussprache im Gespräch mit der ältesten Generation, den Eltern der Land-Stadt-Migranten.
Es bleiben im Detail und im Groben ungelöste Fragen: Warum neigen für die eine Variable eher weibliche Informanten, für die andere eher männliche Informanten zum ‚russischen‘ Muster? Wie ist das seltsame Muster der vor-
388
deren Sibilanten, für die die Kovariation der Generation mit der Affinität der Äußerung auf strukturell tieferen Ebenen jeweils unterschiedlich ausfällt, zu erklären? Wovon hängt – auf einer allgemeineren Ebene – die Variation der Kodes und ihrer einzelnen Merkmale im Diskurs ab? Für die Zukunft sollten daher zwei Aspekte in den Blickpunkt rücken: Zum einen sollte die Wahr-nehmung der einzelnen Merkmale in der Sprachenlandschaft von Belarus sowohl im Sinne von Perzeption als auch von Interpretation untersucht wer-den. Zum anderen sollte eine stärker diskursorientierte, syntagmatische Per-spektive eingenommen werden, die untersucht, wie Sprecher ihr Gesamt-repertoire des Weißrussischen, Gemischten und Russischen kreativ einsetzen. Was die phonische Seite angeht, sind die Grundlagen hierfür mit der vorlie-genden Arbeit gelegt: So ist das Verwenden eines klaren ‚weißrussischen‘ [a] eines Vertreters der jüngsten Generation in einem Diskursfragment an einen Vertreter der ältesten Generation erst vor dem Hintergrund des allgemeinen klaren Trends zum ‚russischen‘ [ɪ] vollständig einzuordnen.
Wie wird aus gemischter Rede ein gemischter Kode? Was die phonische Seite angeht, so zeigen die Ergebnisse, dass Studien zur phonischen Variation im Kontakt eng verwandter, aber doch auf strukturell tieferen Ebenen abwei-chender Sprachen die Variation auf diesen tieferen Ebenen zu berücksichti-gen haben. In gemischter Rede im weiteren Sinne bestehen Unterschiede zwischen Kodes, und diese korrelieren mit Unterschieden auf der phonischen Ebene. Bereits in der ersten, vor allem in der zweiten Generation beginnt die phonische Ausdifferenzierung dieser Kodes (ebenso wie sich in der zweiten Generation bestimmte auch phonisch unterschiedliche Sprechertypen heraus-bilden). Diese phonischen Unterschiede zwischen den Äußerungstypen zei-gen, dass verfestigte phonische „Interferenzen“ in zunächst durch späten Zweitspracherwerb entstandenen Ethnolekten nicht durch einen Mangel an Kompetenz bedingt sein müssen, sondern „freiwillig“, also funktional und intentional geschehen.
389
Quellenverzeichnis
Korpus
OK-WRGR 2014 = HENTSCHEL, G.; ZELLER, J. P.; TESCH, S. 2014: Das Oldenburger Korpus zur weißrussisch-russischen gemischten Rede: OK-WRGR. Oldenburg [http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-ver-lag/ok-wrgr/] [Die in der vorliegenden Arbeit benutzten Angaben zur Affinität der sprachlichen Einheiten, zur Häufigkeit der Lemmata usw. entstammen einer vorläufigen Version dieses Korpus.]
Literatur
ANDERSEN, N. 1978: On the calculation of filter coefficients for maximum entropy spectral analysis. In: Childers, D. G. (ed.): Modern spectrum analysis. New York, 252–255
ANDRĖEŬ, A.M. 1983: Subʼektyŭnyja acėnki parametraŭ nacisknych i nenacisknych halosnych belaruskaj litaraturnaj movy. In: Padlužny, A.I. (rėd.): Fanetyka slova ŭ belaruskaj move. Minsk, 140–177
ANDREEV, A.N. 1983: Količestvennaja i kačestvennaja redukcija glasnych v belorusskom literaturnom jazyke. Avtoref. diss. kand. filol. nauk. Minsk
ANTIPOVA, M.B. 1977: Sopostavitel’naja charakteristika soglasnych russkogo i belorusskogo jazykov. In: Suprun, A.E. (red.): Voprosy prepodavanija russkogo jazyka v školach s belorusskim jazykom obučenija. Minsk, 112–131
AUER, P. 1986: Konversationelle Standard/Dialekt-Kontinua (Code-Shifting). In: Deutsche Sprache (1986), 97–124
AUER, P. 1997: Co-occurrence restrictions between variables. A case for social dialectology, phonological theory and variation studies. In: Hinskens, F.; van Hout, R.; Wetzels, L. (eds.): Variation, change and phonological theory. Amsterdam, 71–102
390
AUER, P. 1999: From code-switching via language mixing to fused lects. Toward a dynamic typology of bilingual speech. In: International Jour-nal of Bilingualism 3, 309–332
AUER, P. 2007: The monolingual bias in bilingualism research, or: why bi-lingual talk is (still) a challenge for linguistics. In: Heller, M. (ed.): Bi-lingualism: a social approach. Basingstoke, 319–339
AUER, P.; BARDEN, B.; GROSSKOPF, B. 1998: Subjective and objective pa-rameters determining ‚salience‘ in long-term dialect accommodation. In: Journal of Sociolinguistics 2, 163–187
AVANESOV, R.I. 1956: Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva
AVANESOV, R.I. 1972: Russkoe literaturnoe proiznošenie. Moskva
BAAYEN, R. H. 2008: Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R. Cambridge
BAKKER, P. 1997: A language of our own: the genesis of Michif, the mixed Cree-French language of the Canadian Métis. New York
BAKKER, P.; MOUS, M. 1994: Introduction. In: Bakker, P.; Mous, M. (eds.): Mixed languages: 15 case studies in language intertwining. Amster-dam, 1–11
BARNES, J. 2002: Positional neutralization. A phonologization approach to typological patterns. Ph.D. dissertation, University of California. Berkeley [http://washo.uchicago.edu/pub/Barnes.pdf; letzter Zugriff: 13.12.2012]
BAUER, L. 2008: Lenition revisited. In: Journal of Linguistics 44, 605–624
BEHRENS, S. J.; BLUMSTEIN, S. E. 1988: Acoustic characteristics of English voiceless fricatives: A descriptive analysis. In: Journal of Phonetics 16, 295–298
BEYRAU, D.; LINDNER R. (Hrsg.) 2001: Handbuch der Geschichte Weiß-russlands. Göttingen
BIEDER, H. 1991: Die erste und zweite Wiedergeburt der weißrussischen Sprache und Kultur. Weißrussisch, Russisch und Polnisch in Weiß-russland unter dem Aspekt der Sprachpolitik und Sprachsoziologie. In: Bieber, U.; Woldan, A. (Hrsg.): Georg Mayer zum 60. Geburtstag. München, 405–451
391
BIEDER, H. 1992: Die gegenwärtige sprach- und kulturpolitische Entwicklung in Weißrussland. In: Die Welt der Slaven 37, 142–168
BIEDER, H. 1995a: Soziolinguistische Aspekte der weißrussischen Sprache. In: Zeitschrift für Slawistik 40, 398–414
BIEDER, H. 1995b: Sprachenpolitische Tendenzen in Weißrussland 1985–1993. In: Wodak, R. (Hrsg.): Sprachenpolitik in Mittel- und Osteuropa. Wien, 29–35
BIEDER, H. 1996a: Normprobleme der weißrussischen Standardsprache: Tendenzen der Russifizierung und Weißrussifizierung. In: Ohnheiser, I. (Hrsg.): Wechselbeziehungen zwischen slavischen Sprachen, Literatu-ren und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart. Innsbruck, 115–128
BIEDER, H. 1996b: Zur Diskriminierung der weißrussischen Sprache in der Republik Weißrussland. In: Die slawischen Sprachen 50, 67–122
BIEDER, H. 2000: Konfession, Ethnie und Sprache in Weißrussland im 20. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Slawistik 45, 200–214
BIEDER, H., 2001: Der Kampf um die Sprachen im 20. Jahrhundert. In: Beyrau, D.; Lindner, R. (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Weißruss-lands. Göttingen, 451–471
BIRYLA, M.V. 1958: Da pytannja ab farmiravanni i važnejšych normach belarusskaha litaraturnaha vymaŭlennja. In: Vesci Akadėmii navuk BSSR. Seryja hramadskich navuk (1958), 165–176
BIRYLA, M.V.; ŠUBA, P.P. (rėd.) 1985: Belaruskaja hramatyka. U dzvjuch častkach. Č. 1: Fanalohija, arfaėpija, marfalohija, slovaŭtvarėnne, nacisk. Minsk
BLINAVA, Ė.; MJACELʼSKAJA, E. 1969: Belaruskaja dyjalektalohija. Minsk
BM 2004 = HRYHOR’EVA, L.M. (rėd.) 2004: Belaruskaja mova. U dzvjuch castkach. Č. 1. Fanetyka, arfaėpija, hrafika, arfahrafija, leksikalohija, frazealohija, marfemnaja budova slova i slovaŭtvarenne, marfalohija. Vyd. 5., vypraŭlenae. Minsk
BOLLA, K. 1981: A conspectus of Russian speech sounds. Köln
BONDARKO, L.V. 1977: Zvukovoj stroj sovremennogo russkogo jazyka. Moskva
392
BONDARKO, L.V. 1981: Fonetičeskoe opisanie jazyka i fonologičeskoe opisanie reči. Leningrad
BONDARKO, L.V. 2000: Language contacts: phonetic aspects. In: Gilbers, D. G.; Nerbonne, J.; Schaeken, J. (eds.): Languages in contact. Amsterdam [etc.], 55–65
BONDARKO, L.V.; VERBICKAJA, L.A.; ZINDER, L.R. 1966: Akustičeskie charakteristiki bezudarnosti (na materiale russkogo jazyka). In: Ivanov, V.V. (rėd.): Strukturnaja tipologija jazykov. Minsk, 56–64
BRANDES, O. 2010: Entwicklungstendenzen in der Flexionsmorphologie der Trasjanka (einer Form der weißrussisch-russischen gemischten Rede) am Beispiel des Genitivs Singular der unbelebten Maskulina. In: Bock, B. (Hrsg.): Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. Ham-burg, 245–260
BRÜGGEMANN, M. 2010: Koloniales sprachliches Erbe. Sprache und Nation in Lukašenkas Belarus. In: Osteuropa 60, 69–80
BRÜGGEMANN, M. 2014: Die weißrussische und die russische Sprache in ihrem Verhältnis zur weißrussischen Gesellschaft und Nation: Ideolo-gisch-programmatische Standpunkte politischer Akteure und Intellektu-eller 1994–2010. Oldenburg [= Studia Slavica Oldenburgensia 23]
BSĖ 2001 [1969–1978] = Bolʼšaja sovetskaja ėnciklopedija. V 30 t. Moskva [http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/; letzter Zugriff am 15.05.2012]
BULACHOV, M.G. 1973: Interferencija belorusskogo jazyka v uslovijach belorussko-russkogo bilingvizma. In: Dimitrov, I. (red.): Lingvističeskie osnovy i metodičeskie problemy interferencii pri izučenii russkogo jazyka slavjanami. Sofia, 101–105
BULLOCK, B. E. 2009: Phonetic reflexes of code-switching. In: Bullock, B. E.; Toribio, A. J. (eds.): The Cambridge handbook of linguistic code-switching. Cambridge, 163–181
BULLOCK, B. E.; TORIBIO, A. J.; GONZÁLEZ, V.; DALOLA, A. 2006: Language dominance and performance outcomes in bilingual pronunciation. In: O’Brien, M. G.; Shea, Chr.; Archibald, J. (eds.): Proceedings of the 8th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference (GASLA 2006). Somerville, Mass., 9–16
393
BYBEE, J. 2002: Word frequency and context of use in the lexical diffusion of phonetically conditioned sound change. In: Language Variation and Change 14, 261–290
CAMPBELL, L. 1996: Phonetics and phonology. In: Goebl, H.; Nelde, P. H.; Starý, Z. (eds.): Kontaktlinguistik – Contact linguistics – Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Bd. 1. Berlin [etc.], 98–103 [= Handbücher zur Sprach- und Kommuni-kationswissenschaft 12:1]
ČĖKMAN, V.M. 1970: Historyja procipastaŭlennjaŭ pa cvërdasci-mjakkasci ŭ belaruskaj move. Minsk
ČEKMONAS, V.N. 1987: Territorija zaroždenija i ėtapy razvitija vostočnoslavjanskogo akan’ja v svete dannych lingvogeografii. In: Rus-sian Linguistics 11, 335–349
ČEKMONAS, V.N. 1997: Mjagkie “šepeljavye” soglasnye [s´´] i [z´´] v govorach Pskovskoj oblasti: (lingvogeografija i osnovnye artikulja-cionno-akustičeskie osobennosti). In: Russian Linguistics 21, 247–270
CHAMBERS, J. K. 1998 [1992]: Dialect acquisition. In: Trudgill, P.; Cheshire, J. (eds.): The sociolinguistic reader. Vol. 1. Multilingualism and varia-tion. London, 145–178
CHAMBERS, J. K.; TRUDGILL, P. 1998: Dialectology. 2nd edn. Cambridge
CHESHIRE, J.; KERSWILL, P.; WILLIAMS, A. 2005: Phonology, grammar and discourse in dialect convergence. In: Auer, P.; Hinskens, F.; Kerswill, P. (eds.): Dialect change. Convergence and divergence in European lan-guages. Cambridge, 135–167
COOPER, F. S.; DELATTRE, P. C.; LIBERMAN, A. M.; BORST, J. M.; GERSTMAN, L. J. 1952: Some experiments on the perception of synthetic speech sounds. In: Journal of the Acoustic Society of America 24, 597–606
CROFT, W. 2000: Explaining language change. An evolutionary approach. Harlow [etc.]
CROSSWHITE, K. M. 2000: Vowel reduction in Russian: A unified account of standard, dialectal, and “dissimilative” patterns. In: University of Rochester Working Papers in the Language Sciences (Vol. Spring 2000), 107–172 [http://www.bcs.rochester.edu/cls/s2000n1/cross-white.pdf; letzter Zugriff: 18.09.2013]
394
CROSSWHITE, K. M. 2004: Vowel reduction. In: Hayes, B.; Kirchner, R.; Steriade, D. (eds.): Phonetically based phonology. Cambridge [etc.], 191–231
CYCHUN, H. 2000: Krėalizavany pradukt. Trasjanka jak ab’ekt linhvistyčnaha dasledavannja. In: Archė 6 [http://arche.bymedia.net/6-2000/cychu600.html; letzter Zugriff: 01.11.2012]
CYCHUN, H. 2013 [1998]: Trasjanka jak ab’ekt linhvistyčnaha dasledavannja. In: Cychun, H. 2013: Studien zur „Trasjanka“ – Študyi pra „Trasjanku“. Herausgegeben von Gerd Hentschel. Oldenburg, 19–30 [= Studia Slavica Oldenburgensia 22]
CZEKMAN, W.; SMUŁKOWA, E. 1988: Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej. Warszawa
DABM 1963a = AVANESAŬ, R.I.; KAPRIVA, K.K; MACKEVIČ, Ju.F. (rėd.) 1963a: Dyjalektalahičny atlas belaruskaj movy. Minsk
DABM 1963b = AVANESAŬ, R.I.; KAPRIVA, K.K; MACKEVIČ, Ju.F. (rėd.) 1963b: Dyjalektalahičny atlas belaruskaj movy. Ustupnyja artykuly, davedačnyja materyjaly i kamentaryj da kart. Minsk
DARJA 1986 = AVANESOV, R.I. (red.) 1986: Dialektologičeskij atlas russkogo jazyka. Atlas v 3–ch vypuskach. Vyp. 1. Fonetika. Moskva
DART, S. N. 1998: Comparing French and English coronal consonant articulation. In: Journal of Phonetics 26, 71–94
DINGLEY, J. 1989: Ukrainian and Belorussian – A testing ground. In: Kirkwood, M. (ed.): Language planning in the Soviet Union. Basingstoke [etc.], 163–184
DOCHERTY, G. J.; P. FOULKES 1999: Derby and Newcastle: instrumental phonetics and variationist studies. In: Foulkes, P.; Docherty, G. J. (eds.): Urban voices. Accent studies in the British Isles. London, 47–71
DONEGAN MILLER, P. 1972: Vowel neutralization and vowel reduction. In: Peraneau, P. M.; Levi, J. N.; Phares, G. C. (eds.): Papers from the Eighth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago, 482–489
DONEGAN, P. J. 1978: On the natural phonology of vowels. Ph.D. diss., Ohio State University. [http://www.ling.hawaii.edu/faculty/donegan/Pa-pers.html; letzter Zugriff: 05.12.2012]
395
DRESSLER, W. U. 1984: Explaining natural phonology. In: Phonology Yearbook 1984/1, 29–51
DUBOIS, S.; HORVATH, B. 1999: When the music changes you change too: Gender and language change in Cajun English. In: Language Variation and Change 11, 287–313
DYER, J. 2002: ‘We all speak the same round here’: Dialect levelling in a Scottish-English community. In: Journal of Sociolinguistics 6, 99–116
DZERHAČOVA, T.L. 2001: Mova sučasnaha belaruskaha radyë ŭ aspekce fonastylistyki. In: Michalʼčuk, T.G. (red.): Rusistika i belorusistika na rubeže vekov. Vklad belorusskich lingvistov, urožencev Mogilevščiny, v nauku: Tezisy dokladov meždunarodnych naučnych čtenij meždunarodnoj naučnoj konferencii “Problemy istorii i kulʼtury Verchnego Podneprovʼja”, 25–26 oktjabrja 2001 g. Mogilev, 115–117
ECKERT, P. 1991: Social polarization and the choice of linguistic variants. In: Eckert, P. (ed.): New ways of analyzing sound change. New York, 213–232
ECKERT, P. 2010: Affect, sound symbolism, and variation. In: University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 15:2, Article 9 [http://repository.upenn.edu/pwpl/vol15/iss2/9, letzter Zugriff: 07.10.2013]
ECKERT, P. 2012: Three waves of variation study. The emergence of meaning in the study of variation. In: Annual Review of Anthropology 41, 87–100
ECKERT, R.; CROME, E.; FLECKENSTEIN, CHR. 1983: Geschichte der russischen Sprache. Leipzig
EROFEEVA, E.B. 1997: Ėksperimentalʼnoe issledovanie fonetiki regionalʼnogo varianta literaturnogo jazyka. Perm
EVANS, D. 1982: On coexistence and convergence of two phonological systems in Michif. In: Workpapers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota 26, 158–173
FANT, G. 1970: Acoustic theory of speech production. With calculations based on X-ray studies of Russian articulations. 2nd ed. The Hague [etc.]
396
FBLM 1989 = PADLUŽNY, A.I. (rėd.) 1989: Fanetyka belaruskaj litaraturnaj movy. Minsk
FIDELHOLZ, J. 1975: Word frequency and vowel reduction in English. In: Grossman, R. E. (ed.): Papers from the 11th Regional Meeting Chicago Linguistic Society: April 18–20, 1975. Chicago, 200–213
FORREST, K.; WEISMER, G.; MILENKOVIC, P.; DOUGALL, R. N. 1988: Statistical analysis of word-initial voiceless obstruents: Preliminary data. In: Journal of the Acoustical Society of America 84, 115–123
FOULKES, P.; DOCHERTY, G. J. 1999: Urban voices – overview. In: Foulkes, P.; Docherty, G. J. (eds.) 1999: Urban voices. Accent studies in the British Isles. London, 1–24
FOURAKIS, M. 1991: Tempo, stress, and vowel reduction in American English. In: Journal of the Acoustical Society of America 90, 1816–1827
FSR 1988 = SVETOZAROVA, N.D. (red.) 1988: Fonetika spontannoj reči. Leningrad
GEERARTS, D. 2010: Schmidt redux: How systematic is the linguistic system if variation is rampant. In: Boye, K.; Engberd-Pedersen. E. (eds.): Language usage and language structure. Berlin [etc.], 237–262
GIGER, M. 2008: Bezudarnyj vokalizm russkogo i belorusskogo literaturnych jazykov s točki zrenija fonologii. In: Ondrejovič, S. (vyd.): IUGI Observatione… jubilejný zborník na počest’ Ľubomíra Ďuroviča. Bratislava, 37–51
GIJN, R. van 2009: The phonology of mixed languages. In: Journal of Pidgin and Creole Studies 24, 91–117
GILES, H.; SMITH, P. 1979: Accommodation theory: optimal levels of convergence. In: Giles, H.; Clair, R. St. (eds.): Languages and social psychology. Oxford, 45–65
GILES, H.; TAYLOR, D.; BOURHIS, R. 1973: Towards a theory of interpersonal accomodation through speech: some Canadian data. In: Language in Society 2, 177–192
GORDON, M. 2007: Phonological variation. In: Llamas, C.; Mullany, L.; Stockwell, P. (eds.): The Routledge companion to sociolinguistics. London [etc.], 19–27
397
GORDON, M.; BARTHMAIER, P.; SANDS, K. 2002: A cross-linguistic acoustic study of voiceless fricatives. In: Journal of the International Phonetic Association 32, 142–174
GREEN, D. 1998: Mental control of the bilingual lexico-semantic system. In: Bilingualism: Language and Cognition 1, 67–81
GROSJEAN, F. 2001: The bilingual’s language modes. In: Nicol, J. L. (ed.): One mind, two languages. Bilingual language processing. Oxford, 1–22
GUTSCHMIDT, K. 2000: Sprachenpolitik und sprachliche Situation in Weißrussland seit 1989. In: Panzer, B. (Hrsg.): Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende: Beiträge zum Internationalen Symposion des Slavischen Instituts der Universität Heidelberg vom 29. September bis 2. Oktober 1999. Frankfurt a.M. [etc.], 67–84
GUY, G. R. 2008: Variationist approaches to phonological change. In: Joseph, B. D.; Janda, R. D. (eds.): The handbook of historical linguistics. Malden [etc.], 369–400
GUY, G. R. 2009 [1993]: The quantitative analysis of linguistic variation. In: Coupland, N.; Jaworski, A. (eds.): Sociolinguistics. Critical concepts in linguistics. Vol. 1. The sociolinguistics of language variation and change. London [etc.], 65–84
HALLE, M. 1971: The sound pattern of Russian. A linguistic and acoustical investigation. With an excursus on the contextual variants of the Russian vowels by Lawrence G. Jones. 2. print. The Hague
HAMANN, S. 2002: Postalveolar fricatives in Slavic languages as retroflexes. In: Baauw, S.; Huiskes, M.; Schoorlemmer, M. (eds.): OTS yearbook 2002. Utrecht, 105–127
HAMANN, S. 2004: Retroflex fricatives in Slavic Languages. In: Journal of the International Phonetic Association 34, 53–67
HAMANN, S.; AVELINO, H. 2007: An acoustic study of plain and palatalized sibilants in Ocotepec Mixe. In: Trouvain, J.; Barry, W. J. (eds.): 16th International Congress of Phonetic Sciences. ICPhS, Saarbrücken, 6–10 August 2007. Book of abstracts. o.O., 949–952 [www.icphs2007; letzter Zugriff: 27.7.2013]
HARRINGTON, J. 2007: Evidence for a relationship between synchronic variability and diachronic change in the Queen’s annual Christmas
398
broadcasts. In: Cole, J.; Hualde, J. (eds.): Laboratory phonology 9. Berlin, 125–143
HARRINGTON, J. 2010: Phonetic analysis of speech corpora. Malden, Mass. [etc.]
HEFFERNAN, K. 2004: Evidence from HNR that /s/ is a social marker of gender. In: Toronto Working Papers in Linguistics 23:2, 71–84
HENTSCHEL, G. 2003: Die slavische Sprachenlandschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts. In: Gugenberger, E., Blumberg, M. (Hrsg.): Vielsprachiges Europa. Zur Situation der regionalen Sprachen von der Iberischen Halbinsel bis zum Kaukasus. Frankfurt a.M., 157–175
HENTSCHEL, G. 2008a: Einige Beobachtungen zur Flexionsmorphologie in der weißrussischen Trasjanka. Zur Variation zwischen weißrussischen und russischen Endungen und Formen beim Verb. In: Nagórko, A.; Heyl, S.; Graf, S. (Hrsg.): Sprache und Gesellschaft. Frankfurt a.M., 455–466
HENTSCHEL, G. 2008b: On the development of inflectional paradigms in Belarusian trasjanka: the example of demonstrative pronouns. In: Hentschel, G.; Zaprudski, S. (eds.): Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk: Structural and social aspects of their description and categorization. Oldenburg, 99–133 [= Studia Slavica Oldenburgensia 17]
HENTSCHEL, G. 2008c: Zur weißrussisch-russischen Hybridität in der weißrussischen „Trasjanka“. In: Kosta, P.; Weiss, D. (Hrsg.): Slavistische Linguistik 2006/2007. München, 169–219
HENTSCHEL, G. 2011 [= HENČALʼ, H. 2011]: Tėarėtyčnae asėnsavanne sistėmnasci mjašanaha belaruska-ruskaha maŭlennja. In: Važnik, S.A.; Kožynava, A.A. (rėd.): Aktual’nyja prablemy palanistyki 2010. Minsk, 43–64
HENTSCHEL, G. 2012 [= CHENČELʼ, G. 2012]: Nekotorye različija i schodstva v smešannoj belorussko-russkoj reči v raznych belorusskich gorodach i u raznych govorjaščich. In: Zaprudski, S.; Cychun, H. (rėd.): Novae slova ŭ belarusistycy. Movaznaŭstva. Minsk, 220–232
HENTSCHEL, G. 2013a [= CHENTŠELʼ, G.]: Belorusskij, russkij i belorussko-russkaja smešannaja reč’. In: Voprosy jazykoznanija (2013), 53–76
399
HENTSCHEL, G. 2013b: Zwischen Variabilität und Regularität, „Chaos“ und Usus: Zu Lautung und Lexik der weißrussisch-russischen gemischten Rede. In: Hentschel, G. (Hrsg.): Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten: Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, der Ukraine und Schlesien. Oldenburg, 27–63 [= Studia Slavica Oldenburgensia 21]
HENTSCHEL, G. 2014a: Belarusian and Russian in the mixed speech of Belarus. In: Besters-Dilger, J.; Dermarkar, C.; Pfänder, St.; Rabus, A. (eds.): Congruence in contact-induced language change. Language families, typological resemblance, and perceived similarity. Berlin, 93–121
HENTSCHEL, G. 2014b: On the systemicity of Belarusian-Russian mixed speech. The redistribution of Belarusian and Russian variants of functional words. In: Hentschel, G.; Taranenko, O.; Zaprudski, S. (Hrsg.): Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? Frankfurt a.M., 195–220
HENTSCHEL, G. 2014c: „Trasjanka“ und „Suržyk“ – zum Mischen von Sprachen in Weißrussland und der Ukraine. In: Hentschel, G.; Taranenko, O.; Zaprudski, S. (Hrsg.): Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? Frankfurt a.M., 1–26
HENTSCHEL, G.; BRANDES, O. 2009: Zur Morphologie der anaphorischen Pronomen in der gemischten weißrussisch-russischen Rede. In: Berger, T.; Giger, M.; Kurth, S.; Mendoza, I. (Hrsg.): Von grammatischen Kategorien zu sprachlichen Weltbildern. Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. München, 199–214
HENTSCHEL, G.; BRÜGGEMANN, M.; GEIGER, H.; ZELLER, J. P. (i.Dr.): The linguistic and political orientation of young Belarusian adults between East and West or Russian and Belarusian. Erscheint in: International Journal of the Sociology of Language.
HENTSCHEL, G.; KITTEL, B. 2011: Weißrussische Dreisprachigkeit? Zur sprachlichen Situation in Weißrussland auf der Basis von Urteilen von Weißrussen über die Verbreitung „ihrer Sprachen“ im Lande. In: Wiener Slawistischer Almanach 67, 107–135
400
HENTSCHEL, G.; TESCH, S. 2006a: „Trasjanka“: Eine Fallstudie zur Sprachmischung in Weißrussland. In: Stern, D.; Voss, Chr. (eds.): Marginal linguistic identities. Studies in Slavic contact and borderland varieties. Wiesbaden, 213–243
HENTSCHEL, G.; TESCH, S. 2006b: O lingvističeskom statuse trasjanki. In: Kunnap, A.; Lehfeldt, B.; Kuznecov, S. (red.): Mikrojazyki. Jazyki. Interjazyki. Tartu, 258–270
HENTSCHEL, G.; TESCH, S. 2007 [= GENČELʼ, G.; TĖŠ, S. 2007]: Trasjanka: v kakoj stepeni ona „russkaja“, „belorusskaja“ ili „obščaja“? (na materiale rečevoj praktiki odnoj sem’i). In: Mova – litaratura – kul’tura. Matėryjaly V Mižnarodnaj Navukovaj Kanferėncyi (da 80-hoddzja prafesara L’va Michajlaviča Šakuna). H. Minsk, 16–17 listapada 2006 hoda. Minsk, 18–26
HENTSCHEL, G.; ZELLER, J. P. 2014: Belarusians’ pronunciation: Belarusian or Russian? Evidence from Belarusian-Russian mixed speech. In: Russian Linguistics 38, 229–255
HENTSCHEL, G.; ZELLER, J. P. 2011 [= CHENŠEL’, G.; CELLER, Ja. P. 2011]: Jakanʼe, ekanʼe, ikanʼe v belorussko-russkoj smešannoj reči: nabljudenija na osnove ėksperimental’no-akustičeskogo analiza. In: Ševčenko, G.I. (red.): Aktualʼnye problemy filologii: antičnaja kulʼtura i slavjanskij mir. Sbornik naučnych statej. Minsk, 228–234
HENTSCHEL, G.; ZELLER, J. P. 2013: Gemischte Rede, gemischter Diskurs, Sprechertypen: Weißrussisch, Russisch und gemischte Rede in der Kommunukation weißrussischer Familien. In: Wiener Slawistischer Almanach 70 (2012), 127–155
HUGHES, G. W.; HALLE, M. 1956: Spectral properties of fricative consonants. In: The Journal of the Acoustical Society of America 28, 303–310
IPA 2005 = INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (ed.) 2005: Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge [etc.]
ISAČENKO, A.V. 1980: Geschichte der russischen Sprache. Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Heidelberg
IVPN 1963 = CENTRALʼNOE STATISTIČESKIE UPRAVLENIE PRI SOVETE
MINISTROV SSSR (red.) 1963: Itogi vsesojuznoj perepisi naselenija 1959 goda. Belorusskaja SSR. Moskva
401
IZS 1987 = BONDARKO, L.V.; VERBICKAJA, L.A. (red.) 1987: Interferencija zvukovych sistem. Leningrad
JACHNOW, H. 1982: Sprachpolitische Tendenzen in der Geschichte der Sowjetunion. In: International Journal of the Sociology of Language 33, 91–100
JANKOŬSKI, F.M. 1974: Histaryčnaja hramatyka Belaruskaj movy. Č. 1. Uvodziny, fanetyka. Minsk
JANKOŬSKI, F.M. 1976: Belaruskae litaraturnae vymaŭlenne. Vydanne čacvërtae. Minsk.
JASSEM, W. 1968: Acoustic description of voiceless fricatives in terms of spectral parameters. In: Jassem, W. (ed.): Speech analysis and synthesis. Warsaw, 189–206
JESUS, L. M. T.; SHADLE, C. H. 2002: A parametric study of the spectral characteristics of European Portuguese fricatives. In: Journal of Phonetics 30, 437–464
JOHNSON, K. 2003: Acoustic and auditory phonetics. Malden, Mass [etc.]
JOHNSON, K. 2008: Quantitative methods in linguistics. Malden, Mass. [etc.]
JONES, D.; WARD, D. 1969: The phonetics of Russian. Cambridge
JONES, L. G. 1971: Contextual variants of the Russian vowels. In: Halle, M.: The sound pattern of Russian. A linguistic and acoustical investigation. With an excursus on the contextual variants of the Russian vowels. 2. print. The Hague, 157–167
KARSKIJ, E.F. 2006 [1908]: Belorusy. T. 2. Jazyk belorusskogo naroda. Kn. 1. Minsk [Nachdr. der Ausg. Varšava 1908]
KASATKIN, L.L. 2001: Fonologičeskoe soderžanie dolgich mjagkich šipjaščich [šʼ:], [žʼ:] v russkom literaturnom jazyke. In: Russkij jazyk v naučnom osveščenii 1, 80–89
KASATKIN, L.L. 2003: Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva
KASATKIN, L.L. 2006: Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. Moskva
KASATKIN, L.L. 2009a: Fonetika. In: Lekant, P.A. (red.): Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Novoe izdanie. Učebnik. Moskva. 41–117
402
KASATKIN, L.L. 2009b: Orfoėpija. In: Lekant, P.A. (red.): Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Novoe izdanie. Učebnik. Moskva. 118–133
KASATKINA, R.F. 1995: O južnorusskom dissimiljativnom akan’e. In: Ljapon, M.V. (red.): Filologičeskij sbornik (k 100-letiju so dnja roždenija akademika V. V. Vinogradova). Moskva, 220–228
KASATKINA, R.F.; SAVINOV, D.M. 2007: Ešče raz k istorii razvitija assimiljativno-dissimiljativnogo vokalizma v južnorusskich govorach. In: Problemy fonetiki 5, 395–407
KENT, R. D.; READ, Ch. 1992: The acoustic analysis of speech. London [etc.]
KERSWILL, P. 2007: Koineization and accommodation. In: Chambers, J. K.; Trudgill, P.; Schilling-Estes, N. (eds.): The handbook of language variation and change. Malden, Mass. [etc.], 669–702
KERSWILL, P.; WILLIAMS, A. 2000: Creating a new town koine: children and language change in Milton Keynes. In: Language in Society 29, 65–115
KERSWILL, P.; WILLIAMS, A. 2002: ‘Salience’ as an explanatory factor in language change: evidence from dialect levelling in urban England. In: Jones, M. C.; Esch, E. (eds.): Language change. The interplay of internal, external and extra-linguistic factors. Berlin, 81–110
KHBM 2007 = LUKAŠANEC, A.A. (rėd.) 2007: Karotkaja hramatyka belaruskaj movy. Č. 1. Fanalohija – marfanalohija – marfalohija. Minsk
KILEVAJA, L. T. 1986: Lokal’naja okraščennost’ russkoj razgovornoj reči v uslovijach dvujazyčija. In: Russkij jazyk 5, 29–36
KILEVAJA, L.T.. 1989: Russkaja razgovornaja reč’ v uslovijach russko-belorusskogo dvujazyčija (na materiale russkoj razgovornoj reči g. Mogileva). Avtoref. diss. kand. filol. nauk. Minsk
KITTEL, B.; LINDNER, D.; TESCH, S.; HENTSCHEL, G. 2010: Mixed language usage in Belarus. The sociostructural background of language choice. In: International Journal of the Sociology of Language 206, 47–71
KLATT, D. H. 1982: Speech processing strategies based on auditory models. In: Carlson, R.; Granstrom, B. (eds.): The representation of speech in the peripheral auditory system. New York, 181–196
KLIMAŬ, I. 2014: Trasjanka und Halbdialekt: Zur Abgrenzung von Phänomenen der parole und der langue. In: Hentschel, G.; Taranenko,
403
O.; Zaprudski, S. (Hrsg.): Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? Frankfurt a.M., 173–192
KNIAZEV, S.; SHAULSKIY, E. 2007: The development of akanje in Russian. New data. In: Trouvain, J.; Barry, W. J. (eds.): 16th International Congress of Phonetic Sciences. ICPhS, Saarbrücken, 6–10 August 2007. Book of abstracts. o.O., 1425–1428 [www.icphs2007; letzter Zugriff: 27.7.2013]
KOCHETOV, A. 2006: The role of social factors in the dynamics of sound change. A case study of a Russian dialect. In: Language Variation and Change 18, 99–119
KOCHETOV, A. 2009: Phonetic variation and gestural specification of Russian consonants. In: Kügler, F.; Féry, C.; van de Vijver, R. (eds.): Variation and gradience in phonetics and phonology. Berlin [etc.], 43–70
KOUZNETSOV, V. 2001: Spectral dynamics and classification of Russian vowels. In: Russian Acoustical Society (ed.): XI Session of the Russian Acoustical Society. Moscow, November 19–23, 2001. o.O., 439–442 [http://ras.akin.ru/; letzter Zugriff: 20.05.2013]
KRAUČANKA, N. (i.Vorb.): Gemischte weißrussisch-russische und russisch-weißrussische Rede bei Kindern und Jugendlichen.
KRAUSE, M. 2010: Zur Typologie von Sprachsituationen: Binnensprachliche Variation zwischen Standard und Dialekt im heutigen Russland. In: Wiener Slawistischer Almanach 65, 53–81
KRIVICKIIJ, A.A.; MICHNEVIČ, A.E.; PODLUŽNYJ, A.I. 1990: Belorusskij jazyk dlja govorjaščich po-russki. 3–e izdanie, pererabotannoe. Minsk.
KRYVICKI A.A.; PADLUŽNY A.I. 1984: Fanetyka belaruskaj movy. Minsk
KRYVICKI, A.A. 2003: Dyjalektalohija belaruskaj movy. Minsk
KUČERA, H. 1973: Language variability, rule interdependency, and the grammar of Czech. In: Linguistic Inquiry 4, 499–521
KURASZKIEWICZ, W. 1963: Zaryz dialektologii wschodniosłowiańskiej. Z wyborem tekstów gwarowych. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. Warszawa
KURCOVA, V.M. 1989: Da prablemy sacyjalʼna-maŭlenčaj hrupoŭki selʼskaha naselʼnictva. In: Belaruskaja Linhvistyka 35, 56–62
404
KURCOVA, V.M. 1990: Stan i prablemy belaruskaj selʼskaj havorki (sacyjalinhvistyčny aspekt). In: Belaruskaja Linhvistyka 38, 50–58
KURCOVA, V.M. 2001: Ruskamoŭnae maŭlenne belarusaŭ: da pytannja jaho kvalifikacyjnych acėnak. In: Belaruskaja Linhvistyka 51, 17–22
KURCOVA, V.M. 2002: Ruskamoŭnae maŭlenne belarusaŭ (pracjah). In: Belaruskaja Linhvistyka 52, 35–40
KURCOVA, V.M. 2005: Stan dyjalektnaha maŭlennja ŭ druhoj palove XX st. i jaho mesca ŭ sistėme sel’skich sacyjal’na-kamunikatyŭnych znosin. In: Kuncėvič, L.P. (ed.): Skarby narodnaj movy. Dyjalektalahičny zbornik. Minsk, 226–250
KURCOVA, V.M. 2010: Belaruskae dyjalektnae maŭlenne: novyja leksičnyja srodki, ich linhvistyčny status i hramadskaja acėnka. In: Anisim, A. (rėd.): Matėryjaly kanferėncyi „Sučasny stan belaruskaj movy i dzejnasc’ hramadskich ab’jadnannjaŭ pa jaho paljapšėnni“. Minsk, 18–31
KUZNECOV, V.I. 1991: Glasnye v svjaznoj reči. (Klassifikacija i akustičeskie charakteristiki). Avtoref. diss. kand. filol. nauk. Leningrad.
KUZNECOV, V.I. 1997: Vokalizm svjaznoj reči. Ėksperimental’noe issledovanie na materiale russkogo jazyka. St. Peterburg
LABOV, W. 1963: The social motivations of a sound change. In: Word 19, 273–309
LABOV, W. 1972: Sociolinguistic patterns. Oxford
LABOV, W. 1991: The three dialects of English. In: Eckert, P. (ed.): New ways of analyzing sound change. New York, 1–44
LABOV, W. 1994: Principles of linguistic change. Vol 1. Internal Factors. Oxford
LABOV, W. 2001: Principles of linguistic change. Vol 2. Social Factors. Oxford
LABOV, W.; YAEGER, M.; STEINER, R. 1972: A quantitative study of sound change in progress. Report on NSF Project no. GS-3287. Philadelphia
LADEFOGED, P. 2003: Phonetic data analysis. An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Malden, Mass. [etc.]
405
LADEFOGED, P.; MADDIESON, I. 1996: The sounds of the world's languages. Oxford
LASS, R. 1984: Phonology. An introduction to basic concepts. Cambridge [etc.]
LE PAGE, R. B.; TABOURET-KELLER, A. 1985: Acts of identity. Creole-based approaches to language and ethnicity. Cambridge
LEOPOLD, E. 2008: Das Piotrowski-Gesetz. In: Köhler, R.; Altmann, G.; Piotrowski, R. G. (Hrsg.): Quantitative Linguistik – Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch – An international handbook. Berlin [etc.], 627–633 [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 27]
LINDBLOM, B. 1963: Spectographic study of vowel reduction. In: Journal of the Acoustical Society of America 35, 1773–1781
LISKOVEC, I.V. [= LISKOVETS, I.] 2009: Trasjanka: A code of rural migrants in Minsk. In: International Journal of Bilingualism 13, 396–412
LISKOVEC, I.V. 2001: Pereključenie i smešenie kodov v reči žitelej g. Minska. In: Vestnik molodych učenych 4, 26–33
LISKOVEC, I.V. 2002: Trasjanka: proischoždenie, suščnost’, funkcionirovanie. In: Antropologija, fol’kloristika, lingvistika 2, 329–343
LISKOVEC, I.V. 2005: Russkij i belorusskij jazyki v Minske: problemy bilingvizma i otnošenija k jazyku. Diss., Evropejskij Universitet v Sankt-Peterburge.
LOBANOV, B.M. 1971: Classification of Russian vowels spoken by different speakers. In: Journal of the Acoustical Society of America 49, 606–608
LOMTEV, T.P. 1956: Grammatika belorusskogo jazyka. Posobie dlja universitetov i pedagogičeskich institutov. Moskva
LOSIK, H.V. 1983: Varyjatyŭnascʼ akustyčnaha sihnalu slova. In: Padlužny, A.I. (rėd.): Fanetyka slova ŭ belaruskaj move. Minsk, 177–199
MACWHINNEY, B. 2013: The CHILDES Project. Tools for analyzing talk – electronic edition. Part 1. The CHAT transcription format. Pittsburgh [http://childes.psy.cmu.edu/manu-als/chat.pdf; letzter Zugriff: 07.01.2014]
406
MADDIESON, I. 1997: Phonetic universals. In: Hardcastle, W. J.; Laver, J. (eds.): The handbook of phonetic sciences. Oxford [etc.], 619–639
MADDIESON, I. 2005: Presence of uncommon consonants. In: Haspelmath, M.; Dryer, M. S.; Gil, D.; Comrie, B. (eds.): The world atlas of language structures. Oxford, 82–84
MANIWA, K.; JONGMAN, A.; WADE, T. 2009: Acoustic characteristics of clearly spoken English fricatives. In: Journal of the Acoustical Society of America 125, 3962–3973
MARTINET, A. 1949: La double articulation linguistique. In: Travaux du cercle linguistique de Copenhague 5, 30–37
MATRAS Y. 2009: Language contact. Cambridge
MATRAS, Y.; BAKKER, P. 2003: The study of mixed languages. In: Matras, Y.; Bakker, P. (eds.): The mixed language debate. Theoretical and empirical advances. Berlin [etc.], 1–20
MCCARTHY, J.; PRINCE, A. 1993: Generalized alignment. In: Booij, G.; van
Marie, J. (eds.): Yearbook of morphology. Dordrecht, 79–153
MEČKOVSKAJA, N.B. 1994: Jazykovaja situacija v Belarusi. Ėtičeskie kollizii dvujazyčija. In: Russian Linguistics 18, 299–322
MEČKOVSKAJA, N.B. 2002: Jazyk v roli ideologii: nacional’no-simvoličeskie funkcii jazyka v belorusskoj jazykovoj situacii. In: Gutschmidt, K. (Hrsg.): Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Dresden, 124–141
MEČKOVSKAJA, N.B. 2006: Belorusskaja trasjanka i ukrainskij suržik: surrogaty etničeskogo substandarta v ich otnošenijach k massovoj kul’ture i literaturnym jazykam. In: Problemy zistavnoj semantyky 7, 109–115
MEČKOVSKAJA, N.B. 2007 [= MJAČKOŬSKAJA, N.B. 2007]: Trasjanka ŭ kantynuume belaruska-ruskich idyjalektaŭ. Chto i kali razmaŭljaje na trasjancy? In: Vesnik BDU. Ser. 4 (2007), 91–97
MEL’NIKOVA, L.A. 1999: Fonetičeskaja interferencija. In: Bulyko, A.N.; Krysin, L.P (red.): Tipologija dvujazyčija i mnogojazyčija v Belorusi. Minsk, 52–60
MENZEL, Th. 2013: Zur Flexion der Pronomen in der weißrussisch-russischen und ukrainisch-russischen gemischten Rede. In: Kempgen, S., Franz,
407
N., Jakiša M.; Wingender, M. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013. München [etc.], 221–232
MENZEL, Th.; HENTSCHEL, G. (i.Dr.): Zu Pronominalparadigmen in Kontaktvarietäten: Demonstrativpronomen in der gemischten weißrussisch-russischen Rede in Weißrussland.
MICHNEVIČ, A.E. 1985: Osnovnye aspekty problemy. In: Michnevič, A.E. (red.): Russkij jazyk v Belorussii. Minsk, 3–12
MIKULA, T.B. 1998: Vlijanie struktury slova na dlitelʼnostʼ glasnych v belorusskom jazyke. Minsk [= Preprinty MGLU 34]
MILROY, J., MILROY, L. 2007: Varieties and variation. In: Coulmas, F. (ed.): The handbook of sociolinguistics. Malden, Mass. [etc.], 47–64
MILROY, J.; MILROY, L. 1985: Linguistic change, social network and speaker innovation. In: Journal of Linguistics 21, 339–384
MILROY, L. 2002: Introduction. Mobility, contact and language change – Working with contemporary speech communities. In: Journal of Sociolinguistics 6, 3–15
MILROY, L.; GORDON, M. 2003: Sociolinguistics. Method and interpretation. Malden, Mass. [etc.]
MOSELEY, Chr. (ed.). 2010: Atlas of the world’s languages in danger. 3rd edn. Paris [http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/at-las; letzter Zugriff am 13.05.2013]
MOSER, M. 2000: Koexistenz, Konvergenz und Kontamination ostslavischer Sprachen in Weißrussland und in der Ukraine. In: Zeitschrift für Slawistik 45, 185–199
MUYSKEN, P. 2000: Bilingual speech. A typology of code mixing. Cambridge [etc.]
MUYSKEN, P. 2006: Two linguistic systems in contact: Grammar, phonology and lexicon. In: Bhatia, T. K.; Ritchie, W. C. (eds.): The handbook of bilingualism. Malden, Mass. [etc.], 147–168
NATHAN, G. S.; DONEGAN, P. J (i.Dr.): Natural phonology and sound change. In: Honeybone, P.; Salmons, J. C. (eds.): The handbook of historical phonology. Oxford [http://www.ling.hawaii.edu/faculty/donegan/Pa-pers/201Xhistphon.pdf; letzter Zugriff: 08.08.2013]
408
NESSET, T. 2002: Dissimilation, assimilation and vowel reduction. Constraint interaction in East Slavic dialects with so-called dissimilative akan’e and jakan’e. In: Poljarnyj vestnik 5, 77–101
NPBD 1964 = AVANESAŬ, R.I. (rėd.) 1964: Narysy pa belaruskaj dyjalektalohii. Vučėbny dapamožnik dlja filalahičnych fakul’tėtaŭ, universitėtaŭ i pedinstitutaŭ. Minsk
OHALA, J. J. 2005: Phonetic explanations for sound patterns. Implications for grammars of competence. In: Hardcastle, W. J.; Beck, J. M. (eds.): A figure of speech. A festschrift for John Laver. London, 23–38
OSRJa 1988 = AVANESOV, R.I. (red.) 1988: Orfoepičeskij slovar’ russkogo jazyka. Proiznošenie, udarenie, grammatičeskie formy. Izd. 4–e, stereotipnoe. Moskva
PADGETT, J. 2001: Contrast dispersion and Russian palatalization. In: Hume, E.; Johnson, K. (eds.): The role of speech perception in phonology. San Diego, 187–218
PADGETT, J.; TABAIN, M. 2005: Adaptive dispersion theory and phonological vowel reduction in Russian. In: Phonetica 62, 14–54
PADGETT, J.; ŻYGIS, M. 2007: The evolution of sibilants in Polish and Russian. In: Cavar, M.; Hall, T.A. (eds.): Special volume on Slavic phonology, 291–324 [= Journal of Slavic Linguistics 15:2]
PADLUŽNY, A.I. 1969: Fanalahičnaja sistėma belaruskaj litaraturnaj movy. Minsk
PADLUŽNY, A.I. 1977: Narys akustyčnaj fanetyki belaruskaj movy. Minsk
PADLUŽNY, A.I. 1982: Bijalahičnyja i sacyjalʼnyja aspekty hukavoha ladu movy. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 132–142
PADLUŽNY, A.I. 1983: Slova ŭ fanetyčnym kantėksce. In: Padlužny, A.I. (rėd.): Fanetyka slova ŭ belaruskaj move. Minsk, 5–98
PADLUŽNY, A.I. 1990: Ustup. In: Padlužny, A.I. (rėd.): Vusnaja belaruskaja mova. Chrėstamatyja. Minsk, 3–17
PADLUŽNY, A.I.; ČĖKMAN, V.M. 1973: Huki belaruskaj movy. Minsk
PANOV, M.V. 1979: Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. Moskva
PARADIS, M. 2004: A neurolinguistic theory of bilingualism. Amsterdam
409
PAVLENKO, A. 2006: Russian as lingua franca. In: Annual Review of Applied Linguistics 26, 78–99
PENʼKOVSKIJ, A.B. 1967: O nekotorych zakonomernostjach usvoenija orfoėpičeskich norm (g smyčnoe i γ frikativnoe). In: Voprosy kulʼtury reči 8, 61–72
PETERSON, G. E.; BARNEY, H. L. 1952: Control methods used in a study of vowels. In: Journal of the Acoustical Society of America 24, 175–184
PHARAO, N. 2010: Consonant reduction in Copenhagen Danish. A study of linguistic and extra-linguistic factors in phonetic variation and change. Diss., University of Copenhagen. [http://dgcss.hum.ku.dk/aarsberet-ninger/2010/master_and_phd_theses/Dissertation_Nicolai_Pharao.pdf/; letzter Zugriff: 10.09.2013]
PICKETT, J. M. 1980: The sounds of speech communication. A primer of acoustic phonetics and speech perception. Baltimore
PN 1999 = NACIONALʼNYJ STATISTIČESKIJ KOMITET RESPUBLIKI BELARUSʼ 1999: Perepisʼ naselenija 1999 g. (osnovnye itogi). [http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/main.php; letzter Zugriff: 05.09.2013]
PN 2009:2 = NACIONALʼNYJ STATISTIČESKIJ KOMITET RESPUBLIKI BELARUSʼ 2010: Perepisʼ naselenija 2009. T. II: Naselenije Respubliki Belarusʼ: Ego čislennostʼ i sostav – Population Census 2009. Vol. II: Population of the Republic of Belarus: Size and composition. Minsk [http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi1.php; letzter Zugriff: 05.09.2013]
PN 2009:3 = NACIONALʼNYJ STATISTIČESKIJ KOMITET RESPUBLIKI BELARUSʼ 2011: Perepisʼ naselenija 2009. T. III: Nacionalʼnyj sostav naselenija Respubliki Belarusʼ - Population Census 2009. Vol. III: Ethnic composition of the population of the Republic of Belarus. Minsk [http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi1.php; letzter Zugriff: 05.09.2013]
PRICHARD, H.; SHWAYDER, K. 2013: Against a split phonology of Michif. Paper presented at PLC 37, University of Pennsylvania 2013. [http://www.ling.upenn.edu/~hilaryp/files/PrichardShwayder-PLC37-Michif.pdf; letzter Zugriff: 11.10.2013]
PRINCE, A.; SMOLENSKY, P. 1993: Optimality theory. New Brunswick, NJ
410
PRYHODZIČ, M.R. 1998: Z historyi belaruskaj movy i jae vyvučėnnja. In: Lukašanec, A.; Prigodzič, M.; Sjameška, L. (rėd.): Belaruskaja mova. Opole, 13–24
PURCELL, E. T. 1979: Formant frequency patterns in Russian VCV utterances. In: Journal of the Acoustical Society of America 66, 1691–1702
RADZIK, R. 2000: Język jako wyznacznik tożsamości Białorusinów. In: Smułkowa, E.; Engelking, A. (red.): Język i tożsamość na pograniczu kultur. Białystok, 71–82
RADZIK, R. 2004: Identity of Belarusians and Ukrainians – similarities and differences. In: Annus Albaruthenicus 5, 49–67
RADZIK, R. 2006: Die Integration mit Russland im Bewusstsein der weißrussischen Bevölkerung. In: Annus Albaruthenicus 7, 93–112
RAMZA, T.R. 2011: Belaruskae hutarkovae maŭlenne. Sučasny stan. Minsk
RD 2005 = KASATKIN, L.L. (red.) 2005: Russkaja dialektologija. Moskva
RHODES, R. A. 1996: English reduced vowels and the nature of natural processes. In: Hurch, B.; Rhodes, R. A. (eds.): Natural phonology. The state of the art. [Contributions to a workshop held in connection with the 1990 annual meeting of the Societas Linguistica Europaea in Bern, Switzerland, Sept. 18–21, 1990]. Berlin [etc.], 239–259
RICKFORD, J. R. 2007: Implicational scales. In: Chambers, J.; Trudgill, P.; Schilling-Estes, N. (eds.): The handbook of language variation and change. Malden, Mass [etc.], 142–167
ROMAINE, S. 1994: Language in society. An introduction to sociolinguistics. Oxford
ROSEN, N. 2006: Language contact and Michif stress assignment. In: Sprachtypologie und Universalienforschung 59, 170–190
SABALENKA, Ė.R. 1982: Nacyjanalʼny sklad naselʼnictva Belarusi. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 6–17
SADOŬSKI, P.V. 1975: Nenacisknyja halosnyja ŭ ruskaj move belarusaŭ. In: Martynaŭ, V.U.; Padlužny, A.I. (rėd.): Halosnyja belaruskaj movy. (Akustyčny analiz). Minsk, 168–190
411
SADOŬSKI, P.V. 1982: Z’javy fanetyčnaj intėrferėncyi va ŭmovach belaruska-ruskaha bilinhvizmu. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 176–228
SADOŬSKI, P.V. 1983: Varyjatyŭnascʼ zyčnych u belaruskaj litaraturnaj move. In: Padlužny, A.I. (rėd.): Fanetyka slova ŭ belaruskaj move. Minsk, 99–140
SADOŬSKI, P.V.; ŠČUKIN, V.H. 1977: Fanetyčnaja varyjatyŭnascʼ maŭlennja va ŭmovach belaruska-ruskaha bilinhvizmu. In: Vesci Akadėmii Navuk Belaruskaj SSR. Seryja Hramadskich Navuk 6, 113–121
SADOVSKIJ, P.V. 1978: Osobennosti fonetičeskich processov belorussko-russkogo dvujazyčija. Avtoref. diss. kand. filolog. nauk. Minsk
SANKOFF, G. 2007: Linguistic outcomes of language contact. In: Chambers, J. K.; Trudgill, P.; Schilling-Estes, N. (eds.): The handbook of language variation and change. Malden, Mass. [etc.], 638–668
SAPPOK, Chr. 1999: Lautsprachliche Forschungsansätze in der Russistik: Methoden, Lautarchive, Datenbanken. In: Jachnow, H. (Hrsg.): Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen. Wiesbaden, 995–1019
SAPPOK, Chr. 2010: Russische regionale Varietäten und Dialekte – eine akustische Datenbank mit diskursiven Annotationen. In: Wiener Slawistischer Almanach 65, 163–190
SBM 1987 = BIRYLA, M.V. (rėd.) 1987: Sloŭnik belaruskaj movy. Arfahrafija, arfaėpija, akcentuacyja, slovazmjanenne. Minsk
ŠČERBA, L.V. 1983 [1912]: Russkie glasnye v kačestvennom i količestvennom otnošenii. Leningrad.
SCHILLING-ESTES, N. 2004: Constructing ethnicity in interaction. In: Journal of Sociolinguistics 8, 163–195
SCHROEDER, B. 2004: Sprachen, Einstellungen und nationale Selbstidentifikation. Zum Problem der Identitätsfindung in der Republik Belarus. Diss., Universität Bochum. [http://webdoc.sub.gwdg.de/e-book/dissts/Bochum/SchroederBritta2004.pdf; letzter Zugriff am 12.09.2013]
SELINKER, L. 1972: Interlanguage. In: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 10, 209–233
412
SIEGEL, J. 2001: Koine formation and creole genesis. In: Smith, N.; Veenstra, T. (eds.): Creolization and contact. Amsterdam [etc.], 175–197
SJAMEŠKA, L.I. 1998: Sacyjalinhvistyčnyja aspekty funkcyjanavannja belaruskaj litaraturnaj movy ŭ druhoj palove XX st. In: Lukašanec, A.; Prigodzič, M.; Sjameška, L. (rėd.): Belaruskaja mova. Opole, 25–54
SKALOZUB, L.G. 1963: Palatogrammy i rentgenogrammy soglasnych fonem russkogo literaturnogo jazyka. Kiev
ŠMELEV, Ju.A. 1986: Russkij jazyk v blizkorodstvennoj jazykovoj srede: Belorussija. Avtoref. diss. kand. filol. nauk. Minsk
SMITH, G.; LAW, V.; WILSON, A.; BOHR, A., ALLWORTH, E. 1998: Nation-building in the post-Soviet borderlands: The politics of national identities. Cambridge
SOBOLENKO, Ė.R. 1980: Sovremennye ėtnolingvističeskie processy. In: Bondarčik, V.K. (red.): Ėtničeskie processy i obraz žizni. Minsk, 193–217
STAMPE, D. 1979: A dissertation on natural phonology. Including The acquisition of phonetic representation. Reproduced. Bloomington
STOLZ, Th.; URDZE, A.; OTSUKA, H. 2011: The sounds of Europe: Velar and post-velar fricatives in areal perspective. In: Lingua Posnaniensis 53, 87–108
STUART-SMITH, J.; TIMMINS, C.; WRENCH, A. 2003: Sex and gender in /s/ in Glaswegian. In: Solé, M. J.; Recasens, D.; Romero, J. (eds.): Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences: 3–9 August 2003, Barcelona, Spain. Rundle Mall, 1851–1854
ŠUBA, P.P. 1982: Mižmoŭnaja belaruska-ruskaja amanimija i paranimija. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 106–131
SUPRUN, A.Ja.; KLIMENKA, H.P. 1982: Nekatoryja psichalinhvistyčnyja asablivasci belaruska-ruskaha dvuchmoŭja. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 76–105
SVEŽINSKIJ, V.M.; LAPICKAJA-ANTIPOVA, I.N.; DOVGJALO, G.A.; JANKOVA, T.S.; KUNCEVIČ, L.P.; VERENIČ, V.L.; VOJNIČ, I.V. 1985: Jazykovaja
413
situacija v selʼskoj mestnosti. In: Michnevič, A.E. (red.): Russkij jazyk v Belorussii. Minsk, 22–60
TERNES, E. 1998: Lauttypologie der Sprachen Europas. In: Boeder, W.; Schroeder, Chr.; Wagner, K. H.; Wildgen, W. (Hrsg.): Sprache in Raum und Zeit. In memoriam Johannes Bechert. Band 2. Beiträge zur empirischen Sprachwissenschaft. Tübingen, 139–152
TESCH, S. 2012 [= TEŠ, S. 2012]: Marfasintaksis zmešanaha belaruska-ruskaha maŭlennja: sklon i lik nazoŭnikaŭ u spalučėnnjach z ličėbnikami dva, try, čatyry. In: Zaprudski, S.; Cychun, H. (rėd.): Novae slova ŭ belarusistycy. Movaznaŭstva. Minsk, 246–255
TESCH, S. 2013: Morphosyntaktische Phänomene in der weißrussisch-russischen gemischten Rede. Präpositionale Konstruktionen. In: Kempgen, S.; Franz, N.; Jakiša, M.; Wingender, M. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013. München [etc.], 283–292
TESCH, S. 2014: Syntagmatische Aspekte der weißrussisch-russischen gemischten Rede: Kodemischen und Morphosyntax. Oldenburg [= Studia Slavica Oldenburgensia 25]
TESCH, S.; HENTSCHEL, G. 2009 [= TEŠ, S.; CHENČEL’, G. 2009]: Pereključenie kodov v trasjanke (nekotorye količestvennye nabljudenija). In: Rudenko, E.N. (red.): Slavjanskie jazyki: aspekty issledovanija. Minsk, 209–215
THOMAS, E. R. 2007: Instrumental phonetics. In: Chambers, J. K.; Trudgill, P.; Schilling-Estes, N. (eds.): The handbook of language variation and change. Malden, Mass. [etc.], 168–200
THOMASON, S. G. 2001: Language contact. An introduction. Edinburgh
THOMASON, S. G.; KAUFMAN, T. 1988: Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley [etc.]
TIMBERLAKE, A. 2004: A reference grammar of Russian. Cambridge [etc.]
TORGERSEN, E.; KERSWILL, P. 2004: Internal and external motivation in phonetic change: dialect levelling outcomes for an English vowel shift. In: Journal of Sociolinguistics 8, 23–53
TORIBIO, A. J.; BULLOCK, B. E.; BOTERO, Chr. G.; DAVIS, K. A. 2005: Perservative phonetic effects in bilingual code-switching. In: Gess, R.
414
S.; Rubin, E. J. (eds.): Theoretical and experimental approaches to Romance linguistics: selected papers form the 34th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Salt Lake City, March 2004. Amsterdam, 291–306
TÖRNQUIST-PLEWA, B. 2005: Language and Belarusian nation-building in the light of modern theories on nationalism. In: Annus Albaruthenicus 6, 109–118
TRUBETZKOY, N. S. 1977: Grundzüge der Phonologie. 6. Aufl. Göttingen
TRUDGILL, P. 1972: Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich. In: Language in Society 1, 179–195
TRUDGILL, P. 1986: Dialects in contact. Oxford
TRUDGILL, P. 1999: Norwich: endogenous and exogenous linguistic change. In: Foulkes, P.; Docherty, G. J. (eds.): Urban voices. Accent studies in the British Isles. London, 124–140
TRUDGILL, P. 2004: New-dialect formation. The inevitability of colonial Englishes. Edinburgh
UNGEHEUER, G. 1958: Die Eigenwerttheorie der Formanten und das System der Vokale. In: Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 11, 36–48
UNGEHEUER, G. 1962: Elemente einer akustischen Theorie der Vokalartikulation. Berlin
VAJTOVIČ, N.T. 1968: Nenaciskny vakalizm narodnych havorak Belarusi. Minsk
VAN COETSEM, F. 1988: Loan phonology and the two transfer types in lan-guage contact. Dordrecht
VBM 1990 = PADLUŽNY, A.I. (rėd.) 1990: Vusnaja belaruskaja mova. Chrėstamatyja. Minsk
VERBICKAJA, L.A. 1976: Russkaja orfoėpija. K probleme ėksperimentalʼno-fonetičeskogo issledovanija osobennostej sovremennoj proiznositelʼnoj normy. Leningrad
VEŠTORT, G.F. 1999: Smešannye formy reči. In: Bulyko, A.N.; Krysin, L.P. (red.): Tipologija dvujazyčija i mnogojazyčija v Belorusi. Minsk, 93–101
415
VOSS, Chr. 2008: Slavische Kreolsprachen: Mythos und Realität. In: Kempgen, S.; Gutschmidt, K; Jekutsch, U.; Udolph, L. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress Ohrid 2008. München, 357–369
VYGONNAJA, L.T. 1985: Fonetičeskie osobennosti russkoj reči v Belorussii. In: Michnevič, A.E. (red.): Russkij jazyk v Belorussii. Minsk, 121–159
VYHONNAJA, L.C. 1975: Usprymanne nenacisknych halosnych nosʼbitami belaruskaj movy. In: Martynaŭ, V.U.; Padlužny, A.I. (rėd.): Halosnyja belaruskaj movy. (Akustyčny analiz). Minsk, 54–101
VYHONNAJA, L.C. 1982: Prablemy indyvidualʼnaha ŭ sacyjafanetycy. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 143–175
VYHONNAJA, L.C. 1987: Arfaėpija i pravapis. In: Padlužny, A.I. (rėd.): Belaruskaja mova. Cjažkija pytanni fanetyki, arfaėpii, hramatyki. Minsk, 23–40
VYHONNAJA, L.C. 1991: Intanacyja, nacisk, arfaėpija. Minsk
VYHONNAJA, L.C. 1996: Psichalinhvistyčnyja aspekty belaruska-ruskaha bilinhvizmu. In: Belaruskaja linhvistyka 45, 10–14
VYHONNAJA, L.C. 1998: Belaruskae litaraturnae vymaŭlenne. In: Lukašanec, A.; Prigodzič, M.; Sjameška, L. (rėd.): Belaruskaja mova. Opole, 105–147
WARD, D. 1975: Unaccented vowels in Russian. In: Russian Linguistics 2, 91–104
WATT, D. 2002: ‘I don’t speak with a Geordie accent, I speak, like, the Northern accent’: Contact-induced levelling in the Tyneside vowel system. In: Journal of Sociolinguistics 6, 44–63
WATT, D.; MILROY, L. 1999: Patterns of variation and change in three Newcastle vowels. Is this dialect levelling? In: Foulkes, P.; Docherty, G. J. (eds.): Urban voices. Accent studies in the British Isles. London, 25–46
WEINREICH, U. 1970: Languages in contact. Findings and problems. 7. printing. The Hague [etc.]
WEXLER, P. 1977: A historical phonology of the Belorussian language. Heidelberg
416
WEXLER, P. 1985: Belorussification, russification and polonization. Trends in the Belorussian language 1890–1982. In: Kreindler, I. T. (ed.): Sociolinguistic perspectives on Soviet national languages. Their past, present and future. Berlin [etc.], 37–56
WEXLER, P. 1992: Diglossia et schizoglossia perpetua – The fate of the Belorussian language. In: Sociolinguistica 6, 42–51
WILLIAMS, A.; KERSWILL, P. 1999: Dialect levelling: change and continuity in Milton Keynes, Reading and Hull. In: Foulkes, P.; Docherty, G. J. (eds.): Urban voices. Accent studies in the British Isles. London, 141–162
WOOD, S. A. J.; PETTERSON, T. 1988: Vowel reduction in Bulgarian – the phonetic data and model experiments. In: Folia Linguistica 22, 239–262
WOOLHISER, C. 1995: The sociolinguistic study of language contact and bilingualism in the former Soviet Union: The case of Belarus. In: Harlig, J.; Pléh, Cs. (eds.): When East met West. Sociolinguistics in the former socialist bloc. Berlin [etc.], 63–88
WOOLHISER, C. 2005: Political borders and dialect divergence/convergence in Europe. In: Auer, P.; Hinskens, F.; Kerswill, P. (eds.): Dialect change: convergence and divergence in European languages. Cambridge, 236–262
ZAPRUDSKI, S. 1996: Jazykovaja Garmonija: Belorusskij variant. In: Nëman 8, 192–210
ZAPRUDSKI, S. 2007: In the grip of replacive bilingualism. The Belarusian language in contact with Russian. In: International Journal of the Sociology of Language 183, 97–118
ZAPRUDSKI, S. 2008: Maŭlenčaja akamadacyja i peraključėnne kodaŭ u pracėse mižkulʼturnaj kamunikacyi: vypadak Belarusi. In: Hentschel, G.; Zaprudski, S. (eds.): Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk: Structural and social aspects of their description and categorization. Oldenburg, 57–97 [= Studia Slavica Oldenburgensia 17]
ZAPRUDSKI, S.; JANENKA, N. 2011: Moŭcy perad vybaram pamiž cvërdym i mjakkim /č/ (na matėryjale chocimskaj častki al’dėnburhskaha korpusa zmešanaha maŭlennja). In: Važnik, S.A.; Kožynava, A.A. (rėd.): Aktualʼnyja prablemy palanistyki 2010. Minsk, 75–86
417
ZELLER, J. P. (i.Vorb.): Eine akustische Untersuchung der weißrussischen Vokale bei jungen Sprechern des Standardweißrussischen.
ZELLER, J. P. 2013a: Lautliche Variation in weißrussisch-russisch gemischter Rede. In: Kempgen, S.; Wingender, M.; Franz, N.; Jakiša, M. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013. München [etc.], 335–346
ZELLER, J. P. 2013b: Variation of sibilants in Belarusian-Russian mixed speech. In: Auer, P.; Reina, J. C.; Kaufmann, G. (eds.): Language variation – European Perspectives IV. Selected papers from the 6th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 6), Freiburg, June 2011. Amsterdam [etc.], 267–280
ZELLER, J. P. 2013c: Vowel variation in Belarusian vernacular. Comments on Ramza 2011 and an instrumental-phonetic study on Belarusian Jakanne. In: Russian Linguistics 37, 193–207
ZELLER, J. P.; TESCH, S. 2011: Zum Zusammenhang von morphologischer und phonischer Variation in gemischter weißrussisch-russischer Rede. In: Mendoza, I.; Pöll, B.; Behensky, S. (Hrsg.): Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit als Herausforderung für Soziolinguistik und Systemlinguistik. Ausgewählte Beiträge des gleichnamigen Workshops der 37. Österreichischen Linguistiktagung 2009. München, 149–167
ZINDER, L.R. 1979: Obščaja fonetika. Izd. 2., pererabot. i dop. Moskva
ZLATOUSTOVA, L.V. 1981: Fonetičeskie edinicy russkoj reči. Moskva
ZSIGA, E. C. 2000: Phonetic alignment constraints: consonant overlap and palatalization in English and Russian. In: Journal of Phonetics 28, 69–102
ZUBRITSKAYA, K. 1997: Mechanism of sound change in Optimality Theory. In: Language Variation and Change 9, 121–148
ŽURAŬSKI, A.I. 1967: Historyja belaruskaj litaraturnaj movy. T. 1. Minsk
ŽURAŬSKI, A.I. 1982: Dvuchmoŭe i šmatmoŭe ŭ historyi Belarusi. In: Biryla, M.V.; Suprun, A.Ja. (rėd.): Pytanni bilinhvizmu i ŭzaemadzejannja moŭ. Minsk, 18–49
ŻYGIS, M. 2003: Phonetic and phonological aspects of Slavic sibilant fricatives. In: ZAS Papers in Linguistics 3, 175–213
418
ŻYGIS, M. 2010: On changes in Slavic sibilant systems and their perceptual motivation. In: Recasens, D.; Miret, F. S.; Wireback, K. J. (eds.): Experimental phonetics and sound change. München, 115–138
ŻYGIS, M.; HAMANN, S. 2003: Perceptual and acoustic cues of Polish coronal fricatives. In: Solé, M. J.; Recasens, D.; Romero, J. (eds.): Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona, 3.-9. August, 2003. Barcelona, 395–398
Software
EMU 2010 = IPS LMU MUNICH 2010: The EMU Speech Database System [http://emu.sourceforge.net/]
EMU-R 2012 = HARRINGTON, J.; JOHN, T. et al.; IPS LMU Muenchen; IPDS CAU Kiel 2012: emu: interface to the Emu Speech Database System. R package version 4.3 [http://CRAN.R-project.org/package=emu]
HMISC 2012 = HARRELL, F. E. Jr et al. 2012: Hmisc: Harrell miscellaneous. R package version 3.9-3. [http://CRAN.R-project.org/package=Hmisc]
LANGUAGER 2011 = BAAYEN, R. H. 2011: languageR: data sets and functions with “Analyzing linguistic data: a practical introduction to statistics”. R package version 1.4 [http://CRAN.R-project.org/package=languageR]
LAWSTAT 2013 = GASTWIRTH, J. L.; GEL, Y. R.; HUI, W. L. W.; LYUBCHICH, V.; MIAO, W.; NOGUCHI, K. 2013: lawstat: an R package for biostatistics, public policy, and law. R package version 2.4 [http://CRAN.R-project.org/package=lawstat]
LME4 2012 = BATES, D.; MAECHLER, M.; BOLKER, B. 2012: lme4: linear mixed-effects models using S4 classes. R package version 0.999999-0 [http://CRAN.R-project.org/package=lme4]
PRAAT 2013 = BOERSMA, P.; WEENINK, D. 2013: Praat: doing phonetics by computer. Version 5.3.51 [http://www.praat.org/]
R 2012= R CORE TEAM 2012: R: a language and environment for statistical computing. Version 2.15.1 [http://www.R-project.org/]
RMS 2012 = HARRELL, F. E. Jr 2012: rms: regression modeling strategies. R package version 3.5-0. [http://CRAN.R-project.org/package=rms]
419
SPECT 2011 = LENNES, M. 2011: SpeCT. The Speech Corpus Toolkit for Praat. Latest update: 20.1.2011 [http://www.helsinki.fi/~lennes/praat-scripts/] draw_formant_chart.praat save_intervals_to_wav_sound_files.praat label_from_text_file.praat collect_formant_data_from_files.praat
421
Anhang
Den Großteil dieses Anhangs bilden Abbildungen der Einzelrealisierungen der Sprecher. Dies sind F2/F1-Plots, in denen die Formanten in Hertz gezeigt wer-den. Wenn vorhanden, so werden oben die Vertreter der Generation 0 gezeigt, in der Mitte Vertreter der Generation 1, unten Vertreter der Generation 2. In den Überschriften werden das Geschlecht, das Geburtsjahr und der Sprechertyp genannt. Der Sprechertyp richtet sich nach der Häufigkeit von Äußerungen unterschiedlicher Affinität bei den Sprechern (HW: Hybrid-Weißrussisch; H: Hybrid; HR: Hybrid-Russisch; R: Russisch).
I. Zu Kapitel 5: Vokalismus
Mittelwerte der „Hauptallophone“ der betonten Vokale a.
Durchschnittliche Formanten, weibliche Sprecher Tab. 120
/a/ /C0_ /e/ /Cʲ_ /i/ /Cʲ_ /o/ /C0_ /u/ /C0_ Spr. F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 ak_B 611 1481 462 1939 323 2097 452 1062 332 983 ak_D 747 1386 544 1935 426 2108 562 1153 394 1211 ak_M 747 1426 499 2164 393 2239 490 1039 369 1094 ba_A 615 1441 457 1929 376 2174 459 1182 387 1119 ba_B 698 1332 529 1761 402 2005 508 1029 401 1055 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. ch_A 730 1521 499 1889 433 2296 527 1186 417 1165 ch_N 749 1379 544 1972 420 2061 548 1165 456 997 ch_P 767 1508 536 2110 421 2435 511 1050 412 958 mi_A 700 1456 482 1918 398 2053 514 1159 383 1028 mi_F 776 1432 550 1994 433 2230 570 1134 443 1126 mi_V 744 1444 467 2043 380 2362 506 1120 398 1074 ra_A 709 1380 501 1901 404 2160 500 1036 426 1043 ra_B 757 1535 517 2211 422 2380 484 1103 377 937 ra_L 711 1358 478 1998 403 2340 468 1083 408 1106
422
sa_I 667 1604 415 2036 358 2326 435 1111 387 1309 sa_M 839 1545 528 2066 380 2513 523 1172 380 1186 sa_N 706 1266 553 1824 470 2058 543 1042 502 981 sm_A 829 1550 489 2145 349 2360 488 1028 379 949 sm_C 827 1476 596 2160 472 2270 575 1050 408 935 Ø: 733 1448 508 2000 405 2220 509 1100 404 1059 σ: 61 83 42 119 37 130 39 56 36 99
Durchschnittliche Formanten, männliche Sprecher Tab. 121
/a/ /C0_ /e/ /Cʲ_ /i/ /Cʲ_ /o/ /C0_ /u/ /C0_ Spr. F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 ak_P 625 1276 490 1633 416 1849 496 1045 423 1063 ak_Q 578 1214 421 1651 327 1818 411 891 366 923 ba_P 543 1256 394 1583 335 1761 425 1025 356 985 ba_V 614 1194 427 1743 311 2004 413 898 309 787 ch_C 524 1277 410 1652 369 1858 450 1019 405 982 ch_R 496 1329 360 1904 288 1993 346 1017 296 900 mi_B 596 1253 440 1602 368 1835 461 984 371 941 mi_Y 535 1166 400 1644 317 1964 407 873 371 873 ra_C 564 1133 430 1579 296 1958 446 933 322 841 ra_D 685 1443 484 1818 342 2036 465 1081 376 1058 ra_S 599 1177 434 1619 356 1771 436 1015 367 1032 sa_T 664 1359 502 1966 382 2189 517 1056 421 976 sm_AF 599 1254 452 1652 339 1978 478 1010 389 980 sm_B 624 1349 396 1575 338 1927 409 1019 324 977 Ø: 589 1263 431 1687 342 1924 440 990 364 951 σ: 51 82 39 120 33 113 42 63 38 77
423
(Akanje1) b.
Normalisierte durchschnittliche Realisierungen von /a/ und /o/ nach nicht-Tab. 122palatalisierten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Akanje1). Für Sprecher mit dissimilativem Akanje sind Positionen vor betontem /a/ ausgeschlossen
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B 0,89 0,03 0,85 0,05 0,70 0,44 51 ak_D 0,07 -0,36 -0,15 -0,35 0,76 0,47 53 ak_M 0,28 -0,27 0,26 -0,26 0,63 0,46 63 ak_P 0,39 -0,15 0,48 -0,21 0,94 0,71 66 ak_Q 0,38 -0,27 0,44 -0,32 0,76 0,55 40 ba_A 0,94 -0,11 0,94 -0,15 0,88 0,44 130 ba_B 0,34 -0,41 0,37 -0,48 0,83 0,55 81 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 0,71 -0,15 0,68 -0,15 0,78 0,48 165 ba_V 0,59 -0,26 0,63 -0,27 0,56 0,46 102 ch_A 1,28 -0,24 1,32 -0,23 0,62 0,35 40 ch_C 1,12 -0,20 0,87 -0,06 0,96 0,38 23 ch_N 0,46 -0,09 0,44 -0,08 0,69 0,54 75 ch_P 1,10 -0,04 1,13 -0,08 0,61 0,33 49 ch_R 0,62 -0,34 0,70 -0,35 0,82 0,47 40 mi_A 0,96 -0,11 0,74 -0,20 0,81 0,53 27 mi_B 1,00 -0,19 1,10 -0,21 0,58 0,35 43 mi_F 0,22 -0,22 0,18 -0,31 0,66 0,62 59 mi_V 0,97 -0,16 0,85 -0,10 0,55 0,34 53 mi_Y 0,90 -0,40 0,92 -0,37 0,65 0,36 26 ra_A 0,57 -0,23 0,59 -0,25 0,73 0,45 91 ra_B 1,05 -0,33 0,96 -0,28 0,68 0,38 37 ra_C 0,80 -0,36 0,88 -0,47 0,55 0,48 48 ra_D 0,54 -0,17 0,58 -0,15 0,48 0,30 61 ra_L 0,89 -0,31 0,81 -0,40 0,85 0,43 68 ra_S 0,95 -0,35 0,96 -0,45 0,59 0,39 28 sa_I 0,90 -0,20 0,95 -0,28 0,84 0,37 49 sa_M 0,88 -0,29 0,94 -0,25 0,56 0,55 12 sa_N 0,56 -0,42 0,45 -0,60 0,98 0,56 50 sa_T 0,90 -0,25 0,91 -0,24 0,51 0,42 56 sm_A 1,16 -0,14 1,17 -0,09 0,63 0,31 51 sm_AF 0,58 -0,36 0,61 -0,31 0,62 0,55 68 sm_B 0,56 -0,09 0,42 -0,18 0,88 0,39 68 sm_C 0,97 -0,32 1,15 -0,30 0,46 0,32 15 Ø: 57,2
424
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Akcjabrski (■=Realisierungen Abb. 80vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
○
○○
○
○○○○○
○
○○
○○
○
○○
○
○
○○
○
○
○○
○
○○
○
○
○
○○
○
○
○
3000 2000 1000
900
700
500
300
■
■■■■■■
■■■
■■
■
■■
■
■
3000 2000 1000
900
700
500
300
ak_B (w, 1936, HW)
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○
○○
○○
○
○ ○○
○○○○
○
○ ○○
○ ○○
○
○
○○○ ○○○○
○○
○
○
○ ○
○○ ○○ ○○
○
○
○○
○
○○
○
○○
○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
■■
■
■■■ ■■
■■
■■■
■■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_M (w, 1969, H)
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
○
○○○
○○ ○○ ○
○
○
○○
○○○
○○
○ ○
○○
○
○○○
○
○○○
○○
○
○○
○○
○
○○ ○○ ○
○○
○
○ ○
○
○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400 ■
■
■
■
■■■
■
■
■■
■
■■
■
■
■
■■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ak_P (m, 1962, H)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○○○
○○○
○
○
○○
○
○
○
○○
○
○○
○○○
○
○○○ ○
○
○○
○
○ ○○ ○
○
○○
○○
○
○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
■■
■
■ ■■
■■
■
■
■
■■■
■■
■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_D (w, 1992, R)
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○○
○○
○
○
○ ○○
○
○○○
○
○
○
○
○
○○
○
○
○○
○
○○○
○
○○○
○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■
■■
■■ ■■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ak_Q (m, 1990, k.A.)
425
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Baranavičy (■=Realisierungen Abb. 81vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
○
○
○
○
○○
○ ○○
○
○○ ○○○○
○
○○
○
○
○
○○
○○○
○
○
○○○○
○○ ○
○
○
○ ○○
○ ○
○○
○○ ○
○○○
○ ○○
○○
○○ ○○
○
○
○ ○○
○
○○○○
○○○○
○
○○○
○○○○
○
○
○○ ○
○ ○
○
○○○
○ ○○
○
○
○○ ○
○○ ○○○○○
○
○
○
○○○
○
○○
○○○
○○
○
○
○
○○
○
○ ○○
○
○○○
○○
○
○
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
■■■■■■■
■■■ ■
■■ ■
■■
■
■
■
■■ ■■■
■
■■■
■ ■■
■
■
■
■■ ■
■
■
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ba_A (w, 1949, HR)
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○○○○○
○○○○○○○
○○
○○
○
○○
○
○○
○○
○
○
○○○
○○○○ ○○
○○○
○○
○ ○○
○ ○
○
○
○○
○ ○
○
○
○○○
○○
○○○○
○○
○
○○
○○ ○○○
○
○○
○○ ○
○ ○○○ ○
○
○○
○
○ ○
○
○○
○
○
○○○○○
○
○ ○○
○
○
○
○
○○
○
○○ ○
○
○○
○
○○○
○○ ○
○
○
○○○
○○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■ ■
■
■■■■
■■ ■■
■ ■■■■
■
■■
■
■■■
■■
■
■■
■
■
■
■■■■
■■
■■
■
■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_P (m, 1949, H)
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
○○○○
○○ ○
○
○
○○
○○○
○
○○○○○○
○ ○○
○ ○
○○○○○
○
○○
○○
○
○○
○○ ○
○
○
○○
○○
○ ○○
○
○
○○
○
○
○
○
○
○○
○
2500 1500 500
800
600
400
200
■■
■
■
■ ■■
■
■
■■■
■■
■
■
■■■
■
■■
2500 1500 500
800
600
400
200
ba_B (w, 1978, R)
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○○ ○
○○○ ○○
○
○
○
○
○
○○○○○ ○○
○
○○
○○
○○○
○ ○○○○
○○
○○ ○
○
○○○○
○
○
○○
○○
○○
○
○
○
○○
○
○
○
○○
○○
○
○
○○
○
○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■
■
■
■■
■
■
■■
■
■■■■
■
■■■
■
■ ■■ ■
■
■■
■■■
■
■
■■■
■■
■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_V (m, 1973, R)
426
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Chocimsk (■=Realisierungen Abb. 82vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
je
a
o
ui
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
je
a
o
ui
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
○○○
○
○○
○
○ ○○○
○○○
○
○
○
○
○
○○
○○ ○
○
○
○○
○○
○○○
○○
○○
○
○○ ○
○
○○
○
○○ ○○
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
■
■
■■
■
■
■
■■
■
■■
■ ■■■
■■ ■■ ■
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
ch_P (w, 1939, HW)
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
○○○○ ○○○○
○○
○
○
○○ ○○
○○○
○○○
○○
○○ ○
○ ○ ○○○○ ○
○○
○
○
○
○○○
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
■
■ ■■
■
■
■
■
■■
■■■
■
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
ch_A (w, 1966, HR)
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
○
○
○
○
○○
○ ○
○○○○
○
○○
○
○○○○ ○○
○
○
○○
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
■
■■
■■
■■
■
■
■■
■
■
■
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
ch_C (m, 1964, HR)
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
○
○
○
○ ○○
○
○
○
○
○○
○
○○ ○
○
○
○
○
○○○ ○
○○
○
○
○○
○
○
○
○
○○ ○○○
○
○ ○○
○
○
○○○
○○
○
○○
○
○
○○○○
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
■■
■
■
■■ ■■■
■
■
■■
■■■
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
ch_N (w, 1988, R)
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
○○○
○
○○○○○
○
○
○○
○○
○○○
○○
○○
○
○○
○
○
2500 1500 500
600
400
200
■
■
■■■
■■■
■■
■
■
■
■ ■
■
2500 1500 500
600
400
200
ch_R (m, 1979, HR)
427
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Minsk (■=Realisierungen vor Abb. 83betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
u
o
a
jei
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
u
o
a
jei
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
○○○○○
○
○○○○
○○○
○○○
○○
○
○ ○
○○○
○○
○ ○○○○
○○
○○
○○○
○○○
○ ○
○○○○○
○
○○
○
○○
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
■
■
■■■ ■
■
■■■
■■■■ ■■
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
mi_V (w, 1921, HW)
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
○○
○
○
○
○ ○○ ○○○
○
○
○
○○○
○
○
○
○○
○
○○
○○
○○○
2500 1500 500
900
700
500
300
■
■■
■■■■
■
■■■
■
■
■
■
■■
■■
2500 1500 500
900
700
500
300
mi_A (w, 1954, H)
a
i
o
u
je
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
o
u
je
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○
○○○○○
○○○○
○○○
○
○○○○ ○
○○○
○
○○○
○○○
○○
○○○○○ ○○
○○ ○○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■■■
■
■
■■■
■ ■
■■
■
■
■ ■■ ■■■
■■■
■■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
mi_B (m, 1959, HR)
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
○ ○
○
○○○
○
○
○○○○
○○
○
○
○○ ○○
○
○○
○○
○○○
○
○ ○
○
○
○
○
○ ○○○ ○
○
○
○
2500 1500 500
1000
600
400
200
■
■
■
■■
■■■■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ ■
2500 1500 500
1000
600
400
200
mi_F (w, 1987, R)
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
○
○ ○○○
○○
○
○
○
○ ○○
○○
○○
○○○○○
○○
○
○
○○○○
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
■ ■■■
■■
■
■■
■
■
■■
■
■ ■
■
■ ■
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
mi_Y (m, 1984, R)
428
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Rahačoŭ (■=Realisierungen vor Abb. 84betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
○
○
○
○
○
○○○○○
○○
○○
○○
○○
○
○
○○
○○○
○
○○
○○○○
○○
○
○
○○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
■■■■
■
■
■
■■
■
■
■■
■■■■ ■■
■■
■
■■■
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_B (w, 1936, HW)
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
○ ○○○○
○
○
○○
○○
○
○○○○
○ ○○
○○ ○
○
○
○
○
○ ○○
○○○○ ○ ○○○○○○ ○○
○
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
■
■
■
■
■
■■
■
■
■■ ■
■
■ ■■
■
■
■■■
■
■■
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
ra_D (m, 1932, H)
i
a
je ou
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
○
○
○ ○○○○
○○
○
○○
○○
○○
○
○
○
○
○○○○ ○
○○○
○ ○○○ ○○○
○○
○
○
○○
○
○
○○
○○
○○○
○
○
○
○
○○
○○
○○○
○
○
○○
○
○
○○○
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
■ ■■
■■ ■■
■
■■
■■
■■■ ■
■■
■
■
■
■■
■■■■
■
■
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
ra_L (w, 1957, H)
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○
○
○
○
○○○
○○○
○ ○
○
○○○
○
○○
○○○
○
○
○○○○
○○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■
■■
■■ ■■
■
■
■■■■
■■■
■■ ■ ■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ra_S (m, 1957, HW)
je oui
a
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
je oui
a
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
○○
○
○
○○
○ ○
○○○
○
○○ ○
○
○
○
○
○
○
○○
○
○○○ ○
○
○○
○○
○○○○
○
○○
○○
○○○ ○○
○
○○○○○
○
○
○○○○○
○ ○○
○○○ ○
○
○
○
○
○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
■
■
■
■
■
■■■ ■■■ ■■
■
■ ■
■
■
■
■■■
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_A (w, 1987, HR)
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
○○
○
○○○○○ ○
○○○○ ○○
○ ○
○ ○
○○
○
○
○○ ○
○○○○ ○
○
○○
○
○○
○○○ ○○
○○○○
○○○
○○
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
■
■
■
■
■■
■ ■■■
■
■
■■ ■
■■■■■■■ ■■■ ■
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ra_C (m, 1980, R)
429
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Šarkoŭščyna (■=Realisierungen Abb. 85vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
○○○○○○
○○○
○○
3000 2000 1000
1200
800
400
sa_M (w, 1956, HW)
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○○
○○○○○○○○ ○
○○
○
○
○
○
○○ ○○○
○○
○○○ ○ ○
○
○○ ○
○
○ ○○○ ○
○○○ ○
○
○
○
○ ○
○○ ○○○○○ ○○
○○○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
■■
■■ ■■■
■
■■■■■ ■■
■■■
■
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_T (m, 1956, HW)
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
○
○
○○
○ ○
○○
○
○○○○○
○○
○
○
○○
○○
○
○
○
○○○○○○
○○○
○○
○
○ ○○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○○ ○
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
■■
■■
■
■
■ ■
■
■
■■■■
■
■■
■■
■
■
■■■ ■■
■
■
■■■■■■
■
■
■■
■■
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
sa_I (w, 1977, HR)
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○ ○○○
○○○
○
○ ○○
○
○
○
○
○○
○○
○○
○
○○ ○
○
○
○
○○○ ○○○ ○○
○○ ○
○○○○
○
○○ ○
○○
○
○
○○○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
■■■
■
■
■
■
■■
■■■
■ ■■
■■■■ ■■
■
■■
■ ■■■■■
■
■■■ ■
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_N (w, 1989, HR)
430
(Akanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Smarhonʼ (■=Realisierungen Abb. 86vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
○
○○
○○
○
○
○
○
○○ ○○ ○
○ ○
○○
○
○○
○○
○
○
○○
○
○○○
○○
○
○
○○
○○
○○
○
○○○
○
○
○○○○○
○
○○
○○
3000 2000 1000 500
1200
800
400
sm_A (w, 1962, H)
■■
■
■
■
■
■■■
■
■
■■■
3000 2000 1000 500
1200
800
400
a
u
ojei
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
a
u
ojei
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○○
○
○○
○○○○○○○
○
○
○○○ ○
○
○○
○○○○○ ○
○○○
○
○○
○○○○○
○○
○○○
○
○○○○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
■■ ■■ ■■
■
■■
■
■■■
■■■
■
■
■
■
■
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sm_B (m, 1961, HW)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○
○○
○○
○○○
○○
○○ ○○
○
○○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
■
■
■
■
■
■■
■
■ ■■ ■■
■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
sm_C (w, 1967, HW)
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
○
○○○
○○ ○
○ ○○ ○○○○
○ ○○
○
○ ○○
○
○
○○
○
○○○
○○○
○○
○
○ ○ ○○○○○
○
○ ○
○
○ ○○
2500 1500 500
800
600
400
200
■■
■■■
■■
■■
■■ ■
■
■
■
■■
■
■■ ■■■
2500 1500 500
800
600
400
200
sm_AF (m, 1979, H)
431
(Akanje2) c.
Normalisierte durchschnittliche Realisierungen von /a/ und /o/ nach nicht-Tab. 123palatalisierten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Akanje2)
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B 0,76 -0,09 0,62 -0,04 0,58 0,40 37 ak_D 0,09 -0,37 -0,13 -0,40 0,83 0,60 26 ak_M 0,28 -0,44 0,24 -0,42 0,64 0,53 31 ak_P 0,29 -0,46 0,14 -0,47 0,78 0,49 27 ak_Q 0,18 -0,17 0,10 0,03 0,67 0,83 15 ba_A 0,33 -0,40 0,14 -0,42 0,85 0,36 54 ba_B 0,22 -0,43 -0,03 -0,35 0,96 0,40 24 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 0,21 -0,29 0,21 -0,25 0,72 0,48 42 ba_V 0,44 -0,24 0,23 -0,19 0,64 0,30 25 ch_A 0,42 -0,50 0,33 -0,47 0,89 0,71 27 ch_C 0,58 -0,37 0,33 -0,35 1,02 0,45 22 ch_N 0,02 -0,34 0,17 -0,15 0,69 0,46 18 ch_P 0,43 -0,23 0,29 -0,21 0,72 0,42 29 ch_R 0,33 -0,42 0,07 -0,38 0,71 0,50 29 mi_A 0,10 -0,29 0,09 -0,16 0,75 0,54 44 mi_B 0,81 -0,38 0,84 -0,42 0,80 0,41 31 mi_F 0,11 -0,35 -0,01 -0,43 0,72 0,63 21 mi_V 0,02 -0,36 -0,19 -0,35 0,60 0,40 32 mi_Y 0,14 -0,50 0,16 -0,55 0,68 0,49 32 ra_A 0,22 -0,38 0,11 -0,34 0,80 0,53 24 ra_B 0,38 -0,40 0,26 -0,37 0,74 0,41 28 ra_C 0,02 -0,30 -0,01 -0,32 0,47 0,44 34 ra_D 0,19 -0,36 0,18 -0,30 0,55 0,45 36 ra_L 0,13 -0,35 0,19 -0,24 0,82 0,37 23 ra_S 0,12 -0,45 0,09 -0,45 0,56 0,57 37 sa_I -0,23 -0,13 -0,40 -0,07 0,53 0,51 24 sa_M -0,11 -0,37 -0,15 -0,48 0,39 0,46 5 sa_N 0,06 -0,41 0,09 -0,35 0,43 0,58 20 sa_T -0,06 -0,21 -0,09 -0,31 0,49 0,65 29 sm_A 0,58 -0,27 0,62 -0,24 0,68 0,38 39 sm_AF 0,06 -0,48 0,07 -0,50 0,46 0,52 33 sm_B 0,00 -0,49 -0,28 -0,64 0,75 0,39 12 sm_C 0,19 -0,28 0,31 -0,25 1,00 0,41 15 Ø: 28,0
432
(Akanje2), Akcjabrski Abb. 87
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
●
●
●●
●
●
●●
●●
●●
●●
●●●●●● ●●
●● ●●●●
●●
●●●
●
● ●●●
●
3000 2000 1000
900
700
500
300
ak_B (w, 1936, HW)
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
●
●●●
●
●●
●●
●
●● ●●●
●●
●●● ● ●●●
●● ●
●●●
●●
●●
●
●
●
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_M (w, 1969, H)
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
●●●●
●●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●●● ●
●
●●
●●●
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ak_P (m, 1962, H)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
●●
●●
●●●
●●●
● ●
●
●
●●
●
●●
●
●
● ●●
●●
●
●●
●
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_D (w, 1992, R)
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
●
●
●●
●●●●
●●●
● ●●
●●
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ak_Q (m, 1990, k.A.)
433
(Akanje2), Baranavičy Abb. 88
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
●●
●
●
●●
● ●
●●
●●●
●● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●● ●
●
●
●
●
●
●●●●
●●
●●
●●
●
●●
●●●●●●●
●
●
●●
●
●
● ●
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ba_A (w, 1949, HR)
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
●●●
●●●●●
● ●●
●
●
●●●
●
● ●●
●
●●●●●●
●
●
●●●
●
●●●
●
●●
●●●●
●●
●
●●
●●
●●
●●
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_P (m, 1949, H)
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
●●●
●●
●
●●
●●●●●
●
●●
●
●
●
●
●●●
●
●●
●● ●●
2500 1500 500
800
600
400
200
ba_B (w, 1978, R)
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
●●
●
●●●
●
●●
●●●
●●
●
●●●
●
●●
●
● ●
●●●
●
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_V (m, 1973, R)
434
(Akanje2), Chocimsk Abb. 89
je
a
o
ui
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
je
a
o
ui
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●●●
●
●●
●●
●● ●
●●
●
●
●●
●
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
ch_P (w, 1939, HW)
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
● ●●
●
●●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●●
●
●●
●
●
●●
●
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
ch_A (w, 1966, HR)
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
●
●
● ●
●●
●●●
●
●
●
●
●
●● ●
●●●●
●
●
●
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
ch_C (m, 1964, HR)
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
●●
●
●●●
●
●
● ●
●●●●●
●
●●
●
●
●
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
ch_N (w, 1988, R)
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
●
●
●●
●
●
●
●
● ●●● ●●●●
●
●●
●
●●●
●●●
●●
●
●●
●
● ●
2500 1500 500
600
400
200
ch_R (m, 1979, HR)
435
(Akanje2), Minsk Abb. 90
u
o
a
jei
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
u
o
a
jei
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
● ●●
●
● ●●
●●
●
●●●
●
●● ●●●
●●●
●
●●
●●●●●
●
●●●●●●
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
mi_V (w, 1921, HW)
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
●●
●● ●●
●●●
●
●●●
●
●
●
●●
●
●
● ●
●
●
●●
●●●
●
●
●●
●
●
●
●●●
●
●● ●
●●
●
●●
2500 1500 500
900
700
500
300
mi_A (w, 1954, H)
a
i
o
u
je
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
o
u
je
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
●●●
●
● ●●
●●
●●
●
●
●●
●
●
●●
●
● ●
●
●
●●
●
●
●
●
●●●
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
mi_B (m, 1959, HR)
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
●●
●● ●
●● ●
● ●●●● ●●
●●●
●
●
●
●●
●
●
2500 1500 500
1000
600
400
200
mi_F (w, 1987, R)
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
● ● ●●●
●
●● ●●●● ●
●●
●
●●
● ●●●●
●●
● ●●●●
● ● ●●
●
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
mi_Y (m, 1984, R)
436
(Akanje2), Rahačoŭ Abb. 91
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
●●
●●
●
●●● ●
●●
●● ●●●
●
●
●
●
●
●
●●
●
● ●●
●
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_B (w, 1936, HW)
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
●●● ●●●
●
●●●
●●●●
●
●●●
●●●●
●●
●
●
●
●●
●● ●
●
●
●●
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
ra_D (m, 1932, H)
i
a
je ou
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
●●●●●●
●
●●●
●
●
●
●●
● ●●
●●●
●● ●●●
●
●
3000 2000 1000 500
1000
800
600
400
200
ra_L (w, 1957, H)
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
●
●● ●
●
●●
●●
●●
●
●●
●
●●
●●
●
●
●
●
●●
●●
●●●●
● ●●
●●
● ●●●
●
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ra_S (m, 1957, HW)
je oui
a
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
je oui
a
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
●
●
●●●● ●●
●
●
●
●●●●
●
●● ●
●
● ●● ●
●●
●●●
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
ra_A (w, 1987, HR)
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
●●●
●
●●
●
●●
●
●●
●
●●
●●●●●●
●● ●●
●
●
●●●●●●●
●●●
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ra_C (m, 1980, R)
437
(Akanje2), Šarkoŭščyna Abb. 92
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
●●
●●
●●●
3000 2000 1000
1200
800
400
sa_M (w, 1956, HW)
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
● ●●
●●
●
●●
●
●
●●●●●
●● ●
● ●● ●●
●●
●●
●●
●●
●
●●● ●
●
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_T (m, 1956, HW)
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
●● ●●●
●
●
●
●●
●
● ●●●
●
●
●●●
●
● ●●● ●
●
●
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
sa_I (w, 1977, HR)
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
●●●
●
●
●
● ●●● ●●
●●●
●
●
●●
●●●●
●
●●
●
●●
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_N (w, 1989, HR)
438
(Akanje2), Smarhonʼ Abb. 93
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
●
●●●
●●
●●
●● ●
●
●●
●
●
●●
●●
●
●●
●●
●
●
●
● ●
●●
●
●
●●●
●●
●
3000 2000 1000 500
1200
800
400
sm_A (w, 1962, H)
a
u
ojei
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
a
u
ojei
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
●
●●● ●● ●
●
●
● ●●
●
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sm_B (m, 1961, HW)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
●● ●
●
●
●
●●●●
●
●
●
●
●●
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
sm_C (w, 1967, HW)
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
● ●
●
●●● ●
●
●
●●●●●●●
●●
●●●
●
●●●
●
●●● ●
●● ●
●
●
2500 1500 500
800
600
400
200
sm_AF (m, 1979, H)
439
(Jakanje1) d.
Normalisierte durchschnittliche Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisier-Tab. 124ten Konsonanten in der unmittelbar vorbetonten Silbe (Jakanje1). Für Sprecher mit dissimilativem Jakanje sind Positionen vor betontem /a/ ausgeschlossen
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B 0,67 0,50 0,54 0,52 0,67 0,38 50 ak_D -0,86 1,03 -0,87 0,95 0,60 0,60 36 ak_M -0,27 0,65 -0,32 0,76 0,76 0,52 34 ak_P -0,39 0,68 -0,56 0,58 0,93 0,65 53 ak_Q -0,60 0,69 -0,58 0,86 0,53 0,49 8 ba_A -0,09 0,79 -0,28 0,82 0,94 0,67 72 ba_B -0,40 0,47 -0,46 0,36 0,77 0,69 27 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P -0,15 0,64 -0,13 0,66 0,69 0,53 78 ba_V -0,56 1,00 -0,56 0,99 0,41 0,53 40 ch_A 0,01 0,57 -0,26 0,60 0,87 0,51 45 ch_C -0,04 0,53 -0,13 0,48 1,09 0,45 43 ch_N -0,83 1,29 -0,85 1,26 0,50 0,50 17 ch_P 0,57 0,68 0,65 0,67 0,63 0,49 34 ch_R -0,62 0,91 -0,59 0,90 0,64 0,50 41 mi_A 0,29 0,53 0,31 0,50 0,72 0,60 50 mi_B 0,13 0,64 0,29 0,62 0,78 0,57 55 mi_F -0,52 0,80 -0,59 0,84 0,66 0,47 32 mi_V 0,14 0,43 0,10 0,45 0,53 0,59 51 mi_Y -0,75 0,88 -0,76 0,83 0,79 0,56 34 ra_A -0,35 0,76 -0,32 0,66 0,60 0,75 74 ra_B 0,81 0,38 0,93 0,36 0,85 0,53 54 ra_C -0,47 0,67 -0,56 0,73 0,70 0,53 52 ra_D -0,09 0,62 -0,06 0,64 0,67 0,49 62 ra_L -0,09 0,62 -0,24 0,59 0,87 0,55 36 ra_S 0,21 0,48 0,40 0,46 0,70 0,48 37 sa_I 0,29 0,49 0,24 0,47 0,84 0,43 42 sa_M 0,46 0,33 0,51 0,37 0,84 0,43 15 sa_N 0,15 0,65 0,13 0,68 0,97 0,62 61 sa_T 0,51 0,34 0,60 0,34 0,56 0,55 60 sm_A 0,38 0,57 0,53 0,62 0,88 0,38 68 sm_AF -0,27 0,40 -0,30 0,42 0,80 0,39 49 sm_B -0,20 0,58 -0,37 0,59 0,63 0,45 25 sm_C 0,05 0,54 0,13 0,46 1,18 0,38 18 Ø: 44,0
440
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Akcjabrski (■=Realisierungen Abb. 94vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
○
○
○
○
○
○○○○○
○
○○○ ○
○
○ ○○○○○○
○○
○○
○
3000 2000 1000
900
700
500
300
■■■■
■
■
■■■
■■■ ■■■■■
■■
■
■■
3000 2000 1000
900
700
500
300
ak_B (w, 1936, HW)
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○
○○○
○
○○
○ ○○
○○
○○ ○
○
○○○
○○
○
○○
○
○○○ ○
○
○
○○○○○
○
○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
■■
■■■
■■
■
■
■■
■■■
■■
■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_M (w, 1969, H)
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400 ○
○ ○
○○
○○
○○
○
○
○
○○
○
○○
○○○○
○○
○○○
○
○
○
○ ○○
○○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
■
■■
■ ■
■
■
■■■
■
■■
■
■
■
■■
■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ak_P (m, 1962, H)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○○○
○○○
○
○○
○○
○
○
○
○○
○ ○○○○
○○○○
○ ○○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
■
■
■
■
■
■■■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_D (w, 1992, R)
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○○
○○ ○
○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ak_Q (m, 1990, k.A.)
441
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Baranavičy (■=Realisierungen Abb. 95vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
○ ○○
○ ○
○
○○
○
○
○
○○○
○○ ○○
○
○
○
○
○○
○○○
○○○
○○
○ ○○
○○
○○
○
○○○
○
○○
○
○
○
○○○○
○
○○
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
■ ■■
■
■
■■
■
■■ ■
■
■■■■ ■
■
■
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ba_A (w, 1949, HR)
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○ ○ ○ ○
○ ○○ ○○○○○○ ○
○○○ ○
○
○○○
○
○
○
○○
○○
○○○
○○○ ○
○○○○○○
○○○
○○○
○
○
○ ○○
○
○
○○
○
○
○○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■■ ■■
■
■
■
■■
■■
■
■
■■ ■ ■
■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_P (m, 1949, H)
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
○○ ○ ○○ ○○ ○○
○
○○○
○
○○
○○○
2500 1500 500
800
600
400
200
■■
■
■ ■
■■■■■
2500 1500 500
800
600
400
200
ba_B (w, 1978, R)
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○○○ ○○ ○
○
○○
○
○
○○
○○ ○○ ○○○ ○○○
○○○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■
■■ ■■ ■
■
■■ ■
■■■
■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_V (m, 1973, R)
442
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Chocimsk (■=Realisierungen Abb. 96vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
je
a
o
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
je
a
o
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
○
○ ○
○
○○○ ○
○
○○
○
○
○
○
○○
○○○
○
○ ○ ○
○○○○
○○○ ○
○○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
■■
■
■■■
■
■■
■
■
■
■■
■
■■
■
■
■■
■
■
3000 2000 1000
1000
800
600
400
ch_P (w, 1939, HW)
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
○○
○○
○○
○○○
○○
○
○
○○○
○○ ○
○○
○
○
○
○
○
○ ○ ○○ ○○
○○
○○
○
○○
○
○ ○○○
○
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
■
■■■ ■
■■
■
■■
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
ch_A (w, 1966, HR)
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
○○○○
○
○○
○
○○
○
○
○
○
○
○
○○
○
○○
○ ○○○
○
○○
○
○ ○○○
○
○ ○○
○○
○○
○
○○
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
■■■■
■■
■■■ ■
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
ch_C (m, 1964, HR)
a
oje
i u
3000 2000 1000
1000
800
600
400
a
oje
i u
3000 2000 1000
1000
800
600
400
○
○○
○○○○○ ○○
○
○
○○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
■■■
3000 2000 1000
1000
800
600
400
ch_N (w, 1988, R)
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
○ ○○
○
○
○ ○○
○○ ○
○○ ○○
○○
○○
○ ○ ○○
○○
2500 1500 500
600
400
200
■■
■■■ ■
■■
■
■■
■
■
■■
■
2500 1500 500
600
400
200
ch_R (m, 1979, HR)
443
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Minsk (■=Realisierungen vor Abb. 97betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
u
o
a
jei
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
u
o
a
jei
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
○○
○
○○
○○ ○
○○○
○
○
○○
○
○○
○
○○ ○○
○○ ○
○
○○
○
○
○
○○○ ○○
○
○○
○○
○○
○○
○○○
○○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
■
■
■■
■
■■ ■
■■■
■■
■
■
■
■
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
mi_V (w, 1921, HW)
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
○
○○ ○
○
○
○
○ ○
○
○○
○○
○○ ○
○○ ○
○ ○
○○
○○○○
○
○○○
○
○○ ○○
○
○○○
○
○
○
○
○
○
○
○○
2500 1500 500
900
700
500
300
■■
■
■
■■
■■■
■ ■
■■
■■■
2500 1500 500
900
700
500
300
mi_A (w, 1954, H)
a
i
o
uje
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
o
uje
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○ ○
○○○
○○○ ○○
○
○ ○○○○○○
○ ○
○
○○
○
○
○○○○ ○○○
○○○○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■
■■■■
■■
■
■■
■■
■
■■■
■
■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
mi_B (m, 1959, HR)
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
○○○ ○○○○
○ ○○○ ○○ ○○
○
○
○○○
○○
○
2500 1500 500
1000
600
400
200
■■
■
■■■
■
■■■■■
2500 1500 500
1000
600
400
200
mi_F (w, 1987, R)
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
○○○○○
○
○○
○
○
○
○○○○
○
○○○○
○ ○
○○○
○○
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
■■■
■■
■■
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
mi_Y (m, 1984, R)
444
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Rahačoŭ (■=Realisierungen vor Abb. 98betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
600
400
200
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
600
400
200
○○
○
○○○
○○○○
○○
○
○○ ○
○
○○ ○○○
○○
○○
○ ○○○
○○
○○
○○
○
○
○
○○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○○
○
○
3000 2000 1000
1000
600
400
200
■■
■ ■■■■
3000 2000 1000
1000
600
400
200
ra_B (w, 1936, HW)
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
○○
○
○
○○
○
○
○
○
○
○○○
○
○ ○
○
○○○ ○
○
○
○○
○○○○
○
○○
○
○○○
○
○
○○
○
○○○○
○○○ ○○
○ ○○○
○○
○
○
○
○
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
■■■■■■■
■
■■
■■■ ■
■■
■■■
■■■■ ■
■
■ ■
■
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
ra_D (m, 1932, H)
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
600
400
200
○ ○○○
○
○
○○
○
○
○○○ ○
○
○○
○○
○
○○ ○○○○○○
○○
○
○
○
○
○○○
3000 2000 1000
1000
600
400
200
■■
■■■■ ■
■
■■
■■ ■
■
■
■■ ■■
■
■
■
3000 2000 1000
1000
600
400
200
ra_L (w, 1957, H)
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○
○○○○○
○
○○
○
○
○
○
○○○ ○○○○○
○
○○○
○ ○
○
○○
○
○
○○
○○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■ ■
■■
■■
■■
■■
■ ■
■
■
■■
■
■■
■ ■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ra_S (m, 1957, HW)
je oui
a
3000 2000 1000
1000
600
400
200
je oui
a
3000 2000 1000
1000
600
400
200
○
○
○ ○○
○
○
○
○○○
○○○
○○
○
○○○
○ ○○○○
○ ○○○○○ ○○○
○○
○○
○○
○○○
○
3000 2000 1000
1000
600
400
200
■■
■■■■
■
■ ■■ ■■■■■
■
■ ■■
■■■■ ■■■
■ ■■
■
3000 2000 1000
1000
600
400
200
ra_A (w, 1987, HR)
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
○○
○○
○
○
○
○○○○○
○ ○○○
○○
○
○○
○
○
○○
○ ○○ ○
○
○○
○
○
○○
○
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300 ■■
■■■
■■
■ ■■
■■
■
■■
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ra_C (m, 1980, R)
445
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Šarkoŭščyna (■=Realisierungen Abb. 99vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
○
○○
○
○○
○○
○○
○
○○○
○
3000 2000 1000
1200
800
400
sa_M (w, 1956, HW)
■
■■
■
3000 2000 1000
1200
800
400
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○○○ ○○ ○
○○○
○○
○○
○
○
○
○○○○ ○
○
○
○○
○
○○
○○○○○
○○○ ○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○○○
○ ○○
○ ○○○○
○
○ ○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
■ ■
■■■■
■■■■
■■ ■
■■ ■
■
■■ ■
■
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_T (m, 1956, HW)
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
○○
○
○
○○
○○ ○
○
○
○
○
○
○
○○○○
○○○
○
○○
○
○○○○ ○○ ○
○
○
○
○
○
○
○○
○
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
■■■■
■■
■■
■ ■ ■■■■■■■
■
■
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
sa_I (w, 1977, HR)
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○
○○
○○
○
○ ○
○○○
○
○
○○○
○
○
○ ○○○
○
○○
○
○ ○○
○○○
○○○
○
○○○
○
○
○○
○
○
○○○
○ ○○
○ ○
○○ ○
○
○○○
○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
■ ■
■
■■
■■■■
■■ ■
■■
■ ■■
■■
■■
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_N (w, 1989, HR)
446
(Jakanje1), unterschieden nach dem betonten Vokal, Smarhonʼ (■=Realisierungen Abb. 100vor betontem /a/; ○=Realisierungen vor anderen betonten Vokalen)
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
○○
○ ○
○ ○
○
○○
○○○
○
○ ○○
○○○
○
○ ○
○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○○
○○
○
○○
○○
○○○
○
○ ○
○
○
3000 2000 1000 500
1200
800
400
sm_A (w, 1962, H)
■■
■■■
■■
■■
■■■ ■
3000 2000 1000 500
1200
800
400
a
uoje
i
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
a
uoje
i
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○ ○○○
○
○○
○
○
○
○○
○○ ○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
■■
■■■ ■■■
■
■
■
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sm_B (m, 1961, HW)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○○
○
○
○
○○ ○○
○
○
○○
○
○
○
○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
■■■■
■■ ■
■
■■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
sm_C (w, 1967, HW)
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
○
○
○○○
○○
○○
○○
○
○○○
○
○
○○○
○○○
○
○ ○
○
○
2500 1500 500
800
600
400
200
■■
■■
■■
■
■
■
■■
■
■
■■■■■ ■
■
■
2500 1500 500
800
600
400
200
sm_AF (m, 1979, H)
447
(Jakanje2) e.
Normalisierte durchschnittliche Realisierungen von /a/, /e/ und /o/ nach palatalisier-Tab. 125ten Konsonanten in weiteren vorbetonten Silben (Jakanje2).
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B -0,70 1,05 -0,71 1,17 0,57 0,52 5 ak_D -0,84 0,55 -0,78 0,49 0,58 0,41 10 ak_M -0,39 0,96 -0,24 0,96 0,42 0,36 10 ak_P -0,08 0,77 -0,16 0,63 0,90 0,73 22 ak_Q k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (2) ba_A -0,23 1,22 -0,14 1,36 0,78 0,76 25 ba_B -0,12 0,57 -0,06 0,48 0,89 0,86 19 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P -0,30 1,10 -0,32 1,20 0,67 0,84 27 ba_V -0,50 1,08 -0,54 1,05 0,44 0,60 21 ch_A -0,93 0,56 -0,77 0,73 0,37 0,54 6 ch_C -0,97 0,52 -1,27 0,39 0,79 0,34 7 ch_N -0,47 0,88 -0,37 0,94 0,66 0,33 8 ch_P -0,90 1,21 -0,76 1,36 0,51 0,38 17 ch_R -0,63 0,90 -0,70 1,03 0,60 0,58 14 mi_A -0,37 1,00 -0,64 1,12 0,83 0,68 21 mi_B -0,10 0,67 -0,30 0,62 0,61 0,46 13 mi_F -0,65 1,11 -0,78 1,15 0,61 0,33 12 mi_V -0,59 0,76 -0,74 0,82 0,50 0,46 13 mi_Y -0,38 0,67 -0,39 0,81 0,47 0,60 12 ra_A -0,38 0,78 -0,33 0,95 0,36 0,53 17 ra_B -0,66 0,54 -0,75 0,54 0,65 0,39 8 ra_C -0,34 0,78 -0,25 0,68 0,37 0,38 16 ra_D -0,50 0,95 -0,39 0,99 0,48 0,52 20 ra_L -0,44 0,76 -0,47 0,72 0,53 0,50 15 ra_S -0,62 1,15 -0,57 1,05 0,65 0,74 12 sa_I -0,65 0,95 -0,62 0,98 0,37 0,47 15 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (3) sa_N -0,74 1,10 -0,91 1,15 0,85 0,46 17 sa_T -0,28 0,76 -0,20 0,72 0,52 0,47 19 sm_A -0,16 0,77 -0,28 0,65 0,52 0,50 15 sm_AF -0,69 0,85 -0,65 0,74 0,59 0,49 21 sm_B k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (4) sm_C k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (3) Ø (Spr. mit n≥5): 15,1
448
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Akcjabrski Abb. 101(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
je
a
o
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
○○ ○
○○
3000 2000 1000
900
700
500
300
ak_B (w, 1936, HW)
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
a
je oi u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○○
○
○○
○
○○○○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_M (w, 1969, H)
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ije
u
a
o
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
○○○ ○○
○
○○○○
○
○○ ○○
○
○ ○
○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
ak_P (m, 1962, H)
■
■■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○○○○
○
○○
○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
ak_D (w, 1992, R)
■■
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
oi
jeu
a
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○○
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ak_Q (m, 1990, k.A.)
449
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Baranavičy Abb. 102(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
je
a
oui
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
○
○○
○
○○○○
○
○
○
○ ○○
○ ○○○○○
○○
○
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ba_A (w, 1949, HR)
■■
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
ojeu
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○○
○○
○
○○ ○
○
○○
○
○○
○
○○○
○
○ ○○
○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_P (m, 1949, H)
■■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
oje
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
○
○
○
○
○
○
○
○○
○
○
○
○
○
2500 1500 500
800
600
400
200
ba_B (w, 1978, R)
■■
■
■■
2500 1500 500
800
600
400
200
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
o
i u
je
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○○
○○ ○○○
○○
○○
○○○
○
○
○○ ○○
○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_V (m, 1973, R)
450
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Chocimsk Abb. 103(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
je
a
o
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400
je
a
o
ui
3000 2000 1000
1000
800
600
400 ○
○○ ○○
○○
○ ○○
○
○○
○○○ ○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
ch_P (w, 1939, HW)
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
a
u
ojei
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
○○ ○
○
○ ■
2500 1500 500
1000
800
600
400
200
ch_A (w, 1966, HR)
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
je
a
uo
i
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
○
○○
○
○○○
2000 1500 1000 500
700
600
500
400
300
ch_C (m, 1964, HR)
a
oje
i u
3000 2000 1000
1000
800
600
400
a
oje
i u
3000 2000 1000
1000
800
600
400
○○○
○○
○
○○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
ch_N (w, 1988, R)
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
i
je ou
a
2500 1500 500
600
400
200
○ ○○○
○ ○ ○○
○
○
○
○
■■
2500 1500 500
600
400
200
ch_R (m, 1979, HR)
451
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Minsk Abb. 104(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
u
o
a
jei
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
u
o
a
jei
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
■ ■○ ○○○
○○
○
○○ ○
○
3000 2000 1000
1000
800
600
400
200
mi_V (w, 1921, HW)
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
ije o
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
○○○○○
○○
○○
○
○○
○
○○
○
○
○
■
■
■
2500 1500 500
900
700
500
300
mi_A (w, 1954, H)
a
i
o
uje
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
a
i
o
uje
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○○ ○
○○
○○ ○ ○■
■
■
2500 2000 1500 1000 500
800
600
400
200
mi_B (m, 1959, HR)
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
ui
je
a
o
2500 1500 500
1000
600
400
200
○
○○
○○
○
○
○
○
○ ○■
2500 1500 500
1000
600
400
200
mi_F (w, 1987, R)
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ouje
a
i
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
○○○
○○○○
○ ○○○
○
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
mi_Y (m, 1984, R)
452
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Rahačoŭ Abb. 105(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
600
400
200
a
oje
ui
3000 2000 1000
1000
600
400
200
○○
○
○○
○
○■
3000 2000 1000
1000
600
400
200
ra_B (w, 1936, HW)
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
je
i
a
u
o
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
○
○○
○○
○
○
○○
○ ○○○ ○○ ○○○
○
○
2500 2000 1500 1000 50090
070
050
030
0
ra_D (m, 1932, H)
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
600
400
200
i
a
je ou
3000 2000 1000
1000
600
400
200
○ ○○○○○ ○○ ○ ○○
○
○○
○
3000 2000 1000
1000
600
400
200
ra_L (w, 1957, H)
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
i u
a
oje
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○
○
○
○○ ○
○
○○○○
○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ra_S (m, 1957, HW)
je oui
a
3000 2000 1000
1000
600
400
200
je oui
a
3000 2000 1000
1000
600
400
200
○○○○○○
○
○○ ○ ○○○○
○
○○
3000 2000 1000
1000
600
400
200
ra_A (w, 1987, HR)
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
a
je o
i u
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
○ ○○○ ○○
○○○○○
○■■ ■■
2500 2000 1500 1000 500
700
500
300
ra_C (m, 1980, R)
453
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Šarkoŭščyna Abb. 106(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
o
i
je
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
○
○
○
3000 2000 1000
1200
800
400
sa_M (w, 1956, HW)
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
i u
a
je o
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○○○
○
○○
○ ○
○○
○○○
○
○○ ○○○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_T (m, 1956, HW)
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
ije u
o
a
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
○○○
○○○○
○ ○
○ ○○○○ ○
3000 2000 1000 500
900
700
500
300
sa_I (w, 1977, HR)
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
jei
o
a
u
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○○
○○
○ ○
○○
○○
○○○○○○
○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sa_N (w, 1989, HR)
454
(Jakanje2), unterschieden nach zugrunde liegendem Phonem, Smarhonʼ Abb. 107(○=Realisierungen von /e/ und /o/, ■=Realisierungen von /a/)
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
a
oje
i u
3000 2000 1000 500
1200
800
400
○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○
○○
○
■
3000 2000 1000 500
1200
800
400
sm_A (w, 1962, H)
a
uoje
i
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
a
uoje
i
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
○
○○○
2500 2000 1500 1000 500
900
700
500
300
sm_B (m, 1961, HW)
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
oje
i
a
u
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
○○ ○
3000 2000 1000 500
1000
600
400
200
sm_C (w, 1967, HW)
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
a
je o
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
○
○
○○○
○
○○
○○
○○○ ○
○
○ ○○○○
○
2500 1500 500
800
600
400
200
sm_AF (m, 1979, H)
455
II. Zu Kapitel 6: Sibilanten
Zur Dauer von (tʲ) und (dʲ) a.
Durchschnittliche Dauer von (tʲ) und (dʲ) Tab. 126
Sprecher Dauer (tʲ) n (tʲ) Dauer (dʲ) n (dʲ) ak_B 0,061 31 0,049 16 ak_D 0,060 26 0,044 11 ak_M 0,053 23 0,042 35 ak_P 0,048 24 0,028 34 ak_Q 0,083 12 0,061 9 ba_A 0,064 7 0,045 17 ba_B 0,058 16 0,049 13 ba_O k.A. -- k.A. -- ba_P 0,066 19 0,037 20 ba_V 0,064 24 0,029 21 ch_A 0,072 30 0,043 16 ch_C 0,097 22 0,055 10 ch_N 0,105 26 0,065 26 ch_P 0,078 22 0,050 27 ch_R 0,080 31 0,047 22 mi_A 0,051 23 0,038 26 mi_B 0,045 21 0,038 9 mi_F 0,060 26 0,032 19 mi_V 0,049 34 0,040 41 mi_Y 0,071 23 0,058 23 ra_A 0,084 24 0,055 28 ra_B 0,076 27 0,044 12 ra_C 0,068 25 0,044 22 ra_D 0,065 33 0,049 14 ra_L 0,090 30 0,056 19 ra_S 0,057 23 0,040 15 sa_I 0,081 28 0,040 30 sa_M k.A. (3) k.A. (2) sa_N 0,079 37 0,046 28 sa_T 0,075 23 0,051 30 sm_A 0,050 51 0,038 39 sm_AF 0,076 22 0,047 21 sm_B 0,054 18 0,036 11 sm_C 0,060 13 0,042 12 Ø (ohne sa_M): 24,8 21,1
456
Gravitationszentren der Sibilanten b.
Absolute durchschnittliche Gravitationszentren (CoG-Werte) im ersten, zweiten und Tab. 127dritten Drittel des Lautes für /s/
Sprecher CoG-Wert 1 CoG-Wert 2 CoG-Wert 3 n ak_B 5908 6074 6158 23 ak_D 6277 6705 6710 49 ak_M 6260 6431 6402 46 ak_P 5993 6021 6102 47 ak_Q 5846 6033 6053 32 ba_A 6242 6424 6365 28 ba_B 6412 6662 6683 29 ba_O k.A. k.A. k.A. -- ba_P 6073 6147 6179 32 ba_V 6231 6358 6359 39 ch_A 6225 6450 6368 36 ch_C 6161 6392 6402 33 ch_N 6590 6874 6900 59 ch_P 6105 6546 6627 33 ch_R 6287 6563 6573 43 mi_A 6046 6259 6317 31 mi_B 6181 6331 6353 28 mi_F 6116 6451 6550 38 mi_V 6095 6229 6271 33 mi_Y 6057 6380 6421 30 ra_A 6211 6502 6585 50 ra_B 6187 6522 6633 46 ra_C 6154 6676 6782 36 ra_D k.A. k.A. k.A. -- ra_L 6171 6549 6620 46 ra_S 5967 6193 6281 33 sa_I 6724 7232 7242 50 sa_M k.A. k.A. k.A. -- sa_N 6540 6954 6976 44 sa_T 6043 6255 6405 46 sm_A 5970 6003 6044 43 sm_AF 6304 6731 6772 32 sm_B 5988 6173 6167 32 sm_C 6247 6648 6749 22 Ø: 37,7
457
Absolute durchschnittliche Gravitationszentren (CoG-Werte) im ersten, zweiten und Tab. 128dritten Drittel des Lautes für /ʂ/
Sprecher CoG-Wert 1 CoG-Wert 2 CoG-Wert 3 n ak_B 5690 5650 5677 42 ak_D 5948 6147 6176 36 ak_M 5930 5867 5883 49 ak_P 5784 5860 5892 30 ak_Q 5566 5545 5506 21 ba_A 5984 6020 6011 17 ba_B 5999 6076 6085 19 ba_O k.A. k.A. k.A. -- ba_P 5899 5895 5916 32 ba_V 5930 5930 5882 27 ch_A 5918 6037 6022 32 ch_C 5943 6027 6020 26 ch_N 6126 6292 6337 43 ch_P 5749 5894 5938 31 ch_R 6002 6030 6043 24 mi_A 5760 5862 5855 35 mi_B 5832 5841 5773 27 mi_F 5945 6093 6089 26 mi_V 6027 5973 5998 25 mi_Y 5743 5833 5803 29 ra_A 5897 6038 6057 42 ra_B 5788 5891 5971 28 ra_C 5871 6085 6146 37 ra_D 5714 5691 5710 26 ra_L 5809 5913 5969 57 ra_S 5855 5890 5998 25 sa_I 6109 6377 6444 35 sa_M k.A. k.A. k.A. -- sa_N 6049 6188 6205 30 sa_T 5980 5946 5950 40 sm_A 5712 5766 5778 49 sm_AF 5996 6128 6150 36 sm_B 5734 5735 5735 19 sm_C 5789 5755 5848 21 Ø: 31,9
458
Absolute und normalisierte durchschnittliche Gravitationszentren (CoG-Werte) im Tab. 129ersten, zweiten und dritten Drittel des Lautes für (sʲ)
CoG-Wert absolut CoG-Wert normalisiert Sprecher 1 2 3 1 2 3 n ak_B 5881 5926 5948 0,76 0,30 0,13 42 ak_D 6156 6574 6623 0,26 0,53 0,67 34 ak_M 6053 6064 6089 -0,25 -0,30 -0,20 56 ak_P 5837 5871 5890 -0,50 -0,86 -1,02 37 ak_Q 5725 5813 5882 0,13 0,10 0,37 20 ba_A 6204 6360 6359 0,71 0,68 0,97 28 ba_B 6203 6431 6448 -0,02 0,21 0,21 22 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 5961 5977 5962 -0,29 -0,35 -0,65 44 ba_V 6242 6344 6271 1,07 0,93 0,63 23 ch_A 6094 6319 6345 0,15 0,37 0,87 31 ch_C 5953 6253 6222 -0,91 0,24 0,06 26 ch_N 6367 6764 6817 0,04 0,62 0,70 46 ch_P 5940 6089 6085 0,08 -0,40 -0,57 28 ch_R 6105 6284 6249 -0,28 -0,05 -0,22 39 mi_A 5935 6029 6038 0,22 -0,16 -0,21 35 mi_B 5976 6106 6126 -0,17 0,08 0,22 37 mi_F 6040 6302 6308 0,11 0,17 -0,05 33 mi_V 6010 6072 6129 -1,52 -0,23 -0,04 44 mi_Y 6157 6460 6480 1,64 1,29 1,19 50 ra_A 6189 6476 6507 0,86 0,89 0,71 39 ra_B 6071 6271 6254 0,42 0,21 -0,14 50 ra_C 6028 6504 6557 0,11 0,42 0,29 40 ra_D k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ra_L 6020 6345 6403 0,17 0,36 0,33 42 ra_S 6004 6155 6187 1,66 0,75 0,34 36 sa_I 6509 6890 6871 0,30 0,20 0,07 26 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N 6274 6577 6536 -0,08 0,02 -0,14 37 sa_T 6065 6008 6076 1,68 -0,60 -0,45 45 sm_A 5816 5947 5954 -0,19 0,53 0,32 77 sm_AF 6059 6231 6196 -0,59 -0,66 -0,85 47 sm_B 5704 5853 5790 -1,23 -0,46 -0,75 25 sm_C 5896 6102 6164 -0,53 -0,22 -0,30 31 Ø: 37,7
459
Absolute und normalisierte durchschnittliche Gravitationszentren (CoG-Werte) im Tab. 130ersten, zweiten und dritten Drittel des Lautes für (tʲ)
Sprecher CoG-Wert absolut CoG-Wert normalisiert 1 2 3 1 2 3 n ak_B 6196 6172 6020 3,64 1,46 0,42 37 ak_D 6445 6633 6606 2,02 0,74 0,61 26 ak_M 6340 6351 6277 1,48 0,72 0,52 22 ak_P 5989 6000 5971 0,96 0,75 -0,25 18 ak_Q 6052 6089 5996 2,47 1,23 0,79 17 ba_A 6288 6429 6341 1,36 1,02 0,87 19 ba_B 6544 6657 6593 1,64 0,98 0,70 20 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 6185 6225 6140 2,28 1,61 0,71 25 ba_V 6304 6465 6383 1,49 1,50 1,10 20 ch_A 6296 6446 6411 1,46 0,98 1,25 39 ch_C 6308 6416 6253 2,35 1,13 0,22 36 ch_N 6703 7018 6903 1,49 1,50 1,01 36 ch_P 6240 6213 6091 1,76 -0,02 -0,56 30 ch_R 6238 6406 6281 0,66 0,41 -0,10 46 mi_A 6034 6143 6154 0,91 0,42 0,29 19 mi_B 6109 6125 6045 0,58 0,16 -0,06 17 mi_F 6473 6632 6497 5,18 2,01 0,77 33 mi_V 6241 6244 6212 5,33 1,11 0,57 52 mi_Y 6417 6621 6530 3,29 1,88 1,35 32 ra_A 6433 6626 6508 2,42 1,54 0,71 40 ra_B 6579 6600 6368 2,97 1,25 0,20 54 ra_C 6264 6635 6634 1,78 0,86 0,53 41 ra_D k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ra_L 6577 6783 6611 3,25 1,74 0,97 44 ra_S 6079 6143 6165 2,99 0,67 0,18 30 sa_I 6848 7054 6910 1,40 0,58 0,17 59 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N 6570 6747 6558 1,12 0,46 -0,08 54 sa_T 6244 6280 6161 7,31 1,16 -0,07 65 sm_A 5994 6018 5998 1,19 1,12 0,65 52 sm_AF k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sm_B 6020 6039 5930 1,25 0,39 -0,10 18 sm_C 6253 6439 6283 1,03 0,53 -0,03 28 Ø: 34,2
460
Absolute und normalisierte durchschnittliche Gravitationszentren (CoG-Werte) im Tab. 131ersten, zweiten und dritten Drittel des Lautes für (dʲ)
Sprecher CoG-Wert absolut CoG-Wert normalisiert 1 2 3 1 2 3 n ak_B 6027 6000 5928 2,10 0,65 0,04 16 ak_D 6240 6284 6248 0,78 -0,51 -0,73 16 ak_M 6186 6220 6179 0,55 0,25 0,14 44 ak_P 5876 5913 5916 -0,12 -0,34 -0,77 39 ak_Q 5959 6040 6010 1,81 1,03 0,84 9 ba_A 6112 6175 6155 0,00 -0,24 -0,19 18 ba_B 6221 6291 6274 0,07 -0,26 -0,37 14 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 6094 6084 6076 1,23 0,50 0,22 20 ba_V 6188 6192 6187 0,72 0,22 0,28 22 ch_A 6135 6216 6290 0,41 -0,13 0,55 18 ch_C 6057 6128 6087 0,05 -0,45 -0,65 10 ch_N 6673 6875 6838 1,36 1,00 0,78 28 ch_P 6002 6025 5961 0,43 -0,60 -0,93 28 ch_R 6073 6051 6014 -0,50 -0,92 -1,11 22 mi_A 5949 5973 5990 0,32 -0,44 -0,41 28 mi_B 6046 6043 6044 0,22 -0,18 -0,06 9 mi_F 6101 6203 6219 0,83 -0,39 -0,44 24 mi_V 6213 6205 6179 4,49 0,81 0,33 41 mi_Y 6324 6478 6431 2,70 1,36 1,04 29 ra_A 6350 6481 6364 1,89 0,91 0,16 32 ra_B 6342 6416 6321 1,78 0,66 0,06 17 ra_C 6218 6435 6463 1,45 0,19 0,00 23 ra_D k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ra_L 6351 6531 6510 2,00 0,94 0,66 20 ra_S 6042 6082 6042 2,34 0,27 -0,69 17 sa_I 6691 6826 6810 0,89 0,05 -0,08 33 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N 6518 6635 6532 0,91 0,17 -0,15 30 sa_T 6183 6223 6182 5,40 0,80 0,02 33 sm_A 5876 5925 5924 0,28 0,34 0,09 44 sm_AF 6135 6132 6187 -0,10 -0,99 -0,88 21 sm_B 5904 5933 5860 0,34 -0,10 -0,42 11 sm_C 5964 6086 6106 -0,24 -0,26 -0,43 13 Ø: 23,6
461
Absolute und normalisierte durchschnittliche Gravitationszentren (CoG-Werte) im Tab. 132ersten, zweiten und dritten Drittel des Lautes für (ʧʲ)
Sprecher CoG-Wert absolut CoG-Wert normalisiert 1 2 3 1 2 3 n ak_B 5801 5748 5640 0,02 -0,54 -1,16 33 ak_D 5976 6090 6070 -0,83 -1,21 -1,40 35 ak_M 5994 5995 5979 -0,61 -0,55 -0,63 32 ak_P 5914 5934 5905 0,24 -0,08 -0,87 39 ak_Q 5578 5669 5626 -0,92 -0,49 -0,56 10 ba_A 6132 6180 6062 0,15 -0,21 -0,71 16 ba_B 6105 6079 6043 -0,49 -0,99 -1,14 17 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 5878 5927 5933 -1,24 -0,75 -0,87 32 ba_V 6054 6011 5984 -0,17 -0,62 -0,57 32 ch_A 5952 6068 6063 -0,78 -0,85 -0,77 28 ch_C 5944 5971 5967 -0,99 -1,31 -1,28 33 ch_N 6214 6340 6330 -0,62 -0,84 -1,03 48 ch_P 5862 5833 5782 -0,36 -1,19 -1,45 33 ch_R 6087 6096 5974 -0,40 -0,76 -1,26 32 mi_A 5874 5862 5854 -0,20 -1,00 -1,00 46 mi_B 5901 5912 5864 -0,60 -0,71 -0,69 27 mi_F 6012 6098 6123 -0,21 -0,97 -0,85 36 mi_V 6147 6148 6110 2,54 0,36 -0,18 28 mi_Y 5810 5789 5780 -0,57 -1,16 -1,08 36 ra_A 6021 6197 6095 -0,22 -0,31 -0,86 49 ra_B 5949 5976 5982 -0,19 -0,73 -0,97 45 ra_C 5895 6009 5974 -0,83 -1,26 -1,54 41 ra_D k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ra_L 5885 5943 5961 -0,58 -0,91 -1,03 46 ra_S 5927 5911 5893 0,28 -0,86 -1,74 27 sa_I 6088 6308 6259 -1,07 -1,16 -1,46 42 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N 6133 6185 6082 -0,66 -1,01 -1,32 45 sa_T 6146 6154 6123 4,23 0,35 -0,24 31 sm_A 5888 5888 5843 0,37 0,03 -0,51 45 sm_AF k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sm_B 5796 5800 5809 -0,51 -0,70 -0,66 27 sm_C 5753 5814 5821 -1,15 -0,87 -1,06 16 Ø: 33,8
462
Formanteneinstiege nach (ʧʲ) c.
Normalisierte durchschnittliche Formanteneinstiege (gemessen nach 20% der Dauer Tab. 133des Vokals) von Vokalen nach (ʧʲ)
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B -0,01 0,12 0,19 0,09 0,87 0,47 26 ak_D -0,74 0,99 -0,76 1,01 0,59 0,73 31 ak_M -0,74 -0,06 -0,73 -0,09 0,49 0,50 24 ak_P -0,30 0,30 -0,32 0,28 0,67 0,55 32 ak_Q k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_A -0,28 0,46 -0,26 0,36 0,75 0,53 44 ba_B -0,25 0,20 -0,37 0,09 0,74 0,70 25 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P -0,39 0,41 -0,46 0,34 0,61 0,47 67 ba_V -0,37 0,96 -0,38 1,07 0,82 0,79 28 ch_A 0,60 0,21 0,47 0,18 0,73 0,47 23 ch_C 0,11 0,10 0,25 0,14 0,95 0,35 19 ch_N -0,39 0,57 -0,51 0,33 0,86 1,03 27 ch_P -0,04 -0,18 -0,25 -0,33 0,83 0,52 24 ch_R -0,03 -0,12 -0,19 0,03 0,92 0,38 24 mi_A -0,23 0,14 -0,35 0,21 0,82 0,56 30 mi_B 0,16 -0,08 0,15 -0,01 0,96 0,59 20 mi_F -0,25 0,82 -0,18 0,85 0,90 0,57 23 mi_V -0,07 0,03 -0,29 -0,03 0,68 0,65 22 mi_Y 0,02 0,38 0,19 0,44 0,80 0,79 21 ra_A -0,11 0,14 -0,15 0,08 0,83 0,88 36 ra_B 0,59 -0,05 0,57 -0,18 0,91 0,58 25 ra_C -0,48 0,86 -0,42 0,86 0,72 0,46 26 ra_D k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ra_L -0,22 0,38 -0,28 0,31 0,82 0,71 27 ra_S -0,18 0,16 -0,11 0,35 0,66 0,73 23 sa_I -0,46 -0,10 -0,58 -0,22 0,97 0,38 21 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N -0,27 0,18 -0,42 0,13 0,80 0,76 27 sa_T -0,33 0,10 -0,28 0,15 0,71 0,39 25 sm_A 0,12 0,15 0,06 0,18 0,66 0,53 28 sm_AF k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sm_B 0,51 -0,12 -0,06 -0,06 1,28 0,49 20 sm_C 0,00 0,04 -0,23 0,02 0,96 0,42 11 Ø: 26,9
463
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Abb. 108Akcjabrski (▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
a
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300
○○
○
○
○
○ ○○○
○○ ○
▼▼
▼
▼▼
▽▽▽▽▽
▲
▲●
●
3000 2000 1000
900
700
500
300
ak_B (w, 1936, HW)
()
a
i u
3000 2000 1000
1000
600
200
▼▼▼▼▼▼▼
▼▼
▲
▲
▲
▲
○○
○ ○○
○
○○○▽ ▽
▽●●
●
3000 2000 1000
1000
600
200
ak_M (w, 1969, H)
() i u
a
2500 1500 500
800
600
400
○○○ ○
○○○○○○
○
○
○
○▼
▼▼
▼▼▼▽▽ ▽
▽▽
▲
▲▲
▲●●●
2500 1500 500
800
600
400
ak_P (m, 1962, H)
()
i
a
u
3000 2000 1000
1000
600
200
○○○○○ ○○○○
○○
○
○○
○
○
○
○
○
○
○○▲
▲▲
▽▽▽ ▽▼▼ ▼
3000 2000 1000
1000
600
200
ak_D (w, 1992, R)
() i u
a
2500 1500 500
800
600
400
200
▼ ▼○○ ▽
2500 1500 500
800
600
400
200
ak_Q (m, 1990, k.A.)
()
464
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Abb. 109Baranavičy (▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
a
ui
3000 2000 1000
900
700
500
300
▼▼▼▼
▼▼
▼▼▼▼▼▼▼
▼▼
○○
○○
○
○○○
○
○○○○
○○ ▽▽▽▽
▽
▽
▽▽
▲
▲▲▲
▲
▲▲ ▲
▲
●●
●●
3000 2000 1000
900
700
500
300
ba_A (w, 1949, HR)
()
a
i u
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
▲▲
▲
▲▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲
▲
▽
▽
▽▽
▽▽
▽▽ ▽
○○○○○○
○○
○
○○○
○
○○
○
○ ○○▼▼ ▼▼▼▼
▼
▼ ▼▼
▼ ▼▼▼
▼
▼ ▼ ●●●●●
●
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_P (m, 1949, H)
()
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲▲
▽ ▽▽▽
▽ ▽▽▼ ▼▼▼▼○○
○
○○
○○○ ●
2500 1500 500
800
600
400
200
ba_B (w, 1978, R)
()
a
i u
2000 1000 500
800
600
400
200
● ●●●
▼
▼
▼▼
▲
▲▲▲
▲
▲ ▲
○○
○○
○
○
○
○○○
▽▽▽
▽
2000 1000 500
800
600
400
200
ba_V (m, 1973, R)
()
465
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Abb. 110Chocimsk (▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
a
ui
3000 2000 1000
1000
600
400
▽
▽▽▽▽
▼
▼
▼▼
▼▼
▼ ▼
▼
▼
▼○○○ ○
▲
▲▲▲
●●●
3000 2000 1000
1000
600
400
ch_P (w, 1939, HW)
()
a
ui
2500 1500 500
1000
600
200
○
○○○○
○○▼
▼
▼ ▼▲
▲▲ ▲▲▲▲
▲
▲
▲
▲▲▲
2500 1500 500
1000
600
200
ch_A (w, 1966, HR)
()
a
ui
2000 1500 1000 500
700
500
300
▽
▽
▽▽
▽▲▲
▲
▲▲▲
▲▲○○○○
●●▼
▼ ▼
2000 1500 1000 500
700
500
300
ch_C (m, 1964, HR)
()
a
i u
3000 2000 1000
1000
600
400
○○○○
○
○○○
▼▼
▼▼
▼
▼
▼▼ ▼▼
▼
▼▼▼
▼ ▼▼▼
▲▲
▲▲
▽▽ ▽
▽
3000 2000 1000
1000
600
400
ch_N (w, 1988, R)
() i u
a
2500 1500 500
600
400
200
▼▼▼
▼▼
▼
▲
▲
▲▲▲▲
▲▲▲
▲
▲
○○
○○ ○ ▽▽▽
2500 1500 500
600
400
200
ch_R (m, 1979, HR)
()
466
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Minsk Abb. 111(▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
u
a
i
3000 2000 1000
1000
600
200
▼▼ ▼▼
▼
○ ○○
○○
○○
○ ○○
●●
▲
▽▽▽▽
3000 2000 1000
1000
600
200
mi_V (w, 1921, HW)
()
i
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
▽▽
▽▽
▼ ▼▼▼
▼ ▼▼
▼
▼▼
○○
○○
○
○
○
○○ ○○○○ ○○▲
▲
▲▲
▲
▲▲
●
2500 1500 500
900
700
500
300
mi_A (w, 1954, H)
()
a
i u
2500 1500 500
800
600
400
200
○
○
○
○○○○○○○
○
○ ●●●▽
▽▽
▽▽
▲
▲
2500 1500 500
800
600
400
200
mi_B (m, 1959, HR)
()
ui
a
2500 1500 500
1000
600
200
●
●●●○○
○
○
○
○
○
○○ ○○○○
▲▲
▲
▲▲ ▲▼
▼
2500 1500 500
1000
600
200
mi_F (w, 1987, R)
()
u
a
i
2500 1500 500
700
500
300
▼▼▼ ▼▼
▼▲
▲▲ ▲
▲▲▲▲▲
▲
○
○
○○
○○ ▽▽
▽
▽
2500 1500 500
700
500
300
mi_Y (m, 1984, R)
()
467
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Abb. 112Rahačoŭ (▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
a
ui
3000 2000 1000
1000
600
200
▲▲▲▲
▲
▲▲▲▲
▲▲▲
▲▲
▼▼
▼▼
▼
▼ ▼
▼▼
▽▽
○
○○
○ ○○
●
3000 2000 1000
1000
600
200
ra_B (w, 1936, HW)
() i
a
u
2500 1500 50090
070
050
030
0
○○
○○○○
▼▼▼
▼▼ ▼▼▼▼ ●
● ●●
▲
▲▲
▲▲▲▲▲
▽
▽
2500 1500 50090
070
050
030
0
ra_D (m, 1932, H)
()
i
a
u
3000 2000 1000
1000
600
200
▼▼ ▼
▼▼▼ ▼●●● ●
○
○
○○○
○○ ○○
○
○ ▽▽ ▽
▽▲▲▲
▲ ▲▲▲
3000 2000 1000
1000
600
200
ra_L (w, 1957, H)
() i u
a
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
▽▽
▽▽▽
○
○
○○○○○○○○ ○
▲
▲▲
●● ●
▼▼▼
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ra_S (m, 1957, HW)
()
ui
a
3000 2000 1000
1000
600
200
▼
▼▼▼▼▼▼
▼○
○○ ○○○
○○○
○○ ○○○
○ ○○
○○
▲
▲▲▲▲
▲
▲
▲
●●●
▽
▽▽
▽
▽
3000 2000 1000
1000
600
200
ra_A (w, 1987, HR)
()
a
i u
2500 1500 500
700
500
300
▼▼▼▼
▼▼▼
▼
▼
○
○○ ○○○
○○
○▲▲
▲
▲
▲▲▲▲▲ ▽▽
2500 1500 500
700
500
300
ra_C (m, 1980, R)
()
468
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Abb. 113Šarkoŭščyna (▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
i
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400 ▽
▽○
○ ○
3000 2000 1000
1200
800
400
sa_M (w, 1956, HW)
() i u
a
2500 1500 500
900
700
500
300
○
○○ ○○○
○○
○ ○○○
○○
●● ●●
▽▽▽
▽
▼▼
▼
▼ ▼
2500 1500 500
900
700
500
300
sa_T (m, 1956, HW)
()
i u
a
3000 2000 1000
900
700
500
300 ○
○
○○
○
○○○
○
○
○
○
▽
▽
▽▽
▽
▽▼
▼
▲▲
● ●
●
3000 2000 1000
900
700
500
300
sa_I (w, 1977, HR)
()
i
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
○○
○○
○
○○○
○
○
○
○
○ ○
○
○▲
▲▲▲ ▲
▼▼
▼▼ ▼ ●
●
▽▽▽
▽
2500 1500 500
900
700
500
300
sa_N (w, 1989, HR)
()
469
Formanteneinstiege von Vokalen nach (ʧʲ), unterschieden nach Vokalphonem, Abb. 114Smarhonʼ (▼=/i/, ○=/e/, ▲=/a/, ▽=/o/, ●=/u/)
a
i u
3000 2000 1000
1200
800
400
○
○○
○
○
○
○ ○
○○○
○
○
○
○ ○○ ○ ○○
▲
▲
▲
▲▲▲
▼
▼▼
▼▼
▽
▽
▽
▽▽
3000 2000 1000
1200
800
400
sm_A (w, 1962, H)
()
a
ui
2500 1500 500
900
700
500
300
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▽▽
▽
○○○○ ○ ○○▼▼▼
●●
2500 1500 500
900
700
500
300
sm_B (m, 1961, HW)
()
i
a
u
3000 2000 1000
1000
600
200
○○
○
○○
▼
▼
▼▽
▲▲▲
▲
▲
3000 2000 1000
1000
600
200
sm_C (w, 1967, HW)
()
a
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
▼▼▼▼
▼
▼▼ ○
○○○○ ○○
○○○○
○○○
○
▲▲
▲▲
▲▲▲▲
▲
▲
▲ ▽▽▽
▽▽
2500 1500 500
800
600
400
200
sm_AF (m, 1979, H)
()
470
III. Zu Kapitel 7: (rʲ)
Normalisierte durchschnittliche Realisierungen von (rʲ) Tab. 134
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B -0,18 0,16 -0,03 0,26 0,85 0,51 16 ak_D -0,47 0,76 -0,70 0,68 0,79 0,40 17 ak_M -0,06 -0,18 -0,25 -0,26 0,68 0,28 24 ak_P 0,15 -0,11 0,08 -0,12 0,82 0,36 34 ak_Q -0,64 0,46 -0,69 0,54 0,45 0,46 11 ba_A -0,08 0,10 -0,11 0,07 0,75 0,51 44 ba_B 0,00 -0,04 -0,03 -0,10 0,76 0,42 18 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P -0,12 -0,05 -0,38 -0,06 0,72 0,43 39 ba_V -0,41 0,40 -0,52 0,43 0,34 0,59 19 ch_A -0,12 0,38 -0,07 0,36 0,52 0,50 21 ch_C -0,31 0,39 -0,28 0,35 0,78 0,29 35 ch_N -0,73 0,85 -0,71 0,73 0,53 0,40 15 ch_P -0,18 0,59 -0,26 0,56 0,75 0,42 33 ch_R -0,39 0,53 -0,43 0,56 0,85 0,41 20 mi_A -0,11 0,09 -0,16 0,13 0,75 0,32 21 mi_B -0,09 0,07 -0,02 0,09 0,54 0,40 24 mi_F -0,62 0,64 -0,59 0,63 0,41 0,50 25 mi_V 0,21 0,03 0,16 0,04 0,61 0,33 20 mi_Y -0,27 -0,01 -0,21 -0,03 0,63 0,39 34 ra_A -0,29 0,29 -0,23 0,29 0,63 0,42 35 ra_B -0,27 -0,01 -0,35 -0,04 0,61 0,38 13 ra_C -0,41 0,52 -0,32 0,54 0,58 0,34 36 ra_D -0,33 0,15 -0,33 0,07 0,32 0,30 26 ra_L -0,10 0,14 -0,19 0,12 0,68 0,43 41 ra_S -0,61 0,16 -0,60 0,27 0,41 0,33 21 sa_I 0,07 0,13 0,04 0,11 0,89 0,40 58 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N -0,39 -0,27 -0,50 -0,31 0,69 0,42 17 sa_T 0,03 -0,18 -0,09 -0,30 0,49 0,35 22 sm_A 0,49 0,11 0,57 0,11 0,59 0,34 28 sm_AF -0,26 0,09 -0,26 0,14 0,50 0,44 18 sm_B 0,27 0,00 -0,05 0,04 0,83 0,42 16 sm_C k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- Ø: Ø ohne Chocimsk:
25,8 26,0
471
Normalisierte durchschnittliche Realisierungen von (r) Tab. 135
Sprecher Ø F1 Ø F2 Median F1 Median F2 σ F1 σ F2 n ak_B -0,07 -0,15 0,00 -0,15 0,67 0,39 25 ak_D -0,09 -0,42 -0,24 -0,40 0,61 0,30 19 ak_M 0,17 -0,34 0,09 -0,33 0,81 0,33 25 ak_P 0,30 -0,39 0,25 -0,49 0,84 0,57 51 ak_Q 0,43 -0,25 0,42 -0,32 0,50 0,43 16 ba_A 0,25 -0,13 0,18 -0,16 0,82 0,37 93 ba_B 0,17 -0,43 0,10 -0,52 0,62 0,45 63 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- ba_P 0,03 -0,31 0,05 -0,35 0,58 0,41 80 ba_V 0,24 -0,46 0,25 -0,42 0,59 0,31 49 ch_A 0,55 -0,24 0,59 -0,17 0,49 0,26 25 ch_C 0,49 -0,11 0,57 -0,06 1,06 0,36 29 ch_N 0,11 0,22 0,05 0,22 0,82 0,38 46 ch_P 0,35 -0,23 0,33 -0,24 0,62 0,28 26 ch_R -0,09 -0,13 -0,03 -0,13 0,90 0,48 24 mi_A 0,24 -0,29 0,34 -0,41 0,45 0,45 22 mi_B 0,47 -0,34 0,40 -0,44 0,83 0,28 23 mi_F -0,02 -0,36 -0,17 -0,45 0,59 0,46 33 mi_V 0,16 -0,33 0,17 -0,38 0,51 0,34 24 mi_Y 0,30 -0,30 0,37 -0,23 0,51 0,36 21 ra_A 0,16 -0,04 0,11 -0,07 0,54 0,30 35 ra_B -0,13 -0,33 -0,10 -0,33 0,79 0,29 27 ra_C 0,28 -0,01 0,12 -0,05 1,38 0,38 48 ra_D -0,12 -0,32 -0,11 -0,38 0,47 0,35 16 ra_L 0,08 -0,30 0,00 -0,37 0,55 0,38 38 ra_S -0,31 -0,13 -0,35 -0,06 0,36 0,27 20 sa_I 0,17 -0,19 0,16 -0,21 0,83 0,27 40 sa_M k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- sa_N 0,01 -0,17 0,06 -0,23 0,82 0,49 32 sa_T -0,07 -0,33 -0,07 -0,33 0,62 0,44 47 sm_A 0,57 -0,23 0,55 -0,20 0,71 0,30 33 sm_AF 0,32 -0,35 0,29 -0,33 0,45 0,43 43 sm_B 0,16 -0,33 0,15 -0,34 0,53 0,33 15 sm_C k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -- Ø: Ø ohne Chocimsk:
35,1 36,1
472
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Akcjabrski Abb. 115
a
i u
3000 2000 1000
900
700
500
300 ■
■
■ ■■
■■■■
■■■■■
■
■○○
○
○○○
○○○
○○○○
○ ○○○
○○ ○○
○
○○○
3000 2000 1000
900
700
500
300
ak_B (w, 1936, HW)
()
a
i u
3000 2000 1000
1000
600
200
○○
○○
○
○○○
○○ ○
○
○○○
○
○○○
○
○○○○
○
■■ ■■■■ ■
■■
■■■■■■■■
■
■■
■■■■
3000 2000 1000
1000
600
200
ak_M (w, 1969, H)
() i u
a
2500 1500 500
800
600
400
■
■
■■■ ■■■■■■
■■■
■
■
■
■ ■■■■
■■ ■■■
■
■
■■
■
■■○
○○○○○
○○
○○
○
○○○○ ○○○
○○
○○○
○
○
○○
○○○
○○○
○○
○○
○○
○○○ ○○
○
○○○
○
○○
2500 1500 500
800
600
400
ak_P (m, 1962, H)
()
i
a
u
3000 2000 1000
1000
600
200
○○○○○○○○
○
○
○
○ ○○ ○
○○
○
○
■
■■
■■
■■■
■■■■■■■
■■
3000 2000 1000
1000
600
200
ak_D (w, 1992, R)
() i u
a
2500 1500 500
800
600
400
200
○○
○○
○
○○○○
○○
○○○○ ○
■■■
■
■■■■■ ■ ■
2500 1500 500
800
600
400
200
ak_Q (m, 1990, k.A.)
()
473
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Baranavičy Abb. 116
a
ui
3000 2000 1000
900
700
500
300
○
○
○
○
○○○○
○ ○○○○
○
○
○
○
○
○
○○
○○
○
○○○○ ○
○○○○
○
○○○○ ○○
○ ○○○○○○○
○○○○○○○○○○○
○
○
○○
○ ○○○○○○
○○
○○○
○○
○○
○
○○ ○○
○○
○○ ○○○○○■
■
■
■
■■
■
■■■
■
■
■■■■
■■
■■■
■■ ■■■■■■■ ■
■■■■
■
■
■
■■■■ ■■
3000 2000 1000
900
700
500
300
ba_A (w, 1949, HR)
()
a
i u
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
■■■■■■■■
■■■
■
■ ■
■
■■
■■
■
■■
■■■
■
■■■
■■■ ■■■ ■■
■■ ○
○
○○○○ ○
○○○ ○○○○○○○○○○○○
○○○ ○○○○○
○○○
○ ○
○
○○○○○
○○○○
○○ ○○○
○○○
○○
○○
○
○
○
○○○○○ ○○○○
○○○○ ○○○○
○
○
○
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ba_P (m, 1949, H)
()
a
ui
2500 1500 500
800
600
400
200
○
○○
○○
○
○○
○
○
○○
○
○○○
○○ ○○○○
○
○ ○○○
○ ○○ ○○○○
○○○○○ ○○
○○○○○
○○
○
○
○○
○○○
○○
○○
○○
○
○
■
■
■
■ ■
■■
■■■■
■
■■■
■
■■
2500 1500 500
800
600
400
200
ba_B (w, 1978, R)
()
a
i u
2000 1000 500
800
600
400
200
○○○
○
○
○ ○○○
○
○
○○○
○○
○
○○
○○
○
○
○○
○○
○○○
○○
○○○○
○○○
○
○
○○ ○
○
○
○○
○■
■■■
■■ ■■■■
■■■■
■■
■■
■
2000 1000 500
800
600
400
200
ba_V (m, 1973, R)
()
474
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Chocimsk Abb. 117
a
ui
3000 2000 1000
1000
600
400
○
○○
○
○ ○○○○
○
○○○○
○○
○○ ○○○
○○○○
○■
■
■
■
■■ ■
■
■
■ ■■
■■
■
■
■
■
■■
■ ■■■■
■
■■ ■
■■■■
3000 2000 1000
1000
600
400
ch_P (w, 1939, HW)
()
a
ui
2500 1500 500
1000
600
200
■
■ ■■■■■■
■■■ ■■■■■ ■■
■■■
○○○
○
○○○○○○ ○
○○○
○ ○○
○○
○○○○
○○
2500 1500 500
1000
600
200
ch_A (w, 1966, HR)
()
a
ui
2000 1500 1000 500
700
500
300
○○
○○
○
○○
○○
○○○
○
○
○ ○
○
○○
○
○
○○○○
○
○ ○
○
■
■■
■ ■■■
■ ■
■■
■
■
■■
■■
■
■■■■■■
■■
■■ ■■■■■■■
2000 1500 1000 500
700
500
300
ch_C (m, 1964, HR)
()
a
i u
3000 2000 1000
1000
600
400
■
■■■■■■■■■
■
■
■■
■○○○○○○
○
○○
○○
○
○
○○
○
○○
○
○○○○
○
○
○○○○
○
○
○○
○○○
○○
○
○
○
○○
○○○
3000 2000 1000
1000
600
400
ch_N (w, 1988, R)
() i u
a
2500 1500 500
600
400
200
○
○○○
○
○○○
○○○
○
○○○
○
○○ ○○○
○
○
■■■■
■
■
■
■■■■
■
■
■■■
■■
■■
2500 1500 500
600
400
200
ch_R (m, 1979, HR)
()
475
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Minsk Abb. 118
u
a
i
3000 2000 1000
1000
600
200
○○
○○○○○
○○
○○ ○○○○
○
○
○
○ ○○
○○○■
■
■■
■ ■■■■■■■
■■■
■■
■■
■
3000 2000 1000
1000
600
200
mi_V (w, 1921, HW)
()
i
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
■
■■ ■■
■
■
■
■■■■
■■■
■■■■■■ ○○
○ ○○○○
○ ○○○○
○
○ ○○○
○
○ ○○○
2500 1500 500
900
700
500
300
mi_A (w, 1954, H)
()
a
i u
2500 1500 500
800
600
400
200
■■■
■■■
■■■ ■■■
■■■■
■■■■■
■
■■
○○○○
○○○○○○
○
○○ ○
○○○
○
○○
○
○○
2500 1500 500
800
600
400
200
mi_B (m, 1959, HR)
()
ui
a
2500 1500 500
1000
600
200
○○○
○○○○○○
○
○
○
○ ○○○ ○○○○○
○
○○○
○○○○○○
○○
■
■■
■ ■ ■■ ■ ■■
■■ ■■
■■■
■ ■
■■■■ ■■
2500 1500 500
1000
600
200
mi_F (w, 1987, R)
()
u
a
i
2500 1500 500
700
500
300
○○ ○○
○
○○○ ○○○○
○○
○○ ○○○○
○■■
■■■ ■■■■
■■ ■■■■■
■■■
■
■■ ■■■ ■■ ■■■■
■■
■
2500 1500 500
700
500
300
mi_Y (m, 1984, R)
()
476
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Rahačoŭ Abb. 119
a
ui
3000 2000 1000
1000
600
200
■ ■
■
■■
■
■
■■
■■■■○○
○
○
○
○
○
○
○○○○○○
○
○
○
○ ○
○
○○○
○
○
○
○
3000 2000 1000
1000
600
200
ra_B (w, 1936, HW)
() i
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
○○○ ○○ ○
○○○
○○
○ ○○
○ ○■■■■■■■ ■■
■■■■
■■■■
■■■ ■
■■■■
■
2500 1500 500
900
700
500
300
ra_D (m, 1932, H)
()
i
a
u
3000 2000 1000
1000
600
200
○○○ ○○ ○
○
○○
○ ○○
○
○○○
○○○
○○○○
○○
○○○○ ○○○○
○
○○
○○
■ ■
■
■■■
■
■■■
■■
■■
■■■■
■
■
■■
■■ ■■
■
■■
■■
■
■
■
■■■■■ ■■
3000 2000 1000
1000
600
200
ra_L (w, 1957, H)
() i u
a
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
○○ ○○○○○○
○
○○○○
○○○○○○○
■■■
■
■■
■
■■■■■ ■■ ■■■■■
■■
2000 1500 1000 500
800
600
400
200
ra_S (m, 1957, HW)
()
ui
a
3000 2000 1000
1000
600
200
■■■■
■
■ ■
■■ ■■ ■
■■■■■■■■
■■
■■
■■
■
■
■■■■
■■ ■○○
○○
○○○○ ○○○○○○ ○○○○○
○○○○○
○
○
○○
○○○○○
○○
3000 2000 1000
1000
600
200
ra_A (w, 1987, HR)
()
a
i u
2500 1500 500
700
500
300
○○○
○○
○ ○
○
○ ○○
○○
○
○○○
○○○
○
○○○○
○
○
○
○○ ○○○○○
○
○
○
○
○
○
○○○○
■ ■
■■
■
■■
■■
■■
■■
■■■■■
■
■■■■
■■■■
■■
■■ ■
■■■
■
2500 1500 500
700
500
300
ra_C (m, 1980, R)
()
477
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Šarkoŭščyna Abb. 120
i
a
u
3000 2000 1000
1200
800
400
■■■○○
○○
○○
○○
3000 2000 1000
1200
800
400
sa_M (w, 1956, HW)
() i u
a
2500 1500 500
900
700
500
300
■■■■
■■■
■■■
■ ■
■■■■■■■
■
■
■
○○○○
○
○○
○
○○○
○○ ○○○
○
○
○ ○○
○
○
○
○
○
○○○ ○○
○○
○○
○○○○○○○○ ○
○○ ○
2500 1500 500
900
700
500
300
sa_T (m, 1956, HW)
()
i
a
u
2500 1500 500
900
700
500
300
■■
■■■■■
■■■ ■
■■ ■
■■
■○○ ○
○
○
○
○
○○
○○○ ○
○○○
○ ○○○
○○
○○○
○
○
○○
○○
○
2500 1500 500
900
700
500
300
sa_N (w, 1989, HR)
() i u
a
3000 2000 1000
900
700
500
300
○○○○○
○
○
○ ○
○○
○○○
○○○
○○
○
○
○
○
○
○
○○
○
○○
○○○○○○
○○○
○■
■■
■■■
■■
■
■■■■
■
■■
■
■
■■
■
■
■■
■■
■■
■
■■
■■■
■■■ ■
■■■■
■■
■ ■■
■■
■
■
■
■
■
■
■■
■
3000 2000 1000
900
700
500
300
sa_I (w, 1977, HR)
()
478
(rʲ) (=■) vs. (r) (=○), Smarhonʼ Abb. 121
a
i u
3000 2000 1000
1200
800
400
○
○
○○
○○○○
○○
○
○○
○○ ○○
○○○○○ ○
○○
○
○
○
○○
○
○○
■ ■
■
■■
■
■
■■■■
■ ■
■■ ■
■
■
■■■ ■
■
■
■■
■■
3000 2000 1000
1200
800
400
sm_A (w, 1962, H)
()
a
ui
2500 1500 500
900
700
500
300
○○○○○○ ○○
○○
○○
○
○○
■■
■
■■ ■
■ ■■
■■
■■■
■■
2500 1500 500
900
700
500
300
sm_B (m, 1961, HW)
()
i
a
u
3000 2000 1000
1000
600
200
■
■■
■■
■■ ■○○○
○
○○
○
3000 2000 1000
1000
600
200
sm_C (w, 1967, HW)
()
a
iu
2500 1500 500
800
600
400
200
○ ○○○○
○○○
○○○ ○○○○○○○○○○
○○○ ○○
○○○
○
○
○○
○○○
○○○○○
○ ○■■■
■
■■■■ ■■■
■■■■■■
■
2500 1500 500
800
600
400
200
sm_AF (m, 1979, H)
()
479
IV. Zu Kapitel 8: (g)
Anteil plosiver Realisierungen von (g) Tab. 136
Sprecher Anzahl plosiver Realisierungen
Anzahl frikativer Realisierungen
Anteil plosiver Realisierungen (%)
n
ak_B 0 111 0 111 ak_D 18 21 46,2 39 ak_M 9 127 6,6 136 ak_P 1 246 0,4 247 ak_Q 0 32 0 32 ba_A 10 486 2,0 496 ba_B 56 215 20,7 271 ba_O 1 15 6,3 16 ba_P 1 290 0,3 291 ba_V 22 70 23,9 92 ch_A 0 453 0 453 ch_C 0 207 0 207 ch_N 3 143 2,1 146 ch_P 0 106 0 106 ch_R 0 233 0 233 mi_A 16 599 2,6 615 mi_B 2 63 3,1 65 mi_F 58 38 60,4 96 mi_V 6 135 4,3 141 mi_Y 1 47 2,1 48 ra_A 0 130 0 130 ra_B 0 96 0 96 ra_C 0 54 0 54 ra_D 0 91 0 91 ra_L 0 607 0 607 ra_S 0 151 0 151 sa_I 20 272 6,8 292 sa_M 10 155 6,1 165 sa_N 7 321 2,1 328 sa_T 10 247 3,9 257 sm_A 78 911 7,9 989 sm_AF 54 503 9,7 557 sm_B 5 77 6,1 82 sm_C 9 51 15,0 60 Ø: 226,5
480
V. Zu Kapitel 9: (v)
Anteil frikativer Realisierungen von (v) Tab. 137
Sprecher Anzahl frikativer Realisierungen
Anzahl vokalischer Realisierungen
Anteil frikativer Realisierungen (%)
n
ak_B 0 23 0 23 ak_D 17 1 94,4 18 ak_M 7 44 13,7 51 ak_P 46 107 30,1 153 ak_Q 1 9 10,0 10 ba_A 121 132 47,8 253 ba_B 143 31 82,2 174 ba_O 0 11 0 11 ba_P 36 139 20,6 175 ba_V 70 17 80,5 87 ch_A 52 256 16,9 308 ch_C 4 115 3,4 119 ch_N 55 76 42,0 131 ch_P 2 42 4,5 44 ch_R 15 200 7,0 215 mi_A 114 288 28,4 402 mi_B 9 36 20,0 45 mi_F 82 5 94,3 87 mi_V 3 31 8,8 34 mi_Y 31 7 81,6 38 ra_A 33 15 68,8 48 ra_B 2 66 2,9 68 ra_C 42 5 89,4 47 ra_D 39 44 47,0 83 ra_L 90 309 22,6 399 ra_S 9 93 8,8 102 sa_I 45 117 27,8 162 sa_M 5 72 6,5 77 sa_N 43 159 21,3 202 sa_T 1 129 0,8 130 sm_A 40 218 15,5 258 sm_AF 183 201 47,7 384 sm_B 8 32 20,0 40 sm_C 7 40 14,9 47 Ø: 130,1
481
VI. Zu Kapitel 10: Phonische Variation
10.2 Variation a.
Kennzahlen der Sprecher für die Analysen in den Abschnitten 10.2, 10.5 und 10.6 Tab. 138(erster Teil). Für (Akanje1) und (Akanje2): die euklidische Distanz zu /a/ /C0_; für (Jakanje1), (Jakanje2), (ʧʲ) und (rʲ): die euklidische Distanz zu /i/ /Cʲ_
Sprecher Ak1 Ak2 Jak1 Jak2 (rʲ) (ʧʲ) ak_B 0,61 0,73 1,76 0,29 1,27 1,41 ak_D 1,46 1,44 0,25 0,71 0,59 0,27 ak_M 1,37 1,38 0,64 0,36 1,45 1,18 ak_P 1,22 1,33 0,82 0,98 1,77 1,19 ak_Q 1,27 1,47 0,66 k.A. 0,84 k.A. ba_A 0,72 1,31 0,93 0,64 1,44 1,03 ba_B 1,24 1,36 0,96 1,06 1,61 1,27 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. ba_P 0,91 1,41 1,01 0,65 1,56 1,02 ba_V 1,01 1,16 0,39 0,39 0,98 0,57 ch_A 0,39 1,29 1,11 0,89 k.A. 1,78 ch_C 0,45 1,00 1,27 0,78 k.A. 1,67 ch_N 1,17 1,59 0,20 0,56 k.A. 0,81 ch_P 0,57 1,23 1,45 0,16 k.A. 1,62 ch_R 1,05 1,35 0,30 0,30 k.A. 1,48 mi_A 0,65 1,52 1,24 0,43 1,26 1,16 mi_B 0,60 0,82 1,19 0,99 1,46 1,73 mi_F 1,38 1,49 0,60 0,29 0,69 0,78 mi_V 0,72 1,66 1,30 0,60 1,65 1,49 mi_Y 0,72 1,48 0,60 1,00 1,61 1,49 ra_A 1,10 1,45 0,74 0,70 1,15 1,38 ra_B 0,64 1,31 1,61 0,62 1,21 1,70 ra_C 0,62 1,40 0,97 0,98 1,12 0,82 ra_D 1,06 1,44 1,08 0,55 1,27 1,10 ra_L 0,84 1,59 0,96 0,65 1,36 1,09 ra_S 0,71 1,53 1,33 0,26 1,15 1,31 sa_I 0,84 1,97 1,33 0,36 1,43 1,42 sa_M 0,77 1,76 1,65 k.A. k.A. k.A. sa_N 1,11 1,61 1,26 0,27 1,66 1,30 sa_T 0,63 1,60 1,81 0,92 1,80 1,36 sm_A 0,53 1,12 1,35 0,78 1,70 1,40 sm_AF 0,92 1,45 1,32 0,71 1,57 1,61 sm_B 1,15 1,76 0,95 k.A. 1,69 1,93 sm_C 0,62 1,39 0,91 k.A. k.A. 1,26
482
Kennzahlen der Sprecher für die Analysen in den Abschnitten 10.2, 10.5 und 10.6 Tab. 139(zweiter Teil). Für (sʲ), (tʲ) und (dʲ): der normalisierte CoG-Wert; für (v) und (g): die relative Häufigkeit der ‚russischen‘ Realisierung
Sprecher (sʲ) (tʲ) (dʲ) (g) (v) ak_B 0,30 0,42 0,65 0,00 3,85 ak_D 0,53 0,61 -0,51 0,46 90,91 ak_M -0,30 0,52 0,25 0,07 13,33 ak_P -0,86 -0,25 -0,34 0,00 31,25 ak_Q 0,10 0,79 1,03 0,00 10,00 ba_A 0,68 0,87 -0,24 0,02 47,50 ba_B 0,21 0,70 -0,26 0,21 81,82 ba_O k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. ba_P -0,35 0,71 0,50 0,00 19,69 ba_V 0,93 1,10 0,22 0,24 81,11 ch_A 0,37 1,25 -0,13 0,00 16,89 ch_C 0,24 0,22 -0,45 0,00 3,05 ch_N 0,62 1,01 1,00 0,02 40,67 ch_P -0,40 -0,56 -0,60 0,00 4,35 ch_R -0,05 -0,10 -0,92 0,00 7,14 mi_A -0,16 0,29 -0,44 0,03 28,54 mi_B 0,08 -0,06 -0,18 0,03 19,57 mi_F 0,17 0,77 -0,39 0,60 94,44 mi_V -0,23 0,57 0,81 0,04 11,43 mi_Y 1,29 1,35 1,36 0,02 81,58 ra_A 0,89 0,71 0,91 0,00 69,39 ra_B 0,21 0,20 0,66 0,00 2,78 ra_C 0,42 0,53 0,19 0,00 89,58 ra_D k.A. k.A. k.A. 0,00 47,06 ra_L 0,36 0,97 0,94 0,00 22,73 ra_S 0,75 0,18 0,27 0,00 7,89 sa_I 0,20 0,17 0,05 0,07 27,22 sa_M k.A. k.A. k.A. 0,06 6,41 sa_N 0,02 -0,08 0,17 0,02 21,80 sa_T -0,60 -0,07 0,80 0,04 0,70 sm_A 0,53 0,65 0,34 0,08 17,69 sm_AF -0,66 -0,17 -0,99 0,10 50,23 sm_B -0,46 -0,10 -0,10 0,06 23,40 sm_C -0,22 -0,03 -0,26 0,15 13,46
483
10.3 Affinität b.
Die erklärenden Variablen, die sich in den Unterkapiteln zu den jeweiligen Variablen als signifikant herausgestellt haben, gehen auch in die folgenden Mehrebenenanalysen ein, werden aber in den Tabellen nicht gezeigt. Referenzwert für Affinität der Äußerung ist ‚hybrid‘.
‚Weißrussische‘ Wortformen in ‚weißrussischen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen Tab. 140
1.a (Jakanje1), F1 (n=423). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=32, σ=0,28), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,13 0,27 0,48 0,5274 Generation Generation 0 0,20 0,17 1,12 0,2666 Generation 2 -0,22 0,15 -1,45 0,0946 Affinität der Äußerung weißrussisch 0,10 0,07 1,38 0,1972
1.b (Jakanje1), F2 (n=423). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=32, σ=0,12), Familie (n=8, σ=0,05)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,08 0,18 0,41 0,6614 Generation Generation 0 0,00 0,09 0,00 0,9092 Generation 2 0,09 0,08 1,17 0,2440 Affinität der Äußerung weißrussisch -0,08 0,05 -1,58 0,1422
2. (sʲ), CoG-Wert (n=197). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=32, σ=0,38), Familie (n=8, σ=0,32)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,55 0,32 -1,74 0,0762 Affinität der Äußerung weißrussisch -0,05 0,16 -0,32 0,7398
3. (tʲ), CoG-Wert (n=262). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=29, σ=0,23), Familie (n=8, σ=0,21)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,17 0,32 0,54 0,5646 Affinität der Äußerung weißrussisch 0,05 0,14 0,33 0,7460
4. (ʧʲ), F2 (n=182). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=29, σ=0,20), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,14 0,26 0,52 0,7004 Generation Generation 0 -0,05 0,15 -0,33 0,6348 Generation 2 -0,04 0,14 -0,28 0,4890 Affinität der Äußerung weißrussisch -0,05 0,09 -0,60 0,7052
484
5. (rʲ), F2 (n=92). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=26, σ=0,08), Familie (n=7, σ=0,12)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,07 0,15 -0,49 0,6394 Generation Generation 0 0,00 0,12 0,00 0,8928 Generation 2 0,14 0,09 1,54 0,1554 Affinität der Äußerung weißrussisch 0,00 0,07 -0,07 0,9444
6. (g) (n=1358). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,69), Familie (n=8, σ=1,27)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -17,07 1914,62 -0,01 0,9929 Generation Generation 0 -0,10 1,40 -0,07 0,9412 Generation 2 0,65 0,95 0,69 0,4900 Affinität der Äußerung weißrussisch -0,87 0,70 -1,25 0,2109
7. (v) (n=558). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,97), Familie (n=8, σ=0,33)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -4,94 1,32 -3,74 0,0002 Generation Generation 0 0,13 1,56 0,08 0,9350 Generation 2 1,14 0,88 1,30 0,1939 Affinität der Äußerung weißrussisch -1,25 1,26 -0,99 0,3212
‚Russische‘ Wortformen in ‚russischen‘ und ‚hybriden‘ Äußerungen Tab. 141
1.a (Jakanje1), F1 (n=476). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,11), Familie (n=8, σ=0,21)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,05 0,20 0,26 0,8030 Generation Generation 0 0,20 0,15 1,35 0,1866 Generation 2 -0,30 0,09 -3,53 0,0010 Affinität der Äußerung russisch -0,09 0,07 -1,36 0,1658
1.b (Jakanje1), F2 (n=476). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=33, σ=0,14), Familie (n=8, σ=0,03)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,26 0,14 1,83 0,0738 Generation Generation 0 -0,03 0,12 -0,24 0,8252 Generation 2 0,20 0,08 2,54 0,0060 Affinität der Äußerung russisch -0,05 0,05 -1,09 0,3188
485
2. (sʲ), CoG-Wert (n=390). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,34), Familie (n=8, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,06 0,28 0,20 0,8392 Affinität der Äußerung russisch 0,13 0,12 1,06 0,2879
3. (tʲ), CoG-Wert (n=418). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=31, σ=0,41), Familie (n=8, σ=0,28)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,78 0,27 2,93 0,0074 Affinität der Äußerung russisch -0,14 0,11 -1,28 0,2334
4. (ʧʲ), F2 (n=407). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=30, σ=0,25), Familie (n=8, σ=0,09)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,03 0,12 0,27 0,8212 Generation Generation 0 -0,02 0,22 -0,09 0,8818 Generation 2 0,33 0,13 2,54 0,0078 Affinität der Äußerung russisch 0,00 0,07 -0,01 0,9486
5. (rʲ), F2 (n=219). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=27, σ=0,16), Familie (n=7, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,17 0,15 -1,15 0,2554 Generation Generation 0 0,11 0,16 0,68 0,4736 Generation 2 0,27 0,10 2,82 0,0028 Affinität der Äußerung russisch 0,12 0,06 1,92 0,0468
6. (g) (n=1384). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=34, σ=0,97), Familie (n=8, σ=2,17)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -4,63 1,20 -3,88 0,0001 Generation Generation 0 0,87 1,48 0,59 0,5563 Generation 2 1,68 0,57 2,95 0,0032 Affinität der Äußerung russisch 0,73 0,26 2,80 0,0050
7. (v) (n=1487). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=34, σ=1,01), Familie (n=8, σ=1,26)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) Generation Generation 0 -0,57 0,76 -0,74 0,4584 Generation 2 2,52 0,48 5,22 0,0000 Affinität der Äußerung russisch 1,39 0,21 6,76 0,0000
486
10.6 Sprechertypen c.
Unterschiede zwischen Sprechertypen in Generation 2 Tab. 142
1. (Akanje1), F1 (n=757). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,20)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,59 0,16 3,70 0,0010 Sprechertyp R -0,11 0,13 -0,87 0,3958
2.a (Jakanje1), F1 (n=502). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,23)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,23 0,23 1,01 0,3172 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,44 0,18 -2,41 0,0166 hybrid -0,25 0,11 -2,22 0,0262 russisch -0,41 0,12 -3,47 0,0006 Sprechertyp R -0,29 0,15 -1,98 0,0620
2.b (Jakanje1), F2 (n=502). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,17)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,05 0,17 -0,31 0,7580 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,07 0,14 0,50 0,5970 hybrid 0,13 0,08 1,58 0,1148 russisch 0,11 0,09 1,26 0,1974 Sprechertyp R 0,22 0,12 1,90 0,0608
3. (sʲ), CoG-Wert (n=448). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,35)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,59 0,32 -1,81 0,0762 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,43 0,32 1,37 0,1654 hybrid 0,14 0,23 0,61 0,5310 russisch 0,37 0,23 1,62 0,0994 Sprechertyp R 0,67 0,23 2,95 0,0094
4. (tʲ), CoG-Wert (n=501). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,27)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,46 0,28 -1,64 0,1027 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,48 0,32 1,50 0,1352 hybrid 0,26 0,19 1,35 0,1793 russisch 0,51 0,19 2,62 0,0090 Sprechertyp R 0,59 0,18 3,20 0,0091
487
5. (dʲ), CoG-Wert (n=296). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,56)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,60 0,46 -1,29 0,1840 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,26 0,31 -0,84 0,4104 hybrid -0,06 0,23 -0,26 0,8110 russisch -0,13 0,22 -0,59 0,5780 Sprechertyp R 0,46 0,35 1,32 0,1430
6. (ʧʲ), F2 (n=362). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=0,27)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,39 0,23 -1,69 0,0888 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,23 0,28 0,81 0,4246 hybrid 0,33 0,18 1,84 0,0654 russisch 0,43 0,18 2,39 0,0162 Sprechertyp R 0,44 0,18 2,50 0,0184
7. (rʲ), F2 (n=279). Zufallsfaktor: Sprecher (n=11, σ=0,23)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,16 0,19 -0,85 0,3646 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,13 0,15 0,92 0,3652 hybrid 0,13 0,10 1,35 0,1944 russisch 0,24 0,10 2,50 0,0134 Sprechertyp R 0,19 0,16 1,20 0,1818
8. (g) (n=1981). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=2,53)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -3,32 1,33 -2,49 0,0126 Affinität der Äußerung gemeinsam 1,25 0,45 2,78 0,0054 hybrid 0,45 0,38 1,20 0,2290 russisch 1,66 0,36 4,58 0,0000 Sprechertyp R 1,25 1,58 0,79 0,4286
9. (v) (n=1686). Zufallsfaktor: Sprecher (n=13, σ=1,30)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -4,27 0,71 -6,02 0,0000 Affinität der Äußerung gemeinsam 2,22 0,36 6,11 0,0000 hybrid 1,15 0,32 3,57 0,0004 russisch 2,99 0,29 10,15 0,0000 Sprechertyp R 3,27 0,79 4,16 0,0000
488
Unterschiede zwischen Vertretern des Sprechertyps HR in Generation 1 und Tab. 143Vertretern der Generation 2.
1. (Jakanje1), F1 (n=827). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=19, σ<0,01), Familie (n=8, σ=0,13)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,04 0,16 -0,22 0,8130 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,12 0,12 -0,99 0,3400 hybrid -0,17 0,07 -2,34 0,0166 russisch -0,34 0,09 -3,82 0,0004 Generation Generation 2 -0,23 0,09 -2,69 0,0344
2. (ʧʲ), F2 (n=524). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=18, σ=0,10), Familie (n=7, σ=0,13)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,04 0,10 0,41 0,6840 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,14 0,14 1,02 0,3038 hybrid 0,11 0,07 1,64 0,1068 russisch 0,16 0,08 2,08 0,0332 Generation Generation 2 -0,15 0,11 -1,42 0,1722
3. (rʲ), F2 (n=391). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=15, σ=0,07), Familie (n=6, σ=0,09)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,16 0,10 -1,52 0,1388 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,04 0,09 -0,44 0,6538 hybrid -0,04 0,05 -0,85 0,3924 russisch 0,07 0,06 1,13 0,2576 Generation Generation 2 0,10 0,10 1,03 0,3218
4. (g) (n=4085). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=19, σ=0,70), Familie (n=8, σ=2,08)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -4,20 1,03 -4,06 0,0000 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,54 0,12 1,06 0,2850 hybrid 0,09 0,30 0,30 0,7605 russisch 0,84 0,33 2,50 0,0128 Generation Generation 2 -0,86 0,72 -1,18 0,2350
5. (v) (n=3327). Zufallsfaktoren: Sprecher (n=19, σ=0,83), Familie (n=8, σ=0,49)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -4,86 0,46 -10,64 0,0000 Affinität der Äußerung gemeinsam 1,71 0,36 4,77 0,0000 hybrid 1,50 0,33 4,53 0,0000 russisch 2,58 0,31 8,39 0,0000 Generation Generation 2 0,10 0,74 0,14 0,8880
489
10.7 Akkommodation d.
Unterschiede in der Rede von Generation 1 zwischen Gesprächen mit Vertretern der Tab. 144Generation 0 und Gesprächen ohne Vertreter der Generation 0. Der Referenzwert in den folgenden Mehrebenenmodellen sind Gespräche ohne Vertreter der Generation 0.
1. (Akanje1), F1 (n=277). Zufallsfaktor: Sprecher (n=5, σ=0,10)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,47 0,24 1,95 0,0700 Gesprächskonstellation mit Generation 0 0,15 0,16 0,93 0,3628
2. (Jakanje1), F1 (n=242). Zufallsfaktor: Sprecher (n=5, σ=0,06)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,57 0,33 1,76 0,1086 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,17 0,23 -0,75 0,4204 hybrid -0,18 0,14 -1,31 0,1576 russisch -0,49 0,17 -2,92 0,0024 Gesprächskonstellation mit Generation 0 0,40 0,13 3,09 0,0016
3. (ʧʲ), F2 (n=151). Zufallsfaktor: Sprecher (n=5, σ=0,11)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,13 0,15 0,90 0,3876 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,47 0,24 1,94 0,0548 hybrid 0,17 0,11 1,54 0,1330 russisch 0,27 0,14 2,00 0,0516 Gesprächskonstellation mit Generation 0 -0,45 0,13 -3,39 0,0004
4. (rʲ), F2 (n=126). Zufallsfaktor: Sprecher (n=4, σ<0,01)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -0,17 0,28 -0,62 0,5026 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,16 0,16 -0,97 0,3474 hybrid -0,10 0,10 -1,05 0,3068 russisch -0,08 0,11 -0,69 0,5210 Gesprächskonstellation mit Generation 0 -0,12 0,22 -0,55 0,5590
5. (v) (n=976). Zufallsfaktor: Sprecher (n=5, σ=1,43)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -5,51 1,14 -4,82 0,0000 Affinität der Äußerung gemeinsam 2,04 0,64 3,16 0,0019 hybrid 1,56 0,61 2,56 0,0104 russisch 3,25 0,57 5,72 0,0000 Gesprächskonstellation mit Generation 0 -1,10 0,55 -2,01 0,0431
490
Effekt unterschiedlicher Gesprächskonstellationen Generation 2 Tab. 145
1. (Akanje1), F1 (n=485). Zufallsfaktor: Sprecher (n=7, σ=0,18)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,41 0,16 2,55 0,0172 Gesprächskonstellation mit Generation 1 0,11 0,07 1,56 0,1244 mit Generation 0 -0,17 0,10 -1,59 0,1134
2. (Jakanje1), F1 (n=283). Zufallsfaktor: Sprecher (n=7, σ=0,22)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,56 0,30 1,88 0,0714 Affinität der Äußerung gemeinsam -0,62 0,24 -2,63 0,0086 hybrid -0,39 0,16 -2,50 0,0120 russisch -0,58 0,16 -3,75 0,0001 Gesprächskonstellation mit Generation 1 0,03 0,10 0,33 0,7548 mit Generation 0 -0,09 0,14 -0,68 0,4970
3. (ʧʲ), F2 (n=214). Zufallsfaktor: Sprecher (n=7, σ=0,39)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,35 0,32 1,09 0,3000 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,26 0,38 0,70 0,4824 hybrid 0,18 0,25 0,75 0,4492 russisch 0,31 0,24 1,30 0,1862 Gesprächskonstellation mit Generation 1 -0,28 0,13 -2,19 0,0310 mit Generation 0 -0,74 0,20 -3,79 0,0008
4. (rʲ), F2 (n=125). Zufallsfaktor: Sprecher (n=6, σ=0,25)
Koeffizient SE t-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) 0,28 0,29 0,97 0,3556 Affinität der Äußerung gemeinsam 0,10 0,23 0,43 0,6874 hybrid 0,16 0,20 0,80 0,4224 russisch 0,27 0,19 1,43 0,1544 Gesprächskonstellation mit Generation 1 -0,11 0,09 -1,27 0,2036 mit Generation 0 -0,34 0,15 -2,21 0,0270
5. (g) (n=945). Zufallsfaktor: Sprecher (n=7, σ=2,20)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -1,79 1,27 -1,42 0,1571 Affinität der Äußerung gemeinsam 2,20 0,82 2,68 0,0073 hybrid 1,40 0,78 1,81 0,0696 russisch 2,42 0,75 3,22 0,0013 Gesprächskonstellation mit Generation 1 -0,57 0,29 -2,00 0,0453 mit Generation 0 -0,60 0,42 -1,43 0,1519
491
6. (v) (n=787). Zufallsfaktor: Sprecher (n=7, σ=2,02)
Koeffizient SE z-Wert p-Wert Feste Effekte: (Konstante) -2,20 1,13 -1,94 0,0519 Affinität der Äußerung gemeinsam 2,91 0,65 4,49 0,0000 hybrid 1,64 0,60 2,72 0,0066 russisch 4,17 0,55 7,52 0,0000 Gesprächskonstellation mit Generation 1 -1,18 0,30 -3,93 0,0001 mit Generation 0 -3,01 0,55 -5,45 0,0000
Studia Slavica Oldenburgensia herausgegeben von Rainer Grübel, Gerd Hentschel und Gun-Britt Kohler
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Fakultät III, Institut für Slavistik
Es liegen folgende Bände vor:
Bd. 1 Funktionswörter im Polnischen / Maciej Grochowski; Gerd Hentschel. –1998. – XV, 259 S. ISBN 3-8142-0629-0 / EUR 11.30
Bd. 2 Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia / M. Giger ; T. Menzel ... – 1998. – VIII, 228 S. ISBN 3-8142-0639-8 / EUR 11.30
Bd. 3 Diversität und Kontinuität: die Entwicklung des russischen historischen Versepos im 18. Jahrhundert / Eddy Weeda. – 1999. – VIII, 312 S. – Literaturverz. S. 293–312 ISBN 3-8142-0656-8 / EUR 11.30
Bd. 4 Variierende Markierung von Nominalgruppen in Sprachen unterschiedlichen Typs / Winfried Boeder; Gerd Hentschel (Hrsg.). – 2001. – VI, 411 S. ISBN 3-8142-0739-4 / EUR 15.40
Bd. 5 Flexionsmorphologischer Wandel im Polnischen: eine natürlichkeitstheoretische Untersuchung auf allgemeinslavistischem Hintergrund / Thomas Menzel. – 2000. – III, 369 S. ISBN 3-8142-0731-9 / EUR 11.30
Bd. 6 Untersuchungen zur Morphologie und Syntax im Slavischen: Beiträge zur dritten Tagung der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) Torun/Thorn 1999 / H. Bar-tels ... – 2001. – VI, 221 S. ISBN 3-8142-0740-8 / EUR 12.80
Bd. 7 Ödipus im Glück: zur Poetik von Aleksej Skaldins Roman „Stranstvija i prikljucenija Nikodima starsego“ („Reisen und Abenteuer Nikodims des Älteren“) / Arne Ackermann. – 2001. – VII, 284 S. ISBN 3-8142-0761-0 / EUR 10.30
Bd. 8 On prepositions / Ljiljana Saric ... (eds.). – 2001. – VIII, 327 S. ISBN 3-8142-0777-7 / EUR 12.30
Bd. 9 Studies on the syntax and semantics of Slavonic languages: papers in honour of Andrzej Boguslawski on the occasion of his 70th birthday / ed. by Viktor S. Chrakovskij ... Gerd Hentschel. – 2001. – XIII, 459 S. ISBN 3-8142-0796-3 / EUR 15.30
Bd. 10 Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Teschener Dialekt des Polnischen / Thomas Menzel; Gerd Hentschel. – 2003. – XXXV, 408 S. ISBN 3-8142-0857-9 / EUR 15.40
Bd. 11 Präpositionen im Polnischen: Beiträge zu einer gleichnamigen Tagung Oldenburg, 8. bis 11. Februar 2000 / Gerd Hentschel; Thomas Menzel. –2003. – XI, 417 S. ISBN 3-8142-0858-7 / EUR 15.40
Bd. 12 Dativ oder Präposition: Zur Markierungsvariation im Kontext adjektivischer Prädikate im Deutschen, Russischen und Polnischen / Hauke Bartels. – 2005. – X, 287 S. ISBN 3-8142-0972-9 / EUR 12.80
Bd. 13 Gabe und Opfer in der russischen Literatur und Kultur der Moderne / Rainer Grübel; Gun-Britt Kohler. – 2006. – XII, 563 S. – Beitr. teilw. in Kyrill. ISBN 978-3-8142-2048-2 / EUR 20.80
Bd. 14 Der poetische Sprachentwurf bei Iosif Brodskij: eine Untersuchung der expliziten und impliziten Poetik / Wiebke Wittschen. – 2007. – 203 S. ISBN 978-3-8142-2056-7 / EUR 10.00
Bd. 15 Michail Geršenzon: seine Korrespondenzen und sein Spätwerk als Fokus russischer Hochmoderne und russischer Revolution / Rainer Grübel (Hrsg.). – 2007. – 285 S. ISBN 978-3-8142-2091-8 / EUR 12.80
Bd. 16 Secondary predicates in Eastern European languages and beyond / Christoph Schroeder, Gerd Hentschel, Winfried Boeder (eds.). 2008. – 449 S. ISBN 978-3-8142-2133-5 / EUR 16.80
Bd. 17 Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk: structural and social aspects of their description and categorization / Gerd Hentschel; Siarhiej Zaprudski (eds.). – 2008 – IX, 133 S. ISBN 978-3-8142-2131-1 / EUR 9.80
Bd. 18 Dostojewskis Legende vom Großinquisitor / Rosanow, W.; Grübel, R. (Hrsg.). – 2009. – 446 S. ISBN 978-3-8142-2143-4 / EUR 19.80
Bd. 19 Bilinguale Lexiko-Aspektographie / Hans-Jörg Schwenk – 2010 – 443 S. ISBN 978-3-8142-2198-4 / EUR 19.80
Bd. 20 Kleinheit als Spezifik / Kohler, G.-B.; Navumenka, P.I.; Grüttemeier, R. (Hrsg.) – 2012 – 266 S. ISBN 978-3-8142-2270-7 / EUR 16.80
Bd. 21 Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten / Gerd Hentschel (Hrsg.) – 2013 – 121 S. ISBN 978-3-8142-2286-8 / EUR 9.80
Bd. 22 Studien zur „Trasjanka“ / Henadz´ Cychun – 2013 – XIV, 53 S. ISBN 978-3-8142-2287-5 / EUR 9.80
Bd. 23 Die weißrussische und die russische Sprache in ihrem Verhältnis zur weiß-russischen Gesellschaft und Nation / Mark Brüggemann – 2014 – XIV, 355 S. ISBN 978-3-8142-2304-9 / EUR 19.80
Bd. 24.1 + 24.2 Der Instrumental des Ortes und der Zeit in den slavischen Sprachen: / Menzel – 2014, S.340 + 269 S. ISBN 978-3-8142- 2309-4/ EUR 28.00
Bd. 25 Syntagmatische Aspekte der weißrussisch-russischen gemischten Rede: Kodemischen und Morphosyntax / Sviatlana Tesch – 2014 – 270 S. ISBN: 978-3-8142-2311-7 / EUR 17,80
Bd. 26 Zur Variation zwischen reinem Dativ und präpositionaler Markierung mit dla 'für' in ostpolnischen Dialekten : / Lars Behnke – 2014 – 492 S. ISBN: 978-3-8142- 2321-6 / EUR 22,80
Außerhalb der Reihe:
Textlehrbuch zum Altpolnischen / Gehrmann, Maria / Hentschel, Gerd / Menzel, Thomas – 1999 – 169 S. ISBN 3-8142-0675-4 / EUR 10.30
Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache de Vincenz, André / Hentschel, Gerd – 2010 – Online-Ressource (ca. 1000 S.) –– http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/wdlp/ ISBN: 978-3-8142-2208-0 / kostenlos nutzbar
Weißrussische Sprache in 20 Lektionen: Intensivkurs Ramza, Taccjana / Tesch, Sviatlana – 2011– 198 S. ISBN: 978-3-8142-2222-6 / EUR 16.80



























































































































































































































































































































































































































































































































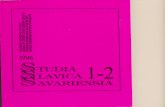





![Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f3e485efe380f30672ea/le-bas-danube-dans-la-seconde-moitie-du-xi-eme-siecle-nouveaux-etats-ou-nouveaux.jpg)













