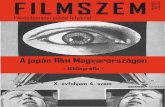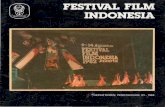Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film. Zwischen nationaler Sinnstiftung, Sowjetnostalgie...
Transcript of Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film. Zwischen nationaler Sinnstiftung, Sowjetnostalgie...
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Liliya BerezhnayaDie Stalinzeit im russischenPostperestroika-FilmZwischen nationaler Sinnstiftung, Sowjetnostalgie undmelodramatischen Kassenschlagern
Seit dem Erscheinen des Films Die Reue (Pokajanie) von Tengiz Abuladze im Jahr1986, der zu einem Klassiker des anti-stalinistischen Perestrojka-Kinos wurde,sind 25 Jahre vergangen. Das Filmzitat: „Aber wozu braucht man eine Straße,wenn sie nicht zur Kirche führt?“ wurde nicht nur zu einem Startpunkt für dieNeureflektierung der stalinistischen Vergangenheit im russischen Kino. Vielmehrwandelte es sich zu einem Leitmotiv der gesamten Perestrojka-Zeit. Nach Poka-janie folgten Der kalte Sommer des Jahres 53’ (Cholodnoje leto 53-go, 1987), Dieschwarze Rose (Černaja roza, 1989), Die Gastmahle des Balthasar, oder Eine Nachtmit Stalin (Piry Valtasara, ili Noč’ so Stalinym, 1989), Verloren in Sibirien (Zaterjan-nyj v Sibiri, 1990), Genosse Stalin fährt nach Afrika (Tovarišč Stalin jedet v Afriku,1991), Ankor, nochmal Ankor (Ankor, ješčo Ankor, 1992) sowie ferner eine Reihevon Dokumentarfilmen über die Epoche des Stalinismus, wie etwa Die Macht vonSolovki (Vlast’ Soloveckaja, 1987). All diese Werke vereinte das Bestreben, einer-seits die Verfehlungen des Stalinismus zu verurteilen, andererseits neue Helden-mythen und Rollenmodelle zu festigen.¹ Der englische Filmwissenschaftler JulianGraffy schrieb 1993, dass die russischenKinoproduzenten der Perestrojka-Zeit his-torischen Themen, insbesondere der Stalinperiode, besondere Aufmerksamkeitschenkten und damit das Ziel verfolgten, die Mythen des sozialistischen Realis-mus zu dekonstruieren. Als solche benannte er im Anschluss an Francois Niney:dieHoffnung auf eine lichte Zukunft, die Überzeugung von der Genialität des Füh-rers, die Existenz feindlicher Verschwörungen und den Lobgesang auf die Tatender Helden der Arbeit.²
1 Susan Larsen: Melodramatic Masculinity, National Identity, and the Stalinist Past in PostsovietCinema, in: Studies in Twentieth-Century Literature 24,1 (2000), S. 85–120.2 JulianGraffy: UnshelvingStalin:After thePeriodof Stagnation, in: RichardTaylor/Derek Spring(Hrsg.), Stalinism and Soviet Cinema. London 1993, S. 218. Für eine detaillierte Analyse vonPerestrojka-Filmen über Stalin und seine Zeit, vgl. Anna Lawton: The Ghost That Does Return:Exorcising Stalin, in: ebd., S. 186–200; David Gillespie: Identity and the Past in Recent RussianCinema, in: Wendy Everett (Hrsg.), European Identity in Cinema. Exeter 1996, S. 53–60. Über den„kinematographischen Beitrag“ in der Dekonstruktion von sowjetischen Mythen, vgl. AlexanderProkhorov: From Family Reintegration to Carnivalistic Degradation. Dismantling Soviet Commu-
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
198 | Liliya Berezhnaya
Im Prozess der Neureflektierung der Vergangenheit, besonders in Zeiten his-torischer Umbrüche und Transformationen, kommt dem Kino eine besondereRolle zu. Nicht allein deshalb, weil Filme Schlüsselprodukte gesellschaftlicherKommunikation sind, sondern auch, weil das kinematographische Bild für ge-wöhnlich die Funktion einer „Naturalisierung“ und damit die Authentifizierungdes ideologischen Gehalts der geschriebenen Sprache leistet.³ In der modernenGesellschaft bezieht das Publikum sein Wissen über seine Vergangenheit viel öf-ter vomBildschirm oder der Leinwand als aus Büchern oder gar Lehrbüchern. Eingutes Beispiel für diese aktive Partizipation bei der Neureflektierung der stalinis-tischen Vergangenheit ist das russische Kino der Perestrojka-Zeit. Es visualisiertedie stalinistische Epoche auf der Ebene eines allgemeinen nationalen Traumas inder Geschichte. Die sogenannten černucha – („schwarze“) Filme⁴ stellen das sta-linistische Regime als dämonisch und zerstörerisch dar undmachten nicht alleinauf die Opfer der stalinistischen Repressionen aufmerksam, sondern auch auf dieOpfer der Gegenwart, wie etwa Soldaten, die unter der dedovščina (Schikane vonDienstälteren an Wehrpflichtigen) litten, Prostituierte, Drogensüchtige oder dieOpfer krimineller Gewalt. Allerdings ging schon in der ersten Hälfte der 1990erJahre das allgemeine Interesse am Thema Stalinismus rapide zurück.⁵
Im Jahr 1996 publizierte das Journal Seans die Dokumente eines runden Ti-sches zum Thema stalinistischer Repressionen im Perestrojka-Kino.⁶ Die versam-melten Filmexperten hielten einmütig die Bearbeitung dieser Thematik in denletzten zehn Jahren für unbefriedigend. Der bekannte Kritiker Daniil Dondurejbeklagte das Fehlen filmischer Umsetzungen von Solženicyn, Šalamov und Dom-brovskij im postsowjetischen Kino. Ljubov Arkus konstatierte, dass es im russi-schen Kino keine der Literatur adäquate Abbildung des Themas „Stalinismus“gebe und fast alle Versuche auf diesem Gebiet in dieser oder jener Hinsicht zumScheitern verurteilt seien. Auf die Frage nach den Gründen dieses Scheiterns ant-worteten die Experten unterschiedlich. Nach Ansicht Dondurejs wirkte sich dasFehlen entsprechender Aufträge für solche Filme von Seiten des Goskomkino (desdamals noch existierenden staatlichen Komitees für Kino) negativ auf das Inter-
nal Myths in Russian Cinema of the Mid-1990s, in: Slavic and East European Journal 51, 2 (2007),S. 272–294.3 Stephen Hutching: Introduction, in: ders. (Hrsg.), Russia and Its Other(s) on Film. ScreeningIntercultural Dialogue. Studies in Central and Eastern Europe. Palgrave 2008, S. 5.4 SethGraham:Chernukha andRussian Film, in: Studies in Slavic Culture 1 (2000), S. 9–27;BirgitBeumers: A History of Russian Cinema. London 2008, S. 204–208.5 Svetlana Boym: Stalin’s Cinematic Charisma: BetweenHistory andNostalgia, in: Slavic Review,51,3 (1992), S. 536–543.6 Seans 14 (11/1996): http://seance.ru/n/14/istoriya/tema.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 199
esse der russischen Regisseure an der Stalin-Epoche aus. Sergej Dobrovol’skij be-merkte „eine deutliche Ermüdung des Materials vom Stalin-Thema“. Ihm pflich-tete Lev Lurje bei, indem er zugleich darauf verwies, dass alle Gesichtspunkte desStalinismus bereits in der Literatur der 1960er und 1970er Jahre präsent seien,so dass die Regisseure der Perestrojka lediglich die bestehenden Konzeptionenwiederholten. Zu diesen Gesichtspunkten zählte Lurje die Ideen, dass Stalin dieIdeale der Oktoberrevolution pervertiert habe, dass die Repressionen des Jahres1937 nur eine logische Fortsetzung der Logik von 1917 seien; und schließlich, dassStalin als Staatsmann und charismatischer Führer ein Nachfolger der RegierungPeters des Großen sei. Oleg Kovalëv bemerkte in den zeitgenössischen russischenFilmen einen bestimmten Akzent auf den „dämonischen Stalinismus“, welcherseiner Ansicht nach zwar die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die persön-lichen Charaktereigenschaften des vožd’ (des Führers) lenkte. Allerdings solltenach Meinung des Kritikers dem Phänomen des „gewöhnlichen“ Stalinismus be-sondere Aufmerksamkeit gelten, etwa der Erforschung der Sprachgewohnheitenund der Mythologeme der Epoche. Folglich „verharrt das Thema noch in Ohn-macht“, so lautete das einhellige Urteil der Experten von 1996.⁷
Der „Tiefpunkt“, den die Beschäftigung mit Stalin durch russische Filmema-cher in der Mitte der 1990er Jahre erreichte, war zugleich ein „Wendepunkt“.⁸ Indieser Zeit wechselte das Thema Stalinismus und Repressionen von der Sphäredes künstlerischen Kinos hinüber in die Sphäre der Massenkultur. Gerade zu die-ser Zeit kam der Kassenschlager Die Sonne, die uns täuscht (Utomlennye solncem,1994) vonNikitaMichalkov indieKinos, undmanbeganndarüber hinaus imFern-sehen die Alten Lieder vom Hauptsächlichen (Starye pesni o glavnom, 1996–2001)zu zeigen, ein Zyklus von Fernsehfilmen zu Neujahr, in denen zeitgenössischeSänger sowjetische Schlager unter anderem aus den 1940er und 1950er Jahrenaufführten. Damals wurde auch, zunächst spät abends, dann zur besten Sende-zeit, erneut der Film Kubaner Kosaken (Kubanskie kazaki, 1949) gezeigt.⁹ DieseWerke wurden zu einer Art „Brücken“, die die sowjetische Vergangenheit und
7 Ebd.8 Alexander Jakobidze-Gitman: Istorija kak „predmet podražanija.“ Stalinskaja epocha v postso-vetskom kino. Diss. Moskva 2009.9 Ljubov Borusjak: „Staroje dobroje kino“ i postsovetskij teleopyt, in: Vestnik obsčestvennogomnenija: Dannyje. Analiz. Diskussii 103,1 (2010), S. 90–101. Über die Alten Lieder vom Haupt-sächlichen als „Teil der Strategie von Produzent Konstantin Ernst bei der Ümschreibung derVergangenheit für die heutigen Konsumszwecke“, vgl. Stephen M. Norris: Blockbuster History inthe New Russia. Movies, Memory, and Patriotism. Bloomington/Indianapolis 2012, S. 291–296.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
200 | Liliya Berezhnaya
das Post-Perestrojka-Russland verbanden.¹⁰ Die Filme aus der Mitte der 1990erJahre über die stalinistischen Repressalien und die sowjetische Wirklichkeit der1930er bis 1950er Jahre vereinten die Forderung nach einer Revision der Narrativeder Perestrojka. Populär wurden jetzt Diskussionen über die geopolitische RolleRusslands, über die Stabilität vonWirtschaft undGesellschaft und über den „drit-ten Weg“.¹¹ Folgt man den Kategorien von Igor Polianski, begann die stalinisti-sche Vergangenheit von derjenigen der „warmen Erinnerung“ („das, was weh tut,weil es aufhört“) in die Kategorie der „heißen Erinnerung“ überzugehen, „einenPol des erinnerungskulturellen Kraftfeldes, von dem aus eine Delegitimation undUmgestaltung der geltenden Gesellschaftsordnung in Namen der Geschichte ge-fordert wird“.¹²
Das gesellschaftliche Bedürfnis, die verlorene kollektive Erinnerung zurück-zubringen, trieb die Regisseure dazu, die Filme der stalinistischen Epoche neuzu überdenken. Die staatliche Gewalt, der „Große Vaterländische Krieg“ unddie Modernisierung der Gesellschaft, also die Schlüsselthemen der 1930er bis1950er Jahre, wurden nun in Formen der westlichen Massenkultur verhandelt.Der Stalinismus war nicht länger allein ein Gegenstand der „schwarzen Filme“(černucha), sondernwurde nun auch vomkommerziellen Kino aufgegriffen. Lipo-veckij charakterisierte solche Filme als post-soz. Charakteristisch für diese isteine Polarisierung in „gute“ und „schlechte“ Archetypen, die durch Zitate ausden Werken des Sozialistischen Realismus und der Hollywood-Massenkultur er-kennbar sind.¹³ Dabei blieb das Thema Stalinismus ein interessantes Sujet für dieRegisseure des künstlerischen Kinos und des Dokumentarfilms. Das Bild Stalins,so wie alles Sowjetische, wurde allmählich zu einer Kino-Mode.¹⁴
10 Jurij Bogomolov: Prošloje kak prijem, in: Seans 35/36 (08/2008): http://seance.ru/category/n/35-36. Sergei A. Oushakine sieht in den damaligen Remakes die Zeichen einer gesellschaftlichenAphasia (Unfähigkeit zu sprechen). Diese Formen sind aus der in der Vergangenheit für die Ge-genwartsstrukturierung entlehnt, vgl. Sergei Alex. Oushakine,NewLives ofOld Forms:OnReturnsand Repetitions in Russia, in: Genre XLIII (Fall/Winter 2010), S. 409–457.11 Russlands Erinnerungskultur in ihrer post-Perestroika-Dynamikwurde eingehendaus verglei-chender Perspektive analysiert in: Bernd Faulenbach/Franz-Josef Jelich (Hrsg.): „Transformatio-nen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989. Essen 2006, S. 221–298.12 Igor J. Polianski: Eisbrecher der Geschichte. „Heiße“, „kalte“ und „warme“ Erinnerung in derpostsowjetischen Geschichtskultur, in: Lars Karl/Igor J. Polianski (Hrsg.), Geschichtspolitik undErinnerungskultur im neuen Russland. Göttingen 2009, S. 70. Polianski greift hier die Begriff-lichkeiten von Jan Assmann auf.13 Mark Lipovetsky: Post-Sots: Transformations of Socialist Realism in the Popular Culture of theRecent Period, in: Slavic East European Journal 48,3 (2004), S. 361–62.14 Jakobidze-Gitman, Istorija kak „predmet podražanija“.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 201
Die Entwicklung resultierte nicht mehr aus einem offiziellen „Anspruch vonoben“ zur Konstruktion eines neuen historisch-identifikatorischen Narrativesmit den Mitteln des Kinos. In den 1990er Jahren wurden Russland und anderepost-sowjetische Staaten von einer bis dahin ungeahnten Welle von westlichenBildern sowie von lateinamerikanischen Seifenopern überschwemmt. Das neueSelbstverständnis knüpfte einerseits an das sowjetische (und im weiteren Sinneimperiale) Erbe an und speiste sich zum anderen aus expliziten Gegenentwür-fen westlicher Seifenopern und der Kommerzialisierung des Kinos. Das Ergebniswaren postsowjetisch-imperiale (vielfach als nationalistisch interpretierte) Vor-stellungsmuster, die eine Rückbesinnung gegenüber dem als Selbstgeißelungempfundenen Zugang der Perestrojka und Glasnost’-Zeit bedeuteten. Nach Mei-nung von Aleksandr Prochorov brachte das Kino dieser Zeit den Wandel dergesellschaftlichen Stimmung von Enttäuschung zu neuer Hoffnung zum Aus-druck.¹⁵
Seitdem sind anderthalb Jahrzehnte vergangen. Das russische Kino ist nachder „Koma-Periode“¹⁶ der Perestrojka in finanzieller wie in kreativer Hinsichtgleichsam regeneriert. Doch inwieweit waren die vergangenen 15 Jahre von einerneuen Hinwendung zum Thema Stalinismus geprägt? Welche neuen Topoi, Nar-rative und Mythologien hat der russische Film bei der Bearbeitung der Stalin-Zeitherausgebildet? Wurde der antistalinistische Konsens aufgekündigt?¹⁷ In wel-cher Weise hat das Post-Perestrojka-Kino die Formierung einer russländischenErinnerungskultur über die Epoche des Stalinismus beeinflusst?
In meinem Aufsatz möchte ich zeigen, dass die vergangenen eineinhalbJahrzehnte tatsächlich von einer neuen Wendung des Interesses zum ThemaStalinismus und Personenkult in der russländischen Geschichte geprägt waren.Dabei knüpften die zeitgenössischen Kinematographen zweifellos an die Metho-den der Verbildlichung des Perestrojka-Kinos an. Doch während die Filme derPerestrojka-Zeit noch in der Tradition der „dämonischen“ Visualisierung des Sta-linismus standen, vermochten die zeitgenössischen Regisseure auch neue Sujetsin der Verbildlichung des „gewöhnlichen“ und „alltäglichen“ Stalinismus zu ent-decken. Im Folgenden werden die russischen Gegenwartsfilme zum Stalinismusentlang von vier Motiven dargestellt, die das Thema konstituieren. Das erste Mo-
15 Prokhorov, From Family Reintegration to Carnivalistic Degradation, S. 275–76.16 Helena Goscilo: Introduction, in: Slavic and East European Journal. (Special Forum Issue:Resent, Reassess, and Reinvent: The Three R’s of Post-Soviet Cinema) 51,2 (2007), S. 214–220,hier 220.17 So Nina Frieß: Nichts ist vergessen, niemand ist vergessen? Erinnerungskultur in Russland.Potsdam 2010, S. 95–96.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
202 | Liliya Berezhnaya
tiv zeichnet den Stalinismus als Symbol von Gefängnis und Unterdrückung (dieMetapher der „Zone“). Dieses Thema wird im ersten Teil betrachtet. Im zweitenTeil wird der Verbindung von Stalinismus und Religion in den Filmen nachgegan-gen, die den „Großen Vaterländischen Krieg“ als eine Zeit von geistiger Reinigungbeschreiben. Der dritte Teil geht der Frage nach, ob die Sicherheitsorgane des sta-linistischen Regimes als Henker und als Verteidiger der Gesellschaft gezeichnetwerden. Und schließlich werden Formen der Verklärung der Stalin-Zeit als einePeriode des Fortschritts aufgezeigt.
Die Stalin-Epoche als Symbol von Gefängnis undUnterdrückungDer Ausspruch des Kritikers Dondurej von 1996 über das Fehlen einer Leinwand-adaptation von Solženicyn und Šalamov blieb unter den russischen Regisseu-ren und Produzenten nicht unbeachtet. Im Auftrag des Fernsehkanals „Rossija“drehte Gleb Panfilov im Jahr 2006 eine 12-teilige Serie nach Motiven des RomansV krugie pervom (Im ersten Kreis der Hölle) von Solženicyn, der auch amDrehbuchmitwirkte und eine Sprechrolle übernahm. Dies war die erste russische Verfil-mung des Romans, zuvor gab es nur eine Theaterinszenierung durch Julia Ljubi-mova von 1998 im Theater an der Taganka.¹⁸ In der Hauptrolle des Neržin trat aufEmpfehlung von Solženicyn selbst Evgenij Mironov auf. Die Lebensgeschichte derpolitischen Gefangenen in der Šaraška (Sondergefängnis fürWissenschaftler undIngenieure) von Marfino zog anfangs die Aufmerksamkeit einer großen Zahl vonZuschauern auf sich und stieß gleichzeitig auf widersprüchliche Reaktionen.¹⁹Die Konfliktlinie verlief dabei nicht zwischen „Stalinisten“ und „Demokraten“,obwohl es diesen Gegensatz auch gab, sondern zwischen jenen, die auf die stali-nistische Epoche durch das Prisma politischer Grabenkämpfe und Repressionenschauten, und jenen, die in der Verfilmung von Solženicyn eher grundsätzlichemoralische Fragen von Liebe, Treue und Verrat sahen.²⁰
18 Der Roman „Im Ersten Kreis der Hölle“ von Aleksandr Solženicyn wurde von ihm zwischen1955–1958nach seinenautobiographischenAufzeichnungenaufgeschrieben, allerdings erst 1990in der UdSSR veröffentlicht.19 Vgl. „Solženicyn pobedil Terminatora“, in: Strana.Ru (01/2006):http://www.vkrugepervom.ru/content.html?id=321&cid=44.20 Bemerkenswert ist, dass ebenfalls der Filmproduzent Maxim Panfilov sich zu den letzterenbekannte. Ebd.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 203
Bereits einige Jahre bevor der Film Im ersten Kreis der Hölle auf den Bild-schirm kam, wurde im russischen Fernsehen eine mehrteilige Bildschirmadapta-tion von Perestrojka-Literatur über die Stalinzeit gezeigt. Der Film Die Kinder vomArbat (Deti Arbata, 2004 Regisseur: Andrej Ešpaj), nach der Trilogie von AnatolijRybakov, erzählt vom Schicksal der Moskauer Jugend in den 1930er und 1940erJahren. Die Serie folgt der traditionellen Perestrojka-Darstellung und teilt die Ge-sellschaft jener Zeit in idealistische Märtyrer und infernalische Henker. Das stali-nistischeRegimeund seine Schergenwerden alsmoralisch verkommene Subjektedargestellt. Symptomatisch ist in diesem Fall das Bild des NKVD-Offiziers JurijŠarok, dargestellt von Daniil Strachov. Der pragmatische Šarok übertritt häufigmoralische Prinzipien im Interesse seiner Karriere, begeht dabei Verrat an Liebeund Freundschaft und bleibt am Ende allein. Der Kulminationspunkt des Wegesdieser Hauptfigur ist die Szene seiner Ermordung auf offener Straße und am hell-lichten Tag durch die Hand anderer NKVD-Agenten. Der Linie des politischen Ter-rors wird das melodramatische Sujet der Liebesbeziehung eines jungen Paaresgegenübergestellt, das es trotz aller Hindernisse schafft, seinen Gefühlen treu zubleiben. Ähnlich wie Michalkovs Von der Sonne getäuscht versucht die Serie DieKinder vom Arbat eine Synthese von Alltagsgeschichte und „großer Geschichte“in Form von „nachahmenden Themen“.²¹
Ungeachtet gewisser Unterschiede im Zugang die gefangenen Gelehrten imErsten Kreis der Hölle führen philosophische Gespräche miteinander, währenddie Helden in Die Kinder vom Arbat eher in Seifenoper-Manier über die Verwick-lungen in ihren persönlichen Beziehungen räsonieren vereint beide Serien dieSuche nach gesellschaftlichen Alternativen zum Terror. Die Regisseure postulie-ren die moralische Reinheit der Repressionsopfer und erheben sie in den Rangmythologisierter Helden. Analoge Motive klingen in einigen Dokumentarfilmender Post-Perestrojka-Epoche an. In erster Linie gehört hierzu der zehnteilige FilmRussland im Krieg. Blut auf Schnee (Rossija v vojnie. Krov’ na snegu, 1996), eineGemeinschaftsproduktion des Fernsehkanals „Rossija“ und der BBC. Einer derAutoren des Drehbuches war der Publizist, Dramaturg und Schriftsteller GenrichBorovik, der in der Gorbačev-Zeit Abgeordneter des Kongresses der Volksdepu-tierten war. Die zwei ersten Folgen (Die Finsternis fällt (T’ma opuskajetsja) und Inletzter Stunde (V poslednij čas)) des Regisseurs Viktor Lisakovič sind dem stali-nistischen Terror der späten 1920er und der 1930er Jahre gewidmet. Auf der Basisvon dokumentarischen Materialien und Erinnerungen von Zeitzeugen versuchendie Autoren des Films zu zeigen, dass die totalitären Systeme Deutschlands undderUdSSRviel gemeinsamhatten, ungeachtet der Rivalität der beidenDiktatoren.
21 Vgl. Jakobidze-Gitman. Istorija kak „predmet podražanija“.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
204 | Liliya Berezhnaya
Stalinwird darin als eine bösartige undmanische Figur dargestellt, die gedanken-los Millionen von Mitbürgern in den Tod schickt. Der Film wurde seither vielfachauf mehreren russischen Fernsehkanälen gezeigt, oft im Zusammenhangmit Fei-erlichkeiten zum Tag des Sieges.²²
Einen analogen Blickwinkel wählte der Regisseur Aleksej Il’juchin in einemDokumentarfilm über das Exekutionsfeld von Butovo unter dem Titel Bittet Gottfür uns (Molite Boga o nas, 2008). Der Film, preisgekrönt auf dem Festival „Gol-dener Recke“ (Zolotoj Vit’jaz), erzählt das Schicksal von Menschen, die zwischen1930 und 1950 auf demExekutionsfeld Butovo des NKVDhingerichtet wordenwa-ren. Da viele der Opfer später als Märtyrer kanonisiert wurden, wird Butovo oftals „russisches Golgotha“ bezeichnet. Genau in diesem Sinne erzählt der FilmIl’juchins von den stalinistischen Repressalien. Aufgenommen in Schwarz-Weißund in rostfarbener Couleur, die an alte Fotographien erinnert, inszeniert BittetGott für uns die Ereignisse dieser Zeit als Martyrium des orthodoxen Russlandswährend der Diktatur einer gottlosen Macht. Dabei sind diese Filme von der Ge-sellschaft nicht nur als einMittel gegen das stalinistische, sondern auch das post-sowjetische Trauma wahrgenommen worden. Die Filme werden als Berichte überdas „Überleben inUnruhezeiten, in den 1920-er ebensowie in den 1990-er Jahren“gesehen.²³
Eine etwas andere Tendenz in der Darstellung stalinistischer Lager verratendie zwei letzten Filme des Regisseurs Nikolaj Dostal’. Im Jahr 2007 brachte erdie Kolymaer Geschichten (Kolymskije rasskazy) von Varlaam Šalamov auf denBildschirm. Die Fernsehserie Lenins Testament (Zaveščanie Lenina) fand beimPu-blikum keine besondere Sympathie, auchwenn sie 2008 den Preis des „GoldenenAdlers“ erhielt und gleich zweifach auf dem Kanal RTR gezeigt wurde. Das magdaran liegen, dass die Prinzipien des stalinistischen Lagersystems, die jeglichemoralische Grundlagen zerstört hatten, die Leitidee des Filmes bildet. Einer der
22 Die Haltung der Filmautoren von Russland im Krieg. Blut auf Schnee (Rossija v vojnie. Krov’nasnegu, 1996), die in Russland zu Zeit der Perestrojka und während Jelzins Amtszeit praktisch alsunstrittig galt, wurde zehn Jahre später zum Hauptgegenstand des Dokumentarfilmdiskurses.Der Hauptredakteur der verbotenen Zeitung „Das Duell“ Jurij Muhin drehte den Film Die Sehn-sucht nach Stalin (Toska po Stalinu, 2007),welcher diewesentlichenPostulate vonBlut auf Schneekritisierte. Laut Muhin, sei die Zahl der Repressionsopfer stark erhöht; die Amerikaner, der Wes-ten undmit ihnen Trotzkij seien die maßgeblichen Gegner und Verleumder der Sowjetunion. DerFilmenthält überwiegendantisemitischeÄußerungenund ständigeVerweise auf „die demokrati-sche undChruščevscheVerschwörung“ gegen dieUdSSR– „das demokratischste LandderWelt“.Die Sehnsucht nach Stalin wurde nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür fand er eine breite Ver-wendung auf ultrapatriotischen Internetseiten.23 Norris, Blockbuster History, 110.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 205
Drehbuchautoren, Jurij Abramov, benannte in einemBrief andieLiteraturnajaGa-zeta zumindest Lüge und Betrug als „durchgängige Themen der Dramaturgie derSerie“ und zugleich als Daseinsprinzipien des stalinistischen Lagersystems über-haupt.²⁴ Der Film, der von Journalisten als „Urteil über die Epoche“²⁵ bezeichnetwurde, beschrieb im Detail die Schrecken des Lebens im Lager Kolyma. Offen-sichtlich hatte das Prinzip einer Darstellung der UdSSR der 1930er bis 1950er Jah-re als Repräsentation von Despotie, Gefängnis und allumfassenden Straflagers²⁶beim zeitgenössischen Publikum an Interesse verloren.
Zwei Jahre später drehte der Regisseur Nikolaj Dostal’ einen weiteren Filmzum Thema des Lagerlebens in der Stalinzeit. Petja auf demWeg ins Himmelreich(Petja po doroge v Carstvo Nebesnoe, 2009) erhielt den ersten Preis auf dem Mos-kauer Internationalen Kinofestival. Der Film ist stilistisch dem Testament Leninsvollkommenentgegengesetzt. ImZentrumder Erzählung steht nunder frei inKan-dalaks lebende, halbverrückte junge Bursche Petja – ein komischer Typ, ein Juro-divyj (ein närrischer Mensch), den zu beleidigen nach russischer Tradition eineSünde bedeutet. Am Ende des Films wird er irrtümlich vom NKVD, der flüchti-ge Gefangene jagt, umgebracht.²⁷ Die stalinistische Epoche stellt in diesem Filmeinen eher allgemeinen Hintergrund dar. Repressionen werden im Film nicht ge-zeigt. Die im Lager Eingeschlossenen sehen zwar wie unglückliche und unfreieMenschen aus, aber ihr Anblick löst eher Befremden und Angst vor dem Unbe-kannten aus. Der Zuschauer sieht das Lager mit den Augen der Siedler, die aufder anderen Seite des Stacheldrahtzaunes wohnen. Insofern erzeugen Stöße undSchreie der Aufseher gegen die dunkle Häftlingsmasse weder Entrüstung nochVerurteilung beim Publikum. Nur einigen Häftlingen gelingt es, diese Grenze derEntfremdung zuüberwinden. ZumBeispielwird der jüdischeHäftlingDoktor Joffeder Frau des Lagerkommandanten zur Verfügung gestellt, die ihrerseits innerhalbeines amourösen Dreiecks versucht, den ungeliebten Mann zu manipulieren und
24 Jurij Abramov: „Steržnevoj osnovoj dramaturgii seriala, jego skvoznoj temoj javlajetsia lož“,in: Literaturnaja gazeta, 04.07.2007: http://www.lgz.ru/article/785/.25 Aleksandr Rogatkin: „Prigovor epoche“, in: Vesti, 04.06.2007: http://www.vesti.ru/doc.html?id=124561.26 Oksana Sarkisova hebt die Motive „Knast“ und „Ausbruch“ als filmische Schlüsselstoffe impostsowjetischen Kino hervor, vgl. Oksana Sarkisova: Long Farewells. The Anatomy of the So-viet Past in Contemporary Russian Cinema, in: Oksana Sarkisova/Péter Apor (Hrsg.), Past for theEyes. East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Buda-pest/New York 2008, S. 145–152.27 Alexander Jakobidze-Gitman: „The Stalin Era in Secondary Processing“, 25 May 2010, in: Art-margins. Contemporary East and Central European Visual Culture: http://www.artmargins.com/index.php/6-film-a-video/580-stalin-era-secondary-processing-film-review-article.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
206 | Liliya Berezhnaya
an ihm Rache zu üben. Der „dämonische Stalinismus der Lager“ fehlt hier fastvollständig. Ungeachtet dessen tritt Petja beinah als Hauptrepräsentant seinerZeit auf, der im selben Jahr wie Stalin stirbt. Auf dem Bildschirm tauchte nun der„kleine Mann“ in der führenden Rolle auf – die Zeit des „gewöhnlichen Stalinis-mus“ war gekommen.
Der Große Vaterländische Krieg, der Glaube undstalinistische VerbrechenWomöglich gibt es kein besseres Genre als den Kriegsfilm, um die Rolle des „klei-nen Mannes“ in der Geschichte darzustellen. Das anwachsende Interesse an derKriegsthematik im russischen Kino wurde schon länger zum Forschungsgegen-standvonHistorikernundKinoexperten.²⁸DieGründe für die aktuelleKonjunkturdes Zweiten Weltkrieges sah man im verletzten Nationalstolz einer ehemaligenWeltmacht, fortgesetzten imperialen Ambitionen sowie im Versuch in der Ge-schichte einen gewissen „Moment der Wahrheit“ zu finden, in dem persönlicheInteressen dem Sieg im Krieg untergeordnet waren. Die russische Führung för-dert solche Stimmungen beim Kinopublikum durch die Initiierung patriotischerKinofestivals, wie etwa „Goldener Recke“ (Zolotoj Vit’jaz) oder „Das Festival desKriegskinos“ (Festival’ vojennogo kino).²⁹
Interessanterweise rief das Bedürfnis der Bevölkerung nach einer Revisiondes Bildes vom „Großen Vaterländischen Krieg“ eine nachhaltige Reaktion unterden Dokumentarfilmregisseuren hervor. In einigen jüngeren Filmen werden Sta-lin und seine Entourage als Feinde des siegreichen Volkes dargestellt. Besondersaugenfällig wird diese Idee in Sieger über die Sieger (Pobediteli pobeditelej, 2010)des Regisseurs Aleksej Smagljuk. Der Film berichtet von der Ermordung der Ge-neräle der Roten Armee, die in deutsche Gefangenschaft geraten waren, durchden NKVD. Der Sieg über die „Faschisten“ wird tituliert als „großes Ereignis inder geistigen Geschichte der Menschheit“, das die Sowjetmenschen zu „Gestal-tern der Geschichte“ machte. Der „Algorithmus der Sieger“, von dem sich die vonder Front heimgekehrten Soldaten leiten ließen, entsprach den Filmesprechern
28 Isabel de Keghel: Ungewöhnliche Perspektiven. Der Zweite Weltkrieg in neueren rußländi-schen Filmen, in: Osteuropa 4–6 (2005), S. 337–346; Denise J. Youngblood: Russian War Films.On the Cinema Front, 1914–2005. Lawrence 2006, Kap. 9; siehe auch die Rezension von ElenaBaraban in: Canadian Slavonic Papers 50,1 (2008), S. 277–278.29 Sarkisova: Long Farewells, S. 158.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 207
zufolge nicht den Vorstellungen Stalins von einer einzigen homogenen Macht imStaat. Analoge Schlussfolgerungen finden sich im Film Stalin gegen die Rote Ar-mee (Stalin protiv Krasnoj Armii, 2011), der von Regisseur Daniil Serych imAuftragdes Fernsehkanals NTV gedrehtwurde. Hitlers Entscheidung, die Sowjetunion imJuni 1941 zu überfallen, wird mit der Erschöpfung der Roten Armee infolge derstalinistischen Repressalien des Jahres 1937 erklärt. Auf diese Weise werden diegroßen Verluste in den ersten Kriegsmonaten als Folge der Politik des Kreml’ dar-gestellt. Und nur dank des Heroismus des gewöhnlichen Sowjetsoldaten sei esgelungen, dem deutschen Angriff standzuhalten.³⁰ In diesen Dokumentarfilmenwird die „Historizität“ und die „Wahrheit“ des Dargestellten durch Kommentareeines Sprechers und durch die argumentative Logik der Erzählführung erzielt. MitBill Nichols gesprochen: Beim Zuschauer entsteht der Eindruck der „Stimme Got-tes“ hinter dem Bildschirm.³¹
Gepaart mit der Kritik an der stalinistischen Politik versucht das russischePost-Perestrojka-Kino über den „Großen Vaterländischen Krieg“ den Krieg alsschwere Prüfung darzustellen. Rimgaila Salys nennt diese Art Film über dieStalinzeit „kompensatorisch“, insofern diese versuchten, einige Aspekte dieserZeit von ihren negativen Konnotationen zu befreien.³² Diese Filme thematisierenhäufig die Wandlung des „kleinen Mannes“ zum Helden, berichten von seinemWiderstand gegen das Regime und verherrlichen dessen moralische Überlegen-heit über die inneren und äußeren Gegner. Besonders instruktiv sind in dieserHinsicht die Serie des schon erwähnten Nikolaj Dostal’ Strafbatallion (Štrafbat,2004)³³ und die zwei neuen Blockbuster von Nikita Michalkov (Von der Sonne
30 Der Film Das letzte Geheimnis des 2. Weltkrieges (Posledniaja tajna vtoroj mirovoj, 2007) vonAlexej Denisovwurde vonGRTK inAuftrag gegebenundhandelt vonRepressionendesNKVD, dieim Jahre 1945 gegen Kosakenfamilien, Angehörige der Vlasov-Armee, russische Emigranten undzur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppte Sowjetbürger gerichtet waren. Aus der Sichtder Filmautoren, gilt die Hauptschuldzuweisung den politischen Regierungen Großbritanniensund der USA, die gemäß den Verträgen von Jalta diese Menschen dem NKVD übergeben hat-ten. Nichtsdestotrotz wird auch Russland (genau so wird die UdSSR im Film genannt) nicht vonjeglicher Schuld freigesprochen. Der Film beginnt und endet mit Bildern von „Tepluški“ (Güter-wagen für Gefangene), Hunden und Stacheldrahtzaun, die das Russland Stalins repräsentieren.Das Lager bildet in der visuellen und textuellen Rangordnung einen Antagonismus zum Bild desschuldlos leidenden Volkes.31 Bill Nichols: Introduction to Documentary. Bloomington 2011, S. 167.32 Rimgaila Salys: Infernal Energy: Revisioning the Stalin Era, in: KinoKultura 33 (2011):http://www.kinokultura.com/2011/33-salys.shtml.33 Isabel de Keghel: The Penal Battalion: a Russian TV Series between Reassessing History andStaging Patriotism, in: Kultura 3 (2005), S. 15–17; Peter Jahn: Patriotismus, Stalinismuskritik undHollywood. Der ‚Große Vaterländische Krieg‘ in russischen TV-Serien der Gegenwart, in: Beate
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
208 | Liliya Berezhnaya
getäuscht 2: Exodus (Predstojanie, 2010) und Von der Sonne getäuscht 3: Zitadelle(Citadell, 2011). Beide Filme sind im Zug der „Umschreibung der Geschichte“ ge-schaffen, wie sie für das spätere Werk von Michalkov so aktuell ist.³⁴ Sie drohtenan den Kinokassen jedoch zum Flop zu werden,³⁵ lösten unter den Zuschauernund den Kritikern aber dennoch Diskussionen aus. Im jüngst erschienenen Buch„Offene Rede“ (Prjamaja reč’) schreibt Michalkov, er habe den Film für die Ju-gend gemacht, die nichts über den Krieg wisse und auch das sowjetische Kinozu diesem Thema nicht kenne.³⁶ Er schuf mit der Fortsetzung von Von der Son-ne getäuscht ein Pendant zum Spielberg-Film Saving Private Ryan (1998): einepersönliche Geschichte vor dem Hintergrund des großen Krieges. Es sollte einerussische Alternative zur Hollywood-Version des Zweiten Weltkrieges sein. DerFilm erzählt die tragische Familiengeschichte Kotovs, der im Verlauf des Filmsseine erwachsen gewordene Tochter wiederfindet und seine Frau erneut verliert.Die stalinistischenRepressionenunddas Lagermilieu bilden lediglich denHinter-grund für die religiöse Erweckung Kotovs, der zunächst einen Priester hinrichtet,als Gefangener seine Sünden bereut und schließlich zu einem moralischen Füh-rer, General und Otec (Pater) seiner Soldaten wird.³⁷
Die Haupthelden der drei Filme sind Strafgefangene, von Repressalien unter-drückte Soldaten und Offiziere, die im Kampf gegen die Wehrmacht das eigeneLeben nicht schonen, in deren Rücken aber stets Wachabteilungen erscheinen.
Fieseler/Jörg Ganzenmüller (Hrsg.): Kriegsbilder. Mediale Repräsentationen des ‚Großen Vater-ländischen Krieges‘. Essen 2010, S. 115–130.34 Birgit Beumers erkennt in Michalkovs Hinwendung zur Geschichte das persönliche Bedürf-nis, eine ideelle und charismatische Vaterfigur zu finden oder zu erzeugen: sei es in Kotov oderZar Alexander III, vgl. Birgit Beumers: Nikita Mikhalkov: between Nostalgia and Nationalism.London/New York 2005, S. 124; vgl. auch: Tatiana Moskvina: „La Grande Illusion“, in: Birgit Beu-mers (Hrsg.), Russia onReels: TheRussian Idea inPost-Soviet Cinema. KINO: TheRussianCinemaSeries. London/New York 1999, S. 91–104.35 „Von der Sonne getäuscht 2: Exodus“ brachte es in den ersten zwei Verleihwochen auf einesehr niedrige Zuschauerzahl, in den zwei Monaten des Jahres 2010 spielte der Film lediglich 217Mio. Rubel ein (ca. 5,2 Mio. Euro): http://kinometro.ru/release/card/id/1252. Das Filmbudget be-lief sich auf 40 Mio. USD. „Von der Sonne getäuscht 3: Zitadelle“ schnitt noch schlechter ab –die Einnahmen für 2011 ergaben nur 42Mio. Rubel (ca. 1 Mio. Euro): http://kinometro.ru/release/card/id/4371. Die Produktionskosten beliefen sich auf 34 Mio. USD.36 Nikita Mikhalkov: Prjamaja rec’. Moskau 2011, S. 326.37 Die Geschichte Kotovs in der Trilogie von Michalkov ist ein typisches Motiv des zeitgenössi-schen russischen Kinos, wie es Aleksandr Etkind beschrieben hat: die Wandlung des Sünderszum Opfer und anschließend zum moralischen Vorbild, vgl. Aleksandr Etkind: The tale of twoturns: Khrustalev, My Car! and the cinematic memory of the Soviet past, in: Studies in Russianand Soviet Cinema 4,1 (2010), S. 45–63.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 209
Im Ergebnis kommt ihre Opferbereitschaft christlichem Märtyrertum gleich, ihreHeldentaten werden religiös überhöht. Es vollzieht sich eine Remythologisierungder Stalin-Epoche und eine Sakralisierung der Kriegszeit.³⁸ Diese Parallelen wer-den in der letzten Szene von Strafbataillon deutlich, als über den Körpern derim Kampf gefallenen Bataillonssoldaten das leuchtende Antlitz der Gottesmut-ter erscheint.³⁹ Und der frühere Divisionskommandeur Kotov entgeht in Von derSonne getäuscht 2: Exodus auf wundersame Weise dem Tod, indem er dank desBeistands einerMutter-Gottes-Ikone die Bombardierung einer Kirche überlebt. Imdritten Film aus demEpos,Von der Sonne getäuscht 3: Zitadelle, führt der von Sta-lin rehabilitierte Kotov seine mit Stöcken bewaffneten Soldaten über Wasser undtrockenes Gelände zum Angriff auf die feindliche Festung. Dabei vermögen diedeutschen Soldaten nicht einmal Widerstand zu leisten, da durch eine seltsameVerkettung von Umständen die Festung aus unerklärlichen Gründen in die Luftgesprengt wird.
Allgemein sind religiöse Motive sehr populär in Filmen über den Krieg. Ei-ne besondere Stellung nehmen in dieser Kategorie dokumentarische Filme überdie Rolle der russischen orthodoxen Kirche im Kampf gegen die Deutschen ein.Zwei Filme betrachten dieses Thema durch das Prisma der Beziehung zwischenKirche undSowjetmacht in den Jahrendes „GroßenVaterländischenKrieges“:FürGlauben und Vaterland (Za veru i otečestvo, 2010, Regie Jurij Linkevič) sowie Stalinund das 3. Rom (Stalin i tretij Rim, 2006, Regie Viktor Beljakov). Beide Filme the-matisieren die Wiedererrichtung des Patriarchats im Jahr 1943 und die schwereEntscheidung von Metropolit Sergij (Stragorodskij) zur Zusammenarbeit mit dematheistischenRegime. In beidenFällenwird der Kompromissmit der Sowjetmachtmit den Notwendigkeiten des Krieges und den gemeinsamen Interessen von Kir-che und Volk gerechtfertigt. Zu den künstlerischen Filmen zum Thema Religion,Stalinismus undKrieg zählt auch der vonRegisseur Chotinenko gedrehte FilmDerPope (Pop, 2009) über die Pskover Mission in den besetzten Gebieten. Auch dasMelodram Ein Krieg (Odna vojna, 2010) von Vera Glagoleva über die Repressionengegen sowjetische Frauen, die Kinder von deutschen Gefangenen bekommen hat-ten, gehört zu diesem Genre der religiösen Erweckungsfilme. Eine der Heldinnenbittet aus Verzweiflung und angesichts des nahen Todes in einem Gebet vor einerkleinen Ikone um ihre Rettung, wird erhört und überlebt.
38 Jakobidze-Gitman: Istorija kak „predmet podražanija“. S. auch Natascha Drubek, RussianFilm Premieres in 2010/11: Sacralizing National History and Nationalizing Religion in: LiliyaBerezhnaya/Christian Schmitt (Hrsg.): Iconic Turns. Nation and Religion in Eastern EuropeanCinema since 1989, Leiden, 2013, S. 81–98.39 Norris, Blockbuster History, S. 120–124.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
210 | Liliya Berezhnaya
Bemerkenswert ist, dass bei all diesen Filmen Repressionsopfer als Haupt-helden auftreten. Auf diese Weise werden die Leidtragenden der staatlichen Ge-walt in ein patriotisches Geschichtsbild integriert. DenOrganisatoren des Terrors,den Offizieren des NKVD, und der stalinistischen Herrschaft wird bei der Verbild-lichung hingegen nur eine Nebenrolle zuteil. Die Regimevertreter erscheinen ent-weder in einer Aura von abstoßender Faszination, wie etwa der „Osobist“ (NKVD-Offizier) im Strafbataillon, oder sie wechseln auf die Seite der Opfer, wofür siedann ihrerseits Repressionen durch die Sowjetmacht erfahren. So entpuppt sichetwa ein Major des NKVD in dem Film Ein Krieg, der zur Verschickung verhaf-teter Frauen in ein Lager eintrifft, als Veteran, der im Verlauf des Krieges seineFamilie verloren hat. Die letzte Szene des Films zeigt seine Wandlung von einemskrupellosen Werkzeug des Regimes zu einem Menschen mit hohen moralischenPrinzipien. Am Ende des Films verhindert der Major nicht die Flucht der Frauenund Kinder zu den Altgläubigen, womit er sein eigenes Todesurteil unterschreibt.
Sicherheitsorgane der Stalinzeit – Henker oderVerteidiger des VaterlandesEs ist viel darüber geschrieben worden, dass der gesellschaftliche Diskurs überdie stalinistischen Repressionen den Akzent auf die Leiden der Opfer setzt unddie Täter praktisch nicht zur Kenntnis nimmt.⁴⁰ Im Kino ist diese Akzentver-schiebung gegenüber der Perestrojka-Zeit besonders deutlich. In einer Reihe vonFilmen (zum Beispiel in Einer von uns (Svoi), Dmitrij Meskiev, 2004) oder Ein hal-ber Augenblick (Polumgla, Artem Antonov, 2005) ist die Grenze zwischen Täternund Opfern sogar aufgehoben.⁴¹ Zwei zeitgenössische Fernsehserien verarbeitendie Rolle des NKVD bei den stalinistischen Repressionen zu Actionfilmen. Die Li-quidierung (Likvidacija, 2007, Regie von Sergej Ursuljak) undDer Apostel (Apostol,2008, Gennadij Sidorov, Jurij Moroz) thematisieren in einer Mischung aus James-Bond-Film und spätsowjetischem Stil die heroische Rolle der Mitarbeiter der
40 Alter L. Litvin/John L. H. Keep: Stalinism: Russian andWestern Views at the Turn of the Mille-nium. TotalitarianMovements and Political Religions. London 2004, S. 68–77 und 97–100;ArsenijRoginskij: Erinnerung und Freiheit. Die Stalinismus-Diskussion in der UdSSR und Russland, in:Osteuropa 61, 4 (2011), S. 55–60; ders.: Fragmentierte Erinnerung. Stalin und der Stalinismus imheutigen Russland, in: Osteuropa 59, 1 (2009), S. 37–44.41 Zu Polumgla siehe auch: Christine Engel: 60 Jahre danach. Neue Sichtweisen auf den ‚GroßeVaterländischen Krieg‘ im Film Polumgla, in: Beate Fieseler/Jörg Ganzenmüller (Hrsg.): Kriegs-bilder. Mediale Repräsentationen des ‚Großen Vaterländischen Krieges‘. Essen 2010, S. 95–113.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 211
Sicherheitsorgane bei der Bekämpfung von Verbrechen und im Kampf gegen diedeutschen Besatzer. Dies ist freilich nur eine der Varianten der Interpretationder Filmsujets. Likvidacija erzählt von der Vernichtung einer Bande von Unter-grundsaboteuren – Kämpfern der Ukrainischen Aufstandsarmee – im Odessa derNachkriegszeit. Der Film hält sich nicht an die historischen Gegebenheiten undblendet die politischen Ziele der ukrainischen Kämpfer vollständig aus. Grau-samkeiten der Sicherheitsorgane werden nicht gezeigt, stattdessen erscheinendie Mitarbeiter des NKVD als aufrechte Kämpfer gegen das organisierte Verbre-chen und Garanten von Ruhe und Ordnung.
Die zweite Serie,Der Apostel, wurde von den Kinokritikern positiv aufgenom-men. Sie erzählt die Geschichte von zwei Zwillingsbrüdern, Pjotr und Pavel, vondenen einer während des Krieges von den Deutschen angeworben und für dieDurchführung von Sabotageakten nachMoskau geschickt wird. Der andere ist einDorflehrer, der ein beschauliches Familienleben führt, aber unter den stalinis-tischen Repressionen zu leiden hat. Als dessen Bruder, der Saboteur, bei einemFluchtversuch ums Leben kommt, erpresst das NKVD ihn zu einem Doppelspielmit der deutschen „Abwehr“. Umseine Familie zu retten,muss sich derDorflehrerdie Verhaltensmuster eines Kriminellen zu eigenmachen und zum Spionwerden.Der Kritiker Jurij Bogomolov machte auf die „Retromotive“ in beiden Filmen auf-merksam, insbesondere auf die Rückkehr zu Stilistik und Sujets des sowjetischenKinos. Im Fall von Die Liquidierung finden sich offensichtlichste Parallelen zuder Serie Der Treffpunkt darf nicht geändert werden (Mesto vstreči izmenit’ nel’zja,1979) vonStanislavGovoruchin.Die Sujetlinie undviele SzenenausApostolhabengroße Ähnlichkeiten mit dem Film Siebzehn Momente des Frühlings (Semnadcat’mgnovenija vesny, 1973) von Tatjana Lioznova. Bogomolov konstatiert, dass esallen vier Serien gelänge, beim Zuschauer „traurige kollektive Emotionen“ zu we-cken. Der Apostel thematisiere etwa den Komplex der Feindschaft zwischen derEinzelperson und dem Staat sowie das Gefühl des Ausgesetztseins durch diesenStaat während der Heimsuchungen des Krieges.⁴² Diese Motive behalten ihre Ak-tualität. Ferner verkörpert der Spezialagent, der seinemSchicksal überlassenwirdund für das Leben seiner Familie kämpfen muss, ein Motiv ganz in der TraditionvonHollywood und entbehrt jeglichen historischenHintergrunds. Trotzdemkann
42 Bogomolov, Prošloje kak prijem. Zwei Tendenzen sind in der Feinddarstellung bei den zeit-genössischen russischen Filmen zu beobachten: eine dichotomische Gegenüberstellung von„Unseren“ und den „Anderen“, und eine Verwischung der Grenze zwischen den beiden. Vgl.Oleg Sulkin: Identifying the Enemy in Contemporary Russian Film, in: Stephen M. Norris/ZaraM. Tortone (Hrsg.): Insiders and Outsiders in Russian Cinema. Bloomington/Indianapolis 2008,S. 113–125.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
212 | Liliya Berezhnaya
man nicht behaupten, dass die Repressionen hier verschwiegenwürden. Ganz imGegenteil: Das Heldentum der NKVD-Angehörigen besteht gerade darin, dass siedie Fallen umgehen, die von „inneren“ wie „äußeren“ Feinden gestellt werdenund ihre Ehre unbefleckt aufrechterhalten.
Nostalgie der stalinistischen Vergangenheit –zwischen Seifenoper, Gangsterdrama und FarceDie Heroisierung der stalinistischen Vergangenheit, die Sakralisierung des Sie-ges im Krieg, die verwischten Grenzen zwischen Opfern und Tätern – all das trugauf die eine oder andere Weise zum Entstehen nostalgischer Erinnerungen überdie sowjetische Vergangenheit bei. Nicht wenig trugen Filme dazu bei, welche die1930er bis 1950er Jahre durch die Augen von Kindern schildern. Ein klassischesBeispiel istDer Dieb (Vor, 1997) von Pavel Čuchraj. Einerseits zeigt der Film detail-liert und mit offener Sympathie das Leben in der Komunalka und die Atmosphärein einem vom Krieg zerstörten Provinzstädtchen, andererseits erzählt er von derendlosen Täuschung und Mimikry der Haupthelden, zu welcher die Atmosphäreder Stalinzeit sie nötigt. Ein Kapitän der sowjetischen Armee ist eigentlich keinKapitän, sein Sohn ist nicht sein Sohn, und ein gewöhnlicher Dieb geriert sich inseiner Umgebung als „Väterchen Stalin“.
Solche Filme über den „gewöhnlichen Stalinismus“ tragen nicht unwesent-lich zum Entstehen nostalgischer Stimmungen in der Gesellschaft bei. Nebendem schon klassisch gewordenen Film Der Dieb ist in diesem Zusammenhangan Zwei Fahrer (Echali dva šofjora, 2002) von Aleksandr Kott zu erinnern. Das et-was simple Sujet, aufgenommen nach Motiven der Ballade Čujskij traktat, erzähltdie amouröse Dreiecksgeschichte vom Lastwagenfahrer Kolja, seiner KolleginRaja und dem Piloten eines Postflugzeugs. Die Geschichte dieser Beziehungenist angesiedelt im Altaj der Nachkriegszeit und stellt so etwas wie eine „sowjeti-sche Idylle“ dar. Die Kritikerin Natalia Sirivlja charakterisiert den Inhalt von ZweiFahrer folgendermaßen: „Ein Film über ‚das Gute und das Ewige‘, in dem es kei-nen einzigen Schuss gibt. Der Konflikt gerät zu einem Kampf ‚des Guten mit demBesseren‘, und eine unschuldige Liebeskollision löst sich durch das Wettrennenzweier Lastwagen“.⁴³ Die nostalgischen Töne im Film von Kott sind zentral. Daherist der Meinung von Rimgaila Salys nicht ganz zuzustimmen, dass Zwei Fahrerbar jedes „historischen Denkens“ sei. Tatsächlich sind Symbole der Sowjetmacht
43 Nataliya Sirivlya: Igra v mašinki, in: Iskusstvo kino 2 (2002), S. 43.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 213
und des Sozialistischen Realismus (Losungen an den Wänden, Statuen von Fall-schirmspringern oder der schwarze Teller eines Lautsprechers mit triumphalerMusik) nicht nur „metonymische Tricks, eingesetzt zur Erzielung komischer Ef-fekte“.⁴⁴ Das Ziel von Kott war ebenso eine Nachschöpfung der Atmosphäre einer„romantischenNachkriegszeit“. Der Film ist somit auch ein Tribut an die nostalgi-schen Erlebnisse der älteren Generation, die auf ihre Weise zur Überwindung desdurch Repressalien und Krieg bedingten kollektiven Traumas fähig war. Deshalbschenkte Kott den historischen Details eine solche Aufmerksamkeit.⁴⁵ Filme wieZwei Fahrer oder Der Dieb befördern in der Gesellschaft eine gewisse einseitigeMischung von Vorstellungen über den Stalinismus, in der es sowohl Raum fürLeiden einzelner Leute, als auch für Bilder von Stabilität und Patriotismus gibt,aber auch Beispiele von hohen moralischen Eigenschaften einen Platz finden.
In den letzten Jahren neigte sich dieWaagschale deutlich zugunsten der letzt-genannten Interpretation. Im Jahr 2007, als die Leinwandadaptionen von Solže-nicyn und Šalamov erstellt wurden, lief im russischen Fernsehen zugleich eineSerie ganz anderer Art an: Stalin Live. In einerMischung aus Dokumentarfilm undSeifenoper setzte der Regisseur Grigorij Ljubomirov für den Fernsehsender NTVdas letzte Lebensjahr des Diktators in 40 Folgen in Szene und entwarf ihm da-bei eine neue Persönlichkeit: der alternde Herrscher blickt auf sein Leben zu-rück, gesteht Fehler ein⁴⁶und rezitiert biblische Fragmente auswendig. Außerdemrechtfertigt der Film sogarmancheRepressalienmit derNotwendigkeit, deutsche,englische und später amerikanische Terrorakte zu verhindern. Folgt man dem, sohat es keine unschuldigen oder sinnlosen Opfer gegeben.
Allerdings bedeuten die nostalgischen Filme über den Stalinismus keines-wegs „einen weiteren Schritt hin zur endgültigen Aufkündigung des einstigenantistalinistischen gesellschaftlichen Konsens.“⁴⁷ Neben Stalin Live erschienenauf den russischen Bildschirmen der Abenteuerfilm von Jurij Gusman Der Parkder sowjetischen Periode (Park sovetskogo perioda, 2006) und die GangsterserieDas Rudel (Staja, 2009). Beide Filme platzieren ihre begüterten und erfolgreichenHelden in ein ungewöhnliches „Sanatorium“ der Stalinzeit. Für den Hauptheldenvon Der Park ist es tatsächlich eine Art „Pension“ am Ufer eines warmen Meeres,ein Symbol für ein multiethnisches und friedliches Imperium, wo die Urlaubersich eine Rolle vom hohen Parteifunktionär bis zum Dissidenten auswählen kön-
44 Rimgaila Salys, Infernal Energy.45 Svetlana Boym: The Future of Nostalgia. New York 2001, Kap. 6; Sarkisova, Long Farewells,S. 165–169.46 Frieß: Nichts ist vergessen, niemand ist vergessen?, S. 95–96.47 So Nina Frieß, vgl. ebd., S. 97.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
214 | Liliya Berezhnaya
nen. Und in Das Rudel haben sich die Personen sogar dazu entschieden, in einerArt parodiertem stalinistischem Lager zu leben. Doch als der Held sich weigertnach den dort geltenden Regeln zu spielen, wandelt sich das Spiel augenblicklichzur realen Welt der Repressionen. Die Auflösung ist in beiden Filmen allerdingshöchst unterschiedlich. Der Park endet wie eine Parodie auf den eingangs er-wähnten Film Die Reue, indem hier der geläufige Satz paraphrasiert wird zu „Werbraucht eine Straße, die nicht in den Park der sowjetischen Periode führt?“⁴⁸Das Rudel vertauscht die Plätze von Opfern und Tätern und spielt auf die ma-fiösen Strukturen des gegenwärtigen Russlands an, indem es die Unterschiedeverwischt, wer jeweils hinter Gittern sitzt und wer in Freiheit lebt.
FazitWie hat sich die Darstellung der Stalin-Zeit im russischen Kino seit der Mitteder 1990er Jahre geändert? Zunächst haben Fernsehproduzenten ihr Interesseam Thema entdeckt. Serien, die in den letzten Jahren aufgelegt wurden, wa-ren für ein Massenpublikum bestimmt, das früher oder später zumindest einigeTeile ansieht. Zweitens gibt es in der Interpretation der stalinistischen Vergan-genheit eine gewisse Ambivalenz. Es tauchten neue Themen auf, denen man inder Perestrojka-Zeit noch keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Dies betrifft inerster Linie das Thema des „Großen Vaterländischen Krieges“, den Heroismusund das Märtyrertum des einfachen Soldaten, der sowohl unter den deutschenBesatzern als auch unter dem Hohn des NKVD leidet. Neu mutet ferner der nos-talgische Blick auf die Stalinzeit an, zumal die Regisseure darum bemüht sind,das vergangene und das gegenwärtige Russlandmit demMittel der Nostalgie mit-einander in Verbindung zu setzen. Nostalgie bedeutet hier allerdings nicht derWunsch nach einer Rückkehr der Vergangenheit. Die Stalin-Zeiten sind in man-chen Filmen vielmehr als eine verlorene Heimat dargestellt. Im Unterschied zur„restaurierenden“ (restorative) Form der Nostalgie, postulieren zeitgenössischerussische Filme eher ihre „reflektierende“ (reflective) Prägung.⁴⁹
Die alten Themen der Unterdrückung der Opfer in den Lagern und der Dämo-nisierung der Täter unterlagen ihrerseits einemWandel. In vielen Filmen erschei-
48 Sarkisova sieht in diesem Zitat die Perversion, die „die Geschichte zur Farce macht“, vgl.Sarkisova, Long Farewells, S. 177.49 Norris, Blockbuster History, 294–296.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.
Die Stalinzeit im russischen Postperestroika-Film | 215
nen die gewohnten Grenzen zwischen den beiden Welten endgültig verwischt.⁵⁰Das Thema der stalinistischen Repressionen ist zweifellos auch für das heutigeRussland nach wie vor aktuell. Seine Interpretation hat jedoch komplexere For-men angenommen als dies noch in der Perestrojka-Zeit der Fall war. Dabei istweniger eine Aufkündigung des antistalinistischen Konsenses zu beobachten, alsTendenzen zur Kommerzialisierung, zur patriotischen Sinnstiftung und auch zueiner Differenzierung der in der Perestrojka-Zeit etablierten klaren Täter-Opfer-Dichotomie.
50 Auf diese Weise wird beim Zuschauer eine vielschichtige Vorstellung von der stalinistischenVergangenheit erzeugt, welche von Andrey Shcherbenok als „vernäht“ („sutured belief“) be-zeichnet wurde. Das bedeutet, der Zuschauer stimmt mit der einseitigen Bilddarstellung vonStalinismusaufder Leinwandvölligüberein.Die Schichtungvonderart einseitigenHerangehens-weisen auf dem Bildschirm erreicht eben den Effekt von Komplexität. Vgl. Andrey Shcherbenok:This Is Not a Pipe: Soviet Historical Reality and Spectatorial Belief in Perestroika and Post-SovietCinema, in: Slavonica 17,2 (2011), S. 145–155; Evgeny Dobrenko/Andrey Shcherbenok: BetweenHis-tory and the Past: The Soviet Legacy as Traumatic Object of Contemporary Russian Culture, in:Slavonica 17,2 (2011), S. 77–84.
This
art
icle
is p
rote
cted
by
Germ
an c
opyr
ight
law
. You
may
cop
y an
d di
strib
ute
this
art
icle
for
your
per
sona
l use
onl
y. O
ther
use
is o
nly
allo
wed
with
writ
ten
perm
issi
on b
y th
e co
pyrig
ht h
olde
r.
Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hrsg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen (Europas Osten im 20. Jahrhundert. Schriften des Imre Kertész Kollegs Jena, Band 4). ISBN 978-3-486-74196-4 © Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2014.