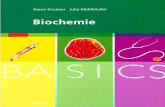Phineas ben Eleazar (German)
Transcript of Phineas ben Eleazar (German)
Danksagung
Dieses Buch stellt die geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertationdar. Für das Zustandekommen der Arbeit danke ich zuerst meinem Doktor-vater, Prof. Arndt Meinhold, der das Thema dieses Buches angeregt, sein Ent-stehen kritisch begleitet und meine manchmal eigenwilligen Lösungsansätzemitgetragen hat. Prof. Ernst Joachim Waschke verdanke ich mehrere grund-sätzliche Rückfragen in der abschließenden Arbeitsphase. Er hat mich zur Ent-schiedenheit in den Thesen gedrängt. Prof. Uwe Becker hat freundlicherwei-se die Arbeit des Drittgutachters übernommen. Ich danke den Mitarbeiterndes Alttestamentlichen Seminars, allen voran Dr. Benjamin Ziemer, mit demich ausführlich wichtige Aspekte zu Pinhas diskutieren konnte. Mit ThomasNeumann habe ich während der ersten Arbeitsphasen eng zusammengearbei-tet. Zu allererst verdanke ich ihm den Zugang zur Palästinawissenschaft. MitJens Kotjatko und Marianne Schröter habe ich einzelne Teile der Dissertati-on detailliert besprechen können. Die Sekretärinnen Brigitte Möhwald undUta Sobotta habe auf je ihre Weise zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäreim Institut beigetragen. Sandra Schippenbeil hat das Buch insgesamt Korrek-tur gelesen. Die landeskundlichen Fragen konnte ich während des Lehrkurses2002 vertiefen. Allen Beteiligten sei herzlicher Dank gesagt. Ich danke Prof.Rüdiger Lux für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe ABG und Dr. Annet-te Weidhas für die verlegerische Betreuung. Dankbar bin ich auch PfarrerinHeyser und den Gemeinden in Trotha und Seeben, wo ich mich als Vikarangenommen fühle und dabei die Dissertation zu Ende führen konnte. DieFöderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland hat dankenswerter-weise einen Teil der Druckkosten übernommen. Besonders bedanke ich michbei meiner Familie für ihr Nachsehen, wenn ich zwar zuhause, in Gedankenaber ganz woanders war. Das Buch ist meinen Eltern gewidmet. Sie habenmeine theologische Ausbildung in vielfältiger Weise unterstützt und auch amWerden »meines Pinhas« regen Anteil genommen.
Brandenburg an der Havel im Advent 2005 Johannes Thon
Inhaltsverzeichnis
Thesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XIII
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Ein Überblick zur Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Name und Herkunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Persönlicher Eifer und Bundesgabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3 Weitere Lebensdaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 Der Beginn der Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.5 Außerbiblische Texte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Forschungsgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3 Sich ergebende Fragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Zur Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.1 Traditionskritik – Literarkritik – Intertextualität . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.2 Zur Interpretation von Genealogien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4.3 Zur Deutung von Grabnotizen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Baal Peor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1 Num 25 – Problembeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Die Plage, Peor und Bileam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.1 Erster Lösungsansatz: Zuordnung zu Quellen . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.2 Zweiter Lösungsansatz: Traditionsgeschichtlich . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.3 Dritter Lösungsansatz: Fortschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3 Das Ziel der Pinhas-Episode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.1 Die Midianiterin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.2 Die � ��� �� qubbah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.3 Mose und Pinhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.3.4 Eheliche Verbindung mit Nichtisraeliten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.4 Num 25 und Ex 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4.1 Die Leviten und ihr Eifern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.5 Num 25 und Num 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.6 Schichtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.7 Literarische Intention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
X Inhaltsverzeichnis
3 Die Bundestradition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1 Der Levibund – Mal 2,4–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.1.1 Ableitung der Vorstellung vom Priesterprivileg . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.1.2 Mal 2,4 – ein syntaktisches Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2 Literarisches Verhältnis der Belegstellen für den Priester- undLevitenbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3 Priestertumsgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.1 Die elidische Erwählungstradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.2 Die priesterliche Levi-Tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.1 Der Midianiterkrieg – Num 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2 Vorsteher der Tür- und Schwellenhüter – 1 Chr 9,20 . . . . . . . . . . . . . 83
4.3 Der Altar am Jordan – Jos 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3.1 Der Streitpunkt: Einheit durch Abgrenzung oder Integration . . 85
4.3.2 Redaktionskritische Einordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.3.3 Eine Altarätiologie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.3.4 Die Schichtung des Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3.5 Ostjordanland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3.6 Beziehung zwischen Jos 22 und Num 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.7 Stellung von Jos 22 am Schluß des Josuabuches. . . . . . . . . . . . . . 94
4.3.8 Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Das Orakel in Bethel – Ri 20,27 f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.5 Redaktionelle Verknüpfungen zwischen Num, Jos und Ri . . . . . . . . . . 98
5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.1 Der Kontext: Jos 24,29–33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2 Offene Fragen als Hinweis auf einen traditionsgeschichtlichenHintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.3 Zur Septuagintaversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.4 Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065.5 Zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.5.1 Die südliche Tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.5.2 Die Tradition bei Sichem: ������ �awarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.5.3 Alter der Paralleltraditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.6 Aaroniden im Gebirge Ephraim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.7 Traditionsgeschichtlicher Bezug zum Gibea von Kirjat Jearim. . . . . . . 118
5.8 Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Inhaltsverzeichnis XI
6 Genealogische Texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.1 Ex 6,14–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256.2 Esr 8,2 – »Die Pinhasiden«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326.3 2 Sam 8,17 – Das Verhältnis zu Pinhas ben Eli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7 Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Literaturverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Stellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Thesen
Gesamtthese: Bei der Endgestaltung der Tora wird Pinhas ben Eleasar als Ahndes legitimen Priestertums vorgeführt. Er stellt eine genealogische Konstrukti-on dar, die Zadok von Aaron her ableitet. In Num 25 entspricht Pinhas einemlevitischen Ideal und zeichnet sich dadurch als idealer Priester aus.
1. Suche nach dem Gibea des Pinhas
1. 1. Historisch am greifbarsten könnte die in Jos 24,33 erwähnte Grabtra-dition sein. Bisher angenommene Theorien über zwei antike Konkur-renztraditionen von Juden und Samaritanern sind aber nicht haltbar.Sie fußen auf zweifelhaften Deutungen mittelalterlicher Quellen.
1. 2. Als plausibel erscheint dagegen ein traditionsgeschichtlicher Zusam-menhang zwischen dem Gibea des Pinhas in Jos 24,33 und dem Gibeades Abinadab von Kirjat Jearim (1 Sam 7,1; 2 Sam 6,3 f.).
1. 3. Das dort auftretende genealogische Segment Eleasar ben Abinadab hatbei der Bildung der aaronidischen Genealogie eine wichtige Rolle ge-spielt und ist dort mit dem Namen Pinhas kombiniert.
2. Umgestaltung der priesterlichen Genealogie
2. 1. Aus dem Vergleich zwischen 2 Sam 8,17 und den Priesterlisten in1Chr 5; 6 und Esr 7 legt sich nahe, daß eine anfängliche genealogischeEinordnung Zadoks in die Familie der Eliden zu einer Herleitung vonAaron her umgestaltet wurde. Analog ist auch das Auftreten des Pin-has ben Eleasar in dieser aaronidischen Herleitung als Übernahme desNamens von dem Eliden Pinhas in diesem Umgestaltungsprozeß zu er-klären.
2. 2. Ri 20,27 f. und Jos 24,33 fallen als Belege einer – etwa »aaronidischen« –Priesterschaft des Nordreiches aus. Die Gruppe, die als Eliden bezeich-net und im Gebirge Ephraim angesiedelt wird (1 Sam 1–6), begründet ih-re Priesterschaft vom Ägyptenaufenthalt Israels her. Die ägyptischen Na-men Hophni und Pinhas legen ganz konkrete Beziehungen nach Ägyp-ten – zur dortigen jüdischen Diaspora – nahe.
2. 3. Ein Teil der Namen in der neu gestalteten Priestergenealogie zwischenAaron und Zadok ist der Elidengenealogie entnommen. Ein andererTeil, der zur aaronidischen Genealogie führte, ist mit dem Gibea von
XIV Thesen
Kirjat Jearim verbunden. Stehen die Eliden als Gegenbild zu Zadok,dann repräsentiert Eleasar ben Abinadab ein eigenes zadokidisches Tra-ditionselement. Mit der aaronidischen Genealogie sind beide Traditio-nen auf der literarischen Ebene miteinander ausgeglichen worden.
2. 4. Die in den Samuel- und Königebüchern unklare Herkunft Zadoks kannerneut mit seiner Herkunft aus dem gibeonitischen Bereich erklärt wer-den, zu dem auch Kirjat Jearim gezählt wird. Obwohl in Num 25 eineklare priesterliche Genealogie über Pinhas ben Eleasar zugrundegelegtwird, finden sich im Text Anspielungen auf die umstrittene IntegrationGibeons (2 Sam 10,1–10).
2. 5. Esr 8,2 nennt nebeneinander die an anderen Stellen als Aaroniden dar-gestellten Priester Pinhas und Itamar als Vorfahren von Priestern. DieStelle dokumentiert eine priesterliche Identität als »Söhne des Pinhas«.Sie muß nicht die endgültige Form der aaronidischen Genealogie re-präsentieren. In den Kapiteln Esr 7; 8 spielt die Herkunft von Pinhasan mehreren Stellen eine wichtige Rolle. Von Esr 7,1–5 her ist das aufPinhas ben Eleasar bezogen. Damit wird Pinhas als Ahn des Esra her-vorgehoben.
2. 6. Die Grundschicht der Genealogie von Ex 6,14–25, die Verse 14–20. 23. 25, kombiniert Israel-, Levi-, und Aarongenealogien miteinander.Obwohl es im Kontext um Aaron geht, endet der Stammbaum bei Pin-has und verweist dadurch auf den Priester, dem der »Bund ewigen Prie-stertums« gegeben werden wird.
2. 7. Eine zweite literarische Schicht (Ex 6,21 f. 24) fügt alle Leviten ein, diein der Tora mit Abstammungsangaben zu Levi auftreten.
3. Die zentrale Erzählung
3. 1. Num 25,1–4 läßt sich als einfache Einheit erklären. Die Verse 5–13. 19und 14–18 stellen zwei Erweiterungen dar. Im Zentrum der ersten Er-weiterung steht die Darstellung des Pinhas als wahrer levitischer Priester.
3. 2. Num 25,5–13. 19 erzählt das Ende der Wüstengeneration und markiertdeshalb im Numeribuch eine wichtige kompositionelle Zäsur. Auf der-selben literarischen Ebene liegt auch die Levi-Genealogie in Ex 6,14–25,die auf Pinhas hinausläuft. Beide Texte sind der Endgestaltung des Pen-tateuch zuzuordnen und werden deshalb als aufeinander bezogen gele-sen.
3. 3. Pinhas’ ägyptischer Name und der halbägyptische seines Großvaters Pu-tiel bestätigen die rabbinische Deutung von Num 25: Pinhas geht ge-waltsam gegen eine israelitisch-midianitische Verbindung vor, obwohler selbst nicht aus rein israelitischer Familie stammt.
Thesen XV
3. 4. Durch das Vorgehen gegen eigene familiäre Bindungen entspricht Pin-has einem levitischen, von Mose formulierten rigoristischen Anspruch(Ex 32,27). Mose selbst wird aber in Num 25 wegen seiner Ehe mit einerMidianiterin ungenannt kritisiert.
3. 5. Ein levitischer Anspruch an priesterliches Handeln kommt mit demLevi-Bund in Mal 2,1–9 zu Wort. Der »Bund ewigen Priestertums«, denPinhas in Num 25,13 zugesprochen bekommt, steht damit in einem tra-ditionsgeschichtlichen Zusammenhang. Das rigoristische Handeln desPinhas begründet die Bundesgabe.
3. 6. Esra, dem die Endgestaltung der Tora zugeschrieben wird, findet in sei-nem Ahn Pinhas eine deutliche Entsprechung – einen Priester, der fürdie Abgrenzung von fremden Völkern eintritt.
4. Verbindungen zwischen Numeri, Josua und Richter
4. 1. Num 25,14–18; 31,6b; Jos 22,9–34 und Ri 20,27b. 28a� setzen Bezüge zwi-schen drei militärischen Aktionen in den Büchern Numeri, Josua undRichter. Die Auseinandersetzung mit Midian in Num 31 wird dadurchzu einer Chiffre für den Anspruch ethischer und religiöser Reinheit in-nerhalb Israels.
5. Rezeptionsgeschichte
5. 1. Die Rezeptionsgeschichte zeigt, daß ganz verschiedene Gruppen ihre Le-gitimität von Pinhas herleiten oder sich auf ihn berufen können. Dabeispielt vor allem sein Eifer eine Rolle, aber auch das ihm zugesprocheneewige Priestertum sowie seine exponierte genealogische Position.
5. 2. Immer wieder ist die brutale Vorgehensweise des Pinhas von Auslegernkritisiert worden. Die Erzählung hat dann im allgemeinen Abscheu er-regt, oder die Legitimität der spontanen Tötung ist hinterfragt worden.
6. Wertung
6. 1. Num 25 macht als Beispielerzählung auf den Zusammenhang von reli-giösem Eifer und Gewalt in der biblischen Tradition aufmerksam undmuß eine kritische Auseinandersetzung damit provozieren. Eifer fürGott unterliegt der Gefahr, den Mitmenschen zu vergessen.
XVI
Hebräisch und Arabisch werden sowohl im Original, als auch in Transkrip-tion wiedergegeben. Zu letzterem werden für das Hebräische die Richtliniender ZAW verwendet. Für das Arabische besteht ein besonderes Problem, daes sich meist um Ortsnamen oder lokale Traditionen handelt. In der Literaturwird oft auf die dialektal gefärbte Aussprache Bezug genommen, die sich mitarabischer Schrift nicht eindeutig wiedergeben läßt. Bestimmte Aussprache-weisen sind relevant für die Argumentation. Da jedoch die verschiedenen Au-toren unterschiedliche Transkriptionssysteme benutzen und Nuancen in derAussprache notiert werden, differiert oft die Umschrift eines Namens in derLiteratur. Deshalb stellt die hocharabische Schreibweise ein klareres Bezugssy-stem dar. Durch die hier genutzte unvokalisierte Form, der die Transkriptionzur Seite gestellt ist, werden die arabischen Namen klarer wiedergegeben.
Die Schreibung biblischer Eigennamen, wenn nicht die hebräische Formangegeben wird, richtet sich nach der revidierten Lutherbibel von 1984. Über-setzungen, zu denen keine Quelle angegeben ist, stammen vom Autor.
1 Einleitung
Die Person des Pinhas, des Enkels von Aaron, wird von den meisten Bibel-lesern höchstens ganz am Rand wahrgenommen. Die wenigen Texte, die ihnerwähnen, gehen in der Fülle des kanonischen Gesamteindrucks unter. Dem-gegenüber ist an diesen wenigen Stellen die Figur mit einer Bedeutung verse-hen, die eine viel breitere Würdigung erwarten ließe. Die Wirkung seiner Tatin Num 25 stellt ihn in einem gewissen Maß sogar Mose und Aaron gleich. Ervereinigt in sich den Hohenpriester, den religiösen Eiferer und den Führer desVolkes. Die wissenschaftliche Bewertung der Figur schwankt extrem zwischender Position, die einen älteren, manschmal sogar vorstaatlichen, Überliefe-rungskern vermutet,1 und der Auffassung, es mit spätnachexilischen2 Textenzu tun zu haben.
Die Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, das vereinzelte biblische Material zu-einander in Beziehung zu setzen. Die Texte dokumentieren unterschiedlicheVorstellungen von dieser Person und können aufeinander Bezug nehmen. Dentraditionsgeschichtlichen und literarhistorischen Fragen wird eine synchroneDarstellung des biblischen Befundes vorangestellt, die in eine – ihrem eigent-lichen Ausmaß unangemessen – kurzgefaßte Rezeptionsgeschichte mündet.
Der Titel der Arbeit hebt einen Aspekt der literarischen Figur des Pinhasben Eleasar besonders hervor, der herausgearbeitet wurde – die Funktion die-ser Figur im Kontext der Tora. Die Formulierung »am Ende der Tora« giltsowohl auf der erzählerischen, als auch auf der kompositionsgeschichtlichenEbene: Obwohl Eleasar noch bis ans Ende des Josuabuches amtiert, wird Pin-has schon vor den Schlußreden des Mose als der Priester dargestellt, der demAnspruch levitisch zu handeln wirklich genügt. Bei der Entstehung der Toraist diese Legitimation des Priestertums im Zuge ihrer Endgestaltung einge-bracht worden.
1 . 1 E I N Ü B E R B L I C K Z U R P E R S O N
Da ein großer Teil der alttestamentlichen Texte, die von Pinhas sprechen, un-tereinander nicht in einem engeren Kontext stehen, soll hier ein Überblickzur Person vorangestellt werden, der auf einer synchronen Ebene zunächst
1 Westermann, Pinehas, 1474; Mendenhall, 99; Budd, 278; Haran, Temples, 70; Schar-bert, 104; Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 358.
2 Holzinger, Numeri, 126; Blum, Komposition, 114 f.; Fritz, Entstehung, 24; Kratz, Kom-position, 112.
2 1 Einleitung
feststellt, welche Referenzen mit dem Namen Pinhas jeweils mit anklangenoder anklingen konnten. Diese Übersicht soll auch eine Grundlage für diefolgenden Argumentationen der Arbeit sein.
Synchrone Darstellung des Themas gibt es öfter. Was dabei unter diesemBegriff verstanden wird, ist durchaus unterschiedlich, was weitreichende Fol-gen hat. Ronald Lee Rushing hat in seiner Dissertation (Dallas 1988) die Pro-blematik mit einem ausdrücklich dispensationalistischen Anspruch synchrondargestellt, insofern er alle Aussagen der Schrift Alten und Neuen Testamentsals miteinander harmonisierend gelesen hat.3
Der Textbereich, den Barbara E. Organ für ihre Pinhas-Interpretation ne-beneinander stellt, ist sehr viel schmaler. Er umfaßt nur eine sich inhaltlichnahelegende Auswahl von Texten aus den Büchern Numeri, Josua und Rich-ter, die Pinhas erwähnen. Sie sieht ihr Vorgehen als mögliche Vorarbeit fürweitere redaktionsgeschichtliche Forschung an.4
Der folgende Überblick hat einen quasi biographischen Ansatz, nicht weiletwa eine konkrete historische Person postuliert und ihr Lebenslauf rekonstru-iert werden soll, sondern weil auch bei einer rein fiktiven literarische GestaltAutoren und Rezipienten eine Biographie assoziieren. Auch wo nur kurz einName genannt ist, wird damit der Horizont für ein ganzes Leben geöffnet.Um dieser Perspektive gerecht zu werden, muß dieser Überblick am Anfangstehen. Die Frage der chronologischen Abhängigkeiten der Texte voneinandermuß dabei noch unberücksichtigt bleiben.
1.1.1 Name und Herkunft
Der Name � �� � �� pîneh. as wird gewöhnlich als die hebräische Form des ägypti-
schen Personennamens�� � �� u. ä. ������� erklärt, der im Neuen
Reich und der Spätzeit häufig auftritt und mit »der Nubier« übersetzt wird.5
So trägt diesen Namen z. B. ein nubischer (!) Vizekönig6. Walter Kornfeld
hat 1973 den Namen �� pnh. s auf einer aramäischen Stele in Edfu gelesenund auf einen jüdischen Namensträger in Ägypten geschlossen.7 Gegen dieseLesung hat aber Rainer Degen 1978 vehement Einspruch erhoben.8
Im Alten Testament ist der Name selten. Er verbindet die hier themati-sierte Figur vor allem mit Pinhas ben Eli, einem Priester, dem aufgrund seines
3 Rushing, besonders 9–16.4 Organ, 23.5 Spiegelberg, 634; Ranke, I,113. II,139. Dagegen Dillmann, 60.6 Veenhof, 205.7 Kornfeld, 133, Abb. 6.8 Degen, 63.
1.1 Ein Überblick zur Person 3
Fehlverhaltens die Weiterführung einer priesterlichen Dynastie verwehrt wird(1 Sam 2 f.). Kein Wunder, daß Pinhas ben Eleasar fast immer genealogischgenau identifiziert wird. So kann keine unerwünschte Verwechslung mit sei-nem Namensvetter entstehen. Was ihn mit Pinhas ben Eli verbindet, wird zuerörtern sein. Der Fakt eines ägyptischen Namens kann auch an Mose erin-nern.9 In diesem Zusammenhang wird oft darauf verwiesen, daß gerade imStamm Levi sich ägyptische Namen häuften (Mose, Aaron, Hofni, Pinhas,Paschhur).10 Allerdings ist die ägyptische Herleitung teilweise umstritten.11
Manfred Görg hat vermutet, daß hinter dem Namen Pinhas proägyptischeGruppen stehen.12
Auch die ausführlichste Angabe zu Pinhas’ Herkunft in Ex 6,25 machteinen solchen ausländischen Namen erklärbar. Sein Großvater mütterlicher-seits heißt Putiel und hat damit einen halb semitisch, halb ägyptischen Na-men.13 Weder die namenlose Mutter (»eine Frau von den Töchtern Putiels«)noch der Großvater sind sonst innerbiblisch erwähnt. Daher legt sich die An-nahme nahe, daß die Notiz nur deshalb steht, um Pinhas’ ethnisch gemischteHerkunft zu betonen.
Wichtiger erscheint jedoch der andere Teil der Verwandtschaft. Die Ge-nealogie in Ex 6 wird als Stammbaum von Mose und Aaron eingeleitet. Sieführt die Generationen von Levi beginnend und mit Pinhas als Einzigem inder letzten Generation endend auf. Dabei steht die aaronidische Genealogiedeutlich im Zentrum. Bei den Nachkommen Aarons ist die Nachfolge im Ho-henpriesteramt ein gesondertes Problem. Das Buch Exodus führt mit Aaronselbst diese Funktion (ohne sie zu nennen) ein,14 während seine Söhne diesonstigen priesterlichen Funktionen übernehmen. Wer aber von den Söhnentritt die Nachfolge des Vaters an? In der ersten Generation wird dem ältestender beiden zum entscheidenden Zeitpunkt noch lebenden Söhne – Eleasar –das Amt übertragen. Das könnte einer relativ mechanischen Regelung folgen.Der Stammbaum erwähnt nur einen Sohn Eleasars. So scheint es hier vor al-lem um die Nachfolge im Amt zu gehen. Aber die Genealogie von Ex 6 istausdrücklich auch wegen Mose aufgeführt und beginnt mit dem StammvaterLevi.
9 Zadok, Anthroponymy, 175 f.; Engel, 78 f.; Meek, Moses, 118 f.; Noth, Personennamen,63; Hommel, 292 f.
10 Spiegelberg, 634 f.; Meek, Moses, 118; Noth, Pentateuch, 205; Zadok, Anthroponymy,175 f.; Görg, Hagar; Ders., Aaron; Homan; Nelson, 3.
11 Zadok, Anthroponymy, 277 f.12 Görg, Pinhas.13 Ebd.14 Schaper, Hoherpriester, 1835.
4 1 Einleitung
1.1.2 Persönlicher Eifer und Bundesgabe
Der erste Text, in dem die Person aktiv wird, ist auch der inhaltsreichste. InNum 25 beim Eintritt Israels in das gelobte Land, genauer gesagt, im Ost-jordanland – nicht mehr Wüste und noch nicht Land –, kommt es zu illegi-timen geschlechtlichen Beziehungen zwischen Israeliten und Moabiterinnen,die mit Götzendienst einhergehen. Werden zuerst die Götter Moabs allgemeingenannt, so geht es ab V. 3 um den Baal Peor. Mit dem Namen Baal tritt damitschon an der Grenze Israel die Versuchung im Land schlechthin entgegen.15
Noch während in nicht ganz eindeutiger Weise der Zorn Gottes strafend un-ter dem Volk wütet, tritt ein Israelit mit einer Midianiterin öffentlich auf undführt sie in sein Zelt. Das erregt den Eifer des Pinhas. Er geht hinterher understicht beide.
Diese Tat erregt nicht nur beim modernen Leser Abscheu,16 sondern hatauch antike Ausleger dazu geführt, ihre Zweifel am kompromißlosen, gewalt-samen religiösen Eifer zum Ausdruck zu bringen. In der Erzählung wird sieaber als Ausdruck eines Eifers verstanden, der dem Eifer Gottes gleichkommt,und so sühnend zwischen den zürnenden Gott und sein Volk tritt. Dabei wirdeine auch kultisch verstehbare Terminologie benutzt, was auf den folgendenLohn für die Tat hinweist: Gott sichert Pinhas in einem »Bund« �� �� �� berît zu,ihm das ewige Priestertum zu erhalten.
Während Anwendung von körperlicher Gewalt im Alten Testament fürden zwischenmenschlichen Bereich nicht als positives menschliches Hand-lungsmuster gedacht ist,17 kann sie in gesamtgesellschaftlichen Zusammen-hängen und in der Gottesbeziehung durchaus als notwendig dargestellt wer-den. Die Gewalt, die von Pinhas ausgeht, hat den Anspruch, legitim zu sein.Es geht dabei um das gesellschaftsstabilisierende Moment, das sogenannte»strukturelle Gewalt« als notwendig erscheinen lassen kann.18 Im altorienta-lischen Kontext – aber nicht nur da – wird die Welt als ständig vom Chaosbedroht gesehen. Das muß zuerst eben mit Gewalt bezwungen werden.19 FürÄgypten sieht Jan Assmann das in der Dreiheit Gott – König – Ma�at ver-wirklicht.20 Pinhas erwirkt durch seine Tat Schalom. Da aber diese Gewaltspontan ausbricht, ist gerade fraglich, was daran strukturell sein soll – eineHinrichtung ohne Gerichtsverfahren und in Selbstjustiz.
Die Anwendung kultischer Terminologie (Pinhas »sühnte« für die Israeli-ten) legt einen Vergleich mit ritueller Gewalt nahe, die zur Verhinderung von
15 Jagersma, 11.16 Nelson, 90; Quesada.17 Vgl. etwa Meinhold, Gewaltmensch.18 Vgl. etwa Lohfink, Gewalt, 23 f.19 Vgl. Otto, Krieg, 1768.20 Assmann, Politische Theologie, 48–53.
1.1 Ein Überblick zur Person 5
Gewalt und zu innergesellschaftlichem Ausgleich führen soll.21 Die Spontani-tät der Tat spricht eigentlich dagegen.22 Sie wurde als priesterlicher Anspruchgedeutet, Kontrolle über sexuelle Beziehungen auszuüben.23 Von anderen wirddagegen ein politischer bzw. gesellschaftlicher Aspekt der Erzählung hervorge-hoben, der ihre Hauptintention ausmache.24 Die Beziehung zwischen einemMann und einer Frau hätte dabei eher exemplarischen Charakter.
Die gewaltsame Tat des Pinhas stellt die konsequente Umsetzung deu-teronomistischer Ausschließlichkeitsforderungen dar (z. B. Dtn 7,1–5). JanAssmann hat den engen Zusammenhang dargestellt, der von einem mono-theistischen Wahrheitsanspruch zu feindlicher Abgrenzung führt.25 Sich überdie Plausibilität dieses Zusammenhangs hinwegzusetzen, bedeutet eine im-mer wieder aktuelle Herausforderung an den einzelnen Gläubigen. Die totaleInanspruchnahme des Menschen durch Gott mündet im Falle von Pinhas’spontanem religiösen Eifer in Gewalt. Gegen die ursprüngliche Intention desTextes, kann die Erzählung als drastische Illustration gedeutet werden, zu wel-chem abgrundtiefen Fehlverhalten auch glaubende Hingabe führen kann. Invermeintlicher Übereinstimmung mit Gott hat Pinhas die Nächstenliebe ver-gessen (Lev 19,18).
Was offenbar schon rabbinisches Judentum an den Zeloten kritisiert,26
nämlich zur Begründung politisch motivierter Gewalt den Eifer des Pinhasheranzuziehen, hat eine traurige Parallele in der Gegenwart. Denn es wird eineamerikanische Sekte beschrieben, die sich »Phinehas Priesthood« nennt unddie staatliche Ordnung in den USA bekämpft. Anscheinend hält sie Bank-überfälle für legitim, um sich zu finanzieren.27 Nicht nur an so einem extre-men Beispiel wird deutlich, daß christlicher Glaube – gemeinsam mit denanderen abrahamitischen Verehrungsrichtungen – Potential zur Gewalt (wiezum Frieden) in sich trägt und daß die Auseinandersetzung mit diesen Ele-menten der religiösen Tradition eine wichtige Aufgabe innerhalb modernerGesellschaften ist, in denen Effektivität und Legitimität von Gewalt heiß um-strittene Fragen sind.28
Horst Seebass mahnt zu recht an, daß die Erzählungen in ihrem kulturel-len Kontext gelesen werden muß, und nicht zu schnell ein Urteil über die imText beschriebene Gewalttätigkeit gefällt werden sollte. Die Pinhas-Erzählungbezeuge vor allem die Ernsthaftigkeit mit sich selbst zu ringen.29 Sosehr in ei-
21 Girard, 19. 27.22 Ebd., 20.23 Quesada.24 Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 357; Sivan.25 Assmann, Unterscheidung, 13 f. Vgl. auch Fabry, Toleranz, 216 f.26 Hengel, 172–175.27 Phinehas Priesthood.28 Vgl. Otto, Krieg und Frieden, 9; Collins.29 Seebass, Numeri III, 144 f.
6 1 Einleitung
nem interkulturellen Dialog verschiedene Werte-Systeme respektiert werdenmüssen, bleiben jedoch die eigenen Wertvorstellungen nur sinnvoll, wenn sieeinen universalen Anspruch haben. Die starke Rezeption biblischer Gewalt-motive in den monotheistischen Traditionen30 rät nicht gerade dazu, das Ur-teil zu relativieren.
Mit Num 25 wird das begründet, was eigentlich schon genealogisch fest-gelegt ist – die Nachfolge im obersten Priesteramt. Einerseits bestätigt das dieAmtsnachfolge, andererseits könnte damit aber betont werden, daß es nichtallein die Geburt ist, die zu diesem Amt führt, sondern wenigstens ebensowichtig ist die persönliche Befähigung.
In Zeb 101b wird die Meinung Rabbi Eliesers im Namen Rabbi Haninasangegeben, daß Pinhas erst mit der Tötung Simris zum Priester wurde. AlsAaron und seine Söhne gesalbt wurden, war er schon geboren, wurde abernicht mitgesalbt (er war ja Enkel).31
Besonderes Interesse erweckt die Vorstellung, daß dem Pinhas das ewigePriestertum als Bund verliehen wurde. Die Vorstellung von einem speziellen
»Bund« (�� �� �� berît) zwischen Gott und den Priestern und Leviten begegnetnoch in Jer 33,18–22; Mal 2,4–8 und Neh 13,29 und klingt noch in einigenanderen Texten an32. Aussagekräftig ist dabei besonders Mal 2,4–8. Dort dientder Bund mit Levi zur Anklage der Priesterschaft wegen ihrer Verfehlungen.Levi erscheint als das Idealbild für einen Priester.
Die Tat des Pinhas in Num 25 ist eigentlich keine typisch priesterlicheHandlung, auch wenn dafür kultische Terminologie benutzt wird. Der Eiferdes Pinhas und das gewaltsame Vorgehen läßt eher daran denken, wie das Le-vitentum im Alten Testament des öfteren charakterisiert wird. Der religiöseEifer dieser Gruppe äußert sich in offener tödlicher Gewalt. Ja, es wird öfterder Grundsatz genannt, daß diese Gewalt selbst vor den eigenen Verwand-ten nicht haltmache (Ex 32,25–29; Dtn 33,9). Zieht man den Eifer des Pinhasals mögliches levitisches Motiv, seinen ägyptischen Namen und die angedeu-tete Herkunft seines Großvaters in Betracht, so entspräche dieser Hoheprie-sterprätendent in beispielhafter Weise der Levitenregel: er geht gegen eineninterethnischen Kontakt vor, obwohl er selbst aus einem solchen hergeleitetwird.
In Num 25 ist nicht wie in Mal 1,6–2,9 Kritik an den Priestern Thema.Eher wird Pinhas als wichtiger Repräsentant der Priesterschaft zu einem levi-tischen Ideal stilisiert.
Zu beachten ist dabei, welche Position Mose in Num 25 einnimmt, dain ihm oft der levitische Prototyp gesehen wird33. An der Stelle, wo in der
30 Einen pointierten Beitrag darüber bietet Gerstenberger, Heiliger Krieg.31 Goldschmidt, VII, 330.32 Lev 2,13; Num 18,19; Dt 33,9.33 Haag, 40; Meek, Moses; Cross, 197.
1.1 Ein Überblick zur Person 7
Erzählung Einsatz gefragt ist und Pinhas auftritt, bleibt Mose inaktiv, obwohler ausdrücklich zugesehen hat. Der Grund ist relativ klar: Mose selbst hateine midianitische Frau. Wie Pinhas ist auch er in Name und Verwandtschaftin das Problem verwickelt. Aber er handelt nicht. Die Literargeschichte desKapitels kann zeigen, daß die Beispielgeschichte mit Pinhas eigentlich gegenMose eingefügt wurde. Wer spielt also Pinhas gegen Mose aus?
Moses Einheirat nach Midian (Ex 2,16–22; 18,1–4) läßt auf ein freund-schaftliches Verhältnis zwischen beiden Völkern schließen. Num 25 stellt dazunicht nur in einem Einzelfall eine Gegenposition dar. Die Auseinandersetzungmit der Mose-Midian-Tradition führt am Ende von Num 25 zur Aufforde-rung, gegen das ganze Volk Krieg zu führen, was in Num 31 auch konsequentausgeführt wird.
Der Vorfall mit Baal Peor, von dem in Num 25,1–5 berichtet wird, undder in der Pinhasepisode seinen Abschluß findet, hat offenbar eine besondereerzählerische Funktion am Übergang von der Wüste zum Land. Am deutlich-sten wird das in Hos 9,10, wo ein ideales Gottesverhältnis Israels in der Wüstebeschrieben wird, das in Baal Peor sein abruptes Ende findet. Gleich an derGrenze begegnet Israel seinem schwersten Problem im Land – dem Baal inder konkreten Form eines lokalen Baal.34 Auch im Pentateuch ist Israel seitNum 21 schon in einem Zwischenstadium zwischen Wüste und Land ange-kommen. Denn das Ostjordanland ist schon erobert, wenngleich ein letzterKrieg noch aussteht (Num 31). Aber die Landnahme, auf die alles hinausläuft,geschieht erst mit dem Übergang über den Jordan im Josuabuch.
Hier findet jetzt der lange Abschied Moses statt, denn er gehört nochzur Generation, die in der Wüste bleiben muß (Num 14,26–35). Das großeSterben in Num 25 scheint im gleichen Zusammenhang zu stehen. Als inKap. 26 die zweite Zählung stattfindet, ist ausdrücklich niemand mehr vonder ersten Zählung am Anfang des Buches dabei, der nicht dabeisein soll(Num 26,64 f.).35 Noch deutlicher wird das in Dtn 4,3 ausgedrückt. Dort wer-den die Überlebenden von Baal Peor mit denen gleichgesetzt, die in das Landkommen können.36
1.1.3 Weitere Lebensdaten
Auch in Num 31 tritt Pinhas wieder gewalttätig auf – diesmal nicht in sponta-ner Einzeltat, sondern als Träger der heiligen Geräte im Krieg. Auch das – derTransport heiliger Geräte – ist eher mit den levitischen als mit den priesterli-chen Aufgaben beim Gottesdienst in Verbindung gebracht worden.
34 Milgrom, 213; Waschke, 165 f.35 Vgl. Milgrom, xiii. 215; Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 352; Ders., Numeri III, 114.36 Organ, 212.
8 1 Einleitung
In Jos 22 wird Pinhas mit dem Problem konfrontiert, daß durch die Inbe-sitznahme der zugeteilten Gebiete durch die Stämme für manche Stämme dieEntfernung zu einem vorgestellten zentralen Aufstellungsort der Lade (etwain Silo Jos 18,1) mit Opferbetrieb, der keine weiteren Kultstätten neben sichzuläßt, sehr groß ist, so daß Zweifel an der Rechtgläubigkeit solcher Stämmeangemeldet und abgewehrt werden. Erst hier, in Jos 22,30 wird Pinhas selbstausdrücklich als Priester bezeichnet. Daher meint Rabbi Aschi in Zeb 101b,daß er erst hier zum Priester wurde.
Im Kontext von Ri 20,27 f. geht es darum, ob der Stämmebund auch nachder Seßhaftwerdung aktionsfähig ist. Die Anarchie, die nach dem König ruft,wird noch einmal mit aller Kraft am Ende des Richterbuches gebändigt. ImGegensatz zu seinen Vorfahren Aaron und Eleasar hat Pinhas als oberster Prie-ster keinen »weltlichen« Führer als Pendent. Sollte er während der Richterzeitin dieser Position gedacht sein, so wird eben ein politisches Vakuum beschrie-ben, das nur sporadisch von Richtern ausgefüllt wird. Ein solches Gegenüberwird aber nirgendwo für Pinhas beschrieben.
Die kurze Notiz in Ri 20,27 f. bringt für den Leser Ordnung in die buch-übergreifenden Zusammenhänge. Seit Jos 18,1 steht die Lade in Silo. Am Endedes Jos-Buches stirbt Eleasar. Erst zu Beginn der Samuelbücher wird das La-deheiligtum in Silo wieder erwähnt. Die kurze Notiz ist das einzige Stück imRichterbuch, das auf das Schicksal der Lade und des zugehörigen Priestertumseingeht. Priester ist am Ende des Richterbuches Pinhas, der nach Jos 24,33 derin Frage kommende Kandidat ist. Daß er in Bethel und nicht in Silo auftritt,kann als vorübergehender Zustand gedacht sein, wenn es heißt, daß die Lade»in jenen Tagen« dort war. Daß sie – gerade zu Kriegszwecken – mitgenom-men werden kann, zeigt das Schicksal der Lade in den Samuelbüchern. Werals Leser von Ri 20 nach 1 Sam 1–4 kommt, kann zuerst einmal die Vermu-tung haben, daß die nun in Silo anzutreffenden Priester, Eli und seine Söhne,in Kontinuität zu den Aaroniden stehen, obwohl die Herkunft des Eli imDunkeln bleibt. Gerade die Namensgleichheit der beiden Pinhase läßt leichtverwandtschaftliche Beziehungen assoziieren.
Auf diese Kontinuität weist auch die Erwähltheit des Ahns Elis zum Prie-stertum hin, die in der ägyptischen Knechtschaft stattgefunden haben soll(1 Sam 2,27 f.). Nach allem bisher Gehörten muß das auf Aaron hinweisen,selbst wenn der Zeitpunkt der Offenbarung rätselhaft bleibt. Dann steht derLeser jetzt aber vor dem Rätsel: Wenn hier das Priestertum Elis, das »für im-mer« (1 Sam 2,30) bestehen sollte, verworfen wird, ist auch das PriestertumAarons im Pentateuch verworfen? Von 1Kön 2,26 f. wird deutlich, daß die-se Weissagung auf die Ablösung des Eliden Abjathar durch Zadok hinweist.Merkwürdigerweise wird aber auch Zadok in 2 Sam 8,17 als Sohn Ahitubs, ei-nes Eliden, bezeichnet. Wie nun: Kann Zadok sein eigenes Vaterhaus ablösen?
Über den ganzen Komplex von Tora und Propheten bleibt diese Frageungelöst. Die Chronik versucht das folgendermaßen zu erklären: Zadok ist
1.1 Ein Überblick zur Person 9
natürlich der rechtmäßige Nachkomme Aarons, sein Vorfahr Ahitub ist nichtder vermutete Elide, sondern ein Namensvetter (1Chr 5,30–41; 6,35–38). DieEliden sind zwar wirklich Nachkommen Aarons, aber in der Nebenlinie derItamariden (1Chr 24,2 f.) und daher keine Nachkommen des Pinhas. Damitbleibt freilich ungeklärt, welcher Vorfahr Elis, der nicht auch Zadoks Ahn war,in Ägypten die besagte Offenbarung empfangen hatte.
Infolge der Rezeption der biblischen Texte sind verschiedene Lösungendafür geboten worden. Dabei kann die genealogische Abfolge von Aaron überPinhas und Eli auf Zadok behauptet werden (4Esr 1,1–3). Eine zweite Lö-sung geht von einer nicht genealogisch begründeten Amtsübergabe an ElisGeschlecht aus (LAB L,337; JosAnt V, 11,538). Während nach den samaritani-schen Chroniken in der Abspaltung des Eli schon der Ausgangspunkt für denspäteren Gegensatz zum Judentum gesehen wird,39 wird in jüdischen Darstel-lungen mit Zadok die rechtmäßige Linie später wieder eingesetzt.40
Relativ ausführlich versuchen Qimchi und Raschi diesen Vorgang in Über-einstimmung mit dem chronistischen Konzept zu beschreiben. In rabbini-schen Texten wird des öfteren darauf verwiesen, daß der Ahn Elis in ÄgyptenAaron sei, da dieser den Israeliten in Ägypten Prophet bzw. von Gott erwähltwar.41 Die beiden Kommentatoren schreiben zu 1 Sam 2,30, daß der Wechselzwischen Eleasariden und Itamariden stattfand. Und zwar wäre das Hoheprie-stertum im Zusammenhang mit der »Schandtat zu Gibea« von Pinhas undseinen Nachfolgern genommen und den Itamariden gegeben worden, weil je-ne der Aufgabe, von Ort zu Ort zu ziehen, nicht nachgekommen seien.42 Dasist wahrscheinlich davon inspiriert, daß in rabbinischen Texten Pinhas vor-geworfen wird, er habe sich – als in der Richterzeit amtierend zu denkenderHoherpriester – bei dem Gelübde des Jeftah am Tod von dessen Tochter mitverschuldet (Ri 11,30–40).43
Nach den samaritanischen Chroniken ist die Abspaltung unter Eli schonder Ausgangspunkt für den späteren Gegensatz zum jüdischen Kult.
1 Chr 9,19 f. berichtet davon, daß Pinhas in der Stiftshütte der Vorsteherder Korachiten in ihrem Amt als Schwellenhüter war. Damit hat auch er wieEleasar und Itamar in Num 4 die Aufsicht über bestimmte Levitenfamilien,um sie beim Umgang mit den Geräten des Heiligtums vor lebensbedrohli-chem Fehlverhalten zu schützen.
37 Dietzfelbinger, 235.38 Clementz, 314 f.39 Macdonald, Chronicle, 110–113.40 Vgl. Feldman, Portrayal, 343.41 ExR 3,16 (Midrasch Rabba, Schemot, 13a, übersetzt bei Wünsche, Schemot Rabba, 49);
TanB Schemot 24 (Buber, 8a, übersetzt bei Bietenhard, I, 309).42 Cohen, 18 f.43 TanB Bechuqqotay 7 (Buber, 57b).
10 1 Einleitung
In Jos 24,33 wird die Grabstätte des Vaters Eleasar im Land Ausdruck füreine endgültige Einnahme desselben (siehe unten S. 101). An diesen Text istvor allem die Frage zu stellen, warum dieser Ort nach dem Sohn benannt ist,und wieso Aaroniden eine besondere Beziehung zum Gebirge Ephraim zei-gen, obwohl ihnen nur in Benjamin und Juda Städte zugewiesen wurden. DerLandbesitz des Pinhas im Gebirge Ephraim steht nämlich im Widerspruch zuJos 21, wo Aaroniden nur Städte in Juda, Simeon und Benjamin (Jos 21,9–16)zugeteilt sind. In BB 111b–113b44 wird daher diskutiert, ob Pinhas das Landüber das Erbrecht seiner Frau bekommen habe.
Die Septuaginta-Fassung dieses Verses berichtet von der Übernahme desPriestertums von Eleasar durch Pinhas, in dessen Zeit die Lade im Land her-umgetragen worden sei. Damit verweist der Text auf Ri 20,27 f., der im maso-retischen Text als einziger von Pinhas als einem amtierenden Priester berichtet– eben nicht, wie erwartet, in Silo, sondern in Bethel, wo er vor der Ladedient.
Die griechische Fassung erzählt dann noch vom Tod des Pinhas, der immasoretischen Text unerwähnt bleibt. Meist wird angenommen, es habe inder Spätantike zwei konkurrierende Grabtraditionen für Eleasar und Pinhasgegeben. Ab dem 12. Jahrhundert werden die Gräber der Aaroniden in �������awarta, südöstlich von Nablus, von muslimischen, jüdischen und samarita-nischen Quellen erwähnt und werden (bis auf das Grab des Pinhas ����� �al-mans.ur, das 1955 bzw. 1958 zerstört wurde) bis heute insbesondere von Sa-maritanern verehrt.45
1.1.4 Der Beginn der Rezeption
Schon innerhalb des Alten Testaments tritt eine Bezugnahme auf Pinhas auf,die keine weiteren Einzelheiten seiner Vita hinzufügt, sondern lediglich dasGeschehen von Num 25 wiederaufnnimmt. Diese Rezeption setzt sich überdie Kanongrenzen hinaus fort. Oft taucht Pinhas in Textzusammenhängenauf, die große zeitliche Abschnitte der biblischen Darstellung überblicken,indem sie bestimmte Ereignisse oder Personen auswählen und hintereinanderaufführen.
Ps 106 stellt in groben Zügen die Vorgänge zwischen dem Auszug ausÄgypten und dem babylonischen Exil mit Schwerpunkt auf Israels Ungehor-sam dar. Im Zentrum wird auf einige Geschichten vom Zorn Gottes gegensein Volk und dessen Stillung durch eine einzelne Person aus der Darstellungdes Wüstenaufenthaltes im Pentateuch Bezug genommen. Diese Geschich-ten durchziehen auch die entsprechenden Pentateuchtexte als ein zentrales
44 Goldschmidt, VI, 1234–1237.45 Siehe dazu unten S. 113–116.
1.1 Ein Überblick zur Person 11
Thema. Sachlich dem entsprechend wird Pinhas hier neben Mose und Aarongenannt. Er tritt nicht als Vertreter der Priester auf, sondern seine Vorbild-funktion wird auf das ganze Volk ausgeweitet.46 Es muß geklärt werden, obder Psalm sich direkt auf Num 25 bezieht, oder ob er andere Quellen hat.Wahrscheinlich liegt eine Anspielung auf Abram (Gen 15,6) vor, wenn gesagtwird, daß Pinhas seine Tat »zur Gerechtigkeit angerechnet wird« (Ps 106,31).
In Sir 45,23–26 wird Pinhas in einem literarischen Kontext aufgeführt, derversucht, einen noch größeren Umfang der alttestamentlichen Geschichte zuüberblicken (Sir 44–50).47 Dieser Abriß ist ganz personenorientiert und führtvon Henoch bis zum aktuellen Hohenpriester. Aaron und Pinhas werden Mo-se gegenüber stark hervorgehoben.48 Während hier schon Aaron der ewigeBund gegeben wird (Sir 45,15),49 geht es bei Pinhas um die Gabe des Hohen-priestertums (Sir 45,24). Es macht den Anschein, als knüpfe Sir 45 an Ps 106an. Jetzt heißt es, daß Pinhas für sein Volk in die Bresche trat (Sir 45,23). InPs 106 war das von Mose gesagt. Die hebräische Fassung von Sir 50,24 istausführlicher als der griechische Text und erwähnt Pinhas neben Simon demGerechten.50
Seine Gnade bleibe bei Simon und er erhalte ihm den Pinhas-Bund,der nicht gebrochen wird, weder ihm, noch seinem Samen, solange der Himmel ist.
Otto Mulder sieht im »Pinhas-Bund« ��� ���� berît pîneh. as den Schlüsselfür die hebräische Fassung des Lobes der Väter, denn Pinhas dient als Zäsurzwischen den ersten beiden Perioden und verweist auf Simon.51 Während benSira den gewaltsamen Eifer für Gott damit zu einem entscheidenden Merkmaldes Hohenpriestertums erklärt und die Abstammung des Hohenpriesters vonPinhas gegen die samaritanische Inanspruchnahme herausstellt, streicht seinEnkel diesen Aspekt, weil die Hohenpriester nach Simon diesem Anspruchnicht gerecht geworden sind.52
Auch in 1 Makk 2,54 wird Pinhas in einer Reihe von Vorbildern genannt(1 Makk 2,49–70),53 die diesmal sehr kurz gehalten ist und von Abraham bisDaniel reicht. Im Kontext geht es um den religiösen Eifer. In der Aufzählungzeichnen sich besonders Pinhas und Elia durch ihr eiferndes Autreten aus.Pinhas wird als einziger in der Reihe als Ahnvater des Sprechers bezeichnet,was sich daraus erklärt, daß Mattatias laut V. 1 aus einer priesterlichen Familie
46 Boudreau, Study, 148.47 Vgl. Goshen-Gottstein, 236–240.48 Fabry, Sirach, 273–276.49 Olyan, 268 f.50 Vgl. Hayward, 30; Text nach Vattioni, 275.51 Mulder, Two Approaches, 223, 231.52 Ders., Simon, 339 f., 343 f.53 Vgl. Goshen-Gottstein, 236.
12 1 Einleitung
stammt. Im vorderen Teil des Kapitels (V. 23–28) dient Num 25 als Vorbild fürdie eifernde Tat des Mattatias. Die Beschreibung der Handlung nimmt aberin V. 27 auch auf Ex 32,26 Bezug (»Wer sich für das Gesetz ereifert und zumBund steht, der soll mir folgen«).
Die Rezeption begann mit Ps 106 im masoretischen Text und wurde dar-über hinaus mit Sir 45 und 1 Makk 2 in der Septuaginta aufgegriffen undweitergeführt. Mit dem vierten Makkabäerbuch befindet man sich nun amäußersten Rand des Kanon. Und auch hier in 4 Makk 18,12 wird Pinhas in ei-ner Reihe herausragender biblischer Gestalten erwähnt, (von Abel bis Danielund von David bis Hesekiel – 4 Makk 18,10–18). Im Kontext des Martyri-ums haben alle Genannten mit Tod beziehungsweise Überleben oder ewigemLeben zu tun. Bei Pinhas wird dagegen – wohl als Voraussetzung für das Mar-tyrium – dessen Eifer hervorgehoben.
1.1.5 Außerbiblische Texte
Thematische und assoziative Zusammenhänge zwischen Pinhas und Elia wer-den in außerbiblischen Texten aufgenommen und sehr stark ausgebaut. Soheißt es in NumR 21,3 (89a)54 zu Num 25,12:
Deshalb sage: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund, Frieden, der noch immer besteht, undso sagt er: Mein Bund war mit ihm das Leben und das Heil ...
Martin Hengel hat hier schon das Nicht-Gestorben-Sein des Pinhas ausge-drückt gesehen,55 obwohl es syntaktisch näher liegt, daß hier vom Bund ge-sagt wird, er bestehe immer noch. Neben dieser zurückhaltenden Aussage,die auf die inhaltliche Nähe zwischen Pinhas- und Levibund hinweist, wirdin einer Reihe von Texten der rabbinischen Literatur, bei Pseudophilo undOrigines Pinhas mit Elia identifiziert.56 Der Targum Pseudojonathan bringtbeides ebenfalls unter Aufnahme von Maleachi zusammen, indem er Pinhasden »Boten des Bundes« (Mal 3,1) nennt, der »ewig lebt, um am Ende der TageErlösung (������ ge
�ûlta�) zu verkünden«. Offenbar werden darüber Mal 2,7und Mal 3,1. 23 verbunden und damit die Identität von Pinhas und Elia her-gestellt. Explizit spricht es derselbe Targum zu Ex 6,18 aus:57
54 Midrasch Rabba, Bemidbar 89a.55 Hengel, 167.56 Vgl. Ebd., 167–172.57 Ginsburger, 107.
1.1 Ein Überblick zur Person 13
Pinhas, das ist Elia, der Hohepriester, der am Ende der Tage zur ExiliertenschaftIsraels geschickt werden wird.58
So kann er auch als himmlischer Hoherpriester, vergleichbar Melchisedek oderdem diesen ersetzenden Christus in Hebr 4–1059, verstanden werden, der dastägliche Opfer versieht.60
Diese Überhöhung der Figur ist – im Anschluß an die Makkabäerbücher –von Pinhas’ Eifer her gedeutet worden. In hellenistisch-römischer Zeit scheinter zu einer Leitfigur aufgestiegen zu sein, mit der sich gewalttätig durchgesetz-te Abgrenzung propagieren ließ. Zu den Nacheiferern des Pinhas gehörtendann auch die »Eiferer«, die Zeloten.61 Das hat ihm Kritik in einigen Schich-ten der rabbinischen Literatur eingebracht.62
R. H. Eisenman und M. Wise vermuten bei allen Qumrantexten, in denendie Wurzel qn� �� »eifern« auftaucht, diesen zelotischen Vorstellungskom-plex.63 Carolyn J. Sharp hat für 4QMMT C 31 f. eine Anspielung auf Pinhasin Ps 106,31 für wahrscheinlich erklärt und von dieser Stelle her die gesam-te Schrift gedeutet.64 Der Name Pinhas taucht in Qumran allerdings nur inpriesterlichen genealogischen Zusammenhängen auf: Einmal eindeutig65 undzweimal in vorgeschlagenen Rekonstruktionen66, zweimal davon zeigt sich sei-ne besondere genealogische Bedeutung in der generalisierenden Formulierung»von den Söhnen Pinhas’«67.
Auch bei den Samaritanern spielt Pinhas eine wichtige Rolle. Eine Selbst-bezeichnung der Gemeinschaft in der samaritanischen Literatur ist »SöhneJosefs und Söhne Pinhas’«.68 Bernd Janowski hat von einer mit ihm verbunde-nen soteriologischen Erwartung gesprochen, wenn Pinhas in Memar Marqah(VI § 5)69 als »Wurzel der Erlösung« bezeichnet wird.70
Der Ansatzpunkt für diese Entwicklung könnte an verschiedenen Stel-len liegen. Da genügte evtl. schon die Beobachtung, daß Pinhas am Ende
58 Die Formulierungen der beiden Targumstellen sind evtl. voneinander abhängig. Jeden-
falls könnten die Worte »die Erlösung« ������ ge�ûlta� und »die Exiliertenschaft« �����
galûta� in engem Zusammenhang stehen.59 Vgl. unter anderem Walter.60 SifNum Balaq (Horovitz, 173, Z. 17 f); Hengel, 170. Vgl. insgesamt Strack und Biller-
beck, IV/2, 462–464.61 Kuhn, 519; Hengel, 153–181.62 Ebd., 172–175; Stumpff, 887.63 Eisenman und Wise, 58.64 Sharp, 209–212.65 6Q13 4 (DJD III, 127).66 4Q243 ar 28,2 (DJD XXII, 116); 4Q522 9ii7 (DJD XXV, 55).67 6Q13; 4Q522.68 Z. B. Stenhouse, 54.69 Macdonald, Memar Marqah, I 139; II 288.70 Janowski, Ps CVI 28–31, 238.
14 1 Einleitung
des Richterbuches immer noch lebt und (im hebräischen Kanon) nirgend-wo von seinem Tod die Rede ist, um ihn für unsterblich zu halten.71 MitElia verbindet ihn dann besonders der Eifer für den Herrn. In rabbini-scher Auslegung könnte dabei durchaus der ähnliche Konsonantenbestandvon ���� �� ���� bqn�w �t qn�ty in Num 25,11 und ���� �� qn� qn�tyin 1Kön 19,10. 14 eine Rolle spielen. Ein dritter Gesichtspunkt, der Pinhasund Elia einander nahekommen läßt, ist die oben beschriebene Verknüpfungdes Bundesboten mit Elia. Jedoch wird in der rabbinischen Literatur öfter dieHerkunft Elias diskutiert, ohne daß dabei Pinhas zwangsläufig erwähnt wür-de. Unter anderen wird dabei auch der Stamm Levi vorgeschlagen.72 Nach denVitae Prophetarum war Tisbe, der Heimatort Elias, Priesterstadt.73 Elias leviti-sche Abkunft könnte aus seinen priesterlichen Handlungen auf dem Karmelgeschlossen worden sein.74 Robert Hayward sieht den Ausgangspunkt in derVerbindung von Elia und Johannes Hyrkan in TPsJ75 zu Dtn 33,11.76 Dannwäre die Verbindung mit Pinhas erst der zweite Schritt.77 In muslimischenTexten kann Elia genealogisch an Pinhas’ Stelle stehen,78 oder sein Nachfahresein79.Ist erst einmal ein Pinhas-Elia geschaffen, dann muß auch noch seine Iden-tifikation mit ������ �� al-h
˘id. r/al-h
˘ad. ir, dem grünen Propheten der orientali-
schen Volksfrömmigkeit, der auch mit St. Georg identifiziert wird, genanntwerden.80 Carsten Colpe hat zu Recht auf das Georg und Pinhas gemeinsameSpeermotiv hingewiesen, das dieser Gleichsetzung förderlich war.81 Für die Sa-maritaner, für die weder Elia, noch �������� al-h
˘id. r, noch St. Georg zum Kanon
gehören, mußte Pinhas der wichtigste Part in dieser interreligiösen Heiligen-gestalt werden.82 Aber auch für den jüdischen Kontext wird zuweilen explizitdie Identifikation von Pinhas mit dem grünen Propheten beschrieben.83 Ei-ne Miniatur in der Handschrift Barberiano greco 372, f. 183v, aus dem 9. Jh.n. Chr. zeigt Pinhas zu Pferde auf Zimri und Kozbi einstechen – ikonogra-
71 Vgl. Hengel, 172.72 Vgl. Ebd., 168.73 VP 21. 1. Vgl. Schwemer, Prophetenlegenden, II, 233.74 Friedmann, 97 f.75 Ginsburger, 362 f.76 Hayward, 31–33.77 Vgl. zum Thema insgesamt Ebd.; Higgins, 324; Johnson, 267; Meinhold, Maleachi,
156–158; Zeron.78 R. G. Khoury, 63.79 T. abari, 461.80 Colpe; Donner, St. Georg; Friedlaender; Lidzbarski.81 Colpe, 170 f., 184 f.82 Ebd., 173–177.83 Al Masûdî, 200; Friedlaender, 256; Wahl, 249.
1.1 Ein Überblick zur Person 15
Abbildung 1: Verehrung des Baal Peor und Pinhas zu Pferde(Handschrift Barberiano greco 372)
phisch St. Georg sehr ähnlich (Abb. 1)84. Patrick Franke hat jedoch daraufhingewiesen, daß Elia und ������ �� al-h
˘id. r in der islamischen Tradition seltener
gleichgesetzt werden, als daß sie als Paar auftreten.85
Verschiedene Erzählmotive, die biblisch nicht belegt sind, durchziehen dieRezeption der Pinhaserzählung in verschiedenen literarischen Bereichen. So-wohl Philo, Pseudophilo und Josephus86 als auch die rabbinische Literaturweisen gemeinsame über den biblischen Text hinausgehende Motive auf.
Dabei geschieht unter anderem der Versuch einer Harmonisierung derSpannungen um Num 25. So hat – geschlossen aus Num 31 – Bileam die Mi-
84 Ferrua, Scena nuova, 110 f., Abb. 2.85 Franke, 155.86 Feldman, Portrayal.
16 1 Einleitung
dianiter angestiftet, die Israeliten zum Baal Peor zu verführen (TPsJ, SifNumBalaq87, PhilMos 1.294,88 JosAnt 4.129–130, LAB 18.13, vgl. auch Offb 2,14).Eine Harmonisierung stellt das allerdings nur dann dar, wenn andersherumangenommen wird, daß der ursprünglich stringente Erzählgang in Num 25gestört ist.89 Philo gelingt es, die Anweisung des Mose, die Aktion des Pinhasund die »Plage« miteinander in Übereinstimmung zu bringen: Pinhas ist dererste, der Moses Anweisung folgt, alle Schuldigen zu töten. Diesem Beispielfolgten einige, die sich nicht mit den fremden Frauen eingelassen hatten, –und töteten 24 000 (PhilMos 1.303).90
Im rabbinischen Kontext wird auch – ausgehend vom fremd wirkendenNamen des Großvaters Putiel – die Provokation von Num 25 auf die Spitzegetrieben: Pinhas entstamme selbst einer israelitisch-midianitischen Misch-ehe, ja Eleasar habe sich eine Schwägerin des Mose zur Frau genommen, dennPutiel sei niemand anderes als Jethro (Sota 43a, San 82b91, SifNum Balaq92).
In der Gemara zu San IX,6, San 82a. b93, wird der Fall Pinhas–Simri alsPräzedensfall herangezogen, wo es in der Mischna heißt: DZ��� ����� �������� DZ���� whb�l �rmyt qn�yn pwg�yn bw – »Wer mit einer Heidin94 schläft, denschlagen Eiferer.« Die Formulierung der Mischna mit dem Begriff »Eiferer«läßt aber vermuten, daß auch sie Bezug auf Num 25 nimmt, bzw. von dortherbeeinflußt ist.
Ausgehend von tannaitischen Midraschim geschehen dem Pinhas in einer Rei-he rabbinischer Texte eine Folge von Wundern, die die Rechtmäßigkeit seinerjuristisch anscheinend nicht einwandfreien Tat bestätigen können und seineunbeschadete kultische Reinheit deutlich machen. Durch alle Erzähltraditio-nen hindurch läuft ein damit eng zusammenhängendes Motiv, daß Pinhas dieErstochenen am erhobenen Speer durch das Lager trägt. Das findet sich so-wohl in den verschiedenen rabbinischen Texten (TPsJ zu Num 25,895, SifNum
87 Horovitz, 172 f.88 Philo, 289 f. Vgl. Feldman, Version, 314–317.89 Vgl. die Diskussion auf S. 36–47.90 Philo, 290.91 Goldschmidt, V, 318 f. VII, 345 f. Vgl. Terbuyken, 99. In Sota 43a wird eine zweite Her-
leitung damit kombiniert, nämlich die von Josef her – wahrscheinlich über den Namenseines Schwiegervaters Potifera motiviert.
92 Horovitz, 173, übersetzt bei Kuhn, 525.93 Goldschmidt, 342 f.
94 ���� �rmy wird hier und anderswo oft von ����� �rwmy »römisch« abgeleitet, was allge-meiner als »heidnisch« verstanden wird.
95 Ginsburger, 277 f.
1.1 Ein Überblick zur Person 17
Abbildung 2: Darstellung desPinhas in der Katakombe unterder Via Latina
Abbildung 3: Illustration des Serbi-schen Psalters München zu Ps 105
Balaq,96 NumR 20,25 (88b)97, San 82a. b98, jSan 28d,57–29a,299 ),100 als auchin den arabischen Prophetenlegenden101, sowie im Bereich des östlichen Chri-stentums102.
Carl-Otto Nordström hat vermutet, daß verschiedene Bibelillustrationen,die Pinhas mit dem erhobenen Speer zeigen, das rabbinische Motiv über –nicht belegte – jüdische Septuagintaillustrationen überliefert bekommen ha-ben.103 Die Motive der betreffenden Illustration des serbischen Psalters ausMünchen (Abb. 3) sind aber unter Heranziehung der Erzählung aus der Tol-kovaja Paleja (1477) erklärt worden.104 Diese Traditionslinie wie auch die Ka-takombenmalerei, auf der Pinhas die Durchbohrten auf der Lanze hochhebt
96 Horovitz, 172 f., übersetzt bei Kuhn, 521–525.97 Wünsche, Bemidbar Rabba, 506 f.98 Goldschmidt, 342 f.99 Wewers, 278 f.
100 Nordström, 39.101 T. abari, 92 f.102 Belting, 135.103 Nordström, 24–26., 39–47.104 Belting, Textband, 134 f.
18 1 Einleitung
(Abb. 2),105 erklärt sich daher eher durch literarische Vermittlung und nichtauf der ikonographischen Ebene.
Christlicherseits ist diese hohe Wertschätzung vereinzelt kritisch aufge-nommen worden. Im Kreuzgang des Domes von Brandenburg an der Havelfindet sich in einem Kapitell ein Schwein mit Menschenkopf und der Be-schriftung »Pinnecas«. Das ist die wahrscheinlich älteste (1230) Darstellungeiner sogenannten »Judensau«.106 Dieser Bildtyp verwendet die Symbolik desSchweins als Zeichen für Luxus und Ausschweifung zu einer diffamierendenDarstellung des Judentums,107 das durch obszöne Andeutungen zu einem be-leidigenden Spottbild wurde.108 Falls sich die Beschriftung mit dem NamenPinhas nicht auf einen Zeitgenossen des Künstlers, der diesen Namen trug, be-zieht,109 dann wäre die Nennung der biblischen Figur als Kritik an jüdischerSchriftauslegung zu verstehen. Martin Luther hat – allerdings Jahrhunder-te später – die Wittenberger »Judensau« auf das Talmudstudium bezogen.110
Möglicherweise ist die oben beschriebene gelegentliche Hochschätzung desPinhas in der rabbinischen Literatur Christen aufgefallen, deren detaillierteErörterungen über den Mord an Simri und Kosbi stellenweise als obszön emp-funden worden sein können. Die Brandenburger »Judensau« würde dann derjüdischen Schriftauslegung vorwerfen, die Bibel mit unangebrachten, mora-lisch verdorbenen Interessen zu lesen. Das jüdische religiöse Bemühen um dieSchrift würde damit zu einer Art Götzendienst erklärt werden, wobei Pinhasexemplarisch als eine Götze beschrieben wäre.
1 . 2 F O R S C H U N G S G E S C H I C H T E
Bibelausleger haben sich vorrangig immer dann mit Pinhas beschäftigt, wennsie gerade an eine der Stellen kamen, in denen er auftrat. Daneben gibt es nochdrei thematische Komplexe, in denen Pinhas regelmäßig mit verhandelt wird:Die Vorstellung von einem speziellen Bund Gottes mit Priestern bzw. Leviten,der Eifer des Pinhas, der vor allem in der Wirkungsgeschichte aufgenommenworden ist, und die Frage nach der traditionsgeschichtlichen Verortung desPinhas. Diese letzte Frage ist relativ wirkungsmächtig, da sie auf eine histori-sche Verortung der Figur hoffen läßt – mit welchem Erfolg auch immer. Siebeginnt nicht mit dem zentralen Text Num 25, sondern mit der Grabnotizdes Eleasar. Dazu werden weitere Motive hinzugezogen: Die Verbundenheitmit der Lade, Pinhas in Bethel, Pinhas und die Türhüter. Schließlich wird
105 Ferrua, Katakomben, 73 f.106 Shachar, 15.107 Ebd., 4–14.108 Ebd., 2 f.109 Ebd., 16.110 Ebd., 44.
1.2 Forschungsgeschichte 19
das Problem der unterschiedlichen priesterlichen Genealogien aufgegriffen,die mit Pinhas ben Eleasar und Pinhas ben Eli eventuell einen gemeinsamenSchnittpunkt aufweisen.
Julius Wellhausen hat Pinhas in seiner Geschichtsrekonstruktion eineSchlüsselrolle für die Argumentation zugeteilt.111
»Das andere alte Priestergeschlecht, das in die Richterzeit hinaufreicht, das ephrai-mitische von Silo, scheint gleichfalls mit Mose in Verbindung gebracht zu werden;wenigstens wird in der allerdings nachdeuteronomischen Stelle 1. Sam. 2, 27, wennJahve sich dem Vaterhause Elis in Ägypten geoffenbart und dadurch zu der Begabungdesselben mit dem Priestertum den Grund gelegt haben soll, doch wol an Moses alsden Empfänger der Offenbarung gedacht. Mit historischer Wahrscheinlichkeit läßtsich die Familie auf Phinehas zurückführen, der in der frühen Richterzeit Priester derLade war und von dem das Erbgut auf dem Gebirge Ephraim und ebenso der zweitevon Elis Söhnen den Namen hatte: es ist nicht anzunehmen, daß er nur der Schattenseines jüngeren Namensgenossen sei, weil der letztere noch vor dem Vater starb undneben demselben keine Bedeutung hatte. Phinehas aber ist nicht nur im Priester-kodex, sondern auch Jos. 24, 33 (E) der Sohn Eleazars, und dieser ist zwar nach dermaßgebenden Tradition ein Sohn Aharons, jedoch in der Aussprache Eliezer nebenGerson ein Sohn Moses.«
Pinhas wäre demnach für die uns heute als genealogische Hauptlinie entge-gentretende Familie der Aaroniden die Figur, die historisch am greifbarstensei. Gerade Aaron sei erst sehr spät zum Ahn der Priester geworden. Viel ehersei Mose ursprünglich der Ahn der Priester gewesen. Wellhausen hält die-se muschitische Herkunft auch für historisch wahrscheinlich. Pinhas scheintgerade deshalb geschichtlich greifbar zu sein, weil von seinem Erbbesitz be-richtet wird, und weil der Vater im Gebiet des Sohnes begraben wurde – derSohn also wohl größere Bedeutung genoß. Er ist in der Richterzeit mit der La-de verbunden. Der Zusammenhang mit Mose bietet sich einerseits durch denVerweischarakter des Pinhas ben Eleasar auf Pinhas ben Eli – der Nachkommeträgt den Namen seines Ahn. Die Offenbarung in Ägypten deute andererseitsam ehesten auf Mose hin. Da sich nun der Vater Eleasar ben Aaron nur inder Vokalisation von dem Mosesohn Elieser unterscheidet, könnte dort derursprüngliche genealogische Ansatzpunkt gelegen haben.
Der Grundgedanke dieser Argumentation ist immer wieder aufgegriffenworden,112 wobei oft nicht so stark auf der Historizität der vorausgehendenGenealogie beharrt und die chronologische Abfolge der Generationen igno-riert wurde: Die Namen in den Genealogien stünden ursprünglich isoliert undsind erst im Nachhinein durch Erzählung und Stammbaum in eine bestimm-te Reihenfolge gebracht worden. So kann bei der Ähnlichkeit von Elieser
111 Wellhausen, Prolegomena, 135 f.112 Gall, 121; Westphal, 224; Gressmann, Mose, 274; Noth, Pentateuch, 203; Auerbach,
Das Aharon-Problem, 51 f.; Engel, 78.
20 1 Einleitung
und Eleasar auch Eli als abgewandelte Form des gleichen Namens angesehenwerden (wobei zwischen Aleph und Ayin gewechselt werden muß).113 Damitrücken die beiden Pinhase noch näher zusammen114 und können miteinanderidentifiziert werden: Pinhas ben Eleasar und Pinhas ben Eli sind zuerst Pinhasben Elieser gewesen. Wenn zuerst die Namen für parallel bestehende Grup-pen standen und erst später genealogisch zugeordnet wurden, bleibt Pinhasals Eponym einer solchen »ursprünglichen« Gruppe bestehen, wofür öfter diePinhasiden aus Esr 8,2 und Pinhas mit der Lade in Bethel (Ri 20,27 f.) an-geführt werden.115 Das Gibea des Pinhas kann dann leicht als ursprünglicherKultort dieser Gruppe angesehen werden.116
Wird so einerseits eine mosaische bzw. levitische Ableitung für die Elidenrekonstruiert,117 so erschließen andere einen traditionsgeschichtlichen Zusam-menhang vor allem zwischen Aaroniden und Eliden.118 Auch hier kann natür-lich mit gleichen und ähnlichen Namen argumentiert werden.119 Der VorfahrElis, dem in Ägypten die Priesterschaft zugesprochen wurde, war dann nichtMose, sondern Aaron.120 Einer Gruppe »Aaroniden« wird dann sehr viel mehrHistorizität zugetraut, die nicht zuletzt mit Pinhas ursprünglich im ephraimi-tischen Gebirge angesiedelt sein kann.121
Aaron kann als ursprünglich Zadok präfigurierend angesehen werden,122
oder man läßt ihn eine den Zadokiden entgegengesetzte Gruppe vertreten.123
Ausschlaggebend ist dabei auch, wie das Verhältnis von P und Ez 44 lite-rarisch bewertet wird. Eckart Otto124 hat auf den Widerspruch in JoachimSchapers Arbeit125 hingewiesen, der Aaron einerseits als späte Fiktion erklärt,andererseits trotzdem eine Gruppe historischer Aaroniden annimmt.126 Ot-to betont den Gegensatz zwischen Aaroniden und Zadokiden, verlagert aber
113 Gunneweg, Leviten und Priester, 165; Sabourin, 126 f.114 Nelson, 6.115 Gall, 121; Eissfeldt, 136; de Vaux, Lebensordnungen II, 236; Nelson, 10; Laato, 83;
Blenkinsopp, Sage, 92; Ders., Judaean Priesthood, 39.116 Vgl. S. 118.117 Cross, 196–198. Vgl. auch die Annahme einer ursprünglich mosaischen Priesterschaft in
bZeb 102a.118 Baudissin, 200; Haran, Temples, 87; Blenkinsopp, Judaean Priesthood, 35; Rooke, 57.119 McNeile, 7; Gunneweg, Mose in Midian, 164 f.120 Baudissin, 198 (unentschieden); Haran, Shilo, 85; Rooke, 57. Vgl. Achenbach, Leviti-
sche Priester, 303, der den Text aber sehr spät datiert.121 Möhlenbrink, 216 f.; Aberbach und Smolar, besonders 137; Cross, 199. Vgl. dagegen
Valentin, 37–39.122 Berry, 235; Nurmela, 136 f.; Schaper, Priester und Leviten, 35 f.; Dahm, 94–96.123 Rudnig, Heilig und Profan, 358; Ders., Rezension zu Konkel, 389; Otto, Priestertum,
1648; Fabry, Zadok, 445; Seebass, Numeri III, 134.124 Otto, Aaroniden.125 Schaper, Priester und Leviten.126 Ebd., 173. 175; Otto, Aaroniden, 408 f.
1.3 Sich ergebende Fragen 21
wegen fehlender vorexilischer Aaronüberlieferung die gesamte Entwicklungin exilisch/nachexilische Zeit: Die Aaroniden seien eine Abspaltung von denZadokiden, deren Konzept einer vorstaatlichen Begründung in P mit PS schonwieder zadokidisch integriert wurde.127
Unabhängig davon, ob man in Aaron und Zadok einen ursprünglichenGegensatz sieht, oder beide dasselbe Konzept repräsentieren läßt, die Weiter-führung der aaronidischen Genealogie in den Pentateuch-Texten mit einerAusdifferenzierung in die Namen Eleasar/Pinhas und Itamar läßt auf eine In-tegration anderer priesterlicher Gruppen unter den Oberbegriff »Aaroniden«und damit als Priester nach einem Kompromiß schließen.128 Pinhas stündedann wiederum für die zadokidische Linie.129 Sein Name könnte noch einmalzusätzlich Ausdruck des Kompromisses sein, da er die Assoziation des elidi-schen Namensvetters zuläßt,130 auch wenn dieser – jedenfalls nach der chroni-stischen Ausführung dieses Kompromisses – gerade unter den Itamariden zusuchen wäre (1Chr 24,3).
Zuweilen finden sich Anhaltspunkte, wer für die Ausbildung dieser(zadokidisch-) aaronidischen Genealogie bzw. konkret für die Funktion desPinhas in diesem Zusammenhang verantwortlich sein kann. So kann etwa dieAaronfigur Esra auf den Leib geschrieben sein131 oder Pinhas einen hasmo-näischen Anspruch132 vertreten. Freilich können das auch Anknüpfungen imNachhinein sein.133
1 . 3 S I C H E RG E B E N D E F R A G E N
Die in dieser Arbeit zu behandelnden Texte stehen relativ separat voneinander.Sie verlangen daher getrennte literarische Untersuchungen. Daneben zeigensich aber deutlich übergreifende Themen, vor allem traditionsgeschichtlicheFragestellungen. Um diese übergreifenden Fragen je zusammen zu behandeln,werden die relevanten Einzeltexte diesen thematischen Gruppen zugeordnet:
Als zentraler Text prägt Num 25 entscheidend das Bild von Pinhas. Esmuß geklärt werden, worin die Intention des Textes liegt, und welche Vor-stellungen er voraussetzt. Daher ist nach der Person des Pinhas selbst undseiner genealogischen Einordnung zu fragen und die Entstehung der Traditi-
127 Ebd., 410 f.128 Kennett, 174; Meek, Aaronites, 158; Rowley, 115; North, 195; Judge, 71; Cody, 171; Nel-
son, 10; Blenkinsopp, Judaean Priesthood, 39 Schaper, Priester und Leviten, 36; Ders.,Hoherpriester, 1835.
129 Baudissin, 200; Berry, 235 f.; Rowley, 115; de Vaux, Lebensordnungen I, 235–237.130 Blenkinsopp, Judaean Priesthood, 39.131 Auerbach, Das Aharon-Problem, 62; Achenbach, Levitische Priester, 305.132 Haag, 31.133 So etwa zu dem hasmonäischen Anspruch Rooke, 281 f.
22 1 Einleitung
on eines Pinhas-Bundes zu verfolgen. Der dem nahestehende Bund Levis unddas Motiv des religiösen Eifers verbindet den Priester Pinhas mit den Levitenund läßt danach fragen, in welchem Verhältnis Priester und Leviten zueinan-der gesehen werden. Auf der Ebene redaktioneller Verknüpfungen wird derKonflikt mit Midian und die Kultfähigkeit der zweieinhalb ostjordanischenStämme thematisiert. Auch die Grabnotiz über das Gibea des Pinhas hat re-daktionelle Funktion, ist aber ein wichtiger Ansatzpunkt für die Annahmeeiner vorauszusetzenden priesterlichen Pinhastradition. Daher ist im Bereichder genealogischen Texte nach einer möglichen pinhasidischen Linie zu fra-gen. Nimmt man die Vermutung ernst, daß Genealogien bestimmte gesell-schaftliche Funktionen haben und daher immer wieder umstrukturiert wer-den müssen, ist nach dem Verhältnis von Pinhas ben Eleasar und Pinhas benEli zu fragen.
1 . 4 Z U R M E T H O D I K
1.4.1 Traditionskritik – Literarkritik – Intertextualität
Im Verlauf der Arbeit wird ein methodisches Problem regelmäßig auftreten,dessen Bewertung weitreichende Folgen hat. Gemeint ist das Verhältnis vonTraditionsgeschichte und literarischer Rezeption. Wenn zwei Texte von dergleichen Sache sprechen, muß untersucht werden, ob ein Text auf den an-deren direkt literarisch Bezug nimmt, oder ob die beiden Texte unabhängigvoneinander bestehen und dann als parallele Zeugen für dieselbe existierendeVorstellung angesprochen werden können.
Die zwei methodischen Herangehensweisen setzen zwei entgegengesetzteModelle zur Textentstehung voraus. In den Texten schlägt sich entweder einebei einer Gruppe von Menschen schon als geläufig vorauszusetzende Vorstel-lung schriftlich nieder, oder beim literarischen Weiterverarbeiten der Schrift-rollen gestalten Schreiber neue Texte mit Bezug auf ihnen vorgegebene.
In der vorliegenden Arbeit treten aber mehrere Fälle auf, in denen einesolche klare Unterscheidung schwierig zu sein scheint. Beispiele:
� Eine zu untersuchende Vorstellung ist die von dem Bund Gottes mitPriestern bzw. Leviten und die von der Priesterschaft Levis. Dabeikönnten schon die wenigen biblischen Texte mit der Bundesvorstellungfür eine bestehende Tradition sprechen, wenn man sie nicht als literari-sche Verarbeitungen eines Textes durch den anderen erklärt. Bei der vorallem außerkanonisch bezeugten priesterlichen Levi-Tradition handelt essich sicher um eine unter eventuell konkreter eingrenzbaren Menschen-gruppen bestehende Vorstellung, wobei die einzelnen Texte deutlichAnzeichen literarischer Abhängigkeiten voneinander und vor allem von
1.4 Zur Methodik 23
Mal 2,4–9 aufweisen. Je nachdem von welcher Seite ein Forscher sichdem Maleachitext nähert (von deuteronomistischen Texten her als End-punkt einer Entwicklung134 oder von den außerkanonischen Texten herals Ausgangspunkt135), ist das Urteil, ob er bereits eine Tradition voraus-setzt oder nicht, sehr unterschiedlich.
� Ein weiteres Beispiel ist das Problem der Grabtraditionen. Die bibli-schen Grabnotizen können Formen redaktioneller Systematisierungensein oder eben als erste Texte bestehende Lokaltraditionen voraussetzen.Spätere Texte über die Traditionen zeigen deutliche literarische Bezügeauf die entsprechenden Bibeltexte, was nicht verwundert, da die Pilgerdie Bibel quasi als Reiseführer nahmen.
� Das dritte Beispiel bezieht sich nun direkt auf den Namen einer poten-ziellen Trägergruppe für eine Tradition. Wenn in Esr 8,2 von Pinhasidengesprochen wird, könnte es sich dabei gut um eine konkrete exilischeGruppe von Priestern handeln, deren Stammvater erst im Nachhineinals Sohn des Eleasar hochgelobt oder als Sohn des Eli diffamiert wurde.Die andere Variante ist, daß hier die wenigstens schon von Aaron bisPinhas ausgearbeitete Genealogie vorausgesetzt ist, und daß daher diegerade dominierende bzw. dominieren sollende Priestergruppe archai-sierend als Pinhasiden bezeichnet werden.
Die Beispiele belegen, daß Traditionen nach ihrer Verschriftlichung nicht auf-hören, als Traditionen zu bestehen. Vielmehr gibt es immer wieder Wech-selwirkungen zwischen den Texten und Traditionen.136 Die oben beschriebe-nen Modelle zur Entstehung biblischer Texte müssen um den Gesichtspunkterweitert werden, daß bestehende Texte eine mehr oder weniger große Brei-tenwirkung haben. Es ist zwar durchaus umstritten, ab welchem Zeitpunktwelche biblischen Texte überhaupt für öffentliche Vorträge vorgesehen wa-ren. Eventuell sind bestimmte Fortschreibungsschichten nur für einen kleinenKreis Eingeweihter bestimmt gewesen. Aber es stellt sich die Frage, wozu derAufwand von Sammlung, Überlieferung und Überarbeitung der biblischenTexte überhaupt betrieben wurde – nur für ein stilles Kämmerlein?
Daher muß in Betracht gezogen werden, daß biblische Texte nicht nurbestehende Vorstellungen voraussetzen, sondern auch solche auslösen. Wennetwa danach gefragt wird, ob die Erwähnung des Vorfalls von Baal Peor inHos 9,10 die Erzählung in Num 25 voraussetzt, wurde oft vermutet, daß bei-den Texten eine gemeinsame Tradition vorgelegen habe. Zu wenig Überein-stimmungen in den Formulierungen sind zu finden. Demgegenüber ist aber
134 Achenbach, Levitische Priester, 307.135 Kugler, 18–22.136 Vgl. Fohrer, 2 f.
24 1 Einleitung
auch möglich, daß Hos 9,10 auf das Wissen um die Vorgänge mit dem BaalPeor Bezug nimmt, weil sie aus Num 25 allgemein bekannt sind, ohne daßkonkret auf die Formulierungen des Textes angespielt wird.
Diese Arbeit geht davon aus, daß die Formen intertextueller Beziehungenim Alten Testament verschieden sein können. Es gibt einerseits deutliche li-terarische Bezüge wie andererseits inhaltliche Referenzen. Weiterhin ist mitnicht mehr vorhandenen dritten schriftlichen Quellen wie mit nur mündlichumlaufenden Vorstellungen zu rechnen.
Um Entscheidungen fällen zu können, müßten zwei Texte signifikante Ge-meinsamkeiten aufweisen, die entweder für eine direkte literarische Abhängig-keit oder für ein allgemeineres Verhältnis sprechen. Wolfgang Lau macht fürden Nachweis literarischer Bezüge in Tritojesaja zur Voraussetzung, daß wört-liche Zitate vorliegen. Stichwortbezüge »sind als bewußte literarische Bezug-nahme nur dann plausibel, wenn sie in einem Sinnzusammenhang stehen.«137
Die Grenzen seien jedoch fließend.138
Gibt es solche aussagekräftigen Anzeichen nicht, so sollte eher die weni-ger weit gehende Hypothese gewählt werden. Es ist mehr behauptet, wenneine direkte Abhängigkeit eines Textes von einem anderen postuliert wird, alswenn man annimmt, beide sprächen vom gleichen Gegenstand. Dann legtsich im Zweifelsfall eine traditionsgeschichtliche Lösung nahe. Dagegen kanneingewendet werden, daß gerade diese Lösung die weitergehende Hypotheseist, weil sie eine dritte Größe neben den beiden vorliegenden Texten postu-liert, nämlich das Wissen um den Gegenstand. Darin liegt sicher das Problemder Traditionsgeschichte, daß sie zu steilen Hypothesen neigt, wenn sie diesesDritte rekonstruiert. Hier ist also Zurückhaltung geboten.
In der gegenwärtigen Forschung werden traditionsgeschichtliche Überle-gungen gern als Spekulationen abgetan. Das ist auch berechtigt, wenn manbedenkt, wie viele solcher Theoriegebilde wieder eingestürzt sind. Dennochgibt es Problemlagen, die sich erst durch das Konstrukt einer Traditionsge-schichte befriedigend deuten lassen. Ein solches Deutungsmodell wird im Er-gebnis dieser Arbeit geboten.
Da die zu behandelnden Texte im allgemeinen relativ spät datiert werdenund deutlich übergreifende literarische Verweise setzen, ist die Frage, wie ihreEntstehung im Kontext größerer literarischer Komplexe erklärt werden kann.Sowohl im Numeribuch, als auch am Übergang von Josua zu Richter wei-sen sie deutliche redaktionelle bzw. kompositionelle Funktionen auf. DieseArbeit begnügt sich damit, diesen Verweischarakter der einzelnen Texte auf-zuzeigen und mit vorliegenden redaktionsgeschichtlichen Einordnungen inBeziehung zu setzen. Auf die mögliche Charakterisierung von Texten als prie-ster(schrift)liche oder deuteronomistische wird unter Bezugnahme auf Sekun-
137 Lau, 15.138 Ebd.
1.4 Zur Methodik 25
därliteratur verwiesen. In den meisten zu behandelnden Fällen geht es jedocheher um weiter nachgeordnete literarische Stufen, die als »Ps«, »postdeutero-nomistisch« oder als Texte bezeichnet werden, deren Themen und Vokabularvon beiden Richtungen beeinflußt zu sein scheinen. Die literargeschichtli-chen Vorgänge, mit denen die Texte vor allem in Zusammenhang stehen, sinddie Gesamtgestaltung des Pentateuch und die Übergänge vom Numeri- zumJosua- und vom Josua- zum Richterbuch.
1.4.2 Zur Interpretation von Genealogien
Genealogien ordnen das Individuum mit Hilfe verwandtschaftlicher Bezie-hungen in seinen gesellschaftlichen Kontext ein. Der Begriff umfaßt sehr un-terschiedliche Textgattungen, deren soziale Relevanz auf ganz verschiedenenEbenen liegen kann. Obwohl in den Begriffen der Blutsverwandtschaft ge-sprochen wird, können ebenso auch geographische, soziale, politische, religi-öse oder wirtschaftliche Realitäten reflektiert werden.139 Die Feststellung derVerwandtschaft eines Individuums hat ja auch ganz konkrete Auswirkungenauf seine Umweltbeziehungen, was etwa Heirat, Erbrecht oder Blutrache an-geht.140
Für die alttestamentlichen Genealogien sind Analogien aus verschiede-nen Bereichen zusammengetragen worden. Für linear aufgebaute Listen bie-ten sich hauptsächlich altorientalische Königsinschriften und -listen an. Siesind vor allem dazu geeignet, die Legitimität einer Person durch Ableitungvon einem anerkannten Vorfahren darzulegen.141 Da es letztlich nur um diezuletzt genannte Figur geht, ist es nicht verwunderlich, daß Zwischengliederausfallen oder in anderer Ordnung auftreten können.142 Die durch mehrereNachkommen in einer Generation aufgegliederten (segmentierten) Genealo-gien haben in altorientalischen Texten fast keine Parallelen.143 Deshalb werdendafür mündlich überlieferte Genealogien moderner tribaler Gesellschaften imVorderen Orient und Afrika herangezogen.144 Diese segmentierten Genealo-gien dienen eher dazu, das Verhältnis einzelner gesellschaftlicher Gruppen zu-einander zu beschreiben. Dabei gibt es frühere Vorfahren, die diese Gruppeneinen, und spätere, die sie voneinander differenzieren.145
Beim Vergleich miteinander im Zusammenhang stehender Genealogienfällt auch bei den herangezogenen Analogien immer wieder auf, daß Namen
139 Wilson, Recent Research, 180 f.; Bendor, 45; Braun, 96.140 Malamat, 42; Neu, 658 f; Dahm, 46.141 Wilson, Genealogy and History, 25 f., 56–114; Braun, 95; Malamat, 52.142 Wilson, Recent Research, 180.143 Ders., Genealogy and History, 134 f.; Malamat, 52.144 de Vaux, Lebensordnungen I, 20–24; Wilson, Genealogy and History, 11–55; Malamat;
Levin, 18 f.145 Braun, 95.
26 1 Einleitung
ihren Platz im System oder ihre genaue Form ändern oder ausgetauscht wer-den können. Diese Veränderungen können mit neuen Verhältnissen zwischenden entsprechenden Gruppen korrelieren. Das geschieht etwa, wenn ein Un-terstamm abwandert und deshalb evtl. neue Koalitionen schließen muß.146
An dieser Stelle geht die Frage nach der »Echtheit« der Texte am Gegenstandvorbei, wenn dabei ursprünglich richtige Beziehungen angenommen werden,die nun verfälscht wären. Indem eine Genealogie veränderten Verhältnissenoder Sichtweisen angepaßt wird, ist sie gerade Zeugnis einer dahinterstehen-den »Realität«.147
Im Alten Testament liegen auch die aufgegliederten Genealogien – auchwenn wohl oft eine mündliche Überlieferungsphase vorausgeht – schriftlichvor.148 In diesem literarischen Rahmen erklären sich dann auch Mischungender beiden genannten Gruppen.149
Martin Noth hat für Genealogien auf zwei grundsätzliche Typen hinge-wiesen. Das eine seien eigentliche Genealogien, in denen Namen zusammen-gestellt werden, die bestimmte historische Verhältnisse – z. B. unter dem Jeru-salemer Tempelpersonal – wiedergeben. Das andere seien sekundäre Genealo-gien, die vor allem den Zweck haben, vorgegebene Traditionen zu verarbeiten– etwa in kompositorischer Absicht.150 Marshall D. Johnson hat darauf hinge-wiesen, daß oft beides miteinander kombiniert sein kann.151 Er hat eine diffi-zilere Auflistung möglicher Intentionen alttestamentlicher Genealogien gelie-fert,152 wobei er für priesterliche Genealogien v. a. den Legitimitätsnachweisfür das Amt aufführt.153 Dabei spielt aber gerade die Anknüpfung an »alte«Namen eine wichtige Rolle, und damit an schon literarisch vorgegebene Tra-ditionen.154
Robert R. Wilson kritisiert diese stark literarisch ausgerichtete Interpreta-tion und fragt statt dessen auch nach dem historiographischen Charakter derTexte. Anknüpfend an Noth orientiert er sich dabei daran, inwieweit Genea-logien mit ihrem erzählerischen Kontext zusammengehören.155 Für den Be-reich der altorientalischen Texte hat er keine Fälle sekundärer Genealogiengefunden.156 Wilson stellt die These auf, daß segmentierte Genealogien inbiblischen Texten nur in der mündlichen Überlieferungsphase soziale Wech-
146 de Vaux, Lebensordnungen I, 20–23.147 Wilson, Recent Research, 180; Braun, 96.148 Malamat, 51.149 Braun, 95 f.150 Noth, Pentateuch, 232–237.151 Johnson, xv.152 Ebd., 77–82.153 Ebd., 79.154 Ebd., 80.155 Wilson, Genealogy and History, 5 f. 199 f.156 Ebd., 135 f.
1.4 Zur Methodik 27
selverhältnisse widerspiegeln könnten. In schriftlicher Form seien sie zu fi-xiert, um auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren zu können. Als lite-rarische Produkte können sie den Erzählzusammenhängen entnommen undaus Listenmaterial zusammengestellt sein.157 Wilsons Argumentation beginntmit dem Fehlen segmentierter Genealogien im Alten Orient in schriftlicherForm. Sind aber Texte da, wie im biblischen Material, so ist es methodischnicht gerechtfertigt, aus ihrem Fehlen im Kontext ihre soziale Irrelevanz imAlten Testament zu postulieren. Yigal Levin hält Wilsons Sicht für zu einfach,da für Israel sein tribales Selbstverständnis auch in später Zeit lebendig sei undselbst den chronistischen Genealogien zeitgenössische Verhältnisse zugrundelägen.158
Bei der Rekonstruktion der Geschichte des israelitisch-jüdischen Priester-tums spielen die Namen der »ersten« Priester eine entscheidende Rolle. Wel-chen Sinn hätten die vielen Namen wie Aaron, Eleasar, Ithamar, Pinhas benEleasar, Eli, Pinhas ben Eli, Hofni, Jonathan ben Gerschom ben Mose oderauch eben Mose, Korach und Levi, wenn nicht die Geschichte des Kultper-sonals eine komplizierte Entwicklung miteinander konkurrierender Gruppendarstellte, die untereinander Machtkämpfe austrugen, bei denen eine Grup-pe über eine andere siegte, oder Kompromisse ausgehandelt wurden? Nebenden Texten, in denen die Konflikte erzählerisch verarbeitet zu sein scheinen(Ex 32; Lev 10; Num 16; 1 Sam 2 f. u. a.), sind die Genealogien als Versuchezu bewerten, die mehr oder weniger komplizierten Machtverhältnisse in einhierarchisches Schema einzuordnen.159
Dieser Überlegung folgend, könnte hinter jedem Namen eine konkre-te priesterliche Gruppe vermutet werden.160 Im Zuge dieser genealogischenNeuordnung dienen – bei den Rekonstruktionsversuchen – einzelne Namenimmer auch als Konstrukte, entweder, daß sie als Ahn priesterlicher Gruppenstilisiert wären, oder daß zum Zwecke der Legitimierung die Herleitung vonbestimmten Personen postuliert wurde, so daß ganz unterschiedliche Gruppensich auf denselben Namen beziehen könnten. In solchen Fällen ginge es stetsum die Einordnung von dem Autor eines konkreten Textes zeitgenössischenGruppen. Aber die Intention des Autors kann auch stärker auf der Ebene lite-rarischer Gestaltung liegen. Eventuell dient eine Genealogie in erster Linie da-zu, größere literarische Zusammenhänge (etwa ein biblisches Buch) mit einemOrdnungsschema zu versehen. Genealogische, wie Grab- und Altersnotizen,können in größeren Textzusammenhängen redaktionellen Systematisierungendienen. In diesem Fall muß nicht zwingend vom Namen her auf eine beste-hende priesterliche Partei geschlossen werden.
157 Ebd., 196–198.158 Levin, 32–34, 38–40.159 Vgl. etwa Nelson, 5–7.160 Gunneweg, Mose in Midian, 12; Spencer, Priestly Families, 398; Neu, 659.
28 1 Einleitung
Die möglichen Wechselwirkungen zwischen Gruppenidentität und Er-zählstoff hat Martin Noth beschrieben. Einerseits stellen die Namen »Epo-nymen bestimmter Gemeinschaften« dar, andererseits knüpfen diese Priester-gruppen gerade an die Erzählungen über Mose und Aaron und ihre Verwandt-schaft an, um sich davon herzuleiten.161
Das Problem wird noch komplizierter, wenn berücksichtigt wird, daß abeinem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich nach dem Exil, ein grundlegen-der Kompromiß zur Genealogie ausgehandelt worden ist, und sich – betrach-tet man seine Wirkung auf heute vorliegende Texte – immer mehr durch-gesetzt hat: Die Aufteilung des Kultpersonals in oberen und niederen Kle-rus über eine ausgewählte Familie aus dem Stamm Levi (Aaroniden/Levitenim Pentateuch; Zadokiden/Leviten bei Ezechiel) und die Einordnung Zadoksund der Eliden in die aaronidische Genealogie. In dem Moment, wo der Autoreines Textes dieses System als Konsens voraussetzt, kann er auf die verschiede-nen Namen Bezug nehmen, obwohl er vielleicht nur eine bestimmte »Partei«vertritt. So können sich Priester durchaus auf ihren Ahn Levi positiv beziehen,aber auch Leviten könnten letztendlich Zadok als die herausragende Figur ih-res Stammes beschreiben. Es ist deshalb problematisch, wenn etwa Saul M.Olyan für ben Sira eine nichtzadokidisch-aaronidische Partei postuliert, weilZadok nicht erwähnt wird, und eine antilevitische Tendenz annimmt, weil Le-vi keine Rolle spielt.162 Corrado Martone weist auf eine eschatologische Um-deutung zadokidischer Herleitung in CD III,12–IV,3 hin.163 Tendenziell wer-den alle ihre Abkunft von dem als rechtmäßig bekannten Priestergeschlechtbehaupten. So wundert es nicht, daß sich auf Pinhas sowohl Zadokiden, alsauch Hasmonäer und ebenso Samaritaner zurückführen.
Fragt man nach der Identität einer priesterlichen Gruppe, ist ihre tatsäch-liche Herkunft (z. B. patrilinear abgeleitet) weniger von Bedeutung, als dieFrage, welche gesellschaftliche Stellung diese Gruppe hatte. Die genealogischeEinordnung ist in erster Linie von kollektiven Selbst- und Fremdzuschreibun-gen bestimmt, selbst wenn dabei die Identitäten der Väter- und Großväterge-nerationen auch eine Rolle spielen. Werden aber Zeiträume von Jahrhunder-ten überblickt, dann wird der Anteil der funktional orientierten Gestaltungan den Genealogien immer größer werden.
1.4.3 Zur Deutung von Grabnotizen
Hermann Schulz hat im Zusammenhang einer kulturgeschichtlichen Ein-ordnung des alttestamentlichen Levitismus die Heiligenverehrung als einen
161 Noth, Pentateuch, 203 f.162 Olyan, 270. 279.163 Martone, 272–274.
1.4 Zur Methodik 29
zentralen Aspekt derselben herausgestellt.164 In den aufgeführten vorderorien-talischen und nordafrikanischen Analogien nennt er auch mehrmals die Be-deutung der Heiligengräber.165 Bei der Herausarbeitung Moses als zentralerlevitischer Heiligengestalt166 geht er jedoch nicht auf Moses Todes- und Be-gräbnisnotiz und die Möglichkeit einer Lokaltradition ein.167 Der Text leug-net eben die Existenz einer lokalen Verehrungstradition (Dtn 34,5 f.). Lassensich alttestamentliche Grabnotizen in Analogie zur mittelalterlichen und mo-dernen orientalischen Heiligenverehrung erklären?
Gräber und Umgang mit Leichen bringen in alttestamentlichen TextenProbleme der Verunreinigung mit sich, und Totenkult168 wird grundsätzlichnegativ bewertet (Dtn 14,1; Jes 8,19; 1 Sam 28 u. ö.). Dennoch ist es wich-tig, ordentlich begraben und daher in der familiären Gemeinschaft geblie-ben zu sein. So werden auch die Begräbnisse herausragender Personen er-wähnt, und die Lage und Art ihrer Gräber wird öfter ausdrücklich notiert(z. B. Gen 49,29–50,14). Von einer Verehrung dieser Personen am Grab wirddagegen nicht gesprochen. Es stellt sich die Frage, welche Funktion solcheherausragenden Gräber, falls sie existierten, gehabt haben könnten. »Scheidet«wegen des Verbotes von Trauerriten, wie Gerhard von Rad meinte, »die An-nahme, daß hier die Ätiologie eines Grabheiligtums gegeben werde, aus,«169
oder sind entsprechende anstößige Elemente der Frömmigkeit gerade deshalbverschwiegen worden?
Die meisten Erwähnungen solcher Gräber erscheinen erst in nachexili-schen Texten.170 Fragt man nach religionsgeschichtlichen Parallelen, liegt eszuerst nahe, die Heiligenverehrung des antiken Judentums ins Auge zu fassen,die seit hasmonäischer Zeit belegt ist171 und zum Teil direkt den Anspruch hat,biblisch erwähnte Grabtraditionen fortzuführen. Sie steht phänomenologischbetrachtet im Zusammenhang etwa mit der muslimischen, hinduistischenund christlichen Heiligenverehrung.172 Ja, oft treffen sich die verschiedenenGruppen an den gleichen Heiligtümern.173 Die christliche Heiligenverehrungwird sowohl vom Märtyrer- als auch vom antiken Heroenkult abgeleitet,174
164 Schulz, 92, 123–136.165 Ebd., 104, 107 f., 115, 131 f., 141.166 Ebd., 181–188.167 Als Grabtradition gedeutet von Wellhausen, Geschichte, 103. Siehe dagegen Noth, Pen-
tateuch, 186–189.168 Zu Toten und spezieller Ahnenverehrung und deren Differenzierung siehe Balz, 225.169 Von Rad, 213. Dagegen Wellhausen, Geschichte, 102 f.170 Koch, 1151.171 Schwemer, Heilige.172 Lanczkowski; Larsson.173 Bergunder.174 Köpf, 1540; Bartelmus, Heroen.
30 1 Einleitung
ihr Zusammenhang mit jüdischer Heiligenverehrung und Heroenkult ist aberumstritten.175
Die Beschreibung des Heroenkults zeigt erstaunlich viele Gemeinsamkei-ten mit der orientalischen Heiligenverehrung und könnte für nachexilischeTexte ein wichtiger Bezugsrahmen sein. Auch hier handelt es sich um Per-sonen, die zum Teil dem göttlichen Bereich sehr nahe sind, wie auch umkonkrete historisch greifbare Menschen. Heroenkulte stellen lokale Traditio-nen dar, die identitätsstiftend wirken. Vergleichbar mit dem orientalischenHeiligenwesen werden die Gräber zu Kultstätten, an denen auch Opfer darge-bracht werden. Der Heroenkult läßt sich archäologisch seit dem 8. Jh. v. Chr.nachweisen und wurde seit dem 5. Jh. v. Chr. auch auf historische Personenangewandt. Erklärungsmodelle sehen den Ursprung des Heroenkultes a) infrüheren Lokalgottheiten, b) im Ahnenkult, c) kann angenommen werden,Figuren aus dem Epos würden Gräber zugeschrieben oder sie seien d) Epo-nymen einer Gruppe.176 Bartelmus hat bei dem religionsgeschichtlichen Ver-gleich zum Heroentum im Alten Testament177 das Element des Grabkultes(fast)178 völlig ausgeblendet. Viele der alttestamentlichen Gestalten, von de-nen Begräbnisse berichtet werden, sind ja auch mitnichten dem Typus einesHeros zuzuordnen. Wenn aber nach dem Sinn von Grabnotizen gefragt wird,ist diese religionsgeschichtliche Parallele mit in Betracht zu ziehen.
Wenn in nachexilischer Zeit vermehrt Interesse an den Gräbern hervorra-gender Gestalten besteht, liegt es nahe, von bestehenden Grabkulten auszuge-hen. Daß solche Kulte im Zusammenhang mit den Gräbern nicht erwähntwerden, wird wahrscheinlich in der Konkurrenz dieser Kulte zum offiziel-len Kult liegen. In der Geschichte der Heiligenverehrung hat es um diesesKonkurrenzproblem immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Polemikdagegen wird schon von Jesus berichtet (Mt 23,29–32; Lk 11,47 f.). Die Ver-bote von Trauerriten und Totenbefragungen weisen auf das Bestehen solcherFrömmigkeitsformen hin.179 Tote können in ihren Gräbern durchaus noch amSchicksal des Volkes Anteil nehmen.180 Es sind die Gräber der Väter, um de-retwillen Nehemia um Jerusalem Sorge trägt (Neh 2,3. 5).181 Eventuell war mitden monotheistischen Tendenzen, die die exilische und nachexilische Zeit im-mer stärker bestimmen, eine Transformierung einer allgemein anzunehmen-den Ahnenverehrung182 auf die Verehrung der Erzväter notwendig.183
175 Vgl. die Diskussion bei Colpe, 165 f.176 F. Graf; Bartelmus, Heroen.177 Ders., Heroentum.178 Ebd., 110.179 Vgl. Koch, 1153 f.180 Ebd., 1153; Brichto, 48.181 Koch, 1152.182 Brichto.183 Loretz, 172; Baumeister, 98.
1.4 Zur Methodik 31
Oswald Loretz hat diesen Prozeß ausführlich plausibel gemacht.184 Dem-nach ist die Ahnenverehrung einerseits unterdrückt, andererseits in historisier-ter Form in das nachexilische Judentum integriert worden, nämlich in Formder Erzelternerzählungen. Die biblischen Texte stellen diesen Aspekt stark alseine kollektive Vergewisserung über die eigene Vorgeschichte dar, in der, enggeknüpft an die Gräber, auch Israels Landanspruch wurzele. Klaas Spronk hatausführlich die Forschungsgeschichte zum Problem der Totenverehrung im al-ten Israel dargeboten.185 Er mahnt zur Zurückhaltung, bei den verschiedenenTrauerriten gleich von vergöttlichten Toten auszugehen.186 Die Analogie zumHeiligenkult liegt hier näher.
Matthias Köckert hat zur Vorsicht gemahnt, allein aus dieser Transfor-mation von Ahnenkulten die Väter Israels zu erklären, und die innere Logikherausgestellt, die die genealogisch orientiert beschriebene Vorgeschichte Is-raels zu einer Familiengeschichte werden läßt.187 Die Gestaltung dieser Vor-geschichte in großen literarischen Komplexen ist die Voraussetzung einer Ver-ehrung der Erzeltern, nicht umgekehrt. Phänomenologisch betrachtet wirddamit allerdings eine Religiosität ausgeübt, die ihre Analogien in der Ahnen-verehrung hat.
Wenn es notwendig ist, Verbote der Totenverehrung auszusprechen, dannist wahrscheinlich, daß sie durchaus von Bevölkerungsgruppen praktiziertwurde.188 Verdrängung auf der Ebene der textlichen Überlieferung schließtnicht zwangsläufig die Verdrängung in der Praxis ein. Wenn also in spätnache-xilischer Zeit die Heiligenverehrung direkt an diesen textlich bezeugten Grab-traditionen anknüpft, kann vermutet werden, daß auch kultische Traditionenzwischendurch nicht vollständig abgebrochen waren.
Dabei ist nicht nur von einer Transformation der Totenverehrung ausge-gangen worden. Sowohl die Lage vieler Gräber auf Hügeln, oft in Begleitungmit heiligen Bäumen,189 als auch ihre Funktion als Schlachtopferstätten190
lassen sie phänomenologisch den Höhenheiligtümern ähnlich erscheinen.191
Wenn sie aber funktional die Höhenkulte beerbt haben sollen, dann könneneinzelne Gräber auch bestimmte lokale Kulttraditionen fortführen.192 UnterVerwendeung des Begriffes »Kanaanismus« setzt sich ausführlich mit dieserSichtweise Markus Kirchhoff auseinander.193
184 Loretz, 172185 Spronk, 25–54.186 Ebd., 247 f.187 Köckert, 309–311.188 Lewis, 1 f.; Podella, 228; Gerstenberger, Theologien, 205 f.189 Canaan, Saints, IV, 3–7.190 Ders., Opfer, 39.191 Clermont-Ganneau, Arabs, 325; Mc Cown, 48.192 Sehr zuversichtlich ist hierin Curtiss, 160.193 Kirchhoff, 270–286.
32 1 Einleitung
Bei der Untersuchung entsprechender Texte muß jedoch auch damit ge-rechnet werden, daß stärker kompositionelle Funktion haben können, alsoähnlich wie genealogische Notizen Erzählungen von einzelnen Personen imKontext eines oder mehrerer Bücher zueinander in einen systematischen Zu-sammenhang bringen. Außerdem dienen Grabnotizen oft auch dazu, Land-besitzansprüche zu untermauern bzw. in eine Vorzeit zu verlegen (so etwa inGen 23).194 Allerdings steht diese Landbesitz begründende Funktion der Grä-ber in einem engen inhaltlichen Zusammenhang zur Anwesenheit der Totenin ihren Gräbern und der Art, wie die Nachkommen sich dazu in Beziehungsetzen.195
194 Vgl. Koch, 1151; Kallai, Rachel’s Tomb, 217–219.195 Brichto, 8–23.
2 Baal Peor
2 . 1 N U M 2 5 – P RO B L E M B E S C H R E I B U N G
Mit der Erzählung vom entschlossenen Ahnden einer illegitimen geschlechtli-chen Beziehung auf frischer Tat, bekommt die Figur des Pinhas ihre markan-testen Züge. Sie ist der Ansatzpunkt für die recht umfangreiche Rezeption.
Die Geschichte steht geographisch – mit dem gesamten Ende des Nume-ribuches und dem Deuteronomium – in einer Übergangssituation. Einerseitshat Israel mit der Eroberung des Ostjordanlandes (Num 21) schon die Wüstehinter sich gelassen. Es ist schon im Lande angekommen. Andererseits machtgerade der Pinhastext Jos 22 deutlich, daß hier eigentlich noch nicht das in-tendierte Land ist. Das Ostjordanland ist nach Num 32 Israel nur zufälligzugefallen und wird mehr aus praktischen Erwägungen mit als Siedlungsge-biet genutzt. Der Beginn des Josuabuches mit seinem dem Schilfmeerdurch-zug parallel gestalteten Jordanübertritt läßt erst hier das eigentliche Land be-ginnen. Die territoriale Zugehörigkeit des Gebietes, in dem die Israeliten indieser Übergangszeit lagern, wird immer wieder unterschiedlich bestimmt. Eshandelt sich um die Ebene am Nordostende des Toten Meeres, wobei die an-grenzenden Gipfel und der Gebirgsabhang des ostjordanischen Gebirges miteinbezogen sind. Wie beschrieben, hatte Israel dieses Gebiet von Sihon, demAmoriter, erobert. Es heißt jedoch auch »Steppe Moabs« (Num 22,1). Sihonhatte es erst von Moab erobert (Num 21,26). Diese Unsicherheit in der terri-torialen Zugehörigkeit kann sogar dazu führen, daß Ammon Anspruch dar-auf erhebt (Ri 11,13), und seit Num 22,4 spielt auch Midian – ein nomadischvorgestelltes Volk aus dem Hedschas – neben Moab (Num 22,4. 7) bzw. denAmoritern (Jos 13,21) eine Rolle, so daß das schon eroberte Ostjordanlandin einem Krieg gegen dieses Volk erst vollständig ethnisch gesäubert werdenmußte (Num 31).
Direkt vor Num 25 – und in starkem Kontrast dazu – ist die Bileampe-rikope (Num 22–24) plaziert. In ihr wird Israel selbst gegen den Willen derAkteure gesegnet. Demgegenüber bietet Israel mit dem Abfall zum Baal Pe-or einen scharfen Kontrast zu Gottes Segen durch Bileam.1 Während Bileamin Num 24,25 nach Hause geht, wird er in Num 31,8. 16 als verantwortlichfür die Geschehnisse in Peor dargestellt. Mit Num 25,19 (»Und nach der Pla-ge«) wird zur zweiten Volkszählung im Numeribuch übergeleitet. Mit dieserZählung ist der Wechsel zwischen Wüsten- und Landnahmegeneration abge-
1 Seebass, Numeri III, 113.
34 2 Baal Peor
schlossen (Num 26,64 f.). Die Plage hat offenbar die Funktion, diesen Wech-sel zu markieren.2 Auch in Dtn 4,3–5 wird deutlich, daß alle, die Baal Peorüberlebt haben, weil sie nicht abgefallen sind, nun ins Land kommen. Dtn 4scheint eng auf Dtn 29 f. bezogen zu sein. Diese Überlebenden sind also diePartner im Moab-Bund.3 In Hos 9,10 dagegen repräsentiert Peor schon dennegativen Zustand des Landbesitzes im Gegenüber zur Idealzeit in der Wüste.Hier wie dort treten die »Väter« auf. Es ist nicht sinnvoll, die Unterscheidungvon Wüsten- und Landnahmegeneration in Hos 9,10 hineinzulesen, denn an-gesprochen sind Hoseas Zeitgenossen. Mit »Väter« wird allgemein auf ihreVorfahren in Israels Frühzeit Bezug genommen.4
Von der Struktur der Erzählung her (Erregung des Zornes Gottes – Ein-greifen einer Person bzw. deren Interzession – Stillung des Zornes) schließtNum 25 die Reihe der Murr- und Auflehnungsgeschichten des Wüstenaufent-haltes ab.5 Stein des Anstoßes bildet jedoch schon ein Baal. Die Herausforde-rung des Landes tritt Israel sofort an seiner Grenze entgegen. Auch aus dieserPerspektive bildet Num 25 den Übergang zwischen Wüste und Landbesitz.
Die Logik der Geschichte ist zunächst bestechend. Beim Eintritt Israelsin das gelobte Land kommt es zur Berührung mit anderen Völkern. Speziellgeschlechtliche Beziehungen führen zur Teilnahme an fremden Kulten.6 DerZorn des Herrn entbrennt und fordert Bestrafung. Einerseits wird die Strafeauf jeden Schuldigen individualisierend ausgeweitet. Andererseits sühnt diespontane Tat eines einzelnen für das ganze Volk. Daß dem Vollstrecker dieewige Priesterschaft als Zusage gegeben wird, ist zum einen Lohn, und hängtzum anderen damit zusammen, daß er ein Enkel Aarons ist und das Sühnenfür das Volk mit priesterlichen Aufgaben am Tempel assoziiert werden kann.
Im Einzelnen betrachtet, erweist sich der Lauf der Erzählung jedoch längstnicht als so geradlinig.7 Während am Anfang das Problem mit Moabiterin-nen bestand, erregt später der Geschlechtsverkehr mit einer Midianiterin denEifer des Pinhas, und am Ende wird davon ausgegangen, daß auch am An-fang von Midianitern die Rede war. Beim göttlichen Auftrag an Mose bleibt– wenigstens für den heutigen Leser – unklar, wer die »Häupter des Volkes«� �� �� � � ��� �� ra�šê ha�am sind, die bestraft werden sollen. Sind Anstifter zumAbfall gemeint, oder Verantwortliche von bestimmten Unterabteilungen desVolkes, die für die Taten ihrer Untergebenen zur Rechenschaft gezogen wer-
2 Olson, 229–232.3 Otto, Deuteronomium, 159.4 Gegen Biberger, 465.5 Vgl. Boudreau, Study, 19–31; Achenbach, Vollendung, 426.
6 Zur Deutung der Vokabel ��� s.md (Nif ) vgl. Mendenhall, 111; Milgrom, 212. ZumJochtragen, das alttestamentlich sonst allerdings eine andere Terminologie zeigt, vgl. Ruwe
und Weise.7 Vgl. jüngst Seebass, Case, 41.
2.1 Num 25 – Problembeschreibung 35
den?8 Die letztere Deutung würde in besonders krassem Widerspruch dazustehen, daß bei der Weiterleitung des Befehls durch Mose andere Repräsen-
tanten des Volkes, die »Richter« �� �� � �� šopet. îm, mit der Bestrafung der einzel-
nen Schuldigen beauftragt werden. Die Interpretation der Häupter als Richterstimmt mit Ex 18,25 f. zusammen, wo Mose dem Volk Häupter auswählt, diees richten sollen.
Nach der Septuaginta und einigen samaritanischen Handschriften sindnicht die Richter, sondern die Stämme angesprochen. Die Variante läßt sicham leichtesten mit einem Verständnisfehler beim Abschreiben des unvokali-sierten Textes erklären. Da die Verwechslung von � b und p im Silbenschlußwahrscheinlicher ist als in einer offenen Silbe, hat der den Fehler verursachen-de Abschreiber offenbar � �� � �� šipt.ê gelesen und � �� � � �� šibt.ê geschrieben. Die
ursprüngliche Lesart ist dagegen »Richter« � �� � �� šopet.ê.Ein weiteres Problem zeigt sich bei der Strafe Gottes für den Götzendienst.
Nach Vers 4 sollen die »Häupter« bestraft werden. Ob die Verbform � �� ��� �wehôqa� dabei nur eine öffentliche Schuldzuweisung (im Sinne von: »an denPranger stellen«) oder eine grausame Hinrichtungsart (etwa: »pfählen, verren-ken«) beschreibt, läßt sich nicht mit Sicherheit klären.9 Nach Vers 5 werdendagegen die »Richter« aufgefordert, daß ein jeder alle Schuldigen unter »seinen
Leuten« (�� ��
�� ���
�� �� ��� � �� hirgû �îš �
anašaw) töte. Im folgenden wird jedoch da-
von ausgegangen, daß die Israeliten eine »Plage« � � ��� �� maggepah (Vers 8 u. ö.)erleiden, deren Gang sie nicht direkt beeinflussen könnten. So befindet sich
die »Gemeinde« � �� �� �edah in Vers 6 während eines Trauer- oder Klageritualsvor dem Zelt der Begegnung. Wie durch ein Wunder wird diese Plage durchdie sühnende Tat des Pinhas gestoppt. Oft wird darauf verwiesen, daß diePlage sich nicht auf die angeordnete Strafe beziehen kann.10 Milgrom unter-scheidet die Plage von der Strafe und sieht sie schon ausgebrochen, wo »derZorn des Herrn gegen Israel entbrannte« (Num 25,3).11 »Plage« bezeichnetjedoch ganz unterschiedliche Formen eines massenhaften Sterbens (vgl. etwaNum 14,37 und die Anwendung des Begriffes auf militärische Niederlagen1 Sam 4,17; 2 Sam 17,9; 18,7).
Ähnlich unerwartet wie in der Pinhas-Episode (V. 6 ff.) die Plage auf-taucht, wird hier plötzlich auch von einer Midianiterin gesprochen, obwohlam Anfang von Moabiterinnen die Rede war. Es heißt »die Midianiterin«
����� � ��� �� hammidyanît – determiniert –, so als müsse der Leser schon längstwissen, um wen es geht. Am Ende des Kapitels und in Num 31, wohin diesesEnde überleitet, ist dann Moab vollends nicht mehr im Blick – der Krieg geht
8 Noth, Numeri, 172.9 Vgl. Polzin. Seebass, Numeri III, 112, ist Thiel, 256, folgend eindeutig für »verrenken«.10 Rudolph, Elohist, 128; Mendenhall, 114 u. ö.11 Milgrom, 211.
36 2 Baal Peor
gegen Midian. Noch ein dritter Begriff taucht unerwartet auf und wird schon,da er den Artikel trägt, als bekannt vorausgesetzt: Die � ��� �� qubbah. An derDeutung dieses Begriffes hängt es, worin das Ärgernis für Pinhas überhauptbestand.
Dieses Problemfeld wird im folgenden in zwei Fragekomplexen unter-sucht. Zuerst geht es um die Einbettung in den Kontext durch diese offenenVerweise: Die Plage, Bileam und der Peor. Danach wird das Kapitel Num 25auf eine innere Zielsetzung hin befragt. Dabei geht es um die Rolle der Midia-niterin und daraus abgeleitet um das Verhältnis von Mose zu Pinhas. Erst nachdiesen zwei Fragekomplexen folgt der Vorschlag zur literarischen Schichtung,aus dem sich mögliche Lösungen der aufgeworfenen Fragen ergeben.
2 . 2 D I E P L A G E , P E O R U N D B I L E A M
2.2.1 Erster Lösungsansatz: Zuordnung zu Quellen
Der beschriebene Befund läßt zuerst einmal eine klassische Lösung in denBlick kommen: Zwei Fragmente (25,1–5: ein Anfang ohne Ende und V. 6–18:ein Ende ohne Anfang) sind zu einer Geschichte zusammengesetzt worden.12
Sie stammen aus zwei parallel laufenden Quellen, die beide am Übergang vonder Wüste zum Land von Abfall und Strafe erzählten. Daher gibt es natür-lich bei allen Unterschieden genug Gemeinsamkeiten, daß die Erzählungenüberhaupt miteinander kombiniert werden konnten.
Das Ende der Erzählung von Num 25,1–5 wäre noch relativ gut greifbar,weil in der göttlichen Aufforderung an Mose der mögliche Ausgang schonangedeutet wird: »Und die Glut des Zornes des Herrn wird sich abkehrenvon Israel.« Israel wäre von moabitischen Frauen zum Götzendienst verführtworden. Gottes Zorn bricht aus und wird durch eine Strafaktion beruhigt.
Für die Rekonstruktion des zweiten Erzählfadens ist ein Hinweis inNum 31,16 gefunden worden: Bileam hatte die Midianiter dazu angestiftet,Israel durch ihre Frauen zum Abfall zum Baal Peor zu verführen. Dadurchbrach eine Plage aus (Ps 106,29), die erst durch den Einsatz des Pinhas been-det wurde.13 Wellhausen weist ausdrücklich darauf hin, daß diese Form derErzählung eine Fortführung »in der Haggada« erfahren hat.14
Noch weitgehender ist der Rückschluß von Greßmann von der JE-Vorlageauf die P-Parallele, indem er die Nähe zu Ex 32 in den Formulierungen betont:
12 Vgl. jüngst Achenbach, Vollendung, 431. 435.13 Wellhausen, Composition, 111 f.; Baentsch, 652 f.; Rudolph, Elohist, 13 f.; Milgrom,
211. Kuenen, 324; Holzinger, Numeri, 126, und Smend, 233, widersprechen dieserRekonstruktion.
14 Wellhausen, Prolegomena, 355. Vgl. dazu oben S. 15.
2.2 Die Plage, Peor und Bileam 37
Auch hier habe es eine Erzählung von Moses und der Leviten Eifer gegen Israelund dessen Häupter gegeben.15
Darüber hinaus sind auch die V. 1–5 noch einmal auf zwei Quellen auf-geteilt worden. Dazu wurde mit mehreren Doppelungen argumentiert: DasNebeneinander der moabitischen Götter und des Baal Peor, von Hurereiund Götzendienst und die Strafanweisung Gottes und Durchführungsbestim-mung Moses, die einander nicht wirklich entsprechen, lassen zwei durchlau-fende Texte rekonstruieren.
Die beiden Erzählfäden wurden meist auf J und E aufgeteilt.16 Als Beispielsoll hier die Aufteilung bei Bruno Baentsch zitiert werden:17
E] 25 1Israel aber liess sich in Šit.t.im nieder, J] und das Volk begann mit den Moa-biterinnen zu buhlen. 2Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter, unddas Volk nahm an den Opfermahlzeiten teil und verehrte ihre Götter. E] 3Und Israelhängte sich an Ba�al Pe�or. Da entbrannte der Zorn Jahves über Israel. J] 4Und Jahvesprach zu Moses: Lass alle Volkshäupter zusammenkommen und pfähle sie (die Übel-täter) angesichts der Sonne, damit der Zorn Jahves von Israel weiche. E] 5Da sprachMoses zu den Anführern Israels: ein jeglicher töte diejenigen seiner Leute, die sich anBa�al Pe�or gehängt haben.
Übersichten über die Vorschläge der Zuordnung von Num 25,1–5 bietet Ge-orge Raymond Boudreau.18 Martin Arneth und Ludwig Schmidt vertreten er-neut eine Aufteilung der Verse 1–5, jedoch nicht auf Quellen, sondern aufGrundschicht und Erweiterung.19
Aber natürlich gibt es auch Stimmen gegen eine solche Aufteilung. Wil-helm Rudolph bietet dabei Versuche an, die vermeintlichen Spannungen aufeiner literarischen Ebene verstehen zu können.20 Im Unterschied zu demPlage-Problem und dem Wechsel von Moab zu Midian sind diese Spannun-gen als literarische Gestaltungsmöglichkeiten durchaus erklärbar.
Die Annahme, den Pentateuch aus mehreren parallellaufenden Quellenzu erklären, zeigt an diesem Beispiel deutlich einen Kreisschluß: Die Strin-genz des Erzählzusammenhangs der erst zu erschließenden Quellen wird ausTexten gewonnen, die gerade erst im Nachhinein die Schwierigkeiten im Textharmonisieren. In Num 25,6 ff. eine zu V. 1–5 parallele P-Erzählung zu sehen,ist eigentlich nur auf der Ebene von PG plausibel. Da die V. 6–13 am ehestenfür eine sekundäre Erweiterung zu P gehalten werden,21 fehlte ihnen in einer
15 Gressmann, Mose, 216 f.16 So z. B. Baentsch, 623 f.; Gressmann, Mose, 335; Ders., Anfänge, 129; Budd, 275 f u. a.17 Baentsch, 623 f.18 Boudreau, Study, 41–48; Ders., Hosea, 122 f., Anm. 2.19 Arneth, 138–140; Schmidt, Numeri, 146.20 Rudolph, Elohist, 128 f.21 Holzinger, Numeri, 126.
38 2 Baal Peor
konstruierten separaten Quelle der Anfang, den jetzt die V. 1–5 darstellen wür-den. Daher ist es sinnvoller anzunehmen, daß die Pinhasepisode den Anfangdes Kapitels fortschreibt.22
Die Frage der literarischen Abhängigkeit der Texte wird eingehender imfolgenden Abschnitt besprochen, in dem es, z. T. von den gleichen Beobach-tungen ausgehend, die hier zur Konstruktion des Erzählzusammenhangs inden Quellen führten, um den Schluß auf die zugrundeliegenden Traditionengeht.
2.2.2 Zweiter Lösungsansatz: Traditionsgeschichtlich
Die Ereignisse um den Baal Peor werden an verschiedenen Stellen im AltenTestament erwähnt. Am ausführlichsten ist Num 25, und von einem kano-nischen Verständnis her wäre hier im Buch Numeri auch die Stelle, an derdas Ereignis seinen natürlichen Ort in der biblischen Geschichtsdarstellunghat. Dtn 4,3 ist eine Wiederholung, muß sich also auf das vorher Erzähltebeziehen. Auch Jos 22,17 ist als Rückblick gestaltet. Aber auch in Propheten(Hos 9,10) und Psalmen (106,28–31) legt sich erst einmal nahe, daß hier vonetwas Bekanntem, schon Erzähltem, gesprochen wird. Als etwas Neues unddaher auch am ausführlichsten wird es in Num 25 berichtet.
Doch ist es gerade das Buch Numeri, das als letztes im Pentateuch mit al-lerlei Stoff aufgefüllt sein könnte. Das Verhältnis kann daher auch umgekehrtwerden. Mit den historischen Verhältnissen im Ostjordanland argumentie-rend hat Ernst Axel Knauf zurückgewiesen, daß Hos 9,10 von Num 25 abgelei-tet werden könne.23 Ähnlich leitet Kugler Num 25 von Ps 106 ab.24 Boudreauhält die Unterschiede zwischen Num 25,1–5 und Hos 9,10 für so groß, daßsich der Hoseatext eher auf ein Ereignis aus dem achten Jahrhundert bezöge.25
Sein Hauptargument, Hosea könne vor der Landnahme nicht schon mit derIdeal-Zeit brechen, ist nicht überzeugend. Schließlich sind auch Widersprü-che innerhalb des Prophetenbuches möglich, zumal wenn hier ein spätererAutor eine fremde Tradition integrieren mußte.
Wie Trauben in der Wüstefand ich Israel,
wie die Erstlinge am Feigenbaum als seine Auslesesah ich eure Väter. Sie kamen zum Baal Peorund sie weihten sich der Schande,und sie wurden zu Scheusalen wie ihr Liebhaber. Hos 9,10
22 Siehe dazu unten Kap. 2.2.3.23 Knauf, Midian, 163. Ähnlich Römer, 229 f.24 Kugler, 14.25 Boudreau, Hosea.
2.2 Die Plage, Peor und Bileam 39
Baal Peor steht hier im Gegensatz zur Wüste. Er steht für ersten Kulturland-kontakt. Was genau die Israeliten taten, bleibt offen. Sie weihten sich der
»Schande« � ��
�� �� bošæt – einer Umschreibung für Baal26. Andererseits wird ihr
Verhältnis zum Baal Peor als ein Liebesverhältnis dargestellt. Das ist negativbewertet, offenbar, weil es in Konkurrenz zum wahren Gott steht. Der Textist in sich nicht geschlossen, sondern wird erst durch ein schon bekanntesGeschehen und durch den hoseanischen Kontext klarer. Setzt er Num 25 vor-aus? Von Pinhas ist nicht die Rede. Ein engeres Verhältnis besteht also nur zuNum 25,1–5. In dem kurzen Stück gibt es – neben dem Namen – nur noch
ein Wort, das eine Nähe zu Num 25 aufweist: »sie weihten sich« ��� ������� wayy-innazerû erinnert, weil es eine PK-Nifal-Form ist, an »und es unterjochte sich«� �� �������� wayyis. s. amæd. Der Stamm ist ein anderer, und das Verb steht im Plural.Für eine literarische Ableitbarkeit reicht das nicht aus.
Eure Augen sind es, die gesehen haben (ihr selbst habt gesehen), was der Herr inBaal Peor getan hat, daß jeden, der dem Baal Peor nachlief, der Herr dein Gott ausdeiner Mitte getilgt hat. Aber ihr, die ihr am Herrn eurem Gott hingt, lebt heutealle. Dtn 4,3 f.
Die konkurrierenden Gottesverhältnisse werden hier mit »nachlaufen« und»anhangen« ausgedrückt. Worin der Frevel bestand, und womit Gott dieSchuldigen vernichtete, bleibt offen. Außer dem Namen gibt es wieder kei-ne wörtlichen Übereinstimmungen mit Num 25. Bemerkenswert ist aber, daßdie Strafe individualisiert wurde. Das entspräche genau Num 25,5, aber we-der dem, was davor, noch was danach kommt. Boudreau hat die Entwicklungder Peor-Tradition von Hos 9,10 her als Ausgangspunkt, weiterentwickelt inDtn 4,3 f., zu Num 25,1–5 hin beschrieben.27 Demgegenüber ist aber festzu-halten, daß Dtn 4,3 f. das in Num 25,4 f. noch schwebende Verfahren dahinge-hend präzisiert, daß genau die Schuldigen bestraft werden (siehe unten S. 61).
Und sie unterjochten sich dem Baal Peor.Und sie aßen Totenopfer.
Und sie kränkten mit ihren Taten.Da brach unter ihnen eine Plage aus.
Pinhas stand auf und richtete,da hörte die Plage auf.
Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnetvon Geschlecht zu Geschlecht für immer. Ps 106,28–31
Auch hier sind die Informationen kurz gehalten, aber man erfährt doch eini-ges. Vor allem gibt es mehrere Berührungen mit Num 25 im Wortlaut.
26 Wolff, 214.27 Boudreau, Study, 217 f.
40 2 Baal Peor
Die Israeliten »unterjochten sich dem Baal Peor« – ��� s.md PK Hifil,jedoch hier im Plural. Auch hier geht es um das Essen von Opfern, nur sindaus »Opfern ihrer Götter« (Num 25,2) »Totenopfer« geworden. Während inNum 25,8 nur das Ende der Plage erzählt wurde, bricht sie hier auch aus. Werin Num 25 zwei Fragmente vermutet, kann in Psalm 106 einen geschlossene-ren Erzählzusammenhang sehen, der für das fragmentarische Ende auch denvermißten Anfang liefert. Genausogut kann jedoch auch von Harmonisierunggesprochen werden. Wie in Num 25,7 wird hier das »Aufstehen« des Pinhas
erwähnt, allerdings nicht mit ��� qwm, sondern mit ��� �md.28
Diese Übereinstimmungen machen eine direkte literarische Beziehungwahrscheinlich.29 Der Psalm gleicht – in verkürzendem Stil – die Spannungenvon Num 25 aus, so etwa in Bezug auf die Plage. Der Psalm repräsentiert alsoeher nicht den ursprünglichen Anfang der Erzählung.30
Die bemerkenswerteste Aussage zu Pinhas in Ps 106,28–31 ist, daß Pin-has seine Tat »zur Gerechtigkeit gerechnet wurde«. Im Vergleich mit Num 25scheint das der Bundesverleihung als Antwort Gottes auf den Eifer desPinhas zu entsprechen. Die Formulierung � �� �� � �� ��� � � �� �� ����� watteh. ašæb lôlis.
edaqah in Ps 106,31a erinnert jedoch mehr an die Formulierung in Gen 15,6b
� �� �� � �� �� �� �� �� �� ������ wayyah. šebæha llô s.edaqah »und er rechnete es ihm als Ge-
rechtigkeit«31. Falls hier eine Anspielung von Pinhas auf Abram vorliegt,32 er-klärt sie sich gut aus dem Nacheinander von Ps 105 und 106. In ihrer jetzigenAnordnung schließt Ps 106 sinnvoll an 105 an.33 Zwar sind die Grundstim-mungen der beiden Geschichtspsalmen entgegengesetzt (Ps 105: Lob der Ta-ten Gottes; 106: Israels Widerstände gegen Gott), und auch Ps 105 blickt biszur Landnahme aus (V. 44), aber der Schwerpunkt liegt in 105 auf Väter- undÄgyptenzeit, in 106 aber auf dem Wüstenaufenthalt. Der Gedanke von IsraelsUndank gegenüber Gott, der Ps 106 bestimmt, wird durch den Kontrast zu 105noch deutlicher. Assoziiert man als Leser von Ps 106,31a her Abram, so kannman leicht auf 105,42 und vor allem 105,6–10 zurückschauen, wo von Abra-ham und ausführlich von der Bundesthematik gesprochen wird. Es ist dahermöglich, daß der Abschnitt über Baal Peor in Ps 106,28–31 erst als Rückver-
28 Zur Deutung dieses In-die-Bresche-Tretens als Interzession Janowski, Ps CVI 28–31, 239–243.
29 Vgl. Boudreau, Study, 141 f; Seebass, Numeri III, 127.30 Anders Budd, 277 f.
31 Obwohl die ganze Rezeptionsgeschichte dagegen steht, hat Ina Willi-Plein recht, daß DZ ���� ��hæ�
æmin konsekutiv zu verstehen und der »Same« Subjekt ist: »›wird/soll‹ also ›so‹ zahlreichwie die Sterne sein oder werden ›und dann (/so) soll er glauben an JHWH.‹« (Willi-Plein,397).
32 Wobei hier der Genesistext schon anders verstanden worden wäre: Einem Menschen wirdetwas als Gerechtigkeit angerechnet.
33 Vgl. Kreuzer, 237.
2.2 Die Plage, Peor und Bileam 41
weis von Ps 106 auf 105 in den Psalm eingefügt ist. Auch das spricht eher füreine Abhängigkeit des Abschnitts von Num 25.34
Es verbleiben noch zwei Referenzen auf den Abfall zum Baal Peor inNum 31 und Jos 22. In beiden Texten tritt auch Pinhas wieder in Erschei-nung. Besonders Num 31 knüpft an Num 25 an, an dessen Ende Mose zumKrieg gegen Midian aufgefordert wird. Das wird in Num 31 als Rachefeldzugdurchgeführt. Bei der Rückkehr des Heeres zürnt Mose den Anführern, weilsie die Midianiterinnen nicht getötet, sondern als Beute mitgebracht haben,denn
... diese brachten doch die Israeliten auf das Wort Bileams hin zum Abfall vom Herrn
in der Angelegenheit Peors, und die Plage war in der Gemeinde des Herrn.Num 31,16
Neben der Nennung des Peor wird die Plage aus Num 25,8 f. erwähnt. Wasaber verwundert, ist die Nennung Bileams. Er war doch schon vor dem Zwi-schenfall heimgekehrt (Num 24,25). In 31,8 befindet er sich plötzlich unterden Midianitern – wurde mit ihren Königen erschlagen. Hier in V. 16 erfährtdas seine Begründung: Bileam hatte die Frauen angestiftet, Israel zu verführen.Eine Verstehenshilfe bietet der kanonische Text mit Num 22,4. 7,35 wo nebenMoab auch die Ältesten Midians in die Bileamperikope eingeführt werden,und Jos 13,21 f., wo die Aussage von Num 31,8 wiederholt wird, daß Bileam mitden »Fürsten« (nicht »Königen«, wie hier) Midians erschlagen wurde. Diese»Fürsten« aber seien »Vasallen« Sichons gewesen (ein Wortspiel zwischen �� ����nasî� und !� ��� nasîk). Es wird meist angenommen, daß diese Stellen gera-de den Widerspruch in den Texten erklären wollen: Midian ist (evtl. als no-madisches Bevölkerungselement) innerhalb Moabs vorzustellen, bzw. befindetsich mit Israel ja eigentlich in Gebieten, die Sichon Moab abgenommen hatte(Num 21,26).
Sind diese Verstehenshilfen aber sekundäre Harmonisierungen,36 dannbleibt die Frage, ob Num 31 tatsächlich den in Num 25 vorliegenden Her-gang voraussetzt, oder ob die Ereignisse in einem verlorenen Kontext berichtetwurden, an dessen Stelle Num 25 getreten ist. Einen weiteren Hinweis dafürkönnte die letzte Referenz bieten, in der Pinhas den suspekten Altar der zwei-einhalb ostjordanischen Stämme inspiziert.
Ist es uns noch zu wenig mit der Sünde Peors, von der wir bis zu diesem Tag nichtgereinigt sind? Da war die Plage in der Gemeinde des Herrn.
Jos 22,17
34 Hossfeld.35 Vgl. Gross, Bileam 1974, 84; M. Rösel, Bileamgestalt, 515.36 Kuenen, 324; Knauf, Midian, 167 f.
42 2 Baal Peor
Mit einer fast wörtlichen Formulierung wie in Num 31,16 findet sich hier einBezug auf die Plage in Num 25,8. Was aber hier zu der dortigen Darstellungnicht passen will, ist die Behauptung, Israel sei noch nicht gereinigt von derSünde des Peor. Dabei hatte Pinhas durch seinen Eifer für Israel Sühne ge-schaffen (Num 25,13). Da Pinhas vorher das Priestertum zugesprochen wurde,legt sich nahe, »Sühnen« im Sinne der Wiederherstellung kultischer Reinheitzu verstehen.37 Bernd Janowski hat jedoch darauf hingewiesen, daß es nachder Logik der Erzählung an dieser Stelle nicht um eine kultische Handlung,sondern um eine Form von Interzession geht.38 Der Text knüpft freilich anAarons schon eher kultisches Vorgehen39 in Num 17,11–15 an. Aber wer wirk-lich nach kultischer Reinheit fragt, dem kann in Num 25 noch etwas feh-len. Jos 22,17 muß also nicht zwangsläufig Num 25,13 widersprechen. Reinheithängt in Jos 22 stark mit der Verwirklichung des Kultes in seiner richtigenForm und am richtigen Ort zusammen. Da diesem etwa in Silo vorzustellen-den Zeltheiligtum doch noch der Makel des Provisoriums anhaften könnte,ist auch keine vollständige Reinheit zu erzielen.
Eine entscheidende Frage ist also, wie die Rolle von Bileam in Num 31erklärt werden kann. Bezieht sich der Text auf einen anderen Erzählverlauf alsden in Num 22,2–25,5 vorliegenden? Neben der quellenkritischen ist auch einetraditionsgeschichtliche Lösung denkbar. Das Hauptargument, das gegen einesolche verlorengegangene Erzählung spricht, ist die anscheinende literarischeAbhängigkeit des Kapitels von Num 25 im ganzen.40 Es bezieht sich sowohlauf Peor als auch auf Pinhas und setzt den Aufruf zum Midianiterkrieg vonNum 25,16–18 in die Tat um. Was hier als Abhängigkeit beurteilt wird, ist aberersteinmal nur Nachzeitigkeit in der Abfolge der Erzählung. Es ist der Vor-schlag gemacht worden, das Verhältnis umzudrehen und Num 25,6–19 geradeals Brücke zwischen Num 25,1–5 und Num 3141 zu verstehen. Demnach gehör-te Num 25,6–19 auf dieselbe harmonisierende Ebene, die Midian als in Moabanwesend beschreibt, wie Num 22,4. 7. Num 31 wäre also älter und würde je-ne Bileam-in-Midian-Tradition repräsentieren, während sich die komplexereGestalt von Num 25 aus diesem Brückenschlag heraus erklären ließe. Obwohldieses Modell einiges erleichtern würde,42 ist das auf das gesamte Kapitel bezo-gen unwahrscheinlich. Den Brückenschlag zwischen Num 25 und 31 bringenerst Num 25,14–18.43 Auch die Notwendigkeit, die Ereignisse von Peor miteinem Rachefeldzug zu beantworten (Num 25,16–18 und Num 31) beinhaltet
37 Vgl. Lang, 308. 311.38 Janowski, Sühne, 146.39 Ebd., 148.40 Donner, Balaam, 113 f.41 So auch Schmidt, Numeri, 148.42 Vgl. Donner, Balaam, 116 f.43 Vgl. Boudreau, Study, 98 f.
2.2 Die Plage, Peor und Bileam 43
die Vorstellung, die Affäre sei noch nicht erledigt. Auf derselben Ebene ist diefehlende Reinigung zu erklären.44
Daß die beiden Bemerkungen in Num 31,8. 16 keine selbständige Traditionvom Geschehen in Peor darstellen, hat A. Van Hoonacker ausführlich begrün-det. Dazu sind diese beiden Erwähnungen viel zu marginal. Sie lassen sich inAbhängigkeit von Num 25 und seiner Stellung direkt nach der Bileamperiko-pe erklären. Der böse Rat des Bileam wurde wahrscheinlich aus Num 24,14–19herausgedeutet: Bileam kündigt Balak die Feindschaft Israels an.45
Öfter wird ein engerer traditionsgeschichtlicher Zusammenhang zwischenBileam ben Beor und dem Baal Peor vermutet, als die jetzige Abfolge vonNum 22–24 und Num 25 annehmen läßt. Das würde eine eigenständigeBileam-Peor-Tradition wahrscheinlich machen, wie sie Num 31 evtl. reprä-sentiert. Dabei spielt zum einen die Ähnlichkeit der Namen Beor und Peoreine Rolle.46 Zum anderen hat Martin Noth auf die bis in jüngere Zeit an-dauernde Heiligtumstraditionen des ������ �� �� šeh
˘gayil hingewiesen, der in
Kontinuität zum Baal Peor gesehen werden könnte.47 Von Ps 106 her kannder Kult des Peor als Totenkult verstanden werden.48 Gerade dieser von Musilbezeugte Scheich ist aber seit dem 20. Jahrhundert nicht mehr faßbar. ClaudeReignier Conder, der Bet Peor weiter südlich lokalisierte, hat das damit ver-bundene Heiligtum ausdrücklich mit Großsteingräbern in Zusammenhanggebracht,49 so daß man auch in Jos 22 einen traditionsgeschichtlich bedeutsa-men Hinweis finden könnte.
1. Biblischer Befund. Mit dem Namen Peor ist in alttestamentlichen Texten einBerggipfel (Num 23,28 � ��� � �� �� ��� ro�š happe
�ôr), eine Stadt (Dtn 3,29 u. ö.
� ��� � �� ��� bêt pe�ôr) und eine Gottheit (Num 25,3; Hos 9,10 � ��� � � �� ��� ba�al
pe�ôr) verbunden. Es spricht nichts dagegen, daß alle drei Sachverhalte in denselben
Zusammenhang gehören, die Stadt also auf oder bei dem Berg und der Kultort desGottes in oder bei der Stadt liegen. Zwischen Num 21 und Jos 3 bildet Peor einenwichtigen geographischen Bezugspunkt als Gegenüber zum Lagerplatz der Israeliten.So kann Bileam vom Peorgipfel aus das Lager der israelitischen Stämme überblicken
(Num 23,28). In Num 25,1 lagern die Israeliten in �� ��� ��
� šit. t. îm und kommen zweiVerse später mit dem Fremdgott in Berührung. Und im Rahmen des Deuterono-miums wird die aktuelle Handlung gleichförmig »im Tal gegenüber von Bet Peor«
� ��� � �� ��� ���� �� ��� ��� baggay� mûl bêt pe�ôr (Dtn 3,29; 4,46; 34,6) verortet.50 Schon
von Num 21,20 her bleibt aber offen, wie das Verhältnis von Stadt und Tal zueinander
44 Vgl. Ebd., 127–130.45 Van Hoonacker.46 Noth, Pentateuch, 83; Lemaire, 181 f.47 Noth, Pentateuch, 80.48 Janowski, Ps CVI 28–31, 243; Spronk, 249.49 Conder, Heth and Moab, 266.50 Vgl. Mittmann, 22.
44 2 Baal Peor
genau gedacht werden muß, d. h. ob sich das Tal noch auf dem Gebirge befindet oderdie Jordanebene bezeichnet.51 In Dtn 34,6 stirbt Mose auf dem Berg, wird aber »imTal« begraben. Bei der Pilgerin Egeria (XII, 1. 2, siehe unten) findet sich das Mose-
begräbnis auf dem Berg Nebo ( �� ������ � ra�s siyaga) belegt. Soll �� ��� ��� baggay� alsonicht »im Tal«, sondern »am Tal« übersetzt werden?52 Oder ist im biblischen Text andas dem Nebo nahegelegene � ��� ������ �� wadi �ayun musa gedacht, das heuteauch eine Mose-Tradition aufweist und noch relativ weit oben liegt?
Von diesem Befund her kommen mehrere Gipfel des ostjordanischen Gebirgesam Nordende des Toten Meeres in Frage. Es ist Vorsicht geboten, bei der Nennungeines Toponyms den Autoren konkrete Ortskenntnis zu unterstellen. Das zeigt sichbesonders an dem verwirrenden Nebeneinander von »Pisga«, »Nebo« und »Abarim«(vgl. Num 27,12; Dtn 3,27; 32,49; 34,1) als Namen des Gipfels, auf den Mose steigt.53
Und selbst wenn eine archäologische Grabung, etwa durch Ostrakafunde, den Na-men einer eisenzeitlichen Siedlung eindeutig zuwiese, wäre damit noch nicht gesagt,ob jeder der Autoren konkrete Kenntnis von diesem Ort gehabt hätte. Ibach deutetan, daß Bet Peor nur eine Landmarke darstellen kann.54
2. Lokalisierungsversuche. In der Fachliteratur werden vor allem drei Lokalisie-rungsvorschläge besprochen.55 Alle drei diskutieren eigentlich nur die Lage der Stadt.Die Frage, auf welchem Bergrücken die Stadt liegt, diskutiert Siegfried Mittmann imZusammenhang mit den drei in der Bileamperikope genannten Berggipfeln und läßtfür den Peorgipfel den �
��� ���� � ra�s el-mušaqqar wahrscheinlich werden,56 was sichnach allgemeiner Auffassung auch für die spätantike Lokalisierung nahelegt.57
Nach dem Onomastikon liegt Peor (����� Fogor oberhalb von Livias [ ������ er-rama]).58 Abgesehen von Conder59 gehen die modernen Lokalisierungsversuche vondiesem Hinweis aus und sehen den Peor-Berg in dem �
��� ���� � ra�s el-mušaqqar,
über den die römische Straße von Livias nach Esbus ( ������� h. isban) führt. Auf dem
Berg nennt Eusebius eine Stadt Dannaba, sieben Meilen von Esbus entfernt,60 und������� Bethfogor, sechs Meilen von Livias. Beides ist am gleichen Ort, nämlichder �� ����� �� � � �� h
˘irbet el-mah. at.t.a vermutet wurden.61 Es wird angenommen, daß die
Pilgerin Egeria an dieser Stelle abgebogen sei (X, 8),62 um den Nebo ( �� ������ � ra�ssiyaga) zu besteigen. Von dort aus wird ihr auch Peor gezeigt, ohne daß sie bemerkte,dort schon gewesen zu sein (XII, 10).63
51 Boudreau, Study, 238–244, unterscheidet den deuteronomistischen Lagerplatz Israels imGebirge und den priesterlichen im Jordantal.
52 Diesen Vorschlag machte Andreas Kunz auf dem Lehrkurs 2002.53 Vgl. dazu auch Fritz, Entstehung, 26; O’Kennedy, 291 f.54 Ibach, 16.55 Überblicke bei Boudreau, Study, 336–347; O’Kennedy, 292–295.56 Mittmann, 11.57 Schmitt, Siedlungen, 280.58 Klostermann, 168,25–27.59 Conder, Heth and Moab, 266.60 Klostermann, 76,9–12.61 Siehe TAVO-Karte B VI 10
62 Franceschini und Weber, 51; Donner, Pilgerfahrt, 106.63 Franceschini und Weber, 54. Vgl. Donner, Pilgerfahrt, 110.
2.2 Die Plage, Peor und Bileam 45
120
130
140
150
210 220 230
h. isbanel-mušaqqar
h˘
irbet �ayun musaras siyaga
madaba
tell el-kefren
tell el-h. ammam
tell er-ramah˘
irbet el-mah. at. t.a
tell el �uz. eme
Abbildung 4: Zur Lage von Peor: Moderne Ortsnamen, Höhenlinien und dierömische Straße über Livias und Esbus (unter Benutzung der TAVO-KartenB IV 6 und B V 18).
46 2 Baal Peor
Alle neueren Lokalisierungsvorschläge sind sich darin einig, daß diese römischeWegstation �� ����� �� � � �� h
˘irbet el-mah. at. t.a ist, und daß Eusebius hier Bet Peor loka-
lisierte. Das geht auf den Lokalisierungsvorschlag von Alois Musil zurück, der voneinem ! ��"� #�� �� šeh
˘gayil in dieser Gegend berichtete.64 Dieser Heilige ist später
nicht wieder gefunden worden.65 Oswald Henke ging davon aus, daß dieses von Mu-sil beschriebene römische Bet Peor in �� ����� �� � � �� h
˘irbet el-mah. at. t.a zu finden sei.66
Das eisenzeitliche Bet Peor sah er jedoch in der � ��� �������� � � �� h
˘irbet �ayun musa67
im Tal zwischen Nebo und ���� ���� � ra�s el-mušaqqar. Siegfried Mittmann identi-
fizierte hier Sibma (Num 32,38 u. ö.) und fand das eisenzeitliche Bet Peor in dem Ort���� ���� el-mušaqqar.68
3. Diskussion. Ein wichtiges Argument für Mittmann ist die Frage, von wel-chem eisenzeitlichen Siedlungsplatz aus welches Tal gut überschaubar ist. Dennder � ��� ������
�� � � �� h˘
irbet �ayun musa liegt nicht das Jordantal, sondern das
� ��� ������ �� wadi �ayun musa gegenüber. Das »Tal« müsse doch der Lagerplatzder Israeliten sein, was nur im Jordantal denkbar sei. Dann fühlt sich Mittmann aller-dings gezwungen, Moses Begräbnis, assoziiert mit der Entrückung Elias, ins Jordantalzu verlegen.69
Es sollte aber ernst genommen werden, daß das »Tal« an den verschiedenen Stel-len unterschiedliche Lokalisierungen nahelegt. Gerade in Num 21,20 kann man denEindruck bekommen, daß sich auch das »Tal« noch auf oder bei der Hochebene be-finde, von wo man einen guten Blick auf die Wüste hat. Wenn der Begriff »Tal« abernicht wirklich greifbar zu sein scheint, bleibt offen, ob die Autoren sich mit Absichtnicht festlegen oder uneins über die Identität des »Tales« sind.
In der Argumentation sollten zwei Dinge unterschieden werden. Eine Aussageist, daß man von dem »Gipfel des Peor« (Num 23,28) eine gute Aussicht auf die Wü-ste, den Lagerplatz der Israeliten – also auf das Jordantal nördlich des Toten Meeres –habe, eine andere ist, daß eine Reihe von Dingen »im Tal gegenüber Bet Peor« statt-finden. Daraus ergibt sich nicht zwingend, wie Mittmann argumentiert, daß manvon der Stadt Bet Peor einen guten Überblick über das Tal gehabt haben müsse70.Vom Jordantal aus gesehen ist fraglich, ob man eine der beiden eisenzeitlichen Sied-lungsstätten überhaupt gesehen hat. Da aber der Berg, den man vom Tal aus sieht,Peor hieß, legt es sich nahe, von der Stadt Bet Peor zu sprechen, die eben an oderauf diesem Berg liegt. Wo Bileam stand, um Israel zu verfluchen, muß nicht zwin-gend mit dem Ort zu tun haben. Am besten übersieht man m. E. das Jordantal von�� ����� �� � � �� h
˘irbet el-mah. at. t.a aus, also dem Ort der spätantiken Tradition. Vom
Gipfel des ���� ���� � ra�s el-mušaqqar aus ist der Blick z. T. verstellt.71 Es ist aber
müßig, zu spekulieren, wo der Autor von Num 23,28 Bileam exakt hat stehen lassen.Er wird, wenn überhaupt, den Berg insgesamt vor Augen gehabt haben.
64 Musil, 348.65 Dalman, Jahresbericht 1907/08, 19.66 Henke, 159 f.67 Ebd., 161 f.68 Mittmann, 22 f.69 Ebd.70 Ebd., 22.71 Vgl. Knauf, Welches »Israel« Bileam sah, 184.
2.3 Das Ziel der Pinhas-Episode 47
Obwohl wahrscheinlich gemacht werden konnte, daß den Referenzen auf dieGeschehnisse mit dem Baal Peor eine gemeinsame Erzähltradition zugrun-de liegt, und es gut möglich ist, daß diese eine Kulttradition im Gebirgenordöstlich des Toten Meeres voraussetzt, läßt sich das durch die Lokalisie-rungsversuche der Stadt Bet Peor nicht enger fassen.72 Es ist möglich, daßBileam ben Beor, Bela ben Beor (Gen 36,32) und der Ortsname Peor einengemeinsamen Ausgangspunkt haben.73 Inhaltlich ist dieser Punkt aber schwerzu greifen. Volkmar Fritz spricht sich ausdrücklich gegen irgendeinen traditi-onsgeschichtlichen Kern aus, sondern meint, Num 25 knüpfe einfach an demOrtsnamen Bet Peor an. Alle anderen Texte ließen sich davon ableiten.74
2.2.3 Dritter Lösungsansatz: Fortschreibung
Es ist deutlich geworden, daß die Pinhasepisode nicht als eigenständige Tra-dition aus Num 31 konstruierbar ist, sondern literarisch den Anfang des Ka-pitels fortschreibt. Die chronologische Ordnung ergibt dann etwa folgendesBild: An den Abfall zum Baal Peor, der sich an die Bileam-Perikope anschließt,wird eine Beispielerzählung mit einer midianitisch-israelitischen Ehe angefügt(Num 25,[5. ]6–13). Der Schluß des Kapitels (V. 14–18) versucht den Kon-text anzugleichen, indem er und Kap 31 insgesamt von einem israelitisch-midianitischen Konflikt ausgeht. Auf einer vierten Ebene erst wird versucht,das Bild der Nachbarvölker Israels im Ostjordanland zu klären: Midian unterSichon und neben Moab (Num 22,4. 7; Jos 13,21 f.).75 Die einzelne Midianite-rin hat also weitreichende Konsequenzen in der Textgeschichte gehabt.76
Diesem Lösungsansatz folgt die vorliegende Arbeit mit dem spezifischenAnsatz, daß Num 25,1–4 kein Fragment, sondern ursprünglich eine einfacheEinheit darstellte. Handelt es sich um eine Fortschreibung, dann muß derscheinbar fragmentarische Charakter der V. 6 ff. anders erklärt werden. Dassoll im folgenden unternommen werden.
72 O’Kennedy, 300–302.73 Mit Verweisen auf ältere Vertreter der Position Lemaire.74 Fritz, Entstehung, 21.75 Vgl. Kuenen, 324; Van Hoonacker; Noth, Josua, 200; Donner, Balaam, 121 f.; Gross,
Bileam 1974, 91 f. 114; L. Schmidt, Bileamüberlieferung, 260 f.; Knauf, Midian, 164–168;Jagersma, 97; Gross, Bileam 1991; Fritz, Entstehung, 24.
76 Vgl. Gross, Bileam 1974, 373; M. Rösel, Bileamgestalt, 515–518.
48 2 Baal Peor
2 . 3 D A S Z I E L D E R P I N H A S - E P I S O D E
2.3.1 Die Midianiterin
Ausgangspunkt für die Analyse ist eine formal schwer auflösbare Spannung:In Num 25,6 ist »die Midianiterin« durch den Artikel determiniert. Damitwird auf einen vorhergehenden Punkt verwiesen, an dem sie schon eingeführtwurde. Das ist jedoch noch nicht geschehen. Nach Gesenius/Kautzsch kannim Hebräischen eine einzelne noch nicht näher bestimmte Person determi-niert werden, »welche durch die gegebenen Umstände als vorhanden und inBetracht kommend zu denken sei.«77 Würde an dieser Stelle eine Moabiteringenannt, könnte man diesen Paragraphen hier anwenden. Da ein konkretesBeispiel für die von vielen betriebene Sünde, die am Anfang beschrieben wur-de, erzählt wird, handelte es sich hier eben um die Moabiterin, mit der diesereine Israelit sich eingelassen hätte. Es wird aber von einer Midianiterin gespro-chen. Es ist klar geworden, daß eine späte Redaktion das Bild vermitteln will,daß Moabiter und Midianiter gemeinsam auftreten. Unter dieser Vorausset-zung bestünde also auch die Möglichkeit, diesen Paragraphen von Geseniusanzuwenden. Auf der Ebene von Num 25,6–13 – noch ohne die genannte Re-daktion – muß der Artikel einen anderen Sinn haben. Es handelt sich umeine hintergründige Anspielung auf Zippora, die midianitische Frau des Mose(Ex 2,21). Der Artikel verweist darauf, daß es in Israels Tradition schon längstund ganz anerkannt die Verbindung mit einem fremden Volk gibt, nämlichdie zu Midian.
2.3.2 Die � ��� �� qubbah
Das Problem unerwarteter Determination eines Begriffes besteht aber nichtnur bei der Midianiterin, sondern ebenso bei der Erwähnung des »Innenrau-mes« und »der Plage« in V. 8. Alle drei werden determiniert genannt, obwohlvorher keine Rede von ihnen war. Damit scheint ein charakteristisches Ge-staltungselement des Textes zum Vorschein zu kommen: Der Leser wird mitInformationen überrascht, die später noch ausgeführt werden. Während sichdie Funktion der Plage im Zusammenhang der literarischen Schichtung erge-ben wird, soll hier nach der für den Text insgesamt zentralen Frage nach derSemantik der »Kuppel« gefragt werden.
Mit dem Begriff � ��� �� qubbah hat wenigstens der heutige Bibelleser einedoppelte Informationslücke, denn das Wort ist hapax legomenon. Eine sehrgeläufige Begründung dafür ist die Herleitung des Wortes aus dem Arabischen
77 Gesenius und Kautzsch, §126 q. Beispiele, darunter »der Flüchtling« in Gen 14,13, aufge-führt in §§r–t.
2.3 Das Ziel der Pinhas-Episode 49
– »Kuppel«, was sowohl auf Gebäude als auch auf eine Zeltform angewendetwerden kann. Nun ist es aber noch eine spezielle Frage, ob mit der arabischenAnalogie ein hebräisches Wort erklärt wird,78 oder ob der Text ein arabischesFremdwort benutzt,79 schließlich geht es im Kontext um ein Volk, das demarabischen Bereich zugewiesen wird,80 um Midian.
Wenn arabische Wörterbücher die Anwendung von arabisch ������ qubba
auf Zelte genauer spezifizieren, charakterisieren sie es als ein kleines Zelt odereinen Baldachin innerhalb des Hauses, das bzw. der bei Festen aufgestelltwird,81 als Sänfte für einzelne Personen82 bzw. kuppelförmiger Aufsatz bei Ka-melen für Frauen83 und für den vorislamischen Kontext speziell das große Zeltaus rotem Leder für wichtige Personen84.
Zwei wichtige Deutungen stehen nebeneinander. Schon die alten Über-setzungen, wie auch Ausleger durch die Zeiten hindurch, haben eine teilwei-se sexuelle Konnotation angenommen: »Hochzeitsraum«85, »innerer Raum«,»Lustzelt«86 oder auch »Bordell«87. Diese Deutung kann sich weitgehend aufden Kontext stützen. Nach Num 25,1 f. scheint es in V. 6 um illegitimenGeschlechtsverkehr mit einer Ausländerin zu gehen. Andererseits wird eine»Heimführung« der Midianiterin beschrieben, was durchaus an eine ehelicheBeziehung denken läßt.88 Zuletzt steht � ��� ��� �� haqqubbah in einem klanglichen
Zusammenhang mit �� �� �� "�#� �� �æl-qåbatah, ebenfalls in V. 8., das gewöhnlichmit »Bauch« oder »Genital« übersetzt wird. Es liegt nahe, hier wenigstens einWortspiel anzunehmen,89 wodurch auch für »die Kuppel« eine sexuelle Kon-notation wahrscheinlich wird. Einige vermuten, daß ����#�� nur den Ortdes Geschehens wiederholt: �� �� ��� ��#� �� �el-qubbatah.90
Die zweite Deutung nimmt die arabische Vokabel mit ihren starken kul-tischen Implikationen ernst. Denn
������ qubba wird heute besonders auch für
Kuppelbauten wie etwa bei Heiligengräbern gebraucht.91 Im vor- und frühis-
78 Ibn Esra zur Stelle (Katzenelenbogen, Bemidbar 231); vgl. Reif, 203.79 Knauf, Midian, 163.80 Ebd., 91 f.; Ders., Midian und Midianiter, 802.81 Dozy, II, 305.82 Ebd.83 Lane, II, 2478. 2885.84 Dozy, II, 305.85 Knauf, Midian, 163.86 Gesenius, 1189.87 Vulgata: lupanar entspricht der Bedeutung im späteren Hebräisch (Koehler und Baum-
gartner, 992).88 Dagegen argumentiert Seebass, Numeri III, 117 f. Vgl. aber unten S. 52.89 Organ, 208.90 Rudolph, Elohist, 15.91 Canaan, Saints, IV, 11; Lanczkowski, 642.
50 2 Baal Peor
lamischen Kontext wird damit jedoch auch ein rotes rundes Lederzelt be-zeichnet, das – vorislamisch – als Behausung der Gottheiten fungierte.92 Eshat enge Parallelen in anders benannten Objekten bei Beduinen der jüngerenVergangenheit.93 Bemerkenswert ist hierbei einerseits die Nähe zur Bundesla-de. Denn jene dient zur Orakelbefragung94 wie diese mit Pinhas in Ri 20,27 f.,und ist als Kriegspalladium95 vergleichbar gerade auch mit Num 31,6. Darausist geschlossen worden, die � ��� �� qubbah Num 25,8 bezeichne eigentlich den
vorher erwähnten � �� ��� � ���� �ohæl mô�ed (V. 6).96 Der Affront könnte nichtschlimmer gedacht sein: Während die Gemeinde vor dem Eingang des Zeltesweint, gehen Zimri und Kozbi vor ihren Augen hinein. Wird das Kuppelzeltvon dem Zelt der Begegnung unterschieden, dann kann an ein midianitischesKonkurrenzheiligtum in Sichtweite des Zeltes der Begegnung gedacht sein.97
Für einen engen Zusammenhang mit der vorislamischen������ qubba spricht
die Rolle der Midianiterin in ihrem Kontext. Julian Morgenstern beschreibtausführlich das Auftreten von Frauen – gerade Töchter von Stammesober-häuptern – im Zusammenhang mit der
������ qubba, vor allem, wenn sie im
Krieg eingesetzt wird.98
Horst Seebass hat im Zusammenhang mit seiner Gesamtanalyse des Ka-pitels diese kultische und sexuelle Deutung verworfen und eine politische an-genommen.99 Das legt sich vor allem auch vom Vergleich mit 2 Sam 21,1–14nahe,100 wo erstaunlich viele Stichwörter aus Num 25 wiederkehren (»pfäh-len« ��� yq� [Hif ], »eifern« �� qn�, »sühnen« � $ kpr [Pi], »vertilgen« ��$klh [Pi]). Diese »politische« Ebene – der Ausgleich mit einer nichtisraeliti-schen Volksgruppe – geht aber zusammen mit einer magisch-kultischen, weilder Zorn Gottes abgewendet werden muß.101 Die ausführlichen Beschreibun-gen Morgensterns machen jedoch deutlich, daß das Auftreten der Jungfrauenim Kriegszug überdeutliche sexuelle Konnotationen hat. Ernst Axel Knaufbetont, daß die kultische Deutung nicht zwingend ist, und erwähnt den Ge-brauch des roten Leder-Rundzeltes als »Hochzeitszelt«.102 Helena Zlotnick Si-
92 Morgenstern, 207–223.93 Ebd., 222 f.94 Ebd., 210.95 Ebd., 209.96 Cross, 202.97 Reif, 204.98 Morgenstern, 212–215.99 Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 354; Ders., Case, 42 f; Ders., Numeri III, 118.
100 Vgl. Arneth, 138–140.101 Vgl. Albertz, 138.102 Knauf, Midian, 163.
2.3 Das Ziel der Pinhas-Episode 51
van hat den politischen Aspekt stark betont, dabei aber an der Deutung aufGeschlechtsverkehr festgehalten.103
Daß dem judäischen Schriftsteller die Einzelheiten in der Funktion desZeltes bekannt sein müssen, ist nicht zwingend anzunehmen. Er benutzt dasfremde Wort, um den fremden Kontext zu illustrieren. Was die beiden in der� ��� �� qubbah taten, muß aus dem Texte geschlossen werden. Es wird nichtsweiter berichtet als der Kontakt zwischen Mann und Frau. Nach Num 25,1 legtsich daher zuerst der Zusammenhang von Geschlechtsverkehr nahe. Auf kulti-sche oder administrative Vorgänge deutet konkret nichts hin. Es kann freilichdarauf angespielt werden. Daß das Durchbohren beider in einer Handlunggenannt wird, könnte zwar bedeuten, daß Pinhas zweimal zugestochen hat.Wenn es aber schon naheliegt, von Geschlechtsverkehr auszugehen, vervoll-ständigt das gleichzeitige Durchbohren beider dieses Bild. Das Wortspiel mit� �� �� qebah bestätigt dieses Deutung.104
2.3.3 Mose und Pinhas
Kann hier mit einem negativen Unterton auf die midianitische Frau des Moseverwiesen worden sein? Von dieser Ehe ist an verschiedenen Stellen die Rede,die insofern nicht einfach voneinander abhängig sein müssen, als der Schwie-gervater Moses unterschiedliche Namen trägt (Ex 2,18; 3,1; Num 10,29). Indiesen Texten wird das Verhältnis Israels zu Midian sehr positiv dargestellt.Einiges läßt darauf schließen, daß Israel von hier seinen Gott übernommenhat.105 In einer Reihe anderer Texte (darunter Num 25) erscheint dieses Ver-hältnis dagegen als ein sehr feindseliges. Auf diesen Wechsel ist öfter hinge-wiesen worden.106 Auch an anderer Stelle erregt eine fremdländische Frau desMose Aufsehen, sie wird allerdings »Kuschiterin« genannt (Num 12,1),107 wasjedoch auf eine gemeinsame ältere Tradition zurückgeführt werden kann108.Unter der Voraussetzung, daß es sich bei Num 25 um einen frühestens exi-lischen Text und bei der Tradition von Moses midianitischer Ehe um älteresallgemein bekanntes Gut handelt, könnte man beim Hörer von Num 25,6 dieKenntnis dieses Zusammenhangs voraussetzen. Bemerkenswert ist, daß derName Pinhas wie die Bezeichnung »Kusch« beide eigentlich Nubier bezeich-nen,109 in ihrem Kontext aber auf Midian verweisen könnten.110
103 Sivan.104 Vgl. ebd., 72.105 M. Rösel, Bileamgestalt, 516.106 Knauf, Midian, 160; Jagersma, 11 f.; Gerhards, 173.107 Vgl. dazu Fritz, Israel in der Wüste, 76; Knauf, Midian, 160; Anderson; Cross, 204.108 Gerhards, 174f.109 Snaith, 303.110 Gressmann, Mose, 275.
52 2 Baal Peor
Im Zusammenhang mit Num 31 wird hier ein Bruch mit der älteren Tradi-tion deutlich. Die midianitische Verschwägerung des Mose belegt ein Wissendarüber, daß Israel seine religiöse Identität auch durch midianitische Vermitt-lung bekommen haben könnte. Eine Reihe von Texten verwundert den Le-ser deshalb damit, daß gerade Midian die Feindschaft angesagt wird.111 MitNum 25 wird dieser Traditionsbruch vielleicht am deutlichsten.
Das bedeutet aber, daß die Statuierung eines Exempels gerade an einerMidianiterin und nicht an einer Moabiterin auf einen »Mißstand« hinweist,der schon längst besteht, nämlich, daß es fremde Frauen im Volk gab, und daßder Führer – Mose – mit »schlechtem« Beispiel vorangegangen war. In Vers 6wird diese Konfrontation überaus deutlich, wenn es heißt:
Und da, einer der Israeliten brachte zu seinen Brüdern die Midianiterin vor den Au-gen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Israeliten.
»Die Midianiterin vor den Augen des Mose« – und Mose bleibt untätig! Eslegt sich nahe, seine Befangenheit mit seiner Frau zu erklären.112 So tritt imfolgenden eben Pinhas in Aktion, nach Ex 6,25 ein Nachkomme aus offenbarebenso »zweifelhaften« Verhältnissen. Durch sein Eingreifen wird der ZornGottes abgewandt, wie es normalerweise von Mose bewirkt wird. Viel stärkerals es von Mose jemals beschrieben wird, handelt Pinhas in Übereinstimmungmit Gott.113
Daß der Israelit die Frau »zu seinen Brüdern« �� �� ��#� �� �æl-�æh. aw bringt,kann andeuten, daß es hier um etwas anderes geht, als mit den Moabiterinnen.Es geht nicht um »huren«, sondern darum, eine Midianiterin in die eigene Fa-milie zu führen, also zur Frau zu nehmen. Es wird jedoch nur darauf angespieltund keine für »Ehe« typische Terminologie114 benutzt. Die Septuagintaversi-on »... brachte seinen Bruder zu der Midianiterin« hat evtl. die Funktion der»Brüder« als Bezeichnung für »Familie« nicht nachvollziehen können und soaus dem einen Bruder den gemacht, den Pinhas später erstechen wird. Dasbringt aber im weiteren Verlauf des Textes neue Probleme mit sich, denn es istauch später ganz selbstverständlich von »dem Israeliten« die Rede, ohne daßerklärt wird, welcher von beiden.
2.3.4 Eheliche Verbindung mit Nichtisraeliten
Die Deutung von Num 25 als vorbildhafter Erzählung für den Eifer gegenMischehen bringt das Kapitel in Zusammenhang mit dem Mischehenproblem
111 Knauf, Midian, 150–169; M. Rösel, Bileamgestalt, 516.112 Vgl. Cross, 202; Milgrom, 214; Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 357–359; Organ, 205; Que-
sada, 29–35. Ausdrücklich dagegen votiert Seebass, Numeri III, 120.113 Boudreau, Study, 29.114 Vgl. Seebass, Numeri III, 117 f.
2.4 Num 25 und Ex 32 53
in Maleachi und besonders Esr/Neh,115 Texten, in denen auch die besondereRolle und Verantwortung des Priestertums diskutiert wird. Es gipfelt in sol-chen Fällen, in denen die hohepriesterliche Linie verstrickt ist (Esr 10,18 f.;Neh 13,28 f.), wobei politische Beweggründe für die Mischehen auf der Handliegen.116 Im Vergleich zu Mal 2,11 f. und Esr/Neh117 läge Num 25 zwischenbeiden Positionen, denn einerseits geht es deutlich um die Verbindung vonMischehe und Idolatrie, andererseits kommt es zur direkten Aktion gegen dieMischehe. Die Intention des Textes geht über einen vehementen Beitrag in derMischehenfrage aus Esr/Neh weit hinaus. Thematisiert wird hier Grundsätz-liches zum Zusammenhang von Kulturkontakt und der Gefahr des Synkre-tismus. Dieses zentrale deuteronomistische Thema118 wird in Auseinanderset-zung mit der älteren Tradition von der Verbindung Israel–Midian behandelt.Im Erzählzusammenhang von Wüste und Landnahme, wo ganze Völker –auf der literarischen Ebene – ohne großes Tränenvergießen ausgelöscht wer-den, geht auch diese Auseinandersetzung tödlich aus. Daß der Autor auch indem ihm zeitgenössischen Mischehenstreit zur spontanen Gewalt aufruft, istnicht zwingend anzunehmen. Eher geht es darum, den Priester Pinhas zumEiferer zu stilisieren, um die Priesterschaft bei dem Streit in ein besseres Lichtzu rücken, weil sie involviert ist (Esr 10,18; Neh 13,28–30)119.
2 . 4 N U M 2 5 U N D E X 3 2
Aussagekräftig über die Intention des Textes in Bezug auf das Verhältnis vonPriestern und Leviten ist ein Vergleich mit Ex 32.120 Vergleichspunkte lassensich an mehreren Stellen finden, so der Grundtyp der Erzählung, in dem dasVolk den Zorn Gottes erregt und das Eintreten eines Einzelnen diesen Zornabwendet. In beiden Texten wird eine Rigorosität an den Tag gelegt, die töd-lich gegen Nahestehende vorgeht. Gerade dieser Punkt hat Ex 32 zu einemzentralen Text werden lassen, aus dem sich ein starkes Konkurrenzverhältniszwischen Aaroniden und Leviten ablesen läßt. Denn Aaron trägt einen großenTeil der Schuld, während Mose die Leviten um sich schart, und diese die Strafeam Volk vollziehen.
Sehr oft wird also von einer gemeinsamen thematischen Abfolge in Ex 32und Num 25 gesprochen: Auf eine Form von Götzendienst folgt eine Bestra-fung durch Tötung einer großen Menge. Danach werden Leviten bzw. Prie-
115 Falk, 5; dagegen Seebass, Numeri III, 119.116 Meinhold, Maleachi, 194 f.117 Vgl. ebd., 195 f.118 Blum, Komposition, 115; Kratz, Hexateuch, 317 f.119 Schaper, Priester und Leviten, 238–241.120 Boudreau, Study, 264 f.; Olson, 233 f.
54 2 Baal Peor
ster zum Priesterdienst eingesetzt.121 Oft ist daher ein motivgeschichtlicherZusammenhang vermutet worden: Der Eifer des Pinhas ist nur eine andereerzählerische Ausformung vom levitischen Eifer.122 Die Formulierungen wei-sen signifikante inhaltliche und wörtliche Übereinstimmungen auf.
. . . und tötet, jeder seinen Bruder, jeder seinen Nächsten, jeder seinen Verwandten.Ex 32,27b
Tötet, jeder seine Leute, die sich dem Baal Peor unterjocht haben. Num 25,5b
Der zweite Punkt ist etwas versteckter und weist vor allem eine sachliche Näheauf. Während Pinhas und seinen Nachfahren das Priestertum zugesprochenwird, sagt Mose den Leviten, sie hätten sich durch ihre Tat »heute für denHerrn die Hände gefüllt« (Ex 32,29a�) – ein Ausdruck, der an Formulierungenbei der Anstellung von Priestern erinnert (Ri 17,12).
Der dritte Punkt weist mit den Wurzeln � $ kpr, sühnen, und %� ngp,schlagen, wieder einen gemeinsamen Wortschatz auf. Inhaltlich unterscheidetsich der Vorgang aber, weil es Mose im Gegensatz zu Pinhas nicht gelingt,Sühne zu schaffen. Gott besteht auf individueller Bestrafung (Ex 32,33–35).
Von diesen wörtlichen und strukturellen Übereinstimmungen her ist dasVerhältnis der Texte zueinander als literarische Bezugnahme erklärt worden.Ein wichtiger Vergleichspunkt zwischen beiden Texten liegt darin, daß sie inextremen Farben – mit Abfall durch Götzendienst – den Aufenthalt in derWüste charakterisieren: Es war eine Zeit der ständigen Konfrontation zwi-schen Gott und seinem Volk, geprägt von Unglauben und Abfall. Dabei bil-det der Sinai, und damit die Geschichte vom Goldenen Kalb, eine wichtigeZäsur. Während Gott vorher regelmäßig dem Drängen des Volkes nachgibtund seine Wünsche erfüllt, straft er es nach dem Sinai, und es bedarf jedesmaleiner Person die vor Gott für das Volk eintritt (Mose, Aaron oder Pinhas).Der Wüstenaufenthalt seit dem Bundesschluß und -bruch am Sinai wird alsovon Ex 32 und Num 25 gerahmt. Und wenn in Num 25 vom Ende der Pla-ge gesprochen wird und danach die neue Generation gezählt werden kann,dann wird damit in gewisser Weise diese ganze Periode seit dem Sinai, seitdem goldenen Kalb, als Plage bezeichnet. Freilich wird auch vorher schon mitder gleichen Formulierung von dem Ende der Plage gesprochen: Num 17. Aufdieser Ebene gelesen, handelt es sich um die Abfolge einzelner Plagen. Num 25setzt aber den Höhe- und Schlußpunkt und bezieht sich eben auch literarischauf den Anfang der Plage-Periode in Ex 32 (»und er schlug« % �������� wayyiggop –Ex 32,35) zurück.123
121 Vgl. Gressmann, Mose, 216 f.; Budd, 277 f.; Blum, Komposition, 206; Milgrom, 211;Cross, 311; Miles, 162 f. u. ö.
122 Vgl. Gressmann, Mose, 216 f.; Cross, 311.123 Vgl. Blum, Komposition, 206; Milgrom, 211; Staubli, 305.
2.4 Num 25 und Ex 32 55
2.4.1 Die Leviten und ihr Eifern
Ist der religöse Eifer, wie in der Einleitung angesprochen, schon bei menschli-chen Akteuren wegen seiner Spontaneität und daher Unberechenbarkeit pro-blematisch, so ist die Vorstellung vom eifernden Gott dem Postulat der Un-wandelbarkeit Gottes geradezu entgegengesetzt. Wer sich vom Zorn mitreißenläßt, steht nicht über den Dingen. Eifersucht ist nicht nur ein sehr auffälligerAnthropomorphismus, sie läßt sich durchaus als charakterliche Schwäche deu-ten.124 Jan Assmann betont jedoch, daß der göttliche Zorn unabdingbar ist,um die Ordnung einer in sich widersprüchlichen Welt aufrechtzuerhalten.125
Der alttestamentliche Begriff »Eifer«/»Eifersucht« � �� �� qin�ah – auch derEifer Gottes – läßt sich von Besitzansprüchen in einer ehelichen Beziehungherleiten. Sie steht im Zusammenhang mit der Liebe, die eindeutige Loya-lität fordert.126 In altorientalischen Texten kann vor allem vom Neid derGötter untereinander gesprochen werden.127 Im alttestamentlichen – vorwie-gend monolatrischen – Kontext richtet sich die Eifersucht gegen die Vereh-rer, sobald sie nämlich andere göttliche Mächte verehren.128 Der semantischeZusammenhang mit innerehelicher Eifersucht kommt im sachlichen Zusam-menhang mit Stellen zum Ausdruck, die die Beziehung Gottes zu seinem Volkim Bild einer Ehe beschreiben.129 Auch in Num 25,1–3 geht es um den engenZusammenhang von Ehen mit fremden Frauen und Teilnahme an deren Kul-ten. In den V. 6–8 erregt dann eine einzelne eheliche Beziehung den Eifer desPinhas, von dem aber hinterher gesagt wird, er habe Gottes eigene Eifersuchtempfunden.
Eifer eines einzelnen für Gott wird im AT, mit der Terminologie »eifernfür« � �� qn� l, von Elia (1Kön 19,10. 14), Jehu (2Kön 10,16) und Pinhas(Num 25,13) berichtet.130 Bei Jehu könnte das ein literarischer Rückverweisauf Elia sein.131 Ein Zusammenhang des Motivs bei Pinhas und Elia ist wenig-stens im Nachhinein hergestellt worden.132 Der menschliche Affekt, der demWort innewohnt, kann bis zur »Beseitigung des Gegners«133 führen. Das stehtim Zusammenhang mit der Selbstgefährdung, die diesem »leidenschaftlichenEinsatz«134 nahestehen kann:
124 Stumpff, 882.125 Assmann, Politische Theologie, 83–92.126 Küchler, 43; Berg, Eifersucht Gottes, 197; Ders., Eifer.127 Sauer, 648 f.128 Ebd., 649; Berg, Eifersucht Gottes, 204–206; Reuter, 59.129 Küchler, 47; Reuter, 59.130 Küchler, 45; Reuter, 57 f.; Smiles, 287 f.131 Reuter, 57.132 Siehe oben S. 12.133 Berg, Eifer.134 Ebd.
56 2 Baal Peor
Ps 69,9 Entfremdet war ich meinen Brüdernund fremd den Söhnen meiner Mutter.
10 Denn der Eifer deines Hauses hat mit gefressen,und die Schmähungen der dich Schmähenden sind auf mich gefallen.
Gewalt im religiösen Eifer wird immer wieder als zentrales Motiv des altte-stamentlichen Levitismus angenommen. Neben dem besprochenen Text ausEx 32 werden dafür Levis und Simeons Rache für die Behandlung ihrer Schwe-ster Dina in Gen 34 und die Levi-Sprüche im Jakob- und im Mosesegen ange-führt. Während Gen 34 und 49,5–7, wovon der zweite Text sich wahrschein-lich auf den ersten bezieht,135 das gewaltsame Vorgehen der beiden Brüdermißbilligt, bezieht sich Dtn 33,8–11 positiv auf Ex 32,27, indem es den Bruchmit familiär Nahestehenden als eine »Levitenregel«136 beschreibt.
Bei der Behandlung der alttestamentlichen Leviten wird deshalb gern derihnen eignende »Eifer« hervorgehoben. Nach dem hebräischen Begriff � �� ��qin�ah, von dem oben gesprochen wurde, im Zusammenhang mit Levitensucht man im AT vergebens. Verbunden wird der Begriff erst in der Lite-ratur der priesterlichen Levi-Tradition mit Levi, und zwar in Anspielung aufNum 25 (Jub 30,18).137 Der Begriff wird also im Nachhinein von Pinhas aufLevi übertragen. Die Vorstellung vom religiösen Eifer entwickelt sich erst inder zwischentestamentlichen Literatur zu einem oft aufgegriffenen Motiv.138
Das knüpft an die literarischen Zusammenhänge an, die zwischen Num 25
und Ex 32 bestehen. Aber erst vom Priester Pinhas wird »Eifer« � �� �� qin�ahgebraucht. Der Begriff, der eher ein gemeinsames Wortfeld der beiden Textebestimmt, ist das Verb »töten« (��� hrg). Noch stärker prägt diese Wurzel aberdie Texte Num 31 und Gen 34.
Um das alttestamentliche Levitentum fassen zu können, ist es von ver-schiedenen Aspekten her beschrieben worden, was zu unterschiedlichen Erklä-rungsmodellen führt. Eine Reihe alttestamentlicher Texte legen Auseinander-setzungen zwischen Leviten und Priestern nahe (Ex 32; Num 16; Ez 44). Kom-biniert mit historischen Abläufen wie der josianischen Reform, dem Exil undder teilweisen Rückkehr nach Juda ergeben sich daraus verschiedene Mög-lichkeiten, den Ursprung des Levitentums von Gruppen vorexilischen Kult-personals abzuleiten – von den Staatskulten des Nordens, des Südens odervon kleineren Höhenheiligtümern auf dem Lande. In den genannten Ausein-andersetzungen geht es darum, wie sich die verschiedenen Priestergruppen,unter ihnen Leviten, die Rechte am einzigen übriggebliebenen Heiligtum auf-
135 Kellermann, 507 f.136 Gunneweg, Leviten und Priester, 33, 40 f., 44; Kellermann, 509; Nelson, 91; Werner,
624.137 Kugler, 15 f.; Kugel, 6 f.138 Reuter, 62; Sauer, 650.
2.4 Num 25 und Ex 32 57
teilen. Dabei kann die untergeordnete Stellung der Leviten in nachexilischerZeit sowohl als Ab- als auch als Aufstieg gedeutet werden.139
Während den verschiedenen angenommenen Priestergruppen eine ver-wandtschaftsbezogene Identität zugeschrieben wird, ist das für die Ursprün-ge des Levitentums nicht so deutlich. Zwar stellen die jetzt im kanonischenText vorliegenden Genealogien das Bild dar, alle Leviten und Priester hättenLevi als gemeinsamen Stammvater. Dieses Schema gilt aber als ein spätes Pro-dukt. Die »Levitenregel«, die die Preisgabe gerade familiärer Bindungen for-dert, scheint der Vorstellung zu widersprechen, Levi sei ein Stamm. Sehr oftist deshalb eine Unterscheidung vorgenommen worden zwischen einem alten,wahrscheinlich untergegangenen Stamm und dem jüngeren Stand der Levi-ten als Kultpersonal (bzw. weltlicher und geistlicher/priesterlicher Stamm),140
bzw. zwischen einem ursprünglichen religiösen Stand und der späteren Sti-lisierung als Stamm.141 Freilich ist gerade in den späteren Texten das Selbst-verständnis, ein Stamm zu sein, eine allgemein anerkannte Vorstellung. Diesestribale Selbstverständnis müßte dann eine Fiktion sein,142 so daß sie sich über-haupt erst einem späten Darstellungsinteresse verdanken könnte143. Allerdingssollte beachtet werden, daß eine tribale Identität immer z. T. auch konstruiertist, denn sie dient ja gerade dazu, mehrere Gruppen zusammenzuschließen.Hermann Schulz hat sich ausdrücklich gegen die Alternative Stand/Stammgewandt.144
Eine besondere personale Bindung an die Person des Mose wird für dieLeviten von Dtn 33,8–11 und Ex 32 her geschlossen. Ebenfalls aus diesen Tex-ten (sowie aus Gen 34 und Gen 49,5–7 als Negativdarstellungen) läßt sichder erwähnte religiöse Rigorismus als zentrales levitisches Motiv herausstel-len. Von Mose her wurden Beziehungen der Leviten zu Ägypten und Midianangenommen. Daran anschließend wird ihre Herkunft aus Südpalästina ver-mutet.145 Auch levitische Genealogien verweisen mit Namen wie Hebron oderLibni in diese Gegend.146
In spätnachexilischen Texten scheint es emanzipatorische Bestrebungenvon Leviten gegeben zu haben,147 die die priesterliche Vorrangstellung ak-zeptierten und sich evtl. auf andere Funktionen konzentrierten.148 JoachimSchaper hat in der Reformtätigkeit Nehemias und Esras den Ausgangspunkt
139 Überblicke bieten Strauss, 13–44; Nelson, 7–11; Meinhold, Maleachi, 146–149.140 Seebass, Levi/Leviten, 39.141 Meinhold, Maleachi, 146.142 Gunneweg, Leviten und Priester, 79 f.143 Achenbach, Levi/Leviten, 294.144 Schulz, 90.145 Meyer, 92 f.; Cross, 201 f.146 Möhlenbrink, 195–197; Cross, 206 f.147 Meyer.148 Glessmer, 132–145.
58 2 Baal Peor
für diese Neuorientierung der Leviten gesehen.149 »Nach und nach wurdedie Schriftauslegung zur Domäne der Leviten.«150 In diesem Zusammenhangscheint Levi aufgewertet und vom Ahn zum idealen Priester stilisiert wordenzu sein (Dtn 33,8–11; Mal 2,1–9).
Hermann Schulz hat das altisraelitische Levitentum in einen kulturge-schichtlichen Zusammenhang mit verschiedenen vorderorientalischen undnordafrikanischen Phänomenen gestellt, die er insgesamt als »Levitismus« be-zeichnet.151 Als zentrale Aspekte beschreibt er dabei die »levitische Konfliktlö-sungskompetenz« als einen Teil der Fähigkeit von Leviten, auf gesellschaftlicheStrukturen und Abläufe wirksam Einfluß zu nehmen, wie auch die intellek-tuelle und spirituelle Kompetenz, die segensvermittelnd wirken kann.152 DieFormen der Gewaltanwendung gehen vom einzelnen Mord bis zum Stämme-krieg. Gerade diese beiden Methoden der Konfliktlösung sind zentrale Ele-mente im Charakterbild des Pinhas, wie es die Texte zeichnen. Für einengroßen Teil der alttestamentlichen Texte, die Schulz heranzieht, ist es frag-lich, ob man in ihnen wirklich vorexilische, ja vorstaatliche153, Verhältnissewidergespiegelt findet.
Es muß daher damit gerechnet werden, daß in nachexilischer Zeit Auto-ren ein Bild, vor allem des vorstaatlichen Israel zeichneten, das dem Phäno-men dieses Levitismus nahekommt. Diese Autoren können durchaus Levitensein, die sich immer stärker auf die Textüberlieferung und -produktion kon-zentrierten.154 Sie hätten dann ein solches Bild des Levitentums in die Vor-zeit projiziert und damit ihr eigenes Selbstverständnis gefunden. Sowohl derStamm Levi wie die Vorstellung von einer Gruppe spontaner Eiferer sind spä-tere Fiktionen. Das heißt aber nicht, daß ihnen keine Realität entspräche. ImGegenteil, eine Identität wird nicht in erster Linie durch die faktische Ver-wandtschaft begründet, sondern erst durch das kollektive Bewußtsein, mit-einander verwandt oder andersartig verbunden zu sein.
Wird Pinhas nun mit seinen ägyptischen Anklängen in die Nähe des Moseund mit seinem Hang zur Gewaltanwendung den Leviten nahegestellt, wo erohnedies genealogisch Levi zugeordnet ist, dann dürfte auch darin der literari-sche Gestaltungswille liegen, die eigene Gruppe – in diesem Fall die dominie-rende Priesterschaft – mit einem levitischen Idealbild zusammenzubringen.155
149 Schaper, Priester und Leviten, 304–307.150 Ebd., 306.151 Schulz.152 Ebd., 87–93.153 Ebd., Titel. 8.154 Vgl. unter anderen Gertner; Gunneweg, Leviten und Priester, 72 f.; Glessmer, 132. 145;
Willi, Leviten, 91 f.155 Vgl. Dahm, 99.
2.6 Schichtung 59
2 . 5 N U M 2 5 U N D N U M 1 7
Die meisten wörtlichen Übereinstimmungen hat Num 25 mit Num 17:
� Die Drohung, das ganze Volk auszulöschen (� ��� �$���� wa�
akallæh – 17,10
/ � ��� ��� �$�
�� � welo�killîtî – 25,11).
� Aaron und Pinhas handeln sühnend (� �� ��#� �� � �� �$���� wayyekapper �al-
ha�am – 17,12 / � �� �� ���� �� ��#� �� �al-benê yisra�el – 25,13)
� Das Ende der Plage (�� �� ��� �� ��� ������ & [� �� �� ����#�� �� � �� ��] � � ��� ��� �� � �� �� �����''' � � ��� ��� ��� watte�as.ar hammaggepah [me�al benê-yisra�el]. wayyihyû ham-metîm bammaggepah . . . – 17,13 f.; 25,8 f.)
� Die Formulierung [�� ��� � ]#� �� ��#� �� �al-debar-[pelônî] (17,14; 25,18), diemit noch anderen Stellen des Kontextes gemeinsam sind.
Auch in Num 25 radikalisiert Mose die Strafanweisung Gottes und läßt »jedenseine Leute« töten. Mose vertritt den levitischen Eifer. Verwirklicht aber wirddieser Eifer erst durch den Aaronnachkommen Pinhas156 – und das vor denAugen des untätigen Mose. Dem Leviten Mose wird die Initiative von dem»levitischen Priester« Pinhas aus der Hand genommen. Was Mose ausgelösthatte, wird nun als Plage bezeichnet, die durch Pinhas’ Initiative gestopptwird.
Mit dem Schlußpunkt als Ende der Plage setzt Num 25 sowohl Mose alsauch Aaron den Pinhas entgegen, der im Ergebnis auch viel erfolgreicher ist,als seine beiden Vorgänger.
2 .6 S C H I C H T U N G
In Bezug auf Num 25,1–5 sprechen die meisten Forscher heute von einemvorpriesterlichen Textbestand.157 Reinhard Gregor Kratz grenzt Num 25,1b–5unter Hinweis auf die deuteronomistischen Formulierungen auch nach vornals nachdeuteronomistisch ein,158 so daß auch dieser erste Teil relativ jungwäre, und die Beziehungen zu anderen Texten untersucht werden müssen, diedie Geschichte um den Baal Peor berichten. Auch Ernst Axel Knauf datiertdie Verse 1–4 relativ jung, wenn er sie von Hos 9,10–17 abhängig sein läßt.159
156 Staubli, 307.157 Z. B. Blum, Komposition, 114; Johnstone, 270 (»D-version«).158 Kratz, Hexateuch, 317 f. Vgl. Boudreau, Study, 48–75; Ders., Hosea, 123 f.; Arneth, 139;
Achenbach, Vollendung, 428.159 Knauf, Midian, 163.
60 2 Baal Peor
Horst Seebass nimmt schon vorpriesterlich einen Textbestand an, in demdie Peor- und die (nicht priesterliche) Pinhastradition miteinander verbun-den sind.160 Es müßte eine aaronidisch orientierte »nicht sehr alte Nicht-P-Tradition« angenommen werden.161 Es fehlen jedoch eindeutige literarkriti-sche Argumente, um die priesterlichen Zusätze ausscheiden zu können. Dannist doch eher eine spätere Entstehung anzunehmen.
Mit V. 6, auch mit dem literarischen Neuansatz liegt ein Ausgangspunktvor. Im folgenden wird eine Plage genannt, bei der 24 000 starben. Das kannsich jetzt nur auf V. 5 beziehen, wo eine große Menge von der Strafe betroffensein kann, weniger auf die Bestrafung Auserwählter in V. 4 (es sei denn, »sie«� �� ��� �ôtam bezieht sich in V. 4 auf Israel). Gerade aber zu V. 5 besteht dieSpannung. Die Verse 1–4 ergeben für sich genommen einen abgeschlossenenZusammenhang. Das Ende (das Abkehren des Zornes) ist in Aussicht gestellt,wenn es auch nicht mehr berichtet wird.162
V. 4 läßt zwei Fragen offen. Was ist der genaue Inhalt der Strafe, und wer-den nur die »Häupter« bestraft oder alle, die gesündigt haben? Syntaktischbesteht jedoch der größte Bezug von »sie« � �� ��� �ôtam auf »Häupter« �� � ��� ��ra�šîm. Vorher wird stets nur Israel als Gesamtheit angesprochen. Sollte diejetzt vernichtet werden? Allerdings entspräche V. 5 dann genau der Ausfüh-rung dieser Anordnung. V. 4 im Sinne von V. 5 zu deuten legte sich, wie dieAuslegungsgeschichte zeigt, immer nahe. Es hat jedoch die Konsequenz, daß»Israel« in V. 1–3 nur einen Teil des Volkes, nämlich die Abgefallenen, undnicht dessen Gesamtheit meint. So liest der Samaritanus in V. 3 folgerichtig,aber gegen die Syntax »und es unterjochte sich von den Söhnen Israels« wys.mdmbny ysr�l. Die beiden syntaktischen Probleme machen daher wahrscheinlich,daß schon V. 5 eine Auslegung von V. 4 in Form von Moses Ausführungsan-ordnung ist: Mose nimmt die »Häupter« zu Richtern, um die Israeliten zubestrafen, aber nur die, die abgefallen waren.
Isoliert man also V. 1–4, ergibt sich mit zwei geringfügigen Änderungen(einer in der Vokalisation und ein verschriebener Konsonant) eine einfacheliterarische Einheit: Die Aufforderung Gottes an Mose beschränkt sich aufdie Aufforderung, die Anführer zu nehmen. Was mit ihnen geschieht, wirdgleich auf der Ebene der Ausführung beschrieben. Dazu muß allerdings bei»und pfähle« � �� ��� � wehôqa� eine Verschreibung von Jod zu He angenommenwerden, so daß die ursprüngliche Fassung wieder Erzähltempus bieten würde:»und er pfählte« � �� ������ wayyôqa� (leichter mit althebräischer Schrift vorstellbar:von � zu�). Nun ist es auch nicht mehr Gottesrede, in der der Gottesnameerscheint. Nach der Ausführung wird der soeben entbrannte Zorn abgewen-
160 Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 358; Ders., Numeri III, 128–132.161 Ebd., 130.162 Smend, 233.
2.6 Schichtung 61
det. Dazu muß aus »und abkehren wird« �� ���� � weyašob die Narrativform »und
es kehrte ab« � "�
������ wayyašåb werden. Der Erzählstil wäre sehr verkürzt, jedochvollständig und schlüssig. Man vergleiche hierzu Gen 15,9 f., wo Abraham von
Gott aufgefordert wird, verschiedene Tiere zu nehmen � �� � �� � qeh. ah lî. Wasmit ihnen geschehen soll, erfährt der Leser aber erst bei Abrams Ausführung,obwohl man eine entsprechende göttliche Anweisung voraussetzen muß. DieVerse 1–4 ergeben dann durchaus eine einfache Einheit:
Und Israel lagerte in Schittim. Da begann das Volk mit den Moabiterinnen zu huren.Und sie luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und huldigteihren Göttern. Und Israel unterjochte sich dem Baal Peor. Da entbrannte der Zorndes Herrn gegen Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm alle Häupter desVolkes. Und er pfählte sie dem Herrn gegen die Sonne. Und die Glut des Zornesdes Herrn kehrte ab von Israel.
V. 5 deutet V. 4 insgesamt als Anordnung Gottes. Die »Häupter« hinzurich-ten, erscheint in seiner Mehrdeutigkeit anstößig. Also wird das »Häupter-Nehmen« zum Einberufen von Richtern. »Sie« � �� ��� �ôtam wird auf Israelbezogen, aber konkretisiert: Nur die Schuldigen sollen getötet werden. V. 5fügt mit der Ausführungsanweisung Moses eine Interpretation des göttlichenBefehls hinzu. Entsprechend Ex 18,25 f. sind mit den Häuptern diejenigen ge-meint, die das Volk richten sollen. Es stellt sich die Frage, ob zusammen mitV. 5 auch schon 6 ff. angefügt wurden. Dafür spricht, daß die so unvollständigverstandene Geschichte nicht ohne Ende bleiben konnte.
Dtn 4,3 f. setzt jedoch eine Lesung von Num 25 schon mit V. 5, aber nochohne 6 ff., voraus. Denn dort wird das Volk eingeteilt in diejenigen, die demBaal Peor nachliefen und deshalb vernichtet wurden, und in diejenigen, dieGott anhingen und daher noch leben. Die individualisierende Deutung ent-spricht also V. 5, weiß aber noch nichts davon, daß durch Pinhas’ Eingreifendie so unterschiedene Bestrafung nicht konsequent zu Ende gebracht wurde.Letztendlich ist daraus aber nicht zwingend abzuleiten, daß V. 5 eine erste se-parate Fortschreibung darstellt, die dann den Fortgang der Episode für einelängere Zeit offen gelassen hätte. Es ist denkbar, daß Dtn 4,3 f. die gleicheDeutung von V. 4 vornimmt wie V. 5 (siehe oben).
Milgrom hat zu Recht darauf hingewiesen, daß die Plage sich gut auf denausgebrochenen Zorn und nicht auf Moses Strafaktion beziehen könnte.163
Auf die Aufforderung zur Bestrafung folgt in V. 4 auch die Ankündigung, daßder Zorn Gottes danach von Israel ablassen wird. Die Strafe veranlaßt alsoetwas zweites – das Ende der Plage. Allerdings zeigt nicht zuletzt die Aus-legungsgeschichte, daß es sich von V. 8 her nahelegt, in der Strafe die Plagezu sehen, denn nach dem Ende der Plage werden die Toten gezählt, die sich
163 Milgrom, 213.
62 2 Baal Peor
gerade aus der Strafe erklären. Mit dem dreimaligen Setzen von ins Leere ge-henden Vorverweisen (»die Midianiterin«, »die Kuppel« und »die Plage«) wirdalso offenbar die Geschichte für Anspielungen geöffnet, indem von hinten hermehrdeutige Bezüge nach vorn gesetzt werden.
Die V. 6–13 sind nun durchaus dazu angetan, die Ausrottung des ganzenVolkes zu verhindern (V. 11 »und ich habe nicht vertilgt« � ��� ��� �$# ��� � welo�-killîtî). Der Akzent wird noch in der Hinsicht verschoben, daß das durchMoses individualisierende Ausführungsbestimmung in Gang gesetzte Massen-sterben als Plage bezeichnet wird. Während Mose gewöhnlich dafür sorgt, daßGottes Zorn die Israeliten nicht vertilgt, stellt die Situation nach der Fort-schreibung von V. 5 gerade das Gegenteil dar. Mose und die ganze Gemeindesehen dem Tun des Simri tatenlos zu. Die Initiative ergreift nicht Mose, son-dern der Priester Pinhas, dem dafür dann auch das ewige Priestertum verliehenwird. Dabei führt Pinhas genaugenommen nur die Bestimmung des Mose aus.Insofern muß nicht angenommen werden, die eifernde Tat des Pinhas habedem Text schon vorliegen müssen. Damit zeigen die Verse 5–13 zusammen einesehr deutliche gegen Mose gerichtete Intention. Sie sind daher nicht getrennt,sondern als eine Fortschreibung anzusehen.
So kommt wohl noch ein weiterer Zug von Kritik an Mose hinzu. Der Ar-tikel der Midianiterin schien oben auf den fragmentarischen Charakter hin-zudeuten. Versucht man aber V. 5–13 als Fortschreibung zu verstehen, so mußmit dem Artikel die sich aus V. 1–3 ergebende Frau gemeint sein. Dabei wird– wohl nicht versehentlich – die Volksbezeichnung geändert. Aus den Töch-tern Moabs kommt nun die Midianiterin. Was vom flüchtigen Hörer evtl.gar nicht bemerkt wird,164 muß dem Aufmerksamen gerade deshalb als einHinweis gelten. Angesichts der eben aufgezählten negativen Assoziationen zuMose, die beim Leser geweckt werden könnten, muß »die Midianiterin« demmidianitisch verschwägerten Mose – in den Ohren der Hörer – als Provokati-on vorkommen. Wie kommt er dazu, eine für Israel derart existentielle Strafezu veranlassen, obwohl er selbst nicht schuldlos ist?
2 . 7 L I T E R A R I S C H E I N T E N T I O N
Das beschriebene Schichtungsmodell hat den Vorteil, die Komplexität vonNum 25 nicht auf die Verknüpfung von Fragmenten zurückzuführen. Die Re-konstruktion solcher Fragmente ist zu hypothetisch und kann nicht alle Fra-gen befriedigend klären. Der dem Leser disparat erscheinende Text kann alsein Knotenpunkt mehrerer intertextueller Bezüge verstanden werden. Das be-zieht sich vor allem auf Num 25,5–13. 19. Dieser Text hat eine wichtige kompo-sitorische Funktion im Numeribuch, setzt Verweise zu den Büchern Exodus
164 Es kommt immer wieder mal zu Verwechslungen: Johnstone, 271.
2.7 Literarische Intention 63
und Genesis und öffnet den Erzählverlauf für das auf ihn Folgende. Nichtunbegründet sind daher Vermutungen, ihn in Zusammenhang mit der Ge-samtgestaltung des Pentateuchs zu bringen.165
Am wichtigsten ist dabei der Abschluß des Wüstenaufenthaltes, der insge-samt als Plage verstanden wird.166 Num 25 ist in Anlehnung an Num 17 kon-struiert. Während dort die Plage ausbricht und beendet wird, nennt Num 25nicht explizit den Ausbruch. Auf einer textinternen Ebene kann der Zorn Got-tes als Beginn der Plage verstanden werden.167 Das Ende der Plage ist aber dasEnde der Wüstenzeit, denn in Num 26 wird die neue Generation gezählt.Stellt die Anspielung auf Num 17 eine Abwertung des Aaron dar, so ist der oftfestgestellte strukturelle und inhaltliche Bezug zu Ex 32 Teil einer dem Textinnewohnenden Kritik an Mose. Mit der Anspielung auf Ex 32 ist aber auchein Hinweis auf den Anfang der begonnenen Plage gesetzt, als der Ex 32,35verstanden werden kann.168
Reinhard Achenbach hat Num 25,1–5 der Hexateuch-Redaktion zugewie-sen.169 Diese habe den Text für die Reihe von Murrgeschichten gestaltet.170
Auf dieser Ebene sei auch der Bezug auf Ex 32,27 hergestellt worden.171 Dain der vorliegenden Arbeit Num 25,5 jedoch nicht mehr zur Grundschichtgerechnet wird, fehlt für die Verse 1–4 ein wichtiges Element übergreifenderBezugnahmen. Diese ergeben sich erst mit der Erweiterung der Verse 5–13. 19.
Im Numeri-Buch stellt für die Unterscheidung der Generationen Num 14eine Schlüsselrolle dar. Denn hier wird der Grund dafür erzählt, warum eineGeneration in der Wüste sterben muß. Folgerichtig erscheint auch an die-ser Stelle der Beriff »Plage« � � ��� �� maggepah (Num 14,37). Benjamin Ziemerhat diese die Perioden gliedernde Funktion von Num 25 für die Endkompo-sition des Pentateuch in Zusammenhang gebracht mit einem Bezugssystemvon »Bundes«-Texten in dieser Kompositionsschicht,172 in dem er Gen 17die Schlüsselfunktion zuweist.173 Daß die Berit »gegeben« wird, verbindetNum 25,12 mit Gen 9,12 und 17,2. Eine Reihe von sich verengenden Bün-den findet erst in Num 25,13 mit dem Priesterbund ihren Abschluß. Ludwig
165 Vgl. z. B. Seebass, Numeri III, 135. Johnstone, 270 f., ordnet Num 25,6–19 »P« zu, das fürihn dem vorliegenden Pentateuch nahe kommt (ebd., 272 f.).
166 Römer, 221, 229 f., hebt die Zäsur zwischen Num 25 und 26 im Zusammenhang desBrückenschlages vom Tetrateuch zum DtrG durch das Buch Numeri hervor.
167 Schmidt, Numeri, 151.168 Vgl. Blum, Komposition, 206.169 Achenbach, Vollendung, 426–433.170 Ebd., 426.171 Ebd., 429.172 Ziemer, 302 f., Anm. 137.173 Ebd., 303 f.
64 2 Baal Peor
Schmidt verlagert die Probleme nur nach hinten hinaus, wenn er Num 25,6–13und Num 31 der Pentateuchredaktion nachordnet.174
Als dritter Prätext scheint 2 Sam 21,1–14 (thematisch und räumlich) rela-tiv weit abgelegen zu sein. Dennoch zeigt sich neben dem oben aufgelisteten(S. 50) gemeinsamen Wortschatz auch ein gemeinsames Thema. Es geht näm-lich um das Verhältnis zu Teilen der Bevölkerung, die seit langem als inte-griert, aber dennoch als ethnisch fremd gedacht werden: Num 25 – Midian/2 Sam 21 – Gibeon. In den Kapiteln 5und 6dieser Arbeit wird es sich nahe-legen, ein zadokidisches Traditionselement in Kirjat Jearim zu sehen. Die-se Stadt gehört nach Jos 9,18 mit zum Bereich Gibeons, das sich mit Israelverbündet hatte. War die Herkunft Zadoks aus Gibeon für den Autor vonNum 25,5–13 bekannt, und ging es ihm gerade um die Neugestaltung seinerGenealogie, dann liegt mit Pinhas eine Anspielung auf diese problematischeHerkunft Zadoks vor: Die nicht rein israelitische Herkunft hindert nicht, deroberste Priester zu sein. Vordergründig sind mit Pinhas ben Eleasar freilichalle Unklarheiten in Zadoks Genealogie ausgeräumt. Der falsche Eifer Sauls(2 Sam 21,2) entspricht in Num 25,5 dem übertriebenen Eifer des Mose.
Ist die Annahme richtig, daß hier eine Anspielung auf den Samueltextvorliegt, dann hat der Autor das »Pfählen«, das ihm in Num 25,4 schonvorgegeben war, zum Anlaß genommen, auf den Gebrauch des Wortes in2 Sam 21,6. 9 hinzuweisen, indem er von dort Wortschatz aufnahm und inNum 25 benutzte (»sühnen«, »eifern«).175
Während der gleichzeitige Bezug auf drei verschiedene Prätexte die Aus-gestaltung von Num 25,5–13. 19 aus den Versen 1–4 heraus in ihrer diffizilenForm verständlich und die Stellung des Textes als Abschluß der Wüstenzeitbegreiflich macht, erscheint die Vergabe der ewigen Priesterschaft an Pinhasals Ziel des Textes. Ist das nun auch einfach erklärlich als Teil des Gegenbildeszu Aaron, das hier aufgebaut wird, oder läßt sich das Priestertum des Pinhasanderweitig herleiten? Wenn es das Ziel des Textes ist, Pinhas’ Anrecht auf dasPriestertum zu rechtfertigen, dann ist gut annehmbar, daß der Anspruch selbstschon besteht und vom Autor vorausgesetzt wird. Literargeschichtlich folgteder Lohn nicht auf die Tat, sondern umgekehrt dient die Tat zur Begründungeines Privilegs.
174 Schmidt, Numeri, 186.175 Arneth, 139.
3 Die Bundestradition
Gott reagiert auf Pinhas’ Eingreifen, indem er ihm einen speziellen »Bund«verleiht:
Num 25,10 Und der Herr sprach zu Mose: 11 Pinhas ben Eleasar ben Aaron wandtemeinen Zorn von den Israeliten ab, indem er unter ihnen meinen Eifer eiferte, sodaß ich die Israeliten nicht in meinem Eifer vernichtete. 12 Deshalb sprich: Siehe ichgebe ihm meinen Bund, Frieden. 13 Der bleibe ihm und seinen Nachkommen nachihm ein Bund ewiger Priesterschaft, dafür daß er für seinen Gott geeifert und für dieIsraeliten gesühnt hat.
Der Eifer des Pinhas wird als eine quasi kultische Handlung interpretiert:Mit seinem Eifer für Gott hat er für Israel Sühne geschaffen. Jedoch kannkein Sühneopfer assoziiert werden, da die Tötung eine Strafe darstellt. EinBezug zu kultischem Handeln besteht in der Vergegenwärtigung göttlichenHandelns. Pinhas eifert selbst Gottes Eifer und hat damit die Bedrohung desVolkes durch den göttlichen Zorn gebannt. Mit seiner Tat hat er offenbardie Befähigung zu wirkungsvollem priesterlichen Handeln erwiesen. Jeden-falls wird damit begründet, daß ihm und seinem Samen das Priestertum fürimmer zugesagt wird. Diese Zusage wird als »Bund« �� �� �� berît bezeichnet.
Anscheinend derselbe »Bund« wird mit der Apposition »Frieden« � ��� � �� šalôm,versehen.
So jedenfalls ist das Verständnis, das sich kontinuierlich durch die Punk-tation und die verschiedenen Übersetzungen durchhält. Freilich erwartet maneher die constructus-Verbindung »Friedensbund« � ��� � �� �� �� �� berît šalôm. Solesen auch Septuaginta und Peschitta. Eine vergleichbare Anwendung von»mein Bund« � ��� �� �� berîtî in einer constructus-Verbindung findet sich inLev 26,42. Behält man das Suffix als lectio difficilior bei, kann man versuchen,der Apposition durch veränderte Vokalisation eine »passendere« Funktion zugeben: »Ersatz« ��� �� � �� šillûm, statt »Friede« � ��� � �� šalôm – »ich gebe ihm mei-nen Bund als Ersatz/Lohn.«1 Gillis Gerleman hat das Verständnis »Ersatz« alsGrundbedeutung für das Gros der Vorkommen von �
��� �
�� šalôm vorgeschla-
gen.2 Dann müßte nicht einmal die Vokalisation geändert werden. Für diesesVerständnis spricht auch, daß ausdrücklich von einer Ersatzleistung gespro-chen wird: »dafür daß« � � ���� � �� ��� tah. at �
ašær.
1 Vgl. BHS z. St.; Ehrlich, 211; Rudolph, Elohist, 15; Snaith, 303 f.2 Gerleman.
66 3 Die Bundestradition
Zu dem Begriff »Friedensbund«, der in Jes 54,10, Ez 34,25 und 37,26 begeg-net, hat man akkadische Parallelen in Ugarit gefunden, so z. B. in RS 17. 132,Z. 19–21: »Vertrag und Frieden von H
˘atti bewahre« – ri-ik-sà/ù ša-la-ma ša
���h˘
a-at-ti/ú-s.ú-ur-ma.3 »Frieden« zwischen den Partnern ist Ziel eines »Bun-des«.4 Insofern können die beiden Begriffe parallel zueinander gebraucht wer-den.5 »Friedensbund« bezeichnet dann keine spezielle Art des Bundes, sonderndrückt nur deutlicher die Wirkung einer �� �� �� berît aus. Wenn in Num 25,12»Friede« als Apposition zu »Bund« steht, entspricht das der beobachteten Par-allelität der beiden Begriffe. Reinhard Achenbach betont, daß Num 25,12 mitdem Friedensbund eine Vorstellung aufnimmt, die mit der Davididenhoff-nung verbunden war. Hinter diesem Gebrauch im Zusammenhang mit demPinhasbund ist daher ein theokratischer Anspruch zu sehen.6
Um zu klären, wie der so stark herausgehobene Pinhas-Bund zu deuten ist,müssen vergleichbare Vorstellungen betrachtet werden. Dazu sind eine Reihevon Texten zu untersuchen, die entweder einen speziellen Bund mit Priesternbzw. Leviten thematisieren oder von der Gabe des Priestertums an eine be-stimmte Gruppe sprechen. So wird eine traditionsgeschichtliche Ableitungdes Pinhas-Bundes möglich.
3 . 1 D E R L E V I B U N D – M A L 2,4–8
Der Text, der die meisten inhaltlichen Berührungen zu Num 25 aufweist, istMal 2,4–8. Innerhalb einer Kritik an den gegenwärtig amtierenden Priesternwird auf eine Vorstellung Bezug genommen, nach der ein Bund Gottes mitLevi bestand, dessen Weiterbestehen nun durch das verantwortungslose Han-deln der Priester auf dem Spiel steht. Auch in dem Maleachitext bezeichnet�
��� �
�� šalôm ein wesentliches Merkmal des Bundes. In Mal 2,6b wirkte Le-
vi »abwendend« (�� ��
� �� hešîb) für die Gemeinschaft. Verglichen mit Num 25sind Zornabwenden und Sühneschaffen hier miteinander verbunden im »Ab-wenden von der Sünde«. Mal 2,7 zeigt deutlich, daß mit diesem Levi-Bunddas Idealbild eines Priesters gezeichnet wird.7 Beiden Texten ist ebenfalls ge-meinsam, daß dieser Bund einer bestimmten Person, freilich in beiden Fällenjeweils jemand anderem, gegeben wird. Die unten folgenden Texte zeigen, daßallgemeiner von einem Bund Gottes mit Priestern und Leviten ausgegeangenwerden konnte. Es zeigen sich also eine ganze Reihe starker inhaltlicher Paral-lelen, bzw. Stichwortbezüge zwischen Num 25,10–13 und Mal 2,4–8. Sprechen
3 Nougayrol, 36, Planche XVI.4 Vgl. Zimmerli, 844 f.5 Weinfeld, berît, 787; Rushing, 108.6 Achenbach, Vollendung, 438–440.7 Meinhold, Maleachi, 145.
3.1 Der Levibund – Mal 2,4–8 67
beide nur vom gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand oder gibt es direkteliterarische Bezüge?
Rezeptionsgeschichtlich begründet haftet dem Begriff »Bund« ein stark in-stitutionelles Verständnis an.8 Mit »Bünden« und »Testamenten« könnenschließlich verschiedene Religionsgemeinschaften voneinander differenziertwerden. Auch der Leviten- bzw. Priesterbund ist mit Institutionen verbun-den, nämlich mit kultischen. Dennoch kann nicht vorausgesetzt werden, inallen Texten würden mit dem Begriff immer genau die gleichen Vorstellun-gen beschrieben. Im folgenden soll die Entwicklung dieser Idee konstruiertwerden.
Schon mit den unterschiedlichen antiken Übersetzungstraditionen wirddas Grundproblem des Begriffes �� �� �� berît deutlich. Einerseits wird es als»letztwillige Verfügung« (Septuaginta: �������, Vetus Latina: testamentum)andererseits als »Bund/Vertrag« (Aquila: �����, Vulgata: foedus/ pactum)wiedergegeben.9 Was den Begriff »Bund« als Übersetzung ungeeignet erschei-nen läßt, ist die oft festzustellende Ungleichheit der Partner. Deshalb ist vor-geschlagen worden, allgemeiner von »Verpflichtung« zu sprechen, wobei dieseunterschiedlich auf die Partner verteilt sein kann.10 Als Übersetzung ist »Ver-pflichtung« freilich ungenügend, weil sie die Wechselseitigkeit nicht deutlichausdrücken kann, die sehr oft dem Begriff �� �� �� berît anzuhängen scheint.Norbert Lohfink hat mit dem Begriff eine »privilegrechtliche Beziehung« aus-gedrückt gesehen, womit er die Zweiseitigkeit von �� �� �� berît ernst nimmt.11
Zieht man in Betracht, neben welchen Begriffen �� �� �� berît genannt wird,dann fallen die parallelen Vorkommen neben verpflichtenden Begriffen auf:»Zeugnis«, »Schwur«, »Weisung«, »Satzung«, »Gebot« und »Rechtsspruch«12
– sehr aussagekräftig ist etwa der Wortschatz in Ps 105,8–10. Wenn �� �� �� berîtheilvolle göttliche Zusagen beschreibt, steht es u. a. neben »Gnade« oder »Frie-de«.13
Unter diesen parallel auftretenden Begriffen hebt �� �� �� berît besonders dieZweiseitigkeit von Verpflichtung hervor. Das beschriebene Wortfeld machtaber deutlich, daß es bei diesem Begriff um den Zusammenhang von Gna-de/Heil und Verpflichtung geht. Für Mal 2,4–8 ist wichtig, daß sowohl »Ge-bot« ��� � �� mis.wah als auch »Friede« � ��� � �� šalôm zusammen mit �� �� �� berît inein Wortfeld gehören.
8 Vgl. Gertz, 1863.9 Vgl. Kutsch, 352.10 Ebd.11 Lohfink, Bund, 344.12 Smiles, 291 f.13 Weinfeld, berît, 785–787.
68 3 Die Bundestradition
Für unser Thema ist das insofern relevant, als bei einem Vertrag ein zeitlichganz konkreter Anfangspunkt vorgestellt werden kann. Wenn die Terminolo-
gie »einen Bund schneiden/schließen« �� �� �� � �� ��$ karat berît oder »geben« DZ�ntn benutzt wird, ist die Vorstellung eines konkreten historischen, den Bundiniziierenden Ereignisses naheliegend. Für die Formulierung »einen Bund auf-
richten/aufrechterhalten« �� �� �� �� �� �� heqîm berît hat Benjamin Ziemer dasjedoch bestritten.14 Wenn festgestellt wird, daß ein besonderes Verhältnis zwi-schen Gott und einem menschlichen Partner besteht, muß nicht zwangsläufigan einen historischen Anfangspunkt gedacht sein.
Während in Num 25 durchaus von einem Anfangspunkt für den »Bund«gesprochen wird – die Bundesgabe ist Konsequenz (laken DZ �$ ��, »deshalb«) derEifertat –, ist das in Mal 2 längst nicht so deutlich. So schreibt Arndt Mein-hold: »Von einer Zeremonie (vgl. Gen 15,9–21; Jer 34,18; Ex 24,5–8; u. a.)oder sonstigen Begleitumständen bei einem Bundesschluß mit Levi verlautetnichts.«15 Hier wird einfach das Verhältnis beschrieben, das zwischen Gott undLevi bestanden haben soll. Es äußerte sich im Lebenswandel Levis. Es heißt,daß er »in Frieden . . . mit Gott wandelte« (Mal 2,6). Diesen Frieden als einepositive Eigenschaft Levis verlieh ihm Gott (V. 5). Dieses »Geben« war alsonicht die Initialzündung eines Bundes, sondern Gottes besonderes Verhältniszu Levi drückte sich in besonderen dauerhaften Zuwendungen aus, die frei-lich auch nach außen ausstrahlten. Wenn in Mal 2,4–8 nicht zwangsläufig einexpliziter Bundesschluß verausgesetzt ist, ist noch eine weitere Beobachtungbemerkenswert. Während in den Versen 5 f. deutlich von einer bestimmtengeschichtlichen Person – dem Stammvater Levi – gesprochen wird, läßt sich
die Bezeichnung des Bundes in V. 8 anders lesen. Er heißt dort ��� ��� �� �� �� �� berîthallewî, was sowohl mit »der Bund Levis«, als auch mit »der Bund des Levi-ten« übersetzt werden könnte.16 Im Kontext geht es dem Autor auch um dasbesondere Verhältnis des Kultpersonals seiner Zeit zu Gott.17
3.1.1 Ableitung der Vorstellung vom Priesterprivileg
Was wird, sozialgeschichtlich betrachtet, mit dem Ausdruck »Levibund« be-zeichnet? Der Begriff könnte nichts weiter beschreiben als einfach die gesell-schaftliche Sonderstellung der Leviten, die in ihrer religiösen Mittlerfunktio-nen begründet ist. Daß Mal 2,4–8 in der Wirkungsgeschichte nach dem Zeit-punkt der Bundesgabe fragen ließ, ist dem geschuldet, daß aus dem allgemei-nen »Bund der Leviten« historisierend »mein Bund mit Levi« wurde.
14 Ziemer, 296 f.15 Meinhold, Maleachi, 146.16 O’Brien, 37 f.; Meinhold, Maleachi, 145, 162.17 Habets, 54.
3.1 Der Levibund – Mal 2,4–8 69
Für ein so allgemeines Verständnis des Begriffsursprungs sprechen auch diedrei Erwähnungen des »Salzbundes«, in deren Kontext es um die privilegrecht-liche18 Stellung des Kultpersonales geht.19 Da die Priester keinen Anteil amLand haben, müssen die für sie bestimmten Anteile am Opfer und Abgabenfestgelegt sein – und zwar »als ewige Satzung« (� �� ��� � �� �� �� �� �� � �� ���#� "� �leh. åq-�ôlam berît mælah. �ôlam Num 18,19). Auch hier ist aber schon eine ri-tuelle Vergegenwärtigung dieser Vorstellung gedacht, die im fortwährenden»Salzen« der Opfer (Lev 2,13) besteht.
In den semantischen Zusammenhang von Priesterprivilegien weisen auchandere alttestamentliche Formulierungen. Zum einen – um den Begriff »Sat-
zung« ��� h. oq aus Num 18 aufzugreifen – ist Gen 47,22 zu nennen, wo
den Priestern in Ägypten eine bestimmte Versorgung durch den Pharao zu-steht. Dieser Anspruch wird als »eine Satzung für die Priester vom Pharao«��� � �� � �� �� ��� �� ��$ �� ��� h. oq lakkohanîm me�et par�oh bezeichnet.
Nach Dtn 18,3 besteht ein vergleichbarer Anspruch israelitischer Priesternicht gegenüber dem König, sondern gegenüber dem Volk, konkret gegenüberden Opfernden: »Das soll das Recht der Priester gegenüber dem Volk, denSchlachtopfer Darbringenden, sein . . . « � �� �� � �� �� ��� �� ��$ �� � �� �� �� ��� ��� �� � ���� �� � �� �� � �� �� zæh yihyæh mišpat. hakkohanîm me�et ha�am me�et zobeh. êhazzæbah. . Danach werden die den Priestern zustehenden Opferanteile auf-gezählt.
Fast dieselbe Formulierung begegnet in einem schwierigeren Kontext1 Sam 2,13, wo es auch um priesterliche Anteile an Opfern geht. »Und dasRecht/die Praxis der Priester mit dem Volk, jedem Opfer Darbringenden«� ��� �� ��� ��� ��#� "�$ � �� �� � �� ��� �� ��$ �� � �� �� ���� ûmišpat. hakkohanîm �et ha�amkål-�îš zobeah. zæbah. . In 1 Sam 2 bestehen enge Bezüge zu Dtn 18,1–6. Da-her ist eine literarische Bezugnahme auf diese Stelle wahrscheinlich. Nur wirddie Vorstellung eines Sonderrechts im Zusammenhang mit den Eliden negativdargestellt.20
Ein spezielles Verhältnis zwischen Gott und dem ganzen Stamm Levi wirdgreifbar im Dtn (besonders 10,8; 18,1–8). Eine klassisch gewordene Auffassungsieht hier das Konzept der josianischen Reform zugrundegelegt, das allen Le-viten das Recht einräumt, am Jerusalemer Tempel Dienst zu tun.21 Besondersinfolge der Dissertation von Ulrich Dahmen wird in den letzten Jahren öf-ter angenommen, es ließe sich wenigstens eine spät- oder nachdeuteronomi-stische Redaktionsschicht ausmachen, die die Levitisierung des Priestertums
18 Gertz.19 Vgl. zum Salzbund allgemein Seebass, Numeri II, 233.20 Siehe unten S. 76.21 Wellhausen, Prolegomena, 152; Nelson, 8; Schaper, Priester und Leviten, 89.
70 3 Die Bundestradition
propagiert, bzw. die Stellung der Leviten im Kult stärken will.22 Unabhängigdavon, welche Lösung man vorzieht, läßt sich wahrscheinlich machen, daßdiese – evtl. bearbeitete – Fassung des Dtn auf den besprochenen Maleachi-text Einfluß hatte, bzw. mit ihm in Zusammenhang steht. Insbesondere derLevisegen in Dtn 33,8–11 kann die Vorstellung von Mal 2,4–8 über einen BundGottes mit Levi angeregt haben.23
Wichtig ist an dieser Stelle, daß »der Bund des Leviten« von Mal 2,8 ausdem gleichen Zusammenhang stammt, der auch mit »dem Recht/der Satzungder/für die Priester« bezeichnet wird, und in den auch der »Salzbund« gehört,– die rechtliche und soziale Sonderstellung des Kultpersonals.
3.1.2 Mal 2,4 – ein syntaktisches Problem
Um den Levibund in Mal 2,4–8 inhaltlich besser fassen zu können, ist dieFrage zu klären, wie er syntaktisch in den Versen 1–9 eingegliedert ist. Zumeinen gibt es in V. 5 eine Art Inhaltsangabe des Bundes:
Mein »Bund« war mit ihm, das Leben und das Heil,und ich gab sie ihm,
Furcht, und er fürchtete mich.Und vor meinem Namen erschauerte er.
Mit einer AK-Form des Verbes ��� hyh werden im Rückblick auf das Ver-hältnis zwischen Gott und dem Ahnvater Zuwendungen und Gaben Gottesbeschrieben, die Levi zum Teil erst zu diesem Gottesverhältnis befähigen24.
Zum andern haben die Priester durch ihr Fehlverhalten den »Bund« un-brauchbar gemacht (V. 8). Gottes Antwort besteht deshalb auch darin, die –schon unbrauchbar gewordenen – Gaben in ihr Gegenteil zu verkehren. InV. 2 verflucht er die »Segnungen«25 der Priester.26
So deutet sich ein enger Zusammenhang zwischen Bundesbruch und Stra-fe an. Wie genau beides miteinander in Verbindung stehen soll, hängt aber ander Interpretation des V. 4:
Und ihr werdet erkennen, daß ich euch diesen Strafbeschluß geschickt habe, daß ermein »Bund« mit Levi sei,spricht der Herr Zebaoth.
22 Dahmen, Ulrich, Leviten und Priester im Deuteronomium, Bodenheim: Philo 1996;Achenbach, Levitische Priester; Otto, Levitisierung.
23 Siehe dazu weiter unten S. 75.24 Habets, 47, spricht von »Indikativ und Imperativ«.25 Zu aktivem oder passivem Verständnis des Begriffes siehe O’Brien, 32 f.26 Habets, 55; Meinhold, Maleachi, 140 f.
3.1 Der Levibund – Mal 2,4–8 71
Es besteht Konsens darüber, daß ��� � �� mis.wa hier kein Gebot bezeichnet,sondern eben den Urteilsbeschluß gegen die Priester.27 Er wird in 2,1 und 2,4deutlich parallel zum Fluch in 2,2 gegen sie gesandt.
War es für Luther durchaus möglich, das »Gebot« mit dem »Bund« zuidentifizieren, so wird es vielen Auslegern ein Problem, nun den »Urteilsbe-schluß« mit dem »Bund« gleichzusetzen. Gott kann vielleicht seinerseits denBund aufkündigen, den die Priester verdorben haben, daß aber ein neuerBund gesetzt wird, der das Urteil zum Inhalt hat, ist schwer vorstellbar.28
Die Deutungen hängen nicht zuletzt daran, welche syntaktische Funktiondas � ��� � �� lihyôt hat. Drei Einschätzungen lassen sich unterscheiden.
Zuerst kann der Inf. cs. + � l begründend übersetzt werden: »Weil icheinen Bund mit Levi habe.«29 Diese Begründung kann positiv oder negativinterpretiert werden: Dem Bund wohnt ein Mechanismus inne, daß auf Ver-gehen Strafe folgt, oder um den Bund weiterhin aufrechterhalten zu können,ist Bestrafung der Schuldigen nötig. Problematisch an dieser Lösung ist, daß
für den Inf. cs. + � l sonst keine begründende Funktion belegt ist. Allenfallshat diese Kombination eine die näheren Umstände beschreibende Funktion,was dann etwa so übersetzt werden müßte: »... wobei/indem mein Bund mitLevi besteht.«30
Wird dem Infinitiv eine finale Funktion zugeschrieben und �� �� �� berît alsSubjekt gedacht, dann kann übersetzt werden: »Damit mein Bund mit Levibestehen bleibe«.31 Solche Konstruktionen, in denen das Subjekt des Infini-tivsatzes (P2) nicht mit dem des Vorbereitungsverbes (P1)32 übereinstimmt,nennt Ernst Jenni admissionale (d. h. ermöglichende) Verknüpfung, und zählt
dazu 475 Fälle.33 Neben Mal 2,4 führt er mit ���� � �� lihyôt an: »damit mein Na-
me dort sei« � ��
� � �� �
� ���� � �� lihyôt šemî šam (1 Kön 8,16b; 2Chr 6,5b. 6a; 7,16)
und »damit Witwen ihre Beute werden« � �� �� �
� ��� �� � �� �
��� � �� lihyôt �almanôt
šelalam (Jes 10,2).34
Die dritte Möglichkeit geht ebenfalls von einer finalen Funktion des Infi-
nitivs aus, versteht aber ��� � �� mis.wah als Subjekt, �� �� �� berît als Prädikat und
27 Habets, 37; Meinhold, Maleachi, 139.28 Marti, 467.29 Ebd.; McKenzie und Wallace, 550; Habets, 37.30 Gesenius und Kautzsch, § 114 o: »Anlässe, begleitende Umstände ...«; Jenni, 155–167,
bezeichnet das als explikative Verknüpfung.31 Hitzig, 421; Elliger, 194; O’Brien, 39 f.; Meinhold, Maleachi, 72; Weyde, 173–176.
Raschi: »Ich habe Gefallen daran, daß ihr in meinem Bund bestehen bleibt« (Buch, VII,406 f).
32 Zur Terminologie siehe Jenni, 150.33 Ebd., 208.34 Ebd., 214–217.
72 3 Die Bundestradition
��� hyh in der identifizierenden Funktion der Kopula. Diese Deutung dürf-te bei Jenni einer intentionalen Verknüpfung bei Transportverben (Rubrik 728)
entsprechen, wobei er ���
� šlh. im Piel hier ausdrücklich mit aufführt.35
August Köhler hatte 1865 den »Urteilsbescheid« mit dem Bund identifi-ziert. Dabei meinte er jedoch nicht, daß ein Bund den anderen ablöst, son-dern daß – aufgrund des Bundesbruches der Priester – das Bundesverhältniszwischen Gott und den Priestern inhaltlich nun nicht mehr vom Segen, son-dern von dem Urteil her bestimmt ist. Er kann durchaus auch die Intentiondarin sehen, daß damit der Fortbestand des Levi-Bundes gewährleistet wird.36
Gottes Bund mit Levi beinhaltete die Zuwendung Gottes (V. 5a), gleich-zeitig verbürgt er die Wirksamkeit priesterlicher Handlungen. Levi – der idea-le Priester – entsprach dem in seinem Wandel (V. 5b. 6). Die angeklagten Prie-ster haben nun dieses Gottesverhältnis mißachtet, sie haben nicht acht aufGottes Ehre gegeben (V. 2a�). Dadurch haben sie schon selbst die Wirksam-keit ihrer Handlungen außer Kraft gesetzt – sie haben den Bund Levis verdor-ben (V. 8). Darauf antwortet Gott mit einem Urteil. Das Urteil ist ein Fluch(V. 1. 2. 4), in den er die Segnungen der Priester verkehrt (V. 2b). Damit setzter seine Gaben, die Inhalte des Bundes (V. 4), in ihr Gegenteil, was nun vorallem die Priester selbst trifft. Insofern ist nun der Fluch Inhalt des Bundes.Wenn dieser also mit Levi Leben und Heil »war«, so soll er jetzt der Fluch»sein«. Dem Wechsel von der Vergangenheit zur angekündigten Neubestim-mung des Bundesverhältnisses entspricht das »aber jetzt« � ��� �� � we
�attah in V. 1.Damit wird die dritte oben genannte Deutung plausibel.
Dieses Verständnis des Textes würde den Levi-Bund weniger als Vertragerscheinen lassen, dessen Bruch eine Strafe nach sich zieht. »Bund« bezeich-net vielmehr das besondere Verhältnis zwischen Gott und den Priestern. Wel-cher Aspekt an diesem Verhältnis besonders zu Tage tritt, kann variieren. DiePriester werden wegen ihres Fehlverhaltens nicht daraus entlassen, sondernmüssen im Gegenteil die volle Konsequenz dessen tragen.
3 . 2 L I T E R A R I S C H E S V E R H Ä LT N I S D E R B E L E G S T E L L E NF Ü R D E N P R I E S T E R - U N D L E V I T E N B U N D
Berührungspunkte in Wortwahl und Vorstellungen bestehen auch zwischenMal 2,4–9 und Dtn 33,8–11.37 Auch hier wird das Sonderverhältnis des Kult-personals mit der engen Gottesbeziehung eines Einzelnen (»der Mann deinerGnade/Treue«) verbunden. Besonderer Wert wird auf das Bewahren und Leh-ren von Tora gelegt. Schließlich ist auch hier von einem Bund die Rede:
35 Jenni, 197–199.36 Koehler, 77 f.37 O’Brien, 104 f.; Habets, 49; Kugler, 7.
3.2 Literarisches Verhältnis der Belegstellen 73
Dtn 33,9b Ja, sie behüteten dein Wort und deinen Bund bewahrten sie,10a sie lehren deine Rechte Jakob und deine Weisung Israel.
Aus dem Nebeneinander der beiden Parallelismen geht hervor, daß es GottesBund mit Israel ist, den die Leviten bewahren, indem sie dem Volk Weisunglehren.38 Syntaktisch gesehen ist jedoch offen, mit wem Gott einen Bund hat –als Partner kommen also auch die Leviten in Betracht. Sucht man nach einembiblischen Beleg, in dem Levi ein Bund gegeben wurde, könnte am ehestendavon gesprochen werden, daß Levi (durch Moses prophetisches Wort) dasPriestertum zugesagt wurde. Es ist aber deutlich, daß die Weiterentwicklungund Konkretisierung der Levitradition gerade von Mal 2 und Dtn 33 immerwieder beeinflußt wurde.39
Ein weiterer Text, der einen Bund mit Priestern und Leviten erwähnt, istJer 33,14–22. Von der Septuaginta nicht überliefert, scheint er ein später Textzu sein, der die Weissagung von Jer 23,5 f. aufgreift und umdeutet. Was hierInhalt des Bundes sein soll, wird durch das Nebeneinander mit dem Davids-bund deutlich. David war die ewige Dauer seiner Dynastie zugesichert worden(2 Sam 7,16). Priestern und Leviten wird die Dauerhaftigkeit des Kultes ver-sprochen, und zwar insofern, als Priester da sein werden, die ununterbrochendie täglichen Opfer vollziehen können. Der Vergleich mit David läßt an dasAmt des Hohenpriesters denken, das für die volle Funktionalität des Tempelsimmer besetzt sein muß. Außerdem bekommen sowohl David als auch dieLeviten eine Art Mehrungsverheißung.
In Bezug auf die Konstituierung des »Bundes« ist interessant, womit erverglichen wird. Die Dauerhaftigkeit der Davididendynastie wie des Priester-amtes in Frage zu stellen, sei so unrealistisch wie ein Bundesbruch Gottes inBezug auf die Regelmäßigkeit von Tag und Nacht. Falls hier überhaupt an
einen Anfangspunkt gedacht ist, dann entspräche �� �� �� berît einer Art Schöp-fungsordnung. Die neben der Zusage an die Priester und Leviten genannteBeständigkeit der Davididendynastie weist freilich auf einen Anfang hin: dieDynastieverheißung in 2 Sam 7.
Ein letzter Text des hebräischen Kanon spricht noch von einempriesterlich-levitischen Bund: Neh 13,29. Im Zusammenhang mit der Ver-schwägerung der hohenpriesterlichen Familie mit Sanballat spricht Nehemiaein Stoßgebet:
������� �� �� � � �� �� �$ �� �� �� ��� � �� �� �$ �� � ��"�"�� � �� � ���� �� � �� �� � �� $" zåkrah lahæm ælohay �al gå�
ålê hakkehunnah ûberît hakkehunnah wehallewiyyîm
38 Fuller, 36.39 Siehe unten S. 78.
74 3 Die Bundestradition
Gerade das Wort, das evtl. zu »Bund« �� �� �� berît parallel steht, � �� "�"�� gå�
ålê,
ist verschieden deutbar. Meist wird es von ��� g�l II, »beflecken«, abgelei-
tet.40 Sinn macht aber auch die Herleitung von ��� g�l I, »lösen« (z. B durch
Verwandte, vgl. »Lösungspflicht/Verwandschaft« � ��� �� �� ge�ullah).41 Nach der
ersten Herleitung müßte übersetzt werden:
Gedenke ihnen, mein Gott, der Befleckungen des Priestertums und (der Befleckun-gen) des Bundes des Priestertums und der Leviten.
Nach der zweiten könnte es lauten:
Gedenke ihnen, mein Gott, der Lösungen des Priestertums und (gedenke) des Bundesdes Priestertums und der Leviten.
Im ersten Fall ist es ein strafendes Gedenken, im zweiten ein bewahrendes.Zwei Beobachtungen machen die zweite Deutung plausibler:
� Im Kontext geht es um die Frage, welche Verwandtschaftsbeziehungen(besonders für Priester) legitim sind.
� Die erste Variante weist eine sehr lange Kette von constructus-Verbindungen auf.42 Das ist nicht ausgeschlossen,43 aber die Möglich-
keit � �� "�"�� gå�
ålê und �� �� �� berît parallel zu setzen, ist plausibel. Nomenrectum ist dann in beiden Fällen »Priestertum«.
Da nach der zweiten Lesart »Lösungen« parallel zu »Bund« steht, bezeichnetder Ausdruck wahrscheinlich Sonderrechte der Priester und Leviten. Beschrie-ben sind solche Sonderrechte mit dem Begriff � ��� �� �� ge
�ullah in Lev 25,32–34. Dort geht es um bleibendes Rückkaufsrecht. Auf Neh 13,29 bezogen, be-schreibt »Lösungen« mit Verwandtschaft zusammenhängende Sonderrechtevon Priestern und Leviten. Sowohl diese Sonderrechte als auch der Priester-und Levitenbund sind offenbar durch das Handeln der Priester in Neh 13 inGefahr gebracht worden.
Sind die angeführten Texte voneinander unabhängige Zeugen einer priester-lichen Bundestradition oder bauen sie aufeinander auf und sind voneinanderliterarisch abhängig? Die begrifflichen Übereinstimmungen liegen, wie oben
40 Rudolph, Esra und Nehemia, 210.41 Vgl. Septuaginta ��� ����� – »Verwandtschaft/Erbfolgerecht«. Bei Bowman, 819 als Alter-
native angegeben.42 Als Problem sieht das Ackroyd, 319 f.43 Gesenius und Kautzsch, § 182a.
3.2 Literarisches Verhältnis der Belegstellen 75
angedeutet, von Mal 2,4–9 auf Dtn 33,8–11 und Num 25 vor. Helmut Utz-schneider und, ihm folgend, Ernst Haag haben solche literarischen Beziehun-gen für wahrscheinlich erklärt.44 Gerade die Beziehung von Mal 2 zu Num 25haben jedoch Steven L. McKenzie und Howard N. Wallace für unwahrschein-lich gehalten.45 Wie auch bei den anderen oben angeführten Texten differier-ten die Inhalte zu stark. Arndt Meinhold hält eine literarische Abhängigkeitdes Maleachitextes von Dtn 33,8–11 bei einer Spätdatierung dieses Textes nachUlrich Dahmen46 für eher unwahrscheinlich und nimmt einen traditionsge-schichtlichen Zusammenhang an.47 Karl William Weyde hat eine Übersichtüber die Lösungsversuche erarbeitet,48 von denen die einen von literarischenAbhängigkeiten ausgehen – mit unterschiedlichen Abhängigkeiten – und an-dere eine den Texten gemeinsame Tradition annehmen.
Oben wurde jedoch gezeigt, daß begriffs- bzw. traditionsgeschichtlich einsachlicher Zusammenhang zwischen den Texten besteht. Es ist wahrschein-lich, daß der Levispruch Dtn 33,8–11 unter Priestern und Leviten bekannt warund daher die Traditionsbildung beflügelt hat. Darauf nimmt Mal 2,4–9 Be-zug. Zwischen Mal 2 und Num 25 gibt es relativ viele Übereinstimmungen,obwohl die inhaltlichen Unterschiede groß sind. Entweder setzen beide ähn-liche Bundesvorstellungen voraus, womit ein bestimmtes Wortfeld benutztwerden kann, oder ein Text spielt kritisierend auf den anderen an. Malea-chi würde dann entweder dem Pinhasbund einen Levibund entgegensetzen.Oder Num 25 nähme, wie oben angenommen, den levitischen Anspruch aufund beansprucht ihn für die Priester.
Julia M. O’Brien hat sehr ausführlich diskutiert, welche Quellen Maleachivoraussetzt. Obwohl dabei die Beziehungen zu Num 25 über die allgemeinesprachliche Nähe von Mal zu P und Dtn hinausgingen, seien die gemein-samen Formulierungen nicht an den beiden Stellen einzigartig, sondern lie-ßen sich auch mit Formulierungen in anderen Bundestexten vergleichen (z. B.Gen 17,19).49
Demnach sollte man auch für diese beiden Texte nur einen traditions-geschichtlichen Zusammenhang annehmen. Pinhas ist dann nicht das Ge-genbild zu Levi oder umgekehrt. Mal 2,4. 8 interpretiert vielmehr den obenbeschriebenen allgemeinen Begriff vom »Bund des Leviten / des Priestertumsund der Leviten«, indem der Singular ��� �� lewî auf den Patriarchen bezogenwird, wie in Maleachi auch auf andere Personen verschiedener Traditionen(Jakob, Esau, Mose, Elia) zurückgegriffen wird.
44 Utzschneider, 64–74; Haag. So auch Kugler, 7. 18–22.45 McKenzie und Wallace, 550.46 Dahmen, 200 f.47 Meinhold, Maleachi, 147.48 Weyde, 176–180.49 O’Brien, 105 f.
76 3 Die Bundestradition
3 . 3 D I E P R I E S T E RT U M S G A B E
Die Vorstellung von einem Priester- bzw. Levitenbund ist nach den voran-gegangenen Überlegungen aus dem allgemeinen Sachverhalt der Sonderstel-lung des Kultpersonals ableitbar. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf derBeständigkeit und Reinheit der priesterlichen Verwandtschaftsbeziehungen.Es besteht daher ein sachlicher Zusammenhang zu Vorstellungen von der Er-wähltheit des Stammes Levi bzw. einzelner priesterlicher Familien zum Prie-sterdienst, auch wenn nicht von einem »Bund« die Rede ist.
Vom Gesamteindruck des Pentateuch her würde man solche Aussagen vorallem über Aaron erwarten. Doch ist der Befund eher spärlich: In Ps 105,26bfindet man eine knappe Erwählungsaussage zu Aaron. Im Sinai-Wüsten-Zusammenhang wirkt die Einsetzung Aarons und seiner Söhne in ihre Ämteretwas mechanisch. Am ehesten stellt der Erzählzusammenhang von Num 16–18 eine solche besondere Erwählung Aarons heraus. Das wird jedoch geradedurch die Hervorhebung des Pinhas in Num 25,8 f. in den Schatten gestellt.Wichtige Aussagen von Dtn 33,8–11 könnten sich auch auf Aaron beziehen, ge-nannt ist aber Levi, und gedacht werden kann dort ebensogut an Mose. Nebenden besprochenen weitreichenden Aussagen über Levi, finden sich knappe Er-wähltheitsnotizen im Dtn (10,8 f.; vgl. 31,25 f.). Die zentrale Stelle zum Themaim Dtn spricht zwar auch vom Stamm Levi, die Erwählung gilt jedoch demPriester, wobei umstritten ist, ob im Dtn beide Größen übereinstimmen:50
. . . dem Priester . . . denn ihn hat er erwählt . . . Dtn 18,3–5
3.3.1 Die elidische Erwählungstradition
1 Sam 2–3 bietet ein bemerkenswertes biblisches Beispiel für eine priesterlicheErwählungsaussage – allerdings unter negativem Vorzeichen. Denn hier wirdder auf Dauer angelegten Verheißung eine Absage erteilt. Da von 1Kön 2,26 f.her deutlich wird, daß zadokidische Interessen dahinterstehen,51 steht die Fra-ge, wer das Gegenüber ist, das kritisiert wird, dem aber auch zugestandenwird, einst das ausgewählte Priestertum gewesen zu sein. Mit der behaupte-ten Offenbarung an den Ahn in Ägypten (1 Sam 2,27) geht diese priesterlicheErwähltheitsvorstellung am weitesten.
Dazu wird deutlich auf Dtn 18,1–8 Bezug genommen. Das Vaterhaus Elissei wie Dtn 18,5 ausgewählt (vgl. auch die »Feuer« – 1 Sam 2,28b). Was aberin Dtn 18,3–5 als das Priesterrecht beschrieben ist, wird von den Söhnen Elis
50 Dahmen, 396–398; Achenbach, Levitische Priester; Otto, Levitisierung.51 Vgl. dagegen Tsevat, 193–195, der diesen Zusammenhang erst in den jüngeren Versen
1 Sam 2,34–36 sieht.
3.3 Priestertumsgabe 77
pervertiert. Auch dort wird von der Auswahl eines Stammes gesprochen. NachDtn 18,1. 6–8 ist damit der ganze Stamm Levi gemeint, der insgesamt denPriesterdienst versieht. 1 Sam 2,27–30 wird von einer Selbstoffenbarung Gottesgesprochen, von der Beauftragung mit Brandopfer, Rauchopfer, Ephodtragenund allgemein »allen Feuern Israels«. Diese Sonderstellung war »für immer«(V. 30) versprochen, wird aber doch zurückgenommen.
Wer ist also der Ahn in Ägypten? Nach den priesterlichen Texten ist Aarondas Priestertum am Sinai gegeben worden. 1Chr 24,2 läßt Zadok dem glei-chen »Vaterhaus« zugehörig sein. Zadok wird aber der »treue Priester« sein,der die elidische Linie ersetzen wird! 1 Sam 2,28 berichtet, daß dieses Vater-haus Elis »aus allen Stämmen Israels« ausgewählt wurde. »Vaterhaus« � �� �� ���bêt �ab bezeichnet normalerweise keinen ganzen Stamm. Daher meint Rein-hard Achenbach, hier sei nicht vom ganzen Stamm Levi gesprochen, sondernes wird aus ganz Israel eine Familie erwählt, nämlich die Aaroniden.52 Al-lerdings wird auch in Jos 22,14 »Vaterhaus« gleichbedeutend neben »Stamm«genannt. Daher kann 1 Sam 2,28 auch den ganzen Stamm Levi meinen.
Verschiedene historische Schlüsse sind daraus gezogen worden: Geht manvon einer vorexilisch im Nordreichskult amtierenden Aaroniden-Priesterschaftaus, dann kann nach deren Ende gegen Aaron und gegen die Exodusrückbin-dung dieses Staatskultes polemisiert werden.53 Da der Text aber deuterono-mistische und priesterliche Charakteristika aufweist, wird er oft entsprechendspät datiert. Levi könnte schon als Vorfahre Aarons gelten, und ihm wird hierdie Offenbarung in Ägypten zugeschlagen.54 Hinter der literarisch basiertenDatierung kann eine ältere Überlieferung der Priester in Silo vermutet wer-den, die – gestützt durch die ägyptischen Personennamen – eine eigene, jetztnur noch schwer greifbare Form hat.55
Da weiter unten Argumente gegen die Konstruktion einer aaronidischenPriesterschaft in Bethel dargeboten werden, legt es sich hier nahe, statt voneiner antiaaronidischen von einer antilevitischen Tendenz auszugehen. Dievorgestellte Berufung des Ahn in Ägypten kann dann sowohl auf Levi als auchauf Mose bezogen gedacht sein.
3.3.2 Die priesterliche Levi-Tradition
Die göttliche Erwählung zum Priestertum durch Offenbarung, wie sie ElisAhn zuteilgeworden ist, hat enge inhaltliche Bezüge zu Vorstellungen in derpseudepigraphischen Literatur. Eben von Levi (also einem potentiellen AhnElis) wird im aramäischen Levi-Dokument, im Jubiläenbuch und im Testa-
52 Achenbach, Levitische Priester, 302 f.53 Stolz, 36.54 Hentschel, 56 f.55 Stoebe, 120.
78 3 Die Bundestradition
ment Levis unter anderem von seiner göttlichen Berufung und Einsetzungzum Priesteramt gesprochen.56 Allerdings ist der Ort der Offenbarung nichtÄgypten wie in 1 Sam 2,27, sondern Palästina. Diesen nachbiblischen Textengeht es verständlicherweise auch nicht mehr um die Frage, wer der Ahn Elissein könnte. Der biblische Text, der viel stärker diese Tradition beeinflußt hat,ist Mal 2, in dem Levi zum idealen Priester stilisiert ist. James Kugel hat aus-führlich herausgearbeitet, wie stark sich diese Tradition aus biblischen Textenableiten lasse, wobei er enge Beziehungen zu midraschischen Erörterungenaufzeigt.57 Einerseits erscheint dadurch diese priesterliche Levi-Tradition als li-terarische Rezeption der biblischen Texte. Andererseits stellen die verschiede-nen Bibeltextbezüge Begründungen dieser Tradition im Nachhinein dar. DieTradition allein als Textrezeption zu erklären, ist nicht plausibel. Die Sonder-stellung der Leviten lag immer deutlich vor Augen. Daher wird auch die Vor-stellung von der Aussonderung Levis – unabhängig von oder in Korrelationmit dem Maleachitext – weiterbestanden haben.
3 . 4 FA Z I T
Das aufgeführte Material hat gezeigt, daß sowohl zeitlich als auch thema-tisch in relativ weit voneinander entfernt stehenden Texten Elemente zweiermiteinander in Beziehung stehender Vorstellungen auftreten, und daher derpriesterlich-levitische Bund und die Vergabe des priesterlichen Amtes als be-stehende Traditionen festgestellt werden können. Sie umfassen das Motiv derpriesterlichen Privilegien und können auch verschiedene Facetten eines prie-sterlichen Idealtypus beinhalten.
Die Polemik gegen die Eliden spielt auf eine levitische Erwähltheitsvorstel-lung an. Auch in der außerbiblischen priesterlichen Levi-Tradition wird überOrt, Zeitpunkt und Inhalt einer Aussonderung Levis zum Priestertum speku-liert. Obwohl das von biblischen Texten abhängig ist, bezeugt sie das gleicheBedürfnis nach einer historisierenden Legitimation. Die Vorstellung von derErwählung Elis in Ägypten ist, da sie ja diskreditiert war, nicht weitergeführtworden.
56 Kugel; Kugler.57 Kugel, 2–35. Terbuyken hat auf die Differenzen zwischen priesterlicher Levi-Tradition
und dem rabbinischen Levibild hingewiesen.
4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
Während Num 25 ausführlich über Pinhas spricht und ihn in den Mittel-punkt stellt, folgt nun die Behandlung einer Reihe von Texten, in denen Pin-has unerwartet auftritt, ohne daß er wirklich tragende Rollen einnimmt. InJos 22 führt er zwar die Verhandlung und fällt die Entscheidung, doch an sei-ner Stelle könnte leicht auch jemand anderes auftreten. Die Nennung seinesNamens wirkt in allen diesen Texten eher zufällig. Anzunehmen ist jedochkein blinder Zufall. Die Autoren werden Gründe haben, Pinhas jeweils auf-treten zu lassen. Ein gemeinsames Motiv läßt sich schon benennen: Alle Textebeschreiben Israel als funktionierenden Stämmebund. Zentrale Führerfigurentreten, soweit vorhanden, zurück. Bedrohungen von außen und innen werdendurch gemeinsame Aktionen bewältigt. Der Stämmebund tritt so aktionsfä-hig auf, als sei Israel noch nicht seßhaft geworden, sondern wie während desWüstenaufenthaltes im Lager nahe beieinander. Beispielhaft wird vorgeführt,wie Krieg geführt, der Bann vollstreckt und die Beute geteilt wird (Num 31),wie innerhalb des Stämmebundes Vorschriften kontrolliert (Jos 22) und Ver-stöße geahndet (Ri 20 f.) werden. Explizit wird auf Pinhas’ Stellung in derLagerordnung in 1Chr 9,17–20 Bezug genommen. Auch die Erweiterung derSeptuaginta in Jos 24,33 thematisiert, wie das Ladeheiligtum auch nach derSeßhaftwerdung zentrales Heiligtum bleiben konnte – es wechselte regelmä-ßig seinen Standort. Dieser letzte Text soll jedoch in einem eigenen Kapitelbehandelt werden.
Während Pinhas in Num 31 und Ri 20 sekundär eingetragen ist, gehörter in Jos 22,9–34 zur Hauptschicht des Textes. Daher wird dieser letzte Textausführlicher besprochen als die beiden ersten. Der Name Pinhas dient dazu,diese drei Kapitel und die zugehörigen Bücher miteinander zu verknüpfen.1Chr 9,17–20 gehört in einen vergleichbaren thematischen Zusammenhang,hängt aber literarisch nicht so eng mit den drei vorher genannten Texten zu-sammen, sondern rezipiert eher das von ihnen gestaltete Bild.
4 . 1 D E R M I D I A N I T E R K R I E G – N U M 3 1
Es hat sich schon gezeigt, daß die literarischen Zusammenhänge von Num 31zu seinem Kontext für traditionsgeschichtliche Fragen eine wichtige Rollespielen. Insbesondere wurde der Bezug auf Pinhas und Bileam untersucht.Num 31 beginnt mit der Aufforderung, an Midian Rache zu nehmen, undwird fortgeführt »danach wirst du dich zu deinem Volk versammeln«. Wäh-
80 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
rend im vorliegenden Kontext die Aufforderung zum Midianiterkrieg an dasEnde von Num 25 (V. 14–18) anzuknüpfen scheint, setzt Gottes Ankündigungvon Moses Tod wahrscheinlich Num 27,12–14 voraus.
Der Krieg gegen Midian wird, angesichts der Länge des Kapitels, nur sehrkurz geschildert. Man bekommt den Eindruck, als ginge es nur darum, andiesem Beispiel zu zeigen, welche Bestimmungen zur Vor- und Nachberei-tung eines Krieges einzuhalten seien. Kultisches – priesterschriftliches – Inter-esse1 und radikale deuteronomistische Kriegsideologie sind miteinander ver-bunden.2 Der Wortschatz, mit dem der Krieg beschrieben wird, weist über-raschend viele Übereinstimmungen mit Gen 34,25–29 auf (die Söhne Jakobsrächen sich an Sichem für ihre Schwester).
� »und sie töteten alles Männliche« (Gen 34,25b/Num 31,7b)
� »und den/die . . . töteten sie mit dem/durch das Schwert« (Gen34,26a/Num 31,8)
� »über die Durchbohrten/ihre Durchbohrten« (Gen 34,27/Num 31,8)
� »und all ihre Herrlichkeit und all ihre kleinen Kinder und ihre Frau-en nahmen sie gefangen und raubten alles, was im Hause war.«(Gen 34,29)/»Und die Israeliten nahmen die Frauen Midians gefangen und ihre klei-nen Kinder und all ihr Vieh und all ihren Besitz und all ihre Herrlich-keit raubten sie.« (Num 31,9)
Diese Übereinstimmungen erklären sich aus dem sachlichen Zusammenhangdes Beutemachens, der beide Stellen miteinander verbindet.3
Obwohl Pinhas den Krieg anführt, wird er doch nur an einer Stelle er-wähnt. In Num 31,6 trägt er die heiligen Geräte und die Trompeten mit in dieSchlacht. Genaugenommen ist er nicht der Anführer im Krieg, sondern hatoffenbar allein diese quasi kultische Funktion. Er wird mit den Tausendschaf-ten in den Krieg geschickt. Daß er und nicht Eleasar geht, hängt vielleichtdamit zusammen, daß Eleasar als oberster Priester nicht durch Umgang mitToten kultunfähig gemacht werden soll.
Es ist zu überlegen, ob Pinhas hier erst sekundär eingefügt wurde. SeineNennung ist eingeschlossen durch zwei Wortwiederholungen – möglicherwei-se ein Hinweis darauf, daß eingefügter Text eingebunden werden soll.
1 Staubli, 330 f.2 Lohfink, Schichten, 107.3 Vgl. Elgavish. Inhaltliche Zusammenhänge zwischen Gen 34 und Num 25 sieht Sivan,
73 f.
4.1 Der Midianiterkrieg 81
Und es sandte sie Mose, tausend je Stamm, zum Kriegsdienst, sie und Pinhas, denSohn Eleasars, des Priesters, zum Kriegsdienst, und die heiligen Geräte und die Kriegs-trompeten waren in seiner Hand. Num 31,6
Da sich der Singular »in seiner Hand« auf Pinhas bezieht, müßte eine literar-kritische Trennung von zwei sekundär angefügten Aussagen ausgehen, diedurch die beiden wiederholten Begriffe verklammert sind. Als erste Schichtbliebe allein übrig:
Und es sandte sie Mose, tausend je Stamm, zum Kriegsdienst.
Das wäre einfach die Ausführung des vorher Befohlenen. Der Text der Septua-ginta legt eine andere Lösung nahe. Dort heißt es nämlich »in ihren Händen«– nur die Nennung des Pinhas könnte sekundär sein und wäre durch die Be-merkung über die heiligen Geräte motiviert.
Und es sandte sie Mose, tausend aus einem Stamm, tausend aus einem Stamm, mitihrer Macht, [und Pinhas, den Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters,] unddie heiligen Geräte und die Signaltrompeten waren in ihren Händen.
Allerdings fehlen in der griechischen Fassung die oben genannten Wortwie-derholungen, die die literarkritische Entscheidung begründeten. Das zweiteMal »zum Kriegsdienst« fehlt ganz. An der ersten Stelle ist ». . . zum Kriegs-
dienst, sie . . . « (��� ���� ls.b� �tm) zu einem Wort zusammengezogen: »mitihrer Macht«, womit regelmäßig der hebräische Ausdruck ������ ls.b�tmübersetzt ist. Die Septuaginta-Fassung läßt sich also als eine Glättung derSyntax auffassen. Dann ist aber auch die Differenz am Versschluß eher alseine inhaltliche »Verbesserung« zu erklären, etwa in dem Sinne, daß Pinhas jasicherlich nicht allein die Geräte und die Trompeten getragen hat.
Da sowohl Pinhas als auch die Trompeten im Fortgang nicht mehr ge-nannt werden, werden beide Aussagen hinzugefügt sein, die zweite, um mitNum 10,9 zu verbinden, die erste, um den Bezug zu Num 25 auszubauen,der schon durch Num 31,16 besteht. Num 31,16, wo bereits die Plage vonNum 25,8 f. vorausgesetzt ist, fügt sich ohne Probleme in seinen Kontext undgehört damit zum Grundbestand von Num 31.
Die Benutzung der Trompeten im Krieg wird in Num 10,9 gefordert. Vor-ausgesetzt ist hier offenbar die Vorstellung der genauen Marschordnung desLagers von Num 1–4 und 10,1–10. Dort wird der Transport der heiligen Ge-räte den Leviten unter der Aufsichts Eleasars übertragen (Num 3 f.), hier –nachdem Eleasar Aaron nach dessen Tod in seinem Amt abgelöst hat – sindsie in der Hand des Pinhas.
Der Bezug zu Num 10,9 wird noch deutlicher, wenn dort auch wie inNum 25,16 »anfeinden« ��� s.rr als zentraler Begriff erscheint. Die klangli-
che Nähe zu »Trompeten« ���� �
���� h.
as.os.erôt ist bewußtes Gestaltungsmittel.
82 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
Die Überleitung von Num 25 nach Num 31 durch 25,14–18 liegt also auf dergleichen literarischen Ebene wie die Nennung des Pinhas in 31,6. Der Bezugauf Num 25 mit der Rache an Midian in 31,1 und der Erwähnung von Frau-en, Bileam, Peor und Plage in 31,16 gehört dagegen zum Grundbestand vonKapitel 31. Damit stellt sich die Frage, ob 25,5–19 verschiedenen literarischenSchichten zugeordnet werden muß. Wenn Kapitel 31 den Anfang dieses Ab-schnittes mit der Nennung der Plage voraussetzt, die Überleitung dorthin amEnde von 25 aber auf der gleichen Ebene wie der Zusatz 31,6b liegt, dann müs-sen zwei Schichten angenommen werden. Als Kriterium bietet sich an, daßdie Überleitung das Geschehen bei Peor nun in Midian ansiedelt, während25,5 ff. durchaus im Kontext von Moab verstanden werden kann. Die Grenzezwischen beiden Schichten läßt sich zwischen V. 13 und 14 ziehen, denn letz-terer interpretiert die einzelne Midianiterin als Repräsentantin ihres Volkes,was bis V. 13 noch nicht angenommen werden muß. Auch der Grundbestandvon Kapitel 31 setzt schon eine Deutung von 25,1–13 im Sinne der späterenFortführung voraus, als werde von Anfang an von Midian gesprochen. DerVatersname Kosbis »Zur«, der in Num 31,8 wieder auftaucht, gehört also nichtzu den rückverweisenden Elementen in Num 31, sondern ist umgekehrt derAnknüpfungspunkt für die Namensgebung in Num 25,15.4
Daraus und aus dem zu Num 25 Besprochenen wird also folgende relativechronologische Ordnung wahrscheinlich: 1) Num 25,1–4; 2) 25,5–13. 19; 3) 31*;4) 25,14–18; 31,6b.
Ein Problem der Interpretation in Num 31 stellt die Unterscheidung vonJungfrauen und dem Rest der Gefangenen dar. Während die Kriegführendenalle erwachsenen Männer, also potenzielle militärische Gegener, töteten undFrauen und Kinder als Beute nahmen, werden sie für letzteres von Mose ge-scholten, weil dieser Wert auf ethnische Abgrenzung legt. Das sei aber gerademit den midianitischen Frauen nicht zu machen, die ja auch für den Abfallzum Baal Peor verantwortlich seien. Diese Begründung deckt sich dann abernicht mit den Ausführungsbestimmungen, denn er läßt auch die männlichenKinder töten, die weiblichen aber, nämlich die Jungfrauen, nicht. Susan Ni-ditch hat unter Heranziehung ethnologischen Vergleichsmaterials diese Diffe-renzierung damit begründet, daß Jungfrauen in ihrer Gruppenzugehörigkeitnoch nicht festgelegt sind, sondern erst durch die Heirat eindeutig zugeord-net werden.5 Es stellt sich daher die Frage, ob der Rückbezug auf Peor eineranderen Schicht als diese Ausführungsbestimmung angehört, oder ob Num 31den Peor-Vorfall so interpretiert, daß die Israeliten in Num 25 mit Frauen mi-dianitischer Männer »Hurerei« betrieben hätten. Insbesondere »die Midiani-terin« Kosbi könnte unter diesem Verstehenshorizont keine Jungfrau gewesensein, was aber die schichtinterne Interpretation einer Anspielung auf Mose
4 Vgl. Knauf, Midian, 164. Dagegen: Seebass, Zu Numeri 25,1–18, 352.5 Niditch, 50–53.
4.2 Vorsteher der Tür- und Schwellenhüter 83
und Zippora erst einmal nahe legen würde. Die Spannung liegt nicht zwi-schen Num 31,16 und 17, sondern zwischen Kapitel 25,1–13 und Num 31. DerRückbezug auf den Abfall zum Peor hat die literarische Funktion, eine Be-stimmung zu begründen, nach der nur jungfräuliche Mädchen leben gelassenwerden. Die Bestimmung besteht schon und leitet sich nicht erst aus Num 25ab. Insofern muß hier keine literarische Spannung innerhalb von Num 31 ge-sehen werden.
4 . 2 VO R S T E H E R D E R T Ü R - U N D S C H W E L L E N H Ü T E R– 1 C H R 9 , 2 0
Den Bezug auf die Lagerordnung des ersten Teils des Numeribuches hatNum 31,6 gemein mit einem anderen Pinhas-Text: 1Chr 9,14–34. Hier gehtes um Leviten und zu einem großen Teil um Türhüter, die – genealogischals Korachiter eingeordnet – als Leviten verstanden werden. Ihre Funktion alsSchwellenhüter wird in V. 19 unter Rückbezug auf die Verhältnisse unter ih-
ren Vätern im »Lager des Herrn« ’� �� �� �� mah.aneh yhwh legitimiert. Was
genau damit gemeint ist, bleibt offen. Daß damit auf das Lager der Wüsten-zeit Bezug genommen ist, wird wahrscheinlich aus der Erwähnung der »Lagerder Leviten« in V. 18, was am besten aus Num 1,48–53 erklärbar ist: Die Levi-ten bildeten mit ihren Lagern einen Ring um das Heiligtum, das von ihnenauch getragen wurde.6 Zu recht hat Sara Japhet darauf hingewiesen, daß diehier verwendete Terminologie die Zeitebenen, von denen gesprochen wird,nicht konsequent trennt – wahrscheinlich um gerade auf Kontinuität Wert zulegen.7
Ein ebensolcher Rückbezug ist auch die Erwähnung des Pinhas als Aufse-her ihrer Vorfahren in 1Chr 9,20. Das könnte ebenfalls daran denken lassen,daß Pinhas seinen Vater im Amt des Aufsehers über die Leviten abgelöst hat(Num 3,32). Genaugenommen wird Pinhas hier aber nur über die korachiti-schen Schwellenhüter gesetzt.
Eine relativ weitgehende Aussage über Pinhas ist hier, daß der Herrmit ihm gewesen sei. Der masoretische Text scheint die ursprünglicheForm darzustellen: »Fürst war er über sie damals – der Herr mit ihm«�� �� �� ���� ��� � � � ��� ���� ��� �� ����� nagîd hayah �
alêhæm lepanîm jhwh �immô.Der Vaticanus hat – evtl. aus hermeneutischen Vorbehalten – statt des Te-tragrammes das Personalpronomen der 3. m. Pl. »Fürst war er über sie damalsund sie mit ihm« � ������ �� ��� ����� �������� ��� ����� ����
�����, hat also wahrscheinlich »und sie mit ihm« ��� ��� wehæm �immôstatt »der Herr mit ihm« ��� ’� yhwh �immô gelesen. Mit einer einfachen
6 Vgl. K. H. Graf, 232.7 Japhet, 225.
84 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
Verschreibung allein ist das nicht zu erklären. Aber welchen Sinn hat dieAussage, daß die ihm Untergebenen mit ihm waren? Evtl. störte den Über-setzer die große Nähe zu Gott. Alexandrinus und der Rest der Septuaginta-Überlieferung scheinen wieder mit dem masoretischen Text ausgeglichen zuhaben, indem der fehlende Gottesname zusätzlich eingefügt wurde: »vor demHerrn, und sie mit ihm« �������� ��� ���� ��� ����� ���� �����.
Für das zeitlich verstandene »früher« ��� � � lepanîm spricht der Kontext,in dem es um den Rückbezug auf die Vorgeschichte geht. Die Aussage, daßGott mit einer Person ist, findet sich häufiger (Gen 39,2 f. 21; Num 23,21;2Chr 36,23). Am nächsten zu der Aussage über Pinhas steht 1Chr 11,9: »UndDavid wurde immer mächtiger, und der Herr Zebaot war mit ihm.« In derVorlage 2 Sam 5,10 heißt es ausführlicher: »und der Herr der Gott Zebaot warmit ihm.« Es ist wahrscheinlich, daß die Formulierung zu Pinhas von dieserFormulierung über David inspiriert ist.
Was an 1Chr 9,20 traditionsgeschichtlich interessant ist, ist einerseits dieArt, wie Pinhas hervorgehoben ist. Sie könnte mit der Bundestradition zu-sammenhängen oder auf Num 25 anspielen. Der Text scheint aber auch auf-schlußreich für eine evtl. anzunehmende Trägergruppe zu sein: Während sichaus dem Bezug auf die Oberaufsicht Eleasars über alle Leviten bzw. über dieKehatiter die entsprechende Position des Pinhas als seines Nachfolgers ablei-ten läßt, ergibt sich daraus nicht die Einschränkung auf die kleinere Gruppeder Türhüter bzw. der Korachiter. Hier liegt evtl. eine speziellere Verbindungeiner solchen Gruppe zu Pinhas vor.8 Besonders bemerkenswert ist dabei, daßdie Funktion des Pinhas in der Vergangenheit offenbar von einem Glied derGruppe selbst übernommen wird: Schallum, »ihr Bruder«, ist nun ihr »Haupt«(V. 17).
Jedoch sind auch diese Indizien auf der Ebene intertextueller Beziehungenerklärbar. Daß Pinhas zum Aufseher der Schwellenhüter erklärt wird, ist evtl.aus Num 25,6 f. abgeleitet, wo er – wenigstens von der Verteilung im Text her– sehr nahe am »Eingang des Zelts der Begegnung« agiert. Daß gerade dieseBezeichnung für den Chroniktext eine Rolle spielt, wird daraus deutlich, daßgleich nach der Nennung des Pinhas ein spezieller Türhüter eben für diesenEingang genannt wird (1 Chr 9,21). Der Grund für diese Entwicklung auf derliterarischen Ebene, könnte darin liegen, daß zwei Dinge, die das Numeribuchnoch unbeantwortet ließ, nun geklärt werden: Wenn hier unter den Levitendie Türhüter als spezielle Gruppe genannt werden, die Aufgaben im brisantenBereich hat, dann ist die Frage, wer über sie Aufsicht führte, genauso nahe-liegend wie diejenige, welche Funktion Pinhas neben seinem Vater einnahm.Von Num 25,6 f. ließ sich beides, miteinander kombiniert, ableiten.
Jacob Liver hat auf die – nicht unüberwindliche – Spannung hingewiesen,daß nach V. 22 erst David und Samuel die Türhüter einsetzten. Liver meint je-
8 So Budd, 279.
4.3 Der Altar am Jordan 85
doch, daß gerade diese Notiz einen redaktionellen Übergang zwischen der hiersingulär erscheinenden Tradition über die Türhüter in der Mosezeit und dersonst beschriebenen Begündung durch David schafft.9 Dann kann aber die-se Türhüter-Pinhas-Bemerkung keine spontane Schöpfung dieses Redaktorssein, sondern muß ihm schon vorgelegen haben. Bemerkenswert ist dann, wieeng die Korachiten und Pinhas in Ex 6,24 f. beieinanderstehen.
4 . 3 D E R A LTA R A M J O R D A N – J O S 2 2
Nach Jos 22 gehen die zweieinhalb Stämme Ruben, Gad und halb Manasseins Ostjordanland heim. Sie hatten dieses Land unter der Voraussetzung be-kommen, daß sie sich an der Eroberung des Westjordanlandes beteiligten. ImVerlauf von Num – Jos wird diese Bedingung öfter genannt.10 Folgerichtigkehren die zweieinhalb Stämme nach abgeschlossener Landverteilung in ihrenErbbesitz zurück. Sie bauen am Jordan einen Altar, was von den westjordani-schen Stämmen als Frevel empfunden wird, und Kriegsvorbereitungen nachsich zieht. Eine Kommission unter Leitung des Aaronenkels Pinhas stellt dieTransjordanier zur Rede. Die Antwort ist unerwartet, die Logik dahinter abereinfach: Der Altar sei nicht für Opfer bestimmt. Er sei nur das Abbild einesAltares, des einen wahren Jahwealtares, von dem nicht genau gesagt wird, woer steht. Mit diesem Abbild sollte gerade die kultische Absonderung der Ost-jordanier verhindert werden, die ihnen von den übrigen Stämmen unterstelltwurde.
4.3.1 Der Streitpunkt: Einheit durch Abgrenzung oder Integration
In dieser Arbeit muß vornehmlich die in den Versen 9–34 erzählte Episodeunter verschiedenen Hinsichten besprochen werden. Voraussetzung für denKonflikt ist die deuteronomistische Vorstellung von der Legitimität nur einerKultstätte. Innerhalb der vorderen Propheten wirkt das wie ein anachronisti-scher Vorgriff, denn im Erzählverlauf ist an dieser Stelle der endgültige Kultortnoch nicht erreicht. Die Konkurrenz könnte allenfalls zu dem Aufstellungsortder Lade gesehen werden. In eigenartiger Kombination deuteronomistischerund priesterlicher Formelsprache11 heißt es: »wo die Wohnung des Herrn
wohnt« ’� DZ ��$ �
� �� � ��
�#DZ �$ ��
� � ��
��� �
ašær šakan-šam miškan yhwh (V. 19).Das Problem ist aber nicht der genaue Standpunkt des Altares, sondern
daß es ein spezieller Altar für das Ostjordanland sein soll. Das macht ihnals Konkurrenz verdächtig. Die Kommission vermutet, daß er deshalb gebaut
9 Liver, 110 f.10 Num 32,20–24; Dtn 3,18–20; Jos 1,12–18; 4,12.11 Hulst, THAT II (wohnen), 107 f.
86 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
wurde, weil das Ostjordanland kultisch unrein ist. Die zugrundeliegende Vor-stellung illustriert am besten V. 19. Das Ostjordanland liegt nicht mehr imWirkungsbereich des gesamtisraelitischen Kultes. Mit einem eigenen Altar, sovermutet die Kommission, wollten die Transjordanier am Jahwe-Kult teilha-ben. Angesichts der Kultzentralisation ist das aber nicht mehr möglich. DieAlternative der Kommission ist, entweder im unreinen Land zu leben oderherüber in den Erbbesitz des Herrn zu kommen.
Auch die Gegenseite sieht die Gefahr der kultischen Abtrennung. Für sieist aber der Altar nicht der Stein des Anstoßes, sondern soll gerade die kulti-sche Zugehörigkeit betonen, er ist ja nur das Abbild des Altares. Die Formu-lierung »keinen Anteil am Herrn haben« erinnert an die wiederholte Fest-stellung der Nordstämme, keinen »Anteil an David« zu haben (2 Sam 20,1;1Kön 12,16). Es wird auf den Nord-Süd-Konflikt angespielt, aber ein West-Ost-Konflikt beschrieben.
Die V. 10. 11 widersprechen sich darin, ob der Altar östlich oder westlichdes Jordan stand. Hätte er sich noch im Lande Kanaan befunden, wäre dasein weiteres Zeichen dafür, daß die Ostjordanier ihr Land selbst für unreinhielten und ihren Altar so nah wie möglich an den Jordan legten (V. 10). V. 11betont dagegen das Konkurrenzhafte dieses Kultes »jenseits der Israeliten«.
Das Nebeneinander der beiden Darstellungen muß nicht literarkritischgelöst werden. Es ist eher erzählstrategisch zu erklären: Schon hier wird derKonflikt vorbereitet. Der Altar wird in V. 10 gar nicht außerhalb des Landesgebaut, was später doch das Problem ist (V. 19). Das Gerücht, das die rest-lichen Israeliten erreicht, lautet aber gegenteilig: Der Altar steht gegenüberdem Lande Kanaan, bei den Steinkreisen am Jordan, jenseits der Israeliten
(� �� ��#� �� (� �� (����#� �� �æl-mûl, �æl, �æl-�ebær). Es handelt sich also um einMißverständnis, das ausgeräumt werden muß.12 Und auch die Lösung, diespäter gefunden werden wird, wird hier schon angedeutet. In V. 10 wird derAltar beschrieben als »groß von Aussehen«. Er ist nur ein Erinnerungszeichen,kein Kultobjekt, das die Ostjordanier von ihrer Seite aus auf dem westjorda-nischen Ufer sehen.13
Die Ostjordanier widersprechen also nicht der Feststellung, daß ihr Landunrein sei.14 Der Jordan ist die Grenze. Die zweieinhalb Stämme hatten wis-sentlich in Num 32 gewünscht, außerhalb des eigentlich als Siedlungsgebietvorgesehenen Landes zu siedeln. Durch diese Ausnahme entsteht – nach Jos 22– schon gleich mit der Landnahme das Problem, was nachexilisch ganz do-minant wird – die Existenz von Juden im Fremdland. An Jos 22 können alsodamit zusammenhängende Fragen schon in Israels Frühzeit durchgespielt wer-den.
12 Vgl. Boudreau, Study, 111 f.13 Ähnlich Noort, 158.14 Gegen Noort, 157.
4.3 Der Altar am Jordan 87
4.3.2 Redaktionskritische Einordnung
Der Text wird nach ziemlich einhelliger Meinung in zwei Einheiten geteilt:V. 1–6(. 7. 8) und V. 9–34. V. 1–6 werden generell als deuteronomistisch be-zeichnet.15 Da sie aber nicht auf einer Ebene mit Jos 21,43–45 liegen können,gehen eine Reihe neuerer Arbeiten16 von einem spätdeuteronomistischen Re-daktor aus. Jedenfalls wird mit »den Herrn lieben«, »in allen seine Wegenwandeln«, »mit ganzem Herzen und ganzer Seele« v. a. in V. 5 deuteronomi-stische Sprache identifiziert.17 Die Verse 9–34 zeigen priesterlichen Charak-ter (»Besitz«, »Baumodell«, »Wohnung«, das Interesse an Reinheit),18 fast aus-nahmslos werden sie als spätpriesterlicher Text eingestuft. Die deuteronomi-stische Forderung der Kulteinheit ist in ihm mit aufgenommen. Das Verhält-nis der beiden Teile zueinander wird dagegen unterschiedlich bestimmt. Fritz,Schorn und Nentel fassen V. 9–34 als Grundschicht des Kapitels auf, V. 1–8 istin spätdeuteronomistischer Redaktion dem spätpriesterlichen Text vorgesetztworden.19 In diesem Zuge sei auch der halbe Stamm Manasse in V. 9–34 nach-getragen worden. Nach Ulrike Schorn befaßt sich die spätpriesterliche Schichtin Num und Jos nur mit Ruben und Gad, während die spätdeuteronomisti-sche Redaktion den halben Stamm Manasse hinzufügt.20 Martin Noth sah inJos 22,1–6 das Gegenstück zu Kap. 1,12–18. Jos 22,9–34 setzt für ihn die Ver-se 1–6 schon voraus.21 V. 7 f. werden erst als später eingefügt und halb Manassein V. 1–6 als nachgetragen verstanden.22 Mit Recht hat Ulrike Schorn daraufhingewiesen, daß V. 7 nicht halb Manasse einführt, sondern erläutert, wie derStamm in zwei Teile geteilt ist.23 Daß in V. 9–34 halb Manasse nachgetragenist,24 läßt sich im einzelnen nicht literarkritisch begründen. Der allgemeinenFeststellung ist zuzustimmen, daß Jos 22,1–8. 9–34 zwei Einheiten bilden. Derzweite Teil nimmt die V. 1–8 auf und führt sie fort. In V. 1–6 dagegen weistnichts auf das Folgende hin. Daher setzt V. 9–34 die Verse 1–6 voraus.
15 Smend, Gesetz, 128.16 Schorn, 205; Fritz, Josua, 226; Becker, 72. Vgl. den Überblick bei Nentel, 98 f.17 Fritz, Josua, 226.18 Petersen, 135 f; Fritz, Josua, 221; Noort, 157.19 Fritz, Entstehung, 221 f., 226 f.; Schorn, 207; Nentel, 99.20 Schorn, 205.21 Noth, Josua, 133.22 Ebd.; Auld, Moses, 58.23 Schorn, 208.24 Noth, Josua, 132; Auld, Moses, 58.
88 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
4.3.3 Eine Altarätiologie?
Immer wieder ist vermutet worden, der Text enthalte eine verstümmelte Al-tarätiologie.25 In V. 34 heißt es »Und die Söhne Ruben und Gad benanntenden Altar . . . , denn Zeuge ist er zwischen uns, daß der Herr Gott ist.« Esscheint, als sei der Name des Altars ausgefallen, der das Wort »Zeuge« � �� �edenthalten müßte. Die Peschitta bietet einen Namen: »Altar des Zeugnisses«madbh. o dsohduto. Textkritisch gesehen ist das wahrscheinlich eine Ergänzungnach dem Kontext, die aber den sachlichen Zusammenhang des ursprüngli-chen Textes treffen kann. Die Formulierung erinnert an Gen 31,47,26 wo einSteinhaufen in Gilead Zeuge für den Vertrag zwischen Laban und Jakob ist. Erheißt � �� ���� gal �ed, worin Gilead anklingt, auf aramäisch � ������� ��� ���� yegarsahadûta. Gilead kann pars pro toto für das ganze Ostjordanland stehen. Auchin Jos 22 geht es zentral um das »Land Gilead«.
Andererseits wurde der Altar nicht im Gebirge Gilead, sondern »bei denSteinkreisen des Jordan« DZ ��� ���� �� � ���� ����� gelîlôt hayyarden gebaut. Auch dieseSteinkreise könnten der Haftpunkt für eine Ätiologie sein. Die Septuaginta
lesen ���� ���� gilgal statt ����� �� �� gelîlôt, meinen also einen wichtigen Kultort am
Jordan, der auch (Jos 5,9) mit einer Ätiologie um das Wort ��� gll und Steinenbehaftet ist. Allerdings verbindet Gilgal, Gilead und die Steinkreise die Wurzel
��� gll, in Jos 22,34 geht es aber um den »Zeugen« � �� �ed. Wäre ursprünglichvon Gilgal die Rede gewesen,27 würde hier die Konkurrenz dieses Heiligtumszu einem anderen – etwa Schilo – verhandelt. Auf der Ebene des Endtextesist es aber von Anfang an kein Heiligtum. Sollte eine Altarätiologie zugrundeliegen, mußte sie verstümmelt werden.
Der Ausgräber von ��� ���
���� tell der �alla, H. J. Franken, hat diesen Ort
nicht für Sukkot gehalten, sondern vorsichtig vermutet, daß hier das GilgalSauls zu finden sei, und angenommen, daß der Altar von Jos 22 hier stand.28
Prähistorische Großsteinkonstellationen sind in der Jordansenke sehr häu-fig. Das betrifft gerade Gilead im engeren Sinn, die Gegend nordöstlich desToten Meeres und schließt die angrenzende Gebirgsregion mit ein.29 Oft sindSteinkreise mit tischförmigen Megalitgräbern kombiniert.30 Für den Zusam-
25 Noth, Josua, 134.26 Vgl. Kloppenborg, 367; Hertzberg, Josua, 125, der die Kombination von Gilgal und
Gilead gar nicht problematisch findet.27 Kloppenborg, 367, 371; Hertzberg, Josua, 125.28 Franken, 7 f.; Vink, 74.29 Vgl. Gilead, 16; Worschech, Land jenseits des Jordan, 60–62; Zohar, Cemetries, 47–49;
Ders., Dolmens, 353 f.; Piccirillo und Alliata.30 Zohar, Cemetries, 44–46; Piccirillo und Alliata, 96–99. 194; Worschech, Cromlechs,
23.
4.3 Der Altar am Jordan 89
menhang von Jos 22 liegen vor allem Dolmen in der Umgebung von���� � !" �
el-�ad¯
eme31 am Nordostende des Toten Meeres räumlich nahe. Gustav Dalmanerwähnt Steinkreise am und auf dem Peorberg.32
���� � !" � el-�ad¯
eme und, weiter
nördlich (näher an der eigentlichen Landschaft Gilead),����#
� " � ed-damıye sindgroße Dolmenfelder im Jordantal, die an wichtigen Übergängen liegen.33 Aufdem westlichen Jordanufer werden selten Dolmen genannt.34 Jos 22 könnteeinen solchen Dolmen mit Steinkreisen vor Augen haben, wenn es bei demAltar um ein weithin sichtbares Objekt gehen soll. Steinkreise und Altar wür-den also enger zusammengehören. Die »Steinkreise« wären als schon vorhan-den vorgestellt, während der »Altar« dazukam. Es könnte sich sogar ein enge-rer Zusammenhang zwischen dem Altar und dem Peor-Kult nahelegen, wennsich bei der Lokalisierung von Schittim oder Peor Dolmen in der Nähe fin-den.35 Die ursprüngliche Funktion von Dolmen für Bestattungen ist nichtunumstritten.36 Udo Worschech weist darauf hin, daß Dolmen immer wiederals Opferaltäre gedeutet wurden.37 Jos 22 reiht sich in diese Deutungstradi-tion ein. Es ist möglich, daß in Jos 22 auf dieses im Jordangraben und demgesamten nördlichen Ostjordanland häufige Phänomen angespielt wird, ohnedaß ein bestimmter Ort gemeint ist.
Volkmar Fritz hat mit Recht darauf hingewiesen, daß ����� �� �� gelîlôt nicht
nur »Steinkreise« bedeuten kann, sondern auch die »Gegend« des Jordan (vgl.
�� ��� �
� �� � �� ����� �� �� gelîlôt happelištîm Jos 13,2 und DZ ��� ���� �� � ��$ �$ kikkar hayyarden
Gen 13,10). Für ihn ist der ätiologische Schluß »aus der Erzählung herausge-sponnen«.38
Jos 22,9–34 liefert wenig Hinweise auf einen konkreten Kultort. Der Textspielt auf einen Dolmen an unter Aufnahme eines gilaeditischen ätiologischenMotives. Es liegt nicht in der Absicht, einen konkreten Kultort auszumachen.Vielmehr soll eine bestimmte Situation stilisiert werden: Kultische Integri-tät der Transjordanier,39 Legitimation von Tempelanlagen außerhalb des Lan-des40 oder die Synagoge – durch die Entfernung bedingt – als opferloser Kul-tort 41.
31 Gilead, 18; Worschech, Cromlechs, 24 f.32 Dalman, Gilgal, 17, 19 f.33 Zohar, Dolmens, 354.34 Dalman, Gilgal, 20; Zohar, Cemetries, 49.35 Vgl. Conder, Heth and Moab, 266; Donner, Pilgerfahrt, 106.36 Vgl. Yassine; Zohar, Cemetries, 51 f.37 Worschech, Cromlechs, 11.38 Fritz, Josua, 226.39 Schorn, 203–223.40 Vink, 73–77.41 Menes, 268–276.
90 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
4.3.4 Die Schichtung des Textes
Dennoch beinhaltet der Text Fragmente, die auf eine umgearbeitete literari-sche Vorlage schließen lassen. Eine solche ältere Schicht zeigt sich in V. 34,dem ätiologischen Schluß, der im jetzigen Kontext verstümmelt ist – es gehtdem Endtext nicht mehr darum, einen Lokalkult zu begründen. Dieser Versbezieht sich zurück auf V. 27, in dem der Altar als Zeuge zwischen Ost- undWestjordaniern dafür fungieren soll, daß auch die Ostjordanier Opfer darbrin-gen. Damit wird der fiktive Vorwurf in V. 25 zurückgewiesen, daß die Ostjor-danier keinen Anteil am Herrn hätten. Eventuell versteckt sich dahinter derursprüngliche Begründungszusammenhang dieses Altares. Es ging gerade dar-um, daß die Ostjordanier auch opfern. Innerhalb von V. 24–27 erklärt nurV. 26b, daß der Altar nicht für Opfer bestimmt war. Nimmt man den Halb-vers heraus, was problemlos möglich ist, so verkehrt sich die Funktion desAltares.
Der Herr, er weiß, und Israel wird erkennen. . . ,ob wir es nicht aus Furcht davor getan haben, daß wir gesagt haben:
Morgen sagen eure Söhne zu unseren Söhnen:Was habt ihr mit dem Herrn, dem Gott Israels zu tun?Der Herr hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch,
Rubeniter und Gaditer, den Jordan.Ihr habt keinen Anteil am Herrn
Und eure Söhne lassen unsere Söhne aufhören, den Herrn zu fürchten.Und wir sprachen:
Laßt uns für uns den Altar bauen– weder für Brand-, noch für Schlachtopfer –,daß er Zeuge sei zwischen uns und euchund zwischen unseren Geschlechtern nach uns,vor ihm den Dienst des Herrn zu dienenmit unseren Brand-, Schlacht- und Friedensopfern.Und eure Söhne sagen morgen nicht zu unseren Söhnen
Ihr habt keinen Anteil am Herrn. Jos 22,22a. 24–27
Weitere Hinweise für die Sonderstellung von V. 24–27 sind, daß auch hier,wie in V. 34 nur Ruben und Gad erwähnt sind. � ��� zæbah. und �� �� �� �� šelamîmwerden getrennt als Opferarten benannt, was für priesterliche Texte als unty-pisch gilt.42 Und V. 28 wiederholt den Kommunikationsgang von V. 27 nocheinmal, nun aber mit eindeutiger Intention. Es hat also eine gewisse Wahr-scheinlichkeit, in V. 24–27 und V. 34 Fragmente eines Prätextes anzunehmen,dessen Inhalt, eine Altarätiologie, für einen neuen Kontext umgedeutet wur-de. Die Ostjordanier bauen sich einen Altar, damit die Opfer darauf dafürzeugen, daß auch sie Anteil am Herrn hätten. Unter dieser Voraussetzung
42 Kloppenborg, 367, ohne daß er eine genaue Abgrenzung einer Schicht vornimmt.
4.3 Der Altar am Jordan 91
spricht V. 27 auch klarer vom Ort der Opfer, wenn es heißt »den Dienst desHerrn vor ihm zu dienen«. »Vor ihm« bezog sich auf den Altar, und nicht aufden Herrn.
Aber auch noch in den Versen 32 und 33 ist die Rede nur von Ruben undGad, also in Versen, die eindeutig dem jetzigen Zusammenhang zugehören.Vielleicht soll man darin eine Überleitung zu V. 34 sehen. Wenn es sich hierum die Überleitung zum Ende handelt, könnte das Fehlen der Manassiterdadurch möglich sein, daß man sie gar nicht zurückläßt – auf dem anderenUfer wohnen auch Manassiter.
4.3.5 Ostjordanland
Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Jos 22 ist die Frage, warum dasOstjordanland – israelitisches Siedlungsgebiet – nicht zum eigentlichen Landgehöre, und warum ihm bzw. seinen Bewohnern Mißtrauen entgegengebrachtwird. Texte in Num und Jos, die das Ostjordanland thematisieren, sehen die-ses als außerhalb des Landes liegend an. Der gesamte Aufriß von Num – Jossetzt die Vorstellung voraus, die eigentliche Landnahme beginne erst mit demJordanübertritt. Das Josua-Buch selbst spiegelt diesen Gegensatz wieder: Er-obert wird nur das Westjordanland, verteilt wird in Kap. 13 aber auch dasOstjordanland. In den Rahmenstücken des Dtn erscheint es dagegen eher alsTeil des für die Siedlung vorgesehenen Landes.43 Mose wird in Dtn 34 nochaußerhalb des Landes das Land gezeigt, zu dem an erster Stelle Gilead gehört.In Dtn 2,24 wird dementsprechend schon der Arnonübergang ähnlich demJordanübergang als Beginn der Landnahme stilisiert.44 Lothar Perlitt sprichtvon zwei gegensätzlichen Traditionen, die im dtrG komplementär zueinanderkomponiert sind.45
Daß das Ostjordanland israelitisches Siedlungsgebiet war, wird gewöhn-lich als eine Tradition aus der Königszeit angesehen.46 Es scheint auch in spä-ter Zeit Juden in Transjordanien gegeben zu haben, denen gegenüber manjedoch Mißtrauen hegte (Neh 2,19; 13,4–9). Klaus Bieberstein47 bringt die-se Ausgrenzung des Ostjordanlandes mit der Gründung der assyrischen Pro-vinz gal�adda 733 in Verbindung und datiert sie daher vordeuteronomistisch.Volkmar Fritz48 sieht ebenfalls einen Zusammenhang mit der Gründung vongal�adda, die Auswirkung dessen auf die Vorstellung von Gilead als Ausland
43 Bieberstein, 389.44 Kloppenborg, 360; Bieberstein, 325; Fritz, Josua, 221. Vgl. 2 Sam 24,5.45 Perlitt, 29.46 Bieberstein, 324 f.47 Ebd., 327.48 Fritz, Josua, 221 f.; Ders., Grenzen, 24.
92 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
sei aber erst in spätpriesterlichen Texten feststellbar. Nach Fritz thematisiertder Text die kultische Zugehörigkeit von Juden außerhalb Judäas.
Andere49 halten die Vorstellung vom Land Kanaan, zu dem das Ostjord-anland nicht gehört, für sehr alt. Sie würde sich von den Grenzen der ägyp-tischen Provinz kinah
˘h˘
i ableiten. Yohanan Aharoni begründet diese Sicht mitNum 34 und Ez 47.50 Dort gehört Baschan zum Land, während nur Gileadaußerhalb der Grenzen liegt.
Da die literarische Form von Jos 22,9–34 auf eine nachpriesterliche Ent-stehung hindeutet, sind als Deutungshorizont die politischen Verhältnisse dernachexilischen Zeit heranzuziehen. Daß es eine jüdisch verstandene territo-riale Einheit nur im Westjordanland gab, wird den Ausschluß Gileads ausdem Land stärker beeinflußt haben. Jos 22 setzt die Unterscheidung zwi-schen ursprünglich vorgesehenem und als Ausnahme hinzugegebenem Landaus Num 32 schon als literarisch vorgegeben voraus.
4.3.6 Beziehung zwischen Jos 22 und Num 31
Die Figur des Pinhas bleibt innerhalb der Geschichte relativ farblos, insoferner der eingesetzte Leiter der Kommission ist, und seine Äußerungen sich voll-kommen in die Logik der Erzählung einpassen. Er bezieht sich auf die Episodezurück, in der er selbst die Hauptrolle spielt, Num 25 (V. 17). Aber es ist mehrdie Funktion, in der er hier auftritt, die dem Charakterbild dieser Gestalt kor-respondiert. Er ist der priesterliche Eiferer, der vornehmlich mit Waffengewaltdie Ausschließlichkeitsforderungen Gottes verwirklicht. Als führende Figur ineinem Krieg des vorstaatlichen Israel tritt er dreimal auf: In Num 31, demKrieg gegen die Midianiter, hier in Jos 22 als Leiter der Kommission zur Vor-bereitung eines Strafkrieges gegen einen Teil der Stämme und bei einer ganzähnlichen Situation, dem Krieg gegen Benjamin, in Ri 20,27 f. (Siehe untenKap. 4.4).
Unter kompositionsgeschichtlicher Hinsicht beachtenswert ist die Bezie-hung zu Num 31. Im Anschluß, nämlich in Num 32, geht es auch dort um dieEinnahme des Ostjordanlandes, um das Begehren der zwei(einhalb)51 Stäm-me, im schon besetzten Gebiet außerhalb des Landes zu siedeln. Das wirdunter der Bedingung zugesagt, sich an der Eroberung des Landes zu beteili-gen. Es ist also nur folgerichtig, daß nach erfolgter Eroberung und Verteilungdes Westjordanlandes die Transjordanier entlassen werden.
49 Weinfeld, Extent, 65–70; Ders., Promise, 74; Aharoni, v. a. 73–75; Mazar, Lebo-hamath, 193 f. Vgl. auch die kuriose Erklärung von Dus, die Lade hätte auf ihrem Och-senwagen nie den Jordan überqueren können.
50 Aharoni, 73–75.51 Von halb Manasse ist erst ab V. 33 die Rede.
4.3 Der Altar am Jordan 93
Daß die beiden nacheinander folgenden Kapitel Num 31 f. aufeinander be-zogen sind, wird durch eine stilistische Beobachtung bestätigt. Nur in diesen
beiden Kapiteln wird das Verb )�� h. ls. Nifal mit der Bedeutung »sich rüsten«gebraucht. Jedoch ist das Ziel des Rüstens unterschiedlich benannt: in Num 32
ist es der »Krieg« (� �� �� � ��� �� lammilh. ama), in Kap. 31 der »Kriegsdienst« (� �� ��� ��las.s. aba�), eine Formulierung, die von dem Ausdruck »Gerüsteter des Kriegs-dienstes« (� �� �� )��� �� h. alûs. s. aba�) abgeleitet ist. Daß in Kap. 31 der »Kriegs-dienst« so im Vordergrund steht, hängt mit dem Bezug auf den Anfang desNumeribuches zusammen, wo � �� ��� �� las.s. aba� allerdings gerade für den (kul-tischen) levitischen Dienst gebraucht wird (Num 2 f.). John R. Spencer hatein ganz paralleles Phänomen beim Gebrauch der Wurzel »mustern« �� pqdin Num 2 f. beschrieben: Zur Bezeichnung der kultischen Funktion wird einmilitärischer Begriff gewählt.52
In Jos 22,12 wird »Kriegsdienst« aus Num 31 einmal aufgegriffen, wennes heißt, daß die Israeliten sich in Silo versammelten, um gegen die Ost-jordanier »zum Kriegsdienst hinaufzuziehen«. Das Auftreten des Pinhas istin Jos 22 mit einem Rückverweis auf Num 25 verbunden (V. 17). Vergleich-bares geschieht in Num 31,16. Auch die Zusammenstellung der Delegationin Jos 22,13 f. scheint konkret an Num 31 anzuknüpfen, wo je tausend proStamm ausgesandt werden. In Jos 22,14 werden zehn Fürsten als Oberhäupterder Stämme und gleichzeitig der Tausendschaften dargestellt.53
Tausend je Stamm, tausend je Stamm, für alle Stämme Israels schickt zum Kriegs-dienst! Num 31,4Und die Israeliten schickten . . . einen Fürsten, einen Fürsten pro Vaterhaus, für alleStämme Israels, und sie sind jeder Haupt ihrer Vaterhäuser, für die TausendschaftenIsraels. Jos 22,13 f.
Jos 22,1–6 ist sekundär zwischen das Ende von Jos 21 und die beiden Ab-schiedsreden gesetzt worden, in einen Zusammenhang, der als Abschied Jo-suas gestaltet ist. 21,43–45, ein Höhepunkt im Josuabuch,54 überblickt schoneinige Jahre der Seßhaftigkeit. So wird mit Jos 22 sekundär ein Rückverweisauf Num 32 gesetzt. An diesen Verweis wird mit dem Namen Pinhas in denV. 9–34 eine Figur aufgegriffen, die in Num 31 eine ähnliche Funktion ausübt.Von Jos 22 aus werden Num 31 und 32 in engen Bezug zueinander gesetzt.
In Num 32 äußern Ruben und Gad ihren Wunsch, das Land zu besiedeln,in dem sie gerade lagern. Durch den Sieg über die Midianiter in Num 31 istdie letzte Auseinandersetzung mit Völkern im Ostjordanland durchgestanden.Das Land ist bereit zur Inbesitznahme.55 Die Gefahr heterodoxen Verhaltens
52 Spencer, PQD.53 Vgl. Organ, 204.54 H. N. Rösel, Von Josua bis Jojachin, 47 f.55 M. Rösel, Bileamgestalt, 516.
94 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
scheint durch die Vertreibung der fremden Völker erst einmal gebannt, wirdaber am Ende des Josuabuches (Kap. 22–24) erneut zum Thema gemacht.
4.3.7 Stellung von Jos 22 am Schluß des Josuabuches
Die Stellung von Jos 22 am Ende des Josuabuches, nach abgeschlossener Land-nahme, macht es sinnvoll zu untersuchen, in welchem Verhältnis das Kapitelzu Jos 23; 24 steht. Alle drei Kapitel beginnen mit einer Einberufung durchJosua (Jos 22,1; 23,2; 24,1b).
Kap. 23 und 24 unterscheiden sich in ihren Auffassungen darüber, ob einevollständige Landnahme stattgefunden hat, oder ob im Land Völker übrigge-blieben sind. Während sich Israel in Jos 23 an den übriggebliebenen Völkernbewähren soll, sind es in Jos 24 nur noch deren Götter, die potentiell verführenkönnten.
Die von Jos 22 dezidiert vertretene Auffassung, das Ostjordanland liegeaußerhalb der Grenzen des Landes, läßt sich in den beiden folgenden Kapitelnnicht finden. Daher sind die drei Kapitel nicht als auf derselben literarischenEbene entstanden erklärbar. Aber es sind formale und inhaltliche Beziehungenzwischen Jos 22 und den beiden folgenden Kapiteln festzustellen.
Jos 22 problematisiert die Sonderstellung des Ostjordanlandes. Es ist derTeil des Landes, der in seiner Zugehörigkeit und kultischen Reinheit am mei-sten suspekt erscheint. Hier wird das beispielhaft vorgeführt, was in Jos 23 fürdas ganze Land gesagt wird: Indem die Stämme in ihre Gebiete entlassen wer-den, kann die Rechtgläubigkeit nicht mehr in dem Maß überwacht werden,wie es bei der Wanderung in einem großen Lager während des Wüstenauf-enthaltes vorstellbar war. Räumliche Trennung und Fremdenkontakt werdenals Gefahr aufgefaßt. In nachexilischer Zeit erscheint das für das Ostjordan-land besonders plausibel, wenn dort vermehrt nomadisierende protoarabischeGruppen auftraten.56 Wenn, wie oben beschrieben, von Jos 22 auf den Midia-niterkrieg in Num 31 verwiesen ist, dann gehört die Auseinandersetzung mitden Beziehungen Israels zu Midian (Num 25; 31) zum Horizont von Jos 22.
Mit Jos 24 verbindet Kapitel 22, wie vehement hier ein Teil des Volkes zurEntscheidung zu Gott aufgefordert wird. Man vergleiche dazu Jos 22,22 »Gott,Gott ist der Herr« mit Jos 24,17 »der Herr ist unser Gott« sowie Jos 22,29»das sei ferne von uns, uns gegen den Herrn aufzulehnen« und Jos 24,16 »dassei ferne von uns, den Herrn zu verlassen«. Die Formulierungen in Jos 22spielen auf Kap. 24 an.
56 Knauf, Midian, 91 f.; Ders., Midian und Midianiter, 802; vgl. auch Schwemer, Prophe-tenlegenden, II, 228–230.
4.4 Das Orakel in Bethel 95
4.3.8 Ergebnis
Jos 22 liegt das Fragment eines Textes zugrunde, der die Ätiologie eines Al-tars erzählte, die seine Funktion in der kultischen Verbindung von Ost- undWestjordanland sah. Im jetzigen Text ist der gemeinte Kultort nicht mehridentifizierbar und zu einem Erinnerungsmal umgedeutet. Er problematisiertdas Ostjordanland als unreines Land, als Fremdland, und beschreibt jüdischeReligionsausübung in der Diaspora als gedankliche Vergegenwärtigung desTempels.
Mit dem Namen des Pinhas wird eine Referenz zu Num 25 gesetzt, demparadigmatischen Text für Israels Teilnahme an falschem Kult. Da »Gilead« inJos 22 das gesamte Ostjordanland repräsentiert, lassen sich auch die Orte desGeschehens miteinander identifizieren: Dem Baal Peor verfiel Israel in demGebiet, von dem aus sie den Jordan überqueren sollten. Die Offenheit desTextes in Bezug auf die genaue Lokalisierung soll diese Assoziation möglichmachen. Dieser Bezug ins Numeribuch wird noch verstärkt, indem Pinhas inNum 31 eingetragen wird. Bei der letzten Schlacht um das Ostjordanland tritter in einer mit der von Jos 22 vergleichbaren Funktion auf.
4 . 4 D A S O R A K E L I N B E T H E L – R I 2 0 , 2 7 – 2 8
In Ri 20, dem Kapitel, in dem der Krieg gegen Gibea in Benjamin beschrie-ben wird, wird bei der Besprechung der Verse 27 f., in denen Pinhas auftritt,V. 27b. 28a� gewöhnlich als späterer Nachtrag behandelt.57 Dafür spricht vorallem, daß diese beiden Teilverse den Zusammenhang zwischen Redeeinlei-tung der Israeliten und Beginn der wörtlichen Rede mit »sprechend« ���� ��le�mor auseinanderreißen und daß Pinhas sowie die Lade hier und im ganzenRichterbuch ganz unerwartet auftreten und wieder verschwinden.
Und die Israeliten befragten den Herrn
– und dort war die Lade des Bundes Gottes in jenen Tagen,und Pinhas ben Eleasar ben Aaron stand vor ihr in jenen Tagen –
sprechend: Soll ich weiterhin in den Krieg ziehen gegen die Benjaminiten, meineBrüder, oder soll ich’s lassen?Und der Herr sprach: Steigt hinauf, denn morgen gebe ich sie in deine Hand.
Gleichzeitig wird neben dieser Bewertung als ein Zusatz angenommen, daßinhaltlich eine Tradition bezeugt wird, die Pinhas mit einer Betheler Kulttra-dition in Verbindung gebracht habe.58 Die Intention der beschriebenen Er-
57 Z. B. Budde, Richter, 136; Smend, Jahwekrieg, 68 f.; Stoebe, 117; Kang, 209; Becker,276 f.; Blenkinsopp, Judaean Priesthood, 30.
58 Eissfeldt, 198; Blenkinsopp, Judaean Priesthood, 30.
96 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
weiterung geht aber in eine andere Richtung, so daß ein solcher traditionsge-schichtlicher Zusammenhang als Hintergrund für diese Stelle ausgeschlossenwerden kann.
Nimmt man V. 27b. 28a� heraus, so ergibt sich für den Kontext folgenderZusammenhang: Nach Ri 20,1 versammeln sich die Israeliten gegen Gibea inMizpa. Bevor sie dann wirklich gegen Gibea ziehen, gehen sie hinauf nachBethel, um den Herrn über ihr Vorgehen zu befragen (V. 18). Auch am zwei-ten Tag steigen sie nach der verlorenen Schlacht hinauf – wahrscheinlich auchnach Bethel (V. 23). Da auch dieser Kampf für Israel verheerend ausgeht, ge-hen sie nun ein drittes Mal nach Bethel. Für den Leser ist eine Spannungaufgebaut, da Gottes Anweisungen beide Male eingehalten wurden und den-noch kein Sieg errungen werden konnte. Vor der dritten Befragung werdenKlage- und Fastenritus und Opfer vorgenommen. Erst jetzt lautet die Antwortausdrücklich, daß Benjamin besiegt werde, so daß der Leser den Eindruck be-kommen kann, es habe vorher an kultischen Vollzügen gemangelt, und des-halb sei Israel kein Erfolg beschieden gewesen. Damit ist zwar das Problemder Erzählung nicht wirklich geklärt. Die Unlösbarkeit liegt jedoch in der Sa-che selbst: Es muß auch Gott schwerfallen, einen ganzen Stamm seines Volkesvernichten zu lassen.
Durch die ausdrückliche Erwähnung der Opfer ist aber ein Problem hin-zugekommen, das einem späteren Bearbeiter auffiel: Was war das für ein Hei-ligtum in Bethel? Durch die Einfügung von V. 27b stellt er klar, daß es sichin Bethel um den aktuellen Standort der Lade gehandelt habe – und nichtum einen daneben bestehenden Konkurrenzkult.59 Die umherziehende Ladeist die in der Wüste angelegte Lösung, sich vor Salomo einen einzigen ge-samtisraelitischen Kultort vorstellen zu können. In dieser Hinsicht Texte dervorderen Propheten zu deuten, entspricht einer Neigung des Chronisten.60
Wenn das die Intention dieser Erweiterung ist, kann sie nicht gleichzeitig eineReminiszenz an eine Betheler Kulttradition im Zusammenhang mit Pinhasbewahren.
Eißfeldt wandte ein, einer so auf rechtmäßigen Kult bedachten Fortschrei-bung hätte doch die spätere »Stätte eines widergöttlichen Kultes« ein Problemsein müssen.61 Zu Recht beharrt Smend dagegen auf der Logik, mit der dieZufügung auf das schon Vorhandene reagieren muß: »Aber wenn der Mantelfällt, muß der Herzog nach: war Bethel einmal in der Geschichte, war demGlossator die vorübergehende Placierung der Lade dort offenbar das geringereÜbel gegenüber einem illegitimen Kultus Gesamtisraels.«62
59 Vgl. Becker, 276; Organ, 216.60 K. H. Graf, 53 f.61 Eissfeldt, 199.62 Smend, Jahwekrieg, 69.
4.4 Das Orakel in Bethel 97
Daß Pinhas in V. 28 erwähnt wird, beantwortet die nächste sich aufdrän-gende Frage. Wenn hier das Ladeheiligtum als alleiniger rechtmäßiger Kultortfestgestellt wird, wer war in dieser führerloser Zeit – es ist ja nicht einmalein Richter erwähnt – der amtierende Nachfolger Aarons, ohne den das Zelt-heiligtum doch nicht vorstellbar wäre? Daß dessen Auftreten in Bethel gegendie sonstige Chronologie im Richterbuch in die dritte Generation nach Am-ram eingeordnet wird, könnte auf das Auftreten des Mose*-Enkels Jonathan(Ri 18,30) im engeren Kontext Bezug nehmen, hätte dann aber eine andereIntention. »Der rechtmäßige Priester wurde nach ungefährer Berechnung derZeit hinzugefügt.«63
Ist die Erwähnung von Pinhas als Priester vor der Lade in Ri 20,27 f. ausliterarisch-systematisierendem Interesse heraus zu erklären, dann kann vondieser Stelle nicht mehr darauf geschlossen werden, die Lade sei ein altes pin-hasidisches Traditionsgut. Geht man davon aus, daß die Gestalt des Pinhasben Eleasar insgesamt eine literarische Neuschöpfung ist, die die Umgestal-tung der zadokidischen Genealogie als Ausgangspunkt hatte, dann ist gar keinanderes Ergebnis denkbar.
Dieses literarische Konzept hatte die Gestalt des Pinhas ben Eli zur Voraus-setzung. Dabei können durchaus einzelne Züge, die mit dieser Person verbun-den sind, auf den neuen Pinhas übertragen worden sein. Für die Vorstellungvon der Erwähltheit zum Priestertum konnte das oben schon wahrscheinlichgemacht werden. Aus der Erwählung des Ahnen in Ägypten wurde ein demPinhas ben Eleasar neu gegebener Bund des ewigen Priestertums.
Wenn Pinhas ben Eleasar bei der Lade auftritt, liegt das erst einmal – beiihm als höchstem Amtsträger am noch mobilen Heiligtum – auf der Hand. In1 Sam 4 wird dagegen ausführlicher über das Verhältnis der beiden Elisöhnezur Lade gesprochen. Zuerst in einem sehr positiven Sinn – ist die Lade mituns, wer kann gegen uns sein! –, dann aber kippt die Stimmung abrupt um.Israel ist sich zu sicher gewesen. Die Schicksale der Lade und der Eliden sindsehr eng miteinander verknüpft (1 Sam 4,11. 18–22). Das ist natürlich auch be-wußte literarische Gestaltung. Aber der scheinbar intakte Automatismus, derin den V. 3–8 beschrieben ist, greift auf eine geläufige Vorstellung zurück, diegut mit den Eli-Söhnen verbunden gewesen sein kann.
Positiver taucht das Motiv des das Heer begleitenden Priesters in1 Sam 14,3. 18 f. und 1 Sam 30,7 f. auf. Die Priester sind ebenfalls Nachkom-men Elis. Als Gegenstände spielen der Ephod und im ersten Fall auch dieLade eine Rolle. Der Priester wird zur Befragung herangeholt. Im zweiten Fallwird ein positiver Bescheid erteilt.
Die Szenerie von Ri 20 ist mit diesen Texten des ersten Samuelbuchesvergleichbar: In einer militärischen Auseinandersetzung erhofft man sich Un-terstützung von Gott (durch Opfer, Befragung oder durch die Anwesenheit
63 Budde, Richter, 136.
98 4 Pinhas im Krieg und die Lagerordnung
der Lade). Wenn Lade und Priester in Ri 20 in den eigentlich führerlos funk-tionierenden Ablauf eingetragen werden, erschließt sich der Sinn aus diesenVergleichsstellen: Entscheidend ist nicht die bloße Anwesenheit heiliger Ge-räte oder der Vollzug von Opfern, sondern es kommt auf die Befragung Gottesdurch den rechtmäßigen Priester an.
Ri 20,27b. 28a� stellen eine Erweiterung dar, die das Ziel hat, kultischenHandlungen der Israeliten den Verdacht der Illegitimität zu nehmen, indemsie an der mobilen Lade und unter der Aufsicht des amtierenden Priestersstattfinden. Damit wird auch für die gesamte Richterzeit der Fortbestand derkultischen Verfassung Israels, wie sie im Josuabuch beschrieben war, klarge-stellt. Der Text erklärt sich zur Genüge aus dieser literarisch systematisieren-den Funktion. Es ist deshalb nicht angebracht, andere als die literarisch vorge-gebenen Traditionen hinter dem Text zu vermuten. Er ist kein Beleg für eineaaronidische Priesterschaft in Bethel.
4 . 5 R E D A K T I O N E L L E V E R K N Ü P F U N G E N Z W I S C H E NN U M , J O S U N D R I
Barbara E. Organ hat mit guten Gründen vermutet, daß Num 31, Jos 22 undRi 20 f. durch das Auftreten Pinhas’ und durch andere Bezugnahmen auf-einander in einem redaktionellen Zusammenhang stehen.64 Drei mehr oderweniger militärische Aktionen der Stämme Israels werden so parallelisiert. DieAnalyse hat ergeben, daß Pinhas nur in Jos 22 dem Hauptbestand der Erzäh-lung ursprünglich angehörte. Sowohl in Num 31,6 als auch in Ri 20,27 f. ister – wohl aus eben diesen redaktionellen Motiven – in den Text eingefügtworden. Jos 22 läge dann evtl. auf dieser redaktionellen Ebene und würde denbeiden Kriegen eine positive Aktion an die Seite stellen: Die Inspektoren fin-den ihre Befürchtungen nicht bestätigt, und so ist der Krieg – zur Freude allerBeteiligten – abgewendet.
Obwohl Gilead und Baschan schon Num 21 von den Amoritern erobertwurden, mußte zehn Kapitel später dieses Gebiet noch vom nicht seßhaftenMidian gereinigt werden, so daß das Land wirklich als Siedlungsland frei wur-de. Das Ostjordanland wird zum Ort der Auseinandersetzung mit als fremdwahrgenommenen Traditionen – unter dem Namen »Midian«. Jos 22 erzähltbeispielhaft, wie die Bedrohungen, die von den beiden Schlußreden Jos 23; 24heraufbeschworen werden, wahr werden könnten. Statt der offensichtlichenBedrohung durch den Baal Peor könnte dieser Gott der ehemaligen Bewoh-ner (Jos 24,15) in dem Altar am Jordan eine Fortführung seiner Verehrungfinden (Jos 22,17). Mit der Vernichtung Midians als Voraussetzung für die Be-siedlung wird auf die Warnung vor den übriggebliebenen Völkern verwiesen,
64 Organ, 210–216.
4.5 Redaktionelle Verknüpfungen 99
wovon Jos 23,4–13 spricht. Die Zwitterstellung des Ostjordanlandes macht esalso nicht nur möglich, eine Diasporasituation zu simulieren, sondern ebensodie Problematik der Existenz im Lande.
Die beschriebene redaktionelle Ebene ist Num 25,5–13 nachgeordnet. Die-se wurde der Endgestaltung des Pentateuch zugeordnet. Das kann als Ausgren-zung der Tora aus größeren Textkomplexen beschrieben werden.65 Die darananschließende Verklammerung mehrerer biblischer Bücher in Num 31, Jos 22und Ri 20 sollen über solche literarische Zäsuren hinweg auf die übergreifen-den Erzählzusammenhänge verweisen.
Im griechischen Schluß des Josuabuches, der im folgenden Kapitel bespro-chen wird,66 finden sich Aussagen, die dieser Redaktionsschicht nahe stehen.Es wird in Jos 24,33a (Septuaginta) erwähnt, daß während der Amtszeit desPinhas als oberster Priester die Lade unter den Stämmen hin- und hergetra-gen wurde. Auch in Ri 20,27 f. ist die Lade eng mit Pinhas verbunden, undin Num 31,6 kann sie mit unter den heiligen Geräten assoziiert werden, mitdenen Pinhas in den Krieg zieht. Da auch das Ende des griechischen VersesJos 24,33b redaktionelle Bezüge in den Anfang des Richterbuches setzt, könn-te gefragt werden, ob dieses griechische Ende des Josuabuches auf derselbenliterarischen Ebene anzusetzen ist wie die beschriebene redaktionelle Schicht.Da aber diese Erweiterung des Verses unten erst im Stadium eines übersetz-ten Textes und nicht einer hebräischen Vorlage erklärt wird,67 können auchdie darin zu findenden intertextuellen Verweise erst in dieser Phase entstan-den sein – sie nehmen freilich ein Motiv aus der redaktionellen Schicht auf(Pinhas und die Lade) und bauen sie aus: Daß die Lade in Ri 20,27 geradein Bethel stand, erklärt der griechische Josuaschluß damit, daß sie regelmäßigunter den Stämmen ihren Standort wechselte.
65 Vgl. etwa Kratz, Komposition, 224 f.; Zenger, Entstehung, 121.66 Kap. 5.3.67 Siehe S. 106.
5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
Wenn Ri 20,27 f. nicht als Nachweis für eine Pinhastradition in Ephraim die-nen kann, muß Jos 24,33, die Bemerkung über das Gibea des Pinhas, auf sei-nen traditionsgeschichtlichen Hintergrund hin untersucht werden. Seit demMittelalter sind Grabverehrungstraditionen, die dieser Bibelstelle entsprechen,bezeugt. Auch ältere Zeugnisse, scheinen die Existenz der Lokaltradition zubelegen. Setzt der Bibeltext ein bestehendes Grab, dessen Verehrung oder denOrtsnamen voraus, oder dient die Bemerkung nur einer textinternen Syste-matik?
Da sich Grabnotizen gerade in sekundären literarischen Schichten fin-den, legt sich eine Erklärung nahe, die innerhalb der Logik der Textentste-hung bleibt und äußere Voraussetzungen nicht zwingend erfordert. Die Wahr-scheinlichkeit, daß einem relativ späten Text historische Informationen überdie Person Eleasars zugrundeliegen, ist eher gering. Nicht die Person des Elea-sar, sondern höchstens die Existenz eines Grabes wird aus diesem Text histo-risch greifbar. Wenn in nachexilischer Zeit durch den Text ein bestehendesGrab bezeugt sein könnte, dann müssen spätere Verehrungstraditionen daraufüberprüft werden, ob sie das im Bibeltext Berichtete fortsetzen.
5 . 1 D E R KO N T E X T: J O S 2 4 , 2 9 – 3 3
Mit Jos 24,29–33 wird das Josuabuch abgeschlossen. Inhalt des Buches ist dieEinnahme und Aufteilung Kanaans; und nach den abschließenden Reden Jo-suas in Kap. 23 f. sendet er in 24,28 das Volk in die jeweils zugeteilten Gebiete.Diese Inbesitznahme des Landes wird bekräftigt durch die Bestattung der Ge-beine Josefs und der beiden Führer Josua und Eleasar. In allen drei Fällen wirdexplizit darauf verwiesen, daß der jeweilige Ort in dem zugeteilten bzw. Erbbe-sitz gewordenen Gebiet liegt. Damit zeigt sich die kompositionelle Funktionder Verse. Sie könnten allein mit dieser Funktion gebildet worden sein. Da-gegen spricht, daß die Formulierungen ganz unterschiedlich sind. WährendJos 24,29 f. literarhistorisch oft zum Grundbestand des DtrG gerechnet wird1
beziehungsweise zu einer ersten Fortschreibung,2 kann der Vers 33 (bzw. 32 f.)einer priesterlichen Redaktion, die im ganzen Buch Eleasar nachträgt,3 oder
1 Becker, 69–71; Auld, Judges 1, 80–82.2 Blum, Knoten, 182–184, 206.3 Fritz, Josua, 224; Blum, Knoten, 201.
102 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
dem Grundbestand von Kapitel 24 zugerechnet werden.4 Reinhard GregorKratz erklärt alle Grabnotizen auf einer Ebene mit Jos 24,1–13.5
Die Information über Josuas Grab in Timnat Serah begegnet noch ein-mal in Ri 2,9 mit der Variante des Namens Timnat Heres. In Jos 19,49 f., imAnschluß an die Beschreibung des Stammesgebietes von Dan, wird die Zu-teilung dieser Stadt zu Josua beschrieben. Jos 19,49 f. ist zwar wahrscheinlichvon den Begräbnisnotizen abhängig,6 diese gehören aber schon zum erzäh-lerischen Grundgerüst im Übergang vom Josua- zum Richterbuch. ObwohlJos 24,29–31 also wahrscheinlich älter als die folgenden Bemerkungen zu Jo-sef und Eleasar ist, läßt sich eine bestehende Grabtradition aus Jos 24,30 desmasoretischen Textes nicht zwingend ableiten, wie es Volkmar Fritz schon fürvorexilische Zeit postuliert.7 Die Septuagintafassung dagegen setzt eine vor-aus,8 wenn es heißt »und dort sind sie bis auf den heutigen Tag«.
Daß die Gebeine Josefs extra in Ägypten aufbewahrt werden mußten(Gen 50,24–26), um später nach Sichem überführt zu werden (Ex 13,19;Jos 24,32), könnte der Versuch sein, die zwei gegensätzlichen Informationenzu vereinbaren, daß Josef in Ägypten gestorben ist, in Sichem aber sein Grabsteht, zumal Gen 33,18–20 – Jakobs Grundstückskauf – ein konkretes Grund-stück im Auge hat. Aber gerade diese Stelle läßt nicht auf eine Begräbnisstätteschließen. In Gen 50,25 ermahnt Josef seine Brüder, seine Gebeine mit nachKanaan zu nehmen. Im Kontext der vorausgegangenen Erzählung, daß Jakobin Hebron begraben wurde, wäre dieser Wunsch wohl auch eher so zu verste-hen, im Patriarchengrab beerdigt zu werden. Jos 24,32 verbindet beide Stellenmiteinander. Ob zu dieser Zeit in Sichem ein Josefsgrab bestand, bleibt damitoffen. Was Gen 33,18–20 und Jos 24,32 an Tradition zugrundeliegt, läßt sich– nicht unumstritten9 – aus dem Vergleich mit Gen 48,22 ableiten, wo Jakobdem Josef Sichem speziell zueignet: Die Bemerkung, er habe es vom Amoritererkämpft, widerspricht der Darstellung in Gen 33,19, Jakob habe es gekauft.Eine spezielle Josef-Sichem-Tradition wird damit wahrscheinlich.
In Jos 24,32 scheint auf diese Tradition Bezug genommen zu werden, wenn
es heißt: � ����� � % �����#�� � �� ��� ������ wayyihyû libnê-yôsef lenah.
alah ». . . und siewurden den Söhnen Josefs zum Erbteil.« Textkritisches Problem ist die Plural-form des Verbes. Vulgata und Peschitta lesen Singular – und sehen das Subjektdann offenbar in der � �� ���� �� � �� � �� h. ælqat hassadæh, »dem Teil des Feldes«. Dasist aber wahrscheinlich ebenso wie die Version der Septuaginta (��� ��!������"� #!�$ �� ������ »und er (Jakob) gab es Josef als Erbteil«) eine Har-
4 Haran, Temples, 69.5 Kratz, Komposition, 205 f.6 Noth, Josua, 123.7 Fritz, Josua, 250.8 Rofé, 23 f., der sie für ursprünglich hält.9 Vgl. u. a. Westermann, Genesis III, 217.
5.2 Offene Fragen 103
monisierung. Die lectio difficilior des masoretischen Textes ist nicht unsinnig,sondern könnte von den »Hundert Qesitta« beeinflußt sein. Es handelt sichevtl. um eine Flurbezeichnung, die erst die Erzählung vom Landkauf moti-vierte. Es ist unwahrscheinlich, daß das Fehlen von Jos 24,32b im Codex Vati-canus erster Hand die ursprüngliche (kürzere) Lesart darstellt. Die Auslassungkönnte die Schwierigkeit des hebräischen Originals nur anders umgehen wol-len.
5 . 2 O F F E N E F R A G E N A L S H I N W E I S AU F E I N E NT R A D I T I O N S G E S C H I C H T L I C H E N H I N T E RG RU N D
Die Grabnotiz des Eleasar beinhaltet Aussagen, die sich nicht aus sich selbstheraus abschließend erklären beziehungsweise die mit dem Josuabuch als grö-ßerem Kontext in Widerspruch zu stehen scheinen. Daher genügt eine textin-tern orientierte Erklärung nicht. Nach möglichen externen Voraussetzungenmuß gefragt werden.
Eleasar wird an einem Ort begraben, der seinem Sohn Pinhas zugeord-net bzw. nach ihm benannt ist. Sollte der Sohn bedeutender als sein Vateroder vielleicht schon vorher gestorben sein? Holzinger vermutet, daß hier ur-sprünglich vom Begräbnis des Pinhas berichtet wurde.10 Aus chronologischenGründen mußte das am Ende des Josuabuches erst einmal in eine Notiz vomTode Eleasars umgewandelt werden.11
Weiterhin ist auffällig, daß diese Information nicht mit dem vorher imBuch Josua Berichteten übereinstimmt. Nach Jos 21,10–21 erhielten geradenicht die Aaroniden, sondern die übrigen kehatitischen Familien Städte imGebirge Ephraim zugeteilt. Dieses Problem ist schon bald von der Schriftaus-legung erörtert worden.12
Gewöhnlich gilt dieser Widerspruch als Indiz für das Alter bzw. die Histo-rizität der Information, weil er eine feste Tradition voraussetzt, die im Zugeder Verschriftlichung nicht mit Kap. 21 harmonisiert werden konnte. So konn-te unter Berufung auf Jos 24,33 das hohe Alter der aaronidischen Genealogiebehauptet werden.13
Der einzige historische Schluß, der daraus gezogen werden könnte, ist, daßzum Zeitpunkt der Anfügung dieses Textes an das Josuabuch – also auf einerrelativ späten redaktionellen Stufe – eine Verbindung zwischen diesem Ortund Pinhas schon bestand. Da das Grab des Pinhas zunächst nicht erwähnt
10 Holzinger, Josua, 100.11 Hertzberg, Tradition, 97 f.; Noth, Josua, 134; Hertzberg, Josua, 139; Gunneweg, Levi-
ten und Priester, 163.12 Siehe oben S. 10.13 Haran, Temples, 70.
104 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
ist, läge evtl. nur der Ortsname – Gibea des Pinhas – vor, an den dieser Textanknüpft.14
5 . 3 Z U R S E P T U A G I N TAV E R S I O N
Da die Sterbe- und Begräbnisnotiz über Josua das Josuabuch abschließt undsich in Ri 2,6–9 in weitgehend wörtlicher Übereinstimmung wiederholt, ge-hen von dieser Notiz Überlegungen über die literarischen Zusammenhängebeim Übergang vom Josua- zum Richterbuch aus. Der Tod Josuas spielt einewichtige kompositionelle Rolle. Die Wiederholung ist im Grunde eine Not-wendigkeit in dem Moment, in dem Josua und Richter zwei jeweils in sichabgeschlossene Bücher darstellen. Es stellt sich dabei allerdings die Frage, anwelcher Stelle der ursprüngliche Platz dieser Notiz war und an welcher Stellesie wiederholt wird.15
Unter dieser Voraussetzung sind die relativ umfangreichen Anfügungen anJos 24,33 in der Septuaginta interessant. Darin werden nicht nur Pinhas’ Über-nahme des Priesteramtes von Eleasar und sein Tod und Begräbnis berichtet,sondern auch die Vorstellung ausgeführt, daß in der kommenden Periode dieLade nicht an einem einzigen Ort (etwa Silo) blieb, sondern unter den Is-raeliten herumgetragen wurde – also regelmäßig ihren Platz wechselte. Dassoll in der nachfolgend beschriebenen Periode – nämlich im Richterbuch –vorgestellt sein. Deshalb leitet der Schluß auch direkt zu den Richtererzäh-lungen über – allerdings nicht zu der ersten (Ri 3,7–11: Otniel), sondern zuder zweiten Erzählung, in der Ehud Israel von Eglon befreit (Ri 3,12–30). DieBemerkung über die Lade im griechischen Josua-Schluß soll auch ein Bild fürdie Richterzeit sein, denn in Ri 20,27 f. wird gerade Pinhas mit der Lade inBethel und nicht in Silo genannt – sie muß also den Ort gewechselt haben.Insofern stellt der griechische Zusatz zu Jos 24,33 eine Lesehilfe am Ende desJosuabuches für die folgende Richterzeit dar, in der einiges anders beschriebenwird als im Josuabuch.
Jos 24,33 Und danach geschah es:16 Auch Eleasar, der Sohn Aarons, der Priester, starbund wurde begraben in Gabaat Pinhas’ seines Sohnes, das sie ihm gaben im GebirgeEphraim.33a An jenem Tag nahmen die Israeliten die Lade Gottes, trugen sie untereinander umher,und Pinhas wurde Priester anstatt Eleasars, seines Vaters, bis er starb und begraben wurdein seinem eigenen Gabaat.33b Die Israeliten gingen jeder an seinen Ort und in seine Stadt. Und die Israeliten fürch-
14 Noth, Josua, 134.15 Auld, Judges 1, 80–82.16 Kursiv gesetzte Texte stellen Überschüsse der Septuaginta gegenüber dem masoretischen
Text dar.
5.3 Zur Septuagintaversion 105
teten die Astarte und Astarot und die Götter der Völker, die sie umgaben. Und der Herrgab sie in die Hand Egloms, des Königs Moabs. Und er herrschte über sie 18 Jahre.
Allerdings ist eingewendet worden, daß der griechische Josuaschluß eine al-te Überleitung von Josua nach Richter darstellen könnte, der die rahmendenEingangstexte des Richterbuches – die als Rahmungen jünger sein könnenals die Richtererzählungen selbst – noch nicht gekannt und gleich zu denRichtererzählungen übergeleitet hätte. Daß dabei Otniel übersprungen wür-de, ist weniger ein Problem, da diese Erzählung oft als eine kompositionelleSchöpfung eingestuft wird, die Juda an den Anfang setzen und einen ideal-typischen Richter zeichnen soll17. Alexander Rofé hat dafür plädiert, daß we-nigstens zwei parallel existierende Übergänge in hebräischen Fassungen vonJosua–Richter bestanden hätten, von denen der griechische Übergang, der inder Septuaginta freilich nur in seinem ersten Teil überliefert wäre, die bei-den Bücher nicht so stark voneinander trennen würde.18 Eine bemerkenswer-te Stütze findet er dafür in CD 5,1–5, wo mehrere Inhalte des griechischenJosuaschlusses nebeneinander aufgezählt sind. Das würde für die Existenz ei-ner hebräischen Vorlage sprechen.19 Allerdings kann man einwenden, daß dieDamaskusschrift das gleiche macht, was auch im griechischen Josuaschluß ge-schehen sein kann: Sie zieht Aussagen verschiedener biblischer Stellen für ihreArgumentation zusammen; im Kontext geht es eigentlich um David.
Auch andere Forscher haben dem Septuagintatext mehr Gewicht als demmasoretischen gegeben.20 Dabei spielt die Bewertung des griechischen Josua-textes insgesamt eine wichtige Rolle. Denn neben solchen Überschüssen zummasoretischen Text ist der griechische an vielen Stellen kürzer und könnteeine zu bevorzugende lectio brevior bieten. Während die Arbeit zum griechi-schen Josua von Johannes Hollenberg sich mit globalen Urteilen zurückhält,21
tendiert S. Holmes dazu, dem griechischen Text von vorn herein einen relativhohen Wert zuzuschreiben.22 Dem haben sich verschiedene Forscher ange-schlossen.23
Daß der griechische Text von Jos 24,33 eine hebräische Vorlage hatte, wirdoft für plausibel erklärt, weil eine Rückübersetzung relativ leicht falle24 undeinige Schwierigkeiten des griechischen Textes sich als Hebraismen erklärenlassen25. Hartmut Rösel hat dagegen eingewandt, daß sich die scheinbaren
17 Hertzberg, Josua, 162.18 Rofé, 28–33.19 Ebd., 28 f.20 Auld, What makes, 124 f.; Ders., Judges 1, 80–82; Tov, 386 f., 395.21 Hollenberg.22 Holmes, 1 f.23 Orlinsky, 195; Auld, Studies; Ders., Texts; Tov, 387.24 Holmes, 80.25 Rofé, 19 f., 26.
106 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
Hebraismen daraus ergeben, daß die Zusätze sich allesamt auf andere Bibel-texte beziehen und ähnlich formuliert wurde wie an diesen Stellen.26 Er deutetein schlagendes Gegenargument schon an, indem er auf die merkwürdige For-mulierung �� %����� �&' (���� verweist. Eleasar wurde im Gibea Pinhas’,seines Sohnes, begraben, und nun, so fährt der griechische Text fort, wirdauch Pinhas in seinem eigenen Gibea beerdigt. Rofé gibt diese griechischeFormulierung ins Hebräische rückübersetzt mit �� ��� ����� bgb�h �šr lwwieder. Genaugenommen müßte man den Ortsnamen des griechischen Tex-tes mit ���� gb�t wiedergeben. Das Problem ist jedoch, daß der Übersetzerdie constructus-Verbindung des masoretischen Textes insgesamt als Ortsnamenübernimmt %����� )�����. In der griechischen Erweiterung ist diese Verbin-dung auseinandergerissen, der status constructus von Gibea ist aber geblieben.Daher ist Rösel zuzustimmen, daß dieser Zusatz der Septuaginta keine eigenehebräische Vorlage hatte.
5 . 4 Z W I S C H E N E RG E B N I S
Von keinem der drei Gräber wird im hebräischen Text gesagt, der Leser könnesie noch sehen. Dennoch lassen sich für das Begräbnis Josefs in Sichem undfür das Gibea des Pinhas dem Text zugrundeliegende Traditionen wahrschein-lich machen. Für die traditionsgeschichtliche Fragestellung ist nun interessant,daß zu allen drei erwähnten Begräbnissen seit der Antike Heiligengräber inMittelpalästina beschrieben werden. Die Frage ist, ob diese LokaltraditionenRezeptionen von Jos 24,29–33 darstellen oder ob der biblische Text schon be-stehende Grabtraditionen voraussetzt, die evtl. von den späteren fortgeführtwerden.
5 . 5 Z U R L O K A L I S I E RU N G D E S G I B E A D E S P I N H A S
Die Hypothesen zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas sind bisher bestimmtgewesen durch die Annahme, es habe in der Antike zwei Konkurrenztradi-tionen gegeben.27 Die eine davon in ������ �awarta bei Nablus besteht nochheute und ist nach der These das samaritanische Gegenstück zu einem jü-dischen, später christlichen Grabkult im südlichen Gebirge Ephraim, in derNähe der Begräbnisstätte des Josua. Da darüber hinaus keine Anhaltspunktefür die Lage der biblischen Ortschaft gefunden werden, setzen viele sie vermu-
26 H. N. Rösel, Überleitungen, 348 f. Vgl. auch M. Rösel, Septuagintaversion, 207; Kratz,Hexateuch, 304.
27 Siehe unten S. 116.
5.5 Zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas 107
tungsweise mit einer dieser beiden Lokaltraditionen, meist mit der südlichen,gleich.
5.5.1 Die südliche Tradition
���� �
��������
�������
�
LXXPhilo
Josephus
Hieronymus
Euseb
Egeria Petrus Diaconus
Descriptio locorum
Beda
Isaak Helo
1. Jahrtausend 2. Jahrtausend
muslimische
samaritanische
jüdische
christlicheTexte
Liber JosuaeAbu’l-Fath
Yaqut Nabulusi
georgisches Rituale
?
Elle hammassaot
Abbildung 5: Stammbaum der zu den Grabtraditionen angeführten Quellen:Ältere Texte wie Bibel, Philo oder Josephus sind ganz allgemein breit rezipiert worden. DieLinien bezeichnen literarische Abhängigkeiten insbesondere bei den geographischen Angaben,wie sie in der Literatur beschrieben sind.29
Josephus erwähnt ein Grabmal Eleasars in einem Ort Gabatha (JosAntV,1,29).30 Eusebius scheint keine so konkrete Kenntnis von der Existenz einesGrabes zu haben. Er identifiziert das Gibea des Pinhas mit %���*� (wahr-scheinlich ��!� ����� el-geb�a) bei Eleutheropolis ( �$�� %��� �&'��� bet gibrın) in Juda,ordnet es dem Stamm Benjamin zu und läßt es sich trotzdem im Gebirge Eph-raim befinden.31 Es zeigt sich auch hier, daß Eusebius seine Angaben stark ambiblischen Text orientiert. Wie oben schon ausgeführt, müßte eine Stadt derAaroniden nach Jos 21 in Juda oder Benjamin liegen. Unter den vier Leviten-städten aus Benjamin in Jos 21,17 f. wird auch ein � ����� geba� genannt. Dahererklärt sich die Zuordnung zu Benjamin. Stamm Juda und Gebirge Ephraimscheinen nicht miteinander vereinbar zu sein.32 Wegen dieses Widerspruchesnehmen die meisten Exegeten einen Irrtum Eusebius’ an und greifen eine an-dere Ortschaft des Onomastikons auf, um das antike Gibea des Pinhas im
29 Kahle, 65; Jeremias, 13 f.; Keel u. a., I, 407, 414–417, 422, 436, 444 f.30 Clementz, 271 f.31 Klostermann, 70,22–25.32 Siehe aber den Erklärungsversuch auf S. 121.
108 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
Gebirge Ephraim identifizieren zu können,33 nämlich %�����, 5 Meilen nörd-lich von Guphna.34
Daß nach Hieronymus Paula die Gräber Josuas und Eleasars »von gegen-über« (e regione) verehrt hat (ep. 108, 13),35 deutete M. V. Guérin so, daß dasGibea des Pinhas in der Nähe von Timnat Serah liegen muß.36 Für JoachimJeremias befand sich Paula noch in Bethel und verehrte die beiden Gräber »ausder Ferne«.37 Die Angabe des Hieronymus bleibt ziemlich vage und bietet imGrunde wenig konkrete Anhaltspunkte. Eventuell wurde Paula einfach dasGebirge gezeigt, wobei auf den Bibeltext Bezug genommen wurde. Eine ge-nauere Angabe bietet Petrus Diaconus: Das Gibea des Pinhas mit den Gräbernvon Eleasar und Pinhas liege zwei Meilen von Josuas Begräbnisstätte – so je-denfalls die herkömmliche Deutung38 – entfernt (Bedae de locis sanctis VII).39
Petrus Diaconus ist primär eine mittelalterliche Quelle (ca. 1100–1153/58). Erhat zwar aus altkirchlichen Pilgerberichten geschöpft, ist aber auch als Fäl-scher bekannt.40 Als Quelle könnte ihm Egeria vorgelegen haben.41 Sicher istdas aber nicht.42 Joachim Jeremias hat als Zeugen ebenfalls das georgische Ri-tuale von Jerusalem angeführt.43 Darin wird das Gedächtnis der Aaronidenam 3. September in Thamnaqsar,44 also am Grab Josuas, gefeiert. Dann ist esaber wahrscheinlich, daß für Eleasar und Pinhas gar keine eigene Kirche imNachbarort bestand.
Auf die Angaben Eusebs hin,45 wird Timnat Serah mit Thamna gleich-gesetzt, das in der Antike Hauptort einer Toparchie war und mit
�� �'� ������ �(
h˘
irbet tibne identifiziert wird.46 Auf die zwei Meilen des Petrus Diaconuskönnte vom Namen her der heutige Ort
���'� �(� gıbiya passen.47 Deshalb wurdedas %����� des Onomastikons wegen einer byzantinischen Kirche48 mit demheutigen ����
���� �( h˘
irbet siyya bei���'� �(� gıbiya gleichgesetzt.49 F.-M. Abel plä-
33 Thomsen, 46, 52; Jeremias, 48.34 Klostermann, 74,1 f.35 Hieronimus, 42 f.36 Guerín, 462.37 Jeremias, 47, 49.38 Ebd., 49.39 Petrus diaconus, 110, 12–14; Weber, 96 f.40 Schwenzer.41 Weber, 92; Wilkinson, 306.42 Keel u. a., I, 416.43 Jeremias, 47.44 Goussen, 31.45 Klostermann, 100,1–3.46 Thomsen, 67; Albright, Results, 4 f.; Jeremias, 68; Finkelstein u. a., I, 367.47 Guerín, 462.48 Ovadiah, 124.49 Jeremias, 48.
5.5 Zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas 109
140 150 160 170 180 190
190
180
170
160
150
140
130
120
110
nablus
�awarta�
h˘
irbet selun
h˘
irbet et-tellgıbiyanebı s. aleh.h
˘irbet tibne
h˘
irbet sıya
gıfnabetın
tell en-nas.be
el-gıb geba�
tell el-fulnebı s.amwıl�
der el-�azar
Jerusalem
geb�a
bet gibrın
Abbildung 6: Für die Lokalisierung relevante Orte: Moderne Ortsnamen, an-tiker Straßenverlauf (nach TAVO B IV 6, B VI 10 und B X 12).
110 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
diert dafür, das nahegelegene Heiligtum des )� ��* +�,��� nebı s. aleh. als Fortfüh-
rung der Pinhas-Kulttradition zu sehen.50 Beide Ortslagen liegen allerdingsabseits der Straße Guphna–Nablus. Das paßt nicht zu der Formulierung desOnomastikons ��+����!� �,� -��� �./��.51
Dalman fand das Gibea des Pinhas in����" � ���� �( h
˘irbet et-tell am &� ���� �� � �-
wadi eg-gıb52, das auch 5 Meilen nördlich von Guphna und näher an der Stra-ße nach Nablus, aber nicht nur 2 Meilen von �� �'� ��
���� �( h˘
irbet tibne entferntliegt, und das einer Notiz bei Isaak Helo (šebîlê dîrûšlæm 3)53 entspricht.54����" � ���� �( h
˘irbet et-tell wurde mehrfach für die Lokalisierung eines Geba in
Ephraim vorgeschlagen (siehe unten S. 117).55 Dalman bezieht sich nur auf dieNennung eines Ortes Gibia zwischen Bethel und Silo. Helo identifiziert esallerdings mit dem biblischen Gibea Benjamins. Gerschom Scholem hat je-doch ausführlich dargelegt, daß das zitierte Werk von Isaak Helo mit hoherWahrscheinlichkeit eine moderne Fälschung ist.56
Von diesen beiden Lokalisierungsvorschlägen für die südliche Tradition
weist nur����" � ���� �( h
˘irbet et-tell 57, aber nicht ����
���� �( h˘
irbet siyya eisenzeit-liche Keramik auf. Relikte aus hellenistisch-römischer Zeit und von byzan-tinischen Kirchen sind an beiden Orten beschrieben worden.58 Sie kommenalso beide für die christliche Tradition in Frage. Für ����
���� �( h˘
irbet siyya istdie Lokalisierung der biblischen Ortschaft abgelehnt worden.59
In der Kreuzfahrerzeit bezeugt eine anonyme Beschreibung des HeiligenLandes eine Identifizierung des Gibea des Pinhas mit Gibea in Benjamin/Gibea Sauls,60 das – zwei Meilen nördlich von Jerusalem gelegen – sich gut
auf .� �/" ����� tell el-ful beziehen kann.61
Secundo miliario ab Jerusalem via que ducit Neapolim mons Gabaath, civitasque Finees,ubi sepultus est.62
50 Abel, Géographie, 335.51 Vgl. Elitzur, 3.52 Heute
�������$%& �� wadi el-h. aramıye (Schunck, 147; Elitzur, 5).53 Dalman, Jahresbericht 1912/13, 40; Eisenstein, 75, übersetzt bei Carmoly, 250.54 Beide Varianten erwägt Thomsen, 52.55 Alt, 50; Mazar, Geba. Dagegen Elitzur; Na�aman, 25.56 Scholem.57 Schunck, 149, sieht keine eisenzeitliche Siedlung belegt.58 Alt, 50; Schunck, 147–150; Ovadiah, 124; Kochavi, 170, 172; Finkelstein, 159 f.; Fin-
kelstein u. a., I, 395; II, 578.59 Ebd., I, 395.60 Wilkinson u. a., 184–203.61 Wilkinson, 68.62 De Vogüé, 428.
5.5 Zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas 111
Diese Notiz ist literarisch verwandt mit drei weiteren Stellen, die nicht alle das Gibeades Pinhas erwähnen. Alle Stellen gehen aber auf eine Weiterentwicklung der Be-merkung über das Gibea des Pinhas im Onomastikon zurück, da sie alle den sonstungewöhnlichen Namen Gabaath nennen oder voraussetzen, der oben mit der Ent-wicklung von Jos 24,33 in der Septuaginta erklärt wurde.63 Dem entsprechend kön-nen auch die unterschiedlichen Angaben zum Grab des Habbakuk erklärt werden,mit dem das Gibea des Pinhas in Zusammenhang gebracht wird. Ausgangspunkt istder griechische Text des Onomastikons: ����� �Jos 24,33�� ���� ������� � ���� �! �� " �# ��!��$��� �% &��'�� ��� ��!��$����� (�) �*� &� +��) ����,(-��� .� � / 0 �����1� ��!��2���� �!�1�� &��� (�) �� ��3�� �4��(�5�+ 6��(�2�� ��2 ��7��2� 8� 6� 2!3� ��� �����64
Bei der weiteren Rezeption dieses Textes rückte das Habbakuk-Grab interes-santerweise noch näher an Kirjat Jearim heran. Denn die oben genannte anonymeBeschreibung fügt an die Gleichsetzung von Gabaath Finees mit dem Gibea Saulseine Bemerkung zum Grab des Habbakuk an, das bei Emmaus, acht Meilen von Je-rusalem entfernt, liege, was sich in der Kreuzfahrerzeit auf '�
��(� �� ���) qeryet el-�enab
beziehen muß: Secundo Miliario ab Jerusalem via que ducit Neapolim mons Gabaath,civitasque Finees ubi sepultus est. Miliario ab Emaus contra meridiem Gabatha ubi Aba-cuc quiescit.65 Pinhas und Habbakuk folgen aufeinander wie im Onomastikon.
Dieser Text ist offensichtlich von der Übersetzung des Onomastikons durch Hie-ronymus abhängig. Sie lautet: Gabaath in tribu Beniamin urbs Finees filii Eleazar, ubisepultus est Eleazarus. est autem nunc Gabatha uilla in duodecimo lapide Eleutheropoleos,ubi et sepulchrum Abbacuc profetae ostenditur.66 Hieronymus hat schon das GebirgeEphraim gestrichen und an seine Stelle das Stammesgebiet Benjamins gesetzt, das beiEuseb erst am Schluß erwähnt war. Die anonyme Beschreibung interpretiert diesenText nun so, als ginge es um zwei unterschiedliche Orte, ein Gabaath, die Stadt desPinhas, und ein Gabatha, wo Habbakuk begraben liegt. Warum aber befindet sie sichbei Emmaus?
Hier hilft der Vergleich mit dem verwandten Werk des Rorgo Fretellus67. Diesesist 1137 entstanden, während die anonyme Beschreibung als Komposition um 1150 zu-sammengestellt wurde. Das literarische Verhältnis beider Werke zueinander ist nichtimmer zu klären und beteht offenbar in einer wechselseitigen Abhängigkeit. Die spä-ter verfaßte annonyme Beschreibung hat im Nachhinein wieder sehr stark auf Aus-gaben des Fretellus eingewirkt.68 Zu Habbakuk heißt es dort: Duodecimo miliario abEmaus contra meridiem Gabatha, in quo quiescit Abacuc.69 Sowohl bei Rorgo Fretellus,als auch in der anonymen Beschreibung ist die eigenartige Identifikation zwischenEmmaus und Eleutheropolis vorgenommen.70 Die zwölf Meilen von Emmaus imzitierten Text entsprechen den zwölf Meilen von Eleutheropolis im Onomastikon.Während bei Fretellus 1137 dieses Emmaus/Eleutheropolis 6 Meilen von Jerusalem
63 Siehe S. 106.64 Klostermann, 70, 22–25.65 De Vogüé, 428.66 Klostermann, 71,23–25.67 Vgl. Keel u. a., I, 444 f.68 Boeren, 4 f.69 Ebd., 39.70 De Vogüé, 482; Boeren, 38.
112 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
entfernt ist, befindet es sich in der anonymen Beschreibung (1150) mit 8 Meilen sehrnahe an '�
��(� �� ���) qeryet el-�enab, wo 1145 die Emmaus-Kirche eingeweiht wurde.
Möglicherweise geht die anonyme Beschreibung stärker auf lokale Gegebenhei-ten ein. Auf jeden Fall änderte sie, nachdem Eleutheropolis nach Emmaus verschobenwar, den Abstand zu Gabatha, indem sie das duodecimo ausließ, so daß der Ort jetztnur noch eine Meile entfernt im Süden liegt. Wenn das nicht einfach als Zeichen star-ker Konfusion der Textvarianten gedeutet werden soll, dann ist die wahrscheinlichsteLösung, daß es eine Lokalität mit Namen Gabatha oder ähnlich bei '�
��(� �� ���) qe-
ryet el-�enab gab. Da � �� �(� � �� der el-�azar in byzantinischer Zeit als Standort derLade betrachtet wurde, wird dem Schreiber der anonymen Beschreibung die Existenzdieses Gibea beim kreuzfahrerzeitlichen Emmaus bekannt gewesen sein, woraufhiner die ihm vorliegende Notiz »korrigierte«.
Die Bemerkung über das Gibea des Pinhas befindet sich bei Fretellus nicht direktvor der Nennung des Habbakuk. Sie lautet: Quarto71 miliario ab Iherusalem via queducit Sichem in tribu Beniamin, mons Gabaath civitasque Finees filii Eleazari, ubi etsepultus fuit idem Eleazarus. Wörtlich fast gleich, jedoch ohne die Nennung von Pin-has und Eleasar, erscheint in diesem Werk ein zweites Gabaath, zwei Meilen nördlichvon Jerusalem. Secundo miliario ab Iherusalem via que ducit Sychem: mons Gabaath intribu Beniamin.72
Da beide Nennungen eines Gabaath auf die Notiz des Onomastikons zurück-gehen, hat Rorgo Fretellus sich aus inhaltlichen Gründen offenbar genötigt gesehen,das Gibea des Pinhas und das Gibea, gegen das Israel unter Pinhas’ priesterlicherBegleitung gekämpft hat, voneinander zu unterscheiden. Dabei konnte er das erstemöglicherweise mit dem etwas weiter nördlich gelegenen *���� geba� identifizieren.
Eine starke Umformung hat der Ortsname in dem mit den bisher aufgeführtenTexten verwandten Traktat de distantiis von Eugesippus erfahren. Ohne von Pinhaszu sprechen lautet die entsprechende Notiz dort: Secundo miliario ab Jerusalem, via,quæ ducit Sichem, mons Sabauth in tribu Benjamin.73 Der ungewöhnliche OrtsnameGabaath – in der Vorlage möglicherweise schlecht leserlich – hat bei einem Abschrei-ber eine Assoziation mit Sabaoth hervorgerufen. In diesem Text wird Emmaus mitNikopolis gleichgesetzt, jedoch nur sieben Meilen von Jerusalem entfernt genannt,74
was viel eher auf das Emmaus der Kreuzfahrer in Abu Goš verweist. Vielleicht ist die-se Diskrepanz in den oben angeführten Texten ausgeglichen, indem Nikopolis durchE(le)uteropolis ersetzt wurde.
Zugrunde liegt in allen Varianten die Identifikation von Gibea Benjamin mitdem Gibea des Pinhas. Die Version der anonymen Beschreibung läßt die obenangeführte Entfernungsangabe von zwei Meilen bei Petrus Diaconus in neuemLicht erscheinen. Auch in seinem Text können die zwei Meilen den Abstandvon Jerusalem und nicht (wie bisher, siehe oben) von Thamnadsare bezeich-nen:
71 Andere Textzeugen Quinto, Boeren, 40.72 Ebd., 35.73 PG 83, S. 1000.74 PG 83, S. 1002.
5.5 Zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas 113
Thamnadsare . . . distat autem ab Ierusalem miliariis uiginti. In alio autem montead miliarium secundum est ecclesia, ubi requiescunt corpora sanctorum Eleazari etFinees.75 Bedae VII
Da beide Quellen aus dem 12. Jahrhundert stammen, ist wahrscheinlich, daßauch Petrus Diaconus sich auf die gleiche mittelalterliche Lokalisierung be-zieht. Auch alle anderen Entfernungsangaben in diesem Abschnitt (Zeilen 4–16) sind von Jerusalem aus gerechnet.
Weder Eusebius noch Hieronymus sprechen deutlich von einem beste-henden Grab. Petrus Diaconus gab den konkretesten Hinweis für die südli-che Tradition. Was er bezeugt, ist jedoch eine Kreuzfahrertradition 2 Meilen
nördlich von Jerusalem. Da zu dieser Zeit in .� �/" ����� tell el-ful keine Kirche
stand, sondern der Ort in römischer Zeit verlassen wurde,76 müßte die Kir-che, die Petrus Diaconus erwähnt, anderswo zu suchen sein. Vielleicht ist aberdie Ruine auf dem Tell77 für eine Kirche gehalten worden.
5.5.2 Die Tradition bei Sichem: ������ �awarta
Die einzige bis heute bestehende Tradition sind die Aaronidengräber in �������awarta.78 Der Name ������ �awarta wird oft vom Aramäischen abgeleitet.
Meist wird als Ausgangspunkt � ��� � �� � qeburta� – Begräbnis – angenommen,79
wobei das Qof zum Ajin geworden wäre.80 Daraus kann geschlossen werden,daß Gräber in diesem Ort schon in aramäischsprachiger Zeit so bedeutendwaren, daß der Ort danach benannt wurde.81 Wer an diesen Gräbern verehrtwurde, ist dabei noch offen. M. Grünbaum und Ran Zadok deuten den Na-men allerdings von der Wurzel �br.82 Für Zeev Wilnaj ist die Herkunft nichtgeklärt.83
75 Weber, 96 f.76 Albright, tell el fûl, 54 f.77 Beschrieben bei Conder und Kitchener, 158–160.78 Vgl. zum folgenden ebd., II, 303–305; Ebers und Guthe, 246; Canaan, Saints, IV, 3–49;
Wilnaj, mas.s.ebôt, 155–159; Colpe.79 Schlatter, 24 f.; Jeremias, 39.
80 ������ nach dem seder dorot (Goldziher, 16), ����� bei R. J. Kitzingen (ebd., 17)und bei Wilnaj, yehûda wešômerôn, 98, beide Formen bei Grünbaum, 195–199, belegt.Goldziher nimmt in beiden Fällen jedoch nur Verschreibungen an. Vgl. auch die Variantenbei Conder und Kitchener, II, 288.
81 Schlatter, 24 f.; Jeremias, 39.82 Grünbaum, 198 f.; Zadok, Notes, 158.83 Wilnaj, yehûda wešômerôn, 309.
114 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
Abbildung 7: el-�azer – das Kenotaph des Eleasar bei ������ �awarta.
Tatsächlich werden die Gräber in der Literatur erst ab dem 12. Jahrhunderterwähnt, dann aber sowohl von samaritanischen84, muslimischen85 wie jüdi-schen86 Schriftstellern. Aus dem 14. Jahrhundert stammt auch ein Bericht, daßChristen im 5. Jahrhundert die Gebeine der Aaroniden zu entwenden versuch-ten.87 Eventuell spiegelt sich hier ein Konflikt mit der seit der Kreuzfahrerzeitbelegten Konkurrenz nördlich von Jerusalem wider.
�� � !" � el-�azer gilt den Samaritanern als Eleasar. Seit dem 17. Jahrhundert
ist belegt, daß Muslime in ihm den mit Esra identifizierten �� � !" � al-�uzayr desKoran (Sure 9,30)88 sehen.89 Dieses Grab befindet sich alleinstehend auf demHügel 0�� " �
���� tell er-ra�s außerhalb des Ortes. Es sind hier unter anderem
Scherben aus der Eisenzeit I und II, persischer und römisch-byzantinischerZeit gefunden worden.90 Auch hier spricht also nichts gegen eine möglicheIdentifizierung mit dem Gibea des Pinhas.
84 Liber Josuae 40 (Juynboll, 40).85 Yaqut, 167; Nabulusi, 88 f., übersetzt bei Strange, 40; Marmardji, 151.86 �ellæ hammassa�ôt 2 (Eisenstein, 66, übersetzt bei Carmoly, 186).87 Abulfath, annales LII (Abel, Histoire, 323; Abulfath, LXXIV. 170, übersetzt bei Stenhou-
se, 238).88 Paret, 201.89 Canaan, Saints, VII, 59; Nabulusi, 88, Anm. 2.90 Kochavi, 67 f.; Finkelstein u. a., 700–702.
5.5 Zur Lokalisierung des Gibea des Pinhas 115
Abbildung 8: Das Pinhasgrab nach Ebers/Guthe, 245.
Der Ort steigt nach Osten zu einem weiteren Hügel an. Darauf lag das Grabeines ����� � al-mans.ur genannten Heiligen. Samaritaner und Juden sehendarin das Grab des Pinhas (Abb. 8). Dazu gehörte eine Moschee. 1958 wurdedas kleine verfallene Gebäude vergrößert. Dabei wurde das Grab des ����� �al-mans.ur zerstört.91
Carsten Colpe, der 1969 in ZDPV von der Zerstörung des Pinhasgrabes 195892 berich-tete, hat nur Vermutungen über den Grund dieses Vorgehens aufstellen können. Alsich am 26. September 1999 versuchte, vor Ort nachzufragen, bestätigten mir mehrereJugendliche, daß��+���� al-mans.ur durch den Bau einer Moschee zerstört wurde. ZurBegründung gab es nur eine antijüdische Bemerkung, die eher dem heutigen Konfliktzu schulden ist. Ob der Bau wahhabitischem Eifer93 oder eher politischen Ressenti-ments zum Opfer fiel, war nicht herauszubekommen. Die Vergrößerung der Moscheewar 1958 vielleicht einfach wegen eines sprunghaften Bevölkerungsanstieges94 nötig.
91 Colpe.92 Nach Zedaqa, 4, schon 1955.93 Paul.94 Hashim, 362 f.
116 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
Das Verschwinden des Grabes und die bewußt gegen die samaritanische Überlie-ferung gesetzte95 Zuordnung von Pinhas zu �,� � ��(� el-�azerat (dem Grab der siebzig
Ältesten) in Survey of Western Palestine96 hat in der Literatur – und dadurch evtl.auch bei heute praktizierten Besuchen – Auswirkungen, so daß neue Verehrungstra-ditionen entstehen könnten. So heißt es bei Israel Finkelstein und Zvi Lederman, daßin� � ��(� el-�azer nicht nur Eleasar, sondern auch Pinhas verehrt wurde.97 Zeev Wilnaj
und Sefi ben-Josef dagegen berichten, daß Pinhas im oberen Gebäude von �,� � ��(�el-�azerat verehrt werde.98 In keiner der drei Publikationen wird die Zerstörung er-wähnt.
5.5.3 Alter der Paralleltraditionen
Adolf Schlatter und ihm folgend Joachim Jeremias haben die antik-jüdischewie die samaritanischen Traditionen von den Gräbern der Aaroniden in vor-christliche Zeit datiert. Als Argument dient ihnen gerade das Bestehen derbeiden Konkurrenztraditonen, denn die Samaritaner hätten nicht gegen ei-ne christliche Tradition eine Konkurrenz eingerichtet.99 Wie oben gezeigtwurde, liegt der Fall aber gerade anders herum. Beide Traditionen sind erstmittelalterlich belegt, und zwar eine christliche gegen samaritanisch-jüdisch-muslimischen Konsens. Damit kann das Argument der alten Paralleltraditio-nen für diesen Fall nicht angewandt werden.
In Bezug auf die Pinhas-Gräber kann eigentlich nicht postuliert werden,sie seien aus dem masoretischen Text hergeleitet. Denn genau dort steht nichtsvon seinem Grab. Die evtl. unabhängig voneinander erklärbaren Belege in derSeptuaginta und in der christlichen sowie in der samaritanischen Traditionmüssen nicht zwangsläufig auf eine ihnen gemeinsam vorliegende Traditionverweisen. Denn es könnte sich in beiden Fällen von der Sachlogik her nahegelegt haben, Pinhas in seinem eigenen Gibea begraben sein zu lassen.
In ������ �awarta könnte für die Unabhängigkeit vom Bibeltext noch dieTatsache sprechen, daß das Pinhasgrab nicht auf dem gleichen Hügel wie dasEleasargrab lag, sondern auf dem benachbarten im Ort selbst.100 Es ist aberauch nicht ausgeschlossen, daß diese mittelalterliche samaritanische Tradition
95 Kitchener, 64.96 Conder und Kitchener, II, 303. Vgl. die Abbildung ebd., 304, mit Canaan, Saints, IV,
49 (Fig. III).97 Finkelstein u. a., 700.98 Wilnaj, yehûda wešômerôn, 98–101; Ben Josef, 345–347.99 Schlatter, 24 f.; Jeremias, 39 f.
100 Abulfath, 34, gleicht – wahrscheinlich bei der Paraphrase von Jos 24,33 – diesen Umstandaus: »He was buried in the citadel wich is opposite the Mountain which he had confidedto Phinehas« (Übersetzung nach Stenhouse, 43).
5.6 Aaroniden im Gebirge Ephraim 117
gegebene Gräber aufnahm – Gräber gleichnamiger, aber späterer Hoherprie-ster. Die Namen Eleasar und Pinhas wechselten unter den Hohenpriesternhäufig ab, so daß solche Identifizierungen belegt sind.101
5 .6 A A RO N I D E N I M G E B I RG E E P H R A I M
Da das Argument der Frühdatierung der Paralleltraditionen nicht mehr greift,kann von diesen mittelalterlichen Traditionen nicht so leicht auf die biblischeOrtschaft geschlossen werden. Deshalb wird die Frage jetzt noch einmal stär-ker von biblischen Texten aus betrachtet. Ausgangspunkt ist die Frage, warumPinhas als Aaronide gegen die Vorgaben von Jos 21 Besitz im Gebirge Ephraimbekommen hat. Da im Gebirge Ephraim die übrigen Kehatiter Städte zuge-teilt bekamen (Jos 21,21), wäre in Jos 24,33 eventuell auf einen solchen, in Jos 21als »nichtaaronidisch« gekennzeichneten Besitzanspruch verwiesen. »GebirgeEphraim« ist speziell Zusatz zu Sichem und Umgebung (Jos 21,21). Von da-
her legte es sich nahe, die samaritanische Grabtradition auf dem 0�� " ����� tell
er-ra�s bei ������ �awarta als mögliche Fortführung der biblischen Traditionernst zu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist zu fragen, ob das Gibea desPinhas nicht mit Gibea, Gibeon oder Geba in Benjamin identisch ist, die denAaroniden gegeben werden (Jos 21,17).
Götz Schmitt hat gezeigt, daß Jos 21 vor allem aus literarischem Gestal-tungsinteresse zu erklären ist. Er wendet sich daher gegen Auslegungen, die dieListen von Levitenstädten als historische Quellen für irgendeinen Zeitpunktüberbetonen. Am Ende unternimmt er aber selbst den Versuch einer solchenhistorischen Deutung für die südjudäischen Städte.102 Es ist wahrscheinlich,daß literarische Gestaltungen nicht losgelöst von sozialen oder geographischenGegebenheiten geschehen. Auf welcher Ebene solche Bezüge liegen, ist abernicht eindeutig greifbar.
Benjamin Maisler hat den nördlichen Grenzort des josianischen Juda � �����gæba� (2 Kön 23,8) nicht in 1�(� geba�
103, sondern – weil es nördlich von Bethel
liegen müsse – in����" � ���� �( h
˘irbet et-tell gefunden,104 das Dalman mit Gibea
des Pinhas in Zusammenhang gebracht hatte105 (siehe oben S. 110). Daran hatZ. Kallai-Kleinmann106 angeknüpft und auch das benjaminitische Geba damitidentifiziert. Patrick M. Arnold hat die weitreichenden von diesem vorausge-
101 Vgl. Colpe, 177.102 Schmitt, Levitenstädte.103 Görg, Geba104 Mazar, Geba. Dagegen Na�aman, 25.105 Dalman, Jahresbericht 1912/13, 40.106 Kallai-Kleinmann, 139 f.
118 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
setzten literarkritischen Hypothesen nicht akzeptiert und den Vorschlag daherabgelehnt.107 Er hat jedoch die mögliche kultische Bedeutung des Geba/Gibea(er identifiziert beide miteinander)108 von Benjamin als nördliche Grenzfestehervorgehoben.109
Gehören aber die benjaminitischen Stätte zum »Gebirge Ephraim«? Wennder Begriff »Gebirge Ephraim« weitergefaßt ist als das Stammesgebiet Eph-raims,110 liegt Benjamin auf dem südlichen Ausläufer dieses Gebirges. Wäh-rend nach Ri 3,15. 27 und 2 Sam 20,1. 21 Benjamin auf dem Gebirge Ephraimangesiedelt zu sein scheint,111 läßt sich aus Ri 19,16 schließen, daß Gibea ge-rade nicht mehr zu diesem Gebirge gehört112. In Ri 19,16 soll aber betontwerden, daß der Gastgeber kein Benjaminite, sondern aus Ephraim stammtund als »Fremdling« in Gibea wohnt. Aus literarischem Interesse wird also aufdas Territorium des Stammes Bezug genommen. Daher erklärt sich eine Dif-ferenz zwischen dieser Stelle und einem sonst möglicherweise weiter gefaßtenGebrauch von »Gebirge Ephraim«. Es ist demzufolge nicht auszuschließen,daß Jos 21,17 und 24,33 auf den gleichen Ort Bezug nehmen.
Setzt man das Gibea des Pinhas mit Geba in Benjamin gleich, dann wärevorjosianisch auch ein Lokalkult literarisch belegt (2 Kön 23,8).113 Bringt manes mit Gibeon in Verbindung, müßte die dortige Bamah und Zadok als ihrPriester in diesen Zusammenhang gehören (1Kön 3,4; 1Chr 16,39).114 Bezögeman es auf Gibea in Benjamin, ergäbe sich ein starker Kontrast dazu, daßPinhas gerade im Krieg gegen diese Stadt auftritt. Orientiert man sich an dernördlichen, vornehmlich samaritanischen Tradition,115 kommt eher Sichemals zugehöriger Kultort in Betracht.116
5 . 7 T R A D I T I O N S G E S C H I C H T L I C H E R B E Z U G Z U MG I B E A VO N K I R J AT J E A R I M
Ein weiteres Gibea wird in Kirjat Jearim erwähnt. Und hier findet sich im Bi-beltext ein traditionsgeschichtlicher Bezug zum Gibea des Pinhas, weil nach1 Sam 7,1 ein Eleasar ben Abinadab zum Hüter der Lade eingesetzt wurde. Inder korrespondierenden Stelle 2 Sam 6,3 werden zwei weitere Söhne Abina-
107 Arnold, 24.108 Ebd., 14.109 Ebd., 25, 109 f.110 Donner, Einführung, 31.111 Buhl, 89.112 Simons, 30; Zapletal, 279 f. Vgl. auch Noth, Welt, 50.113 Vgl. Arnold, 109 f.114 Vgl. Auerbach, Aufstieg, 238.115 Conder, Joshua’s Tomb, 23.116 Hertzberg, Josua, 139.
5.7 Bezug zum Gibea von Kirjat Jearim 119
Abbildung 9: Das genealogische Segment Eleasar ben Abinadab und Berüh-rungspunkte mit dem aaronischen Stammbaum.
dabs bei der Lade genannt: Usa und Ahjo. Der Tod Usas durch fehlerhaftenUmgang mit der Lade (V. 6) erinnert an den Untergang der beiden Aaronsöh-ne Nadab und Abihu (Lev 10,1–3), die durch Eleasar abgelöst wurden. Daherist öfter festgestellt worden, daß ein Verständnis von »Abinadab« als »Vaterdes Nadab« auf einen traditionsgeschichtlichen Zusammenhang mit Aaronverweisen könnte.117 Nach Ex 6,23 hieß der Großvater der Aaronsöhne müt-terlicherseits Amminadab (siehe Abb. 9).118 Damit sind für das Gibea vonKirjat Jearim und das Gibea des Pinhas drei Gemeinsamkeiten festzustellen:Die Einsetzung des Eleasar zu einem kultischen Dienst, auffallende Bezügezur aaronidischen Genealogie und der Ortsname Gibea.
Franz Schicklberger hat diese Namensähnlichkeiten gerade als literarischeStilisierungen in 1 Sam 6,20–7,1 gedeutet. Es werde angespielt auf die bekann-ten aaronidischen und levitischen Genealogien.119 Werden diese Genealogienschon vorausgesetzt, dann kann aus chronologischen Gründen der Text nichtdie Identität der Personen behaupten. Im folgenden Kapitel wird aber dieaaronidische Genealogie erst als nachexilische Neugestaltung einer zadokidi-schen Herleitung verstanden. Dann legt sich für die vorliegende Arbeit dieumgekehrte Richtung nahe: Die Namen der Ladehüter und -träger in Kir-jat Jearim repräsenieren eine Vorstufe der aaronidischen Genealogie, ein Seg-ment, das bei ihrer Bildung mit aufgenommen wurde.
Da oben den herkömmlichen Lokalisierungsvorschlägen für Gibea desPinhas ein wichtiges Argument zur Frühdatierung genommen wurde, legt essich für den alttestamentlichen Zusammenhang nahe, in diesem Gibea des
117 Nöldeke bei Budde, Samuel, 47. Vgl. ebd., 46 f., 228 f.118 Vgl. Blenkinsopp, Kiriath Jearim, 150.119 Vgl. Schicklberger, 144–147.
120 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
Abinadab (1 Sam 7,1a) den engsten Zusammenhang mit dem Gibea des Pin-has zu sehen. Jos 24,33 nimmt Bezug auf dieses Gibea des Eleasar, kombiniertes aber mit dem Namen Pinhas.
Eduard Robinson hatte Kirjat Jearim mit &��!" � ����
�� qeryet el-�enab (AbuGoš ) gleichgesetzt.120 Jetzt wird es meist mit dem auf der anderen Straßenseite(nordwestlich) liegenden Hügel � ���!" � ��� der el-�azar identifiziert.121 Dieserarabische Name wurde mit Eleasar in Verbindung gebracht.122 Dagegen wirdöfter betont, daß die heutige Namensform 2 ��3� ��� der el-azhar sei.123
Außerdem wurde auf den von den Muslimen im Ort verehrten �� � !" � +�,���
nebı el-�azer hingewiesen, der freilich mit Esra identifiziert wird.124 Ist aberder oben vermutete Zusammenhang vom Gibea des Pinhas und Kirjat Jearimplausibel, legt es sich nahe, in dieser Verehrungsstätte125 eine Fortführung derEleasartradition zu sehen.126 Daß bei Muslimen Esra und Eleasar ausgetauschtwerden können, ist oben am Beispiel des �� � !" � el-�azer gezeigt worden (sieheS. 114).127
Allerdings ist es möglich, daß diese moderne Verehrung des �� � !" � el-�azernicht die biblische Tradition fortsetzt, sondern dadurch begründet ist, daß derOrt bis in die Kreuzfahrerzeit für Kirjat Jearim gehalten wurde128. Am Stand-ort der Lade kann auch an ihren Wächter erinnert worden sein. Auch dieseit dem 16. Jahrhundert belegte Jeremiaverehrung in Abu Goš 129 kann zu der �� � !" � el-�azer-Tradition geführt haben. Die Koranstelle, auf die Muslime inAbu Goš die Tradition beziehen, ist Sure 2,259(261).130 Sie wird entweder auf �� � !" � al-�uzayr von Sure 9,30 oder auf Jeremia bezogen.131 Da aber die Jeremi-averehrung schwer zu erklären ist,132 läßt diese sich eher aus der muslimischenVerehrung ableiten als umgekehrt.133
120 Robinson, 588–591. Umfangreiche Diskussion von Gegenpositionen bei Conder und Kit-chener, III, 43–52.
121 Vincent, 415, 417; Cook, 115; Ehrlich.122 Vgl. Germer-Durand, 287.123 Vincent, 415; Lauffs, 265; De Vaux und Steve, 10.124 Lauffs, 295 f.; Canaan, Saints, IV, 16 f. ,50 f.; De Vaux und Steve, 114–116; Keel und
Küchler, II, 794, 799.125 Es ist kein Grab, sondern Gebetsstätte des Heiligen (Canaan, Saints, IV, 50 f.).126 So schon Clermont-Ganneau, Researches II, 62; Canaan, Saints, VII, 59 – auf Eleasar
ben Abinadab bezogen. Dagegen Lauffs, 295; De Vaux und Steve, 115.127 Vgl. Canaan, Saints, VII, 59.128 Lauffs, 280–282; Cook, 111; Keel und Küchler, II, 794; Ehrlich, 167 f.129 Robinson, 589; De Vogüé, 343; Lauffs, 287.130 Canaan, Saints, IV, 51.131 A. Th. Khoury, 186.132 De Vogüé, 343; Lauffs, 287 f.133 Vgl. De Vaux und Steve, 115, 118.
5.7 Bezug zum Gibea von Kirjat Jearim 121
Kirjat Jearim dient öfter als Grenzpunkt zwischen Juda und Benjamin(Jos 15,9; 18,14 f.). Daher kann es einerseits dem Stamm Benjamin zugeordnet(Jos 18,28) und andererseits mit der Apposition »in Juda« (Jos 18,14; Ri 18,12)versehen werden.134 Es liegt offenbar am Rand des Gebirges Ephraim, dennvon hier aus kann man dessen Grenze überschreiten (Ri 18,13). Damit bekom-men aber die oben erwähnten Aussagen des Onomastikon neues Gewicht.135
Denn dort wurde das Gibea des Pinhas sowohl Juda als auch Benjamin zuge-ordnet und dennoch ins Gebirge Ephraim verlegt. Möglicherweise sah auchEusebius einen Zusammenhang zwischen dem Gibea von Kirjat Jearim unddem Gibea des Pinhas. Wenn er das Gibea des Pinhas weiter südlich verortet,könnte er es für den Standplatz der Lade gehalten und daher auf der Höhevon Bet Schemesch gesucht haben.136
Genaugenommen ist in � ���!" � ��� der el-�azar die byzantinische Traditiondes Ladestandortes lokalisiert. Ob sie eine Fortführung der biblischen Ort-schaft ist, bleibt weiter offen. Joseph Blenkinsopp hat die verschiedenen text-lichen Probleme zum Verhältnis von Lade und Kirjat Jearim zusammengetra-gen.137 Er hält eine genauere Lokalisierung des Ladestandortes Gibea weiteroffen und schlägt als nahen herausragenden Punkt ����45 +�,�
�� nebı s.amwıl
vor.138 Zechariah Kallai lokalisiert das Gibea Kirjat Jearims in � ���!" � ��� derel-�azar, das Kirjat Jearim in Juda dagegen weiter südlich, so daß die Stam-mesgrenze dazwischen verliefe.139
Blenkinsopp weist auch auf den Zusammenhang zwischen Abinadab (Sep-tuaginta: 0�������) aus Kirjat Jearim und Amminadab in Davids Stamm-baum, zwischen der Lade und Ephrata (Ps 132,6–8) sowie die gemeinsa-me Herleitung von Betlehem und Kirjat Jearim über Kaleb von Ephrata(1Chr 2,50 f.) hin.140 Diese Beobachtung bestätigt auch die oben genannteNähe zur aaronidischen Genealogie, nach der Eleasar mit der judäischen Für-stenfamilie verschwägert ist (Ex 6,23). In 1Chr 2,42–55 wird ein enger Zu-sammenhang zwischen Kaleb und Kirjat Jearim hergestellt. Als Sohn Hebronstaucht hier Korach auf. Zu Korachiten hat Pinhas in 1Chr 9,19 f. eine enge-re Beziehung. Diese in der Chronik hergestellten Beziehungen stellen jedochnicht unbedingt alte genealogische Überlieferungen dar. Nach Thomas Willizeigt sich hier das starke Interesse des Chronisten, Beziehungen genealogisch
134 Vgl. Blenkinsopp, Kiriath Jearim, 143.135 Siehe oben S. 107.136 Vgl. die Überlegungen bei Robinson, 590 f., Anm. 4.137 Blenkinsopp, Kiriath Jearim. Vgl. auch Schicklberger, 133–139.138 Blenkinsopp, Kiriath Jearim, 151. Vgl. auch Arnold, 39 f.139 Kallai, Tribes, 332.140 Blenkinsopp, Kiriath Jearim, 150–154.
122 5 Jos 24,33 – Eine Lokaltradition?
darzustellen, wobei er »möglichst alle verfügbaren Überlieferungsdaten« be-rücksichtigt.141
Ob die biblische Ortschaft Kirjat Jearim mit � ���!" � ��� der el-�azar zuidentifizieren ist, bleibt letztlich offen. Sicher ist die Gleichsetzung erst in by-zantinischer Zeit. Der Hinweischarakter vom Gibea des Pinhas auf das Gibeavon Kirjat Jearim ist unabhängig davon als Textbezug festzuhalten. Da imfolgenden Kapitel die aaronidische Genealogie als zadokidische Konstruktionbeschrieben wird, die mit dem Namen Pinhas ein Element der elidischen Ge-nealogie aufgreift, ist in dem genealogischen Segment Eleasar ben Abinadabein zadokidisches Element zu sehen. Unter dieser Perspektive bekommt dieThese Karl Buddes, die freilich von anderen Beobachtungen ausging, neuesGewicht, daß Zadoks Herkunft aus dem Gibea von Kirjat Jearim abzuleitensei.142 Elias Auerbach hat von 1Chr 16,39 her Zadoks Herkunft von seinemDienst an der großen Bama in Gibeon erklärt.143 Beide Thesen können aufden gleichen Umstand verweisen. Kirjat Jearim gehörte nach Jos 9,17 zumgibeonitischen Bereich.144
Da in Jos 24,33 mit Pinhas ben Eleasar die Kombination zweier heteroge-ner Traditionen zu Tage tritt, ist die Todesnotiz des Eleasar literarisch nichtder Ebene von Jos 22 zuzuordnen, sondern ist sachlich schon in die Nähevon Num 25,1–13 zu stellen, wo die Person des Pinhas Gestalt bekam. Einedirekte literarische Beziehung zwischen Num 25 und Jos 24,33 ist jedoch nichtfeststellbar.
5 . 8 E RG E B N I S
Der Text von Jos 24,33 ist vor allem auf literarischer Ebene erklärbar. Er hat dieIntention, am Ende des Buches Josua mit dem Tod Eleasars die Zeit der Land-nahme abzuschließen. Fragen werfen aber das Verhältnis von Vater und Sohnund der Besitz der Leviten im Gebirge Ephraim auf. Traditionsgeschichtlichsetzt der Text etwas voraus: Ein Grab, eine Lokaltradition oder einen Ortsna-men.
Daher hat die Untersuchung auch die späteren Grabtraditionen mit inBetracht gezogen. Sie erklären sich in erster Linie als Rezeptionen des Bibel-textes. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß sie eine vom Text vorausgesetzteTradition fortführen. Schon die Septuaginta, die konkreter von den Gräbernspricht, gehört zu dieser Rezeption.
141 Willi, Chronik, 72. 76. 80.142 Budde, Herkunft, 48–50.143 Auerbach, Aufstieg, 238.144 Jüngst gegen beide Thesen Fabry, Zadok, 441.
5.8 Ergebnis 123
Die Lokalisierungsversuche waren bisher von der These geprägt, in derAntike hätten zwei Konkurrenztraditionen bestanden. Dieser These muß wi-dersprochen werden. Die aussagekräftigsten Quellen stammen erst aus dem12. Jahrhundert. Die Frage der Lokalisierung ist dadurch noch offener, als sieohnedies schon war. Ein traditionsgeschichtlicher Anhaltspunkt ließ sich je-doch mit dem genealogischen Segment Eleasar ben Abinadab im Gibea KirjatJearims finden. Dieser Zusammenhang könnte sogar die sonst als fehlerhafteingestuften Angaben des Eusebius erklären.145
Öfter wird ein Zusammenhang zwischen einer Grabnotiz und einer eph-raimitischen Kulttradition angenommen.146 Geht man von dem Auftreten derbeiden Pinhase in Silo und Bethel aus, bieten diese Orte, oder Mizpa, sichals naheliegende Kultorte an.147 Das ist freilich nur plausibel, wenn man dasGibea des Pinhas in dieser Region lokalisiert, wie es für die antike jüdischeTradition getan wurde. Mit der Infragestellung dieser Lokalisierungsversucheverliert auch dieser Beleg für Aaroniden in Ephraim an Aussagekraft. Der er-klärende Nebensatz »das ihm gegeben wurde im Gebirge Ephraim« in Jos 24,33ist bei der angenommenen Kombination zweier Traditionen als Hinweis aufPinhas ben Eli zu werten.
145 Siehe oben S. 107.146 Gall, 120 f.147 Dahm, 73; Blenkinsopp, Judaean Priesthood, 30–34; Auerbach, Das Aharon-Problem, 51
(Silo); Kallai, Rachel’s Tomb, 218 (Bethel).
6 Genealogische Texte
Wenn, wie oben im Kap. 1.4.2 ausgeführt, Genealogien die Funktion haben,die Beziehungen verschiedener Gruppen zueinander darzustellen, dann legt essich nahe, hinter den Namen der Ahnen Zeitgenossen des Autors – Einzel-personen oder Gruppen – zu vermuten. Die durch Genealogien systematischeingeordneten Personen können jedoch auch aus literarischen Zusammenhän-gen aufgegriffen worden sein. In diesem Kapitel soll das Zusammenspiel dieserbeiden Faktoren bei der Herausbildung der aaronidischen Genealogie darge-stellt werden.
Zuerst wird ein Vorschlag gemacht, die scheinbar verworrene Form derGenealogie in Ex 6,14–25 durch eine literarkritische Lösung durchschaubarerzu machen. Ein zentrales Problem bei der Behandlung der priesterlichen Ge-nealogien ist das Verhältnis von Zadok zu Aaron, also das Verhältnis zwischenden in der Frühzeit abbrechenden Stammbäumen im Pentateuch und denHohepriesterlisten in Chr und Esr/Neh, die von Aaron über Zadok hinausausgeschrieben sind. Als Schlüsselstelle zu dieser Frage muß die Problematikvon 2 Sam 8,17 besprochen werden. Schließlich könnte Esr 8,2 mit dem Be-griff der »Pinhasiden« � �� � � �� �� benê pîneh. as einen Beleg dafür bieten, daßsich Priester besonders auf den Namen Pinhas zurückführen. Es muß geprüftwerden, ob es sich dabei lediglich um eine Alternativbezeichnung für Aaroni-den oder Zadokiden handelt oder ob eine spezielle Gruppe dahintersteht.
6 . 1 E X 6 , 1 4 – 2 5
Eine ausführliche genealogische Einordnung von Pinhas ben Eleasar findetsich im Pentateuch in der Genealogie Ex 6,14–25. Sie steht in einem Erzähl-zusammenhang, der eine – viel dramatischer erzählte – Parallele in Ex 4,10–16hat: Mose versucht sich der Berufung zu entziehen, indem er seine kommu-nikative Kompetenz zur Führung des Volkes aus der Krise als ungenügenddarstellt. Daher stellt Gott ihm Aaron an die Seite. Im jetzigen Kontext, indem die Parallelen aufeinander folgen, wirkt die zweite Berufung wie eineBestätigung der ersten.1 Die Genealogie ist in diesen Erzählzusammenhangeingeschlossen, indem die ihr vorausgegangenen Aussagen hinterher zum Teilwörtlich wiederholt werden.2
1 W. H. Schmidt, 274.2 Vgl. Noth, Exodus, 42.
126 6 Genealogische Texte
Ex 6,13 Und der Herr sprach zu Mose und zu Aaron und ordnete sie ab zu den Israe-liten und zum Pharao, dem König Ägyptens, die Israeliten aus dem Lande Ägyptenherauszuführen. . . .Ex 6,26 Das sind Aaron und Mose, zu denen der Herr gesprochen hatte, die Israe-liten nach ihren Heeresabteilungen aus dem Lande Ägypten herauszuführen. 27 Siewaren es, die mit dem Pharao, dem König Ägyptens, redeten, um die Israeliten ausÄgypten herauszuführen. Das sind Mose und Aaron.
Diese zweite Berufungsgeschichte wird gewöhnlich P zugeordnet.3 Die ge-nannte Inklusion kann darauf verweisen, daß in einen Erzählzusammenhangetwas ihm Fremdes eingebaut wurde. Daher kann die Genealogie als sekun-däre Erweiterung von PG (Ps) zugeschrieben4 oder – PG zeitlich nachgeordnet– der Pentateuchredaktion zugeordnet5 werden. Die Inklusion kann jedochauch darauf hinweisen, daß in die Grundschicht des Kapitels eine vorgegebe-ne genealogische Tradition eingebaut werden mußte. Die Überlegungen aufS. 132 stellen die Genealogie zusammen mit Num 25,5–13. 19 in den Zusam-menhang der Endgestaltung des Pentateuch.
Die vorliegende Genealogie macht auf den Leser einen sehr fragmentari-schen Eindruck.6 Sie beginnt als Stammbaum aller Stämme Israels, führt dieersten beiden (Ruben und Simeon) aber nur kurz aus, während sie zu Levi vielweiter ins Einzelne geht und danach abbricht. Dieses Prinzip scheint inner-halb des Levi-Stammbaumes fortgeführt zu werden: von Generation zu Ge-neration verengt sich die Perspektive immer weiter: von allen Leviten auf dieKehatiter, innerhalb der Aaroniden auf die Eleasariden. In der letzten Genera-tion wird nur noch eine Person genannt: Pinhas. Bei einer linearen Genealogiewürde man in ihm das Ziel des Ganzen vermuten. Es ginge um seine Legiti-mation. In einer segmentierten Genealogie (siehe oben S. 25) geht es dagegenstärker um die Wechselbeziehungen zwischen den Namen. Von der Einbin-dung in den Erzählkontext her wird die Genealogie anderer Personen wegeneingeführt.
Der Text erscheint zunächst sehr unübersichtlich. Denn es werden nichtnacheinander die einzelnen Teillinien vorgestellt. Stattdessen wird der ganzeStammbaum generationsweise aufgeführt, so daß die Angehörigen einer Ge-neration, aber von verschiedenen Familien nacheinander genannt werden, be-vor der Stammbaum zur nächsten Generation übergeht. Nach diesem Schemaist der Text konsequent gestaltet. (Vgl. Abbildung 10).
Die Einleitung »Diese sind die Häupter ihrer Vaterhäuser« (Ex 6,14) kannsich mit »ihrer« auf zwei verschiedene Gruppen beziehen. In V. 13 gehen demdie »Israeliten« direkt voraus. Demnach wird also wirklich ein Stammbaum
3 W. H. Schmidt, 270–272.4 Noth, Exodus, 42.5 Otto, Pentateuchredaktion, 101.6 Vgl. Westphal, 219 f.
6.1 Ex 6,14–25 127
für ganz Israel eingeleitet, der dann auch mit Ruben und Simeon beginnt.Wenn der Leser aber die Konzentration auf Leviten und Priester sieht, kanner »ihrer« auch auf Mose und Aaron aus V. 20 beziehen. Sie werden ebenfallsin V. 13 genannt. Am Ende der Genealogie wird dieser Perspektivenwechselbestätigt, indem sie als Levitengenealogie abgeschlossen wird (V. 25b) – miteiner etwas verkürzten Terminologie (� ��� �� �abôt statt � ��� ��#�� ��� bêt-�abôt)wie die Eröffnung: »Diese sind die Vater(häuser) – der Leviten nach ihrenFamilien«. Demnach müßte es sich um einen Levitenstammbaum handeln.Gleich darauf wird aber noch einmal präzisiert: »Das sind Mose und Aaron«.
Dieses Spiel mit den Referenzen zwischen Stammbaum und Kontextmacht es unwahrscheinlich, den fragmentarischen Charakter auf Textverlustoder unachtsame Einarbeitung zurückzuführen. Die Verengung der Perspek-tive ist bewußte Gestaltung. Das Ganze wird wenigstens deshalb als Israel-Stammbaum begonnen, um Levis Position an dritter Stelle deutlich zu ma-chen. An sich geht es darum, im Zusammenhang mit dem Auftritt Aaronsdie priesterliche Genealogie einzuführen. Da Aaron aber neben Mose auftritt,muß das Verhältnis zu diesem, und deshalb auch zu den Leviten allgemein, ge-klärt werden. Allerdings erscheint Mose gegenüber Aaron zurückgesetzt. SeineSöhne werden nicht erwähnt.7 Die Bevorzugung der Eleasariden-Linie gegen-über Itamar wird dadurch ausgedrückt, daß sie noch eine Generation weiterausgeführt wird – bis auf Pinhas.
Kurt Möhlenbrink, von formalen Gesichtspunkten ausgehend, vermutete,in dieser Genealogie seien mehrere Überlieferungselemente (Schemata) mit-einander kombiniert worden.8 Dabei lassen sich zuerst die Elemente einerAaroniden-Genealogie herauslösen, weil sie im Erzähltempus gestaltet sind.9
Ex 6,20a Und Amram nahm sich Jochebed, seine Tante, zur Frau. Und sie gebar ihmAaron und Mose . . .23 Und Aaron nahm sich Elischeba, die Tochter Amminadabs, die Schwester Nach-schons, zur Frau. Und sie gebar ihm Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar. . . .25a Und Eleasar, der Sohn Aarons, nahm sich von den Töchtern Putiels – sich zurFrau. Und sie gebar ihm Pinhas . . .
7 W. H. Schmidt, 296.8 Möhlenbrink, 188.9 Ebd., 188. 190 f.
128 6 Genealogische Texte
����������������
��
����
����
��������
������
����
.
��
��
��
������
��������
16 Und das sind die Namen der Söhne Levis
Gerschon Kehat
17 Die Söhne GerschonsLibni und Schimi
���� ����� ������
18 Und die Söhne KehatsAmram
��� ��� ���� ��� ������ ������ ��� �
20 Und Amram nahm Jochebed seine Tante sich zur Frauund sie gebahr ihm Aaron und Mose.
��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� �����
23 Und Aaron nahm Elischeba, die Tochter Amminadabs, die Schwester Nahschons, sich zur Frau,und sie gebar ihm Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar.
25 Und Eleasar, der Sohn Aarons, nahm sich von den Töchtern Putiels – sich zur Frau,und sie gebar ihm Pinhas.
��� ���� ��� ������� ��� ������������� ���� ����� �������
14 Das sind die Häupter ihrer Vaterhäuser:
Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen IsraelsHanoch und Pallu, Hezron und Karmi.
��� ���� ��� ������ ������
15 Und die Söhne Simeons:Jemuel und Jamin und Ohad und Jachin und Zohar und Schaul, der Sohn der Kanaaniterin.
��� ���� ��� ������ !��"���
6.1 Ex 6,14–25 129
�����������������
��
������
������
��������
�� ����
������
�����
����������
������
.
���������
����
����������
�����������������
Levis nach ihren Zeugungen
Kehat und Merari��� ��� ���� ��� ������ ��#�� $���� ��� �����
und Jizhar Hebron Ussiel19 Und die Söhne Meraris
Mahli und Muschi
��� ���� ��� ������ ��#�� ���� ����� %��&��&���
21 Und die Söhne JizharsKorah und Nefeg und Sichri
22 Und die Söhne UssielsMischael und Elizafan und Sitri.
24 Und die Söhne Korahs:Asir und Elkana und Abiasaf.
Diese sind die Familie des Korahiters.
Abbildung 10: Darstellung des Textes von Ex 6,14–25 als genealogisches Schema.Unterschriften und Altersangaben sind serifenlos, die Fortschreibung kursiv gesetzt.
130 6 Genealogische Texte
Auch in Num 3,1–4 und 26,57–61 spielen erzählerische Elemente in der Aaro-nidengenealogie eine wichtige Rolle.
Num 3,4 Und es starb(en) Nadab und Abihu vor dem Herrn, als sie in der WüsteSinai fremdes Feuer vor den Herrn brachten. Aber Söhne hatten sie nicht. Und eswurde(n) Priester Eleasar und Itamar vor Aaron, ihrem Vater.Num 26,58b Und Kehat zeugte Amram. 59 Und der Name der Frau Amrams warJochebed, die Tochter Levis, die sie dem Levi in Ägypten geboren hatte. Und siegebar dem Amram Aaron und Mose und Mirjam, ihre Schwester. 60 Und es wurdedem Aaron geboren – Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar. 61 Und es starb(en)Nadab und Abihu, als sie fremdes Feuer vor den Herrn brachten
Die zugrundeliegenden Erzähltexte sind:
Ex 2,1 Und ein Mann aus dem Hause Levis ging hin und nahm die Tochter Levis. 2aUnd die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn . . .Lev 10,1 Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Pfanne undgaben darauf Feuer und taten darüber Räucherwerk und brachten es vor den Herrn
– ein fremdes Feuer, das er ihnen nicht geboten hatte. 2 Da ging Feuer aus von vordem Herrn und verbrannte sie. Und sie starben vor dem Herrn.
Die wörtlichen Übereinstimmungen sind mit Ex 2,1 f. nicht besonders stark.Eine direkte literarische Abhängigkeit zu postulieren, legt sich daher nicht na-he. Wahrscheinlich ist jedoch, daß die biographischen Hinweise zu Mose indiesem Text bei der Herausbildung der aaronidischen Genealogie mit aufge-nommen wurden. Wenn Ex 2,1 f. noch keine konkreten genealogischen Infor-mationen voraussetzt, könnte mit der Formulierung abgesichert sein, daß derVater von Mose und Aaron sich nach der Heiratsvorschrift für Hohepriester(Lev 21,14b: »sondern eine Jungfrau aus seinem Stamm10 nehme er«) richtete.»Die Tochter Levis« bezöge sich dann nicht auf eine Tochter des Stammva-ters, sondern auf eine Levitin. Sie ist determiniert, weil nur eine Levitin inFrage kommt. Erst Num 26,59 und Ex 6,20 hätten dann die Konsequenzengezogen, sie zur Tante gemacht und die Anstößigkeit, die sich daraus ergab,hingenommen (Lev 20,19 f.).
Auch wenn dieser Rückgriff auf Erzähltexte zur Aaronidengenealogie hin-zuzugehören scheint, bleiben Wortwahl und Informationszuwachs dabei of-fenbar variabel. Es gibt aber Informationen, die über die Textbezüge hinausbeiden Genealogien gemeinsam sind. So benennen sowohl Ex 6,20 als auchNum 26,59 die Levitin aus Ex 2,1 übereinstimmend als Jochebed. Gegen Möh-lenbrinks Aufteilung der Leviten in drei Schemata (Ex 6,16–19 – Levi + 2 Ge-nerationen; V. 21 f. – Jizhariter und Usieliter; V. 24 – Korachiten)11 wendet
10 Vgl. zur Übersetzung von �� ��� �� �ammaw als »seine Stammverwandten« Hulst, THAT II(Volk), 196 f., und Ruwe, 261 f.
11 Möhlenbrink, 189.
6.1 Ex 6,14–25 131
Werner H. Schmidt deren formale Gleichheit ein.12 Manfred Oeming hat dieharmonisierende Tendenz in Möhlenbrinks Schemata kritisiert.13 Im folgen-den werden Ex 6,21 f. 24 als Erweiterung der sonst literarisch einheitlichen Ge-nealogie beschrieben, in deren Grundschicht die Traditionen der ersten dreiGenerationen der Levigenealogie und der Nachkommen Amrams miteinan-der kombiniert sind.
Der literarische Schlüssel für den Stammbaum in Ex 6 liegt in dem Systemvon Abschlußformeln, kombiniert mit Altersangaben. Die Altersangaben ver-binden die Leviten- mit der prosaischen Aaronidengenealogie.14 Sie fungierenaber gleichzeitig in der Levitengenealogie als Abschlußformeln, weil sie wiediese nach der Generation der Söhne den Vater nennen. Sie ersetzen also diesonst bis in die Enkelgeneration Levis stets benutzten Abschlußformeln. Dadieses System von Abschlußformeln und Altersangaben Mose mit den Levitenverbindet und nur so der Stammbaum im Kontext seinen Sinn macht, zeigtsich hierin der Schöpfer bzw. Kompositor des konkret vorliegenden Stamm-baumes.
Eine Fortschreibung scheinen die Leviten ab V. 21 (also parallel zu demAaronidenstammbaum) zu sein. In V. 19 war der Levitenstammbaum schonabgeschlossen worden. Der Stammbaum wird nur noch selektiv weitergeführt.Zwei- von dreimal fehlen Abschlußformeln. Eine Beobachtung Rabbi Schmu-els ben Rabbi Meir (Raschbam) könnte Aufschluß über den Sinn dieser Er-weiterung geben:
»Dem Text gemäß war es hier nötig die verwandtschaftlichen Beziehungen bis zuMose und Aaron darzustellen, aber bis zu Korach, den Söhnen Usiels und Pinhas,die in der Tora, die uns vorliegt, erwähnt sind, [war es nötig] um zu wissen, wer siesind, die uns vorliegend erwähnt sind. [. . . ] Von den drei Söhnen Kehats Amramund Jizhar und Usiel führt er je ihre Söhne auf, aber von Hebron führt er nicht auf.Und wenn du einwendest, daß er keine Kinder hatte – aber stehen nicht im Pen-tateuch die Gemusterten geschrieben und die Familie des Hebroniters (Num 26,58)?Und warum führt er hier die Söhne Hebrons nicht auf? Weil ihre Namen nicht inder uns vorliegenden Tora erwähnt sind, aber jene drei, Amram und Jizhar und Usiel,deren Kinder sind in der Tora erwähnt; Amram wegen Aaron, Mose und Mirjam, dieSöhne Jizhars wegen Korach: Da nahm Korach ben Jizhar etc. (Num 16,1), die SöhneUsiels wegen Mischael und Elzafan: Und Mose rief Mischael und Elzafan, die SöhneUsiels, des Onkels Aarons (Lev 10,4). Und die Söhne Korachs Asir und Elkana, wie unsvorliegend geschrieben ist aber die Söhne Korachs starben nicht (Num 26,12), und dieSöhne Aarons, weil geschrieben steht und zu Mose sprach er: steige zum Herrn auf,du und Aaron, Nadab und Abihu (Ex 24,1), und Eleasar ben Aaron etc. wegen Pinhasben Eleasar. Aber die Söhne Itamars führt er hier nicht auf, weil sie nicht in der unsvorliegenden Tora erwähnt werden mußten.«15
12 W. H. Schmidt, 298.13 Oeming, 142 f.14 Vgl. Hieke, 218 f.15 Katzenelenbogen, Šemot I, 72, 74 f.
132 6 Genealogische Texte
Er erklärt die offensichtlichen Lücken des hinteren Teils der Genealogie so,daß nur die Personen Erwähnung fanden, die in der Tora auch an andererStelle erwähnt sind. Eingeschränkt auf die Leviten lag hier wahrscheinlichwirklich das Interesse der Fortschreibung in den Versen 21 f. 24. Sie fügt inden Stammbaum alle im Pentateuch genannten Leviten, deren genealogischeHerleitung von Levi ausgeführt ist, hinzu. Gegebenenfalls nennt sie zu die-sen Personen Brüder (von den Söhnen Korachs werden überhaupt erstmalsNamen genannt). Nicht aufgezählt sind: Eljasaf ben Lael (Num 3,24) undZuriel ben Abihajil (Num 3,35), zu denen der Text keine eindeutigen Hin-weise zur Eingliederung in die Genealogie bietet. Nicht genannt sind ebensoMirjam und die Söhne Moses. Sie müßten an die Prosasätze der Amramiden-genealogie anschließen, die jedoch nur auf eine Linie hinausläuft. Hier hat dieFortschreibung offenbar nicht eingegriffen.
Während die drei Formeln, die mit »diese« � ��� �� �ellæh beginnen, den äu-ßeren Rahmen bilden und die beiden Komplexe voneinander trennen, weisendie Altersangaben gerade auf das Verbindende hin, um das es geht: Sie mar-kieren die Linie Levi–Aaron.
Die segmentierte Genealogie von Kehat bis Pinhas zeigt eine bewußte Ge-staltung unter Aufnahme der in Pentateuchtexten vorliegenden Informatio-nen. An drei Stellen der Tora ist sie inhaltlich übereinstimmend (bis Eleasar),aber mit verschiedener Wortwahl eingefügt worden. Es liegt nahe, ihre Vor-kommen in Ex 6, Num 3,1–4 und Num 26,57–61 dem gleichen kompositio-nellen Konzept zuzuordnen. Die beiden Genealogien im Numeribuch habendie Funktion, zwischen Wüsten- und Landnahmegeneration zu unterschei-den. Dieser Unterscheidung dient auch der Abschluß der Plage in Num 25,8 f.Num 25,5–13 ist daher derselben literarischen Ebene zuzuordnen. Die Nen-nung von Putiel steht also in enger Beziehung zu Num 25 und muß zu dessenDeutung mit herangezogen werden.
6 . 2 E S R 8 , 2 – » D I E P I N H A S I D E N «
In Esr 8,2 wird ein Pinhaside neben einem Itamariden genannt. Das ver-wundert, weil diese beiden Ahnen, Pinhas und Itamar, nach ausführlicherenStammbäumen zwei unterschiedlichen Generationen angehören. Möglicher-weise repräsentiert der Text eine Vorstufe in der Entwicklung der aaronidi-schen Genealogie. In demselben literarischen Zusammenhang wird Esra ansEnde einer solchen priesterlichen Ahnenreihe gesetzt (Esr 7,1–5), in der auchEleasar aufgeführt wird. Esr 8,2 kann dabei aus einer älteren Quelle stammenund nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie der Gesamttext.
Die Bezeichnung »die Söhne des Pinhas« beweist noch nicht die Existenzeiner gesonderten Gruppe von Pinhasiden, denn so können sich später al-le nennen, die Anspruch auf hohepriesterliche Herkunft erheben. Deutlicher
6.2 Esr 8.2 133
setzt die Formulierung »die Söhne des Pinhas« in 3 Esr 5,5 die zadokidischeGenealogie voraus.16
In Esr 7,1 wird Esra genealogisch in die hohepriesterliche Familie einge-ordnet. In V. 5 ist dann auch Pinhas als sein Vorfahre genannt. 1 Chr 6,35–38 läßt zwischen Merajot und Amarja Serahja aus. Die Liste in 1Chr 5,29–41 ist sehr viel umfangreicher. So wird bezeichnenderweise Jeschua ben Je-hozadaq in Esr 7,1–5 nicht genannt, der vor Esras Auftreten Hoherpriester war(Hag 1,1), und dessen Vater in der genannten Vergleichsstelle an letzter Stellesteht (1 Chr 5,41). Das kann einerseits damit erklärt werden, daß Esra aus einerSeitenlinie der hohenpriesterlichen Familie stammte. Eine lineare Genealogiedeutet aber andererseits auf einen Amtsanspruch Esras hin. Die Formulierung»von den Söhnen Pinhas’« in Esr 8,2 läßt mehrere Nachkommen des Pinhasin einem Text zu.
Es ist möglich, daß in Esr 8,2 Namen genannt sind, die für bestimmtebabylonisch-jüdische Gruppen stehen. Insofern muß hinter den »Pinhasiden«hier noch keine Gruppe stehen, die auch als »Zadokiden« auftreten könnten.Es kann sich um eine eigenständige Gruppe handeln,17 die sich etwa von Pin-has ben Eli oder einem jetzt nicht mehr greifbaren Ahn dieses Namens herlei-tet. In eine andere Richtung deutet das Nebeneinander zu Itamar, das sich mitdem priesterschriftlichen und chronistischen Schema deckt, wie es in Esr 7,1–5vorausgesetzt zu werden scheint.
Welchen historischen Wert Esr 8,2 hat, hängt von der Bewertung der gan-zen Liste in ihrem Kontext ab. Einigen Auslegern scheint Esr 8,1–14 insge-samt eine rein literarische Schöpfung zu sein, die sich aus der HeimkehrerlisteEsr 2/Neh 7 ableiten läßt und deutliche Anzeichen einer bewußten Gestal-tung aufweist:18 Ein Großteil der Namen beider Listen stimmen überein.19 InEsr 8 ist daraus eine Zwölfzahl gemacht worden.20 Während in Esr 2/Neh 7und Esr 10 die vier Priestergeschlechter Jedaja, Immer, Paschhur und Harimbzw. Seraja, Paschhur, Amarja und Harim genannt werden, stehen der Listein Esr 8 zwei Vertreter je von Pinhasiden und Itamariden voran.21
Mowinckel verbindet den Zweifel an der Historizität der Liste wegen ihrerKünstlichkeit damit, daß sie ursprünglich nicht zu ihrem Kontext gehöre. DieListe stamme von einem ungeschickten Interpolator.22 Dagegen ist einzuwen-den, daß es gerade für die Historizität der eingefügten Liste spricht, wenn sie
16 Vgl. auch das Vorkommen der Formulierung in 6Q13 4 (DJD III, 127) und rekonstruiertin 4Q522 9ii7 (DJD XXV, 55).
17 So Blenkinsopp, Sage, 92.18 Mowinckel, 122.19 Ebd., 121 f.20 Ebd., 121; Kratz, Komposition, 79.21 Schaper, Priester und Leviten, 277 f.22 Mowinckel, 116–118.
134 6 Genealogische Texte
nicht in ihren Kontext paßt.23 Ulrike Dahm hat aber darauf Wert gelegt, daßdie Liste, wenn schon nach dem Vorbild der ersten Heimkehrerliste gestaltet,für ihren erzählerischen Kontext geschaffen ist, da das Fehlen der Leviten dasHauptmotiv der Erzählung darstellt.24
Übereinstimmend wird festgestellt, daß die Herleitung von Pinhas und It-amar die Einteilung in vier Priestergeschlechter abgelöst hat – entweder zuerstauf literarischer Ebene oder bei bestimmten Gruppen im babylonischen Exil.Die Frage ist, ob diese genealogische Umorientierung das Schema der aaro-nidischen Genealogie im Pentateuch schon voraussetzt25 oder ob dieses aucherst eine literarische Folge darstellt26. Das Nebeneinander von Pinhas und It-amar entspricht nicht gleichen Generationen in Ex 6. In 1Chr 24,3–5 sinddagegen exakter Eleasar und Itamar gegenübergestellt. Insofern könnte dasgenealogische System, was die Generationenabfolge anbetrifft, in Esr 8,2 nochoffen gewesen sein. Gerschom wird in den verschiedenen Listen der Nach-kommen des Pinhas sonst nicht aufgeführt.27 Insofern steht die Notiz auchmit den chronistischen Listen nicht auf einer Ebene. Das könnte gerade fürdie Historizität des Gerschom sprechen. Er stellte dann den Vertreter einerpriesterlichen Gruppe dar, die neben einer Gruppe von Itamariden auftritt.Ob beide sich von Aaron ableiten, wird an der Stelle nicht gesagt.
Setzt Esr 8,2 aber die Abfolge Aaron–Eleasar–Pinhas noch nicht voraus,dann müssen Pinhas und Itamar hier noch keine Aaroniden vertreten. DiePinhasiden könnten eben jene Gruppe sein, gegen die 1 Sam 2 f. polemisiert.28
Nach de Vaux stand Pinhas auch hier schon für die Zadokiden, die sich abermit der Gruppe, die sich von Pinhas ben Eli herleiteten (bei ihm Abjatariden),geeinigt hätten, und sich nun ebenfalls von Pinhas herleiteten, der aber zumAaronenkel geworden war: »Nach dem Einschub 1 Sam 2,27–36, der vielleichtunmittelbar nach der Reform des Josias, auf jeden Fall aber sicher vor Es-dras geschrieben ist, war das Haus Eli seit dem Aufenthalt in Ägypten für dasPriestertum erwählt. Es fehlte nur der Name Aarons, aber dieser mußte sichaufdrängen, als sich die Gestalt Aarons zum Hohenpriester in Israel formte.Ein Vergleich wurde zwischen den Nachkommen Sadoks und denen Abjatarsgeschlossen, die sich entsprechend mit den beiden Söhnen Aarons, Eleazar(oder dessen Sohn Pinchas) und Itamar, verknüpften.«29
Die Gestalt Aarons »formte sich« zum Hohenpriester. Dabei bleibt offen,ob das priesterliche Bild von Aaron und seinen Söhnen der aaronidischen Ge-nealogie schon vorgegeben war, oder ob sie erst als zadokisches Konzept zu
23 Rudolph, Esra und Nehemia, 79. Vgl. auch Williamson, 108 f.24 Dahm, 36.25 So Kittel, 405 f.; Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah, 161.26 So Nelson, 10.27 Mowinckel, 119.28 de Vaux, Lebensordnungen II, 236. Vgl. oben S. 20.29 Ebd.
6.2 Esr 8.2 135
erklären sind. Zu unterscheiden ist dabei zwischen der Nennung Aarons mitNadab und Abihu (Ex 24,1) und der Nennung aller vier Söhne (Ex 28,1) sowieder Erzählung vom Tod der beiden älteren Söhne. Nadab und Abihu erklä-ren sich als Anspielung auf die beiden Söhne Jerobeams (1Kön 14,1; 15,25).Der Bericht über ihren Tod läßt sich mit dem genealogischen Segment Usaben Abinadab erklären. Eleasar und Itamar stellen dann zwei Gruppen dar,die durch das neue genealogische Konzept einen Kompromiß gefunden ha-ben. Über Pinhas ben Eleasar wird gesagt, daß er gerade den zadokidischenAnspruch auf Vorherrschaft kraftvoll in Szene setze.30
Daß Pinhas und nicht Eleasar neben Itamar genannt wird, stellt keine un-erklärbare Spannung dar. Schließlich bleibt Eleasar im Hexateuch eine ziem-lich blasse Gestalt, während Pinhas den Bund verliehen bekommen hatte.Nimmt man Esr 7 f. als literarische Schöpfung ernst, werden nebeneinan-der gleich drei Pinhasiden genannt: Esra (7,1–5), Gerschom (8,2) und Eleasar(8,33). Pinhas gilt offenbar hier als wichtigster genealogischer Bezugspunkt fürPriester. Esra als Hauptfigur leitet sich von ihm ab.31
Auf jeden Fall kann Esr 7,1–5 als Anhaltspunkt für eine Datierung der ge-nealogischen Ableitung Aaron – Pinhas – Zadok dienen. Esra wird mit dieserGenealogie versehen – zu datieren ist also zeitgleich zu oder nach Esra. Wenndie Herleitung wichtiger Personen von Pinhas die Kapitel 7 und 8 prägt, kanndiese priesterliche Legitimierung nicht bedeutungslos sein.
Die Vermischung mit fremden Völkern war für Pinhas ben Eleasar auchin Num 25 und Num 31 ein Problem. Hier in Esra/Nehemia wird zwar nichtvon Midian gesprochen. Daß aber auch arabische Bevölkerungsgruppen imSpiel sind, zeigt Neh 4,1.32 Bezeichnend ist auch, daß Esra, selbst ein Prie-ster, gegen die Mischehen unter Priestern, Leviten und Israeliten vorgeht, ver-gleichbar dem Pinhas in Num 25. Num 25,5–13 gehört in die abschließendePhase der Pentateuchwerdung (vgl. oben Kap. 2.7). Schon die biblische Dar-stellung weist diesen literargeschichtlichen Vorgang in die Verantwortung vonEsra, und auch moderne Thesen zur Pentateuchentstehung weisen ihm einezentrale Rolle zu.33
Falls Joachim Schaper recht hat, daß sich die Priester im Gegensatz zuden Leviten eher in Opposition zu Esra begaben,34 zeugt diese Herleitung desEsra über Pinhas davon, daß die Reformtätigkeit Esras auch von Priestern –eventuell zu einem späteren Zeitpunkt – positiv aufgenommen wurde.
30 Westphal, 224; Milgrom, 216. 479; Rooke, 52.31 Rudolph, Esra und Nehemia, 79.32 Vgl. auch Van Seters, 76; Schaper, Priester und Leviten, 254.33 Vgl. den Überblick bei Zenger, Tora, 81 f.34 Schaper, Priester und Leviten, 255–258.
136 6 Genealogische Texte
6 . 3 2 S A M 8 , 1 7 – D A S V E R H Ä LT N I S Z U P I N H A S B E NE L I
��������������
�������
��������
������
�����
������
��������
Amram
Aaron Mose
GerschomElieserRi 18,30
Jonatan
ItamarEleasar
Pinhas
Eli
Pinhas Hophni
IkabodAhitub
Ahia 1 Sam 14,3Ahimelek
AbjatarZadok
1 Sam 22,20
Ahitub 2 Sam 8,17
1 Chr 24,3
Esr 7,1–5
Ex 18,3 f.
Ex 6,20. 23. 25
Abbildung 11: Vereinfachte Darstellung priesterlicher Genealogien. Ein ent-scheidender Punkt ist 2 Sam 8,17, wo Zadok in die elidische Linie eingeordnetwird, obwohl er später die aaronidische Linie vertritt.
Um das Verhältnis von Pinhas ben Eleasar und Pinhas ben Eli zu klären, muß2 Sam 8,17 besprochen werden, denn an dieser einen Stelle kann der Eindruckentstehen, Zadok, der nach Chr und Esr/Neh als Nachkomme Pinhas benEleasars gilt, sei ein Enkel Pinhas ben Elis. Innerhalb einer Liste von DavidsBeamten werden »Zadok ben Ahitub und Ahimelech ben Abjatar, Priester«��� ��� �$ � ���� � ��#DZ ��� ! �� ��� ������ ����� ����#DZ ��� � ��� �� genannt. Diese Notiz überraschtim Kontext der Samuel- und Königebücher.35 Denn erstens gehören Zadokund Abjatar auf eine Ebene, und zweitens ist unklar, wie Zadok seine eigeneFamilie ablösen kann, wenn mit der Entlassung Abjatars durch Salomo dieProphezeiung an Eli in Erfüllung gegangen ist (1 Kön 2,26 f.). Für das ersteProblem ist die Version der Peschitta interessant, denn sie setzt Abjatar paral-lel zu Zadok, nennt aber seinen Vater Abimelech. Diese Variante ist als Har-monisierungsversuch angesehen worden. Nach 1 Sam 22,20 müßte die Reiheheißen: Abjatar ben Ahimelech ben Ahitub. Da dann ursprünglich Zadokohne Vorfahren am Anfang stand und dann zu Abjatar drei Generationenangegeben waren, habe ein Abschreiber aus einem eher oberflächlichen syste-
35 Wellhausen, Text, 176 f.; Maurer, 184. Vgl. auch Thenius, 184 f. und Rowley, 113–115.
6.3 2 Sam 8,17 137
matischen Interesse die Namen neu zugeordnet.36 Wellhausen geht dagegendavon aus, daß derjenige, der in den Text eingegriffen hat, Zadok gegen Ab-jatar aufwerten wollte, also letzteren nicht mehr unter David amtieren ließ.Seiner Meinung nach war die ursprüngliche Reihenfolge genau umgekehrt:»Abjatar ben Ahimelech ben Ahitub und Zadok, Priester«. Es war also keinVersehen, sondern Absicht, denn die Chronik hätte ganz bewußt nur an die-ser einen Stelle angeknüpft.37 Sie setzt jedenfalls mit 1 Chr 18,16 schon dieFormulierung »Zadok ben Ahitub« aus 2 Sam 8,17 voraus.
Dieser »verderbte« Text (2 Sam 8,17) ist also der erste Ansatz zu einer zado-kidischen Genealogie, der zur Bildung der Linie von Aaron bis Zadok in Chrund Esr/Neh geführt hat. Dazu war es offenbar möglich, sich eines Namensder elidischen Linie – Ahitub – zu bedienen. Ulrike Dahm hält die Herlei-tung Zadoks von Ahitub sogar für historisch zutreffend,38 worauf jedoch außer2 Sam 8,17 keine weitere Stelle wirkliche Hinweise gibt. In den späteren aus-gearbeiteten Genealogien erscheint dieser Name für einen Vorfahren Zadoksimmer wieder. Mit dem Namen Pinhas findet sich ein zweiter Name der elidi-schen Genealogie in den aaronidisch-zadokidischen Priesterlisten wieder. DieVermutung legt sich nahe, daß diese »Verdopplung« einer Person zum selbenVorgang gehört – der Neubildung einer Genealogie für Zadok unter Anknüp-fung an der elidischen Genealogie. Möglich ist, daß die Eliden sich schonvorher auf Aaron zurückbezogen (der Ahn in Ägypten – 1 Sam 2,27). Dannlag die Verbindung von Aaron nach Pinhas schon vor und muß im Penta-teuch noch nicht zwangsläufig auf Zadok hinauslaufen. Ist aber Aaron einneu geschaffener Ahn (Eli eher auf Mose zurückgeführt), dann geht ihm dieVerbindung von Pinhas zu Zadok voraus, so daß jede aaronidische Genealogiein der Tora schon auf Zadok hinauslaufen müßte.
Diese Entscheidung gegen ein vorexilisches – von Zadokiden unterschie-denes – aaronidisches Priestertum wird mit der vorliegenden Arbeit gestütztdurch die Beobachtungen zu Ri 20,27 f. und Jos 24,33, die beide mit als Ar-gumente für die Verortung der Aaroniden in Bethel angeführt wurden,39 diejedoch beide dafür nicht taugen (siehe oben S. 95 und 123). Literarisch er-scheint Aaron als Priester frühestens in exilischen Texten.40 Die Kontroversein Ex 32,25–29 erklärt sich hinlänglich als eine zwischen Priestern und Leviten.Die Nähe zwischen Aaron und Jerobeam liegt auf einer anderen literarischenEbene und ist sicher eine polemische Anspielung auf die Exodus-Kulttraditiondes Nordreiches41 – aber nicht gegen seine Priesterschaft, sondern gegen des-sen eigenmächtige Einsetzung durch einen Volksführer.
36 Maurer, 184.37 Wellhausen, Text, 176 f.38 Dahm, 55–61.39 Aberbach und Smolar, 137; Haran, Temples, 69 f.40 Valentin, 37–39.41 Pfeiffer, 40.
138 6 Genealogische Texte
Ex 6,14–27 oder, wenn man so will, auf jeden Fall die Erweiterung derAaronidengenealogie bis auf Pinhas, setzt die Verbindung von Zadok zu Ahi-tub und deren Umdeutung in eine aaronidische Abstammung voraus. Sie ge-hört damit in die Nähe der Hohenpriesterreihen in Esr und Chr, ist jedenfallsschon auf Zadok hin konzipiert, auch wenn aus internen Gründen des Penta-teuch nur bis Pinhas ausgearbeitet.
Es ist zu bedenken, welche Funktion Pinhas als letzter genannter Prie-ster im Pentateuch, Josua und Richter erzählerisch haben könnte. Liest manden Enneateuch von vorn, so wird mit den Eliden in 1 Sam eine priesterlicheFamilie genannt, deren Zusammenhang mit der im Pentateuch beschriebe-nen Aaroniden-Genealogie zu wünschen übrig läßt. Der zuvor letztgenannteName eines Priesters, Pinhas, läßt dem Leser wenigstens assoziativ die Mög-lichkeit offen, daß damit ein Zusammenhang zwischen den beiden Genealo-gien bestehen könnte, zumal dieser Pinhas beim Ladeheiligtum gedacht ist,das von den Eliden in Silo verwaltet wird. In Ri 20,27 befindet sich der be-wegliche Kultort schon ganz in der Nähe von Silo, in Bethel. Liest man dieSamuel- und Königebücher aber dann weiter, wird klar, daß die Eliden als le-gitime Linie ersetzt werden, so daß sie nicht diejenigen Nachkommen Aaronsbzw. Pinhas’ sein können, denen das Amt am Heiligtum oblag.
Das vorläufige Ende der aaronidischen Genealogie dient also offenbar da-zu, den Fortgang des Pentateuch für verschiedene Gruppen offenzuhalten, sowie eben auch keine Entscheidung für Jerusalem oder Garizim genannt wird.Es ist dennoch deutlich, daß dem Komponisten die eigene Parteizugehörig-keit schon klar war – die Fortführung der aaronidischen Genealogie bis zuPinhas wird in der vorliegenden Arbeit aus zadokidischem Interesse herausgedeutet.42
Für die Rekonstruktion der Entstehung der aaronidischen Genealogie stel-len die Aaroniden des Pentateuch den vorläufigen Endpunkt der Entwicklungdar. Wie läßt sich der vorausgegangene Konflikt historisch greifen? Zadokund Abjatar gehören in den literarischen Komplex der Aufstiegsgeschichte Sa-lomos. Für spätere Konflikte sind diese Texte nicht der Ausgangspunkt, son-dern sie stellten eine geeignete Projektionsfläche dar. Greifbar wird ein solcherKonflikt mit Ez 44, wo Zadokiden gegen Leviten polemisieren, obwohl siesich dem Stamm Levi zugehörig fühlen. Daß eine Gruppe nach Zadok be-nannt ist, zeigt deutlich die Selbstwahrnehmung mit Bezug auf die Aufstiegs-geschichte. Das Schicksal der Eliden ist in den Samuelbüchern als Vorausan-zeige auf den Konflikt zwischen Zadok und Abjatar gestaltet. Damit dürftendie Erzählungen um die Eliden diesen bei Ezechiel bezeugten Konflikt zwi-schen Zadokiden und Leviten abbilden. Von Seiten der Zadokiden wird denLeviten ihre Herleitung aus Ägypten zugeschrieben. Das ist plausibel und paßtzur Bindung der Leviten an Mose sowie die ägyptischen Namen Hofni und
42 Vgl. zur grundsätzlichen Offenheit des Pentateuch Konkel, 382.
6.3 2 Sam 8,17 139
Pinhas. Auch die Priesterschaft von Dan, die als levitisch eingeführt ist, wirdin später Zeit und polemischem Kontext auf Mose zurückgeführt, wobei ex-plizit auf die Parallelität zum Heiligtum in Silo verwiesen wird (Ri 18,13).
Es ist dabei bemerkenswert, daß ein wichtiger Ort jüdischer Ansiedlung inÄgypten, Tachpanhes (Jer 43,7), vom selben Stamm gebildet ist wie der NamePinhas, die »Nubierburg«. Der Erzählzusammenhang von Jer 41–44 macht eswahrscheinlich, daß judäische Bevölkerungsgruppen in Ägypten sich von ei-ner Auswanderung aus der Gegend von Mizpa herleiteten. Wenn sich eineGruppe von Priestern in Palästina von Pinhas ableitet, bezeugt das möglicher-weise in umgekehrter Richtung eine enge Beziehung zwischen judäischer Be-völkerung und dieser Stadt – vorstellbar bei einer Gruppe von Rückkehrern.Daß dem Vorfahren des Pinhas ben Eli in Ägypten das Priestertum zugespro-chen wurde, stützt diese Vermutung. In 1 Sam 2,27 zeigt sich dieser Ägypten-bezug dann jedoch nicht durch die Nennung von Tachpanhes. Er ist deutlichin den Zusammenhang der Knechtschaft und des folgenden Auszugs gesetzt.
Die Einbindung Zadoks in die Familie Abjatars in 2 Sam 8,17 – ob sekun-där oder nicht – wird vor der Gestaltung dieser Elidenerzählungen anzusetzensein. Mit ihren Bezügen auf Dtn 18 sind sie frühestens exilisch zu datieren.Hinterher war es jedoch nötig, die zadokidische Genealogie neu zu gestalten.Dabei wurden einzelne Elemente der Genealogie übernommen (Ahitub, Pin-has). Daneben wurde sich einer anderen Sequenz bedient, nämlich Eleasarben Abinadab aus dem Gibea von Kirjat Jearim (1 Sam 7,1). Hierbei handeltees sich nicht um eine levitische Genealogie. Das wird nach der Umgestaltungnoch damit angedeutet, daß über Amminadab die Verschwägerung mit Judabeschrieben wird. Die Erweiterung der Aaronsöhne um Eleasar und Itamar istdurch Lev 10 in Anlehnung an 2 Sam 6,1–8 gestaltet worden. Das hat in ei-nem zweiten Schritt zur Ausarbeitung der aaronidischen Genealogie geführt,die auf den (neuen) Pinhas weitergeführt wurde, der in Num 25 zum heraus-ragenden Priester stilisiert worden ist.
Wenn Aarons Söhne Nadab und Abihu schon zu den Elementen im Zu-sammenhang Aarons gehören, die von der Erzählung des goldenen Kalbesauf die »Sünde Jerobeams« hindeuten (Jerobeams Söhne Nadab und Abija),43
dann bot Eleasar ben Abinadab einen guten Anknüpfungspunkt für den ge-nealogischen Umbau: Aaron, der nun der zadokidischen Genealogie voran-gestellt wird, bekommt neben seine Söhne Nadab und Abihu den Eleasarbeigesellt. Der vierte Sohn Itamar ergab sich von seinem Gegenüber zu Pin-has (Esr 8,2). Nadab und Abihu freilich, die in der priesterlichen Genealogiefunktionslos wurden, ereilte in Lev 10 ein ähnliches Schicksal wie Usa, demanzunehmenden Bruder Eleasars.
Die Zadokiden, die mit dieser genealogischen Umgestaltung beschäftigtwaren, könnten im Gibea von Kirjat Jearim von einer eigenen Kulttradition
43 Kennett, 165; Aberbach und Smolar.
140 6 Genealogische Texte
gewußt haben. Genausogut ist möglich, daß sie die Texte über die Aufbewah-rung der Lade im Hause des Abinadab als Anhaltspunkt nahmen, um eineHerkunft Zadoks zu rekonstruieren. In Jos 24,33 spiegelt sich die Kombinati-on dieser beiden Stränge: Pinhas ist mit dem Gibea des Eleasar verbunden.
7 Ergebnis
Die Figur des Pinhas ben Eleasar ließ sich in der vorliegenden Arbeit als Pro-dukt eines genealogischen Umbaus beschreiben. Bei der Bildung einer Genea-logie für Zadok war dieser zuerst in die Familie der Eliden eingeordnet worden(2 Sam 8,17). Dieser Ansatz wurde verworfen und eine Linie von Aaron überZadok hinaus konstruiert. Dabei sind zwei Namen aus der elidischen Genea-logie übernommen worden: Ahitub und Pinhas (Kap. 6.3).
Auf der literarischen Ebene hat das nicht dazu geführt, daß die Identi-tät der Namensträger behauptet wurde. Insbesondere bei Pinhas ben Elea-sar ist deutlich, daß durch diesen Prozeß eine neue Figur eingeführt werdenmußte. Das geschah durch die Genealogie Ex 6,14–25 und die ErweiterungNum 25,5–13. 19. Num 25 markiert im Numeribuch die Zäsur zwischen derWüsten- und der Landnahmegeneration. Das ist mit intertextuellen Bezügennach Ex 32 und Num 17 sowie 2 Sam 21,1–10 gestaltet worden. Pinhas wird alsIdeal eines Priesters dargestellt, der sich durch göttlichen Eifer für das Prie-stertum bewährt. Obwohl er selbst einer gemischten israelitisch-ägyptischenFamilie entstammt, geht er gewaltsam in levitischer Rigorosität gegen eineisraelitisch-midianitische Verbindung vor. Damit wird deutlich Kritik an derProblemlösungskompetenz des Mose und der mit diesem verbundenen Tra-dition eines freundschaftlich-befruchtenden Miteinanders mit Midian geübt(Kap. 2).
Ein historisch greifbarer Anhaltspunkt für Pinhas ben Eleasar hätte derNachweis des in Jos 24,33 erwähnten Gibea des Pinhas, beziehungsweise einedort vorhandene Grabtradition sein können. Diese Stelle hat sich jedoch alsliterarische Konstruktion erwiesen.
Die Suche nach der Lage des Gibea des Pinhas hat noch mehr Unsicher-heit aufgedeckt, als ohnehin schon immer angenommen wurde. Von den bis-her vermuteten zwei Paralleltraditionen über die Gräber der Aaroniden ge-ben frühestens mittelalterliche Quellen Auskunft. Die nördliche Tradition istgut bezeugt und bis heute erhalten. Mittelalterlich ist eine christliche Parallelezwei Meilen nördlich von Jerusalem insofern bezeugt, als das Gibea des Pinhasmit dem Gibea Sauls identifiziert wurde.
Für den Bibeltext wird aber ein traditionsgeschichtlicher Zusammenhangzwischen dem Gibea des Pinhas und dem Gibea von Kirjat Jearim entschei-dend. Er ist begründet durch ein genealogisches Segment, das in einem en-geren Zusammenhang mit Aaron und seinen vier Söhnen steht, und durchdie Ortsbezeichnung Gibea. Jos 24,33 liegt daher keine eigene ephraimitische
142 7 Ergebnis
Tradition zugrunde, sondern der Vers spielt auf die Lokaltradition des Gibeavon Kirjat Jearim an.
Die beschriebene Umgestaltung der Genealogie Zadoks hat ihren Grundim Gegensatz zwischen Abjatar und Zadok. Wenn die genealogische Herlei-tung von Ahitub und Pinhas von Abjatar übernommen wurde, dann stellt diegenealogische Sequenz Abinadab mit den Söhnen Eleasar, Usa und Ahjo einzweites Element dar, das zu der Bildung der neuen, aaronidischen Genealogiegeführt hat. Dieses zweite Element ist dann eher als genuin zadokidisch an-zusehen. »Gibea des Pinhas« präsentiert schon die Kombination zweier Über-lieferungen: Das (zadokidische) Gibea von Kirjat Jearim einerseits und Pinhasals Ahn andererseits, der in die Familie Abjatars gehört (Kap. 5).
Das größte Gewicht bekommt Pinhas in Num 25 durch die Verleihungdes ewigen Priesterbundes. Diese Vorstellung wurde auf die religiöse, rechtli-che und soziale Sonderstellung des Kultpersonals innerhalb der israelitischenGesellschaft zurückgeführt. Der Bund Gottes mit Priestern beziehungsweiseLeviten drückt einerseits deren Ansprüche aus und wird andererseits mit derErwartung einer idealen Lebens- und Wirkweise verbunden. Auch den Elidenund damit auch Pinhas ben Eli war das Priestertum für immer zugesagt. Daswurde in die Zeit der Knechtschaft in Ägypten verlegt (Kap. 3). Ebenso deutetder Name Pinhas das Bewußtsein um eine enge Beziehung nach Ägypten an.Möglicherweise hat dabei auch die jüdische Bewohnerschaft der ägyptischenStadt Tachpanhes eine Rolle gespielt (S. 139).
Num 25,5–13. 19 wendet sich gegen Mose, vereinnahmt dabei jedoch einrigoristisches levitisches Ideal. Was an Mose kritisiert wird, ist das positiveVerhältnis zu nichtisraelitischen Gruppen (Kap. 2.3.3). Das entspricht durch-aus einer Kritik an der vorausliegenden Tachpanhes-Ephraim-Tradition. In-sofern ist für Pinhas ben Eli eher eine mosaische oder levitische Herleitunganzunehmen und keine aaronidische. Da die aaronidische Genealogie obenaus einem zadokidischen Interesse heraus erklärt wurde, ist keine von Zadokunabhängige aaronidische Priesterschaft anzunehmen (S. 137).
Damit ist der Kern älterer Thesen über Pinhas bestätigt, die einen Um-bau der Herleitung des Pinhas von Elieser ben Mose zu einer von Eleasarben Aaron postulierten. Was sich nicht bestätigt hat, ist die Annahme einervon Zadok unabhängigen Tradition einer aaronidischen Priesterschaft im Ge-birge Ephraim, was unter anderem aus dem Auftreten von Pinhas in Bethel(Ri 20,27 f.) und aus seinem ephraimitischen Erbbesitz (Jos 24,33) geschlossenworden war (Kap. 1.2).
Da Num 25 literarisch der Gesamtgestaltung des Pentateuchs zugeordnetwurde, ist auf die Beziehungen zu Esra hinzuweisen: Eine findet sich in derGestalt des Pinhas selbst, der – wie Esra ein Priester – gegen die Vermischungmit fremden Völkern auftritt. In Esr 7 f., wo die Genealogie Esras aufgeführtwird, spielt die Herkunft von Pinhas eine wichtige Rolle. Je nachdem, wieEsras Verhältnis zu den Priestern gedeutet wird, steht Num 25 in engem Zu-
7 Ergebnis 143
sammenhang mit seiner Reformtätigkeit oder bezeugt, wie von priesterlicherSeite diese Veränderungen positiv aufgenommen wurden (S. 135).
Auf einer zweiten, auf Num 25,1–13. 19 aufbauenden, literarischen Ebenewerden Bezüge zwischen Aktionen des Stämmebundes im Numeri-, Josua-und Richterbuch hergestellt. Der tragende Text ist Jos 22,9–34, in dem ei-ne ältere Gileadtradition (V. 24b. 25. 26a. 27. 34) zu einer Kulterinnerungsformumgedeutet ist, wobei der Text sich nun auf eine im Ostjordanland häufigeKonstellation von Dolmen mit Steinkreisen beziehen könnte. Durch den Na-men Pinhas und die Logik der Erzählung ist auf Num 31 f. verwiesen. Schondie Fortführung Num 25,14–18 sieht keinen Unterschied zwischen Moabite-rinnen und der Midianiterin. An diesem Punkt und im Fortgang (Num 31)wird davon ausgegangen, daß es von Anfang an um Midianiterinnen ging.Andere redaktionelle Lösungen versuchen beides miteinander zu harmonisie-ren und setzen Midianiter als Verbündete der Moabiter (Num 22,4. 7) bzw.Vasallen der Amoriter (Jos 13,21) voraus. Num 25,14–18 und Num 31 sehen inden Midianitern ein anderes Problem als 25,5–13. Es geht diesen Texten umfremde nomadische Bevölkerungsteile, die der Besiedlung des Ostjordanlan-des durch die zweieinhalb Stämme entgegenstehen (Num 31–32).
Im Zusammenspiel mit Jos 22 wird deutlich gemacht, worin das Problembesteht. Dort ist das Ostjordanland Paradigma gerade in seiner Zwitterstel-lung zwischen Israels Land und unreinem Land. Es bietet die Möglichkeit,schon direkt nach der Landnahme eine diasporaähnliche Situation zu konstru-ieren. So kann schon jetzt im Josuabuch, das mit dem Idealzustand abschließt,die Frage nach rechtmäßiger Religionsausübung außerhalb des Landes bespro-chen werden.
Blickt man von hier aus wieder auf Num 31 f. zurück, wird deutlich, welcheRolle Midian bei dieser negativen Sicht des Ostjordanlandes spielt. In denbeiden Schlußreden Josuas wird auf die Gefahren bei der Seßhaftwerdungdurch die übriggebliebenen Völker bzw. die Götter des Landes hingewiesen.Der Krieg gegen Midian wie die innerisraelitische Auseinandersetzung umden Altar am Jordan werden durch das Auftreten des Pinhas zu einer analogenBedrohung (Kap. 4).
Sowohl die eifernde Gewalttat des Pinhas, als auch die Gabe ewigen Prie-stertums an ihn spielen in der Wirkungsgeschichte eine entscheidende Rolle.Teilweise wird ihm eine endzeitlich-soteriologische Funktion zugeschrieben.Die Spontanität seiner Tat hat jedoch auch Kritik hervorgerufen und nachder Legitimität solcher Gewalt fragen lassen (Kap. 1.1).
Abkürzungsverzeichnis
AASOR Annual of the American School(s) of Oriental ResearchABG Arbeiten zur Bibel und ihrer GeschichteADPV Abhandlungen des Deutschen PalästinavereinsAGJU Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Ur-
christentumsAJSL American Journal of Semitic Languages and LiteraturesAnBib Analecta BiblicaAOAT Alter Orient und Altes TestamentAÖAW. PH Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der österreichi-
schen Akademie der WissenschaftenArOr Archiv orientálniATD Das Alte Testament DeutschAThANT Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testa-
mentsBASOR Bulletin of the American School of Oriental ResearchBBB Bonner biblische BeiträgeBBKL Biographisch-Bibliographisches KirchenlexikonBEAK Beiträge zur Erforschung der antiken Moabitis (Ard. el-Kerak)BEThL Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensiumBEvTh Beiträge zur Evangelischen TheologieBFChTh Beiträge zur Förderung christlicher TheologieBHH Biblisch-historisches HandwörterbuchBHS Biblia Hebraica StuttgartensiaBib. BiblicaBibInt Biblical InterpretationBJPES Bulletin of the Jewish Palestine Exploration SocietyBK. AT Biblischer Kommentar. Altes TestamentBN Biblische NotizenBTAVO B Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B
(Geisteswissenschaften)BTS Beiruter Texte und StudienBWANT Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen TestamentBZ Biblische ZeitschriftBZAR Beihefte zur Zeitschrift für die Altorientalische und biblische
RechtsgeschichteBZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
146 Abkürzungsverzeichnis
CBQ Catholic Biblical QuarterlyCHANE Culture and History of the Ancient Near EastCChr. SL Corpus Christianorum. Series LatinaCRBS Currents in Research: Biblical StudiesDJD Discoveries in the Judaean Desert (of Jordan)DNP Der Neue PaulyEdF Erträge der ForschungEHAT Exegetisches Handbuch zum Alten TestamentFAT Forschungen zum Alten TestamentFRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen
TestamentsFTS Frankfurter theologische StudienFzB Forschung zur BibelGAT Grundrisse zum Alten TestamentGTA Göttinger theologische ArbeitenGThW Grundriß der theologischen WissenschaftHAT Handbuch zum ATHBS Herders Biblische StudienHebAnnRev Hebrew Annual ReviewHeyJ Heythrop JournalHK Handkommentar zu Alten TestamentHThKAT Herders Theologischer Kommentar zum Alten TestamentHThR Harvard Theological ReviewHUCA Hebrew Union College AnnualIntB The Interpreters BibleJARG Jahrbuch für Anthropologie und ReligionsgeschichteJBL Journal of Biblical LiteratureJBTh Jahrbuch für biblische TheologieJJS Journal of Jewish StudiesJNES Journal of Near Eastern StudiesJPOS Journal of the Palestine Oriental SocietyJPSTC The JPS Torah commentaryJQR Jewish Quarterly ReviewJSHRZ Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer ZeitJSJSup Supplements to the Journal for the Study of JudaismJSOT Journal for the study of the Old TestamentJSOT. S Journal for the study of the Old Testament. Supplement seriesJThSt Journal of Theological StudiesJudChr Judaica et ChristianaKAANT Kleine Arbeiten zum Alten und Neuen TestamentKAT Kommentar zum Alten TestamentKEH Kurzgefaßtes exegetisches Handbuch zum Alten TestamentKHC Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament
Abkürzungsverzeichnis 147
LAB Liber antiquitatum biblicarum (Pseudophilo)MSSNTS Monograph series. Society for New Testament StudiesMThSt Marburger Theologische StudienNBL Neues Bibel-LexikonNEAEHL The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the
Holy LandNEB Neue Echter BibelNESE Neue Ephemeris für semitische EpigraphikNSK. AT Neuer Stuttgarter Kommentar. Altes TestamentOBO Orbis biblicus et orientalisOLA Orientalia Lovaniensia analectaOLZ Orientalistische LiteraturzeitungOTE Old Testament EssaysOTL Old Testament LibraryOTS Oudtestamentische StudiënOTSt Old Testament studiesOTM Oxford Theological MonographsPEFQSt Quarterly Statement. Palestine Exploration FundPEQ Palestine Exploration QuarterlyPG Patrologiæ cursus completus – Series græca. Accurante J.-P.
MignePJ Palästinajahrbuch des Deutschen evangelischen Instituts für
Altertumswissenschaft des heiligen Landes zu JerusalemPRU Palais royal d’UgaritQD Quaestiones DisputataeRAC Reallexikon für Antike und ChristentumRB Revue BibliqueRGG Religion in Geschichte und GegenwartRPARA Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di ArcheologiaRQ Revue de QumrânSAT Die Schriften des Alten Testaments in AuswahlSBAZ Studien zur Biblischen Archäologie und ZeitgeschichteSBL. DS Society of Biblical Literature. Dissertation seriesSBL. EJL Society of Biblical Literature. Early Judaism and its LiteratureSFSHJ South Florida studies in the history of JudaismSGKA Studien zur Geschichte und Kultur des AltertumsSHR Studies in the History of ReligionSNVAO. HF Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo –
Historisk-Filosofisk KlasseSSDI Schriften des Simon-Dubnow-InstitutsStANT Studien zum Alten und Neuen TestamentStTDJ Studies on the texts of the desert of JudahSWJT Southwestern journal of Theology
148 Abkürzungsverzeichnis
TAVO Tübinger Atlas des Vorderen OrientsTel Aviv Tel Aviv. Journal of the Intitute of Archaeology of Tel Aviv
UniversityTer TeresianumTHAT Theologisches Handwörterbuch zum Alten TestamentTheophaneia Theophaneia. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte
des AltertumsThFr Theologie und FriedenThR Theologische RundschauThRv Theologische RevueThWAT Theologisches Wörterbuch zum Alten TestamentThWNT Theologisches Wörterbuch zum Neuen TestamentTRE Theologische RealenzyklopädieTSAJ Texte und Studien zum Antiken JudentumTThZ Trierer Theologische ZeitschriftVT Vetus TestamentumVT. S Supplements to Vetus TestamentumWASt Wiener alttestamentliche StudienWBC World Biblical CommentaryWMANT Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Te-
stamentWUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen TestamentYNER Yale Near Eastern ResearchesZA Zeitschrift für AssyriologieZAH Zeitschrift für AlthebraistikZAR Zeitschrift für Altorientalische und Biblische RechtsgeschichteZAW Zeitschrift für die alttestamentliche WissenschaftZBK. AT Zürcher Bibelkommentar. Altes TestamentZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen GesellschaftZDPV Zeitschrift des Deutschen Palästina-VereinsZThK Zeitschrift für Theologie und Kirche
Literaturverzeichnis
Abel, F.-M., Géographie de la Palestine, Band II, Paris: J. Gabalda et Cie –Librairie Lecoffre 1938
Histoire de la Palestine depuis la conquête d’Alexandre jusqu’al’invasion arabe, Band II, Paris: J. Gabalda et Cie – Librairie Lecoffre1952
Aberbach, Moses und Smolar, Leivy, Aaron, Jeroboam, and the GoldenCalves, JBL 86 1967, 129–140
Abulfath, 67���8���" � 9� �
�: kitab at-ta�rıh˘
/Annales Samaritani, hrsg. v. Vilmar,
Eduard, Gotha: Perthes 1865
Achenbach, Reinhard, Levitische Priester und Leviten im Deuteronomium,ZAR 5 1999, 285–309
Levi/Leviten, RGG4 V 2002, 293–295
Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte des Nu-meribuches im Kontext von Hexateuch und Pentateuch, BZAR 3,Wiesbaden: Harrassowitz 2003
Ackroyd, PeterR., I & II Chronicles, Ezra, Nehemiah, London: SCM Press1973
Aharoni, Yohanan, Das Land der Bibel. Eine historische Geographie, Neu-kirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1984
Albertz, Rainer, KPR: Kultische Sühne und politische und gesellschaftlicheVersöhnung, in: (Hrsg.), Kult, Konflikt und Versöhnung. Beiträ-ge zur kultischen Sühne in religiösen, sozialen und politischen Ausein-andersetzungen des antiken Mittelmeerraumes, AOAT 285, Münster:Ugarit-Verlag 2001, 135–149
Albright, William Foxwell, Some archaeological and topographical Re-sults of a trip through Palestine, BASOR 11 1923, 3–14
Excavations and results at tell el fûl (Gibea of Saul), AASOR 4 1924
Alt, Albrecht, Das Institut im Jahre 1926, PJ 23 1927, 5–51
Anderson, Roger W., Zephaniah ben Cushi and Cush of Benjamin: Tracesof Cushite Presence in Syria-Palestine, in: Holloway, Steven W. undHandy, Lowell K. (Hrsg.), The Pitcher is Broken. Memorial Essaysfor Gösta Ahlström, JSOT. S 190, Sheffield: Sheffield Academic Press1995, 45–70
150 Literaturverzeichnis
Arneth, Martin, »Sonne der Gerechtigkeit«. Studien zur Solarisierung derJahwe-Religion im Lichte von Psalm 72, BZAR 1, Wiesbaden: Harras-sowitz 2000
Arnold, Patrick M., Gibea. The Search for a Biblical City, JSOT. S 79,Sheffield: Sheffield Academic Press 1990
Assmann, Jan, Politische Theologie zwischen Ägypten und Israel, hrsg. v.Meier, Heinrich, Bonn: VG Bild-Kunst 1992Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus,München – Wien: Carl Hanser 2003
Auerbach, Elias, Der Aufstieg der Priesterschaft zur Macht im alten Israel,in: Congress Volume. Bonn 1962, VT. S 9, Leiden: E. J. Brill 1963, 236–249
Das Aharon-Problem, in: Vriezen, Th. C. u. a., Congress Volume.Rome 1968, VT. S 27, Leiden: E. J. Brill 1969, 37–63
Auld, A. Graeme, Textual and Literary Studies in the Book of Joshua,ZAW 90 1978, 412–417Joshua: the Hebrew and Greek Texts, in: Emerton, J. A. (Hrsg.), Stu-dies in the Historical Books of the Old Testament, VT. S 30, Leiden:E. J. Brill 1979, 1–14Joshua, Moses and the Land, Edinburgh: T. & T. Clark 1980, Reprint1983
Judges 1 and History: a Reconsideration, in: (Hrsg.), CongressVolume. Leuven 1989, VT. S 43, Leiden – New York – Københaven –Köln: E. J. Brill 1991, 79–101, zuerst erschienen in VT 25 (1975) 261–285What makes Judges Deuteronomistic?, in: Auld, A. Graeme, JoshuaRetold. Synoptic Perspectives, Edinburgh: T. & T. Clark 1998, 120–126
Baentsch, Bruno, Exodus – Leviticus – Numeri, HK I,2, Göttingen: Van-denhoeck & Ruprecht 1903
Balz, Heinrich, Ahnen/Ahnenverehrung, RGG4 I 1998, 225 f.Bartelmus, Rüdiger, Heroentum in Israel und seiner Umwelt. Eine traditi-
onsgeschichtliche Untersuchung zu Gen 6, 1–4 und verwandten Textenim Alten Testament und der altorientalischen Literatur, Band 65, Zü-rich: Theologischer Verlag 1979
Heroen, RGG4 III 2000, 1678 f.Baudissin, Wolf Wilhelm Graf, Die Geschichte des alttestamentlichen
Priesterthums, Leipzig: S. Hirzel 1889Baumeister, Theofried, Heiligenverehrung I, RAC XIV 1988, 96–150Becker, Uwe, Richterzeit und Königtum. Redaktionsgeschichtliche Studien
zum Richterbuch, BZAW 192, Berlin – New York: Walter de Gruyter1990
Literaturverzeichnis 151
Belting, Hans (Hrsg.), Der Serbische Psalter. Faksimile-Ausgabe des Cod.Slav. 4 der Bayerischen Staatsbibliothek München, München: LudwigReichert 1978
Bendor, S., The Social Structure of Ancient Israel. The Institution of theFamily (beit �ab) from the Settlement to the End of the Monarchy,Jerusalem Biblical Studies 7, Jerusalem: Simor 1996
Berg, Werner, Die Eifersucht Gottes – ein problematischer Zug des altte-stamentlichen Gottesbildes, BZ 23 1979, 197–211Eifer, NBL I 1991, 490
Bergunder, Michael, Heilige/Heiligenverehrung I. Religionsgeschichtlich,RGG4 III 2000, 1539 f.
Berry, George R., Priests and Levites, JBL 42 1923, 227–238Biberger, Bernd, Unsere Väter und wir. Unterteilung von Geschichtsdarstel-
lungen in Generationen und das Verhältnis der Generationen im AltenTestament, BBB 145, Berlin – Wien: PHILO 2003
Bieberstein, Klaus, Josua – Jordan – Jericho. Archäologie, Geschichte undTheologie der Landnahmeerzählungen Josua 1 – 6, OBO 143, FreiburgSchweiz – Göttingen: Universitätsverlag Freiburg – Vandenhoeck &Ruprecht 1995
Bietenhard, Hans, Midrasch Tanh. uma B. R. Tanh. uma über die Tora, ge-nannt Midrasch Jelammedenu, 2 Bände, JudChr 5, Bern – Frankfurtam Main – Las Vegas: Peter Lang 1980
Blenkinsopp, Joseph, Kiriath Jearim and the Ark, JBL 88 1969, 143–156Ezra-Nehemiah. A Commentary, OTL, London: SCM Press 1988
Sage, priest, prophet: religious and intellectual leadership in ancientIsrael, Library of Ancient Israel, Louiseville, Kentucky: Westminster /John Knox Press 1995
The Judaean Priesthood during the Neo-Babylonian and AchaemenidPeriods: A Hypothetical Reconstruction, CBQ 60 1998, 25–43
Blum, Erhard, Studien zur Komposition des Pentateuch, BZAW 189, Berlin– New York: Walter de Gruyter 1990
Der kompositionelle Knoten am Übergang von Josua zu Richter. EinEntflechtungsvorschlag, in: Vervenne, M. und Lust, J. (Hrsg.), Deu-teronomy and Deuteronomic Literature. Festschrift für C. H. W. Bre-kelmans, BEThL 133, Leuven-Louvain: University Press 1997, 181–212
Boeren, P. C., Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre sainte.Histoire et edition du texte, Amsterdam – Oxford – New York: NorthHolland Publishing 1980
Boudreau, George Raymond, A study of the traditio-historical developmentof the Baal of Peor tradition, Diss., Emory University, 1991
152 Literaturverzeichnis
Boudreau, George Raymond, Hosea and the Pentateuchal Tratitions. TheCase of the Baal of Peor, in: Graham, M. Patrick, Brown, William P.und Kuan, Jeffrey K. (Hrsg.), History and Interpretation, Festschriftfür John H. Hayes, JSOT. S 173, Sheffield: Sheffield Academic Press1993, 121–132
Bowman, Raymond A., Nehemiah. Exegesis, IntB XII 1954, 662–819Braun, Roddy L., 1Chronicle 1–9 and the Reconstruction of the History of
Israel: Thoughts on the Use of the Genealogical Data in Chroniclesin the Reconstruction of the History of Israel, in: Graham, M. Pa-trick, Hoglund, Kenneth G. und McKenzie, Steven L. (Hrsg.),The Chronicler as Historian, JSOT. S 238, Sheffield: Sheffield Acade-mic Press 1997, 92–105
Brichto, Herbert Chanan, Kin, Cult, Land and Afterlife – a Biblical Com-plex, HUCA 44 1973, 1–54
Buber, Schlomo (Hrsg.), DZ���� ����� ����� ���� midraš tanh. ûmahhaqqadûm wehayyašan, New York: Sefer 1946
Buch, Jacob (Hrsg.), ������ ������ miqra�ôt gedôlôt, zu Propheten undSchriften, XI Bände, Jerusalem 1963/64
Budd, Philip J., Numbers, WBC 5, Waco, Texas: Word Books 1984
Budde, Karl, Die Bücher Samuel, KHC VIII, Tübingen – Leipzig: Mohr(Siebeck)Das Buch der Richter, KHC VII, Freiburg i. Br. – Leipzig – Tübingen:Mohr (Siebeck) 1897Die Herkunft S. adok. s, ZAW 52 1934, 42–50
Buhl, F., Geographie des alten Palästina, GThW II, 4, Freiburg i. B. – Leipzig:Mohr (Siebeck) 1896
Canaan, Taufik, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine,JPOS IV–VII 1924–1927, Band IV, 1–84; Band V, 163–203; Band VI,1–69; Band VII, 1–88Das Opfer in palästinischen Sitten und Gebräuchen, ZAW 74 1961,31–44
Carmoly, E. (Hrsg.), Itinéraires de la terre sainte, Brüssel: A. Vandale 1847
Clementz, Heinrich, Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. Übersetztund mit Einleitung und Anmerkungen versehen, Band I, Halle an derSaale: Otto Hendel (1899)
Clermont-Ganneau, Charles, The Arabs in Palestine, in: Wilson,Charles, The Survey of Western Palestine, Band Special Papers onTopography, Archæology, Manners and Customs, London: The Com-mittee of the Palestine Exploration Fund 1881, 315–330
Literaturverzeichnis 153
Archæological Researches in Palestine during the years 1873–1874,Band II, London: The Committee of the Palestine Exploration Fund1896
Cody, Aelred, A History of Old Testament Priesthood, AnBib 35, Rom: Pon-tifical Biblical Institute 1969
Cohen, Menachem (Hrsg.), ��$� ������ ������/Mikra�ot Gedolot ›Ha-keter‹. A revised and augmented scientific edition of ›Mikra�ot Gedolot‹based on the Aleppo Codex and early Medieval MSS, Bar Ilan Univer-sity 1995
Collins, John J., The Zeal of Phinehas: The Bible and the Legitimation ofViolence, JBL 122 2003, 3–21
Colpe, Carsten, Das samaritanische Pinehas-Grab in Awerta und die Bezie-hung zwischen H
˘ad. ir- und Georgslegende, ZDPV 85 1969, 162–196
Conder, Claude Reignier, Joshua’s Tomb, PEFQSt 1878, 22 f.Heth and Moab. Explorations in Syria in 1881 and 1882, London: Ri-chard Bentley and Son 1885
und Kitchener, Horatio Herbert, The Survey of Western Pale-stine. Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography, and Ar-chæology, Band I–III: Galilee – Samaria – Judæa, London: The Com-mittee of the Palestine Exploration Fund 1881–83
Cook, Francis T., The site of Kirjath Jearim, AASOR 5 1925, 105–120Cross, Frank Moore, Canaanite Myth and Hebrew Epic. Essays in the Hi-
story of the Religion of Israel, Cambridge – London: Harvard Univer-sity Press 1997
Curtiss, Samuel Ives, Ursemitische Religion im Volksleben des heutigenOrients, Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung 1903
Dahm, Ulrike, Opferkult und Priestertum in Alt-Israel. Ein kultur- und reli-gionswissenschaftlicher Beitrag, BZAW 327, Berlin – New York: Walterde Gruyter 2003
Dahmen, Ulrich, Leviten und Priester im Deuteronomium, Bodenheim:Philo 1996
Dalman, Gustaf H., Jahresbericht des Deutschen evangelischen Institutsfür die Altertumswissenschaft des heiligen Landes für das Arbeitsjahr1907/08, PJ 4 1908, 1–20Jahresbericht des Deutschen evangelischen Instituts für die Altertums-wissenschaft des heiligen Landes für das Arbeitsjahr 1912/13, PJ 9 1913,1–75
Das Gilgal der Bibel und die Steinkreise Palästinas, PJ 15 1919, 5–26Degen, Rainer, Zu den aramäischen Texten aus Edfu, NESE 3 1978, 59–66
154 Literaturverzeichnis
Dietzfelbinger, Christian, Pseudo-Philo: Antiquitates Biblicae (Liber An-tiquitatum Biblicarum), JSHRZ II, 2, Gütersloh: Gütersloher Verlags-haus 1979
Dillmann, August, Die Bücher Exodus und Leviticus, Band XII, 2. Auflage,Leipzig: S. Hirzel 1880
Donner, Herbert, Einführung in die biblische Landes- und Altertumskun-de, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976Balaam pseudopropheta, in: , Hanhart, Robert und Smend,Rudolf (Hrsg.), Beiträge zur Alttestamentlichen Theologie, Festschriftfür Walther Zimmerli, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1977, 112–123
Pilgerfahrt ins Heilige Land. Die ältesten Berichte christlicher Palästi-napilger (4.–7. Jahrhundert), Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 1979
St. Georg in den großen Religionen des Morgen- und Abendlandes, in:Müller, Hans Martin und Rössler, Dietrich (Hrsg.), Reformati-on und Praktische Theologie, Festschrift für Werner Jetter, Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht 1983, 51–60
Dozy, R., Supplément aux dictionaires arabes, Beirut: Librairie du Liban 1991,Wiederabdruck des Originals (Leiden: Brill 1881)
Dus, Jan, Die Lösung des Rätsels von Jos. 22. Ein Beitrag zur GeschichteAltisraels, ArOr 32 1964, 529–546
Ebers, Georg und Guthe, Hermann (Hrsg.), Palästina in Bild und Wort.Nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen, Band 1, Stuttgart –Leipzig: Deutsche Verlagsanstalt 1883
Ehrlich, Arnold B., Randglossen zur hebräischen Bibel. Textkritisches,Sprachliches und Sachliches, Band 2: Leviticus, Numeri, Deuterono-mium, Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung 1909
Ehrlich, Michael, The Identification of Emmaus with Abu Goš in the Crus-ader Period Reconsidered, ZDPV 112 1996, 165–169
Eisenman, Robert und Wise, Michael, Jesus und die Urchristen. DieQumran-Rollen entschlüsselt, München: C. Bertelsmann 1993
Eisenstein, Jehuda David, Ozar Massaoth. A Collection of Itineraries byJewish Travelers to Palestine, Syria, Egypt and other countries, NewYork: Selbstverlag 1926
Eissfeldt, Otto, Lade und Stierbild, ZAW 58 1940/41, 190–215Elgavish, David, The Division of the Spoils of War in the Bible and in the
Ancient Near East, ZAR 8 2002, 242–273
Elitzur, Yoel, ��#���� DZ� �� ’���‘ �� ����� ����� ��� �#��� ��� gebbehar-�æprayim ûše �elat qiyyûmah šæl ‘gæba�’ mis.s.
epôn lebêt-�el , Cathe-dra 45 1987, 3–18
Literaturverzeichnis 155
Elliger, Karl, Das Buch der zwölf kleinen Propheten, II: Die ProphetenNahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi, ATD 24, II,8. Auflage, Göttingen – Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht 1982
Engel, Helmut, Die Vorfahren Israels in Ägypten. ForschungsgeschichtlicherÜberblick über die Darstellungen seit Richard Lepsius (1849), FTS 27,Frankfurt am Main: Joseph Knecht 1979
Fabry, Heinz-Josef, Toleranz im Alten Testament, BiKi 58 2003, 216–223Jesus Sirach und das Priestertum, in: Fischer, Irmtraud, Rapp, Ur-sula und Schiller, Johannes (Hrsg.), Auf den Spuren der schriftge-lehrten Weisheit, Festschrift für Johannes Marböck, BZAW 331, Berlin– New York: Walter de Gruyter 2004, 265–282Zadok/Zadokiden, TRE 36, Lieferung 2/3 2004, 440–447
Falk, Zeev W., Mischehe I. Judentum, TRE XXIII 1994, 3–7Feldman, Louis H., The Portrayal of Phinehas by Philo, Pseudo-Philo, and
Josephus, JQR 92 2002, 315–345Philo’s Version of Balaam, Henoch 25 2003, 301–319
Ferrua, Antonio, Una scena nuova nelle pittura catacombale, RPARA 30–311956–1957 und 1959–1960, 107–116Katakomben. Unbekannte Bilder des frühen Christentums unter derVia Latina, Stuttgart: Urachhaus 1991
Finkelstein, Israel, The Archaeology of Israelite Settlement, Jerusalem: Is-rael Exploration Society 1988
, Lederman, Zvi und Bunimovitz, Shlomo, Highlands of Many Cul-tures. The Southern Samaria Survey. The Sites, 2 Bände, Tel Aviv Uni-versity 1997
Fohrer, Georg, Tradition und Interpretation im Alten Testament, ZAW 731961, 1–30
Franceschini, E. und Weber, R. (Hrsg.), Itinerarium Egeriae, in: Itinerariaet alia geographica, CChr. SL CLXXV, Turnhout: Brepols 1965, 27–90
Franke, Patrick, Begegnung mit Khidr, BTS 79, Stuttgart: Franz Steiner2000
Franken, H. J., Excavations at Tell Deir �Alla I. A Stratigraphical and Analy-tical Study of the Early Iron Age Pottery, Leiden: E. J. Brill 1969
Friedlaender, Israel, Die Chadhirlegende und der Alexanderroman. Ei-ne sagengeschichtliche und literarhistorische Untersuchung, Leipzig –Berlin: B. G. Teubner 1913
Friedmann, M., Seder Eliahu rabba and Seder Eliahu zuta (Tanna d’be Elia-hu), Wien: Achiasaf (Warschau) 1902, (3. Druck: Wahrmann Book, Je-rusalem 1969)
156 Literaturverzeichnis
Fritz, Volkmar, Israel in der Wüste. Traditionsgeschichtliche Untersuchungder Wüstenüberlieferung des Jahwisten, MThSt 7, Marburg: N. G. El-wert Verlag 1970
Fritz, Volkmar, Das Buch Josua, Band I/7, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1994Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v. Chr., BiblischeEnzyklopädie 2, Stuttgart – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 1996
Die Grenzen des Landes Israel, in: Studies in historical geography anbiblical historiography, Festschrift für Zecharia Kallai, VT. S 81, Leiden– Boston – Köln: E. J. Brill 2000, 14–34
Fuller, Russell, The Blessing of Levi in Dtn 33, Mal 2, and Qumran, in:Bartelmus, Rüdiger, Krüger, Thomas und Utzschneider, Hel-mut (Hrsg.), Konsequente Traditionsgeschichte, Festschrift für KlausBaltzer, OBO 126, Freiburg Schweiz – Göttingen: Universitätsverlag –Vandenhoeck & Ruprecht 1993, 31–44
Gall, August Freiherr von, Altisraelitische Kultstätten, BZAW 3, Gießen:J. Ricker’sche Verlagsbuchhandlung 1898
Gerhards, Meik, Die Herkunft der Frau des Mose, VT 55 2005, 162–175
Gerleman, Gillis, �� �� šlm genug haben, THAT II� 1984, 919–935Germer-Durand, J., Découvertes archéologiques a Aboughoch, RB 15 1906,
286 f.Gerstenberger, Erhard S., Theologien im Alten Testament. Pluralität und
Synkretismus alttestamentlichen Gottesglaubens, Stuttgart – Berlin –Köln: W. Kohlhammer 2001
Heiliger Krieg oder Heiliger Friede? Der Gottesglaube in bewaffnetenKonflikten, in: Diehl, Johannes F., Heitzenröder, Reinhard undWitte, Markus (Hrsg.), »Einen Altar von Erde mache mir ...«, Fest-schrift für Diethelm Conrad, KAANT 4/5, Waltrop: Hartmut Spenner2003, 77–93
Gertner, M., The Masorah and the Levites. An Essey on the History of aConcept, VT 10 1960, 241–272
Gertz, Jan Christian, Bund. II. Altes Testament, RGG4 I 1998, 1862–1865Gesenius, Wilhelm, Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et
chaldaeae Veteris Testamenti, Band III, 1, Leipzig: F. C. W. Vogel 1842und Kautzsch, Emil, Hebräische Grammatik, 28. Auflage, Leipzig:
F. C. W. Vogel 1909Gilead, David, Burial Customs and the Dolmen Problem, PEQ 100 1968,
16–26Ginsburger, Moses (Hrsg.), Pseudo-Jonathan (Thargum Jonathan ben Usiel
zum Pentateuch). Nach der Londoner Handschrift, Hildesheim – NewYork: Georg Olms 1971, Nachdruck der Ausgabe Berlin 1903
Girard, René, Das Heilige und die Gewalt, Zürich: Benzinger 1987
Literaturverzeichnis 157
Glessmer, Uwe, Leviten in spätnachexilischer Zeit. Darstellungsinteressenin den Chronikbüchern und bei Josephus, in: Albani, Matthias undArndt, Timotheus (Hrsg.), Gottes Ehre erzählen, Festschrift für HansSeidel, Leipzig: Thomas Verlag 1994, 127–151
Goldschmidt, Lazarus, ���� ����� talmûd bablî/Der Babylonische Tal-mud mit Einschluß der vollständigen Mišnah, IX Bände, Leipzig: Har-rassowitz 1897–1935
Goldziher, Ignaz, Muhammedanische Traditionen über den Geburtsort desJosua, ZDPV 2 1879, 13–17
Görg, Manfred, Aaron – von einem Titel zum Namen, BN 32 1986, 11–17Hagar, die Ägypterin, BN 33 1986, 17–20Geba, NBL I 1991, 738Pinhas, NBL III 2001, 151 f.
Goshen-Gottstein, Alon, Ben Sira’s Praise of the Fathers: A Canon-Conscious Reading, in: Egger-Wenzel, Renate (Hrsg.), Ben Sira’sGod. Proceedings of the International Ben Sira Conference Durham –Ushaw College 2001, BZAW 321, Berlin – New York: Walter de Gruyter2002, 235–267
Goussen, H., Über georgische Drucke und Handschriften, die Festordnungund den Heiligenkalender des altchristlichen Jerusalems betreffend, Li-turgie und Kunst IV, München-Gladbach 1923
Graf, Fritz, Heroenkult, DNP 5 1998, 476–480Graf, Karl Heinrich, Die geschichtlichen Bücher des Alten Testaments.
Zwei historisch-kritische Untersuchungen, Leipzig: T. O. Weigel 1866Gressmann, Hugo, Mose und seine Zeit. Ein Kommentar zu den Mose-
Sagen, FRLANT 18, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1913Die Anfänge Israels (Von 2. Mose bis Richter und Ruth), SAT I,2,2. Auflage, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1922
Gross, Walter, Bileam. Literar- und formkritische Untersuchung der Prosain Num 22–24, StANT 38, München: Kösel-Verlag 1974
Bileam 1991, NBL I 1991, 300 f.Grünbaum, M., Bemerkungen zu einigen früher in dieser Zeitschrift erschie-
nenen Aufsätzen, ZDPV 6 1883, 195–205Guerín, M. V., Description géographique, historique et archéologique de la
Palestine, Band II (Samarie), 1, Paris: Challamel Aîné 1974
Gunneweg, Antonius H. J., Mose in Midian, ZThK 61 1964, 1–9Leviten und Priester. Hauptlinien der Traditionsbildung und Ge-schichte des israelitisch-jüdischen Kultpersonals, Göttingen: Vanden-hoeck & Ruprecht 1965
Haag, Ernst, Gottes Bund mit Levi nach Maleachi 2, TThZ 107 1998, 25–44
158 Literaturverzeichnis
Habets, G., Vorbild und Zerrbild. Eine Exegese von Maleachi 1,6–2,9, Ter 411990, 5–58
Haran, Menahem (Menah. em), Shiloh and Jerusalem: The Origin of thePriestly Tradition in the Pentateuch, JBL 61 1962, 14–24Temples and Temple-Service in Ancient Israel. An Inquiry into Bibli-cal Cult Phenomena and the Historical Setting of the Priestly School,Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns 1985
Hashim, Abd al Hadi, ������ �awarta, in: Encyclopædia Palæstina Micropæ-dia, Band III, Damaskus: Encyclopædia Palæstina Corporation 1984,362–363
Hayward, Robert, Phinehas – the same is Elija: The Origins of a RabbinicTradition, JJS 29 1978, 22–34
Hengel, Martin, Die Zeloten. Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbe-wegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr., AGJU 1, 2. Auflage,Leiden – Köln: E. J. Brill 1976
Henke, Oswald, Zur Lage von Beth Peor, ZDPV 75 1959, 155–163Hentschel, Georg, 1 Samuel, in: Scharbert, Josef und Hentschel, Ge-
org, Rut. 1 Samuel, NEB 33, Würzburg: Echter Verlag 1994, 31–139Hertzberg, Hans Wilhelm, Die Tradition in Palästina, PJ 22 1926, 84–104
Die Bücher Josua, Richter, Ruth, ATD 9, 5. Auflage, Göttingen: Van-denhoeck & Ruprecht 1973
Hieke, Thomas, Die Genealogien der Genesis, HBS 39, Freiburg – Basel –Wien – Barcelona – Rom – New York: Herder 2003
Hieronimus, Epitaphium sanctae Paulae (epistula CVIII), in: Stummer, Fri-dericus (Hrsg.), Monumenta historiam et geographiam Terrae Sanctaeillustrantia, Bonn: Petrus Hanstein 1935, 22–69
Higgins, A. J. B., Priest and Messiah, VT 3 1953, 321–336Hitzig, Ferdinand, Die zwölf kleinen Propheten, 4. Auflage besorgt von
Heinrich Steiner, KEH, Leipzig: S. Hirzel 1881Hollenberg, Johannes, Der Charakter der alexandrinischen Uebersetzung
des Buches Josua und ihr textkritischer Werth, Moers: J. G. Eckner 1876Holmes, S., Joshua. The Hebrew and Greek Texts, Cambridge: University
Press 1914
Holzinger, H., Das Buch Josua, KHC VI, Tübingen – Leipzig: Mohr (Sie-beck) 1901Numeri, KHC IV, Tübingen – Leipzig: Mohr (Siebeck) 1903
Homan, Michael M., A Tensile Etymology for Aaron: �aharon ‹ �ahalon,BN 95 1998, 21–22
Hommel, Fritz, Die Altisraelitische Überlieferung in inschriftlicher Beleuch-tung. Ein Einspruch gegen die Aufstellungen der modernen Penta-teuchkritik, München: G. Franz’sche Hofbuchhandlung 1897
Literaturverzeichnis 159
Van Hoonacker, A., Quelques observations critiques sur les récits concer-nant Bileam, Le Muséon 7 1888, 61–76
Horovitz, H. S. (Hrsg.), Siphre d’be Rab, Band 1: Siphre ad Numeros adjectoSiphre zutta, Jerusalem: Shalem Books 1992
Hossfeld, Frank-Lothar, Ps 106 und die priesterliche Überlieferung desPentateuch, in: Kiesow, Klaus (Hrsg.), »Textarbeit«: Studien zu Tex-ten und ihrer Rezeption aus dem Alten Testament, Festschrift für PeterWeimar, AOAT 294, Münster: Ugarit-Verlag 2003, 255–267
Hulst, A. R., � ��/� �� �� �am/goj Volk, THAT II� 1984, 290–325
DZ$ �� škn wohnen, THAT II� 1984, 904–909Ibach, Robert D. Jr., Archaeological Survey of the Hesban Region: Ca-
talogue of sites and Characterization of Periods, Hesban 5, BerrienSprings, Michigan: Institute of Archaeology and Andrews UniversityPress 1987
Jagersma, H., Numeri III, De Prediking van het Oude Testament, Nijkerk:G. F. Callenbach 1990
Janowski, Bernd, Sühne als Heilsgeschehen. Studien zur Sühnetheologie derPriesterschrift und zur Wurzel KPR im Alten Orient und im Alten Te-stament, WMANT 55, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1982
Psalm CVI 28–31 und die Interzession des Pinhas, VT 33 1983, 237–248Japhet, Sara, 1Chronik, übersetzt von Dafna Mach, HThKAT, Freiburg –
Basel – Wien: Herder 2002
Jenni, Ernst, Die hebräischen Präpositionen. Band 3: Die Präposition La-med, Stuttgart – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 2000
Jeremias, Joachim, Heiligengräber in Jesu Umwelt (Mt. 23,29; Lk. 11,47).Eine Untersuchung zur Volksreligion zur Zeit Jesu, Göttingen: Van-denhoeck & Ruprecht 1958
Johnson, Marshall D., The Purpose of the Biblical Genealogies. With Spe-cial Reference to the Setting of the Genealogies of Jesus, MSSNTS 8,2. Auflage, Cambridge: Cambridge University Press 1988
Johnstone, William, The Use of the Reminiscences in Deuteronomy inRecovering the Two Main Literary Phases in the Production of thePentateuch, in: Gertz, Jan Christian, Schmid, Konrad und Wit-te, Markus (Hrsg.), Abschied vom Jahwisten. Die Komposition desHexateuch in der jüngsten Diskussion, BZAW 315, Berlin – New York:Walter de Gruyter 2002, 247–273
Josef, Sefi ben, ����� �awarta�, Israel Guide The Northern Valleys, MountCarmel and Samaria 1980, 345–347
Judge, H. G., Aaron, Zadok, and Abiathar, JThSt N. S. 7 1956, 70–74
160 Literaturverzeichnis
Juynboll, Th. Guil. Joh. (Hrsg.), �;� �� �$�� 1 ����� �/� sifr yuša� bin nun/
Chronicon Samaritanum, Arabice conscriptum, cui titulus est Liber Jo-suae, Lugduni Batavorum: S. & J. Luchtmans 1848
Kahle, Paul, Die moslemischen Heiligtümer in und bei Jerusalem, PJ 6 1910,63–101
Kallai, Zecharia, ����� ���� ���� nah.alôt šibt.ê yisra�el/The Tribes of Is-
rael. A Study in the Historical Geography of the Bible, Jerusalem: BialikInstitute 1967
Rachel’s Tomb. A historiographical review, in: Loader, James Alfredund Kieweler, Hans Volker (Hrsg.), Vielseitigkeit des Alten Testa-ments, Festschrift für Georg Sauer, WASt 1, Frankfurt am Main u. a.:Peter Lang 1999, 215–223
Kallai-Kleinmann, Z., The Town Lists of Judah, Simeon, Benjamin andDan, VT 8 1958, 134–160
Kang, Sa-Moon, Divine War in the Old Testament and in the Ancient NearEast, BZAW 177, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1989
Katzenelenbogen, Mordechai Leib (Hrsg.), ����� ���� '���� �������� tôrat h. ayyîm. h.
amišah h. umšê tôrah, Jerusalem: Mossad HaravKook 1986–1993
Keel, Othmar und Küchler, Max, Orte und Landschaften der Bibel,Band II: Der Süden, Zürich u. a.: Benzinger – Vandenhoeck & Ru-precht 1982
Keel, Othmar, Küchler, Max und Uehlinger, Christoph, Orte undLandschaften der Bibel, Band I: Geographisch-geschichtliche Landes-kunde, Einsiedeln u. a.: Benzinger – Vandenhoeck & Ruprecht 1984
Kellermann, D., ��� �� lewî, ThWAT IV 1984, 499–521Kennett, R. H., The Origin of the Aaronite Priesthood, JThSt 6 1905, 161–
186
Khoury, Adel Theodor, Der Koran arabisch-deutsch. Übersetzung und wis-senschaftlicher Kommentar, Band III, Gütersloh: Gütersloher Verlags-haus – Gerd Mohn 1992
Khoury, Raif Georges, Les légendes prophétiques dans l’Islam, Band 3,Wiesbaden: Harassowitz 1978
Kirchhoff, Markus, Text zu Land. Palästina im wissenschaftlichen Diskurs1865–1920, SSDI 5, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005
Kitchener, Horatio Herbert, Journal of the Survey, PEFQSt 1878, 62–67Kittel, Rudolf, Geschichte des Volkes Israel III, Stuttgart: W. Kohlhammer
1927
Kloppenborg, John S., Joshua 22: The Priestly Editing of an Ancient Tradi-tion, Bib. 62 1981, 347–371
Literaturverzeichnis 161
Klostermann, E. (Hrsg.), Das Onomastikon der biblischen Eigennamen,Band 3, 1. Hälfte, Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung 1904, Re-print: Olms, Hildesheim 1966
Knauf, Ernst Axel, Midian. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas undNordarabiens am Ende des 2. Jahrtausends v. Chr., ADPV, Wiesbaden:Harrassowitz 1988
Midian und Midianiter, NBL II 1995, 802–804Welches »Israel« Bileam sah, in: Ninow, Friedbert (Hrsg.), Wort undStein. Studien zur Theologie und Archäologie, Festschrift für Udo Wor-schech, BEAK 4, Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang 2003, 179–186
Koch, Klaus, � �� �� qæb¯
ær, ThWAT VI 1989, 1149–1156
Kochavi, Moshe (Hrsg.), ��� �������$�� ��� 'DZ���� DZ����� ������”$�� yehûdah šômerôn wegôlan. sæqær �arke�ôlôgî bišnat (5)728 / JudaeaSamaria and the Golan. Archaeological Survey 1967–1968, Jerusalem:Carta 1972
Köckert, Matthias, Vätergott und Väterverheißungen. Eine Auseinander-setzung mit Albrecht Alt und seinen Erben, FRLANT 142, Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht 1988
Koehler, August, Die Nachexilischen Propheten. IV: Die WeissagungenMaleachis, Erlangen: Andreas Deichert 1865
Koehler, Ludwig und Baumgartner, Walter, Hebräisches und aramäi-sches Lexikon zum Alten Testament, neu bearbeitet von Walter Baum-gartner und Johann Jakob Stamm, Band III, Leiden: E. J. Brill 1983
Konkel, Michael, Die Gola von 587 und die Priester. Zu einem Buch vonThilo Alexander Rudnig, ZAR 8 2002, 357–383
Köpf, Ulrich, Heilige/Heiligenverehrung II. Kirchengeschichtlich, RGG4
III 2000, 1540–1542Kornfeld, Walter, Jüdisch-aramäische Grabinschriften aus Edfu,
AÖAW. PH 110, Nr. So. 4, 123–137Kratz, Reinhard Gregor, Die Komposition der erzählenden Bücher des Al-
ten Testaments. Grundwissen der Bibelkritik, Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht 2000Der vor- und der nachpriesterschriftliche Hexateuch, in: Gertz,Jan Christian, Schmid, Konrad und Witte, Markus (Hrsg.), Ab-schied vom Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngstenDiskussion, BZAW 315, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2002,295–323
Kreuzer, Siegfried, Die Frühgeschichte Israels in Bekenntnis und Verkün-digung des Alten Testaments, BZAW 178, Berlin – New York: Walterde Gruyter 1989
162 Literaturverzeichnis
Küchler, Friedrich, Der Gedanke des Eifers Jahwes im Alten Testament,ZAW 28 1908, 42–52
Kuenen, A., Historisch-critisch Onderzoek naar het Onstaan en de Verza-meling van de Boeken des Ouden Verbonds, Band I,1: De Hexateuch,2. Auflage, Leiden: P. Engels 1885
Kugel, James, Levi’s Elevation to the Priesthood in Second Temple Writings,HThR 86 1993, 1–64
Kugler, Robert A., From Patriarch to Priest. The Levi-Priestly Traditionfrom Aramaic Levi to Testament of Levi, SBL. EJL 9, Atlanta, Georgia:Scholars Press 1996
Kuhn, Karl Georg, Der tannaitische Midrasch Sifre zu Numeri, Rabbini-sche Texte II. Tannaitische Midraschim 3, Stuttgart: W. Kohlhammer1959
Kutsch, Ernst, �� �� �� berît Verpflichtung, THAT I� 1984, 339–352Laato, Antti, The Levitical Genealogies in 1 Chronicles 5–6 and the Forma-
tion of Levitical Ideology in Post-exilic Judah, JSOT 62 1994, 77–99Lanczkowski, Günter, Heilige/Heiligenverehrung I. Religionsgeschichtlich,
TRE 14 1985, 641–644Lane, E. W., Arabic-English Lexicon, Cambridge: The Islamic Text Society
1984, Wiederabdruck des Originals (London – Edinburgh: Williamsand Norgate I: 1863, II: 1877)
Lang, B., � �� ��$ kippær, ThWAT IV 1984, 303–318Larsson, Göran, Heilige/Heiligenverehrung II. Judentum, TRE 14 1985,
644–646Lau, Wolfgang, Schriftgelehrte Prophetie in Jes 56–66. Eine Untersuchung
zu den literarischen Bezügen in den letzten elf Kapiteln des Jesajabu-ches, BZAW 225, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1994
Lauffs, Zur Lage und Geschichte des Ortes Kirjath Jearim, ZDPV 38 1915,249–302
Lemaire, André, Bala�am/Bela� fils de Be�ôr, ZAW 102 1990, 180–187Levin, Yigal, Understanding Biblical Genealogies, CRBS 9 2001, 11–46Lewis, Theodore J., Cults of the Dead in Ancient Israel and Ugarit, Harvard
Semitic Monographs 39, Atlanta, Georgia: Scholars Press 1989
Lidzbarski, Mark, Wer ist Chadhir?, ZA 7 1892, 104–116Liver, Jacob, Chapters in the History of the Priests and Levites. Studies in the
Lists of Chronicles and Ezra and Nehemiah/���$� ������� ���� ������� peraqîm betôledôt hakkehunnah wehallewiyyah, Jerusalem: Ma-gnes Press 1968
Lohfink, Norbert, Die Schichten des Pentateuch und der Krieg, in:(Hrsg.), Gewalt und Gewaltlosigkeit im Alten Testament, QD 96, Frei-burg – Basel – Wien: Herder 1983, 51–110
Literaturverzeichnis 163
»Gewalt« als Thema alttestamentlicher Forschung, in: (Hrsg.),Gewalt und Gewaltlosigkeit im Alten Testament, QD 96, Freiburg –Basel – Wien: Herder 1983, 15–50Bund, NBL I 1991, 344–348
Loretz, Oswald, Vom kanaanäischen Totenkult zur jüdischen Patriarchen-und Elternehrung. Historische und tiefenpsychologische Grundproble-me der Entstehung des biblischen Geschichtsbildes und in der jüdi-schen Ethik, JARG 3 1978, 149–204
Macdonald, John (Hrsg.), Memar Marqah. The Teaching of Marqah, BandI–II, Berlin: Alfred Töpelmann 1963
The Samaritan Chronicle No. II (or: Sepher Ha-Yamim). From Joshuato Nebuchadnezzar, BZAW 107, Berlin: Walter de Gruyter 1969
Malamat, Avraham, Tribal Societies: Biblical Genealogies and African Linea-ge Systems, in: , History of Biblical Israel: Major Problems andMinor Issues, Culture and history of the ancient Near East 7, Leiden:E. J. Brill 2001, 41–53
Marmardji, A.-S., Textes géographiques arabes sur la Palestine. Recueillis,mis en ordre alphabétique et traduits en français, Paris: J. Gabalda etCie 1951
Marti, Karl, Das Dodekapropheton, KHC XIII, Tübingen: Mohr (Siebeck)1904
Martone, Corrado, Beyond Beyond the Essene Hypothesis? Some Observati-ons on the Qumran Zadokite Priesthood, Henoch 25 2003, 267–275
Masûdî,�<� ��=3
8�- ���
�'��" � 9� ��: / Kitâb at-tanbîh wa’l-ischrâf, Band 8, hrsg. v.
de Goeje, M. J., Leiden: E. J. Brill 1894Maurer, Franc. Jos. Valent. Dominic., Commentarius grammaticus criti-
cus in Vetus Testamentum, Band I, Leipzig: Fridericus Volckmar 1835
Mazar (Maisler), Benjamin, ��� ��� �� ���� miggæba� �ad be�er šæba�
/ From Geba to Beersheba, BJPES 8 1940/41Lebo-hamath and the Northern Border of Canaan, in: , The earlybiblical period: historical studies, hrsg. von Shmuel Ahituv und BaruchA. Levine, Jerusalem: Israel Exploration Society 1986, 189–202
Mc Cown, Chester Charlton, Muslim shrines in Palestine, AASOR 2. 31923, 47–79
McKenzie, Steven L. und Wallace, Howard N., Covenant Themes in Ma-lachi, CBQ 45 1983, 549–563
McNeile, A. H., The Origin of the Aaronite Priesthood, JThSt 7 1907, 1–9Meek, Theophile James, Aaronites and Zadokites, AJSL 45 1929, 149–166
Moses and the Levites, AJSL 56 1939, 113–120Meinhold, Arndt, Maleachi, Lieferung 1–3, BK. AT XIV/8,1–3, Neu-
kirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2000–2003
164 Literaturverzeichnis
Meinhold, Arndt, Der Gewaltmensch als abschreckendes Beispiel in Pro-verbien 1–9, in: , Zur weisheitlichen Sicht des Menschen. Gesam-melte Aufsätze, hrsg. v. Thomas Neumann und Johannes Thon, ABG 6,Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2002, 151–164
Mendenhall, George E., The Tenth Generation. The Origins of the Bi-blical Tradition, Baltimore – London: John Hopkins University Press1976
Menes, A., Tempel und Synagoge, ZAW 50 1932, 268–276Meyer, Eduard, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, Halle an der Saale:
Max Niemeyer 1906
Meyer, R., Levitische Emanzipationsbestrebungen in nachexilischer Zeit,OLZ 41 1938, 721–728
����� '��� ���� midraš rabbah. wîlna�, 2 Bände, Jerusalem: Ortsel 5721Miles, Jack, Gott. Eine Biographie, München – Wien: Carl Hanser 1996
Milgrom, Jacob, Numbers �����, JPSTC, Philadelphia – New York: TheJewish Publication Society 1990
Mittmann, Siegfried, Die Gebietsbeschreibung des Stammes Ruben inJos 13,15–23, ZDPV 111 1995, 1–27
Möhlenbrink, Kurt, Die levitischen Überlieferungen des Alten Testaments,ZAW 52 1934, 184–231
Morgenstern, Julian, The Ark, the Ephod, and the »Tent of Meeting«,HUCA 17 1942, 153–266
Mowinckel, Sigmund, Studien zu dem Buche Ezra-Nehemia I. Die nach-chronistische Redaktion des Buches. Die Listen, SNVAO. HF 3, Oslo:Universitetsforlaget 1964
Mulder, Otto, Two Approaches: Simon the High Priest and YHWH Godof Israel / God of All in Sirach 50, in: Egger-Wenzel, Renate (Hrsg.),Ben Sira’s God. Proceedings of the International Ben Sira ConferenceDurham – Ushaw College 2001, BZAW 321, Berlin – New York: Walterde Gruyter 2002, 221–234Simon the High Priest in Sirach 50. An Exegetical Study of the Signifi-cance of Simon the High Priest as Climax to the Praise of the Fathers inBen Sira’s Concept of the History of Israel, JSJSup 78, Leiden – Boston:E. J. Brill 2003
Musil, Alois, Arabia Petraea, Band 1, Wien: Alfred Hölder 1907
Na�aman, Nadav, The Kingdom of Judah under Josiah, Tel Aviv 18 1991, 3–71Nabulusi, �Abd al-Gani,
����� �/" � ��>� "� �< ����?
�@3� �A ������� al-h. ad. ra al-unsiyya fir-rih. la al-qudsiyya, Beirut: al-mas.adir 1990m / 1411h
Nelson, Richard D., Raising up a faithful priest: community and priesthoodin biblical theology, Louiseville, Kentucky: Westminster / John KnoxPress 1993
Literaturverzeichnis 165
Nentel, Jochen, Trägerschaft und Intentionen des deuteronomistischen Ge-schichtswerks. Untersuchungen zu den Reflexionsreden Jos 1; 23; 24;1 Sam 12 und 1 Kön 8, BZAW 297, Berlin – New York: Walter de Gruy-ter 2000
Neu, Rainer, Genealogie, RGG4 III 2000, 658–660Niditch, Susan, War, Women, and Defilement in Numbers 31, Semeia 61
1993, 39–57Noort, Ed, Der Streit um den Altar. Josua 22 und seine Rezeptionsgeschichte,
in: Albertz, Rainer (Hrsg.), Kult, Konflikt und Versöhnung. Beiträ-ge zur kultischen Sühne in religiösen, sozialen und politischen Ausein-andersetzungen des antiken Mittelmeerraumes, AOAT 285, Münster:Ugarit-Verlag 2001, 151–174
Nordström, Carl-Otto, Rabbinica in frühchristlichen und byzantinischenIllustrationen zum 4. Buch Mose, in: Brunius, T. (Hrsg.), Idea andForm. Studies in the History of Art, FIGURA. Uppsala Studies in theHistory of Art. New Series I, Stockholm: Almquist & Wiksell 1959,24–47
North, Francis Sparling, Aaron’s Rise in Prestige, ZAW 66 1954, 191–199Noth, Martin, Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemein-
semitischen Namengebung, BWANT 3. F, 10, Stuttgart: Kohlhammer1928
Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, Stuttgart: W. Kohlhammer1948
Die Welt des Alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alt-testamentlichen Wissenschaft, Sammlung Töpelmann, 2. Reihe: Theo-logische Hilfsbücher 3, 3. Auflage, Berlin: Alfred Töpelmann 1950
Das zweite Buch Mose. Exodus, ATD 5, Berlin: Evangelische Verlags-anstalt 1960Das vierte Buch Mose. Numeri, ATD 7, Berlin: Evangelische Verlags-anstalt 1969Das Buch Josua, HAT I, 7, 3. Auflage, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1971
Nougayrol, Jean, Textes accadiens des archives sud (Archives internationa-les), 2 Teilbände, PRU IV, Paris: Impriemerie nationale – C. Klinck-sieck 1956
Nurmela, Risto, The Levites. Their Emergence as a Second-Class Priest-hood, SFSHJ 193, Atlanta, Georgia: Scholars Press 1998
O’Brien, Julia M., Priest and Levite in Malachi, SBL. DS 121, Atlanta, Ge-orgia: Scholars Press 1990
Oeming, Manfred, Das wahre Israel. Die »genealogische Vorhalle« 1Chronik1–9, BWANT 128, Stuttgert – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 1990
166 Literaturverzeichnis
O’Kennedy, D. F., Prayer in Moab (Dt 3:23–29): The relationship betweenthe recorded prayer and its historical geographical setting, OTE 11 1998,288–305
Olson, Dennis T., Negotiating Boundaries. The Old and New Generationsand the Theology of Numbers, Interpretation 51 1997, 229–241
Olyan, Saul M., Ben Sira’s Relationship to the Priesthood, HThR 80 1987,261–286
Organ, Barbara E., Pursuing Phinehas: A Synchronic Reading, CBQ 632001, 203–218
Orlinsky, M., The Hebrew Vorlage of the Septuagint of the book of Joshua,in: Vriezen, Th. C. u. a., Congress Volume. Rome 1968, VT. S 27,Leiden: E. J. Brill 1969, 187–195
Otto, Eckart, Die nachpriesterschriftliche Pentateuchredaktion im BuchExodus, in: Vervenne, Mark (Hrsg.), Studies in the Book of Exodus.Redaction – Reception – Interpretation, BEThL 76, Leuven-Louvain:University Press – Uitgeverij Peeters 1996, 61–111Die post-deuteronomistische Levitisierung des Deuteronomiums,ZAR 5 1999, 277–284Krieg und Frieden in der Hebräischen Bibel und im Alten Orient.Aspekte für eine Friedensordnung in der Moderne, ThFr 18, Stuttgart– Berlin – Köln: W. Kohlhammer 1999
Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch. Studien zur Li-teraturgeschichte von Pentateuch und Hexateuch im Lichte des Deute-ronomiumsrahmens, FAT 30, Tübingen: Mohr (Siebeck) 2000Gab es »historische« und »fiktive« Aaroniden im Alten Testament?,ZAR 7 2001, 403–414Krieg IV. Altes Testament, RGG4 IV 2001, 1768 f.Priestertum II. Religionsgeschichtlich 1. Alter Orient und Altes Testa-ment, RGG4 VI 2003, 1646–1649
Ovadiah, Asher, Corpus of the Byzantine Churches in the Holy Land, Theo-phaneia 22, Bonn: Peter Hanstein 1970
Paret, Rudi, Der Koran. Konkordanz und Kommentar, 2. Auflage, Stuttgart– Berlin – Köln – Mainz: W. Kohlhammer 1980
Paul, Jürgen, Heilige/Heiligenverehrung V. Islam, RGG4 III, 1546Perlitt, Lothar, Deuteronomium, Lieferungen 1–3, BK. AT V, 1–3, Neu-
kirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1990–1994Petersen, John E., Priestly Materials in Joshua 13–22: A Return to the He-
xateuch?, HebAnnRev 4 1980, 131–146Petrus diaconus, Liber de locis sanctis, in: Geyer, Paulus (Hrsg.), Itinera
Hierosolymitana saeculi IIII–VIII, Pragae – Vindobonae – Lipsiae: F.Tempski 1898, 105–121
Literaturverzeichnis 167
Pfeiffer, Henrik, Das Heiligtum von Bethel im Spiegel des Hoseabuches,FRLANT 183, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999
Philo von Alexandria, Die Werke in deutscher Übersetzung, Band I, hrsg.v. Cohn, Leopold, 2. Auflage, Berlin: Walter de Gruyter 1962
Phinehas Priesthood, A Voice in the Wilderness, Oktober 1996 (http://www.a-voice.org/main/phinehas.htm), Zugriff am 9. April 2003
Piccirillo, Michele und Alliata, Eugenio, Mount Nebo. New Archaeolo-gical Excavations 1967–1997, Jerusalem: Studium Biblicum Francisca-num 1998
Podella, Thomas, Ahnen/Ahnenverehrung III. Altes Testament, RGG4 I1998, 227 f.
Polzin, Robert, hwqy� and Covenantal Institutions in Early Israel, HThR 621969, 227–240
Quesada, Jan Jaynes, Body Piercing: The Issue of Priestly Control over Ac-ceptable Family Structure in the Book of Numbers, BibInt 10 2002,24–35
Rad, Gerhard von, Das erste Buch Mose, ATD 2–4, Berlin: EvangelischeVerlagsanstalt 1955
Ranke, Hermann, Die Ägyptischen Personennamen, 3 Bände, Glückstadt:J. J. Augustin 1935–76
Reif, S. C., What enraged Phinehas? – A Study of Numbers 25:8, JBL 90 1971,200–206
Reuter, E., �� qn�, ThWAT VII 1993, 51–62Robinson, Eduard, Palästina und die südlich angrenzenden Länder. Tage-
buch einer Reise im Jahre 1838 in Bezug auf die biblische Geographieunternommen, I–III, Halle an der Saale: Verlag der Buchhandlung desWaisenhauses 1841–1842
Rofé, Alexander, The End of the Book of Joshua According to the Septua-gint, Henoch IV 1982, 17–36
Römer, Thomas Chr., Das Buch Numeri und das Ende des Jahwisten.Anfragen zur »Quellenscheidung« im vierten Buch des Pentateuch,in: Gertz, Jan Christian, Schmid, Konrad und Witte, Markus(Hrsg.), Abschied vom Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch inder jüngsten Diskussion, BZAW 315, Berlin – New York: Walter deGruyter 2002, 215–231
Rooke, Deborah W., Zadok’s Heirs. The Role and Development of the HighPriesthood in Ancient Israel, OTM, Oxford: University Press 2000
Rösel, Hartmut N., Die Überleitungen vom Josua- ins Richterbuch, VT 301980, 342–350Von Josua bis Jojachin. Untersuchungen zu den deuteronomistischenGeschichtsbüchern des Alten Testaments, VT. S 75, Leiden – Boston –Köln: Brill 1999
168 Literaturverzeichnis
Rösel, Martin, Wie einer vom Propheten zum Verführer wurde. Traditionund Rezeption der Bileamgestalt, Bib. 80 1999, 506–524Die Septuaginta-Version des Josuabuches, in: Fabry, Heinz-Josefund Offerhaus, Ulrich (Hrsg.), Im Brennpunkt: Die Septuagin-ta. Studien zur Entstehung und Bedeutung der Griechischen Bibel,BWANT 153, Stuttgart – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 2001, 197–211
Rowley, H. H., Zadok and Nehushtan, JBL 58 1939, 113–141Rudnig, Thilo Alexander, Heilig und Profan. Redaktionskritische Studien
zu Ez 40–48, BZAW 287, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2000
Rezension zu Michael Konkel, Architektonik des Heiligen, ZAR 82002, 384–389
Rudolph, Wilhelm, Der »Elohist« von Exodus bis Josua, BZAW 68, Berlin:Alfred Töpelmann 1938
Esra und Nehemia samt 3. Esra, HAT 20, Tübingen: Mohr (Siebeck)1949
Rushing, Ronald Lee, Phinehas’ Covenant of Peace, Diss., Dallas, 1988Ruwe, Andreas, »Heiligkeitsgesetz« und »Priesterschrift«. Literaturgeschicht-
liche und rechtssystematische Untersuchungen zu Leviticus 17,1–26,2,FAT 26, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1999und Weise, Uwe, Das Joch Assurs und jhwhs Joch. Ein Realienbegriff
und seine Metaphorisierung in neuassyrischen und alttestamentlichenTexten, ZAR 8 2002, 274–307
Sabourin, Leopold, Priesthood. A Comparative Study, SHR 25, Leiden: E. J.Brill 1973
Sauer, Georg, � �� �� qin�a Eifer, THAT II� 1984, 647–650Schaper, Joachim, Hoherpriester. I. Altes Testament, RGG4 IV 2000, 1835–
1836
Priester und Leviten im achämenidischen Juda. Studien zur Kult- undSozialgeschichte Israels in persischer Zeit, FAT 31, Tübingen: Mohr(Siebeck) 2000
Scharbert, Josef, Numeri, NEB, Würzburg: Echter Verlag 1992
Schicklberger, Franz, Die Ladeerzählungen des ersten Samuelbuches. Eineliteraturwissenschaftliche und theologiegeschichtliche Untersuchung,FzB 7, Würzburg: Echter Verlag 1973
Schlatter, Adolf, Der Märtyrer in den Anfängen der Kirche, BFChTh 19,3,Gütersloh 1915
Schmidt, Ludwig, Die alttestamentliche Bileamüberlieferung, BZ 23 1979,234–261Das vierte Buch Mose. Numeri 10,11–36,13, ATD 7,2, Göttingen: Van-denhoeck & Ruprecht 2004
Literaturverzeichnis 169
Schmidt, Werner H., Exodus. 1. Teilband: Exodus 1–6, BK. AT II/1, Neu-kirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1988
Schmitt, Götz, Levitenstädte, ZDPV 111 1995, 28–48Siedlungen Palästinas in griechisch-römischer Zeit. Ostjordanland, Ne-geb und (in Auswahl) Westjordanland, BTAVO B 93, Wiesbaden: Lud-wig Reichert 1995
Scholem, Gerschom, %��� � – ���� ���� ’�� ������� ����� ’� / sepær šebîlêdîrûšlæm lerabbî yis.h. aq h. êlô – mezuyyap, Zion 6 1933/34, 1–15
Schorn, Ulrike, Ruben und das System der zwölf Stämme Israels. Redak-tionsgeschichtliche Untersuchungen zur Bedeutung des ErstgeborenenJakobs, BZAW 248, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1997
Schulz, Hermann, Leviten im vorstaatlichen Israel und im Mittleren Osten,München: Chr. Kaiser 1987
Schunck, Klaus-Dietrich, Bemerkungen zur Ortsliste von Benjamin(Jos. 18,21–28), ZDPV 78 1962, 143–158
Schwemer, Anna Maria, Studien zu den frühjüdischen ProphetenlegendenVitae Prophetarum, 2 Bände, TSAJ 49. 50, Tübingen: Mohr (Siebeck)1995/96Heilige/Heiligenverehrung IV. Judentum, RGG4 III 2000, 1545
Schwenzer, Daniel, Petrus Diaconus, BBKL XVIII, Ergänzungen V, 1149–1152
Seebass, Horst, Levi/Leviten, TRE XXI 1991, 36–40Zu Numeri 25,1–18, in: Graupner, Axel, Delkurt, Holger undErnst, Alexander B. (Hrsg.), Verbindungslinien, Festschrift für Wer-ner H. Schmidt, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2000, 351–362
The Case of Phinehas at Baal Peor in Num 25, BN 117 2003, 40–46Numeri 2. Teilband. Num 10,11–22,1, BK. AT IV/2, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2003
Numeri 3. Teilband. Num 22,2 ff. [Lieferung 1 und 2], BK. AT IV/3,2004/2005
Seters, John van, The Terms »Amorite« and »Hittite« in the Old Testament,VT 22 1972, 64–81
Shachar, Isaiah, The Judensau. A Medieval Anti-Jewish Motif and its Histo-ry, London: Warburg Institute 1974
Sharp, Carolyn J., Phinehan Zeal and Rhetorical Strategy in 4QMMT ,RQ 18,2 1997, 207–222
Simons, J., The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament,Leiden: E. J. Brill 1959
Sivan, Helena Zlotnick, The Rape of Cozbi (Numbers XXV), VT 51 2001,69–80
170 Literaturverzeichnis
Smend, Rudolf d. Ä., Die Erzählung des Hexateuch. Auf ihre Quellen un-tersucht, Berlin: Georg Reimer 1912
Smend, Rudolf d. J., Jahwekrieg und Stämmebund. Erwägungen zur ältestenGeschichte Israels, FRLANT 84, 2. Auflage, Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht 1966
Das Gesetz und die Völker. Ein Beitrag zur deuteronomistischen Re-daktionsgeschichte, in: , Die Mitte des Alten Testaments. Gesam-melte Studien Band 1, BEvTh 99, München: Chr. Kaiser 1986, 124–137
Smiles, Vincent M., The Concept of »Zeal« in Second-Temple Judaism andPaul’s Critique of It in Romans 10:2, CBQ 64 2002, 282–299
Snaith, N. H. (Hrsg.), Leviticus and Numbers, London – Edinburgh: Nelson1967
Spencer, John R., Priestly Families (or Factions) in Samuel and Kings, in:Holloway, Steven W. und Handy, Lowell K. (Hrsg.), The Pitcheris Broken. Memorial Essays for Gösta Ahlström, JSOT. S 190, Sheffield:Sheffield Academic Press 1995, 387–400
PQD, the Levites, and Numbers 1–4, ZAW 110 1998, 535–546
Spiegelberg, Wilhelm, Eine Vermutung über den Ursprung des Namens����, ZDMG 53 1899, 633–643
Spronk, Klaas, Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Ne-ar East, AOAT 219, Kevelaer–Neukirchen Vluyn: Butzon & Bercker –Neukirchener Verlag 1986
Staubli, Thomas, Die Bücher Levitikus, Numeri, NSK. AT 3, Stuttgart: Ka-tholisches Bibelwerk 1996
Stenhouse, Paul, The kitab al-tarıkh of Abu ’l-Fath. . Translated with Notes,Studies in Judaica 1, Sydney: Mandelbaum Trust 1985
Stoebe, Hans Joachim, Das erste Buch Samuelis, KAT VIII, 1, Gütersloh:Gütersloher Verlagshaus 1973
Stolz, Fritz, Das erste und zweite Buch Samuel, ZBK. AT 9, Zürich: Theo-logischer Verlag 1981
Strack, Hermann L. und Billerbeck, Paul, Kommentar zum Neuen Te-stament aus Talmud und Midrasch, München: C. H. Beck 1922–1961
Strange, Guy Le, Palestine under the Moslems. A Description of Syria andthe Holy Land, o. O.: The Committee of the Palestine ExplorationFund 1890
Strauss, Hans, Untersuchungen zu den Überlieferungen der vorexilischenLeviten, Diss., Bonn, 1960
Stumpff, Albrecht, 1&/�� ��/2, ThWNT II 1935, 879–894
Literaturverzeichnis 171
T. abari, Abu Ga�far Muh. ammad bin Garir al, 67���8��� �B�
%� �C"� 67���8���
D�>� � - .��� " � ta�rıh˘
at.-t.abarı. ta�rıh˘
ar-rusul wal-muluk, Band 9,hrsg. v. Ibrahim, Muh. ammad Abu’l-Fad. l, Kairo: Dar al-mu�arif 1968
Terbuyken, Peri J., Levi, Jochebed und Pinhas in der rabbinischen Tradition.Genealogische Anmerkungen, BN 116 2003, 95–104
Thenius, Otto, Die Bücher Samuels, KEH IV, Leipzig: S. Hirzel 1864Thiel, Winfried, Rizpa und das Ritual von Gibeon, in: Kottsieper, In-
go (Hrsg.), »Wer ist wie du, Herr, unter den Göttern?« Studien zurTheologie und Religionsgeschichte Israels, Festschrift für Otto Kaiser,Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1994, 247–262
Thomsen, Peter, Loca sancta. Verzeichnis der im 1. bis 6. Jahrhundertn. Chr. erwähnten Ortschaften Palästinas mit besonderer Berücksich-tigung der Lokalisierung der biblischen Stätten, Band 1, Halle an derSaale: Rudolph Haupt 1907
Tov, Emanuel, The Growth of the Book of Joshua in Light of the Evidenceof the Septuagint, in: , The Greek and Hebrew Bible: collectedessays on the Septuagint, VT. S 72, Leiden: E. J. Brill 1999, 385–396
Tsevat, Matitiahu, Studies in the Book of Samuel, HUCA 32 1961, 191–216Utzschneider, Helmut, Künder oder Schreiber? Eine These zum Pro-
blem der »Schriftprophetie« aufgrund von Maleachi 1,6–2,9, BEAT 19,Frankfurt am Main – Bern – New York – Paris: Peter Lang 1989
Valentin, Heinrich, Aaron. Eine Studie zur vor-priesterschriftlichen Aaron-Überlieferung, OBO 18, Freiburg – Göttingen: Universitätsverlag –Vandenhoeck & Ruprecht 1978
Vattioni, Francesco, Ecclesiastico. Testo ebraico con apparato critico e ver-sioni greca, latina e siriaca, Neapel: Istituto orientale di Napoli 1968
de Vaux, Roland, Das Alte Testament und seine Lebensordnungen I, Frei-burg – Basel – Wien: Herder 1960
Das Alte Testament und seine Lebensordnungen II, Freiburg im Breis-gau: Herder 1960
de Vaux, Roland und Steve, A.-M., Fouilles à Qaryet el-�Enab = Abu GôshPalestine, Paris: Librairie Lecoffre – J. Gabalda et Cie 1950
Veenhof, Klaas R., Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexander desGroßen, GAT 11, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001
Vincent, H., Église byzantine et inscription romaine a Abou Ghôch, RB 161907, 414–421
Vink, J. G., The date and origin of the Priestly Code in the Old Testament,OTS 5 1969, 1–144
de Vogüé, Melchior, Les églises de la terre sainte, Paris: Victor Didron 1860,im Anhang die anonyme Descriptio locorum circa Hierusalem adjacenti-um, 414–433
172 Literaturverzeichnis
Wahl, S. F. G., Der Koran oder Das Gesetz der Moslemen durch Muhammedden Sohn Abdallahs, Halle an der Saale: Gebauersche Buchhandlung1828
Walter, Nikolaus, Präexistenz, Inkarnation und himmlisches PriestertumChristi nach dem Hebräerbrief. Ein Beispiel der Auslegung des AltenTestaments im Neuen, in: Meinhold, Arndt und Berlejung, Ange-lika (Hrsg.), Der Freund des Menschen, Festschrift für Georg Christi-an Macholz, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2003, 195–203
Waschke, Ernst-Joachim, Religionskonflikt. Anmerkungen zu Israels Aus-einandersetzung mit »Kanaan«, in: Meinhold, Arndt und Berle-jung, Angelika (Hrsg.), Der Freund des Menschen, Festschrift für Ge-org Christian Macholz, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2003,163–177
Weber, R. (Hrsg.), Appendix ad itinerarium Egeriae, in: Itineraria et aliageographica, CChr. SL CLXXV, Turnhout: Brepols 1965, 91–103
Weinfeld, M., �� �� ��, ThWAT I 1973, 781–808The Extent of the Promised Land – the Status of Transjordan,in: Strecker, Georg (Hrsg.), Das Land Israel in biblischer Zeit.Jerusalem-Symposium 1981, GTA 25, 1983, 59–75The Promise of the Land. The Inheritance of the Land od Canaan bythe Israelites, Berkeley – Los Angelos – Oxford: University of CaliforniaPress 1993
Wellhausen, Julius, Der Text der Bücher Samuelis, Göttingen: Vanden-hoeck & Ruprecht 1871Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Al-ten Testaments, 3. Auflage, Berlin: Georg Reimer 1899
Prolegomena zur Geschichte Israels, 6. Auflage, Berlin: Georg Reimer1905
Israelitische und jüdische Geschichte, Berlin: Georg Reimer 1907
Werner, W., Levi(t), NBL II 1995, 623–625Westermann, Claus, Pinehas, BHH III 1966, 1473–1475
Genesis III. Genesis 37–50, BK. AT I/3, Neukirchen-Vluyn: Neukir-chener Verlag 1982
Westphal, G., Aaron und die Aaroniden, ZAW 26 1906, 201–230Wewers, Gerd A., Sanhedrin. Gerichtshof, Übersetzung des Talmud Yeru-
shalmi IV/4, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1981Weyde, Karl William, Prophecy and Teaching. Prophetic Authoriy, Form
Problems, and the Use of Traditions in the Book of Malachi,BZAW 288, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2000
Wilkinson, John, Jerusalem Pilgrims Before the Crusades, 2. Auflage, War-minster (England): Aris & Phillips 2002
Literaturverzeichnis 173
Wilkinson, John, Hill, Joyce und Ryan, W. F., Jerusalem Pilgrimage 1099–1185, London: Hakluyt Society 1988
Willi, Thomas, Chronik, Lieferung 1, BK. AT XXIV/1, Neukirchen-Vluyn:Neukirchener Verlag 1991
Leviten, Priester und Kult in vorhellenistischer Zeit. Die chronistischeOptik in ihrem geschichtlichen Kontext, in: Ego, Beate, Lange, Ar-min und Pilhofer, Peter (Hrsg.), Gemeinde ohne Tempel. Commu-nity without Temple, WUNT 118, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1999, 75–98
Willi-Plein, Ina, Zu A. Behrens, Gen 15,6 und das Vorverständnis des Pau-lus, ZAW 109 (1997), 327–341, ZAW 112 2000, 396 f.
Williamson, H. G. M., Ezra, Nehemiah, WBC 16, Waco: Word Books 1995
Wilnaj, Zeev, ����� )��� ��� ����� mas.s.ebôt qodæš be�æræs. yisra�el , Je-
rusalem: Mossad Harav Kook 1963
DZ������ ����� yehûda wešômerôn, Tel Aviv: Sifrijat hasSadeh 1968
Wilson, Robert R., The Old Testament Genealogies in Recent Research,JBL 94 1975, 169–189Genealogy and History in the Biblical World, YNER 7, New Haven –London: Yale University Press 1977
Wolff, Hans Walter, Dodekapropheton 1. Hosea, BK. AT XIV, 1, Neu-kirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1990
Worschech, Udo, Das Land jenseits des Jordan. Biblische Archäologiein Jordanien, SBAZ 1, Wuppertal – Zürich – Hamburg: Brockhaus/Saatkorn-Verlag 1991
Cromlechs, Dolmen und Menhire. Vergleichende Studien zu vor-und frühgeschichtlichen Grabanlagen in Jordanien, BEAK 2, Frankfurtam Main u. a.: Peter Lang 2002
Wünsche, August, Der Midrasch Schemot Rabba das ist die haggadischeAuslegung des zweiten Buches Moses, Leipzig: Otto Schulze 1882
Der Midrasch Bemidbar Rabba das ist die allegorische Auslegung desvierten Buches Mose, Leipzig: Otto Schulze 1885
Yakut al-Rumi, �;� >� " � EF� !#/Mu�djam al-buldan, Band IV, Beirut: DarSader 1977
Yassine, Khair, The Dolmens: Construction and Dating Reconsidered, BA-SOR 259 1985, 63–69
Zadok, Ran, Notes on Modern Palestinian Toponymy, ZDPV 101 1985, 156–161
The pre-hellenistic israelite anthroponymy and prosopography,OLA 28, Leuven: Peeters 1988
Zapletal, Vincenz, Das Buch der Richter, EHAT VII, 1, Münster in Westf.:Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung 1923
174 Literaturverzeichnis
Zedaqa, Binjamin, �������� ������ ���� ����� ���� �
aliyyah leqibrê�abôt bemasôræt haššômerônîm, A. B. – The Samaritan News 235 1979,4 f.
Zenger, Erich, C I. Die Tora/der Pentateuch als Ganzes, in: , Einlei-tung in das Alte Testament, Kohlhammer Studienbücher Theologie 1,1,4. Auflage, Stuttgart – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 2001, 66–86C II. Die Entstehung des Pentateuch, in: , Einleitung in das Al-te Testament, Kohlhammer Studienbücher Theologie 1,1, 4. Auflage,Stuttgart – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 2001, 87–122
Zeron, Alexander, The Martyrdom of Phineas-Elijah, JBL 98 1979, 99–100Ziemer, Benjamin, Abram–Abraham. Kompositionsgeschichtliche Untersu-
chungen zu Genesis 14, 15 und 17, BZAW 350, Berlin – New York:Walter de Gruyter 2005
Zimmerli, Walther, Ezechiel, BK. AT XIII/1. 2, 2. Auflage, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1979
Zohar, Mattanyah, Megalithic Cemetries in the Levant, in: Bar-Yosef,Ofer und Khazanov, Anatoly (Hrsg.), Pastoralism in the Levant. Ar-chaeological Materials in Anthropological Perspectives, Monographs inWord Archaeology 10, Madison: Prehistory Press 1992, 43–63Dolmens, NEAEHL I 1993, 352–356
Stellen
UgaritRS
17. 132 66
Altes TestamentGen
9,12 64
13,10 89
14,13 48
15,6 11
15,6b 40
15,9 f. 61
17 64
17,2 64
17,19 75
23 32
31,47 88
33,18–20 102
33,19 102
34 56, 5734,25–29 80
36,32 47
47,22 69
48,22 102
49,5–7 56, 5749,29–50,14 29
50,25 102
Ex2,1 f. 130
2,1–2a 130
2,16–22 7
2,18 51
2,21 48
3,1 51
6 3, 1346,10–16 125
6,13 126, 1276,14 126
6,14–25 125–132, 1416,14–27 138
6,16–19 130
6,18 12
6,19 131
6,20 127, 130, 1366,21 f. 130–1326,23 119, 122, 127, 1366,24 130, 1326,24 f. 85
6,25 3, 52, 127, 1366,26 f. 126
13,19 102
18,1–4 7
18,3 f. 136
18,25 f. 35, 6124,1 135
28,1 135
32 27, 36, 53–59, 63, 14132,25–29 6, 13832,26 12
32,27b 54
32,29a 54
32,33–35 54
32,35 55, 63Lev
2,13 6, 6910 27, 139, 14010,1–3 119
10,1 f. 130
19,18 5
20,19 f. 130
21,14b 130
25,32–34 74
26,42 65
Num1–4 81
1,48–53 83
2 f. 93
3,1–4 130, 1323,24 132
3,32 83
3,35 132
4 9
10,1–10 81
10,29 51
14,26–35 7
14,37 35, 63
176 Stellen
16 27, 5616–18 76
17 59, 63, 14117,10–14 59
18 69
18,6 6
18,19 69
21 33, 43, 93, 9821,20 43, 4621,26 33, 4121,43–45 93
22–24 33, 4322,1 33
22,2–25,5 42
22,4 33, 41, 42, 47, 14322,7 33, 41, 42, 47, 14323,21 84
23,28 43, 46, 4724,14–19 43
24,25 33
25 23 f., 33–64, 66, 68, 75, 79–83, 94, 139, 141, 142
25,1 43, 5125,1 f. 49
25,1–13 82, 8325,1–13. 19 143
25,1–3 55, 6025,1–4 60–62, 6425,1–5 36–38, 42, 5925,1b–5 59
25,2 40
25,3 4, 35, 4325,4 35, 60–6225,5 35, 60–62, 6425,5–13 62–64, 132, 135, 14325,5–13. 19 141
25,5–19 82
25,5b 54
25,6 35, 48–52, 6025,6b 82
25,6 f. 84
25,6 ff. 35, 6125,6–8 55
25,6–13 47, 4825,6–18 36
25,6–19 42
25,7 40
25,8 35, 40, 42, 48–50, 62
25,8 f. 41, 59, 76, 81, 13225,10–13 65, 6625,11 59
25,12 64, 6625,13 42, 55, 59, 8225,14 82
25,14–18 42, 47, 80, 82, 14325,16 81
25,16–18 42
25,17 92, 9325,18 59
25,19 33, 63, 6426 7, 6326,57–61 130, 13226,64 f. 7, 3427,12 44
27,12–14 80
31 7, 15, 33, 35, 41–43, 47, 56, 79–83, 94, 98, 99, 143
31 f. 92–14331,1 82
31,6 80–82, 98, 9931,6–9 80
31,8 33, 41–43, 50, 8231,16 33, 36, 41–43, 81–83, 9331,17 83
32 33, 86, 92, 93, 14332,20–24 85
32,38 46
Dtn2,24 91
3,18–20 85
3,27 44
3,29 43
4,3 7, 38–41, 614,3–5 34
4,46 43
7,1–5 5
10,8 69
10,8 f. 76
14,1 29
18 139
18,1 77
18,1–8 69, 7618,6–8 77
29 f. 34
31,25 f. 76
32,49 44
Stellen 177
33,8–11 56–58, 70, 72–73, 75, 7633,9 6
33,11 14
34 91
34,1 44
34,5 f. 29
34,6 43
Jos1,12–18 85, 873 43
4,12 85
9,18 64
13 91
13,2 89
13,21 33, 14313,21 f. 41, 4715,9 121
18,1 8
18,12–15 121
18,28 121
19,49 f. 102
21 10, 103, 107, 11721,9–16 10
21,10–21 103
21,17 117, 11821,17 f. 107
21,21 117
21,43–45 87
22 8, 33, 43, 79, 85–95, 98, 99,143
22–24 94
22,1 94
22,1–8 87
22,5 87
22,6 93
22,7 f. 87
22,9–34 85–94, 14322,10 86
22,11 86
22,13 f. 93
22,14 77, 9322,14 f. 93
22,17 41–43, 9822,19 85
22,22 90, 9422,24–27 90–9122,24b 143
22,25 90, 143
22,26a 143
22,26b 90
22,27 90, 91, 14322,28 90
22,29 94
22,30 8
22,24 90
22,34 88, 90, 14323 94, 9823 f. 101
23,2 94
23,4–13 99
24,1–13 102
24 94, 98, 10224,1b 94
24,15 98
24,16 f. 94
24,28 101
24,29–33 101–10324,33 8, 10, 79, 101–123, 137,
140–14224,33a. b[LXX] 104–10624,33a[LXX] 99
24,33b[LXX] 99
Ri2,6–9 104
2,9 102
3,7–11. 12–30 104
3,15. 27 118
11,13 33
11,30–40 9
17,12 54
18,13 139
18,30 97
19,16 118
20 8, 95, 9920 f. 98
20,1. 18. 23 96
20,27 50, 13820,27 f. 8, 10, 20, 79, 92, 95–99,
101, 104, 137, 14220,27b 95–9820,28 97
20,28a� 95–981 Sam
1–4 8
2 69, 1342 f. 3, 27, 76
178 Stellen
2,13 69
2,27 76, 78, 137, 1392,27 f. 8
2,27–30 77
2,28 77
2,30 8, 92,34–36 76
4 97
4,11 97
4,17 35
4,18–22 97
6,20–71 119
7,1 119 f., 13914,3 97
14,18 f. 97
22,20 136
22,30 77
28 29
30,7 f. 97
2 Sam5,10 84
6,1–8 139
6,3. 6 119
7 73
7,16 73
8,17 8, 35, 125, 136–14117,9 35
20,1 86, 11820,21 118
21,1–10 141
21,1–14 50, 6421,2. 6. 9 64
24,5 91
1Kön2,26 136
2,26 f. 8, 763,4 118
8,16b 71
12,16 86
14,1 135
15,25 135
19,10. 14 14, 5522,20 137
2 Kön10,16 55
23,8 117, 118Jes
8,19 29
10,2 71
28 30
54,10 66
Jer23,5 f. 73
33,14 73
33,18–22 6
43,7 139
Ez34,25 66
37,26 66
44 56, 138Hos
9,10 7, 23 f., 34, 38–41, 439,10–17 60
Hag1,1 133
Mal1,6–2,9 6
2 68
2,1 71, 722,1–9 70
2,2 70–722,1–9 58
2,4 70–722,4–8 6, 66–70, 732,4–9 23, 752,5 68, 70, 722,5 f. 68, 722,6b 66
2,7 12, 662,8 68, 70, 722,11 f. 53
3,1. 23 12
Ps69,9 f. 56
105 40
105,6–10 40
105,8–10 67
105,26b 76
105,42 40
106 10, 11106,28–31 38–41106,29 36
106,31 11
132,6–8 121
Esr 53, 1372 133
Stellen 179
7 f. 135, 1427,1. 5 133
7,1–5 132, 133, 135, 1368 133
8,1–14 133
8,2 23, 125, 132–136, 1408,33 135
10 133
10,18 f. 53
Neh 53, 1372,3. 5 30
2,19 91
4,1 135
7 133
13,4–9 91
13,28–30 53
13,29 6, 73–741Chr 137
2,42–55 122
2,50 f. 121
5,29–41 133
5,30–41 9
6,35–38 9, 1339,14–34 83–859,17 84
9,17–20 79
9,19 9, 839,19 f. 122
9,20 83, 849,21 f. 84
11,9 84
16,39 118
18,16 137
24,2 77
24,2 f. 9
24,3 21, 13624,3–5 134
2 Chr 137
6,5 f. 71
7,16 71
36,23 84
Apokryphen und Pseudepigraphen1Makk
2,23–28 12
2,49–70 11
2,54 11
4 Makk18,10–18 12
18,12 12
3 Esr5,5 133
Sir44–50 11
45 11
45,15. 23–26 11
50,24 11
4Esr1,1–3 9
Neues TestamentMt
23,29–32 30
Lk11,47 f. 30
Hebr4–10 13
Offb2,14 16
QumranCD
5,1–5 105
3,12–4,3 28
4Q243
ar 28,2 13
4Q522
9ii7 13, 1334QMMT
C 31 f. 13
6Q13
4 13, 133
Mischna und TalmudBB
111b–113a 9
San82a. b, 16 17
82b 16
IX,6 16
Sota43a 16
Zeb101b 5, 7
jSan28d,57–29a,2 17
180 Stellen
MidraschExR
3,16 9
NumR21,3 12
20,25 17
SifNumBalaq, 12 15–17
TanBBechuqqotay 7 9
Schemot 24 9
TargumTPsJ 15
Dtn 33,11 14
Ex 6,18 12
Num 25,8 17
Koran2,259(261) 121
9,30 114, 121
BibelkommentareIbn Esra, Kommentar zu
Num 25,8 49
Qimchi, Kommentar zu1 Sam 2,30 9
Raschbam, Kommentar zuEx 6,14–25 131
Raschi, Kommentar zu1 Sam 2,30 9
Mal 2,4 71
GeschichteAbulfath, annales
LII 114
JosAntV, 11,5 9
V, 1,29 107
IV, 129–130 16
Jub30,18 56
LAB18.13 16
L,3 9
Liber Josuae40 114
Masudi, kitab at-tanbıh 14
Philo, Vita Mosis1.229 303 16
Tabari, ta�rıh˘
14, 17Vitae Prophetarum
21. 1 14
Geographiedescriptio locorum 110
Egeria, PeregrinatioX, 10 46
X, 8 46
XII, 1. 2. 44
�ellæ hammassa�ôt2 114
Eugesippus, de distantiis 112
Eusebius, Onomastikon168,25–27 44
70,22–25 107, 121, 12374,1 f. 108
76,9–12 44
Hieronymus,ep. 108 13, 108
Isaak Helo, šebîlê dîrûšlæm3 110
Nabulusi, had. ra 114
Petrus Diaconus, Bedae de locis sanctisVII, 108 113
Rorgo Fretellus, descriptio 111
Yakut, mu�gam 114
SonstigesGeorgisches Rituale 108
Memar MarqahVI § 5 13
Tolkovaja Paleja 17