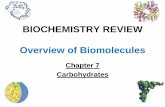Biochemistry German
Transcript of Biochemistry German
Hanni Kirchner, Julia Mühlhäußer Fachliche Unterstützung: Dipl.-lng. Sirnone Höge
BASICS Biochemie
ELSEVIER U RßA N & FISCti ER URBAN & FISCHER München
Zuschriften und Kritik bitte an:
Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, Lekrorar Medizinstudium, Hackerbrücke 6, 80335 M ünchen
E-Mail: medizinstudium@elsevier_de
Wichtiger Hinweis für den Benutzer
Die Erkenntnisse in der Medizin unterliegen laufendem Wandel durch Forschung und klinische Erfahrungen. Die Autoren dieses Werkes haben
große Sorgfalt darauf verwendet, dass die in diesem Werk gemachten therapeutischen Angaben [insbesondere hinsichllich Indikation, Dosierung
und unerwünschter Wirkung) dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Das entbindet den Nutzer dieses Werkes aber nicht von der Ver
pflichtung, anhand der Beipackzettel zu verschreibender Präparare zu überprüfen, ob die dort gemachten Angaben von denen in diesem Buch
abweichen, und seine Verordnung in eigener Veramwonung zu treffen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaill ierte bibliografische Daten sind i rn
Internet unter http:/ / dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten l . Auflage 2009 © Elsevier GmbH, München Der Urban & Fischer Verlag ist ein lmprint der Elsevier GmbH.
09 10 11 12 13 5 4 3 2
Für Copyright in Bezug auf das verwendete Bildmaterial siehe Abbildungsnachweis.
Der Verlag hat sich bemüht, sämlliche Rechteinhaber von Abbildungen zu ermitteln. Sollte dem Verlag gegenüber dennoch der Nachweis der
Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar gezahlt.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtl ich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen renzen des Urheberrechts
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gi lt insbesondere für Vervielfält.igungen, Übersetzungen, M ikroverfi l
mungen und die Einspeicherung und Verarbei tung in elektronischen Systemen.
Programmleitung: Dr. Dorothea Hennessen
Planung: Bettina Meschede
Lektorat: Karolin Dospil Redaktion: Dr. Andreas Bender
Herstellung: Rainald Schwarz, Elisabeth Märtz
Zeichnungen: Wolfgang Zettlmeier
Satz: Kösel, Krugzell Druck und Bindung: L. E.G.O. S.p.A., Lavis, Italien
Covergestaltung: Spieszdesign, Büro für Gestaltung, Neu-Ulm
ßildquelle: © DigitalVision/ Getrylmages
Printed in Italy ISBN 13: 978·3-437-42656-8
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.elsevier.de und www.elsevier.com
l
Vorwort
Biochemie - der Albtraum vieler Medizinstudenten. Einst auch unser eigener. Aber irgendwie haben wir auch diese Hürde gemeistert. Nur schade, dass es damals noch nicht die BASICS-Reihe von Elsevier gegeben hat. So mussten wir uns durch einen Berg dicker und unübersichtlicher BiochemieBücher und -Skripte kämpfen und haben letztlich die Klausur irgendwie geschafft. An diese Zeit mussten wir denken, als wir vor der Entscheidung standen, ob wir uns an das schwierige Thema Biochemie heranwagen sollten. Wichtig war uns dabei, die relevanten Grundlagen verständlich, übersichtlich und anschaulich darzustellen. Wir hoffen, dass uns dies auch gelungen ist. Wir haben versucht, alle für Mediziner wichtigen Themenbereiche der Biochemie abzudecken. Das ist bei einem so kurzen Lehrbuch nicht so ausführlich möglich, wie in einem Standardlehrbuch, aber es hilft sicher, sich über das Wichtigste einen guten Überblick zu verschaffen und vor der Klausur alles noch einmal zu wiederholen.
Bedanken möchten wir uns bei Karolin Dospil, Bettina Meschede, Christina Nussbaum und Julia Bender vom Elsevier Urban & Fischer Verlag für die tatkräftige Unterstützung und vor allem für ihre Geduld mit uns. Danke auch an
IV I V
Sirnone Hoege für die fachliche Beratung und ebenfalls für ihre Geduld_ Außerdem möchten wir uns bei unseren Familien und Freunden bedanken, die immer ein offenes Ohr für unser Gejammer hatten oder uns beim Korrigieren unserer Kapitel geholfen haben - Tobias Benthaus, Veronika Daiminger, Corina Epp, Susanne Fröhlich, Nina Gaus, Metanie Grimm, Marina und Melanie Kofler, Julia Krabbes, Matthias Krieg, Stefanie Passarge, Denise Sinnemann und natürlich allen anderen, die wir aus Platzgründen nicht mehr erwähnen können. Ich, Julia, möchte mich außerdem bei Hanni bedanken. Einfach dafür, dass sie so ist wie sie ist und hoffentlich auch so bleibt und dass sie die Idee hatte, das Buch zu schreiben. Ich, Hanni, möchte mich außerdem bei]ulia bedanken. Dafür, dass sie so eine gute Freundin ist und man mit ihr so viel Spaß haben kann (auch, wenn man gerade ein Buch schreibt).
Wir wünschen unseren Lesern (den Umständen entsprechend) viel Spaß beim Lesen dieses Buches und viel Glück in der Biochemie-Klausur.
München, im Mai 2009 Hanni Kirchner und Julia Mühlhäußer
Inhalt
A Allgemeiner Teil . ... . .. . . ..... ..... .
Grundlagen . . . . . . .... . .. . . .. . . . . . . . . . .
I Zytologie I .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. ... . . . I Zytologie JI . ... ..... . .. . . ...... ... . .. . . I Chemische Grundlagen I . . .. .. .. . . . . . . ... .
1 Chemische Grundlagen II . . . .. . . .. ... . ... .
I Enzyme . . . .. .. . . ... . . . . .. . . . . . ... ... .
I Enzymfunktion und -k.inetik .... . .. .. . .... .
I Prinzipien der Stoffwechselregulation . . ... .. .
I Vi tamine I .. .. . ..... . . . . . . . . . .. . . . .. .. .
I Vi tamine II ..... .... .... . . . . .... . . . . . . .
I Säure-Basen-Haushalt .. . . . .. .. .... .. . .. . .
2 - 2 1 Energiegewinnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76- 7 9
2_ 2 1 I Pyruva t-Dehydrogenase-ReakUon und Citra tzyklus . . ... . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
2 1 Atmungskette und ATP-Syn~ese .. . . .. ... . . . 4 6 Hormone und Zytokine ... . . .. . ..... . . . .
1 ~ 1 Grundlagen der in terzellulären Kommunikation
1 Hypothalamus-hypophysäres System . . . . .. . . . 12
I Schilddrüsenhormone . . . . ..... . . . . ... . .. . 14 16
I Regulation des Kalzium· und Phosphathaushalts 1 Hormone des Nebennierenmarks:
18 20
Adrenalin und Noradrenalin .... .. . . . . . . . . . 1 Hormone der Nebennierenrinde . ... . .. .. .. .
1 Hormone der Nebennierenrinde II . . . . .. .. . . .
76 78
80 - 99
80 82 84 86
B Spezieller Tei I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 135 1 Hormone der Bauchspeicheldrüse I ... .. . . . . .
88 90 92 94 96 98 Aminosäuren und Proteine . ... .. . .. .. .. .
I Aminosäuren . . .. ...... . . . . .. . . . . .. . . . .
I Peptide und Proteine . . . .. . . . . . . .. . . . .... .
I Aminosäure- und Proteinmetabolismus I ... .. .
I Aminosäure- und Proteinmetabolismus II . . ... .
Genetik .. .. . . . . . ... ... . . .. . . ..... . .. . .
I Stoffwechsel der Nukleotide I ...... . . .. ... .
I Stoffwechsel der Nukleotide li .. .. .. ... . ... . 1 Nukleinsäuren, Desoxyribonukleinsäure (DNA) 1 Replikation der DNA . . .. . . ... . . .. . . . . ... .
1 Transkription . . . . ..... . . .. .. . . . . . . . . .. .
I Translation ........ . ... .. . .. . . .. . .. . . . .
1 Prozessierung und Zielsteuerung von Proteinen
1 Regulation von Zellwachstum und Genexpression
1 DNA-Schäden, Reparatur und Onkogenese . . . .
1 Gentechnologie .... . ... .. ... . . .... ... . . .
Kohlenhydratstoffwechsel ...... .... . . . .
I Kohlenhydrate . .. . . .. . . . . . . . .. ... .. . .. .
I Glykolyse ..... . . . . ..... . ..... . . .. . . .. .
I Glukoneogenese . .. .. . ... . .. .. ... . . . .. . .
1 Glykogenstoffwechsel . . . . ... . . . . .... .. .. .
I Pentosephosphatweg . . . . .. . . . . - . . . - . · · · · ·
Lipidstoffwechsel . . . ..... . . . . . ... . . . . . .
I Fettsäuren und Lipide I . . ..... . .. . . .. . . .. .
1 Fettsäuren und Lipide II .. . .. . ..... . . 1 Biosynthese der Fettsäuren und Triacylglycerine
1 Abbau der Neutral fette und Fettsäuren . . . . .. .
I Ketonkörper . . . .. .. .. ..... . .. . .. . ..... .
I Cholesterin .... . . . ... .. . . . . . . .. . . .. . . . .
I Lipoproteine ..... . .. . . ... . ... . . .. . ... . .
1 Hormone der Bauchspeicheldrüse I I .... . ... . 24 - 31 I Eicosanoide und Zytok.ine .... .. .. . .. . . . . . .
24 26 Immunsystem . . . . .. . .. ... . . .... . . . . . . . 100 - 111
28 I Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 30 1 Zellen des Immunsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 02
32 - 5 1
32 34 36 38
1 Humorale Abwehr I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 04
1 Humorale Abwehr II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 06
I Antigene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 08
1 Rolle des Immunsystems in der Klinik . . . . . . . . I 10
Blut . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . . . .... . . 112 - 121
40 1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
42 1 Hämoglobin I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 14
44 I Hämoglobin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 16
46 I Erythrozyten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 8
48 I Blutstil lung und Geri nnung . . . . . . . . . . . . . . . . 120 so
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe .. . .. . . . .. .. . . . . . 122 - 135 52- 61
52 54
I Leber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 22
I Niere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 56
I Verdauungsorgane I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 58
1 Verdauungsorgane II . . . .. . . .. . .. .. . . · . . . . I 28 60
1 Das Muskelgewebe . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · . · 130
62 - 75
62 64 66
1 Das Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1 Das Binde· und Stützgewebe . . . . . . . . . . . . . . . 134
C Versuche ...... .. .. .. .... .. .. .... .. . 138- 145
68 I Versuch I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
70 1 Versuch 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
72 1 Versuch 3 . .. . ..... .. .. .. ....... . - . . . . . 142
74 1 Versuch 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 44
D Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 - I SO
Abkürzungsverzeichnis VI lVII
A E Abb. Abbildung E Extinktion ACAT Acyi-CoA-Cholesterol-Acyl-Transferase e- Elektron ACE Angiotensin -Converting-Enzym EKG Elektrokardiogramm ACP Acyl-Carrier-Protein ELISA Enzyme Linked lmmunosorbent Assay ACTH adrenokortikotropes Hormon EPO Eryhropoetin ADH Alkohol-Dehydrogenase, Anti-Diuretisches ER endoplasmatisches Retikulum Hormon etc. et cetera ADP Adenosindiphosphat AGS Adrenogenitales Syndrom F ALAT Alanin-Aminotransferase FAD Flavinadenindinukleotid ALS Aminolävulinsäure Fe Eisen AMP Adenosinmonophosphat FMN Flavinmononukleotid ANP atriales natriuretisches Peptid FSH Follikel-stimulierendes Hormon APC Antigen-präsentierende Zelle APRT Adenin-Phosphoribosyltransferase G ASAT Aspartat-Am in o transferase g Gramm ATP Adenosintriphosphat G-Protein Guaninnukleotid-bindendes Protein
G6PDH Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase B GABA gamma-Aminobutyrat BCR B-Zeli-Antigenrezeptor Ga! Galaktose BPG Bisphosphoglycerat GAP GTPase aktivierendes Protein, bzw. beziehungsweise Glycerinaldehyd-3-Phosphat
GDP Guanosindiphosphat c GFR glomeruläre Filtrationsrate c Kohlenstoff ggf. gegebenenfalls oc °Celcius GH Growth Hormone c Konzentration GLDH Glutamatdehydrogenase Ca Kalzium GLP Glucagon-Like-Peptide ca. circa GLUT Glukosetransporter cAMP cyclo-AMP GMP Guanosinmonophosphat CD cluster of differentiation GnRH Gonadotropin-releasing Hormone Cdk Cyclin dependent kinase = Cyclin-abhängige GOT Glutamat-Oxalacetat-Transaminase
Kinase GPT Glutamat-Pyruvat-Transaminase cGMP cyclo-GMP Grb Growth factor bound CK Creatin-Kinase GTP Guanosin trisphosphat Cl Chlor Co Cobalt H CO Kohlenmonoxid H Wasserstoff C02 Kohlendioxid H2C03 Kohlensäure CoA Coenzym A H20 Wasser COMT Catechol-0-Methyl-Transferase H20 2 Wasserstoffperoxid COPD Chronisch obstruktive Lungenerkrankung H2P04- Dihydrogenphosphat cox Cyclooxygenase Hb Hämoglobin CRH Kortikotropin-releasing Hormone HbA adultes Hämoglobin CRP (-reaktives Protein Hb F fetales Hämoglobin
Hb02 Oxyhämoglobin D HbS Sichelzellhämoglobin d Schichtdicke HCI Salzsäure d.h. das heißt HC03- Bicarbonat Da Dalton HDL High Density Lipoprotein DAG Diacylglycerol He Helium DAP Dihydroxyacetonphosphat HGPRT Hypoxanthin -Guanin-Phosphoribosyl transferase dATP desoxy-Adenosintrisphosphat HIV humanes lmmundefizienz-Virus dCTP desoxy-Cytidintrisphosphat HLA humane lymphocyte/ leukocyte antigene dGTP desoxy-Guanosintrisphosphat HMG-CoA Hydroxy-Methyl-Glutaryl-CoA DIT Di iodtyrosin HMV Herzminutenvolumen dl Deziliter HPOi - Hydrogenphosphat DNA Desoxyribonukleinacid (Desoxyribonukleinsäure) Hsp HitzeschockproteiD dTTP desoxy-Thymidintrisphosphat HWZ Halbwertszeit
Abkürzungsverzeichnis
I NK-Zellen natürliche Killerze llen
I Intensität NLS Nuclear Localisation Signal
I Iod nm Nanometer
IDL Intermed iate Density Lipoprotein NNR Nebennierenrinde
JFN Interferon NSAID non-steroid al anti-inflammatory drugs
Ig Immunglobulin NSAR nichtsteroidale Antirheumatika
IGF Insuline like growth fac tor IL Interleukin 0
IMP Inositolmonophosphat 02 Sauerstoff
INR International Normalized Ratio IP3 Inositoltrisphosphat p
IRS Insulin-Rezeptor-Substrate PAF platelet activation factor PALP Pyridoxalphosphat
J PAPS 3-Phosphoadenosi n-5- Phosphosul fa t
JAK-Kinase Janus-Kinase PC Pyru va tcarboxylase PCR Polymerase chain reaction =
K Polymerase-Kettenreaktion
K Kalium PDH Pyruvat-Dehydrogenase
Kap. Kapitel PFK Phosphofruktokinase
kcal Kilokalorien PC Prostagland in
kg Kilogramm PIP3 Phosphatidyl-l nosi tol-Trisphospha t
k] kJoule PKU Phenylketonurie
KM Michaeliskonstante POMC Proopiomelanokorti n PRPP Phosphoribosylpyrophosphat
L PTH Para thormon
LCAT Leci thin-Cholesterin-Acyl-Transferase LDH Laktat-Dehydrogenase Q
LDL Low Density Lipoprotein 0 Ubichinon
lg Logarithmus OH2 Ubich inol
LH luteinisierendes Hormon LPL Lipoproteinlipase R
RAAS Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
M Rb Retinablastom
m Meter RE Restriktionsendonukleasen
M. Morbus, Musculus rER raues endoplasmatisches Retikulum
MAC Membranangriffskomplex RES retikuloendotheliales System
MAO Monoaminooxidase RH Releasing Hormone
ME LAS mitochondriale Encephalomyopathie, Rh Rhesus Laktatazidose und Schlaganfall RlA Radioimmunassay
MEOS mikrosomales ethanoloxidierendes System RNA Ribon ukleinacid (Ribonukleinsäure)
mg Milligramm RO respiratorischer Quotient
Mg Magnesium rRNA ribosomale RNA
MHC major histocompatibil ity complex MIT Monoiodtyrosin s Mmol Millimol s Schwefel
Mn Mangan s. siehe
MPS mononukleäres Phagozytensystem s. a. siehe auch
mRNA messenger RNA s.o. siehe oben
Ms Millisekunde s. u. siehe unten
MSH melanozytenstimulierendes Hormon SAM S-Adenosylmethionin
mtDNA mitochondriale DNA sog. sogenannte/ r Sos Son of sevenless
N Stat Signal transducer and activator of transcription
N Stickstoff STH somatolropes Hormon/ Somatotropin
Na Natrium Na Cl Kochsalz T
NAD Nikotin-(säure )am id -ad enin -dinukleotid T Transmission
NADP Nikotinsäureamid-adenin-dinukleotid-phosphat t-PA tissu -Plasminogena ktivator
NAGA N-Acetyl-Galaklosamin T3 Triiodthyronin
NaOH Natronlauge T4 Tetraiodthyronin = Thyroxin
; Ab kü rzu ngsve rze ich n i sjQu e llenverzeichn i s
VIII IIX
Tab. Tabelle TAG Triacytglyceride TBG Thyroxin bindendes Globulin TCR T-Zeli·Antigenrezeptor THB Tetrahydrobiopterin THF Tetrahydrofolsäure TMP Thymidinmonophosphat TNF Tumor-Nekrose-Faktor TPP Thiaminpyrophosphat TRH Thyreotropin·reteasing Hormone tRNA transfer RNA TSH Thyreoidea-stimulierendes Hormon TX Thromboxan
u u Unit u-PA Urokinase· Plasminogenaktiva tor u.a. unter anderem u.v.m. und viele mehr UDP Uridindiphosphat UMP Uridinmonophosphat usw. und so weiter UTP U ridintrisphosphat uv ultraviolett
Quellenverzeichnis
[I] Braun, T./Röhler gen. Riemer, A./Weber, F.: Kurzlehr· buch Physiologie. München, Elsevier Urban & Fischer, 1. Auflage, 2006
[2) Dettmer, U./Folkerts, M./Kächler, E./Sönnichsen, A.: Intensivkurs Biochemie. München, Elsevier Urban & Fischer, 1. Auflage, 2005
[3] Gagiannis, D.: Biochemie in Frage und Antwort: Fragen und Fallgeschichten zur Vorbereitung auf mündliche Prüfungen während des Semesters und Examen. München, Elsevier Urban & Fischer, 2. Auflage, 2006
[4) Golenhofen, K.: Basislehrbuch Physiologie: Lehrbuch, Kompendium, Fragen und Antworten. München, Elsevier Urban & Fischer, 4. Auflage, 2006
[5] Horn, F. / Moc, 1./Schneider, N./Grillhösl , C./Berghold, S./Lindenmeier, G.: Biochemie des Menschen: Das Lehrbuch für das Medizinstudium. Stuttgart, Thieme, 3. Auflage, 2005
[6] Kremer, A.: Crashkurs Biochemie: Repetitorium mit Einarbeitung der wichtigsten Prüfungsfakten. München, Elsevier Urban & Fischer, I. Auflage, 2005
[7] Kreutzig, T.: Kurzlehrbuch Biochemie. München, Elsevier Urban & Fischer, 12. Auflage, 2006
[8) Löffler, G.: Basiswissen Biochemie: mit Pathobiochemie. Berlin, Springer, 7. Auflage, 2008
[9) Male, D.: Immunologie auf einen Blick. München, Elsevier Urban & Fischer, 1. Auflage, 2005
[I 0[ Marischler, C: Basics Endokrinologie. München, Elsevier Urban & Fischer, 1. Auflage, 2007
V V Volt V. Vena v.a. vor allem Vit. Vitamin VLDL Very Low Density Lipoprotein Vmax katalytische Kapazität vs. versus
w wz Wechselzahl
X XMP Xanthinmonophosphat
z z. T. zum Teil z.B. zum Beispiel Zn Zink ZNS zentrales Nervensystem
Funktionelle Gruppen: -COOH Carboxylgruppe ·NH2 Aminogruppe -OH Hydroxygruppe .p ·Phosphat
[1 1] Michalk, D./Schönau, E.: Differentialdiagnose Pädiatrie. München, Elsevier Urban & Fischer, 2. Auflage, 2004
[12] Mims, C./Dockrell, H.M./Goering, R.V./Roitt, 1./Wakelin, D./Zuckerman, M.: Medizinische MikrobiologieInfektiologie: mit Virologie und Immunologie. München, Elsevier Urban & Fischer, 2. Auflage, 2006
[13] Mir, A. M.: Blickdiagnosen. München, Elsevier Urban & Fischer, 1. Auflage, 2007
[14] Renz· Polster, H./Krautzig, S./Braun, J .: Basislehrbuch Innere Medizin: kompakt- greifbar- verständlich . München, Elsevier Urban & Fischer, 3. Auflage, 2006
[15] Renz-Polster, H./Krautzig, S.: Basislehrbuch Innere Medizin: kompakt- greifbar- verständlich. München, Elsevier Urban & Fischer, 4. Auflage, 2008
I 16] Sauer, R.: Strahlentherapie und Onkologie. München, Elsevier Urban & Fischer, 4. Auflage, 2003
[17] Schart!, M./Gessler, M./von Eckardstein, A.: Biochemie und Molekularbiologie des Menschen. München, Elsevier Urban & Fischer, 1. Auflage, 2009
[ 18] Speckmann, E.-] ./Hescheler, J ./Köhling, R.: Physiologie. München, Elsevier Urban & Fischer, 5. Auflage, 2008
[19] Storch, V. / Welsch, U./Wink, M.: Evolutionsbiotogie. Berlin, Springer, 2. Auflage, 2007
[20] Zeeck, A./Fischer, S. C./Grond, S./Papastavrou, I.: Chemie für Mediziner. München, Elsevier Urban & Fischer, 6. Auflage, 2006
Grundlagen
2 Zytologie I 4 Zytologie II 6 Chemische Grundlagen I 8 Chemische Grundlagen II
10 Enzyme 12 Enzymfunktion und -kinetik 14 Prinzipien der Stoffwechselregulation
16 Vitamine I 18 Vitamine II 20 Säure-Basen-Haushalt
Zytologie I
Die Zelle (I Abb. 1) ist der kleinste lebende Baustein eines
Organismus. Sie ist ein eigenes geschlossenes System, das für
sich allein lebensfähig ist und über einen eigenen kontrol
lierten Stoffwechsel verfügt, aber dennoch im Dienste des
Gesamtsystems Körper arbeitet. Die verschiedenen Ze ll typen
besitzen alle einen ähnlichen Aufbau: biologische Membra
nen unterteilen den Innenraum der Zelle in versch iedene
Funktionseinheiten, die Kompartimente. Neben dem Zyto
plasma, in dem sich die versch iedenen Zel lorganellen befin ·
den, gibt es noch das Karyoplasma (von der Zellkernmembran
umgebenes Plasma) und das die Zelle stabil isierende Zyro
skelett. In den folgenden beiden Kapi teln sollen die einzelnen
Bestandteile der Zelle, insbesondere die Zellorganellen,
besprochen werden.
Plasmamembran
Durch die Plasmamembran (= Zellmembran) wird die Zelle
von ihrer Umgebung abgetrennt.
Aufbau
Die Plasmamembran ist ein typischer Bilayer, eine Doppel
lipidschicht , die von amphipathischen Fetten gebildet
wird, die aus einem polaren (also hydrophilen) Kopf und
einem unpolaren (also hydrophoben) Schwanz aufgebaut
sind. Die Doppelschicht kommt durch hydrophobe
Wechselwirkungen der unpolaren Fettschwänze zustande
(s. Kap. 62). Das Grundskelett der Plasmamembran bilden
Phospholipide, die den Hauptteil ausmachen. Außerdem
enthält sie Cholesterin, das der Stabili tät und Fluidität der
Membran dient, und Glykolipide, die mit den Glykopro
teinen zusammen die Glykokalix bilden. Neben den Lipiden
enthält die Zellmembran auch zahlreiche (u. a. Trans·)
Membranproteine, die z. B. für den Transport in bzw.
aus der Zelle (Kanalproteine, Transporter), die interzelluläre
Kommunikation (Rezeptoren), die Ausbildung von Zellkon
takten, oder die Zellerkennung (Glykokalix) verantwortl ich
Lysosom -
raues endoplasmatisches
Retikulum (Ribosomen)
Mitochondrium
(Ort der Zellatmung)
Golgi-Apparat
I Abb. 1: Die eukaryontische Zelle und ihre Organellen )121
Kernmembran
Zytoplasma
glattes endoplasmati sches Retikulum
sind. Die Proteine sind nach dem Fluid-Mosaik-Modell
nach Singerund Nicolson in dem Oüssigen Phospholipidfi lm
verschiebbar eingebettet.
An der Außenseite der Zellmembran haften verschiedene Kohlen~ hydratreste (z. B. Glukose, Galaktose, Mannose, Aminozucker), die zusammen die sog. Glykokalix bilden. Sie unterscheidet sich von Zellart zu Zellart und dient der Zelle als charakteristische und spezifische Erkennungsstruktur. So können sich gleichartig diff~ renzierte Zellen erkennen, was z. B. Voraussetzung für die Ausbildung von Gewebsverbänden ist.
Aufgaben
Die Au fgaben der Plasmamembran sind im Wesentl ichen:
~ Abgre nzung gegenüber der Umwelt, bzw. gegenüber
anderer Zellorganellen (bei intrazellulären Membranen),
~ Gewährleistung konLroll ierten StoffLransports und Auf
rechterhal tung des inneren Milieus der Ze lle,
~ Übersetzung und Weiterleitung äußerer Signale (Signal
transduktion) ins Innere der Zelle über Rezeptoren,
~ Ausbi l d ung von Zell kontakten und damit Ermöglich ung
von Gewebe- und Organbildung,
~ Verankerung des Zytoskeletts und damit Stabilisierung der
Zelle, ~ Au fbau chemischer oder elektrischer Gradienten.
Stofftransport
Es gibt verschiedene Mechanismen, über die Stoffe über
die Zellmembran transportiert werden können. Man unter
scheidet ganz grob zwischen dem passiven Transport, für
den keine Energie aufgewendet werden muss, und dem ATP
verbrauchenden akti ven Transport. Außerdem ist es möglich,
Stoffe durch Abschnürung von Membrantei len über die
Membran zu Lransportieren (= Zytose), was mit oder ohne
Energieverbrauch einhergehen kann.
~ Passiver Transport: Hierbei folgen die Stoffe einem Kon
zentrations- oder Ladungsgefälle, weshalb kein zusätz licher
Energieaufwand mehr nötig ist. Be i der Diffusion wandert
das Molekü l entweder frei durch die Ze lle ("freie Di ffusion")
oder nur mithi lfe eines Carrier-Kanalproteins ("erleichterte
Diffusion"), je nachdem, wie groß und wie polar der Stoff ist.
Während kleine, unpolare Stoffe meist problemlos über die
Membran gelangen, können größere, geladene Stoffe nur
durch erleichterte Di ffusion transportiert werden.
~ Aktive r Transport: ollen Stoffe entgegen eines Konzen
trationsgefäl les über die Membran g !an en, muss dafür
Energie au fgewendet werden. Beim primär aktiven Transport
wird die Energie durch ATP-Spaltun wonn n und di rekt
in d n Transport esteckt, beim sekundär n aktiv n Transport
wird zunächst energiea bhängig ein l kLrochemischer oder
Konzentrationsgradi nt auf baut, d r als An tri b fü r d n
Transport in s and r n toff s di n .
-Beispiel für einen primär aktiven Transport: Die Na+ /K+-ATPase transportiert unter Verbrauch eines ATP drei Na+-Ionen aus der Zelle und zwei K' -Ionen in die Zelle hinein.
-Beispiel für einen sekundär aktiven Transport: In den Nieren wird Glukose gemeinsam mit Na+ über einen Symport (s. u.) aus dem Tubuluslumen in die Tubuluszelle rückresorbiert Als Antrieb dient ein Natriumgradient, der zuvor durch die Na+/ K+-ATPase erzeugt wird. Das Na+ "reißt" seinem Konzentrationsgradienten folgend die Glukose einfach mit
~ Transportproteine: Dies sind Carrier, die spezifisch Stoffe durch die Zellmembranen schleusen. Sie weisen wie Enzyme eine Sättigungskinetik auf und können durch andere Substanzen kompetitiv gehemmt werden. Man unterscheidet Uniporte, bei denen ein Molekül alleine transportiert wird, von Antiporten und Symporten, bei denen zwei Teilchen im Austausch gegeneinander bzw. gemeinsam in die gleiche Richtung transportiert werden. ~ Zytose: Die Aufnahme von Stoffen über die Abschnürung von Membranvesikeln nennt man Endozytose, die Ausschleusung Exozytose. Bei der Endozytose unterscheidet man auch noch zwischen der Aufnahme fester Stoffe (Phagozytose) und die Aufnahme gelöster bzw. flüssiger Substanzen (Pinozytose].
Zytoskelett
Das Zytoskelett stabilisiert die Zelle und ermöglicht außerdem die Bildung von Zellkontakten, die Fixierung von
Zellorganelle Aufgaben (Auswahl)
Membranbestandteilen (z. B. Membranproteine) und die Bewegung mancher Zellen. Die Aktinfilamente sind zusammen mit dem Myosin für die Bewegung der Zelle (v. a. im Muskel) verantwortlich, erhalten aber auch die Zellform und verankern Zytoskelett und Membranproteine. Intermediärfilamente dienen in erster Linie dem mechanischen Halt und sind gewebsspezifisch. Mikrotubuli sind auch für Zellstabilisierung und Transport wichtig und bilden außerdem den Spindelapparat für die Zellteilung, oder sind als Bestandteile von Geißeln an der Zellbewegung beteiligt.
Zellkontakte
Zellen können sich über Zellkontakte zu einem Gewebe-oder Organsystem zusammenhaften. Dies geschieht über bestimmte Kontaktformen, die entweder der rein mechanischen Befestigung der Zellen oder dem Informationsaustausch dienen können. Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Zellkon takten:
~ Tight junctions sind besonders dichte Kontakte, bei denen sich die Membranen zweier Zellen so eng aneinander lagern, dass der Interzellulärraum verschwindet. Beispiele dafür sind z. B. Enterozyten oder die Zellen, die die Blut-Hirn-Schranke ausbilden. ~ Desmosomen: Dies sind Haftkontakte, die entweder zwei Zellen miteinander verbinden (Desmosomen] oder eine Zelle mit der umliegenden extrazellulären Matrix (Hemidesmosomen). Dieser Kontakt dient wieder nur der
Zellkern DNA-Replikation, Synthese von mRNA, rRNA und tRNA
Mitochondrium Energiegewinnung (ß-Oxidation, Citratzyklus, oxidative Phosphorylierung), Fettsäuren-Kettenverlängerung, Teile des Harnstoffzyklus
Ribosomen Ort der Translation (Proteinbiosynthese)
Raues ER Synthese von Sekretproteinen
Glattes ER Verschiedene Syntheseleistungen
Golgi-Apparat Membranspeicher, Modilizierung von Syntheseprodukten (Proteine)
Lysosomen Speichervesikel hydrolytischer Enzyme
Zytoplasma Fettsäure-.. de novo"-Synthese, Teile des Harnstoffzyklus, Glykolyse
Grundlagen 213
rein mechanischen Verbindung, und wird mithilfe des Zytoskeletts und sog. Adhäsionsmoleküle ( Cadherine, Integrine] geknüpft. ~ Gap junctions werden auch Nexus genannt und ermöglichen durch Tunnelproteine den Stoff- und Informationsaustausch zweierbenachbarter Zellen (z. B. Myokardzellen].
Überblick über die Zellorganellen
Die einzelnen Zellorganellen werden im folgenden Kapitel genauer erklärt. Dieser kurze Überblick solllediglich den Einstieg erleichtern. Die Funktionen der Zellorganellen (I Tab. 1) kann man grob in drei Gruppen unterteilen:
~ Der Zellkern und die Mitochondrien sind die beiden wichtigsten Organellen und als einzige Organellen von einer Doppelmembran umgeben. Der Zellkern speichert die genetische Information, und die Mitochondrien sind kleine Energiekraftwerke, in denen ATP für die Versorgung der gesamten Zelle entsteht ~ Die Ribosomen, das endoplasmatische Retikulum (ER} und der GolgiApparat sind hauptsächlich für die Proteinsynthese zuständig. ~ Lysosomen und Permcisomen dagegen sorgen für den Abbau nicht mehr benötigten Materials.
Manchmal werden RibOsomen, das endoplasmatil~che Retikulum, der GolgiApparat und die PeroXIaomen zur MikroIIOmenfraktlon ~aammengefasst
I Tab. 1: Die Zellorganellen und ihre Aufgaben
Zytologie II
Zellkern
Mit wenigen Ausnahmen (Erythrozy
ten) verfügt jede Körperzelle über einen
Zellkern. Manche Zellen haben sogar
zwei (z. B. Leberzelle) oder noch mehr
Kerne (z. B. Osteoklasten). Der Zellkern ist ein rundliches Zellor
ganell, das man- im Gegensatz zu den
anderen Organellen - schon im Licht·
mikroskop erkennen kann. Ihn umge
ben eine innere und eine äußere Mem
bran. An den Stellen, an denen die
Membranen verschmelzen, befinden
sich sog. Kernporen, die aus mehreren
Proteinen aufgebaut sind, und dem ATP-abhängigen Transport von Protei
nen in und aus dem Kern dienen. Der
Zellkern ist Ort der DNA-Replikation
und außerdem für die Synthese von
mRNA, rRNA und tRNA zuständig, und
damit reich an Nukleinsäuren. 90% der
DNA und 30% der RNA befinden sich
in ihm. Die DNA liegt dabei als Chroma
tin verpackt vor (s. Kap. 36).
Die äußere Membran des Zellkerns geht
häufig direkt in die Membran des endo
plasmatischen Retikulums über. Da
durch wird eine direkte Verbindung
zwischen dem Ort der mRNA-Synthese
und einem Ort der Proteinsynthese
geschaffen. Im Zellkern befinden sich außerdem die
Nukleoli(= Kernkörperchen). Sie ent
halten hochrepetitive DNA-Sequenzen
und sind Hauptbildungsorte der rRNA.
Mitochondrien
Die Mitochondrien werden häufig als
"Kraftwerke" der Zellen bezeichnet.
Dies liegt daran, dass in den Mitochond·
rien die meisten Stoffwechselleistungen
stattfinden, bei denen ATP, der Energie
lieferant der Zellen, entsteht. Sie dienen
dem Körper also vorwiegend als Ener
gieproduzenten, sind aber noch an an
deren Stoffwechselvorgängen beteiligt.
Aufbau
Wie der Zellkern auch, besitzen Mi to·
chondrien zwei Membranen. Diese
sind aber sehr unterschiedlich aufge
baut: Die äußere Mitochondrienmem
bran ist glatt und porenreich, was sie
für viele Stoffe durchgängig macht,
während die innere Membran stark
gefältelt und praktisch undurchlässig ist.
Durch die Falten (Cristae) der inneren
Mitochondrienmembran vergrößert sich
deren Fläche erheblich, wodurch an ihr
viele Reaktionen gleichzeitig ablaufen
können. Den Raum, der von der inne
ren Membran umgeben ist, bezeichnet
man als Mitochondrienmatrix, den
Raum zwischen den Membranen als
Intercristae-Raum.
Mitochondriale DNA (mtDNA)
Die Mitochondrien besitzen eine eigene
DNA. Sie ist ringförmig und codiert
für 13 Proteine, darunter auch einige
Enzyme der Atmungskette, sowie für
22 tRNAs und zwei rRNAs. Da sie sehr
dicht gepackt ist - sie enthält keine In
trans- und über kein Reparatursystem
verfügt, ist sie anfällig für Mutationen,
die verschiedene Erkrankungen, wie
z. B. das MELAS-Syndrom, auslösen.
Die sog. Mitochondriopathien werden
matemal vererbt (d . h. nur Frauen kön
nen diese vererben), da die Mitochond·
rien sich in den Spermatozyten nur in
den Geißeln befinden, diese bei der
Befruchtung allerdings nicht in die Ei
zelle eindringen. Es ist verwunderlich,
dass die Mitochondrien eine eigene
DNA besitzen, daher geht man davon
aus, dass es sich bei den Mitochondrien
um im Laufe der Evolu tion in die Zellen
eingewanderte Mikroorganismen han
delt (Endosymbiontentheorie). Dazu
passt auch, dass Mitochondrien eigene
Transport Richtung Art
Phosphat außen _,. innen H'-Syrnport
Ribosomen haben und sich se lbstständig vermehren.
Stoffwechselleistungen
Der Stoffwechsel der Mitochondrien
zielt vorwiegend auf Energiegewinnung
ab. Sie enthalten sämUiche Enzyme
des Citratzyklus, der Atmungskette
und der oxidativen Phosphorylierung.
Außerdem finden dort die Reaktionen
der Pyruvat-Dehydrogenase und der
ß-Oxidation statt, aus denen Acetyl
CoA entsteht, welches anschließend
energiebringend oxidativ abgebaut wer
den kann. Weitere Stoffwech selleistungen der Mitochondrien sind:
ll>- Teile des Harnstoffzyklus, ll>- Porphyrinsynthese, ll>- Oxidative Decarboxylierungen,
ll>- Ketonkörperbildung.
Um die dazu benötigten Stoffwechsel
substrate, aber auch die entstehenden
Produkte über die undurchlässige inne
re Mitochondrienmembran zu schaffen,
sind verschiedene Transportmechanismen von Nöten (I Tab.! ).
Ribosomen
ln den Ribosomen findet die Translation
statt, sie sind also Ort der Proteinbiosynthese. Aufgebaut sind die Ribo
somen, die aus zwei Untereinhe iten
bestehen (60S- und 40 S-Untereinheit),
aus ribosomaler RNA (rRNA) und aus
ribosomalen Proteinen. Sie können
entweder einzeln im Zytosol vorliegen,
oder an das raue endoplasmatische Reti
kulum gekoppelt sein, je nachdem für
welchen Zweck das Protein synthelisiert
werden soll. Die Ribosomen, die an das
ER andocken, sind für die Synthese von
Pyruvat außen - ) innen H·-Symport (s. Kap. 76)
ATP Innen
NADH/ H'
Fettsä uren
Acetyi-CoA
Ant iport mit ADP
Malat-Aspart at-Shuttlo
Carn ltln-Shutll (s. Kap 68)
Malat-Citrat-Shuttle (s. Kap. 66)
I Tab. I : Tran port-sy t m üb r di Mitoc ho ndrienrnem br 11
-
Exportproteinen, also Proteinen, die ihren Bestimmungsort außerhalb der Zelle haben, zuständig. Die freien Ribosomen synthetisieren die Zytoplasmatischen Proteine. Sind mehrere Ribosomen an der Synthese eines Proteins beteiligt und zu diesem Zweck hintereinander geschaltet, bezeichnet man sie als Polysomen.
Endoplasmatisches Retikulum
Das endoplasmatische Retikulum (ER) ist ein schlauchförmiges Zellorganell, das sowohl mit der Kernmembran als auch mit der Zellmembran in Verbindung steht. Es bildet außerdem eine funktionelle Einheit mit dem Golgi-Apparat. Man kann im endoplasmatischen Retikulum zwei Regionen unterscheiden: das glatte und das raue ER.
~ Als raues ER bezeichnet man den Abschnitt, an dem Ribosomen anlagern. Hier spielt sich die Bildung der Exportproteine ab, welche aus den Ribosomen direkt ins Lumen des endoplasmatischen Retikulums hineinsynthetisiert werden. Neben den exkretorischen Proteinen werden hier auch Membranproteine und Iysosomale Enzyme gebil· det. ~ Am glatten ER sind keine Ribosomen angelagert. Es ist für die Synthese von Membranphospholipiden und Steroid· hormonen zuständig, sowie von Lipoproteinen, Glykoproteinen, Cholesterin und Mucopolysaccharide. Andere Aufgaben des glatten ERs sind: - Glukose-6-Phosphatase-Reaktion
( = letzter Schritt der Glukoneogenese ),
- Biotransformation in der Leber, - Bildung und Glukuronidierung von
Bilirubin, - Kalziumspeicherung im Muskel als
sarkoplasmatisches Retikulum, - Bildung der Funktionseinheiten des
Golgi-Apparates, den Diktyosomen.
Golgi-Apparat
Der Golgi-Apparat setzt sich aus seinen Funktionseinheiten, den Diktyosomen, zusammen, die untereinander
nicht verbunden sind. Die Seite des Golgi-Apparates, die dem ER und damit auch dem Zellkern zugewandt ist, bezeichnet man als cis-Seite, die periphere Seite, die zur Zellmembran zeigt, als trans-Seite oder Reifungsseite. An seiner cis-Seite nimmt der Golgi-Apparat die vom ER kommenden Vesikel auf, und gibt sie an der transSeHe wieder ab. Die Aufgabe des Golgi-Apparates be· steht in der Modifizierung von Proteinen ( = posttranslationale Prozessierung, s. auch Kap. 44), bevor diese an ihren Bestimmungsort verteilt werden. Beispiele für solche Modifikationen sind das Anhängen von Phosphatresten, Kohlenhydratresten, Sulfatgruppen oder Lipidgruppen. Außerdem hat der Golgi-Apparat eine Verteilerfunktion. Er sorgt dafür, dass Sekretproteine und Membranproteine ihren Bestimmungort erreichen und führt durch Abschnürung von lysosomalen Proteinen in einem Vesikel zur Entstehung von Lysosomen.
Peroxisomen
Peroxisomen sind kleine Vesikel, die vom rauen ER abgeschnürt werden und verschiedene Enzyme (Peroxidasen, Katalasen, Uricase) enthalten, die Sauerstoff-abhängige Oxidationen katalysieren. Damit können Zellstrukturen vor Oxidation geschützt werden. Das dabei entstehende Wasserstoffperoxid H20 2 wird anschließend durch die Katalase zu H20 und 0 2 abgebaut. Beson-
Zusammenfassung
Grundlagen 415
ders häufig kommen Peroxisomen in Leber- und Nierenepithelzellen vor.
Peroxisomcm sinii außerdem an der ß-Oxidatlonbetelllgt {s. Kap. 68).
Lysosomen
Lysosomen entstehen durch Abschnürung vom Golgi-Apparat. Sie enthalten hydrolytische Enzyme und sind dadurch zum Abbau von sowohl zelleigenen als auch zellfremden Stoffen befähigt. Zu den Hydrolasen der Lysosomen gehören z. B. die saure Phosphatase, saure Ribonuklease, Kollagenase, Glukuronidasen, saure Triacylglycerin· Iipase usw. Ein neu gebildetes Lysosom, das noch keine Substanzen aufgenommen hat, bezeichnet man als primär. Hat ein Lysosom bereits Substanzen aufgenommen und ist gerade dabei, diese hydro· lytisch abzubauen, heißt es sekundäres Lysosom.
Proteasomen
Im Zytoplasma und im Zellkern befinden sich kleine Proteinpartikel, die über proteolytische Aktivität verfügen. Auf diese Weise können geschädigte oder falsch synthetisierte Proteine abgebaut werden. Die Proteine müssen zum Teil erst mit Ubiquitin markiert werden, bevor sie in den Proteasomen abgebaut werden können (s. Kap. 42).
X Plasmamembranen bestehen aus einer Lipiddoppelschicht, deren
Grundskelett Phospholipide bilden, und in die Proteine eingelagert sind. X Man unterscheidet einen aktiven, energieabhängigen Stofftransport durch
die Membran vom passiven ATP-unabhängigen Transport.
X Der Zellkern enthält die genetische Information und ist Ort der
DNA-Replikation und der RNA-Synthese.
X Mitochondrien sind als "Kraftwerke" der Zelle vor allem für die Energiegewinnung zuständig.
X Die Ribosomen, das endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat meistern gemeinsam Synthese und Zielsteuerung von Proteinen.
Chemische Grundlagen I
In diesem Kapitel wollen wir uns nun erst einmal mit den
wichtigsten Grundbegriffen der Chemie beschäftigen. Wir
können hier allerdings nur auf die wichtigsten Grundlagen
der Chemie eingehen. Genauere Details können in einem
Lehrbuch der Chemie nachgelesen werden.
Atome und Ionen
Aufbau und Bestandteile von Atomen Die kleinsten Bausteine, aus denen alles besteht, und die
nicht mehr weiter auftrennbar sind, sind die Atome. Auf
gebaut sind diese Atome aus positiv geladenen Protonen,
negativ geladenen Elektronen und ungeladenen Neutro
nen. Während Protonen und Neutronen ungefähr die gleiche
Masse haben, beträgt die Masse der Elektronen nur einen
Bruchteil davon, etwa 1/ 2000. Um nicht mit der absoluten
Masse rechnen zu müssen, verwendet man vereinfacht die
relative Masse (I Tab. ! ) Diese Elementarteilchen bilden die Grundlage aller Atome.
Im Atomkern befinden sich Neutronen und Protonen. Der Kern ist positiv geladen und enthält fast die vollständige
Masse des Atoms. Umgeben ist er von einer negativ gelade
nen Elektronenhülle. Nach außen hin ist das Atom also von
neutraler Ladung.
Aufbau der Elektronenhülle Die negativ geladenen Elektronen ordnen sich nach einem
bestimmten Prinzip um den positiv geladenen Atomkern an.
Sie verteilen sich in Schalen um den Kern. Diese Schalen können in der Regel acht Elektronen aufnehmen. Nur die
erste Schale enthält maximal zwei Elektronen. Die einzelnen
Schalen werden von innen nach außen gefüllt. Das Sauerstoff
atom beispielsweise hat acht Elektronen - zwei in der ersten
Schale und sechs in der zweiten (I Abb. I). Die Elektronen in
der äußersten Schale werden auch Bindungs- oder Valenz
elektronen genannt.
Größe des Atoms Ein Atom hat in etwa einen Durchmesser von 0, I nm.
Der Atomkern macht aber nur einen Bruchteil davon aus,
umgeben von der Elektronenhülle mit den frei beweglichen
Elektronen. Das Größenverhältnis kann man sich in etwa
vorstellen, wenn man eine Orange (diese steht für den Atom
kern) in einen riesigen Saal (die Elektronenhülle) legt.
Kernladungszahl Die Kernladungszahl, auch Ordnungszahl genannt, ent
spricht der Anzahl der Protonen in einem Atomkern . Das
Elementartellehen Relative Ladung Absolute M18ae Relative Ma18e
Proton (p) + I 1,66 X J0·1<
Neutron (n) 0 1,66 x ro-><
Elektron (e·) - I 9, IO x 10 18 S x 10 •
1 Tab. 1: Lad ung und Masse von Protonen, Neutronen und Elektronen
Wasserstoff ~ H
Kern: 1 Proton 1. Schale: 1 Elektron Sauerstoff 1 ~ 0
Kern : 8 Protonen 8 Neutronen
1. Scha le: 2 Elektronen 2. Schale : 6 Elektronen
I Abb . I : Aufbau
eines Wasserstoff
sowie eines Sa ue r
stoffatoms
kleinste Atom ist hierbei das Wasserstoffatom. Es hat die
Kernladungszahl I, also ein Proton in se inem Kern. Nach
außen hin ist jedes Atom von neutraler Ladung, also besitzt
es die gleiche Anzahl an Elektronen in der Hülle.
Massenzahl Die Massenzahl entspricht der Anzahl der im Kern enUla l
tenen Protonen und Neutronen zusammen. Die Elektronen
werden aufgrund ihrer geringen Masse vernachlässigt.
Das Element Stickstoff (N) beispielsweise hat die Kernladungs
za hl 7. Die Massenzahl beträgt 14. Es besteht aus 7 Protonen
7 Elektronen und 7 Neutronen. Seine Schreibweise wird in '
I Abbildung 2 dargestellt. Enrnält ein Atom nicht die gleiche Anzahl an Protonen und
Neutronen, so spricht man von einem Isotop des ursprüng
lichen Atoms. Beim Stickstoff gi bt es hier die Möglichkeit des 15N- es enthält 7 Protonen und 8 Neutronen .
Atommasse Die Atommasse entspricht der Masse eines Atoms. Die abso
luten Massen sind sehr klein (ein Wasserstoffatom wiegt
ca. I ,66 x I 0-24 g). Um den Um gang mit der Masse zu er
leichtern, wurde die relative Atommasse definiert. Diese
wurde festgelegt als die Masse des Kohlenstoffs: 12,000.
Ein Wasserstoffatom hat den zwölften Tei l der Masse eines
Kohlenstoffatoms, also 1 ,00.
Ionen Ionen sind nach au ßen hin immer positiv oder negativ
geladen. Es handelt sich hierbei um Atome, die Elektronen
aufgenommen oder abgegeben haben.
,...,...--... t ' ' ; .... ,..,, ' ~f· '1
I ' " ~ ' t \ 1 , ' ~ ' I ' ~ ~ ' • .. ~ 1• 'Y
1 o: > > l\
I
0
I , I O : 0 O II
Massenzahl ~zf!: M Element symbol O rd nungsza hl ~--
I Abb . 2: Sehr lbw I e von EI mcn ron
Elemente und Periodensystem der Elemente
Ein Element Ist ein Stoff, der nur aus Atomen besteht, die alle die gleiche Kernladungszahl haben.
Stoffmenge Die Stoffmenge eines Elements wird in Mol angegeben. Ein Mol eines Stoffes enthält genau 6,02 x 1023 Atome. Diese Konstante wird als Avogadro'sche Zahl bezeichnet. So kann man die Mengen verschiedener Stoffe vergleichen. Gleiche Stoffmengen enthalten immer die gleiche Anzahl an Teilchen, egal, um welchen Stoff es sich handelt. 1 moleines Elementes gibt somit die relative Atommasse in Gramm wieder.
Periodensystem der Elemente (PSE} Alle Elemente, die zurzeit bekannt sind, werden im sogenannten Periodensystem der Elemente angeordnet (I Abb. 3). Sie haben ein bestimmtes ElementsymboL Momentan sind 111 Elemente in diesem System aufgeführt. In jedem Kästchen des Periodensystems ist ein Element mit seiner Kernladungszahl und der dazugehörigen relativen Atommasse aufgeführt. Die horizontalen Zeilen sind die 7 Perioden, die senkrechten Spalten sind die Gruppen. Man unterscheidet hier zwischen Haupt- und Nebengrup· pen. In den einzelnen Perioden sind die Elemente nach der steigenden Zahl der Elektronen in der Elektronenhülle geordnet. Die Zahl der Elektronen in der äußersten Schale der Elektro-
1.0079 I . Periode Was.~ierslofT 2 13 14 15 16 1H (II A) (lil A) (I VA) (VA) (V IA)
6.941 9.0122 10.811 12.011 14.007 15.9994 Lithium Beryllium Bor Kohlenstoff S1id.s1off Saucrstoff 2. Periode
JLi 4Be sB 6C 1N sO 22.990 24.305 26.982 28.086 30.974 32.066 Natrium Magnesium Al uminium Silicium Phosphor Schwefel
3. Periode 11Na 12Mg nAI 14Si 1sP 16S
39.098 40.078 69.723 72.61 74.922 78.96 Kalium Calcium Gall ium Gennanium Ar>< n Selen 4. Periode
19K wCa J1Ga l2Ge 33AS 34Se 85.468 87.62 114.82 118.71 121 .75 127.60 Rubidium Suonlium Indium Zinn Antimon Tellur
5. Periode HRb J&Sr 49ID 5oSD Si Sb s2Te 132.91 137.33 204.38 207.2 208.98 208.98 Caesium Barium Th1llium Blei Bismul Polonium
6. Periode 5sCs S6ß8 s1TI szPb s3Bi 84PO*
223.02 226.03 Francium Radium
7. Periode 87Fr* ssRa•
Grundlagen 617
nenhülle entspricht der Hauptgruppe des Elements. Die Elektronen befinden sich in der Hülle in Schalen um den Kern. Die erste Schale kann wie bereits erwähnt maximal zwei Elektronen aufnehmen. Dies ist auch der Grund dafür, dass in der ersten Periode des Periodensystems nur zwei Elemente, Wasserstoff (H) und Helium (He) enthalten sind. Ab der zweiten Schale können sich dann jeweils bis zu 8 Elektronen dort befinden. Außer den oben aufgeführten Hauptgruppen gibt es noch Nebengruppen im Periodensystem der Elemente, die aber für Mediziner in der Biochemie keine große Rolle spielen.
Chemische Bindungen
Atombindung = kovalente Bindung Eine Atombindung, auch kovalente Bindung genannt, ist die feste Bindung zwischen zwei Atomen. Solche Bindungen liegen vor allem in Nichtmetallen und Komplexen vor. Die Atome streben danach, ihre äußeren Schalen mit Elektronen aufzufüllen. Die bereits in der Schale enthaltenen Valenzelektronen versuchen, kovalente Bindungen mit den Valenzelektronen anderer Atome einzugehen. Es entsteht eine Elektronenpaarbindung. Hierbei kann jedes Atom genau die Zahl an Bindungen knüpfen, wie es Elektronen in der äußersten Schale besitzt. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass mehrere Elektronenpaarbindungen zwischen zwei Atomen gebildet werden, es entstehen Doppel-, Dreifach- und in seltenen Fällen sogar Vierfachbindungen.
4.0026 17 Helium
(VIIA) ,He
18.998 20. 180 Fluor Neon
9F 10Ne
35.453 39.948 Chlor Argon
11CI 1sAr
79.904 83.80 Brom Kryplon
Jsßr J6Kr
126.90 131.29 Iod Xe non SJI s4Xe
209.99 222.02 As1a1 Radon
ssAt* s6Rn*
I Abb.3: Hauptgruppen des Periodensystems * radioakli ve Eleme nte; angegeben ist die Masse e ines wicht igen Isotops (soweir beka nnt) der Elemente
Chemische Grundlagen II
Unter der Bindungsenergie versteht man die Energie, die
aufgewandt werden muss, um eine Atombindung wieder zu
spalten. Mit der Zahl der Bindungen zw ischen zwei Atomen
steigt die Bindungsenergie, am meisten Energie wird benö·
tigt, um einer Vierfachbindung zu lösen.
Ionenbindung
Ionenbindungen, auch ionische Bindungen entstehen aus
den Wechselwirkungen zwischen den geladenen Ionen, die
daraus resultieren, dass sich unterschiedlich geladene Ionen
gegenseitig anziehen. Beispiele für Ionenbindungen sind viele
Salze. Kochsalz zum Beispiel besteht aus einem Ionengitter,
das aus Natrium- und Chiaridionen aufgebaut ist. Die positiv
geladenen Na+-lonen reagieren mit den negativ geladenen
Cl--Ionen zu NaCI: Na++ Cl- .....,> Na Cl
Bei ionischen Bindungen handelt es sich um sehr starke
Bindungen. Es ist eine hohe Bindungsenergie nötig, um sie
wieder zu trennen. Dies bedeutet auch, dass viele Sa lze
einen sehr hohen Schmelzpunkt besitzen.
Wasserstoffbrückenbindung
Wasserstoffbrückenbindungen sind um einiges schwächer
als Atom· und Ionenbindungen. Sie werden gebildet zwi·
sehen einem Wasserstoffatom und einem Awm mit freien
Elektronenpaaren. Wasserstoffbrückenbindungen können
sowohl innerhalb eines großen Moleküls als auch zwischen
zwei Molekülen bestehen.
Ein Beispiel für eine Substanz, in der diese Bindung eine
wichtige Rolle spielt, ist Wasser, bei dem die einzelnen Was
sermoleküledurch Wasserstoffbrückenbindungen zu einem
großen Netz verbunden werden.
Auch beim Aufbau der DNA sind Wassers toffbrücken bin·
dungenvon großer Bedeutung. Die beiden DNA-Stränge
bilden untereinander solche Bindungen aus, was zur cha rak
teristischen Doppelhelix der DNA führt.
Chemische Reaktionen
Bei einer chemischen Reaktion werden ein oder mehrere
Edukte zu einem oder mehreren Produkten umgewandel t.
Hierbei kann Energie sowohl frei als auch verbraucht
werden.
Q)
·~ Q) c w
Energie von Reak tionen
Um eine_ c~emis he Reakyon zu starten . ist oft die Zuführun
von A.kUv1erungsenergte notwendig. Die e wird gebrauch g
um der Reaktion über ein n anfängli hen "Energieberg' t,
hinwegzuhelfen, o dass si ab in m beslimmt n Punkt oft
weiter von selbst ablaufen kann.
Startet eine R aklion von s lbst, ohn ass ine solche
Energiezufuhr notwendig ist, spricht man von einer pontan
ablaufenden Reaktion.
Die benötigte En rgie kann aus r Umg bung in Form
von Wärme aufgenomm n w rd n. D m ntspr hend Wird
freiwerdende En rgi als \ ärm abgegeben.
Exotherme Reaktionen
ln der Bilanz ein r exothermen Reaktion wi rd Energie frei.
gesetzt. Um die Reaktion zu starren , ist häu 1g in Aktivie
rungsenergie notwendig. Di fre iwerdende Energie wird
auch als Reaktionsenthalpie bez ichnet. Den Ablauf eine
exothermen Reaktion zeigt I Abbil ung 4. r
Endotherme Reaktion en
Bei einer endmhermen Reaktion wird Energie verbraucht.
Es wird sowohl Aktivierungs· als auch Reaktionsenergie
zugeführt , um die Reaklion in Gang zu setzen. Die in gesa.rn
aus der Umgebung fü r d n Ablauf d r Reaklion aufgenom- t
mene Energie ist die R ak tionsen rgie. I Abbildung 5 zeigt
den Ablauf einer endoth rmen Reaktion.
Verschiedene Arten chemischer Reak tionen
Säure-Base-Reak tionen
Bei Säu re-Base-Reaktion n find L zwisch n d n R aktions
parmern ein Austaus h von Proton n, also von H•- Jonen
statt. Edukt sind imm rein äur und ein Bas . Die Sä ur
dient als Protonendonator, währ nd di Bas d r Proton e
akzeptor ist. Di Proton nüb nr gung b z ichnet man a en~ Uch
als Protolyse.
Ein B ispiel für in so! h R aklion ist di Aufl ösung von
Salzsäu r in Wasser. Di alzsäur ist hi rb i d r Protonen
donator, Wass r fu ngi rl als Protonenakz ptor, in di em Fau al o als Ba : H I H2 - > H 1 ' ' J
Man kann di Funktion in zw I T ilfunkti n n auft ilen:
Proton nabgab : H I H · 1 I
Proton naufnahm : H2 1 H· - H1 •
Edukte AktlviLerung norgi
Reaktlons-
entha l~t •.•..••.•••••.•. Pr ukt
I Abll 4 Abl<~uf OI<W< •' Ol hO< 111 n ~ ktl 11
Edukte
Redoxreaktionen
Reaktionsenergie ßE
Reaktionsverlauf
Grundlagen 819
I Abb. 5: Ablauf einer endothermen Reaktion
Reversible und irreversible Reaktion en Bei Redoxreaktionen findet eine Übertragung von Elektronen zwischen den an der Reaktion beteiligten Partnern statt. Ein Reaktionspartner fungiert als Elektronendonator, er gibt ein Elektron ab. Man spricht von einer Oxidation. Das andere Edukt nimmt das Elektron auf, es handelt sich um den Elektronenakzeptor, an dem die Reduktion abläuft.
Sehr viele Reaktionen sind nicht nur in der Lage, in einer Richtung abzulaufen, es kann auch zur Rückumwandlung der Produkte in die Edukte kommen. Angestrebt wird das Vorliegen eines chemischen Gleichgewichts. Dies ist der Zustand, in dem die für das Reaktionssystem günstigste Energie vorliegt, und in dem die Hin- und die Rückreaktion in gleichem Ausmaß abläuft. Eine Reaktion des Elektronendonators X mit dem Elektronen
akzeptor Y kann fo lgendermaßen ablaufen: Im menschlichen Körper gibt es aber auch viele irreversible Reaktionen. Diese sind vor allem beim Stoffwechsel notwendig, um die Richtung der Stoffwechselwege festzulegen und häufig Reaktionen, bei denen eine große Menge Energie frei wird.
Oxidation: X~ X+ + e-Reduktion: Y + e-~ YGesamtgleichung: X+ Y ~X+ + y-Redoxreaktionen sind im menschlichen Körper von großer Bedeutung. Sie laufen beispielsweise bei unzähligen Stoffwechselvorgängen ab.
Zusammenfassung X Atome bestehen aus positiv geladenen Protonen, negativ geladenen
Elektronen und Neutronen. Sie sind nach außen hin von neutraler Ladung. X Ionen hingegen sind geladen. Bei positiver Ladung spricht man von
Kationen, negativ geladene Ionen werden auch als Anionen bezeichnet. X Elemente sind aus Atomen gleicher Kernladungszahl aufgebaut. Sie wer
den im Periodensystem der Elemente angeordnet.
X Wichtige chemische Bindungen für den Mediziner sind Atom-, Ionen- und Wasserstoffbrückenbindungen . Letztere sind wichtig beim Aufbau der DNA. Sie bilden die Verbindung der beiden Einzelstränge zu einem Doppelstrang.
X Von einer chemischen Reaktion spricht man, wenn es zu einer Umwandlung von einem oder mehreren Edukten zu Produkten kommt. Bei einer exothermen Reaktion wird Energie frei, bei einer endothermen hingegen muss Energie zugefügt werden.
X Säure-Base-Reaktionen, bei denen eine Protonenübertragung stattfindet, sowie Redoxreaktionen, bei denen es zu einem Austausch von Elektronen zwischen den einzelnen Reaktionspartnern kommt, sind wichtige im menschlichen Körper ablaufende Reaktionstypen.
Enzyme
Enzyme sind Biokatalysatoren, die die
Aktivierungsenergie einer Reaktion
heruntersetzen und somit dafür sorgen,
dass Reaktionen im menschlichen Kör
per ablaufen. Dies würde von alleine
zwar auch geschehen, aber viel zu lange
dauern. Deswegen sind Enzyme, die
Reaktionen um das bis zu I 012-Fache
beschleunigen, für die Funktionen des
Körpers essentiell.
Eigenschaften
Bei Enzymen handelt es sich in den
allermeisten Fällen um Proteine. Diese
haben eine Tertiärstruktur und können
über Domänen mit unterschied lichen
Teilfunktionen verfügen. Selten besitzen
auch Ribonukleinsäuren enzymatische
Aktivität, was bei der Proteinbiosynthe
se eine Rolle spielt. Wichtig zu wissen
ist außerdem, dass Enzyme aus jeder
Reaktion unverändert hervorgehen und
auch das Gleichgewicht einer Reaktion
nicht beeinflusst wird . Lediglich die
Einstellung des Gleichgewichts wird
beschleunigt.
Enzyme sind in der Regel für Ihre kataly.. sierten Reaktionen hochspezifjsch, d. h. sie setzen nur ein bestimmtes Substrat um (Substratspezlfitit), und auch nur eine spezielle Reaktion dieses Substrats (Wirkungsspezifltät). Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Enzym!t hinsichtlich des Ausmaßes Ihrer Subetratspezitltät.
Manche Enzyme sind nicht für ein
bestimmtes Substrat, sondern für eine
bestimmte Gruppe (OH-Gruppe, Peptid
bindung usw. ) spezifisch, d. h. sie setzen
prinzipiell alle Verbindungen um, die
diese Gruppe aufweisen {Gruppen
spezifität). Ein weiterer Begriff, der erläutert wer
den sollte, ist die Stereoselektivität
Ein Enzym katalysiert somit normaler
weise nur ein bestimmtes Stereo isomer
einer Verbindung.
Einteilung der Enzyme
Um den Überblick über die mittlerweile
mehr als 3000 bekannten Enzyme zu
gewährleisen, ist eine Klassifikation ein
geführt worden, bei der jedes Enzym
einen Nummerncode (EC-Nummer
oder Enzym-Kiassifiz ierungsnummer)
erhält. Die erste Nummer steht hierbei
für eine der sechs HauptkJassen. Oie
Hauptklassen lei ten sich im Wesent
lichen von den katalysierten Reaktionen
ab. Einen Überbl ick über die Hauplklas
sen gibt I Tabelle 1.
Eine wichtige Untergruppe der Transferssen sind die Klnasen. Sie katalysieren Phoaphaqruppenübertragungen von ATP auf Substrate.
Zum besseren Verständnis ist es hilf
reich, die Nomenklatur der Enzyme
zu verstehen. Enzyme erkennt man
an der Endung -ase. Sie bestehen außer
dem meist aus zwei Teilen, wobei der
erste für das Substrat steht und der
zwei te für die katalysierte Reaktion .
So kann man vom Namen auf die Funk
tion des Enzyms sch ließen.
Enzyme katalysieren nicht nur eine Reaktion selbst. sondern auch deren ROck· reaktlon. Daher kann sich der Name eines Enzyms ggf. auch von der ROckreaktion ableiten. Davon sollte man sich nicht verwirren lassen.
Isoenzyme
Isoenzyme sind Enzyme, die die gleiche
Reaktion katalysieren, sich jedoch ge
ringfügig in ihrer Primärstruktur, also
in ihrer Aminosäuresequenz, voneinan
der unterscheiden. Sie haben in der
Regel unterschiedliche Eigenschaften
(z. B. elektrophoretische Wanderungs
geschwindigkeit, KM -Wert, Substrat-
affinitä t, isoelekuischer Punkt), anhanct
derer man sie labortechnisch unrerschei _
den kann . Oft sind diese Isoenzyme
organspezifisch, d. h. sie werden in den
verschiedenen Geweben unterschied-
lich stark exprimiert, was in der klini
schen Diagnostik eine Rolle spielt.
Laktat-Dehydrogenase (LDH) : Die
LOH, die die Umwandlung von Pyruvat
zu Laktat katalysiert, besteh t aus vier
Untereinheiten. Diese können entweder
vom Typ M oder vom Typ H se in. Aus
der Kombination dieser vier Unterein
heilen entstehen 5 LDH-Isoenzyme:
LDH 1 (H4), LDH 2 (H3 M 1), LDH 3 (H2
M2), LDH4 (H 1 M3) und LDH 5 (M4).
LDH 1 und LDH2 kommen im Herzmus
kel vor, und eine Erhöhung dieser Isoen
zyme im Plasma deutet auf einen Unter
gang von Herzmuskelzellen , wie z. B.
beim Herzinfarkt, hin. LDH 5 findet sich
dagegen in der Leber und im Skelett
muskel.
Kreatin-Kinase (CK]: Ähnlich wie die
LOH wird auch die CK zur Herzinfarkt
Diagnostik verwendet. Bei Herzschä
digung steigt der Anteil des Isoenzyms
CK-MB, das v.a. im Herzmuskel vor
kommt, an der Gesamt-CK innerhalb
weniger Stunden an. Die CK-MM findet
man in der Skelett- und der Herzmusku
la tur, die CK-BB im Gehirn.
Enzyme kommen beim Gesunden nur in sehr gerlnsen Mensen im Blutplasma vor. Bei Zelluntergang werden sie jedoch frelsesetzt, und durch eine Aktlvltltsbestlmmung Im Plasma kann auf eine Organachldigung geschlossen werden.
Hauptklasse Katalysierte Reaktionen Belspiele
I : Oxido- Biologische Oxidat ionen (Oxidasen) und Reduklionen (Dehydrogenasen); Laktat-Dehydrogenase
reduk tasen oft wird ein wasserstoffübertragendes Coenzym benötigt
2: Transferasen Übertragung von verschiedenen Gruppen (z. B. Pl10sphat-, Melhyl-,
Acylgruppen usw.)
3: Hydrolasen Spaliung chemischer Bindungen unler H,O-Anlagerung • Hydrolyse
Hexoklnase,
Peptidyltranslerase
Pllosphatasen,
Este rasen, Pepitd asen
4: Lyasen/ Abspaltung von Gruppen unter Bildung einer Doppelbindung (• Elimlnie- Adenylatzyk lase,
Synthasen rung) oder Anlagerung von Gruppen an Doppelbindungen (• Addition) Aldolase
5: Isomera sen Umwandlung von Isomeren Glukose-6-Phosphat-
6: Ligasenf
Synthetasen
Energieabhängige (meist vom ATP) Knüpfung von Substra lbindungen
(C-C, C-0, C-N, C-S)
I Tab. I : ÜbersiciH über die Enzymhauptklassen
lsomerase
Pyruvatcarboxylase,
DNA-Ligase
Lokalisation von Enymen
Die einzelnen Komparti mente der Zelle beherbergen unterschiedliche Stoffwechselwege. Dies kommt dadurch zustande, dass ein Kompartiment nicht über alle Stoffwechse lenzyme verfügt, sondern vielmehr über ein begrenztes Repertoire, was auch für die Regulation des Stoffwechsels von Vorteil ist So befinden sich beispielsweise die Enzyme der Fettsäuresynthese im Zytoplasma, während sich der Fettsäureabbau in den Mitochondrien abspielt So kommen sich Auf- und Abbau nicht in die Quere.
~ Zytoplasma: Enzyme der Glykolyse, Glukoneogenese (Teil) , Fettsäuresynthese, Pentosephosphatweg, ~ Mitochondrium: Enzyme der Atmungskette, Citratzyklus, Fettsäureoxidation, Ketogenese, Harnstoffzyklus, Glukoneogenese (Teil ), ~ Lysosomen: Proteasen, Hydrolasen, Phosphatasen, N ukleasen, ~ Zellkern: NAD+-Phosphorylase, ~ Zellmembran: Na+/ K+-ATPase.
Coenzyme und prosthetische Gruppen
Funktionen und Beispiele
Coenzyme sind Hilfsmoleküle, die von vielen Enzymen benötigt werden, damit diese ihre Funktion ausüben und Reaktionen katalysieren können. Sie dienen hierbei als Überträger von Elektronen, Ionen oder Molekülgruppen. Ist ein Coenzym fest mit dem Enzym verbunden, wird es prosthetische Gruppe genannt Lösliche Coenzyme ( = Cosubstrate) werden dagegen nicht-kovalent an das aktive Zentrum des Enzyms gebunden. Allerdings werden diese Begriffe oft synonym gebraucht Bei den Coenzymen handelt sich meist um sehr stabile Moleküle, die oft wiederverwertet werden können. Sie leiten sich meistens von Vita minen ab. Im Gegensatz zu den Enzymen sind Coenzyme nur wenig spezifisch. Einen Überblick über die Coenzyme und deren Funktion gibt I Tabelle 2.
Grundlagen 1 o I 11
Coenzym Funktion Vitamin
Nikotinam idadenindinukleotid (NADH) Wasserstoff-Transfer (Redox) Nikotinsäureamid
Nikotinam idaden indinukleotidphosphat (NADPH) Wasserstoff-Transfer (Redox) Nikotinsäureamid
Flavinadenindinuk leotid (FADH) Wasserstoff-Transfer (Redox) Riboflavin
Flavinmononukleot id (FMNH) Wassers toff-Transfer (Redox) Riboflavin
S-Adenosylmethionin (SAM) Methylgruppen-Transfer Methionin (Aminosäure)
Tetrahydro folsä ure (FH4) Formylgruppen-Transfer Folsäure
Coenzym A (CoA) Übertragung von Acylresten Pantothensäure
Biotin Transfer von C02 Biotin
Pyridoxalphosphat Aminogruppenüberträger Pyridoxin (Vitamin B6)
I Tab. 2: Coenzym e und deren Funktion
Coenzyme als Wasserstoffüberträger
NADH, NADPH (I Abb. 1) und FADH sind die wichtigsten Überträger von Reduktionsäquivalenten, d. h. sie dienen als Elektronenüberträger bei Redox-Reaktionen, wobei die Elektronen meist zusammen mit Wasserstoffprotonen übertragen werden. Sie können entweder in ihrer oxidierten (NAD+, NADP+ bzw. FAD ) oder ihrer reduzierten Form (NADH/ H+, NADPH/ H+ bzw. FADH2)
vorliegen und je nachdem Elektronen abgeben oder aufnehmen. Zur Verein-
Anlagerungsste lle
für das Hydrid-Ion (W)
fachung wird die Zustandsform oft außen vor gelassen, und die Abkürzungen NADH, NADPH und FADH verwendet. Enzyme können normalerweise nur mit einem Coenzym als Elektronenüberträger arbeiten, also z. B. entweder NADH oder NADPH. Interessant ist außerdem, dass NADH und FADH hauptsächlich als NAD+ und FAD+ vorliegen und vor allem an katabolen Oxidationen als Elektronenakzeptoren beteiligt sind . NADPH dagegen dient in seiner reduzierten Form (NADPH/ H+) vor allem als Elektronendonator für Synthesereaktionen (anaboler Stoffwechsel) .
I Ab b. 1: Struktu rfo rm el
vo n NADH bzw. NADPH
( w N~ ~c, ~N ~:-~ NH2 N~~ )
NeH H CH2-o-~~~-o-~~~ -o-~c,lo N
o- o- be im NADP+ statt OH: H 0 H HH HH O
I OH OH- O=P- o-
1 o-
Zusammenfassung X Enzyme sind hochspezifische Biokatalysatoren und ermöglichen durch
Herabsetzen der Aktivierungsenergie .chemische Reaktionen.
X Sie sind meist substrat- oder gruppenspezifisch sowie wirkungsspezifisch. X Isoenzyme katalysieren die gleiche Funktion, aber unterscheiden sich in
ihrer chemischen Struktur und sind oft organspezifisch.
X Coenzyme sind für den Ablauf vieler Reaktionen nötig. Die Coenzyme NADH, NADPH, FADHund FMNH sind als Elektronenüberträger an RedoxReaktionen beteiligt.
Enzymfunktion und -kinetik
Wie funktionieren Enzyme?
Damit eine Reaktion ablaufen kann, muss zunächst einmal
eine Aktivierungsenergie aufgewendet werden. Diese ist
unter den Temperaturverhältnissen, wie sie im Körper herr·
sehen (37 oc), meistens so hoch, dass die Reaktionen
wenn überhaupt - nur sehr langsam ablaufen würden.
Enzyme können diese Aktivierungsenergie herabsenken und
das Ablaufen einer Reaktion dadurch besch leunigen, wobei
die Gleichgewichtslage der Reaktion jedoch nicht verändert
wi rd. Enzyme entfalten ihre Wirkung, indem sie ihr dazugehöriges
Substrat an einer speziel len Bindungsstelle - dem aktiven
Zentrum - bind en, wodurch sich ein Enzym·Substrat·Kom
plex ausbildet. Diese Verbindung ist sehr reaktionsfreudig und
führt zu einer sog. Substrataktivierun g. Das Produkt entsteht,
und das Enzym wird unverändert aus dem Komplex freige
setzt: E + S ~ ES ~ EP ~ E + P Die Wirkung von Enzymen über Herabsetzung der Aktivie
rungsenergie ist in I Abbildung I dargestellt.
Enzymkinetik
Die Enzymkinetik beschäftigt sich mit der Frage, wie schnell
enzymkatalysierte chemische Reaktionen ablaufen. Ihr Haupt
ziel ist es, die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von
der Substratkonzentration zu beschreiben. Dazu bedient sie
sich versch iedener Formeln und Begriffe.
Begriffe der Enzymkinetik
liJJ. Die Aktivität eines Enzyms wird in Internationa len Ein·
heiten (U = Units) gemessen. Dabei entspricht eine Einheit
der Umwandlung von 1 ].lmol Substrat pro Minute. ln der
Klinik wird die Enzymaktivität auf das Volumen von 1 ml
bezogen, man gibt sie also in U/ ml an.
Aktivierungsenergie der nicht kata lysie rten Hinreaktion
J
Aktivierungsenergie der
~-~--!--- j''''''"'" "'""'ktloo
Energieniveau SubstratS
ßG Aktivierungsenergie
der katalysierten Rückreaktion
l Energieniveau Produkt P
I Abb. 1: Energiediagramme (katalysierte vs . unkata lysierte Reak tion) 171
.... Die Affinität eines Enzyms sa t aus, wie ei nfach sich ein
Enzym mit seinem Substrat vereinigt. Je höher die Affinität
desto geringer muss die Substratkonzentration sein, damit '
es zur Ausbildung eines Enzym-Substra t-Komplexes kommt
und umgekehrt. Als Maß für die Affinität eines Enzyms kan~ die Michaeliskonstante KM dienen (s . u.), dabei gi lt: Je nied
riger die Michaeliskonstante, desro höher die Affinität.
.... Die katalytische Kapazität (= Vmaxl eines Enzyms be
schreibt die maximale Geschwind igkeit, mit der ein Substrat
umgesetzt wird, wenn alle Enzyme mit Substrat beladen
sind. Sie ist von der Enzymkonzentration abhängig. Teilt man
V max durch die Enzymkonzentration lEI, so erfährt man, w ie
viele Substratmoleküle ein einziges Enzym pro Minute um
setzt. Diesen Wert bezeichnet man als Wechselzahl (WZ).
Michaelis-Menten-Kinetik
Geht man von einer konsta nten Enzymmenge aus, so ist die
Geschwindigkeit, mi t der eine enzymatische Reaktion abläuft
von der Substratkonzemration abhängig. Versucht man, die '
Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Substrat
konzentration graph isch darzustellen, so zeigt diese einen
typischen Verlauf (I Abb. 2).
ln der Initialphase liegt nur wenig Substrat vor, was zur Folge
hat, dass sich nur wenige Enzym-Substrat-Komplexe ausbil
den. Die Reaktionsgeschwindigkeit (v) ist noch gering. Bei
zunehmender Substrat.konzentration [SI steigt auch die Um
satzgeschwindigkeit kontinuierlich an, da sich immer mehr
Enzym-Substrat· Komplexe ausbi lden können, also immer
mehr Enzyme aktiv arbeiten. Dies geschieht allerdings nu1~
bis alle Enzyme mit Substrat beladen si nd , bis also die Subs
tratsättigung des Enzyms eingetreten ist. Danach kann die
Umsatzgeschwindigkeit allenfalls durch eine Erhöhung der
Enzymkonzentration gesteigert werden (da wir aber von
einer konstanten Enzymmenge ausgehen, lassen wir diese
Mögl ichkeit einmal außen vor). An dieser Stel le ist die maxi
mal mögliche Reak tionsgeschwindigkeit V max erreicht.
Anfangsreakt ionsgeschwindigkeit
V o
i V max
V max
KM Substratkonzentration [S]
I Abb. 2: Abhängigkeit der Rcak tionsg schwindigk it von der ubstra t
kon zentration (Micha lis-Men ten-Funktion) 121
Dadurch erhält die Kurve ihren typischen Verlauf. Sie flacht ab und nähert sich asymptotisch an die maximale Geschwindigkeit Vm • ., mit der eine Reaktion bei Substratsättigung ablaufen kann, an. Aufgrund dieser asymptotischen Annäherung wäre es sehr schwierig, die Substratkonzentration zu errechnen, bei der V max erreicht wäre, zu mal V max nur ein Annäherungswert ist Deswegen berechnet man stattdessen die Substratkonzentration bei halbmaximaler Geschwindigkeit Die Substrat-Konzentration, bei der ein Enzym mit halbmaximaler Geschwindigkeit arbeitet, bezeichnet man als Michaeliskonstante oder abgekürzt als KM. Jedes Enzym hat eine spezifische KM, wobei diese im Gegensatz zu V max und zur halbmaximalen Umsatzgeschwindigkeit, nicht von der Enzymkonzentration abhängig ist Um nun die Reaktionsgeschwindigkeit bei einer bestimmten Substratkonzentration zu berechnen, kann man eine Formel (die sog. Michaelis-MentenGieichung) verwenden, auf deren Herleitung wir verzichten, da das an dieser Stelle zu weit führen würde. Sie lautet: V= Vmax x ISJ
HSJ +KM]
Umformung nach Lineweaver und Burk
Lineweaver und Burk haben durch die Umformung der Michaelis-MentenFunktion eine Gleichung entwickelt, aus der der KM·Wert sehr einfach ermittelt werden kann. Man erhält diese durch die doppeltreziproke Umkehrung der Michaelis-Menten-Gleichung, wobei eine Geraden-Gleichung nach dem Schema y = ax + b entsteht: 1 KM I 1 - =--x-+--V vrnax ISJ V max
Stellt man diese graphisch dar (I Abb. 3), so kann man aus der Kurve direkt die Werte für den KM-Wert (- 1 / KM= Schnittpunkt mit der Abszisse) und Vmax (1 / Vmax = Schnittpunkt mit der Ordinate) ablesen.
Grundlagen 12 I 13
1 I Abb. 3: Lineweaver-Burk-Darstellung [21
.,
Vo
., ., ., ; ,.' Vmax
Einflussfaktoren auf die Enzymkinetik
Die Kinetik eines Enzyms kann auf verschiedene Weisen beeinflusst werden, wobei es entweder zu einer Aktivitätsabnahme oder Aktivitätszunahme kommen kann. Sowohl die katalytische Aktivität V max als auch die Michaeliskonstante KM können durch Inhibitoren bzw. Aktivatoren verändert werden, was mit einer Verschiebung der Michae!is-Menten- und Lineweaver-Burk-Diagramme einhergeht. Die Regulation des Stoffwechsels beispielsweise greift auf solche Mechanismen zurück. Wichtige Mechanismen der Enzymhemmung und -aktivierung sind kompetitive und nichtkompetitive Hemmung, Allosterie und Interkonvertierung bzw. Interkonversion (s. Kap. 14). Auch äußere Faktoren können auf die Aktivität von Enzymen Einfluss nehmen:
Zusammenfassung
~ So führt eine Temperaturerhöhung im physiologischen Temperaturbereich zu einer Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeiten. Übersteigt die Temperatur den physiologischen Bereich, so kommt es zur Denaturierung der Enzym-Proteine, und die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt wieder ab. ~ Auch der pH-Wert kann die Aktivi· tät eines Enzyms beeinflussen. Die meisten Enzyme arbeiten bei einem pH-Wert zwischen 5 und 9 am effektivsten. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wie beispielsweise die Magenenzyme (pH 1-2), Iysosomale Enzyme (pH 3-5) oder die alkalische Phosphatase (pH > 7) . ~ Einige Enzyme benötigen die Anwesenheit von Metallionen, um arbeiten zu können. Diese wirken bei den Reaktionen als Cofaktoren. Die ATPase z. B. benötigt Mg2•-Ionen, Peptidasen arbei· ten mit Mn2• -, Zn2• - und Co2+.Jonen zusammen.
Jt Enzyme katalysieren biologische Reaktionen, indem sie deren Aktivierungsenergie herabsetzen.
Jt Die Substratbindungsstelle eines Enzyms bezeichnet man als aktives Zentrum.
Jt Die Michaelis-Menten-Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Substratkonzentration bei konstanter Enzymkonzentration.
Jt V max ist die maximale Geschwindigkeit, mit der eine Reaktion bei Substratsättigung ablaufen kann.
Jt Die Michaeliskonstante beschreibt diejenige Substratkonzentration, bei der die halbmaximale Umsatzgeschwindigkeit erreicht wird. Sie dient als Affinitätsparameter.
Prinzipien der Stoffwechselregulation
Die Regulation des Stoffwechsels ist
ein wichtiges Thema in der Biochemie,
da nur dadurch ein koordiniertes Ablau
fen der unterschiedlichen Reaktionen
des Körpers ermöglicht wird, zumal
die verschiedenen Stoffwechselsysteme
oftmals miteinander verzahnt sind . So
wird auch gewährleistet, dass sich der
Körper und dessen Funktion flexibel an
die herrschenden Bedingungen anpas
sen können. Die Reaktionsgeschwindig
keit wird im Wesentlichen durch drei
Parameter bestimmt: das Substrat
angebot, die Enzymaktivität und die
Enzymmenge.
Regulation der
Enzymaktivität
Kompetitive Hemmung
Bei der kompetitiven Enzymhemmung
konkurrieren der Inhibitor und das
Substrat um die Bindungsstelle im ak
tiven Zentrum des Enzyms. Der Inhibi
tor blockiert diese, und das Substrat
kann nicht andocken, d. h. das Enzym
ist für die Zeit funktionslos und die Re
aktionsgeschwindigkeit insgesamt her
abgesetzt. Durch eine Erhöhung der
Substratkonzentration kann der Inhibi
tor aus der Bindung verdrängt werden.
Ist die Affinität des Enzyms zum Inhibi
tor jedoch viel höher als die zum Subs
trat, ist die Hemmung nahezu irreversi
bel, weil sich der Inhibitor nicht ver
drängen lässt. Ein klin isches Beispiel
hierfür ist die Vergiftung mit Kohlen
monoxid, einem kompetitiven Inhibitor
des Hämoglobins (s. Kap. 11 6). Durch
kompetitive Hemmung kommt es zu
Veränderungen bei der Michaelis-Men
ten-Kurve und der Lineweaver-Burk-Ge
raden (I Abb. 1 ): Zwar bleibt die kataly
tische Kapazität V max gleich (Inhibitor
kann durch viel Substrat verdrängt wer
den), während sich die Michaelis-Kons
tante KM jedoch scheinbar erhöht (ein
Anfangsreaktionsgeschwindigkeit
Vo
V max - 2-
- ungehemmte Reaktion - kompetitiv gehemmte
Reaktion (I = Inhibitor)
KM, KM, Substratkonzentration [S]
- gehemmt - ungehemmt
~
.," ~' _ 1_
""' ,' Vmax
1 1 1
-KM, - KM, [S)
I Abb. I: Einfluss eines kompeti t iven Inhibitors
au f Michaelis-Menten-Ku rve und Lineweaver
Burk-Gerade [2)
Teil des Enzyms wird stets durch den
Inhibitor blockiert).
Nicht-kompetitive Hemmung
Bei dieser Form der Enzymhemmung
konkurriert der Inhibitor nicht mi t dem
Substrat um die gleiche Bindungsstelle,
sondern bindet stattdessen außerhalb
des aktiven Zentrums, wod urch die
räumliche Struktur des Enzyms so ver
ändert wird, dass die Enzymaktivität
stark eingeschränkt bzw. völlig unter
drückt wird. Dies kann nicht durch
Erhöhung der Substratkonzentration
rückgängig gemacht werden, was dazu
führt, dass V max nie erreicht werden
kann. In der Klini k spiel t diese Form der
Hemmung eine untergeordnete Rolle,
ein prominentes Beispiel stell t aber die
Zyanid-Vergi ftung dar, bei der die
Atmungskette über eine nicht-kompe
titive Hemmung der Cytochrom-Oxi
dase unterbrochen wird. Bei der nicht
kompetitiven Hemmung verringert sich
V maXI die Affinität zum Substrat und da
mit auch der KM-Wert bleiben allerdin gs
gleich (I Abb. 2).
Allosterie Bei der Allosterie kommt es durch
Bindung eines Stoffes (allosterischer
Effektor) an eine Bindungsstelle außer-
halb des aktiven Zenuums des Enzyms
(allosteri sches Zentru m) zu einer Kon
forma tionsänd erung des aktiven Zen
tru ms, und somi t zu einer Ak tivitä ts
steigerung bzw. -senkung des Enzyms
(s. u. ).
ln terkonvert ierung
Bei dieser Form der Enzymregu lation
kommt es durch eine kleine chemische
Veränderung eines Enzyms zu dessen
Aktivierung bzw. Deaktivierung. So
werden manche Enzyme, die zunächst
inaktiv sind, erst katalysefähig gemacht
und umgekehrt. Dies geschieht meist '
über eine Phosphorylierung durch ein
anderes Enzym, z. ß. durch eine Pro
teinkinase. Dieser Regu lationsmecha
nismus findet z. B. in der Koordination
von Zuckerabbau (Glykolyse) und Zu
ckersynthese (G lukoneogenese) seine
Anwendung, oft infolge von Hormon
wirkungen.
Produ kt- und Substra themmung
Auch das Produ kt einer Reaktion selbst
( Produkthemmung, negative Rück
koppelung) oder ein herrschender
Substratüberschuss (Substrathemmung)
können das katalysierende Enzym hem
men. Dadurch wird verhindert, dass es
Anfangsreaktionsgeschwindigkeit
Vmax1 - 2-
V max2 - 2- -
- gel1emmt
1 v;;
- ungehemmt
1
Vmax2
1 - KM
Vmax - ------ ..!
- ungehemmte Reaktion - nichtkompetitiv
gehemmte Reaktion (V-Typ)
Substratkonzentrat ion [S]
1
fSi
I Abb. 2: in fluss d r nicht-komp tit iv n Hem
mung auf Michaelis-M nten- und Lin weaver
Burk-Diagr mm 121
zu einer überschießenden Produkt-Synthese kommt Die Produkthemmung kann hierbei sowohl kompetitiv, als auch nicht-kompetitiv erfolgen. Bei der Substrathemmung kommt es zur Bindung von zwei Substraten an das aktive Zentrum eines Enzyms. Der entstehende Komplex kann nicht umgesetzt werden, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt.
Besonderheiten der Allosterie
Die Allosterie nimmt eine SonderstelJung in der Stoffwechselregulation ein, da sie wesentlich an der intrazellulären Koordination verschiedener Stoffwechselwege beteiligt ist So werden Schrittmacherreaktionen in der Regel allosterisch reguliert Zunächst gilt es, den Begriff der Kooperativität zu erklären. Die meisten allosterischen Proteine, worunter auch die wichtigsten Schlüsselenzyme fallen, bestehen aus mehreren (jedoch mindestens zwei) Untereinheiten, die sich gegenseitig beeinflussen. So führt die Bindung von Substrat an eine der Untereinheiten zu einer Erhöhung der Substrataffinität der nächsten Untereinheit etc. Das bedeutet, dass mit jeder Bindung von Substrat an eine Untereinheit die Bindung an die anderen Untereinheiten erleichtert wird. Dadurch erhält die Kurve der Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Substratkonzentration einen sigmoiden Verlauf. Die einfache MichaelisMenten-Formel ist hier nicht mehr ausreichend. Nun kann diese Kurve durch die Anwesenheit von allosterischen Effektoren beeinflusst werden. Man unterscheidet bei allosterisch regulierten Enzymen zwei Typen:
Reaktionsgeschwindigkeit des Enzyms
tvmax
_......Km Km Km...._ Substrat-aktiviert 11 ohne h gehemmt konzentration a ostensc e
Regulation
Grundlagen
Reaktionsgeschwindigkeit des Enzyms
14 I 15
Substratkonzentration
I Abb. 3: Einfluss allosteri scher Effektoren: links Enzym vom K-Typ, rechts Enzym vom V-Typ [3]
..,. K-Typ: Modulatoren vom K-Typ bewirken eine Veränderung der Mfinität des Enzyms zum Substrat, also des (scheinbaren) KM-Werts. Beispiel: Phosphofructokinase (PFK) . ..,. V-Typ: Aktivierung oder Hemmung vom Y-Typ führt zu einer Veränderung der katalytischen Kapazität, d. h. die Maximalgeschwindigkeit wird verändert Beispiel: Pyruvatcarboxylase (PC).
Regulation der Enzymmenge
..,. Induktion und Repression der Enzymsynthese: Durch Erhöhung der
Zusammenfassung
Transkriptionsrate des Gens, das für ein Enzym kodiert, wird die Enzymproduktion gesteigert, eine Verminderung bewirkt das Gegenteil. Dieser Mechanismus läuft langsamer und nachhaltiger ab als die oben beschriebenen Prozesse zur Veränderung der Enzymaktivität. Oft wird er durch Hormone gesteuert. ..,. Limitierte Proteolyse: Aus einer inaktiven Vorstufe, einem sog. Proenzym, entsteht durch Abspaltung bestimmter Sequenzen das aktive Enzym. Vor allem extrazelluläre Enzyme (z. B. Verdauungsenzyme, Gerinnungsfaktoren) werden durch limitierte Proteolyse reguliert.
• Die Stoffwechselregulation erfolgt in der Regel über die Beeinflussung von
Schrittmacherreaktionen und deren Schlüsselenzyme.
• Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Enzyme in ihrer Aktivität zu beeinflus
sen. Wichtige Begriffe sind hier kompetitive und nicht-kompetitive Hem
mung, Allosterie und lnterkonvertierung.
• Ein kompetitiver Inhibitor kann bei steigender Substratkonzentration aus dem aktiven Zentrum verdrängt werden, die nicht-kompetitive Hemmung
dagegen kann nicht durch Substratzugabe rückgängig gemacht werden.
• Bei allosterischen Enzymen vom K-Typ wird die Affinität zum Substrat ver
ändert, bei solchen vom V-Typ ändert sich die Maximalgeschwindigkeit
Vmax•
• Andere Einflussfaktoren auf den Ablauf von Stoffwechselreaktionen sind
das Substratangebot und die Enzymmenge.
Vitamine I
Vitamine sind organische Verbindungen, die der menschliche
Organismus nicht selbst synthetisieren kann, sie sind also
für den Menschen essentiell und müssen über die Nahrung
aufgenommen werden. Eine Ausnahme bildet das Vitamin D,
das der Mensch aus Cholesterin herstellen kann. Vitamine
nehmen verschiedene Funktionen ein: einige von ihnen,
wie Vitamin A, Vitamin K und alle B-Vitamine sind Coenzyme
wichtiger Reaktionen oder Bestandteile dieser, und daher
unverzichtbar für die Aufrechterhaltung des Stoffwechsels.
Aufgabenbereiche anderer Vitamine beinhalten z. B. den
Oxidationsschutz, die Regulation der Genexpression, oder
die Signaltransduktion im Auge.
Man teilt die verschiedenen Vitamine in zwei Gruppen ein:
wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine.
Zu den fettlöslichen Vitaminen zählt man die Vi tamine A, D,
E, K (Merkhilfe: EDEKA), alle übrigen sind wasserlöslich.
Hypo- und Hypervitaminosen
Wird dem Körper zu wenig eines Vitamins zugeführt, so kann
dies zu einer Hypovitaminose, oder im schlimmsten Fall
zu einer lebensbedrohlichen Avitaminose führen. Dies kann
als Folge einer unzureichenden, einseitigen Ernährung oder
aufgrundvon Resorptionsstörungen auftreten, kommt aber
heutzutage in unseren Breiten selten vor, zumal der Tages·
bedarf an Vitaminen nur sehr gering ist (0,005- 60 mg).
Während die Symptome eines geringfügigen Vitaminmangels
eherunspezifisch sind (z. B. Abgeschlagenheit, Konzentra
tionsstörungen, Schwindel), können ausgeprägte Hypo·
oder Avitaminosen zu schweren Symptomen füh ren, die für
das jeweil ige Vita min spezifi sch sind.
Erhält der Körper zu große Mengen eines Vitamins, so kann
dies schädigende Wi rkungen zur Folge haben . Diesen Zu·
stand bezeichnet man als Hypervitaminose. Hypervitamino
sen kommen allerdings sehr sel ten vor und können nur bei
fettlöslichen Vitaminen auftreten, da die überschüssigen
wasserlöslichen Vitamine bei "Überdosierung" über die Niere
ausgeschieden werden .
Einen Überblick über die einzelnen Vitamine, deren Vorkom
men, Funktion und Mangelerkrankungen gibt I Tabelle 1.
Fettlösliche Vitamine
Als lipophile Moleküle werden für die Resorption der fett·
löslichen Vi tamine Gallensäuren benötigt. Sind davon nicht
ausreichend vorhanden, so kann dies zu Mangelzuständen
führen.
Reti nol (Vitamin A) Das Retinolleitet sich chemisch von den Isoprenaiden ab.
Es kann über die Nahrung entweder direkt oder in Form der
Karotinoid e(= Provitamine) aufgenommen werden.
Es gibt drei biologisch aktive Formen des Vitamin A:
..,.. Das Retinol sorgt für die Stabilisierung biologischer
Membranen, insbesond ere der Epithelze llen von Haut und
Schleimhäuten.
..,.. Das Retinoat hat Ein fiuss auf Wachstum, Differenzierung
und Embryogenese, indem es die Proteinsynthese und die
Mitoserate antreibt.
Vitamin Funktion BedarfjTag Vorkommen Mangelerkrankung
Fettlösliche Vitamine
A (Retinol ) Signa ltransduktion, Epithelstabilisierung 1,5- 2mg Karotten, Tomaten, Grünpflanzen, Fischöl, Eigelb, Leber Nachtblindheit , Xerophthalmie
D (Calciferol) Ca2 ' -Stoffwechsel 0,02 mg Leber, Tierfett, Milchprodukte Rachitits, Osteomalazie
E (T ocopherol) Oxidationsschutz 20 mg Getreide, Nüsse, Öle, Sojabohnen Muskelschwäche
K (Phyllochinon) Bildung von Faktoren der Blutgerinnung 1- 2 mg Leber, Nüsse, Grünpflanzen Hämorrhagische Diathese
Wasserlösliche Vitamine
C (Ascorbinsäure) Oxidationsschutz, Coenzym 60 - 100 mg Obst, Paprika, Sa lat, Innereien Skorbut
B, (Thiamin) Coenzym 1,5- 2 mg Hefe, Getreide, Nüsse, Eigelb, Innereien Beri-Beri, Polyneuritis
B, (Pyridoxin) Coenzym 2- 4 mg Getreide, Hefe, Sojabohnen, Obst, Nüsse, Innereien Neuritis, Krämpfe
B" (Cobalamin) Coenzym 0,003 mg Eier, Fleisch Pern iziöse Anämie
Vitamin·B2-Komplex
Riboflavin Coenzym 1,5- 2 mg Pilze, Salat, Tomaten, Innereien Dermatitis, Schleimhautentzündungen
Nikotinamid Coenzym t0 - 20 mg Hefe, Ge treide, Pilze, Nüsse, Innereien Pellagra
Pantothensäure Coenzym tO mg Hefe, Getreide, Nüsse, Eier, Innereien Graue Haare, .. burn lng-foe t-syndrome"
Folsäure (Vit. M) Coenzym 0,3 - 1 mg Anämie
Biotin (Vit. H) Coenzym 0, 15- 0,3 mg D rma tltis
I Tab . 1: Überblick über die Vitamine
~ Das Retinal bildet als 11-cis-Retina! zusammen mit dem Protein Opsin das Rhodopsin (Sehpurpur), welches als lichtempfindlicher Stoff für den Sehprozess von bedeutender Rolle ist.
Das Retina! und das Retinaliassen sich durch eine Alkoholdehydrogenase reversibel ineinander umwandeln (I Abb. I). Bei Vitamin-A-Mangel kommt es infolge der verlangsamten Regeneration des Sehpurpurs zu einer verminderten Lichtempfindlichkeit der Sehstäbchen, was eine Nachtblindheit zur Folge hat Außerdem kann die Hypovitaminose zu Verhornungsstörungen des Epithels führen, wie Hyperkeratosen oder Xerophthalmie.
Calciferol (Vitamin D) Die wichtigsten Vertreter der D-Vitamine (Calciferole) sind das Vitamin D2 (Ergocalciferol) und das Vitamin D3 {Cholecalciferol), wobei nur Letzteres im menschlichen Körper synthetisiert werden kann und deshalb für uns die größere Rolle spielt. Das Cholecalciferol entsteht aus seinem Provitamin, dem 7-Dehydrocholesterol, das in der Leber aus Cholesterin gebildet wird . Im Aufbau und in seiner Funktion weist es eine große Ähnlichkeit zu den Steroidhor-
Retina I
Dehydrogenase ------~ NADH + H (l)
~NAD0 Ht1H
~ ~ ~ 'oH
Retinol
I Abb. 1: Reversible Umwandlung von Retinol zu Retinal
Grundlagen 16 I 17
monen auf. Inzwischen ist man sogar soweit, dass man die aktive Form des Vitamin D, das I ,25-Dehydroxycholecalciferol {= Kalzitriol), eher zu den Hormonen zählt als zu den Vitaminen. Man hat es ursprünglich als Vitamin klassifiziert, da man davon ausging, dass das endogen gebildete Cholecalciferol, dessen Synthese UV-Licht-abhängig ist, nicht ausreicht und man es deshalb zusätzlich über die Nahrung aufnehmen muss. Inzwischen kommt man aber immer mehr von der Vorstellung ab. Deshalb besprechen wir Biosynthese, Wirkungen und Mangelerscheinungen ausführlicher in Kapitel86.
Phyllochinone (Vitamin K) Das Vitamin K {I Abb. 2) leitet sich vom 2-Methyl-1 ,4-Naphthochinon (= Menadion) ab. Es gibt zwei Wege, wie der Mensch an Vitamin K kommt: Es ist nicht nur in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten, sondern wird auch von den Bakterien unserer Darmflora synthetisiert. Die aktive Form ist das Difarnesyl-Naphtochinon, das die y-Carboxylierung von Glut· amylrestender Gerinnungfaktoren II, VII, IX und X katalysiert, und somit essenziell für eine funktionierende Blutgerinnung ist. Ein Mangel an Vitamin K führt daher zu Blutungen, und kann Folge sein von Malabsorptionssyndromen, Lebererkrankungen (Vitamin K wird in der Leber gespeichert) und der Einnahme von Vitamin-K-Antagonisten (=Cumarine). Besonders gefährdet sind auch Neugeborene, die noch keine ausreichend funktionsfähige Darmflora besitzen und daher nach Geburt eine Vitamin-K-Prophylaxe erhalten.
Tocopherol (VitaminE) Das Tocopherol wirkt antioxidantisch und dient dem Schutz von ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A und Thiolgruppen vor Oxidation, wobei es selbst oxidiert wird. Ein Mangel an VitaminE zieht eherunspezifische Symptome mit sich. Bei schwerem Mangel kann es zu Störungen der neuromuskulären Übertragung kommen.
0
I Abb. 2: Vitamin K
Vitamine II
Wasserlösliche Vitamine
Werden mehr wasserlösliche Vitamine
zugeführt als benötigt, so werden die
überschüssigen Vitamine über die Niere
ausgeschieden. Es kann also nicht zu
einer Hypervitaminose kommen.
Thiamin (Vitamin B1)
Thiamin besteht aus einem Pyrimidin
und einem Thiazolring, und wird in
der Leber in seine aktive Form, dem
Thiaminpyrophosphat (TPP), überführt.
Es ist als Coenzym an dehydrierenden
Decarboxylierungen von a·Ketosäuren
(Pyruvat-Dehydrogenase, a-Ketogluta
rat-Dehydrogenase) und an der Trans
ketolase-Reaktion des Pentosephosphat
wegs beteiligt. Ein Vitamin-B1-Mangel kann zum Beri
Beri-Syndrom führen, das durch neu
rologische Störungen, Herzinsuffizienz
und Ödeme gekennzeichnet ist Bei
chronischem Alkoholabusus kommt es
häufig zu Thiamin-Mangel, welcher im
schlimmsten Fall in einer Wernicke
Enzephalopathie münden kann, bei
der die Patienten unter schwerwiegen·
den neurologischen und psychiatrischen
Symptomen leiden.
Vitamin 82-Komplex Die im Folgenden beschriebenen
Vitamine kann man zum Vitamin-82-
Komplex zusammenfassen:
Riboflavin: Das Riboflavin ist Bestand
teil der für zahlreiche Reaktionen
wichtigen Flavinocoenzyme FMN (Fla
vinmononukleotid) und FAD (Flavin
adenindinukleotid). FMN wirkt als
Wasserstoffüberträger in der Atmungs
kette und FAD ist an Reaktionen der
ß-Oxidation, des Purinbasen-Abbaus,
des Citratzyklus, sowie an der Pyruvat
dehydrogenase-Reaktion beteiligt.
Nikotin(säure)amid: Das Nikotin
amid ist Baustein der beiden wichtigen
wasserstoffübertragenden Coenzyme NAD+ und NADP+. Diese sind Reakti
onspartner in bedeutenden Redoxreak
tionen, u. a. des Citratzyklus, der ß-Oxi
dation und anderer Stoffwechselwege.
Der Körper kann Nikotinamid aus der
essentiellen Aminosäure Tryptophan
herstellen, was zur Folge hat, dass das
Mangel-Syndrom Pellagra, meis t erst
bei einem kombinierten Tryptophan
und Nikotinamid-Mangel auftri tt. Dieses
ist gekennzeichnet durch "die drei Os" :
Demenz, Dermatitis und Diarrhö.
Biotin: Biotin ist Coenzym aller Carb·
oxylierungs-Reaktionen. Durch ATP
abhängige Bindung einer C0 2-Gruppe
entsteht das biologisch aktive Carboxy
biotin, das nun die Carboxyl -Gruppe auf
das jeweilige Substrat übertragen kann.
Reaktionen, bei denen Biotin benötigt
wird, sind die Acetyi-CoA-Carboxylase,
die Propionyl -CoA-Carboxylase und die
Pyruvat-Carboxylase. Biotin-Mangeler
krankungen kommen selten vor, da es
auch von Darmbakterien gebildet wi rd,
und äußern sich v. a. in Form von Der
matitiden, neurologischen Symptomen
und Haarausfall.
Pantothensäure: Die Pantothensäure
ist Baustein für Acylcarrierproteine der
Fettsäuresynthese und für das Coenzym
A. Letzteres ist in der Lage, mit anderen
Stoffen energiereiche Thioesterbindun
gen einzugehen, wodurch diese akti·
vierr werden. Der wichtigste Thioester
ist das Acetyi-CoA, welches Endprodukt
des Kohlenhydrat-, Fett· und Amino
säurestoffwechsels ist. Beim extrem
seltenen Pantothensäuremangel ist v. a.
die Pyruvatdehydrogenase- Reaktion
betroffen, da diese einen besonders hohen CoA-SH-Bedarf hat. Es kommt
zum Wachstumssti llstand, zur Ergrau
ung der Haare und zum "Burning fee t" ·
Syndrom.
Folsäure: Die biologisch aktive Form
der Folsäure (I Abb. 3) ist die Tetrahy
drofolsäure (TH4, THF), die für Über
tragungen von Cl -Resten {Methyl -,
Hydroxyl-, Formyl- und Formiat-Reste)
notwendig ist. Solche Übertragungen
fi nden u. a. bei 1\eaklionen der Purin und Pyrim id inbiosynthese und des
Amino äuresroffwechsels statt, und ein
Mangel an Folsäure macht sich durch
die Störung der Nukleo tid ·ßiosynthese
in erster Linie an Geweben mit hohen
Zellteilungsraten, wie dem Knochen
mark, bemerkbar. Es kann zur megalo blastären Anämie, zur Leuko- und
Thrombopenie od er auch zu Gastriti
den, Dermatitiden und anderen Symptomen kommen.
Pyridoxin (Vi ta min 86)
Das Pyridoxin {= Pyridoxol), dessen
entsprechendes Aldehyd (Pyridoxal)
und das Amin (Pyridoxamin) können
ineinander überführt werden . Aktiv ist
das Vitamin ß0 nach ATP-abhängiger
Phosphorylierung zum Pyridoxa lphos
phat {PALP), welches ein wichtiges Co
enzym des Aminosäurenstoffwechsels
darstellt und die Bildung von biogenen
Aminen und a-Ketosäuren aus Amino
säuren erlaubt. Außerdem ist es an der
Häm·Symhese beteiligt, da das PALP Cofaktor der 8-Aminolävulinsäure
Synthetase ist. Das erklärt, wieso ein
Pyridoxin-Mangel zu einer hypochromen Anämie führ t.
Cobalamin (Vitamin Bd Methylcobalamin und Adenosylcobal
amin sind die beiden Formen, in denen
obalamin seine Fu nktion als Coenzvrn
ausübt. Für drei Reaktionen wird das Vitamin B12 benötigt:
~ Synthese von Methionin aus Ho
mocystein durch Übertragung einer
Methylgruppe, ~ Umlagerung von Methylmalonyi-CoA
zu Succinyi-CoA: Methylmalonyi-CoA
entsteht beim Abbau von Propionsäure
die wiederum beim Abbau ungerader '
Fettsäuren gebildet wird . Das entstande-
: H 0 ; COOH
: 1-o-11: I N CH ~N f ~ C ' N- CH N:x :r 2
: : I I I I : - : H CH2 ~ ~ , , I
H2N N N : : CH ' ' 2 : : I : : COOH
Pteridinrest p-Aminobenzosäure Glutaminsäure I Abb. 3: Fol äure
ne Succinyl-CoA kann nun in den Citratzyklus eingeschleust werden. ...,. Umlagerung von a-Leucin zu ß-Leucin.
Das Cobalamln Ist eng mit der Folsäure verstrickt Bei der Übertragung der Methylgruppe auf das Homocysteln wird Methyltetrahydrofolsäure zu aktiver Tetrahydrofolsäure regeneriert. Ein Cobalaminmangel führt somit iiber lingere Zeit auch zum Mangel an aktiver Folsäure, was wiederum zu einer rnegaloblastiren Animle führt. Ist diese ursprOngllch auf Cobalamln-Mangel zurückzuführen; spricht man von einer pctmlzlösen Anämie.
Eine weitere Folge eines Vitamin B12-
Mangels kann eine funikuläre Myelose sein, eine Degeneration der Hinterund Seitenstränge des Rückenmarks.
Ascorbinsäure (Vitamin C) Neben ihrer stark reduzierenden Wirkung, durch die sie Hämoglobin, verschiedene Enzyme und Coenzyme vor Oxidation schützt, besitzt die Ascorbinsäure außerdem selbst coenzymatische Fähigkeiten. Sie ist u. a. am Aufbau von Kollagen, an der Noradrenalin-Synthese sowie an der Bildung von Tetrahydro· folat (THF) aus Folsäure beteiligt. Eine Hypovitaminose führt zur Mangelerkrankung Skorbut, bei der die Störung der Bindegewebssynthese im Vordergrund steht, was zu einer allgemeinen Blutungsneigung, Zahnausfall und verzögerter Wundheilung führt. Ein Ascorbinsäure-Mangel geht nicht selten mit einem Eisenmangel einher, da Vitamin C das dreiwertige Eisen aus der Nahrung in das besser resorbierbare Fe2+
reduziert.
--------------------------------~- -~--~~~
Antivitamine
ln der Klinik werden häufig Vitaminanaloga, sog. Antivitamine, eingesetzt. Das sind Stoffe, die strukturelle Ähnlichkeiten zu Vitaminen aufweisen, aber keine biologische Wirkung entfalten. Es kommt zu einer kompetitiven Hemmung. Die wichtigsten Antivitamine sind:
,.,.. Folsäureantagonisten: Es gibt in der Klinik zwei Einsatzorte für Folsäureinhibitoren. Zum einen kommen sie als Zytostatika in der Tumortherapie zum Einsatz. Methotrexat hemmt die Bildung von THF, wodurch es zur Störung der DNA-Synthese kommt und die Zellteilung besonders bei schnell wachsenden Tumoren beeinträchtigt wird. Das zweite Einsatzgebiet für Folsäureantagonisten ist die antibakterielle
Gru ndlagen 18 I 19
Therapie. Sulfonamide hemmen die Folsäuresynthese in Bakterien, Trimethoprim und Aminopterin hemmen die bakterielle Dihydrofolat-Reduktase (I Abb. 4). Sie sind bakteriostatisch wirkende Antibiotika. ,.,.. Vitamin-K-Antagonisten: Cumarinderivate wie Marcumar® hemmen Vitamin K kompetitiv. Dadurch kommt es zu einer Gerinnungsstörung, die erst einsetzt, nachdem die noch vorhandenen Gerinnungsfaktoren verbraucht sind. Daher wirken Cumarine erst nach ca. 3- 4 Tagen. Eingesetzt werden Vitamin-K-Antagonisten zur Infarkt- und Thromboseprophylaxe. Zur Kontrolle der Dosierung verwendet man den INR-Wert (International Normalized Ratio] oder den etwas veralteten Quick-Wert. Einer Überdosierung kann mit Vitamin-K-Gabe entgegen gewirkt werden.
NADPH + HCll NADPCll NADPH + He NADPe
Folsäure ~ 1 } ~ 7,8-Dihydrofolsäure ~ r } ~ 5,6,7,8-Tetrahydrofolat
I
Folatreduktase
I
Dihydro7 duktase
Hemmung durch Folsäureantagonisten
I Abb. 4: Wirkprinzip der Folsäureantagonisten
Zusammenfassung X Bei den Vitaminen kann man wasserlösliche von fettlöslichen unterschei
den. Zu den fettlöslichen zählt man die Vitamine A, D, E und K ("EDEKA"),
die übrigen sind wasserlöslich.
X Hypovitaminosen treten insgesamt selten auf und sind bei uns meist Folge
von Absorptionsstörungen und seltener von Mangelernährung.
X Vitamine nehmen verschiedenste Aufgaben wahr, die meisten von ihnen
sind aber als Coenzyme an Reaktionen beteiligt.
X Drei Anämieformen können bei Vitaminmangel vorkommen: Mangel an
Pyridoxalphosphal führt zur hypochromen Anämie, Folsäuremangel zu
einer megaloblastären Anämie und Cobalaminmangel zur perniziösen
Anämie. Die Formen sollte man nicht durcheinanderbringen!
X Antivitamine sind Vitaminanaloga (z. B. Folsäureantagonisten und Vitamin
K-Antagonisten), die Vitamine kompetitiv hemmen, und deren Effekte im
klinischen Alltag genutzt werden.
Säure-Basen-Haushalt
Unter dem Säure-Basen-Haushal t versteht man versch iedene
Regelmechanismen des Körpers, die dafür sorgen, dass der
pH-Bereich, also die Protonenkonzenuation im Extrazellulär
raum in einem gewissen Bereich gehalten wird. Außerhalb
dieses Bereichs (bei Schwankungen von einem Wert ab 0,3)
könnten viele Enzyme nicht arbei ten und wir könn ten nicht
überleben.
Puffersysteme
In unserem Blut gibt es mehrere Puffersysteme, die dafür
zuständig sind, den pH -Wert in unserem Blut uotz einer
Änderung der Protonenkonzentration konstant zu halten
(I Tab. 1). Das Prinzip ist bei allen diesen Systemen ähnlich. Eine Kom
bination aus einer Säure und der dazugehörigen Base
nimmt Protonen auf, wenn deren Konzentration steigt und
somit der pH-Wert fällt. Bei sinkender Protonenkonzentra
tion, also einer drohenden Alkalose gibt das System Protonen
ab. Puffersysteme bestehen stets aus einer schwachen Säure
und der zugehörigen Base.
Doch nun zu den verschiedenen Systemen, die im mensch
lichen Körper eine Konstanthaltung des pH-Werts ermögli
chen.
Bicarbonat
Dieser Puffer ist das wichtigste System, um den Blut-pH-Wert
im physiologischen Rahmen zu halten. Er übernimmt 65%
der gesamten Pufferkapazität des Bluts.
C02 + H20 ~ H2C03 ~ HC03- + H+
Auf der einen Seite der von der Carboanhydrase angetriebe
nen Reaktionsgleichung sind Kohlendioxid (C02) und Wasser
(H20). Diese reagieren über die Aufnahme eines Protons (H+)
zur flüchtigen Kohlensäure (H2C03), die sofort zu Bicarbonat
(HC03- ) und einem Proton (H+) zerfällt.
Puffersystem Si ure Base Anteil am Geaamtpufferayatem
Bicarbonat H,CO, HCO,- ca. 50%
Hämoglobin HbO, Hb- ca. 30%
Proteine Protein Salz des Proteins ca . 15%
Phosphal H2P04 HPO,'- ca. 2%
I Tab. 1: Die verschiedenen Puffersysteme des Blutes
Bei einem Überschuss an Prownen im Blut wird das Gleich
gewicht der Rea ktion nach links, also auf die Seite von Koh
lenstoffdioxid und Wasser verschoben, die Protonen werden
gepufferr und der pH-Wert bleibt konstant ansratr zu sinken
Das entstehende co2 wird abgeatmet, es kommt ZU einer -
Hyperventi lalion.
Bei einer Verschiebung des Blut-pH -Werts in die andere
also die alka lische Richtung wird. der Protonenmangel a~sge. gl;chen , tndem d;e Reakuon m d;e andere Richtung abläuft.
Das Gleichgewicht wird au f die rech te Seite verschoben und
die Zahl der Protonen im Blut erhöh t. Um die Kohlenstoff
diox idkonzentration im Blut trotzdem konstant zu halten
wird kompensatorisch die Atemfrequenz erniedrigt, es fin,det
eine Hypoventilation sta tt.
Hämoglobin
Der rote Blutfarbstoff Hämoglobin (Hb) ist das zweitwichtigs
te Puffersystem in unserem Körper. Mit Sauerstoff beladenes
Hämoglobin ist eine stärkere Säure als die desoxygenierte
Form. ln der oxygenierten Form kann das Hämoglobin also
auch als Protonendonator fungieren und einen alkalischen
Blu t-pH-Wert ausgleichen. Bei einer drohenden Azidose Wird
das Gleichgewicht des Hämoglobins auf die mi t Sauerstoff be
ladene Seite verschoben, es können Protonen aufgenommen
werden.
Proteine
Hierunter versteht man alle Plasmaproteine. Diese liegen
beim physiologischen pH-Wert des Blu tes in deprotonierter
Form vor. Bei einem Protonenanstieg im Blut, also bei sinken
dem pH -Wert, werden die Proteine protoniert - sie nehmen
Protonen auf und der pH-Wert kann konstantgehalten wer
den.
Phosphat
Dieser Puffer macht nur einen geringen Anteil der Cesamt
pufferkapazität des Blutplasmas aus. Bei Protonenüberschuss
wird das Gleichgewicht wiederum auf die Seite der Säure
H2P04 , dem Dihydrogen-Phosphat verschoben, indem Pro
tonen aufgenommen werden. Bei Protonenmangel werden
diese abgegeben, das Gleichgewicht verschiebt sich zur Seite
des Hydrogenphosphats HPO/ .
Störungen des Säure-Basen-Haushalts
Ein Überschuss oder ein Mangel an Protonen im Blut kann
viele verschiedene Ursachen haben (I Tab. 2).
Protonenüberschuss: Azidose
Von einer Azidose spricht man ab einem pH, der kleiner als
7,36 ist. Eine Protonenüberlastung des Körp rs kann ihre
Ursache in der Nahrung haben, so z. B. bei stark m Verzehr
Blutgase Ursache Kompensation
Respiratorische CO, ern iedrigt Hyperventilation Protonenzufuhr über Alkalose HCO; Ieicht erniedrigt die Niere
Respiratorische CO, leicht erhöht Hypoventilation Protoneneliminie-Azidose HCO,· erhöht rung durch die Niere
Metabolische CO, erhöht Erbrechen, Hypoventilation Alkalose HCO,- Ieicht erhöht Diuretika
Metabolische CO, leicht erniedrigt Diabetes mellitus, Hyperventilation Azidose HCO,· erniedrigt Laktatazidose
I Tab. 2: Übersicht über die Störungen des Säure-Base-Haushalts
von Lebensmitteln, die viel Säure enthalten, oder auch bei einer proteinreichen Ernährung. Schwefelhaltige Aminosäu· ren verursachen die Protonenbelastung. Die Säurebelastung durch die Nahrung kann der Körper jedoch zumeist über die Organe ausgleichen.
Metabol ische Azidose Auf den verschiedenen Stoffwechselwegen kommt es zur Bildung von Protonen. Ein Überschuss kommt allerdings nur zustande, wenn die Stoffwechselprodukte nicht weiter abge· baut werden können. Mögliche Gründe hierfür können sein:
lll> Laktat: Bei der Glykolyse (s. Kap. 54) kommt es unter anaeroben Bedingungen zur Bildung von Laktat, das ohne Sauerstoff nicht in Pyruvat umgewandelt werden kann. Anaerobe Bedingungen findet man beispielsweise bei Sprintern. Der Laktatspiegel steigt, und es kommt zu einer Protonenbelastung des Körpers. Man spricht von einer Laktatazidose. lll> Ketonkörper: Durch einen verstärkten Abbau von Fettsäuren (s. Kap. 68) kommt es zu einer Anreicherung des Acetyl-CoA im Blut. Dies kann durch längere Nahrungskarenz verursacht sein, aber auch durch die Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus (s. Kap. 94 und 96 ). Der Körper ist nicht in der Lage, das vermehrt anfallende Produkt im Citratzyklus abzubauen, und es kommt zu einer Umwandlung in die
Grundlagen 20 I 21
Ketonkörper Acetessigsäure sowie 3-Hydroxy-Buttersäure. Diese liegen im Blut in saurer Form vor, geben Protonen ab, und es kommt zu einer sogenannten Ketoazidose.
Respiratorisc he Azidose Bei einer alveolären Hypoventilation kommt es zu einem primären Anstieg des C02• Ursachen für eine solche respirato· rische Azidose kann z. B. eine chronische Bronchitis (COPD) sein.
Protonenmangel: Alkalose
Ab einer Erhöhung des pH-Werts des Bluts über einen Wert von 7,44 spricht man von einer Alkalose. Diese kann wiederum unterschiedliche Gründe haben, die sowohl durch den Stoffwechsel bedingt als auch respiratorisch sein können:
Metabol ische Alkalose Hier liegt, meist aufgrund einer vermehrten Protonenausscheidung, eine erhöhte Bicarbonatkonzentration vor. Mögliche Ursachen:
lll> Häufiges Erbrechen führt über einen Verlust von saurem Magensaft zu einem ProtonenmangeL lll> Die Einnahme von Diuretika (Medikamente, die die Ausscheidung über die Niere fördern) kann über einen Kaliummangel zu einer Alkalose führen.
Respiratorische Alkalose Eine respiratorische Alkalose kommt durch einen Abfall des C02 zustande. Dieser liegt bei einer alveolären Hyperventilation vor. Mögliche Ursachen für eine Hyperventilation sind:
lll> Stimulation des Atemzentrums durch Medikamente, psychogene Ursachen, Fieber, Sepsis etc., lll> Sauerstoffmangel (Hypoxie) beispielsweise in großer Höhe. Dies führt zu einer Stimulation peripherer Chemorezeptoren und so zu einer Hyperventilation.
Zusammenfassung X Verschiedene Puffersysteme im menschlichen Blutplasma sind dafür
zuständig, den pH-Wert in einem physiologischen Ra hmen zu halten.
Der optimale pH-Wert des Bluts liegt bei 7 ,41.
X Der wichtigste Puffer ist das Bicarbonat, ein offenes Puffersystem,
das mit der Atmung in Verbindung steht.
• Eine Azidose entsteht bei einem Protonenüberschuss, eine Alkalose bei
einem ProtonenmangeL Beide können sowohl respiratorische als auch
metabolische Ursachen haben. Bis zu einem gewissen Ausmaß können
diese Störungen des Säure-Base-Haushalts über die Puffersysteme oder
die Atmung kompensiert werden.
Aminosäuren und Proteine
24 Aminosäuren 26 Peptide und Proteine
28 Aminosäure- und Proteinmetabolismus I
30 Aminosäure- und Proteinmetabolismus II
Genetik
32 Stoffwechsel der Nukleotide I
34 Stoffwechsel der Nukleotide II
36 Nukleinsäuren, Desoxyribonukleinsäure (DNA)
38 Replikation der DNA
40 Transkription 42 Translation 44 Prozessierung und Zielsteuerung
von Proteinen 46 Regulation von Zellwachstum und
Genexpression 48 DNA-Schäden, Reparatur und
Onkogenese 50 Gentechnologie
Kohlenhydratstoffwechsel
52 Kohlenhydrate
54 Glykolyse 56 Glukoneogenese 58 Glykogenstoffwechsel
60 Pentosephosphatweg
Lipidstoffwechsel
62 Fettsäuren und Lipide I
64 Fettsäuren und Lipide II
66 Biosynthese der Fettsäuren und
Triacylglycerine
68 Abbau der Neutralfette und
Fettsäuren 70 Ketonkörper 72 Cholesterin 74 Lipoproteine
Energiegewinnung
76 Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion
und Citratzyklus
78 Atmungskette und AlP-Synthese
Hormone und Zytokine
80 Grundlagen der interzellulären
Kommunikation 82 Hypothalamus-hypophysäres System
84 Schilddrüsenhormone
86 Regulation des Kalzium- und
Phosphathaushalts 88 Hormone des Nebennierenmarks:
Adrenalin und Noradrenalin
90 Hormone der Nebennierenrinde I
92 Hormone der Nebennierenrinde II
94 Hormone der Bauchspeicheldrüse I
96 Hormone der Bauchspeicheldrüse II
98 Eicosanoide und Zytokine
Immunsystem
100 Grundlagen 102 Zellen des Immunsystems
104 Humorale Abwehr I 106 Humorale Abwehr II
1 08 Antigene 110 Rolle des Immunsystems in der Klinik
Blut
112 Grundlagen 114 Hämoglobin I 116 Hämoglobin II 118 Erythrozyten 120 Blutstillung und Gerinnung
Spezielle Biochemie der
verschiedenen Organe
122 Leber 124 Niere 126 Verdauungsorgane I
128 Verdauungsorgane II
130 Das Muskelgewebe
132 Das Nervensystem 134 Das Binde- und Stützgewebe
Aminosäuren
Aminosäuren sind Moleküle, die zwei funktionelle Gruppen besitzen: eine Carboxylgruppe (COOH) und eine Aminogruppe (NH2). Man unterscheidet zwei Arten von Aminosäuren:
..". Proteinogene Aminosäuren, die die Bausteine der Proteine sind, und ..". Nicht-proteinogene Aminosäuren, die andere Aufgaben im Körper übernehmen. Beispiele fü r Letztere sind Ornithin und Citrull in, die uns im Harnstoffzyklus wieder begegnen werden, sowie y-Aminobuttersäure (= GABA), die als Transmitter im ZNS fungiert
In diesem Kapitel werden wir uns vorwiegend mit den proteinogenen Aminosäuren beschäftigen.
Proteinogene Aminosäuren
Von den über 1 00 vorkommenden Aminosäuren werden nur 20 (bzw. 21 mit der seltenen Aminosäure Selenocystein) für den Aufbau von Proteinen verwendet
Struktur
Alle proteinogenen Aminosäuren sind a -L-Aminosäuren und weisen eine ähnliche Struktur mit einer Aminosäuregruppe auf, wie sie in I Abbildu ng 1
dargestellt ist. Aus der Nomenklatur ist herauszulesen, dass sie alle die Aminogruppe (NH2) an dem a -Kohlenstoff tragen und dass diese links vom a-C-Atom steht [L-lsomer) . Bei D-Aminosäuren dagegen würde die NH2-Gruppe rechts stehen (D-Isomer) . Diese Unterscheidung ergibt sich dadurch, dass das a -Kohlenstoffatom ein Chiralitätszentrum bildet, an dem vier unterschiedliche Substituenten gebunden sind. Eine Ausnahme stellt das Glycin dar, das als Rest nur ein Wasserstoffatom trägt Weiterhin sollte man wissen , dass für jede proteinogene Aminosäure auch Abkürzungen in Form eines Drei-Buch-
COOH I
H2N-C-H I R
I Abb. 1: Struktur der
proteinogenen Aminosäu ren
staben bzw. Ein-Buchstaben-Codes gebräuchl ich si nd.
Alle proteinogenen Aminosluren sind a-l-Amlnosluren mit einer typlachen Struktur: Am a-C-Atom sind eine Aminopppe, eine Carboxylgruppe, ein Wasserstoff, und ein Rest &ebunden,in dem sich die verschiedenen Aminosluren unterscheiden.
Einteilung
Man kann die proteinogenen Aminosäuren in aliphatische, aromatische und heterozyklische Aminosäuren ein te ilen. Bei den aliphatischen Aminosäuren unterscheidet man außerdem, ob diese neutral oder geladen (sauer oder basisch) sind.
Aliphatische Aminosäuren Als aliphatisch bezeichnet man Aminosäuren, die eine Kettenstruktur besitzen. Zu den neutralen, aliphatischen Aminosäuren gehören Glycin [Gly), Alanin [Ala), Serin (Ser), Threonin [Thr), Valin (Val), Leuein (Leu) und Isoleuein [Ile), sowie die schwefelhal tigen Aminosäuren Methionin (Met), Cystein ( Cys) und das Cystin [ CysCys), das entsteht, wenn sich zwei Moleküle Cystein über eine Disul fidbrücke miteinander verbinden. Ferner zählt man Asparagin (Asn) und Glutamin (Gin) zu den ungeladenen aliphatischen Aminosäuren. Diese stellen allerdings nur die zwei Säureamide der sauren Aminosäuren Aspartat [Asp) und Glutamat (Glu) dar, weshalb man sie in der Liste der 20 Aminosäuren nicht extra dazuzählt Sie tragen anstelle der zusätzlichen Carboxylgruppe von Aspartat und Glutamat eine Carboxyamidgruppe. Neben den beiden sau ren Aminosäuren, gibt es auch basische aliphatische Aminosäuren, die mehr als eine NH2-Gruppe tragen. Dazu gehören das Arginin (Arg), Lysin (Lys) und Hydroxylysin (Hyl).
Aromatische Aminosäuren Diese enthalten in ihrer Struktur einen aromatischen Ring. Die zwei Vertreter dieser Gruppe sind das Phenylalanin (Phe) und das Tyrosin [Tyr) .
Heterozyklische Am inosäuren An der Ri ngbildung heterozyklischer Aminosäuren sind neben dem Kohlen stoff noch andere Elemente beteiligt. Zu ihnen zählt man das Histidin (H is) welches eine Imidazotgruppe enthält '
' das lndolgruppe- haltige Tryptophan [Trp), sowie das Prolin (Pro) . Prolin nimmt insgesamt eine Sonderstell ung bei den Aminosäuren ein, da es eigentlich eine lminosäure ist. Es bildet zwischen der a -Aminogruppe und seiner Seitenkette einen Ri ng aus, wodurch d ie Amidgruppe verdeckt erscheint. Dieser Pyrrolidinring wirkt sich auf die räumliche Stru ktur von Prolin-haltigen Proteinen und Peptiden aus. Das Selenocystein, das erst vor einigen Jahren entdeckt worden ist, kommt nicht in freier Form vor, sondern nur als Bestandteil sehr weniger Proteine wie z. 8. der Glutathion-Peroxidase ' oder der Thyroxin-Deiodase. Deshalb ist es normalerweise nicht in der Liste proteinogener Aminosäuren mit aufgeführ t. Eine Übersicht über die 20 proteinogenen Aminosäuren gibt I Abbildung 2.
Eigenschaften
Essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren Nicht alle proteinogenen Aminosäuren kann der Körper selbst synthetisieren. Acht von ihnen müssen mit der Nahrung aufgenommen werden und sind fo lglich essentiell. Andere wiederum sind nur in bestimmten Situationen essenziell , so sind beispielsweise Arginin und Histidin im Säuglingsalter essenzielL
Wasserlöslichkeit Ob eine Aminosäure wasser-oder fettlöslich ist, hängt im Wesentlichen von ihrer Se itenkette ab. Hydroph il sind vor allem Aminosäuren, die in ihrer Seitenkette Stickstoff- oder Sauerstoffa tome
Aminosäuren und Proteine 241 25
coo- coo [UNPOIARl coo- H 3N•-~-H HJN•-t-H
I Abb . 2: Die 20 protein
ogenen Aminosäuren
im Überblick
lierung des Glutamats ist Vitamin-Kabhängig.
H3N'-~ - H I I
coo- coo- THz CH-CHJ
H 3N'-~- H H 3 N•-~-H I I CH-CHJ CH-CHJ CH2
I I I I I H CH 3 CH3 CH3 CHJ
Glycin Alanin Valin Leuein Isoleuein
Ampholytcharakter der Aminosäuren Aminosäuren sind Ampholyte, d. h. sie können Protonen sowohl aufnehmen als auch abgeben. Sie besitzen diese Eigenschaft, weil sie sowohl eine basische Aminogruppe als auch eine saure Carboxylgruppe enthalten. Im pH-Bereich von ca. 5-8, und damit auch bei physiologischem pH ( ca. 7,4], liegen die neutralen Aminosäuren als Zwitterionen vor, d. h. die Carboxylgruppe liegt als Anion vor (COO-] und kann ein H+ aufnehmen (Baseneigenschaft) und die Aminogruppe liegt als Kation vor (NH/ ] und kann ein H+ abgeben (Säureeigenschaft]. In einer sauren Lösung halten beide funktionelle Gruppen ihre Protonen (COOH und NH3 ' ), während sie in einer basischen Lösung beide deprotoniert (als COO- und NH2] vorliegen.
f POLAR l coo- coo-ungeladen HJN' - t - H coo- H3N•-~-H
I I CHz
HJN'-t-H CH2 coo- coo- coo- I I
H3N'-~-H H3 N•-~-H HJN'-t-H I
CH2 CHz CHz I I I I I I CHz CH-OH CHz s C=O C=O I I I I I I OH CH3 SH CHJ NHz NHz
Serin Threonin Cyslein Methionin Asparagin Glutamin
positiv geladen negat iv geladen
coo- coo-
coo- HJN•-t- H HJN' - t - H I I
H3N• - t - H CHz I I coo-CHz CHz
HJN'-t-H I coo-<~ I I CHz CHz HJN• - t - H CHz I I \\__NH I I CH2 NH CH2 CH2 I I I I CH2 C= NH C=O C=O I I I I NHz NHz OH OH
Lysin Arginin Histidin Aspartat Glutamat
fAROMATJSCH] Isoelektrischer Punkt coo
H,N'-t- H
cooH, N'-t - H
cooH ,N'-~-H
Bildet aufgrund seiner zykl ischen Struktur eine Ausnahme:
Der isoelektrische Punkt (IP] entspricht dem pH-Wert, bei dem eine Aminosäure ungeladen vorliegt. Bei neutralen Aminosäuren errechnet er sich aus dem Mittelwert der pK,-Werte der Aminound der Carboxylgruppe. Bei geladenen Aminosäuren muss man zur Berechnung des IP den Mittelwert der pK,Werte der beiden Carboxylgruppen
I I I
6 ~ ~ ~Nv OH
Phenylalanin Tyrosin Tryptophan
tragen, über die sie Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden können:
~ Zu den hydrophilen Aminosäuren zählen Arginin, Lysin, Histidin, Glutamin, Asparagin, Serin, Threonin, Cystein, Aspartat und Glutamat. ~ Hydrophob sind Alanin, Glycin, Valin, Leucin, Isoleuein und Prolin, sowie Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin.
Chemische Modifikationen Nach abgeschlossener Proteinsynthese (Translation] werden die Aminosäurebausteine oft chemisch modifiziert. Dieser Prozess nennt sich posttranslationale Modifikation. Beispiele hierfür sind die Bildung von Hydroxylysin und Hydroxyprolin nach dem Einbau ins Kollagen. Die Mod ifikationen können ganz unterschiedlich aussehen, so kommen auch Phosphorylierungen, Methylierungen, Sulfatierungen oder
Prolin
Carboxylierungen vor. Das y-Carboxyglutamat ist hierfür ein klinisch-relevantes Beispiel, da es Bestandteil wichtiger Gerinnungsfaktoren ist. Diese Carboxy-
Zusammenfassung
(bei sauren Aminosäuren] bzw. der beiden Aminogruppen (bei basischen Aminosäuren] nehmen.
X Es gibt 20 (bzw. 21) proteinogene Aminosäuren. Dies sind Aminosäuren,
die als Bausteine für Proteine dienen.
X Die proteinogenen Aminosäuren sind allesamt a.-L-Aminosäuren und tra
gen an ihrem a.-C-Atom neben einer Carboxylgruppe, einer Aminogruppe
und einem H-Atom, einen spezifischen Rest, durch den sich die Amino
säurenvoneinander unterscheiden.
X Man unterscheidet aliphatische, aromatische und heterozyklische Amino
säuren, sowie essenzielle und nicht-essenzielle. Die essenziellen Amino
säuren sind: Threonin, Valin, Leucin, lsoleucln, Lysin, Methionin, Phenyl
alanin und Tryptophan.
X Aminosäuren sind Ampholyte, d. h. sie liegen bei einem bestimmten pH
Wert (dem isoelektrischen Punkt) ungeladen als sog. Zwitterionen vor.
Peptide und Proteine
Peptide und Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaut, die durch Peptidbindungen miteinander verknüpft sind. So entstehenunverzweigte Ketten mit einer Länge von bis zu I 00 Aminosäuren ( = Peptide) oder von über 1 00 Aminosäuren (=Proteine). Bei den Peptiden unterscheidet man noch mal zwischen Oligopeptiden(< 10 Aminosäuren) und Polypeptiden ( 1 0-1 00 Aminosäuren).
Bindungstypen
Die Peptidbindung
Die Peptidbindung wird auch als Säureamidbindungbezeichnet und entsteht bei Verknüpfung der a-Carboxylgruppe einer Aminosäure mit der a-Arninogruppe einer anderen Aminosäure. Die Knüpfung einer solchen Bindung geschieht unter Wasserabspaltung und benötigt Energie. Peptidbindungen sind planar, obwohl die Stickstoff- und Kohlenstoffatome nur über eine Einfachbindung miteinander verbunden sind, da Elektronenverschiebungen zwischen dem Sauerstoffatom der Carbonylgruppe und dem Stickstoffatom zu einer Einschränkung der Drehbarkeil der Bindung führen. Die Peptidbindung erhält dadurch einen sog. partiellen Doppelbindungscharakter. ln der Regel stehen die zwei a-Kohlenstoffatome der beiden verknüpften Aminosäuren in Bezug auf die Peptidbindung in der trans-Konfiguration zueinander (I Abb. I). Eine Ausnahme bilden Peptidbindungen, an denen die Aminosäure Prolin beteiligt ist. Aufgrund ihrer speziellen Struktur (s. Kap. 24) bevorzugen sie die Cis-Konfiguration.
Weitere wichtige Bindungsformen in Proteinen
Proteine liegen im Raum nicht einfach nur als lange Ketten vor, sondern neh-
(/) Q)
~ Q) ·- -o E c .... w J!l
I z
men verschiedene Raumstrukturen ein (s. u.). Diese kommen unter anderem durch verschiedene Bindungen und Wechselwirkungen zustande.
.,.. Wasserstoffbrückenbindung: Durch elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den Carbonylgruppen und den Wasserstoffatomen der NH2-
Gruppen kommt es innerhalb der Aminosäurekette zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen. Die Bindungsenergie einer Einzelbindung ist zwar nicht so stark (nur ca. 1/ 10 einer kovalenten Bindung), aber aufgrund der großen Menge an H+-Brücken innerhalb eines Proteins ist die gesamte Bindungsenergie doch sehr groß. .,.. Hydrophobe Wechselwirkungen: Durch die energetisch günstigere Zusammenlagerung unpolarer, also hydrophober, Bestandteile kommt diese "Bindung" zustande. .,.. Van der Waalsche-Kräfte: Dies sind Wechselwirkungen zwischen zwei eng benachbarten hydrophoben Kohlenwasserstoffketten, die sich infolge dessen gegenseitig anziehen. .,.. lonenbeziehungen: Zwischen positiv und negativ geladenen Gruppen treten diese Wechselwirkungen auf. .,.. Disulfidbrücken: Diese verbinden die Sulfhydrylgruppen (SH-Gruppen) zweier Cysteinmoleküle (prominentes Beispiel: Insulin).
Räumliche Struktur der Proteine
Wie oben schon erwähnt, bilden Proteine im Raum bestimmte Strukturen aus. Während das "Rückgrat" bestehend aus der Atomsequenz -N-C-C-N-C-C-(1 Abb. I) bei allen Peptiden und Proteinen gleich ist, sind die Seitenketten der verschiedenen Aminosäuren variabel. DieNH-und Carbonyl- Gruppen und die Seitenketten der Aminosäuren können miteinander in Wechselwir-
0 <D m.,
:::J 3 Q_ -· <D :::J ~ (!) (/)
kungen treten und erklären das unterschiedliche räum liche Verhalten der verschiedenen Proteine.
Primärstruktur
Die Sequenz der Aminosäuren eines Proteins bezeichnet man als Primärstruktur. Diese ist auf der DNA kodiert und damit genetisch festgelegt.
Sekundärstruktur
Die Sekundärstruktur der Proteine, die erstma ls von Pauling und Corey beschrieben worden ist, kommt durch Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen (s.o.) zustande. Inzwischen wurde diese Theorie durch Röntgenstrukturanalyse bestätigt. Die wichtigsten Sekundärstrukturen sind die a-Helix: und das ß-Faltblatt, untergeordnete Rollen spielen die ß-Kehre und die eü-Schleife. Ein Protein kann auch über mehrere Strukturen in verschiedenen Bereichen verfügen.
a-Helix: Durch Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den CO- und NH-Gruppen der Aminosäurenkette wird die schraubenförmige Windung der a-Helix-Struktur stabi lisiert. Die Wasserstoffbrücken verbinden jeweils die CO-Gruppe einer Aminosäure mit der NH-Gruppe der vierten auf sie folgenden Aminosäure und verlaufen nahezu parallel zur Achse der a-Helix. Die Seitenketten der Aminosäuren ragen nach außen (I Abb. 2). Pro Windung enthält die a-Helix 3,6 Aminosäuren, die Ganghöhe beträgt 0,54 nm Im Prinzip wären sowohl rechts- als · auch linksgängige Helices möglich, aber da die rechtsgängige a -Helix energetisch günstiger is t, tritt diese Form in der Natur bevorzugt auf. Mehrere Helices können sich zusammenlagern und so Helices mit einer Länge von bis zu 100 nm bilden. Beispiele für solch
I Abb. 1: Peptidbindungen in einer Aminosäurenkett e 121
....
verdrillte Helices sind das Keratin der Haare, Fibrin und Myosin.
ß-Faltblatt: Bei dieser Sekundärstruktur sind zwei oder mehr Peptidketten durch Wasserstoffbrücken miteinander verbunden. Im Gegensatz zur a-Helix sind die Ketten hier nicht gewunden, sondern gestreckt. Die Wasserstoffbrücken führen zur Faltung der Aminosä ureketten in eine Zickzackform, die der Struktur ihren Namen gab. Auch hier ragen die Seitenketten nach außen, dabei liegen sie abwechselnd ober- oder unterhalb der Faltblattebene. Man unterscheidet beim ß-Faltblatt zwischen einer parallelen und einer antiparallelen Struktur, je nachdem ob die einander gegenüberliegenden Peptidketten in die gleiche oder in entgegengesetzter Richtung verlaufen [bezogen auf das C- und das N-Ende).
Tertiärstruktur
Bei der Tertiärstruktur lagern sich die verschiedenen Sekundärstrukturen [a-Helix-, ß-Faltblatt- und Schleifenanteile) eines Proteins so zusammen, dass eine stabile räumliche Gesamtanordnung entsteht. Meistens kommt es hierbei zur Verlagerung der hydrophoben Anteile ins Innere eines Proteins. Diese Struktur kommt durch verschiedene Wechselwirkungen zustande. Neben Wasserstoffbrückenbindungen und hydrophoben Wechselwirkungen sind auch Van-der-Waals-Kräfte und Disulfidbrücken an der Stabilisierung der Tertiärstruktur beteiligt. Oft haben Proteine mehrere Domänen mit z. T. unterschiedlichen Aufgaben . Diese Domänen entstehen bei der Faltung eines Proteins in mehrere abgrenzbare Bereiche.
Quartärstruktur
Bei Proteinen, die aus mehreren Aminosäureketten bestehen, gibt es auch eine Ouartärstruktur. Die einzelnen Aminosäureketten bilden Untereinheiten des Proteins, die un tereinander in Wechselwirkung stehen und sich dadurch wiederum im Raum organisieren. Die räumliche Anordnung dieser einzelnen Untereinheiten bezeichnet man als
Aminosäuren und Proteine 26 I 27
Ouartärstruktur. So nennt man beispielsweise Proteine mit zwei Aminosäureketten [also zwei Untereinheiten) dimere, und solche mit vier Untereinheiten, tetramere Proteine.
Funktionen der Peptide und Proteine
Peptide nehmen im Körper unterschiedlichste Funktionen wahr. Einige wichtige Hormone gehören zur Klasse der Peptide [TRH, CRH, ADH, ACTH, Insulin, Glukagon), sowie die Gewebshormone Bradykinin und Kallidin, und Glutathion, das für den Oxidationsschutz zuständig ist. Auch einige Antibiotika (z. B. Penicillin) und Toxine [z. B. a -Amanitin) sind Peptide. Proteine haben vielfältige Funktionen:
R
~ Als Enzyme sind Proteine für die Katalyse von Stoffwechselprozessen zuständig. ~ Strukturproteine (z. B. Kollagen, Elastin, Keratin) stabilisieren Gewebsstrukturen. ~Aktin und Myosin sind kontraktile Proteine des Muskels, die die Muskelkontraktion und somit Bewegungsabläufe ermöglichen. ~ Membranproteine wie die Na+/ K+ATPase oder der Insulinrezeptor nehmen Aufgaben wie Transport, Signaltransduktion, Zelladhäsion u.v.m. wahr. ~ Immunglobuline, die für die Bindung von Antigenen zuständig sind, sind ebenfalls Proteine. ~ Transportproteine wie Transferrin und Albumin sind für den Transport diverser Substanzen im Blutplasma erforderlich. ~ Als Transkriptionsfaktoren oder Bausteine des Chromatins (Histone) spielen Proteine auch in Prozessen der Genetik eine wichtige Rolle. ~ Proteine sind als Puffersystem an der Regulation des Säure-Basen-Haushalts beteiligt.
.· I Abb. 2: a-Helix- (links) und ß-Faltblattstruktur (rechts) [31
Zusammenfassung • Peptide und Proteine sind Ketten aus Aminosäuren, die über Peptidbin
dungen miteinander verknüpft sind. Definitionsgemäß enthalten Peptide bis zu 100 und Proteine über 100 Aminosäuren.
• Proteine nehmen durch die Bildung von Bindungen und verschiedene Arten von Wechselwirkungen eine stabile räumliche Gestalt an.
• Die räumliche Anordnung und Gestalt jedes Proteins ist gekennzeichnet durch dessen Primär-, Sekundär-, Tertiär- und ggf. Quartärstruktur.
• a.-Helix und ß-Faltblatt sind die wichtigsten Sekundärstrukturen der Proteine.
--=
Aminosäure- und Proteinmetabolismus I
Proteine sind aufgrund ihrer zahlreichen, lebensnotwendigen Funktionen für den Organismus unverzichtbar. Sie sind aus Aminosäuren aufgebaut und werden in den Ribosomen synthetisiert (s. Kap. 4). Je nach Angebot (z. B. über Nahrungsproteine) und Bedarf werden Proteine aus Aminosäuren synthetisiert oder zu Aminosäuren abgebaut. So werden im Hungerzustand beispielsweise vermehrt Muskelproteine abgebaut und die frei werdenden Aminosäuren zur Energiegewinnung verwendet. Die beim Abbau von Nahrungs- oder Muskelproteinen frei werdenden Aminosäuren werden anschließend zur Leber, dem Hauptort des AminosäuremetaboJismus, transportiert. Dort werden diese, je nach Bedarf, entweder zur Proteinsynthese verwendet oder abgebaut.
Proteinabbau
Die Spaltung der Proteine wird von speziellen Enzymen, den sog. Proteasen katalysiert. Bei diesen unterscheidet man zwischen Endoproteasen, die Peptidbindungen innerhalb einer Pro· teinkette spalten, und Exoproteasen, durch die Aminosäuren am Amino- oder am Carboxylterminus abgespalten werden. Intrazellulär läuft der Proteinabbau in den Lysosomen und Proteasomen ab. In den Lysosomen werden vorwiegend intrazelluläre oder extrazelluläre, durch Endozytose aufgenommene Partikel abgebaut, während Proteasomen für
coo-+ I
H3N- C- H I CH2 I CH2 I coo-
die Vernichtung feh lerhafter, in der Zelle synthetisierter Proteine zuständig sind.
Aminosäureabbau-Teil 1: Abbau der Aminogruppe
Im ersten Schritt des Aminosäureabbaus wird die Aminogruppe abgespalten, wo· durch Ammoniak (NH3 ) entsteht. Das Ammoniak ist für unsere Ze llen toxisch und muss in der Leber im Harnstoffzyk· Jus eliminiert wird.
Transaminierung, Desaminierung, Decarboxylierung
Der Abbau von Aminosäuren läuft im Wesentlichen über drei Reaktionstypen ab.
Transaminierung Ganz allgemein versteht man unter einer Transaminierung die Übertragung der a-Aminogruppe einer Ami nosä ure auf eine a-Ketosäure. Dabei wird aus der a-Ketosäure ihre a-Aminosäure und aus der a-Aminosäure ihre a -Ketosäure: AS I + Ketosäure II ~ Ketosäure I + AS II. Meistens wird die a·Aminosäure auf a-Ketoglutarat übertragen, wodurch Glutamat entsteht. Das Glutamat kann anschließend oxidativ desaminiert werden, wobei Ammoniak abgespalten wird. Diese Übertragungen werden durch Aminotransferasen katalysiert. Die beiden wichtigsten Vertreter si nd die Aspartat-Aminotransferase (ASAT) und die Alanin-Aminotransferase (ALAT).
.".. Die ASAT überträgt die a -Aminogruppe von Aspartat auf a ·Ketoglutarat, dabei entstehen Oxalacetat und Gluta· mat. Sie wird daher auch GlutamatOxalacetat-Transaminase (GOT) ge-
nannt: Aspartat + a-Ketoglutarat ~ Oxalacetat + Glutamat .".. Durch die Übertragung de r o-Am inogruppe von Alanin auf a· Ketoglu tarat en tstehen Pyruvat und Glutamat. Daher heißt die ALAT auch Glutamat·PyruvatTransaminase (GPT): Alanin+ a.-Ketoglutarat ~ Pyruvat + Glutamat
Transaminierungen dienen neben dem Aminosäureabbau auch der Synthese von neuen, nicht-essenziellen Aminosäuren, wie Alanin aus Pyruvat, Serin aus Hydroxypyruva t, Asparaginsäure aus Oxalacetat oder Glutaminsäure aus a· Ketoglutara t.
Desaminierung Oxidative Desaminierung Bei der oxidativen Desaminierung wird die Aminogruppe einer Aminosäure indirekt abgespalten. Hierbei wird die Aminosäure zunächst zu einer Iminosäure dehydriert und anschließend hydrolysiert ( + H20 ). Es entstehen eine a-Ketosäure und ein Molekül Ammoniak. Oxidative Desaminierungen benötigen als Coenzyme NAD+ oder NADP•, auf die die bei de r Dehydratation frei werdenden Wasserstoffe übertragen werden. Die oxidative Desaminierung von Glutamat zu a·Ketoglutarat und Ammoniak (I Abb. I ) hat von den oxidativen
coo+ I
cool
H2N= C I CH2 I CH2 I coo-
C= O I CH2 I CH2 I coo-
Giutamat a-Ketoglutarat I Abb. I : oxidative Desa rnini erung
L---------------------------------' von Glutamat
a-lminoglutarat
Desaminierungen die größte Bedeutung, da bei den meisten Transaminierungen Glutamat entsteht (s.o), das auf diese Weise weiter abgebaut wird. Das katalysierende Enzym ist die Glutamatdehydrogenase (GLDH), die in den Mitochondrien der Leber lokalisiert ist. Diese Reaktion ist zwar reversibel, allerdings stellt sich durch die Eliminierung des Ammoniaks in der Regel kein Gleichgewicht ein. GTP und ATP sind Hemmer der Glutamatdehydrogenase, GDP und ADP sind allosterische Aktivatoren.
Eliminierende Desaminierung Unter der elimin ierenden Desaminierung versteht man die direkte Eliminie· rung der a -Aminogruppe durch pyridoxalabhängige Dehydratation. Da hierfür eine ß-Hydroxylgruppe Voraussetzung ist, können auf diese Weise nur Serin und Threonin abgebaut werden. So entsteht aus Serin Pyruvat, aus Threonin rx-Ketobutyrat.
Deca rboxyli e ru ng Bei der Abspaltung der Carboxylgruppe einer Aminosäure(= Decarboxylierung) entsteht dessen biogenes Amin. Die biogenen Amine nehmen z. T. wichtige Funktionen wahr. So dient das biogene Amin des Glutamats, das y-Aminobutyrat (GABA) beispielsweise als Neurotransmitter, und das Histamin(= bio· genesAminvon Histidin) als Gewebshormon. Die biogenen Amine werden durch Aminooxidasen (Mono- oder Diaminooxidasen) weiter abgebaut.
Harnstoffzyklus
Das beim Abbau von Aminosäuren und Purinbasen entstehende Ammoniak (NH3 bzw. NH/ , da das freie Ammoniak bei physiologischem pH.Wert hauptsächlich als Ammoniumion vorliegt) ist schon in geringen Dosen toxisch und muss daher aus dem Körper eliminiert werden. Dies geschieht in der Leber über die Umwandlung des Ammoniaks in Harnstoff, das nicht toxisch ist und gut über die Nieren ausgeschieden werden kann. Neben Ammoniak ist auch das Aspartat ein unmittelbarer Stickstofflieferant für den Harnstoffzyklus.
Aminosäuren und Proteine 28 I 29
Die Bildung von Harnstoff aus Ammoniak geschieht in fünf Schritten, von denen die ersten beiden in den Mitochondrien stattfinden, und die letzten drei im Zytosol der Leberzellen (I Abb. 2):
~ Bildung von Carbamoylphosphat durch die Carbamoylphosphatsynthetase I unter Spaltung von 2 Molekülen ATP. Diese Reaktion wird durch N-Acetyl-Glutamat allosterisch aktiviert. ~ Die Ornithin-Carbamoyi-Transferase katalysiert die Reaktion des Carbamoylphosphats mit Ornithin (= Trägermolekül), wobei unter Abspaltung eines Phosphats Citrullin entsteht. Dieses tritt ins Zytosol aus. ~ Die Kondensation von Citrullin mit Aspartat führt zur Bildung von Argininosuccinat, wobei zwei energiereiche Bindungen eines ATPs gespalten wer-
2ADP + P,
0 II
H;,N-c-® Carbamoyl· phosphal
~Ho C=O I
yHo-NH
r r. H-y-NH:J
cooCitrullln
den müssen. Enzym ist die Argininosuccinatsynthetase. ~ Die Argininosuccinase spaltet Argininosuccinat in Arginin und Fumarat. Das frei werdende Fumarat wird über Malat zu Oxalacetat umgewandelt, das entweder wieder zu Aspartat transaminiert, zu Glukose umgewandelt, oder in den Citratzyklus eingeschleust werden kann. .- Bei der Hydrolyse von Arginin durch die Arginase wird Isoharnstoff abgespalten. Dieses lagert sich spontan zu Harnstoff um. Das Ornithin wird wieder freigesetzt und steht somit wieder dem Harnstoffzyklus zur Verfügung.
Ir ~NH,
TH,-NH
f' CHo I •
H-CH3
~ooc,c-'H Arginin II
H....-C.....coo-Arginino· Fumarat
succinat-Lyase
NHo coo-~-NHi.tH I )I
CHo-NH CHo I Fumarase I I I r Argl~:-r + SUCCinat
H-y-N-I:J coo-
Malat
AMP + P-P1+ H)O p)~P,
a -Kalo- Malat-DH gluterat Glutamat ~
• ~ Oxalacetat
Mitochondrium Aspanal ASAT Zytosol
I Abb. 2: Der Harnstoffzyklus 121
Aminosäure- und Proteinmetabolismus II
Aminosäureabbau -Teil 2: Abbau des Kohlenstoffgerüsts
Was bei dem Abbau der Aminosäuren mit der Aminogruppe geschieht, haben wir im letzten Kapitel kennengelernt Bei der Umwandlung des Kohlenstoffskeletts der verschiedenen Aminosäuren entstehen eigentlich nur sieben unterschiedliche Zwischenprodukte. Diese sind entweder Substrate der Glukoneogenese oder der Ketonkörpersynthese bzw. können in den Citratzyklus eingeschleust werden. Aus diesem Grund unterscheidet man glukogene und ketogene Aminosäuren (I Tab. I):
IJI>- Als glukogen bezeichnet man solche Aminosäuren, die zu Pyruvat, a·Ketoglutarat, Succinyl-CoA, Fumarat oder Oxalacetat abgebaut werden, da deren Abbauprodukte für die Glukoneogenese verwendet werden können. IJI>- Die Abbauprodukte ketogener Aminosäuren, Acetyl-CoA und Acetoacetat können nicht zu Glukose umgewandelt werden. Sie dienen als Substrate der Ketonkörpersyn these.
Abbau zu Pyruvat
Die fünf Aminosäuren Alanin, Cystein, Glycin, Serin und Threonin werden zu Pyruvat umgewandelt. Dies geschieht über folgende Mechanismen:
IJI>- Alanin wird über die Alanin-Aminotransferase (ALAT), die wir schon vom
Klassifikation Aminosluren
letzten Kapitel kennen, zu Pyruvat transaminiert. IJI>- Serin und Threonin können durch die Serin- bzw. Theronin-Dehydratase desaminiert und anschließend über Aminoacrylat bzw. Aminoaceton zu Pyruvat umgewandelt werden. An dieser Desaminierung ist Pyridoxalphosphat (PALP) beteiligt. IJI>- Auch das Cystein wi rd über die Zwischenstufe Aminoacrylat abgebaut. IJI>- Glycin reagiert mit Tetrahydrofolsäure zu Serin, das anschließend in Pyruvat überführt werden kann.
Abbau zu Oxalacetat
Nur Aspartat und Asparagin werden zu Oxalacetat abgebaut. Durch Desaminierung entsteht aus Asparagin Aspartat, das anschließend durch Transaminierung durch die Aspartat-Transaminase in Oxalacetat überführt wird.
Abbau zu a-Ketoglutarat
Der Abbau von Glutamin, Prolin, Arginin und Histidin führt zur Entste· hung von a-Ketoglutarat. Dabei läuft der Abbau aller vier Aminosäuren über die Bildung des Zwischenproduktes Glutamat, das anschließend zu seiner a-Ketosäure, dem a-Ketoglutarat transaminiert wird .
Abbauprodukt
Glukogen Arginin, Glutamat, Glutamin, Histidin, Prolin a -Ketoglutaral
Alanin, Cyste1n, Glycin, Serin, Threonin, Tryptophan Pyruvat
lsoleucin, Methionin, Va lin, Threonin Succinyi-CoA
Phenylalanin, Tyrosin, Aspartat Fumarat
Aspartat, Asparagin Oxalacetat
Ketogen Leucin, Lysin Acetyi-CoA
Leuein Acetoaceta t
Glukogen und Ketogen lsoleucin, Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan Acetyi-CoA, bzw. Acetoacetat
I Tab. 1: Gluk ogene und ketogene Aminosäuren
Abbau zu Succinyi-CoA
Isoleucin, Methionin und Valin werden zu Succinyl-CoA abgebaut. Aus Isoleuein entsteht außerdem AcetyJ. CoA. Es ist damit nicht nur glukogen, sondern zusätzlich noch ketogen. Als Zwischenprodukte entsteht beim Abbau dieser Gruppe zunächst Propionyl-CoA
' das ATP-abhängig zu Methylmalonyi-CoA carboxyliert wird. Als Nächstes folgt die Vitamin 812-abhängige Umwand lung des Methylmalonyi-CoA zu Succinyl-CoA (I Abb. 3).
Abbau von Phenylalanin und Tyrosin
Phenylalanin und Tyrosin sind sowohl glukogen als auch ketogen. Das Phenylalanin wird zunächst einmal zu Tyrosin hydroxyliert, was durch die Phenylalaninhydroxylase katalysiert wird. Bei der Phenylketonurie, einer nicht seltenen Erbkrankheit, führt ein Defekt dieses Enzyms zu schweren Symptomen (s. u.). Anschließend wird das Tyrosin transaminiert und zu Fumarat und Acetaacetat abgebaut.
Biosynthese der Aminosäuren
Nun noch ein paar Worte zur Biosynthese von Aminosäuren. Nur 12 der 20 (bzw. 21) proteinogenen Aminosäuren kann der Mensch selbst synthetisieren die übrigen sind essentiell und müsse~ über die Nahrung aufgenommen werden (s. Kap. 24) . Die Synthesewege der nicht-essentiellen Aminosäuren sind:
IJI>- Durch reduktive Amidierung durch die Glutamatdehydrogenase entsteht aus a-Ketoglutarat Glutamat, das durch die Gl utamin-Synthetase zu Glutamin umgewandelt werden kann . Auch Prolin und Arginin leiten sich vom Gluta. mat ab. IJI>- Alanin und Aspartat entstehen durch Transaminierung von Pyruvat und Oxalacetat. Aus Aspartat und NH
4-..
entsteht Asparagin. .,._ Serin entsteht aus 3-Phosphoglycerat und ist wiederum Vorstufe für die Synthese von Glycin und Lysin.
Methionin, lsoleucin.
Valin
Aminosäuren und Proteine 30 I 31
Valin
~ H 0 0 I II II
I Ab~3:Abbauvon Methionin, Valin und
Isoleuein
-ooc -C-C-S-CoA - -ooC-CH2 -CH2-C-S-CoA I CH3
Propionyi-CoA Methylmalonyi-CoA Succinyi-CoA
..,. Phenylalanin (essentiell) wird durch die Phenylalaninhydroxylase in Tyrosin überführt.
Die Assistenten des Aminosäurestoffwechsels
Coenzym 8 12
Für die intramolekularen Umlagerungen bei der Umwandlung von Methylmalonyl-CoA zu Succinyl-CoA wird Coenzym B12 benötigt, das sich vom Cobalamin (Vitamin Bd ableitet. Dieses dient außerdem als Coenzym bei der Umwandlung von Homocystein zu Methionin.
Überträger von Ein-Kohlenstoff-Einheiten
..,. S-Adenosylmethionin (SAM): Das SAM überträgt Methylgruppen. Es wird aus ATP und Methionin gebildet, wobei vom ATP ein Triphosphat abgespalten wird. Nach Übertragung der Methylgruppe zerfält SAM in Adenosin und Homocystein. Letzteres muss nun wieder zu Methionin remethyliert werden, dazu reagiert es in einer Vitamin-B12-abhängigen Reaktion mit N5-
Methyi-THF. Das Methionin steht nun wieder der Bildung von SAM zur Verfügung. SAM ist unter anderem an der Bildung von Adrenalin, Kreatin und Cholin beteiligt, sowie an der Entgiftung einiger Pharmaka. ..,. Tetrahydrofolsäure (THF, FH4):
Die Tetrahydrofolsäure ist ein wichtiger Überträger von CI-Einheiten unterschiedlicher Oxidationsstufen, wie Methyl-, Methylen- oder Formylgruppen. Sie leitet sich von der Folsäure (Vit-B2-
Komplex) ab und besteht aus Glutamat,
p-Aminobenzoesäure und einem substituierten Pteridin. Die Ein-KohlenstoffEinheiten binden an das N5- oder N10-Atom der Tetrahydrofolsäure, dabei entstehen deren chemisch aktive Abkömmlinge N1o-Formyi-THF, NS,NI O_ Methylen-THF und N5-Methyi-THF. Das Methylen-THF beispielsweise erhält die Hydroxymethylgruppe vom Serin, das dabei zu Glycin umgewandelt wird. Wichtig ist die THF für die Purinbiosynthese, die Bildung von N-Formyi-Methionin-tRNA, die Umwandlung von Glycin in Serin und von Homocystein zu Methionin sowie für die Synthesen von Thymin und Cholin.
Pathobiochemie: Phenylketonurie
Die Phenylketonurie (PKU) ist eine relativ häufige Stoffwechselerkrankung (1 : 7000 Neugeborene), die autosomalrezessiv vererbt wird. Bei den Patienten liegt ein Defekt der Phenylalaninhydroxylase vor, wodurch der Abbau von Phenylalanin zu Tyrosin gestört ist. Dies hat zur Folge, dass sich Phenylala-
Zusammenfassung
nin im Körper anreichert und gleichzeitig ein Tyrosinmangel herrscht. Das Schädigende dabei ist aber vor allem, dass Phenylalanin statt zu Tyrosin zu Phenylpyruvat und dessen toxischen Abbauprodukten abgebaut wird. Diese beeinträchtigen die Myelinscheidenbildung in den Oligodendrozyten, was bei den betroffenen Kindern zu einer mangelnden geistigen Entwicklung führt. Um die Bildung der toxischen Substanzen zu verhindern, müssen die Neugeborenen eine strenge, phenylalaninarme und tyrosinreiche Diät einhalten, und zwar mindestens bis zum 12. Lebensjahr, bis die Myelinisierung abgeschlossen ist. Im Rahmen des Neugeborenenscreenings werden alle Kinder auf PKU untersucht, damit die Diät möglichst früh angefangen werden kann.
• Beim Abbau der Aminosäuren unterscheidet man den Abbau der Amino
gruppevon dem des Kohlenstoffskeletts.
• Zur Abspaltung der Aminogruppe gibt es drei Reaktionstypen: Trans
aminierung, Desaminierung und Decarboxylierung.
• Bei der Abspaltung der Aminogruppe entsteht Ammoniak, das toxisch ist
und in der Leber über den Harnstoffzyklus eliminiert werden muss.
• Das verbleibende Kohlenstoffskelett kann zu verschiedenen Zwischen
produkten abgebaut werden. Wichtig ist hierbei die Unterscheidung
zwischen glukogenen und ketogenen Aminosäuren.
---=
Stoffwechsel der Nukleotide I
Nukleotide sind die Bausteine der Nukleinsäuren, aus denen wiederum die DNA und die RNA zusammengesetzt sind . Außerdem sind sie in manchen Coenzymen (z. B. Coenzym A, NADH, FADHz, SAM] enthalten und Bestandteile aktivierter Zucker (z. B. UDP-Glukose) oder Lipide (z. B. UDP-Cholin) . Auch in der Regulation der Proteinbiosynthese und als second messenger (cAMP, cGMP) bei der Wirkungsentfa ltung von Hormonen spielen die Nukleotide eine zentrale Rolle . Doch als Erstes ist es wichtig zu wissen, was Nukleotide überhaupt sind.
Aufbau der Nukleotide
Ein Nukleotid besteht aus drei Komponenten: einer Base (Purin oder Pyrimidin), einem Zucker (Ribose oder Desoxyribose) und einer, zwei oder drei Phospha~ruppen(~onophospha~ -Diphosphat, -Triphosphat).
Der Zucker: Als Zucker enthält jedes Nukleotid eine Pentose, und zwar entweder Ribose (= Ribonukleotid) oder 2'-Desoxyribose (= Desoxyribonukleotid). Der Unterschied zwischen diesen beiden liegt lediglich im "Anhang" des C2'-Atom: Während die Ribose an dieser Stelle eine OH-Gruppe trägt, hat die Desoxyribose dort nur einen Wasserstoff. An der Pentose hängen sowohl die Base, und zwar N-glykosidisch am CI ' -Atom, als auch die Phosphatgruppen (am C5'-Atom). Die Striche hinter den Zahlen bedeuten, dass damit die C-Atome des Zuckers gemeint sind. Bei der Durchnummerierung der Kohlenstoffatome der Base wird der Strich weggelassen, damit es zu keinen Verwechslungen kommt.
Die Base: Als Basen stehen den Nukleoliden entweder Purine oder Pyrimidine zur Verfügung. Es gibt zwar einige Basen mehr, aber es reicht vorerst, die fünf wichtigsten zu kennen: Diese sind die Purine Adenin und Guanin sowie die Pyrimidine Uracil, Cytosin und Thymin. Seltenere Basen kommen hauptsächlich in der tRNA vor.
Die Phosphatgruppen: Ein Nukleotid
tid! Fehlt ihm das Phosphat, nennt man das Molekül Nukleosid (Adenosin, Guanosin, Uridin, Thymidin , Cytidin ). Die Phosphatgruppen machen die Nukleo· tide zu starken Säuren, daher liegen sie in den Zellen als ihre Salze dissoziiert vor. Sie enden dann auf -at, Adenylat, Guanylat, Uridylat, Thymidylat und Cytidylat. Gebräuchlicher ist aber die abkürzende Schreibweise (z. B. AMP, GMP usw. s. u.). Je nachdem, wie viele Phosphatgruppen die Nukleo tide enthalten, hängt man die jeweilige Endung an (-Monophosphat, -Diphosphat, -Triphosphat).
ll> Zucker (Ribose oder Desoxyribose)+ Base (Purin oder Pyrimidin) = Nukleosid ll> Nukleosid + I Phosphatgruppen = Nukleosidmonophosphat (z. B. AMP = Adenylat) ll> Nukleosid + 2 Phosphatgruppen = Nukleosiddiphosphat (z . B. ADP) ll> Nukleosid + 3 Phosphatgruppen = Nukleosidtriphosphat (z. B. ATP)
I Abbildung 1 zeigt Aufbau und Bestandteile der Nukleotide samt deren Strukturformeln.
Die Nukleotide als Bausteine der DNA und RNA
In der DNA liegen die Nukleotide als Desoxyribonukleotide vor, in der RNA als Ribonukleotide . Um die Zuckerkomponenten der Nukleotide unterscheiden zu können, steht vor dem Nukleotid ein d für Desoxyribonukleotid, bzw. ein r für Ribonukleotid (z. B. dTMP, rTMP). Allerdings wird diese Schreibweise nicht oft verwendet, da
man meist aus dem Kontext erfährt, um welche Art von Nukleotid es sich handelt. DNA und RNA sind aus den gleichen Purinbasen (Adenin, Guanin) aufgebaut, unterscheiden sich allerdings in der Zusammensetzung ihrer Pyrimidine: Während in der DNA die Pyritnidinbasen Thymin und Cytosin vorkommen, findet man in der RNA die Basen Uracil und Cytosin.
Stoffwechsel der Nukleotide
Der Nukleotidstoffwechsel ist sehr komplex, insbesondere die Synthese der Purin- und Pyrimidinbasen. Man unterscheidet hierbei die De-novo-Synthese von der Wiederverwertung anfallender Basen aus dem Nukleinsäurenabbau oder aus der Nahrung(= Salvage pathway). Fast jede menschliche Zelle ist zur Purin- und Pyrimidinsynthese befähigt. Beim Abbau der Basen in der Leber entsteht aus den Purinen Harnsäure, aus den Pyrimidinen ß-Aminosäuren.
Purinbiosynthese
Bei der Purinbiosynthese entsteht kein einzelnes Purinmolekül, sondern das Purin wird aus kleinen Bausteinen di-
0
HNJYCH3 j A.J ~
0 ~ f Thymin
NukleoUd Adenin Guanin
N~N Base ~~ ) -o~o~·
-o-Lo-LoJ1
1-o-Qco V · H b- ~- o- J' 2·
Pentose PhOsphatgruppe / ""'
Nukleosid
-monophosphat -0COH2 0 -OCOH, 0
-diphosphat L...----:-;--;---:-;----' H H H H H H
-triphosphat
HO OH HO H Ribose Desoxyribose
ohne Phosphatgruppe ist kein Nukleo- I Abb. t : Aufbau eines Nukleotids Zuckeranteil
I Abb. 2: Herkunft der Atome des Purinrings [21
rekt an der Ribose des Nukleotids synthetisiert. Die Enzyme dafür befinden sich im Zytosol. Die De-novo-Biosynthese der Purine ist komplex, daher ist es sehr hilfreich, wenn man weiß, woher die Atome des Purins überhaupt stammen (I Abb_ 2).
Schritte der Purinsynthese In mehreren Schritten wird der Purinring ans Ribosephosphat angebaut. Das Ribose-5-Phosphat, das v. a. aus dem Pentosephosphatweg stammt, muss aber zunächst aktiviert werden, bevor es dazu in der Lage ist, die N-glykosidische Bindung zu knüpfen . Dazu wird es durch eine Reaktion mit ATP in seine aktivierte Form, das Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP), überführt. Die weiteren Schritte sind [I Abb. 3):
~ Die geschwindigkeitsbestimmende Reaktion der Purinsynthese ist die Bil-dung von 5-Phosphoribosylamin aus PRPP und Glutamin. Katalysiert wird sie durch die Glutamin-PRPP-Amidotransferase, das Schlüsselenzym der Purinbiosynthese. ~ Es fo lgt die ATP-abhängige Konden-sation des 5-Phosphoribosylamins mit Glycin. ~ Nun wird das Molekül formyliert. Der Formylrest stammt dabei vom Forrnyl tetrahyd rofol. ~ Ein weiteres Stickstoffatom wird unter ATP-Verbrauch vom Glutamin eingefügt, und nach Wasserabspaltung kommt es zum Ringschluss. ~ Anschließend folgt eine Carboxylierung: Ein freies C02 wird in den Ring eingebaut. ~ Nun folgt der Einbau eines weiteren N-Atoms (vom Aspartat, ATP-abhängig) und noch eines Cl-Fragments [vom Formyi-THF), und der Ring kann unter Wasserabspa ltung geschlossen werden. Es entsteht lnositolmonophoshat
anthin. Inositolmonophosphat ist Ausgangssubstanz für die Synthese von AMP und GMP. ~ Synthese von AMP aus IMP: Zur Bildung von AMP wird die Ketogruppe am C6 durch eine NH2-Gruppe ersetzt. Dies geschieht durch Addition von As· partat und Eliminierung von Fumarat und ist GTP-abhängig. ~ Synthese von GMP aus IMP: IMP wird mithilfe von NAD+ zu Xanthosinmonophosphat [XMP) oxidiert. Als Nächstes folgt die ATP-abhängige Arninierung durch eine Reaktion mit Glutamin.
Regulationsmechanismen Die Purinbiosynthese wird an verschiedenen Stellen reguliert. Erster Ansatzpunkt ist die Bildung von PRPP durch
Genetik 32 I 33
die PRPP-Synthetase. Sie wird gehemmt durch AMP, GMP und IMP. Das Schlüsselenzym der Purinsynthese, die Glutamin-PRPP-Amidotransferase, wird ebenfalls von AMP, GMP und IMP wie auch von deren höher phosphorylierten Formen gehemmt. Außerdem hemmt das GMP seine eigene Synthese aus IMP, und das AMP seine eigene Synthese aus IMP. Damit es zu einer ausgeglichenen Synthese von AMP und GMP aus IMP kommt, greift hier ein weiterer Regulationsmechanismus ein: die reziproke Substratbeziehung: ATP fördert die Bildung von GMP aus XMP, da die Reaktion ATP-abhängig ist. Hohe Konzentrationen von GTP fördern wiederum die AMP-Synthese aus IMP [Diese Reaktion ist GTP-abhängig.).
®-o-t~H2 H
4 I
H OH
®-O- CH2
"""~ IHr"' pp. OH OH
A\ zp ®-0-C~Hz 0 H
"' H H o-®-®
OH OH
a-D-Ribose-5-P
co,
HC,..... N~ ~ ~CH
' ....._N H, N I
Hp, Glutamat Glutamin . ' )
I RIBOSE-5-P
0 NI O_Formyi-H -Folat H4-Folat ~ 4
HO" X\H \,_ / H, N NI I \
I RIBOSE-5-P I Aspartal FumO<ol
OH OH
PRPP
I RIBOSE-5-P I Formylglycinamid
Ribonukleo t id
I RIBOSE-5-P I
IMP
· 5-Phosphoribosylamin
H,O. ADP + ~~~ Glycin
r 0 NH,
® - O- C8Hz Hz( NH
.... ----,{~\-----H4-folat N 10 Formyl- H H
H4-Fola l OH OH
Aspartat, Fumarat, GTI' GDP, P;
\.) ~
GlycinamidRibonukleotid
I RIBOSE-5-P I
~ HzO,NAD<il
~NADH + H"' Glutamat,
Adenosinmonophosphat (AMP)
0
~ Glutamin, A~:t· 0
AlP ~ HN"' ' c,.....\
0:~ ...._ ..... ~....._ N/H ~ I
\_ ) HN"' ' C.....-Nt-, "' ~ ~ ~CH
H, N- ~N""' ....._N/
I [ RIBOSE-5-P I I RIBOSE-5-P I
(IMP}, das Nukleotid der Base Hypox- I Abb . 3: Purinnuk leotidsynthese [71 Xanthosinrnonophosphat (XMP)
Guanosinmonophosphal (GMP)
Stoffwechsel der Nukleotide II
Pu ri nwiederverwertu ng (Salvage pathway)
Im Organismus findet durch den ständigen Auf- und Abbau der oftmals kurzlebigen RNA-Moleküle ein regerUmsatz an Nukleoliden statt. Die Oe-nova-Synthese der Nukleotide kostet viel Energie in Form von ATP, während der Nukleotidabbau nur sehr wenig Energie liefert Daher werden die beim Nukleinsäurenabbau entstehenden Purinbasen möglichst wiederverwertet
Ablauf des Salvage pathways Zunächst werden die freien Purinbasen mit Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP) zu Nukleosidmonophosphaten verknüpft, die im Anschluss zu Di- und Triphosphaten phosphoryliert werden können. Die Ausbildung der N-glykosidischen Bindung zwischen den Purinbasen und PRPP wird dabei durch zwei Enzyme katalysiert:
~ Die Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase (HGPRT) katalysiert die Verknüpfung von Hypoxanthin bzw. Guanin mit PRPP: Hypoxanthin+ PRPP B IMP + PPi bzw. Guanin + PRPP H GMP + PPi ~ Die Adenin-Phosphoribosyltransferase (APRT) katalysiert die Verknüpfung von Adenin mit PRPP: Adenin + PRPP B AMP + PPi
Diesen Weg der Purinwiederverwertung bezeichnet man als Salvage pathway.
Störungen in der
Purinwiederverwertung Eine X-chromosomal rezessiv vererbte Störung der Hypoxanthin-Guanin·Phosphoribosyltransferase (HGPRT) kann zum Lesch-Nyhan-Syndrom führen, das durch mentale Retardierung, Selbstverstümmelung, Hyperurikämie und megalabiastäre Anämie gekennzeichnet ist Pathobiochemisch erklärt sich die Hyperurikämie durch eine gesteigerte Purinsynthese, die Folge einer fehlenden Rückkoppelungshemmung durch IMP und GMP und einem erhöhten Angebot an PRPP ist Der Purinüberschuss führt wiederum zur gesteigerten Bildung von Harnsäure.
Die Löslichkeitsgrenze der Harnsäure Im Serum liegt bei ca. 7 mg/dl. Eine Hyperurikämie mit Überschreiten dieser Konzentration führt zum Ausfallen von Uratkristallen, die schmerzhafte, lokale Entzündungsreaktionen verursachen können (klinisch manifeste Gicht). Die Kristalle fallen meist in schlecht kaplllarisierten Geweben (z. 8. Knorpel, Hornhaut usw.), und zwar typlacherweise Im GroB~hengrundgelenk aus. Ursliehlieh können EJ~ZYmdefekte (s.o.), mangelnde Ausscheidung (Niereninsuffizienz) oder
-eloe puiinre1che Ernährung (z. B. lnne-11ien. Fleisch, Hülsenfrüchte) sein.
Synthese der Pyrimidinnukleotide
Im Gegensatz zur Purinnukleotidsynthese wird bei der Synthese der Purinnukleotide der Pyrimidinring einzeln synthetisiert, bevor er an die Ribose
H HO ' c'io eo
HN Asparta ttrans-
angeknüpft wird _ Die Atome für die Pyrimidinsynthese stammen vom Aspartat und vom Carbamoylphosphat
~ Erster Schri tt: ATP-abhängige Bildung von Carbamoylphosphat aus Glutamin und C0 2 (Enyzm: Carbamoylphosphatsynthetase II ). ~ Carbamoylphosphat und Aspartat reagieren zu Carbamoylaspartat (Enzym: Aspartattranscarbamoylase, Schrittmacher der Pyrimidinsynthese) _ ~ Anschließend kommt es durch Wasserabspaltung zum Ringschluss. Dihydroorotat wird mittels Dehydrierung zur Orotsäure oxidiert ~ Nun folgt die Ausbildung der Nglykosidi schen Bindung zwischen dem Pyrimidinring und PRPP. Dabei wird Pyrophosphat (PPJ abgespalten, und Orotidinmonophosphat entsteht.
'(~ . .0 0
I
H2N~coo0 carbamoylase H2N ' CH2
o~c 'o +
\ ,.. Ä D1hydroororase ,.. HN CH
2
® P,
Carbamoyl- Asparta t phosphat
H ~~ ,c , ,__c - coo0
® o~:~ 1 Orotid in-5-PhosphatDecarboxylase ~H
Orotidin-5-Phosphat
co,
H:~ Qj,NJ NADPH + H<!l NADPID
®-O-G~1 \_ ) "_ 2 Thymidila t-0 synthase
OH OH Urid in-5-Phosphat
(UM P)
ATP ADP
I ~ -coo0 O= C N ' H I
H Carbamoylaspartat
Orotat-Phosphovibosyl transferase
\ oj"w"~;-cooe H20
1 H
H Oi hydroorotsäure
Orotsäure- ~ NAD0
Dell)'d rogenase
.,_ NADii + He
5-Phospllonbosyt-1-d iphosphat
' ""='"· """"'· J5 ATP ADP . P, 0
~~ (Cyticlintriphosph at)
I Abb. 4: Reaktionen der Pyrimid inbiosynthese 171
,.. @-@- ® -0-Ci-1 2 i CTP
]~1 H
Enzyme: 1: Adenosin-Desaminase 2: Purinnukleosid-
Phosphorylase 3: Xanthin-Oxidase 4: Guanin-Desaminase
OH
Genetik 341 35
( ~. P; Rib-P
:S:N 0 (x) 6 l ~ ( ~. (\ " N N N I I
Rib H20 NH3
Adenosin Inosin
I Abb. 5: Abbau der Purinbasen
..,.. Dieses wird durch Carboxylierung zu Uridinmonophosphat (UMP) umgewandelt. UMP kann durch Phosphorylierungen weiter zu UTP umgewandelt werden (I Abb. 4).
Die Synthese von TMP Die Synthese von TMP aus UMP erfolgt durch NADPH/H+-abhängige Reduktion zu dUMP und anschließende Methylierung durch die Thymidilat-Synthase, wobei dTMP entstehe Methylgruppendonator und Reduktionsmittel ist bei dieser Reaktion die Tetrahydrofolsäure, die dabei zu Dihydrofolsäure oxidiert wird. Sie muss anschließend regeneriert werden, damit sie wieder der TMP-Synthese zur Verfügung stehen kann (Enzym: Dihydrofolatreduktase) . Zellen mit hohen Zellteilungsraten, wie z. B. Krebszellen, benötigen viel TMP zur Bildung von DNA. Diese Tatsache macht man sich bei der Krebstherapie mit Hemmstoffen der Thymidilat-Synthase und der Dihydrofolatreduktase (z. B. Methotrexat) zu Nutze.
Bildung der Desoxyformen der Purin- und Pyrimidinnukleotide Um aus den Ribonukleotiden die für die DNA-Synthese benötigten 2'-Desoxy-
Rib P; Rib-P
Hypoxanthin
ribonukleotide zu gewinnen, muss die Ribose reduziert werden. Das Enzym dieser Reaktion ist die Ribonukleotidreduktase, die Thioredoxin als Reduktionsmittel nutzt. Dieses muss anschließend mithilfe von NADPH/ H+ durch die Thioredoxinreduktase wieder regeneriert werden.
Abbau der Purin- und
Pyrimidinnukleotide
Beim Abbau der Purin- und Pyrimidinnukleotide werden die Nukleotide zunächst durch die Nukleotidase hydrolytisch zu Nukleosiden gespalten. Als Nächstes katalysiert die Nukleosidphosphorylase die phosphorylytische Spaltung der Nukleoside in (Desoxy-)Ribose-1-Phosphat und die freie Base. Ribose-IPhosphat gelangt nach Isomerisierung
Zusammenfassung
Xanthin Harnsäure
zu Ribose-5-Phosphat wieder in den Stoffwechsel.
Abbau der Purinbasen: Lediglich die Nukleoside Inosin, Xanthosin und Guanosin können von der Nukleosidphosphorylase umgesetzt werden. Adenosin muss, um abgebaut werden zu können, zunächst zu Inosin desaminiert werden. Beim Abbau der Purinbasen bleibt der Purinring erhalten und wird als Harnsäure (Urat) über die Nieren ausgeschieden (I Abb. 5).
Abbau der Pyrimidinbasen: Bei den Pyrimidinbasen kann der Ring komplett abgebaut werden. Die Enzyme dazu sind in der Leber lokalisiert. Der Abbau läuft über einen mehrstufigen Prozess und endet in der Bildung von Acetat, Propionat, NH3 und C02•
X Nukleotide sind aus einer Pentose, einer Purin- oder Pyrimidinbase und
einer bis drei Phosphatgruppen aufgebaut.
X Die wichtigsten Purine sind Adenin und Guanin, die wichtigsten Pyrimidine
Cytosin, Thymin und Uracil.
X Die Purinbasen werden direkt am PRPP synthetisiert. Bei der Pyrimidin
synthese wird erst der Pyrimidinring gebildet und anschließend mit dem
Zucker verknüpft. Seide können auch über den sog. Salvage pathway
wiederverwertet werden.
• Beim Abbau der Purinbasen entsteht unlösliche Harnsäure. Ein Über
angebot an Purinen kann zur Hyperurikämie führen (Gicht).
DNA und Nukleinsäuren
Nukleinsäuren sind die Träger der Erbanlagen aller Lebewesen. Es handelt sich um Polynukleotide, von denen Millionen von Monomeren durch Phosphodiesterbrücken miteinander verbunden werden.
RNA besteht aus Ribose, DNA enthält Desoxyribose als Zuckerbaustein. Es gibt zwei überlebenswichtige Eigenschaften der DNA: zum einen muss sie in der Lage sein, genetische Information genau zu speichern und an spätere Generationen weiterzugeben, zum anderen muss sie alle wichtigen Daten in verschlüsselter Form speichern. RNA hat mehrere Funktionen- einerseits wird sie zur Transkription und Translation benötigt, bei einigen Viren ist die RNA aber auch Träger der gesamten Erbinformation.
Aufbau der DNA
DNA ist eine Doppelhelix aus zwei antiparallel velaufenden, unverzweigten Ketten aus Desyoxyribonukleotiden. Diese rechtsgängige Helix entsteht dadurch, dass die Basen der beiden Stränge, die auf der Innenseiteam CI-Zucker hängen, Basenpaare bilden und sich durch Wasserstoffbrücken miteinander verbinden. Hierbei bilden Guanin und Cytosin drei, sowie Adenin und Thymin zwei Wasserstoffbrücken untereinander (I Abb. I) . Diese Brücken sind es, die der DNA ihre Stabilität verleihen. Durch die Drehung der Helix und da die Winkel der Verbindungen zwischen Zucker und Base< 180° betragen, weist die DNA nach außen hin eine große und eine kleine Furche auf (I Abb. 2)
Organisation der DNA
Die DNA bildet das Genom des Menschen im Zellkern - einen diploiden Chromosomensatz aus insgesamt 46 Chromosomen - 22 Autosomen-
5'
HO 3'
paare und zwei Geschlechtschromosomen.
5'
ln jedem Zellkern sind ungefähr I ,8 m DNA enthalten, verpackt auf 6 lJm. Um die DNA auf so kleinem Platz speichern zu können, muss sie verdichtet werden. Hierzu ist die DNA der Chromosomen um Histon-Proteine gewickelt. Dies sind basische, also positiv geladene Kernproteine. Ein Stück des DNA-Strangs wickelt sich um zwei Moleküle der vier verschiedenen Histo· ne und bildet so einen Nukleosomenkern, der über eine Linker-DNA mit dem nächsten verbunden ist.
E E -.:t c0
kleine Furche
I Abb. 2: Die DNA-Doppelhelix 121
I Abb. I: Die Basenpaa re der DNA [17 ]
Ein Nukleosomenkern und die zugehörige Linker-DNA bilden ein Nukleosom. Alle Nukleosomen zusammen ergeben den Nukleosomenstrang. Dieser ist über weitere Kondensationsmechanismen zum Chromosom verdichtet. Eine weitere Aufgabe der Histone ist die Regula tion der Genexpression. An sie können sogenannte ChromatinRemodellierungsmaschinen binden die die in den Nukleosomen verpackte' DNA zugänglich machen, indem sie die Verbindung zwischen den Histonen und der DNA lösen und so zum Beispiel Sequenzen freilegen können. Diese Werden für die RNA-Polymerase zugänglich und die Zelle kann die Transkription ' dieser Gene starten.
Das menschliche Genom
Gene sind kodierende Einheiten auf dem DNA-Strang. Die meisten Gene stellen Ba upläne für Proteine dar. Zur Synthese der Proteine wird die DNA durch Transkription in RNA umgewandelt. Die auf der RNA gespeicherte Information wird dann in Proteine übersetzt, diesen Vorgang nennt man Translation.
Ein prokaryontisches Gen besteht aus:
.... einem Promotor, der die Ansatzstelle für die RNA-Polymerase sowie für die Transkriptionsfaktoren enthält, .... einem Start-Codon, den ersten drei Basen, die bei der Proteinsynthese translatiert werden, .... einem Strukturgen, dem Teil des Gens, der transkribiert wird. Hierbei ist es wichtig, zwischen Exons und Introns zu unterscheiden: Exons sind die kodierenden Bereiche des Gens, die später zum Protein translatiert werden. Introns sind die nicht kodierenden Sequenzen, die zwar transkribiert werden, aber vor der Synthese des Proteins aus der RNA herausgeschnitten werden; ~ einem Stopp-Codon, das den Abbruch einer Translation markiert.
Das menschliche Genom besteht aus 46 Chromosomen mit ungefähr 30 000 Genen. Durch alternatives Spleißen Werden aus diesen Genen über 100 000 verschiedene Proteine und 3,2 Milliarden Basenpaare. Allerdings sind nur etwa 1,5'J6 der Basensequenzen kodierend.
Die nichtkodierenden Teile der DNA lassen sich folgendermaßen unterteilen:
~ Introns: nichtkodierende Anteile der Gene, die im Rahmen der Transkription herausgeschnitten werden, ~ Abschnitte zwischen den Genen: Man unterscheidet zwischen nicht· repetitiven Sequenzen, die nur einmal im Genom vorkommen und mehrfach vorkommenden repetitiven Sequenzen. Diese genfreien Abschnitte der Chromosomen bilden das Heterochromatin, das sich nach Anfärbung der Chromosomen dunkel darstellt. Die genreichen Teile bilden das hellere Euchromatin.
Der genetische Code
Die Reihenfolge der Basen auf dem DNA-Strang codiert für die Aminosäuresequenz der späteren Proteine. Aus den vier Basen, abgekürzt mit den Buchstaben A, C, T, G müssen die 20 verschiedenen Aminosäuren gebildet werden. Da zwei Basen nur 42 = 16 Aminosäuren kodieren könnten, ist ein BasentripJett
nötig, um die Aminosäuren eindeutig zu verschlüsseln. Da drei Basen aber 43 = 64 Aminosäuren ergeben, stehen für die meisten Aminosäuren mehrere Basenkombinationen zur Verfügung. Meist unterscheiden sich die unterschiedlichen Codes für eine Aminosäure nur durch den letzten Buchstaben, so kodieren beispielsweise CTT, CTC, CTA und CTG alle Leuein (I Abb. 3). Deshalb bezeichnet man den genetischen Code auch als degeneriert, und dies ist der Grund dafür, dass man den Code nur in die Richtung von DNA zu Polypeptid eindeutig ablesen kann.
• Met= Start
Zusammenfassung
Genetik 36 I 37
Die Degeneration des Codes schützt auch vor Mutationen, so dass es oft trotz Austausches einer Base zu keiner Änderung der Aminosäuresequenz kommt. Weiterhin gibt es noch verschiedene Tripletts, die nicht für den Einbau einer Aminosäure stehen, sondern das Ende der Translation markieren. Hierzu gehören TGA, TAA und TAG. Den Beginn der Translation signalisiert allerdings nur ein BasentripJett - die Sequenz ATG. Dieses steht für Methionin, das die erste Aminosäure in jedem Polypeptid darstellt.
I Abb. 3: Die genetische Sonne -Aminosäuren und die zugehörigen Basentrip leUs
X Nukleinsäuren sind die Träger der Erbanlagen. DNA hat die Aufgabe,
genetische Information zu speichern und weiterzugeben.
X Die rechtsgängige Helix wird durch Ausbildung von Wasserstoffbrücken
zwischen den Basen stabilisiert.
X Die im Zellkern gespeicherte DNA muss verdichtet werden, um auf so
kleinen Raum zu passen. Es werden Chromosomen gebildet. ln jeder Zelle
befinden sich 46 Chromosomen.
X Der genetische Code ist degeneriert. Immer drei aufeinanderfolgende
Basen der Nukleinsäuren kodieren für eine Aminosäure. Degeneration des
genetischen Codes bedeutet, dass für die meisten Aminosäuren hierbei
mehrere Tripletts zur Verfügung stehen.
Replikation der DNA
Vor der Teilung einer Zelle muss die DNA verdoppelt, also repliziert werden, damit jede der entstehenden Tochterzellen das komplette Erbgut erhalten kann. Dies gilt nicht nur für Eukaryonten, sondern auch für Prokaryonten, bei denen durch jede Zellteilung ein neues Individuum entsteht. Bei Eukaryonten wird nicht die gesamte DNA der Zelle nacheinander repliziert, sondern, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, an vielen Stellen gleichzeitig mit der Synthese begonnen. Ein Replikon ist ein Stück, das in einem Teil repliziert wird. So schafft es die Zelle, ihr Genom innerhalb weniger Stunden neu zu synthetisieren. Durch die verschiedenen Basenpaare hat jede Base genau eine andere, die zu ihr komplementär ist. Die Synthese funktioniert einfach gesagt folgendermaßen: Die beiden Stränge werden voneinander getrennt. Die komplementären Basen binden sich an die freiliegenden Basen der aufgetrennten Stränge und es entstehen zwei neue Doppelhelices.
Ablauf der Replikation
Die Synthese der DNA ist unterteilt in drei Schritte:
~ Initiation, ~ Elongation, ~ Termination.
Initiation
Die Synthese der DNA (I Abb. 1) wird von einem Enzymkomplex namens DNA-Polymerase katalysiert. Der erste Schritt der Replikation ist die Entwindung der beiden DNA-Stränge durch die Helicase. Die Wasserstoffbrücken, die die beiden Stränge verbinden, werden gelöst. Da durch diesen Vorgang die benachbarten Abschnitte der DNA übermäßig verdrillt werden, sind so genannte Topoisamerasen nötig, um die entstandene Spannung wieder zu lösen. Die Topoisomerase I fügt vorübergehend Einzelstrangbrüche in die DNA-Kette ein, die Topoisomerase II Doppelstrangbrüche. Die Topoisamerase II wird bei Bakterien auch DNA-Gyrase genannt. Sie ist
5'-Ende des Strangs
I 0 I
-o-P = o I
0 c -
H2CQ
1
O H H
H
G
3'-Ende des Strangs
I 0
OH, I
0 I
o = P- o-1
0
neu synthetisierter
Strang
0 I
-o- P = 0 Matrizen-1 strang
0 A CH 2 H2CQ1 O ? H H O=P - o-
H I 0
OH a 3'-Ende (y) (~) (a) des Strangs 0 0 0 C - G 0 Cl H2 I I II I I Q ---
-0-P-Q-P-Q - P - Q - CQ2 0 I I *I o- o- o-
Pyrophosphat HO
neues Desoxyribonucleosidtriphosphat
I Abb. 1: Ablauf der Replikation der DNA 117]
Angriffspunkt für viele Antibiotika, wie z. B. Nalidixinsäure oder Novobiocin. Die Replikationsgabel ist die Stelle, an der die Synthese der DNA stattfindet. Hierbei wird nicht erst der komplette Doppelstrang getrennt und dann die Tochterstränge synthetisiert, sondern die Replikationsgabel wandert am DNAStrang entlang, entwindet diesen und synthetisiert gleichzeitig neu. Da die DNA-Polymerase die Synthese des neuen Stranges nicht bei Null beginnen kann, sondern an ein vorheriges Nukleotid mit einer freien 3'-0H Gruppe am freien Ende anknüpft, wird ein Primer benötigt. Dies ist ein Nukleinsäureabschnitt, der von der DNA-abhängigen RNA-Polymerase (Primase) hergestell t wird. Es hat am 3'-Ende eine freie 3'-0H-Gruppe an das die neuen Nukleotide passend zu den Basen des mütterlichen DNA-Strangs angehängt werden.
Elongation
Bei der Replikation wird gleichzeitig von den beiden el terlichen Strängen ab-
I O=P- o-
1
0
A OH, L...------' I
0 I
o= P-o-1
0
I
O=P -o I
0 I
5'-Ende des Strang
gelesen und an jeden ein zweiter, zur Basensequenz passender DNA-Strang gebunden. Beide neu entstehenden Doppelstränge bestehen also aus einern elterlichen Strang und einem Tochterstrang. Man bezeichnet diese Art der Replikation als semikonservativ. Die DNA-Polymerase bewirkt nun die Addition von Nukleotiden an die wachsende DNA-Kette in 5'---+3'-Richtung. An das 3'-Ende des Primers wird bei der Verlängerung des Strangs das erste Nukleotid gehängt. Dieses muss, um eingebaut werden zu können, in der aktivierten Form, als Nukleosid-Triphosphat vorliegen. Die 3'-0 H-Gruppe des bereits in den neuen DNA-Strang eingebauten Nukleotids füh rt einen hydrophi-
...
L
len Angriff auf das 5'-Triphosphat des anzuhängenden Nukleotids durch. So entsteht zwischen diesen eine Phosphodiesterbindung. Dabei wird Pyrophosphat frei, das von einem Enzym namens Pyrophosphatase unter Energiefreisetzung zu zwei Phosphaten gespalten wird . Von dieser Energie wird die DNA-Synthese angetrieben. Die DNA-Polymerase ist in der Lage, beide elterlichen Stränge gleichzeitig zu töchterlichen Doppelsträngen zu synthetisieren. Dies ist nicht selbstverständlich, da die Synthese in Richtung 5 '~3' stattfindet. Da aber die beiden Stränge antiparallel angeordnet sind, müsste normalerweise ein Strang in 3'~5'Richtung wachsen. Die Natur hat dies folgendermaßen gelöst: Ein Tochterstrang, der sog. Leitstrang, wird kontinuierlich gebildet, in der Richtung, in der die Replikationsgabel auf der DNA entlang wandert. Der andere Strang wird diskontinuierlich synthetisiert, das heißt die Polymerase macht hierbei Sprünge zu einem etwas weiter vorne gelegenen Abschnitt auf dem DNAStrang und wandert dann in 5'~3'· Richtung zurück. Bei jedem Sprung ist für den Synthesebeginn wieder ein Primer nötig, der später von einer DNAPolymerase mit 5'~3' Exonukleaseaktivität wieder entfernt wird. Es entste· hen sogenannte Okazaki-Fragmente, die durch die DNA-Ligase mit dem Folgestrang verbunden werden. Um zu vermeiden, dass fehlerhafte Nukleotide in die DNA eingebaut werden, was zu Mutationen mit schwerwiegenden Folgen führen könnte, hat die DNAPolymerase eine 3'~5' Exonukleaseaktivität. Dies ermöglicht ihr, die zuletzt eingebaute Base noch einmal zu überprüfen, falsche Kombinationen einfach herauszuschneiden und durch eine korrekte zu ersetzen.
Termination
Ist der zu replizierende DNA-Abschnitt komplett abgelesen und die entspre· ehenden Tochterstränge hergestellt, so schneidet die DNA-Polymerase den Strang ab und beendet somit die Replikation.
Aufbau des DNA-PolymeraseKomplexes
Abschließend noch eine genauere Beschreibung des Enzymkomplexes, der die DNA-Synthese ermöglicht. Leichter ist dies am Beispiel der bakteriellen DNA-Polymerase, die sehr ähnlich funktioniert wie die menschliche, aber etwas einfacher aufgebaut ist (I Abb. 2). Dieser Enzymkomplex besteht aus mehr als zehn Untereinheiten und aus zwei Teilkomplexen, von denen einer auf dem Leitstrang, der andere auf dem Folgestrang ansetzt. Verbunden werden die beiden Komplexe durch die -r-Untereinheit. Ein Komplex synthetisiert den Leit-, der andere den Folgestrang, weshalb sie auch nicht identisch sind, sondern unterschiedliche Enzyme beinhalten. An der Spitze des Enzymkomplexes sitzt die Helicase, die die DNA-Doppelhelix entwindet und den Doppelstrang trennt. Die Synthese des Leitstranges läuft in Richtung der Bewegung der auf der DNA entlangwandernden ReplikationsgabeL Bei der Synthese des Folgestranges ist dies komplizierter, es wird eine Schleife gebildet und die DNA-Polymerase bildet die oben beschriebenen Okazaki-Fragmente. Ein sog. Gleitring
Zusammenfassung
Genetik 381 39
ermöglicht hierbei außerdem eine höhere Prozessivität- er "klammert" die DNA-Polymerase an den Strang, so dass schneller größere Stücke synthetisiert werden können, ohne dass der Enzymkomplex sich vom DNA-Strang lösen muss. Die DNA-Polymerase ist in der Lage, pro Sekunde etwa 1000 Nukleotide an die entstehende Kette zu hängen.
s· 3'
3' 5'
3' 5'
I Abb. 2: Aufbau der DNA-Polymerase [ 17]
a Vor jeder Zellteilung muss die DNA der Zelle verdoppelt werden. a Aus der ursprünglichen DNA entstehen bei der semikonservativen Repli
kation zwei Tochterstränge, die mit der elterlichen Doppelhelix identisch
sind. a Bei der Replikation werden die beiden DNA-Stränge voneinander getrennt.
An die beiden einzelnen Stränge werden die komplementären Basen gebunden, so dass zwei neue Helices entstehen. Katalysiert wird dieser Ablauf von der DNA-Polymerase. Die Wachstumsrichtung ist von 5' nach 3'.
a Die DNA-Polymerase ist durch ihre Eigenschaft als 3'~5' Exonuklease in der Lage, ihre eigenen Fehler zu korrigieren. Der letzte Schritt wird nochmals überprüft, bevor die Polymerase ein weiteres Nukleotid an die wachsende Kette anhängt. Passt das neue Nukleotid nicht zum Originalstrang, wird es wieder abgespalten.
a Aufgebaut ist der DNA-Polymerase-Komplex aus über zehn Einheiten, die eine viel schnellere Synthese der DNA ermöglichen, als die enthaltenen Enzyme einzeln.
Transkription
Bei der Transkription wird die Speicherform der genetischen Information, die DNA, in die RNA, die Arbeitsform , umgewandelt.
RNA-Typen
Bei der Transkription entstehen drei unterschiedliche Gruppen von RNA, für deren Synthese drei verschiedene Enzyme zuständig sind:
~ Ribosomale RNA (rRNA): wird in die Ribosomen eingebaut. Die Synthese wird katalysiert von der RNA-Polymerase I. .,. Messenger RNA (mRNA): wird für die Herstellung von Proteinen in der Translation als Vorlage benötigt. Das synthetisierende Enzym ist die RNAPolymerase II. ~ Transfer RNA (tRNA): wird in der Translation zur Übersetzung zwischen mRNA und Aminosäurensequenz benötigt (s. Kap. 42). Die Synthese übernimmt die RNA-Polymerase III.
Ablauf der Transkription
Die RNA-5ynthese beginnt, wenn eine RNA-Polymerase an eine Promotor-sequenz auf der DNA bindet. Dies ist ein Abschnitt auf der DNA, der eine Andockstelle für die RNA-Polymerase und des weiteren Informationen enthält, an welcher Stelle der DNA die Synthese beginnen soll und welcher der belden Stränge abgelesen werden soll.
Die RNA-Polymerasen sind allerdings nicht in der Lage, die Promotoren allein zu erkennen und an sie zu binden. Dazu ist die Hilfe von Transkriptionsfaktoren notwendig. Dies sind Proteine, die an die DNA binden und unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Die verschiedenen Transkriptionsfaktoren sind in I Tabelle I aufgelistet. Hat die RNA-Polymerase nun an die
DNA gebunden, wandert sie in 3'---+ 5'-Richtung an ihr entlang. Der Abschnitt der DNA, der gerade an die RNA-Polymerase gebunden ist, wird Transkriptionsblase genannt (I Abb. 1 ). Der Doppelstrang wird in einem Bereich von 17 Basenpaaren kurzfristig durch eine in der Polymerase enthaltene Helikase aufgetrennt. Nun wird ein zu einem der beiden Stränge komplementärer RNA-Strang synthetisiert: Der entstehende RNA-Strang wächst in 5'---+ 3'-Richtung und entsteht ähnlich wie bei der DNA-Replikation: Eingebaut werden die Ribonucleosidtriphosphate ATP, GTP, CTP und UTP. Bei dieser Reaktion ist auch noch eine Pyrophosphatase beteiligt, die ein Pyrophosphat zu zwei Molekülen Phosphat reagieren lässt. Dabei wird eine große Menge Energie frei, die bewirkt, dass die Synthese-Reaktion des RNA-Strangs praktisch irreversibel ist. Während die RNA-Polymerase an der Matrize entlangwandert, wird der entstehende RNA-Strang um die komplementären Nukleotide verlängert. In den Abschnit· ten, die von der Transkriptionsblase durchlaufen wurden, lagern sich die beiden aufgetrennten DNA-Stränge wieder aneinander. Wie die Termination des RNA-Strangs abläuft, ist noch nicht vollständig erforscht.
RNA-Prozessierung
Die entstandenen RNA-Ketten müssen nach der Synthese noch weiter bearbeitet werden, bis sie die vom Körper benötigte Form haben. Diesen Vorgang nennt man Prozessierung.
Prozessierung der mRNA
Anhängen ei ner Kappe am 5'-Ende Die im Zellkern hergestellten mRNAStücke werden auch als primäre Transkripte bezeichnet. An das 5'-Ende wird
Zinkfinger Kleine Protein-Zink-Komplexe, die wie Finger in die DNA greifen und an sie binden
Leucin-Zipper Enthält basische Aminosäuren, die an die saure DNA binden können
Helix-Loop-Helix- Zwei "--Helices, die durch eine Schleife verbunden sind und ebenfalls an die DNA binden können.
noch während der Synthese eine Kappe aus 7-Methyi-Guanosin angeheftet. Diese Kappe ist sehr wichtig, wenn die mRNA in der Translation als Vorlage für die Proteinsynthese genutzt wird.
Polyadenyl ierung Am 3'-Ende enthält die fertig synthetisierte mRNA eine posttranskriptioneile Polyadenylierung: Die Basenkombination AAUAAA. Diese wird von einer Endonuklease erkannt und dahinter li egende Nukleotide abgeschnitten. Von einer Polymerase werden nun etwa I 00- 300 Adenosine angehängt, PolyA-Schwanz genannt. Dieser Schwanz hilft scheinbar, die mRNA zu stabilisieren und die Translation an den Ribosomen zu erleichtern, die genaue Funktion ist allerdings noch nicht genau erforscht.
Posttransk riptionelles Spleißen Die synthetisierten Vorläufermoleküle der mRNA enthalten In trons und Extrons.
Exons sind die Abschnitte in der mRNA, welche die für die Herstellung eines Proteins nötigen Kodierungen beinhalten. Sie werden unterbrochen von benachbarten lntrons. Hierbei handelt es sich um nicht-codierende Sequenzen in derRNA.
Beim Prozessieren werden nun diese Introns herausgeschnitten und die Exons miteinander zum fertigen mRNA.Stück verknüpft. Dieser Vorgang, auch Spleißen genannt, muss nicht immer gleich ablaufen. Beim alternativen Spleißen werden nach der Transkription aus dem gleichen VorläufermolekQl unterschiedliche Bereiche entfernt, so können aus einem Gen unterschiedliche Proteine entstehen .
Edi tiere n der RNA Auch nachträglich können die RNAStücke von bestimmten Enzymen noch
Struktu ren I Tab. 1: Transkriplionsfak toren
Genetik 40 141
RNA-Polymerase I Abb. 1: Transkriptionsblase [2]
Matrizenstrang codierender Strang
Elongationsstelle
5'
3'
Bewegung der Polymerase
verändert werden. Oft wird ein Cyto· sin durch ein Uracil oder ein Adenosin durch ein Thymidin ersetzt. Dies hat dann Auswirkungen auf die Herstellung des Proteins. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Apolipoprotein B: Dieses Protein wird sowohl im Dünndarm als auch in der Leber synthetisiert. In der Leber wird das große Apolipoprotein B-1 00 hergestellt, das ein Protein des LDL und wichtig für die Bindung an den LDL· Rezeptor ist. Im Darm hingegen wird durch eine Desaminase ein Cytidin durch ein Uridin ersetzt. Dies hat zur Folge, dass statt des Einbaus eines Glutamins ein Stopp-Codon bei der Proteinsynthese erreicht wird und ein verkürztes Apolipoprotein B-48 entsteht. Dieses kann mit dem LDL-Rezeptor keine so starke Bindung eingehen, wie das Apolipoprotein B-1 00.
Prozessierung von tRNA und rRNA
Auch die tRNA-Vorläufermoleküle werden nach der Synthese noch weiter bearbeitet. Von den entstandenen, noch zu langen tRNA-Stücken wird sowohl am 5'- als auch am 3'-Ende ein Stück durch eine RNase abgeschnitten. Es findet ebenfalls ein Spleißen von Introns statt.
- - - - - - - ----- - --
Die Vorläufermoleküle der rRNA werden durch Nukleasen zu kleineren Stücken zerschnitten. So entstehen verschiedene Untereinheiten, die später in den Ribosomen wichtig sind (s. Kap. 2 und Kap. 4).
Hemmung der Transkription
Es gibt verschiedene Stoffe, die die Transkription hemmen können. Dabei handelt es sich zum Teil um Gifte, aber auch um Stoffe, die als Medikamente eingesetzt werden:
~ a-Amanitin: a-Amanitin, das Gift der Knollenblätterpflanze, hemmt die RNA-Polymerasen unterschiedlich stark: I ist kaum empfindlich für das Gift, li wird sehr stark gehemmt, die RNAPolymerase III wird weniger stark beeinträchtigt. Die giftige Wirkung des
Zusammenfassung
Pilzes hat also in der Transkription ihren Ansatzpunkt. Vergiftete Zellen sterben nach einiger Zeit ab, die größte Wirkung wird in der Leber erreicht. Erste Symptome sind nach 8-24 Stunden zu beobachten, die Patienten versterben meist an Leberversagen. ~ Rifampicin: Hierbei handelt es sich um ein Antibiotikum, das man beispielsweise bei Tuberkulose verabreicht. Es blockiert die RNA-Polymerase der Prokaryonten. ~ Actinomycin D: Dieses Zytostatikum bildet Komplexe mit der DNA und führt zu einer Verklebung der beiden DNA-Stränge. Somit wird die Entwirrdung durch die RNA-Polymerase verhindert. Actinomycin D wird vor allem als Medikament in der Tumortherapie eingesetzt, um die Teilung neoplastischer Zellen zu verhindern.
M Für die Synthese der unterschiedlichen RNA-Typen (rRNA, mRNA und tRNA) gibt es drei verschiedene Enzyme, die RNA-Polymerasen 1-111.
M Die Transkription beginnt an einer Stelle der DNA, die Promotor genannt wird. Damit die RNA-Polymerasen an diesen Bereich binden können, werden Transkriptionstaktoren benötigt.
• Der RNA-Strang wächst durch den Einbau von zum DNA-8trang komplementären Ribonukleosidtriphosphaten in 5' ~ 3'-Richtung.
ac Die entstehenden Vorläufermoleküle werden weiter prozessiert. Bei der mRNA wird eine Kappe ans 5'-Ende gehängt, es findet eine Polyadenylierung am 3'-Ende statt, sowie ein Spleißen von lntrons. Durch alternatives Spleißen werden aus einem mRNA-8trang Vorlagen für unterschiedliche Proteine.
Translation
Translation ist der Vorgang der Synthese von Proteinen. Dieser Prozess findet an den Ribosomen statt. Hierbei muss die Nukleinsäuresequenz der mRNA in die entsprechende Aminosäuresequenz der Proteine übersetzt werden.
Funktion der tRNA
Oie Transfer-RNA (tRNA) erfüllt mehrere Aufgaben. Sie ist das Übersetzermolekül zwischen den Codons auf der mRNA und den dazu passenden Aminosäuren. Am 3'-Ende jeder tRNA ist eine Aminosäure gebunden. jede einzelne Aminosäure hat mindestens ein "eigenes" tRNA-Molekül , das am gegenüberliegenden Ende das sogenannte Anticodon enthält (I Abb. 1 ). Dieses Anticodon ist komplementär zu dem entsprechenden Codon auf der mRNA, das für die Aminosäure steht, die an die tRNA gekoppelt ist. Da viele Aminosäuren nicht nur ein kodierendes Triplett, sondern mehrere besitzen, existieren dementsprechend auch mehrere tRNA Moleküle für ein und dieselbe Aminosäure.
Am inoacyl-tRNA-5ynthetase
Die Funktion dieses Enzyms ist es, die Aminosäure an die tRNA zu binden. jede Aminosäure besitzt eine eigene Synthetase, z. B. die Alanin-tRNA-Synthetase. Diese erkennt die Aminosäure und die zugehörige tRNA und verbindet diese unter Verbrauch von zwei Molekülen ATP miteinander. Zuerst wird die Aminosäure mit einem ATP aktiviert und dann an die tRNA gebunden. Produkt ist eine Aminoacyl-tRNA, das mit der Aminosäure beladene tRNA-Molekül. Aminosäure + ATP + tRNA ~ Aminoacyl-tRNA + AMP + PP1
Anticodon
I Abb. 1: Die Kleeblattstruktur einer tRNA [7]
Ablauf der Translation
Ribosomen
Ribosomen sind kugelartige Verbindungen aus Proteinen und Ribonukleinsäuren (die den größeren Anteil haben).
lnitiator-tRNA bzw.
Peptidyl-tRNA ~
~
Sie sind die Zellorganellen, an denen die Umwandlung von mRNA in Aminosäuresequenzen stattfindet. Ribosomen bestehen aus zwei Untereinheiten: einer großen, auch 60 S-Unterein-heit genannt, und einer kleinen, der 40 S-Untereinheit. An jedem Ribosom findet man eine Bindungsstelle für die mRNA sowie zwei eng benachbarte Bindungsstellen für tRNA:
.". A-Bindungsstelle: Hier bindet die mit einer Aminosäure beladene Aminoacyl-tRNA. .". P-Bindungsstelle: Hier ist das letzte im letzten Schritt der Translation an ' die wachsende Peptidkette geknüpfte tRNA-Molekül gebunden.
Initiation
Zu Beginn der Translation lagern sich die beiden Untereinheiten des Ribosorns an einer bestimmten Stelle der mRNA zusammen. Diese Stelle ist das soge-
Aminoacyl-tRNABindung
~ Aminoacyl-tRNA
~
j """"'"'" "''" "'
~ r:::L_j I:JGFo-GP-l:J lu T"'""""'
~ I Abb. 2 : Entstehung einer Peptid
kelte an einem Ribosom mit tRNA
rnRNA und wachsender Peptidket;e ]1 7]
...
Genetik 42143
nannte Start-Codon und besteht immer Termination aus der Kombination AUG. Dieses
Abbau der Proteine
Basentripleu kodiert für die Aminosäure Methionin. Für die Anlagerung an die mRNA sind sogenannte Initiationsfaktoren notwendig. An der P-Bindungs- . stelle des Ribosoms ist bereits eine AminoacyHRNA mit Methionin gebunden. Die Synthese kann nun starten, indem an die A-Bindungsstelle das nächste AminoacyHRNA-Molekül entsprechend den fo lgenden drei Nukleoliden der mRNA gebunden wird (I Abb. 2).
Elongation
Die Verlängerung der entstehenden Peptidkette läuft folgendermaßen ab: Das Ribosom wandert drei Nukleotide an der mRNA entlang und bindet passend zum nächsten Codon die zuge· hörige AminoacyJ.tRNA an die A-Bindungsstelle. Mithilfe von Elongationsfaktoren sowie unter Verbrauch von GTP werden das Codon der mRNA und das Anticodon der tRNA mitei· nander verbunden. Eine Peptidyltransferase, die in der großen Untereinheit des Ribosoms enthalten ist, katalysiert nun die Bildung einer Peptidbindung zwischen der Aminosäure auf der P-Bindungsstelle und der neu angekommenen auf der A-Bindungsstelle. Die Aminosäure auf der P-Bindungsstelle wird hierbei von ihrer tRNA abgelöst, und die wachsende Peptidkette hängt nun komplett an der neu angehängten Aminosäure und deren tRNA- eine PeptidyHRNA. Die tRNA der P-Bindungsstelle wird entfernt und die Peptidyl-tRNA von der A- auf die P-Bindungsstelle verschoben. Das Ribosom wandert wiederum ein Codon auf der mRNA weiter. Auch hierbei wird wieder GTP verbraucht, zusätzlich werden Tranlokationsfaktoren benötigt. Die wieder fre igewordene A·Bindungsstelle kann nun eine neue Aminoacyl-tRNA aufnehmen, und eine weitere Aminosäure kann an die wachsende Peptidyi-Kette gebunden werden.
Oie Ableaerichtuns der mRNA Ist von ~· nach 3', die Proteinkette wiehat vom N<ndeln Richtung des c.Endea.
Sobald das Ribosom auf der mRNA eines von drei möglichen Stopp-Codons (UAG, UAA oder UGA) erreicht, wird die Proteinsynthese beendet:
~ Anstelle einer Aminoacyl-tRNA werden Release-Faktoren gebunden. Diese Faktoren beeinflussen die Funktion der Peptidyltransferase. ~ Statt einer Aminosäure wi rd ein Wassermolekül an die wachsende Proteinkette angehängt. Dies hat zur Folge, dass die Bindung der Peptidylkette an das Ribosom gelöst wird. Das fertiggestell te Protein wird nun ans Zytoplasma abgegeben. ~ Das Ribosom zerteilt sich wieder in seine beiden Untereinheiten, und die mRNA ist frei. Ribosom und mRNA sind also wieder bereit für eine erneute Proteinsynthese.
Hemmstoffe der Translation
Die Translation ist der Angriffspunkt vieler Medikamente. Durch die Wirkungsweise einiger Anitbiotika wird die Proteinsynthese von Bakterien gestoppt (I Tab. 1 ).
Die vorhandene Menge eines jeden Eiweißes wird genau kontrolliert. Der Abbau der Proteine wird auch als Proteolyse bezeichnet. Ein sehr kleines Protein, Ubiquitin, ist dafür zuständig, die Proteine zu markieren, die abgebaut werden sollen. Hierbei handelt es sich zum einen um solche, die von Haus aus nur eine kurze Zeit leben sollen. Außerdem werden Proteine markiert, die beschädigt oder durch Fehler in der Translation nicht richtig funktionsfähig sind. Ein durch Ubiquitin markiertes Protein wird ans Proteasom gesandt. Hier läuft es durch den sogenannten Zentralkanal, in dem sich Proteasen befinden, die für die Zerkleinerung der Proteine zuständig sind. Zuerst wird durch diese Proteasen das lange Protein in kürzere Peptidstücke zerschnitten und dann weiter in die einzelnen Aminosäuren zerlegt. Die einzelnen Aminosäuren werden nun entweder wieder in der Translation verwendet, abgebaut oder für die Synthese anderer Aminosäuren gebraucht.
Tetrazyk lin Verhindert die Bindung der Aminoacyl-tRNA an die A-Bindungsste lle der Ribosomen bei Bakterien
Streptomycin Führt zum Abbruch der Translation, indem es den Übergang von Initiation zu Elongation verhindert
Chloramphe- Hemmung der Peplidyltransferase nicol
I Tab. 1: Antibiotika - Hemmstoffe der Trans lation, die man gegen bakterielle Infektionen einsetzt.
Zusammenfassung X Bei der Translation wird die auf der mRNA in Codons gespeicherte Infor
mation für die Synthese von Proteinen mithilfe von tRNAs entschlüsselt.
• Die Proteinbiosynthese findet an den Ribosomen statt. Diese bestehen aus
zwei Untereinheiten, die sich für diesen Vorgang zusammenlagern. Es gibt
Bindungsstellen für die tRNA und die mRNA.
X ln der Initiationsphase wird als erste Aminosäure stets Methionin am Ribo
som befestigt. Hieran wird dann in der Elongationsphase durch die Bildung
von Peptidbindungen die restliche Peptidkette nach und nach angeknüpft.
X Der Abbau der Eiweiße findet durch Proteasen statt. Dieser Prozess, auch
Proteolyse genannt, findet im Proteasom statt.
Prozessierung und Zielsteuerung von Proteinen
Schon während und auch nach der Translation werden die entstehenden Proteine weiter verändert, damit sie ihre spätere biologische Fu nktion erfüllen können. Man spricht von ko- und posttranslationeHer Modifizierung. Nach der Translation werden die Proteine zuerst gefaltet. Dann werden sie weiter verändert und erhalten Signalsequenzen, die dafür sorgen, dass die Proteine an ihr Ziel, ihren Wirkungsort in der Zelle gebracht werden. Zuletzt erfolgen weitere Prozessierungen wie beispielsweise Glykosylierung.
Prozessierung der Proteine
Faltung
Als Primärstruktur der Proteine bezeichnet man die Abfo lge der Aminosäuren, die in der Translation aneinandergebunden werden. Schon während der Synthese und auch posttranslationeil werden die Proteine nun gefalten , es entsteht die Ter
tiärstruktur. Die Faltung übernehmen vor allem sog. Chaperone, Moleküle, die an die wachsende Peptidkette binden und diese erst freigeben, wenn das Protein fertig gefaltet wurde. Eigentlich ist Faltung ein thermodynamisch regulierter Prozess, der von selbst abläuft. Um ihn zu beschleunigen, sind jedoch noch weitere Faktoren nötig, wie die PeptidylProlyl-Isomerase und die Proteindisulfid-Isomerase. Das fertig gefaltete Protein wird stabilisiert durch die Ausbildung von Wasserstoffbrücken innerhalb des Proteins und durch Wechselwirkungen, den Van-der-Waals Kräften zwischen den unterschiedlich geladenen Aminosäuren.
Modifizierung
Viele Proteine werden nach der Translation modifiziert. Die wichtigsten Modifizierungsmechanismen sind folgende:
~ Glykosylierung: Hierbei handelt es sich um die am häufigsten stattfindende Proteinmodifizierung, es wird eine Kohlenhydratkette ans entstandene Protein gebunden. Sie findet entweder im Lumen des endoplasmatischen Retikulums oder im Golgi-Apparat statt. Intrazelluläre Proteine werden im Gegensatz zu extrazellulären, lysosomalen und Membranproteinen nicht glykosyliert. Die Glykosylierung erhöht beispielsweise die Löslichkeit von Plasmaproteinen , gibt dem Protein mehr Stabilität, schützt so vor dem Abbau durch Proteasen und erleichtert es anderen Molekülen, das Protein zu erkennen. ~ Phosphorylierung: Durch Phosphorylierung werden viele Proteine und auch Enzyme reversibel aktiviert bzw. inaktiviert. ~ Hydroxylierung: Dies geschieht vor al lem in Kollagenen. Hier werden die in den Proteinen enthaltenen Aminosäurereste Prolyl und Lysyl hydroxyliert. Dies ermöglicht unter anderem die Ouervernetzung des Ko llagens. ~ Acetylierung: Ans n-terminale Ende vieler Proteine wird eine Acetylgruppe angehängt. ~ Carboxylierung: Diese Modifizierung findet am Glutamat statt. Dies ist wichtig für die Entstehung einiger Blutgerinnungsfaktoren .
Zielsteuerung der Proteine
Proteine gelangen nach der Synthese an den Ribosomen an ihren endgül tigen Bestimmungsort. Dies ist durch Signalsequenzen auf der mRNA kodiert. Eine erste Sequenz legt fest, ob die komplette Synthese der Proteine an freien Ribosomen stattfindet. Dies ist bei Proteinen der Fall, die nach Beendigung der Translation im Zytosol bleiben. Synthetisiert ein Ribosom ein sekretorisches Protein, so wird es während der Translation am rauen ER fixiert, und das Protein wird ins Lumen des rER abgegeben. Eine weitere Signalsequenz bestimmt den endgültigen Zielort der fertiggestellten Proteine. Dieser kann innerhalb oder außerhalb der Ze lle sein (I Abb.l ).
Proteine im Inneren der Zelle
Enthält die mRNA nur eine Signalsequenz, so findet die komplette Translation an den freien Ribosomen der Zelle statt.
Zytosolische Proteine Proteine, deren Wirkungsort im Zytosolliegt, werden nach Fertigstellung von den Ribosomen ins Zytosol abgegeben und können dort ihre Funktion erfüllen.
Mitochondriale Proteine Ein Teil der Proteine, die in den Mitochondrien vorkommen werden von diesen selbst synthetisiert. Die restlichen müsse~ 1m Zytosol hergestellt werden und dann durch die doppelte Membran, welche die Mitochondrien umgibt, in ihr Inneres transportiert werden. Für den Transport über die Membran sind Proteine nötig. Sog. TOM-Proteine ermöglichen den Transport der Proteine über die äußere Mitochondrienmembran, die TIM-Proteine den über die innere. Um durch die Membran zu gelangen, müssen die Proteine vollkommen entfaltet sein. Nach dem Transport wird die Signalsequenz
' die das Protein ins Mitochondrium gelenkt hat, von einer Signalpeptidase abgespalten, und somit kann das Protein nicht zurück ins Zytosol ge langen.
Nukleäre Proteine Proteine, die für den Zellkern bestimmt sind, tragen so genannte Kernlokalisationssequenzen, auch NLS (nuclear localisation signal) . Durch Ke rnporen können die Proteine in den Zellkern gelangen. Diese Poren können in offenem
~Protein~
Zytosol Endoplasmatisches Retikulum
Mitocho~ 1 ! Golgi-Apparat
------..... Zellkern
.--- 1-------... Sekretion Membra ne11
Peroxisomen
Lysosomen
I Abb. 1: Transportwege von Proteinen
-
oder geschlossenem Zustand vorliegen, nur in offenem Zustand ist ein Proteintransport möglich. So besteht die Möglichkeit, den Transport von Proteinen in den Kern genau zu regulieren. Kleine Proteine können bei geöffneten Poren durch einen zentralen Kanal ins Innere des Kerns gelangen. Bei großen Proteinen ist hierfür ein aktiver Transportprozess nötig.
Peroxisomale Proteine Proteine, deren Ziel die Peroxisomen sind, enthalten eine kurze Signalsequenz, die das Ziel angibt. Sie werden komplett an den freien Ribosomen synthetisiert und ansch ließend ins Innere der Peroxisomen abgegeben.
Proteine außerhalb der Zelle
Proteine, die nach der Synthese in den Extrazellulärraum transportiert werden, werden nicht komplett an den freien Ribosomen hergestellt. Sie durchlaufen den sekretorischen Weg der Proteinsynthese (I Abb. 2). Eine Signalsequenz, die von sog. Signalerkennungspartikeln erkannt wird , lenkt die Ribosomen ans raue ER, wo sie an einen Rezeptor binden. Hier findet nun die restliche Translation der Proteine statt. Das wachsende Protein wird so am ER fixiert, dass das Protein während der Synthese direkt in einen Translokationskanal wächst, der das Protein ins Lumen des ERs leitet. Sobald die Synthese des Proteins beendet ist, schneidet eine Signalpeptidase die Signalsequenz ab, die den Weg zum ER geleitet hat, und das Protein befindet sich im Inneren des ER. Vom ER aus wandert das Protein als nächstes zum Golgi-Apparat.
Sekretorische Proteine Sekretorische Proteine, wie zum Beispiel das Hormon Insulin, enthalten keine weiteren Signalsequenzen mehr. Sie werden im Golgi-Apparat in Vesikeln verpackt, wandern dann an die Zelloberfläche und werden dort sezerniert.
Membranproteine Proteine, die in eine Membran eingebaut werden, werden bei der Synthese
am rauen ER nicht in dessen Lumen abgegeben. Sie enthalten eine Signalsequenz, die während der Translation zum Verschluss des Translokationskanals führt. So werden die Proteine in der Membran des ER verankert. Neue Membranen werden aus Membranen des ER und des Golgi-Apparats hergestellt, die in der Membran benötigten Proteine werden somit gleich bei ihrer
Sekretorischer Weg
Nukleus
' .-· ·!
Golgi-Apparat
Export
Genetik 44145
Synthese dort eingebaut, wo sie gebraucht werden.
Lysosomale Proteine Lysosomale Proteine wandern ebenfalls zum Golgi-Apparat. Hier findet auch die Herstellung der Lysosomen statt. Die Proteine werden wiederum in Vesikeln verpackt und an die Lysosomen abgegeben.
' )
\.___/ Lys~om I Abb. 2: Der sekretorische Weg der Proteine [51
Zusammenfassung X Während und nach der Translation werden die Proteine prozessiert. Es fin
det eine Faltung statt, durch die die Proteine die Tertiärstruktur erhalten. X Als Nächstes werden viele Proteine modifiziert, was Ihnen unterschiedliche
Funktionen verleiht. Hierbei kann es beispielsweise durch eine Phosphorylierung zur Aktivierung von Enzymen oder durch Glykosylierung zu einer Stabilisierung der Proteine kommen.
X Proteine, die fürs Innere der Zelle bestimmt sind, werden komplett an den freien Ribosomen translatiert. Ihr Zielort können das Zytosol, die Mitochondrien, der Zellkern oder Peroxisomen sein.
X Proteine fürs Zelläußere werden am rauen ER zu Ende synthetisiert. Sie durchlaufen den sekretorischen Weg und werden entweder in den Extrazellulärraum sezerniert, in Membranen eingebaut oder zu lysosomalen Proteinen.
Regulation von Zellwachstum und Genexpression
Wachstum, Proliferation und Differenzierung von Zellen unterliegen im mehrzelligen Organismus strengsten Kontrollmechanismen, da nur so eine optimale Funktion des Gesamtorganismus gewährleistet werden kann. Was passiert, wenn die Proliferation einer Zelle außer Kontrolle gerät, wird uns in der Klinik leider viel zu oft vor Augen geführt: Es kommt zur Entstehung von Krebs.
Zellzyklus
Als Zellzyklus (I Abb. 1) bezeichnet man den Kreislauf der Zelle zwischen einer Zellteilung und der nächsten. Man unterteilt den Zellzyklus in verschiedene Phasen:
11>- Die Teilung der Zelle spielt sich in der Mitose-Phase (M-Phase) ab. Die einzelnen Schritte der Zellteilung (Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase) dürften jedem aus dem Biologieunterricht bekannt sein. 11>- Bevor die Zelle geteilt werden kann, muss ihre DNA verdoppelt werden (Replikation), was in der S-Phase (Synthese-Phase) geschieht. 11>- Die Zeit, die zwischen der Mitose und der nächsten DNA-Replikation vergeht, bezeichnet man als G1-Phase, die Zeit zwischen der DNA-Synthese und der Zellteilung wiederum als G2-Phase (das G steht hierbei für gap, also Lücke). 11>- Eine Zelle kann sich auch komplett aus dem Zellzyklus ausklinken und für sehr lange Zeit ruhen, ohne sich zu teilen. Sie befindet sich dann in der G0-Phase. Manche Zellen verbringen ihre ganze Lebensdauer ohne zu proliferieren in dieser Phase (z. B. Motoneuronen).
GI"", S.. und Gr.Pflase fasst man auch als Interphase zusammen.
Regulation des Zellwachstums
Eine Zelle proliferiert in der Regel nur, wenn sie durch ein bestimmtes Signal dazu angeregt wird. Diese Signale werden von anderen Zellen ausgeschüttet und können zum Beispiel Wachstums-
faktorenoder Zytokine (s . Kap. 82 und 98) sein. Meistens wirken mehrere Signale gleichzeitig auf eine Zelle, und erst deren Kombination entscheidet darüber, was mit der Zelle geschieht, also ob sie sich teilt, differenziert oder spezialisiert. Das Signalmolekül dockt an den Rezeptor der Zielzelle an und setzt eine Kas· kade in Gang, die letztendlich zum Ziel hat, das Muster der Genexpression insoweit zu verändern, dass die Zelle je nachdem, was gewünscht wird entweder zur Proliferation oder zur Differenzierung veranlasst wird. Dies kann über verschiedene Mechanismen geschehen, die aber alle entweder die Aktivierung eines Transkriptionstaktors oder die Inaktivierung von Inhibitoren ei nes Transkriptionstaktors zur Folge ha· ben, was zum gleichen Ergebnis führt.
Aktiv ierung durc h Tyrosi nkinase
Rezepto ren Die meisten Wachstumsfaktor-Rezeptoren sind Tyrosinkinasen, die sich nach Bindung des Signalmoleküls autophosphorylieren. Im phosphorylierten Zustand können sie Adapterproteine (z. B. Grb) binden, die wiederum Andockstellen für weitere Proteine (z. B. Sos) besitzen. Beispiel: Die Bindung eines Wachstumshormons an seinen Rezeptor bewirkt dessen Autophosphorylierung. Nun kann ein Grb-Protein (= growth factor bound] daran binden, das wiederum Andockstellen für weitere Proteine bietet, wie z B. für Sos ( = son of sevenless), einem Ras-Aktivator-Protein. Dieses bewirkt durch den Austausch von GDP gegen GTP am Ras-Protein dessen Aktivierung, wodurch wiederum eine Phosphorylierungs-Kaskade (die sog. Ras-Kaskade) in Gang gesetzt wird.
Die Ras-Kaskade Die Ras-Kaskade dient der Übertragung des Wachstumshormonsignals von der Plasmamembran in den Zellkern über eine Reihe von Proteinkinasen, die sich nacheinander phosphorylieren und dadurch aktivieren. Die Reihenfolge ist dabei folgende: aktiviertes Ras phosphoryliert Raf (Serin/ Threonin-Kinase) - > aktiviertes Raf phosphoryliert MEK
(Serin/Threonin-Kinase] --t aktiviertes MEK aktiviert die MAP-Kinase. Diese kann die Kernmembran passieren und Genregulatorproteine phosphorylieren die dadurch aktiviert werden und auf ' die Genexpression Einfluss nehmen können. Neben Ras-Aktivator-Proteinen (z. B. Sos) gibt es auch Inhibitoren der RasKaskade. Das Protein GAP (GTPase aktivierendes Protein) führt zur Hydrolyse des am Ras gebundenen GTP zu GDP und hat somit dessen Inaktivierung zur Folge.
Wirkung von Wachstumsfaktoren
über die Inaktivierung von Rb Das Rb-Protein (Rb steht für Retinablastom, da es in diesem Zusammenhang zum ersten Mal beschrieben worden ist) inhibiert in ruhenden Zellen einen Transkriptionstaktor (E2), der für die Einleitung der S-Phase von Bedeutung ist. Die Funktion des Rb-Proteins ist somit die Hemmung der Proliferation, was ihm eine zentrale Rolle in der Wachstumsregulation eingebracht hat. Wachstumsfaktoren können zur AktiVierung bestimmter Kinasen führen, die Rb phosphorylieren und damit inaktivieren Die Hemmung von Genaktivatoren · durch Rb ist nun aufgehoben, und es kommt zur Zellproliferation. Diese Kinasen sind Cyclin-abhängig und werden daher auch als Cyclin-abhängige Kinasen (Cdk = Cyclin-dependent kinases) bezeichnet.
Bedeutung der Cycline Cycline sind Proteine, die sich während des Zellzyklus zyklisch auf- und wieder abbauen (daher auch der Name). Es gibt verschiedene Arten von Cyclinen, die jeweils typischerweise in einer Phase des Zellzyklus in hoher Konzentration vorkommen. Man geht daher davon aus, dass Cycline in Zusammenarbeit mit den Cdk für den Eintritt der Zelle in die verschiedenen Zell zyklusphasen benötigt werden (I Abb. I).
Zellzyklus-Kontrollsystem
Um eine gefürchtete unkontrollierte Zellproliferation zu vermeiden, hat der Körper ei n Kontrollsystem entwickelt
'
...
I Abb. 1: Zellzyklus und Einfluss der Cycl ine [16]
mit dem die Schritte des Zellzyklus ständig überwacht werden können_ Ein wichtiger Kontrollpunkt ist der Restriktionspunkt zwischen der G1 und der S-Phase_ Hier wird grünes Licht für die DNA-Replikation gegeben (oder eben nicht) . Am G2/M-Kontrollpunkt wird die replizierte DNA gründlich nach Fehlern untersucht, bevor die Zelle zur Mitose zugelassen wird.
Rolle des p53 Weiter oben ist die Rolle des Rb-Proteins in der Zellzykluskontrolle bereits besprochen worden. Ein weiteres Protein, das die Zellproliferation hemmt, ist das p53. Will sich eine Zelle mit fehlerhaftem Genmaterial tei len, oder sind während der Replikation DNA-Schäden aufgetreten, so spürt p53 diese auf und veranlasst das Anhalten des Zellzyklus, bis der Schaden repariert worden ist. Lässt sich der Fehler nicht mehr beheben, so leitet es den programmierten Zelltod (Apoptose) ein (s. Kap. 48). p53 ist ein Transkriptionsfaktor, der durch DNA-Schäden aktiviert wird, und daraufhin die Transkription eines Proteins (p21) initiiert. p21 ist ein Inhibitor von Cyclin-Cdk-Komplexen, der verhindert, dass der Zellzyklus in die nächste Phase übergehen kann. Dies führt zum Arrest des Zellzyklus v. a. am G/ S- aber auch am G/M-Übergang, was die Entstehung somatischer Mutationen - und damit die Krebsentstehungverhindern soll (s. Kap. 48)_ Aufgrund dieser Kontrolleigenschaft wird das p53 auch als "Wächter des Genoms" bezeichnet.
Allgemeine Prinzipien der Genregulation
Im Zusammenhang mit Zellwachstum und -differenzierung, aber z. B. auch bei der interzellulären Kommunikation (Hormonwirkungen etc.) spielen Regulationsmechanismen eine Rolle, die auf genetischer Ebene, also über Änderungen im
Genetik 46147
Genexpressionsmuster, ablaufen. Die Bedeutung der Genregulation wird einem sehr deutlich vor Augen geführt, wenn man überlegt, wie viele morphologisch und funktionell unterschiedliche Zellarten wir haben, die aber alle über die gleiche DNA verfügen. Der Trick dabei ist, dass sie verschiedene Gene exprimieren und daher ganz unterschiedliche Proteine synthetisieren.
Transkriptionstaktoren Die Genexpression wird meist auf der Stufe der Initiation der Transkription gesteuert, hier entscheidet sich also, ob ein Gen exprimiert wird oder nicht. Für die Transkription eines Gens benötigt die RNA-Polymerase die Hilfe von Transkriptionsfaktoren, die sie am Promotor positionieren und ihr somit die Initiation ermöglichen .
..,. Allgemeine Transkriptionstaktoren sind sehr unspezifisch und für jede Transkription notwendig. Sie kommen ubiquitär vor und sind weniger an der Genregulation beteiligt. .".. Die spezifischen Transkriptionstaktoren sind die tatsächlichen Regulatoren der Genexpression. Sie binden an DNA-Abschnitte mit spezifischen Sequenzen, sog. Enhancer oder Silencer, und vermitteln über diese eine Steigerung oder Verminderung der Expressionsrate. Solche regulatorischen Transkriptionstaktoren stehen oft am Ende einer Signalkaskade, die durch die Bindung eines Effektors an einen Rezeptor ins Rollen gebracht wird. Die Aktivität eines Transkriptionstaktors kann beispielsweise über Ligandenbindung (Steroidhormone), Phosphorylierungen oder Konzentrationsänderungen gesteuert werden.
Zusammenfassung ac Der Zellzyklus wird in vier Phasen unterteilt (M-, G,-,
S- und G2-Phase).
• Zellen müssen durch Signale (z. B. Wachstumshormone) zur Proliferation bzw. Differenzierung angeregt werden.
• Rb und p53 sind Proteine, die den Zellzyklus kontrollieren. Rb verhindert die Einleitung der 5-Phase. p53 kann beim Auftreten von DNA-5chäden den Zellzyklus stoppen und so die Entstehung somatischer Mutationen verhindern.
• Die Genexpression wird über spezifische Transkriptionsfaktoren, die an regulatorische DNA-5equenzen (Enhancer, Silencer) binden, gesteuert.
DNA-Schäden, Reparatur und Onkogenese
Damit in folge von DNA-Schäden keine gefährlichen Mutationen entstehen, verfügen wir über ausgefeilte Reparatursysteme, die Fehler in der DNA schnell erkennen und reparieren können. Diese Reparatursysteme sind vor allem auf die Korrektur spontaner DNA-Veränderungen spezialisiert, daher sind Entstehung und Prol iferation mutierter Zellen (Onkogenese) oft auf das Einwirken eines Mutagens zurückzuführen.
DNA-Schäden
Entstehung von DNA-Defekten
Man unterscheidet bei der Entstehung von Mutationen drei Mechanismen:
..,. Einerseits kommt es immer wieder zu spontanen Veränderungen der DNA. Am wichtigsten sind hierbei spontane Desaminierungen an den Nukleotiden, wodurch z. B. Cytosin in Uracil oder Adenin in Hypoxanthin überführt wird . Da diese Nukleotide normalerweise nicht in der DNA vorkommen, werden sie von Reparatursystemen erkannt und durch die richtige Base ersetzt. Eine andere Ursache für spontane DNA-Schäden ist die thermische Depurinierung, d. h. die Abspaltung der Purinbase von der Desoxyribose. ..,. Induzierte DNA-Schäden entstehen durch das Einwirken exogener Mutagene. Bei diesen handelt es sich meist um chemische Stoffe (Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Zigarettenrauch usw.) oder energiereiche Strahlung (z. B. UV-Licht, radioaktive Strahlung), aber auch manche Viren (z. B. Retroviren) können die DNA ihrer Wirtszelle schädigen. ..,. Zuletzt können auch während der Replikation DNA-Schäden entstehen. Nicht selten baut die DNA-Polymerase Fehler in den Tochter-Strang ein, die aber in der Regel durch ein "hauseigenes" Reparatursystem der DNA-Polymerase sofort behoben werden. Nur ein Bruchteil der Fehler bleibt unentdeckt, was aber auch kaum Konsequenzen hat, da die replizierte DNA vor der Zelltei-
Jung in der G2·Phase noch einmal kontrolliert und ggf. repa riert wird.
Folgen einer Mutation
Wird ein DNA-Schaden nicht durch einen der Reparaturmechanismen beseitigt, so ist eine Mutation entstanden. Diese bleibt erhalten und wird bei jeder Zellteilung an die Tochterzelle weitergegeben. Oft hat eine Mutation keinerlei Folgen für den Gesamtorganismus, z. B. wenn die Mutation in einem Bereich der DNA geschieht, der keine Bedeutung hat (z . B. Introns, nicht kodierende DNAAbschnitte), oder wenn der Schaden nur zum Untergang dieser einzelnen Zelle führt.
Somatische Mutationen Mutiert eine somatische Zelle, also eine Zelle irgendeines x-beliebigen Körpergewebes, so besteht die Gefahr, dass Gene betroffen sind, die für das Zellwachstum oder die Zelldifferenzierung zuständig sind. Dies ist insofern problematisch, da es dadurch zum unkon· trollierten Wachstum eines Zellklons kommen kann (Onkogenese, s. u. ), was natürlich schlimme Folgen für den Gesamtorganismus hätte.
Keimbahnmutationen Die wichtigsten Folgen von Keimbahnmutationen sind Enzymdefekte. Mutiert eine Keimbahnzelle im Bereich eines Gens, das für ein Enzym kodiert, so wird dieser Defekt an alle weiteren TochterzeLlen weitergegeben. Das Kind, das diesen Enzymdefekt geerbt hat, trägt ihn also in allseinen Zellen, was je nach betroffenem Gen zu unterschied· lichsten Erkrankungen führen kann .
Arten von Mutationen
Man unterscheidet bei den DNA-Mutationen verschiedene Formen, je nachdem, ob Basen vertauscht worden (Substitution), verloren gegangen (Deletion) oder zusätzliche Basen hinzugekom-
men (Insertion) sind. Betrifft eine Mutation nur eine ei nzelne Base, wird sie als Punktmutation bezeichnet.
lll> Bei der Substitution werden einzelne Basen durch andere Basen vertauscht_ Oft ha t eine Substitution - auch wenn sie in ei nem kodierenden Bereich liegt_ keme Konsequenzen, da verschiedene Basen-TripJetts für dieselbe Aminosäur kodieren können( = sti lle Mutation) . e lll> Deletionen und Insertionen sind insofern problematisch, da es durch d Fehlen bzw. Hinzukommen einer Ode~s mehrerer Basen zu einer Leserasterverschiebung (= Frame-shift-Mutation kommen kann, was dazu führt, dass ) eine falsche Aminosäure nach der anderen aneinandergereiht wird (I Abb. 1) . lll> Chromosomenmutationen sind Mutationen größerer DNA-Abschnitt denen der Bruch eines Chromosoms
e,
vorausgeht, und die zu strukturellen Veränderungen des Chromosoms führen. Man unterscheidet hier den Verlu . Ch st emes romosomenbruchstücks (De-
letion), den spiegelverkehrten Einbau eines Bruchstücks ins Chromosom (Inversion) und den Austausch von Bruchstücken zwischen zwei Chromosome (Translokation). n
Schutz vor Mutationen
DNA-Repa ratu rsysteme
Bei der Aktivierung der Reparatursysteme spielt das p53-Protein eine entscheidende Rolle. Dessen Konzentrati
· b · A f on ste1gt e1m u treten größerer DNA-Schäden durch bisher ungeklärte Mechanismen rasch an, und führt zu ein em Arrest des Zellzyklus. Nun kann die Reparatur eingeleitet werden. Sind die Schäden zu groß, als dass sie noch beh ben werden können, aktiviert das p53 oeine Protein-Kaskade ( Caspasen), die den programmierten Zelltod (Apoptos ) der Zelle induziert. e
Ablauf der Reparatur Wird ein fehlerhafter DNA-Abschni tt entdeckt, so wird die betroffene Base erst einmal durch ine DNA·GlykosyJ herausgeschnitten. Eine Endonukleas ase entfernt anschließend das verbleibend:
...
- Bildung eines neuen Proteins
-nun basenlose - Desoxyribosephosphat aus der DNA (Basen-Exzisionsreparatur). Die Nukleotid-Exzisionsreparatur läuft ähnlich ab, mit dem Unterschied, dass die entfernten DNAAbschnitte in der Regel länger sind und das Nukleotid komplett inklusive Base und Desoxyribosephosphat herausgeschnitten wird.
Einzelstrang- vs. Doppelstrangschäden Ist nur ein Strang geschädigt (Einzelstrangschaden), kann der korrekte Strang als Matrize für die Neusynthese des fehlenden Abschnittes durch die DNA-Polymerase-a verwendet werden. Die DNA-Ligase verbindet zuletzt das neu entstandene Nukleotidstück mit der ursprünglichen DNA. Die Reparatur von Doppelstrangschäden, die vor allem infolge ionisierender Strahlung auftreten, ist etwas komplizierter. Das Reparatursystem kupfert hierbei die korrekten Nukleotidsequenzen vom homologen Chromosom ab, und kann so den korrekten Strang wiederherstellen (homologe Reparatur). Bei der fehlerbehafteten, nicht homologen Reparatur werden die geschädigten und noch einige intakte Nukleotide entfernt, bis beide Stränge mehr oder weniger übereinstimmen und wieder zusammengefügt werden können.
Apoptose
Im Gegensatz zur Nekrose, die ein unkontrolliertes Absterben einer Zelle infolge einer starken Schädigung darstellt, ist die Apoptose ein kontrollierter Vorgang, der ein geplantes Zugrundegehen einer Zelle zur Folge hat. Ist eine Zelle irreparabel geschädigt (z. B. in fo lge von DNA-Schäden) oder herrscht innerhalb einer Zelle Sauerstoffmangel, so
ohne Mutation
mit Mutation
I Abb. I : Schematische Darstellung einer Frame-shift
Mutation
leitet sie zum Schutz des Gesamtorganismus ihren eigenen Zell tod ein. An diesem Vorgang ist das p53 maßgebend beteiligt (s.o.). Oft wird die Apoptose auch durch benachbarte Zellen induziert, was dann meist im Rahmen von physiologischen Reaktionen geschieht (z. B. Einleitung der Menstruationsblutung) und durch Botenstoffe (Zytokine wie TNF-a, Glukokortikoide usw.) vermittelt wird. Am Apoptosevorgang sind eine Reihe von proteolytischen Enzymen, die sog. Caspasen, und die Mitochondrien beteiligt. Die Caspasen sind Cystein-Proteasen, die hinter Aspartat schneiden und die Zerstörung der Zelle bewerkstelligen.
Onkogenese
Krebs entsteht, wenn sich eine Zelle den Mechanismen der Wachstumsregulation entzieht und sich unkontrolliert teilt. Dies geschieht infolge einer Mutation in einem Genabschnitt, der an der
Zusammenfassung
Genetik 48149
Kontrolle von Zellwachstum und Proliferation beteiligt ist.
Protoonkogene und Tumorsuppressorgene Gene, die für Proteine kodieren, die das Wachstum bzw. die Proliferation einer Zelle aktivieren (z. B. ras), bezeichnet man als Protoonkogene (oder c-Onkogene). Gene, die für Proteine kodieren, die Zellwachstum hemmen oder kontrollieren (z. B. p53 oder rb), bezeichnet man als Tumorsuppressorgene. Zum unkontrollierten Wachstum kann es nun durch Überexpression von Protoonkogenen ("gain of function mutations") oder Funktionsverlust von Tumorsuppressorgenen ("loss of function mutations") kommen.
Beispiele für Krebsentstehung .,._ Durch eine Punktmutation in einem Protoonkogen (z. B. ras) entzieht es sich der Kontrolle regulierender Proteine und wird dadurch zu einem echten Onkogen. .,._ Werden DNA-Segmente, die ein Protoonkogen enthalten, dupliziert (Genamplifikation), kommt es zu einer Überexpression dieses Protoonkogens und damit zur Krebsentstehung. .,._ Ein Protoonkogen gerät unter die Kontrolle eines fremden Promotors und wird dadurch überexprimiert (z. B. infolge einer Chromosomentranslokation).
X Eine Mutation kann spontan geschehen oder durch ein Mutagen induziert
sein.
X Mutationen können Körperzellen (somatische Mutation) oder Keimbahnzel
len (Keimbahnmutation) betreffen, was unterschiedliche Auswirkungen hat. X Es gibt Kontroll- und Reparatursysteme, die DNA-Schäden aufspüren und
reparieren können. Ist der Schaden irreparabel, wird der programmierte
Zelltod eingeleitet (Apoptose).
X Mutationen in Genen, die das Zellwachstum regulieren (Protoonkogene, Tumorsuppressorgene), können zur Krebsentstehung führen (Onkogenese).
Gentechnologie
DNA-Technologien nehmen in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung zu und haben uns schon zahlreiche Erkenntnisse über genetisch bedingte Erkrankungen gebracht. Versuche zur Gentherapie stellen einen vielversprechenden, aber auch umstrittenen Ansatz in der Behandlung bisher unheil barer Erkrankungen dar. Die wichtigsten Methoden in der DNA-Technologie werden in diesem Kapitel beschrieben.
Polymerase-Kettenreaktion
Die Polymerase-Kettenreaktion (= polymerase chain reaction, PCR) ist eine Methode zur Vervielfältigung einer bestimmten DNA-Sequenz. Hierbei kann aus jeder DNA eine beliebige Nukleotidsequenz schnell und selektiv ampl ifiziert werden.
Das Prinzip der Polymerase-Kettenreaktion ist relativ einfach: Es funktioniert ähnlich wie die Replikation, im Gegensatz zu dieser wird hier aber selektiv nur ein bestimmter Teil der DNA repliziert. Man benötigt hierzu die dazugehörigen Primer (=kurze DNA-Einzelstrangstücke aus ca. 20- 30 Nukleotiden), die die zu amplifizierende DNA-Sequenz vorgeben, sowie Nukleotide (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) als Bausteine für die neu gebildete DNA. Als Enzym wird eine hitzestabile DNA-Polymerase verwendet. Ein PCR·Zyklus erfolgt folgendermaßen:
.,.. Durch Erhitzung auf ca. 90 oc wird der DNA-Doppelstrang getrennt (Denaturierung). .,.. Die anschließende Abkühlung der Reaktionslösung ermöglicht den Primern, an die DNA-Matrize zu binden (PrimerAnnealing). .,.. Im letzten Schritt verlängert die Polymerase den Prim er, mit dem Endresultat, dass der gewünschte DNA-Abschnitt
-r-r-r-r-r-r-r-r-.r-.r-.r-rT-rT-rTTTTTT 5'
~: 1111 11111111111 111111 1111 3'
Erhitzen l 3' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 5
' 1. Schritt
.--1 S"-tr.:..:an""gt-'-"re-nn-u-ng' l
5. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 3'
Abkühlen r Primer
3' I I I lill l I I I I I I I I I I I I I I I I I 5' ~2~. S=c~hr~itt ________ , Anlagerung des
5• I I I I I I I I I I I I I I I I I Im I I I I 3' Pnmers (= Hybridisierung)
r DNA-Polymerase + Nukleolides (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)
3, 1 1 1 ~- I I I II I II I I I I I I I I I I I I I ~ ~: r-
3
0-·Ns_Ach_Srit_t
1-h - --,
3- ~ 5• - yn ese
5, I I I I I I I I I I I I I I I II I l I l 1 1 1 1 3, ausgehend vom Pnmer
1 Abb. 1: Ein Zyk lus der Polymerase-Kettenreaktion
verdoppelt wi rd (Elongation). Für optimale Arbeitsbedingungen der Polymerase muss eine für sie spezifische Temperatur gewäh lt werden.
Diesen Zyklus ka nn man nun beliebig oft wiederholen, Wobei sich die Zahl der geb ildeten Doppelstränge bei jedem Zyklus verdoppelt. So erhält man nach 2, 3, 4 oder 5 Zyklen, die 4 _ 8-, 16-, bzw. 32-fache Menge der ursprünglichen DNA. Wie: derholt man den Zyklus 30-mal, erhält man im Optimalfall die 230.Fache Menge.
Genanalyse
Diese Methode zielt darauf hin, einzelne Gene innerhalb des gesamten Genoms darzustellen und zu analysieren. Dies kan beispielsweise sinnvoll sein , um herauszufinden, ob ein Kind n dessen Eltern heterozygote Träger einer vererbbaren Krank- ' heit sind, gesund oder krank sein wird. Der Nachweis geschieht in mehreren Schri tten:
.,.. I. Isolation der DNA aus den Zellen der zu untersuchenden Person [z. B. ungeborenes Kind ), .,.. 2. Fragmentierung der DNA mithilfe von Restriktionsendonukleasen, .,.. 3. Elektrophoretische Auftrennung auf einem Agarosegel und anschließende Fixierung der DNA auf einem Nylonfilte .,.. 4. Sichtbarmachen der spezifischen, zu untersuchenden r, DNA-Sequenz mittels Hybridisierungstechniken.
Restriktionsendonukleasen
Restriktionsendonukleasen (RE) sind bakterielle Enzyme, die DNA in viele kleine Fragmente zerschneiden können . Den Bakterien dienen sie als Schutz vor fremder DNA (Phagen), im Menschen kommen sie nicht vor. In der Gentechn logie werden diese dazu verwendet, isolierte DNA in Stück o-definierter Länge zu zerschneiden. Hierbei binden die e verschiedenen REs an jeweils für sie spezi fi sche Nukleotidsequenzen und schneiden die DNA in der Bindungsstelle du rch . Diese Schnittstellen für REs bestehen aus 4- 8 Basenpaaren und sind meist pal indromisch aufgeba ut, wie z. B. die Sequenz CAGCTC (die komplementären Basen, von hinten gelesen, ergeben die gleiche Sequenz) .
Gelelektrophorese
Geladene Makromolekü le wie Proteine und Nukleinsä uren lassen sich aus einem Molekülgemisch heraustrennen, inde man sie auf ein Gel aufträgt (sog. Träger-Gel), und an diesesrn ein elektrisches Feld anlegt. Die verschiedenen Moleküle wandern aufgrund ihrer Eigenschaften auf dem Gel mit unt schiedlicher Ges~hwin.d igkeit. Die Wand_erungsgeschwindig~rkeit eines Molekuls hangt von semer Große, Fo rm und Nettoladung ab sowie von der angelegten pan nung. So kommt auf dem Gel zu r Bildung verschiedener Banden, die jeweu:s identische Molek üle enthalten.
Hybridisierung
Darunter versteht man die radioaktive Markierung interessierender DNASequenzen. Zunächst trennt man die isolierte, bereits durch Restriktionsendonukleasen zerkleinerte, menschliche DNA durch Erhitzen auf I 00 oc in ih re Einzelstränge. Anschließend gibt man eine größere Menge einer radioaktiven Sonde (mit komplementärer Nukleotidsequenz zur gesuchten DNA) dazu, damit diese im Überschuss vorhanden ist. Inkubiert man dieses Gemisch ansch ließend über längere Zeit bei 70 oc, finden die Einzelstränge wieder zueinander und verbinden sich (vgl. auch PCR). Da die radioaktiven Sonden im Überschuss vorliegen, kommt es vorwiegend zu einer Vereinigung mit diesen, und die gesuchte Sequenz wird sichtbar gemacht.
DNA-Kionierung
Die Klonierung ist eine häufig verwendete Methode zur Vermehrung spezieller DNA-Abschnitte. Dies ist deshalb so wichtig, da für die Untersuchung eines DNA-Abschnitts (beispielsweise eines Gens) in der Regel viele Kopien davon benötigt werden. Dazu verwendet man bakterielle Plasmide, kleine ringförmige DNA-Moleküle, die sich in den Bakterien selbstständig replizieren. Zunächst schneidet man die isolierte DNA mittels Restriktionsendonukleasen in kleinere Fragmente. Mithilfe eines Enzyms, der DNA-Ligase, lassen sich diese wieder miteinander verbinden, oder aber auch in die Plasmid-DNA einbauen. Das veränderte, sog_ rekombinante Plasmid dient dann als Vektor für die menschliche DNA, die nun zusam· men mit dem Plasmid autonom mitvermehrt wird . Sind genügend Kopien entstanden, lässt sich das menschliche Gen problemlos aus dem Plasmid herausspalten, indem man das gleiche Restriktionsenzym verwendet, das man zur Fragmentierung benutzt hat.
DNA-Sequenzierung (nach Sanger}
Durch die im Folgenden beschriebene Methode lässt sich die Nukleotid-Se-
quenz beliebiger DNA herausfinden. Diese inzwischen automatisierte Technik ermöglichte die EntschlüsseJung des gesamten menschlichen Genoms. Bei der Technik der DNA-Sequenzierung beginnt man ähnlich wie bei der PCR. Die zu sequenzierende DNA wird zunächst erhitzt, wodurch eine einzelsträngige DNA-Matrize entsteht. Man benötigt zudem einen Primer, der an die Matrize bindet und die DNA-Synthese initiiert, eine DNA-Polymerase, die die Synthese katalysiert, sowie als Bausteine radioaktiv markierte Nukleotidtriphosphate. Der wesentliche Unterschied: Man macht vier verschiedene Ansätze, denen jeweils eine geringe Menge an Di-Desoxyribonukleotiden zugefügt wird . In den ersten Ansatz kommt ddATP, in den zweiten ddTTP, in den dritten ddCTP und in den vierten ddGTP. Di-Desoxyribonukleotide sind künstlich hergestellte
.~TGCGGGAACCTATGCA J TACGCCCTTGGATACGT 5
l TACGCCCTTGGATACGT 5
ATGCG
Genetik 50 I 51
Nukleotide, die am 3'-Ende nur ein -H, anstatt einer OH-Gruppe enthalten. Wird ein solches Di·Desoxyribonukleo· tid in den DNA-Strang eingebaut, kann die Polymerase den Strang nicht weiter verlängern, und es kommt zum Kettenabbruch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von I 0% wird an entsprechender Stelle anstatt eines "normalen" Desoxynukleotids, ein solches Di-Desoxynukleotid eingebaut und die Kette unterbrochen. So kommt es in jeder der vier Serien zur Bildung von Fragmenten unterschiedlicher Längen. Die vier Versuchsansätze werden nun nebeneinander auf ein Träger-Gel aufgetragen und die DNA-Fragmente elektrophoretisch ihrer Größe nach getrennt. Die gesuchte Sequenz kann anschließend einfach abgelesen werden. Zum besseren Verständnis sind die vier Versuchsansätze in I Abbildung 2 graphisch dargestellt.
DNA-Doppelstrang
DNA-Einzelslrang
j •· DNA-Po l ymer<>se + Übe r schuss der Nucleotide
dAT P d TT P dCT P dGT P
t ddAT":l r ddTT P
ATGCG GGA ATGCGGGAACCT ATGCG GGAA ATGCGGGAACCTAT ATGCG GGAACCTA j ATG~TGCA l I
A T C G
Zusammenfassung
I· d d CT P 1 + ddGT P
ATGCG GGAAC ATGCG G ATGCGGGAACC ATGCG GG ATGCGGGAACCTATGC ATGCG GGAACCTATG
3 G A
G c T T A A G G A c G T 5
I
I Abb. 2: Prinzip der DNASequenzierung [ 19]
X Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine einfache und schnelle Methode zur Ampllflzlerung von DNA-Abschnitten.
X Mithilfe von Restriktionsendonukleasen lässt sich DNA selektiv in kleinere Fragmente zerschneiden.
X Bei der DNA-Kionierung erreicht man die Vervielfachung eines bestimmten DNA-Abschnittes durch den Einbau in bakterielle Plasmide.
Kohlenhydrate
Kohlenhydrate sind eine für unseren
Körper wichtige Stoffklasse und ein
großer Bestandteil unserer Nahrung.
Wir benötigen sie als Substrat für die
Energiegewinnung, als Ausgangsstoff
für die Synthese von Lipiden und Ami·
nosäuren, sie sind Bestandteil der DNA,
man findet sie in Membranen, und sie
sind an vielen weiteren Prozessen im
Organismus beteiligt.
Monosaccharide
Monosaccharide sind die kleinsten Ein·
heiten der Kohlenhydrate. Übersetzt
bedeutet dieser Begriff auch "Einfachzu·
cker". Man teilt sie nach verschiedenen
Kriterien in Kategorien ein (I Tab. 1 ).
Die kleinsten Monosaccharide besitzen
drei C·Atome. Man nennt sie auch
Triosen, das Grundgerüst besteht aus
Glycerin.
Chi ra lität von Zuckern Unter einem chiralen Zenuum versteht
man ein C·Atom mit vier unterschied·
liehen Substi tuenten (I Abb. 1), in un·
serem Beispiel also das mit einem Stern
markierte C2. Man unterscheidet bei
Zuckern zwischen einer D· und einer
L·Form. Bei der L-Form des Zuckers
hängt die OH·Gruppe auf der linken
Seite, bei der D-Form auf der rechten.
In der Natur kommen vor allem die
D·Formen der Kohlenhydrate vor.
Fischer-Projektion Die zweidimensionale Schreibweise der
Zucker nennt man auch Fischer-Projek
tion. Die Kohlenstoffkette wird in einer
senkrechten Reihe angeordnet, wobei
Anzahl der C-Atome Aldose
3 (Triose) Glycerinaldehyd
4 (Tetrose) Erythrose
5 (Pentose) Ribose
6 (Hexose) Glukose
Galaktose
(o~ / H c I* HO-C-H I
H- C- OH I
HO- C- H I
HO-C- H I
HO- C-H I H
L-Glukose
(o~ / H c I* H- C- OH I
HO- C- H I
H- C- OH I
H- C- OH I
H-C-OH
I H
o-Glukose
das C·Atom mit der höchsten Oxida·
tionsstufe oben steh t. Dies ist stets die
Aldehyd· oder die Ketogruppe. Die
OH-Gruppen der restlichen C-Atome
werden je nach Chiralität links oder
rechts davon geschrieben (I Abb. I ).
Halbaceta le Kohlenhydrate kommen in der natür
lichen Form fast nie in der gestreckten
Form vor. Sie bilden eine energetisch
günstigere Form, die man Halbacetal
nennt: Das Aldehyd des einen Endes
reagiert hierbei mit der OH·Gruppe
eines C-Atoms am andern Ende der Ket·
te (meist dem vorletzten) und es kommt
zu einem Ringschluss_ Diese Ringform
nennt man bei AJdosen Halbacetal,
bei Ketosen Halbketal. Die funktio· nellen Gruppen, die man in der Fischer
Schreibweise rechts geschrieben hat,
werden in der Schreibform der Ringe
nach oben geschrieben, die linken dem
entsprechend nach unten (I Abb. 2).
Beim Ringschluss können wiederum
zwei unterschiedliche Moleküle entste·
hen. Am C ! ·Atom liegt jetzt nämlich
wiederum ein chirales C-Atom. Wird
dessen OH-Gruppe nach unten geschrie
ben, spricht man von der a-Form, steht
sie nach oben, entsteht die ß-Form des
Rings, in unserem Beispiel der Glukose.
Keto•e
Dihydroxyaceton
Erythrulose
Ribulose I Tab. 1: Übersicht
Fruktose über die wic htigs ten
M onosaccharide
I Abb. I : Chiralit ä t vo n Zuckern, L- und
D-Form der Glu kose
Diese beiden Formen sind die Anome
re der Glukose, eine Form der Isomer· (siehe Chemie-Lehrbücher). Ie
Hexosen und Pentosen Die wich tigsten Monosaccharide im
menschlichen Körper sind Pentosen
und Hexosen, die wir nun genauer besprechen wollen.
Die am häufi gsten vorkommende
Hexose ist die Glukose_ Sie ist der arn
häufigsten natürlich vorkommende
organische Stoff und unabdingbar für
unseren Stoffwechsel u~d die Energie
gewinnung im Körper. Uber verschiedene Transporter wird die Glukose au
dem Blut in die Zellen aufgenommen s
und dort in der Glykolyse abgebaut
(s. Kap. 54). Leber und Muskel sind i der Lage, Glukose in Form von Glyko~ gen zu speichern (s. Kap. 58).
Fruktose ist die wichtigste Ketohe:x:o
Sie ist ebenfalls wichtig in vielen Vorg~e. genunseres Stoffwechsels. anDie für uns relevanten Pentosen sind
die Ribose, die Bestand teil der RNA . . d. D 'b 1St
sowie Ie esoxyn ose, Baustein d ' DNA. er
Disaccharide
Disaccharide entstehen, wenn zwisch zwei Monosacchariden eine O-glyl{
0_en
sidische Bindung geknüpft wird D· · tes
Bindungen werden zwischen den l-fy- e
droxylgruppen zweier Monosaccharid
geknüpft. Hierbei wird Wasser abges e
J h K f. . Pal-ten. e nac on IguratiOn des ersten Zuckers in der Verbindung spricht rn
. d . an w1e erum von e;nem a· oder einem ß-Disaccharid .
Ko h lenhyd ratstoffwech sei 52 I 53
~~~ ... .----.~ ~'6H c;,: H6~6H H6~
..,_,._--ll_._ r.~~H H6~l
I Abb. 2: Die Ringform der Glukose
OH OH OH a-0-Giukose D-Giukose
Die wichtigsten Disaccharide sind Maltose, Laktose und Saccharose {I Abb. 3):
..- Maltose besteht aus zwei Glukose· molekülen. Stärke und Glykogen, wichtige Bestandteile in der Nahrung, werden in der Verdauung zu Maltose abgebaut. Diese wiederum wird von der Maltase in die beiden Glukosemoleküle gespalten . ..- Laktose (Milchzucker) enthält Glukose und Galaktose. Dieser Stoff ist sowohl in allen Milchprodukten enthal· ten, als auch in der Muttermilch. Im Verdauungstrakt wird der Milchzucker durch die Laktase in seine Bestandteile zerlegt. Bei einer Laktoseunverträglich· keit herrscht ein Mangel an diesem Enzym . ..- Saccharose ist der normale Haus· haltszucker, bestehend aus Glukose und Fruktose.
Oligo- und Polysaccharide
Oligosaccharide Ketten aus drei bis zehn Kohlenhydra· ten, die durch glykosidische Bindungen miteinander verknüpft sind, bezeichnet man als Oligosaccharide. Diese kom· men in unserem Körper allerdings fast nur an Proteine oder Lipide gebunden vor. Man findet sie in Zellmembranen oder auf der Oberfläche der Erythrozy· ten, wo sie für die Blutgruppeneigen· schaften des Menschen verantwortlich sind.
Polysaccharide Polysaccharide sind Kohlenhydratketten ab einer Länge von zehn Zuckerein· heiten. Diese große Gruppe wird noch einmal unterteilt in die Homoglykane, die nur eine Zuckerart enthalten, und Heteroglykane, die aus verschiedenen Monosacchariden aufgebaut sind. Das für uns wichtigste Homoglykan ist Glykogen, das aus Glukoseeinheiten
ß-D-Giukose
besteht und in Kapitel 58 genauer be· sprachen wird. Heteroglykane sind zumeist an Proteine oder Lipide gebunden. Proteoglykane sind Kohlenhydrate mit einem kleinen Eiweißrest Bei Glykoproteinen han·
delt es sich um Proteine mit einem klei· nen Kohlenhydratrest Glykolipide sind Fette mit einem kleinen Kohlen· hydratanteil. Der überwiegende Anteil steht also immer im hinteren Teil der Stoffbezeichnung.
0
H OH H OH Maltose
a -o-Giukopyranosyl-( 1 fi 4 )-a-o-glukopyranose
H OH H OH Lactose
ß-D-Galaktopyranosyl-(1 fi 4 )-ß-o-glukopyranose
H OH
HOH2C
H I 0 H 2Vu~~
o_jHcH2oH
OH H Saccharose
a-o-Giukopyranosyl-(1 fi 2)-ß-o-fruktofuranose
Zusammenfassung
I Abb. 3: Strukturformeln der wichtigsten Disaccharide
ac Die aus Wasser und Kohlenstoff bestehenden Kohlenhydrate sind sehr wichtig für viele Prozesse im menschlichen Organismus.
K Man unterscheidet Monosaccharide wie Glukose oder Fruktose von Di-, Oligo- und Polysacchariden.
ac Disaccharide werden mit der Nahrung aufgenommen und im Verdauungstrakt in ihre Bestandteile gespalten.
Glykolyse
Grundlagen
Die Glykolyse ist der zen trale Abbauweg für Glukose zur Energiegewinnung.
Alle menschlichen Zellen besitzen die dafilr n6tlgen Enzyme, die man im Zytoplasma findet.
Ein Molekül Glukose wird durch die Stoffwechselvorgänge in der Glykolyse zu zwei Molekülen Pyruvat abgebaut Man unterscheidet zwischen aerober und anaerober Glykolyse:
.,.. Zellen, die Mitochondrien besitzen, können das entstandene Pyruvat in darauffolgenden Schritten des Citratzyklus und der Atmungskette (siehe Kap. 76 und 78) zu C02 und Wasser oxidieren. Sie leisten aerobe Glykolyse, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist Auf dem kompletten Stoffwechselweg entstehen durch den Abbau von einem Molekül Glukose 38 Moleküle ATP. .,.. Normale Zellen, die sich gerade in einem Zustand des Sauerstoffmangels befinden und Zellen, die keine Mitochondrien besi tzen, leisten anaerobe Glykolyse. Auf diesem Weg wird das entstehende Pyruvat in den fo lgenden Schritten zu Laktat umgewandelt Es entstehen nur 2 Moleküle ATP.
Reaktionsschritte der
Glykolyse
Die Schritte der Glykolyse (I Abb. I):
.,.. Als Erstes wird die mittels der Glukosetransporter in die Zelle aufgenommene Glukose durch die Hexokinase zu Glukose-6-Phosphat phosphoryliert. Das Phosphat stammt von einem ATP, das durch die Reaktion zu ADP umgewandelt wird. Dieser erste Schritt bewirkt, dass das Molekül die Zelle nicht mehr verlassen kann, da für phosphorylierte Zucker keine Transporter über die Zellmembran existieren. .,.. Als Nächstes wird Glukose-6-Phosphat mithilfe der Glukose-6-Phosphat
Isomerase durch Isomerisierung zu Fruktose-6-Phosphat umgewandelt Hierbei entsteht aus der Aldoseform der Glukose die Ketose Fruktose.
.,.. Nun wird das Fruktose-6-Phosphat noch einmal phosphoryliert. Die Phosphofruktokinase katalysiert diese Reaktion, die Fruktose-! ,6-Bisphosphat als Produkt hat.
Die durch die Phoephofruktcilcinese katalysierte Phoephorylleru.ns des Fruktose--0-Phoaphsta 1st die Schrfttm8cherreaktlon der GlykoJyae. Diesee Enzym ~mt41e Gesch\.VInc,ligl(elt.aller ablautenden ~lctlonen.
.,.. Die Aldolase spaltet nun das Fruktose-! ,6-Bisphosphat in zwei C3-
Kohlenhydrate. Es entstehen Glycerinaldehyd-3-Phosphat (GAP) und Dihydroxyacetonphosphat (DAP). Das DAP kann nun durch die Triose-
phophatisomerase ebenfalls in GAP umgewandelt werden, beide Reaktionsprodukte können in der Glykolyse Weiterverwertet werden.
Bis zu diesem Punkt musste Energie in Form von ATP in die Glykolyse invesüert werden (I Abb. I). Nun werden die entstandenen Triasephosphate in der zweiten Phase unter ATP-Gewinn weiter zu Pyruvat abgebaut. Da das C6-Kohlenhydrat Glukose nu n in zwei C3-Körper zerlegt worden ist, laufen ab diesem Schritt alle Reaktionen doppelt ab:
.,.. GAD wird im nächsten Schritt durch die Glycerinaldehyd-3-phosphatDehydrogenase zu 1 ,3-Bisphosphoglycerat oxidiert. Als Oxidationsmittel fungiert hier im ersten Teilschritt NAD +
Glukose
ATP {0CH,OHO H
OH H HO OH
'
I Hexekinase I H OH
CH,OH I C= O
bwPO,'"
I Abb. 1.: Übersicht über die Reak
tionen der Glykolyse. Ab der Spa ltung
des C6-Zuckers in zwei C3-Zucker
laufen die Reaktionen pro Molekül
Glukose zweimal ab. [21
AOP
Fruktose-1 ,6-Bisphosphat
NADH; H"
1.3-Bisphosphoglyceral
AOP
ATP
2-Phosphoglycora t
I Enolaso 11 - H20
Phosphoenolpyruvat
ADP
I Pyruvat·Kinaso I P-;ruvot
IOCH,OP~,'~
OH H HO OH
H OH
'·o3POH,Gr:O~CH"QH
H~6H OH H
'·o3POH,CK:o~H,OPo}-
HHoH
OH H
H......_c~o
I H- r - OH
CH,QP0,2-
2-0 JPO, C.,;::::.O
I H- C- OH
I CH,OP0,2-
coo· I
H- C- OH I CH,QP0,2-
coo-I
H- C- OP0}-1 CH,OH
coo-l w-OPO,'-CH.,
coo-l r=o CI-I,
das zu NADH + H+ reduziert wird. Im zweiten Schritt wird ein anorganisches Phosphat P; gebunden. Hierbei entsteht eine energiereiche Säureanhydrid-Bindung. ~ Die Phosphoglycerat-Kinase überträgt nun das gebundene Phosphat auf ein ADP-Molekül. Es entsteht ein Molekül ATP sowie 3-Phosphoglycerat. ~ Mittels der Phosphoglycerat-Mutase wird die Phosphatgruppe vom C3-Atom jetzt auf das C2-Atom umgelagert, das Produkt ist 2-Phosphoglycerat. ~ Durch Wasserabspaltung, katalysiert von der Enolase, entsteht nun Phosphoenolpyruvat, eine Verbindung, die ein hohes Bestreben hat, die Phosphatgruppe am C2-Atom abzuspalten. Dies ist dann der nächste Schritt der Glykolyse. Die Phosphatgruppe wird auf ein ADP übertragen, es entsteht ein Molekül ATP sowie Pyruvat. Katalysiert wird diese Reaktion von der Pyruvat-Kinase. Sie ist das zweite Schrittmacherenzym der Glykolyse.
Substratkettenphosphorylierung
Unter Substratkettenphosphorylierung versteht man die Bildung der energiereichen Verbindung ATP durch Übertragung eines zuvor an einem Zwischenprodukt fixierten anorganischen Phosphatrestes auf ein Molekül ADP. In der zweiten Phase der Glykolyse, entstehen durch diesen Mechanismus pro C3-
Molekül zwei Moleküle ATP:
~ Bei der Abspaltung der Phosphatgruppe des 1 ,3-Bisphosphoglycerats auf ein ADP entsteht ATP sowie 3-Phosphoglycerat. ~ Eine Phosphatgruppe des Phosphoenolpyruvats wird auf ADP übertragen.
Diesen Mechanismus der Substratkettenphosphorylierung werden wir später noch einmal beim Citratzyklus kennenlernen.
Weitere Schritte des Pyruvats
Der weitere Weg des Pyruvats ist abhängig von der Zelle, in der die Glykolyse stattgefunden hat und außerdem von deren Sauerstoffversorgung:
Kohlenhydratstoffwechsel 541 55
~ Aerober Abbau des Pyruvats: in allen Zellen, die Mitochondrien besitzen und gerade über Sauerstoff verfügen, wird das Pyruvat in der Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion sowie über den Ci· tratzyklus (s. Kap. 76) und die Atmungskette (s. Kap. 78) zu H20 und C02 abgebaut. ~ Anaerober Abbau des Pyruvats zu Laktat (I Abb. 2): In Zellen ohne Mitochondrien sowie in Zellen, die sich gerade in einem Zustand des Sauerstoffmangels befinden, wird das Pyruvat in der Laktat-Dehydrogenase-Reaktion, der sog. Milchsäuregärung zu Laktat reduziert. Wichtig ist dieser Schritt, da für den Ablauf der Glykolyse wieder NAD+ benötigt wird, das aus dieser Reaktion gewonnen wird. Somit wird der weitere Ablauf der Glykolyse garantiert.
Regulation der Glykolyse
Die Phosphofruktokinase ist, wie oben bereits erwähnt, das wichtigste Schlüsselenzym der Glykolyse. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Wirkung dieses Enzyms:
~ Ein hoher AMP-Spiegel signalisiert der Zelle Energiebedarf. Als Folge einer allosterischen Aktivierung arbeitet die Phosphofruktokinase verstärkt und die Glykolyse läuft beschleunigt ab. ~ Im Gegensatz dazu hemmt ein hoher ATP-Spiegel allosterisch die Phosphofruktokinase und somit die Glykolyse,
Zusammenfassung
NADH +W NAD+
cxxr ~ ) CCXT I I C=O HO- C-H I Laktat- I
CH3 Dehydrogenase
CH3
Pyruvat Laktat
I Abb. 2: Die Umwandlung von Pyruvat zu Laktat in der Laktat-Dehydrogenase-Reaktion
da bereits genügend Energie vorhanden ist. ~ Auch der Citratspiegel hat Auswirkung auf die Aktivität der Phosphofruktokinase. Citrat entsteht als Zwischenprodukt im Citratzyklus. Ein hoher Spiegel signalisiert, dass momentan genügend Produkte für die Energiegewinnung im Citratzyklus vorhanden sind. Die Phosphofruktokinase wird also durch Citrat gehemmt. ~ Ein weiterer wichtiger Regulationsfaktor in der Leber ist Fruktose-2,6-Bisphosphat. Der Spiegel dieses Moleküls steigt parallel zum Insulinspiegel und signalisiert, dass viel Glukose im Blut vorhanden ist, die abgebaut werden kann. Fruktose-2,6-Bisphosphat fungiert in der Leber als Botschafter des Insulins und aktiviert die Glykolyse. Der genaue Mechanismus wird im Kapitel über die Hormone der Bauchspeicheldrüse besprochen (s. Kap. 94 und 96).
• Die Glykolyse ist der wichtigste Abbauweg von Glukose in unserem Körper.
Alle Zellen des Menschen besitzen die dafür benötigten Enzyme.
• Im Rahmen der Glykolyse entsteht aus einem Molekül Glukose zwei Mole
küle Pyruvat.
• Man unterscheidet zwischen aerober und anaerober Glykolyse, wobei bei
der aeroben viel mehr Energie gewonnen wird, als bei der anaeroben.
• Wichtigstes Schlüsselenzym ist die Phosphofruktokinase. Von der Aktivität
dieses Enzyms ist die Geschwindigkeit des Ablaufs der Glykolyse abhängig.
• Die Glykolyse läuft bevorzugt bei Energiebedarf des Körpers ab. Demnach
wirken AMP und Fruktose-2,6-Bisphosphat als Aktivatoren, ATP und Citrat
hingegen hemmen die Glykolyse.
Glukoneogenese
Grundlagen der Glukoneogenese
Alle Zellen des Menschen nutzen Glukose bei ihrem Stoffwechsel zur Energiegewinnung. Am meisten Glukose wird hierbei vom Nervensystem gebraucht, etwa 75% des gesamten Bedarfs. Erythrozyten und die Zellen des Nebennierenmarks sind auf die Glukose unbedingt angewiesen, da dies ihre einzige Möglichkeit ist, Energie zu gewinnen. Normalerweise wird die benötigte Glukose aus der Nahrung sowie aus im Körper gespeicherten Glykogenreserven gewon· nen. Sind diese Speicher aber, zum Beispielaufgrund von Nahrungskarenz verbraucht, so kann der Körper Glukose aus Pyruvat herstellen. Diesen Vorgang nennt man Glukoneogenese.
Nur die Leber sowie zu kleinen Teilen die Niere sind in der Lage, Glukoneogenese zu betreiben. Hierbei wird in der Bilanz aus zwei Molekülen Pyruvat ein Molekül Glukose gebildet.
Die dabei entstehende Glukose wird dann dem restlichen Organismus zur Verfügung gestellt und über die Blutbahn zu den einzelnen Organen transportiert. In der Bilanz ist die Glukoneogenese (I Abb. 1) die Umkehrung der Glykolyse. Die meisten Schritte der Glykolyse werden hierbei einfach umgekehrt durchlaufen, da die Reaktionen in etwa im Gleichgewicht stehen und nicht viel Energie benötigt wird. Allerdings sind drei Reaktionen der Glykolyse so stark exogen, dass sie nich t einfach umkehrbar sind:
.._ Die Umwandlung von Glukose zu Glukose-6-Phosphat mittels der Hexokinase; .._ Fruktose-6-Phosphat--; Fruktose· I ,6-bisphosphat durch die Phosphofruktokinase; .._ Die Pyruvat-Kinase-Reaktion mit der Umwandlung von Phosphoenolpyruvat zu Pyruvat haben wir schon im Kapitel der Glykolyse als die Schlüsselreaktionen kennengelernt
Um die drei Reaktionsschritte zu umgehen, müssen vier Reaktionen ablaufen, die mithilfe der folgenden Enzyme voll · zogen werden:
.._ Pyruvat-Carboxylase: Pyruvat wird zu Oxalacetat umgewandelt. .._ Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase: katalysiert die Reaktion Oxalacetat ~ Phosphenolpyruvat. .._ Fruktose- I ,6-Bisphosphatase: Fruktose-] ,6-Bisphosphat wird zu Fruktose-6· Phosphat dephosphoryliert. .._ Glukose-6-Phosphatase: dephosphoryliert Glukose-6-Phosphat zu Glukose.
Die wichtigsten Reaktionen
In diesem Abschnitt wird auf die oben genannten vier wichtigen Reaktionen der Glukoneogenese eingegangen, die nicht nur einfach die Umkehrung der entsprechenden Schritte der Glykolyse sind.
Umwandlung von Pyruvat in Oxalacetat In den Mi tochondrien find et der erste irreversible Schritt der Glukoneogenese statt. Bei der Carboxy lierung von Pyruvat 2 Oxalacetat wird ein Molekü l ATP verbraucht. Außerdem ist u die Hil fe des Coenzyms Biotin nötig, das ein aktiviertes Molekül C02 überträgt: Pyruvat + ATP + C02 --; Oxalacetat + APD + P; Die restlichen Schri tte der Glukoneogenese finden im Zytoplasma statt. Da Oxalacetat die Mitochondrienmembran nicht einfach passieren kann, wird es zuerst mittels der mitochondrialen Malat-Dehydrogenase zu Malat umgewandelt, das ins Zytosol transportiert werden kann. Dort wird das Malat durch die zytosolische Malat-Dehydrogenase wieder zu Oxalacetat oxidiert.
Decarboxylierung von Oxalacetat zu Phosphoenolpyruvat Oxalat wird nun durch die Phosphoenolpyruvat·Carboxyklnase zu Phosphoenolpyruvat umgewandelt. Hierbei Wird das zuvor angehängte C0 2 wieder abgespalten. Die freiwerdende Energie wird genutzt, um das entstandene Enol zu
Oxolacetat
GTP
Phosphoenolpyruvat
2 x I Enolase 11
H20
2-Phosphoglycerat
3-Phosphoglycerat
ATP
ADP
r C= O
bwro,·-
~~ Fruktose-1,6-Bisphosphat
I Abb. I : Übersicht üb d. G e r 1e lukeneogenese [2 ] Glukoso
Kohlen hyd ratstoffwec hsel ~~&--------------------------------------------~~~~~~~~~~ 56 I 57
phosphorylieren. Die Phosphatgruppe stammt von einem GTP, es entsteht Phosphoenolpyruvat.
Fruktose-1 ,6-Bisphosphat wird zu Fruktose-6-Phosphat Bei der dritten Umgehungsreaktion der Glukoneogenese wird eine Phosphorylgruppe des Fruktose-] ,6-Bisphosphats hydrolytisch abgespalten. Es entsteht Fruktose-6-Phosphat. Katalysiert wird dieser irreversible Schritt durch die Fruktose-! ,6-Bisphosphatase.
Dephosphorylierung von Glukose-6-Phosphat Im letzten Schritt wird nun Glukose-6-Phosphat zu Glukose umgewandelt. Das dazu benötigte Enzym ist die Glukose-6-Phosphatase. Die entstandene Glukose kann nun die Zellen verlassen (I Abb. 2), gelangt in die Blutbahn und kann zu den Organen transportiert werden, die sie benötigen. Auch hierbei handelt es sich um eine irreversible Reaktion.
Energiebilanz der
Glukoneogenese
Für die Herstellung von einem Molekül Glukose werden in der Glukoneogenese zwei Moleküle Pyruvat benötigt. Auf dem Wege der Glukoseentstehung werden pro Pyruvat zwei ATP und ein GTP benötigt, insgesamt also vier ATP und zwei GTP für jedes gebildete Molekül Glukose. Im Vergleich dazu werden bei der Glykolyse auf dem Weg von der Glukose zum Pyruvat nur zwei ATP gewonnen. Insgesamt hat man also bei der Glukoneogenese einen Verlust von vier ATP.
I Abb. 2: Durch die Glukose-6-Phosphatase wird Glukose-6-Phosphat zu Glukose dephosphoryliert.
Glukose-6-Phosphat -========- Glukose Diese kann die Zelle verlassen.
Regulation der Glukoneogenese
Die Regulation von Glukoneogenese und Glykolyse verläuft gegensinnig, so dass Glykolyse und Glukoneogenese nicht gleichzeitig ablaufen können. Man unterscheidet bei der Regulation zwischen allosterischer, die innerhalb weniger Minuten wirkt, sowie hormoneller Beeinflussung, die erst nach mehreren Stunden ihre Wirkung entfaltet, da hier Umstellungen auf genetischer Ebene stattfinden, durch die die Expression der einzelnen Enzyme beeinflusst wird. Die Schlüsselstellen sind hierbei die folgenden drei Enzyme, die allosterisch und hormonell beeinflusst werden:
~ Fruktose-! ,6-bisphosphatase, ~ Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase, ~ Pyruvat-Carboxylase.
Allosterische Regulation Die Fruktose-1 ,6-Bisphosphatase wird durch AMP gehemmt und durch Citrat aktiviert. Das bedeutet, das Glukoneogenese vor allem stattfindet, wenn gerade genügend Energie zur Verfügung steht. Diese Regulation verhält sich genau entgegengesetzt zum
Zusammenfassung
entsprechenden Enzym der Glykolyse, der Phosphofruktokinase. Dementsprechend wirkt Fruktose-2,6-Biphosphat, das bei der Glykolyse als Stimulator fungiert, hier hemmend. Die beiden Enzyme, durch welche die Umwandlung von Pyruvat zu Phosphoenolpyruvat katalysiert wird, also die Phosphenolpyruvat-Carboxykinase und die Pyruvat-Carbo:xylase werden ebenfalls entgegengesetzt zum entsprechenden Enzym der Glykolyse, der Pyruvat-Kinase reguliert. Ein hoher ADP-Spiegel wirkt hemmend, Energieüberschuss fördernd.
Hormonelle Regulation Die Hormone Insulin und Glukagon, die in Kapitel 94 und 96 noch genauer besprochen werden, regulieren ebenfalls den Ablauf der Glukoneogenese. Hierbei wirkt Insulin hemmend, indem es die Bildung der für die Glukoneogenese nötigen Enzyme Pyruvatcarboxylase, Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase, Fruktose-1 ,6-Bisphosphatase und Glukose-6-Phosphatase unterbindet. Glucagon hingegen aktiviert die Bildung der Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase und der Fruktose- I ,6-Bisphosphatase und wirkt somit stimulierend.
• Glukoneogenese dient bei Energiemangel zur Gewinnung von Glukose.
• Glukoneogenese findet fast ausschließlich in der Leber statt, auch die
Niere ist zu geringen Teilen in der Lage, Glukose auf diesem Weg zu
gewinnen. Nur in diesen beiden Organen ist die Glukose-6-Phosphatase
vorhanden. Die Glukose wird dann über das Blut zu den Organen gebracht,
die sie benötigen.
• Die Regulation findet a1:1f allosterischem und hormonellem Wege statt.
Hierbei wirkt das Insulin hemmend, Glukagon stimulierend auf den Ablauf
der Glukoneogenese.
G lyko ge n stoffwec h seI
Glykogen ist eine Speicherform der Glukose, die der Körper leicht mobilisieren kann (I Abb_ I]. Es kann in allen Zellen des Menschen, außer in den Erythrozyten gebildet werden_ Große Mengen speichern aber nur die Skelettmuskelzellen und die Leber_ Die Muskelzellen speichern das Glykogen nur für den eigenen Bedarf, sie haben nicht die Möglichkeit, Glukose-6-Phosphat in Glukose umzuwandeln, so dass es die Zelle verlassen kann. Die Leber hingegen mobilisiert das Glykogen; wenn Energiebedarf besteht, wandelt es komplett in Glukose um und stellt es dem Organismus zur Verfügung.
Struktur des Glykogens
Bei Bedarf werden dann die endständigen Glukosemoleküle von der Kette abgespalten, umso verzweigter die Kette also ist, desto schneller kann Glukose mobilisiert werden, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Menschen, bei denen das Glykogen nicht ausreichend verzweigt ist, leiden unter Hypoglykämien.
Glykogensynthese
Die Glykogensynthase ist für den Großteil der Synthese der Glykogenkette zuständig_ Den Beginn der Synthese übernimmt allerdings ein anderer Stoff, das Protein Glykogenin. Dieser ist ein für die Bildung eines Anfangsmoleküls zuständiger Starter. Das Glykogenirr wird selbst in die entstehende Kette eingebaut und hängt acht Glukoseeinheiten aneinander. Ist nun dieses Anfangsmolekül entstanden, kann die Glykogensynthase eingreifen_ Diese hat die Aufgabe, unter Bildung einer glykosidischen Bindung
weitere Glukosemoleküle anzuhängen. Allerdings muss die Glukose hierfür in aktivierter Form vorliegen, als Uridindiphosphat-Gl ukose (UDP-Glukose). Bei der Knüpfung der glykosid ischen Bindung wird UDP abgespalten und die Glykogenkette um ein Glukosemolekül verlängert Für eine Verzweigungsstelle wird ein Verzweigungsenzym benötigt, auch Branching-Enzym gena nnt Eine 1 ,4-glykosidische Bindung wird wieder gespa lten und durch eine 1 ,6-glykosidische Bindung ersetzt. So entsteht die starke Verzweigung des Glykogenmoleküls mit den vielen endständigen Glukoseresten. Zwei Verzweigungsstellen liegen durchschnittlich zehn Glukosemoleküle voneinander entfernt Der Mindestabstand beträgt allerdings nur vier Glukoseeinheiten. Durch die häufige Verzweigung des Glykogens ist es beim Abbau, wenn vom Körper Glukose benötigt wird, möglich, sehr schnell sehr viel Glukose zu gewinnen, da an jedem Ende Moleküle mobilisiert werden können.
Abbau des Glykogens: Glykogenolyse
Für den Abbau der Glykogenkette zu einzelnen Glukosemolekülen sind drei Enzyme zuständig:
lll- Die endständigen Glukosereste, die über eine 1 ,4-glykosidische Bindung angehängt sind , werden durch die Glykogenphosphorylase phosphorolytisch abgespalten (I Abb. 2). Es en tsteht Glukose-I-Phosphat lll- Die Glykogenphosphorylase ist allerdings nicht in der Lage, die Verzwei-
gungsstellen zu trennen. Vier Glukosemoleküle von einem solchen Punkt entfernt übernimmt eine Transferase die Abspaltung dreierweiterer Einheiten und überträgt diese auf einen anderen Zweig_ Die a-1 ,6-Glukosidase
' das Debranching-Enzym, spaltet die Ve rzweigungsstelle, wobei ein normales Glukosemolekül frei wird, das die Zelle sofort verlassen kan n. lll- Die ansonsten entstehenden GlukoseI-Phosphate müssen weiter umgewandelt werden, um im Stoff\vechse] ei ngebaut zu werden. Die Glukosephosphatmutase überträgt die Phosphatgruppe vom Cl - auf das C6-Atorn_ So entsteht Glukose-6-Phosphat, das in die Glykolyse eingeschleust werden kann.
Al lerdings kann die Glukose in dieser phosphorylierten Form die Zelle nicht verlassen. lm Muskel verbleibt sie also in der Zelle und wird dort in der Glykolyse weiterverwertet In der Leber hingegen ist die uns schon aus der Glukoneogenese bekannte Glukose-6-Phosphatase vorhanden . So kann Glukose-6-Phosphat zu freier Glukose dephosphoryliert werden. Die freie Glukose kann die Zelle verlassen und über die Blutbahn zu den Orten transportiert werden, die viel Energie benötigen, dies sind vor all em das Gehirn und die Erythrozyten.
CH,PH CH20H CH20H
OO H -OH O H ~H O 1H a-1,6-Bindung
OH H OH H OH H / HO 0 0 0
H OH H OH H OH \ u-1 ,4-Bindung
CH,PH CH,PH 6
CH2 j CH;PH
~0\7 ~0~ ~0\7 ~0\~ 0ti--ft-o~o~o~R
H 00 H 00 H 00 H ~
I Abb. 1: Aufbau des Glykogens
,~~----------------------------------------------~K~o~h~le~n~h~y~d~r~a~ts~t~o~f~fw~e~c~h~s~e~l 581 59
OCH20H
0H
OH H HO 0
H OH H
Glykogen (n Reste)
OR
OH
Glykogenphosphorylase: phosphorolytische Spaltung ~
CH20H0 H
H OH H +
HO OPO} -
H OH
Glukose-1-phosphat
OCH20H
0H
H OH H
HO OR
H OH
Glykogen (n- 1 Reste)
I Abb. 2: Abspaltung von Glukose- I -Phosphat von einer Glykogenkette
Regulation
Glykogensynthese Die Steuerung der Glykogensynthese erfolgt über die Glykogensynthase, das Schlüsselenzym der Synthese. Steigt der Glukosespiegel im Blut, wird die Glykogensynthase dephosphoryliert und so in ihre aktive Form gebracht. Die zur Verfügung stehende Glukose kann als Glykogen gespeichert werden. Fällt der Blutglukosespiegel unter einen bestimmten Wert, wird die Synthase phosphoryliert, also inaktiviert.
Glykogenabbau Auch der Glykogenabbau wird über sein Schlüsselenzym, die Glykogenphospho· rylase gesteuert. Steigt die Glukoseoder die ATP-Konzentration in der Zelle, wird das Enzym gehemmt, es wird keine zusätzliche Glukose benötigt. Anund abgeschaltet wird das Enzym durch Phosphorylierung. In der phosphorylierten Form ist die Glykogenphosphorylase aktiv und baut Glykogen zu Glukosemolekülen ab. in der dephosphorylierten Form hingegen ist sie inaktiv. Sinkt der Blutglukosespiegel, wird die Glykogenphosphorylase also phosphoryliert und Glykogen zu Glukose abgebaut. Glykogensynthase und -phosphorylase arbeiten nie parallel. Ist eines der beiden Enzyme aktiv, ist das andere abgeschaltet. Die Regulation übernimmt die Leber, die den Blutzuckerspiegel registriert und die Aktivierung der beiden Enzyme dementsprechend steuert.
Regulation durch Hormone Mehrere Hormone haben eine Auswirkung auf den Glykogenstoffwechsel:
~ Glukagon: Glukagon wird ausgeschüttet, wenn der Blutzuckerspiegel
sinkt. Folglich bewirkt es eine Al<tivierung des Glykogenabbaus und eine Hemmung der Glykogensynthese. Sowohl die Glykogensynthase als auch die Glokogenphosphorylase werden phosphoryliert. Wie oben beschrieben, liegt die Phosphorylase nun in aktiver Form vor, die Synthase hingegen wird gehemmt. ~ Insulin: Insulin ist der Gegenspieler des Glukagons. Die Bauchspeicheldrüse setzt Insulin bei einem Anstieg des Blutglukosespiegels frei. Insulin aktiviert eine Phosphatase, die die beiden Schlüsselenzyme dephosphoryliert und somit eine Aktivierung der Glykogensynthese bewirkt. ~ Adrenalin: Adrenalin hat eine ähnliche Wirkung wie Glukagon. Auch dieses Hormon hat einen Abbau des Glykogens zur Folge, allerdings wirkt es nur im SkelettmuskeL Giukagon entfaltet seine Wirkung in Muskel- und Leberzellen.
Zusammenfassung
Glykogenspeicherkrankheiten
Bei diesen angeborenen Krankheiten sind Enzyme des Glykogenstoffwechsels defekt. Bei diesen Enzymen kann es sich sowohl um solche der Synthese als auch um solche des Abbaus handeln. Es handelt sich um vererbbare Krank· heiten, die sehr selten sind. Am häufigsten ist hierbei die Glukose-6-Phosphatase betroffen: Bei einem Defekt dieses Enzyms kann das Glukose-6-Phosphat in der Leber nicht mehr zu freier Glukose umgewandelt werden. Die Glukose kann die Zelle nicht mehr verlassen und es kommt zu einer Anhäufung von Glukose in der Leber. Folge ist eine übermäßige Synthese von Glykogen. Schon beim Säugling kommt es zu Hypoglykämien und zu einer Hepatomegalie durch die große Menge an Glykogen. Diese Krankheit wird auch als Von-Gierke-Krankheit bezeichnet.
• Glykogen ist die Speicherform der Glukose, ein stark verzweigtes Enzym,
das bei Glukosemangel schnell zu Glukose abgebaut werden kann und
diese dem Körper zur Verfügung stellen kann.
• Nur die Skelettmuskulatur und die Leber sind in der Lage, Glykogen zu
synthetisieren und zu speichern.
• Die Glykogensynthase ist das Schlüsselenzym der Glykogensynthese.
Die Glukose wird über glykosydische Bindungen aneinandergehängt,
eine Transglykosylase ist für die Verzweigungen zuständig.
• Das wichtigste Enzym für den Glykogenabbau ist die Glykogenphosphorylase.
• Bei zu niedrigem Blutzuckerspiegel wird Glykogen abgebaut, steigt der
Glukosespiegel über einen bestimmten Wert, wird Glukose in Form von
Glykogen gespeichert, es findet Glykogensynthese statt.
• Insulin bewirkt eine verstärkte Glykogensynthese, Glukagon und Adrenalin
hingegen steigern die Glykogenolyse.
Pentosephosphatweg
Alle menschlichen Zellen sind in der Lage, Glukose über den Pentosephosphatweg zu verstoffwechseln. Er findet im Zytosol statt. Produkte sind Pentosen, die für die DNA-Synthese benötigt werden, sowie NADPH.
Ablauf des Pentosephosphatwegs
Der Pentosephosphatweg wird in zwei Phasen aufgeteilt:
.,.. Im ersten, auch oxidativen Teil genannten wird Glukose-6-Phosphat zu Ribose-5-Phosphat umgewandelt (I Abb. 1). .,.. Im zweiten nicht-oxidativen, reversiblen Teil wird die Ribose in unterschiedlich lange Zuckermoleküle überführt (zwischen drei und sieben Kohlenstoffatome), die dann wieder der Glykolyse zugeführt werden können.
Oxidativer, irreversibler Teil .,.. Im ersten Schritt wird Glukose-6-Phosphat zu 6-Phosphoglukonolacton oxidiert. Katalysiert wird diese Reaktion von der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase. .,.. Das 6-Phosphoglukonolacton wird im nächsten Schritt durch eine Lactonase zu Glukonat-6-Phosphat hydrolysiert. Es wird Wasser angelagert. .,.. Die Glukonat-6-Phosphat-Dehydrogenase decarboxyliert dieses Produkt weiter zu Ribulose-5-Phosphat.
.,.. Mithi lfe der Pentose-5-PhosphatIsomerase wird das Ribulose-5-Phosphat nun zu Ribose-5-Phosphat isomerisiert.
Beim ersten Teil des Pentosephosphatwegs entstehen 2 MolekOie NADPH.
Nicht-oxidativer, reversibler Teil In den meisten Zellen, vor allem solchen, die sehr stoffwechselaktiv sind, wird die Ribose weiter umgewandelt zu Zwischenprodukten der Glykolyse , die dort wieder eingeschleust werden können (I Abb. 2). Dies läuft nach folgendem Prinzip ab (I Tab. 1):
.,.. Zuerst entsteht aus zwei Pentosen eine Heptose und eine Triose: Die Transketolase katalysiert folgende Reaktion: Ribose-5-Phosphat + Xylulose-5-Phosphat ~ Glycerinaldehyd-3-Phosphat + Sedoheptulose-7-Phosphat Das benötigte Xylulose-5-Phosphat entsteht zuvor aus Ribose-5-Phosphat in einer Reaktion, die durch die Phosphopentose-Epimerase ermöglicht wird . .,.. Die beiden Produkte werden durch die Transaldolase weiter umgewandelt in einen C6 und einen C4-Zucker: Glycerinaldehyd -3-Phosphat + Sedoheptulose-7-Phosphat ~ Fruktose-6-Phosphat + Erythrose-4-Phosphat
NADP+ NADPH + H'
ö H20 H+
5 ~ ) ~) H ~H H O OH H
HO OH Glukose-6-Phosphat- HO j Laktonase j Dehydrogenase
H OH
Glukose-6-Phosphat
coo-l
H- C- OH I
HO- C- H I
H- C- OH I
H- C- OH I CH~PO}-
Glukonat-6-Phosphat
NADP+ NADPH, C02
~J Glukonat-6-Phosphat
Dehydrogenase
H OH
6-Phosphoglukono-8-lakton
CH:PH I C= O I
H- C- OH I
H- C- OH I CH:PPO} -
Rlbulose-5-Phosphat
PentosephosphatIsomerase
CHO I
H- C- OH I
H- C- OH I
H- C- OH I CH:PPO:J2-
Ribose· 5-Phosphat
Reaktion Enzym
es +es --> Cl + C3 Transketolase
Cl + C3 --> C6 + C4 Transaldolase
C5 + C4 --> C3 + C6 T ransketolase
I Tab. 1: Umwand lung der Kohlenstoffketten in der zwe 1ten Phase des Pentosephosphatwegs
.,.. Zuletzt reagieren ein weiterer C5-und ein C4-Zucker mithilfe der Transketolase zu einer Triase und einer Hexose: Xylulose-5- Phosphat+ Erythrose-4-Phosphat ~ Fruktose-6-Phosphat + Glycerinaldehyd-3-Phosphat
Das entstehende Fruktose-6-Phosphat kann nun in die Glykolyse eingeschleust werden, genau wie das Glycerinaldehyd-3- Phosphat. In manchen Zellen wird das Ribose-5-Phosphat für die Synthese von DNA und RNA benötigt. Hier kann der ZWeite Tei l des Pentosephosphatwegs auch rückwärts ablaufen, es werden Zwischenprodukte der Glykolyse in Ribose-5-Phosphat umgewandelt und dann in die DNA-Synthese eingeschleust (s. Kap. 38).
Regulation
Der oxidative Teil des Pentosephosphatwegs wird über den Bedarf an NADP}-f und Ribose geregelt:
I Abb. 1: Der oxidative Teil des
Penlosephosphatwegs [2[
IJ> Fehlt einer Zelle NADPH für den Stoffwechsel und Ribose für die DNASynthese, wird der erste Teil des Pentosephosphatwegs verstärkt betrieben. IJ> Benötigt eine Zelle keine Ribose, sondern nur NADPH , so wird ebenfalls die erste Phase aktiviert, die Ribose aber in der zweiten Phase wieder in Zwischenprodukte der Glykolyse umgewandelt und dieser wieder zugeführt. IJ> Für den Fall, dass eine Zelle nur Pentosen für die DNA-Synthese braucht, aber kein NADPH benötigt, wird die zweite Phase des Pentosephosphatwegs rückwärts durchlaufen. Der Glykolyse werden Fruktose-6-Phosphat und Glycerinaldehyd-3-Phosphat entzogen und wie oben beschrieben zu Ribose-5-Phosphat umgewandelt.
Zusatz: NADPH
NADPH, oder auch Nicotinamidadenindinukleotidphosphat ist ein wichtiges Coenzym, das bei vielen Stoffwechselreaktionen benötigt wird. Es handelt sich um ein Reduktionsmittel, es gibt also Elektronen ab. Seine Funktion ist die Übertragung von Wasserstoff und Elektronen: NADPH + H+ ~ NADP + 2 Elektronen+ 2 H+ Die Stoffwechselvorgänge, in denen dieses Coenzym zu find en ist, sind vor allem anaboler Art. Reaktionen mit NADPH finden im Zytosol statt:
IJ> Fettsäuresynthese, IJ> Synthese von Hormonen in der Nebennierenrinde, IJ> Cholesterinsynthese in der Leber, IJ> Entgiftung toxischer Stoffe und verschiedener Medikamente in der Leber, IJ> Reduktion von Glutathion in den Erythrozyten.
Kohlenhydratstoffwechsel
CHi)H I C= O I
HO- C- H + I
H- C- OH I CHi) POl -
Xylu lose-5-Phosphat
CHO I
H- C- OH + I CH20PO} -
CHO I
H- C- OH I
H- C- OH I
H- C- OH I CH20POl -
Ribose-5-Phosphat
CH;PH I
C= O I
HO- C- H I
H- C- OH I
H- C- OH I
H- C- OH I CH;Pf'0:3 2-
Gtycerinaldehyd- Sedoheptulose-3-Phosphat 7-Phosphat
CHO I
H- C- OH
CH;PH I C= O I
I + HO-C-H H- C-OH
I CH;PPO}-
Erythrose-4-Phosphat
I H-C-OH
I CH:PPO}-
Xylulose-5-Phosphat
I Transketolase I
I Transaldolase I
I Transkatolase I
CHO I
H- C- OH + I CH:PPO} -
Glycerinaldehyd-3-Phosphat
CH20H I C= O I
Hü-C- H I +
H-C-OH I
H- C-OH I CH20PO}-
Fruktose-6-Phosphat
CH:PH I
C= O I
HO- C- H I +
H- C- OH I
H- C- OH I CH:PPÜJ2
-
Fruktose-6-Phosphat
I Abb. 2: Die Reaktionsschritte des zweiten Tei ls des Pentosephosphatwegs 121
Zusammenfassung
60 I 61
CHi)H I C= O I
HO- C- H I
H- C- OH I
H- C-OH I
H- C- OH I C~OPO}-
Sedoheptulose-7-Phosphat
CHO I
H-C- OH I
H- C-OH I CH;PPO} -
Erythrose-4-Phosphat
CHO I
H- C- OH I CH;Pf'0:32
-
Glycerinaldehyd-3-Phosphat
X Wichtigste Produkte des Pentosephosphatwegs sind NADPH, das in vielen Stoffwechselwegen benötigt wird, und Ribose-5-Phosphat für die Synthese von DNA und RNA.
X ln stoffwechselaktiven Zellen wird die entstandene Ribose umgewandelt in Zwischenprodukte der Glykolyse und dort eingeschleust.
X Man unterteilt den Pentosephosphatweg in einen ersten, irreversiblen oxidativen Teil bis zum Ribose-5-Phosphat und einem zweiten, reversiblen nicht-oxidativen Teil, in dem die Umwandlung der Zucker stattfindet.
X NADPH ist ein Reduktionsmittel, das in vielen anabolen Stoffwechselvorgängen als Elektronen- und Protonendonator fungiert. Im oxidativen Teil des Pentosephosphatwegs werden zwei Moleküle NADPH gewonnen.
Lipide und Fettsäuren I
Lipide dienen im Körper als Energiespeicher, Baumaterial, Temperaturregulatoren, und sind Bestandtei le von Nervengewebe und Membranen. Des Weiteren erfüllen sie Aufgaben als Hormone, Gallensäuren und Vitamine . Die Gruppe der Lipide ist sehr vielfältig, allerdings ist ihnen allen gemeinsam, dass sie fettlöslich [ = lipophil) sind und aus Acetyl-CoA-Einheiten bestehen.
Eigenschaften der Lipide
Charakteristisch für Lipide ist, dass sie wenigstens zum Teil lipophil - also unpolar - sind . Sie lösen sich demzufolge schlecht in Wasser, aber gut in apolaren Lösungsmitteln wie Ether und Benzol. Von amphiphilen oder amphipatischen Lipiden spricht man, wenn das eine Ende des Lipids lipophil und das andere ähnlich stark hydrophil ist. Dadurch lässt es sich sowohl in polaren [Wasser) als auch in unpolaren Lösungsmitteln mehr oder weniger gut lösen. Diese Eigenschaft eignet sich ideal zur Bildung von Membranen, die ausschließlich aus amphiphilen Lipiden aufgebaut sind. Amphiphile Moleküle werden auch als Emulgatoren oder Detergenzien bezeichnet. Die Apolarität der Lipide kommt dadurch zustand e, dass sie größtenteils aus CH-Bausteinen bestehen, deren Atome sich in ihrer Elektronegativität kaum unterscheiden.
Je nach hydrophilen oder Hpophilen Anteilen lagern sich Lipide in wässrigem Milieu spontan zu unterschiedlichen Strukturen zusammen (I Abb. 1 ):
.,._ Öl-Wasser-Grenzschichten: Der hydrophile Teil richtet sich zum Wasser hin aus, während der lipophile Schwanz durch hydrophobe Wechselwirkungen aus dem Wasser verd rängt wird. So bildet sich bei der Vermischung von polaren und apolaren Substanzen eine Phasengrenze zwischen diesen, z. B. ein Öl- oder Fettfilm auf Wasser. Dies führt u. a. zu einer Reduktion der Oberflächenspannung! .,._ Mizellen: Mizellen bilden sich ab einer bestimmten Konzentration der apolaren Substanz. In diesem Fall richten sich die hydrophoben Schwänze ins Innere einer Kugel, die nach außen hin von den hydrophilen Anteilen der Lipide begrenzt werden. In solchen Mizellen können andere lipophile und amphiphile Stoffe transportiert werden, z. B. Cholesterin und fettlösliche Vi tamine . .,._ Bilayer, Membranen und Liposomen: Bilayer si nd Lipiddoppelschichten. Die beiden äußeren Grenzschichten werden von den polaren Regionen der Lipide geb ildet, zwischen diesen befindet sich eine hydrophobe Mi ttelschicht bestehend aus deren apolaren Schwänzen, als wichtiges Beispiel hierfür seien die Zellmembranen genannt. Lagern sich diese Lipiddoppelschichten in Form eines Ringes an,
Lipid
polarer apolarer Kopf Schwanz
~0 Mizelle ~0
1nnu ~0
I Abb. 1: Zusammenschlüsse von amphiphilen Molekü len in wässrigem M-1. I Ieu
heißen sie Liposomen. In ihrem Inn eren ist Wasser eingesch lossen.
Einteilung der Lipide
Wie schon erwähn t, ist die Gruppe der Lipide sehr heterogen was die Einteilung nich t so einfach macht. Man unterscheide' verschiedene Fettsäuren, die entweder isoliert oder als t
Bausteine größerer Lipide vorkommen, von komplexeren Lipiden, die man in zwei große Gruppen unterteilen kann: In die Isoprenderivate und die verseitbaren Lipide. Letztere sind zusammengesetzte Lipide, dich sich dadurch auszeich nen, dass sie Esterbindungen enthalten.
Fettsäuren
Fettsäuren (I Abb. 2) kommen entweder isoliert oder als Bausteine größerer Lipide vor. Sie bestehen aus längeren Ode weniger langen, unverzweigten Kohlenstoftketten, die an r einem Ende eine Carbonsäuregruppe [Carboxyl-Gruppe, COOH) besitzen. Bei einem pH von 7,4 liegen sie dissoziiert vor [COO-). Die kürzeste Fettsäure ist mit ihren vier CAtomen die Butan-oder Buttersäure.
apolarer Schwanz polarer Kopf
I Abb. 2: Aufbau einer Fett säure
....
Eigenschaften Polarität Fettsäuren si nd amphiphil. je nachdem, wie lang die Kohlenstoffkette ist, kann die hydrophile Carboxyl-G ruppe am Fettsäurekopf (kurze Ketten) oder die Lipophilie des apolaren Schwanzes überwiegen (lange Ketten).
Sättigung Gesättigte Fettsäuren haben zwischen ihren C-Atomen ausschließlich Einfachbindungen. Von einer ungesättigten Fettsäure spricht man, wenn sie mindestens eine Doppelbindung zwischen ihren Kohlenstoffatomen trägt Bei mehr als einer Doppelbindung handelt es sich um eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Des Weiteren spielt die Lage der Doppelbindungen untereinander eine Rolle. Hier unterscheidet man zwischen konjugierten (Doppel- und Einfachbindungen wechseln sich ab) und isolierten Doppelbind ungen (zwischen zwei Doppelbindungen liegen mindestens zwei Einfachbindungen.), sowie zwischen cis-und trans-Isomeren (I Abb. 3). Die Fettsäuren im menschlichen Organismus besitzen immer isolierte ( cis·) Doppelbindungen.
Essenzielle und halbessenzielle Fettsäuren Es gibt zwei Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, da er keine Doppelbindungen jenseits des C9-Atoms einbauen kann. Diese sog. essenziellen Fettsäuren, die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen, sind die Linolsäure und die UnoJensäure (I Abb. 4). Nur aus diesen können die Zellen im endoplasmatischen Retikulum die
I Abb. 3: Isolierte (cis-) Doppelbindung (oben) und konjugierte (Irans-) Doppelbindung (unten)
Lipidstoffwechsel 62 I 63
Arachidonsäure (I Abb. 4) herstellen. Diese ist somit halbessenziell, da ihre Produktion vom Vorhandensein essenzieller Fettsäuren abhängig ist. Obwohl die Ölsäure (I Abb. 4) auch eine Doppelbindung nach C9 trägt, ist sie nicht essenziell, da sie durch Oxidation aus der nicht essenziellen Stearinsäure hergestellt werden kann.
Nomenklatur Für Fettsäuren gibt es verschiedene Schreibweisen. Wichtig hierbei sind jeweils die Anzahl der Kohlenstoffatome sowie Anzahl und Positionen der Doppelbindungen. Man nummeriert die Kohlenstoffatome bei der Carboxylgruppe beginnend durch. Die Position der Doppelbindungen wird durch den griechischen Buchstaben Delta~" markiert, wobei das n die Nummer des C-Atoms darstell t, von dem die Doppelbildung ausgeht. Bei einer Doppelbindung zwischen dem 9. und dem 10. C-Atom, hieße diese ~9 . Bei der ffi-( = Omega-) Namensgebung beginnt man die CAtome vom Methylende aus durchzuzählen. Die Entfernung der ersten Doppelbindung vom w-C I-Atom ist hier ausschlaggebend. So kann man zwei wichtige Familien unterscheiden: die ffi-6-Familie und die w-3-Familie.
Struktur Die Kohlenstoffkette bildet im Raum meist eine Zickzackform aus, da sie in dieser Form am stabilsten ist Zur einfacheren Darstellung kann man anstatt alle C-Atome extra auszuschreiben, auch eine Zickzacklinie an die Carboxyl-Gruppe zeichnen, wobei jede Spitze für ein Kohlenstoffatom steht.
/o" 10 9 II
C-OH
Ölsäure
13 12 10 9
Linolsäure
16 15 13 12 10 9
Linolensäure
15 14 12 11 9 8 6 5
Arachidonsäure
/o" II C-OH
I Abb. 4: Ölsäure, Linolsäure, Linolensä ure, Arachidonsäure
Lipide und Fettsäuren II
Verseitbare Lipide
Unter die Gruppe der verseitbaren Lipide fa llen sowohl einfache als auch komplexe Lipide:
~ Zu den einfachen Lipiden gehören die Wachse, Öle und Fette. Sie bestehen aus einem Alkohol, der mit einem oder mehreren Acylresten verestert ist. ~ Die komplexen Lipide tragen zu. sätzlich noch andere (polare) Kompo· nenten. Man teilt sie nach ihrem Alkohol-Grundgerüst in Phosphoglyceride und Sphingolipide ein.
Einfache, verseitbare Lipide ~ Fette: Die sog. Neutralfette (I Abb. 5) bestehen aus einem Glycerinmolekül, das an jeder seiner drei Hydroxylgruppen mit einer Fettsäure verestert ist. Man kennt sie auch unter dem Namen Triacylglycerine oder abgekürzt Triglyceride. Auch Mono-oder Diacylglycerine gehören zu den Fetten, diese sind aufgrund ihrer hydrophilen OH-Gruppe, amphiphil. ~ Öle: Der Aufbau der Öle ist analog zu dem der Fette, mit dem Unterschied, dass Öle einen hohen Anteil an mehr· fach ungesättigten Fettsäuren (Linolsäure, Linolensäure, Arachidonsäure ) besitzen. Außerdem liegen Öle bei Raumtemperatur in fl üssiger Form vor. ~ Wachse: Bei den Wachsen handelt es sich um Ester zwischen einer langkettigen Fettsäure und einem einwertigen Alkohol.
Phosphoglyceride Die Phosphoglyceride (auch Phospholipide genannt, I Abb. 6) enthalten, wie die Acylglycerine auch, den Alkohol Glycerin (allerdings als Phosphoglycerin) als Grundgerüst Bei den Phosphoglyceriden ist also eine der Hydroxylgruppen nicht mit einer Fettsäure, sond ern mit einer polaren Phosphorsäure verestert, die den Phosphoglyceriden ihren amphi· philen Charakter vermittelt. Über die Phosphorsä ure können Phospholipide Verbindungen mit anderen polaren Bestandteilen wie Cholin, Serin oder lnositol ausbilden. Dabei entstehen Phosphosäured iesterverbindungen wie Lecithin (Phosphatidylcholin), Kephalin
0 I Abb . 5: Aufbau eines Triacylglycerins
II H2C-o -c-R1
I ~ HC-O- C-R2
I ~ H2C- 0 - C- R3
(Phosphatidylserin , Phosphatidylethanol· amin) und Phosphatidyl inositol.
~ Der einfachste Vertreter der Phosphoglyceride ist die Phosphatidsäure, bei der die Phosphorsäure allein mit dem Glyceringrundgerüst verknüpft ist. Sie ist demnach eine Phosphorsäuremonoesterverbindung. Ihre Bedeutung hat sie als Zwischenprodukt der Triacylglycerin- und Phosphoglyceridbiosynthese. ~ Phosphorsäurediester zwischen Dia· cylglycerin und Cholin bezeichnet man als Lecithine. Sie sind die häufi gsten Phosphoglyceride und wichtige Bausteine biologischer Membranen. ~ Phosphatidylserin und Phosphatidylethanolamin gehören zu der Gruppe der Kephaline. Serinkephalin gilt u. a. als eine gerinnungsaktive Substanz. ~ Das Phosphatidylinositol ist ein häufig vorkommender Phosphodiester, bei dem die Phosphorsäure des Glycerinphosphats mit dem zykli schen Alko· hol Inositol verbunden ist. Es ist ein wichtiger Membranbaustein und dient dort als Anker für Membranproteine. Außerdem spielen lnositolphosphatide als Second messenger eine Rolle bei der Signaltransduktion. ~ Ein weiteres wichtiges Phospho· glycerid ist das Cardiolipin, das in Mitochondrienmembranen in hoher Konzentration vorkommt. Es ist ei n Diphosphatidylglycerin, besteht also
0 II
aus einem Glyceringerüst, das an zwei seiner Hydroxylgruppen mit Phosphatidsäuren verestert ist.
Sphingolipide Die Sphingolipide (I Abb_ 7) besitzen als Grundgerüst den Arn inodialkohol Sphingosin, der das Produkt aus Serin und Palmitoyl-CoA darstellt.
~ Das einfachste Sphingolipid ist das Ceramid, das durch die Verknüpfung von Sphingosin mit einem Acyl-CoA entsteht (Säureamidbindung) . Es komrnt hauptsächlich in der Haut vor. ~ Wird an die endständige Hydroxylgruppe des Ceramids ein Phosphorylcho. linrest gebunden, so erhält man Sphingomyelin. Dieses ist ein wichtiger Bestandteil der Myelinscheiden des Nervengewebes. ~ Verknü pft man Ceramid mit einem aktivierten Monosaccharid, so entsteht ein Cerebrosid. Das Monosaccharid ist dabei meistens Galaktose, die Verknüpfung erfolgt glykosid isch an der endständigen OH-Gruppe des Ceramids Cerebrosin kommt hauptsächlich im · ZNS, aber auch in anderen Geweben , vor. ~ Ein Gangliosid entsteht bei Kopplun von Ceramid mit einem Oligosaccharid.g Glukose, Galaktose, N-Acetyl-Neuramin. säure und N-Acetyl-Galaktosamin werden schrittweise glykosidisch an die endständige OH-C ruppe des Ceramids
H2C- O - C~
I ~ H2C-OH I
HC - OH 0 I II
H2C-0 - P- 0 I
0
I Phosphoglycerin I
HC- 0-C~
I ~ H2C- 0 - P- R
I 0
I Phospholipid I
I Abb. 6: Phosphoglycerin, Phosphatidsä ure und Phospholipid I Phosphatids~
H2C-OH
I ~ HC-N- C~ I H
~AC-OH
I Ceramid I H
H2C-0- R
I ~ HC-N-C~ I H
~AC-OH H
wenn R = Cholin : Sphingomyelin wenn R = ein Monosaccharid: Cerebrosid
wenn R =ein Oligosaccharid : Gangliosid
I Abb. 7: Struktur der Sphingolipide 13]
gebunden. Ganglioside sind in der grauen Substanz des Ge· hirnsund in Membranen verschiedener Zellen enthalten.
1)1' Cerebroslde, Sulfatlde und Gensiloaide fasst man Zl,l derGrupo P.! der Glykosphlnsollplde zusammen.
Isoprenderivate
Eine Lipidgruppe, deren Vertreter ausnahmsweise keinen Alkohol als Grundgerüst enthalten, ist die der Isoprenderi· vate. Wie der Name bereits sagt, leiten sich diese vom Isopren (2·Methyl·l ,3·Butadien) ab. Man unterscheidet dabei zwei Untergruppen: die Terpene und die Steroide.
Terpene Terpene sind einkettige Moleküle, die durch Polymerisierung mehrerer Isopreneinheiten entstehen. Je nachdem, aus wie vielen Isopreneinheiten ein Terpen besteht, wird es entweder als Monoterpen (2 Einheiten), als Sesquiterpen (3 Einheiten) , oder als Di· , Tri· oder Tetraterpen (bei 4, 6 oder 8 Isopren· einheiten) bezeichnet. Zu den Terpenen gehören die pflanz· Iichen Carotinoide, die Pheromone, sowie die fettlöslichen Vitamine Retinol, Tocopherol und Phyllochinon.
Steroide Auch die Steroide sind Derivate des Isoprens. Sie entstehen durch Cyclisierung des Triterpens Squalen, und leiten sich allesamt vom Steran (Cyclopentano·Perhydrophenanthren) ab. Die für uns wichtigsten Vertreter der Ste roide sind das
Lipidstoffwechsel 641 65
Cholesterin (s. Kap. 72), die Steroidhormone (s. Kap. 90 und 92), die Gallensäuren (s. Kap. 122) und das Vitamin D (s. Kap. 86) .
Funktion der Lipide und des Fettgewebes
Eine bekannte Hauptaufgabe der Lipide ist die Energiespeicherung, das ist aber noch lange nicht alles. So gehören z. B. alle fettlöslichen Vitamine und alle Stereidhormone zur Klasse der Lipide. Sphingolipide machen einen großen Anteil des ZNS· und Nervengewebes aus, das bis zu 40% aus Lipiden aufgebaut ist. Auch als Bestandteil biologischer Membranen sind Lipide unverzichtbar. Insbesondere die Phospholipide sind am Aufbau von Membranen beteiligt, indem sie sich zu Lipiddoppelschichten anordnen. Im Körper gibt es zwei Arten von Fettgewebe: weißes und braunes Fettgewebe. Ersteres ist univakuolär und dient als Energiespeicher (Depotfett) und Baumaterial (Baufett) . Braunes Fettgewebe (plurivakuolär) kommt als Thermo· regulator hautsächlich bei Säuglingen vor.
~ Depotfett dient dem Körper vorwiegend als Energiespei· eher. Die Verbrennung von I g Fett liefert ca. 9,3 kcal bzw. 39,06 kJ Energie. Bei Energiemangel werden die Fettspeicher, die v. a. aus Triacylglycerinen bestehen, durch Aktivierung der Lipolyse mobilisiert. Das Depotfett sorgt außerdem für eine ausreichende Wärmeisolation und Polsterung des Körpers . .,.. Das Baufett dient dem Körper als BaumateriaL Seine Aufgaben sind die Fixation und Isolation von Organen, es kommt beispielsweise im Nierenlager, in der Augenhöhle und an den Fußsohlen vor.
Zusammenfassung X Lipide sind lipophile Moleküle, die aus Acetyi-CoA
Einheiten aufgebaut sind.
X Amphiphile Moleküle besitzen ein hydrophiles und ein lipophiles Ende, und haben deshalb besondere Lösungseigenschaften. Sie bilden in wässrigem
Umfeld Grenzschichten, Mizellen, Bilayer oder Lipo
somen aus.
X Fettsäuren sind unverzweigte Kohlenstoffketten, die
an einem Ende eine Carboxylgruppe tragen (COOH). X Die meisten komplexeren Lipide enthalten als Grund
gerüst einen Alkohol (Glycerin oder Sphingosin). Eine Ausnahme bilden die lsoprenderivate, die sich vom
Isopren ableiten.
X Triacylglycerine bestehen aus einem Glycerinmolekül,
das mit drei Acylsäure-Resten verestert ist.
Biosynthese der Fettsäuren und Triacylglycerine
Steht dem Körper mehr Energie in Form von Nährstoffen zur Verfügung als er gerade benötigt, werden Vorräte angelegt. Das überschüssige Acetyl-CoA, das u. a. bei der Glykolyse entsteht, wird zur Fettsäuren-Biosynthese verwendet. Diese wiederum werden in Form von Triacylglycerinen im Fettgewebe gespeichert. Bei der Fettsäuresynthese unterscheidet man die Fettsäurekettenverlängerung von der "de-novo"-Synthese von Fettsäuren. Bei dieser werden Fettsäuren aus Acetyl-CoA-Einheiten neu hergestellt. Hauptbildungsort ist die Leber, allerdings können fast alle Zellen des Körpers gesättigte Fettsäuren synthetisieren.
"De-novo"-Fettsäuresynthese
Die Biosynthese der Fettsäuren spielt sich im Gegensatz zur ß-Oxidation, die im MHochondrium stattfindet, im Zytosol ab. Katalysiert wird die Gesamtreaktion durch einen Multienzymkomplex, dem Fettsäure-Synthase-Komplex, als Reduktionsmittel wird NADPH benötigt. Über die "de-novo"Synthese können gesättigte Fettsäuren mit Kettenlängen von C 16 (Palmitinsäure) bis C 18 (Stearinsäure) hergestellt werden. Eine Kettenverlängerung oder die Einführung von Doppelbindungen sind in weiteren Schritten möglich (s. u.) .
ZI,Jr VeranscJiaullchung die Summengleichung der Synthese am Belspiel der PalmitlnSiure: 1 Acetyf-CoA + 7 Malonyt;CoA 11- 14 NADPH + 14 W ~ CH.-(CH2) 14.,CODH + 7 C02 + 6 H20 + 8 CoA + 14 NAOp+
Bausteine der Fettsäuresynthese
11>- Malonyl-CoA: Die benötigten Malonyl-CoA-Moleküle entstehen durch die Carboxylierung von Acetyl-CoA (I Abb. 1 ). Die Acetyl-CoA-Carboxylase, welche die Reaktion katalysiert, ist das Schrittmacher-Enzym bei der de-novo-Synthese von Fettsäuren. Dessen Aktivität wird hormonell und allosterisch reguliert: Insulin, Citrat und ATP führen zu einer Aktivitätssteigerung, Glukagon, Katecholamine, Acyl-CoA (aktivierte Fettsäuren) und AMP hemmen die Acetyl-CoACarboxylase. 11>- Acetyi-CoA: Das Acetyl-CoA, das in den Mitochondrien entsteht, kann die Mitochondrienmembran nicht passieren und benötigt ein Transportsystem, um ins Zytosol zu gelan·
Carboxybiotin Biotin Acetyi-CoA Malonyi-CoA
1ADP,P,
ATP I Abb. 1: Biotinabhängige Ca rboxylie-
Bio!in C02 rung von Acetyi-CoA zu Malonyi-CoA [21
I Abb. 2:
~\ Acetyi- AcetyiCoA
Transpo rt von Acety i-CoA
aus dern M itochondrium ins Zytosol
CoA r c;"., Citrat
Oxalacetat
r NADH Oxalacelat
Pyruvat
Malat
Pyruvat~ NADPH
gen. Dies geschieht über eine intermediäre Citratsynthese durch Reaktion von Acetyl-CoA mit Oxalacetat (I Abb. 2) . 11>- NADPH: Als Quell en der NADPH-Bildung dienen einerseits die ersten beiden Schritte des Pentosephosphatweges, aber auch folgende Reaktion, die vom sog. Malatenzym (= decarboxylierende Mala tdehydrogenase) katalysiert wird: Malat + NAPD+ ~ Pyruvat + C02 + NADPH + H+
Die Fettsäure-Synthase und ihre Reaktionsschritte
Bei der Fettsäure-Synthase handelt es sich um einen Mulitenzymkomplex. Sie besteht aus zwei Untereinhei ten, die jeweils eine zentrale und eine periphere SH-Gruppe enthalten. Die zentrale SH-Gruppe ist Teil eines Phosphopantetheins, welches an einem Träge rmolekü l namens Acyl-Carrier-Protein (ACP) hängt. Die Reaktionen spielen sich im WesenUichen an der zentralen SH-Einheit ab, die periphere Einheit dient lediglich der Aufnahme des ersten Acetyl -CoAs und der Zwischenlagerung von Fettsäureketten. Ein Zyklus der Fettsäuresynthese besteht aus mehreren Reaktionsschritten, die in I Abbildung 3 dargestellt sind.
Leber, Niere Fettgewebe, Muskulatur
Glyceri nkinase
Glycerin-3-® -0 ehydrogenase
Dihydroxyaceton-®
Ä
Glycerin-3-® Glykolyse
. ® ~2 Acyi-CoA Glycenn-3- I) - _ _ _ Acyltransferase
2 CoA
Phosphatidsäure
Diacylg lyccrin
Diacylg lyceri n ___ r Acyi-CoA
Acyltransfera se ~ oA
I Abb. 4: Schritte der Triacylglycerln T riacylglycerin-Syn t hese [71
dSrH
~ S,H
d:>pl o,,c,CoA
I CH 3
arter·Acelyi-CoA
CoA-SH
SpH
0 II
S, -C - CH 3
2
0 ~C-CH 2 -coo0
CoA Malonyi-CoA
CoA-SH
I Abb. 3: Fettsäuresynthese ]7]
1 - Einschleusung eines Acetyi-CoA zum Start der Fettsäuresynthese 2 - Übert ragu ng des Acetyl rests auf die periphere SH-Gruppe 3 - Anlagerung eines Malonyi-CoA an die zentrale SH-Gruppe 4 - Kondensation der Malonyl- und Acetylreste 5 - 1. Redukt ion 6 - Dehydratation 7 - 2. Reduktio n 8 - Übertrag ung des Butyrylrests auf die periphere SH-Gruppe 9 - erneute Bindung eines Malonyi ·CoA an die zentrale SH-Gruppe
-> der Zyklus kann von vorn beginnen
2. Reduktion
SPH
0 0 II II
~ S, -C-CH 2-C-CH 3
Pro Zyklus wächst die Fettsäurekette um zwei Kohlenstoffatome. Der Zyklus wiederholt sich so lange, bis sie lang genug ist. Dabei ist zu beachten, dass der Fettsäurerest die ganze Zeit an dem Enzymkomplex hängen bleibt. Erst bei Erreichen der nötigen Länge wird die entstandene Fettsäure durch die Thioesterase aus dem Komplex freigesetzt.
der Membran des endoplasmatischen Retikulums lokalisiertes System zur Fettsäurekettenverlängerung erreicht, das so ähnlich funktioniert wie die Fettsäure-Syn thase-Reaktion. ~ Bildung ungesättigter Fettsäuren: Das Enzym Acyl-CoA-Desaturase ermöglicht unter Verbrauch von mole-
Zusammenfassung
Lipidstoffwechsel 66 I 67
kularem Sauerstoff und NADPH die Einführung von Doppelbindungen in Fettsäuren. Wichtig zu wissen ist, dass dies nur bis zum C9-Atom möglich ist, d. h. Fettsäuren mit Doppelbindungen jenseits davon kann der Mensch nicht selber synthetisieren. Diese sind also essenziell und müssen mit der Nahrung aufgenommen werden (z. B. die Linolund die Linolensäure). Die Arachidonsäure ist halbessenziell, d. h. sie kann aus der essenziellen Linolsäure hergestellt werden (durch Kettenverlängerung und zweifache Desaturierung). ~ Bildung ungeradzahliger Fettsäuren: Ungeradzahlige Fettsäuren sind selten und entstehen meist zufällig, wenn als Startermolekül statt AcetylCoA ein Propionyl-CoA (C3-Rest!) gebunden wird.
Synthese der Triacylglycerine
Die freien Fettsäuren werden im Zytoplasma der Adipozyten in Form von Glycerinestern, den sog. Triacylglycerinen (Neutralfette) gespeichert. Die Synthese der Triacylglycerine spielt sich in der Leber und im Fettgewebe ab und benötigt als Baustein die aktivierte Form des Glycerins, das Glycerin-3-Phosphat. Diese entsteht vorwiegend aus dem Dihydroxyacetonphosphat (DAP), einem Zwischenprodukt der Glykolyse, oder seltener auch direkt aus Glycerin. Auch die Fettsäuren müssen vor der Veresterung mit dem Glycerin zu Acyl-CoA aktiviert werden. Unter ATP-Verbrauch wird die Bildung des Acyl-CoAs durch die Fettsäure-Thiokinase (Acyl-CoA-Synthetase) katalysiert. I Abbildung 4 zeigt die Synthese der Triacylglycerine.
Besonderheiten bei der Fettsäuresynthese
~ Bildung von längeren Fettsäureketten: Die Fettsäuresynthase führt zur Bildung von Palmitin- ( 16 Kohlenstoffatome) oder Stearinsäure ( 18 Kohlenstoffatome). Gelegentlich werden aber auch längere Fettsäureketten benötigt, wie z. B. für die Synthese der Arachidonsäure (C20) . Dies wird durch ein in
X Die Fettsäuresynthese findet im Zytosol v.a. der Hepatozyten statt und wird katalysiert durch einen Multienzymkomplex, die Fettsäure-Synthase.
X Bausteine der Fettsäuresynthese sind Acetyi-CoA, Malonyi-CoA und als Reduktionsmittel NADPH/H+.
X Die Acyi-CoA-Desaturase wird für die Bildung ungesättigter Fettsäuren benötigt. Sie katalysiert den Einbau von Doppelbindungen, allerdings nur bis zum C9-Atom.
Abbau der Neutralfette und Fettsäuren
Die Fettsäuren werden in Form der Triacylglycerine im Fettgewebe gespeichert und können bei Energiebedarf mobilisiert werden: Die Neutralfette werden dazu in Glycerin und freie Fettsäuren gespalten. Letztere gelangen ins Blut und können von verschiedensten Organen aufgenommen und unter Energiegewinnung (ß-Oxidation) abgebaut werden.
Abbau von Triacylglycerinen
Triacylglycerine werden bei Bedarf durch Hydrolyse der Esterbindungen in Glycerin und Fettsäuren gespalten. Diesen Vorgang bezeichnet man als Lipolyse. Er wird durch spezifische Lipasen katalysiert, die jeweils für Tri- , Di- oder Monoacylglycerine zuständig sind. Reguliert wird die Lipolyse im Wesentlichen über die Triacylglycerinlipase, die sog. hormonsensitive Lipase. Adrenalin, Noradrenalin, Glukagon und ACTH stimulieren die Aktivität der hormonsensitiven Lipase, Insulin hemmt diese. Das frei gewordene Glycerin wird in der Leber und in den Mukosazellen des Darms phosphoryliert und in Dihydroxyacetonphosphat (DAP) umgewandelt, das anschließend in die Glykolyse eingeschleust oder zur Glukoneogenese verwendet werden kann. Die freien Fettsäuren können in den verschiedenen Organen zu Acetyl-CoA abgebaut werden.
Abbau von Fettsäuren
(ß-Oxidation)
Die Enzyme der ß-Oxidation befinden sich vorwiegend in den Mitochond· rien, nur ein Teil des Fettsäure-Abbaus
HO, _":-0 ATP PP, AMP- O, _":-0 CoA AMP CoA, 4 0 I Abb. 1: Einzelschritte c ~ J . c
I I CH2 CH2 I I R R
Fettsäure Acyladenylat
findet in hepatischen Peroxisomen statt. Die ß-Oxidation kann in fast allen Organen ablaufen, wi rd aber v. a. von Leber, Skelettmuskel und Herzmuskel zur Energiegewinnung genutzt.
Allein das Gehim und die Erythrozyten sind nicht zur Fettsäureverwertung befähigt, da Fettsäuren die Blut-Hirn-Schranke nicht Oberwinden können und Erythrozyten keine Mitochondrien besitzen.
Vorbereitung der ß-Oxidation
Bevor der Abbau beginnen kann, müssen die reaktionsträgen Fettsäuren aktiviert und in die Mitochondrien, dem Ort der ß-Oxidation, transportiert werden.
Fettsä uren-Aktivieru ng Durch Bindung an Coenzym-A wer-den die Fettsäuren reaktionsfreudig gemacht. Zunächst entsteht nach Reaktion der Fettsäure mit ATP das Acyladenylat, bei dem die Fettsäure an die Phosphatgruppe des AMP gebunden ist. Im folgenden Schritt wird diese Bindung durch die SH-Gruppe von Coenzym A gespalten, wobei AMP frei wird und das aktvierte Acyi-CoA entsteht (I Abb. I). Diese Reaktionsschritte werden von der Thiokinase (Acyi-CoA-Synthetase) katalysiert, die im Zytoplasma an der äußeren Mitochondrienmembran lokalisiert ist.
~ J . c"' I zur Fettsä ure-Aktivie-CH2 rung I R
Acyi-CoA
Transport in die Mitochondrien Damit das im Zytosol entstehende Acyi -CoA in die Mitochondrienmatrix gelangen kann, bedarf es eines speziellen Transportsystems, da die innere Mitochondrienmembran für Acyl-CoAVerbindungen und urchlässig ist. Diese Aufgabe übernimmt das Carnitin. Unter Abspaltung von CoA geht dieses mit der Fet_tsäu~e eine Esterverbindung (AcylcarDitm) em, welche die Mitochondrienmembran passieren kann . Katalysiert werden die beiden Schritte durch die Carnitin-Acyi-Transferase I und die Translokase. in der Mi tochondrienmatrix angelangt, wird der Acylrest durch die Carnitin·Acyltransferase II vom Acyleamitin wieder auf Coenzym A übertragen . ln I Abb. 2 ist ein Überblick über das Transportsystem dargestellt.
Ablauf
Die ß-Oxidation stel lt einen Zyklus dar in dem vier Reaktionsschritte immer ' wieder durchlaufen werden. In jeder Runde werden zwei C-Atome der abzubauenden Fettsäure in Form von Acetyl-CoA abgespalten. Die vier Reaktionen der ß-Oxidation sind:
..,. 1. Oxidation (in Form einer Dehydrierung): Im ersten Schritt wird das Acyi -CoA zu Enoyi-CoA oxidiert, wobei
äußere Mitochondrienmembran Innere Mitochondrienmembran
Carnitin-Acyllransferase I
CoA-SH +--!f--It--
extramltochondrlalea Kompartiment Zwlachenmembranraum
Acyi-CoA
CoA-SH
Mltochondrlenmetrlx
I Abb. 2: Der CarnitinCarrier in1
Überblick l l i' J
zwei Wasserstoffatome auf FAD übertragen werden(= Dehydrierung). Es entsteht eine Doppelbindung zwischen C2
und U Das entstandene FADH2 gibt seinen Wasserstoff im Anschluss sofort an ein Flavoprotein, das sog. Elektronen-Transfer-Protein, weiter, das die Elektronen über das Ubichinon in die Atmungskette übergibt. Enzym dieser ersten Reaktion ist die Acyi-CoA-Dehydrogenase. ..,.. 2. Hydratisierung: Die Enoyi-CoAHydratase katalysiert die Anlagerung von H20 ans Enoyi-CoA, wodurch L-ß-Hydroxyacyi-CoA entsteht. Bei dieser Hydratisierung wird die im ersten Schritt geknüpfte Doppelbindung wieder aufgelöst. ..,.. 3. Oxidation (in Form einer Dehydrierung): Die Oxidation der ß-Hydroxylgruppe durch die L-ß-HydroxyacyiCoA-Dehydrogenase hat die Entstehung einer Ketogruppe zur Folge. ln dieser NAD+-abhängigen Reaktion entsteht das ß-Ketoacyi-CoA sowie NADH/H+, das seine Wasserstoffe an die Atmungskette energiebringend weiterleitet. ..,.. 4. Thiolyse: Im letzten Schritt wird die Bindung zwischen den a -und ß-C-Atomen durch die SH-Gruppe eines zweiten CoA-Moleküls thiolytisch gespalten. Die 3-Ketothiolase katalysiert diese Reaktion, bei der ein Acetyi-CoA abgespalten wird , und ein um 2 C-Atome verkürztes Acyi-CoA entsteht.
Besonderheiten
..,.. Abbau ungeradzahliger Fettsäuren: Hier entsteht bei der letzten Spaltung statt einem Acetyl-CoA ein Propionyl-CoA. Dieses kann über Malonyi-CoA in Succinyi-CoA umgewandelt und in den Citratzyklus eingeschleust werden. Succinyi-CoA kann außerdem über Oxalacetat als Substrat der Glukoneogenese dienen. Damit kann hier ausnahmsweise aus einem Stück Fettsäure Glukose hergestellt werden. ..,.. Abbau ungesättigter Fettsäuren: Der Abbau ungesä ttigter Fettsäuren geschieht über die gleichen vier Reaktionsschritte wie der Abbau gesättigter Fettsäuren. Allerdings muss ein Umweg über zwei zusätzliche Enzymaktivitäten
Lipidstoffwechsel 68 I 69
,p R-CH2-CH2-CH2-C ~AD
'c oA 1 - - - - - Acyi-CoA-Dehydrogenase Acyi-CoA (C~~ , - - - - - - - - , , , FADH2
r ' r '
' ,...0 \ H 0 ,,o
CH 3-C 'coA
R-CH2-c ' ' ' 'r 'coA, , ,R-CH~-C=C-C Acyi-CoA (C n-2) ,' \ ' ~ 'Co A
Acetyi-CoA I
3-Keto-Thiolase
' f
' \
a-ß-ungesättigte-
F)""'"~;·:~ Hydratase
4 0 ü-- --
R-CH,-g1.CH2-C' ------s ' coA
I Abb. 3: Die ß-Oxidation auf einen Blick [7]
eingeschlagen werden, da ungesättigte Fettsäuren in der "cis"-Form vorliegen, die ß-Oxidation aber nur "trans"-Formen umsetzen kann.
Regulation
Die einzelnen Enzyme der ß-Oxidation werden nicht direkt reguliert. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt beim Abbau von Fettsäuren ist stattdessen die Reaktion der Carnitin-Acyltransferase I, der erste Schritt des Fettsäuretransports in die Mitochondrienmatrix. Gehemmt wird diese durch Malonyi-CoA, einem Zwischenprodukt der Fettsäurebiosynthese. Stimulierend wirken dagegen Schilddrüsenhormone sowie langkettige Fettsäuren, die die
Zusammenfassung
Transkriptionsrate für die Carnitin-Acyltransferase I steigern.
Energiebilanz
Das bei der ß-Oxidation entstehende FADH2 liefert bei Oxidation in der Atmungskette 1,5 Moleküle ATP, das NADH/ W 2,5 ATP. Pro Molekül AcetylCoA können bei Endoxidation in Citratzyklus und Atmungskette 1 0 Moleküle ATP gewonnen werden. Der Abbau von Palmitinsäure ( 16 C-Atome) führt beispielsweise zur Bildung von 108 ATPMolekülen (8 Acetyi-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH/ H+). Zieht man die zwei ATP, die man für die Fettsäure-Aktivierung benötigt ab, so bleiben immer noch 1 06 gewonnene ATP-Moleküle übrig!
tc Die hormonsensitive Lipase ist Schrittmacherenzym bei der Lipolyse, dem Abbau von Triacylglycerinen zu freien Fettsäuren.
tc Die ß-Oxidation findet in den Mitochondrien statt. Über den CarnitinCarrier können aktivierte Fettsäuren (Acyi-CoA) ins Innere der Mitochond
rien gelangen.
tc Ein Zyklus der ß-Oxidation beinhaltet vier Reaktionen: erste Oxidation, Hydratisierung, zweite Oxidation, Thiolyse.
tc Bei jedem Zyklus entstehen ein Acetyi-CoA, ein Molekül FADH2 und ein Molekül NADH/H+. Die anschließende Oxidation dieser Produkte hat eine hohe Energieausbeute zur Folge.
Ketonkörper
Im Hungerzustand kommt es im menschlichen Organismus zur vermehrten Synthese der sog. Ketonkörper. Kann der Energiebedarf der Organe nicht durch die Zufuhr von Kohlenhydraten gedeckt werden, was schon bei einer (kohlenhydratarmen) Diät mit einem Kohlenhydratanteil von 10-20% der Fall ist, schaltet der Körper auf den Ketonkörpermetabolismus um. Ketonkörper werden aus Acetyl-CoA synthetisiert, und sind geeignete Energielieferanten, da sie gut löslich sind, und von den meisten Organen verwertet werden können.
Ketogenese
Die Biosynthese der Ketonkörper findet ausschließlich in den Mitochondrien der Leberzellen aus Acetyl-CoA statt. Die in die Mitochondrien transportierten freien Fettsäuren werden hier über die ß-Oxidation zu Acetyl-CoA, abgebaut. Geschieht dies in dem Ausmaß, dass mehr Acetyl-CoA anfällt, als im Citratzyklus weiterverwertet werden kann, wird auf die Ketonkörpersynthese umgeschaltet. In drei Schritten wird aus Acetyi-CoA das Acetacetat (I Abb. 1 ):
~ Der erste Schritt entspricht der Umkehrung der Ketothiolasereaktion der Fettsäureoxidation und wird von der 3-Ketothiolase katalysiert. Zwei Moleküle Acetyl-CoA reagieren hierbei unter Abspaltung eines CoA miteinander zu Acetacetyl-CoA. ~ Verbindet sich nun ein weiteres Acetyl-CoA mit dem Acetacetyl-CoA, so entsteht ß-Hydroxy-ß-MethylglutarylCoA (HMG-CoA). Diese Reaktion wird durch die mitochondriale ß-HMGCoA-Synthase katalysiert (nicht zu verwechseln mit der zytoplasmatischen HMG-CoA-Synthase bei der Cholesterinbiosynthese!). ~ Anschließend wird das HMG-CoA durch die HMG-CoA-Lyase sofort wie-
der gespalten. Dabei entstehen Acetacetat und ein freies Acetyl-CoA.
Aus Acetacetat können die anderen beiden Ketonkörper ß-Hydroxybutyrat und Aceton gebildet werden. ß-Hydroxybutyrat entsteht durch die Reduktion von Acetacetat durch die ß-HydroxybutyratDehydrogenase. Als Reduktionsmittel wird hierzu NADH/ H+ benötigt, das dabei zu NAD+ oxidiert wird. ß-Hydroxybutyrat kann die Leberzelle leicht verlassen und stellt daher die "Transportform" der Ketonkörper dar. In einer nichtenzymatischen Reaktion kann Acetacetat zu Aceton decarboxylieren. Da es im Körper keine Verwendung findet, wird es über die Atemluft ausgeschieden und führt so bei stark erhöhter
Ketonkörperproduktion (wie z. B. bei juvenilen Diabetikern) zu einem typischen Acetongeruch der Atemluft
Steuerung der Ketonkörpersynthese
Die Ketonkörpersynthese wird nicht direkt reguliert, sie hängt vielmehr vom Angebot an Acetyl-CoA ab, und davon, wie viel von dem Acetyl-CoA in den Citratzyklus eingeschleust werden kann. Damit Acetyl-CoA im Citratzyklus weiterverwertet werden kann, benötigt es Oxalacetat, mit dem es zu Citrat reagiert (s. Kap. 76). Das Oxalacetat wiederum wird nicht nur im Citratzyk!us, sondern auch für die Glukoneogenese (s. Kap. 56) benötigt.
Acetyi-CoA ~ Acetyi-CoA
I Th1olase I HS-CoA
~ l - CoA l - CoA H~-C-CH2-C H3C- C + H20
~ ~ 0 0
Acetacetyi-CoA ~ Acetyi-CoA
I ß-HMG-CoA-Synthetase I HS-CoA
0 OH ~ I
C- CH2- C- CH2-COO-/ I
CoA- S CH3
o-3-Hydroxy-methyl-glutaryi-CoA (HMG-CoA)
I ß-HMG-CoA-Lyase I~ l - CoA H~-c
~ 0 0
'~:{ 0 11
co2 H3C- C- CH3
Aceton
I Abb. 1: Ketonkörpersynthese 121
II H3C- C- CH2-c oo-
Acetacetat
OH I
H3C- ? - CH2- coo-H
o-3-Hydroxybuttersäure (D-3-Hydroxybutyrat)
Veränderungen im Hungerzustand
Herrscht im Körper ein Hungerzustand, in dem ihm nicht genügend Glukose zur Verfügung steht, um ausreichend Energie über die Glykolyse zu gewinnen, versucht die Leber dies durch verstärkte Glukoneogenese auszugleichen. Das Oxalacetat wird nun vorwiegend in die Glukosesynthese gesteckt und fehlt dem Citratzyklus. Acetyl-CoA kann weniger im Citratzyklus verstoffwechselt werden und reichert sich in den Hepatozyten an. Zusätzlich führt der Kohlenhydratmangel zur Ankurbelung der Lipolyse, was ein erhöhtes Angebot an freien Fettsäuren, und somit einen weiteren Anstieg des Acetyl-CoA-Angebots zur Folge hat. Infolge der steigenden Acetyl-CoAKonzentration in der Leber, schaltet der Hepatozyt auf Ketonkörpersynthese um.
Rolle des Insulins
Verstärkt wird dieser Prozess dadurch, dass im Hungerzustand weniger Insulin sezerniert wird. Es herrscht sozusagen ein relativer InsulinmangeL Insulin hält normalerweise die Fette in ihren Speichern, so dass ein Mangel mit einer wiederum gesteigerten Lipolyse einhergeht, wodurch es noch mal zusätzlich zu einer Ankurbelung der Ketogenese kommt. Aus diesem Grund führt auch ein Diabetes mellitus mit absolutem oder relativem Insulinmangel zu einer starken Ketonkörpersynthese. Bei schwerem Insulinmangel kann die erhöhte Ketogenese zu Azidose führen, da die sauren Ketonkörper aufgrund des ausreichenden Glukoseangebots nicht verstoffwechselt werden und sich im Körper anreichern. Im Extremfall kann dies im ketoazidotischen Koma enden.
Ketonkörperverwertung
Fast alle Organe können Ketonkörper aus dem Blut aufnehmen und zur Energiegewinnung nutzen. Besonders wichtig ist dies für das Gehirn , das zur Energiegewinnung in Form von ATP normalerweise auf Glukose angewiesen ist. Es kann keine Fettsäuren verwerten, da diese die Blut-Hirn-Schranke nicht
passieren können. Nach einer Adaptationsphase von mehreren Tagen (nach Induktion der CoA-Transferase} ist das ZNS dazu in der Lage, ca. ein Drittel seines Energiebedarfs aus Ketonkörpern zu decken. Niere und Herzmuskel sind auch große "Fans" der Ketonkörper, sie ziehen diese sogar der Glukose als Energieträger vor.
ß-Hydroxybutyrat
Lipidstoffwechsel 70 I 71
Schritte der Ketonkörperverwertung
Die Ketonkörper werden durch die Leber ins Blut abgegeben und so in die Peripherie transportiert, wo sie von den (energiebedürftigen} Zellen aufgenommen werden. Dort wird es durch die ß-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase zu Acetacetat oxidiert, wobei aus NAD+ NADH/ H+ gebildet wird. Anschließend überträgt eine spezifische CoA-Transferase das Coenzym A von einem Succinyl-CoA auf das Acetacetat, das so zu Acetacetyl-CoA aktiviert wird. Durch eine Thiolase wird dieses in zwei Moleküle Acetyl-CoA gespalten, die nun in den Citratzyklus eingeschleust werden können (I Abb. 2}.
I Abb. 2: Ketonkörperabbau
T ramierase , Acetoacetat --------.".....;.·-.;:--------• Acetoacetyi-CoA
Succinyi-CoA ( \ Succinat
CoA --- Thiolase
Acetoacetyi-CoA-Synthetase I
ATP. CoA AMP, ®,® 2 Acetyi-CoA
Zusammenfassung X Ketonkörper sind Energieträger, die v. a. im Hungerzustand (Giukoseman
gel, gesteigerte Lipolyse) und bei Insulinmangel (gesteigerte Lipolyse) von der Leber gebildet werden. Dies geschieht in Folge eines Anstiegs des Acetyi-CoA-Angebots in den Leberzellen.
X Bei Diabetikern kann es zur Anreicherung der Ketonkörper kommen. Die Ketonkörper sind Säuren und können somit bei Anreicherung zu einer
Ketoazidose führen.
ac Zu den Ketonkörpern zählt man j3-Hydroxybutyrat, Acetacetat und Aceton. Letzteres wird abgeatmet und ist für den starken Acetongeruch der Atemluft von juvenilen Diabetikern verantwortlich.
X Alle Zellen außer den Hepatozyten und den Erythrozyten können Ketonkörper verwerten.
X Bei Glukosemangel (z. B. im Hungerzustand) ist v.a. das Gehirn auf Ketonkörper angewiesen, da es nicht dazu in der Lage ist, Fettsäuren energiebringend zu verwerten.
Cholesterin
Cholesterin (I Abb. I ) ist ein Alkohol aus der Klasse der Steroide mit der Summenformel C27 H450H. Der Körper eines Erwachsenen enthält ca. 150 g Cholesterin, von denen ca. 60% endogenen Ursprungs sind. Hauptsynthese· ortder Cholesterinbiosynthese ist die Leber, aber auch im Darm, in den Nebennieren und in den Gonaden wird ein Teil des Cholesterins synthetisiert. Die restlichen 40% des Gesamtcholesteringehalts nehmen wir über die Nahrung zu uns. Das Cholesterin liegt im Plasma zu 2/ 3 mit Fettsäuren verestert vor. Aufgrund seiner Hydrophobie müs· sen Cholesterin und seine Ester im Blut an Lipoproteine gebunden transportiert werden (s. Kap. 74).
Funktionen
Das Cholesterin nimmt unter anderem Funktionen als Strukturelement biolo· giseher Membranen und Gewebs- und Plasmalipoproteine, aber auch als Ausgangsstofffür verschiedene Substanzen, wahr. Die wichtigsten Aufgaben des Cholesterins sind:
IJi- Als Bestandteil von Zellmembranen ist es an der Kontrolle von Membranstabilität und -fluidität beteiligt. IJi- Cholesterin ist die Ausgangssubstanz für die Synthese der Gallensäuren. IJi- Außerdem ist Cholesterin selbst in geringem Maße ein Bestandteil der Gallenflüssigkeit. IJi- Cholesterin ist Ausgangsstoff für die Steroidhormonsynthese und somit Voraussetzung für die Bildung von Glukokortikoiden, Mineralokortikoiden, Androgenen, Östrogenen und Gestagenen. IJi- Auch für die Bildung des Cholecal· ciferols (Vitamin 03, s. auch Kap. 16) stellt Cholesterin die Synthesevorstufe dar.
HO
I Abb. 1: Cholesterin
Biosynthese
Cholesterin kann in jeder Körperzelle synthetisiert werden, wird aber haupt· sächlich in der Leber gebildet sowie in geringerem Maß in der Darmmukosa, den Nebennieren und den Gonaden. Bei der Synthese lagern sich 18 Mole· küle Acetyl-CoA zu 6 Isopren-Einheiten zusammen. Da die Cholesterinsynthese im Zytoplasma stattfindet, das AcetylCoAals Abbauprodukt des Glukose-, Fettsäuren· und Aminosäurenstoffwechsels aber hauptsächlich in den Mitochondrien entsteht, muss dieses zunächst über einen Acetyl-CoA-Carni· tin-Carrier über die Mitochondrienmembran ins Zytoplasma transportiert werden.
Schritte der Biosynthese
IJi- Zunächst reagieren drei Moleküle Acetyl-CoA zu einem Molekül ß-HMG· CoA (ß-Hydroxy-Methyl-Glutaryl·CoA). Dies geschieht analog zur Bildung des HMG-CoA für die Ketonkörperbildung, jedoch mit einem Unterschied: Das HMG-CoA der Cholesterinbiosynthese entsteht im Zytosol (zytoplasmatische HMG-CoASynthase), während sich die Ketonkörperbildung im Mitochondrium abspielt (mitochondriale HMG-CoASynthase) . IJi- In der Schrittmacherreaktion der Cholesterinbiosynthese wird das zyto· plasmatische ß·HMG-CoA durch die HMG·CoA·Reduktase zu Mevalon· säure reduziert. Hierbei werden zwei NADPH/ H+ verbraucht.
IJi- Anschließend wird die Mevalonsäure durch die Mevalonatkinase zu Mevalo· nat-5-Phosphat phosphoryliert, und nach einer weiteren Phosphorylierung durch die Mevalonat-5-P-Kinase entsteht das Mevalonat-5·Pyrophosphat. Für diese beiden Schritte werden insge· samt zwei ATP verbraucht. IJi- Im nächsten Schritt wird durch De-
carboxylierung und H20·Abspaltung aktives Isopren, das Isopentenyl-Pyrophosphat gebildet. Auch dieser Schritt verbraucht ein ATP. IJi- Nach Umwandlung von IsopentenylPyrophosphat zu Dimethylallyl·Pyrophosphat durch eine spezifische Isomerase, die den Wechsel der Doppelbindung katalysiert, folgen einige Kondensationen: - lsopentenyl-Pyrophosphat ( = 1. Iso
preneinheit) kondensiert mit Dimethylallyi·Pyrophosphat (= 2. Isopreneinheit) zu Geranyl·Pyrophosphat.
- Geranyl·Pyrophosphat kondensiert mit einem weiteren Isopentenyl· Pyrophosphat (= 3. lsopreneinheit) zu Farnesyl-Pyrophosphat.
-Zwei Moleküle Farnesyl-Pyrophosphat kondensieren zum Squalen. Damit benötigt man für die Synthese eines Squalen·Moleküls sechs Isopreneinheiten .
IJi- Aus Squalen entsteht über die Zwischenstufe des Lanosterins nach Umlagerungen von Doppelbindungen Abspaltung dreier Methyl-Gruppen ' und einer Hydroxylierung am C3-Atom das ringförmige Cholesterin.
Zum besseren Verständnis sind die Reaktionen der Cholesterinbiosynthese in I Abbildung 2 noch einmal abgebildet.
Bilanz
Für die Bildung von einem Mol HMGCoA (6 C) werden 3 Mol Acetyl-CoA (2 C) benötigt. Die Umwandlung von HMG-CoA in aktives Isopentenylpyrophosphat (5 C) verbraucht 2 Mol NADPH/ H+, sowie 3 Mol ATP. 6 Mol Isopren kondensieren unter Verbrauch von I Mol NADPH/ H+ zu Squalen, dessen Umwandlung in Cholesterin ein weiteres Mol NADPH/ H+ kostet.
Regulation
Die Regulationsstelle der Cholesterinbiosynthese ist die Reaktion der
Bildung von lsopentenyiPyrophosphat
3 Acetyi-CoA C2
2 NADPH + W I ß-HMG-CoA-Reduktase I
OH I
HOOC - CH2-9-CH2-CH2-0H
CH3
Mevalonsäure C6
~ I Mevalonatkinase I Mevalonat-5-P
!:d=i I Mevalonat-5-P-Kinase I Mevalonat-5-P-P
Mevalonat-5-P-P-Kinase, ,-------, C02, Decarboxytase
I Isomerase I P •
C5 Dimethytallyi-P-P - H2C=r-CH2-CH2-0- P-P
CH3
(isopentenyi-P-P) CS lsopentenyi-Diphosphatlaktives Isopren)
r:l 0::-im-e-:-thy-:-la-lly-1-li::-ra-ns-:-fe-ra-se'l-'
P,P
C10 Geranyi-P-P
I Geranyi-Transferase I P, P
C15 Farnes~I-P-P NADPH +H' I Squaten-Synthetase I NADP•
3CH3. ~ Wechsel einer Doppelbindung
HO
(Squalen) C30
Cholesterin C27
I Abb. 2: Schritte der Cholesterinbiosynthese [6]
I Kondensationen I
HMG-CoA-Reduktase. Diese kann auf verschiedenen Ebenen beeinflusst werden.
.,._ Mevalonsäure und Cholesterin hemmen die Aktivität HMG-CoA-Reduktase (Rückkoppelungshemmung). .,._ Ein niedriger Cholesterinspiegel führt zu einer Steigerung der Transkription- bzw. Translationsrate der HMG-CoAReduktase, während eine erhöhte Cholesterinkonzentration zu deren Hemmung führt .,._ Erhöhte Sterinkonzentrationen führen zu einer Änderung der Struktur der HMG-CoA-Reduktase, wodurch deren Abbau durch Proteasen erleichtert wird. .,._ Die HMG-CoA-Reduktase sowie die Zytoplasmatische
Lipidstoffwechsel 72 I 73
HMG-CoA-Synthase gehören zu den enzymatisch interkonvertierbaren Enzymen (s. auch Kap. 14). Sie sind in der dephosphorylierten Form aktiv, während eine Phosphorylierung zu ihrer Inaktivierung führt Die Phosphorylierung geschieht bei Energiemangel über eine AMP-abhängige Proteinkinase. Also führen ein hoher AMP-Spiegel (bzw. niedriger ATP-Spiegel), aber auch der Einfluss von Glukagon zur Hemmung der Cholesterinbiosynthese, während ein hoher ATP-Spiegel und Insulin sie ankurbeln. Dies macht Sinn, da das Acetyi-CoA in Energiemangelsituationen so für die Energiegewinnung zur Verfügung steht
Cholesterinausscheidung
Der menschliche Organismus ist nicht dazu in der Lage, Cholesterin abzubauen, also muss der Körper auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, um es zu eliminieren. Der Hauptteil des Cholesterins wird in Form von Gallensäuren über die Gallenflüssigkeit in den Darm ausgeschieden, von denen allerdings fast 90% im Ileum rückresorbiert und wieder der Leber zugeführt werden (enterohepatischer Kreislauf). Auf diesem Wege eliminiert der Mensch täglich nur etwa 1 g Cholesterin mit den Faeces. Geringe Mengen an Cholesterin gehen außerdem durch Abschilferung von Haut und Darmepithelien verloren oder in sehr geringem Maße auch durch renale Eliminierung von Steroidhormonen und ihren Abbauprodukten.
Zusammenfassung X Der Steroidalkohol Cholesterin reguliert als Bestand
teil biologischer Membranen die Membranfluidität und ist außerdem Ausgangsstoff für die Biosynthese von Gallensäuren und Hormonen (Steroidhormone,
1-,2 5-Dihydroxycholecalciferol). X Der Syntheseweg des Cholesterins aus 18 Acetyi-CoA
findet im Zytoplasma vor allem der Hepatozyten statt
und führt über die Zwischenstufen 13-HMG-CoA, lsopentenyi-Pyrophosphat und Squalen.
X Das Schlüsselenzym der Synthese ist die HMG-CoAReduktase. Sie wird durch AMP (Energiemangel) und Glukagon gehemmt und durch Insulin aktiviert.
X Der Hauptteil des Cholesterins wird in Form von Gallensäuren über die Gallenflüssigkeit ausge
schieden .
1proteine
:_::: :::.:: sind bekanntlich hydrophob, d. h. sie lösen sich sehr schlecht bzw. gar nicht in wässrigem Milieu. Trotzdem müssen einige Lipide, wie das Cholesterin, das in der Leber synthetisiert bzw. im Darm resorbiert wird, aber in allen Zellen benötigt wird, im Blut transportiert werden. Andere Lipide des Blutplasmas sind Phospholipide, Triacylglycerine (TAG) und freie Fettsäuren. Zum Transport im Blut müssen apolare und schwach polare Lipide an Proteine gebunden werden. So entstehen hydrophile Lipoproteinkomplexe, die sog. Lipoproteine.
Allgemeines und Einteilung
Lipoproteine nennt man Zusammen· schlüsse von apolaren und amphiphilen Lipiden mit einem variablen ProteinanteiL Im groben Aufbau ähneln sich die verschiedenen Lipoproteine: Wäh· rend sich die apolaren Lipide eher im Zentrum zusammenlagern, bilden die Proteinanteile zusammen mit den amphiphilen Lipiden eine Hülle. Man unterscheidet insgesamt fünf Lipoproteine, die unterschiedlich zusammengesetzt sind und demnach auch spezifische Eigenschaften aufweisen. Die Proteinanteile der Lipoproteine nennt man Apolipoproteine. Von diesen sind bisher zehn verschiedene bekannt: A 1, A2, A4, B48, B 1 00, C 1, C2, C3, D und E. Sie werden in der Leber und im Dünndarm gebildet und vermitteln die Löslichkeit von Lipoproteinen. Zudem dienen sie als Signalvermittler im LipoproteinstoffwechseL
te sowie in ihrer Wanderungsgeschwindigkeit in der Elektrophorese. Die Einteilung nach ihrer Dichte war ausschlaggebend für die Benennung der Lipoproteinklassen (I Tab. I).
Die Lipoproteinklassen im Einzelnen
Chylomikronen
Chylomikronen werden nach fettreichen Mahlzeiten in der Mukosa des Darms gebildet, und enthalten als Lipidanteil vorwiegend exogene Triacylglycerine (TAG) aus der Nahrung. Sie werden vom Darm über die Lymphe zur Blutbahn transportiert. Die extrazelluläre Lipoproteinlipase {LPL} vor allem des Fettgewebes baut die Triacylglycerine der Chylomikronen ab. Dadurch werden Fettsäuren frei, die vom Fettgewebe aufgenommen, oder an Albumin gebunden weitertransportiert werden. Übrig bleiben Restpartikel der Chylomikronen (= remnants), die von der Leber aufgenommen werden.
VLDL (Very Low Density
Lipoproteins)
durch die Leber aufgenommen, und nach Modifikation als LDL in die Blutbahn abgegeben.
LDL (Low Density Lipoproteins)
LDL sind die Lipoproteine mit dem höchsten Cholesterinanteil (45%). Sie entstehen in der Leber und in der Peripherie beim Abbau von VLDL und IDL und gelangen nach Bindung an spezi- ' fische LDL-Rezeptoren samt diesen per Endozytose in die peripheren Zellen. Das Erkennungssignal für den Rezeptor liefert hierbei das Apolipoprotein B-1 oo Die Anzahl der extrazellulären LDL-Re-· zeptoren wird durch die intrazelluläre Cholesterinkonzentration bestimmt. Bei hohem intrazellulärem Cholesteringehalt verhindert die Hemmung der LDL-Rezeptor-Synthese eine Überspeicherung von Cholesterin. In der Zelle wird das Cholesterin durch Iysosomale Lipasen aus LDL freigesetzt und der Rezeptor wandert in die Mem: bran zurück. Das Cholesterin kann nun entweder verwertet, oder durch die Acyl-CoACholesterol-Acyl-Transferase (ACAT) mit Fettsäuren verestert und als Cholesterinester gespeichert werden.
Das LDL gilt allgemein als das .schlech~e Cholesterin•, da es das Cholesterin aus der Leber in die Peripherie verteilt. Dies führt zur Cholesterinablagerung in den Gefäßwänden und somit zur Bildung artlt-i riosklerotischer Plaques.
Die Lipoproteinklassen unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, ihrem Bildungsort, ihrer Größe und ihrer Dich-
VLDL werden in der Leber gebildet und transportieren endogen synthetisierte Triacylglycerine und Cholesterin in die Peripherie. Dort werden, wie bei den Chylomikronen auch, die Triacylglycerine durch die Lipoproteinlipase abgebaut, und aus VLDL wird IDL (intermediate density Iipoproteins) mit einem nun höheren relativen Cholesteringehalt Ein Teil der IDL wird durch die Lipoproteinlipase gleich intravasal zu LDL weiter abgebaut, der Rest wird
HOL (High Density Lipoproteins)
Das phospholipidreiche HDL wird in Leber und Darm gebildet und hat mit
Chylomikronen VLDL IDL LDL HOL
Bildungsorte Darmschleimhaut Leber Peripherie und Leber aus VLDL Peripherie und Leber aus VLDL und IDL Leber
Größe 100-1000nm 30 - 70 nm 25-30 nm 15 - 25 nm 7,5 - 10 nm
Höchster Lipidanteil Exogene Nahrungs-TAG Endogene TAG Cholesterinester Cholesterinester Cholesterinester
Apolipoproteine A1,A2,A4,B48,C 1-3 B 100, C 1-3, E B 100, C3, E 8100 A1, A2, C1-3, D, E
Proteinanteil 0,8-2,5% 8-12% 12 - 20% 20 - 24% 40 - 60%
Mechanismus der Durch die Lipoprotein- Durch die LPL Durch die LPL oder rezeptor- Durch rezeptor-vermittelte Endozytose
Lipidabgabe Lipase (LPL) vermittelte Endozytose
Elektrophoresefraktion Keine Wanderung Prä-p-Fraktion ß-Fraltion ß-Fraktion a 1-Frak tion
I Tab. 1: Lipoproteine und ihre Eigenschaften auf einen Blick
~~---------------------------------------------------~L~ip~id~s~t~o~ff~w~e~c~h~s~el 741 75
Darmmukosa
Muskel+ Fett
I Abb. 1: Stoffwechselwege der Lipoproteine im Überblick
40- 60% den höchsten Proteingehalt aller Lipoproteine. Es transportiert Cholesterin aus der Peripherie in die Leber und dient als "Cholesterinfänger", da es dazu in der Lage ist, Cholesterin aus den peripheren Geweben und aus anderen Lipoproteinen aufz unehmen. Dieses wird im HDL vorwiegend in veresterter Form transportiert. Die Veresterung des Cholesterins mit einer Fettsäure eines Phospholipids wird katalysiert durch die Lecithin-CholesterinAcyl-Transferase (LCAT) .
Der Weg der Lipoproteine lässt sich am Besten bildlich nachvollziehen. I Abbildung 1 bietet einen Überblick über den Stoffwechsel der Lipoproteine.
Hyperlipoproteinämien
Hohe Lipoproteinkonzentrationen im Blutplasma gehen mit einem erhöhten Arterioskleroserisiko einher und sind daher im Klinikalltag von großer Bedeutung. Man unterscheidet neben den ernährungsbedingten, reaktiven Hyper-
lipoproteinämien, auch primäre und sekundäre Formen:
~ Die häufige primäre Hyperlipoproteinämie ist eine hereditäre Erkrankung mit autosomalern Erbgang. Eine Sonderform ist die primäre Hypercholesterinämie, die mit erhöhten Cholesterinwerten einhergeht und eine familiäre Häufung aufweist. Als Ursache geht
man von Defekten in der LDL-RezeptorRegulation aus. ~ Sekundäre Hyperlipoproteinämien sind Begleiterscheinungen bzw. Folge anderer Erkrankungen. Sie treten z. B. auf bei Diabetes mellitus, Adipositas oder Lebererkrankung.
Man teilt die Hyperlipoproteinämien nach Fredrickson in sechs verschiedene Gruppen auf (I Tab. 2).
Typ erhöhter Lipidanteil Arterioskleroserisiko Häufigkelt
Chylomikronen + Sehr selten
lla (familiäre Hypercholesterinämie) LDL +++ tO%
llb (kombinierte Hyperlipidämie) VLDL, LDL +++ 15%
111 VLDL, ß-Lipoproteine ++ 5%
IV VLDL ++ 70%
V Chylomikronen, VLDL + Selten
I Tab. 2: Einteilung der Hyperlipoproteinämien nach Fredrickson
Zusammenfassung X Lipoproteine sind Zusammenschlüsse von Lipiden mit verschiedenen
Proteinanteilen, den sog. Apolipoproteinen. Sie stellen die Transportform
der sonst unlöslichen Lipide im Blutplasma dar.
X Man teilt die Lipoproteine ihrer Dichte nach in fünf Gruppen mit unter
schiedlichen Eigenschaften ein: Chylomikronen, VLDL, IDL, LDL und HOL
X Hyperlipoproteinämien gehen mit einem erhöhten Arterioskleroserisiko
einher. Dieses kann bei den verschiedenen Formen (nach Fredrickson)
stark abweichen.
Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion und Citratzyklus
In den folgenden Kapiteln geht es um Energiegewinnung. Was aber ist genau mit Energie gemeint? In Kapitel 8 haben wir bereits über endotherme und exotherme Reaktionen gesprochen. Energie wird also für den Ablauf endergoner Reaktionen und anderer Prozesse des Körpers (aktiver Transport usw.) benötigt und durch die Spaltung energiereicher Verbindungen gewonnen. Der wichtigste Energielieferant im Körper ist das Nukleotid Adenosintriphosphat (ATP}, das zwei energiereiche Phosphoanhydrid- bzw. Säureanhydridbindungen enthält. Es stellt sozusagen die "Energiewährung" des Körpers dar. Davon zu unterscheiden sind die Energiespeicher, wie z. B. Glykogen oder das Fettgewebe, die bei Energieüberschuss angelegt werden und auf die im katabolen Zustand zurückgegriffen werden kann. Zusammengefasst kann man also Energiegewinnung mit ATPGewinnung gleichsetzen. Diese erreicht der Körper über den oxidativen Abbau unserer Nahrungsstoffe, welche sich im Wesentlichen aus Kohlenhydraten (Glukose), Fett- und Aminosäuren zusammensetzen. Die gemeinsame Endstrecke aller drei Stoffklassen ist der Citratzyklus.
Pyruvat-Dehyd rogenase
Reaktion
Während der Abbau von Fett- und Aminosäuren direkt zur Bildung von Acetyl-CoA führt, entsteht durch die Glykolyse Pyruvat. Dieses wird entweder zu Laktat abgebaut (anaerobe Glykolyse) oder in den Citratzyklus eingeschleust und im weiteren Verlauf vollständig in C02 und H20 oxidiert, was wesentlich mehr Energiefreisetzung zur Folge hat. Dafür muss das Pyruvat allerdings erst durch die Pyruvat-Dehydrogenase (PDH) zu Acetyl-CoA decarb· oxyliert werden. Bei Energieüberschuss wird das entstandene Acetyl·CoA zur Biosynthese von Fettsäuren verwendet. Damit dient die Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion auch als Baustein-Lieferant für die Fettsäuresynthese.
Ablauf
Die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat wird durch einen Multienzymkomplex mit drei verschiedenen Enyzmfunktionen, dem Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex, katalysiert. Dieser befindet sich in der mitochondrialen Matrix, daher muss zunächst das Pyruvat aus dem Zytosol durch einen PyruvatCarrier (Pyruvat/ OH-Antiport bzw. Pyruvat/H+-Symport) ins Mitochondrium transportiert werden. Dort fi ndet folgende Nettoreaktion statt: Pyruvat + CoA + NAD+ -+ Acetyl· CoA + C02 + NADH + H+ Reaktionsschritte in Worten und die jeweils dazugehörige Enzymfunktion (I Abb. 1):
11>- I. Oxidative Decarboxylierung des an TPP gebundenen Pyruvats: PyruvatDehydrogenase, E1;
11>- 2. Übertragung des dabei entstandenen Hydroxyethylrests auf Liponamid und dabei Oxidation zu einem Acetylrest: Pyruvat-Dehydrogenase, E1;
11>- 3. Transfer der Acetylgruppe auf Coenzym A: Dihydrolipoyl· Transacetylase, E2;
11>- 4. Regeneration des Cofaktors Liponamid durch Oxidation (FAD dient hier als Elektronenakzeptor und überträgt die Elektronen anschließend auf NAD+): Dihydrolipoyl-Dehydrogenase, E3•
Für die Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion werden fünf Coenzyme benötigt: Thlaminpyrophosphat (TPP), Uponamld, FAD und die stöchiometrischen Cofaktoren Coenzym A und NAD•
Regulation
Die Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion ist ein wichtiger, irreversibler Schritt· macher im Kohlenhydratstoffwechsel, da Acetyl-CoA nicht mehr zu Pyruvat und damit zu Glukose zurückverwan-
delt werden kann. Die Weichen werden sozusagen in Richtung Endabbau oder Fettsäuresynthese gestellt. Regulationsmechanismen der Reaktion sind:
11>- Allosterische Endprodukthemmung durch Acetyl-CoA und NADH, 11>- Rückkoppelungsregulation: GTP hemmt, AMP aktiviert, 11>- Interkonvertierung: Inaktivierung durch Phosphorylierung durch die Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase (:::: Bestandteil des Mulitenzymkomplexes; aktiviert durch Acetyl-CoA, NADH und ATP, gehemmt durch Pyruvat, CoA, NAD+ und ADP) , Reaktivierung durch eine Ca2+.abhängige Phosphatase; 11>- Hormone: Aktivierung der PDH durch Katecholamine und Insulin.
Citratzyklus
Der Citratzyklus ( = Zitronensäurezyklus oder Tricarbonsäurezyklus) stellt die Verbindung zwischen Substratabbau und Zellatmung dar. Er verbindet dabei die Abbauwege von Kohlenhydraten Aminosäuren und Lipiden und hat ' gleichzeitig eine anabole Funktion
' da seine Zwischenstufen oft auch Bio-syntheseverstufen sind. Er spielt damit eine zentrale Rolle im gesamten Stoffwechselkonstrukt Seine Hauptaufgabe besteht allerdings darin, Acetyl-CoA zu NADH/H+, FADH2 und GTP abzubaue und dadurch in Zusammenarbeit mit n der Atmungskette Energieäquivalente in Form von ATP zu gewinnen.
Ablauf
Der Citratzyklus ist ein Kreisprozess der acht Reaktionen beinhaltet. Er s~iel sich in den Mitochondrien ab und ist t direkt mit der Atmungskette gekoppelt Um den Kreislauf aufrecht zu erhalten · muss das Eingangsmolekül Oxalace~ tat ständig regeneriert werden. Dies geschieht in der zweiten Phase des Citratzyklus, in der aus Succinat Oxal-
0 co2
H3c-~-coo- __ )'--P-.. 0 2e- 0 CoA
0
H3C-~ - __ )<---+-.. H3C-~ + ____,\~-.. HaC-~-S-CoA Acetyi-CoA Pyruvat
I Abb. 1: Reaktionsschritte der Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion
acetatwiederhergestellt wird . Die ers· ten Schritte des Zyklus dienen dem Ab· bau des Acetyl·Restes von Acetyl·CoA zu zwei Molekülen C02• Die einzelnen Reaktionsschritte sind in I Abbildung 2 dargestellt.
Bilanz
Die Bilanzgleichung des Citratzyklus lautet: Acetyl·CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + P; + 2 HzO ~ 2 C02 + 3 NADH + H+ + FADH2 + GTP + CoA Die Reduktionsäquivalente NADH/ H+ und FADH2 werden anschließend der Atmungskette zugeführt und führen dort zur Bildung von ATP und gleich· zeitig zur Regeneration von NAD+ und FAD, die nun wieder für den Citrat· zyklus zur Verfügung stehen. Das entstandene GTP ist mit einem Molekül ATP gleichzusetzen, da diese ohne Energieverlust durch die Nukleosiddiphosphat-Kinase (GTP + ADP ~ COP+ ATP) ineinander übergeführt werden können. Das C02 ist ein Abfallprodukt des Citratzyklus und wird abgeatmet. Da durch die Oxidation eines NADH/ W drei Moleküle ATP und durch die Oxidation eines FADH2 zwei ATP entstehen, hat der Citrat-Zyklus eine hohe Energieausbeute von zwölf ATP pro Verbrennung eines Acetyl-CoAs.
Regulation
Der Citratzyklus wird im Wesentlichen über drei Schlüsselenzyme reguliert:
~ Citrat-Synthase, ~ Isocitrat-Dehydrogenase und ~ a-Ketoglutarat·Dehydrogenase.
Insgesamt hängt ihre Aktivität hauptsächlich vom energetischen Zustand der Zelle ab. So deuten z. B. ATP, Citrat und NADH/ H+ darauf hin, dass in der Zelle genug Energie vorhanden ist, und die Schlüsselenzyme werden gehemmt.
coo-l
HO- C-H I CH2 I coo-
Malat
1 ,.-,~ H20~
CoA
Acetyi-CoA
I Abb. 2: Der Citratzyklus
Hohe ADP-Konzentrationen zeigen dagegen einen Energiebedarf an und beschleunigen den Ablauf des Citratzyklus.
Zusammenfassung
Energiegewinnung
CCXT I CH2 I
-ooc-C-OH I CH2 I coo-
Citrat
+ co2
a-Ketoglutarat
Succinat
Citratzyklus als Baustein-Lieferant
76 I 77
Wie schon erwähnt können einige Zwischenprodukte des Citratzyklus für die Biosynthese anderer Stoffe verwendet werden. Er liefert Grundbausteine für die Hämsynthese (Succinyl-CoA), die Glukoneogenese (Oxalacetat) sowie für die Fett- (Acetyl-CoA) und Aminosäuresynthese (Oxalacetat, a -Ketoglutarat).
X Die Pyruvat-Dehydrogenase ist ein irreversibles Schlüsselenzym im Kohlenhydratstoffwechsel. Aus Acetyi-CoA kann kein Pyruvat mehr entstehen, daher ist die Regulation dieses Enzyms von großer Bedeutung.
X Der Citratzyklus Ist zentraler Drehpunkt des gesamten Stoffwechsels. Neben seiner Hauptaufgabe, der Energiegewinnung, führt er zur Bildung von Synthesevorstufen für verschiedene Stoffe.
X Der Citratzyklus hat eine hohe Energieausbeute von insgesamt zwölf ATP pro Acetyi-CoA.
Atmungskette und ATP-Synthese
Die Atmungskette, auch oxidative Phosphorylierung genannt, ist ein für die Energiebereitstellung sehr wichtiger Bereich des Stoffwechsels. Sie besteht aus vier Enzymkomplexen (I Abb. 1) und findet am Mitochondrium statt. Diese Proteine sind verantwortlich für die Übertragung von Elektronen und Protonen auf Sauerstoff, wobei Wasser entsteht. Dabei wird ein Protonengradient an der Mitochondrienmembran aufgebaut. Beim Ausgleich dieses Gradienten wird an der ATP-Synthase ATP aus ADP und Phosphat produziert.
Aufbau der Atmungskette
1. Komplex: NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase Der erste Proteinkomplex der Atmungskette ist die NADHUbichinon-Oxidoreduktase. Dieses Enzym befindet sich in der inneren Mitochondrienmembran. Hier findet die Übertragungzweier Elektronen sowie zweierProtonenvon NADH auf ein Flavinmononukleotid (FMN) statt. Hierbei handelt es sich um eine prosthetische Gruppe des Enzymkomplexes. Nun werden die Elektronen und die Protonen über einen Zwischenschritt auf Ubichinon übertragen. Dieser Teil des Komplexes wird dadurch zu Ubichinol reduziert. Das für diese Reaktion benötigte NADH stammt aus der Glykolyse, dem Citratzyklus oder dem Abbau von Fettsäuren. Durch die Protonenübertragung am 1. Komplex der
Inter-membran-
raum
4W
zw 111
innere Mitochondrien-
membran
2H• +2e-
~
ze·
(
Zytochrom b ) Zytochrom c1
Fe-S
Zyt Cred Zyt Cox
NADH + H•
4W
Succinat a-Giycerophosphat Acyi-CoA
Fumarat DHAP Enoyi-CoA
I---- --2H•
I Abb. 1: Die Komplexe der Atmungskette [2]
Atmungskette werden vier Protonen aus dem Innenraum des Mitochondriums in seinen Intermembranraum befördert.
2. Kom plex: Succ inat-Ubichinon-Reduktase Der zweite Komplex kann keine Protonen über die Mitochondrienmembran pumpen. Er ist dafür zuständig, im Citratzyklus (s. Kap. 76) entstandenes FADH2 zu FAD zu oxidieren. Die Succinat-Dehydrogenase, die wir ebenfalls schon vom Ci tratzyklus her kennen, ist Bestandteil dieses Komplexes. Die Protonen des FADH2 werden wiederum auf Ubichinon übertragen, das zu Ubichinol reduziert wird.
3. Komplex: Ubich inoi-Cytoch rom-c
Oxidoreduktase Der Vorgang an diesem Komplex wird auch als 0-Zyklus bezeichnet. Hier werden die zuvor aufs Ubichinol geladenen Elektronen an Cytochrom c weitergegeben. Die zwei Protonen, die das Ubichinol zuvor aufgenommen hatte, werden in den Intermembranraum gepumpt. Ubichinol (OH
2) wird
bei diesem Vorgang wieder zu Ubichinon (0) oxidiert.
4. Komplex: Cytochrom-c-Oxidase An der Cytochrom-c-Oxidase findet die Übertragung der vorn Cytochrom c aufgenommenen Elektronen auf Sauerstoff statt. Der Sauerstoff nimmt zwei Elektronen sowie zwei Protonen auf und wird so zu Wasser reduziert. Die Protonen stammen aus dem Innenraum des Mitochondriums. Außer diesen beiden auf den Sauerstoff übertragenen Elektronen werden noch zwei weitere Protonen aus der Matrix des Mitochondriums in den Intermembranraum gepumpt. Bei diesen Reaktionsschritten entstehen zellschädliche Sauerstoffverbindungen, die mithilfe der Enzyme Superoxid-Dismutase und Katalase unschädlich gemacht werden.
AlP-Synthese
Das Enzym, an dem die Synthese von ATP stattfindet ' ist die ATP-Synthase.
Durch Reaktionen, die von der ATP-Synthase katalysiert werden, wird aus ADP das energiereiche ATP hergestell t. ATP ist der wichtigste Bereitsteller von Energie in unserem Körper und wird in sehr vielen Vorgängen des Stoffwechsels benötigt. Wichtig hierfür ist der in der Atmungskette entstandene Protonengradient an der Mitochondrienmembran. Dieser Gradient verbindet Atmungskette und ATP-Synthese untrennbar miteinander, weshalb die ATP-Synthase auch als fünfter Komplex der Atmungskette bezeichnet wird .
Aufbau der ATP-Synthase
Das Enzym ist aus zwei Un tereinheiten aufgebaut, die man als F0 und F1 bezeichnet (I Abb. 2):
IJI> F1: Dieser Teil der Synthase beinhaltet das katalytische Zentrum des Enzyms. Er ragt ins Innere der Mitochondrienmatrix und ist wiederum aus mehreren Untereinheiten aufgebaut. IJI> F0: Diese Untereinheit sitzt in der inneren Mitochondrienmembran. Sie bildet einen Kanal, durch den die Protonen bei der Synthese fließen.
Mechanismus der Synthese
Die eigentliche Herstellung von ATP findet in der F1-Untereinheit der Synthase statt. Hier läuft folgende Reaktion ab: ADP+P1 ~ ATP Hierfür wird Energie benötigt, die durch den Rückfluss der Protonen aus dem lntermembranraum des Mitochondriums in dessen Matrix gewonnen wird . Diese sind im Zwischenmembranraum an NADH + H+ gebunden. Die Protonen fließen durch den Kanal der F0-Unterei nheit des Enzyms, wodurch die F1-Untereinheit in Rotation versetzt wird. Im lntermembranraum bleibt NAD+ zurück. Bei einem Fluss von 20 Protonen entstehen auf diesem Weg etwa fünf ATP. Dieser Mechanismus funktioniert allerdings nur bei einer intakten Mitochondrienmembran. Hat diese ein "Loch", so fließen die Protonen nicht durch den Kanal der ATP-Synthase, sondern direkt zurück in den Innenraum, und es kann kein ATP synthetisiert werden.
Regulation von Atmungskette und ATP-Synthese
Die Synthese von ATP kann nur stattfinden, wenn genügend Produkte, also ADP, Phosphat, Sauerstoff und NADH + H+ vorhanden sind. Kontrolliert wird die Synthese allerdings vom Spiegel des ADP.
Der ADP·Spiegel hat nicht nur Einfluss auf Atmungskette und ATP-Synthese,
Energiegewinnung 78 I 79
sondern reguliert im gleichen Sinne den Citratzyklus.
Hemmstoffe der Atmungskette
IJI> Antimycin A: Dieses Antibiotikum hemmt den dritten Komplex der Atmungskette und somit die Übertragung von Elektronen von Ubichinol auf Cytochrom c. IJI> Kohlenmonoxid: Kohlenmonoxid hemmt im vierten Komplex die Reaktion mit Sauerstoff, indem es dessen Bindungsstelle blockiert. Der Protonengradient bricht in der Folge zusammen, und die Synthese von ATP wird unmöglich. IJI> Oligomycin: Dieses Antibiotikum hemmt die ATP-Synthase und durch die Verbindung von Atmungskette und ATP-Synthese über den Protonengradienten auch die Atmungskette.
Zusammenfassung
Entkoppler der Atmungskette
Entkoppler der Atmungskette , wie zum Beispiel Dinitrophenol, haben einen unkontrollierten Antrieb der Atmungskette zur Folge und somit den höchstmöglichen Sauerstoffverbrauch, allerdings ohne die Produktion von ATP. Sie verursachen einen Rückfluss der in der Atmungskette in den lntermembranraum gebrachten Protonen in die mitochondriale Matrix. Der Protonengradient kann nicht aufrechterhalten werden und somit auch kein ATP synthetisiert werden. Die Energie, die von der Atmungskette produziert wird, wird als Wärme abgegeben. Thermogenin ist ein physiologischer Entkoppler der Atmungskette: Säuglinge (im braunen Fettgewebe) und auch Tiere nutzen diese Möglichkeit als zusätzliche Wärmequelle.
I Abb. 2: Aufbau der ATP-Synthase [2 ]
ac An den vier Komplexen der Atmungskette werden über mehrere Zwischenschritte Elektronen und Protonen von NADH und FADH2 auf Sauerstoff übertragen. Es entsteht Wasser.
ac Es werden Protonen aus dem Innenraum des Mitochondriums in dessen Intermembranraum gepumpt. Dadurch entsteht ein Protonengradient über der inneren Mitochondrienmembran.
ac Bei der Synthese von ATP an der ATP-Synthase fließen die Protonen durch einen Kanal des Enzyms zurück ins Innere des Mitochondriums. Die freiwerdene Energie wird für die Synthese von ATP aus ADP und Phosphat genutzt.
ac Der ADP-5piegel ist der wichtigste Regulationsmechanismus von Atmungskette und AlP-Synthese. Steigt er, wird Energie benötigt, und die beiden Prozesse laufen verstärkt ab.
ac Entkoppler führen zu Wärmebildung statt zur Synthese von ATP, indem sie den Protonengradienten zerstören. Dies nutzen Neugeborene im braunen Fettgewebe als Wärmequelle.
Grundlagen der interzellulären Kommunikation
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Zellen untereinander Informationen austauschen können. Neben der elek· trisehen Übertragung, die meist sehr schnell abläuft, spielt der in den folgen· den Kapiteln behandelte, etwas langsa· mere, chemische Informationsaustausch eine wichtige Rolle.
Formen der zellulären
Signalübertragung
...,. Gap junctions: Diese Form der Signalübertragung findet sich oft zwi· sehen Zellen, die einer gemeinsamen Zellgruppe angehören (z. B. Erregungs· Ieitung in Myokardzellen). Hierbei kön· nen über einen schmalen Spalt zwi· sehen zwei benachbarten Zellen kleine Moleküle und damit auch Informati· onen ausgetauscht werden. ...,. Oberflächenproteine und Rezeptoren: Über Proteine, die in der Membran einer Zelle verankert sind, kann diese mit eng benachbarten Zellen, die den dazugehörigen Rezeptor tragen, Informationen austauschen. ...,. Signalmoleküle: Die Zelle, die ein Signal weitergeben will, produziert und sezerniert Moleküle, die auch über grö· ßere Entfernungen hinweg, z. B. über die Blutbahn, ihre Zielzellen erreichen und an deren Rezeptoren binden können. Solche Moleküle sind glanduläre (=klassische) Hormone wie z. B. Insulin oder Glukagon sowie Gewebshormone, Mediatoren, Interleukine und Neuro· transmitter.
Sekretion und Wirkweisen
von Signalmolekülen
...,. Bei der autokrinen Sekretion sind Erreger- und Zielzellen identisch, d. h. Zellen reagieren auf Substanzen, die sie selbst abgegeben haben. Diese Art von Sekretion wird häufig bei Tumoren beobachtet. Eigens produzierte Wachstumsfaktoren regen die Tumorzellen zur Proliferation an. ...,. Bei der parakrinen Sekretion han· delt es sich bei den kommunizierenden Zellen zwar um verschiedene Zellarten, diese befinden sich aber in unmittelbarer Nachbarschaft. ...,. Gibt die sezernierende Zelle ihr Hor-
mon an die Blutbahn ab, kann dieses weite Strecken zurücklegen, um sein Zielorgan zu erreichen. In diesem Fall spricht man von einer endokrinen Sekretion. Die klassischen Hormone wirken endokrin. ...,. Bei der neuroendokrinen Sekretion werden die Überträgerstoffe (z. B. Re· Ieasing-Hormone, Noradrenalin, Peptide) von spezialisierten Nervenzellen gebildet.
Die verschiedenen Sekretionsmechanis· men sind in I Abbildung I dargestellt.
Hormone werden entweder je nach Bedarf aus gespeicherten Vorstufen aktiviert und pulsatil abgegeben (z. B. lnsulin) oder kontinuierlich sezerniert (z. B. Steroidhormone).
Einteilung der Hormone nach
ihrer chemischen Struktur
...,. Peptidhormone: Die meisten klassischen Hormone gehören zu dieser Gruppe. Peptidhormone sind allesamt hydrophil. ...,. Steroidhormone: Hormone, die die· ser Gruppe angehören (z. B. Kortisol, Kalzitriol, Geschlechtshormone), leiten sich vom Cholesterin ab, und besitzen ein Sterangerüst. Sie zählen zu den lipo· philen Hormonen und müssen deshalb zum Transport über das Blut an Transportproteine gebunden sein. Beispiele hierfür sind das Kortisol und die Geschlechtshormone. ...,. Aminosäure-Derivate: Hier entste· hen die Hormone durch chemische Veränderungen verschiedener Aminosäuren. Man kann zwei Gruppen un terscheiden: die lipophilen Schilddrüsenhormone und die übrigen AminosäureDerivate, die allesamt hydrophil sind.
Hormonrezeptoren
Die Wirkung des Hormons an seiner Zielzelle wird über Rezeptoren vermittelt, die man in vier verschiedene Familien einteilen kann. Drei davon sind Oberflächenrezeptoren, bei der vierten sind die Rezeptoren im Inneren der Zelle lokalisiert.
a endokrin
endokrines Gewebe
Signalmolekül
Zielzellen
Reaktion Reaktion
b parakrin
~ Steuerzelle
( - V Signalmolekül
Zielzellen
Reaktion Reaktion
c autokrin
Reaktion
Reaktion
Reaktion Steuerzelle = :Ziel.zene
I Abb. 1: Sekretionsmechanismen [1 7[
G-Protein gekoppelte
Membranrezeptoren
Durch die Bindung eines Signalmolek·· . Mb Uls an emen em ranrezeptor wird ein
G-Pr?tein \G_uanin~ukleotid-bindenctes Protem) akt1v1ert. Dieses befindet sich an der Innenseite der Membran unct bindet im inaktivierten Zustand GDp Wird es durch das Andocken eines u.
d . no~
mons o er emes anderen Signalmole-külsam Rezeptor aktiviert, kommt e im G·Protein zum Austausch von G~p zu GTP. Dies führt wiederum zur Akuvierung eines Enzyms (Adenylatcyc] Phospholipase C, etc.), das zur Bilduase,
ng
eines second messengers angereg[ wird. Es gibt verschiedene Arten von second messengers, die unterschiedlichste Wirkungen auf die Zelle haben können. Die wichtigsten sind zyklisches AMP (cAMP), zyklisches GMP (cGMP). Diacylglycerol (DAG), Inositol·Triphos· phat (IP3) und Phosphatidyl·lnositol· Triphosphat (PIP3). Es gibt verschiedene G-Protein-Typen. I Abbildung 2 zeigt die Signalkaskaden der G,, G1· und Gq·Proteine am Beispiel der Katecholaminrezeptoren. Neben den Katecholaminen entfaltet z. B. auch das Glukagon seine Wirkung über die Aktivierung von G-Proteinen, aber auch an vielen anderen Prozessen (Sehvor· gang, Riechvorgang, Genexpression, Vesikeltransport usw.) sind G-Proteingekoppelte Rezeptoren beteiligt.
Enzymgekoppelte Membranrezeptoren Die Rezeptoren werden nach Bindung eines Hormons selbst katalytisch aktiv. Dadurch wird die Wirkung des außen an der Zelle gebundenen Hormons ins lnne· re der Zelle weitergeleitet. Das Paradebt:ispiel für enzymgekoppelte Rezeptoren ist der Insulinrezeptor, der über eine Tyrosinkinase-Aktivität verfügt (s. Kap. 94).
Ligandengesteuerte Ionenkanäle Hier bilden die Oberflächenrezeptoren einen Teil eines lonenkanals. Bindet ein Ligand an einen solchen Rezeptor, wird ein Ionenkanal geöffnet, und es kommt zum Ein- bzw. Ausstrom von Ionen in bzw. aus der Zelle. Infolgedessen kommt es zu einer Depolarisation der Zelle, was alle möglichen Effekte nach sich ziehen kann. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor, der bei Aktivierung zur Öffnung eines Natriumkanals und zum Natriumeinstrom in die Zelle führt.
Intrazelluläre Rezeptoren Lipophile Hormone (z. B. Steroidhor· mone, Schilddrüsenhormone) können die Zellmembran ungehindert passieren und an intrazellulär gelegenen Rezep· toren andocken. Die Wirkung der Hormone tritt dann auf DNA-Ebene ein, und zwar über eine Modulation der Genexpressionsrate. Dadurch kommt es
Hormone und Zytokine 80 I 81
zu einer vermehrten oder verminderten Proteinbiosynthese. Der Wirkungseintritt dauert hierbei länger als bei den Oberflächenrezeptoren, und die Wirkung hält über einen längeren Zeitraum an. Es gibt zwei Sorten von intrazellu· lären Rezeptoren:
~ Zytosolische Rezeptoren liegen im Zytosol und werden erst nach Hormonbindung in den Zellkern transportiert (z. B. Kortisol·Rezeptor). ~ Kernlokalisierte Rezeptoren befinden sich bereits im Zellkern und
~ ~ Gq Gi
~
~
~ Ga
~
~
sind dort an Enhancer bzw. SilencerElemente der DNA gebunden, die die Expression der Gene hoch- oder runterregulieren (z. B. Trijodthyronin-, Estradiol-Rezeptor).
Hydrophile Hormone wirken über Oberflächenrezeptoren und regulieren meist die AktiVität vorhandener Enzyme. Upop!llle Hormone wirken über intrazelluläre Rezeptoren und verindem in der Regel die Menge der Eozyme durch Gen-Induktion oder ·Repression.
Rezeptortyp
Ga aktivierte G-Proteine
~
Effektoren
~ IP3 cAMP cAMP
~ ~ l Ca2+
j Ca2-+-Kanal Second messenger u.
~ l Aktivierung der Signalkaskaden Protein-Kinase A
Actin/Myosin-ca2• l Wechselwirkung
~ Hemmung der ! Transmitter- Stimulation der zellphysiologische Kontraktion Freisatzung Kontraktion Glykogenolyse Effekte
glatte Noradrenerge Herzmuskel Leber Zielgewebe Muskelzellen Neuronen
I Abb. 2: Signalkaskaden der G-Proteine am Beispiel der Katecholaminrezeptoren I 17]
Zusammenfassung • Hormone spielen eine wichtige Rolle bei der interzellulären Kommuni
kation. Sie beeinflussen den Stoffwechsel und die Reproduktion ihrer
Zielzellen.
• Zelluläre Signalübertragung kann über gap junctions, Oberflächenproteine oder Signalmoleküle erfolgen.
• Bei den Sekretionsformen unterscheidet man autokrine, parakrine, endokrine und neuroendokrine Sekretion. Die ersten beiden Formen wirken lokal, die beiden anderen systemisch.
• Hormonrezeptoren können sich entweder als Oberflächenrezeptoren außen an der Zellmembran befinden oder intrazellulär liegen. Bei den Membranrezeptoren unterscheidet man G-Protein gekoppelte, enzymgekoppelte oder lonenkanai-Rezeptoren.
othalamisch-hypophysäres System
---~~- ::~ Hormonsekretion dem jeweiilg.::n Bedarf des Körpers anzupassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigste Rolle spielen hierbei Regelkreise, die für viele Hormone ähnlich ablaufen . Der bedeutendste Regelkreis ist das HypothalamusHypophysen-System. In den neuroendokrinen Zellen des Hypothalamus werden sog. ReleasingHormone (CRH, TRH etc.) gebildet und über ihre Axone zur Hypophyse geleitet. Hier wirken die Releasing-Hormone, die auch Liberine genannt wer· den, auf den Hypophysenvorderlappen, wo sie die Zellen zur Sekretion weiterer Hormone stimulieren. Dies sind zum einen die glandotropen Hormone (TSH, ACTH usw.), die periphere Hormondrüsen zur Bildung und Ausschüt· tung von Effektorhormonen anregen, der Hypophysenvorderlappen produ· ziert aber zum anderen auch selbst Effektorhormone.
Effektornonnone wirken direkt am Erfolgsorgan, glandotrope Honnone wirken an den peripheren Honnondrüsen und stimulieren diese zur Bildung und Sekretion von f ffektorhonnonen.
Die Regulation der Hormonausschüt· tung funktioniert im Wesentlichen über "negatives Feedback". Ist von einem Hormon im Körper ausreichend vorhanden, kann dessen weitere Produktion und Sekretion auf drei Ebenen gedrosselt werden: Glandotrope Hormone wirken hemmend auf den Hypothalamus, Effektorhormone hemmen sowohl den Hypothalamus als auch den Hypophysenvorderlappen. Dies führt zu einer verminderten Sekretion von Releasing· Hormonen sowie von glandotropen Hormonen (I Abb. I ). Daneben werden im Hypothalamus Release-lnhibiting· Hormone (Statine) gebildet, die ebenfalls zu einer verrin· gertenSekretionglandulärer und Effektorhormone führen. Einflüsse auf den Hormonhaushalt können auch nervale Faktoren, wie z. B. Stress, haben. Durch psychische Belastung kann es so zu körperlichen Dysfunktionen kommen, beispielsweise zu Zyklusstörungen bei der Frau.
Hormone des Hypothalamus
Der Hypothalamus stellt eine Verbindung zwischen dem Nerven- und dem endokrinen System dar. Er empfängt neuronale Reize und passt über seine Releasing-Hormone die Hormonsekretion dem gegenwärtigen Bedarf an. Er ist somit wesentlich an der Aufrechterhaltung des Hormonhaushalts beteiligt. Dabei spielen vor allem zwei Kerngebiete des Hypothalamus eine Rolle:
.". Parvizelluläres Kerngebiet: Hier werden die hypophyseotropen Releasing-Hormone und die Release- lnhibiting-Hormone gebildet. Sie wirken auf den Hypophysenvorderlappen und regulieren somit die Produktion und Ausschüttung zahlreicher Hormone. .". Magnozelluläres Kerngebiet: Hier werden die Hormone ADH und Oxytocin gebildet. Sie werden im Hypophysenhinterlappen gespeichert und bei Bedarf freigegeben.
Hormone der Hypophyse
Bei der Hypophyse kann man funktionell und entwicklungsgeschichtlich drei Teile unterscheiden:
.". Hypophysenvorderlappen (HVL, =Adenohypophyse): Hier werden die vier glandotropen Hormone ACTH, TSH, LH und FSH gebildet, die bei der Regulation der Hormone der Nebennieren, der Schilddrüsenhormone und der Sexualhormone eine Rolle spielen. Außerdem produziert der HVL die Effektorhormone Somatotropin (STH) und Prolaktin. .". Hypophysenhinterlappen (HHL, = Neurohypophyse): Die Hormone des HHL sind Oxytocin und antidiuretisches Hormon (ADH). .". Hypophysenmittellappen: Hier wird Melanozyten-stimulierendes Hormon (MSH) gebildet.
ACTH und MSH entstehen, wie die Lipotroplne (p un~ y) und Endorphlne auch, durch limitierte Proteolyse aus dem Vorläuferpeptid Prooplomelanokortln (POMC).
-
3. 1nstanz
2. 1nstanz
1.1ns1anz
I Abb. 1: Hormonel ler Regelkreis [ 1]
Eine Übersicht über einige Hormone des Hypothalamus-Hypophysen -System gibt I Tabelle 1. s
Somatotropin
Ist vom Wachstumshormon die Recte dann meint man damit das in den eo~inophilen Zellen der Adenohypophyse gebildete Somatotropin, das auch son-. ··•a-totropes Hormon (STH) oder im Englischen growth hormone (GH) genannt wird. Neben Somatotropin spielen außerdem die Schilddrüsenhormone, die den Energieumsatz regeln, und Androgene, die eine Eiweiß-aufba _ ende Wirkung haben, im Wachstums- u prozess eine Rolle. Bei Somatotropin handelt es sich um ein Peptidhormon, dessen Ausschüttu durch die Hypothalamus-Hormone ng Somatoliberin (oder GRH für growth hormone releasing hormone) und Somatostatin gesteuert wird. Die Se.kretion erfolgt stoßweise und hängt m1t dem Lebensalter und weiteren Faktoren zusammen. Hoch ist sie z. B während der Pubertät, bei Hypoglyk- · ämie, Hunger, Stress oder im Schlaf.
Hypothalamus
CRH
(Kortikotropin-RH)
Release-lnhlblting-Hormone
TRH (Thyreotropin-RH) Somatostatin
GnRH
(Gonadotropin-RHJ
Hormone und Zytokine 82 I 83
Glandotrope Hormone
Hypophyse
ACTH (Adrenokortikotropes Hormon)
Endokrine Hormone
Peripherie
Glukokortikoide (v.a . Kortisol), Mineralkortikoide (v. a. Aldosteron)
TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon) T3 (Trijodthyronin) , T4 (Thyroxin)
FSH (Follikel-stimulierendes Hormon) Östrogene
Gestagene
Endokrine Drüse
Nebennierenrinde (NNR)
Schilddrüse
Ovarien, Graaf-Follikel, Corpus luteum, NNR
Ovarien, Corpus luteum, NNR - -------- LH (luteinisierendes Hormon) Hoden, Leydig-Zellen, NNR
lnhibin (aus Sertoli-Zellen
des Hodens) Androgene
I Tab. 1: Hormone des Hypothalamus-Hypophysen-System s
Somatotropin wirkt einerseits selbst als Effektorhormon, seine Hauptwirkung entfaltet es aber über die Steigerung der Produktion von Somatomedinen, die v. a. in der Leber (aber auch in Knochen und anderen Geweben) gebildet werden. Somatomedine heißen auch insuline like growth factors (IGFs), weil sie in ihrer Struktur dem Insulin sehr ähneln und über ähnliche Rezeptoren mit Tyrosink.inase-Aktivität wirken.
..,.. Eigene Wirkungen des STHs sind eine Steigerung der Proteinsynthese, die Aufnahme von Aminosäuren und Insulin in die Zellen ( = Insulin-synergistische Wirkung), Mobilisierung energiereicher Substanzen durch gesteigerte Glukoneogenese und Abgabe von Glukose ins Blut ( = Insulin-antagonistische Wirkung) sowie die Steigerung der Lipolyse . ..,.. Somatomedine, v. a. IGF-1, aber auch IGF-2, das hauptsächlich beim intrauterinen Wachstum eine Rolle spielt, steigern die Proteinbiosynthese in den Wachstumsfugen der Knochen und führen somit zum Längenwachstum der Knochen.
Antidiuretisches Hormon
Das antidiuretische Hormon (= ADH, auch Vasopressin oder Adiuretin genannt) wird im Hypothalamus gebildet und über axonalen Transport zur Speicherung an die Neurohypophyse transportiert. Die Wirkungen erfolgen im Wesentlichen über zwei Rezeptortypen:
..,.. VI-Rezeptoren an den glatten Muskelzellen und ..,.. V2-Rezeptoren an den Sammelrohren der Niere (das V leitet sich von dem älteren Ausdruck Vasopressin ab).
Adiuretin wirkt regulatorisch auf die Plasmaosmolalität, indem es die renale
Zusammenfassung
Wasserausscheidung hemmt. Eine zweite Hauptwirkung entfaltet es an den glatten Muskelzellen der Gefäße, wodurch es zur Kreislaufregulation beiträgt. Diese Wirkung tritt erst bei hohen Konzentrationen von ADH auf, es führt daher erst bei ausgeprägter Hypotonie und Hypovoiämie zu einer Vasokonstriktion. Oxytocin und Prolaktin spielen bei der Milchproduktion und beim Geburtsvorgang eine wichtige Rolle. Oxytocin löst während der Geburt Kontraktionen des Uterus aus und erleichtert beim Stillen das Ausstoßen der Milch. Prolaktin bereitet die Brust auf die Milchproduktion vor und fördert diese während der Stillperiode.
ac Das Hypothalamus-Hypophysen-System steuert viele Hormone. Die Regu-lation geschieht über Releasing-Hormone des Hypothalamus. Diese wirken auf die Hypophyse, die mit einer erhöhten oder erniedrigten Bildung von glandotropen Hormonen reagiert. So kann die Hormonsekretion der peripheren Hormondrüsen gesteigert werden.
• Zu den glandotropen Hormonen zählen: ACTH, TSH, LH und FSH. • Über "negatives Feedback" hemmen Hormone ihre eigene Produktion. • Somatotropin ist ein wichtiges Wachstumshormon, das bei Hypophysen
dysfunktionen zu Akromegalie, Riesenwuchs oder Zwergenwuchs führen kann.
• ADH reguliert Kreislauffunktionen durch Vasekonstriktion und die Plasmaosmolalität durch Steigerung der Wasserretention.
__; ~/lilddrüsenhormone
Die Schilddrüse stellt zwei verschiedene Hormone her, die Derivate der Aminosäure Tyrosin sind (I Abb. 1 ):
..,. Triiodthyronin (T3),
lll> Tetraiodthyronin, auch Thyroxin genannt (T4).
Diese beiden Hormone spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation vieler Prozesse in unserem Körper. Ein Mangel führt zur Verlangsamung vieler Vorgänge, wie zum Beispiel des Fettabbaus, der Wärmeregulierung oder des Sauerstoffverbrauchs. In der Wachstumsphase kann ein Mangel sogar zu irreversiblen Schäden führen. Eine Schilddrüsenüberfunktion hingegen hat Schlafstörungen, Unruhe, Herzrhythmusstörungen, Wärmeintoleranz und noch andere Folgen.
Synthese von Thyroxin und
Triiodthyronin
Die Synthese der beiden Hormone findet in den Follikelepithelzellen der Schilddrüse statt (I Abb. 2). Diese enthalten ein Sekret, das sogenannte Kolloid, das zum Großteil aus Thyreoglobulin besteht, einer Substanz mit mehreren Tyrosylresten.
lll> Der erste Schritt ist die Aufnahme von Iodid über eine Na+-I--ATPase in die Follikelzelle. Hier wird das Iodid nun durch eine Peroxidase zu Iod oxidiert. lll> Ebenfalls mittels der Peroxidase findet im nächsten Schritt eine Iodierung von Tyrosylresten des Thyreoglobulins statt. Es entstehen Monoiodtyrosin (MIT) und Diiodtyrosin (DITJ.
Diese Verbindungen können sich nun auf zwei unterschiedliche Arten miteinander verknüpfen:
lll> Bei der Kombination von einem MIT mit einem DIT wird unter Bildung einer Etherbindung ein Serylrest abgespalten. Es entsteht ein Triiodthyronylrest. Dies ist die Speicherform des späteren T3.
lll> Verknüpfen sich zwei DIT-Reste miteinander, so entsteht ein Tetraiodthyronylrest, die Speicherform von Thyroxin.
Freisetzung, Transport
und Regulation
Freisetzung Stimuliert wird die Freisetzung der Hormone durch TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon), das aus der Hypophyse stammt (s. Kap. 82). Es kommt zu einer Proteolyse des Thyreoglobulins. Die frei werdenden MIT und D!Twerden dejodiert und T 3 und T 4 ins Blut sezerniert. Das bei der Dejodierung entstandene Iod kann nun wieder zur Synthese von neuen Hormonen genutzt werden.
H
HO-o-~ ~-@ Tyrosin - I
H
y ~2
I Abb. 1· Die Strukturformeln von (a) Triiod
thyronin und (b) Tetraiodthyronin ~ Thyroxin
Regulation Synthese und Freisetzung der Schilddrüsenhormone werden in erster Linie durch Hypothalamus und Hypophyse gesteuert. Der Hypothalamus als Steuerzentrum im Gehirn erhält Informationen aus dem Körper und bildet TRH (Thyrotropin-Releasing-Hormone). Dieses gelangt über axonalen Transport zum Hypophysenvorderlappen und bewirkt dort die Freisetzung von TSH. An der Schilddrüse bindet TSH nun an TSH-Rezeptoren, was eine Iodaufnahm in die Follikelzellen auslöst. e Dies aktiviert die Biosynthese von neuen Schilddrüsenhormonen, außerdem stimuliert es die Sekretion von bereits gebildetem T3 und 14•
Über einen Rückkopplungsmechanismus reguliert auch die Konzentration der freien Hormone im Blut die Freisetzung von TRH und TSH in Hypothalamus und der Hypophyse (I Abb. 3).
I Abb 2: Synthese von T3
und T 4
I I
Ho-{)-b-® HO-P-b-® - I - I
H H I
Monoiodtyrosin (MIT) + Diiodtyrosin (DIT) + DIT
~ / ~ I
Hy~~-i-® I I
Triiodtyrosin (T 3)
Hormone und Zytokine 84185
1---- Hemmung I Abb. 3: Regulation der Schilddrüsenhormone
Hypothalamus: TRH :=J--1 T3 + T4
Vorderlappen der Hypophyse: TSH
Schilddrüse: T 3 + T4
Wirkung
Übers Blut wird T3 nun in die Zielzelle transportiert und gelangt dort in den Zellkern, wo es an den zugehörigen Hormonrezeptor bindet und die Genexpression von Enzymen beeinflusst. Schilddrüsenhormone bewirken Veränderungen im ganzen Organismus:
.,.. Erhöhung des Grundumsatzes (Sauerstoffverbrauch, Energiegewinnung, Wärmeproduktion), .,.. Erhöhung der Blutglukose durch Steigerung der Glukoneogenese und der Glykogenolyse, .,.. Fettabbau, der als Folge einen erhöhten Fettsäurespiegel im Blut hat,
.,.. Durch Stimulation der 5THSekretion kommt es zu Wachstum, .,.. Steigerung der Herzfrequenz durch Erhöhung der Adrenalinwirkung, .,.. Steigerung der Proteinsynthese, .,.. Cholesterin: Steigerung sowohl von Synthese als auch von Abbau, insgesamt sinkt der Cholesterinspiegel, .,.. Sehr wichtig für die Gehirnentwicklung und das Wachstum bei Kindern.
Klinische Bezüge
Iodmangel Für eine normale Schilddrüsenfunktion sollte der Mensch pro Tag 150-300 ng Iodid aufnehmen. In vielen Gegenden der Welt herrscht jedoch Iod mange!. Dieser hat eine verminderte Hormonsynthese zur Folge. Über die Rückkopplungsregulation steigt der TSH-Spiegel. Die Schilddrüse wächst, es entsteht ein Struma (Kropf).
Zusammenfassung
Hyperthyreose Ein Überschuss an Schilddrüsenhormonen hat verschiedene Folgen, unter anderem innere Unruhe, Tremor, Wärmeintoleranz, Gewichtsverlust trotz Heißhungers, Tachykardie, verstärktes Schwitzen und Schlafstörungen. Ursache für eine Schilddrüsenüberfunktion ist zum Beispiel der Morbus Basedow. Bei dieser Autoimmunerkrankung werden Antikörper gegen den TSHRezeptor gebildet, was dazu führt, dass die Rezeptoren ständig aktiviert sind. Es kommt zu einer unkontrollierten Stimulation der Hormonproduktion.
Hypothyreose Eine Schilddrüsenunterfunktion ist vor allem bei Kindern sehr gefährlich, da das Wachstum sowie die geistige Entwicklung beeinträchtigt werden . Einige sonstige Symptome sind Müdigkeit, Leistungsabfall, Gewichtszunahme durch den verminderten Grundumsatz, Bradykardie sowie Hypotonie.
X Die beiden Hormone der Schilddrüse, Triiodthyronin und Thyroxin spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation vieler Stoffwechselprozesse in unserem Körper.
X Die Synthese der Hormone findet in den Zellen der Schilddrüse statt. Wichtigste Ausgangsprodukte sind Thyreoglobulin und Iod. Das zentrale Enzym ist die Peroxidase.
X Der Transport findet zum größten Teil gebunden an TBG statt. ln freier Form sind die Hormone biologisch aktiv, wobei T4 zu T3 umgewandelt wird.
X Schilddrüsenüber- und unterfunktion sind häufig gesehene Krankheitsbilder. Bei einer Überfunktion werden viele Prozesse im Körper beschleunigt. Eine Unterfunktion hingegen hat eine Verlangsamung zur Folge.
ulation des Kalzium- und Phosphathaushalts
. .= _ _ ,m a . - -. (C z+)
Kalzium ist ein Elektrolyt, das im Körper zu 99% im Knochen gespeichert vorliegt. Der Rest befindet sich vor· wiegend extrazellulär. Der Serum· Kalzium-Gehalt liegt im Normalfall bei 2, I-2,6 mmol/1, wovon ca. 50% an Proteine gebunden sind und 50% in ihrer freien, aktiven Form vorliegen. Als Hydroxylapatit (Ca10(P04)6(0Hb) lagert sich Kalzium im Knochen ein und sorgt dort für ausreichende Mineralisa· tion und Stabilität. Außerdem ist es an der Aktivierung von Gerinnungsfak· toren, an Signaltransduktionsprozessen sowie an der Muskelkontraktion [durch Bindung an Troponin) beteiligt. Ausge· schieden wird Ca2• vorwiegend über den Darm.
Auch Phosphat ist im Hydroxylapatit des Knochens enthalten. Neben der Knochenmineralisation dient Phosphat der Enzymregulation durch Phosphory· lierung und fungiert außerdem als second messenger (in Form von cAMP), als "Energiewährung" ATP, als Phos· phat-Puffer und als Bestandteil vieler anderer Moleküle. Phosphat wird hauptsächlich über die Nieren ausge· schieden.
Regulationsmechanismen
Die Regulierung des Kalzium· und Phosphathaushalts wird im Wesentlichen von zwei Hormonen bewerkstelligt: von Parathormon und Kalzitonin. Ein dritter Mitstreiter in der Regulation ist I ,25-Dihydroxycholecalciferol, das sich von Vitamin D ableitet.
Parathormon
Parathormon (PTH) ist ein Protein, das aus 84 Aminosäuren besteht und in den Zellen der Nebenschilddrüse (Glandula parathyreoidea) aus einer längeren Vorstufe, dem Präpro-PTH, synthetisiert wird. Dies geschieht durch Abspaltung des Signalpeptids und eines weiteren Peptids. Die Freisetzung von Parathormon aus den Sekretgranula ist vom Kai·
ziumspiegel abhängig und wird gesteu· ert über einen Gi·Protein-gekoppelten Rezeptor, der bei Erhöhung des Serum· Kalziums die Sekretion hemmt. Seine Wirkung entfaltet das Parathor· man über G,-Protein·gekoppelte Rezeptoren, die die Adenylatzyklase aktivieren. Dies geschieht an drei Organen:
~ Skelettsystem: Parathormon führt zu einer Mobilisierung von Ca2+ aus dem Knochen. Die Rezeptoren dafür befinden sich jedoch nicht an Osteoklas· ten, die Knochensubstanz abbauen, sondern an Osteoblasten, die normalerwei· se für den Knochenaufbau zuständig sind. Diese aktivieren aber wiederum mittels Ausschüttung von Interleukin·I die Osteoklasten, was Knochenabbau mit Ca2•-Freisetzung zur Folge hat. ~ Niere : In der Niere kommt es durch PTH zu einer verstärkten Phosphat· und einer verminderten Kalzium-Ausscheidung. Außerdem erhöht es durch ver· stärkte Hydroxylierung die Syntheserate des biologisch aktiven I ,25-Dihydroxy· cholecalciferols aus 25-Hydroxychole· calciferol. ~ Darm: Hier steigert Parathormon die Ca2+·Resorption in der Dünndarmmukosa.
Kalzitonin
Kalzitonin wird von den C-Zellen der Schilddrüse gebildet und bei erhöhten Kalziumwerten sezerniert. Das Peptid
Parathyrin Kalzitonin
Ca2•.Manget HPO/- ·Mangel
besteht aus 32 Aminosäuren und wird nach seinem Bildungsort auch Thyreokalzitonin genannt. Es wirkt wie Parathormon über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren , führt aber zu einer Erniedrigung des Ca2+·Spiegels. Dies wird erreicht durch eine Hemmung der Kalzium-Freisetzung aus dem Knochen
' durch Förderung von Knochenanbau-prozessen durch die Osteoblasten, sowie durch eine Erhöhung der Ca2+. Ausscheidung über die Nieren. Im Darm kommt es durch Hemmung von Motilität und Verdauungsenzymsekretion zu einer verlangsamten KalziumResorption.
1, 2 5-Di hydroxycholecalciferol (= Kalzitriol)
Kalzitriolleitet sich zwar von Vitamin D ab und wird deswegen oft zu den Vitaminen gezählt, man tendiert aber immer mehr dazu, es aufgrund seiner Funktionen und seiner Struktur (Ähnlichkeit mit Steroidhormonen) wie ein Hormon zu behandeln. Seine Biosynthese erfolgt in verschiedenen Organen: Das in der Leber aus Cholesterin gebi}. dete 7-Dehydrocholesterol (Enzym :::: Cholesterin·Dehydrogenase) wird nach Transport in die Haut in einer W-Uchtabhängigen Reaktion in Cholecalciferol umgewandelt. Bei dieser Reaktion Wird das Sterangerüst des Dehydrocholesterols gespalten. Anschließend wird das entstandene Cholecalciferol durch
I Abb. 1: Biosynthese von Kalzitrial [ 18]
.L------------------------------------------------~H~o~r~m~o~n~e~u~n~d~Z~y~t~o~k~in~e / 86 I 87
l
Hydroxylierungen in Leber und Niere in das aktive 1 ,25-Dihydroxycholecalciferol überführt. Die Schritte der Biosynthese sind in I Abbildung 1 dargestellt. Die Wirkungen von Kalzitrial auf den Kalziumhaushalt sind die Erhöhung der Kalzium- und Phosphat-Resorption im Darm und eine Mineralisierung der Knochen durch Einbau von Kalzi um und Phosphat. An den Nieren führt Kalzitrial in Anwesenheit von Parathormon zu einer Hemmung der renalen Ca2+- und Phosphatausscheidung. Sein Wirkmechanismus entspricht dem der Steroidhormone: Seine Rezeptoren sind im Zellkern lokalisiert und bewirken eine Modulation der Transkriptionsrate bestimmter Gene. Auf diesem Weg hat Kalzitrial neben seinen Ca2+-regulierenden Eigenschaften auch Einfluss auf Wachstum, Zelldifferenzierung und Karzinogenese.
Pathobiochemie
Hyperkalziämie/ Hypokalziämie
Der Serum-Kalzium-Spiegel wird streng kontrolliert, da schon geringe Abweichungen große Auswirkungen auf den Organismus haben.
~ Hyperkalziämie: Bei Serumwerten von > 2,6 mmol/1 spricht man von einer Hyperkalziämie, die zu schweren Störungen führen kann und dann zwingend behandlungsbedürftig ist. Eine hyperkalziämische Krise stellt einen internistischen Notfall dar. Die Symptome sind vielfältig: An den Nieren kann es zu Kalziumphosphatablagerungen kommen, die zu Nephrokalzinose, Nephrolithiasis und im schlimmsten Fall zu einer Niereninsuffizienz führen. Durch Störungen des Membranpotenzials treten neuromuskuläre und neurologisch-psychiatrische Störungen wie Verwirrtheit,
Psychosen, Bewusstseinstörungen oder eine Muskelschwäche auf. Am Herzen führen erhöhte Ca2+-Werte zur OT-ZeitVerkürzung. Weitere Symptome können Hypertonie, Obstipation und Ileus sowie Gewebsverkalkungen sein. ~ Hypokalziämie: Eine Hypokalziämie liegt vor, wenn das Serum-Kalzium unter 2, I mmol/1 fällt. Dies führt zu einer erhöhten neuromuskulären Erregbarkeit mit Muskelspasmen, Krämpfen, Tetanie und Diarrhö. Aufgrund der verminderten Kontraktilität kommt es am kardiovaskulären System zu einer QT-Verlängerung, Herzrhythmusstörungen, Hypotonie, bis hin zur Herzinsuffizienz. Die erhöhte Erregbarkeit kommt da· durch zustande, dass die erhöhte extra· zelluläre Ca2+-Konzentration zu einer Abnahme der Na+-Permeabilität der Membranen führt.
Hyperparathyreoidismus/ Hypoparathyreoidismus
~ Ein Hyperparathyreoidismus führt zur Knochen-Demineralisierung, infolge derer vermehrt Knochenbrüche auftre·
suffizienz mit daraus resultierendem Mangel an Dihydroxycholecalciferol, mehr Parathormon produziert. Das Kalzium ist in dem Fall meist erniedrigt oder normal.
~ Ein Hypoparathyreoidismus ent· steht bei versehentlicher Entfernung der Nebenschilddrüse, z. B. bei einer Schild· drüsenoperation. Dies hat eine Hypokalziämie mit oben genannten Symptomen zur Folge.
Ra eh itis /Osteomalazie
Ein Mangel an Kalzitrial kann durch Resorptionsstörungen, Hydroxylierungsstörungen bei Lebererkrankungen oder Niereninsuffizienz oder durch mangelnde UV-Bestrahlung entstehen. Im Kindesalter führt eine chronische Unterversorgung zum Krankheitsbild der Rachitis, die durch fehlende Knochenmineralisierung und Auftreten von Skelettdeformitäten [I Abb. 2) gekennzeichnet ist. Zur Knochenerweichung und damit verbundenen Skelettveränderungen führt ein Kalzitrial-Mangel beim Erwachsenen. Man nennt das
ten. Man unterscheidet den primären Krankheitsbild dann Osteomalazie. Hyperparathyreoidismus aufgrund einer Überfunktion der Nebenschilddrüse von der sekundären Form: -Ursache für den primären Hyper
parathyreoidismus können hormonproduzierende Adenome oder auch diffuse Hyperplasien sein. Der Ca2+Spiegel ist hierbei immer erhöht.
-Bei der sekundären Form wird irrfolge eines Kalzium-Mangels, beispiels-weise ausgelöst durch eine Nierenin· I Abb. 2: Rosenkranzphänomen bei Rachitis [ 11)
Zusammenfassung • Kalzium und Phosphat sind Elektrolyte, die v.a. in Form von Hydroxylapatit
im Knochen vorliegen.
a Das Kalzium muss streng reguliert werden, da Abweichungen vom Norm
bereich (2, 1-2,6 mmol/1) für den Menschen sehr gefährlich werden kön
nen. Sie führen v. a. zu neuromuskulären und psychiatrischen Symptomen
und zu EKG-Veränderungen.
• Die Regulation des Kalzium- und Phosphathaushalts erfolgt über Parat
hormon, Kalzltonin und Kalzitriol ( 1 ,25-Dihydroxycholecalclferol). Kalzitriol
und Parathormon führen zu einer Erhöhung des Serum-Kalziums, während
Kalzitonin dessen Konzentration senkt.
~=:ormone des Nebennierenmarks: Adrenalin und Noradrenalin
Die beiden Hormone Adrenalin und Noradrenali n sind chemisch Abkömmlinge des Katechols (I ,2-Dihydroxybenzol), weshalb sie auch Katecholamine genannt werden . Zu den Katecholaminen zählt weiterhin Dopamin, das im zentralen Nervensystem (ZNS) als Neurotransmitter dient. Adrenalin und Noradrenalin werden vorwiegend in Stresssituationen und bei körperlicher Anstrengung sezerniert. Hier führt v. a. Adrenalin zur schnellen Mobilisierung gespeicherter Substrate und versetzt den Körper in eine Art Alarmbereitschaft ("fight and run"-Reaktion). Noradrenalin hat neben seiner Wirkung als Stresshormon auch eine Funktion als Neurotransmitter_
Biosynthese und Sekretion der Katecholamine
Die Synthese der Katecholamine erfolgt in den chromaffinen Zellen des Nebennierenmarks aus der Aminosäure Tyrosin. Hier werden sie in Granula gespeichert und als Reaktion auf neuronale Impulse des Sympathikus sezerniert. In geringen Mengen wird Adrenalin, v. a. aber auch Noradrenalin, zusätz· lieh im ZNS gebildet.
Syntheseschritte
Die Biosynthese des Adrenalins aus Tyrosin erfolgt in vier Schritten über die Bildung von L-Dopa, Dopamin und Noradrenalin. Schlüsselenzym der Katecholaminbiosynthese ist die Tyrosinhydroxylase, die den ersten Schritt katalysiert:
..,. Tyrosin ~ L-Dopa: Die katalysierende Tyrosinhydroxylase benötigt neben molekularem Sauerstoff auch das Cosubstrat Tetrahydrobiopterin (THB} . ..,. L-Dopa ~ Dopamin: L-Dopa wird durch die (aromatische) L-Arninosäure-Decarboxylase zum biogenen Amin Dopamin decarboxyliert. Dopamin kann nun seine Funktion als Neurotransmitter aufnehmen (z. B_ in der Substantia nigra des Mittelhirns) oder "weiterverarbeitet" werden.
COOH COOH
..,. Dopamin ~ Noradrenalin: Diese Reaktion wird von der ß-Hydroxylase katalysiert. Für die Hydroxylierung der Seitenkette des Dopamins wird zusätzlich Vitamin C (Ascorbinsäure) benötigt. ..,. Noradrenalin ~ Adrenalin: Als letzter Schritt erfolgt die Methylierung von Noradrenalin zu Adrenalin durch die (Noradrenalin·)N·Methyltransferase. Als Methylgruppenüberträger dient S-Adenosylmethionin (SAM).
Die einzelnen Syntheseschritte mit Strukturformeln sind in I Abbildung 1 dargestellt.
Sekretion und Regulation
Die Katecholamine werden in den Zellen des Nebennierenmarks in Granula gespeichert. Ein erhöhter Bedarf führt zur Freisetzung durch Exozytose, die durch einen Anstieg der intrazellulären Ca2+-Konzentration stimuliert wird. Während das sezernierte Adrenalin vorwiegend aus dem Nebennierenmark stammt, kommt das Noradrenalin hauptsächlich aus den Nervenendigungen sympathischer, postganglionärer Nervenzellen. Hier dient es als Neurotransmitter oder entweicht aus dem synaptischen Spalt in die Blutbahn, wo es seine Wirkung als Hormon entfaltet. Katecholamin-Synthese und -Sekretion werden beeinflusst durch neuronale Reize des Sympathikus, durch Kortisol und durch Endprodukthemmung. Eine Sympathikusaktivierung füh rt zur Aktivi tätssteigerung der Tyrosinhydroxylase und de ß-Hydroxylase, während Kortisol v. a. die N-Methyltransferas r induziert. Durch allosterische Rückkoppelungshemmung der e Katecholamin-Biosynthese durch deren Endprodukte (also Adrenalin und Noradrenalin) wird eine überschießende Produktion vermieden.
Wirkmechanismen und Funktionen
Adrenalin und Noradrenalin wirken über verschiedene Rezeptoren, die unterschiedliche Funktionsweisen und Wirkungen haben und eine spezifische Organverteilung aufweisen. Diese sollte man kennen, um die Katecholaminwirkungen auf den Körper besser nachvollziehen zu können_
H H CH3 I I I I I H2N-C- H H2N-C-H H2N-C- H H2N- C- H HN- CH2 I I I I I
~ NAgfH/ NADP'
~~ - ~ HO- C- H
HO~H co2 0 2
HOt?
\__ J .. J Tyrosin- L-Aminosäure- ß-Hydroxylase N-Methyl-
Hydroxylase Decarboxylase HO trans1erase
OH OH OH OH OH Tyrosin DOPA Dopamin Noradrenalin Adrenalin
1 Abb. 1: Synthese der Katecholamine aus der Aminosäure Tyrosin
I!""' I
Rezeptor G-Proteln
ß,-Rezeptoren G • !•l imulierend]
ß,-Rezeptoren G , (nlrnuliereno)
0.2-Rezeptor Gl (in hiti~ r rad)
a 1-Rezeptor G,
Mechanismus
Sti mulation der Adenytatzyklase--> cAMP t--> Öff
nung von Ca2 ' -Kanälen--> Ca''-Konzentration i
Stimulation der Adenylatzykl ase - > cAMP t
--> Aktivierung der Proteink inase A
Hemmung der Adenylatzyklase --> cAMP i
Sti mulation der Phospholipase C--> Bildung der zwei
secend messenger Diacylglycerol (DAG) und lnositoltrisphosphat (JP,)--> Ca 2•t
I Tab. 1: Molekulare Wirkm echa nism en der versch iedenen Rezeptortypen
Adrenerge und noradrenerge Rezeptoren
Alle Katecholaminrezeptoren sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (G" Gi und Gq) mit sieben Transmembrandomänen. Man kennt fünf Rezeptortypen: a 1-, a 2·, ß1-,
ß2- (und ß3-) Rezeptoren. Die Signaltransduktionswege der Rezeptoren sind in I Tabelle I dargestellt (s. dazu auch Kap. 80, I Abb. 2). Die Affinitäten der einzelnen Rezeptortypen zu Adrenalin bzw. Noradrenalin unterscheiden sich stark. Während Adrenalin an allen Rezeptoren wirkt, so wirkt Noradrenalin zwar über die a-Rezeptoren und ß1, aber so gut wie gar nicht über ß2•
Wirkungen
Die Katecholamine haben Einfluss auf viele Organe, wie Herz, Lunge, Gefäße, Pupillen, Muskel u.v.m. Sie stellen den Körper darauf ein, hohe Leistungen erbringen zu können. So führt Adrenalin zur Erhöhung der Herzfrequenz, des Herzminutenvolumens und der Muskeldurchblutung, bei gleichzeitiger Drosselung der Durchblutung von Darm und Haut. Um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, müssen genügend Energiequellen zur Verfügung stehen: Der Blutglukosespiegel wird u. a. durch Glykogenabbau und Glukoneogenese erhöht. Das Angebot an Fettsäuren und Glycerin wird durch Fettabbau gesteigert. Die Insulinsekretion wird
Rezeptor Orpn Wirkung
a, Schweißdrüsen Stimulierung der Schweißsekretion
a, Auge Myd riasis (M. dilatator pupillae)
a.l, 0.2 Darm, Niere, Haut Konstriktion der Blutgefäße
a, Pankreas, Fettgewebe Hemmung der lnsulinsekretion; Lipolyse
a,,ß, Leber Stimulierung der Glykogenolyse
f3, Herz Anstieg von Frequenz, Kontraktilität, HMV
ß, Fettgewebe Stimulierung der Lipolyse
J3, Coronargefäße Dilatation
ß, Lunge Bronchialdilatation, Dilata tion der Blutgefäße
ß, Skelettmuskel, Leber Dilatation der Blutgefäße
ß, Pankreas Glukagonfreisetzung, Jnsulinfreisetzung
1 Tab. 2 : Kat echo laminwi rkungen auf die versch iedenen Organe (Ausw ahl)
Hormone und Z tokine 88 I 89
gehemmt, die Glukagonsekretion gefördert. Eine Auswahl an Katecholaminwirkungen und der beteiligten Rezeptoren gibt I Tabelle 2.
Abbau der Katecholamine
Adrenalin wird vorwiegend in der Leber abgebaut. Hierbei entstehen inaktive Abbauprodukte, die anschließend über die Nieren ausgeschieden werden können. Die beiden entscheidenden Enzyme sind die Katechol-0-Methyl-Transferase (COMT) und die Monoaminoxidase (MAO). Über die beiden Zwischensubstrate Metanephrin und 3-Methoxy-4-Hydroxy-Mandelsäurealdehyd kommt es zur Bildung von Vanillinmandelsäure, dem Endprodukt des Katecholaminmetabolismus (I Abb. 2). Bei Überproduktion von Katecholaminen, z. B. durch ein Phäochromozytom, kann sie erhöht im Urin nachgewiesen werden, wodurch sie in der klinischen Diagnostik Bedeutung erlangt hat.
Ty rosin ____,.. DOPA ___.... Dopamin
~ !D~ Homovanillinsäure
Metanephrine /
COMT
~ Vanillinmandelsäure
MAO: Monoaminooxidase DBH: Dopamin-ß-hydroxylase COMT: Catechol-0-methyltransferase
Noradrenalin
!PNMT
Adrenalin
PNMT: Phenylethanolamin-N-methyltransferase
I Abb. 2: Abbau der Katechola mine [ 151
Zusammenfassung • Die Katecholamina Adrenalin und Noradrenalin
werden im Nebennierenmark aus der Aminosäure
Tyrosin synthetisiert.
• Die Ausschüttung der Katecholamina erfolgt auf
nervale Reize des Sympathikus hin und führt insge
samt zu einer gesteigerten Leistungsbereitschaft
des Körpers.
• Katecholamine führen zur Mobilisierung von
gespeicherten Energiequellen, zur Steigerung
des Herzminutenvolumens und zur Erhöhung der
Muskeldurchblutung.
Hormone der Nebennierenrinde I
Die Nebennierenrinde ist für die Synthese der Steroidhormone zuständig. Diese werden alle aus Cholesterin synthetisiert und tragen ein Sterangerüst, nehmen aber ganz unterschiedliche Funktionen wahr. Man kann sie unterteilen in:
~ Glukokortikoide, die v. a. auf den Zuckerstoffwechsel Einfluss nehmen, ~ Mineralokortikoide, die den Wasser- und Elektrolythaushalt regulieren, ~ Sexualhormone.
Aufgebaut ist die Nebennierenrinde aus drei Zonen: der Zona glomerulosa, der Zona fasciculata und der Zona reticularis (von außen nach innen).
ln der Zona glomerulosa werden die Mineralokortikoide (und ein Teil des Kortikosterons), in der Zona fasciculata die Glukokortlkolde und in der Zona reticularis die Androgene und Östrogene gebildet.
Da die Synthesewege der verschiedenen Steroidhormone eng miteinander verästelt sind, macht es Sinn, sich erstmal einen Überblick über diese zu verschaffen (I Abb. 1 ).
Kortisol
Kortisol ist der wichtigste Vertreter der Glukokortikoide, zu denen auch Kortison, Kortikosteron und strukturverwandte synthetische Verbindungen (z. B. Prednisolon, Dexamethason) gehören. Es hat Einfluss auf den Glukose-, Aminosäuren- und Lipidstoffwechsel und wirkt außerdem immunmodulatorisch und entzündungshemmend.
Synthese, Sekretion, Transport und Regulation
Synthese Die Biosynthese des Kortisols aus Cholesterin beginnt mit Hydroxylierungen an den Positionen 20 und 22 und anschließender Abspaltung der Seitenkette, wobei Pregnenolon entsteht. Dieser geschwindigkeitsbestimmende Schritt wird von der Desmolase katalysiert und spielt sich im Mitochondrium ab.
~ HO
~0 ~0 ~-H ~'OH
HO 0 0
~OH
~-'?
Kortisol
~' {i--j011 WOH
o.GC.J~ I HO
I Abb. 1: Synthese der Stereidhormone im Überblick (21 ~ 21-Hydroxylase, 11 ß ~ 11 ß-Hydroxylase A ~ Aromatase, D ~ Desmolase) [ 101 '
Nach Oxidation zu Progesteron im Zytosol und dreifacher Hydroxylierung an den Positionen C11, C17 und C21 ist Kortisol ( = Hydrokortison) entstanden. Die Hydroxylierungen finden am C 11 im Mitochondrium, und an C 1 7 und C21 im Zytosol statt.
Sekretion Die Kortisolsekretion weist tageszeitabhängige Schwankungen auf, sie unterliegt somit einem zirkadianen Rhythmus: In den Morgenstunden sind Sekretion und Serumkonzentration am höchsten. Unter hohem Stress, wie z. B. bei Krankheit oder nach längerer Hungerperiode, steigt die Kortisol-Sekretion ebenfalls an.
Transport Da Kortisol schlecht wasserlöslich ist, wird es im Blut an das a-Globulin Transkortin gebunden transportiert. Bei hohen Kortisolkonzentrationen kann auch Albumin als Transportmolekül dienen.
Regulation Die Regulation von Kortisolsynthese und ·Sekretion erfolgt durch das Hypothalamus-Hypophysen -System (s. Kap. 82). Das hypothalamisehe Kortikotropin-Releasing Hormon (CRH)
bewirkt die Sekretion von adrenokortikotropem Hormon (ACTH) aus der Hypophyse, das wiederum die Freisetzung von Kortikosteroiden aus der Nebennierenrinde stimuliert. Einen positiven Einfluss auf die Sekretion haben außerdem die Zytokine IL-1 IL-6 und TNFa, die auf allen drei Ebe- ' nen stimulierend wirken (Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde). Gehemmt wird die Sekretion durch negative Rückkoppelung.
Wirkmechanismus
Der Kortisol-Rezeptor befindet sich, im Gegensatz zu den membranständigen Rezeptoren für Insulin, Katecholamine und Glukagon, im Zytosol. Dort liegt er an das Hitzeschockprotein Hsp9Q gebunden vor, das verhindert, dass der Rezeptor in den Zellkern wandert. Das lipophile Kortisol kann ungehindert die Zellmembran passieren und an seinen Rezeptor binden. Dies führt zur Lösung des Hsp90 vom Rezeptor, wodurch die DNA-Bindungsdomäne und das Kernlokalisierungssignal des Rezeptors demaskiert werden. Er wandert daraufhin in den Zellkern und bindet dort an Enhancer-Regionen der DNA was die Expression bestimmter Gene'
bewirkt. Auf diese Weise werden Enzyme gebildet, wie beispielsweise Schrittmacherenzyme des Kohlenhydrat- oder Aminosäurenstoffwechsels, die die Wirkungen des Kortisols vermitteln.
Wirkungen
~ Glukosestoffwechsel: Kortisol ist für die Aufrechterhaltung des Blutglukosespiegels zuständig, und sorgt so dafür, dass das ZNS ausreichend mit Energie versorgt wird . Dazu stimuliert es die Glukoneogenese in der Leber und hemmt die Glukoseaufnahme in die Muskel- und Fettgewebszellen. Damit genügend Ausgangsstoffe für die Glukoneogenese zur Verfügung stehen, induziert Kortisol Proteasen, die Aminosäuren aus dem Muskelgewebe freisetzen. Die Aminosäuren können schließlich nach Umwandlung zu a-Ketosäuren [Pyruvat, a -Ketoglutarat) als Oxalacetat in die Glukoneogenese eingeschleust werden. Erleichtert wird dies über die Induktion Aminosäure-metabolisierender Enzyme durch das Kortisol.
~ Lipidstoffwechsel: Durch Aktivierung der hormonsensitiven Lipase in den Fettgewebszellen, fördert Kortisol die Lipolyse und damit die Freisetzung von Fettsäuren aus TriacylglycerinSpeichern. Diese können beim Fasten in der Leber zu Ketonkörpern (s. Kap. 70) umgewandelt werden, die die meisten Organe, und nach einer Adaptationsphase auch das Gehirn , zur Energiegewinnung nutzen können. ..,. Entzündungshemmung: Eine weitere Wirkung von Kortisol ist die Unterdrückung entzündlicher Reaktionen. Dies geschieht durch die Induktion des Proteins Lipocortin, das durch Hemmung der Phospholipase A2 zu einer verminderten Freisetzung von Arachidonsäure aus den Membranlipiden führt. Arachidonsäure ist Ausgangssubs·
Hormone und Zytokine 90 I 91
tanz für die Synthese entzündungsfördernder Gewebshormone, der Prostaglandine. ~ Immunsuppression: Glukokortikoide führen über eine Beeinflussung der Lymphozytenfunktion zu einer Abschwächung des Immunsystems. So hemmt Kortisol die Synthese von Interleukin, das für die Differenzierung und Proliferation der T-Helferzellen notwendig ist. Ohne reife T-Helferzellen, können sich auch die B-Zellen nicht differenzieren, und die Antikörpersynthese bleibt aus. Dieser Effekt wird in der Klinik für die Behandlung von Erkrankungen mit überschießender Immunaktivität genutzt. Zum Einsatz kommen Glukokortikoide bei Autoimmunerkrankungen, wie der rheumatoiden Arthritis, oder auch gegen die akute lymphatische Leukämie.
Pathobiochemie: Cushing-Syndrom
Ein Hyperkortisolismus [CushingSyndrom) kann als Ursache einen ACTH-produzierenden Hypophysentumor[= Morbus Cushing) oder einen kortisolproduzierenden Nebennierenrinden-Tumor haben oder auch Folge einer Glukokortikoid-Therapie sein. Durch das Überangebot an Kortisol kommt es zur Lipidmobilisation. Die Fette werden jedoch nicht verbrannt,
Stiernacken [I Abb. 2). Durch den gesteigerten Proteinabbau kommt es zur Muskelschwäche, die verstärkte Synthese und Mobilisierung von Glukose führen zum Steroiddiabetes. Andere Symptome sind Depression, arterielle Hypertonie, Osteoporose und Hauterscheinungen wie Striae rubrae [I Abb. 2).
sondern lagern sich im Körper um. I Abb. 2: Das typische Bild eines Cushing-Patien-Dies führt zu den typischen Symptomen ten mit stammbetonter Fettsucht, Mondgesicht Stammfettsucht, Mondgesicht und und Striae rubrae (131
Zusammenfassung X Glukokortikoide werden in der Nebennierenrinde aus Cholesterin syn
thetisiert. Ihr wichtigster Vertreter ist Kortisol. X Kortisol gewährleistet, dass das ZNS - auch in Hungerperioden - aus
reichend mit Energie versorgt wird. Dazu erhöht es den Glukosespiegel Im Blut und bewirkt außerdem die Synthese von Ketonkörpern aus Fett
gewebe.
• Kortisol wirkt entzündungshemmend und immunsuppressiv und wird deshalb zur Therapie bestimmter Krankheiten eingesetzt.
X Ein Oberangebot an Kortisol führt zum Cushing-Syndrom, das schwerwiegende Symptome zur Folge haben kann.
-Hormone der Nebennierenrinde II
Neben den Glukokortikoiden werden in der Nebennierenrinde(= NNR) auch Mineralokortikoide und Sexualhormone gebildet. Der wichtigste Vertreter der Mineralokortikoide ist Aldosteron, das fü r die Regulation des Wasser- und Elektrolythaushalts zuständig ist. Zu den Sexualhormonen zählt man die Androgene und die Östrogene.
Aldosteron
Biosynthese
Wie alle Hormone der Nebennierenrinde werden auch die Mineralokortikoide aus Cholesterin synthetisiert, und zwar in der Zona glomerulosa, der äußersten Schicht der NNR.
Regulation
Aldosteron sorgt für die Aufrechterhaltung eines konstanten Extrazellulärvolumens, was über die Steuerung der Natrium· Retention in den Nieren erreicht wird. Außerdem greift Aldo· steron in die Regulation des Kalium-Haushalts ein. Die Kennt· nis dieser Funktionen hilft, die Regulationsmechanismen der Aldosteronsynthese und ·Sekretion besser zu verstehen:
.,.. Eine Abnahme des Extrazellulärvolumens wirkt stimulierend, die Zunahme hemmend. .,.. Die Abnahme der Natriumkonzentration im Plasma führt zur Stimulation, die Zunahme zur Hemmung. .,.. Bei Erhöhung der Kaliumkonzentration kommt es zu einer Zunahme der Aldosteronausschüttung, sinkt das Ka· lium, so wird diese gehemmt. .,.. Dopamin wirkt hemmend auf die Aldosteronsekretion . .,.. ACTH (adrenokortikotropes Hormon) stimuliert die Aldo· steronsekretion.
Der wichtigste Aldosteron-regulierende Mechanismus ist je· doch das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS} (I Abb. 3). Bei Hypotonie kommt es zu einer verminderten Nierenperfusion, was zur gesteigerten Renirrsekretion aus den juxtaglomerulären Zellen der Niere führt. Renirr spaltet aus Angiotensinogen, das v. a. in der Leber gebildet wird, Angio· tensin I ab, das wiederum durch das Angiotensin·Converting· Enzym (ACE) in Angiotensin II umgewandelt wird. Dieses führt zu einer starken Aktivierung der Aldosteronsynthese und -ausschüttung. Ein weiterer Effekt von Angiotensin ll ist eine Vasokonstriktion, über die der Blutdruck zusätzlich erhöht wird.
Wirkungen
Seine Wirkungen entfaltet Aldosteron über die Bindung an einen zytoplasmatischen Steroidhormonrezeptor, über den die Expression der Zielgene beeinflusst wird . Die Wirkungen der Mineralokortikoide dienen der längerfristigen Homöostase des Wasserhaushalts. In den Nieren steigert Aldosteron
im Sammelrohr die Natriumrückresorption und damit auch die Wasserretention, da das rückresorbierte Natrium Wasser mit sich zieht. Gleichzeitig wird Kalium vermehrt in das Tubuluslumen ausgeschieden, und die K +-Plasmakonzentration sinkt. Auch die Ausscheidung von Protonen über den Na+/ H+·Antiport wird durch Aldosteron gefördert. Im Darm und in den Schweißdrüsen wird die Natriumausscheidung ebenfalls gedrosselt.
Pathobiochem ie
.,.. Conn-Syndrom: Das Conn-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine chronische Aldosteron-Überproduktion, die meist durch ein Nebennierenrinden-Adenom verursacht wird. Folgen sind eine Hypokaliämie, die zu Herzrhythmusstörungen und Tetanie führen kann, sowie eine Hypertonie. Aufgrund der verstärkten Protonenausscheidung kommt es zusätzlich zu einer metabolischen Alkalose. .,.. M. Addison (=primäre NNR-Insuffizienz}: Ein Ausfall der NNR-Funktion betrifft meist alle Nebennierenhormone allerdings verursacht der Mangel an Mineralokortikoiden ' akut die gefährlichsten Symptome. Diese wären eine Hyperkaliämie, metabolische Azidose und Dehydratation. Weitere Erscheinungen des Morbus Addison sind Hypoglykämie und eine Hyperpigmentierung der Haut, die durch erhöhte ACTHSekretion irrfolge mangelnder Rückkoppelungshemmung verursacht wird. Aus ACTH wird vermehrt Proopiomelanokortin gebildet, was mit einem Anstieg von melanozytenstimulie-
Regelgrößan:
durch Einbau von Natriumkanälen im distalen Tubulus und I Abb. 3: Überbli ck überdas Renin-Angiotensin-Aidosteron-System [14]
....
L
~ ~
Renin ---0-+ Angiotensin ---0- Aldosteron
~ II -
I Abb. 4: Hormonelle Regulation des Wasser- und Elektrolythaushalts [81
rendem Hormon (MSH) und einer intensiven Pigmentierung der Haut einhergeht.
Zusammenspiel mit anderen Hormonen des Wasserhaushalts
~ ADH: Das hypophysäre antidiuretische Hormon (s. Kap. 82) führt wie Aldosteron zu einem Blutdruckanstieg. Es führt durch den Einbau von Wasserkanälen (Aquaporine) im distalen Tubulus und im Sammelrohr zu einer Steigerung der H20·Rückresorption. Da hierbei keine Natrium-Ionen rückre· sorbiert werden, kommt es zur Abnahme der Serumosmolalität. Die Sekretion von ADH wird stimuliert durch eine Zunahme der Serumosmolalität, Acetyl· cholin, Nikotin und Morphin, während Adrenalin und Ethanol hemmend wirken. ADH bewirkt außerdem eine Vasokonstriktion, was zu einem weiteren Anstieg des Blutdrucks führt. ~ ANP: Das atriale natriuretische Peptid wird bei Vorhofdehnung irrfolge einer Zunahme des Plasmavolumens von endokrinen Herzmuskelzellen sezerniert. Es führt zu einer Dilatation der Arteriolen und der renalen Blutge· fäße. Dies führt zum Anstieg der glome· rulären Filtrationsrate und damit zur Zunahme der Wasser- und Salzausschei·
Hormone und Zytokine 92 I 93
dung. Zusätzlich werden die Na+-Rückresorption sowie die Ausschüttung von Aldosteron und ADH gehemmt.
Sexualhormone
Androgene
Die männlichen Geschlechtshormone nennt man Androgene. Sie werden in der Zona reticularis der NNR und in den Leydig-Zellen des Hodens gebildet und sind für die Ausbildung der männlichen Geschlechtsmerkmale zuständig. Das wichtigste Androgen ist Testosteron, dessen aktive Form 5a-Dihydrotestosteron ist. Androsteron entsteht beim Abbau von Testosteron und anderen Steroidhormonen, hat aber eine deutlich schwächere Wirkung als Testosteron. Androgene stimulieren die Bildung der Geschlechtsorgane und den Hodenabstieg beim männlichen Feten, das Wachstum der männlichen Geschlechtsorgane und die Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale beim Mann sowie die Spermatogenese. Außerdem hat Testosteron eine anabole Wirkung, die die Eiweißsynthese fördert, und es erhöht bei beiden Geschlechtern Libido und Erythropoese.
Östrogene
Die Östrogene mit ihren wichtigsten Vertretern, Östron und Östradiol,
Zusammenfassung
sind die weiblichen Sexualhormone. Sie werden v. a. im Ovar und in den Graaf-Follikeln gebildet, in geringerem Maße aber auch in der NNR und im Hoden. Die hypophysären Hormone LH und FSH sind für die Regulation der Östrogensynthese verantwortlich. Diese geschieht aus dem Cholesterin über die Zwischenstufen der Androgene. Östrogene stimulieren das Wachstum der weiblichen Geschlechtsorgane (Vagina, Ovar, Uterus, Tube) und die Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale.
Pathobiochem ie: adrenogenitales Syndrom
Das AGS (adrenogenitales Syndrom) beruht auf einem Gendefekt und einer damit verbundenen Störung der Steroidbiosynthese. Meistens ist das 21-Hydroxylase-Gen betroffen. Es kommt zum Mangel an Kortisol und Aldosteron, da diese nicht aus ihren Vorstufen, Pro· gesteron und 17-Hydroxy·Progesteron, synthetisiert werden können. CRH und ACTH werden aufgrund der fehlenden Rückkoppelungshemmung durch Kortlsol vermehrt ausgeschüttet. Progesteron und 17-Hydroxyprogesteron reichem sich an, und werden vermehrt zu Androgenen umgewandelt (s. auch Kap. 90, I Abb. 1 ). Dies führt bei Mädchen zu einer Vermännlichung (Virilisierung) und bei Jungen zum vorzeitigen Eintritt in die Pubertät (Pseudopubertas praecox).
X Aldosteron ist für die Regulation des ExtrazelluläJVolumens zuständig.
Es führt zu einer Erhöhung der Na+- und Wasserretention und der K+- und
H+-Ausscheidung über die Nieren.
X Reguliert wird Aldosteron vor allem über das Renin-Angiotensin-Aidoste
ron-system.
X ADH führt wie Aldosteron zu einer Erhöhung des Blutdrucks, allerdings un
ter Abnahme der Serumosmolalität. ANP stellt in seinen Funktionen einen
Gegenspieler des Aldosterons dar.
X Androgene und Östrogene sind an Ausbildung und Wachstum der Fort
pflanzungsorgane und der sekundären Geschlechtsmerkmale beim Mann
bzw. bei der Frau beteiligt.
Hormone der Bauchspeicheldrüse I
Insulin
Insulin-Biosynthese
Insulin ist ein Hormon, das in den endokrinen Langerhans'schen Inseln der Bauchspeicheldrüse produziert und gespeichert wird. Das Pankreas enthält drei Arten endokriner Zellen mit den folgenden Funktionen:
lll>- u-Zellen: Produktion von Glukagon, lll>- ß·Zellen: Produktion und Speicherung von Insulin (etwa 80% der Zellen der Langerhans'schen Inseln), lll>- 8-Zellen: Produktion von Somatostatin.
Der erste Schritt der Synthese von Insulin (I Abb. 1) ist die Bildung von Präproinsulin. Dies ist eine Vorstufe, bestehend aus einer A- und einer B-Kette, einem C-Peptid , sowie einem Signalpeptid. Das Signalpeptid lenkt das Präproinsulin nun in das Lumen des rauen ER. Dort wird es durch eine Signalpeptidase abgespalten. Es entsteht Proinsulin, das in Vesikel verpackt zum Golgi-Apparat transportiert wird. Die restliche Synthese findet nun entweder im Golgi-Apparat oder in den Speiebergranula der ß-Zellen statt. Eine Protease schneidet das c-Peptid zwischen A- und B-Kette heraus, Produkt ist das fertige Insulin.
Regulation der Sekretion
Präproinsulin
~ER
Proinsulin
HOOC
Golgi-Apparat, Vesikel
Der Mechanismus ist folgender: Die ß·Zellen des Pankreas besitzen einen Glukose-Transporter, GLUT-2. Dieser transportiert die Glukose in die Zelle, so dass der Glukosespiegel in der ß-Zelle dem im Blut entspricht. Die Glukokinase fungiert nun als sogenannter "Glukose-Sensor". Sie wandelt die aufgenommene Glukose in Glukose-6-Phosphat um, in anschließenden Schritten der Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette entsteht ATP. Die Menge des in der Zelle entstehenden ATPs entscheidet nun über die Menge des sezernierten Insulins. ATP bindet an intrazelluläre K+·Kanäle, die dadurch verschlossen werden. In der Folge werden Ca2+-Kanäle geöffnet. Das einströmende Kalzium fördert die Exozytose der lnsulinspeichergranula.
Rezeptor und Wirkung des Insulins
Membranständiger Insulinrezeptor Ein membranständiger Insulinrezeptor vermittelt die Wirkung des Insulins ins Innere der Zelle. Dieser Rezeptor besteht aus zwei a· und zwei ß- Untereinheiten (I Abb. 2). Die ß-Untereinheit hat eine Tyrosinkinaseaktivität und ist dadurch in der Lage, sich selbst und auch andere Proteine, hierbei sind IRS 1 und IRS 2 (Insulin-Rezeptor-Substrate) wichtig, zu phosphory. lieren, sobald Insulin am Rezeptor andockt. An diese beiden Proteine binden nun Enzyme und werden aktiviert. Je nachdem, welches Enzym das ist, werden die schnellen oder die langsamen Wirkungen des Insulins herbeigeführt:
lll>- Schnelle Wirkung: Ein Enzym, das durch den Insulinrezeptor aktiviert wird, ist die Phosphatidylinositol-3-Kinase die ihrerseits die Bildung von PIP3 (Phosphatidylinositol-3,4:5-Trisphosphat) katalysiert. Dies ist ein sogenannter "second messenger", der über die Phosphorylierung von Serin- und Threoninresten unterschiedliche Wirkungen haben kann.
Insulin I Abb. I: Die Synthese von Insulin )2]
l Hormone und Zytokine "~----------------------------------------------~--------~---- 941 95
s I s
s I s
I Abb. 2: Wirkungsmechanismus des Insulins aus [21
II>- Langsame Wirkung: Die Langzeiteffekte des Insulins werden über die Ras-Kaskade vermittelt, die bewirkt, dass verschiedene Transkriptionstaktoren aktiviert werden, die die Genexpression von anabolen Schrittmacherenzymen zur Folge haben. Diese Effekte setzen dann nach einigen Minuten bis Stunden ein.
Insulin-Wirkungen Eine wichtige Funktion des Insulins ist es, den Glukosespiegel im Blut zu senken. Diese Wirkung hat es aber nicht in allen Organen auf die gleiche Weise (I Tab. 1 ):
11>- Muskel- und Fettgewebszellen: Glukose kann nicht einfach durch die Zellmembran in die Zellen diffundieren, sondern muss durch Transporter hineingebracht werden. Von diesen Transportern gibt es fünf verschiedene: GLUT 1-5. Fett· und Muskelzellen besitzen GLUT 4, den einzigen insulinempfindlichen Glukosetransporter. Insulin fördert nun den Einbau von GLUT 4 in die Zellmembran, und somit kann Glukose in die Zelle transportiert werden. 11>- Andere Organe, wie die Leber oder das Gehirn, nehmen Glukose insulinunabhängig auf.
Volkskrankheit Diabetes mellitus
Die verschiedenen Formen des Diabetes mellitus haben alle einen Mangel an Insulin und in der Folge einen erhöhten Blutglukosespiegel gemeinsam. Zur Diagnose eines Diabetes sind folgende Kriterien notwendig:
Wirkungs-ort __
Muskel- und Fettgewebe
Glykolyse
Glukoneogenese
Pentosephosphatweg
Glykogensynthese
Glykogenolyse
Lipolyse
Lipidsynthese
Proteinsynthese in Muskelzellen
I Tab. 1: Insulin-Wi rk ungen
Wirkung
Glukoseaufnahme in die Zelle
Stimulation in allen Geweben durch Aktivierung
der Phosphofruktokinase
Hemmung
St imulation
Stimulation
Hemmung
Hemmung
St imulation
Stimulation
11>- einmaliger Nüchtern-Blutzucker> 125 mg/dl 11>- Gelegenheitsblutzucker > 200 mg/dl 11>- 2·h·Wert beim Glukosetoleranztest > 200 mg/ dl
Diabetes Typ 1 Bei dieser Art des Diabetes, auch insulinabhängiger oder juveniler Diabetes genannt, liegt ein absoluter Insulinmangel vor. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der Antikörper gegen die ß·Zellen der Bauchspeicheldrüse gebil· det werden. Die ß-Zellen werden mehr und mehr zerstört, und die Insulinproduktion sinkt, bis gar kein Insulin mehr gebildet werden kann. Durch den Mangel an Insulin kann die im Blut vorliegende Glukose nicht mehr in die Zellen aufgenommen werden, und es kommt zu einem Anstieg der Glukose im Blut. Durch einen vermehrten Abbau von Fett kommt es im Blut zudem zu einem Anstieg der Fettsäuren. Diese können aufgrunddes nicht funktionierenden Kohlenhydratstoffwechsels nicht auf normalem Wege ab_gebaut wer· den, sondern werden zu den Ketonkörpern Betahydroxy· buttersäure, Aceton und Acetessigsäure. Sie führen zu einer Übersäuerung des Blutes, und es entsteht eine metabolische Ketoazidose. Der Körper versucht, diese respiratorisch zu kompensieren, indem er mehr C02 abatmet. Der Atem der Patienten riecht nach Aceton, ein wichtiges Erkennungszeichen der Hyperglykämie bei der Erstdiagnose des Diabetes. Weitere Zeichen der Hyperglykämie sind Polyurie sowie starker Durst und Bauchschmerzen. Bei extrem hoher Glukose kann es zu einem hyperglykämischen Koma kom· men. Diese Art des Diabetes beginnt bereits in jungem Alter, häufig schon bei Kindern. Die einzige Behandlungsmöglichkeit bei diesem Typ besteht in der Substitution von Insulin.
Hormone der Bauchspeicheldrüse II
Diabetes Typ 2 Beim Typ-2-oder auch Altersdiabetes bewirken verschiedene Ursachen eine Resistenz gegen Insulin. Folge ist, dass mehr Insulin ausgeschüttet werden muss, um den Blutglukosespiegel zu senken. Am Anfang der Erkrankung ist der Insulinspiegel also erhöht, erst spä· ter kann er erniedrigt sein. Folgen des Insulinmangels sind Hyperglykämien, da der Körper ohne die Wirkung von Insulin nicht in der Lage ist, den Blut· glukosespiegel ausreichend zu senken. Die wichtigsten Risikofaktoren für diese Form des Diabetes sind neben der gene· tischenVeranlagungvor allem Adipo· sitas, Hypertonus, Hyperlipidämie und Nikotinabusus. Behandelt wird Typ·2·Diabetes mit oralen Antidiabetika, die den Blutzucker· spiegel senken, indem sie die Sekretion von Insulin fördern. Ist der Körper zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, ausreichend Insulin zu produ· zieren, wird wie beim Typ-I-Diabetes Insulin substituiert. Die Folgen der Erkrankung sind bei den unterschiedlichen Formen die gleichen. Es kann durch den erhöhten Blutzuckerspiegel zu einer Makroangiopathie kommen, die über Arteriosklerose zu koronarer Herzerkrankung führen kann. Über die Hälfte der Diabetiker stirbt an einem Herzinfarkt. Weitere Folge der Hyperglykämien sind über eine Mikroangiopathie Niereninsuffizienz so· wie eine diabetische Retinopathie. Oft kommt es zu einer Polyneuropathie, mit an den Füßen beginnenden sensiblen Störungen. Aufgrund der Poly· neuropathie haben Diabetiker bei einem Herzinfarkt oft keine Schmerzen.
Glukagon
Glukagon, ein neben dem Insulin weiteres wichtiges Hormon des endokrinen Pankreas, wird, wie schon beschrieben, in den a-Zellen der Bauchspeicheldrüse hergestellt.
Glukagon-Biosynthese
Auch Glukagon wird vorerst als Vorstufe gebildet, dem Präproglukagon, das außer in der Bauchspeicheldrüse auch
Glukagon
Glukagon
Glukagon
a-Zellen des Pankreas
GLP-1 GLP-2
GLP-1 GLP-2
I I I
c=J GLP-1
c=J GLP-2
~ ZNS + Darm
in der Darmschleimhaut sowie im ZNS gebildet wird, dort aber anders weiterverwertet wird. Präproglukagon besteht aus dem eigentlichen Glukagon sowie zwei weiteren Peptiden, GLP-1 (Giukagon-Like-Peptide) und GLP-2, und einem Signalpeptid (I Abb. 3) . Von der Vorstufe wird nun im endoplas· matischen Retikulum das Signalpeptid abgespalten, es entsteht das Prohormon. In der Bauchspeicheldrüse wird im nächsten Schritt durch proteolytische Spaltung Glukagon hergestellt. In der intestinalen Mukosa sowie im ZNS hingegen wird Glukagon zerstört und GLP-1 und GLP-2 entstehen. Hierbei handelt es sich um Hormone des Verdauungs· trakts, die im entsprechenden Kapitel besprochen werden.
Glukagonrezeptor
AdenylatzyKiase
~
I Abb. 3: Glukagon-Synthese
Regulation und Wirkung
Glukagon Ist der Gegenspieler von Insulin. Bei einem Abfall des Blutzuckerspiegelswird vom Pankreas Glukagon sezerniert.
Bei einem Anstieg des Glukosespiegels sinkt der Spiegel von Glukagon, der Insulin-Spiegel steigt und umgekehrt. Zusätzlich ist die Glukagon-Sekretion abhängig von der Zusammensetzung der Nahrung. Nach Aufnahme vieler Kohlenhydrate wird weniger Glukagon ausgeschüttet, nach einer Mahlzeit mit vielen Proteinen, also nach Resorption von Aminosäuren, steigt der Glukagonspiegel.
y
ATP ~ zyklisches AMP
t Protein-~ Proteinkinase A kinase A
Phosphorylase· ~ Phosphorylase· Kinase Kinase
t Phosphorylase ~ Pl1osphoryl inaktive Form aktive For~e
I Abb. 4: Wirkmechanismus von Glukagon am Beispiel der Stimulation der Glykogenolyse [21
l Hormone und Zytokine /~--------------------------------------~~~~~~~~ 961 97
G lukagon reze pto r Glukagon wirkt über einen G,-gekoppelten Rezeptor (I Abb. 4) . Zuerst bindet das Hormon an den Glukagonrezeptor_ Dadurch wird beim an den Rezeptor gekoppelten G-Protein ein GDP durch ein GTP ersetzt und eine Untereinheit wird abgespalten. Diese Untereinheit wiederum aktiviert die membranständige Adenylatzyklase. Dieses Enzym katalysiert in der Zeit, in der der Rezeptor aktiv ist, die Bildung von zyklischen AMP-Molekülen (cAMP), die als Vermittler der Hormonbotschaft in der Zelle fungieren.
Wirkung des Glukagons In der Leber ist die Dichte der Glukagonrezeptoren am höchsten, hier hat ein Anstieg des Glukagonspiegels die stärkste Auswirkung:
~ Bindet Glukagon an die entsprechenden Rezeptoren in der Leber, so bewirkt dies eine Stimulation der Glykogenolyse, indem die Glykogen-Phosphorylase, das Schlüsselenzym der Glykogenolyse aktiviert wird (I Abb. 4). ~Außerdem aktiviert Glukagon die Glukoneogenese und die ß-Oxidation von Fettsäuren. Im Fettgewebe wird die Lipolyse stimuliert durch
Wirkung
Glykolyse Hemmung
Glukoneogenese Stimulation
Glykogensynthese Hemmung
Glykogenolyse Stimulation
13-0xidation von Fettsäuren Stimulation
Lipolyse Stimulation
Aktivierung der hormonsensitiven Lipase. ~ Hemmend wirkt Glukagon auf die Glykolyse durch Inaktivierung der wichtigen Schrittmacherenzyme Phosphofructokinase und Pyruvatkinase. Ebenfalls durch Inaktivierung des Schlüsselenzyms wird die Glykogensynthese gehemmt. Angriffspunkt hierbei ist die Glykogen-Synthase.
Zusammenfassung
I Tab. 2: Wirkungen des Glukagons
Glukagon-Anwendung In der Klinik kommt Glukagon auch als Medikament zur Anwendung. Bei einer Hypoglykämie, wie sie zum Beispiel bei Diabetikern auftreten kann, wird Glukagon als Notfallspritze eingesetzt, um den Blutzuckerspiegel rasch wieder anzuheben. Außerdem wirkt Glukagon als Antidot bei Vergiftungen mit ß-Blockern.
• ln den ß-Zellen der Bauchspeicheldrüse wird über mehrere Vorstufen
Insulin produziert. Die Menge ist abhängig vom Blutzuckerspiegel: Je höher
der Glukosespiegel ist, desto mehr Insulin wird hergestellt.
• Es gibt schnelle und langsame Wirk1:1ngen des Insulins, wobei die Haupt
funktion darin besteht, den Glukosespiegel im Blut zu senken, indem Glu
kose in die Zellen aufgenommen und dort im Stoffwechsel verbraucht wird.
• Ein Mangel an Insulin liegt bei der Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus
vor. Hierbei unterscheidet man zwei verschiedene Typen, den juvenilen
Typ-1-Diabetes sowie den überwiegend erst im Alter auftretenden Typ-2-
Diabetes.
• Glukagon ist ein wichtiges Hormon der Bauchspeicheldrüse. Es wird dort
in den a.-Zellen gebildet.
• Aus der Vorstufe Präproglukagon wird durch Abspaltung eines Signal
peptids sowie protaolytische Spaltung Glukagon gebildet.
• Stimulation für die Sekretion von Glukagon ist ein Abfall des Blutglukose
spiegels.
• Die wichtigste Wirkung ist die Steigerung des Blutglukosespiegels durch
Aktivierung bzw. Hemmung der unterschiedlichen Stoffwechselwege.
• Klinisch kommt Glukagon zur Anhebung des Blutzuckerspiegels bei
Hypoglykämie sc.>wie als Gegenmittel bei Vergiftungen mit ß-Biockern zur
Anwendung.
• Insulin und Glukagon sind Antagonisten mit weitgehend gegensätzlicher
Wirkung.
Eicosanoide, Zytokine und Signaltransduktion
Eicosanoide und Zytokine sind Signalmoleküle mit hormonartiger Wirkung und nur kurzer Lebensdauer, die in allen Zellen hergestellt werden, mit Ausnahme der Erythrozyten. Die Signalmoleküle binden an spezifische Rezeptoren auf der Zielzelle und durch Signalkaskaden werden in der Zielzelle spezifische Reaktionen ausgelöst
Eicosanoide
Eicosanoide leiten sich von mehrfach ungesättigten C20-Fettsäuren ab und haben unterschiedlichste Funktionen. Zu den Eicosanoiden zählen die Prostaglandine und Thromboxane sowie die Leukotriene. Die wichtigsten Vertreter der Prostaglandine (PG) sind PGA, PGE, PGF und PGI. Prostaglandin 12 wird auch als Prostacyclin bezeichnet Thromboxane (TX) kommen in allen Geweben vor, Thromboxan·Rezeptoren befinden sich an Thrombozyten und an den Zellen der glatten Muskulatur.
Biosynthese der Eicosanoide
Die Eicosanoide werden aus Arachidonsäure (s. auch Kap. 62) gebildet, die in membrangebundenen Phosphatidylverbindungen (Phosphatidylinositol, -ethanolamin, -cholin, -serin) vorkommt und durch Phospholipasen wie die Phospholipase A2 freigesetzt wird. Die Umwandlung von Arachidonsäure in Eicosanoide erfolgt auf zwei Hauptwegen:
~ Prostaglandine und Thromboxane werden durch die Cyclooxygenase (COX) gebildet, ..,. Leukotriene werden durch die Lipoxygenase gebildet (I Abb. I).
Physiologische Wirkung der Eicosanoide
Eicosanoide haben unterschiedliche Funktionen, und teilweise wirken die Vertreter dieser Gruppe gegensätzlich. So fördern Thromboxane die Aggrega· tion der Blutplättchen, während Prostaglandin 12 die Wirkung der Thromboxane hemmt Eicosanoide binden
( Phospholipid ) Plasmamembran I Abb. 1: Synthese der Eicosanoide
j I Phospholipase A2 1 l Hemmung · · 7 durch Kortikoide
Arachidonsäure
Hemmung /, d durch NSAID r
Prostaglandine, Thromboxane
an spezifische Rezeptoren, die zur Gruppe der G-Protein gekoppelten Rezeptoren gehören.
~ Prostaglandine haben ein breites Wirkungsspektrum, sie verursachen Schmerzen, Entzündung, Fieber und in geringerem Umfang eine Konstriktion der glatten Muskulatur. Außerdem hemmen sie die Säuresekretion des Magens. ~ Thromboxane fördern die Aggregation der Blutplättchen über Vasekonstriktion und direkte Aktivierung der Thrombozyten. ~ Leukotriene wirken auf die glatte Muskulatur, wodurch sich die Bronchokonstriktion bei allergischem Asthma erklärt. Die bronchokonstriktorische Wirkung der Leukotriene ist 1 000-mal stärker als die der Prostaglandine oder des Histamins. Das Leukotrien LTB4
vermittelt die Aggregation von Leukozyten und ihre Adhäsion an die Gefäßwand. Zusätzlich werden entzündungsfördernde Radikale freigesetzt
Hemmung der EicosanoidSynthese durch Pharmaka
Nichtsteroidale Antirheumatika Synonyme: NSAR oder NSAID ( = nonsteroidal anti-inflammatory drugs). Die Wirkung einiger gängigen Schmerzmittel (z . B. Acetylsalicylsäure, lbuprofen, Diclophenac) wird über eine Inhibition der Cyclooxygenase (COX) vermittelt. Dies führt zu einer verminderten Prostaglandinsynthese und damit zur Hemmung von Schmerz-, Fieber- und Entzündungsreaktionen. Die meisten NSAID hemmen beide Isoenzyme der Cyclooxygenase (COX-1 und COX-II ), und führen so zu Nebenwirkungen
Leukotriene
insbesondere am Magen. Durch neuere selektive COX-11-Inhibitoren (Coxibe)' können die Nebenwirkungen vermieden werden, da diese v. a. durch die Hemmung der ubiquitär vorkommenden COX-l verursacht werden.
Eine weitere Nebenwirkung der NSAID ist das sog. ,.Aspirin-induzierte Asthma• bei dem die COX-Hemmung zu einer ' überschießenden Leukotrien-Bildung führt, was wiederum eine starke Bronchokonstriktion zur Folge hat.
Glukokortikoide Die entzündungshemmende Wirkung der Glukokortikoide beruht auf der Hemmung der Phospholipase A21 was die Freisetzung von Arachidonsäure und folglich die Eicosanoidsynthese verhindert (I Abb. 1 ).
Zytokine
Zytokine sind Polypeptide, die die DNA-, RNA- und Proteinsynthese nach Bindung an spezifische Rezeptoren in der Plasmamembran der Zielzelle steuern. Sie beeinflussen neben Entzündungsreaktionen auch Dauer und Stärke der Immunabwehr und regulieren Teilung, Wachstum und Bewegung anderer Zellen. Gentechnisch hergestellte Zytokine werden auch therapeutisch eingesetzt, so in der Behandlung der Hepatitis Bund C (Interferon).
Einteilung
Die Zytokine lassen sich in Untergruppen einteilen, dazu zählen die lnterleukine, Interferone, Chemokine und Wachstumsfaktoren:
1)- In der Gruppe der Interleukine gibt es pro-inflammatorische (z. B. !L-I, TNFa) und anti-inflammatorische (z. B. IL-4, TGFß) Zytokine. Die Bezeichnung ist nicht einheitlich. So werden einige Zytokine als Interleukin (IL), andere mit ihrem historischen Wirkmechanismus bezeichnet, wie z. B. Tumor-NekroseFaktor a (TNFa ). 1)- Interferone (IFN) werden nach ihrem Bildungsort unterschieden: Alpha-Interferone stammen aus Leukozyten, Beta-Interferone aus Fibroblasten und Gamma-Interferone aus I-Lymphozyten. 1)- Chemokine führen nach Bindung an spezifische Rezeptoren zu einer gerichteten Wanderung von Zellen (Chemotaxis). 1)- Wachstumsfaktoren steuern die Differenzierung von Zellen und regen die Zellproliferation an. Die Bezeichnung richtet sich in der Regel nach dem beeinflussten Zelltyp oder der Funktion (z . B. Erythropoietin, Granulocyte colony Stimulation factor).
Physiologische Wirkung der Zytokine
Einzelne Zytokine können auf unterschiedliche Zellen jeweils andere Einflüsse ausüben (Pleotropismus), andererseits können verschiedene Zytokine dieselbe Wirkung haben (Redundanz). Zytokine sind an der Regelung bei· nahe aller entzündlichen Vorgänge im Körper beteiligt und können autokrin, parakrin oder endokrin wirken (s. Kap. 80). Es gibt eine Vielzahl von Interleukinen. Sie dienen der lmmunabwehr, aber auch der Hämatopoiese. Interferone werden von Virus-infizierten Zellen freigesetzt und schützen andere Zellen, sie haben immunmodulatorische Eigenschaften.
Hormone und Zytokine 98 I 99
Einige der interleuklne werden für die Diagnostik bei Entzündungsreaktionen genutzt, z. B. il-6, andere sind in Ihrer Wirkung beeinflussbar, wie z. 8. TumorNekrose-Faktor a (TNFa) über den monokionaien TNFa-Antikörper lnfliximab.
TNFa, das auf allen kemhaltigen Zellen des Körpers Rezeptoren besitzt, bewirkt die klassischen Zeichen einer Entzündung (Rötung, Schwellung, Schmerz, Überwärmung).
Signaltransduktion
Zytokine binden an spezifische Rezeptoren der Zelloberfläche und lösen eine Signalkaskade aus. Der Rezeptor dient der Signalübermittlung in das Zellinnere, da die meisten Liganden die Zellmembran nicht durchdringen können. Die Bindung eines Liganden an der Außenseite seines Rezeptors führt zu einer Konformationsänderung auf der zytosolischen Seite, wodurch das Signal mithilfe des TransmembranproteiDs ins Zellinnere überführt wird. Zytokine steuern das Zellwachstum auf der Ebene der Transkription von Genen. Dazu wird nach Bindung eines Liganden (z. B. Interferon), eine Signalkaskade aktiviert, die das Signal direkt von der Zellmembran bis in den Zellkern weiterleitet, die sog. Jak.-StatKaskade (I Abb. 2). Diese benötigt nur wenige Signalmoleküle und ermöglicht eine rasche Änderung der Transkriptionsaktivität In der Zellmembran finden sich zwei Interferon-Rezeptor-Monomere, die
Zusammenfassung
selbst keine Tyrosinkinaseaktivität besitzen. Mit jedem Rezeptor-Monomer ist eine JAK-Kinase (Janus-Kinase, abgeleitet von Janus, dem römischen Gott mit zwei Gesichtern) verbunden, die solange inaktiv ist, bis durch Bindung des Liganden ein Rezeptor-Dimer entsteht, worauf die Phosphorylierung der aktivierten JAK-Kinasen erfolgt. Im nächsten Schritt werden die im Zytoplasma vorhandenen Stat-Proteine (Signal transducer and gCtivator of transcription) durch die Jak-Kinase phosphoryliert und dadurch aktiviert. DieStat-Proteinewerden in den Zellkern transportiert und bewirken dort eine Steigerung der Expression von Genen, die die entsprechende Erkennungssequenz tragen.
I Abb. 2: Prinzip der Jak-Stat-Kaskade 15)
X Eicosanoide sind Signalmoleküle mit hormonähnlicher Wirkung. Sie sind Schlüsselmoleküle bei Entzündungs- und Abwehrvorgängen.
X Synthese (z. B. Cyclooxygenase-Reaktion) und Wirkmechanismus (z. B. TN Fa-Rezeptor) der Eicosanoide erlauben pharmakologische
Beeinflussung.
X Die Übermittlung der Information erfolgt über Rezeptoren an der Zellaußenseite. Diese leiten das Signal über eine Kaskade zum Zellkern weiter.
X Jak-Stat-Kinasen sind ein schneller Weg zur Regulation der "transkription bestimmter Gene.
Immunsystem - Grundlagen
Unser Immunsystem ist dazu da, den Körper sowohl vor fremden, womöglich gefährlichen Substanzen als auch vor infizierten oder entarteten Körperzellen (Krebszellen) zu schützen. Dazu muss es in der Lage sein, diese von körper· eigenen, gesunden Zellen zu unterschei· den.
Einteilung
Bei der Immunabwehr gehen zwei ver· schiedene Systeme Hand in Hand:
~ Die zelluläre Immunantwort, die durch die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) repräsentiert wird , sowie ~ Die humorale Abwehr, an der gelöste Stoffe (Proteine) beteiligt sind.
Außerdem unterscheidet man eine er· worbene bzw. spezifische, von einer angeborenen, unspezifischen Reaktion. Einen Überblick über die verschiedenen Teilsysteme der Abwehr liefert I Tabelle 1.
Zelluläre Abwehr
Die Zellen der Immunabwehr bezeichnet man zusammengefasst als Leukozyten. Sie entstehen im Knochenmark und leiten sich- wie Erythrozyten und Thrombozyten auch- von pluripotenten Stammzellen ab. Diese können sich in alle möglichen Richtungen ausdifferenzieren, wobei verschiedene Leukozytenarten entstehen, die jeweils spezielle Eigenschaften aufweisen und dementsprechend unterschiedliche Auf. gaben übernehmen. Zu den Leukozyten zählt man Lymphozyten, Granulozyten, Monozyten, Makrophagen, Mastzellen und dendritische Zellen. Allerdings findet man normalerweise nur die ersten drei Gruppen im Blut. Makrophagen, Mastzellen und dendritische Zellen halten sich vorwiegend im Gewebe auf.
Spezifisch
Zellulär
~ B-Lymphozyten
~ T-Lymphozyten
Unspezifisch ~ Monozyten/ Makrophagen
~ Granulozyten
~ Mastzellen
~ Natürliche Killerzellen (NK-Zellen)
~ Dendritische Zellen
Humorale Abwehr
Zur humoralen Abwehr zählt man alle Proteine, die auf irgendeine Weise an der Immunantwort beteiligt sind:
~ Komplementsystem ( s. Kap. 1 06), ~ Lysozym: Lysozym ist ein in Körperflüssigkeiten (Atemwegssekret, Tränen· flüssigkeit, Speichel) vorkommendes Enzym, das die Bakterienwand grampositiver Bakterien angreift, und auf diese Weise bakterizid ( = Bakterien abtötend) wirkt. ~ Laktoferrin: Bakterien benötigen Eisen, um sich replizieren zu können. Das Protein Laktoferrin wirkt antibak· teriell , indem es Eisen bindet und da· durch die Eisenkonzentration senkt, was dazu führt, dass die Bakterienver· mehrunggehemmt wird (Bakteriostase). ~ Akute-Phase-Proteine (s. Kap. I 06), ~ Interferone: Gewebshormone, die immunstimulierend wirken und haupt· sächlich von Leukozyten und Fibroblasten gebildet werden. Sie wirken vor allem antiviral und antiturnoraL
Die bisher genannten Proteine sind Teil der unspezifischen Immunabwehr. Zur humoralen Abwehr zählen aber auch Antikörper (Immunglobuline), die Bestandteil der spezifischen Abwehr sind.
Unspezifische Abwehr
Die unspezifische Abwehr greift jeden Fremdkörper an, egal, ob dieser ihr bereits bekannt ist oder nicht. Dazu erkennt sie Oberflächenmerkmale der jeweiligen Eindringlinge (z. B. Krankheitserreger), die diese als körperfremd ausweisen. Wie der Name bereits sagt, ist diese Form der Abwehrreaktion sehr unspezifisch, d. h. sie erkennt Oberflächenstrukturen, die bei sehr vielen
Humoral
Antikörper (Immunglobuline)
~ Komplement
~ Lysozym
~ Laktoferrin
~ Akute-Ph ase-Proteine
.,. Interferone I Tab. 1: Einteilung
der Immuna bwehr
verschiedenen Keimen vorkommen. Die unspezifische Abwehr wird auch als natürliche oder angeborene Abwehr bezeichnet, da sie von Geburt an einsatzbereit ist. Die Zellen der unspezifischen Abwehr verfügen über verschiedene Methoden
' um gegen die Eindringlinge vorzugehen.
~ So "fressen" die Phagozyten (auch Fresszellen genannt) die Fremdstoffe auf, um sie in ihrem Inneren abzutöten und abzubauen. Auch körpereigene Zellen, die zu alt oder funktionsunfähig sind, werden auf diese Weise zerstört. Zu den Fresszellen zählen neutrophile Granulozyten und (Gewebs-}Makrophagen. Letztere entstehen, wenn ihre Vorläuferzellen, die Monozyten, aus dem Blut ins Gewebe auswandern, um dort zu Makrophagen auszureifen. ~ Andere Zellen der unspezifischen Resistenz dagegen (Mastzellen, natürliche Killerzellen, basophile und eosinophile Granulozyten} bekämpfen Eindringlinge durch Sekretion von schädigenden Stoffen. ~ Dendritische Zellen bekämpfen Krankheitserreger, indem sie diese aufnehmen und an ihrer Oberfläche präsentieren, um Zellen des spezifischen Immunsystems auf sie aufmerksam zu machen. Sie gehören zu den wichtigsten Antigen-präsentierenden Zellen (APC).
Spezifische Abwehr
Zelluläre und humorale
Komponenten Im Gegensatz zur natürlichen Abwehr sind die Bestandteile der erworbenen Abwehr(= Immunsystem) hochspezifisch, d. h. jeder B- oder I-Lymphozyt ist auf die Bekämpfung eines einzigen Fremdstoffes spezialisiert. Die Spezifität wird dabei über spezielle Oberflächenrezeptoren der Lymphozyten vermittelt
' an denen Antigene andocken und zu einer Aktivierung des Lymphozyten führen können. Zum besseren Verständnis sollte man sich über die Definition eines Antigens im Klaren sein.
Ein Antigen ist ein Strukturmerkmal einer Zelle oder eines Stoffes {körperfremd oder körpereigen), das durch die Zellen der spezifischen Abwehr erkannt wird. Die Antigenrezeptoren der Lymphozyten und die Antikörper erkennen dabei einen ganz bestimmten Teil des Antigens, das Epitop (• antigene Determinante).
Den humoralen Teil der spezifischen Abwehr bilden die Antikörper ( = Immunglobuline) . Diese werden durch aktivierte B-Lymphozyten (Plasmazellen} sezerniert und deaktivieren Krankheitserreger, indem sie an diese binden und zu einer Bildung von unlöslichen Antigen-Antikörper-Komplexen führen . Eigentlich handelt es sich bei den Antikörpern um die löslichen, sezernierten Formen der Antigenrezeptoren der B-Lymphozyten.
Eigenschaften der spezifischen Abwehr Ein Nachteil der spezifischen Abwehr ist, dass ihre Reaktion verzögert abläuft: Sie erreicht ihr Maximum erst nach ca. 5-8 Tagen, weil die Lymphozyten sich normalerweise im Ruhestand befinden (G0-Phase des Zellzyklus) und erst durch Kontakt mit ihrem spezifischen Antigen aktiviert werden. Um im Falle einer Re-Infektion schneller reagieren zu können, hat sich das spezifische Immunsystem einen Trick ausgedacht. Es kann ein immunologisches Gedächtnis in Form der sog. Gedächtniszellen auszubilden. Ein Teil derBund I-Lymphozyten differenziert sich nach Erstkontakt mit einem Antigen zu B-bzw. T-Gedächtniszellen aus. Die Gedächtniszellen befinden sich in ständiger Einsatzbereitschaft und gewährleisten bei erneutem Kontakt mit dem Antigen eine rasche und sehr effektive Immunreaktion. Dieser Effekt wird auch beim Prinzip der aktiven Impfung genutzt.
Immunzellbildung
Alle Zellen des Immunsystems leiten sich von pluripotenten Stammzellen aus
dem Knochenmark ab, die dazu in der Lage sind, sich zu jeder Art von Blutzelle zu differenzieren. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Hauptdifferenzierungswege: die lymphatische Reihe und die myeloische Reihe (I Abb. 1 ):
ll> Zur lymphatischen Reihe gehören nur die Lymphozyten (T- und B-Lymphozyten, NK-Zellen) sowie deren Vorläuferzellen (präT und prä-B-Zellen). Die Vorläuferzellen der Lymphozyten reifen in den primären lymphatischen Organen (Thymus, Knochenmark) aus, wobei dies für die T-Zellen im Thymus stattfindet, während die B-Zellen noch im Knochenmark (Bane marrow) ausreifen. Anschließend wandern die reifen
Immunsystem 1 oo I 1 o 1
Lymphozyten in die sekundären lymphatischen Organe (Lymphknoten, Milz, Peyer'sche Plaques, Tonsillen, Appendix) ein, wo sie zur Ruhe kommen, bis sie durch Antigenkontakt zur Differenzierung und Proliferation angeregt werden. ll> Alle übrigen Blutzellen (Granulozyten, Monozyten/ Makrophagen, Mastzellen, dendritische Zellen, Erythrozyten, Thrombozyten) gehen den Weg der myeloischen Reihe.
Welchen Weg die plurlpotente Stammzelle einschlägt, wird durch Hormone {Erythropoletln, Thrombopoletln) und durch Zytokine (z. B. lnterleukine) g~euert.
/ ....... i<.ö~cii.eililiäl-k --..
-~~ "'""]"" "'C_.~_~·>---+-- (3. Po;~~~i~~-Ze l le; ....,. i myeloische...,. NK-Ze lle) ....,. ! Stammzelle f
! lymphatische ' Thrombozyten -c- Megakaryozyten...,. \.. Stammzelle 1
Eosinoph ile -.,.. Neutroph ile ~.:::,. Leukozyten Basophile ,;:
Erythrozyten
( Knochenmark ::.:·] ................. [ ... ·(:~:~ i f
l !
I unabh~::~;·Phase ~ ----t [---
! #/t\~ i · 8-Zellen i
~~ •- <~"•" 'i~'m'"'"':~Z-)efl,l'ee r- T-Suzpeflel\e~-nach Anligenkontakt .. t
y
Thymus \i
prä-T-Zeile
l" ... Thymusfaktoren !
T-Zelle
-- j /
Zytotoxische T-Gedächtnis-Zelle Zelle
Pla smazelle Zelluläre Immunität
B-Gedächtniszelle .... J--- Antikörpe r
),).",\AAA
Humorale Immunität
Zusammenfassung
I Abb. 1: Immunzellbildung im Überblick [7]
X Man kann das Immunsystem in eine unspazifische (angeborene) und eine
spezifische (erworbene) Abwehr unterteilen.
X Die Bestandteile der unspezifischen Immunantwort richten sich gegen alle
körperfremden Zellen und Stoffe, ohne vorher aktiviert werden zu müssen.
X Die Zellen und Antikörper der erworbenen Abwehr richten sich gezielt ge
genfür sie spezifische Fremdstoffe. Dabei spielt die Aktivierung durch Anti
gene eine große Rolle.
X Bei der Immunzellbildung aus pluripotenten Stammzellen des Knochen
marks unterscheidet man die lymphatische von der myeloischen Zell reihe.
Zellen des Immunsystems
Bei der Einteilung der unterschiedlichen Immunzellpopulationen bedient man sich verschiedener Methoden. Beispielsweise kann man die einzelnen Granulozytenunterarten schon lichtmikroskopisch voneinander unterscheiden, was bei den Lymphozytensubgruppen nur elektronenmikroskopisch möglich ist. Ein weiteres System, nach dem man die Leukozyten einteilen kann, ist das CD-System (CD= duster of differentiation). CD-Moleküle befinden sich auf den Zelloberflächen der Leukozyten und auch anderer Körperzellen, wobei jeder Zelltyp eine charakteristische Zusammensetzung dieser Oberflächenmoleküle aufweist (I Tab. 1).
Myeloische Zellreihe
Die Abwehrzellen der myeloischen Reihe sind im Wesentlichen Granulozyten, Monozyten, Makrophagen und dendritische Zellen.
Granulozyten
Granulozyten enthalten in ihrem Zytoplasma Granula und werden nach ihrem Färbungsverhalten in neutrophile, eosinophile und basophile Granulozyten eingereil t:
~ Neutrophile Granulozyten enthalten kleine Granula, die sich kaum anfärben lassen. Sie machen mit 60- 70% den größten Anteil der Leukozyten im Blut aus und spielen besonders bei akuten Entzündungen eine wichtige Rolle. Dabei werden sie chemotaktisch (d. h. durch Ausschüttung von Botenstoffen) von entzündetem bzw. geschädigtem Gewebe angelockt. Hier bekämpfen sie die Krankheitserreger durch Phagozytose, d. h. sie nehmen diese durch Einstülpen in die Zell-
membran auf, wobei Vesikel entstehen, die sog. Phagosomen. Anschließend verschmelzen die Phagosomen mit den Granula der Neutrophilen, die Iysosomale und bakterizide Enzyme enthalten. In den Granula werden die Eindringlinge abgebaut. ~ Die mittelgroßen Granula der eosinophilen Granulozyten lassen sich durch den sauren Farbstoff Eosin rot anfärben. Die Eosinophilen machen ca. 3-5% der Gesamtleukozyten aus und sind hauptsächlich an der Abwehr von Parasiten, aber auch an der Entstehung von allergischen Reaktionen beteiligt. Sie bekämpfen ihre Zielzellen durch Ausschüttung toxischer Substanzen aus ihren Granula und durch Phagozytose. An diesen Reaktionen sind v. a. IgE-Antikörper beteiligt. .,.. Basophile Granulozyten enthalten größere Granula, die sich durch basische Farbstoffe blau anfärben lassen. Sie sind mit ca. 0-1% die seltensten Zellen des Differenzia lblutbilds. Ihre Funktion ist noch weitgehend ungeklärt, aber man vermutet, dass sie in der Auslösung von Allergien eine entscheidende Rolle spielen, da der Kontakt mit antigen-beladenen IgEAntikörpern sie zur Sekretion von Histamin stimuliert. Wandern Basophile ins Gewebe aus, werden sie Mastzellen genannt.
Monozyten und Makrophagen
Monozyten sind die größten Leukozyten und machen ca. 3- 7% der Gesamtleukozyten im Blut aus. Während sie sich im Blutkreislauf aufhalten, nehmen sie keine besondere Funktion wahr. Erst wenn sich die Monozyten im Gewebe eingenistet haben und zu (Gewebs-)Makrophagen ausgereift sind,
CD Zelltyp (Beispiele) Funktion des CD-Molekilla (Beispiele)
CD3 ReifeT-Lymphozyten T-Zeii-Signaltransduktion, Expression des T-Zeii-Rezeptors
CD4 T-Helferzellen. Monozyten/Makrophagen. Corezeptor bei der T-Zeii-Aktivierung über MHC- 11-Moleküle;
Granu lozyten, dendri tische Zellen
CDB ZytotoxischeT-Ze llen
CD40 Makrophagen, dendritische Zell en,
Endothelzellen, Keratinozyten
HIV-Rezeptor
Corezeptor bei der T-Zeii-Aktivi erung über MHC-1-Moleküle
B-Zeii-Wachstum, Differenzierung und Antikörper-Klassen
wechsel
werden sie für die Immunabwehr von Bedeutung.
Monozyten sind die Vortäuferzellen der Makrophagen.
Ähnlich wie neutrophile Granulozyten bekämpfen Makrophagen Keime und befallene Körperzellen mittels Phagozytose. Aber im Gegensatz zu Granulozyten arbeiten sie eng mit dem spezifischen Immunsystem zusammen: Sie binden die aufgenommenen Antigene an einen Oberflächenrezeptor, den MHC-11-Rezeptor, um sie den T-Zellen zu präsentieren, wodurch diese aktiviert werden. Die Makrophagen kommen im ganzen Körper vor, haben aber in jedem Gewebe einen eigenen Namen (z. B. Leber~ Kupfferzellen, Nieren --+ Mesangiumzellen, Lunge --+ Alveolarmakrophagen usw.). Die Gesamtheit aller Makrophagen wird als mononukleäres Phagozytensystem oder retikuloendotheliales System (RES) zusammengefasst.
Dendritische Zellen
Dendritische Zellen sind die einzigen Zellen des Immunsystems, die sich ausschließlich mit der Antigenpräsentation beschäftigen. Sie gehören zur Gruppe der Antigen-präsentierenden Zellen (APC).
Lymphatische Zellreihe
Zur lymphatischen Zellreihe gehören Lymphozyten und ihre Vorstufen sowie natürliche Killerzellen (NK-Zellen). Letztere gehören zur unspezifischen Abwehr, wodurch sie sich zusätzlich von den übrigen Lymphozyten unterscheiden.
I Tab. 1: Beisp iele für CD-Moleküle mit den dazugehörigen Zelltypen
B-Lymphozyten Reife B-Lymphozyten (Plasmazellen) sind die einzigen Immunzellen, die Antikörper produzieren können. Sie sind damit die Träger der humoralen (spezifischen) Immunantwort Die Verwandlung der pluripotenten Stammzelle über die prä-B-Zelle zum B-Lymphozyten geschieht im Knochenmark (hone marrow). Diesen Schritt bezeichnet man als Antigen-unabhängige Phase, da er ohne Kontakt zu einem Antigen abläuft. Bereits in diesem Schritt entsteht durch Rekombination von Genen (s. u.) eine Vielfalt verschiedener B-Lymphozyten, die über unterschiedliche, spezifische Antigenrezeptoren verfügen. Die B-Zellen gelangen aus dem Knochenmark in die sekundären lympha· tischen Organe, wo sie zur Ruhe kommen, bis sie mit einem für sie spezifischen Antigen in Kontakt kommen. Trifft also ein Antigen auf den passenden B-Lymphozyten, differenziert er zur Plasmazelle, die sich daraufhin vermehrt (klonale Selektion)_ Die Plasmazelle produziert Antikörper gegen das Antigen, das zu ihrer Aktivierung geführt hat. Antikörper sind nichts anderes als die Antigenrezeptoren des Vorläufer-B-Lymphozyten in gelöster, sezernierter Form. Ein Teil der aktivierten B-Lymphozyten differenziert zu B-Gedächtniszellen. Diese ruhen weiterhin in den sekundären lymphatischen Organen, sind aber bei einer Re-Infektion sofort einsatzbereit.
T-Lymphozyten Die I-Lymphozyten sind vorwiegend für die zelluläre Immunantwort verantwortlich. Sie sind für die Abwehr von körperfremden Geweben, Tumorzellen und virusinfizierten Zellen zuständig. Die Reifung der I -Lymphozyten aus ihren Vorläuferzellen (prä-T-Zellen) spielt sich im Thymus ab. Auch T-Lym-
phozyten verfügen über spezifische Rezeptoren, die durch Kombination verschiedener Gene entstehen. Nach der Reifung werden die T-Z eilen aus dem Thymus in die Blutbahn ent· lassen, wo sie auf ihren Einsatz warten. Der Thymus bildet sich bei Eintritt in die Pubertät zurück. Man unterscheidet bei T-Lymphozyten vier Subtypen:
..,.. ZytotoxischeT-Zellen (T-Killerzellen) schütten nach Aktivierung durch Fremdantigene zytotoxische Substanzen (Perforin) aus. Sie gehören zu den CD8·Zellen und erkennen die entspre· ehenden Antigene nur, wenn sie ihnen an einem MHC-1-Protein präsentiert werden. ..,.. T-Helferzellen unterstützen B-Zellen bei ihrer Differenzierung zur Plasmazelle, da hierfür der reine Kontakt mit einem Antigen meist nicht ausreicht. Dazu präsentiert die B-Zelle das am MHC-II-Protein gebundene Antigen. Über ihr CD4-Molekül, das dabei als Corezeptor fungiert, erkennt die T-Hel· ferzelle das Antigen, was sie aktiviert und die Sekretion von Zytokinen aus· löst. Diese wiederum stimulieren die B-Zelle zur Differenzierung. ..,.. T-Suppressorzellen sind an der Regulation des Immunsystems beteiligt, indem sie Immunantworten von T-Hel· fer-Zellen und B-Lymphozyten unter· drücken. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen T-Suppressorzell· Defekten und der Entstehung von Autoimm unerkrankungen.
Zusammenfassung
Immunsystem 1021103
..,.. Auch T-Lymphozyten sind in der Lage, ein immunologisches Gedächtnis auszubilden (T-Gedächtniszellen).
Theorien zur Spezifität der Lymphozyten Wie bereits gesagt, wird ein Lymphozyt nur durch ein für ihn spezifisches Antigen aktiviert. Dabei entsteht die Spezifität nicht erst nach Kontakt mit einem An· tigen, sondern wird den B· und I-Zellen schon bei ihrer Reifung mit auf den Weg gegeben. Sie wird über die T-Zell· bzw. B-Zell-Antigenrezeptoren (TCR, BCR) vermittelt, die durch Rekombination von Teilgenen (V-, D- und J-Teilgene) eine unglaubliche Vielfalt erreichen. So ist das Immunssystem dazu befähigt, ca. l 011
verschiedene Antigene zu erkennen. Dieses Prinzip nennt man somatische Rekombination (s. auch Kap. 106). Ein zweiter Trick, der die gezielte Be· kärnpfung eines spezifischen Eindringlings erleichtert, ist die klonale Selektion: Bei einer Infektion kommt es nur zur Proliferation der für den Keim spezifischen Lymphozyten, da diese erst nach Aktivierung durch Antigenkontakt proliferieren.
X Neutrophile Granulozyten und Makrophagen sind Phagozyten, während
eosinophile und basophile Granulozyten v. a. über die Ausschüttung
toxischer Substanzen wirken.
X 8-Lymphozyten differenzieren nach Antigenkontakt zu Antikörper
produzierenden Plasmazellen.
X Von den T-Lymphozyten gibt es verschiedene Subtypen (zytotoxische
T-Zelle, T-Helfer-Zelle und T-5uppressorzelle), die jeweils unterschiedlict.le
Aufgaben haben.
X Sowohl 8- als auch T-Lymphozyten können ein immunologisches
Gedächtnis ausbilden.
1orale Abwehr I
:=: s: ;:5ßte Teil der humoralen Abwehr wird von Antikörpern ui:Jernommen. Aber auch einige unspezifische Abwehrpro· teine, wie die Faktoren des Komplementsystems oder die in der Leber gebildeten Akute-Phase-Proteine, unterstützen das Immunsystem bei der Abwehr von Krankheitserregern.
Antikörper
Antikörper (Immunglobuline) werden von aktivierten B-Lymphozyten, den Plasmazellen, sezerniert. Sie entsprechen dabei den B-Zeli-Antigenrezeptoren (BCR) der Plasmazelle und richten sich nur gegen das für die Plasmazelle spezifische Antigen. Durch Bildung von Antigen-AntikörperKomplexen machen sie die Antigen-tragenden Zellen und Stoffe unschädlich.
Struktur
Antikörper sind Glykoproteine, die aus zwei identischen leichten L-Ketten (light chains) und zwei identischen schweren H-Ketten (heavy chains) aufgebaut sind. Weiterhin besitzen die Antikörper einen konstanten und einen variablen Bereich, wobei beide Kettenarten sowohl konstante (C), als auch variable (V) Domänen besitzen. Dieser typische Aufbau lässt sich am besten an einem Beispiel - in diesem Fall ein Immunglobulin G- nachvollziehen (I Abb. I):
~ Die konstanten Regionen legen die biologischen Eigenschaften der Immunglobuline fest. Damit können sie z. B. bestimmte Zellen oder auch Komplementproteine binden. ~ Die variablen Anteile der Antikörper bilden dagegen die Antigenbindungsstellen und sind, wie der Name schon sagt, sehr variabel. Sie machen die Spezifität der Antikörper aus. ~ L-Ketten: Von den L-Ketten gibt es zwei verschiedene Arten (Kund A.). Dabei ist innerhalb eines Immunglobulinmoleküls immer der gleiche L-Kettentyp enthalten. Funktionell unterscheiden sich die beiden L-Kettentypen nicht. ~ H-Ketten: Bei den H-Ketten unterscheidet man 5 verschiedene Typen (a, 8, e, y und Jl ). Jedes Immunglobulin enthält nur einen H-Kettentyp und wird diesem entsprechend in eine der fünf Immunglobulin-Klassen eingeteilt: - IgA---+ a-H-Kette, - IgD ---+ e-H-Kette, - IgE ---+ e-H-Kette, - lgG---+ y- H-Kette, - lgM---+ 11-H-Kette. ~ Die verschiedenen Ketten sind durch Disulfidbrücken miteinander verbunden. ~ Immunglobuline verfügen außerdem über eine Gelenkregion. Wird ein Antikörper in dieser Region gespalten (z. B. durch die Protease Papain), entstehen drei Fragmente: zwei identische F.b-Fragmente [ab steht für antigenbindend) und ein F,-Fragment. Auch Pepsin kann Immunglobuline spalten, allerdings baut es das Fe-Fragment vom C-terminalen Ende her kontinuierlich ab.
N-terminales Ende
C-terminales Ende
I Abb. 1: Aufbau eines lgG-Moleküls
Antikörperklassen
Antigenbindungsstelle
Paratop
Fab
Immunglobuline werden nach strukturellen Unterschieden [H-Kettentyp, Zahl und Anordnungder Disulfidbrücken etc.) in fünf Subtypen eingeteilt, die sich auch in ihrem Vorkommen und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Immunglobulin M Das IgM-Molekül ist ein Pentamer aus fünfY-förmigen Strukturen, die im Aufbau einem IgG-Molekül ähneln und über eine Polypeptidkette []-Kette) miteinander verknüpft sind [I Abb. 2)_ Es ist mit einem Molekulargewicht von 900 000 Dalton das größte Immunglobulin und kann zehn Antigene gleichzeitig binden. Dadurch ist es besonders gut zur Agglutination und Komplementaktivierung befähigt. Eine weitere Besonderheit des IgM ist, dass es als einziges Immunglobulin vom Fetus synthetisiert werden kann. Die Blutgruppenantigene des ABO-Systems gehören zur Klasse der IgM.
- = Disulfidbrücke
I Abb. 2: Immun
globulin M
Immunglobulin G Das lgG ist typischerweise Y-förmig und verfügt über zwei Antigenbindungsstellen (I Abb. 1 ). Es ist mit einer Serumkonzentration von 12 mg/ml das häufigste im Blut vorkommende Immunglobulin. Man unterscheidet fünf lgG-Typen mit unterschiedlichen biologischen Eigenschaften (IgG1-IgG5) . IgG ist der einzige plazentagängige Antikörper und verleiht dem Fetus auf diesem Wege einen Nestschutz, was allerdings auch Nachteile mit sich bringen kann (z. B. die Entstehung einer Rhesusunverträglichkeit, s. Kap. 11 0). Aufgrund seiner langen Halbwertszeit (HWZ) von etwa 23 Tagen eignet sich lgG bestens zur passiven Immunisierung. Immunglobulin G ist ein multifunldoneller Antikörper mit zahlreichen Wirkweisen (I Tab. 1 ).
Immunglobulin A Immunglobulin A ist nur als Dimer, in dem zwei !gA-Monomere über eine J- und eineS-Kette miteinander verbunden sind, biologisch aktiv. Es kommt in dieser Form hauptsächlich in Sekreten wie Schleim, Speichel, Tränenflüssigkeit und Darmsekret vor und ist auch in der Muttermilch enthalten. Es wirkt agglutinierend, bakterizid und antiviral, kann aber kein Komplement aktivieren.
Immunglobulin E Immunglobulin E ist neben der Bekämpfung von Parasiten auch an der Entstehung von Allergien beteiligt. Es bindet mit seinem Fe-Teil an Mastzellen und basophile Granulozyten und verbleibt dort monatelang, bis es durch ein Antigen aktiviert wird. Geschieht dies, so stimuliert lgE die Mastzelle bzw. den Basophilen zur Degranulation. Die sezernierten Stoffe, insbesondere Histamin, lösen eine Überempfindlichkeitsreaktion aus.
Immunsystem 1041 105
Immunglobulin D Die Funktion des IgD ist weitgehend unbekannt. Man weiß allerdings, dass es als Oberflächenrezeptor an der Differenzierung von B-Lymphozyten beteiligt ist.
Funktion der Antikörper
Wie schon aus I Tabelle 1 ersichtlich, wirken Antikörper auf verschiedene Weisen antimikrobielL Sie können über ihren F.b-Teil an Antigene binden und zu einer Bildung von Antigen-Antikörper-Komplexen führen. Dadurch bewirken sie eine direkte Inaktivierung der Antigene. Kommt es dabei zu einer Verklumpung korpuskulärer Antigene, nennt man den Prozess Agglutination. Der Begriff Präzipitation bezeichnet die Verklumpung und anschließende Ausfällung löslicher Antigene. Antikörper können auch Toxine neutralisieren oder Rezeptoren für Erreger blockieren, wodurch deren Eindringen in Körperzellen verhindert wird (Neutralisierung). Weiterhin können Antikörper andere Komponenten des Immunsystems aktivieren und Antigen-tragende Stoffe dadurch indirekt bekämpfen. Diese Funktion wird nach Antigenerkennung über den Fe-Teil der Antikörper vermittelt. So können auf diese Weise z. B. Mastzellen, basophile und eosinophile Granulozyten zur Degranulation angeregt werden (lgE). IgG ist in der Lage, Antigene zu binden und dadurch Phagozyten anzulocken. Es macht ihnen die Antigene dadurch besonders "schmackhaft", was man als Opsonierung bezeichnet. Auch zytotoxische T-Zellen können durch IgGmarkierte Zellen aktiviert werden. An der Aktivierung des Komplementsystems sind verschiedene Antikörperklassen beteiligt (I Tab. 1).
Molekulargewicht (Da) HWZ(Tage) Vorkommen Wirkweisen Besonderheiten
lgM 900 000 (Pentamer) 5
lgG 150000 23
lgA 400 000 (Dimer) 5,5
lgE 200 000
lgD 180000 2,7
I Tab. 1: Überblick über die Antikörperklassen
Blut
BI ut, Gewebe
Sekrete (Blut)
Auf Mastzellen und
Basophilen
Aul B-Zellen
Agglutinierend, komplementaktivierend, antibakteriell Frühphase der Immunantwort
Agglutinierend, opsonierend, komplementaktivierend, Plazenta-gängig, für passive lmmunisie-antibakteriell, antiviral, Antitoxin-Wirkung rung geeignet
Agglutinierend, antibakteriell, antiviral Kommt v. a. in Sekreten vor
Komplementaktivierend (Mastzelldegranulation) Gegen Parasiten, löst Unverträglichkeilsreaktionen aus
B-Zeii-Oifferenzierung
Humorale Abwehr II
Ursachen der Antikörpervielfalt
Es gibt eine große Anzahl unterschiedlicher Antikörper, die jeweils gegen ein für sie spezi fi sches Antigen gerichtet sind. Die Spezifität eines Antikörpers wird dabei durch seinen vari· ablen Teil (F,b) determiniert und ist schon festgelegt, bevor überhaupt ein Kontakt mit einem Antigen stattgefunden hat. Vielmehr regt ein Antigen nur diejenigen B·Lymphozyten zur Proliferation und Antikörperproduktion an, die auch genau zu diesem Antigen passen (klonale Selektion). Nun stellt sich aber die Frage, wie diese unglaubliche Anti· körpervielfai r zustande kommt. Immerhin ist der Körper dazu in der Lage, ca. 10 11 verschiedene Antigene zu erken· nen, während er aber nur über eine begrenzte Anzahl an Genen verfügt, die für B·Zell·Rezeptoren bzw. Antikörper kodieren.
Somatische Rekombinati on Neben den normalen Keimbahnmutationen und ·rekombina· tionen, tritt bei der B·Zell·Reifung noch eine weitere Art von Rekombination auf: die somatische Rekombination (Trans· position, Rearrangement). Hierbei kommt es zu einer Umla· gerung von Teilgenen auf DNAEbene. Die genetischen Infor· mationen für die Antigenrezeptoren bzw. Antikörper sind auf zum Teil weit auseinander liegende Genabschnitte, die V-, D- und J-Teilgene (v für variables, d für diversity· und j für joining·Gensegment) verteilt. Erst durch Kombination dieser Teilgene durch einen dem Spleißen ähnlichen Vorgang entsteht ein funktionierendes Gen. Aufgrund der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten kommt eine Vielfalt an für Anti· körperkodierenden Genen zustande. Der Mechanismus lässt sich am besten mithilfe einer Grafik nachvollziehen (I Abb. 3). Hier sieht man, dass aus dem ur· sprünglichen Genpool während der (Antigen-unabhängigen) Lymphozytenreifung Genabschnitte herausgetrennt werden, so dass von den zahlreichen verschiedenen Y., D· und )-Teil· genenjeweils nur eines übrig bleibt. Die fertigen Leichtket· tengene (insgesamt 316 verschiedene) setzen sich nur aus V· und J·Teilgenen zusammen, die Gene für die schweren Ketten (8262 Möglichkeiten) enthalten zusätzlich noch ein D·Teilgen.
Nur das Gen fDr die variable (V-)Reglon des Antikörpers wird durch somatische Rekombination zusammengesetzt. Für die C-Region codiert nur ein c-Gensegment
Weitere Ursachen für die Antikörpervielfalt Neben der Rekombination von Y., (D·) und)-Teilgenen kommt die Antikörpervielfalt durch Kombination der unter· schiedlichen H· und L·Ketten, die ja willkürlich miteinander verknüpft werden können, sowie durch Keimbahnmutation und -rekombination, durch Ungenauigkeiten beim Spleißen und durch somatische Punktmutationen zustande. Allein bei der Kombination von H· und L-Ketten erhält man 316 x 8262, also 2,6 x 10° verschiedene Möglichkeiten.
5'
somatische Rekombination
V(D)J-Rekombinase
zah lre iche Kombinationsmög lichkeiten
3'
5'{]{)fr3' 5'{]{)fr3' 5'{]{)fr 3' etc .
I Abb. 3: Prinzip der somatischen Rekombinati on durch V(D)J-Rekombination
Antikörperswitch
Plasmazellen synthetisieren als erstes lgM und erst später lgG, IgA oder lgE. Den Wechsel der von einer B·Zelle produzierten Immunglobulinklasse bezeichnet man als Switch. Dabei wird nur die konstante Region ausgetauscht, der antigenbindende Anteil und die Spezifität bleiben erhalten. Dem Ig-Switch liegen ebenfalls das Prinzip der somatischen Rekombination sowie Spleiß-Effekte zugrunde.
Ein lg-Swltch ist nur möglich, wenn es sich bei dem entspre-, ehenden Antigen um ein Peptid handelt.
Komplementsystem
Das Komplementsystem ist eine Komponente der unspezi· fischen, humoralen Abwehr. Es besteht aus ca. 20 Glykoproteinen mit Enzymfunktion, die kaskadenartig über limitierte Proteolyse aktiviert werden und eine Zerstörung der Zell· membran der körperfremden oder infizierten Zelle zum Ziel haben. Einige der Komplementfaktoren können zusätzlich bestimmte Zellen aktivieren oder eine Entzündungsreaktion hervorrufe n. Produktionsstätte der Komplementfaktoren sind die Leber, Mukosazellen des Magen-Darm-Traktes und Phagozyten. Neun Hauptkomponenten sind an der Aktivierung des Korn. plementsystems beteiligt (C 1- C9). Die übrigen Proteine sind hauptsächlich für die Regulierung des Komplementsystems verantwortlich.
Komplementaktivierung
Das Komplementsystem kann auf zwei Wegen aktiviert werden:
l Immunsystem ~~~ --------------------------------------------------------~~~~~~ 106 I 107
.,. Der klassische Weg wird durch ein komplementaktivierendes Immunglobulin (v. a. lgM und IgG), das ein Antigen gebunden hat, begonnen. Durch Ausbildung des Antigen-Antikörper-Komplexes wird die Komplement-Bindungsstelle am Fe· Teil des Antikörpers aktiviert, was wiederum die Komplementkaskade startet. Die Einzelkomponenten werden nacheinander in der Reihenfolge C 1 ~ C4 ~ C2 ~ C3 ~ CS ~ C6 ~ C7 ~ C8 ~ C9 aktiviert. .,. Beim alternativen Weg der Komplementaktivierung werden die Fak· toren CI, C4 und C2 umgangen, und stattdessen C3 direkt aktiviert. Von da an läuft die Kaskade analog zum klassischen Aktivierungsweg ab. Der alternative Weg spielt vor allem in der Frühphase einer In fe ktion eine Rolle, er läuft schon ab, bevor eine spezifische Immunreaktion stattfindet. C3 wird dabei durch Endotoxine aus der äußeren Zellmembran gramnegativer Bak· terien aktiviert, bei denen es sich vorwiegend um Polysaccharide und Lipopolysaccharide handelt. An diesem Weg sind außerdem Plasmafaktoren (Faktor Bund D) und das Protein Properidin beteiligt. .,. Die gemeinsame Endstrecke der beiden Komplementaktivierungssysteme wird auch als Membranangriffskomplex ( = MAC) oder lytischer Komplex bezeichnet. Er verursacht Löcher in der Membran der Zielzelle, die durch den Einstrom von Wasser, Ionen und Enzyme zerstört wird (Lyse). Zum Membranangriffskamplex zählt man die Faktoren CSb, C6, C7, C8 und C9.
Weitere Funktionen der Komplementfaktoren
Wie schon erwähnt, nehmen einige der Hauptfaktoren des Komplementsystems auch andere Aufgaben als die Aktivierung und Bildung des Membranangriffskomplexes wahr. So verursachen die Faktoren C3a, C4a und CSa beispielsweise eine Entzündungsreaktion, weshalb man sie auch als Anaphylatoxine bezeichnet. Sie führen zu einer Kontraktion der glatten Muskulatur an den postkapillären Venolen, was mit der Ausbildung eines Erythems und Ödems
einhergeht, sowie an den Bronchien, wodurch es zum Bronchospasmus kommt. Andere durch Anaphylatoxine ausgelöste Reaktionen sind eine Erhöhung der Gefäßpermeabilität, Mastzelldegranulation und Chemotaxis. C3b wirkt zusätzlich opsonierend. Es stimuliert Neutrophile, Eosinophile, Monozyten und Makrophagen zur Phagozytose.
Akute-Phase-Proteine
Als Akute-Phase-Proteine bezeichnet man eine Gruppe von Plasmaproteinen, die als Folge entzündlicher Vorgänge vermehrt gebi ldet werden. Ihre Plasmakonzentration steigt innerhalb der ersten 6-48 Stunden nach Gewebsschädigung an und kann ein I OOOfaches der Ausgangskonzentration erreichen. Der Mechanismus dabei ist folgender: Durch eine Verletzung oder Infektion
Funktion
werden die lokalen Gewebszellen zur Ausschüttung von proinflammatorischen Zytokinen, insbesondere Interleukin-1 (I L-I), Interleukin-6 (IL-6) und Tumor-Nekrose-Faktor a (TNF-a), angeregt. Diese führen sowohl zu einer lokalen Entzündungsreaktion als auch zu systemischen Veränderungen. Im Hypothalamus führen sie zu einer Temperatur-Sollwertverstellung, wodurch es zu Fieber kommt, in der Leber induzieren sie die Synthese der Akute-PhaseProteine. I Tabelle 2 liefert eine Übersicht über die wichtigsten Akute-PhaseProteine und ihre Funktion. Neben den Akute-Phase-Proteinen, deren Konzentration bei Entzündungsreaktionen erhöht ist, gibt es die sog. negativen Akute-Phase-Proteine, deren Konzentration irrfolge von Gewebsschäden und Infektionen sinkt. Dazu gehören u. a. (Prä- )Albumin, Transferrin und Antithrombin III.
Bedeutung für die Infektabwehr
Fibrinogen Gerinnungsneigung i Thrombenbildung verhindert Ausschwemmung der
Erreger in die Blutbahn
a 1-Antitrypsin Protease-Inhibitor Reduktion der Gewebsschäden
C-reaktives Bindet an bakterielles Phosphocholin Opsonierung, Komplementaktivierung
Protein (CRP)
Haptoglobin Hämoglobintransport Schutz vor Eisenverlust bei intravasaler Hämolyse durch
Transport von freiem Hb ins retikuloendotheliale System
Coeruloplasmin Kupfertransport, Ferroxidase-Aktivität Schutz der Zellmembranen vor Oxidation
C3, C4 Komplementfaktoren Opsonierung, Chemotaxis, MAC
Plasminogen Fibrinolyse t Schutz vor überschießender Gerinnung
Ferritin Eisenspeicher
I Tab. 2: Beispiele für Akute-Phase-Proteine und ihre Funktion
Zusammenfassung
X Antikörper machen den humoralen Teil der spezifischen Abwehr aus. Sie
werden von Plasmazellen gebildet wnd wirken spezifisch gegen ein Antigen.
X Antikörper kann man nach ihrer Struktur in fünf Immunglobulinklassen
(lgM, lgG, lgA, lgE und lgD) unterteilen.
X Das Komplementsystem kann über einen klassischen oder einen alter
nativen Weg aktiviert werden. Beide Wege gipfeln in der Bildung eines
Membranangriffskomplexes, der zur Lyse der Zielzelle führt.
X Akute-Phase-Proteine werden in der Leber gebildet_ Ihre Konzentration
ist bei Entzündungsprozessen erhöht bzw. bei negativen Akute-Phase
Proteinen erniedrigt.
Antigene
Antigene sind Substanzen, an die Lymphozyten oder Anitkörper, also alle Komponenten der spezifischen Abwehr, binden können. Dabei wird meist nur ein kleiner Teil des Antigens als fremd erkannt, den man als Epitop oder antigene Determinante bezeichnet An dieses Epitop bindet ein Antikörper mit seiner Antigenbindungsstelle (Para top l-
Einteilung und Eigenschaften
Man kann Antigene nach verschiedenen Kriterien einteilen. Zunächst einmal ist es interessant zu wissen, ob ein Antigen überhaupt dazu imstande ist, eine Immunreaktion auszulösen_ Ist dies der Fall, bezeichnet man es auch als Immunogen. Weiterhin unterteilt man Antigene nach der Form und Anzahl der Epitope, nach seiner chemischen Klasse und danach, ob sie thymusabhängig oder thymusunabhängig sind_
Einteilung nach Form und
Anzahl der Epitope ..,. Besitzt ein Antigen ein einziges Epitop, so bezeichnet man es als unideterminant, univalent ..,. Trägt das Antigen zwar nur eine Epitopart, die aber multipel vertreten ist, so ist das Antigen unideterminant, multivalent. ..,. Sind auf einem Antigen zwar viele verschiedene Arten von Epitopen vertreten, wobei aber jede Epitopart nur ein einziges Mal vorkommt, dann bezeichnet man das Antigen als multideterminant, univalent ..,. Ein Antigen mit vielen verschiedenen Epitoparten, von denen jeweils mehrere vorhanden sind, nennt man multideterminant, multivalent.
Einteilung nach der Stoffklasse:
Hauptantigenklassen Antigene können Substanzen aus den verschiedensten Stoffklassen sein_ Die Stoffklasse sagt dabei auch etwas über die Fähigkeit zur Immunogenität eines Antigens aus. So sind Kohlenhydrate (Polysaccharide) potenziell , aber nicht zwingend immunogen, während Proteine dagegen sehr gute lmmunogene darstellen, v. a. wenn es sich um komplexe Proteine handelt Oft sind diese
multideterminant. Nukleinsäuren sind nur schwach immunogen wirksam und Lipide noch schlechter oder oft sogar gar nicht immunogen.
Thymusabhängigkeit von
Antigenen Nur wenige Antigene sind sog. Thymus-unabhängige Antigene, d.h. sie können B-Lymphozyten auch ohne Mithilfe der im Thymus gereiften T-Helferzellen stimulieren. Die wenigen Thymus-unabhängigen Antigene sind oft Substanzen mit hohem Molekulargewicht Auf deren Stimulation hin produziert die Plasmazelle nur Antikörper der !gM-Klasse. Die meisten Antigene benötigen allerdings zur B-Zeii-Stimulation gewisse Reize von T-Helferzellen, sie sind demnach Thymus-abhängig.
Antigen-abhängige Immunreaktionen
Voraussetzungen für
lmmunogenität Um eine Immunreaktion auslösen zu können, muss ein Antigen bestimmte Eigenschaften aufweisen. Ein hohes Molekulargewicht von mindestens 6000 Dalton begünstigt die Immunogenität eines An tigens_ Antigene, die ein geringeres Molekulargewicht haben, sind meist nur über Bindung an ein Trägermolekül immunogen (Haptene). Auch eine hohe chemische Komplexität eines Antigens begünstigt die Auslösung einer Immunantwort Körpereigene Strukturen werden vom Immunsystem normalerweise nicht angegriffen, außer sie wurden vorher als infiziert oder fehlerhaft markiert Körperfremde Strukturen dagegen lösen üblicherweise eine gute Immunreaktion aus_
Interaktionen zwischen Antigen
und Immunzellen Das Antigen kann über verschiedene Wege in den Organismus eindringen (Blut, Haut, Magen-Darm-Trakt, Atemwege) . Je nach Eindringpforte geschieht der erste Kontakt mit dem Immunsystem in der Milz, den lokalen Lymphknoten oder den Tonsillen. Die Immunantwort erfolgt dort durch Makrophagen, T und B-Zellen und verläuft in drei Schritten:
..,. Nach Bindung des Antigens an T- und B-Lymphozyten präsentiert die B-Zelle das Antigen einer T-Helferzelle_ Diese stimuliert mittels Zytokinen die B-Zelle zur Differenzierung zur Plasmazelle_ ..,. B-Lymphozyten differenzieren zu Plasma- und Gedächtniszellen, T-Zellen zu zytotoxischen Zellen, Suppressor-und Helferzellen. ..,. Die produzierten Antikörper reagieren schließlich mit den Antigenen zu Agglutinaten und Präzipitaten.
Spezielle Antigene
MHC-Antigene
Nahezu jede Zelle des menschlichen Organismus trägt auf ihrer Zelloberfläche MHC-Moleküle. MHC-Moleküle können Antigene erkennen, binden und anderen Zellen präsentieren. Allerdings haben MHC-Moleküle selbst antigene Eigenschaften, was klinisch in der Transplantationschirurgie von großer Bedeutung ist MHC-Antigene sind als erstes im Rahmen von Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantationen aufgefallen, was ihnen den Namen "major histocompatibility complex" eingebracht hat, da sie etwas über die Verträglichkeit verschiedener Gewebe aussagen. Eine andere Bezeichnung für die MHC-Moleküle ist HLA-Antigene (humane lymphocyte/leucocyte antigene). Sie weist auf die besondere Bedeutung der MHCMoleküle auf den Leukozyten hin. MHC-Antigene sind Glykoproteine, die aus zwei Polypeptidketten bestehen und fest in der Zellmembran verankert sind_ Die Gene, die für die MHC-Moleküle kodieren (HLA-Genkomplex: HLA-A
I
HLA-B, HLA-C, HLA-DO, HLA-DR,
~------------------------------------------------------~l~m~m~u~n~sy~s~t~e~m 108 I 109
HLA-DP) weisen eine unglaubliche interindividuelle Variabilität auf. Somit kommen exakt gleiche Zusammensetzungen an MHC-Molekülen praktisch nur bei eineiigen Zwillingen vor. Man kann die MHC-Antigene ihrer Funktion und ihrem Vorkommen nach in zwei Klassen unterteilen.
MHC-Kiasse I Für MHC-1-Proteine kodieren die Gene HLA-A, HLA-B und HLA-C. Praktisch alle kernhaltigen Zellen tragen an ihrer Oberfläche MHC-Proteine der Klasse I. An den MHC-1-Molekülen präsentieren sie den zytotoxischen I-Zellen Peptidfragmente von Proteinen, die in der Zelle selbst produziert worden sind. Diese können entweder körpereigen oder körperfremd sein. Letzteres kommt vor, wenn die Zelle durch einen intrazellulären Erreger (z . B. Virus) befallen ist und beispielsweise virale Peptide an seinem MHC-1-Molekül präsentiert. Das fremde Peptid wird von I-Killerzellen erkannt, die daraufhin die Vernichtung der Zelle initiieren. Trägt die Zelle nur körpereigene, korrekte Peptide, passiert ihr nichts. Die Bindung zwischen dem MHC-1-Molekül und dem I-ZellRezeptor muss durch den CD8-Corezeptor stabilisiert werden.
MHC-Kiasse II Die MHC-Antigene der Klasse li kommen nur auf Antigen-präsentierenden Zellen (dendritische Zellen, B-Zellen, Makrophagen) vor und werden durch die Gene HLA-DP, HLA-DO und HLA-DR kodiert. Die Antigen-präsentierende Zelle nimmt exogene Antigene (z. B. extrazelluläre Erreger) auf und spaltet diese in Phagolysosomen, um die entstehenden Peptidfragmente an den MHC-II-Molekülen zu präsentieren. Im Gegensatz zur MHC-1-Klasse werden sie aber nicht den T-Killerzellen, sondern den T-Helferzellen präsentiert, was nicht
zur Zerstörung der präsentierenden Zelle , sondern vielmehr zu deren Stimulation führt. B-Zellen werden so zur Alltikörperproduktion und Makrophagen zur Phagozytose stimuliert. Als Corezeptor bei der Bindung zwischen MHC-II-Protein und T-Zell-Rezeptor dient das CD4.
MHC-1-Moleküle interagieren mit CD8-Zellen, MHC-11-Moleküle mit CD4-Zellen. Um sich das besser merken zu können, gibt es eine Eselsbrücke: 1 x 8 • 8 und 2 x 4 '" 8.
Blutgruppenantigene
Die Erythrozyten haben auf ihrer Zelloberfläche noch andere Arten von Antigenen, die Blutgruppenantigene. Deren Zusammensetzung bestimmt die Blutgruppe eines Menschen, allerdings unterscheidet man dabei mindestens 15 verschiedene Blutgruppensysteme. Die beiden wichtigsten sind das ABOund das Rhesus-System.
ABO-System Die Antigene des ABO-Systems sind Glykoproteine, ausschlaggebend für die Blutgruppe ist jedoch nur der terminale Zucker der Polysaccharidkette. Der proteinnahe Teil der Polysaccharidkette ist bei allen ABO-Antigenen gleich, er bildet demnach das Grundgerüst und wird als H-Substanz (H für humane) bezeichnet. An die H-Substanz, deren Ende ein Galaktose- und ein Fucosemolekül (-Gal-Fuc) bilden, kann entweder ein N-Acetyl-Galaktosamin-Rest (NAGA),
Zusammenfassung
ein Galaktose-Rest (Ga!) oder kein weiterer Zuckerrest gebunden sein. Je nachdem bezeichnet man die Blutgruppe als A (NAGA), B (Ga!) oder 0. Kommen auf den Erythrozyten sowohl NAGA- als auch Gal-Reste vor, so liegt die Blutgruppe AB vor. Jeder Mensch hat Antikörper gegen fremde Blutgruppenantigene, die sog. lsohärnagglutinine, auch wenn er vorher noch nie Kontakt mit fremden Erythrozyten gehabt hat. Ursache dafür ist, dass bestimmte Bakterien der physiologischen Darmflora mit den Blutgruppenantigenen kreuzreagieren. Die Isohämagglutinine gehören der IgM-Klasse an, ein Antikörperswitch ist nicht möglich, da die BlutgruppenAntigene keine Peptid-, sondern Zuckerreste sind. Das ABO-System ist für lebensbedrohliche Transfusionszwischenfälle verantwortlich (s. Kap. 11 0).
Rhesus-System Beim Rhesus-System wird unterschieden, ob jemand Träger des Rhesus-Antigens (Antigen D) ist, oder nicht. Etwa 85% der Menschen hierzulande sind Rhesus-positiv (Rh+), d. h. ihre Erythrozyten tragen das D-Antigen. Rhesus-negative (rh-) Menschen können Antikörper gegen das Rhesus-Antigen ausbilden, im Gegensatz zum ABO-System ist hierfür aber der vorausgegangene Antigenkontakt Voraussetzung. Anti-DAntikörper gehören zur Klasse der IgG und sind damit plazentagängig, was zu Schwierigkeiten in der Schwangerschaft führen kann (s. Kap. 110).
• Einige AntigeRe sind gleichzeitig lmmunogene, d. h. sie lösen eine
Immunreaktion aus.
• Je größer (Molekulargewicht!), je komplexer und je körperfremder ein
Antigen ist, desto wahrscheinlicher ist die lmmunogenität.
• Haptene können erst nach Bindung an ein Carrier-Molekül eine Immun
reaktion auslösen.
• MHC-Antigene sind Oberflächenmerkmale auf Körperzellen. MHC-1-
Antigene dienen der Identifikation aller kernhaltigen Zellen und können
zytotoxische T-Zellen aktivieren. MHC-11-Antigene helfen den Antigen
präsentierenden-Zellen bei der Aktivierung von T-Helferzellen.
• Die wichtigsten Blutgruppensysteme sind das ABO- und das Rhesus-System.
Rolle des Immunsystems in der Klinik
Immunpathologie
Allergie
Ein gut funktionierendes Immunsystem schütze unseren Körper vor Infektionen und ist für uns somit hilfreich und notwendig. Allerdings können überschießende Immunreaktionen auch krank machen. Eine Überempfindlichkeitsreaktion (Allergie) wird durch Antikör· perder Klasse IgE in Zusammenarbeit mit Zellen der unspezifischen Abwehr (Mastzellen, Basophile, Eosinophile) ausgelöst. Diese Zellen bewirken normalerweise durch Sekretion proinflammatorischer Stoffe eine Entzündungsreaktion, die das spezifische Immunsystem bei der Erregerbekämpfung unterstützt. Eine übersteigerte Entzündungsreaktion als Antwort auf ein eigentlich ungefährliches Antigen [Allergen) bezeichnet man als Allergie. Nach Erstkontakt mit einem Allergen produzieren B-Zellen IgE-Antikörper gegen dieses (Sensibilisierungsphase). Die Antikörper heften sich an die sekretorischen Zellen der unspezifischen Abwehr und stimulieren diese nach erneutem Al lergen-Kontakt zur Degranulation mit Freisetzung von Entzündungsmediatoren. Im schlimmsten Fall kann eine solche Reaktion zum anaphylaktischen Schock führen, der tödlich enden kann.
Autoimmunerkrankungen
Autoimmunkrankheiten kommen dadurch zustande, dass sich das Immunsystem gegen körpereigene Substanzen (Autoantigene) richtet und zu Gewebsschädigungen führt. Dabei können sich die Schäden entweder auf ein Organ begrenzen oder systemische Reaktionen zur Folge haben. Beispiele für Autoimmunerkrankungen sind:
IJl- Diabetes mellitus Typ 1: Autoantikörper gegen ß-Zellen des Pankreas, IJl- Morbus Basedow: Autoantikörper gegen den TSH-Rezeptor der Schilddrüse, IJl- Myasthenia gravis: Autoantikörper gegen Acetylcholin-Rezeptoren der motorischen Endplatte,
IJl- Lupus erythematodes: Autoantikörper gegen DNA-Fragmente (syseemisch), IJl- Rheumatoide Arthritis: lgG-Autoantikörper gegen den Fe-Teil der lgM-Antikörper (systemisch) .
Blutgruppenunverträglichkeit
Tra nsfu sionszwischenfälle Soll jemand eine Bluttransfusion erhalten, so ist es zwingend notwendig, dass vorher die Kompatibilität beider Blutgruppen (insbesondere der ABO-Blutgruppen!) überprüft wird. Erhält der Empfänger Erythrozyten, gegen die er Antikörper besitzt, so kann dies weit reichende Folgen haben. Es kommt dabei zur Bildung von Antigen-Antkörper-Reaktionen zwischen den Spendererythrozyten und den ABO-An tikörpern des Empfängers (Major-Reaktion), was zur Agglutination und Lyse der Erythrozyten führt. Das Gleiche gilt natürlich umgekehrt auch für den Kontakt zwischen Empfängererythrozyten und gegen diese gerichtete Antikörper aus Fremdplasma (Minor-Reaktion) . Folgen sind Mikrozirkulationsstörungen, Schock, Verbrauchskoagulopathie sowie akutes Nierenversagen. Um dies zu vermeiden, ist unmittelbar(!) vor jeder Transfusion ein Bedside-Test anzuwenden, bei dem die Blutgruppe des Empfängers untersuche und mit der Blutgruppe der Konserve abgeglichen wird. I Tabelle I gibt eine Übersicht über die Kompatibilität der verschiedenen Blutgruppen bei der Transfusion von Erythrozytenkonzentraten.
Morbus haemolyticus
neonatorum Ist eine Rhesus-negative Frau mit einem Rhesus-positiven Kind schwanger, kann es zu einer Rhesusunverträglichkeitsreaktion (Rhesusinkompatibilität) kommen. Beim ersten Kind ist das Risiko noch gering, da die Mutter im Normalfall bisher noch keinen Kontakt mit Rh-positiven Erythrozyten gehabt hat. Während der Geburt des ersten Rhpositiven Kindes durch die Rh-negative Mutter vermischt sich das JQndliche mit dem mütterlichen Blut (Erstkontakt), woraufhin die Mutter Antikörper (lgG)
Spenderblutgruppe Empfängerblutgruppe
(Erythroz)•lenspende) + =Transfusion möglich
·::: Transfusion nicht möglich
0 A B AB
0 + +
A + +
B + +
AB
I Tab. 1: Blutgruppenkompatibil ität bei Erythrozytenspende
gegen den Rh-Faktor bildet. Wird sie erneut mit einem Rh-positiven Kind schwanger, können die lgG-Antikörper gegen das D-Antigen ungehindert die Plazentaschranke passieren und die JQndlichen Erythrozyten "angreifen". Es kommt beim Fetus zur Hämolyse und zum lebensbedrohlichen Krankheitsbild des Morbus haemolyticus neonatorum, gegen das ggf. noch intrauterin mittels einer Austauschtransfusion vorgegangen werden muss.
Transplantatabstoßung
Nach einer Organtransplantation kann es zu einer Abstoßungsreaktion des Immunsystems des Empfängers gegen das transplantierte Organ kommen ("host versus graft"). Dies versucht man durch eine höchstmögliche Übereinstimmung zwischen den MHC-Antigenen von Spender und Empfänger (s. Kap. I 08) und die Gabe von Immunsupressiva zu vermeiden. Nach allogenen Knochenmarks- oder Stammzelltransplantationen können gelegentlich auch Graft-versus-Host-Reaktionen beobachtet werden, bei denen sich die T-Lymphozyten aus dem Transplantat gegen den Empfängerorganismus richten.
Immunsuppressiva
Unter der Gruppe der Immunsuppressiva fasst man verschiedene immunmodulierende Medikamente zusammen die eine überschießende lmmunreak: tion verhindern sollen. Sie werden zur Therapie allergischer Reaktionen und Autoimmunerkrankungen und zur Prophylaxe von Transplantatabstoßungen
L Immunsystem ~~--------------------------------------------------~~~~~~ 110 I 111
eingesetzt. Der prominenteste Vertreter ist Kortison, das durch Hemmung der Lymphozytenproliferation immunsuppressiv wirkt. Andere Beispiele für Immunsuppressiva sind das Purinanalogon Azathioprin, das Folsäureanalogon Methotrexat und Antikörper gegen proinflammatorische Zytokine (sog. Biologicals), wie z. B. Rituximab (Anti-CD20 Antikörper).
Immunologische Testmethoden
In der klinischen Diagnostik hat man sich manche Eigenschaften unseres Immunsystems zunutze gemacht und verschiedene immunologische Nachweisverfahren entwickelt. Die meisten dieser serologischen Testmethoden basieren auf der Ausbildung von AntigenAntikörper-Komplexen und ermöglichen einen qualitativen und/ oder quantitativen Nachweis von Antikörpern im Blut. Man unterscheidet hierbei vor allem Agglutinationsmethoden, Immunpräzipitationsmethoden und enzymologisclle und radioimmunologische Tests.
Agglutinationsmethoden
Ein Agglutinat entsteht, wenn Antigentragende Zellen auf die entsprechenden Antikörper treffen und es daraufhin zu einer Verklumpungsreaktion kommt. Diese Verklumpung wird dann als Agglutinat bezeichnet. Der sog. Coombs-Test beruht auf der Ausbildung solcher Agglutinate. Er dient den Klinikern zum Nachweis spezieller Immunglobuline und basiert auf Antikörpern, die gegen die nachzuweisenden Immunglobuline gerichtet sind (Anti-Immunglobulin-Test). Er wird vor allem für den Nachweis von IgG-Antikörpern gegen Erythrozyten verwendet, z. B. zum Nachweis von Rh-Antikörpern der Mutter im Rahmen einer Rhesusinkompatibilitätsreaktion.
~ Der direkte Coombs-Test dient dem Nachweis (z . B. auf Erythrozyten) gebundener Antikörper aus Patientenblut mittels gelöster Antikörper aus einem Test-Serum, dem sog. CoombsSerum.
IJJ> Der indirekte Coombs-Test dient dem Nachweis von freien Antikörpern im Patientenserum mittels spezieller Testerythrozyten, die definierte Oberflächenmerkmale aufweisen, gegen die die nachzuweisenden Immunglobuline gerichtet sind.
Immunpräzipitation
Präzipitate sind unlösliche Komplexe, die entstehen, wenn Antigene und Antikörper in speziellen Lösungen aufeinandertreffen. Da es nur bei annähernd gleichen Konzentrationen der Antigene und Antikörper zu ausgeprägter Präzipitatbildung kommt, dient diese Methode nicht nur dem qualitativen, sondern auch dem quantitativen Nachweis von Antikörpern.
Enzymologische und radioimmunologische Tests
Auch diese Testverfahren, die sog. Absorbent Tests, dienen dem Nachweis spezifischer Antikörper. Die entsprechenden Antigene liegen bei all diesen Methoden fest an eine Oberfläche gebunden vor. Zwei wichtige Vertreter dieser Gruppe sind der Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) und der Radioimmunassay (RIA), die sich in ihrem Versuchsaufbau ähneln.
Zusammenfassung
EUSA und RIA lassen sich zur Diagnostik nahezu aller Infektionskrankheiten anwenden, so z. B. auch zum Nachweis einer HIV- oder Hepatitis-Infektion.
ELISA Das Antigen, gegen das die nachzuweisenden Antikörper gerichtet sind, ist fest auf einer Trägerplatte gebunden. Nach Hinzufügen von Patientenserum kommt es- falls die gesuchten Antikörper vorhanden sind - zur Ausbildung von Anti· gen-Antikörper-Komplexen. Als Nächstes gibt man Anti-Antikörper hinzu, die mittels eines Enzyms markiert sind und sich an die F,-Region der Serum-Antikörper anlagern. Um diese Immunkomplexe sichtbar zu machen, gibt man nun ein Substrat hinzu, das bei seiner Umsetzung durch das Enzym eine Farbreaktion hervorruft. Durch Photometrie kann diese Farbreaktion genau gemessen werden.
Radioimmunassay Der Versuchsaufbau gleicht dem ELISA, allerdings mit dem Unterschied, dass statt enzymmarkierter Antikörper radioaktiv-markierte Antikörper hinzugefügt werden. Durch Messung der Strahlungsaktivität der Antigen-AntikörperKomplexe können die gesuchten Antikörper bzw. Antigene qualitativ und quantitativ bestimmt werden.
• Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems
gegen ein ungefährliches Antigen (Allergen).
• Bei Autoimmunerkrankungen richtet sich das Immunsystem gegen körper
eigene Substanzen (Autoantigene).
• Bei Bluttransfusionen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die
Spender- und Empfängerblutgruppen kompatibel sind, da sonst gefährliche Unverträglichkeitsreaktionen auftreten können.
X Der Coombs-Test ist eine Agglutinationsmethode zum Nachweis von
Antikörpern, insbesondere gegen Erythrozyten.
• ELISA ist eine wichtige Nachweismethode für die meisten Infektionskrankheiten.
Blut- Grundlagen
Im Körper des Menschen zirkulieren ca. 4- 6 Liter Blut, was ungefähr 7- 8% seines Körpergewichtes ausmacht. Kleinere Blutverluste (bis ca. einem Liter) kann der Organismus ohne Schäden vertragen, ab einem Verlust von ca. 30% der Gesamtmenge wird es kritischer und es kann zu einem Volumenmangelschock mit all seinen Konsequenzen kommen. Verliert man 50% seiner Blutgesamtmenge oder mehr, geht dies ohne adäquate Therapie letal aus. Doch was genau ist der "Saft des Lebens" und wozu ist er überhaupt da?
Bestandteile
Das Blut setzt sich aus korpuskulären Bestandteilen, den Zellen, und aus Blutplasma zusammen. Letzteres besteht vorwiegend aus Wasser und enthält verschiedene Stoffe (s. u. ). Den Großteil des Blutzellvolumens machen mit 99% die roten Blutkörperchen (Erythrozyten ) aus. Andere Zellen, die im Blut herumschwimmen, sind Thrombozyten (Blutplättchen) und weiße Blutkörperchen (Leukozyten), die man noch weiter unterteilen kann (s. S. 1 02). Insgesamt machen die zellulären Bestandteile ca. 45% (Männer) bzw. 42% (Frauen) des gesamten Blutvolumens aus. Diesen Wert- also das Verhältnis der Blutzellen bzw. der Erythrozyten (um das Ganze zu vereinfachen) zum Gesamtblutvolumen- bezeichnet man als Hämatokrit.
Die zellulären Bestandteile des Blutes sind: Erythrozyten (ca. 5000000/ J,II), Leukozyten (ce. 7000/J.d) und Thrombozyten (ca. 300000/J.ll).
Funktionen
Eine der wohl wichtigsten Aufgaben des Blutes ist der Transport von Stoffen im Körper. Damit wird z. B. gewährleistet, dass der über die Lunge aufgenommene Sauerstoff alle Gewebe erreicht. Über den Transport von Hormonen und Zytokinen ermöglicht das Blut die Kommunikation zwischen den verschiedensten Zel len des Körpers. Andere Aufgaben sind z. B. die Verteilung von Nährstoffen oder die Elimination von Giftstoffen
durch Abtranspon zu den Ausscheidungsorganen. Auch für die Homöostase ist das Blut mit anderen Organen zusammen zuständig. Homöostase bedeutetdie Aufrechterhaltung bestmöglicher Bedingungen für die Funktion des Körpers, oder anders gesagt, die Erhaltung des Gleichgewichts. Darunter fallen Parameter wie Säure-Base-Haushalt, Wasserhaushalt, Körpertemperatur oder die Konzentration gelöster Stoffe, wie z. B. Glukose. Als "Träger" der Bestand teile des Immunsystems dient das Blut außerdem der lnfektabwehr. Es enthält Leukozyten, die Zellen des Immunsystems, aber auch andere Stoffe, die an der Abwehr beteiligt sind, wie Antikörper oder Komplementsystem.
Erythropoese
Die Zellen des Blutes entstehen alle im Knochenmark aus pluripotenten Vorläu-
ferzellen oder Stammzellen. Pluripotent bedeutet, dass diese Zellen dazu in der Lage sind, sich zu jeder Art von Blutzelle auszudifferenzieren. Welchen Weg die jeweilige Stammzelle einschlägt, wird durch Zytokine (lnterleukine, Erythropoetin usw.) reguliert. Eine Übersicht über die Hämatopoese der verschiedenen Zelltypen und deren stimulierende Faktoren gibt I Abbildung I. Die Entwicklung der Leukozyten wurde im Kapitel I 00 schon näher besprochen, daher beschränken wir uns in diesem Kapitel auf die Entwicklung der Erythrozyten. Die Entwicklung der roten Blu tkörperchen läuft über verschiedene Zwischenstufen ab. So entwickelt sich die myeloische Stammzelle zum Erythroblasten und über den Makroblasten und den Normoblasten zum Retikulozyten, der letzten Vorstufe des Erythrozyten. Die Retikulozyten befinden sich zum größten Teil noch im Knochenmark nur5-1 O%o der Erythrozyten im Bl~t
~ Pluripotente
~~~·=:"~· Lymphoide Stammzelle CFU-GEMM
~-TP-----. \.W) Epo l
leukopoese
Lymphozyt
B-Zelle T-Zelle
Spezifische Abwehr
Basophiler Makrophage Neutrophiler Eosinophiler G1anulozyt Granulozyt Granulozyt
·r-: ( o0o~'
Oo
Unspeziflsche Abwehr Mithilfe bei der Abwehr
CFU-CM = Kolonie bildende Einheit der Granulozyten-/Makrophagen-Reihe
CFU-Eo = Kolonie bildende Einheit der Eosinophilen-Reihe
l Erythropoese
Proerythroblast
Ci) + Erythroblast
t Retikulozyt
+ Erythrozyt
• 0~-Transport
CFU-GEMM = Kolonie bildende Einheit für Granulozyten, Eosinophile, Monozyten und Makrophagen
CFU-B = Kolonie bildende Einheit der Basophilen-Reihe GM-CSF = Kolonie stimulierender Faktor der Cranulozyten/Makrophagenreihe
G·CSF = Kolonie stimulierender Faktor der Granulozyten-Reihe
M-CSF = Kolonie stimulierender Faktor der Makrophagen-Reihe
Epo = Erythropoetin
TP = Th rombopoetin
I Abb. 1: Hämatopoese [ 14(
Thrombopoese
Megakaryoblast
(j) + Megakaryozyt
(j t
Thrombozyten
~(fo ~ ® fJ' <:foq(foq
Blutgerinnung
sind unreife Retikulozyten. Der Anteil kann sich jedoch beim akuten Mangel an roten Blutkörperchen, z. B. nach starkem Blutverlust, erhöhen. Retikula· zyten haben keinen Zellkern mehr, son· dern lediglich kleine Reste an RNA, die ihnen das netzartige Aussehen geben. Für die Ausreifung der Stammzelle zum Erythrozyten wird Erythropoietin (EPO) benötigt, ein Hormon, das in den Nieren und geringfügig auch in der Leber synthetisiert wird . Es stimuliert und reguliert die Erythropoese und wird bei sinkendem Sauerstoff· Partialdruck vermehrt ausgeschüttet. Diese Tatsache wird von Leistungssportlern oft ausgenutzt, die sich vor Wettbewerben einem Höhentraining unterziehen, denn in großer Höhen herrscht ein niedrigerer 0 2-Partialdruck. Dadurch steigt der EPO-Spiegel an und die Eryhropoese nimmt zu. Mehr Erythrozyten können mehr Hämoglobin (und damit mehr Sauerstoff!) transportieren, was im Ausdauerspart natürlich zu Vorteilen führt.
Blutplasma
Das Blutplasma macht in etwa 55% des Gesamtblutvolumens aus. Im Blutplasma ist neben zahlreichen anderen gelösten Stoffen auch Fibrinogen enthalten. Nimmt man das Fibrinogen heraus, z. B. indem es bei der Blutgerinnung verbraucht wird, bleibt das Blutserum übrig. Blutserum ist also Blutplasma ohne Fibrinogen. Im Plasma sind noch zahlreiche andere Stoffe enthalten, wir beschränken uns hier aber auf die wichtigsten Inhaltsstoffe.
Plasmaproteine Im Blutserum sind insgesamt ca. 6-8 g/ dl Proteine enthalten. Diese sind mit Ausnahme des Albumins so gut wie alle Glykoproteine. Mittels Elektrophorese lassen sich die Plasmaproteine in fünf Fraktionen aufteilen (I Tab. 1 ).
Blut 112 I 113
Fraktion Anteil am Gesamtprotein Beispiele
~--------------------------~ Albumin 55 - 70%
a ,-Giobu lin 2-5% Antitrypsin, HDL, Prothrombin, Transkortin
a 2- Giobulin 5-10% Caeru loplasmin, Antithrombin 111, Haptoglobin, Plasminogen,
Makroglobu lin, Cholin-Esterase
ß-G iobulin 10- 15% LDL, Transferrin, Fibrinogen , C-reaktives Protein
-y-Giobul in 12-20% Immunglobuline (lgG, lgA, lgM, lgD, lgE)
I Tab. 1: Plasmaprote infraktionen
Die Verteilung der Plasmaproteine weist ein spezielles Muster auf, das beim Gesunden konstant ist und bei verschiedenen Erkrankungen abweichen kann, wie z. B. bei Immunglobulin-produzierenden Tumoren oder akuten Entzündungen (s. auch Kap. 138].
~ Die Albumine sind mit einem Molekülgewicht von ca. 68 000 Dalton die kleinsten Plasmaproteine, machen aber mengenmäßig den größten Anteil aus (ca. 60%). Proalbumin wird in der Leber gebildet und anschließend durch limitierte Proteolyse in Albumin umgewandelt. Albumin ist der wichtigste regulierende Faktor des kolloidosmotischen Drucks. Außerdem ist es ein Vehikelprotein, das verschiedene Stoffe bindet und auf diese Weise transportiert (z. B. freie Fettsäuren, Vit. B12, Bilirubin, Cholesterin, Steroidhormone, Thyroxin, Pharmaka usw.). ~ Hydrophobe Substanzen werden im Plasma an Lipoproteine gebunden transportiert. Die wichtigsten Lipoproteine sind die Chylomikronen, VLDL, LDL und HOL (s. Kap. 74).
Zusammenfassung
Plasmaenzyme Beim Gesunden tauchen im Blutplasma nur einige Enzyme auf, die von der Leber bzw. dem Pankreas ins Blutplasma sezerniert werden. Dies sind die Enzyme der Blutgerinnung, die Leci· thin-Cholesterin-Acyl-Transferase (LCAT), die Lipoproteinlipase, die a-Amylase und die Pseudocholinesterase. Andere im Plasma auftauchende Enzyme deuten auf eine Organschädigung hin, da sie nur bei Zelluntergang ins Plasma gelangen können. Man misst solche Enzyme zu diagnostischen Zwecken (z. B. GOT und GPT bei Verdacht auf Leberschäden oder die Lactatdehydrogenase (LOH) beim Herzinfarkt).
Niedermolekulare Bestandteile Weiterhin im Blutplasma enthalten sind verschiedenste niedermolekulare Bestandteile, wie die Stickstoffhaitigen Verbindungen Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin und freie Aminosäuren, sowie Glukose (70- 1 00 mg/dl), Cholesterin ( 150- 220 mg/dl], Triacylglycerine (bis 172 mg/dl), Elektrolyte (Na+, K+, Ca2+
usw. ) und Spurenelemente, wie z. B. Eisen (13,4-31 ,3 mmol/1].
• Das Blut setzt sich aus einem zellulären Anteil (Erythrozyten, Leukozyten,
Thrombozyten) und dem Blutplasma zusammen.
ac Die Funktionen des Blutes sind unter anderem Stofftransport, Homöostase
und lnfektabwehr.
• Blutzellen werden im Knochenmark aus pluripotenten Stammzellen
gebildet. Ein wichtiger Stimulator für die Bildung von Erythrozyten ist
das Erythropoetin.
• Das Blutplasma enthält neben seinen Plasmaproteinen (z. B. Albumin),
auch Enzyme und niedermolekulare Bestandteile.
Hämoglobin I
Das Hämoglobin (Hb) als Hauptbestandteil der Erythrozyten dient in erster Linie dem Sauerstofftransport im Blut, aber auch dem Transport von C02,
das am Hämoglobin gebunden zur Lunge transportiert wird, wo es schließlich abgea tmet werden kann. Außerdem ist Hämoglobin als Pu ffe rsystem an der Regulation des pH-Wertes beteiligt, und verleiht unserem Blut zu guter Letzt auch seine Farbe ("roter BI utfarbstoff") .
Struktur und Eigenschaften
Ein Hämoglobinmolekül besteht aus vier Untereinheiten, die jeweils aus einem Hämmolekül und einem Protein· antei l, dem Globin, aufgebaut sind . Der Zusammenhalt des Moleküls wird durch hydrophobe und ionische Wechselwirkungen und durch Wasserstoffbrückenbindungen gewährleistet.
~ Häm: Das Häm-Molekül ist die prosthetische Gruppe des Hämoglobins und macht den Sauerstofftransport überhaupt erst möglich. Es ist chemisch gesehen ein Porphyrin , und dementsprechend aus vier Pyrrolringen aufgebaut, die über Methinbrücken (= CH-) miteinander verbunden sind (= Porphy· rinogen). Durch Modifikation der Pyrrolringe, wie dem Ersatz der Wasserstoffatome durch Seitenketten, erhält man verschiedene Porphyrinderivate, so z. B. auch das Häm-Molekül (I Abb. 1 ). Im Zentrum trägt das Häm an seine Stickstoffe gebunden ein Eisen-Ion (Fe2• ). Das Fe2+ verfügt über sechs Koordi nationsstellen, über die es binden kann. Vier davon werden durch die Stickstoffe der Pyrrolringe blockiert, eins dient der Bindung ans Globin , und das letzte steht der Sauerstoffbindu ng zur Verfügung. ~ Globin: Bindet ein Häm-Molekül an einen Proteinanteil (Globin), so entstehen Hämoproteine, zu denen neben dem Hämoglobin auch das Myoglobin gehört. Das Globin ist eine Polypeptidkette, die über einen Histidinrest kovalent ans zentrale Eisen-Ion des Häms gebunden wird. Vier verschiedene Arten dieser Polypeptidketten (a-, ß-, y- und 8-Kette) können im Hämoglobin vor-
CH,
HOOC COOH
I Abb. 1: Porphyrin (oben) und sei n Derivat Häm
(unten)
kommen. Dabei enthalten immer zwei der vier Untereinheiten des Hämoglobins eine Polypeptidkette vom gleichen Typ.
Hämoglobinarten
Im Blut des Erwachsenen kommen zwei ve rschiedene Hämoglobinarten vo r:
~ Zum einen Hb A1 (A fü r "Adult" ), das aus zwei a- und zwei ß-Ketten aufgebaut ist (a2f32) und mit 98% den Großteil des Gesamthämoglobins ausmacht, ~ Zum anderen Hb A2 , das zwei a ·Ket· ten und zwei 8- Ketten enthä lt (a2o2).
Es gibt noch ein anderes Hämoglobin, das Hb F, das aber nur im fetalen Blut vorkommt. Es besteht aus zwei a - und zwei y-Ketten (a2y2), und macht I 00% des fetalen Hämoglobins aus. Das Hb F hat eine höhere Affinität zum Sauerstoff als das adulte Hämoglobin, d. h. es zieht den Sauerstoff stärker an, als Hb A. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass das Ungeborene seinen Sauerstoff aus dem mütterlichen Blut bezieht. Die hohe Affini tät bewirkt, dass das fetale Hämoglobin dem Hämoglobin der Mutter den Sauersto ff abnehmen kann . Nach der Geburt wird das Hämoglobin nach und nach ausgewechselt, bis der Säugli ng nach wenigen Lebensmonaten nur noch Hb A produz iert.
Hämoglobinsynthese
Hämoglobin wird vor allem von den Vorläuferzellen der Erythrozyten im Knochenmark gebildet. Einen kleinen Teil des Hämoglobi ns synthetisiert die Leber. Während das Globin wie bei Proteinen übl ich, an den Ribosomen gebildet wird , ist die Biosynthese des Häms etwas kompl izierter. Sie spielt sich zum Teil in den Mitochondrien und zum Teil im Zytoplasma ab. Es ist nicht so wichtig, alle Einzelschritte der Hämbiosynthese (I Abb. 2) zu kennen. Im Folgenden beschränken wir uns nur auf die wichtigsten Reaktionen . Man sollte aber die Ausgangssubstanzen kennen und wissen, wo sich die Synthese abspielt.
~ Im ersten Schri tt reagieren die Ausgangssubstanzen Succinyi-CoA und Giycin zu o-Aminolävulinsäure (o-ALS). Succinyi-CoA ist Zwischenprodukt des Citratzyklus, daher kann diese Reaktion nur im Mitochondrium ablaufen. Das kata lysierende Enzym ist hierbei die o-ALS-Synthetase, die fü r die Decarboxylierung Pyridoxalphosphat (PALP) als Coenzym benötigt.
Die A~ynthetase lat zym der Hlmbiosyntheae . .... v ~ .. ,~ ..
wird reguliert durch Hlm, Ihre Expresston und BIOlsynj:IJo i-:il alloeterlsch Ihre
~ Die nächsten Schritte spielen sich im Zytoplasma ab. Zunächst kondensieren zwei o-ALS zu einem Molekül Porphobilinogen, was durch die o-ALS- Dehydratase katalysiert wird. Das Po rphobilinogen enthält bereits einen Pyrrolring. ~ Vier Moleküle Porphobilinogen vereinigen sich dann zu Uroporphyrinogen 111 mit seinem für Porphyrine typischen Tetrapyrro lring. Als Zwischenschritt entsteht dabei allerdings zunächst Uroporphyrinogen I, das anschließend durch eine Isomerase zum physiologisch wirksa men Typ 11 1 umgewandelt wird. ~ Durch Decarboxylierung der Acetatgruppen zu Methylgruppen entsteht nun Coproporphyrinogen lll, das anschlie-
ßend ins Mitochondrium transportiert und dort mehrfach oxidiert wird. 111- Die Ferrochelatase baut zuletzt das Eisenatom in das entstandene Protoporphyrin ein und das Häm ist fertig. 111- Das Häm gelangt nun wieder ins Zytoplasma, wo es mit dem Globin verbunden wird. So entsteht endlich unser Hämoglobin.
Ein Funktionsverlust oder Mangel eines der Enzyme der Hirnbiosynthese fllhrt zu Störungen der Porphyrinsynthese mit Anreicherung der Synthesestufen. Die Vorstufen lagem sich in verschiedenen Organen ab, was die Symptome der sog. Porphyrie verursacht. Dies filhrt z. B. zu einer Lichtempfindlichkelt der Haut, die mit Blasenbildung und schweren Nekrosen einhergeht, sowie zu neurologischen Symptomen.
COOH I CH2 I CH2 I C=O I s I CoA
Succinyi-CoA
COOH I
+ H2N-CH2
Glycin
Uroporphyrinogen 111
Abbau des Hämoglobins
Der Abbau des bei Hämolyse oder nach Erythrozytenmauserung frei werdenden Hämoglobins beginnt im mononukleären Phagozytensystem (MPS) von Milz, Leber und Knochenmark und setzt sich in der Leber for t. Um an seine Abbauorte zu gelangen, wird das Hämoglobin an Haptoglobin gebunden im Blut transportiert. Als Erstes werden die Häm- und Globinanteile voneinander getrennt, wobei Letztere zu Aminosäuren gespalten werden, die anschließend wiederverwertet werden können. Häm dagegen muss in mehreren Schritten abgebaut werden, da es nicht wiederverwertbar ist.
ö-Aminolaevulinsäure 2 X
I ö-ALS-Dehydratase I J
R2 Desaminase + Isomerase
COOH I
COOH CH2 I I
4< J-f'
R1 = - CH2-COOH R2 = -CH2- CH2-COOH
J I Decarboxylase I Coproporphyrinogen 111 - Protoporphyrin
I Abb. 2: Hämsynthese
H2r N
NH2 H
Porphobilinogen
I Ferrochelatase I
Blut 114 I 115
Hämabbau 111- Im MPS spaltet die Häm-Oxygenase Cytochrom P450-abhängig den Rlng des Hämoglobins, wobei 0 2 und NADPH/ H+ verbraucht werden. Daraus entsteht Biliverdin, und Kohlenmonoxid (CO] und FeZ+ werden frei. 111- Biliverdin wird anschließend durch Reduktion (Enzym: Biliverdin-Reduktase, Coenzym: NADPH/ H•] zum indirekten Bilirubin, das aufgrund seiner schlechten Wasserlöslichkeit an Albu· min gebunden zur Leber transportiert werden muss. 111- In den Hepatozyten erfolgt nun die Koppelung des indirekten Bilirubins an zwei Moleküle aktivierter Glukuronsäure (UDP-Glukuronsäure) . Enzym ist hierbei die Glukuronyl-Transferase, und das Produkt nennt man Bilirubin· glukuronid, bzw. direktes Bilirubin. Die Konjugation hat den Sinn, das Bilirubin wasserlöslicher zu machen, damit es über die Galle ausgeschieden werden kann.
Ausscheidung des Bilirubins Das konjugierte Bilirubin wird von den Leberzellen über einen aktiven Transport in die Galle abgegeben. Im Darm angelangt, spaltet die bakterielle Glukuronidase die Glukuronsäure wieder ab, und das freie Bilirubin wird anschließend zu Urobilinogen und zu Stercobilinogen reduziert. Bei Anwesen· heit von Sauerstoff oxidieren diese anschließend zu Stercobilin und Urobilin, die unserem Stuhl seine braune Farbe geben.
Hämoglobin II
Sauerstofftransport
und Speicherung
Die Hauptfunktion des Hämoglobins
(Hb) liegt in dem Transport von Sauer
stoff im Blut Dazu kann jedes Hb-Mole
kül bis zu vier Sauerstoffmoleküle bin
den. Man nennt es in diesem "bela
denen Zustand" Oxyhämoglobin
(HbOJ
Bindungsverhalten
des Hämoglobins Wichtig zu wissen ist, dass es sich
bei der Sauerstoffbindung um eine
Oxygenierung und nicht um eine
Oxidation handelt Der Unterschied
dabei ist, dass sich bei der Oxygenie
rung die Wertigkeit des Eisens (Fe2+)
nicht ändert, während eine Oxidation
zur Bildung von funktionslosem
Methämoglobin (s. u.) führt, dessen
Eisenatom dreiwertig ist
Man beobachtet bei der 0 2-Bindung
durch Hämoglobin ein sog. koopera
tives Bindungsverhalten. Durch
Anlagerung eines Sauerstoffmoleküls
ändert das Hb seine Konformation,
wodurch sich die Affinitä t zum Sauer
stoff erhöht und die Bindung weiterer
Sauerstoffmoleküle erleichtert wird.
Damit wird die 0 2-Bindung umso
leichter, je mehr Sauerstoffmoleküle
bereits am Hämoglobin gebunden
sind. Diese Kooperativität führt zu
einem sigmoidalen Verlauf der Sauer
stoffbindungskurve des Hämoglobins,
Sa01 (%)
100
90
80
70
60
so
40
30
20
10
Unlcmnchlebung bel: Alblose. J. peo,. J. Temp., + 2,3-81'G, f1Uiem Hb
Normal
Rechtsverschiebung bei: Azldo5e, t pC02,
t Temp., t 2,3-BPG
0 -JL-..,-..,--,---,---,-----,---,-- ,---,---,--
0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 p01
(mmHg)
I Abb. 3: Sauers toffbi ndungskurve (normal,
bei Links- und bei Rechtsverschiebung) 11 51
die zudem einen Sättigungscharak ter
aufweist, d. h. sie flacht wieder ab,
wenn das Hb voll mit 0 2 beladen ist
(I Abb. 3).
Verschiebung der
Sauerstoffbindungskurve Verschiedene Einflussfaktoren führen zu
einer Rechts- bzw. Linksverschiebung
der 0 2-Bindungskurve. Eine Rechts
verschiebung bedeutet eine Abnahme
der Affinität des Hämoglobins zum Sau
erstoff, d. h. der Sauerstoff wird leichter
abgegeben. Eine Linksverschiebung
dagegen bewirkt eine Zunahme der
Affinitä t, folglich wird der Sauerstoff
nur erschwert abgegeben bzw. leichter
aufgenommen.
Zu einer Rechtsversch iebung führen:
llJ>- eine Abnahme des pH-Wertes,
"" eine Zunahme der C02-Konzen
tration, llJ>- Temperaturansti ege und
"" eine Erhöhung der 2,3-BPG-Konzen
tration.
Damit es zu einer Linksverschiebung
kommt, verhalten sich die Einflussfak
toren genau umgekehrt.
Als Bohr-Effekt bezeichnet man den
Einfluss von pH-Wert und C02-Konzent
ration auf die 0 2-Affinität. Er erleichtert
die 0 2-Aufnahme in der Lunge und die
Abgabe im Gewebe.
Sauerstoffspeicher Myoglobin
Das in den Muskelze llen vorkom
mende Myoglobin ist ebenfalls ein
Hämoprotein, besteht aber im Unter
schied zum Hämoglobin aus nur einem
Häm und kann daher insgesamt nur
ein 0 2-Molekü l aufnehmen. ine
0 2-Affinität ist sechs Mal höher als di
des Hämoglobins, was dazu führt, dass
es seinen Sa uersto ff nur bei ehr ni d
rigen 0 2-Partialdrücken abgibt. Di se
Eigenschaft verleiht dem Myoglobin
eine Funktion als 2- peicher.
C0 2-Transport
Das C02 wird auf drei verschiedenen
Wegen im Blut transportiert:
lll>- 80% davon gelangen als Bicarbonat
lonen (HC03 ) an ihren Bestimmungs
ort. Um als HC03- transportiert werden
ZU können, Wird das C02 zunächst im
Erythrozyten durch die Carboanhy
drase zur Kohlensäure hydriert, die
anschließend in HC03- und H+ disso
ziiert. Im Austausch gegen ein Cl--Ion
gelangt ein HC03 aus dem Erythrozy:
ten. In der Lunge ge langt das Bicarbonat
wiederum im Austausch gegen CJ- in
den Erythrozyten, wo die Carboan
hydrase die Rückverwandlung in CO
katalysiert. Dieses kan n den Erythro-2
zyten ungehinderr verlassen und ab
geatmet werden. Die Gleichung der
Carboanhydrasereaktion lautet:
H20 + C02 ~ HzC03 (dieses dissoziiert spontan in HC03- und H~ j .
lll>- I 0% werden an Hämoglobin gebun
den transportiert {HbC02). Unter Bil
dung von Carbaminohämoglobin
wird C02 am Hämoglobin gebunden
im Erythrozyten transportiert. Die Bin
dungsstelle ist hierbei eine andere als
die für den Sauerstoff! Kohlendioxid
bindet nicht an das zentrale Eisenatom
der Globinketten, sondern kovalent an
deren NH2-Gruppen (aminoterminales Ende).
lll>- I 0% des C02 werden in physikalisch
gelöster Form im Blut zur Lunge transportiert.
Da C02 ein Abfallprodukt des Stoff
wech sels ist, wird es zur Elimination
zu r Lunge transportiert, wo es abge
atmet werden kann.
Pathologie des Hämoglobins
Inaktive Zustandsformen
des Hämoglobins
lll>- Normalerweis ist das am Häm ge
bund ne Eisen zweiwenig ( Fe2; ). Wird
s ab r zu F ' oxidl rt, so ist das Hä
moglobin nicht mehr in der Lage, Sauer
stoff zu tran porti r n. Dies Zustands
form h ißt M ethämoglobin (MetHb).
V rstärkt M thämo loblnsynthese tritt
bei verschiedenen Vergiftungen auf, wie z. B. durch Oxidationsmittel, Nitri te oder H20 2• Therapiert werden diese durch Gabe von Reduktionsmitteln. .,. Kohlenmonoxid (CO] hat am Hämo· globin die gleiche Bind ungsstelle wie Sauerstoff, allerd ings ist seine Affinität ca. 300-malso hoch wie die des Sauer· stoffs, der dadurch aus der Bindung verdrängt wird. Die Bildung von HbCO schränkt den 0 2-Transport daher we· sentlich ein, was eine Kohlenmonoxid· vergiftung lebensbedrohlich macht. Durch Überdruckbeatmung mit reinem 0 2 kann diese therapiert werden.
Hämoglobinopathien Hämoglobinopathien sind genetische Er· krankungen, die mit einer fehlerhaften oder unzureichenden Hämoglobinsyn· these einhergehen. Die Sichelzellanämie beruht auf einer fehlerhaften Synthese des Globins, in dessen ß-Kette eine falsche Aminosäure eingebaut wird (Valin statt Glutamat]. Dies führt zur Bi ld ung von Sichelzellhämoglobin (Hb S), das im unbeladenen Zustand (ohne 0 2] eine geringere Löslichkeit aufweist als das normale Hb. Das Hb S fällt intrazellulär aus, wodurch sich die Erythrozyten sichelartig verformen. So kommt es zu Gefäßverschlüssen und infolge eines verstärkten Erythrozytenabbaus zu einer Anämie. Bei der v. a. im Mittelmeerraum vorkommende Thalassämie besteht eine Störung der Synthese der a - oder der ß-Ketten des Hämoglobins. Da ein Mangel der entsprechenden Kettenart besteht, greift der Körper bei der HbSynthese stattdessen auf andere Ketten zurück, wobei vermehrt Hb Fu nd Hb A2 entstehen. Allerdings können diese physiologisch nur in geringeren Mengen produziert werden. Es entwickelt sich eine mikrozytäre, hypochrome Anämie.
Eisenstoffwechsel
An dieser Stelle machen wir einen kleinen Exkurs zum EisenstoffwechseL Eisen ist als Zentralatom der Porphyrine, wie Hämoglobi n, Myoglob in und der Cytochrome, maßgeblich am Sauerstoff· und Elektronentransport beteiligt. Außerdem ist es Bestandtei l von chwe-
fei·Eisen-Komplexen, die in der Atmungskette eine große Rolle spielen. Der Mensch nimmt täglich etwa 10-20 mg Eisen über die Nahrung zu sich, von denen allerdings nur 10% (bei Eisenmangel bis zu 40%] im Dünndarm resorbiert werden. Also nehmen wir täglich ca. 1 mg Eisen aus der Nahrung (Gemüse, Getreideprodukte, Leber) auf, der Gesamtkörperbestand beträgt ca. 3-5 g.
.,. Eisenresorption: Das in der Nah· rung enthaltene Eisen ist meist dreiwertig (Fe3+) . Da es in dieser Form schlecht resorbierbar ist, wird es zunächst im Duodenum reduziert, wobei das besser resorbierbare Fe2+ entsteht. Vitamin C und SH-Gruppen-haltige Aminosäuren (z. B. Cystein) fördern die Reduktion. ln den Mukosazellen des Darms wird Fe2+ durch Caeruloplasmin gleich wie· der zu Fe3+ oxidiert. .,. Eisentransport: Eisen wird an Transferrin gebunden im Blut trans· portiert. Dazu binden die Fe3+-Ionen an Apotransferrin, wobei Transferrin, ein Glykoprotein, das in der Leber gebildet wird, entsteht. .,. Speicherung von Eisen: Vom Gesamtkörpereisen sind über 60% in Hämoglobin, 4,5 % in Myoglobin und 2% in Enzymen gebunden. Ca. 20% liegen in den Zellen der Leber, des Kno-
Zusammenfassung
Blut 116 I 117
chenmarks und des mononukleären Phagozytensystems als Speichereisen an Proteine gebunden vor. Die Hauptspeicherform ist das Ferritin. Ist der Ferritinspeicher voll, so wird das Eisen auch an Hämosiderin gebunden. .,. Eisenausscheidung: Der menschliche Organismus ist nicht in der Lage, größere Mengen an Eisen auszuscheiden, die tägliche Ausscheidungsrate beträgt nur ca. I mg. Daher eignet sich die Eisenausscheidung nicht zur Regulation des Eisenangebots .
Bei Eisenmangel, z. B. infolge mangelnder Aufnahme oder bei chronischen Blutungen (z . B. aus einem Magengeschwür), greift der Körper zunächst auf seine Eisenreserven zurück. Sind diese erschöpft, kann nicht mehr genügend Hb hergestellt werden, und es kommt zu einer Eisenmangelanämie mit mikrozytären, hypochromen Erythrozyten . Bei der Hämosiderose dagegen wird zuviel Eisen im Dünndarm resorbiert. Dies führt zum Eisenüberschuss mit Hämosiderinablagerungen in verschiedenen Organen, insbesondere in Leber, Pankreas und Herz, was mit Leberzir· rhose, Diabetes mellitus oder Herzinsuf· fizienz einhergehen kann. Zur Therapie werden die Patienten auch heute noch regelmäßig zur Ader gelassen.
ac Hämoglobin besteht aus vier Untereinheiten, die jeweils einen Proteinanteil und ein Hämmolekül enthalten.
ac Die Hauptaufgabe des Hämoglobins ist der Sauerstofftransport 0 2 wird dafür an die zentralen Eisenatome der vier Hämmoleküle gebunden.
ac Beim Abbau von Hämoglobin entsteht indirektes Bilirubin, das anschließend in der Leber zu direktem Bilirubin konjugiert wird. Dieses kann über die Galle ausgeschieden werden.
ac Die Affinität des Hämoglobins zum Sauerstoff spiegelt sich in der Sauerstoffbindungskurve wider. Diese wird durch verschiedene Faktoren wie z. 8. pH-Wert oder C02-Konzentration beeinflusst.
ac Die Funktion des Hämoglobins kann gestört sein, wenn seine Zustandsform geändert wird, z. B. infolge von Oxidation des zentralen Eisens oder Bindung von Kohlenmonoxid.
Erythrozyten
Die Erythrozyten machen den größten Anteil des Blutzellvolumens aus [99 %). Dabei handelt es sich bei Erythrozyten gar nicht um richtige Zellen, denn sie verlieren im Laufe ih rer Entwicklung [Erythropoese, s. Kap. 11 2) fast alle Zell· organellen, unter anderem auch ihren Zellkern. Dieser Verlust schmerzt den Erythrozyten allerdings wenig, da auf diese Weise mehr Platz für den Transport von Hämoglobin gewinnt. Das Hämoglobin benötigt er für die Wah r· nehmung seiner Aufgaben: den Sauer· Stofftransport und die Blutpufferung.
Eigenschaften der Erythrozyten
Der Mensch besitzt in einem ~tl Blut ca. 4,5- 5 x I 0" Erythrozyten, wobei der Wert bei Frauen meist ervvas gerin· ger ist als bei Männern. Wie schon erwähnt, verlieren die Erythrozyten während der Erythropoese ihren Zellkern sowie ihre Mitochondrien, Ribosomen und ihr endoplasmatisches Retikulum. Das hat zur Folge, dass dem Erythrozyten alle Stoffwechselwege, die sich in diesen Zellorganellen abspielen, fehlen. Demnach ist die einzige Methode, über die er Energie gewinnen kann , die anaerobe Glykolyse, was den Vorteil hat, dass der Erythrozyt nicht selbst seinen transportierten Sauerstoff verbraucht. Schließlich soll er ja die 0 2-Versorgung des peripheren Gewebes gewährleisten. Ein Erythrozyt ist nicht zur Teilung be· fähigt, da er keine Nukleinsäuren und keine Proteine herstellen kann. Seine Überlebenszeit beträgt 120 Tage, da· nach wird er durch die Milz aus dem Blu tkreislauf aussortiert (Erythrozytenmauserung).
Erythrozytenstoffwechsel
Durch den Verlust seiner Zellorganellen bleiben dem Erythrozyten nur die zyto· plasmatischen Stoffwechselwege Glykolyse und Pentosephosphatweg erhalten.
Glykolyse
Die anaerobe lykolyse stell t die einzige Möglichkeit dar, wie der Erythrozyt an Energie (ATP) gelangen kann. Das ATP
benötigt er im Wesentlichen für drei Vorgänge. Einerseits muss er se in inneres Ionenmilieu aufrechterhalten , was durch die Energie verbrauchende Na+/ K+·ATPase erreicht wird. Weiterhin benötigt er das ATP für die Glutathionsynthese und zur Erhaltung seiner Zell form. Die Glykolyse läuft beim Erythrozyten etwas anders ab, als in anderen Zellen . Der Erythrozyt geht dabei einen kleinen Zwischenschritt über 2,3-Bisphosphoglycerat (2,3-BPG).
Bildung von
2,3-Bisphosphoglycerat Normalerweise beinhaltet ein Schritt der Glykolyse die Umwandlung von I ,3-Bisphosphoglycerat [I ,3-BPG) zu 3-Phosphoglycerat, wobei bei der Spaltung der energiereichen Säureanhydridbindung des I ,3-Bisphosphoglycerats ein ATP-Molekül entsteht. Diese Reaktion der Glykolyse wird in Erythrozyten jedoch zum Teil umgangen. Stattdessen wird hier die energiereiche Säureanhyd· ridbindung in eine energieärmere Esterbindung umgewandelt, wobei 2,3-Bis· phosphoglycerat entsteht [I Abb. I). Bei der Reaktion von 2,3-BPG zu 3-Phosphoglyerat wird nicht genügend Energie frei , als dass ein ATP gebildet
Glykolyse
/o'-- _ II _ _ 10-P-0~ h Ol - I - ' c '
101 I - - H- C- OH
I H- e-®
I H
1 ,3-Bisphosphoglycerat
BisphosphoglyceratMutase
werden könnte. Damit geht dem Erythrozyten durch diesen Umweg ein Energieäquivalent verloren.
Bel der erythrozytären Glykolyse werden 20% des 1,3-Bisphoaphoglycerats zu 2,3-Biaphosphogtycerat umgewandelt. Ober diesen alternativen Weg kann der Erythrozyt statt 2 Mol ATP nur 1 Mol ATP pro Mol Glukose gewinnen.
Funktionen des
2,3-Bisophosphoglycerats Man könnte meinen, dieser Umweg über das 2,3-Bisphosphoglycerat sei sinnlos, denn immerhin geht dem Erythrozyten dabei Energie verlore n. Doch hin ter diesem Zwischenschritt steckt ein höherer Sinn: Das 2,3-BPG nimmt Ei nfluss auf die Sauerstoffaffinität des Hämoglobins. Es bindet an die ß-Kette des sauerstofffreien Hämoglobins (Desoxy- Hb) und blockiert dadurch dessen Sauerstoffaufnahme (a llosterische Inhibition ). Die Bereitschaft zur Sauerstoffbindung sinkt also, oder anders gesagt: Die Sauerstoffaffinität des Hämoglobins nimmt ab. Dadurch wird die Sauerstoffabgabe ans Gewebe erleichtert. 2,3-BPG bindet nur an Desoxy-Hb, daher wird es umso mehr verbraucht je mehr Desoxy-Hb in einem Geweb~ vorkommt. Besteht also in einem Gewebe 0 2-Mangel, so wird 2,3-BPG ver
mehrt verbraucht und gleichzeitig seine Produktion angekurbelt. Dies erleichtert wiederum die Sauerstoffabgabe ins Gewebe und führt dort zu einem Aus-
Ester
coo - /<5' I _ II _ _
H- C- O - P- 01 I - I -
H- C-® IQI_ I H ADP~
@ I 3-Phosphoglycerat-Kinase I 2,3-Bisphosphoglycerat
3-Phosphoglycerat
coo-l
H- C- OH I
H- e-® I H
I Abb. I : Bildung von 2,3-ßisphospho
glyc rat Über die anaerobe Glyko lyse
gleich des 0 2-Mangels. Der Sauerstoffbedarf eines Gewebes hat also einen Einfluss darauf, ob ein Erythrozyt den Weg der klassischen Glykolyse einschlägt oder den Umweg über das 2,3-Bisphosphoglycerat wählt
Pentosephosphatweg
Die entscheidende Aufgabe des Pentosephosphatwegs im Stoffwechsel des Erythrozyten besteht in der Bildung von NADPH/ H+_ Dieses wird für die Regeneration von Glutathion (s_ u.) dringend benötigt, und die einzige Quelle, die den Erythrozyten dafür zur Verfügung steht, ist der Pentosephosphatweg. Das am Ende des Pentosephophatweges entstehende Fruktose-6-Phosphat kann bei NADPH/ H+-Bedarf anschließend in Glukose-6-Phosphat umgewandelt und erneut in den Pentosephosphatweg eingeschleust werden. Dadurch entsteht eine Art Kreislauf, der eine ausreichende Versorgung des Erythrozyten mit NADPH/ H+ gewährleistet Ist genügend NADPH/ H' im Erythrozyten vorhanden, so wird Fruktose-6-Phosphat direkt in die Glykolyse eingeschleust und für die ATP-Synthese verwendet
Schutz der Erythrozyten vor Oxidation
Kommt eine Zelle mit Sauerstoff in Kontakt, so besteht die Gefahr, dass oxidierende Substanzen (H20 2, Sauerstoffradikale) entstehen. Diese sind sehr reaktionsfreudig, sie können Zellbestandteile (Zellmembran, Proteine usw.) schädigen und sogar den Untergang der Zelle hervorrufen. Erythrozyten sind besonders gefährdet, da sie bekanntlich Sauerstoff transportieren und ihm daher ständig ausgesetz t sind. Glutathion ist das wichtigste Antioxidans des Erythrozyten und schützt ihn in Zusammenarbeit mit anderen Enzymen vor den schädigenden Wirkungen des Sauerstoffs.
Rolle des Glutathions
Das Glutathion ist ein Tripeptid, das aus den Aminosäuren Glu tamat, Cystein und Glycin aufgebaut ist. Seine Synthese ist ATP-abhängig und spielt sich
im Zytoplasma ab, wo die Aminosäuren miteinander verknüpft werden. Glutathion ist ein Antioxidans, es schützt also die Bestandteile des Erythrozyten (Enzyme, Zellmembran, Hb) vor Oxidation, indem es sie nach unfreiwilliger Oxidation wieder reduziert, wobei es selbst oxidiert wird (Enzym: Glutathion-Peroxidase) . Dabei werden stets zwei Giutathion-Moleküle oxidiert, die sich anschließend unter Ausbildung einer Disulfidbrücke zu einem Glutathion-Disulfid verbinden. Dieses muss anschließend wieder zu zwei reduzierten Glutathion-Molekülen regeneriert werden, damit es erneut seine Funktion als Antioxidans ausüben kann. Dies geschieht durch die Glutathion-Reduktase, die als Coenzym NADPH/ H+ (Wasserstoffdonator) benötigt.
Andere Antioxidantien
Neben dem Giutathion verfügen die Erythrozyten über weitere Enzyme, die sie vor oxidierenden Substanzen schützen können. Die Superoxid-Dismutase beseitigt die anfallenden Superoxidradikale, die beispielsweise bei der spontanen Oxidation von Hämoglobin zu Methämoglobin entstehen, während die Katalase die Glutathion-Peroxidase bei der Entschärfung von Wasserstoffperoxid (H 20 2 ) unterstützt Würde das H20 2 nicht beseitigt, so könnte es mit einem Superoxidradikal zu einem Hydroxylradikal weiterreagieren, das noch reaktionsfreudiger und schädlicher als andere Oxidantien wäre.
Zusammenfassung
Blut 118 I 119
Enzymdefekte
Störungen der erythrozytären Enzyme können zu verschiedenen Krankheitsbildern führen.
Glukose-6- Phosphat-Dehydroge
nase-Mangel (G6PDH-Mangel) Der häufigste erythrozytäre Enzymdefekt ist der Mangel an Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase, dem Enzym, das den ersten Schritt des Pentosephosphatwegs katalysiert Bei G6PDHMangel kann der Pentosephosphatweg nur beschränkt ablaufen, was zu einem Mangel an NADPH/ H+ und somit zur gestörten Regeneration von Glutathion führt. Dadurch kommt es wiederum zu einer vermehrten Bildung von Methämoglobin. Die Symptome variieren sehr stark und hängen unter anderem von der Mutation (über 100 bekannte Varianten) und dem Geschlecht der betroffenen Person ab. Sie reichen von Beschwerdefreiheit bis hin zum Auftreten hämolytischer Krisen. Durch den Verzehr von Favabohnen können solche hämolytischen Krisen hervorgerufen werden, daher wird die Erkrankung auch als Favismus bezeichnet.
Pyruvatkinase-Mangel Beim Pyruvatkinase-Mangel ist der Ablauf der erythrozytären Glykolyse gestört. Dies führt zu Störungen der zellulären Integrität und kann mit einer mehr oder weniger starken hämolytischen Anämie einhergehen.
• Erythrozyten haben keinen Zellkern, keine Mitochondrien, keine Riboso
men und kein endoplasmatisches Retikulum.
• Sie bestehen zum Großtell aus Hämoglobin und sind hauptsächlich für
den Sauerstofftransport im Blut zuständig.
• Die erythrozytäre Glykolyse weist eine Besonderheit auf: Ober einen
Zwischenschritt kommt es zur Bildung von 2,3-Bisphosphoglycerat, das die
Sauerstoffaffinität des Hämoglobins herabsetzt.
• Glutathion schützt den Erythrozyten und seine Bestandteile vor oxidieren
den Substanzen. Seine Regeneration erfolgt mithilfe von NADPH/H+, und
ist beim Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel gestört.
Blutstillung und Gerinnung
jeder kennt es: Schneidet man sich in den Finger, fängt es aus der Wunde erstmal an zu bluten. Dass die Blutung relativ schnell wieder sistiert, verdanken wir einem ausgeklügelten System, das der Körper zur Reparatur verletzter Gefäßwände entwickelt hat. Zunächst kommt es zu einer vaskulären Reaktion, d. h., das Gefäß selbst versucht den Blutverlust durch Konstriktion mög· liehst gering zu halten. Thrombozyten und die plasmatische Blutgerinnung erledigen daraufhin den Rest.
Thrombozyten
Entstehung und Eigenschaften
Thrombozyten oder auch Blutplättchen gehören zu den zellulären Bestandteilen des Blutes. Sie entstehen im Knochen· mark aus Megakaryozyten, von denen sie sich als kleine Zellfragmente abschnüren. Thrombozyten sind flach und scheibenförmig und haben keinen Zellkern . Nach einer mittleren Lebenszeit von I 0- 12 Tagen werden die gealterten Blutplättchen in der Milz abgebaut. Im Normalfall befinden sich in unserem Blut 150000-300000 Thrombozyten pro Jl l, deren Aufgabe darin besteht, Gefäßverletzungen behelfsweise zu verschließen und die Blutgerinnung zu aktivieren. Dabei entsteht Fibrin, das die Thrombozyten miteinander "verklebt" und so den zunächst insta· bilen primären Plättchenthrombus stabilisiert.
Rolle bei der Blutstillung
Zunächst einmal müssen die Thrombozyten in der Lage sein, beschäd igte Gefäßwände zu finden. Dies geschieht über verschiedene Strukturen, die sich eigentl ich in der subendothelialen Matrix befinden, durch eine Verletzung der Gefäßwand aber freigelegt werden. An diese können Thrombozyten nun über ihre Rezeptoren binden, und so den primären Plättchenthrombus aus· bilden. Der erste Kontakt erfo lgt über die Bindung an den von-WillebrandFaktor. Über Kollagen-, Fibronektinund Lamininrezeptoren wird der Kontakt stab ilisiert. Durch diese Bin-
dungenwerden die Blutplättchen gleichzeitig aktiviert. Diese Aktivierung fü hrt zu:
ll>- Ausschüttung der in Thrombozyten enthaltenen Granu la: Die Granula enthalten Substanzen, die weitere Plättchen aktivieren (ADP, Serotonin) oder für den Ablauf der Gerinn ung nötig sind (z. B. Ca2+). ..". Bildung von Thromboxan A2 aus freigesetzter Arachidonsäure aus der Thrombozytenmembran: Das Thromboxan füh rt zur Vasokonstriktion und zur Aktivierung weiterer Thrombozyten. ll>- Verformung der Thrombozyten: Die Thrombozyten werden flacher und bilden Fortsätze (Pseudopodien) aus, mit denen sie den Gefäßdefekt provisorisch abdecken können. Außerdem kommt es zu einer Umstrukturierung der Plätt· chenmembran. Negativ geladene Phospholipide der Membran, die eigentlich ins Zellinnere ragen, gelangen auf die Außenseite und werden so den Gerinnungsfaktoren präsentiert. Dadurch kommt es zu deren Aktivierung.
Zunächst bildet sich also ein weißer Plättchenthrombus, bei dem die Blutplättchen über Fibrinogenbrücken zu. sam mengehalten werden.
Blutgerinnung
Der primäre Plättchenthrombus ist noch ziemlich instabil. Erst nach Ablauf der Gerinnungskaskade, wenn das lösliche Fibrinogen in un lösliches, vernetztes Fibrin umgewandelt wurde, hal ten die Plättchen richtig fest zusammen. Diese Umwandlung geschieh t durch Thrombin, dessen Aktivierung am Ende der Gerinnugskaskade steht und auf zwei Wegen erreicht werden kann (lntrinsic- oder Extrinsic-System).
Gerinnungsfaktoren
Für den Ablauf der Gerinnungskaskade werden sog. Gerinnungsfaktoren benö· tigt, von denen es 13 verschiedene gibt: Faktor I- XIII. Sie haben alle auch einen Eigennamen, wichtiger ist es aber, die jeweilige römische Zi ffer zu kennen. Bei den meisten Gerinnungsfaktoren handelt es sich um Proteinasen, die
nach ihrer Aktivierung wiederum einen weiteren Faktor aktivieren, wozu sie als Cofaktoren Ca2+ und Phospholipide benötigen. So en tsteht eine Kaskade die in der Aktivierung von Thrombi~ gipfelt. Ist ein Faktor aktiviert, wird dies kenntlich gemacht, indem seiner Zi ffer ein a hinzugefügt wird . Die Faktoren der Gerinnungskaskade sind:
ll>- Faktor 1: Fibrinogen, ll>- Faktor 11 : Prothrombin, ll>- Faktor 111: Gewebsth romboplastin (= Thrombokinase), ll>- Faktor IV: Kalzium (CaZ+ ), ll>- Faktor V: Proaccelerin, ll>- Faktor Vl = aktivierter Faktor V (Va), ll>- Faktor VII: Prokonvertin, ll>- Faktare VIII: Antihämophiles Globulin A, ll>- Faktor IX: Christmas Factor, ll>- Faktor X: Stuart Prower Factor, ll>- Faktor XI: Plasmathro mboplastin, ll>- Faktor XII: Hageman Factor, ll>- Faktor XIII: Fibrinstabilisierender Faktor.
Ablauf
Man un terscheidet bei der Blutgerinnung das intrinsische und das extrinsische System. Beide führen letztendlich zu einer Aktivierung des Faktors X zu Xa. Ab da gehen beide Systeme eine gemeinsame Endstrecke, die zum Schluss in die Bildung eines s~~bilen Fibrinpolymers mündet. Einen Uberblick über die gesamte Blutgerinnung liefert I Abbildung 1.
Intrinsisches System Bei der intrinsischen Gerinnung liegen alle beteiligten Faktoren im Blut vor: Durch Kontakt mit Fremdoberfläche (z. B. im Reagenzglas) bzw. mit negativer Lad un g, werden im Blutplasma vorhandene Subs tanzen akti viert: Präkallikrein hochmoleku lares Kininogen und Faktor' XII. Diese aktivieren sich auch gegenseitig zu Kallikrein, Bradykinin und Faktor Xlla. Die Kette wird nun fortgesetzt
'
Intrinsisches System
Endothelverletzung
XII ___1___. Xlla
~ XI - x1a
~+Ca2• IX - 1xa
1 Ca' •
VIIl - Vlila
X J:· Xa
Extrinsisches System
Gewebsverletzung + GT'
Vlla J_ VII
Ca2+
Blut 120 I 121
tor Xa hemmt. Außerdem bilden Endo· thelzellen zusätzlich Prostazyklin und Thrombomodulin, weitere Hemmer der Blutgerinnung. Wichtig ist außerdem Protein C, das zusammen mit Protein S negative Phospholipide bindet und die Faktoren V und VIII zerstört Protein C und S werden Vitamin-K-abhängig in der Leber gebildet.
Faktor IV } Faktorv ------~ l Phospholipide 1 Ca~'·---~
'--P-rot_hr_om_b_in_;-----'--------'- 1 Thrombin - - ----,
Der PAF (= platelet activation factor) dagegen wirkt gerinnungsfördernd, indem er die Thrombozytenaggregation ankurbelt.
Fibrinogen -----'!'-------+ Fibrinmonomer
I Abb. 1: Die Blutgerinnung im Überblick 1151
indem Faktor Xlla den Faktor XI in seine aktive Form überführt, was wiederum zu einer Aktivierung von Faktor IX führt, der mithilfe von Faktor VIII, Ca2+ und Phospholipid die Bildung von Faktor Xa bewerkstelligt. Der Ablauf der intrinsischen Gerinnung vollzieht sich im Minutenbereich.
Extrinsisches System Die extrinsische Gerinnung läuft in weniger Schritten und innerhalb von Sekunden ab. Hierzu kommt es bei einer Gefäßverletzung mit freiliegendem subendothelialen Gewebe (befindet sich nicht im Blut, daher extrinsisch), insbesondere mit dem Gewebsthromboplastin (= Faktor 111). Gewebsthromboplastin aktiviert Faktor VII zu Vlla, und dieser wiederum Faktor X zu Xa.
Gemeinsame Endstrecke In den letzten Schritten der Gerinnung führt Faktor Xa zur Aktivierung von Prothrombin (Faktor II ) zu Thrombin (Faktor Ila ), das aus Fibrinogen (Faktor I) Fibrinmonomere frei setzt. Dadurch entsteht zunächst instabiles Fibrin, das erst durch Faktor Xllla , über die Bildung von kovalenten Peptidbindungen zwischen den lockeren Fibrinmonomeren, in ein stabiles Fibrinpolymer überfühn wird.
Regulation der Blutgerinnung
Im Blut sind eine Reihe von Stoffen vorhanden, die eine überschießende Blutgerinnung und damit auch die Ausbildung gefährlicher Thrombosen verhindern. Dazu gehört Antithrombin III, das Thrombin abbaut und Fak-
Zusammenfassung
Fibrinolyse
Auf- und Abbau(= Fibrinolyse) von Fibrin stehen normalerweise in einem Gleichwicht zueinander und laufen parallel ab. Die Fibrinolyse führt zum Umbau des Thrombus und damit zur Wiederherstellung eines normalen Blutflusses. Das Enzym, das für den Abbau des unlöslichen Fibrinpolymers zuständig ist, ist das Plasmin, das aus seiner Vorstufe Plasminogen aktiviert werden muss. Bei diesen Plasminogenaktivatoren unterscheidet man einen Gewebetyp (tissue-PA, t-PA) und einen Urokinase-Typ (u-PA). In der Klinik verwendet man zur Auflösung von Thromben, z. B. nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall Streptokinase, einen Plasminogenaktivator, der von Streptokokken gebildet wird.
• Im ersten Schritt der Blutstillung bilden Thrombozyten einen instabilen Plättchenthrombus aus, der erst durch Fibrin richtig zusammengehalten wird.
• Das Fibrin ist Produkt der Gerinnungskaskade, bei der sich die Gerinnungsfaktoren gegenseitig aktivieren, bis Thrombin entsteht, das Fibrinogen zu Fibrin umwandelt.
• Man unterscheidet bei der Blutgerinnung die extrinsische von d&r intrinsischen Aktivierung.
• Das Enzym Plasmln baut die Thromben wieder ab (Fibrlnolyse). Dazu sind Plasmlnogen-Aktlvatoren nötig.
Leber
Die Leber nimmt im Körper zahlreiche wichtige Funktionen ein: Sie ist zentraler Knotenpunkt vieler Stoffwechselwege und kann fast alle Stoffwechselreaktionen durchführen. Auf diese Weise ist es ihr möglich, das innere Milieu aufrechtzuerhalten und den Stoffwechsel an die gegebenen Bedingungen anzupassen. Des Weiteren dient die Leber als Ausscheidungs- und Entgiftungsorgan sowie als Biosyntheseund Speicherort zahlreicher Stoffe.
Stoffwechselleistungen
Die drei Hauptstoffwechselwege (Aminosäuren- , Kohlenhydrat- und Lipidstoffwechsel) wurden schon in den jeweiligen Kapiteln genauer besprochen. Hier sollen noch einmal die wichtigsten Stoffwechselleistungen der Leber zusammengefasst werden.
Resorptionsphase vs.
Postresorptionsphase
Ganz allgemein unterscheidet man zwei Arbeitsphasen der Leber:
~ In der Resorptionsphase, ca. 2- 4 Stunden nach Nahrungsaufnahme, herrscht ein Nährstoffüberschuss. Es kommt zur Ausschüttung von Insulin aus dem Pankreas, und der Stoffwechsel wird auf Anabolismus umgeschaltet: Nährstoffe werden aufgenommen, verarbeitet und gespeichert, bZ\'1. zur Baustoffsynthese verwendet. In der Leber führt dies zur Umwandlung von Glukose in Glykogen (Speicherform), bzw. zur Synthese von Fetten aus überschüssiger Glukose. ~ In der Postresorptionsphase werden die Nährstoffreserven langsam wieder knapper, und es wird vermehrt Gl ukagon aus dem Pankreas sezern iert. Dies führt zu einem katabolen Stoffwechsel mit Bereitstellung von Nährstoffen aus den Reserven. Die Leber ist nun dazu angehalten, Gl ukose und andere Energieträger für die übrigen Organe zur Verfügung zu stellen. Sie baut dafür Speicherstoffe (zunächst Glykogen, dann Fette und Proteine) ab und ste llt Glukose aus anderen Substraten wie Aminosäuren oder Glycerin
her (Glukoneogenese). In längeren Hungerperioden bildet die Leber Ketonkörper, die andere Organe zur Energiegewinnung nutzen können.
Aminosäurenstoffwechsel
Die bei der Verdauung resorbierten freien Aminosäuren gelangen über die Pfortader zur Leber und werden dort weiterverarbeitet Dazu hat die Leber verschiedene Optionen: Sie kann die Aminosäuren zur Synthese von z. B. Plasmaproteinen nutzen, oder weiter abbauen und die Produkte in die Glukoneogenese, Fettsäuresynthese oder Ketogenese einschleusen, bzw. energiebringend im Citratzyklus abbauen.
Kohlenhydratstoffwechsel
Die Leber ist außer am Glukosestoffwechsel und seiner Anpassung an das bestehende An gebot (s.o., Resorptions-, Postresorptionsphase) auch maßgebend am Galaktose- und Fruktose-Stoffwechsel beteiligt. Nur in der Leber ist die Verstoffwechslung von Galaktose zu UDP-Glukose in großem Umfang möglich. Galaktose ist ein Bestandteil der Laktose und vor allem in der Milch enthalten. Auch der Fruktose-Stoffwechsel spielt sich überwiegend in der Leber ab. Sie verfügt über eine spezifische Fruktokinase, die Fruktose in Fruktose- I-Phosphat umwandelt. Aus Fruktose- I-P hosphat können im Anschluss Substrate der Glykolyse gebildet werden. Dies ist auf zwei Wegen möglich:
~ Fruktose- 1-P ~ Dihydroxyacetonphosphat + Glycerinaldehyd (Enzym: 1-Phosphofruktoaldolase, Aldolase B) ~ Fruktose- I - Phosphat~ Fruktose-! ,6-Bisphosphat ~ Dihydroxyacetonphosphat + Glycerina ldehyd-3-Phosphat
Lipidstoffwechsel
Die Aufgaben der Leber im Lipidstoffwechselbeinhalten Fettsäurekeltenverlängerungen bzw. -verkürzungen, Abbau der Nahrungsfette, Triacylglycerin- und Cholesterinstoffwechsel, und zudem verschiedene Synthese-
Ieistungen . In der Leber werden die meisten Lipoproteine und ca. 90% des endogenen Cholesterins, sowie die Gallenfiüssigkeit produziert. Außerdem ist die Leber das einzige Organ, das zur Ketonkörperbildung befäh igt ist.
Biosyntheseleistungen
Plasmaprotein-Synthese
Die meisten Proteine, die im Blutplasma zirkulieren, werden von der Leber hergestell t. Sie bi ldet Albumin, a 1-, a 2- und ß-Globuline. Lediglich die y-Globuline [Immunglobuline) werden außerhalb der Leber von Plasmazellen synthetisiert. Die Plasmaprote ine nehmen wiederum verschiedenste Aufgaben wahr. So ist die Leber an der Bildung von Transportproteinen (Albumin , Transferrin, Haptoglobin , Caeruloplasmin) , Immunproteinen [Komplementsystem, Aku te- Phase-Prote ine, Proteasehemmer
' C-reaktives Protein), Gerinnungsfakto-ren, Lipoproteinen und der Cholinesterase, die ein wichtiger klinischer Leberfunktionsparameter ist, beteiligt.
Synthese der Gallensäuren
ln der Leber wird außerdem die Gallenflü ssigkei t synthetisiert, deren Gallensäuren an der Verdauung fet treicher Nahrung beteil igt sind (s. a. Kap. 124 ). Die Gallensäuresynthese aus Cholesterin erfolgt im Wesentlichen durch:
~ Einführung von OH-Gruppen, ~ Reduktion einer Doppelbindung (im B-Ring), ~ und Kürzung der Seitenkette um drei C-Atome.
Dadurch entstehen die primären Gallensäuren Cholsäure ( Hydroxylgruppen an C3, C7 und C 12) und Chenodesoxycholsäure (Hydroxylgruppen an C3 und C7), I Abb. I. Die Schrittmacherreaktion der Gallensäurensynthese ist die C7-Hydroxyl ierung durch die
holesterin -7 -a -H ydroxylase. Durch Konjugation der primä ren
allensäuren mit Glyci n oder Taurin, die noch in der Leberzelle sta ttfindet, ents tehen die wasserlöslicheren Ga llen-
COOH
HO
Chenodesoxycholsäure
-------
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 122 1123
HO
Cholsäure
COOH können, da ihnen zunächst die dazu nötigen funktionellen Gruppen fehlen. Substanzen, die zur Konjugation ge· eignet sind, und die entsprechenden Konjugationsreaktionen sind:
..",. UDP-Glucuronat (=aktivierte Glucuronsäure) ~ Glucuronidierung:
I Abb. 1: Chenodesoxycholsäure (l inks) und Cholsäure (rechts) Die UDP-Glucuronyl-Transferase koppelt Glucuronsäure an -OH, -NH2 oder -COOH-Gruppen.
salze [Giykocholsäure und Taurocholsäure, bzw. Glykodesoxycholsäure und Taurodesoxycholsäure). Sie werden nun ins Duodenum sezerniert, wo sie ihrer Aufgabe nachkommen können.
Leber als Entgiftungsorgan
Die Leber sorgt über den Harnstoffzyklus für die Entgi ftung von Ammoniak und ist in der Lage, über die Galle Substanzen direkt in den Darm auszuscheiden. Aber das sind nicht alle Funktionen des Ausscheidungsorgans Leber. Eine weitere ist die Biotransformation lipophiler Substanzen [körpereigene und körperfremde), die nicht renal oder über die Galle ausgeschieden werden können. Sie werden von der Leber modifiziert und dadurch eliminierbar gemacht.
Biotransformation
Die Biotransformation läuft in zwei Phasen ab, in denen die zu entgiftenden Moleküle schrittweise in hydrophile, ausscheidbare Moleküle umgewandelt werden.
Phase 1: Umbau funktioneller Gruppen In Phase I werden die Moleküle durch oxidative oder seltener durch reduktive Umwandlungen polarer und reaktions· freudiger ge macht, was oft gleichzeitig zu einer Inaktivierung der Substanz (z. B. Arzneimi ttel) führt. Erreicht wird
dies durch den Einbau polarer Gruppen (z _ B. -OH, -NH2, oder -COOH), oder selten auch durch die Entfernung funktioneller Gruppen [Desalkylierung, Desaminierung) oder hydrolytische Spaltung. Die wichtigsten Phase-I-Reaktionen sind NADP+-abhängige Oxidationsreaktionen, die von den mischfunktionellen, mikrosomalen Monooxigenasen katalysiert werden. Meistens enthalten die Monooxigenasen Cytochrom P 450 , das durch seine Substrate induziert oder gehemmt werden kann und für viele Arzneimittelwechselwirkungen verantwortlich ist.
Phase II: Konjugation Damit das lipophile, zu eliminierende Molekül ausgeschieden werden kann, muss es mit einer stark polaren Substanz gekoppelt(= konjugiert) und da· durch wasserlöslich gemacht werden. Die Konjugation ist manchmal direkt möglich, oft müssen Stoffe aber erst Phase I der Biotransformation durchlaufen, bevor sie konjugiert werden
H I
H 3C-~-OH
NAD<Il NADH + H<ll
\..) .....
..",. PAPS[= aktiviertes Sulfat, 3-Phosphoadenosin-5-Phosphosulfat) ~ Sulfatierung: Die Sulfatase überträgt Sulfatgruppen auf -OH oder -NH2-Gruppen. ..",. Glutathion ~ Thioätherbildung, ..",. Glycin ~ Methylierung, ..",. Acetyl-CoA ~ Acetylierung, ..",. Aminosäuren ~ Amidierung.
Alkoholmetabolismus
Eine weitere Funktion des Entgiftungs· argans Leber ist der Abbau von Alkohol. Das aufgenommene Ethanol verteilt sich rasch im Organismus [v. a. in Gehirn und Muskulatur) und landet schließlich in der Leber, wo es über zwei Mechanismen abgebaut werden kann. Der größte Teil des Alkohols wird mithilfe des Enzyms Alkohol-Dehydrogenase (ADH) abgebaut (I Abb. 2). Nur ein kleiner Teil des Ethanols wird über das mikrosomale ethanoloxidierende System (MEOS) metabolisiert, das den Alkohol Cytochrom-P 450-abhängig oxidiert.
H
Ethanol Acetaldehyd Acetat
I Abb. 2: Abbau von Ethanol über die Alkohol-Dehydrogenase
Zusammenfassung a Die Leber ist ein Knotenpunkt zahlreicher Stoffwechselvorgänge und
reguliert so das innere Milieu des Körpers. a ln der Leberfindet unter anderem die Biosynthesen von Cholesterin,
Gallensäuren und vielen Plasmaproteinen statt. a Die Biotransformation läuft in zwei Phasen ab. Nach der Modifikation des
zu entgiftenden Stoffes (Phase I) folgt dessen Konjugation (Phase II).
Niere
Funktionen der Nieren
Die Nieren sind für unseren Stoffwechsel sehr wichtige Organe. Obwohl sie weniger als I% unseres Körpergewichts wiegen, verbrauchen sie 25% des Herzminutenvol umens. Zu ihren Aufgaben gehören:
11>- Entgiftung und Ausscheidung schädlicher Stoffwechselprodukte 11>- Regulierung des Säure-Base-Haushalts 11>- Hormonsynthese: Erythropoietin, Renin, Calcitrial 11>- Regulation des Wasserhaushalts ..,._ Harnbi ldung 11>- Sekretion und Resorption verschiedener Stoffe
Die Harnbildung
jede Niere enthält über I Million Nephrone, welche die funktionellen Einheiten der Niere darstellen. In den Abschnitten der Nephrone (I Abb. l ) findet die Harnbi ldung statt
..,._ glomeruläre Filtration 11>- tubuläre Resorption 11>- tubuläre Sekretion
Glomerul äre Filtration
' - . ' - t f ~ ; '~, r I • • •
\ -'\' ''' . '"t.~J·· "":"..·
Die glomeruläre Filtrationsrate {GFR) ist die Menge Primärharn, die alle Glomeruli in einer gewissen Zeiteinheit filtrieren. Die GFR ist abhängig vom Fil trationsdruck, der Größe der Filtrationsfläche, also der Zahl der Glomeruli sowie dem rena len Blutfluss und der Leitfähigkeit des Fi lters, also der Durchlässigkeit der Glomeruli .
Tubulä re Resorption Nur ein kleiner Teil der 180 l Primärharn, die pro Tag gefiltert werden, wird letzten Endes auch von der Niere ausgeschieden. Der größte Teil des Wassers und der aus dem Plasma fi ltrierten Stoffe wird im Tubulussystem wieder zurückresorbiert und zurück ins Blut abgegeben. Für die Rückresorption gibt es mehrere Möglichkeiten:
..,._ primär-aktiven Transport: die Na+K +-ATPase transportiert unter ATP-Verbrauch 3 Na+-Ionen aus dem Tubul us, im Austausch wandern 2 K+-lonen aus dem Intersti tium ins Tubuluslumen. 11>- Sekundär-aktiven Transport: Au fgrund des Konzentra tionsgradienten (Na+-Konzentration ist im Tubuluslumen höher als außen) strömt Natrium passiv aus dem Tubuluslumen. Mit ihm zusammen, im sog. Na+-Symport werden Glucose, Anionen wie Chiari d oder Phosphate und Aminosäuren sekundäraktiv mit ins Intersti ti um befö rdert. ..,._ Solvent drag: Der durch die Verschiebung der Elektrolyte entstehende osmotische Gradient bewirkt, das Wasser aus dem Tubulus ins Interstitium strömt. Gemeinsam mit dem Wasser fli eßen weitere Stoffe wie Glucose oder Harnstoff zurück ins Blut. 11>- Shunts: Über Spalte zwischen den Tubuluszellen, sog. Parazelluläre Shunts können Cl-Ionen entlang dem vorliegenden Konzentrationsgefälle ins Intersti tium gelangen. Im Gefolge strömen NaT-, Mgk und Ca2+. Ionen .
Rückresorption von Wasser Im proximalen Tubulus werden bereits 70% des im Glomerulum filtrierten Wassers zu rück ins Plasma resorbiert. Du rch die Aktivität der Na+-K+·ATPase entsteht ein osmotischer Gradient, dem das Wasser fo lgt und so zurück ins Interstitium gelangt. In der Henle-Schleife werden weitere 20% des ursprünglichen Filtrats rückresorbiert. Es en tsteht ein sog. Gegenstromsystemdurch die beiden nah aneinander grenzenden auf- und absteigenden Schenkel der Schleife, die die weitere Kon zentri erung des Harns ermöglicht. Im distalen Tubulus und im Sammetrohr werden noch einmal maximal I 0% des ehemals filtrierten Wassers ins Interstitium zurückresorbiert Die Regulation dieses Vorgangs übernimmt das antidiuretische Hormon (ADH ). Benötigt der Körper Wasser, steigt der AD H-Spiegel und es werden Aquaporine im Sammelrohr eingebaut, die den Rückfluss von Wasser ins Blutplasma ermöglichen.
Distaler Tubulus
Kapillarschl ingen des Glomerulus - -t--:li--- -Ht-.-t
Bowmansche Kapsel
Proximaler Tubulus
Vene
Arterie
Sammelrohr
Tubulusapparat
Henle 'sehe Schleife
I Abb. 1: Aufbau eines Nephrons 11 51
Rückresorption von Natrium 2/ 3 des glomerulär filtri erten Natriums werden gleich im proximalen Tubulus wieder zurückresorbiert Dies geschieht über die oben beschriebenen Mechanismen. Die genaue Menge Natrium, die letztlich im Harn vorhanden ist, wird im Sammelrohr bestimmt. Aldostern (siehe unten) übernimmt hier die Regulation der weiteren Natriumrückresorption. Glucose und Aminosäuren werden vor
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 1241125
Substanz Primärharn Endharn
Natri um 135- 150 mmol/1 15-150 mmol/ 1
Kalium 3,5 - 5 mmol / 1 30-300 mmol/ 1
Harnstoff 5 mmol/1 ca. 250 mmol/1
Phosphat 1-1,5 mmol/ 1 3- 20 mmol/1
Kalzium 2, 25-2,75 mmol/1 3- 6 mmol / 1
Chiarid 100-115 mmol/ 1 30 - 150 mmol/ 1
Harnsäu re 0,3 mmol/1 3 mmol / 1
Protei ne 10 mg/1 < 40 mg/1
allem im Symport mit Natrium und vor I Tab. 1: Konzentration unterschiedlicher Stoffe in Primär- und Endharn
allem im proximalen Tubulus nahezu vollständig rückresorbiert
Stoffwechsel wichtigen Kalzitriols Ren in Tubuläre Sekretion beteiligt. Der Kalziumstoffwechsel wird Renin wird als Prorenin in Epitheloid
zellen des juxtaglomerulären Apparats der Niere gebildet und dann in Granula gespeichert, in denen es zum fertigen Renin aktiviert wird.
Im Tubulus find et neben der Rückresorp- in Kapitel 86 besprochen. tion von Stoffen auch eine Sekretion statt. So kann eine vermehrte Ausscheidung gewisser Substanzen genau reguliert werden. Wichtig ist dies beim Kalium. 70% des im Glomerulum filtri erten Kaliums wird im proximalen Tubulus wieder resorbiert. Im distalen Tubulus sowie im Sammelrohr besteht die Möglichkeit, wieder Kalium zu sezernieren und im Austausch gegen Natrium ins Tubuluslumen zu befördern. Die Regulation dieses Mechanismus übernimmt das Hormon Aldosteron (s. S. 92). Ein erhöhter Aldosteronspiegel bewirkt eine vermehrte K+-Sekretion und somit eine erhöhte Na+-Rückresorption. Eine Erniedrigung des Aldosteronspiegels bewirkt genau das Gegenteil.
Der Urin Dem letzten Endes von der Niere ausgeschiedene Endharn wurden zuvor ein Großteils der im Primärharn filtrierten Stoffe wieder entzogen. Da ein großer Teil des Wassers dem Harn wieder entzogen wird, ist die Konzentration der meisten Substanzen im Endharn höher als im Primärharn. I Tabelle I liefert eine Übersicht über die unterschiedliche Konzentration einiger Substanzen im Primärharn sowie im Endharn.
Hormone der Niere
Außer der Harnbildung hat die Niere noch eine endokrine Funktion. Sie bi ldet Erythropoietin sowie Renin und ist an der Syn these des für den Kalzium-
Erythropoietin Erythropoietin, auch EPO ist ein für die Hämatopoese und hier insbesondere die Bildung von Erythrozyten wichtiges Hormon. Es handelt sich um ein Glykoprotein. Dieses bindet an EPO-Rezepto· ren,die sich vor allem an Stammzellen im Knochenmark befinden und stimuliert so die Erythropoese. Genauer wird die Erythropoese auf Seite 118 erklärt. Die Synthese des Erythropoietins in der Niere findet im äußeren Mark und im Kortex der Niere statt durch die Tubuli umgebende Fibroblasten. Bei Sauerstoffmangel, der die Erythropoietinsynthese aktiviert, wird so die Möglichkeit gegeben, neue Erythrozyten zu bilden und den Sauerstofftrans-port zu verbessern.
Zusammenfassung
Renin wird ausgeschüttet, wenn der Blutdruck im Körper sinkt. Dieser Abfall wird in den afferenten Arteriolen der Niere registriert. Ein Blutdruckanstieg hemmt die Reninfreisetzung. Renin hat die Funktion, vom in der Leber produzierten Angiotensinogen Angiotensin I abzuspalten. Somit wird eine Kaskade in Gang gesetzt. Das An· giotensin-Converting-Enzym wandelt Angiotensin I in Angiotensin II um, welches nun seine Wirkung entfalten kann. Dies ist eine Kontraktion der glatten Gefäßmuskelzellen sowie eine Stimulation der Aldosteronsekretion. Beides hat einen Anstieg des Blutdrucks zur Folge.
• Zu den wichtigen Aufgaben der Niere gehören die Entsorgung schädlicher Stoffwechselprodukte, die Harnbildung und ihre endokrine Funktion.
• Die Harnbildung findet in Nephronen, der kleinsten funktionellen Einheit der Niere statt.
• Auf die glomeruläre Filtration folgt die tubuläre Rückresorption und Sekretion. Ein Großteil der filtrierten Substanzen wird im Tubulussystem wieder ins Blut zurückgeführt.
• Die Niere ist an der Bildung von Calcitriol beteiligt. Außerdem werden in der Niere Erythropoietin für die Erythropoese sowie Renin zur Regulation des Blutdrucks produziert.
Verdauungsorgane I
Unser Verdauungstrakt besteht aus Speiseröhre (Ösophagus), Magen, Dünndarm [Duodenum, Jejunum und Ileum), Dickdarm und Enddarm (Rektum). Aufgaben dieser Organe sind die Aufbereitung der zugeführten Nahrung und die Resorption der für den Körper benötigten Sro ffe (Nährstoffe, Elektrolyte, Vitamine und Spurenelemente). Dazu werden die Nahrungsbestandteile während der Darmpassage in kleinste Bausteine zerlegt, da sie nur so resorbiert werden können. Alles, was der Körper nicht gebrauchen kann, wird einfach ausgeschieden.
Allgemeine Grundlagen
zur Ernährung
Zu den Nährstoffen zählt man Koh· lenhydrate, Lipide und Proteine bzw. Aminosäuren. Sie dienen uns in erster Linie als Energielieferanten, weshalb man sie auch als Brennswffe bezeichnet. Am Ende des Abbaus aller Nährstoffe entsteht Acetyl-CoA, das durch Weiterverarbeitung in Citratzyklus und
Atmungskette zur Bildung von C02,
HP und ATP, unserem wichtigsten Energieträger, Führt. Beim Abbau der Aminosäuren entsteht zusätzlich Ammoniak, das im Harnstoffzyklus entgiftet werden muss.
Energiebilanz
Energiebedarf Der durchschnittliche Energiebedarf des Menschen beträgt pro Tag ca. 1900 kca l (8000 kj ) in Ruhe, 2200 kcal (9200 kJ) bei leichter Arbei t und 4000 kcal ( 16 800 kJ) bei schwerer Arbeit. Die Werte hängen von Alter, Geschlecht, Körpergröße und Körpergewicht ab. So ist der Grundumsatz bei Frauen beispielsweise etwas geringer als be i Männern.
Energiegehalt der Nahrung Bei normaler Ernährung nimmt der Mensch pro Tag durchschnittlich erwa 2700 kcal zu sich. Dabei machen die Kohlenhydrate durchschnittlich ca. 1230 kca l aus, während etwa 328 kcal in Form von Proteinen und ca. I 130 kca l als Fette zugeführt werden. Wir ernähren uns demnach insgesamt zu fettig, was auf den zunehmenden Fleischgenuss unserer Gesell schaft zurückzuführen ist.
~ Respiratorischer Quotient: Das Verhältnis von ausgeatmetem co2 ZU aufgenommenem 0 2 bezeichnet man als respiratorischen Quotienten (RO). Anhand dieses Wertes kann man Rücksch lüsse darüber ziehen, welcher Art die verstoffwechselten Substanzen angehören . Bei der Verbrennung von Kohlenhydraten (Glukose) wird genauso viel Sauerstoff verbraucht, wie C02
entsteht (C6H120 6 + 6 0 2 ~ 6 C02 + 6 H20), derRObeträgt demnach bei ausschließlicher Aufnahme von Kohlenhydraten 1 ,0. Die Verbrennung von Lipiden und Proteinen benötigt mehr Sauerstoff, daher fä llt der RO hier unter I ,0. Er liegt bei Lipiden bei ca. 0, 7 und bei Proteinen (je nach Aminosäurenzusammensetzung) in etwa bei 0,8. ~ Physikalischer und physiologischer Brennwert: Der Brennwert sagt etwas darüber aus, wie viel Energie bei der Verbrennung der verschiedenen Nährstoffe frei wird. Dabei muss man den physikalischen Brennwert vom physiologischen Brennwert unterscheiden. Ersteren erhält man bei vollständ iger Verbrennung des Nährstoffs unter experimentellen Bedingungen, Letzterer entspricht der tatsächlichen Energie, die bei der Verbrennung durch den Organ ismus entsteht. Da Kohlenhydrate und Lipide im Körper vollständig abgebaut bzw. verbrann t werden können, ist ihr physiologischer Brennwert gleich dem physikalisc hen. Beim Abbau von Proteinen hingegen bleib t Ammoniak, das nicht weiter abgebaut werden kann, übrig. Demnach findet keine vollständige Oxidation statt, und der physikali sche ßrennw rt liegt etwas liber dem physiologischen. Der Br nnwert der Kohlenhydrate b trägt 17 kj / g und der
der Lipide 39 kJ/g, Proteine verfügen über zwei Brennwerte (physikalischer: 23 kJ / g, physiologischer: 17 kJ /g) .
Nährstoffe
Kohlenhydrate, Proteine und Fette sind die Hauptbestandteile unserer Nahrung und werden als Nährstoffe bezeichnet. Während Kohlenhydrate und Fette hauptsächlich der Energiegewinnung dienen, werden die aufgenommenen Proteine weniger zu Energie verstoffwechselt, sondern stattdessen in den anabolen Proreinstoffwechsel eingeschleust. Daher reich t uns eine tägliche Proteinzufuhr von mindestens 40 g (Eiweißminimum) oder idea lerweise von 70- 90 g (Eiweißoptimum) aus.
Verdauung
Nahrungsresorption
Die makromolekularen Nahrungsbestandteile müssen auf dem Weg durch den Verdauungstrakt {I Abb. 1) in kleinere, resorbierbare Untereinheiten gespalten werden, damit die einzelnen Nährsto ffe aufgenommen werden können. Die Aufspaltung geschieht hierbei durch die zahlreichen Enzyme des Gastrointestinaltrakts. Die Resorption der Nährstoffe erfolgt hauptsächlich in Duo
denum und Jejunum, während eine der Hauptaufgaben des Ileums die ResorpUon von Cobalamin (Vit. B12) ist. Unverdaute Nah rungsbestandteile spielen inso fern eine Rolle, als dass sie die Stuhlkonsistenz auflockern.
Verdauungsenzyme
Di einzelnen Abschnitte des Verdauungstraktes v rfüg n üb r spezifische Enzyme, w !ehe die Nahrungsbestandteile Schritt fü r Schritt aufspalten. Un-
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 126 I 127
Pankreasenzyme Galle
Fettlösliche Vitamine (A, D, E, K)
Kalzium, Eisen, Magnesium, Monosaccharide (Glukose, Xylose), Disaccharide
Eiweiß
Fett
Wasserlösliche Vitamine (C, Thiamin, Riboflavin, Pyridoxin, Folsäure)
I Abb. 1: Resorptionsorte im Magen-Darm-Trakt [ 15)
terstützt werden diese von den Verdauungssekreten aus Pankreas und Leber (Gallenflüssigkeit).
..". Der Verdauungsprozess beginnt schon in der Mundhöhle, wo die Speicheldrüsen neben Mucin, das die Nahrung gleit· fäh ig macht, auch die Stärke abbauende a-Amylase (Ptyalin) sezernieren. ll- Oie Zellen des Magens unterstützen die Verdauung auf drei Wegen. Oie Belegzellen produzieren Salzsäure, die zur Denaturierung von Proteinen führt, an der Hydrolyse der Kohlenhydrate beteiligt ist und außerdem Pepsinogen zu Pepsin aktiviert. Weiterhin wird in den Belegzellen Intrinsic factor gebildet, der für die Resorption von Vitamin B12 essenziell ist. Die Hauptzellen des Magens bilden die Endopepti· dase Pepsin, die Proteine unspezi fi sch spaltet. Die Glykoproteine aus den Nebenzellen dienen dem Schutz der Magenmukosa vor Selbstverdauu ng. ll- Zahlreiche Verdauungsenzyme sind im Pankreassaft enthalten (I Tab. 1), der du rch das Pankreas sezerniert und über den Ductus choledochus ins Duodenum geleitet wird. Er ent· hält zudem reichlich Bicarbonat, wodurch die Magensäure neutral isiert wird. ll- Auch der Dünndarm verfügt über exkretorisch wirkende Zellen. Sie sezernieren verschiedene Verdauu ngsenzyme, wie Aminopeptidasen, Ente ropeptidasen, Phosphodiesterasen und Disaccharasen.
Enzym Funktion
Trypsin Spa ltet Proteine in Oligopepl ide
Chymotrypsi n Spaltet Proteine in Oligopeptide
Carboxypeptidase A und B Spa ltetC-terminaleAminosäuren aus Prote inen
Elastase Spaltet Elastin und Kollagen
Lipase Spaltet Triacylglycerin e
Cholesterinesterase Spa ltet Cholesterinester in Cholesteri n un d Fettsäuren
Ribonuklease Spa lte t DNA- und RNA-Moleküle in Nukleotide
(Pank reas-)o.-Amylase Spa ltet Stärke und Glykogen in Maltose
I Tab. 1: Verdauungsenzym e des Pankreas
Gallenflüssigkeit
Die Gallenflüssigkeit hat ihre Bedeutung bei der Verdauung von fetthaltiger Nahrung. Sie enthält Gallensäuren, die aufgrund ihres amphiphilen Charakters in der Lage sind, mit Triacylglycerinen und anderen Fetten Mizellen auszubilden, wodurch diese von der Lipase besser abgebaut werden können. Außerdem sorgen die Gallensäuren zusätzlich für eine Aktivierung der Pankreaslipase. Die Galle wird in der Leber gebildet und besteht zu ca. 93% aus Wasser und zu ca. 2% aus Gallensäuren. Sie enthält au· ßerdem die ebenfalls für die Fettverdauung wichtigen Phos· pholipide (z. B. Lecithin) sowie Gallenfarbstoffe als Abbauprodukte des Porphyrinstoffwechsels (insbesondere Bilirubin), Cholesterin und Elektrolyte. Sie gelangt über den Ductus hepaticus communis und den Ductus choledochus aus der Leber ins Duodenum. Überschüssige Galle wird in der Gallenblase gespeichert. Im Duodenum wirken die Gallensäuren als Emulgatoren und erleichtern auf diese Weise den Fettabbau. Aus den primären Gallensäuren Cholsäure und Cheno· desoxycholsäure entstehen vor allem im Dickdarm die sekundären Gallensäuren Desoxycholsäure und Lithocholsäure. Dies geschieht durch die Einwirkung von Darmbakterien, welche die primären Gallensäuren dekonjugieren und in Position 7 dehydroxylieren. Nur ca.l 0% der sezernierten Gallensäure werden tatsächlich ausgeschieden, da der Großteil im Ileum über einen Na+-Cotransport sekundär-aktiv rückresorbiert wird. Die resorbierten Gallensäuren gelangen über die Pfortader wieder in die Leber zurück und können dort sozusagen "recycelt" werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als enterohepatischen Kreislauf.
Verdauungsorgane II
Verdauung der einzelnen
Nährstoffklassen
Koh lenhyd rate Den Hauptanteil der über die Nahrung zugeführten Kohlenhydrate macht die Stärke (Polysaccharid) aus. Sie ist als Reservestoff in pflanzlichen Zellen en thalten und kommt in großen Mengen in Getreide und Kartoffe ln vor. Andere Nahrungskohlenhydrate sind die Disaccharide Lactose und Saccharose, und die Monosaccharide Gl ucose, Fructose und Sorbit
Abbau Ausschließlich Monosaccharide können über den Darm resorbiert werden. Größere Kohlenhydrate wie die Polysaccharide Stärke und Glykogen müssen vorher zu Monosaccharideinheiten gespalten werden. Dabei ist der Körper nicht dazu in der Lage, ß-glykosidischverknüpfte Kohlenhydrate zu spalten, da die dazu nötigen Enzyme fehlen . Man bezeichnet diese als Ballaststoffe. Eine Ausnahme bildet hier die Lactose, deren ß-glykosid ische Bindung zwischen Galaktose und Glucose durch die Lactase gespalten werden kann.
.,._ Die Spaltung der Polysaccharide erfolgt durch Amylasen aus dem Speichel und dem Pankreassaft Zunächst entstehen dabei noch höhermolekulare Polysaccharidbruchstücke (Dextrine), die dann weiter zu Oligosacchariden und Disacchariden abgebaut werden (Maltose, Jsomaltose)_ .,._ Die entstehenden Disaccharide Maltose und Isomaltose werden im Folgenden durch Maltasen weiter abgebaut. Auch für die Spaltung der Nahrungsdisaccharide Saccharose und Lactose gibt es spezielle Abbauenzyme (Saccharasen, Lactasen) .
. . "' :~· "':: ~ ~ : ~ ' ' _,
.. , 1,.) •
Resorption Die Resorption von Glucose und Galaktose im Darm erfolgt aktiv, während die Fructose durch erleichterte
Diffusion passiv in die Mukosazellen gelangt.
Lipide Das in unserer Nahrung enthaltene Fett setzt sich im Wesentlichen aus Triacylglycerinen zusammen, deren Zusammensetzung der unserer Organlipide ähnelt. Während der Spaltungs- und Resorptionsvorgänge der Fettverdauung, kann es innerhalb der Triacylglyceride zum Austausch verschiedener Fettsäuren kommen, wobei die einzelnen Komponenten aber nicht verändert werden . Für unsere Ernährung sp ielen insbesondere die essenziellen Fettsäuren (Linolsäure, Linolensäure) und die halbessenzielle Fettsäure Arachidonsäure eine Rolle, da der Körper diese nicht selbst synthetisieren kann. Auch die fettlöslichen Vitamine müssen wir über die Nahrung aufnehmen.
Abbau (I Abb. 1) .,._ Durch eine im Magen enthaltene Lipase werden die Triacylglycerine im Vorfeld verflüssigt, bevor die Triacylglycerinlipase des Pankreas die Fettsäurereste an der I'- und der 3' -Stellung abspaltet. Dabei entstehen v_ a. ß-Monoacylglycerine und freie Fettsäuren. Die Gallensäuren helfen dabei , indem sie die Pankreaslipase aktivieren. .,._ Durch Diffusion gelangen die ß-Monoacylglcerine in die Mukosazelle, während die längerkettigen Fettsäuren mit Hilfe der Gallensäuren als Bestandteile von Mizellen (zusammen mit anderen fettlöslichen Substanzen) aufgenommen werden. Auch freies Nahrungscholes terin benötigt die Hilfe von Ga llensäuren, um resorbiert werden zu können. .,._ Innerhalb der Mukosazellen werden die Triacylglycerine wieder zusammengesetzt, und in Chylomikronen verpackt zusammen mit Cholesterin, Cholesterinestern und Phospholipiden über die Lymphe zur Leber transportiert. Kurzkettige Fettsäuren können auch über die Blutbahn (V. portae) zur Lebertransportiert werden .
Proteine Proteine werden in erster Linie als Aminosäuren oder als kleinere Iigapeptide in die Enterozyten resorbiert.
Duodenum
Cholestenneller Phospholiplde
~s~~!erin~ (nicht-spezifische Lipase)
Phospho-~ llpaseA ~
I Abb. 2: Verdauung der Lipide 1151
Abbau
Trigiyzeride
.,._ Als erster Schritt des Proteinabbaus werden die aufgenommenen Proteine im Magen durch Einwirken der Magensäure denaturiert (=entfaltet) und anschließend durch die Endeprotease Pepsin in Polypeptide zerlegt. .,._ Vier Enzyme des Pankreas zerlegen die Polypeptidbausteine im Duodenum noch weiter. Dabei unterscheidet man Endepeptidasen (Trypsin und Chymotrypsin), welche die Proteine in der Mitte des Moleküls schneiden, von Exopeptidasen, die Proteine von ihrem Ende her abbauen, und zwar entweder vom C-terminalen Ende (Carboxypeptidase), oder vom N-terminalen Ende (Aminopeptidase) her.
Resorption Die entstandenen Iigapeptide und Aminosäuren werd en im Duodenum resorbi rt, d r Transport erfolgt hauptsächlich sekundär aktiv. Bevor die
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 128 1129
Peptidbruchstücke ans Pfortaderblut abgegeben werden können, müssen sie zunächst endgültig zu Aminosäuren abgebaut werden, da sie nur in dieser Form ins Blut abgegeben werden können.
Störungen der Verdauung
Bei den Verdauungsstörungen unterscheidet man grundsätzlich zwei Formen: die Maldigestion und die Malabsorption. Erstere bezeichnet eine Störung der enzymatischen Spaltung von Nahrungsstoffen, z. B. infolge einer Magenresektion, einer Pankreasinsuffizienz oder angeborener Enzymdefekte, Letztere geht mit einem gestörten Transport von Nahrungsstoffen aus dem Darmlumen in die Blut- bzw. Lymphbahn (enterale Resorption) einher und tritt z. B. bei Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder Zöliakie auf.
Störungen der Digestion ~ Die Lactoseintoleranz basiert auf einem Mangel an Lactase in der Darmmukosa, was dazu führt, dass Lactose nicht mehr in Glucose und Galaktose gespalten werden kann. Die Lactose gelangt also unverdaut in den Dickdarm, wo sie durch die Darmbakterien in Essigsäure, Milchsäure, Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff zersetzt wird. Dies wiederum führt zu einem Anstieg des osmotischen Drucks im Dickdarm, und es kommt zum Wassereinstrom ins Darmlumen und infolge dessen zur Diarrhö. ~ Störungen der Fettresorption können auftreten, wenn die
Bildung von Mizellen nicht ausreichend funktioniert, z. B. als Folge von GallensäurenmangeL Ursachen hierfür können eine Leberzirrhose [mangelnde Gallensäurenproduktion), oder auch eine Cholestase (Gallenstauung) sein. Die nicht resorbierten Lipide führen zum Auftreten von Fettstuhl und zu Durchfall und Blähungen(= Meteorismus), da deren Abbau durch Darmbakterien zur Bildung von Gasen führt.
Mangelernährung- und Überernährung ~ Im Hungerzustand passt der Körper seinen Stoffwechsel an den gegenwärtigen Nährstoffmangel an, und greift zur Gewährleistung der Energieversorgung auf seine Energiespeicher zurück. Als Erstes werden die Glykogenvorräte der Leber aufgebraucht, bevor auf den Verbrauch von Fetten und Proteinen umgeschalten wird. Die Gluconeogenese aus glucoplastischen Aminosäuren, Glycerin und Lactat gewährleistet einen Minimalbedarf an Glucose und hält den Blutzuckerspiegel aufrecht. Durch eine gesteigerte Lipolyse werden vermehrt Ketonkörper gebildet, was zur Entstehung einer Ketoazidose führt. Die Ketone können von den meisten Organen zur Energiegewinnung genutzt werden und führen zu einer Einsparung von Glucose und Proteinen. ~ Herrscht ein Überschuss an Nährstoffen, d. h. werden mehr Nährstoffe zugeführt, als entsprechende Energie verbraucht wird, so werden diese in Form von Fett gespeichert, wobei pro 8-9 überschüssige kcal 1 g Fett gespeichert wird. Während ein geringer Überschuss an Kohlenhydraten noch in Form von Glykogen gespeichert werden kann, führen größere Mengen an Kohlenhydraten zur Umwandlung in Fettgewebe. Auch Proteine werden, insofern keine Muskelaufbauphase besteht, in Fett oder Glucose umgewandelt. Folgen einer chronischen Überernährung sind Adipositas und sämtliche damit verbundenen Risiken.
Zusammenfassung X Um den durchschnittlichen Grundumsatz zu decken, benötigen wir eine
tägliche Energiezufuhr von etwa 1900 kcal (8000 kJ). X Kohlenhydrate sollten idealerweise etwa 55%, Proteine 15% und Fette 30%
unserer Gesamtnahrung ausmachen.
• Die Hauptbestandteile unserer Nahrung' sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Diese unterscheiden sich in Ihrem Energiegehalt und werden über
unterschiedliche Mechanismen verdaut.
• Der Abbau der Nahrungsbestandteile geschieht mithilfe verschiedener
enzymhaltlger Verdauungssekrete, wie Speichel, Magensaft und Pankreassaft. Die Galle Ist v. a. für die Fettresorption von Bedeutung.
X Störungen der Verdauung können zu Diarrhö, Meteorismus und Mangelerscheinungen führen.
Das Muskelgewebe
Kontraktiler Apparat der Muskelzelle
Man untenei lt das Muskelgewebe im menschlichen Körper in quergestreifte und glatte Muskulatur. Die Kontraktion der quergestreiften Ske· Jettmuskulatur steuern wir willkürlich, es handelt sich um schnelle Komraktio· nen. Ebenfalls quergestreift ist die Herzmuskulatur, deren Kontraktion aber nicht willkürlich steuerbar ist. Glatte Muskelzellen werden vom vegetativen Nervensystem innerviert und unter liegen somit nicht der Willkürmo· torik. Sie findet man in den inneren Or· ganen sowie in den Wänden der Gefäße. In diesem Kapitel wollen wir uns auf den Skelettmuskel, dessen Kontraktions· mechanismus und seine Energiequellen konzentrieren.
Die quergestreifte Muskulatur
Jeder Skelettmuskel ist aufgebaut aus Muskelfaserbündeln, die wiederum aus einzelnen Muskelfasern bestehen. Die Fasern sind aufgebaut aus Myofibrillen, die sich aus vielen Sarkomeren zusam· mensetzen (I Abb. I).
Aufbau eines Sarkomers Beim Sarkomer handelt es sich um die kleinste funktionelle Einheit der Musku· latur. Die Grenze zwischen zwei sol · chen Sarkomeren bilden die Z-Streifen. Zwischen ihnen befinden sich Aktemyosine, alle Muskelproteine, die am Kontraktionsvorgang beteiligt sind:
111> In den Z·Scheiben verankert sind die dünnen Aktinfilamente. Bestandteile sind F·Aktin, Tropomyosin und Troponin, das die Bindung zwischen Aktin und Tropemyosin stabilisiert. Die Enden der Filamente treffen sich nicht in der Mitte des Sarkomers. 111> In der Mitte des Sarkomers befi nden sich die dickeren Myosinfilamente. An einem Ende haben diese Fi lamente Köpfe, die einen ATP·Komplex binden können und ATPase Aktivität besitzen. Dieser Bereich ist sehr wichtig für den Kontraktionsmechanismus. Die Enden von Aktin- und Myosinfilamen ten über·
Jappen sich.
111> Den Mittelpunkt zwischen zwei Z· Scheiben bildet die sogenannte M-Zone. Dies ist auch genau der Mittelpunkt der Myosinfilamente, die sich nach beiden Seiten gleich lang erstrecken. 111> Der Bereich des Sa rkomers, in dem nur Myosinfilamente sind , wird als H-Zone bezeichnet. 111> Anschließend fo lgt die I-Bande, in der sich Aktin- und Myosinfilamente überlappen. 111> Den äußersten Bereich, in dem sich nur Aktinfilamente befinden, bildet die A-Bande.
Sarkoplasmatisches Retikulum und Sarkolemm Das endoplasmatische Retikulum der Muske lzelle, auch sarkoplasmatisches Retikulum oder longitudinales System genannt, unterscheidet sich von dem der restl ichen Zellen unseres Körpers. Es fungiert als Calciumspeicher und hat somit eine wichtige Aufgabe bei der Kontraktion des Muskels. Auch die Membran , welche die Muskelzelle umgibt, unterscheidet sich von der normalen Zellmembran: An der Innenseite der Membran ist ein Protein namens Dystrophin angelagert, das die Membran stabilisiert. Außer· dem ist sie umgeben von einer Kollagen· schicht, die an den Enden der Fasern die Muskelsehnen bildet. Des Weiteren bil-
• • · · Aktinfilament
det sie quer zu den Muskelfa sern stehende Einstülpungen aus, die sogenannten T-Tubuli oder auch transversales System. Diese befinden sich im Bereich der I-Bande, der Überlappung von Aktinund Myosinfilamenten. Sie helfen dabei das an der motorischen Endplatte anko~mende Aktionspotential schnell über die gesamte Muskelfaser zu verteilen.
Das Zytoskelett Das Zytoskelett, in dem sich die oben genannten Proteine fü r die Kontraktion befind en hat die Aufgabe, der Muskel· zelle Hal t zu geben und sie zu stabilisieren. Es muss aber auch elastisch gebaut sein , um die Kontraktion zu ermöglichen. Innerhalb des Sarkomers sorgen Proteine wie Titin, Myomesin und a.·Aktinin für Halt. Außerhalb besteht ein System aus Intermediärfilamenten wie dem schon erwähnten Dystrophin, das das Sarkomer in der Zelle stabilisiert.
Mechanismus der Kontraktion
Auslösung der Kontraktion Durch ein Motoneuron wird ein Aktionspotential aus dem Rückenmark an die motorische Endplatte geleitet und auf die Muskelfasern übertragen. Eine Gruppe von Muskelzellen, die von einem Motoneuron innerviert werden, bezeichnet man hierbei als motorische Einheit. Erreicht ein Aktionspotential die motorische End platte, so kommt es zur Ausschüttung von Acetylcholin, einem Transmitter, der bewirkt, dass das Akti·
l~~o++-+--l•·;lone · · : Sarko-:- H·Zone ; A·ßande ; mer
i- I-Bande : 11'1~~~""NI · · · · Z·Streilen ···~---········ :
• · • • Myoslnlilament
I Abb. I : Aufbau eines Sa rkomers [18)
-d - -AlP-Hydrolyse
ADP und P; gebunden
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 130 I 131
Kraftentwicklung
Energieumsatz der Muskulatur
Der Energieverbrauch des Muskels ist sehr hoch. Um diesen decken zu können, hat er verschiedene Möglichkeiten, um ATP zu gewinnen:
..,. gespeichertes ATP: Das in der Zelle vorrätige ATP reicht bei Belastung des Muskels nur für ein paar Sekunden
" ~ /_ 'ATPl· ~ AlP ~
..,. Kreatinphosphat Die Muskelzelle hat die Möglichkeit, aus der Umwandlung von Kreatinphosphat zu Kreatin ATP zu gewinnen. Katalysiert wird diese Reaktion von der Kreatin-Kinase. Die auf diesem Wege gewonnene Energie reicht etwa eine halbe Minute .
AlP-Bindung ---.. Myosinkopf vom Aktin gelöst I Abb. 2: Kontraktionszyklus
[21
..,. Glucose: Das im Muskel gespeicherten Glykogen wird bei Bedarf zu Glucose abgebaut und dieses in der Glykolyse weiterverwertet Außerdem kann dem Blut Glucose entnommen werden. Das in der Glykolyse gewonnene ATP wird für die Kontraktion benötigt. Die in der anaeroben Glykolyse gewonnene Energie reicht für etwa 1,5 Minuten. Nach einer halben Minute Muskelarbeit setzt die aerobe Glykolyse ein.
anspotential über die T-Tubuli die komplette Muskelfaser erreicht. Eine weitere Folge ist die Öffnung von Calciumkanälen im Sarkolemm und in sarkoplasmatischen Retikulum, was einen starken Einstrom von Calcium und in der Folge einen Anstieg der Calciumkonzentration ums Sarkom er bewirkt. Dies ist der auslösende Faktor der Kontraktion.
Ablauf der Kontraktion Bei der Kontraktion gleiten die Aktinund Myosinfilamente ineinander. Es findet keine Verkürzung der Fibrillen statt. Dies läuft folgendermaßen ab (I Abb. 2): Die Bindungsstellen fü r Calcium im Aktin werden nach Anstieg der Calciumkonzentration besetzt. Dadurch wird die Bindungsstelle für das Myosinköpfchen am Aktin fre i. Bei Bindung der Köpfchen des Myosins verändert sich deren ATPBindungsstelle so, dass ATP gebunden werden kann. Dieses wi rd zu ADP + P1
gespalten. Durch diese Reaktion "kippt" das Myosinköpfchen von seiner Ausgangsstellung, die in etwa senkrecht is t um 45° ab und zieht die Enden des Aktins in Richtungder Mi tte des Sarkomers. Das ebu ndene ADP wird freigegeben und die ATP-ßi ndun sst ll e ist
frei. Bindet ein neu es ATP, löst sich die Bindung ans Aktin und ein neuer Kontraktionszyklus kann ablaufen. Diesen Zyklus nennt man auch OuerbrückenzykJus. Die gesamte Verkürzung des Muskels setzt sich zusammen aus vielen solcher Zyklen verschiedener Sarkomere. Ein einzelnes abkippendes Myosinköfpchen führt nur zu einer zusätzlichen Überlappung von Aktin und Myosin um 5 nm.
Zusammenfassung
..,. ß-Oxidation: Beim Abbau von Fettsäuren ent<;tehende Energie wird nach einigen Minuten verwendet, die Fettsäuren werden dem Blut entnommen. ..,. Ketonkörper: Energie aus dem Ketonkörperabbau wird im Hungerzustand für die Muskelarbeit benötigt.
IC Muskulatur wird unterteilt in quer gestreifte und glatte Muskulatur.
Zur quer gestreiften gehört zum einen die willkürliche Skelettmuskulatur
und zum anderen die nicht willkürlich steuerbare Herzmuskulatur. Glatte
Muskulatur ist ebenfalls nicht willkürlich zu steuern.
IC Das Sarkomer der Muskelzelle ist aufgebaut aus Aktin- und Myosin
filamenten.
IC Bel der Kontraktion wird durch die AlPase-Tätigkeit des Myosinköpfchen
ATP gespalten. Das Myosinköpfchen kippt ab und die Aktin- und Myosin
filamente gleiten ineinander.
IC Die für die Kontraktion benötigte Energie wird aus in der Zelle gespeicher
tem ATP, aus Kreatinphosphat, aus Glucose, dem Abbau von Fettsäuren
und Ketonkörpern gewonnen.
Das Nervensystem
Aufbau des Nervensystems
Im Nervengewebe find et man einen hohen Anteil polarer Fette. Dieser ist in der weißen Substanz noch höher ist als in der grauen. Das liegt daran, dass die Membranen der Myelinscheiden und der markhaltigen Nervenfasern durch den hohen Lipidanteil stabilisiert werden . Außerdem gibt es im zentralen Nervensystem (ZNS) Stoffe, die sonst im Körper nicht vorkommen, wie zum Beispiel Endorphine. Dies sind Peptide, die an den gleichen Rezeptoren wirken wie Opiate und eine schmerzlindernde Wirkung haben .
Myelin Myelin ist das Gewebe, das die Axone der Nervenfasern umhüllt. Es besteht zu etwa drei Vierteln aus Lipiden und zu etwa einem Viertel aus Proteinen. Je dicker die Myelinh ülle einer Nervenfaser ist, desto schnell er ist dessen Erregungsleitungsgeschwindigkeit. Die Myelinscheiden sind Ausstülpungen spezieller Gliazellen. Im zentralen Nervensystem sind dies die Oligodendrozyten, im peripheren Nervensystem die Schwann'schen Zellen. Die Myelinscheiden werden unterbrochen von Aussparungen, den sogenannten Ranvier'schen Schnürringen.
Die Blut-Hirn-Schranke Bei der Blut-Hirn-Schranke handel t es sich um eine natürliche Barriere zwischen dem ZNS und dem Blutkreislauf.
Aufbau Die Blut- Hirn -Schranke wi rd gebildet durch:
.,_ sogenannte Tightjunctions der Kapillarzellen. Die Tight junctions versch ließen die Zellzwischenräume und kontrollieren den Durchfluss von Molekü len.
.,_ eine durchgängige Basalmembran. Sie erstreckt sich über die Endothelzellen, die Astro- und die Perizyten. .,_ eine li pidhaltige Endothelzellmembran. Diese sorgt zusätzlich für Wasserdich te.
Funktion Für polare Substanzen ist die Blut-H irnSchranke undurchlässig. Lediglich fettlösliche Moleküle wie beispielsweise Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Alkohol, Narkosemittel oder auch verschiedene Drogen sind in der Lage, die Barriere zu passieren. Andere Stoffe können die Schranke nur mit fremder Hilfe durchqueren. Diese Hilfe können Carrier leisten, wie der GLUT 3 für Glucose oder aber Ionenkanäle, die einen aktiven Transport ermöglichen. Bei Entzündungen und anderen Erkrankungen wie zum Beispiel der Multiplen Sklerose kann es zu einer Schädigung der Blut-Hirn-Schranke kommen. Die Barrierefunktion ist zerstört und andere Substanzen können die Schranke passieren. Erkennen kann man eine solche Störung anhand einer Liquorpunktion.
Die Blut-Liquor-Schranke Die Blut-Liquor-Schranke hat die Funk· tion, die Liquorräume vom Blutsystem abzutrennen.
Aufbau und Funktion Diese Schranke besteht aus
.,_ der Basalmembran der Epithelzellen der Plexus choroidei , .,_ Tightjunctions .,_ und den Endothelzellen der Blutkapillaren .
Die Basa lmembran der Plexus choroidei wird gebildet aus Kollagenen und Proteoglykanen (s. Kap. 134). Nur Wasser, Sauerstoff, Koh lenstoffdi oxid und wenige weitere Molekü le sind in der Lage, diese Barriere zu passieren .
Energiegewinnung des ZNS
Unser Gehirn benötigt jeden Tag twa 1600- 200 kj an Energie. Dies sind 20% des gesamten Energieumsatzes unser s
Körpers und das, obwoh l das Gewicht des Geh irns nur etwa 2% des gesamten Körpergewichts beträgt. Der größte Teil di eser Energie wird zur Aufrechterha ltung des Membranpotentials genutzt, welches Erregungen sowie deren Weiterleitung ermöglicht.
.,_ Aerobe Glykolyse: Das Ge hirn verbraucht ca. I 00 g Glucose pro Tag, wobei es nicht die Möglichkeit hat, diese zu speichern , sond ern auf die ständige Zufuhr aus dem Blut angewiesen ist. Die Aufnahme der Glucose gesc hieht unabhängig von Insulin über einen GLUT-3-Transporter. In der Glykolyse wird die Glucose nun, wie in Kapitel 54 beschrieben, abgebaut. .,_ Ketonkörper: Ist das Glucoseangebot des Bluts zu niedrig, so ist das Nervensystem außerdem in der Lage, durch den Abbau von Ketonkörpern Energie zu gewinnen. Der Ablauf des Ketonkörperabbaus wird in Kapitel 70 dargestell t.
Sowohl die aerobe Glykolyse als auch der Ketonkörperabbau führen zur Entstehung von Acetyl-CoA. Dieses wird dann über Citratzyklus und Atmungskette zu ATP, also Energie umgewandelt (s. Kap 76+78).
Erregungsweiterleitung und
Neurotransmitter
Erregungen werden über die Nerven in Form von Aktionspotentialen weiterge leitet (I Abb. l ). Diese dauern in Nervenze llen 1- 2 ms. Du rch eine Zunahme der Membranpermeabilität für Na '- Ionen kommt es zum Einstrom dieser in die Zelle und das Membranpotential ste igt. Hat es eine gewisses Schwellenpotential erreicht, öffnen sich Natriumkanäle. Es kommt zur Depolarisation. Nachdem für eine kurze Zeit ein positives Potential erreicht worden ist, öffn en sich Kaliumkanäle. K•- tonen strömen aus der Zelle aus, es kommt zur Repolarisation. Nach Erreichen
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 1321 133
MP[mV] +60 - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -, - - - - -
I Abb. 1: Aktionspotential [aus Speckmann, Physiologie]
synthetisieren. ln der Präsynapse wird es in Vesikeln verpackt gespeichert. Gelangt ein Aktionspotential an die Synapse, wird Acetylcholin in den synaptischen Spalt ausgeschüttet Es bewirkt eine Öffnung von Na+-Kanälen
I
+40
+20 Depola-risation
0 - 20
-40 Nachpotenzial ~S
I I an der Postsynapse, was dort eine Depolarisation zur Folge hat. Nun muss das Acetylcholin wieder aus dem Spalt entfernt werden, damit es nicht zu einer dauerhaften Erregung kommt Diese Aufgabe übernimmt die Acetylcholinesterase. Sie spaltet es in die Bestandteile Acetyl-CoA und Cholin, die wieder in die Präsynapse aufgenommen werden können und dort zur erneuten Synthese verwendet werden.
-60 -- - -- -~-- - ------- ~-- - ·
-80 '-v-'
1 ms
des Ausgangspotentials fi ndet noch eine Hyperpolarisation statt, die dadurch entsteht, durch ein verzögertes Schließen der Kaliumkanäle. ln Nerven ohne Myelin werden die Aktionspotentia!e kontinuierlich weitergeleitet. Der unmittelbar folgende Bereich der Membran wird erregt. In myelinisierten Nerven hingegen findet eine sal ta torische Weiterleitung der Erregung statt. Diese "springt" von einem Ranvier'schen Schnürring zum nächsten. Diese Form der Erregung ist viel schneller als die kontinuierliche. Für die Übertragung eines Reizes von einer Nervenzelle zur nächsten bzw. von einer Nerven-auf eine Muskelzelle sind Synapsen zuständig. Gelangt ein Aktionspoten tial an eine Synapse, so werden von der präsynaptischen Membran Neurotransmitter in den synaptischen Spal t ausgeschüttet. Diese besetzen Rezeptoren an der Postsynapse, um dort die gewünschte Reaktion auszulösen (I Abb. 2). Einige wichtige Neurotransmitter sind in I Tabelle I dargestell t Den wichtigsten der Überträgerstoffe, das Acetylcholin wollen wir nun noch einmal näher betrachten. An diesem
Tronemltter Wirkunport
Acetylcholin motorische Endplatte, Parasympathikus, ZNS, präganglionäre Übertragung des Sympathikus
Noradrenalin postganglionäre Übertragung des Sympathikus
Dopamin hemmende Wirk ung im ZNS
Glutamat erregende Wirkung im ZNS
GABA (Gamma- hemmende Wirkung im ZNS Amlnobunersäure)
I Tab. 1: Neurot ra nsmiuer und ihre Wi rkungsorte
Zeit
Beispiel kann man auch den Vorgang verstehen, der abläuft, wenn eine Erregung eine Synapse erreicht: Die Nervenzellen sind in der Lage, aus Acetyl-CoA und Cholin Acetylcholin zu
Präsynapse
..___ __ __, • • • Exozytose des synapti scher Spalt
Postsynapse [
Zusammenfassung
• • • Transmitters
Y ~ Y Rezeptor
J I Abb. 2: Erregungsübertragung an einer Synapse [11
X Das helle Aussehen der weißen Substanz des Gehirns kommt durch die Myelinisierung der Nervenfasern zustande. Die graue Substanz wird vom unmyelinisierten Gewebe gebildet.
ac Die Blut-Hirn-Schranke sowie die Blut-Liquor-Schranke haben die Funktion, das Gehirngewebe bzw. den liquorraum vom Blutkreislauf zu trennen. Sie sind nur für wenige Substanzen durchlässig.
ac Das Gehirn hat einen sehr hohen Energieverbrauch. Es ist in der Lage, durch aerobe Glykolyse und, in Hungerzeiten, durch Ketonkörperabbau ATP zu gewinnen.
ac ln myelinisierten Nerven werden Erregungen saltatorisch weitergeleitet. Dies ist um ein Vielfaches schneller als dle kontinuierliche Weiterleitung der unmyelinisierten Nerven.
X An Synapsen werden Transmitter benötigt, um die Erregung von Präauf Postsynapse zu übertragen. Der wichtigste Neurotransmitter ist Acetylcholin.
Das Binde- und Stützgewebe
Das Binde- und Stützgewebe kommt in vielen Bereichen des extrazellulären Raums unseres Körpers vo r_ Es kommt vor in Knochen, Knorpel, Bändern und Sehnen und ist unter anderem beteiligt am Aufbau der Blutgefäße, vieler parenchymatöser Organe und des Fettgewebes. Die Zellen, die für die Bildung des Bindegewebes zuständig sind, stammen alle von mesenchymalen Stammzellen ab. Sie bilden zusammen die sogenannte extrazelluläre Matrix:
..,. Chondroblasten: zuständig für die Knorpelbildung ..,. Fibroblasten: übernehmen die Produktion der Matrix in Sehnen und Bändern ..,. Osteoblasten: wichtig beim Aufbau des Knochens ..,. Endothelzellen: extrazelluläre Matrix in Gefäßen
Makromoleküle der extra
zellulären Matrix
Die oben genannten Zellen produzieren die extrazelluläre Matrix, die aus folgenden Makromolekülen besteht:
..,. Kollagene
..,. Elastin
..,. Proteoglykane
..,. Hyaluronsäure
Kollagene
Sie kommen in großer Menge vor und bilden fast ein Drittel der Gesamtproteine des menschlichen Körpers. In unter
schiedlichen Geweben kommen verschiedene Subtypen des Kollagens vor. Man unterscheidet zwischen fibrillären und nichtfibrillären Kollagenen. Eine Auswah l der großen Anzahl unterschiedlicher Typen zeigt I Tabelle 1. Die Subtypen I- Ill sind fibrillär und machen 90% aller Kollagene aus. Typ IV ist der wichtigs te Vertreter der nichtfibrillären Kollagene und betei ligt am Aufbau der Basaimembranen.
Kollagentyp Vorkommen
Knochen. Gefäße, Haut, Sehnen, Lunge
Knorpel
11 1 Haut, innere Organe, Gefä ße
IV Basalmembranen
I Tab. I: Ko llagen typen und ihr typisches Vor
kommen
Synthese der Kollagene: Die Synthese der Kollagene geht von den Fibroblasten aus. Sie findet sowohl intra- als auch extrazellulär statt:
..,. Im ersten Schri tt werden a-Präprokollagen- Monohelices gebildet. In diesen Proteinen ist ungefähr jede dritte Aminosäure Glycin und jede fünfte Prolin. Beide sind sehr wichtig für den Aufbau der Kollagene. ..,. Durch Abspaltung des Signalpeptids entsteht nun Prokollagen. ..,. Im dritten Schritt werden die entstandenen Monohelices durch Knüpfung von Disulfidbrücken zu Tripelhelices verbunden. ..,. Hydroxylierung eines Teil der Prolin- (etwa 50%) und der Lysinreste ( l 0- 80%) führt zu einer Stabilisierung der Tripelhelices. Außerdem kommt es zu einer Glykosylierung von Hydroxylysinresten _ ..,. Als Nächstes werden die ProkollagenTripelhelices in den extrazellulären Raum sezerniert. ..,. Dort findet eine Abspaltung N- und C- terminaler Peptidreste durch Peptidasen statt. Produkt sind fertige Kollagenmoleküle, die sich zu Mikrofibrillen zusammenlagern . ..,. Letzter Schritt ist eine Ouervernetzung der Mikrofibrillen durch Aldehydgruppen. Dies führt zu einer weiteren Stabilisierung.
El astin Wichtigste Funktion des Elastins ist es, dem Bindegewebe elastische Eigenschaften zu verleihen. Dies wird vor al lem dort benötigt, wo große Volumen - und Druckschwankungen herrschen : l n Arterien, den Stimmbändern, dem Respira
tionstrakt und der Haut. Während der Synthese polymerisi r n Elastinmoleküle zu Aggregaten, die
dann zusammen mit Kollagen und Glykoproteinen elastische Fasern bi lden.
Proteoglyka ne Hierbei handelt es sich um Pro teine mit Kohlenhydratseitenketten. Die Seitenketten bestehen aus repetitiven Disaccharideinheiten. Eines der Saccharide ist meistens ein Hexosamin_ Man bezeichnet diese Se itenketten auch als Glykosaminoglykane. Sie sind nega tiv geladen, was ihnen ermöglicht, Molekü le reversibel zu binden. Funktion der Proteoglykane ist die Bindung von Wasser, das dem extraze llulären Gewebe wie ein Polster Elastizität verleiht.
Hyalu ronsäure Hya luronsäure besteht ebenfalls aus Glykosaminoglykanen, hat aber keinen ProteinanteiL Aufgebaut sind die Disaccharide aus N-Acetylglycosamin und Glucuronsäure . Die Funktion der Hyaluronsäure gleicht derer der Proteoglykane, sie sorgt durch Wasserbindung für Elastizität.
Knochen
Beim Kn ochen handelt es sich um Stützgewebe, das an sämtlichen Bewegungen des Körpers beteiligt ist. Es schützt die Organe und fungiert außerdem als Calcium- und Phosphatspeicher.
Bestandteile des Knochens Zu 70% besteht Knochen aus anorganischen Substanzen. Den größten Te il dieser Masse bildet Hydroxylapatit, außerdem sind Minera lien enthalten. 20% des Kn ochens werden von organischen Substanzen gebildet: extraze lluläre Matrix, Kollagen, vor allem Typ l, Osteoblasten und Osteoklasten. l 0% des Knochens bestehen aus Wasser. Im Knochen unterscheidet man die Substantia compacta von der Substantia spongiosa. Die Substantia compacta bildet die b rfläche aller Knochen und Schäfte der mit gelbem Fettmark ge füllten Röhrenknochen. Es hand lt sich um eines hr dichte Mas ·e, die dem Kn chen tabilität v rleih t.
Substantia spongiosa find et sich in den Epiphysen der Röhrenknochen und füllt die flachen Knochen vollstandig aus. Diese locker gebaute Masse enthält das blutbildende Knochenmark.
Knochenaufbau
Beim EIWBchsenen herrscht zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau ein Gleichgewicht. Für den Aufbau sind die Osteoblasten, fOr den Abbau die OsteoIdasten zuständig.
Der Knochenaufbau läuft fo lgender· maßen ab:
.".. Die für den Knochenaufbau zuständigen Osteoblasten produzieren die Knochengrundsubstanz, das Osteoid.
Spezielle Biochemie der verschiedenen Organe 1341 135
ten an die Oberfläche des Knochens an und bilden dort ein Kompartiment, die sog. Howship-Lakune. .".. In diese Lakune werden nun Protonen abgegeben. Zuständig hierfür ist eine H+-ATPase. Die H+-Ionen sorgen für ei ne En tmineralisierung des Knochens. Die Osteok.lasten nehmen die freiwerdenden Calciumionen und weitere Mineralien auf und geben sie ans Blut ab. .".. Für die Auflösung des Osteoids sezernieren die Ostecklasten Phosphatase und Proteasen in die Lakunen. Die Abbauprodukte werden von den Osteoklasten an Lysosomen
weitergegeben und dort fertig abgebaut.
Regulation von Knochenaufbau und -abbau Die in den Knochen eingemauerten Osteoblasten und Ostecklasten stehen über sog. Gap-junctions miteinander in Verbindung. Dies dient zum einen der Versorgung der Zellen mit Nährstoffen, zum anderen der Übertragung von Informationen, zum Beispiel der Signale von Hormonen und anderen Botenstoffen. Diese regulieren Synthese und Abbau des Knochens. Die Wirkung der verschiedenen Stoffe zeigt I Tabelle 2.
Dieses besteht ZU etwa 90% aus Kolla- Botenstoff Wirkung
gen Typ 1, aus Proteoglykanen sowie Wachstumshormon -------------------------------------------------------Stimulation der Osteoblasten
Matrixproteinen. Kalzitrial (Vitamin-0-Harmon) ----~------~~---------------------------------------
Stimulation der Osteoblasten
.... Nach Bildung des Osteoids wandeln Parathormon Freisetzung von Interleukin t und Kollagenase aus Osteoblasten führt zu einer Demineralisierung des Knochens und Erhöhung des Calciumspiegels im Blut. Außerdem Stimulation der Osteoklasten
sich die Osteoblasten zu Osteozyten um. Diese haben als Aufgabe die Mine- · ralisation des Knochens. Glukokortikoide Hemmung der Osteoblasten
Stimulation der Ostecklasten .".. Für die Mineralisation speichern die Osteozyten Kalziumphosphat in Vesikel verpackt Diese Vesikel geben sie in den Extrazellulärraum ab. Die Calciumphosphate fallen dort aus und führen zu einer Kalzifizierung des Knochens . .".. Die Osteozyten selbst bleiben in der nun fertigen Knochensubstanz gespeichert.
Embryologisch wird der größte Teil der Knochen zuerst als Knorpel angelegt, der dann zu Knochen umgebaut wird. Diesen Vorgang nenn t man chondrale Ossifikation. Gesichtsknochen sowie die des Schädels werden ohne diese Vo rstufe gebildet. Es handelt sich um desmale Ossifikation.
Knochenabbau Osteoklasten, die für den Abbau der Knochensubstanz zustä ndig sind, sind mehrkern ige Riesenzellen, die von Monozyten-Makrophagen-Stammzellen abstammen. Der Abbau des Knochens:
.".. An Stellen, wo Kn ochen abgebaut werden soll , Ia rn sich die steoklas-
Östrogene
Interleukin 1
Kalzitonin
Stimulation der Osteoblasten
Hemmung der Ostecklasten
Stimulation der Ostecklasten
Hemmung der Ostecklasten
I Tab . 2: Regulation des Knochenstoffwechsels
Zusammenfassung X Binde- und Stützgewebe bildet die extrazelluläre Matrix des Körpers.
Sie besteht vor allem aus Kollagen, Elastin, Proteogiykanen und Hyaluronsäure.
X Wichtige Aufgaben sind die StOtzfunktion und die Verleihung von Elastizität.
X Kollagene bilden den Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix. Die verschiedenen Subtypen sind unter anderem wichtig beim Knochen- und Knorpelbau und Bestandteile vieler anderer Gewebe.
X Knochen sind aufgebaut aus organischer sowie anorganischer Substanz. Für den Knochenaufbau sind die Osteoblasten zuständig, den Abbau übernehmen die Osteoklasten.
X An der Regulation des Knochenumbaus sind verschiedene Hormone zuständig. Beim Erwachsenen findet ständig Knochenaufbau und Knochenabbau parallel statt.
Versuch 1: Serumelektrophorese
Kasuistik Ein 63-jähriger Patient kommt zu Ihnen
in die Praxis. Er klage seit etwa 6 Monaten über Müdigkeit und mangelnde Belastbarkeit. Außerdem schwitze er in
der Nacht ziemlich viel, was ihm sehr unangenehm se i. Auf Nachfrage gibt
der Patient an, innerhalb der letzten Zeit 4 kg abgenommen zu haben, ob
wohl er eigentlich normal gegessen habe. Bei der körperlichen Untersuchung fiel neben Lymphknotenschwellungen (Lymphadenopathie) ein verringertes Vibrationsempfinden (Pallhypaes
thesie) als Hinweis auf eine beginnende
Polyneuropathie auf. In der abdominellen Sonographie konnte zudem eine Vergrößerung der Milz nachgewiesen
werden (Splenomegalie). Bei der geschilderten B-Syrnptomatik (Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Gewichtsverlust) und den auffälligen
Untersuchungsbefunden (Lymphadenopathie, Splenomegalie) stellte sich der
dringende Verdacht auf eine hämatolo
gische Erkrankung. An Diagnostik wur
de neben bildgebenden Verfahren und einer histologischen Untersuchung des
Knochenmarks bzw. der Lymphknoten auch eine Elektrophorese der Serumproteine durchgeführt, die einen typischen
Befund ergab (I Abb. 2, E).
Serumelektrophorese
Unter Elektrophorese versteht man die
Auftrennung verschiedener Substanzen
durch Anlegen einer elektrischen Span
nung. Da die verschiedenen Proteine bei einem bestimmten pH-Wert eine
unterschiedliche Anzahl von Ladungen
tragen, unterscheiden die sich in ihrer Wanderungsgeschwindigkeiten im elek
trischen Feld. Diese Methode wird in der Klinik routinemäßig zur Auftren
nung der Serumproteine verwendet, die sich aufgrund ihrer Wanderungs
geschwindigkeiten in fünf Gruppen
einteilen lassen (Albumin, a1, a z, ß, y). Abweichungen vom typischen Vertei lungsmuster (I Abb. I ) können Hinwei
se auf Erkrankungen liefern.
Grundlagen Allgemein hängt die Wanderungsge
schwindigkeit eines Teilchens im elek-
trisehen Feld im Wesentlichen von zwei
Faktoren ab: von der Größe und Gestalt des Teilchens und von seiner Ladung.
.,.. Positiv geladene Teilchen (Kationen)
wandern im elektrischen Feld in Richtung der Kathode, während sich negativ
geladene Teilchen (An ionen) auf die An
ode zubewegen. Teilchen, die sowohl positiv als auch negativ geladen sind ,
besi tzen eine sog. Überschussladung
bzw. Nettoladung. Diese ergibt sich aus
der Summe aller (positiven und negativen) Ladungen und ist von Protein zu Protein unterschiedlich. .,.. Der Beschleunigung des Tei lchens im
elektrischen Feld wirkt dessen Reibung
entgegen. Wie groß diese ist, hängt von
der Größe und der Gestalt des Teilchens ab_
Versuchsdurchführung Damit Proteine im elektrischen Feld wandern, müssen sie im geladenen Zustand vorliegen. Ob Proteine geladen
oder ungeladen sind, hängt wiederum
vom pH-Wert der Lösung ab, die sie umgibt. Damit die elektrophoretische Auftrennung der Serumproteine also gelingt, lässt man sie in einer Lösung ablaufen, die einen alkalischen pH-Wert
aufweist, dem sog. ElektrophoresePuffer_ Die Proteine geben hier ihre H+
Ionen ab und nehmen eine negative Ladung an. Trägt man das Serum nun in der Nähe des Minus-Pols (Kathode) auf, so wandern sie nach Anlegen einer
Spannung unterschiedlich sc hnell in
lj Ii \
ir
Normalbefund Albumin
fl
Richrung der Anode und werden somit in verschiedene Fraktionen aufgeteilt. Zur Elektrophorese wird das Serum auf
ein Trägermaterial aufgetragen. Im Laboralltag haben sich hierfür insbeson
dere zwei Materialien durchgesetzt: Celluloseacetat und Agarose-GeL Diese beiden Methoden sind sich im Versuchsaufbau sehr ähnlich, daher be
sc hränken wir uns auf die Beschreibung der Celluloseacetat-Eiektrophorese.
Ce ll uloseacetat-Elektrophorese Bei diesem Versuchsaufbau wird das
Serum auf einen in Pufferlösung (pH 8,2 bis 8,6) getränkten Celluloseacetatstrei
fen au fge tragen. Anschließend wird eine Spannung von in der Regel 200 - 250 y angelegt, und die Proteine begeben sich
auf Wanderschaft. Die gängige Laufzeit einer Elektrophorese beträgt ca. 20 Mi
nuten. Danach müssen die zunächst unsichtbaren Proteine durch einen
Proteinfarbstoff eingefärbt werden, man
verwendet dazu z. B. Arnidoschwarz
oder Ponceau-Rot Der Celluloseacetetstreifen selbst wird in mehreren Entfärbebädern (z. B. Eisessig-Methanol-Ethanol-Gemisch) entfärbt, so dass nur noch
der ans Prolein gebundene Farbstoff übrig bleibt. Auf dem Streifen sind jetzt
fünf verschiedene Farbbanden zu sehen die unterschiedlich breit sind und deren'
Intensi tät variiert. Sie stellen die verschiedenen Elekrophoresefraktionen
der Serumproteine dar. Die Intensität der Färbung wird mittels Photometrie erfasst und quantifiziert. Sie ist propor
tional zur Proteinmenge, man kann also aus ihr den relativen Anteil einer Pro
teinfraktion am Gesamtproteingehalt errechnen. Ist die Gesamtproteinkonzentration bekannt, lassen sich daraus
"---
I Abb. I : physiologisch Kurve einer Serumelek trophore e 11 51
a
b
akute Entzündung
chronische Entzündung
d
Leberzirrhose
nephrotisches Syndrom
e M. Waldenström
t
Plasmozytom t
Versuch 1 138 I 139
I Abb. 2: Elektropherogramme verschiedener Erkrankungen
t absolute Erhöhung/Erniedrigung t relative Erhöhung
auch Absolutkonzentrationen für die einzelnen Fraktionen ableiten.
Auswertung Bei der Auswertung der Elektrophorese ergibt sich ein typisches Diagramm, in dem die fünf Wanderungsfraktionen dargestellt sind (I Abb. I). Die höchste Spitze bildet das Albumin, das den größten Anteil der Serumproteine ausmacht. Die anderen Fraktionen ( a 1, a 2, ß, und y) stellen sich viel flacher dar. Aus den Flächen unterhalb der Kurve lässt sich der prozentuale Anteil der Fraktionen am Gesamtprotein berechnen (Albumin: 60%,a 1:4%,a2:8%,ß: 12 %,y: 16%).
Pathologische Elektropherogramme
Das Elektropherogramm kann bei verschiedenen Erkrankungen verändert sein. Bei der Auswertung muss man beachten, dass es sich bei den Prozentwerten nur um relative Werte handelt, d. h. wenn eine Fraktion vermindert ist, steigen die anderen automatisch relativ an.
Akute Entzündung Als Folge einer akuten Entzü ndung kommt es in der Leber zu r vermehrten Bildung de1· Akute-! hase·Proteine, die hauptsächlich in den a ·Frak tionen der Elektrophorese laufen. E kommt also zu einer relativen und absoluten Erhö-
hung dieser Fraktionen, insbesondere der a 2-Fraktion (I Abb. 2, a).
Chronische Entzündung Hält eine Entzündungsreaktion länger an, so kommt das spezifische Immunsystem ins Spiel. Es reagiert mit einer gesteigerten Produktion von Immunglobulinen (vor allem IgG), infolge derer die y-Giobuline absolut und relativ erhöht sind (I Abb. 2, b).
Leberzirrhose Bei einer Leberzirrhose ist die Proteinsynthese in der Leber gestört. Dies macht sich vor allem an dem Abfall der Serum-Albuminkonzentration bemerkbar, aber auch der Gesamtproteingehalt ist vermindert. Außerdem kommt es zu einem Anstieg der ß- und der y-Giobulinfraktionen, was sich durch den Rückstau des Blutes über die Pfortader in die Milz erklärt. Dieser führt zu einer vermehrten Produktion von Antikörpern in den Plasmazellen der Milz (I Abb. 2, c).
Nephrotisches Syndrom lnfolge mancher Nierenerkrankungen tritt das nephrotische Syndrom auf, bei welchem es durch Barrierestörungen in den Nierenglomeruli zur erhöhten Aus· scheidungvon Albumin kommt. Folglich ist die Albuminfraktion in der Elektrophorese abso lut wie relativ vermin·
dert, während die a- und ß-Fraktionen relativ erhöht sind (I Abb. 2, d).
Morbus Waldenström Dem Morbus Waldenström liegt eine Proliferation eines Plasmazellklons zugrunde. Dieser produziert Immunglobuline der Klasse M, was dazu führt, dass die linke Flanke der y-Globulinfraktion spitzenförmig erhöht ist (I Abb. 2, e) Die typischen Symptome des M. Waldenströms sind Müdigkeit, B·Symptomatik, Blutungsneigung, Lymphknotenschwellungen, Hepatosplenomegalie und Polyneuropathie (s. Kasuistik).
Plasmozytom Die Pathologie des Plasmozytoms (= Multiples Myelom) ähnelt der des Morbus Waldenströms, allerdings mit ein paar wesentlichen Unterschieden. Beim Plasmozytom handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der massiv Antikörper, und zwar vorwiegend lgG (55%) oder lgA (25 %], produziert. Infolge der extrem gesteigerten Antikörperproduktion zeigt sich im Elektropherogramm ein hoher, schlanker Gipfel im Bereich der rechten y-Globulin-Fianke (I Abb. 2, f).
Versuch II: Photometrische Messung der LOH-Aktivität
Die Lactat-Oehydrogenase (LDH) ist ein Enzym, das im Zytoplasma nahezu aller Körperzellen vorkommt. Sie katalysiert
die reversible Umwandlung von Pyruvat zu Lactat, was gleichzeitig zur Oxidation von NADH/ H+ zu NAD• führt. Mittels eines ein fachen optischen Tests,
der Photometrie, kann die Enzymakti
vität der LDH gemessen werden.
Grundlagen
Prinzipien der
Absorptionsphotometrie Die Photometrie ist eine gängige Methode zur Bestimmung von Konzentrationen gelöster Stoffe. Das Prinzip der Photometrie beruht darauf, dass gelöste Stoffe einfallendes Licht absorbieren,
wobei die Menge der Absorption von der Stoffkonzentration abhängt. Dabei absorbiert jeder Stoff nur Licht einer
bestimmten Wellenlänge. Um also die Konzentration eines Stoffes photometrisch zu bestimmen, wählt man mono
chromatisches Lich t, d. h. man wählt
den Wellenlängenbereich aus, der von den gelösten Molekülen, deren Konzentration zu ermitteln ist, absorbiert wird.
Dies ermöglicht eine selektive Bestimmung einzelner Stoffe in einer Lösung. Mittels eines Beugungsgitters (sog.
Gitter-Monochromator) kann der gewünschte Wellenlängenbereich aus dem weißen Licht einer Lichtquelle heraus
geschnitten werden.
Bestimmung von Konzentrationen
gelöster Stoffe Bestrahlt man eine Küvette, die die zu
untersuchende Lösung enthält, mit monochromatischem Licht, so wird
ein Teil des Lichts durch den gelösten
Stoff absorbiert. Das Licht, das hin ter
der Küvette austri tt, ist also in seiner Intensität (I) im Vergleich zum ein fa llen
den Licht (Intensität 10) gemindert. Mittels Photometer kann man nun
aus diesen beiden lntensitäten die sog.
Transmission, also den Ameil des ein
gestrahlten Lichts, der von der Küvette
durchgelassen wird, bestimmen.
Transmission T = 1110
Um aber die Konzentra tion erm itteln zu
können, benötigt man den Antei l des
Lichtquelle
Beugungsgitter
weißes Licht
Küvette
monochromatisches Licht
I Abb. 1: Prinzip der Photometrie
eingestrahlten Lichts, der absorbiert worden ist, die sog. Extinktion. Diese berechnet sich aus dem LambertBeer'schen Gesetz: Extinktion
E = lg {1 /T) = -lg T = - lg 1110.
Daraus ergibt sich folgender Zusammen
hang zwischen der Transmission und der Extinktion (I Tab. I ): Aus der Extinktion kann man sich die
Konzentration errechnen, wenn man
bedenkt, dass die Extinktion der Konzentration des gelösten Stoffes (c) und der Schichtdicke der Küvette (d} pro
portional ist, d. h. E = c x d x c: .
Zusätzlich benötigt man noch einen weiteren Wert, den Extinktionskoeffizienten (~:). Für jeden Stoff gibt es
einen spezifischen Extinktionskoeffizienten, den man entweder aus der Literatur entnehmen, oder für den Fall , dass man ein Stoffgemisch un tersucht
dann gibt es keinen definierten Extinktionskoeffizienten - selbst erm itteln kann. Letz teres geschieht durch Mes
sung von Standardlösungen mit bekannter Konzentration des zu bestimmenden
Stoffes unter den jeweiligen Reaktionsbedingungen.
Trenomloolon Extinktion
% Dezimal-
bruch
100 - lg I • lg I • 0
10 0. 1 - lg 0. I • lg I 0 • I
0.0 1 - lg 0.0 I • lg I 00 • 2
0.1 0.00 I - lg 0.00 I • lg 1000 • 3
0 0 - lg 0 • un ndllch
gemessene Extinktion
Von der errechneten Extinktion muss noch der sog. Blindwert {E0) abge· zogen werden. Dieser entspr.icht der Extinktion der Küvette, wenn der zu
bestimmende Stoff noch nicht darin enthalten ist. Er ist sozusagen ein Leerwert
' der unabhängig von der Konzentration des zu ermittelnden Stoffes ist, und u. a. durch die Reflektion an der Küvette und
die Absorption des Lösungsmittels zustande kommt.
Bestimmung der LOH-Aktivität Die Lactat-Oehydrogenase (LOH) ist
ein Enzym, das die Umwandlung von Pyruvat zu Lactat katalysiert.
~,' '. "~~. 'f'.l""~:'"'•'r.\Or~.~ ~v ,....-:;.~ . , 1 ·'.-~ • ';, "-1 '•'"·-~.:.·i·""'fl/•1 ~"!...,, .l,; ......... .-~~,'\ "
, ,' , ~I 11 _,.:;_ ~ \.i ~ •' I. • ' ' I
L2 a ", .. >-.. ~ ... :.._ ~ .,. ·~ ...... >~{_; ._ ,'. -_. , ,
Um die Aktivität eines Enzyms zu be
stimmen, muss die Umsatzgeschwindigkeit der katalysierten Reaktion gemessen werden. Diese erhält man durch
Messung der Entstehung oder des Verbrauchs eines Reaktionspartners pro Zeiteinheit.
NAD/ NADH Ein Reaktionspartner der LDH ist das NADH (Nicotin-(säure )amid-adenin
dinucleotid), ein Coenzym, das bei der
Umwandlung von Pyruvat zu Lactat als
I Tab. 1: Zusamm nhang zwi schen Transmission
und Extinktion
Reduktionsmittel dient. Praktischerweise absorbiert bei einer bestimmten Wellenlänge (340 nm) von den fünf Reaktionspartnern nur das NADH (I Abb. 2), man wählt also zur photometrischen Bestimmung der LOH-Aktivität monochromatisches Licht mit einem Wellenlängenbereich zwischen 320 und 380 nm_
Der Enzymtest Um die Enzymaktivität der LDH im Plasma zu bestimmen, wird in einer Küvette ein bestimmtes Volumen an Plasma, NADH und Puffer vorbereitet, und diese in das Photometer gestellt Durch Zugabe von Pyruvat wird die Reaktion gestartet Um die Reaktionsgeschwindigkeit, und damit die Aktivität der LOH bestimmen zu können, messen wir die Extinktionsänderung des NADH pro Zeit ab dem Zeitpunkt der Pyruvatzugabe. Wie wir aus Kapitel 12 bereits wissen, ist die Reaktionsgeschwindigkeit einer enzymkatalysierten Reaktion von der Substratkonzentration und der Enzymmenge abhängig, wobei sie sich bei sehr hohen Substratkonzentrationen asymptotisch der Maximalgeschwindigkei t annähert Wird das Substrat allmählich durch das Enzym umgesetzt, so nehmen dessen Konzentration, und damit auch die Reaktionsgeschwindigkeit, kontinuierlich ab. Damit man also möglichst lange eine konstante Reaktionsgeschwindigkeit erhält, wählt man im Versuch sehr hohe Substratkonzentrationen, die mindestens I 0-fach über der Michaeliskonstante (KM) li egen_
Auswertung des Enzymtests Bei der Messung der Extinktionsänderung des NAD H pro Zeit (öE/ min) bei 340 nm erhält man ei ne typische Kurve (I Abb. 3). Kurz nach dem Start der Reaktion nimmt die Ex tin ktion annähernd um den gleichen Betrag ab, die Reaktionsgeschwindi ke it ist zu Beginn also annähernd konstant päter flac ht die Kurve ab, und zum chluss ändert sich die Exti nktion ga rni ht mehr, und zwar
c 0
~ c
-~
w
260 300 340 380 420 Wellenlänge [nml
I Abb. 2: Absorptionsspektren von NAD ' und NADH
wenn das Reaktionsgleichgewicht erreicht ist In diesem Fall ist das Pyruvat praktisch vollständig in Lactat überführt worden, da das Gleichgewicht bei dieser Reaktion stark auf der Seite des Lactats liegt. Um die Enzymaktivität zu bestimmen, wählt man die Reaktionsgeschwindigkeit zu Beginn der Reaktion, die man durch Anlegen einer Tangente im oberen Bereich der Kurve erhält (I Abb. 3).
Berechnung der Enzymaktivität Die Aktivität eines Enzyms sagt aus, wie viel Substrat das Enzym innerhalb eines Zeitraumes umsetzen kann. Es wird in sog. internationalen Enzymeinheiten (U = Units) gemessen. Eine Unit entspricht der Enzymaktivität, die in einer Minute I 11mol Substrat umsetzt (bei 25°C).
Start der Reaktion
~
Zeit
Versuch 2 140 I 141
1 U • 1 1Jmol Substrat/mln.
Aus der Extinktionsänderung pro Zeit t.E/min, die der Steigung der Tangente in I Abb. 3 entspricht, lässt sich über das Lambert-Beer'sche Gesetz die Konzentrationsänderung pro Zeit (M/min) errechnen_ Unter Mitberücksichtigung des Küvettenvolumens kann auch auf die Enzymakivität in pmollmin geschlossen werden (E = s x c x d 4
t.E/ min = Ex M /min x d). Bei den gängigen Laboruntersuchungen zum Nachweis von Enzymaktivitäten (z .B. im Blutplasma) wird die Enzymaktivität bezogen auf eine Volumeneinheit angegeben, also beispielsweise in U/mL
Klinische Anwendung
Die LDH ist ein intrazelluläres Enzym, das im Blutplasma normalerweise nur in sehr geringen Konzentrationen vorkommt. Kommt es im Körper jedoch aus unterschiedlichsten Gründen zum Zelluntergang, so gelangt die zelluläre LDH ins Blutplasma, was sich in einer Erhöhung der LOH-Aktivität im Plasma widerspiegelt Da es fünf LDH-Isoenzyme gibt, die jeweils in den verschiedenen Organen in unterschiedlich hohen Konzentrationen vorkommen, können durch deren Bestimmung Rückschlüsse auf den Ort der Zellschädigung gezogen werden. So führt der Untergang von Myokardzellen infolge eines Herzinfarkts zum Anstieg der LDH-Isoenzyme l und 2 (s. auch Kap. 10).
I Abb. 3: Extin ktionsänderung (LlE) während eines Enzymtests
·Versuch 111: Titration und physiologische Puffersysteme
Die Wasserstoffionenkonzentration und somit der pH -Wert in unserem Blut liegt wie schon im Kapitel über den SäureBasen-Haushalt beschrieben [s . Kap. 20) in einem sehr engen Bereich. Schwankungen außerhalb des für den Menschen physiologischen Bereichs sind so gefährlich, weil sich dann der Ladungszustand schwacher Säuren ändert Dies
ist vor allem für die Funktion vieler Enzyme sowie für Am inosäuren von Bedeutung, deren Seitenketten analog zur H+-Konzentration geladen sind.
Pathologische Veränderungen des pH Werts können bei vielen Krankheiten entstehen und können lebensgefährlich sein. Auch auf Intensivstationen spielt die Konstanthaltung des pH-Werts der Patienten eine wichtige Rolle. ln diesem Versuchskapitel soll nun erklärt werden, wie man die Konzentration einer Säure bzw. einer Base in einer Lösung bestimmt
Titration
Potentiometrie Die Potentiometrie ermöglicht in der Medizin eine Bestimmung des pH-Werts mittels eines sogenannten pH-Meters. Es handelt sich um ein Verfahren, bei dem eine Glaselektrode in eine Flüssigkei t gehalten wird. Die Elektrode liefert ein
elektrisches Potential anhand dessen der pH-Wert der Flüssigkeit auf zwei Dezi malen genau angegeben werden kann .
Grundlagen der Titration Unter Titration versteht man ein Verfah
ren, mildem man die genaue Konzentration einer Säure oder einer Base in einer Lösung mit einem bekannten
Volumen bestimmen kann. Zur Bestimmung der gesuchten Konzen
tration wird bei der Titration einer Säure nun schri ttweise eine basische
Maßlösung hinzugegeben. Diese muss eine bekannte Konzentration haben, das zugegebene Volumen wird gemes
sen. Meistens wird hier Natronlauge einer Kon zentration von 0, I mol/1 verwendet. Analog dazu wird bei der Titration von Basen eine sau re Maßlösung hinzugegeben . Hierbei handelt es sich zumeist um Salzsäure mit einer Konzen
tration von 0, I mol/ 1.
Durctl die Zugabe der Maßlösung kommt es nun langsam zu einer Neutralisation: Säure + OH- -+ Base + H20.
Der Endpunkt der Titration ist der sogenannte Äquivalenzpunkt, der unge fähr bei pH=7 liegt, insofern bei der Neutral isation keine weiteren Produkte entstehen . Nun lässt sich die Stoffmengen der bis zum Erreichen des Umschlagspunkts zugegebenen Maßlösung aus dem dafür benötigten Volumen und der Konzentration errechnen: n =cx V Aus der Reaktionsgleichung der Titration kann man nun das Verhältn is der Stoffmengen von Puffersäure und Pufferbase entnehmen. Zu letzt lässt sich nun die Konzentration der gesuchten Säure bzw. Base anhand des Volumens
und der Stoffmenge ausrechnen: c = n/V
Arten der Titration Für die Messung des pH-Werts im Verlauf der Titration gibt es mehrere Mög·
lichkeiten :
Titration mithilfe eines Indikators Bei dieser Methode wird vor der Titration zur Lösung ein Indikator hinzu
gegeben. Bei der Titration von Salz-
Ständer
Base (hier NaOH)
Säure (hier HCI) inkl. Farbindikator, der beim Äquiva lenzpunkt umschlägt
säure, verwendet man beispielsweise Bromthymolblau, für Essigsäure Phenolphthalein. Analog zur Änderung des pH -Wens ändert der Indikator seine Farbe. Das Erreichen des Äquivalenzpunktes erkennt man an einem plötzlichen Farbumschlag des Indikators.
Hierbei handelt es sich allerdin gs um eine rela tiv ungenaue Methode, den Äquivalenzpunkt zu messen, da es oft
nicht leicht ist, den genauen Umschlagpunkt zu bestimmen. I Abbi ldung 1 zeigt den Versuchsaufbau einer Titration .
Messung durch pH -Meter Mit dem oben bereits erklärten pHMeter wird nach jeder Zugabe von Maßlösung der pH-Wert gemessen. Die Werte kann man in einer Titrationskurve
(I Abb. 2) eintragen. Bei der Messung mit einem pH-Meter handelt es sich um eine sehr genaue Möglichkeit, den Äquivalenzpunkt zu bestimmen. Dies ist vor allem bei Puffersystemen praktisch, bei deren Titration der pH-Wert sich lange Zeit nur sehr wenig verändert und es
dann plötzlich zum Erreichen des Äquivalenzpunktes kommt. ln der medizinischen Diagnostik wird auch die Maßlösung durch einen elektronischen Titrationsapparat hinzugegeben, was eine noch genauere Messung zur Fo lge hat
I Abb. I : V rsuchsaufbalJ einer Titrati on
Henderson-Hasselbalch'sche Gleichung
Anhand der Ti tration ist es möglich, die "Henderson-Hasselbalsch'sche Gleichung" zu verstehen. Diese ermöglicht die Berechnung des pH-Werts eines Puffersystem bei gegebener Konzentration der Pufferbase, der Puffe rsäure sowie gegebenem pK,-Wert. Der pK5Wert, die Säurekonsta nte gibt Auskunft über die Stärke einer Säure. Je kleiner diese Konstante ist, desto stärker ist die zugehöri ge Säure.
Die Henderson-Hasselbalch 'sche Gleichung ist gültig für alle schwachen Säuren. Beispiele fü r schwache Säuren sind p-Nitrophenolsäure oder Essigsäure, die im Titrationsversuch dieses Kapitels benötigt wird.
Titrat ion von Salzsäure In diesem Versuch liegt ein bekanntes Volumen Salzsäure unbekannter Konzentration vor. Nun wird mithilfe einer Pipette schrittweise Natronlauge mit einer Konzentration von 0, I mol/ 1 hi nzugegeben und der jeweilige pH-Wert mit einem pH-Meter gemessen. Durch die Zugabe der Lauge wird die Puffersäure so Schritt für Schritt neutralisiert, in diesem Fall: Salzsäure+ Na tronlau ge ~ Natriumch lorid (Kochsalz) + Wasser H30 + + Cl- + Na++ OH-~ Na Cl + 2 H20 Trägt man die Menge der zugegebenen Natronlauge (in ml) sowie den jeweils zugehörigen pH-Wert in ein Koord inatensystem ein, so erhält man die zur Titra tion gehörige Titrationskurve (I Abb. 2), anhand derer man den Äqui-
14
12
t 10 w ~ 8 ± n. 6
4
2
Äquivalenzpunkt
0+----------------------NaOH-Zugabe [ml]
valenzpunkt sowie das bis dahin verbrauchte Volumen Natronlauge ablesen kann. Die benötigte Stoffmenge errechnet sich nun aus der Konzentration der Natronlauge sowie dem bis zur Neutralisation benötigten Volumen (n=c x V) . Aus der Reaktionsgleichung ist ersichtlich, dass das Verhältnis von Natronlauge zu Salzsäure I: I ist: n(NaOH) : n(HCI)= I: I Daraus folgt die gesuchte Konzentration der Salzsäure aus der errechneten Stoffmenge und dem bereits anfangs gegebenen Volumen: c(HCI) = n(HCl) /V(HCl).
Kl inische Relevanz Mithilfe von Titration und der Henderson-Hasselbalch'schen Gleichung ist es möglich, die Anteile der verschiedenen Komponenten in einem Puffersystem zu berechnen. Dies kann im Körper das Bicarbonatpuffersystem, der Hämoglobinpuffer, der Protein- oder der Phosphatpuffer sein. Diese Systeme sind in Kapitel 20 beschrieben. Anhand der Berechnungen kann man die Ursache von Störungen des Säure-Basen-Haushalts herausfinden, wie zum Beispiel ein erhöhtes Kohlendioxid sowie erhöhtes Bicarbonat bei einer respiratorischen Azidose und diese behandeln.
Versuch 3 142 I 143
I Abb. 2: Tit rationskurve
Abschließend noch ein Beispiel aus der Praxis, das verdeutlicht, wie wichtig die Diagnostik solcher Säure-Base-Störungen ist. Ein Patient liegt nach einem schweren Autounfall mit Polytrauma und nach einer langen Operation auf der Intensivstation. Noch vor einiger Zeit war der Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Dann klagt er erst über Bauchschmerzen, er trübt vermehrt ein, und es kommt zu einer Hyperventilation. Der Puls steigt bei gleichzeitigem Abfall des Blutdrucks an. Der Patient ist im Schock. Die ermittelten Werte der Blutgasanalyse zeigen bei einem starken Laktatanstieg eine metabolische Azidose, die teilweise respiratorisch kompensiert wurde. Ursache der Laktatazidose ist in diesem Fall der Schockzustand des Patienten nach der Operation. Wichtigste Therapie ist hier die Gabe von Flüssigkei t und Elektrolyten. In extremen Fällen der Azidose können auch puffemde Substanzen verabreicht werden, wie beispielsweise Natriumhydrogencarbonat. Hier muss aber besonders darauf geachtet werden, dass der Patient nicht in eine alkalische Stoffwechsellage rutscht.
Versuch IV: H IV
Kasuistik
Ein 28-jähriger Mann stell t sich in der Infektionsambulanz einer Klin ik vor. Er habe vor etwa vier Monaten ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Der damalige Partner habe ihm nun
offenbart, dass er HIV-positiv se i. Er selbst habe einige Tage nach dem
Geschlechtsverkehr an einem grippalen Infekt, einer Temperaturerhöhung und allgemeinem Schwächegefüh l gelitten_ Außerdem seien ihm geschwollene Lymphknoten am Hals aufgefallen. Aufgrund der geschilderten Situation wird sofort ein HIV-Suchtest veranlasst
und der Patient genau über die Bedeutung von geschütztem Geschlechtsverkehr aufgeklärt. Bei einem HIV-Suchtest handelt es sich um einen ELISA [Enzy
me-Linked-lmmunosorbent Assay)-Test mit einer hohen Sensitivität. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, eine infizierte Person zu erkennen. Allerdings nimmt man hierbei in Kauf, dass auch nicht infizierte Perso
nen als krank getestet werden, man also ein falsch positives Ergebnis erhält. Deshalb wird nach dem Suchtest zur Absicherung der Diagnose ein Bestäti gungstest durchgeführt. Hierbei handelt es sich meist um einen Western-Blot.
Antikörpertest
ELISA Bei der Durchführung eines Antikörpertests, in diesem Fall ein ELISA-Suchtest
für HIV-1 und HIV-2 werden nicht die
Viren selbst, sondern die vom Körper
gegen die Viren gebildeten Antikörper
nachgewiesen. Da diese Antwort des
Immunsystems erst mit einiger Verzö
gerung stattfindet, kann man erst drei
Monate nach Kontakt mi t dem Virus sicher se in, dass ein negativer Test auch
eine Nichtinfektion bedeutet. Allgemein kann man mit einem ELISA
Test verschiedene Viren, Hormone,
Proteine und andere Substanzen nach
weisen. Hierbei nutzt man die Bindung
von Amigenen an die entsprechenden
An tikörper. Entweder Anti gen oder An
ti körper werden vor der Reaktion mi t einem Enzym markiert, das bei einer
stattfindenden Reaktion für eine Fa rb·
veränderung sorgt. Die Stärke des Farbumschlags lässt dann au f die Konzentration des Antikörpers schließen.
Du rc hführung des ELISA-Tests Für einen solchen Antikörpertest werden spezielle Mikrotiterplatten benötigt
[I Abb. I ). Diese Platten haben mehrere
Reihen kle iner Einbuchtungen, die mi t der Substanz [in unserem Fall HIVProteinen) gefül lt werden, die mit dem nachzuweisenden Stoff [hier den HIVAntikörpern) reagieren sollen. In diese Einbuchtungen wird nun das Serum der zu testenden Person gegeben. Bei einem Farbumschlag liegen Antikörper vor, bleibt die Farbe gleich, sind keine entsprechenden Antikörper
im Blut vorhanden. In unserem Fall lägen also bei einer Farbveränderung H IV-Antikörper im Blut der Person vor. Die Wahrschein
lichkeit, dass der Patient HIV-positi v ist, ist dann sehr hoch.
Bestät igungstest - Western Blot Bei einem posi tiven ELISA-Suchtest
wird im Anschluss ein Western Blot Antikörpertes t durchge führ t. Erst wenn auch dieser positiv ist, wird dem Pa tien
ten das Ergebnis mitgeteilt.
Durchführu ng des Western Blots Beim Western Blo t werden unterschied
liche HIV-Proteine nebeneinander in Banden auf eine Trägermembran (z. B.
aus Nitrocellulose) aufgetragen. Hierzu wird ein Polyacrylamid-Gel benötigt .
Nun werden die Proteine elektrophore-
A Antikörper
AA 0 Q () 0 0
Testplatte mil Antigenen beschichtet
Antikörper binden an Antigene. ein Farbumschlag wird sichtbar
tisch auf die Membran übertragen. Die Bindung an die Membran wi rd durch hydrophobe Wechselwirkungen sowie Wasserstoffbrücken gewährleistet. Diese Übertragung, das so genannte
" Blatten", verleiht dem Testverfahren seinen Namen. An die fixierten Proteine können nun An tikörper binden. Hierzu wird die Membran in verdünn tes Serum des zu testenden Patienten eingelegt. Sind im
Serum Antikörper vorhanden, so binden diese an die auf der Membran fixierten H IV-Proteine. Durch ein Waschen der Membran werden die nich t an die Proteine gebundenen Bestandteile des Serums im nächsten Schritt wieder entfernt.
Als Nächstes werden die Proteine, die Antikörper gebunden haben, durch eine Farbreaktion sichtbar gemacht. Sie erscheinen als dunkle Streifen (I Abb. 2). Der HIV-Bestätigungstest wird als positiv bewertet, wenn im Serum Antikör
per gegen zwei oder mehr HIV-Proteine vorl iegen.
PCR-Test
Eine weitere Möglichkeit für einen HIVTest ist die bereits in Kapi tel 50 besprochene PCR. Hierbei werden nicht die Antikörper nachgewiesen, die der Körper gegen die Viren bildet, sondern die Nukleinsäuren der Viren selbst. Dies ist
eine sehr genaue Nachweismethode für HIV, die aber auch mit entsprechend
hohen Kosten verbunden ist.
I Abb. 1: ELISA-T slprinzip
1 Auftrennung der Proteine (SDS·PAGE) 2 Transfer auf den Blot
- -= = - -- -- - - --- - -
Blotting-Membran
D 4 Entwickung mit Chromogen 31dentifizierung mit Antikörper/Enzym
Er wird genutzt, um die Viruslast im Verlauf der HIV-Erkrankung zu bestimmen und die Effektivität der medikamentösen HAART-Therapie (hochaktive an tiretrovirale Therapie) beobachten zu können. Ziel dieser Therapie ist es, die Viruslast im Blut unter die Nach· weisgrenze zu senken. Außer zur Kontrolle der Therapie wird die PCR eingesetzt, um gespendetes Blut auf HIV zu testen sowie in seltenen Fällen zur Diagnose. Hier werden aber aus Kostengründen normalerweise der Antikörpersuchtest sowie der -bestätigungstest angewandt. Ein Ausnahmefall sind zum Beispiel Neugeborene, die noch die Antikörper der Mutter im Blut haben, weshalb Antikörpertests falsch positive Ergebnisse li efern können.
Durchführung der PCR Bevor die PCR durchgeführt werden kann, muss die virale RNA in cDNA umgewandelt werden. Hierbei handelt es sich um eine zur RNA komplemen-
täre DNA, die mithilfe einer reversen Transkriptase aus der viralen RNA hergestellt werden kann. Nun findet die Vervielfältigung der cDNA wie in Kapitel 50 beschrieben statt. Durch die exponentielle Verfielfältigung der DNA lässt sich nach Durchführung der PCR die ursprüngliche Zahl der Viren pro Milliliter Blut berechnen. Die untere Nachweisgrenze für HI-Viren liegt bei etwa 50 Kopien/mi.
Ausblick
An den Folgen der Infektion mit dem 1983 erstmals beschriebenen HumanenImmundefizienz-Virus sind bisher weltweit etwa 25 Millionen Menschen gestorben. Vor allem in armen Ländern der dritten Welt schreitet die Verbreitung des HlV rasend fort, aber auch in Deutschland sind knapp 60000 Menschen mit dem Virus infiziert, bei jährlich etwa 2700 Neuinfektionen. Weltweit gibt es etwa 2,7 Millionen Erkrankte.
Versuch 4 144 I 145
I Abb. 2: Western-Biet [9 ]
Das Retrovirus HIV bindet im Körper des Menschen mithilfe von Oberflächenproteinen an CD4-Rezeptoren der CD4-THelferzellen. Diese werden im Verlauf der Erkrankung durch das Virus zerstört, was letztlich zur lmmunschwäche führt. Anhand der Zahl der T-Helferzellen sowie der durch die Immunschwäche folgenden opportunistischen Infektionen durch Pilze, Bakterien, Parasiten oder Viren wird das Stadium der Erkrankung nach dem sog. CDC-System ermittelt. Schwerstes Krankheitsstadium ist AIDS. Zu den AIDS-definierenden Erkrankungen zählen unter anderem maligne Lymphome, CMV-Infektionen, Kaposi-Sarkome und das Wasting-Syndrom. Die Heilung der Erkrankung bzw. eine Impfung gegen das Virus ist heute noch nicht möglich. Dies ist einer der Gründe dafür, dass der Bekämpfung des HIV ein großer Bereich der Forschung gewidmet wird.
Register
Symbole a-Amanitin 41 a·Amylase 113, 127 a-Helix 26 a·Ketoglutarat 28, 30, 77 a-Ketoglutarar-Dehydrogenase 77 a· Kerosäure 28 a·L·Aminosäuren 24 a, !Horm 52 a·, ß·, o·Zellen 94 a 1-, a2·, ß-Giobulin 11 3 a-1 ,6-Giukosidase 58 ß·Aianin 35 ß-Aminoisobutyrat 35 ß· Faltblatt 27 ß-HMC-CoA 72 ß-HMG-CoA-Synthase 70 ß-Hydroxybutyrat 70 ß-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase 70 ß-Hydroxylase 88 ß-Hydroxy-Merhyi-Giutaryi-CoA 72 ß· Ketoacyi-CoA 69 ß-Oxidation 68 5-ALS-Synthetase I 14 I ,25-Dehydroxycholecalciferol 17 I ,25-Dihydroxycholecalciferol 86 I ,3-Bisphosphnglycera t 55 1-Antitrypsin I 07 I-Globulin I 13 1-Phosphofruktoaldolase 122 11 -Desoxykortikosteron 92 2,3-ßisphosphoglycerat 116, 1 18 2-Methyl- 1 ,4-Naphthochinon 17 2-Phosphoglycerat 55 21-Hydroxylase 93 3-Ketothiolase 69, 70 3-Mcthoxy-4-Hydroxy-Mandcl
säurealdehyd 89 3-Phosphoadenosin-5-
Phosphosulfat 123 5-Dihydrotestosteron 93 7-Methyi-Guanosin 40
A A·Bindungsstelle 42 ABO-System I 04, I 09 Acetacetat 70 Acetace tyi-CoA 70 Acetat 35 Aceton 70 Aceryi-CoA 62 , 66, 70, 72, 76, 126 Acetyi-CoA-Carboxy lase 66 Acetyi-CoA-Carnitin-Carri er 72 Acerylierung 44, 123 ACTH 83 Actinomycin D 41 Acyl -Carrier-l'rotein 66 Acyl -CoA 66, 68 Acyl -CoA-Cholestero i-Acyl-
Transferase 7 4 Acyi -CoADehydrogenase 69 Acyi-CoADesaturase 67 Acyi -CoA Synthetase 67, 68 Acyladenylat 68 Acyl eami tin 68 Adenin 32, 36 Adenin-Phosphoribosyl transferase 34 Adenohypophyse 82 Adenosin triphosphat 76 Adenosylcobalamin 18 Adenylatzykl ase 89 ADH 93 Adh äsionsmoleküle 3 Adiuretin 83 AD P 54, 120 Adrenalin 59. 88 adrenerge Rezeptoren 89 adrenogenitales Synd rom 93 adrenokonikou-opes Hormon 90
aerobe Glykolyse 54 Affinität 12 Agglutination I 05 , II 0 Agglutinationsmethoden I I I Akromegalie 83 Aktinfilamente 3 ak tiver Transport 2 aktives Zen trum 12 Aktivierun gsenergie 8, 12 Akute-Phase-Proteine 100, 107 Alanin 30 Alanin-Aminotrans ferase [ALAT) 28 Albumin 107, 11 3, 122 Alrlimin 28 Aldolase 54 Aldolase ß 122 Aldosteron 92 alipha tische Aminosäuren 24 Alkohol-Dehydrogenase 123 Alkoholmetabolismus 123 Allergen I I 0 Allergie II 0 Allosterie 14 alternative Komplement-
aktivierung I 06 Altersdiabetes 96 Al veolarmakrophagen I 02 Amidierung 123 Am inoacyl-tRNA-Synthetase 42 Aminogruppe 24 Aminolävulinsäure I 14 Aminopeptidasen 127 Aminopterin 19 Aminosäure- Derivate 80 Aminosäureabbau 30 Aminosäuremetabol ismus 28 Aminosäuren 24 Aminosäurenkette 26 Aminosäurensymhese 30 Aminosäuresequenz 37 Ammoniak 28, 126 AMP 33 AMP-Spiegel 55 amphipatisch 62 amphiphil 62 Ampholyte 25 Anabolismus 122 anaerobe Glykolyse 54 - in Erythrozyten I 18 Anaphase 4(J anaphylaktischer Schock I I 0 Anaphylatoxine I 07 Androgene 93 Androsteron 93 Angiotensin 92 Angiotensin-Converring-Enzym 92 Angiorensin II 92 Angiotensinogen 92 An ionen 6 Anomere 52 ANP 93 Anticodon 42 amidiuretisches Hormon 83 Antigen I 0 I Antigen-Amikörper-Komplexe I 04 Antigen-präsemierende Zellen I 00,
102 Anti gene I 08 amig ne DeLenn inante I 0 I ,
108 antihämophi les Globu lin A 120 Ant ikörper I 00, I 03, I 04 An tikörp rklassen I 04 Ant ikörperswitch I 06 Antikörpervielfal t I 06 Antimycin A 79 Anti ox idant ien I 19 Antiport 3 Ant ithrombin 111 107, 121
Amivitamine 19 Apolari tä t 62 Apolipoprotein B 41 Apolipoproteine 7 4 Apoptosc 48, 49 APRT 34 Aquaporine 93 Arachidonsäure 63, 67, 98 Arginin 29, 30 Argininosuccinat 29 Argininosucc inatsymhetase 29 aromatische Aminosäuren 24 arteriosklerotische Plaques 74 Ascorbinsäure 19, 88 Asparagin 30 Aspartat 29, 30 Aspartat-Aminou-ansferase [ASAT) 28 Aspartattranscarbamoylase 34
Aspirin-induziertes Asthma 98 Atmungskette 78 Atombindung 7 Atome 6 Atomkern 6 Atom masse 6 ATP 4,29, 54, 76 ATP-Spiegel 55 ATP-Synthase 78 ATP-Symh ese 78 atrophische Gastrilis 19 Autoantigene II 0 Autoimmunerkrankungen I I 0 autokrine Sekretion 80 Autosomenpaare 36 Avitaminose 16 Avogadro'sche Zahl 7 Azathioprin I I I
B B-Gedächtn iszellen I 03 8-Lymphozyten I 00, I 03 B-Zell -An tigenrezeptoren I 04 bakterielle Plasmide 51 Basen-Exzisionsreparatur 49 Basenpaare 36 Basentripleu 37 basophi le Granulozyten I 00, I 02 Bauchspeicheldrüsenhormone 94, 96 Baufett 65 Bedside-Test I I 0 Beri-Beri -Syndrom 18 Bica rbona t 20, I 16 Bilayer 2, 62 Bilirubin I 15 llilirubinglukuronid I 15 Biliverd in II 5 Bindung 7 Bindungselektronen 6 Bindungsenergie 8 biogenes Amin 29 BiokatalysaiOren I 0 Biologieals I I I Biotin 18 Biotransformation 123 Blut 112 Bluterkrankheit 121 Blutgerinnung 120 Blutglukosespiege l 94 Blutgruppenantigene I 04, I 09 Blutgruppenkompatibilitä t I I 0 lllutgruppenunvenrä Iiehkeil I I 0 Blutplasma I 13 Blutplättchen I 12, 120 ll lutserum 11 3 lllutsti llung 120 Blutzellen I 0 I lllutzuckerspl gel 94 Bohr-Effekt I I Bradyklnln 120 braun s Fcllp, w b 6
Brennwert 126 Butansäure 62 Buttersäure 62
c C-Peptid 94 C-reaklives Pro tein 1 07 Cadherine 3 Caeruloplasmin 122 Calciferol I 7 cAM P 81 Carbaminohämoglobin I 16 Carbamoylasparta t 34 Carbamoylphosphat 29, 34 Carbamoylphosphatsymhetase 29.
34 Carboanhydrase 20, I 16 Carboxybiotin 18 Carboxylgruppe 24 Carboxylierung 44 Carboxypeptidase A und B 127 Cardiolipin 64 Carnitin 68 Carnilin -Acyl-Transferase 68 Carolinoide 16, 65 Caspasen 48, 49 CD-System 102 CD4-Zellen I 09 C D8-Zellen I 09 Ceramid 64 Cerebroside 64 cGMP 81 Chaperone 44 chemische Grundlagen 6 chemische Reaktionen 8 Chemokine 99 Chenodesoxycholsäure 122 Chiralität 52 Chloramphenicol 43 .Cholecalciferol 17, 86 Cholesterin 72, 74 Cholesterin-7-a-Hydroxylase 122 Cholesterinausscheid ung 73 Cholesterinbiosynthese 72 Cholesterinesterase 127 Cholsäure 122 Christmas Factor 120 Chromalin-Remodellierungs-
maschinen 36 Chromosomen 36 Chromosomenmutationen 48 Chylomikronen 7 4 Chymotrypsin 127 Cis-Konfiguration 26 Citrat-Symhase 77 Citratspiegel 55 Citratzyklus 76 Citrullin 29 CK 10
2-Transpon 116 Coba lamin 18 Coenzym A 18, 68 Coenzym B,2 31 Coenzyme I I Coeruloplasmin I 07 Co faktoren 13 Conn-Synd rom 92 Coombs-Test I I I Coproporphyrinogen I 14 Cosubs trate I I C X-l i-Inhibitor n 98
RH 83 CRP 107 Cumarin
ushing- yndrom 91 yclln-abhänglg Klnas n 46 ycl lnc 46 yclooxyg nas 98 ysteln 30
Cytochrom-c-Oxidase 78 Cytochrom P410 123 Cytosin 32, 36
D D-Form 52 Debranching-Enzym 58 Decarboxylierung 29 degenerierter Code 3 7 Deletion 48 Denaturierung 50 dendritische Zellen I 00, I 02 Depotfett 65 Desaminierung 28 Desmolase 90 Desmosomen 3 Desoxy-Hb I 18 Desoxyribonukleinsäure 36 Desoxyribonu kJeotide 32 Desoxyribose 32, 52 Dexamethason 90 Di-Desoxyribonukleotide 51 Diabetes mellitus 71, 95, I I 0 Diacylglycerine 64 Diacylglycerol 81 Di farnesyl -Naphtochinon 17 Dihydrofolatreduktase 35 Dihydrofolsäure 35 Dihydrolipoyl-Transacetylase 76 Dihydroorotat 34 Dihydroxyaceton 52 Dihydroxyacetonphosphat 54, 67,
122 Diiodtyrosin 84 Diktyosomen 5 Dimethylallyl-Pyrophosphat 72 Dinitrophenol 79 direktes Bilirubin 115 Disaccharasen I 2 7 Disaccharide 52 Disulfidbrücken 26 DNA 32,36 DNAG!ykosylase 48 DNA-Gyrase 38 DNA-Klonierung 50 DNA-Ligase 51 DNA-Polymerase 38, 50 DNA-Polymerase-Komplex 3lJ DNA-Reparatursysteme 48 DNA-Replikation 38 DNA-Schäden 48 DNA-Sequenzierung 51 Dopamin 88 Doppelbindungscharakter 26 Doppelhelix 36 Doppellipidschicht 2 Doppelstrangscl1äden 49
E Effektorhormone 82 Eicosanoide 98 ein fache Lipide 64 Einfachzucker 52 Einzelstrangschaden 49 Eisen 11 6 Eisenmangelanämie I 17 Eisenstoffwechsel 117 Eiweißminimum 126 Elastase 127 Elektronen 6 Elektron n-Transfer-Protein 69 Eleku· nenakzeptor 9 Elektronendonat r 9 Elektronenhülle 6 Elektronenpaarbindung 7 ElementarLeilehen 6 Elemente 7 ELI A !I I Elonga tion 38, 43, 0
endokrine Sekretion 80 endoplasmatische Retiku lum 5 Endeproteasen 28 Endesymbiontentheorie 4 endotherme Reaktionen 8 Endozytose 3 Energiebedarf 126 Energiebilanz 126 Energiegehalt 126 Energiegewinnung 76 Enhancer 47 Enolase 55 Enoyl-CoA 68 Enoyi-CoA-Hydratase 69 enterehepatischer Kreislauf 73, 127 Enterepeptidasen 127 Entzündungsreaktionen 99 Enzym-Substrat-Komplex 12 Enzymaktivität 14 Enzyme I 0, 12, 27 Enzymfunktion 12 Enzymhauptklassen I 0 Enzymhemmung 14 Enzymkinetik 12 Enzymmenge 14 eosinophile Granulozyten I 00, I 02 Epitop 10 1, 108 Erbanlagen 36 Ergocalciferol I 7 Ernährung 126 Erythroblasten 112 Erythropoese I 12 Erythropoelin I 0 I, I 12 Erythrose 52 Erythrose-4-Phosphat 60 erythrozytäre Glykolyse I 18 Erythrozyten 112, 118 Erythrozytenmauserung 118 Erythrozytenspende I I 0 Erythrozytenstoffwechsel I 18 Erythrulose 52 essenzielle Aminosäu ren 24 essenzielle Fettsäuren 63 Essigsäure 62 Euchromatin 37 Exons 37, 40 Exonukleaseaktivität 39 Exoproteasen 28 exotherme Reaktionen 8 Exozytose 3 extrinsisches System 121
F FAD 18 FADH I I FADH2 69, 77, 78 Favismus 11 9 Ferritin I 07, 11 7 feta les Hämoglobin 114 Fette 64, 126 fettlösliche Vitamine 16 Fettsäure-Abbau 68 Fettsäu re-Synthase-Komplex 66 Fettsäure-Thiokinase 67 Fettsäuren 62, 126 Fettsäuresynthese 66 Fibrinogen I 07, 120 Fibrinolyse 121 fibrinstabilisierender Faktor 120 Fi scher-Projektion 52 Flavinadenindinukleotid 18 Flavinmononukleolid 18 l:luid-Mosa ik-Modell 2 !:MN 18 Follikelepit.helzellen 84 Folsäure 18,3 1 Folsäureantagonisten 19 Frame·shift·Mutalion 48 Fredrickson-Klassifikalion 75
Fresszellen I 00 Fruk tokinase 122 Fruktose 52 Fruktose- ! ,6-Bisphosphat 54, 122 Fruktose- ! ,6-Bisphosphatase 56 Fruktose-I-Phosphat 122 Fruktose-6-Phosphat 54, 56, 60,
11 9 Fruktose-Stoffwechsel 122 FSH 83 Fumarat 29 funikuläre Myelose 19
G G-Phasen 46 G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 89 G6PDH-Mangel 11 9 Galaktose 52 Galaktose-Stoffwechsel 122 Gallenflüssigkeit 127 Gallensäuren 72, 122 Ganglioside 64 GAP 46 Gapjunctions 3,80 Gelelektrophorese 50 Genamplifikation 49 Genanalyse 50 genetischer Code 37 Genexpression 46 Genregulation 47 Gentechnologie 50 Geranyi-Pyrophosphat 72 Gerinnung 120 Gerinnungsfaktoren 120 Gerinnungskaskade 120 gesättigte Fettsäuren 63 Geschlechtschromosomen 36 Gewebsthromboplastin 120 GH 82 Gicht 34 glandotrope Hormone 82 glattes ER 5 Gleitring 39 Globin 114 Globulin I 13 Glucuronidierung 123 Glukagon 59, 96 glukogene Aminosäuren 30 Glukokinase 94 Glukokortikoide 83, 90, 98 Glukoneogenese 56 Glukose 52, 56, 58, 94, 126 Glukose-6-Phosphat 54, 56, 60, 94,
11 9 Glukose-6-Phosphat-Dehydro
genase 60 Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-
Mangel 119 Glukose-6-Phosphat-Isomerase 54 Glukose-6-Phosphatase 56,58 Glukose-Transporter 94 Glukoseabbau 54 Glukosephosphatmutase 58 Glukosespiegel 94 Glukuronsäure 11 5 Glukuronyl-Transferase 11 5 Glutamat 28 Glutamat-Oxalacetat-Transaminase
(GOT) 28 Glutamat-Pyruvat-Transaminase
(GPT) 28 Glutamatdehydrogenase (GLDH) 29 Glutamin 30 Glutam in-PRPP-Arnidotransferase 33 Glutathion 119, 123 Glycerin-3-Phosphat 67 Glycerinaldehyd 52, 122 Glycerinaldehyd -3-Phosphat 54, 60,
122
Register 146 I 147
Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase 54
Glycin 30, 122 Glykocholsäure 123 Glykodesoxycholsäure 123 Glykogen 53, 58 Glykogenin 58 Glykogenolyse 58 Glykogenphosphorylase 58 Glykogenspeicherkrankheiten 59 Glykogenstoffwechsel 58 Glykogensyn thase 58 Glykogensynthese 58 Glykokalix 2 Glykolipide 53 Glykolyse 54 Glykoproteine 53 Glykosphingolipide 65 Glykosylierung 44 GMP 33 GnRH 83 Golgi-Apparat 5, 45 Graft-versus-1-lost-Reaklionen 110 Granulozyten I 00, I 02 Grb-Protein 46 GRH 82 growlh hormone 82 growlh hormone releasing
hormone 82 Gruppenspezifttät I 0 GTP 77 Guanin 32, 36
H H-Ketten 104 Hageman Factor 120 Halbacetale 52 halbessenzielle Fettsäuren 63 Halbketal 52 Häm 114 Häm-Oxygenase 115 Hämabbau I 15 Hämatokrit 112 Hämoglobin 20, 114 Hämoglobinopathien 117 Hämoglobinsynthese 114 Hämophilie 121 Hämosiderin 117 Hämosiderose 117 Haptene 108 Haptoglobin 107, 122 Harnsäure 34 Harnstoffzyklus 29 Hauptantigenklassen 108 Hauptgruppe 7 HbA 1 114 HbA2 114 HbCO 117 Hb F 114 HOL 74 Helikase 40 Helix-Loop-Helix-Strukturen 40 Hemidesmosomen 3 Heterochromatin 37 Heteroglykane 53 heterozyklische Aminosäuren 24 Hexakinase 54, 56 Hexose 52 HGPRT 34 Histamin I 02, I OS Histidin 30 Histon-Proteine 36 Histone 27 Hitzeschockprotein Hsp90 90 HLA-Antigene 108 HMG-CoA 70 HMG-CoA-Lyase 70 HMG-CoA-Reduktase 72 HMG-CoA-Synthase 72
Register
Höhemrai .ing I 13 Homoglykäne 53 homologe Reparatur 49 Homöostase I 12 Hormone 80 Hormonrezeptoren 80 hormonsensitive Lipase 68 hast versus graft I I 0 humorale Abwehr I 00, I 04 Hungerzustand 28, 70 Hybridisierung 50 Hydrokortison 90 Hydrolasen I 0 hydrophil 62 hydrophile Aminosäuren 25 hydrophob 62 hydrophobe Aminosäuren 25 hydrophobe Wechselwi rkungen 26 Hydroxy·ß·Methylglu taryi ·CoA 70 Hydroxylapati t 86 Hydroxylierung 44 Hyperkalziämie 87 Hyperkortisolismus 91 Hyperl ipoproteinämien 75 Hyperthyreose 85 Hyperurikämie 34 Hypervi ta minose 16 H ypokalziämie 8 7 Hypoparathyreoidismus 87 Hypophysen-Hormone 82 Hypophysenadenom 83 Hypophysenhinterlappen 82 Hypophysenmittellappen 82 Hypophysenvorderlappen 82 hypothalamisch-hypophysäres
System 82 Hypothalamus-Hormone 82 Hypothalamus-Hypophysen-
System 90 Hypothyreose 85 Hypovitaminose 16 Hypoxanthin-Guanin·Phosphoribosyl·
transferase 34
I IDL 74 IFN 99 lgE 110 IGF 83 Ikterus 115 iminesäure 28 Immunglobulin A I OS Immunglobulin D I OS ImmunglobulinE 105 Immunglobuline 27. I 00, I 04 Immunglobulin G I OS Immunglobulin M 104 Immunegen 108 lmmunogenität I 08 immunologisches Gedächtnis I 0 I immunologische Testmethoden I I I
Immunpathologie I I 0 Immunpräzipitation I II Immunsuppressiva I I 0 Immunsystem I 00 Immunzellbildung I 0 I Immunzellen I 02 IMP 33 indirektes Bilirubin II S lnniximab 99 lnhibin 83 Initiation 38, 42 Jnositol -Trisphophat 81 lnositolmonophoshat 33 INR-Wert 19 Insertion 48 Insulin 59, 94 insuline Jike growth factor 83 Insu lin rezeptor 81, 94
lntegrine 3 lntercristae-Raum 4 Interferone C)l), I 00 lnterkonvertierung 14 ln terleukine 98 Intermediärfilamente 3 Interphase 46 interzellu läre Kommunikation 80 intrazellu läre Rezeptoren 81 lntrinsic factor 127 intrinsisches System 120 lntrons 37,40 Inversion 48 Iod id 84 Iodmangel 8S Ionen 6 Ionenbeziehungen 26 Ionenbindung 8 Ionengitter 8 lsocilrat-Dehydrogenase 77 isoelektrischer Punkt 25 Isoenzyme I 0 Isohämagglutinine I 09 Isoharnstoff 29 Isoleuein 30 Isomerasen I 0 Jsopentenyl-Pyrophosphat 72 Isopren 72 Isoprenderivate 62, 65 Iso top 6
J JAK-Kinase 99 jak-Stat·Kaskade 99 juveniler Diabetes 95
K K-Typ 15 Kalium-Hausha lt 92 Kallikrein 120 Kalzitonin 86 Kalzitriol 86 Kalzium 86, 120 Kalziumhaushalt 86 Kappe 40 Karyoplasma 2 kataboler Stoffwechsel 122 Ka talase 78 katalytische Kapazität 12 Ka techoi-0-Methyi-Transferase 89 Katecholamin-Sekretion 88 Ka techolamine 88 Ka techolaminrezeptoren 81, 89 Kationen 6 Keimbahnmutationen 48 Kephalin 64 Kernkörperehen 4 Kernladungszahl 6 Kernlokalisationssequenzen 44 kernlokalisierte Rezeptoren 81 Kernporen 4, 44 Ketoazidose 21 , 71 ketogene Aminosäuren 30 Ketogenese 70 Ketonkörper 70 Ketonkörperverwertung 71 Kettenabbruch 51 Kin inogen 120 kl assische Komplement·
aklivierung I 06 Kleinwuchs 83 klonale Selektion I 03 kohlenhydratarme Diät 70 Kail ienhydrate 52 , 126 Kohlenmonoxid 79, I 17 Koh lenmonox id-V rglftung 14 Kolloid 84 Kompartimente 2 kompetitiv Hemmung 14
Komplement I 00 Komplementaktivierung I 06 Komplementsystem I 00, I 06 komplexe Lipide 64 Konjugation 123 kooperatives Bindungsverhalten I 16 Kooperativität 15 Kortikosteron 90 Kortikotropin-Releasing Hormon 90 Kortisol 90 Kortison 90, 1 1 1 kotranslationelle Modifizierung 44 kovalente Bindung 7 Kreatin-Kinase 10 Krebsentstehung 49 Kupfferzellen I 02
L L·ß· H yd roxyacyi-CoA· Dehyd ro·
genase 69 L·Aminosäure-Deca rboxylase 88 L-Dopa 88 L·Form 52 L-Ketten I 04 Laktat 55, 76 Lakta t·Dehyd rogenase·Reak tion 55 Lakta tdehydrogenase I 0 Laktonase 60 Laktatazidose 21 Laktoferrin I 00 Laktose 53 Lak toseunverträgl ichkeit 53 Lanosterin 72 LDH 10 LDL 74 Leberstoffwechsel 122 Lecithin 64 Leci thin-Cholesterin-Acyi-
Transferase 75, I 13 Leitstrang 39 Lesch-Nyhan-Syndrom 34 Lese rasierverschiebung 48 Leucin-Zipper 40 Leu kotriene 98 Leukozyten I 00. I 02, I 12 LH 83 Liberine 82 ligandengesteuerte Ionenkanäle 8 1 Ligasen I 0 Lineweaver·Burk-Gieichung 13 Linker-DNA 36 UnoJensäure 63, 67 Linolsäure 63 Lipase 127 Lipide 62, 126 Lipolyse 68 Liponamid 76 lipophil 62 lipophob 62 Lipoproteine 74 . 113 Lipoproteinklassen 74 Lipoproteinlipase 74, 11 3 Liposomen 62 Lipoxygenase 98 Lupus erythematodes I I 0 Lyasen I 0 lymphatische rgane I 0 I lymphatisch Reihe I 0 I lymphatisclle Zel lreihe 102 Iysosomale Lipasen 74 Iysosomale Proteine 45 Lysos men , 28 Lysozym I 00 lylischer Komplex I 07
M M-Phase 46 M. Addison 92 rnagnoz Jlulär s K rngeblet 82
Makroblasren I 12 Makrophagen I 00, I 02 Malat 29, 57, 66 Malar-Dehydrogenase 57 Malatenzym 66 Malonyi-CoA 66 Maltose 53 MAP·Kinase 46 Massenzahl 6 Mastzellen I 00, I 02 Mäusegerucll 31 Megakaryozyten 120 megalabiastäre Anämie 19 MELAS-Syndrom 4 Membranangriffskomplex I 07 Membranen 62 Membranprote ine 2, 27, 4S Membranrezeptoren 81 Menadion 17 Menstruationsblutung 49 Mesangiumzellen I 02 messenger RNA (m RNA) 40 metabolische Alkalose 21 metabol ische Azidose 21 Metanephrin 89 Metaphase 46 Methämoglobin 116, 11 9 Methionin 30, 37,43 Methotrexat 3S, I I I Methylcobalarnin 18 Methylen-THF 31 Methylierung 123 Mevalonat-5-Phosphat 72 Mevalonat-5-Pyrophosphat 72 Mevalona tkinase 72 Mevalonsäure 72 MHC-Amigene 108, 110 MHC·Kiasse I 109 MI·IC-Kiasse II I 09 MHC.Moleküle I 03 Michaelis-Menten·Gieichung 13 Michaelis-Menten-Kinetik 12 Michael iskonstante 12 mikrosomale Monooxigenasen
123 mikrosomales ethanolox idierendes
System 123 Mikrotubuli 3 Milchzucker 53 Mineralkortikoide 83 Mineralokortikoide 92 mitochondriale DNA 4 mitochondriale Proteine 44 Mitochondrien 4 Mitochondrienmatrix L1 Mitochondrienmembran 4 Mitochondriopathien 4 Mitose 46 Mizellen 62, 127 Monoacylglycerine 64 Monoaminoxidase 89 Monoiodtyrosin 84 mononukleäres Phagozyten-
system I 02, I 15 Monosaccharide 52 Monoterpen 65 Monozyt n I 00, I 02 Morbus Basedow 85, I I 0 Morbus llaemolyticus
n ona torum I I 0 Muci n 127 rnultid t rminant I OB rnu ltival nt I 08 Muskelkontrakti n 27 Muta >en L18 MutaU n n 48 Myasthenla grav ls I I 0 my I Ische R 111 I 0 I Myogl bin 114, 11 6
N N-Ace tyl-Glutamat 29 N-Mcthyltransferase 88 Na •/K'·ATPase 3 NAD ' 18,28 NADH I I , 78 NADH-Ubichinon-Oxido-
reduktase 78 NADH/ H' 70, 77 NAD P• 18,28 NADPH I I , 60, 66 Nährstoffe 126 Nahrungsresorption 126 Nal idixinsäure 38 Natrium·Haushal! 92 natürliche Killerzellen I 00, I 02 Nebengruppe 7 Nebennierenmarkshormone 88 Nebennierenrinden-lnsuffizienz 92 Nebennierenrindenhormone 90 negative Rückkoppelung 14 negatives Feedback 82 Nekrose 49 Neugeborenenscreening 31 neuroendokrine Sekretion 80 Neurohypophyse 82 Neutralfelle 64 Neutral fette, Abbau 68 Neutralisierung I OS Neutronen 6 neutrophile Granulozyten I 00, I 02 Nex us 3 nicht-essenzielle Aminosäuren 24 nicht-kompetiti ve Hemmung 14 nicht-proteinogene Aminosäuren 24 nichtsteroidale Antirheumatika 98 Nicotinamidadenindinukleotid·
phosphat 6 1 Nikotinamid 18
ikotinsäureamid 18 NK-Zellen 100, 102 NLS 44 Noradrenalin 88 noradrenerge Rezeptoren 89 Normoblasten 11 2 Novabioein 38 NSAID 98 NSAR 98 nukleäre Proteine 44 Nukleinsäuren 36 Nukleoli 4 Nukleosiddiphosphat 32 Nukleosiddiphosphat-Kinase 77 Nukleosidmonophosphat 32 Nukleosidphosphorylase 35 Nukleosidtriphosphat 32 Nukleosom 36 Nukleosomenkern 36 Nukleolid·Exzisionsreparatur 49 Nukleotidase 35 Nukleo lide 32
0 0 -glykosid ische Bindung 52 Obernächenrezeptoren 81 Okazaki·Fragmente 39 Öl -Wasser-Grenzschichten 62 Öle 64 Ol igomycin 79 Ol igopeptide 26 Oligosaccharide 53 Ölsäure 63 Onkogenese 49 Opsonierung I OS Ordnungszahl 6 OrniU1 in 29
rnlthin-Carbamoyl-Transferase 29 Orotidln·5·1'hosphat 34
rotsäur 34
Osteoblasten 86 Ostecklasten 86 Osteomalazie 87 Östradiol 93 Östron 93 Oxalacetat 29, 30, 56, 66, 70, 76 Oxidation 9 oxidative Phosphorylierung 78 Oxidereduktasen I 0 O)[ygenierung 11 6 Oxyhämoglobin 116 Oxytocin 83
p P·Bindungsstelle 42 p53 47, 48 Palmitinsäure 66 Pankreashormone 96 Pankreassaft 127 Pantothensäure 18 PAPS 123 parakr ine Sekretion 80 Parathormon 86 Paratop I 08 parvizelluläres Kerngebiet 82 passive Immunisierung I 05 passiver Transport 2 PCR 50 Pellagra 18 Pentose 32, 52 Pentose-5-Phosphat-lsomerase 60 Pentosephosphatweg 60, 11 9 Pepsin 127 Pepsinogen 127 Peplidbindung 26 Peptide 26 Peptidhormone 80 Peptidyi·Prolyl·lsomerase 44 Peptidyl -tRNA 43 Peptidyltransferase 43 Periodensystem der Elemente 7 Peroxidase 84 peroxisomale Proteine 45 Peroxisomen 5 pH-Wert 20 Phagosomen I 02 Phagozyten I 00 Phagozytose I 02 Phäochromozytom 89 Phenylalanin 30 Phenylalanin-Hydroxylase 31 Phenylketonurie 31 Phenylpyruvat 31 Pheromone 65 Phosphat 86 Phosphat-Puffer 20 Phosphatgruppen 32 Phosphathaushall 86 Phosphatidsäure 64 Phosphatidyl-Inositoi·Trisphosphat 81 Phospha tidylcholin 64 Phosphatidylethanolamin 64 Phosphatidylinositol 64 Phosphatidyli nositol·3·Kinase 94 Phosphatidylserin 64 Phosphenolpyruvat 56 Phosphodiesterasen 127 Phosphoenolpyruvat 55 Phosphoenolpyruvat-
Carboxykinase 56 Phosphofruktokinase 54, 56 Pil osphoglukonolac ton 60 Phosphoglycerat·Kinase 55 Phosphoglycerat-Mutase 55 Phosphoglyceride 64 Phospholipase C 89 Phospholipasen 98 Phospholipide 64, 120 Phosphop ntose-Epimerase 60
Phosphoribosylpyrophosphat 33, 34 Phosphorylierung 14, 44 Phyllochinon 65 Phyllochinone 17 physikalischer Brennwert 126 physiologischer Brennwert 126 Plasma 11 3 Plasmaenzyme I 13 Plasmamembran 2 Plasmaprotein-Synthese 122 Plasmaproteine I 13 Plasrnathromboplastin 120 Plasmazellen I 01, I 03, 104 Plasmin 121 Plasminogen I 07 Plasminogenaklivatoren 121 pla telet activation factor 121 Plättchenthrombus 120 Pleotropismus 99 pluripotente Stammzellen 101 polar 62 Polari tät 63 PoiyASchwanz 40 Polyadenylierung 40 Polymerase-Kettenreaktion 50 Polypeplide 26 Polysaccharide 53 Polysamen 5 Porphobilinogen 11 4 l'orphyrie 11 5 Porphyrin 114 Porphyrinogen 114 Postresorptionsphase 122 posttranskriptionelles Spleißen 40 posttransla tionale Modifikation 25 Prä kallikrein 120 Präproglukagon 96 Präproinsulin 94 Präzipitation 105 Prednisolon 90 Pregnenolon 90 primäre Gal lensäuren 122, 127 primärer Plät!chenthrombus 120 Primärstruktur 26 Primase 38 Primer 38, SO Primer·Annealing 50 Proaccelerin 120 Produkthemmung 14 Progesteron 90 Proinsulin 94 Prokonverti n 120 Prolaktin 83 Protin 30 Promotor 37 Promotor-Sequenz 40 Prophase 46 Propianat 35 Propionyl-CoA 67, 69 Prostacyclin 98 Prostaglandine 98 Prostazyklin 121 prosthetische Gruppen I I Proteasen 28, 43 Proteasom 43 Proteasomen 5, 28 Proteinabbau 28, 43 Protein C 121 Proteindisulfid·lsomerase 44 Proteine 20, 26, 126 Proteine, Prozessierung und
Zielsteuerung 44 Proteinfal tung 44 Proteinmetabolismus 28 proteinogene Aminosäuren 24 Protein S 121 Proteinstruktur 44 Proteinsynthese 42 Proteoglykane 53
Register 1481149
Proteolyse 43 Prothrombin 120 Protolyse 8 Protonen 6 Protonenakzeptor 8 Protonendonator 8 Protonengradient 78 Proloonkogene 49 Protoporphyrin 11 5 PRPP 33,34 PRPP-Syn lhetase 33 Pseudocholinesterase 113 Pseudopodien 120 Ptyalin 127 Puffersystem 20, 27 Punktmutation 48 Purin 32 Purinbiosynthese 32 Purinwiederverwertung 34 l'yridoxalphosphat (PALP) 28, 11 4 Pyridoxamin I 8 Pyridoxin 18, 28 Pyridoxol 18 Pyrimidin 32 Pyrimidinnukleotide 34 Pyrophosphatase 39, 40 Pyruvat 30, 54, 56, 76 Pyruvat·Carboxylase 56 Pyruvat·Carrier 76 Pyruval·Dehydrogenase 76 Pyruval-Dehydrogenase-Reaktion 76 Pyruvat-Kinase 55, 56 Pyruvatabbau 55 Pyruvat-Kinase-Mangel 11 9
Q
Q-Zyklus 78 Quartärstruktur 27 QuickWen 19
R RAAS 92 Rachi tis 87 Rad ioimmunassay I I I Ras-Kaskade 46 Ras-Protein 46 raues ER 5, 44 Rb· Protein 46 Reaktionsenergie 8 Reaktionsenthalpie 8 Redoxreaktionen 9 Reduktion 9 Reduktionsäquivalente I I Redundanz 99 Regulation der Genexpression 46 Regulation des Zellwachstums 46 Release-Faktoren 43 Release·lnhibiting·Hormone 82 Releasing· Hormone 82 Renin 92 Renin·Angiotensin·Aldosteron-
System 92 Replikation 38 Replikationsgabel 38 Repliken 38 Resorptionsphase 122 respi ratorische Alkalose 21 respiratorische Azidose 21 respiratorischer Quotient 126 Restriktionsendonukleasen 50 Restriktionspunkt 4 7 retikuloendothel iales System I 02 Retikulozyten I 12 Retina! 17 Retinoat 16 Retinoide 17 Retinol 16, 65 reverser Cholesterintransport 75 Rezeptoren 80
Register
reziproke Substratbeziehung 33 Rhesus-System I 09 Rhesusinkompatibilität I I 0 Rheumatoide Anhrilis 110 Rhodopsin I 7 Riboflavin 18 Ribonuklease 127 Ribonukleinsäure 36 Ribonukleotide 32 Ribonukleotidreduktase 35 Ribose 32, 52. 60 Ribose-5-Phosphat 60 ribosemale RNA (rRNA) 40 Ribosomen 4, 42, 44 Ribulose 52 Ribulose-5-Phosphat 60 Riesenwuchs 83 Ri fampicin 4 1 Riruximab I I I RNA 32,36 RNA-Polymerase 38, 40 RNA-Prozessierung 40 RNA-Typen 40 Rosenkranzphänomen 87 rote Blutkörperchen I 12
s S-Adenosylmethionin 31, 88 S-Phase 46 Saccharose 53 Salvage pathway 34 Salzsäure 127 Sättigungskinetik 12 Sauerstoffaffinität 118 Sauerstoffatom 6 Sauerstoffbindungskurve 116 Sauerstoffradikale I 19 Sauerstoffspeicher 11 6 Sauerstofftransport 11 4 , 116 Säure-Base-Reaktionen 8 Säure-Basen-Haushalt 20 Säureamidbindung 26 Schalen 6 Schiff-Base 28 Schilddrüsenhormone B4 Schilddrüsenüberfunktion 85 Schilddrüsenunterfunktion 85 Schlüsselenzym 14 Schrittmacherreaktion 14 second messenger 8 I Sedoheptulose-7-Phosphat 60 Sekretionsmechanismen 80 sekretorische Proteine 45 sekundäre Gallensäuren 127 Sekundärstruktur 26 Sensibilisierungsphase II 0 Serin 29, 30 Serotonin 120 Serum 113 Sesquiterpen 65 Sexualhormone 93 Sichelzellanämie I 17 Signalkaskaden 8 I Signalmoleküle 80, 98 Signalpeptidase 94 Signaltransduktion 98 Signalübertragung 80 Silencer 47 Skorbut 19 somatische Mutationen 48 somatische Rekombination I 03,
106 Somatoliberin 82 Somatomedine 83 Somatostatin 82, 94 somatotropes Hormon 82
omatolropin 82 Sos 46
Speicheldrüsen 127 spezifische Abwehr I 00 Sphingomyelin 64 Sphingosin 64 Spleißen 40 Squalen 72 Stammzellen I 0 I Start-Codon 37, 43 Star-Proteine 99 Statine 82 Stearinsäure 63, 66 Stercobilin I 15 Stercobilinogen I 15 Stereoselektivität I 0 Stereiddiabetes 91 Steroide 65 Stereidhormone 80 STH 82 Stoffmenge 7 Stofftransport 2 Stoffwechselregulation 14 Stopp-Codon 37, 43 Streptokinase 121 Streptomycin 43 Striae rubrae 9 1 Strukturgen 37 Strukturproteine 27 Stuan Prower Factor 120 Substitution 48 Substrataktivierung 12 Substratangebot 14 Substrathemmung 14 Substratkettenphosphorylierung 55 Substratspezifltät I 0 Succinat 76 Succinat-Oehydrogenase 78 Succinat-Ubichinon-Reduktase 78 Succinyi-CoA 30, 69, 77, 11 4 Sulfalierung 123 Superoxid-Dismutase 78 Sympathikusaktivierung 88 Symport 3 Synthasen I 0 Synthetasen I 0
T T-Gedächtniszellen I 03 T-Hel ferzellen I 02 T-Lymphozyten I 00, I 02 t-PA 12 1 T-Suppressorzellen I 03 Taurin 122 Taurocholsäure 123 Taurodesoxycholsäure 123 Telophase 46 Terminal ion 39, 43 Terpene 65 Tertiärstruktur 27 Testosteron 93 Tetrahydrobiopterin 88 Tetrahydrofolsäure 18, 35 Tetrahydrofolsäure (THF) 3 1 Tetraiodthyronin 84 Tetraiodthyronylrest 84 Tetrazyklin 43 Tetrose 52 Thalassämie I 17 Thermogenin 79 Thiamin 18 Thiaminpyrophosphat 76 Thioätherbi ldung 123 Thioesterase 67 Thiok inase 68 Threonin 29, 30 Thrombokinase 120 Thrombomodulin 12 1 Thrombopoielin I 0 I Thromboxan A1 120
Thromboxane 98 Thrombozyten 112, 120 Thymin 32, 36 Thymusabhängigkeit I 08 Thyreoglobulin 84 Thyreokalzitonin 86 Thyroxin 84 Thyroxin-bindendes Globulin 84 Tight junctions 3 TIM-Proteine 44 TM P 35 TNF 99 TNF- 107 Tocopherol 17, 65 TOM-Proteine 44 Topoisamerase 38 trans-Konfiguralion 26 Transaldolase 60 Transaminierung 28 transfer-RNA (tRNA) 42 Transferasen I 0 Transferrin 107, 11 7, 122 transfer RNA (tRNA) 40 Transfusionszwischenfalle I I 0 Transketolase 60 Transkanin 90 Transkription 36, 40 Transkriptionsblase 40 Transkriptionsfaktoren 27, 40. 47 Translation 36, 42 Translokase 68 Translokation 48 Translokalionskanal 45 Transplan tatabstoßung I I 0 Transportproteine 3, 27 TRH 83,84 Triacyiglycerinabbau 68 Triacylglycerine 64 Triacylglycerinsynthese 66 Tricarbonsäurezyklus 76 Triglyceride 64 Triiodthyronin 84 Triiodthyronylrest 84 Trimethoprim 19, 35 Triase 52 Triosephophatisomerase 54 TripJetts 37 tRNA 42 Trypsin 127 TSH 83,84 Tumor-Nekrose-Faktor 99, I 07 Tumorsuppressorgene 49 Tunnelproteine 3 Tyrosin 30, 88 Tyrosinhydroxylase 88 Tyrosinkinase-Rezeptoren 46
u u-PA 12 1 Überempfindlichkeitsreaktion I OS,
110 Ubichinol 78 Ubichinoi-Cytochrom-c-Oxido-
reduktase 78 Ubichinon 78 Ubiquitin 43 UDP-Glucuronat 123 UDP-Clucuronyi-Transferase 123 UDP-C iukose 122 UMP 34 unideterminant I 08 Uniport 3 univalent I 08 unpolar 62 unsp zifisch Abwehr I 00 Uracil 32 Uridin- -1 hospha t 34 Uridindlphosphat·Ciukos 8
Urobilin I 15 Urobilinegen 11 5 Uroporphyrinogen 114 UTP 34
V V-Typ 15 V I -Rezeptoren 83 V2-Rezeptoren 83 Valenzelektronen 6 Valin 30 van der Waalsche-Kräfte 26 Vanillinmandelsäure 89 Vasopressin 83 Verdauung 126 Verdauungsenzyme 126 Verdauungsorgane 126 versei fbare Lipide 64 Vitamin-K-Antagonisten 19 Vitamin A 16 Vi taminanaloga 19 Vitamin B, 18 Vitamin ß12 18, 127 Vitamin ß2-Komplex 18 Vitamin Bn 18, 28 Vitamin C 19, 88 Vitamin D 17, 86 VitaminE 17 Vitamine 16 Vitamin K 17 VLDL 74 Volumenmangelschock I 12 Von-Gierke-Krankheit 59 von-Willebrand-Faktor 120
w Wachse 64 Wachstumsfaktoren 99 wasserlösliche Vi tamine 16, 18 Wasserretention 92 Wasserstoffatom 6 Wasserstoffbrückenbindung 8, 26 Wasserstoffperoxid I 19 Wasserstoffüberträger I I Wechselzahl 12 weiße Blutkörperchen 112 weißes Fettgewebe 65 Wernicke· Enzephalopathie I 8 Wirkungsspezifität I 0
X Xanthinoxidase 35 Xylulose-5-Phosphat 60
z Zellkern 4 Zellkontakte 3 Zellmembran 2 Zellorganellen 3 zelluläre Immunantwort I 00 Zellwacllstum 46 Zellzyklus 46 Zellzyklu -Kontrollsystem 46 Zinkfinger 40 Zitronensäurezyklus 76 Zona fasciculata 90 Zona glomerulosa 90 Zona relicu laris 90 Zwitterionen 25 Zyanid·Vergiftung 14 Zytoklne 98, I 07 Zytologi 2 Zytoplasma 2 Zyt s 3 Zytoskel 11. 3 zytosollsch Prot lnc 44 zytosollsch I ezeptor n 81 zytotoxisch T·Zellen I 02