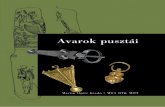Lachte das Mittelalter anders? Relative Alterität und kognitive Kontinuität komischer Strukturen...
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Lachte das Mittelalter anders? Relative Alterität und kognitive Kontinuität komischer Strukturen...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Sonderdruck aus
Manuel Braun (Hg.)
Wie anders war das Mittelalter?
Fragen an das Konzept der Alterität
Mit 5 Abbildungen
V& R unipress
ISBN 978-3-8471-0157-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Inhalt
Manuel BraunAlterität als germanistisch-mediävistische Kategorie: Kritik undKorrektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Kritik der Mediävistik am Konzept der Alterität
Rüdiger SchnellAlterität der Neuzeit : Versuch eines Perspektivenwechsels . . . . . . . . 41
Florian KraglAlterität als Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Katharina PhilipowskiVergangene Gegenwart, vergegenwärtigte Vergangenheit: Zeit undPräsenz in der mediävistischen Alteritätsdebatte . . . . . . . . . . . . . . 127
Timo Reuvekamp-FelberMittelalterliche Literatur als Schauraum einer performanzbestimmtenLaienkultur? Visualisierungstechniken als Grundlagen des Erzählens inVormoderne und Moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Silvan WagnerPostmodernes Mittelalter? Religion zwischen Alterität und Egalität . . . 181
II. Konstanten als Alternativen zum Konzept der Alterität
Christine StriddeInnovativer Formalismus und Konkretheit des Symbolischen. Konradsvon Würzburg poetologisches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Klaus KipfLachte das Mittelalter anders? Relative Alterität und kognitiveKontinuität komischer Strukturen in Schwankerzählungen des 13. – 15.Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Elisabeth SchmidÜbersetzen und Adaptieren französischer Versromane.Bearbeitungskonzepte im volkssprachlichen Mittelalter . . . . . . . . . . 265
Annette KehnelDer homo miserabilis oder : die menschliche Befähigung zum »Heimwehnach der Traurigkeit«. Kulturhistorische Grundlagenforschung zurconditio humana, zugleich ein Plädoyer für Universalien statt Alterität . 299
Inhalt6
Klaus Kipf
Lachte das Mittelalter anders? Relative Alterität und kognitiveKontinuität komischer Strukturen in Schwankerzählungendes 13. –15. Jahrhunderts
Zwischen 1980 und 2000 erlebte das Thema ›Lachen und Komik im Mittelalter‹,auch ausgelöst durch das Erscheinen des erfolgreichen Mittelalterromans »Ilnome della rosa« von Umberto Eco (1980, in deutscher Übersetzung 1982), eineKonjunktur in verschiedenen mediävistischen Disziplinen.1 Zu den in dieserDebatte kontrovers diskutierten Fragen gehörte und gehört, wenngleich zumeistimplizit, auch die nach der Alterität von Komik in literarischen Texten desMittelalters. Die Frage ›Lachte das Mittelalters anders?‹ darf unter den imRahmen dieser Debatte berührten Fragen als eine unerledigte gelten. Sie wirddeshalb hier noch einmal aufgegriffen, verbunden mit dem Versuch, sie für denim Untertitel skizzierten generischen Teilbereich methodisch kontrolliert zubeantworten, indem komische Strukturen in mittelalterlichen Texten an solchenStellen identifiziert werden, an denen über eine komische Situation, Handlungoder Äußerung gelacht wird.2 Im Rahmen des vorliegenden Bandes, dessenAbsicht es ist, die Eignung der Alterität als forschungsleitendes Konzept kritisch
1 Eco, Umberto: Il nome della rosa. Milano 1980; ders.: Der Name der Rose. Roman. München,Wien 1982; ders.: Nachschrift zum »Namen der Rose«. München, Wien 1984. Vgl. aus me-diävistischer Sicht: Lektüren. Aufsätze zu Umberto Ecos »Der Name der Rose«. Hg. v.Bachorski, Hans-Jürgen. Göppingen 1985 (GAG 432); »… eine finstere und fast unglaub-liche Geschichte?« Mediävistische Notizen zu Umberto Ecos Mönchsroman »Der Name derRose«. Hg. v. Kerner, Max. Darmstadt 1987; Wyss, Ulrich: Die Urgeschichte der Intellek-tualität und das Gelächter. In: Zeichen in Umberto Ecos Roman »Der Name der Rose«. Hg. v.Kroeber, Burkhart. München, Wien 1987, S. 85 – 106.
2 Diesen Weg gehen (unabhängig voneinander) Besamusca, Bart: Humor in »Malagis«. In: VanMadelgijs tot Malagis. Een bundel opstellen verzameld n. a. v. de tachtigste verjaardag vanGilbert de Smet. Hg. v. Schutter, Georges de u. Goossens, Jan. Gent 2002 (Studies op hetgebied van de oudere Nederlandse letterkunde 1), S. 65 – 88; und Kipf, Johannes Klaus:Mittelalterliches Lachen über semantische Inkongruenz. Zur Identifizierung komischerStrukturen in mittelalterlichen Texten am Beispiel mittelhochdeutscher Schwankmären, in:Komik und Sakralität. Aspekte einer ästhetischen Paradoxie in Mittelalter und Früher Neu-zeit. Hg. v. Grebe, Anja u. Staubach, Nikolaus. Frankfurt a. M. u. a. 2005 (Tradition – Re-form – Innovation 9), S. 104 – 128.
zu prüfen,3 möchte dieser Beitrag die mögliche Alterität mittelalterlicher Textehinsichtlich ihrer Komik anhand eines fest umrissenen Korpus von Textenmethodisch kontrolliert überprüfen.
Wie erwähnt fiel in der Debatte über die Eigenart des Lachens und der Komikim Mittelalter zwar selten – wenn ich recht sehe, nur ein einziges Mal – derBegriff ›Alterität‹,4 gleichwohl wurde eine Andersartigkeit von Lachen undKomik im Mittelalter in den meisten einschlägigen Untersuchungen behauptetoder zumindest vorausgesetzt. So geht Joachim Suchomski in seinem Stan-dardwerk »zum Verständnis mittelalterlicher komischer Literatur«5 auf derGrundlage der Kritik am Lachen als leichtfertig vor allem in der monastischenTheologie des Mittelalters6 davon aus, dass das Mittelalter »die Welt, den Men-schen, die Literatur und vielleicht auch das Lächerliche mit ganz anderen Augenangesehen«7 habe, und er zieht aus dieser Hypothese radikaler Alterität zweimethodische Folgerungen. Zunächst sei darauf zu verzichten, die »Kriterien fürdie Beurteilung komischer Literatur aus verschiedenen modernen Theorienüber das Lächerliche zu entlehnen«.8 Ferner stellt er für die eigene Arbeit das»Gebot« auf, »die Anwendung moderner Begriffe […] auf mittelalterliche ko-mische Dichtung möglichst zu vermeiden – oder sie erst nach einer Definitionaus mittelalterlicher Sicht wieder zu gebrauchen –, weil mit einer Übertragungder Begriffe zwangsläufig die […] moderne Konzeption von Komik und Humorund die darin implizierten Qualitätsmaßstäbe« auf das ›ganz andere‹ Mittelalterzurückprojiziert würden.9 Nun ist eine derart weitgehende Forderung nachmethodischer Askese – darauf haben bereits einige Rezensenten hingewiesen –10
nicht durchzuhalten, und auch Suchomski selbst verwendet ständig »moderne[]Begriffe« (etwa in dem zitierten Satz). Doch in seiner Berufung auf die ›ganzandere‹ Sicht des Mittelalters auf die Welt, den Menschen und das Lächerliche
3 Vgl. die Einleitung von Manuel Braun zu diesem Band.4 Besamusca [Anm. 2], S. 67, spricht (mit Verweis auf Hans Robert Jauss) von »de ›Alterität‹,
de andersheid, van de middeleeuwse literatuur« in Bezug auf ihre komische Wirkung.5 Suchomski, Joachim: delectatio und utilitas. Ein Beitrag zum Verständnis mittelalterlicher
komischer Literatur. Bern, München 1975 (Bibliotheca Germanica 18).6 Zur Bewertung des Lachens in mittelalterlicher Theologie Schmitz, Gerhard: Ein Narr, der
da lacht… Überlegungen zu einer mittelalterlichen Verhaltensnorm. In: Vom Lachen. EinemPhänomen auf der Spur. Hg. v. Vogel, Thomas. Tübingen 1992, S. 129 – 153 (mit der älterenLiteratur). Eine positivere Einstellung zum Lachen (vor allem bei Thomas von Aquin) decktauf Kemper, Tobias A.: Iesus Christus risus noster. Bemerkungen zur Bewertung des Lachensim Mittelalter. In: Komik und Sakralität [Anm. 2], S. 16 – 31. Vgl. auch Le Goff, Jacques: DasLachen im Mittelalter. Stuttgart 2004.
7 Suchomski [Anm. 5], S. 6.8 Ebd.9 Ebd.
10 Vgl. bes. Heinzle, Joachim. In: AfdA 90 (1979), S. 33 – 38; Knapp, Fritz Peter. In: MlatJb 14(1979), S. 295 – 298; Wailes, Stephen L. In: CollGerm 19 (1976/77), S. 82 f.
Klaus Kipf234
scheint mir Suchomskis extreme Position ein geeigneter Ausgangspunkt für dieEntwicklung meiner Ausgangshypothese zu sein. Denn auch wenn in derneueren Debatte um mittelalterliche Komik vergleichbar radikale Positionenkaum mehr vertreten werden, wird weiterhin mit Recht darauf hingewiesen,dass es eine »fundamentale Andersartigkeit mittelalterlicher Bewertungmenschlichen Gelächters«11 gebe, und es wird davor gewarnt, »sich dem Phä-nomen der mittelalterlichen Komik […] auf der Grundlage einer hinsichtlich derAnwendung auf den mittelalterlichen Gegenstand u. U. nicht genügend hinter-fragten modernen Theorie zu nähern«.12 Im Kontext einer »unübersicht-lich[en]« und »zersplitterte[n] Forschungslage« zum Thema »Komikverwen-dung im Mittelalter« soll davor gewarnt werden,13 die Andersartigkeit der Be-wertung des Lachens im Mittelalter zur These absoluter Alterität mittelalterli-cher Komik zu verallgemeinern, und es soll versucht werden, methodischkontrolliert Funktionsweisen mittelalterlicher Komik zu beschreiben.
Meine Arbeitshypothese besagt, dass literarische als ein Sonderfall sprach-licher Komik stets auf einem einfachen kognitiven Prozess aufseiten des Rezi-pienten beruht. Dieser basale kognitive Prozess, der sich textuell in wenigensemantischen Grundoperationen manifestiert, darf in sämtlichen komischenTexten, auch in solchen des Mittelalters, vorausgesetzt werden. Zumeist wird erdurch semantische Analyse der entsprechenden Texte bzw. Textpassagen re-konstruierbar sein. In einer Reihe von Fällen, aus denen die Textbeispielestammen, sagen die Texte darüber hinaus selbst oder legen es zumindest nahe,dass sie für mittelalterliche Rezipienten Anlass zum Lachen boten. Wenn sichsolche Textpassagen, deren komisches Potential durch ein textinternes Lachenüber eine bestimmte Situation, Handlung oder Äußerung herausgestellt wird,nun mithilfe der kognitiv-semantischen Theorie erklären lassen, liegt es nahe,dass sie auch für mittelalterliche Rezipienten aufgrund der zu beschreibendensemantischen Strukturen Anlass zum Lachen geben konnten und dies auchgetan haben dürften, sofern keine Lachhemmnisse vorlagen.14
11 Hartmann, Sieglinde: Ein empirischer Beitrag zur Geschichte des Lachens im Mittelalter :Lachen beim Stricker. In: Mediaevistik 3 (1990), S. 107 – 129, hier S. 108.
12 Tomasek, Tomas: Bemerkungen zur Komik und zum ›Humor‹ bei Wolfram von Eschenbach.In: Komik und Sakralität [Anm. 2], S. 94 – 103, hier S. 95.
13 Ebd., S. 94. Unter den neueren Beiträgen zur mittelalterlichen Komik sind wegen ihrermethodischen Reflexionen hervorzuheben: Steinmetz, Ralf-Henning: Komik in mittelal-terlicher Literatur. Überlegungen zu einem methodischen Problem am Beispiel des»Helmbrecht«. In: GRM N. F. 49 (1999), S. 255 – 273; Tomasek, Tomas: Komik im Minne-sang. Möglichkeiten einer Bestandsaufnahme. In: Komische Gegenwelten. Lachen und Li-teratur in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hg. v. Röcke, Werner u. Neumann, Helga. Pa-derborn u. a. 1999, S. 13 – 28.
14 Den Weg über die Analyse des Lachens von Figuren »und seine[r] Anlässe« schlägt auchSteinmetz [Anm. 13], S. 259, vor, ohne ihn selbst zu beschreiten. Systematisch begehen ihn
Lachte das Mittelalter anders? 235
Meine These werde ich in drei Schritten entwickeln. Zunächst stelle ich unterder Frage ›Warum lachen wir über Witze und andere komische Dinge?‹ eineHypothese über die zahlreichen komischen Texten zugrunde liegende seman-tische Struktur vor. In einem weiteren Schritt untersuche ich mittelalterlicheTexte, in denen handlungsextern oder -intern gelacht wird, und frage, worüberin ihnen gelacht wird. Nach einem Blick auf solche Erzählungen, die das Lachenals Rezeptionsmodell bereits im Prolog (oder einem sonstigen Paratext) the-matisieren, werden dabei vor allem solche Stellen diskutiert, in denen hand-lungsintern (intradiegetisch) gelacht wird. Ich werde dabei Schwankmären ausdem Stricker-Korpus, solche aus dem Themenkomplex erotischer Naivität undzuletzt einige Prosa-Fazetien des 15. Jahrhunderts betrachten. Abschließendversuche ich, anhand der beobachteten Textphänomene die titelgebende Fragedurch die Stichwörter ›relative Alterität‹ und ›kognitive Kontinuität‹ zu beant-worten.
I. Warum lachen wir über Witze und andere komische Dinge?
Antworten auf diese Frage verstehen bereits Grundschulkinder. So erklärt in derersten Staffel der Tübinger »Kinder-Uni« der Volkskundler und KomikforscherHermann Bausinger den »Trick beim Witz« damit, »dass er ganz bewusst Dingedurcheinander bring[e]«, und er erläutert die ›durcheinandergebrachten Dinge‹als »Bedeutungen« von Wörtern.15 Auch meine Tochter, die ein mindestensebenso großer Witz-Fan ist wie ich, begann bereits mit sieben Jahren, dieStruktur dieser Textsorte zu verstehen, wenn sie zu zwei in der Bauform ähn-lichen Witzen bemerkt, das seien zwar zwei ›verschiedene Witze, aber derselbeWitz‹. Sie meint damit: Es gibt zwei verschiedene witzige Erzählungen (Witz1),die auf demselben Prinzip (Witz2) beruhen.
Veranschaulichen möchte ich den grundlegenden kognitiven Prozess vonKomik an einem Witz, der im akademischen Milieu spielt :
Auf einem WC der Uni trifft ein Student seinen Professor und sagt zu ihm: »Endlichkann ich mir Ihnen gegenüber mal etwas herausnehmen.« Aber der Professor erwidert:»Machen Sie sich keine Illusionen; Sie werden auch diesmal den kürzeren ziehen«.16
Besamusca [Anm. 2], Hartmann [Anm. 11] und Kipf [Anm. 2]. Zahlreiche Studien überdie Bedeutungen des Lachens (s. u. Anm. 30–35) analysieren fallweise auch solche Szenen, indenen über Komisches gelacht wird.
15 Janssen, Ulrich u. Steuernagel, Ulla: Die Kinder-Uni. Forscher erklären die Rätsel derWelt. Stuttgart, München 2003, S. 93 – 116, hier S. 94.
16 Röhrich, Lutz: Der Witz. Seine Formen und Funktionen. Mit tausend Beispielen in Wortund Bild. Stuttgart 1977, S. 14.
Klaus Kipf236
Der Witz dieses Witzes liegt zunächst in der Doppelbedeutung der Redensarten›sich etwas herausnehmen‹ und ›den Kürzeren ziehen‹, die durch den situatio-nellen Kontext, die Herrentoilette, neben ihrem konventionalisierten meta-phorischen Sinn (›unangemessen freches Verhalten‹ und ›unterliegen‹) ihreursprüngliche Bedeutung wiedererlangen: »Scheinbar völlig harmlose Meta-phern […] erweisen sich als doppelsinnig und obszön«.17 Aus linguistischerSicht lässt sich der Witz somit als Kombination von zwei Wortspielen mitPhraseologismen erklären. Darüber hinaus lässt sich ein agonales Schema er-kennen. Auf die äußerst knappe Exposition und die Provokation des Studenten,der gegenüber dem Vertreter der überlegenen Rolle einen Geltungserfolg er-zielen möchte, folgt die übertrumpfende, die Logik des Angriffs aufnehmendeund zugleich überbietende Reaktion des Professors, der dem frechen Studentenmit ebenbürtig obszöner Münze zurückzahlt.18 Die Erwiderung des Professorswird durch ihre Endposition in der Kleinsterzählung zu einer übertrumpfendenSchlusspointe, die die Provokation des Studenten mit gleichen Mitteln, obszönerDoppeldeutigkeit, zurückgibt und diese überbietet. Durch diese Schematikentspricht dieser Witz exakt dem Schema von occasio, provocatio und dictumbzw. Pointe, das ich im Anschluss an Theodor Verweyen und Gunther Wit-
ting, die sich wiederum an die späthumanistische Poetik des Jacobus Pontanusanlehnen, als Grundstruktur der humanistischen Fazetie beschrieben habe.19
Die nächsten Beispiele entstammen einer Werbekampagne der »MünchenerVerkehrsgesellschaft«; sie sollen verdeutlichen, dass die hypothetisch zugrundegelegte generelle Struktur der Komik nicht auf sprachliche Komik beschränktist. Mit einem Plakat, auf dem drei Trambahn-Passagiere einen Mini-Staub-sauger mit sich führen (Abbildung 1), wirbt der Verkehrsverbund für Sauberkeitund Ordnung in seinen Fahrzeugen.
In einem anderen Bild derselben Serie stehen die Fahrgäste in Reih und Gliedsowie Hand in Hand auf dem Bahnsteig wie eine Gruppe eines Kindergartensbeim Ausflug; in einem dritten Plakat sieht man eine elegant gekleidete Frau eineganze Tonne Altpapier aus einem U-Bahn-Wagen wuchten. Das Prinzip allerPlakate dieser Kampagne ist dasselbe: Die Bilder zeigen übersteigert in sym-pathischer Skurrilität, wie sich Fahrgäste idealerweise verhalten sollen. DieBildunterschrift sagt im Klartext, was das Unternehmen von seinen Kunden
17 Ebd., S. 15.18 Daher entspricht der Witz nach der in der Schwankforschung etablierten Terminologie dem
»Steigerungstyp Revanche«; vgl. Bausinger, Hermann: Bemerkungen zum Schwank undseinen Formtypen. In: Fabula 9 (1967), S. 118 – 136, hier S. 128.
19 Kipf, Johannes Klaus: cluoge geschichten. Humanistische Fazetiensammlungen im deut-schen Sprachraum. Stuttgart 2008 (Literaturen und Künste in der Vormoderne 2), S. 29 – 32.Vgl. ferner Verweyen, Theodor u. Witting, Gunther : [Art.] Apophthegma. In: RLW 1(1997), S. 106 – 108, bes. S. 106.
Lachte das Mittelalter anders? 237
erwartet – dass sie »[i]hr Altpapier wieder mitnehmen«, »nicht drängeln« und»[i]hren Platz sauber hinterlassen«.20 Die in allen Plakaten der Serie identischeBildüberschrift »Sie müssen es ja nicht gleich übertreiben…«21 expliziert dasPrinzip, das den Appell der Kampagne, sich im Nahverkehr einer Metropolerücksichtsvoll und höflich zu verhalten, humorvoll transportiert.
Diese Übertreibung im Bild entspricht nun dem Grundprinzip der Komik,das nicht erst die rezente Linguistik herausgearbeitet hat.22 Der Handstaub-sauger passt ebenso wenig in die Trambahn wie die Altpapiertonne in die U-Bahn, und Erwachsene, die sich auf dem U-Bahnsteig paarweise in einer Reiheaufgestellt an den Händen halten, wirken unpassend, weil wir dieses Bild vonSchul- oder Kindergartenausflügen kennen. Allen Bildern eignet daher einMoment der semantischen Inkongruenz; sie enthalten ein Element, das nicht indie Vorstellung – die linguistische Semantik spricht von script bzw. frame – dergroßstädtischen Nahverkehrsmittel passt, das aber im Verbund mit den Textender Plakatserie doch wieder gut ins Bild passt, weil es die Intention der Kam-pagne humorvoll übertreibend umsetzt.
Als letztes Beispiel für Text-Bild-Humor, der von der Medialität lebt, sollenT-Shirts mit der Aufschrift »Juniorprofessor« bzw. »Juniorprofessorin« dienen,
Abbildung 1: Plakat der Werbekampagne 2008 der Münchner Verkehrsgesellschaft m. b. H.; URL:http://www.tramgeschichten.de/2008/10/15/sie-mussen-es-ja-nicht-gleich-ubertreiben/ (15.01.2010)
20 Alle Zitate nach Abbildungen der Plakate der Kampagne unter : http://www.mvg-mobil.de/ruecksicht.htm (aufgerufen am 15. 01. 2010).
21 Ebd.22 Zur Geschichte der Komiktheorie und älteren Versuchen, Inkongruenz bzw. Kontrast als
Grundprinzip zu formulieren vgl. Attardo, Salvatore: Linguistic Theories of Humor. Berlin,New York 1994 (Humor Research 1), S. 18 – 59.
Klaus Kipf238
die der Shop der Universität Potsdam ausschließlich in Kindergrößen vertreibt(Abbildung 2).
Diese T-Shirts beziehen ihren Witz aus dem neuen Sinn, den die Amtsbe-zeichnungen auf dem Rücken eines Kindergarten- oder Grundschulkindes er-halten. Gemeint ist nun nicht mehr ein relativ junges, befristet verliehenes Amtan deutschen Universitäten, sondern entweder ein (zumindest in den Augen derEltern) besonders aufgewecktes Kind, oder – und dieses Verständnis legt dieTatsache nahe, dass solche Produkte im Merchandising-Bereich einer Univer-sität vertrieben werden – das Kind eines Angehörigen dieser Institution, vondem die Eltern vielleicht hoffen, dass es später einmal eine richtige Professorinoder ein ausgewachsener Professor wird. Aber natürlich ist die ursprünglicheBedeutung des Begriffs den erwachsenen Betrachtern, die ein solches T-Shirtsehen oder kaufen, präsent, und aus dem semantischen Kontrast zwischen derursprünglichen und der neuen Bedeutung bezieht dieses Produkt seinen Reiz.
Diese Beispiele gegenwärtiger sprachlicher und bildlicher Komik könntenbeliebig fortgesetzt werden. Doch sollte bereits plausibel geworden sein, dasssprachliche Komik überaus häufig, womöglich stets, auf einem simplen kogni-tiven Prinzip beruht: dem der semantischen Ambivalenz, die Inkongruenz,Kontrast oder einen semantischen Gegensatz jedweder Art beinhaltet, der einenneuen, oft erst beim zweiten Hinsehen oder Hinterherhören zu erkennendenSinn eröffnet.23 Für jeden Einzelfall wäre dieses Prinzip neu auszubuchstabieren.In den einschlägigen Arbeiten der linguistischen Komiktheorie werden die se-mantischen Kontraste, Inkongruenzen und Ambivalenzen mithilfe der Script-
Abbildung 2: Kinder-T-Shirt ›Juniorprofessor‹ aus dem Uni-Shop der Universität Potsdam;URL: http://www.unishop-potsdam.de/shop/product_info.php?info=p68_Kindershirt–JUNIOR-PROFESSOR—-rot.html (15. 01. 2010)
23 Vgl. die script-theoretische Formulierung der Ambivalenz-Kontrast-Theorie bei Raskin,Victor : Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht u. a. 1985, S. 99: Ein Text sei genau dannein Witz, wenn er »compatible, fully or in part, with two different scripts« sei und diese»scripts with which the text is compatible are opposite in a special sense«. Auch ohne Rekursauf die linguistische Semantik hat sich die Witz-Forschung dieser Theorie genähert; sospricht Röhrich [Anm. 16] von verschiedenen Arten »komische[r] Konflikte« (S. 100, 120,140, 190 u. ö.).
Lachte das Mittelalter anders? 239
oder Frame-Theorie, die das internalisierte Wissen kompetenter Sprecher überGegenstände oder Zusammenhänge formalisiert, detailliert beschrieben.24 DieseRekonstruktionen müssen hier nicht nachvollzogen werden; eine alltags-sprachliche Beschreibung der Semantik zu den diskutierten Beispielen reichtaus, um die Erklärungskraft der Theorie durch ihre Anwendung auf verschie-denartige komische Phänomene zu plausibilisieren. Einige Vertreter der lingu-istischen Komiktheorie, etwa Victor Raskin,25 Salvatore Attardo
26 und RobertLatta,
27 erheben darüber hinaus den Anspruch der universalen Gültigkeit ihrerim Detail ausgearbeiteten und je unterschiedlich akzentuierten Theorien. Einsolcher Geltungsanspruch kann und muss hier nicht diskutiert werden. Jedochsoll im Folgenden gezeigt werden, dass auch deutschsprachige Texte des Mit-telalters an dieser kognitiven Grundstruktur der Komik partizipieren. Gelängedies, wäre die These absoluter Alterität mittelalterlicher Komik, die besagt, dassdas, worüber im Mittelalter gelacht wurde, nichts mit moderner Komik zu tunhabe, widerlegt.
Über die Funktion von Komik, über ihre kulturellen und sozialen Rahmen-bedingungen und anderes mehr ist mit dieser These über die semantischeStruktur komischer Texte noch nichts gesagt; es geht allein um das grundle-gende Prinzip, das für die kognitive Verarbeitung von Witzen sorgt. DieKenntnis dieses Prinzips ist keineswegs neu, die Theorien, die Komik generellauf Inkongruenz und damit auf ein kognitives Prinzip zurückführen, werdenmindestens seit dem 18. Jahrhundert vertreten,28 und die damit verbundeneErkenntnis ist relativ trivial. Trotz ihrer Einfachheit ist die basale semantischeTheorie der Komik für unsere Fragestellung relevant, denn die These, dassKomik immer und überall auf den Prinzipien semantischer Ambivalenz undsemantischen Kontrastes beruht, impliziert, wenn sie zutrifft, dass wir davonausgehen dürfen, auch in historisch oder sprachlich-kulturell differentenkomischen Texten diese Prinzipien wiederzufinden.
24 Vgl. vor allem Attardo [Anm. 22], S. 195 – 230; Raskin [Anm. 23], S. 59 – 98.25 Raskin [Anm. 23], S. 99 f.26 Attardo [Anm. 22], S. 226 f.27 Latta, Robert L.: The Basic Humor Process. Cognitive-Shift-Theory and the Case against
Incongruity. Berlin, New York 1999 (Humor Research 5).28 Fietz, Lothar : ›Versuche‹ einer Theorie des Lachens im 18. Jahrhundert. Addison, Hut-
cheson, Beattie. In: Semiotik, Rhetorik und Soziologie des Lachens. Vergleichende Studienzum Funktionswandel des Lachens vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hg. v. dems. u. a.Tübingen 1996, S. 21 – 36.
Klaus Kipf240
II. Worüber wurde im Mittelalter gelacht? Das Beispielmittelalterlicher Schwankerzählungen
Im Folgenden möchte ich aus dem großen Reservoir mittelalterlicherSchwankerzählungen in deutscher Sprache solche herausgreifen, in denen übereine bestimmte Situation, Handlung oder Äußerung gelacht wird. AufSchwankerzählungen in Vers und Prosa beschränke ich mich deshalb, weilaufgrund ihrer handlungsinhärenten Komik, über deren gattungsdefinierendeNotwendigkeit in der Forschung kein ernsthafter Zweifel geäußert wird,29 hiereine besonders hohe Dichte an Szenen zu erwarten ist, in denen nicht nur gelachtwird, sondern in denen dieses Lachen auch als eine Reaktion auf ein bestimmtesElement im Text erkennbar ist.
Dabei ist vorauszuschicken, dass nicht jedes Lachen im Text – es wird zumeistdas Lachen einer Figur, ein intradiegetisches Lachen sein – auch impliziert, dasszugleich Komik im Spiel ist. Anthropologisch kann Lachen vielfältige Ursachenhaben; daher ist es für den Literaturwissenschaftler interpretatorisch ambig.Das große Spektrum der historischen Semantik des Lachens im deutschspra-chigen Mittelalter ist seit der grundlegenden Dissertation von Karl RichardKremer
30 umrissen und wird auch in jüngeren Forschungsbeiträgen betont,etwa von Christoph Huber,
31 Sebastian Coxon,32 Jan-Dirk Müller,
33 WernerRöcke, Hans Rudolf Velten
34 oder Stefan Seeber, um nur einige zu nennen.35
29 Vgl. grundlegend Fischer, Hanns: Studien zur deutschen Märendichtung. 2., durchgese-hene u. erweiterte Aufl. besorgt v. Janota, Johannes. Tübingen 1983, S. 104. Eine eingehendeDiskussion bei Grubmüller, Klaus: Die Ordnung, der Witz und das Chaos. Eine Geschichteder europäischen Novellistik im Mittelalter : Fabliau – Märe – Novelle. Tübingen 2006, S. 67 –76.
30 Kremer, Karl Richard: Das Lachen in der deutschen Sprache und Literatur des Mittelalters.Diss. Bonn 1961.
31 Huber, Christoph: Lachen im höfischen Roman. Zu einigen komplexen Episoden im lite-rarischen Transfer. In: Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter. Kollo-quium im Deutschen Historischen Institut Paris 16.–18. 3. 1995. Hg. v. Kasten, Ingrid u. a.Sigmaringen 1998 (Beihefte der Francia 43), S. 345 – 358.
32 Coxon, Sebastian: do lachete die gote. Zur literarischen Inszenierung des Lachens in derhöfischen Epik. In: Wolfram-Studien 18 (2004), S. 189 – 210.
33 Müller, Jan-Dirk: Lachen – Spiel – Fiktion. Zum Verhältnis von literarischem Diskurs undhistorischer Realität im »Frauendienst« Ulrichs von Liechtenstein. In: DVjs 58 (1984), S. 38 –73.
34 Röcke, Werner : Die getäuschten Blinden. Gelächter und Gewalt gegen Randgruppen in derLiteratur des Mittelalters. In: Lachgemeinschaften. Kulturelle Inszenierungen und sozialeWirkungen von Gelächter im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Hg. v. dems. u. Velten,Hans Rudolf. Berlin, New York 2005 (Trends in Medieval Philology 4), S. 61 – 82; Velten,Hans Rudolf: Text und Lachgemeinschaft. Zur Funktion des Gruppenlachens bei Hofe in derSchwankliteratur. In: Ebd., S. 125 – 143.
35 Vgl. Seeber, Stefan: Poetik des Lachens. Untersuchungen zum mittelhochdeutschen Romanum 1200. Berlin, New York 2010 (MTU 140); ferner die übrigen Beiträge in den Anm. 2, 13, 28
Lachte das Mittelalter anders? 241
Hinzu kommt, dass mittelhochdeutsch lachen sowohl ›lachen‹ als auch ›lächeln‹bedeuten kann.36 Wird schließlich noch berücksichtigt, dass im Mittelhoch-deutschen noch weitere Vokabeln in das Wortfeld ›lachen‹ gehören wie smielen,smieren, smutzen, kuttern, kittern oder kachezen sowie alle Derivate dieserVerben,37 dann wird ersichtlich, dass für die historische Semantik hier ein weitesForschungsfeld offen steht, dessen Bestellung auf methodischer Höhe der Zeitnoch am Anfang steht.38
Auf der anderen Seite ist ebenfalls klar, dass nicht jedes Mal, wenn in einemText Komik vorkommt, auch eine Figur darüber lacht, oder der Erzähler dasimplizite Publikum zum Lachen auffordert. Insofern ist das Lachen von Figurenweder notwendige noch hinreichende Bedingung für die Identifizierung vonKomik im Text.39 Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Lachen von Figurennicht zwingend die Intention des Autors, das Publikum zum Lachen zu bringen,impliziert.40 Doch wenn die genannten Phänomene im Lachen von Figuren überkomische Situationen zusammenkommen, darf man davon ausgehen, dass dieSituation, die Handlung oder die Äußerung, über die gelacht wird, für zeitge-nössische Rezipienten zumindest komisches Potential besaß.41
In einem weiteren Schritt kann in einer Analyse desjenigen Textelements,über das gelacht wurde, auch die Wirkweise der Komik beschrieben werden.Dieses Verfahren kann man als Test für die Gültigkeit einer bestimmten Ko-miktheorie für mittelalterliche Texte verwenden;42 hier soll es für die Frage-stellung einer grundsätzlichen Unterschiedenheit mittelalterlicher Komik vonmodernen bzw. neuzeitlichen Formen des Lächerlichen fruchtbar gemachtwerden.
und 34 zitierten Sammelbänden sowie: Risus Mediaevalis. Laughter in Medieval Literatureand Art. Hg. v. Braet, Herman u. a. Leuven 2003.
36 Kremer [Anm. 30], S. 28.37 Ebd., S. 28 – 47.38 Vgl. jetzt den umsichtigen systematischen Aufrisss von Seeber [Anm. 35], S. 7 – 62, bes.
S. 24 – 34, der allerdings von der (zu der hier vertretenen These entgegengesetzten) Prämisseausgeht, dass die historisch adäquate Analyse mittelalterlichen Lachens auf »moderne Ko-miktheorien« (S. 266) gerade zu verzichten hätte.
39 Kipf [Anm. 2], S. 113.40 Grubmüller, Klaus: Wer lacht im Märe – und wozu? In: Lachgemeinschaften [Anm. 34],
S. 111 – 124, hier S. 111. Dieser Punkt scheint bei Hartmann [Anm. 11] nicht immer be-dacht zu sein.
41 So bereits Besamusca [Anm. 2], S. 67: Es sei unwahrscheinlich, dass mittelalterliche Re-zipienten »chagrijnig reageerden op situaties die de lachlust opwekken van de personages«.
42 Kipf [Anm. 2]. Eine Überschneidung der hier diskutierten Textstellen mit den dort sowievon Grubmüller [Anm. 40] angesprochenen ist unvermeidlich.
Klaus Kipf242
II.1 lachen als idealer Rezeptionsmodus im Prolog
Innerhalb der Schwankmären können beim Vorkommen von Verben desWortfelds lachen zwei Typen unterschieden werden: Einerseits kann Lachen alsintendierte Rezeptionsweise – diese nenne ich extradiegetisch –43 in den rah-menden Paratexten (Pro- bzw. Epilog) eingeführt werden, andererseits kommtLachen auch intradiegetisch, als Lachen handelnder Personen vor (s. u. II.2.).Die extradiegetische Thematisierung des Lachens findet sich insbesondere inPro- und Epilogen: So fordert der anonyme Dichter von »Schrätel und Was-serbär« den Hörer eingangs auf:
Swer hovel�cher mære ger,der neige herze und �re her,dem gibet dise �ventiureein lachen ze stiure44.
Solcherart wird das lachen von vornherein als intendierter Rezeptionsmodusprivilegiert, als ein Rezeptionsmodus, der von der Autor-Instanz des Textesproduktionsseitig gestützt wird mit der biblisch zu untermauernden Bemer-kung,45 dass auch der Autor lache, wenn die rechte Zeit dafür sei und die Ab-wesenheit von Sorgen, die auf die Nöte der Existenz des historischen Autors alsFahrender verweist, den zum Lachen benötigten Freiraum verschaffe:
ich lache ouch, wen des wirt z�t,ob sorge mir die muoze g�t,der ich wan sorge ie muoste pflegen (V. 5 – 7).
Zweifellos ist das »anmutige Gedicht«46 vom Kobold im Haus des dänischenBauern, der einem zahmen Eisbären, der im Auftrag des Königs von Norwegendem König von Dänemark als Geschenk überreicht werden soll, und seinemBegleiter Herberge gewährt, wobei es zum Kräftemessen zwischen Kobold undEisbär kommt, sowohl im Großen wie im Detail komisch. Klaus Grubmüller
benennt die »ironische Distanz [des Erzählers, K. K.] zum spukhaften Gesche-hen« als Ursache, die die »abergläubische Hilflosigkeit des Bauern«, die »hel-
43 Ich verwende die Begriffe ›intra-‹ und ›extradiegetisch‹ in Anlehnung an Genette, G�rard:Die Erzählung. München 21998, S. 162 – 165 u. ö. Allerdings beziehe ich mich damit auf jedesElement außerhalb der erzählten Welt, nicht nur – wie Genette – auf Elemente einer Die-gese höherer Ebene, etwa eine Rahmenerzählung.
44 Zitiert nach: Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Hg., übersetzt u. kommentiert v.Grubmüller, Klaus. Frankfurt a. M. 1996 (Bibliothek deutscher Klassiker 138), S. 698 – 717,hier V. 1 – 4.
45 Vgl. die ›Lehre von der fallenden Zeit‹ Ecl 3, 1 – 8, bes. 3, 4: tempus flendi et tempus ridendi,tempus plangendi et tempus saltandi.
46 Kraus, Carl von: Studien zu Heinrich von Freiberg II – IV. München 1941 (Sitzungsberichteder Akademie der Wissenschaften München, Phil.-hist. Abt. II 6), S. 20.
Lachte das Mittelalter anders? 243
denhafte Selbstgewißheit des Bärenführers« oder die »siegreiche Tapsigkeit desBären« mit Mitteln sprachlicher Komik inszeniert, und er benennt auch »ko-mische Kontraste« wie denjenigen in der Einführung des Kobolds, dessenKleinheit (kaum drei Spannen) und Bekleidung (ein r�tez keppel, V. 190) imGegensatz zu seiner Gefährlichkeit stehen, oder die Flucht des Bärenführers inden bakoven (V. 264), aus dem er den Kampf beobachtet.47 Ein Poltergeist mitrotem keppel ist durch den Kontrast zwischen unheimlich-gefährlichem my-thologischem Wesen und Harmlosigkeit signalisierender Bekleidung ein Signaldafür, dass wir es nicht mit einer Schauergeschichte, sondern mit der Parodieeiner solchen zu tun haben. Schließlich beruht auch die Schlusspointe desSchwanks auf einem komischen Missverständnis, einer typischen, gerade inKomödien häufigen Form, denn der Kobold verlässt den Hof des dänischenBauern nur, weil er glaubt, dass dieser noch weitere »große Katzen« – für einesolche hält er den Bären – habe.
Auf ähnliche Weise wie im Prolog von »Schrätel und Wasserbär« kündigt in»Drei buhlerische Frauen«, der ältesten Version des Schwankstoffs »Die Wetteder drei Frauen«,48 der Autor zu Beginn des Prologs eine Geschichte ›über lustigeSachen‹, von gemelichen dingen49 an, die auf angenehme Weise die Zeit ver-treiben könne:
nu wil ich beginnensagen seltsæniu mære.nu si iu niht swære,wan wir mugen ir wol lachen (V. 6 – 9).
Auch hier steht außer Frage, dass die dieser Ankündigung folgende Geschichtevoller komischer Effekte ist, da bereits die Rahmenhandlung darauf beruht, dassdrei Ehefrauen, die einen goldenen Ring gefunden haben, diesen derjenigenüberlassen wollen, die am lustigsten (gemelichest) von einem Betrug an ihremEhemann erzählen kann:
47 Grubmüller, Klaus: Kommentar. In: Novellistik [Anm. 44], S. 1003 – 1379, hier S. 1264.48 Raas, Francis: Die Wette der drei Frauen. Beiträge zur Motivgeschichte und zur literarischen
Interpretation der Schwankdichtung. Bern 1983 (Basler Studien zur deutschen Sprache undLiteratur 58).
49 Neues Gesamtabenteuer. Das ist Fr. H. von der Hagens Gesamtabenteuer in neuer Auswahl.Die Sammlung der mittelhochdeutschen Mären und Schwänke des 13. und 14. Jahrhunderts.Bd. 1. Hg. v. Niewöhner, Heinrich. 2. Aufl. hg. v. Simon, Werner mit den Lesarten besorgt v.Boeters, Max u. Schacks, Kurt. ND Dublin, Zürich 1967, S. 111 – 117, hier V. 3, unter dem Titel»Drei listige Frauen I«; seit Fischer [Anm. 29], S. 286, unter dem Titel »Drei buhlerischeFrauen«; so auch Schirmer, Karl-Heinz: [Art.] Drei buhlerische Frauen. In: 2 VL 2 (1980),Sp. 224 f.
Klaus Kipf244
unser iegelich sol sagenane valsche sinnevon der besten minnedie si an ir elichen manze tougner trutschaft ie gewan;diu aller gemelichest sage,daz si das golt hinnen trage (V. 60 – 66).
Die drei Geschichten, die die Frauen möglichst gemelich erzählen wollen, ba-sieren auf dreister Überlistung ihrer Ehemänner. Die Komik der drei List-handlungen beruht aber – wie jede Listkomik von Aristophanes bis zum Ko-mödienstadl – auf dem Kontrast zwischen dem vollständigen Wissen der Zu-schauer und der defizitären Einschätzung der Überlisteten.
Wenn aber das Schwankmäre als Adaptation des altfranzösischen fabliauebenfalls ein conte � rire, eine ›Erzählung zum Lachen‹ ist, dann überrascht es,dass in den programmatischen Passagen dieser Textreihe die beiden zitiertenBelege, »Schrätel und Wasserbär« sowie »Drei buhlerische Frauen«, offenkundigallein stehen.50 Zwar ergänzen Prologaussagen mit ähnlicher Intention, die etwadie zu erzählende Geschichte als mære […] von gemelichen dingen51 oder aberals büechel […] j von seltsænen geschihten52 bzw. seltsænen mære53 bezeichnen,diese Belege,54 doch wird der Befund, dass nur der kleinere Teil der alsSchwankmären klassifizierten Kurzerzählungen die komische Wirkungsabsichtin den diskursiven Paratexten reflektiert, durch diese Beobachtungen nichtaußer Kraft gesetzt. Man darf annehmen, dass Darstellungskonventionen, die inden kommentierenden Paratexten wie Prolog, Pro- oder Epimythion neben derunterhaltenden zumindest auch eine belehrende Intention privilegieren, auch inden Kurzerzählungen mit komischen Themen dominieren.55
50 Meine Recherchen stützten sich auf die »Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank« (http://www.mhdbdb.sbg.ac.at, aufgerufen am 15. 12. 2009) und verschiedene Wörterbücher. AuchFischer [Anm. 29], S. 104, führt allein die beiden oben erwähnten Mären an.
51 Sibote: Die Zähmung der Widerspenstigen. In: Neues Gesamtabenteuer [Anm. 49], S. 2 – 35,hier V. 2 f.
52 Johannes von Freiberg: Das Rädlein. In: Novellistik [Anm. 44], S. 618 – 647, hier V. 5 f.53 Ebd., V. 11.54 Sie sind zusammengestellt bei Fischer [Anm. 29], S. 104.55 Interessanterweise stehen sowohl am Anfang als auch am Ende der Gattungsentwicklung der
schwankhaften Kurzerzählung in Deutschland Texte, deren Prologe, Pro- oder Epimythienfast stets den lehrhaften Anspruch betonen, am Anfang die des Strickers, am Ende diejenigenHans Rosenplüts oder, wenn man sie hinzuzählen will, Hans Sachsens; vgl. Grubmüller
[Anm. 40], S. 120 f.
Lachte das Mittelalter anders? 245
II.2 lachen handelnder Figuren
Weit häufiger begegnet in den Schwankmären ein zweiter Typus textinternenLachens: das intradiegetische Lachen handelnder Figuren, das häufig im resü-mierenden Rückblick der Protagonisten auf die gelungene List oder den ge-lungenen Streich am Ende der erzählten Handlung erscheint. So lachen zweinamenlose Studenten, die Protagonisten der ältesten deutschsprachigen Versiondes Schwanks vom »Studentenabenteuer« (A), ungehemmt nach vollbrachterArbeit, nachdem sie »sich durch raffinierte Vertauschung von Bett und Wiegeeine Liebesnacht mit der Frau und der Tochter ihres Gastgebers«56 erschlichenhaben:
die schuolære die schieden danmit urloube �f ir str�ze;si lachten �ne m�zevon diser gemelicher t�tund sich des gelückes ratund ir sælden sch�benals� liezen tr�ben.57
Eindeutig wird hier über eine komische Handlung, eine gemeliche[] t�t, gelacht,die in der Verwechslungskomödie zwischen dem Gastgeber und seiner Ehefrau,deren herangewachsener Tochter und dem Nachzügler-Sohn in der Wiege aufder einen und den beiden Studenten, die als Gäste in derselben Stube über-nachten, auf der anderen Seite besteht.58 Auch in anderen Schwankmären lachendie Protagonisten am Ende über die Handlung, die vom Erzähler explizit als›lustig‹, gemelich bezeichnet wird, so in Heinrich Kaufringers »HübscherSchusterin« oder in Volrats »Die alte Mutter«: ez d�hte si gemellich; j si lachtenund verburgen sich.59
Diese Beispiele wären leicht – im Anschluss insbesondere an Grubmüllerseinschlägige Stellensammlung – fortzusetzen und zu vermehren. Dies soll hierjedoch unterbleiben zugunsten eines systematischen Blicks auf die ältesten indeutscher Sprache überlieferten Schwankmären, die Stricker-Mären. Auf dasKorpus der dem Stricker zugeschriebenen komischen Kurzerzählungen zu-rückzugreifen, bietet sich an, weil sich bei ihm die Praxis komischen Erzählens
56 Ebd., S. 112.57 Stehmann, Wilhelm: Die mittelhochdeutsche Novelle vom Studentenabenteuer. Berlin 1909
(Palaestra 67), S. 198 – 216, hier V. 466 – 472. Dieses und die folgenden Beispiele bereits beiGrubmüller [Anm. 40], S. 112 f.
58 Zum Stoffkomplex vgl. Ziegeler, Hans-Joachim: Boccaccio, Chaucer, Mären, Novellen.»The Tale of the Cradle«. In: Kleinere Erzählformen im Mittelalter. Paderborner Colloquium1987. Hg. v. Grubmüller, Klaus u. a. Paderborn u. a. 1988, S. 9 – 31.
59 Von der alten Mutter. Hg. v. Haupt, Moriz, In: ZfdA 6 (1848), S. 497 – 503, hier V. 175 f.
Klaus Kipf246
mit theologisch informierter Bewertung des Lachens verbindet.60 Die einschlä-gigen Textstellen sind in der Forschung denn auch bekannt und diskutiert,61
dennoch sollen einige davon unter unserer Fragestellung neu aufgegriffenwerden, denn auch in den Stricker-Mären wird über komische Kontraste gelacht.
So will im »Erzwungenen Gelübde«, einer »eheliche[n] Kraft- und Treue-probe[]«,62 ein Ehemann von seiner Frau unter Morddrohung das Gelübde er-pressen, nach seinem Tod unverheiratet zu bleiben. Von einer Freundin beraten,geht die Frau unter der Bedingung, dass der Mann dasselbe gelobe, vor denherbeigeholten Verwandten beider darauf ein, verlangt aber als Garantie(pfant)63 ein bedingungsloses Versprechen64 sowie eine hohe Summe als Si-cherheit (widerwette, V. 127) für die Einhaltung des Eids. Als die Frau dann diesofortige moniage beider verlangt, sieht sich der Mann außerstande, sein Ver-sprechen einzuhalten und muss, um sich vom Eid und der widerwette freizu-kaufen, der Frau einen Liebhaber zu Lebzeiten zugestehen. Als der Mann dieseehrverletzende Forderung erleichtert und gern gewährt, sie sogar als Glücksfall,als einen Sechser im Würfelspiel, bezeichnet und ein Fest feiern will, löst erdamit bei den anwesenden Verwandten Gelächter aus:
des begundens alle lachen,daz im diu schande geschachund er doch sælden dar an jach (V. 228 – 230).
Hier liegt, durch das Adverb des syntaktisch eindeutig markiert, ein Lachen überein Verhalten des Protagonisten vor, somit eine klare Verbindung von komi-schem bzw. lächerlichem Verhalten und dem Lachen als Reaktion von beob-achtenden Akteuren. Der Erzähler erklärt überdies den Grund für das Lachen,der in einem Kontrast in der Bewertung des Ausgangs dieses Ehestreits besteht.Dass der Mann ein in den Augen der Verwandten (beider Parteien) schändlichesErgebnis als Glück (sælde) empfindet, ist in deren Augen lachhaft.65 Dennochendet die eheliche Kraftprobe – atypisch für Stricker-Erzählungen – versöhn-
60 Vgl. bereits Hartmann [Anm. 11], S. 110: Beim Stricker fänden sich »konkrete Darstel-lungen von menschlichem Gelächter und abstrakte Reflexionen über das Lachen, Lach-theorie und Lachpraxis, im Werk ein und desselben Autors vereint«.
61 Vgl. vor allem ebd.; ferner Kipf [Anm. 2], S. 122 – 124; Rocher, Daniel: Inwiefern sindStrickers mæren echte contes � rire? In: Wolfram-Studien 7 (1982), S. 132 – 143.
62 Fischer [Anm. 29], S. 96.63 Der Stricker : Das erzwungene Gelübde. In: Ders.: Verserzählungen I. Hg. v. Fischer,
Hanns. 4. revidierte Aufl. besorgt v. Janota, Johannes. Tübingen 1979 (ATB 53), S. 11 – 21,hier V. 119.
64 Zum Motiv des rash boon vgl. Dicke, Gerd: Gouch Gandin. Bemerkungen zur Intertextualitätder Episode von »Rotte und Harfe« im »Tristan« Gottfrieds von Straßburg. In: ZfdA 127(1998), S. 121 – 148.
65 und (V. 230) ist hier adversativ mit ›während, gleichwohl, indessen‹ zu übersetzen; vgl. Kipf
[Anm. 2], S. 123, Anm. 95.
Lachte das Mittelalter anders? 247
lich. Der Mann verhält sich nach dieser Niederlage derart zuvorkommend ge-genüber seiner Frau, dass diese die Erlaubnis, sich einen Liebhaber zuzulegen,glatt vergisst (V. 231 – 236).
Nur ein weiteres Mal wird in den Kurzerzählungen, die Hanns Fischer als›Mären‹ klassifiziert, über etwas Komisches gelacht.66 In der »EingemauertenFrau« mauert ein Mann seine widerspenstige Ehefrau kurzerhand ein, nachdemauch brutale Prügel sie nicht gefügig gemacht haben. Als unfreiwillige Inkluse67
muss die Frau mitansehen, wie ihr Mann es sich gutgehen lässt und sogar eineGeliebte nimmt. Dies kuriert die Ehefrau von ihrer Halsstarrigkeit, und siemacht es sich zur Aufgabe, anderen übelen w�ben68 durch die bei ihr bewährteMethode der Einmauerung ir übele (V. 272) auszutreiben. Einige der als Zeugender Bekehrung anwesenden männlichen Verwandten der beiden möchten diesesAngebot für ihre (ebenfalls anwesenden) Ehefrauen69 annehmen und diesegleich dalassen. Sie lösen damit große Heiterkeit aus, auch bei den Frauen, aufderen Kosten der Scherz geht:
suml�che spr�chen: ›mir h�t diu m�ns� vil ze leide get�n,si muoz ouch l�hte hier best�n,daz ir mirs guot machet.‹des wart d� vil gelachetvon rittern und von vrouwen (V. 288 – 293).
Erneut ist durch das Adverb des der Bezug des Lachens als ein Lachen über etwasKomisches syntaktisch markiert. Der Anlass des Lachens ist die Äußerung der alsZeugen geladenen Männer, auch ihre Frauen könnten eine vergleichbare Be-handlung zur Besserung vertragen. Durch die pragmatische Rahmenbedingung,die Anwesenheit der Ehefrauen, wird diese Absicht ironisiert; der komischeKontrast dieser Äußerung besteht auf pragmatischer Ebene zwischen demscheinbar ernsten Eingehen auf das Angebot der kurierten Eingemauerten undder Anwesenheit der vorgeblich ebenfalls besserungsbedürftigen Frauen, diediese Ernsthaftigkeit durchkreuzt. Es handelt sich daher wohl nicht nur um ein»befreiende[s] Gelächter der Beteiligten über die geglückte Aussöhnung nacheiner ehelichen Kraftprobe«,70 und ganz sicher ist das Lachen nicht auf die »Er-klärung der ritter unter den Gästen, sie [die bekehrte Widerspenstige, K. K.] sei
66 Die Fälle, in denen andere Arten des Lachens vorkommen, sind genannt und kommentiertbei Hartmann [Anm. 11], S. 120 – 123; vgl. ferner Kipf [Anm. 2], S. 122 – 124.
67 Zum frömmigkeitsgeschichtlichen Hintergrund Wailes, Stephen L.: Immurement and Re-ligious Experience in the Stricker’s »Eingemauerte Frau«. In: PBB 96 (1974), S. 79 – 102.
68 Der Stricker : Die eingemauerte Frau. In: Ders. [Anm. 63], S. 50 – 65, hier V. 271.69 Die Anwesenheit der Frauen wird vom Erzähler eindeutig vermerkt: n�ch ir vriunden und
n�ch den s�nen j sande er, daz si dar g�hten j und ir vrouwen mit in br�hten (V. 222 – 224).70 Hartmann [Anm. 11], S. 121.
Klaus Kipf248
ein heilic w�p (285)«,71 zu beziehen, denn der Anlass des Lachens ist nicht alleindie Erleichterung über den gelösten Konflikt, sondern ein konkreter Scherz, derdie Lösung des Konflikts allerdings zur Voraussetzung hat.
Ein weiteres Lachen über eine komische Handlung findet sich im »PfaffenAmis«, dem ersten Schwankroman in deutscher Sprache. Am Ende der elftenEpisode (der Fassung der Riedegger Handschrift) lacht eine unbestimmteGruppe von intradiegetischen Rezipienten über das Ergebnis der Schwank-handlung. Der Protagonist, den es nach Konstantinopel verschlagen hat, hateinen byzantinischen Stoffhändler um dessen Vermögen gebracht, indem ereinen deutschen, der Landessprache nicht mächtigen Maurer als Bischof aus-gegeben und in dessen Namen den gesamten Warenbestand des Stoffhändlersaufgekauft hat. Er zahlt aber nicht sofort, sondern macht sich unter dem Vor-wand, erst Geld aus der Herberge holen zu müssen, mit den Stoffen aus demStaub und lässt den ›Bischof‹, den er zuvor instruiert hatte, auf jede Frage nurmit deisw�r zu antworten, beim Händler zurück. Diese Konstellation führt zuzunehmend absurden Dialogen zwischen dem Stoffhändler und dem Maurer-bischof, da dieser auf die in immer größerer Erregung vorgebrachten Fragen undDrohungen des Geprellten, schließlich sogar auf körperliche Angriffe in sto-ischer Ruhe immer mit dem gleichen deisw�r antwortet. Hier wirkt das gleichekomödiantische Motiv wie im 15. Jahrhundert in der »Farce du ma�tre Pathelin«,die Johannes Reuchlin zu seiner erfolgreichen Schulkomödie »Scaenica pro-gymnasmata« (1497) inspirierte, die u. a. Hans Sachs ins Deutsche übertrug(»Henno«, 1531).72
Als die Täuschung endlich auffliegt und der Maurer dem Händler den Betruggesteht – ein Stadtbewohner hat zuvor im angeblichen Bischof den Maurer er-kannt –, wirft dieser sich vor, ein Narr zu sein, weil er auf Amis’ Versprechungenhereingefallen ist:
ich bin ein t�r, als got wol weiz,daz ich mir durch ein geheizs� gr�zen schaden h�n get�n73.
71 Ziegeler, Hans-Joachim: Erzählen im Spätmittelalter. Mären im Kontext von Minnereden,Bispeln und Romanen. München 1985 (MTU 87), S. 208. Damit entfällt auch der Beleg fürZiegelers Ansicht, dass die »Diskrepanz zwischen legendarisch vorgeprägtem Handeln derFrau und dessen Interpretation durch die Figuren der Fikition« (ebd.) das Legendenschemakonsequent ironisiere. Vgl. so bereits Wailes [Anm. 67], S. 94.
72 Vgl. (auch zur Motivparallele zum »Amis«) Dietl, Cora: Die Dramen Jacob Lochers und diefrühe Humanistenbühne im süddeutschen Raum. Berlin, New York 2005 (QF 37), S. 170 f.
73 Der Pfaffe Amis von dem Stricker. Ein Schwankroman aus dem 13. Jahrhundert in zwölfEpisoden. Hg. u. übersetzt v. Henne, Hermann. Göppingen 21992 (GAG 530), V. 2017 – 2019.
Lachte das Mittelalter anders? 249
Den Verlust des versprochenen Bistums, so der Maurer weiter, könne er ja nochverschmerzen, doch der Rücken schmerze doch zu arg von den Schlägen desTuchhändlers:
ich wolt ez �ne klage l�n,daz mir des bistuoms niht enwirt,wan daz mir der rücke swirt. (V. 2020 – 2022)
Daraufhin fährt der Erzähler fort:
swer daz vernam, der lachteunz an den wirt: dem krachtevor zorne herze unde muot (V. 2023 – 2025).
Eindeutig ist das Lachen als eine Reaktion auf einen Wahrnehmungsakt ge-kennzeichnet. Es erscheint möglich, ja plausibel, dass das Lachen all jener, die›dies hörten‹, nicht nur allgemein auf die Komik der gesamten Episode zu be-ziehen ist, sondern konkret auf die lächerliche Äußerung des Maurers, der biszum Schluss ernsthaft damit rechnet, Bischof zu werden, und dies mit denSchmerzen seines geprügelten Rückens vergleicht. Doch auch, wenn wir diesesLachen auf die gesamte voraufgehende Episode beziehen, können wir es alsLachen über eine komische Handlung identifizieren, die sich mit den Mitteln derAmbivalenz-Kontrast-Theorie beschreiben lässt. In der unterschiedlichen Re-aktion der neutralen Beobachter und des betrogenen Händlers zeigt sichüberdies, dass die Wahrnehmung von Komik durch individuelle Dispositionenverhindert werden kann.
Betrachtet man das Werk des Strickers als Ganzes, so fällt auf, dass die Belegefür die Vokabel lachen, die keine Reaktion auf Komik bilden, deutlich in derMehrheit sind.74 Auch sind es keineswegs die von Fischer als Mären einge-stuften Erzählungen, in denen das Lachen am häufigsten vorkommt, sondernandere Kurzerzählungen. Mit zehn Belegen voran steht »Der ernsthafte König«,eine geistliche Exempelerzählung, die das theologische Verdikt gegen das La-chen narrativ umsetzt.75 In ihr geht es um einen vorbildlichen, ernsthaftenKönig, dessen leichtlebiger Bruder ihn fragt, warum er nie lache. Als Antwortinszeniert der König ein allegorisches Rollenspiel, indem er den Bruder vor allenUntertanen im Hemd auf ein Podest steigen und vier Speere direkt auf seinen
74 Sie sind komplett besprochen in meiner unpublizierten Staatsexamensarbeit : Kipf, Jo-hannes Klaus: Komik im »Daniel von dem blühenden Tal« des Strickers. Münster 1998,S. 110 – 136. Aufzufinden sind sie über Christoph, Siegfried: Lemmatisierter Index zu denWerken des Strickers. Tübingen 1997 (Indices zur deutschen Literatur 30), S. 272.
75 Vgl. umfassend, besonders zur Motivgeschichte, Derron, Marianne: Des Strickers ernst-hafter König. Ein poetischer Lachtraktat des Mittelalters. Eine motivgeschichtliche Studiezur ersten Barlaam-Parabel. Frankfurt a. M. u. a. 2008 (Kultur, Wissenschaft, Literatur 19),bes. S. 111 – 161.
Klaus Kipf250
Körper richten lässt. Auf die Frage des Königs, warum er nun nicht lache, ant-wortet der Bruder, dass jede durch das Lachen verursachte Bewegung sein si-cherer Tod sei. Genau so, versetzt der König, gehe es auch ihm. Vier Dinge, dieMarter Christi, die Ungewissheit der eigenen Todesstunde, das unbestimmteSchicksal der Seele nach dem Tod und der unbekannte Ausgang des JüngstenGerichts, hinderten ihn am Lachen:
daz hat min herze also versnitendaz ich daz lachen han vermitenund nimmer niht gelachen mac76.
Hier, wie auch in einer anderen Beispielerzählung,77 erwähnt der Stricker dentheologischen Topos, dass Christus nie gelacht habe, weil er um seine künftigenLeiden gewusst habe.78
In der Erzählung »Der ernsthafte König« wird das Lachen zum Thema, indemes als Signum eines für einen König unstatthaften leichtfertigen Lebenswandelsstilisiert und einer strengen Askese gegenübergestellt wird. Die Ursachen desLachens bzw. seiner Verweigerung spielen dabei keine Rolle. Dieser Befundkönnte durch die Auswertung der übrigen Stellen aus der geistlichen Exem-peldichtung, in denen der Stricker das Lachen mit theologischen Gründen ver-urteilt, untermauert werden.79 Die negative Einschätzung des Lachens in dergeistlichen Dichtung des Strickers, besonders im »Ernsthaften König« zeigt aberauch, dass die theologische begründete Skepsis gegenüber dem Lachen undvirtuose Handhabung narrativer Komik keine Gegensätze sein müssen.
Wie gattungsgebunden der Einsatz der Vokabel lachen im Werk ein unddesselben Autors sein kann, zeigen die vier Erwähnungen in der »Frauenehre«,einer frühen höfischen Minnerede bzw. -lehre. Alle bewegen sich in den kon-ventionellen Bahnen der Darstellung von vröude als Grundlage der weltlich-höfischen Kultur und der Darstellung des lachens, das hier wohl eher mit ›lä-cheln‹ zu übersetzen ist. So ist der Anblick der Frau für den Mann ein spilende[r]schin […], der in sin herze lachet j durch ir süezen anblic80. An einer zweitenStelle ist die schœne
76 Die Kleindichtung des Strickers. Gesamtausgabe in 5 Bdn. Hg. v. Moelleken, Wolfgang W.u. a. Göppingen 1973 – 1978 (GAG 107/I – V), Nr. 98, V. 131 – 133.
77 Des Königs alte Kleider (ebd., Nr. 76), V. 111 f. : christ hat umbe uns gewachet, j er hat nie nihtgelachet. Vgl. Dworschak, Helmut: Milch und Acker. Körperliche und sexuelle Aspekte derreligiösen Erfahrung. Am Beispiel der Bussdidaxe des Strickers. Bern 2003 (Deutsche Lite-ratur von den Anfängen bis 1700 40), S. 208 – 210. u. ö. (Register).
78 Der ernsthafte König, V. 127 – 129: er het vor angest die not j uf die marter und uf den tot, j dazman in sach gelachen nie.
79 Kipf [Anm. 74], S. 115 – 118.80 Hofmann, Klaus: Strickers Frauenehre. Überlieferung – Textkritik – Edition – literatur-
geschichtliche Einordnung. Marburg 1976, V. 409 – 411.
Lachte das Mittelalter anders? 251
[…] vür den smerzenein vröude sines herzenund der gedanke spiegel gar :die schowent lachende dar (V. 1417 – 1420).
Da es in der »Frauenehre« um Frauenpreis geht, bedient sich der Stricker derDarstellungskonventionen und der Wertungskriterien des Minnediskurses, etwades Lachens der Frau als Zeichen ihrer Gewogenheit. Die theologische Abwer-tung des Lachens in den geistlichen B�speln berührt die positive Besetzung vonmhd. lachen in der »Frauenehre« nicht, auch kommt der Zusammenhang vonLachen und Komik nicht in den Blick. Die Darstellung und Bewertung desLachens erweist sich als in hohem Maß gattungsabhängig. Dieser Befund könnteauch durch die einschlägigen Stellen in Strickers »Karl«, der Bearbeitung des»Rolandslieds«, oder in seinem Artusroman »Daniel von dem blühenden Tal«erhärtet werden.81
II.3 Mären aus dem Themenkreis ›erotische Naivität‹
Einige prominente Stellen, in denen Figuren über Komisches lachen, finden sichin einer Gruppe von Schwankerzählungen, die erotische Naivität zum Themahaben und die, da sie direkt oder indirekt auf altfranzösische Vorlagen oderVorbilder zurückgehen, von Grubmüller als »deutsche Fabliaux« bzw. Mären des»Fabliaux-Typ[s]« bezeichnet werden.82 In dieser ab etwa der Mitte des 13. biszum frühen 14. Jahrhundert in Deutschland neu entstehenden Untergattungdominiert die »Lust am Witz«.83 Es ist daher wohl nicht zufällig, wenn gerade indiesen Kurzerzählungen, die direkt auf die Fabliaux zurückgehen, auch dasLachen handlungsintern privilegiert wird. Da die entsprechenden Stellen in derForschung bereits vorgestellt und besprochen sind, kann ich mich kurz fassen.Sie sollen hier aber nicht übergangen werden, weil sie die wohl spektakulärstenLachszenen der mittelhochdeutschen Literatur enthalten.
Im »Häslein«, einer anonymen, unikal überlieferten Erzählung des späten 13.Jahrhunderts, trifft ein Ritter auf der Jagd eine junge Frau, die gern einen Hasen,den der Ritter gefangen hat, besäße. Er bietet ihn ihr im Tausch gegen ihreminne84 an, sie stimmt zu, denn sie weiß nicht, was dies ist, doch er solle ruhig
81 Kipf [Anm. 74], S. 131 – 136; zum Lachen im »Rolandslied« auch Coxon [Anm. 32], S. 198 –203.
82 Grubmüller [Anm. 29], S. 127, 132, 141.83 Ebd., S. 127.84 Novellistik [Anm. 44], S. 590 – 617, hier V. 84. Nach Abschluss des Manuskripts erschien:
Dimpel, Friedrich Michael: Das Häslein ist kein Sperber. Multiperspektivisches Erzählen imMäre. In: ZfdPh 132 (2013), S. 29 – 47.
Klaus Kipf252
bei ihr suchen. Nachdem der Ritter die Minne gefunden hat – die junge Frau hatdie Suche sehr genossen – und aufbrechen will, versucht sie ihn aufzuhalten, daer ja noch gar nichts bekommen habe. Daraufhin reitet der Ritter lachend fort:
›herre, war ist iu s� g�ch?wes nemet ir niht die minne gar?ich wirde, weiz got, wol gewar,daz ir si gar niht h�nt genomen.wellent ir niht herwider komen,s� ist mir iuwer schade leit.‹der ritter lachende dann�n reit (V. 180 – 186).
Zwar ist das Lachen des Ritters nicht syntaktisch als Lachen über den Versuchder jungen Frau ihn aufzuhalten markiert, doch ist klar, dass der Ritter darüberlacht, dass die Frau, mit der er gerade Minnefreuden genossen hat, glaubt, dass erdie verlangte Minne noch nicht erhalten habe und das schlechte Tauschgeschäft,das er in ihren Augen gemacht hat, gar noch bedauert. Komik entsteht hier ausdem erzählpragmatischen Kontrast zwischen dem Bedauern der Frau und derdetaillierten Schilderung der Minnevereinigung (V. 154 – 175) wenige Versezuvor.
Ein zweites Mal lacht der Ritter am Ende der Erzählung. Zuvor hat die jungeFrau ihrer Mutter vom Tauschgeschäft mit dem Häslein erzählt, ist dafür ver-prügelt worden und hat bei einem zweiten Treffen mit dem Ritter die Minne aufdieselbe Weise zurückbekommen, wie sie sie zuvor weggegeben hatte, darf denHasen aber obendrein behalten. Nach einigem Widerstreben hat auch die Mutterakzeptiert, dass das verführte Mädchen nun wieder Jungfrau ist. Ein Jahr daraufhält der Ritter Hochzeit mit einer jungen Adligen und lädt hierzu auch dasMädchen mit dem Häslein ein. Als diese nun mit kintl�chen siten (V. 390) und �narge liste (V. 393) auf dem Fest erscheint, verliert der Ritter die Contenance undbricht in lautes Lachen aus:
der wirt, der d� wol wiste,wie der hase wart gekouft,und wie diu tohter wart zerrouft,und wie der wehselkouf geschach,der lachete und tet einen kachund began s� sÞre lachenvon den selben sachenund mohte sich des niht enthaben,daz man in ieze wolte laben,und wider k�me kam ze sich (V. 394 – 403).
Für den Ritter ist das Erscheinen des von ihm verführten Mädchens mit demHasen als Symbol des Geschehens ein zu komischer Kontrast zum Geschehender eigenen Hochzeit, um ernst zu bleiben. Anlass des Lachens ist die Wahr-
Lachte das Mittelalter anders? 253
nehmung des Mädchens mit dem Hasen, die den Ritter an seine erotischenErlebnisse erinnert, während er mit einer standesgemäßeren Braut Hochzeithält. Auch Grubmüller sieht in dem »Kontrast zweier Welten, den die rührendeNaivität des Mädchens inmitten der Festgesellschaft mit einem Schlage offen-bart«,85 die Ursache für den Lachanfall des Ritters. Sein herausplatzendes Ge-lächter wird jedoch auch zum Movens der Handlung, denn viele Gäste und auchseine Braut wollen nun wissen, wes er gelachet hæte (V. 405) bzw. durch waz erhæte get�n j s� herzecl�chez lachen (V. 412 f.). Letztlich führt der lachendeAusbruch des Ritters sogar zur Rehabilitierung des um ihre Unschuld betro-genen Mädchens. Denn nachdem der Ritter seine Geschichte preisgegeben hat,offenbart die adlige Braut ihre Verachtung gegenüber der tœr�n (V. 439), die einesolche Lappalie ihrer Mutter gebeichtet habe, und verrät ihr eigenes Verhältnismit einem Kaplan, woraufhin sie nach Hause geschickt, das Mädchen mit demHäslein aber an ihrer Stelle vom Ritter geehelicht wird.
Auch im »Gänslein«, einer motivverwandten Novelle vom Beginn des 14.Jahrhunderts, in der ein Mönch, der innerhalb der Klostermauern aufgewachsenist und daher wenig von der Welt gesehen hat, den erotisch naiven Part spielt,wird über Komisches gelacht. Als der junge Mönch erstmals das Kloster verlässt,fragt er den ihn begleitenden Abt nach den Namen aller Tiere, die sie sehen.Besonders beeindruckt ist er von Frau und Tochter eines Pächters eines demKloster gehörenden Hofs, bei dem sie einkehren. Da der Abt ihm im Scherzgesagt hat, diese crÞ�t�re86 seien Gänse, wünscht er sich, solche ›Gänse‹ auch imKloster zu haben:
d� sprach der münich: ›crÞde mich,s� sint die gense siuberlich.wie kumt daz wir niht gense h�n?die möhten sich vil wol beg�nan unser kl�sterweide.‹des lachten sie d� beide,des wirtes tohter und s�n w�p (V. 85 – 91).
Erneut markiert ein des den syntaktischen Bezug des Lachens über die unfrei-willig komische Einschätzung des unwissenden Mönchs. Auch der Grund für dasVergnügen der Frauen wird vom Erzähler als ein Inkongruenzphänomen be-nannt:
si wundert sÞre daz s�n l�pwas s� rehte minneclichunt daz er niht verstüende sichwie ein w�p wer genant (V. 92 – 95).
85 Grubmüller [Anm. 40], S. 115.86 Novellistik [Anm. 44], S. 648 – 665, hier V. 82.
Klaus Kipf254
Die Naivität des Mönchs gibt im Verlauf der Erzählung noch einmal Anlass zumLachen: Nach der Rückkehr ins Kloster berichtet der Mönch seinen Brüderndavon, wie viele ihm unbekannte Dinge er auf seinem Ausflug gesehen habe.Auch darüber lachen seine Mitmönche herzlich: des gelachten si vil, j s�n redewas ir aller spil (V. 193 f.).
Auch die »Teufelsacht« gehört zu den Schwankmären aus dem Themenkreiserotischer Naivität. Hier erklärt ein Ehemann seiner unerfahrenen Frau in derHochzeitsnacht, dass der Liebesakt die Ächtung des Teufels, das heißt seineVertreibung, sei.87 Beim öffentlichen Festmahl am folgenden Tag schildert sie diein der Nacht erlebten Freuden genau:
vil rehte wart in d� gesaget,waz si des nahtes hete erliten.d� wart lachens niht vermiten,Igl�chez sach daz ander an.des schemte sich der junge man88.
Hier lachen die Mutter und die Hochzeitsgäste über die detaillierte Schilderungdes Liebesakts mithilfe der idiosynkratischen Terminologie, die die Frischver-mählte von ihrem Mann gelernt hat. Ein doppelter komischer Kontrast ergibtsich aus dem öffentlichen Reden über die sonst weitgehend tabuisierte Sexualitätund aus dem unüblichen dazu verwendeten Vokabular, das aus der Hochzeits-nacht einen lustvollen Exorzismus macht. Ein zweites Mal lacht allein die Mutterresigniert, aber auch erleichtert (V. 65) über die Hartnäckigkeit ihrer Tochter, dieauch ihrer Schwägerin detailliert berichtet, dass sie alles so getan habe, wie ihreMutter es verlangt hat.
Alle diese Beispiele zeigen, dass in den mittelhochdeutschen Schwankmärenhäufig über komische Situationen, unangemessen-naive Einlassungen oderHandlungen gelacht wird. Häufig wird das Lachen der Figuren syntaktischeindeutig auf die Elemente, über die gelacht wird, bezogen und mehrfach weisenErzählerkommentare Ansätze zur Komikanalyse auf, indem sie nachträglicherläutern, warum eine Figur gelacht hat. In allen Beispielen lässt sich die Komik,über die gelacht wird, mithilfe der Theorie semantischer Ambivalenz und se-mantischen Kontrastes erklären. Es liegt daher nahe, jetzt schon den Schluss zuziehen, dass die Komik mittelalterlicher Schwänke in ihrem grundlegendensemantisch-kognitiven Prozess nicht radikal von neuzeitlicher bzw. modernerKomik unterschieden ist.
87 Zur Metapher der Ächtung und ihrem rechtshistorischen Hintergrund Kipf [Anm. 2],S. 124, mit Anm. 105; Ziegeler, Hans-Joachim: [Art.] Des Teufels Ächtung. In: 2VL 9(1995), Sp. 719 – 721, bes. Sp. 720.
88 Gesammtabenteuer. Hundert altdeutsche Erzählungen. Bd. 2. Hg. v. Hagen, FriedrichHeinrich von der. Stuttgart, Tübingen 1850, S. 127 – 135, hier V. 236 – 240.
Lachte das Mittelalter anders? 255
Meine letzte Beispielgruppe, Poggio Bracciolinis Fazetien, führt ans Ende desMittelalters. Sammlungen von facetiae, witzigen Prosakurzerzählungen in la-teinischer Sprache, sammelt zum ersten Mal in Buchstärke der FlorentinerHumanist und Sekretär mehrerer Päpste, Poggio Bracciolini. Sein »Liber face-tiarum«, zwischen 1438 und 1452 in verschiedenen handschriftlichen Samm-lungsstufen angelegt, 1470 (oder 1471) erstmals gedruckt, eine Sammlung vonzuletzt 273 kurzen Prosaerzählungen, ist bereits zu Lebzeiten, wie der Autorselbst stolz berichtet, über ganz Europa verbreitet und regt Nachahmer zu ei-genen Sammlungen, zu Übersetzungen und zu anderen Formen des literari-schen Kulturtransfers an. Wie in einer Sammlung von Witzen, denn nichts an-deres bedeutet lateinisch facetiae, nicht anders zu erwarten, wird in PoggiosFazetien überaus häufig gelacht. Auch in ihnen kommt ein intradiegetischesLachen der Figuren, das in den mittelhochdeutschen Versschwänken häufig zubeobachten war, weitaus häufiger als ein extradiegetisches Lachen in der Rah-menhandlung vor.89
So lacht ein Mann (Nr. 62), der – dies ist ein bevorzugtes Thema der Fazetien,die viele Herrenwitze enthalten –90 genital bestens bestückt ist, am Ende einerErzählung über den sexuellen appetitu[s] seiner Frau.91 Über ein dictum desCarlo Razello de’ Auri, der eine abschätzige Redensart umdeutet, bemerkt derErzähler : ›Mit diesem Ausspruch brachte er sowohl die Umstehenden zum La-chen und parierte gleichzeitig die Stichelei des anderen mit einer eigenen‹.92
Ebenfalls lachen die Mönche über die Scherzfrage (Nr. 245) eines einfachenMannes, was Jesus als Erstes getan habe, nachdem er 30 Jahre alt geworden war(er ging ins 31. Lebensjahr hinein): »Alle mußten lachen und lobten den Witz desMannes«.93 Und über die »hübsche Antwort«94 einer Florentiner Dame, die voneinem schüchternen Verehrer angesprochenen wird, lachen auch seine Freunde
89 Bracciolini, Poggio: Facezie. Introduzione, traduzione e note di Pittaluga, Stefano. Milano1995. Ich zähle 21 Fälle von intradiegetischem Lachen: Nr. 13, 62, 70, 91, 95, 109, 113, 125,126, 135, 138, 140, 142, 143, 145, 159, 177, 245, 247, 266, 268.
90 Schnell, Rüdiger : Männer unter sich – Männer und Frauen im Gespräch. In: Konversati-onskultur in der Vormoderne. Geschlechter im geselligen Gespräch. Hg. v. dems. Köln u. a.2008, S. 387 – 440, hier S. 389 – 399 u. ö.
91 Bracciolini [Anm. 89], Nr. 62, S. 70: Risit vir, cum semiasellus in ea re videretur, bonumuxoris appetitum: hoc postea narrantem audivi in aliorum coetu.
92 Ebd., Nr. 91, S. 98: Hoc dicto, et circumstantibus risum movit, et dicacitatem hominis dica-citate compressit. Übersetzungen stammen, sofern nicht als Zitate gekennzeichnet, von mir.
93 Die Facezien des Florentiner Poggio. Nach der Übersetzung v. Floerke, Hanns. Leipzig1967, S. 286. Bracciolini [Anm. 89], Nr. 245, S. 262: Omnes, oborto risu, facetum hominisdictum commendarunt.
94 Ebd., S. 288.
Klaus Kipf256
(Nr. 247): ›Die Gefährten lachten sowohl über die Dummheit dieses Menschenals auch über die hübsche Antwort der Frau.‹95
Seltener sind solche Fälle, in denen die Erzählgemeinschaft der päpstlichenSekretäre im sogenannten bugiale (›Lügenstübchen‹), der Poggio im Nachwort,der Conclusio, ein verklärendes Denkmal setzt, nach dem Ende der eigentlichenErzählungen lacht und so zu einer echten »Lachgemeinschaft« im Sinne vonRöcke und Velten wird.96 So heißt es am Ende der 49. Fazetie, in der FrancescoFilelfo, Poggios Lieblingsfeind unter den humanistischen Zeitgenossen, seineruntreuen Ehefrau eine untaugliche Strafe androht: ›Wir mussten alle über dieseso vollkommene Art der Strafe lachen, mit der jener Dummkopf sich an seineruntreuen Frau zu rächen glaubte‹.97 Ähnlich endet die 246. Erzählung mit derBemerkung des Erzählers: ›Wir alle lachten über die gepfefferte Antwort diesesMannes‹.98
Mehrfach werden beide Formen des Lachens verbunden.99 Über einen Scherzvon Dienern, die einem geizigen Kurialen Urin statt Wein zu kosten geben(Nr. 70), lacht am Ende die ganze Tischgemeinschaft, die Lachgemeinschafterster Ordnung, und der am Streich Beteiligte, von dem Poggio die Geschichtegehört haben will, lacht, als er sie weitererzählt: ›So beendeten jene Leute dieMahlzeit unter Lachen. Und der Anstifter des Streichs hat sie mir später untergroßen Gelächter erzählt‹.100 Derart verwischen die Grenzen zwischen Lachen inder Binnen- und in der Rahmenerzählung, die meist nur in Andeutungen vor-handen ist, da fast immer eine Erzählgemeinschaft besteht, in der die Fazetievorgetragen wird und diese oft durchlässig ist zum bugiale, der Erzählgemein-schaft der Rahmenhandlung.
Strukturell entspricht das extradiegetische Lachen der Akteure der Rah-menerzählung den Bemerkungen des Erzählers, der häufiger die Qualität dererzählten Anekdoten bewertet, wie in der 47. Fazetie, in der die Antwort auf dieFrage, warum die Männer den Frauen nachlaufen, obwohl doch beide glei-chermaßen die Liebe genössen, als ›kluge und witzige Antwort‹101 gewürdigtwird. Stets jedoch lässt sich das Lachen im Text, sei es intra- oder extradiege-
95 Bracciolini [Anm. 86], Nr. 247, S. 264: Riserunt socii et hominis stupiditatem, et bellummulieris responsum.
96 Röcke [Anm. 34]; Velten [Anm. 34]. Ich zähle neun Fazetien, in denen die Erzählge-meinschaft lacht: Nr. 49, 70, 89, 113, 126, 145, 158, 246, 247.
97 Die Facezien des Florentiner Poggio [Anm. 93], S. 79. Bracciolini [Anm. 89], Nr. 49, S. 58:Risimus omnes genus supplicii adeo exquisitum, quo stultus ille ultorum se uxoris flagitiaputavit.
98 Bracciolini [Anm. 89], Nr. 246, S. 264: Risimus omnes salsum hominis dictum.99 Ich zähle vier Fälle: Nr. 70, 113, 145, 247.
100 Bracciolini [Anm. 89], Nr. 70, S. 78: Illi vero risu coenam finierunt. Hoc eius rei machinatormihi postmodum retulit multo cum risu.
101 Ebd., Nr. 47, S. 56: Scita facetaque responsio.
Lachte das Mittelalter anders? 257
tisch, als ein Lachen über etwas Komisches identifizieren. Die Fazetien zeichnensich nämlich dadurch aus, dass sie strukturell dem Muster der Textsorte Witzsehr nahe kommen: In den meisten Fällen sind es einfach Witze, die dem Schemavon occasio/provocatio/dictum bzw. Pointe entsprechen.
Mein Schlussbeispiel soll das an einer Anekdote, in der das Lachen eine Rollespielt, illustrieren (Nr. 95):
Der Bischof von Aleth erzählte vom Ausspruch eines römischen Bürgers. Als demKardinal von Neapel, einem dummen und ungelehrten Mann, auf dem Rückweg vomPapst ein Bürger begegnete, lachte der Kardinal, wie üblich, beständig vor sich hin. DerBürger fragte seinen Begleiter, worüber der Kardinal seiner Meinung nach lache. Alsdieser antwortete, er wisse es nicht, sagte er : »Sicher lacht er über die Dummheit desPapstes, der ihn so unverdient zum Kardinal gemacht hat«.102
Hier gründet die Komik im Kontrast zwischen dummem Kardinal und der In-terpretation, die ihn als klüger erscheinen lässt, als er ist, zugleich seineDummheit bloßstellt und auch noch den Papst kritisiert.
Ich möchte die Beispiele hier nicht fortsetzen. Man könnte in anderenFazetien- ebenso wie in den deutschsprachigen Schwanksammlungen des 16.Jahrhunderts, für die Dieter Kartschoke eine Tendenz »[v]om erzeugten zumerzählten Lachen«103 feststellt, eine Vielzahl von Belegen zusammentragen, andenen Akteure oder Erzähler bzw. ihr Publikum über komische Zusammen-hänge lachen. An allen Beispielen könnte man zeigen, dass auch in der lateini-schen und deutschen Schwankliteratur des 15.–17. Jahrhunderts über Hand-lungen und Äußerungen gelacht wird, deren Struktur mithilfe einer linguistischinformierten Komiktheorie erklärt werden kann.
102 Ebd., Nr. 95, S. 102: Alter, episcopus scilicet Electensis, Romani cuiuspiam dictum retulit:›Cum cardinali Neapolitano, homini stolido atque indocto, redeunti a Pontifice Romanuscivis obviasset, cardinalis vero, quia mos suus erat, continuo rideret, petivit a socio quam-nam ob causam cardinalem putaret ridere. Qui cum id se nescire respondisset, ›Atqui‹ inquit›stultitiam Pontificis ridet, qui se adeo immerito cardinalem fecit‹.
103 Kartschoke, Dieter : Vom erzeugten zum erzählten Lachen. Die Auflösung der Pointen-struktur in Jörg Wickrams »Rollwagenbüchlein«. In: Kleinere Erzählformen des 15. und 16.Jahrhunderts. Hg. v. Haug, Walter u. Wachinger, Burghart. Tübingen 1993 (Fortunavitrea 8), S. 71 – 105.
Klaus Kipf258
III. Inwiefern unterscheidet sich Komik in mittelalterlichenSchwankerzählungen von moderner Komik?
Lachte das Mittelalter anders? – In dieser hypertrophen Generalität ist die Fragenicht zu beantworten, jedenfalls nicht von einem Einzelnen.104 Zu vielfältig istbereits die historische Semantik von lachen, seinen Entsprechungen im Latei-nischen und den Volkssprachen des Mittelalters, um sie einfachhin bejahen oderverneinen zu können, und zu differenziert – die Bemerkungen über das Lachenin nicht-schwankhaften Texten haben dies angedeutet – dürfte das Ergebniseiner Untersuchung über die Funktionen von Lachen in verschiedenen Gat-tungen und Zeiträumen mittelalterlicher Literatur ausfallen. Hier ging es je-doch – wie der Untertitel einschränkend festhält – nur um textlich fixiertesLachen über komische Situationen, Handlungen oder Äußerungen in einigendeutschsprachigen und lateinischen Schwankerzählungen des 13.–15. Jahr-hunderts in Vers und Prosa.
An deren Beispiel allerdings hoffe ich gezeigt zu haben, dass literarische Textebzw. Textsegmente, die durch textuelle Kriterien als komisch gekennzeichnetsind, sich mithilfe einer semantisch fundierten Theorie der Komik erklärenlassen. Es konnte gezeigt werden, dass es zahlreiche Textstellen gibt, in denenFiguren der Diegese über komische Kontraste, semantische Inkongruenzen inForm von Missverständnissen, listigem Betrug, naivem Unwissen, gewollteroder unfreiwilliger Zweideutigkeit oder ähnlichen Phänomenen lachen. In ei-nigen (wenigen) Schwankmären wird das Lachen zudem als intendierte Reak-tion der Rezipienten paratextuell privilegiert. Dieser Befund scheint zu demSchluss zu berechtigen, dass die dergestalt ausgezeichneten Textelemente oderTexte auch auf zeitgenössische Rezepienten potentiell komisch, d. h. lachener-regend wirkten. Ein vollständiger Überblick über alle vergleichbaren Textstellender edierten mittel- und frühneuhocheutschen Schwankliteratur, der mithilfeder verfügbaren Hilfsmittel zumindest annähernd erreichbar sein dürfte,würde – so meine These – kein nennenswert abweichendes Ergebnis bringen.Und auch in Gattungen, in denen die Komik weniger dominant ist als inSchwankerzählungen, wird häufig über Phänomene gelacht, die sich mithilfe derInkongruenz-Theorie erklären lassen – so legt es die einschlägige Forschung, diebibliographisch noch nicht zusammengeführt ist,105 nahe. Würde der Blick überdie schwankhafte Novellistik systematisch auf andere Gattungen, in denenKomik eine Rolle spielt, wie den Minnesang, den Artusroman oder die Hel-
104 Vgl auch Huber [Anm. 31], S. 347: »Grundsätzlich aber ist das Thema ›Lachen im Mit-telalter‹ zu breit angesetzt«.
105 Tomasek [Anm. 12], S. 94, nennt »eine alle mediävistischen Teildisziplinen abdeckendeSpezialbibliographie ein dringendes Desiderat«.
Lachte das Mittelalter anders? 259
denepik ausgeweitet, dürften andere Funktionen des Lachens und der Komikzutage treten. Doch ist zu bezweifeln, dass grundlegend andersartige Strukturendes Komischen freigelegt würden. Eher ist zu erwarten, dass das anhand vonSchwankerzählungen gewonnene Bild auch in anderen Gattungen Bestand hat.Gelacht wird über Kontraste, Inkongruenzen, Ambivalenzen, worin immer diesekonkret bestehen mögen. Bart Besamuscas Studie, die über 50 Stellen aus-wertet, in denen in dem in der Mitte des 15. Jahrhunderts im Umfeld des Hei-delberger Hofs aus dem Niederländischen übersetzten »Malagis« über Komi-sches gelacht wird, bestätigt diese Annahme, indem sie zu dem Ergebnis kommt,»dat de notie incongruentie […] voor het humoroderzoek in middeleeuwseteksten bruikbar is«, und daraus den Schluss zieht, »dat de kloof tussen hetmiddeleeuwse en het hedendaagse gevoel voor humor toch minder groot is danwel eens gevreesd wordt«.106
Wenige Beispiele sollen dies weiter plausibilisieren. Wenn der Erzähler inWolframs von Eschenbach »Willehalm« en passant bemerkt, dass eine Ente, dieden Bodensee austrünke, Schmerz empfände,107 wirkt dies grotesk aufgrund dessemantischen Kontrastes zwischen dem Fassungsvermögen eines Entenmagensund der Größe des Bodensees – unabhängig von der Frage nach der Funktiondes Witzes im narrativen Kontext.108 Nicht selten sind komische Szenen auchdurch ein Lachen handelnder Personen markiert. So löst am Ende des »Parzival«Feirefiz’ Ansinnen, den touf mit str�te109 zu erringen, Heiterkeit beim neuen undbeim alten Gralkönig aus: der wirt des lachte sÞre j und Anfortas noch mÞre(815,1 f.). Zwar »läutet« dieses »Lachen des Erlösers und seines erlösten Vor-gängers eine Heilszeit ein« und »bindet so magisch-mythische und eschatolo-gische Zeitstrukturen der Dichtung in einer zeichenhaften Geste zusammen«,110
doch ist diese für die mythische Struktur des Romans und deren heilsge-schichtlichen Hintergrund zeichenhafte Geste auch eine Reaktion der Gralkö-nige auf die naive Absicht des heidnischen Ritters, die Taufe und mit ihr dieHand der erwählten Frau im Kampf zu erobern.
Ähnlich lachen Gunther und Hagen in der achten Aventiure des Nibelun-genlieds über Brünhilt, die ihren Kämmerer die Befüllung von Schatztruhen fürdie Reise nach Burgund überwachen lässt, weil sie Dankwart, der zuvor allzu
106 Besamusca [Anm. 2], S. 75.107 Wolfram von Eschenbach: Willehalm. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St.
Gallen. Hg. v. Heinzle, Joachim. Tübingen 1994 (ATB 108), 377,4 – 6: n� seht, ob vunde einantvogel j ze trinken in dem BodemsÞ, j trünk er’n gar, daz taet im wÞ.
108 Dazu zuletzt Kartschoke, Dieter : Die Ente auf dem Bodensee. Zu Wolframs »Willehalm«377,4 ff. In: ZfdPh 121 (2002), S. 424 – 432 (mit der älteren Literatur).
109 Wolfram von Eschenbach: Parzival. Bd. 2. Nach der Ausgabe Karl Lachmanns revidiert u.kommentiert v. Nellmann, Eberhard, übertragen von Kühn, Dieter. Frankfurt a. M. 1994(Bibliothek deutscher Klassiker 110), 814,25.
110 Huber [Anm. 31], S. 356.
Klaus Kipf260
freigebig mit ihrem Gut umgegangen ist, nicht mehr traut: Gunther unt Hagenedar umb lachen began111. Im »Jüngeren Sigenot« lachen die anwesenden Heldenüber die witzig-frechen Bemerkungen Wolfharts, mit denen dieser die HerzoginUote über den Abschied ihres Gatten Hiltebrant hinwegtröstet, der zur BefreiungDietrichs von Bern aus der Hand des Riesen Sigenot ausreiten will. Zunächstlachen allein die anwesenden Kämpfer über seinen Rat an die Herzogin, sicheinen jungen man zu nehmen, der sie baz getrœsten könne,112 falls der alteHiltebrant nicht zurückkehre:
Beide riter und knehte,Die lacheten d� alle sant,Wie wol siu leidic w�ren (129,6 – 8).
Danach wird ein weiterer Witz Wolfharts über den Abschiedskuss des Her-zogspaares mit allgemeinem Lachen (einschließlich der Herzogin) quittiert: D�erlachten siu alle sant (133,1). Zweimal lacht hier eine Gruppe von Zuhörern –als Reaktion jeweils gesichert durch das Adverb d� – über einen Witz, der imsituativen Kontrast zur Trauer und Furcht beim Heldenabschied steht.
Überaus häufig wird schließlich in Ulrichs von Liechtenstein »Frauendienst«gelacht,113 nach meiner Zählung 35-mal, davon allein 13-mal über witzige Reden,Scherze oder andere komische Elemente.114 Bisweilen lacht man über denProtagonisten Ulrich als Opfer eines Scherzes seiner ersten vrowe ;115 besondershäufig aber wird über ihn während seiner Fahrt in Verkleidung als Venus gelacht.Dreimal lachen (und lächeln) Beobachter über seinen allzu blide[n] Gang zum
111 Das Nibelungenlied. Nach der Ausg. v. Bartsch, Karl hg. v. Boor, Helmut de. 22., revidierteu. v. Wisniewski, Roswitha ergänzte Aufl. Mannheim 1988 (Deutsche Klassiker des Mit-telalters), 521,4.
112 Der jüngere Sigenot. Nach sämtlichen Handschriften und Drucken hg. v. Schoener, A.Clemens. Heidelberg 1928 (Germanische Bibliothek III 6), 127,4 f.
113 Grundlegend Müller [Anm. 33]; ferner Spechtler, Franz Viktor : Ein ›lächerlicherMinneritter‹? Zur Funktion der Komik bei Ulrich von Liechtenstein. Wege der Forschung.In: Sprachspiel und Lachkultur. Beiträge zur Literatur- und Sprachgeschichte. Zum60. Geburtstag von Rolf Bräuer. Hg. v. Bader, Angela. Stuttgart 1994 (StAG 300), S. 144 –154.
114 Vgl. bereits die Zusammenstellung von Reiffenstein, Ingo: Rollenspiel und Rollenent-larvung im »Frauendienst« Ulrichs von Liechtenstein. In: Festschrift für Adalbert Schmidtzum 70. Geburtstag. Hg. v. Weiss, Gerlinde. Stuttgart 1976 (StAG 4), S. 107 – 120, hierS. 108 – 111. Die übrigen, hier nicht zu diskutierenden Fälle sind zumeist Beispiele deslachens der Minneherrin als Zeichen ihrer Gunst gegenüber Ulrich. Reflektiert wird dieses(an)lachen, das hier auch ›(an)lächeln‹ heißen kann, als Intensivierung des Grußes dervrouwe im »Frauenbuch« (Hg. v. Spechtler, Franz Viktor. Göppingen 21993 [GAG 520]),600,1 – 5.
115 Ulrich von Liechtenstein: Frauendienst. Hg. v. Spechtler, Franz Viktor. Göppingen 1987(GAG 485), 134,1: Des schimpfes wart gelachet da.
Lachte das Mittelalter anders? 261
opfer während der Messe (536,1);116 eine Gräfin lacht, als sie ihn vor dem Frie-denskuss (pece) als Mann erkennt (538,1). Noch einmal lachen Umstehende überUlrichs Gang nach blider vrouwen sit (945,7) und seine Verkleidung.117
Schließlich lacht er selbst nach der Auflösung des Cross-dressing: Des lacht ichund ma[n]ic ritter guot, j als man (nach) spaeher rede tuot (989,1 f.).118 Auch imzweiten Teil wird wiederholt über witzige reden gelacht, so über das Dienst-versprechen des Herzogs von Österreich, das ein Bote dem Artus überbringt,hinter dem sich sein Vasall Ulrich verbirgt.119 Komisch wirkt zumeist das»Auseinanderfallen von gespielter Rolle und der ›normalen‹ gewohntenRolle«.120 Ulrichs fiktive Autobiographie zeigt, dass intradiegetisches Lachenvon Figuren über komische Kontraste auch außerhalb des Märes massiert auf-treten kann. Alle hier genannten Beispiele machen deutlich, wie alltäglich dasLachen über komische Äußerungen und Situationen auch in nicht dominantkomischen Gattungen ist.
Benannt werden sollen abschließend aber auch Grenzen der hier vorgestelltenUntersuchungsmethode und ihrer Ergebnisse. Wenn für die Grundstrukturkomischer Prozesse transhistorische kognitive Kontinuität vorausgesetzt wird,so bedeutet dies nicht, dass anzunehmen ist, dass jede Komikverwendung desMittelalters heute unmittelbar komisch wirken muss. Was im konkreten Ein-zelfall komisch wirkt, was zum Lachanlass wird, unterliegt historischem Wandel.Doch dieser historische Wandel lässt sich mit Wörterbüchern, Grammatiken,Sachlexika, Stellenkommentaren und anderen Hilfsmitteln rekonstruieren. Sosetzt etwa die sexuelle Metaphorik der »Teufelsacht« neben dem biologischenErfahrungswissen theologisches und rechtsgeschichtliches Spezialwissen vor-aus, über das Autor und primäre Rezipienten verfügt haben dürften, währenddie historische Philologie es mithilfe von Nachschlagewerken und Handbüchernrekonstruieren muss. Poggios Fazetien setzen eine Vielzahl von Informationenüber die römische Kurie des Quattrocento, ihre Akteure, Intrigen und ihr dif-ferenziertes Expertentum voraus. Im »Häslein« erfährt man einiges über un-terschiedliche Lizenzen sexueller Freizügigkeit für Männer und Frauen, im»Gänslein« über das Klosterleben und seine ökonomische Fundierung, in des
116 536,5 – 8: min opfer ich so blide an vie, j do ich her von dem opfer gie, j daz man daz pece sadar truoc j gelachet wart des da genuoc ; 600,5 – 8: ich het an minen lip geleit j vil wun-neclichen vrowen chleit, j blide hin ze kirchen und von dan j gie ich, des lachet do manic man;945,3 f. : daz ich den ganc so blide an vie j des wart gelachet dort und hie.
117 933,4 – 8: des smielten al die vrowen gar j daz ich ez also blide an vie j und ouch in wibeschleidern gie j und also schoene zöpfe truoc – j des wart gelachet da genuoc.
118 Die Venusfahrt gibt Ulrich und seinen männlichen Genossen auch sonst Anlass für manicschimpfwort (989,6) in feucht-fröhlicher Runde (vgl. 989,8).
119 1461,1: Der rede wart vil gelachet da ; vgl. (auch zum Grund des Lachens) Müller [Anm.33], S. 38 f.
120 Reiffenstein [Anm. 114], S. 109.
Klaus Kipf262
Strickers »Eingemauerter Frau« über mittelalterliches Eherecht, die Rolle derVerwandtschaft beider Ehepartner für die Ehe und religiöse Lebensformen. Aberdieses zu rekonstruierende Spezialwissen betrifft in allen genannten Fällen diekulturellen Rahmenbedingungen von Komik, nicht deren semantische oderkognitive Struktur. Meine These ist, dass diese Beobachtung universalisierbarist. Die konkreten, materiellen Lachanlässe sind zwar nicht immer und überall,in Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart, dieselben, doch die Semantik der Komikund deren zugrunde liegende kognitive Struktur dürfte – zumindest in derKultur des Abendlands – weitgehend konstant sein. Die historisch differieren-den Rahmenbedingungen aber lassen sich mithilfe des philologischen Wissenslangjähriger Forschungsarbeit soweit rekonstruieren, wie dies unter der Maß-gabe der hermeneutischen Grenzen jeder historisch-philologischen Arbeit ebenmöglich ist.
Verzichtet werden kann aber für die mittelalterliche Komik auf den Begriff derAlterität, wenn diese Vokabel benutzt wird, um das, was uns hier und heutefremd ist, zu hypostasieren und essentialisieren und es damit der historisch-philologischen Rekonstruktion zu entziehen in einer Kategorie, die prinzipielleUnhintergehbarkeit beansprucht und die nicht auf dem Weg bewährter philo-logischer Methodik approximativ zu minimieren wäre. Die Vorstellung abso-luter Alterität mittelalterlicher Texte ist auf dem Teilgebiet der Komik obsolet.Davon unberührt bleibt die These relativer Alterität mittelalterlicher Komik,d. h. die Tatsache, dass sich die Lachanlässe – das, worüber gelacht wurde –aufgrund sich wandelnder kultureller Rahmenbedingungen verändert haben.
Mit der Verankerung im historischen Material steigt auch die Attraktivitätdieser Theorie für die Identifizierung komischer Strukturen in nicht als komischmarkierten Texten oder Textsegmenten. Hier bieten sich für eine semantisch undkognitiv fundierte Theorie der Komik Anschlussmöglichkeiten an eine allge-meine Poetik der Kognition, die bislang nur skizzenhaft und in ersten Umrissenexistiert.121 Dieser Beitrag ist auch ein Versuch, auf diese Anschlussmöglich-keiten der germanistischen Mediävistik hinzuweisen.
121 Vgl. für die literaturwissenschaftliche Komikforschung Müller, Ralph: Theorie derPointe. Paderborn 2003 (Explicatio), bes. S. 93 – 99 (»kognitive Sprachwissenschaft undPointe«). Die ausgedehnte und in der literaturwissenschaftlichen Mediävistik noch kaumrezipierte Diskussion um eine kognitive Poetik wird gegenwärtig vor allem in bestimmtenBereichen der Poetik (bes. Metaphern-, Fiktionalitätstheorie) vorangetrieben und hat sich,wenn ich recht sehe, der Komiktheorie noch nicht angenommen. Vgl. einführend Stock-
well, Peter : Cognitive Poetics. An Introduction. London u. a. 2002; Tsur, Reuven: Towarda Theory of Cognitive Poetics. 2. , expanded and updated ed. Brighton u. a. 2008. NachAbschluss des Manuskripts erschien: Mohr, Robert: Cognitive Poetics und mittelalterlicheLiteratur. Chancen einer Untersuchung mittelalterlicher Leseprozesse und schemabezo-gener Identitätsbildung. In: ZfdA 141 (2012), S. 419 – 433.
Lachte das Mittelalter anders? 263