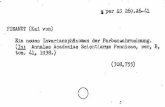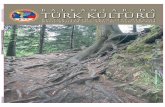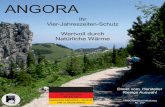J. Schneeweiß, Neues vom Höhbeck-Kastell, NNU 81, 2012, 81-110
Transcript of J. Schneeweiß, Neues vom Höhbeck-Kastell, NNU 81, 2012, 81-110
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte
Herausgegeben von derArchäologischen Kommission für Niedersachsen e.V.
und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege
durchHenning Haßmann
Band 812012
Schriftleitung:Katharina Malek
KommissionsverlagKonrad Theiss Verlag
Stuttgart
Die Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte erscheinen von Band 38 (1969) an als Organ der Archäologischen Kommission für Niedersachsen e.V.
Seit 1995 werden sie gemeinsam mit demNiedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (ehem. Institut für Denkmalpflege) herausgegeben.
Sie wurden 1927 von K.H. Jacob-Friesen im Rahmen des„Niedersächsischen Jahrbuches für Landesgeschichte“
begründet.
Gedruckt mit Mitteln des Landes Niedersachsen und der Stadt Syke (Ldkr. Diepholz).
Redaktionsausschuss:Dr. Hartmut Thieme (Paläolithikum, Mesolithikum), Dr. Hildegard Nelson (Neolithikum),
Prof. Dr. Karl-Heinz Willroth (Bronzezeit), Prof. Dr. Rosemarie Müller (Eisenzeit), Dr. W. Haio Zimmermann (Römische Kaiserzeit, Völkerwanderungszeit), Dr. Lothar Klappauf (Mittelalter), Dr. Hans-Wilhelm Heine †
(Besprechungen und Berichte).
Redaktion dieses Bandes:Katharina Malek M.A.
Englische Übersetzungen: Henry Thoms, Celle (H.T.); Graphik: Vijay Diaz.
Abbildungsnachweise bei den jeweiligen Beiträgen.Für die urheberrechtlichen Angaben sind die jeweiligen Autoren verantwortlich.
Titelbild: Ausschnitt Königspfalz Werla, Kernburg, Ldkr. Wolfenbüttel und Goldartefakte aus dem Hortfund von Gessel, Ldkr. Diepholz.
Fotos: A. Grüttemann (Werla) und V. Minkus (Goldartefakte)Gestaltung: V. Diaz
Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte / hrsg. von der Archäologischen Kommission für Niedersachsen e.V. und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege durch Henning Haßmann.Stuttgart: TheissErscheint jährlich. – Früher im Verl. Lax, Hildesheim. – Aufnahme nach 60. 1991 (1992) – Verl.-Wechsel.
Umschlagentwurf: Matthias Hütter, Schwäbisch Gmünd© Archäologische Kommission für Niedersachsen e.V., c/o Ostfriesische Landschaft, Hafenstr. 11, D-26603 Aurich
und Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Scharnhorststr. 1, D-30175 HannoverAlle Rechte vorbehalten
Gesamtherstellung: Druckhaus Breyer GmbH, DiepholzPrinted in Germany
ISBN 978-3-8062-2789-5ISSN 0342-1406
XXVII
Inhaltsverzeichnis
In memoriam HANS-WILHELM HEINE. Von Rol f Bä ren f änger und Hen n ing Haßman n . . . . . . . . . . . . . . . . VIISchriftenverzeichnis Hans-Wilhelm Heine †. Bearbeitet von Katha r ina Malek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Aufsätze und Fundberichte
The Anglo-Frisian Sceatta Hoard of “Kloster Barthe”, Gem. Hesel, Ldkr. Leer, East Frisia from 1838: Catalogue and Comment.
By Wybrand O p den Velde and Rol f Bä ren f änger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Neues vom Höhbeck-Kastell. Von Jens Sch neeweiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Die Ausgrabungen auf der Königspfalz Werla 2007 bis 2011 – Vorbericht. Von Mark us C. Bla ich und Michael Geschwinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Der bronzezeitliche Goldhort von Gessel, Stadt Syke, Ldkr. Diepholz. Beschreibung der einzelnen Goldobjekte, Beob- achtungen zur Herstellungsweise und erste archäologische Einordnung. Von Hen n ing Haßman n , Tina Heintges , A nd reas Niemuth , Ber nd Rasin k und Fr ied r ich- Wi lhelm Wulf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Zweiter Vorbericht über die archäologischen Ausgrabungen an der Kirchenburg zu Ankum, Ldkr. Osnabrück, 2010. Von Dan iel Lau . Mit Beiträgen von Nicole G r u ner t , I ngo Jüdes , Ch r is t i na Sch midt und Jens Schuber t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
brunesguik – Brunswik. Archäologische Untersuchungen zur Frühphase der Stadt Braunschweig. Von Di rk R ieger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Karolingische Eisengewinnung am Iberg bei Bad Grund, Ldkr. Osterode a. Harz. Von Fr ied r ich-Alber t Lin ke, Cor nel ia K r ie te und Lotha r K lappauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Archäobotanische Untersuchungen an Verhüttungsplätzen aus dem Mittelharz (10.–13. Jh.) mit Schwerpunkt auf Holz-kohlenanalysen: Lässt sich die Holznutzung zwischen verschiedenen Verhüttungsplätzen (Kupfer- und Silberschmelz-plätzen) und dem metallurgischen Montangewerbe unterscheiden? Von Han nes K napp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Waren die Germanen auch mit Holzschwertern in der „Varusschlacht“ bewaffnet? Von Erha rd Cosack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Die Wendekopf-Kachel Narr/Kardinal aus Braunschweig (Grabung Turnierstraße 1) und ihr zeitgeschichtlich-theologischer Hintergrund. Von Ral f Busch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Schreibgriffel oder Haarnadel? Ein Beitrag zur Kontroverse um die Stili des 12. und 13. Jahrhunderts mit Aufhängeöse. Von Tors ten Lüdecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Anzeigen und Besprechungen
Angelika ABEGG, Dörte WALTER, Susanne BIEGERT (Hrsg.), Die Germanen und der Limes. Ausgrabungen im Vorfeld des Wetteraulimes im Raum Wetzlar-Gießen. Römisch-Germanische Forschungen 67. Mainz 2011. (W. Ebel-Zepezauer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Archäologie in Westfalen – Lippe 2009. Herausgegeben von LWL – Archäologie für Westfalen und der Altertums-kommission für Westfalen. Langenweißbach 2010.
XXVIII
Archäologie in Westfalen – Lippe 2010. Herausgegeben von LWL – Archäologie für Westfalen und der Altertums-kommission für Westfalen. Langenweißbach 2011. (B. Rasin k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Wolfgang HARDTWIG, Alexander SCHUG (Hrsg.), History Sells!. Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt. Stuttgart 2009. (H.-W. Heine †) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Manfred GLÄSER (Hrsg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen. Lübeck 2010. (U. Ba r tel t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Ronald HEYNOWSKI, Fibeln – Erkennen – Bestimmen – Beschreiben. Bestimmungsbuch Archäologie 1. Berlin 2012. (A. Wendowsk i-Schü neman n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Deborah Barbara KARL-BRANDT, Frauenschmuck der späten Bronzezeit und der vorrömischen Eisenzeit in Horten des südlichen Nordeuropas. Antiquitates 53. Hamburg 2011. (M. Pah low). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Marschenratskolloquium 2009. Flüsse als Kommunikations- und Handelswege. 5.–7. November 2009, Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 34. Rahden/Westf. 2011. (S. Möl lenberg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Annette SIEGMÜLLER, Die Ausgrabungen auf der frühmittelalterlichen Wurt Hessens in Wilhelmshaven. Siedlungs-und Wirtschaftsweise in der Marsch. Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im südlichen Nordseegebiet 1. Rahden/Westf. 2010. (S. Kön ig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Katrin STRUCKMEYER, Die Knochen- und Geweihgeräte der Feddersen Wierde. Gebrauchsspuren an Geräten von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter und ethnoarchäologische Vergleiche. Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im südlichen Nordseegebiet 2. Feddersen Wierde 7 (= Die Ergebnisse der Ausgrabung der vor-geschichtlichen Wurt Feddersen Wierde bei Bremerhaven in den Jahren 1955 bis 1963). Rahden/Westf. 2011. (F. K l imscha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Olaf WAGENER (Hrsg.), „vmringt mit starcken turnen, murn“. Ortsbefestigungen im Mittelalter. Beihefte zur Mediae-vistik 5. Herausgegeben von Peter Dinzelbacher. Frankfurt am Main 2010. (H.-W. Heine †) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Berichte und Nachrichten
Archäologische Kommission für Niedersachsen e.V. Jahresbericht 2011. Von Rol f Bä ren f änger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
81
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte Band Seite Stuttgart 2012
NNU 81 81 – 110 Konrad Theiss Verlag
Neues vom Höhbeck-Kastell
Von
Jens Schneeweiß
mit 19 Abbildungen und 1 Tabelle
Zusammenfassung:Aktuelle Ausgrabungen in der Vietzer Schanze auf dem Höhbeck haben ihre Datierung in die Zeit Karls des Großen und der Er-wähnung des castellum hohbuoki zweifelsfrei belegen können. Dies ist Anlass für eine grundlegende Revision und Auswertung der umfangreichen Altgrabungen, die zu einem Rekonstruktionsvorschlag dieser fränkischen Befestigung im Sachsenland führt. Abschließend erfolgt vor dem Hintergrund der neuen Forschungsergebnisse eine Neubewertung der historischen Vorgänge am Höhbeck im frühen 9. Jahrhundert.
Schlüsselwörter: Frühmittelalter, Elbe, Befestigung, Höhbeck, Karl der Große, Sachsen, Slawen
Title: New investigations at the „castellum Hohbuoki“ of Charlemagne
Abstract: Recent archaeological excavations at the so-called Vietzer Schanze on top of the Höhbeck revealed clear evidence for its dating to 810 AD, the year of the first mention of the castellum hohbuoki in the Frankish annals. This result initiated a critical re-examination of the extensive previous research and led to a new reconstruction of this Frankish fortification in Saxon territory. In the light of this, the paper then puts forward a re-evaluation of the historical events at the Höhbeck in the early 9th century.
Keywords: Early Middle Ages, River Elbe, fortification, Höhbeck, Charlemagne, Saxons, Slavs
Einleitung
Der hier gewählte Titel nimmt Bezug auf einen Aufsatz von Ernst Sprockhoff (1955): „Neues vom Höhbeck“, der durchaus programmatisch verstanden werden kann. Carl Schuchhardt hatte seine Ausgrabungen am Höhbeck nie publiziert. Dennoch war er unerschütter-lich davon überzeugt gewesen, dass die Vietzer Schan-ze hoch über der Elbe auf dem Höhbeck das Kastell Karls des Großen gewesen sein muss, das als castellum hohbuoki in den Fränkischen Annalen erwähnt worden war. Was er bei seinen Ausgrabungen fand, war je-doch nicht geeignet, diese Überzeugung zu belegen, es reichte nicht aus. Die gesamte Dokumentation und die Funde waren inzwischen durch den Krieg vernichtet. Sprockhoff nahm sich nach dem Krieg auf Anregung des Oberkreisdirektors des Landkreises Lüchow-Dan-nenberg Oskar Lübbert (ElbE-JEEtzEl-zEitung vom 14.10.1954, 3. Sprockhoff 1955, 51 Anm. 5) erneut dieser Sache an, ebenso überzeugt von der Richtigkeit der These vom Höhbeck-Kastell wie Schuchhardt und entschlossen, durch neue Ausgrabungen Beweise zu finden. Unterstützt wurde er von Gerhard Körner, dem damaligen Direktor des Museums für das Fürstentum
Lüneburg. Zunächst versuchte er Schuchhardts Gra-bungen zu rekonstruieren, bevor er ganz neue Flächen öffnete. Es gelang nicht immer die alten Schnitte zu finden. Durchaus optimistisch sind seine ersten Be-richte zu lesen, die erstmalig die Befunde der Kons-truktionsweise des Kastells veröffentlichten (Sprock-hoff 1955; 1958 a). Ein guter Start, doch dann blieben die gesuchten Belege abermals aus. Auch Sprockhoff fand nicht, was er suchte, und sah von weiteren Pu-blikationen ab. Über zehn Jahre, bis 1965, dauerten die Ausgrabungen an, doch es wurde nach 1958 nie wieder etwas ‚Neues vom Höhbeck’ publiziert. Es schien, als wären die Möglichkeiten erschöpft. Doch die Zeit blieb nicht stehen. Das Methodenspektrum der Archäologie wuchs beständig und nun war die nächs-te Forschergeneration am Zug. Im Herbst 2008, 111 Jahre nach Schuchhardts erstem Spatenstich auf dem Höhbeck-Kastell, wurde der nächste Versuch gestartet, einen archäologischen Beleg für seine eindeutige Iden-tifizierung zu finden. Dieses Vorhaben, das nur durch die finanzielle Unterstützung der Samtgemeinde Gar-tow und der Gemeinde Höhbeck ermöglicht wurde, war endlich von Erfolg gekrönt. Zwar wurde immer noch kein sicher in die letzten Lebensjahre Karls des
82
Großen zu datierender Fund gemacht, aber es gelang die unzweifelhafte Datierung der Vietzer Schanze in das frühe Mittelalter, und zwar in das Jahr 810, das Jahr der Ersterwähnung des castellum hohbuoki. Da-mit darf die erste der beiden Grundfragen, die Sprock-hoff (1955, 1) stellte, nämlich „ob hier Karls Kastell Hohbuoki vorliegt“, als positiv beantwortet gelten.
Naturräumlich-geographische Situation
Inmitten des 8–10 km breiten Elbtales erhebt sich ge-genüber vom brandenburgischen Städtchen Lenzen der Höhbeck, ein Stauchmoränenrest der vorletzten Eiszeit, der den vorbei fließenden Wassermassen im Urstromtal standgehalten hat. Wie eine Insel überragt er die umliegende flache Landschaft des Elbetals um bis zu 60 m. Die nördliche und östliche, elbaufwärts gewandte Seite fällt dabei schroff ab, hier zeigen sich ein Prallhang des Flusses und ein regelrechtes Steil-ufer. Nähert man sich dem etwa 2 x 4 km großen Höh-beck dagegen von der anderen, südwestlichen Seite, so steigt er sanft an. Heute sind seine Hänge zum größ-ten Teil dicht bewaldet, doch einstmals war er über-wiegend kahl. Noch vor weit weniger als einhundert Jahren konnte man sich auf dem Höhbeck auf die Wie-se legen und den Blick über die weite Elblandschaft schweifen lassen. Das ist heute nicht mehr möglich. Wie die Vegetation vor 1200 Jahren genau aussah, lässt sich im Detail nicht mit Sicherheit sagen. Kiefern, die gerne sandige, trockene Standorte bewohnen und heu-te einen Großteil des Waldes ausmachen, hat es damals hier nicht gegeben. Eichen kamen vor und wahrschein-lich auch Buchen. Es stimmt allerdings nachdenklich, dass keine einzige der zahlreich erhaltenen Holzkoh-len aus dem Kastell von einer Buche stammte, denn der Name ‚Hohbuoki’ wird gemeinhin mit „hochge-legener Buchenwald“ übersetzt (DEbuS 1993, 54). In diesem Sinne hatte auch SchuchharDt (1924, 58) den Namen interpretiert, wobei seiner Ansicht nach über eine volksethymologische Umdeutung daraus dann Hohbeke („hochgelegener Bach“) und also das heutige ‚Höhbeck’ geworden sein könnte. In einer Urkunde des Jahres 1318 wird nämlich eine villa hobeke erwähnt (puDElko 1963, 238). Eine sprachwissenschaftliche Analyse der Entwicklung von Hohbuoki über Hobeke zu Höhbeck unternahm erst Wolf (1963). Sie führte zu dem klaren Ergebnis, dass „gegen eine Gleichsetzung der Namen Hohbuoki und Höhbeck [...] keine Beden-ken philologischer Art“ bestehen (Wolf 1963, 194). Übrigens wurde Wolfs Analyse später gern als siche-rer Beleg für die Identifizierung des Höhbeck-Kastells angesehen (z.B. SchulzE 1972, 4), obwohl er betont hatte, dass die sprachliche Herleitung allein nicht für den Beweis der Identität des Kastells ausreiche (Wolf 1963, 194).
Anders als der nicht nachgewiesene Buchenwald er-gibt die Verbindung mit einem „hochgelegenen Bach“
durchaus einen nachvollziehbaren Sinn, denn eine Be-sonderheit des Höhbecks sind seine hochgelegenen Schichtquellen. Sie speisen u.a. den Talmühlenbach, der ein tiefes Tal in den Höhbeck eingeschnitten hat und durch fast 60 m Gefälle einem Mittelgebirgsbach ähnelt, bevor er in die Elbe mündet. Schon in der rö-mischen Kaiserzeit ermöglichten diese Quellen eine dichte Besiedlung, die sich vor allem an diesem Bach entlang zog (vgl. z.B. nüSSE 2008, 278 Karte 1 Gebiet C). Später war es vielleicht doch insgesamt zu trocken, denn es wurden bislang keine frühmittelalterlichen Siedlungen auf dem Berg entdeckt, abgesehen von den Befestigungen. Für die Versorgung der Befestigungen dürften die Quellen und der Bach jedenfalls essentiell gewesen sein. Der große Fluss im Tal, die Elbe, kam dafür nicht in Frage. Er hat damals, lange bevor die ersten Deiche angelegt wurden, die gesamte Breite des Flussbettes in Anspruch genommen, mäandrierte in zahlreichen Schleifen, mit vielen Seitenarmen, Totar-men, Wasserlöchern, und zwar auf beiden Seiten des Höhbecks. In Abhängigkeit von der Jahreszeit führte er mehr oder weniger Wasser. Am problematischsten dürfte die Überquerung des Flusses im Frühjahr nach der Schneeschmelze gewesen sein, ansonsten gab es wahrscheinlich immer eine oder mehrere passierba-re Furten. Die Insellage des Höhbecks in dem bis zu 12 km breiten Flusstal machte ihn zum idealen Über-gangsort über die Elbe. Elbabwärts liegen riesige sai-sonal vernässte oder sumpfige Flächen, dem Fluss waren hier keine natürlichen Grenzen gesetzt, zu un-berechenbar war hier sein Verlauf. Auch elbaufwärts breiteten sich große Niederungsgebiete aus, die nur schwer zu durchqueren waren. Am Höhbeck dagegen sah die Situation anders aus. Von Südwesten kommend gab es nur einen Weg über den Fluss auf die Anhöhe, der gut zu passieren gewesen sein dürfte. Die Breite des Flusstales lag auf dieser Seite des Berges unter 2 km. Von der anderen, nordöstlichen Seite des Höh-becks waren es nur etwa 3 km bis zum anderen Ufer des breiten Flusstales. Dadurch war hier die im gesam-ten größeren Umkreis sicherste Stelle, den Fluss zu überqueren. Hinzu kommt, dass der Berg eine wichtige Landmarke war und zur Orientierung im Raum diente. Gleichzeitig ermöglichte er auch umgekehrt durch die-se strategisch günstige Position eine effektive Überwa-chung der Flussübergänge sowie des vorbeiziehenden Schiffsverkehrs.
Forschungsgeschichte – Die Altgrabungen
Einige Dinge aus der Forschungsgeschichte der Viet-zer Schanze klangen einleitend bereits an. Die ‚Ent-deckung’ der Vietzer Schanze als castellum hohbuoki liegt jedoch schon lange vor Schuchhardt. Der Amt-mann Wedekind aus Lüneburg formulierte 1828 erst-mals die These, dass die Vietzer Schanze auf dem Höhbeck Karls Kastell gewesen sein könnte, und lenk-te so die damals bereits umfangreich und kontrovers
83
geführte Diskussion um die Lokalisierung des castel-lum hohbuoki in eine neue Richtung (WEDEkinD 1828, 244 ff.). Seine These wurde von Spangenberg sofort aufgegriffen und mit weiteren Details versehen, wobei jener sich jedoch gegen die Vietzer Schanze aussprach, weil er deren Bauzeit im 30jährigen Krieg vermute-te (SpangEnbErg 1828, 199). Er bevorzugte die höher gelegene und „altertümlichere“ Befestigung, die heute unter dem Namen Schwedenschanze bekannt ist und damals Blocksberg hieß (SpangEnbErg 1828, 202). Eine kontroverse Diskussion um diese Lokalisierung kam nicht in Gang, die Verbindung von hohbuoki mit Höhbeck war weitgehend überzeugend. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wollte Schuchhardt Beweise fin-den. Am 15.04.1897 schrieb er an Voss, den damaligen Direktor der vorgeschichtlichen Abteilung des Völker-kundemuseums in Berlin: „Ich war vor einigen Tagen auf dem Höhbeck bei Gartow a.d. Elbe und habe das alte Kastell mit seinen Vorschanzen, das nach den Fun-den, die ich bei dem daneben hausenden Müller sah und nach seiner Bauart [...] sicher das Hohbuoki Karls d. Gr. ist, für unseren Atlas vorgesch. Befestigungen in Niedersachsen aufgenommen.“ (SMB-PK/MVF, Archiv, E 1897/00466 – IIe/002). Er nutzte die Gele-genheit für eine erste Ausgrabung von nur wenigen Ta-gen im Juli 1897. Danach passierte längere Zeit nichts mehr, aber die Vietzer Schanze ließ Schuchhardt, auch nachdem er 1908 als Direktor der Vorgeschichtlichen Abteilung des Völkerkunde-Museums nach Berlin ge-gangen war, keine Ruhe. Nach den Wirren des Krieges und wenige Jahre vor seiner Pensionierung unternahm er vom 16. August bis Ende September 1920 eine grö-ßere Grabungskampagne von 4 ½ Wochen.1 Er unter-suchte damals den Torbereich im Südwall, den Wall selbst sowie größere Bereiche der Innenfläche. Mit den Ergebnissen zeigte er sich durchaus zufrieden, wie sein Bericht kurze Zeit nach den Grabungen erkennen lässt: „[…] Hier gelang es die Umwehrung völlig und die Besetzung des Innern zum guten Teil aufzuklären. Das Kastell (170 : 70 m) war umzogen von einer 6 m dicken und wie sich errechnen ließ auch 6 m hohen Burgmauer aus Holz und Lehm. Das Kastell ist von Osten nach Westen langgestreckt. Die nördliche Lang-seite hält sich am Elbufer, die östliche Schmalseite an der Schlucht des in die Elbe einmündenden Talmühl-Baches. Diese beiden Seiten sind also sturmfrei und haben keine Tore. In der Mitte der südlichen Langseite lag das Haupttor, 6 m weit, mit doppelter Durchfahrt, erkennbar daran, dass die Wände und die Mittelteilung ihre Pfostenlöcher im Boden hinterlassen hatten. Die westliche Schmalseite des Kastells hatte auffallender Weise 2 kleine Tore von nur etwa 1 ½ m Weite, jedes 50 m von der Mitte entfernt. Die Bebauung des Innern ließ sich an Gruppen von Pfostenlöchern und Scher-benlagern, die durch breite Straßen reinen Sandes voneinander getrennt waren, einigermaßen feststellen.
1 In seinen Erinnerungen schreibt SchuchharDt (1944, 367) jedoch von „drei Wochen Höhbeck“.
Vom Tore aus kam man zunächst auf einen freien Platz, links von ihm haben wir den Pfostenrahmen einer Ka-serne von 10 : 12 m herausgearbeitet, rechts wird ein ähnliches Gebäude gelegen haben, gradeaus, in der Mitte der ganzen Burg erstreckten sich mehrere lange Gebäude von Norden nach Süden parallel zueinander. Ringsumher lief eine breite Straße an der Wallmauer entlang. Die Funde bestanden in diesem Kastell fast ausschließlich aus Topfscherben und zwar fränkischen und sächsischen ungefähr zu gleichen Teilen, und ei-nigen wenigen slawischen (die Wenden haben 810 das Kastell erobert und kurze Zeit inne gehabt). Die einzigen Metallfunde waren eine große eiserne Lan-zenspitze (Ango) und ein kleines Ortband aus Bron-zeblech. […]“ (SMB-PK/MVF, Archiv, E 1920/00661 – E 813/20). Es handelt sich um ein Zitat aus einem Brief an den Regierungspräsidenten zu Lüneburg, doch offensichtlich hat Schuchhardt seine Ergebnisse einem weiteren Kreis mitgeteilt, denn sein Bericht an den Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin vom 17.03.1921 enthält den gleichen Wortlaut (eine Abschrift des Berichtes befindet sich in den Ortsakten von Vietze). Obwohl es mit dem damaligen Besitzer, Herrn Julius Siems aus Hamburg, einige Unstimmig-keiten wegen der Wiederherrichtung nach der Grabung gab, hatte jener eingewilligt, dass die Funde sämtlich an das Staatliche Museum nach Berlin gingen. Leider sind sie, genauso wie die Grabungsdokumentation Schuchhardts, Kriegsverlust. Aus den Inventarbüchern lassen sich lediglich einige Anhaltspunkte gewinnen. Bei der erwähnten eisernen Lanze (I l 2006a) handelte es sich um ein großes Exemplar von 45 cm Länge und einer maximalen Breite von 5 cm. Das Stück ist nur in einer relativ ungenauen Zeichnung im Inventarbuch überliefert, die hier in einer maßstäblichen Umzeich-nung wiedergegeben wird (Abb. 1,1). Das „kleine Ort-band“, ein Messerscheidenbeschlag, wurde 1938 von Knorr erstmals publiziert und skizzenhaft abgebildet (knorr 1938, 481 Katalogeintrag I.A.1 und Taf. 1,1). Er gibt für das „bronzene Messerortband“ durch einen Lesefehler allerdings eine falsche Inventarnummer an (I e 2006b statt I l 2006b). Sprockhoff (1958b, 530) erwähnt den Beschlag ebenfalls als „der silberne Griff-beschlag eines slawischen Messers oder Dolches“, bil-det ihn aber nicht ab, denn der Beschlag war damals schon verloren. Die aktuelle Umzeichnung beruht auf Knorrs Skizze und der Zeichnung im Inventarbuch (Abb. 1,2). Sowohl die Lanzenspitze als auch der Be-schlag wurden in der Berme des Nordwalles gefun-den. Laut Knorr gehörten zu dem Fundkomplex des Messerscheidenbeschlages „frühdeutsche Scherben niedersächsischen Stiles (Bombentöpfe) vom 9.–12. Jahrhundert (I l 1017)2, u.a. ein slawischer Scherben, Randstück gegurtet aus dem 11. Jahrhundert“ (knorr 1938, 481). Unter dieser Inventarnummer wird im In-ventarbuch allerdings nur „allgemein Höhbeck“ als Fundzusammenhang für ein „Kästchen mit Scherben,
2 Bei Knorr fälschlicherweise I e 1017.
84
feingeschlemmt [sic!] und hartgebrannt, meist hell-grau, z.T. Randscherben mit auswärts gebogenem, z.T. verdicktem Rand; ein rotes Henkelbrst., ein gla-sierter Scherben“ angegeben. Es handelte sich also offenbar um allgemeine Sammelfunde, die nichts mit dem Fundkontext des Beschlages und der Lanze vom Nordwall zu tun haben. Unter der Inventarnummer I l 1004a-c sind aber Funde des „Nordschnittes“ ver-zeichnet. Dieser Schnitt hat sicher in unmittelbarer Nähe zur Berme des Nordwalles gelegen, wenn die-se nicht sogar von ihm geschnitten wurde. Folgendes wurde aus dem Nordschnitt inventarisiert: 1) ein „gro-ßer Kasten mit groben Scherben, Handarbeit, meist glatt, einige gerauht, einer mit wirrem Kammstrich“ (I l 1004a); 2) ein „Kasten mit etwas feineren Scher-ben, handgemacht, darunter mehrere auswärts gebo-gene Randstücke“ (I l 1004b) und 3) ein „Kasten mit Scherben, feingeschlemmt [sic!] und klingend hart ge-brannt, z.T. blaugrau. Bruchstück einer großen Tülle, rot“ (I l 1004c). Offensichtlich haben wir es hier mit einem Querschnitt aus verschiedenen Epochen zu tun, es sind sowohl kaiserzeitliche und slawische Scherben
als auch harte Grauware darunter. Der Messerschei-denbeschlag gehört zweifellos in das 11. oder 12. Jahr-hundert, wie auch ein Teil des übrigen Fundmaterials.
Die Funde aus Schuchhardts Höhbeck-Grabung von 1920 wurden bei ihrer Inventarisierung mit kurzen Beschreibungen versehen, denen zum Teil einfache Skizzen der Randprofile beigegeben sind. Dadurch ist trotz des Verlustes der Funde selbst häufig noch eine relativ klare Ansprache möglich. Sie zeigen auch ins-gesamt ein dem Nordschnitt vergleichbares Spektrum: kaiserzeitliche Keramik, in geringerem Maße slawi-sche Keramik und spätmittelalterliche Keramik (harte Grauware, glasierte Scherben). Offensichtlich haben bei Schuchhardts erster Beurteilung der Funde jedoch seine aus den Fränkischen Annalen genährten Erwar-tungen eine gewisse Rolle gespielt. Dies wird beson-ders deutlich, wenn er unmittelbar nach den Grabun-gen schreibt: „Und das Glück war gut, es hat uns neben Massen von fränkischen und sächsischen Scherben, die sich von einander klar scheiden lassen, wenigstens auch ein paar wendische in den Schoß geworfen, so
Abb. 1 Funde aus den Grabungen Carl Schuchhardts 1920 im Höhbeck-Kastell. 1 Lanzenspitze (Eisen); 2 Messerscheidenbe-schlag (Bronze); 3–6 slawische Keramik. (Zeichnungen: 1, 2 Verf.; 3–6 nach SchuchharDt 1921, Abb. 1 und 2).
85
wenige, daß man sieht, es hat nach oder zwischen der fränkischen Benutzung des Platzes keine besondere wendische Siedlung hier gestanden [...], sondern die slavischen Scherben sind nur die Zeugen des kurzen, gewaltsamen Besuches, den die Wilzen i. J. 810 hier abgestattet haben.“ (SchuchharDt 1921, 141–142). Die wenigen slawischen Scherben vom Höhbeck-Kastell haben Schuchhardt damals dazu veranlasst, erstmals eine Dreiteilung der slawischen Keramik vor-zunehmen, die er allerdings noch nicht näher benann-te. Während er nämlich explizit von „spätslavischen Gefäßen“ (1921, 140) sprach, ordnete er die vorherge-henden Stufen zwar dem 10. bzw. 8./9. Jahrhundert zu, benannte sie aber nicht früh- oder mittelslawisch. Die sichere Ansprache und Einordnung der slawischen Ke-ramik durch Schuchhardt ist umso beachtlicher, als bei den Ausgrabungen nur „6 slavische Scherben zutage gekommen“ waren (SchuchharDt 1934, 327). Diese wurden einerseits wie der slawische Messerscheiden-beschlag in der Nordost-Ecke des Kastells (Abb. 1,3) und andererseits im Mittelbereich nördlich des Tores im Südwall (Abb. 1,4–6) gefunden. Es handelt sich hier offensichtlich um frühslawische Keramik, die in die Zeit des Kastells zu setzen sein könnte, sowie um ein mittelslawisches Gefäß vom Typ Menkendorf, das wohl zu einer etwas späteren Nachnutzung gehört. Die frühslawische Keramik ist durch den Feldberger Typ (Abb. 1,6) und den Sukower Typ (Abb. 1,4–5) vertre-ten. Es ist allerdings anzumerken, dass die Ansprache der unverzierten Scherben allein anhand der Zeich-nungen als Typ Sukow nicht ganz eindeutig ist, denn hier könnte es sich auch um die gleichzeitige sächsi-sche Ware handeln, besonders bei dem in Abbildung 1,5 gezeigten Stück. Die Einordnung der sächsischen Siedlungsware jener Zeit bereitet teilweise bis heute Schwierigkeiten, und wenn man bedenkt, dass seiner-
zeit auch die eisenzeitliche Siedlungskeramik kaum erforscht war, so verwundert es nicht, dass es sich bei den angeblich zahlreichen „sächsischen und fränki-schen Topfscherben“ aus dem Kastell zu einem nicht geringen Teil um Keramik der römischen Kaiserzeit handelte. Gerade die Siedlungskeramik war damals noch nicht so bekannt und wurde von Schuchhardt zu-nächst irrtümlicherweise als sächsische Keramik ange-sprochen. So schreibt er 1921: „Mitten in ihn [Hexen-platz oder Schwedenschanze – J.S.] hin wurde jetzt ein neues Haus gebaut (Ziegler). Dabei waren dieselben sächsischen Scherben aus dem Boden gekommen, die neben den fränkischen sich im Kastell gezeigt hatten. Bei der Gartenanlage südlich vom Hexenplatz fanden sie sich auch wieder [...]. Es war klar, hier musste das große sächsische Dorf gelegen haben, an dessen Sei-te das Kastell sich anbaute.“ Doch diese erste Inter-pretation konnte der wissenschaftlichen Analyse nicht standhalten. Das größere Alter der Scherben vom Höh-beck wurde schon bald erkannt und H. Lange lieferte auch die zeitliche und typologische Einordnung der Höhbeck-Scherben (Schalen mit verdicktem Rand: Abbildung 2/1–3; große bauchige Gefäße mit brei-tem abgesetzten Schrägrand: Abbildung 2/4–5; und kleine bauchige Gefäße mit verdicktem fazettierten Rand oder Verdickung durch Randwulst: Abbildung 2/7–12) in den Ausgang der Spät-La-Tène-Zeit bzw. die Seedorf-Stufe nach Schwantes (langE 1926, 110). Bereits 1924 korrigierte Schuchhardt seine vormalige Ansicht vom sächsischen Dorf und spricht nun von einem „altgermanischen Dorf“, in das Karl der Gro-ße sein Kastell hineinsetzte (SchuchharDt 1924, 62) bzw. von „Spuren einer alten germanischen Siedlung“ (1934, 327) einen Kilometer östlich vom Kastell. Es geht dabei um die große kaiserzeitliche Siedlung in der Nähe von Funkturm und Schwedenschanze (vgl.
Abb. 2 Randprofile von Scherben der römischen Kaiserzeit aus den Grabungen Carl Schuchhardts 1920 im Höhbeck-Kastell. (Nach langE 1926, Abb. 6 (1–3), Abb. 7 (4–6), Abb. 8 (7–12)).
Abb. 3 Teilrekonstruierter Plan des Höhbeck-Kastells aufgrund von Geländemerkmalen und Grabungsergebnissen. Kartengrundlage: feintopographischer Plan von 1988. Eingezeichnet sind die Grabungsflächen von E. Sprockhoff
(1954–1965) und J. Schneeweiß (2008) mit wichtigen Befunden zum Wallverlauf. (Grafik: P. Fleischer).
86
87
Abb. 4 Funde aus den Grabungen Ernst Sprockhoffs im Höhbeck-Kastell 1963. Keramik der römischen Kaiserzeit. (Zeichnungen: P. Fleischer/Verf.).
88
nüSSE 2008, 105 Brünkendorf). Über die Keramikfun-de aus der Schwedenschanze berichtet er später: „Bei der Fundamentierung ihres Häuschens war Latène-Keramik gefunden worden.“ (1944, 367). Die Proble-me, die anfangs die Einordnung der Siedlungskeramik noch bereitete, und den folgenden Erkenntnisprozess beschreibt Schuchhardt 1926 am Beispiel seiner Gra-bungen auf der Düsselburg aus dem Jahre 1904, das ebenso gültig für seine Untersuchungen des Kastells ist: „Im Burginnern [...] erhielten wir mehrere ältere polierte und verzierte [Scherben], für die uns damals noch jegliches Vergleichsmaterial fehlte. Ich hielt sie für sächsisch [...]. Jetzt zeigt sich, daß sie germanisch aus frührömischer Zeit sind [...]“ (SchuchharDt 1926, 120). Abgesehen von der slawischen Keramik (Abb. 1/3–6) und den in Abbildung 2 gezeigten Profilen3 ist nie Keramik aus Schuchhardts Kastell-Grabungen vor-gelegt worden. Nach 1920 hat er hier keine Ausgra-bungen mehr durchgeführt.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Ernst Sprock-hoff die Grabungen erneut auf. Er war wie Schuch-hardt der festen Überzeugung, dass es sich bei der Vietzer Schanze um eines der bedeutendsten frühge-schichtlichen Denkmäler Deutschlands handele. Da Schuchhardts Grabungen nicht publiziert worden wa-ren, machte sich Sprockhoff zunächst auf Spurensuche und erkundete, auf welche Befunde Schuchhardt die oben zitierten Interpretationen gegründet hatte. Dabei gelang es ihm, die nämlichen Pfostenstellungen im Torbereich zu identifizieren. Sie waren nicht vollstän-dig ausgegraben und z.T. noch mit Grabungspflöcken versehen. Einige Ansichten Schuchhardts konnten von Sprockhoff korrigiert werden, andere wurden ergänzt (vgl. Sprockhoff 1955; 1958a; 1958b). Bei seinen um-fangreichen Ausgrabungen in der Innenfläche stieß er immer wieder auf alte Grabungsschnitte Schuchhardts, die sich als überraschend kleinflächig erwiesen. Zum größten Teil handelte es sich offenbar um eine Art Suchgräben, die selten breiter als 1 m waren und in nahezu allen Bereichen des Kastells angelegt gewe-sen sind. Der Wallschnitt Schuchhardts konnte von Sprockhoff allerdings nicht mehr lokalisiert werden. In den folgenden Jahren schnitt er den Wall an mehreren Stellen und untersuchte einen großen Teil der Innen-fläche (Abb. 3). Die Ausgrabungen der Jahre 1954 und 1956 wurden von ihm ausführlich vorgelegt (Sprock-hoff 1955; 1958a; 1958b). Offensichtlich schien ihm jedoch der Erkenntnisgewinn der zahlreichen darauf folgenden Grabungskampagnen nicht groß genug, je-denfalls publizierte er sie nicht mehr. Gleichwohl setz-te er die Grabungen bis 1965 fast jährlich fort (1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965). Nach seinem Tod 1967 wurden die Unterlagen ad acta gelegt und die archäologischen Forschungen am Kastell ruhten für über vier Jahrzehnte. Seine Grabungsdokumentati-
3 Den Hinweis auf diese Veröffentlichung verdanke ich Herrn Diet-mar Gehrke, Lüneburg.
on und das Fundmaterial befinden sich im Museum für das Fürstentum Lüneburg.4 Eine Inventarisierung der Funde ist erst 1985 erfolgt, wobei der allergrößte Teil der Scherben als „slawisch“ angesprochen worden ist. Die aktuelle Durchsicht der Funde ergab allerdings, dass das Spektrum naheliegenderweise ungefähr dem entspricht, was auch Schuchhardt seinerzeit fand. Slawische Scherben bilden darin die Ausnahme. Von den Grabungen Sprockhoffs auf dem Kastell befinden sich ungefähr 1000 Scherben im Lüneburger Museum. Der tatsächliche Anteil slawischer Keramik bleibt ver-schwindend gering und beschränkt sich im Wesentli-chen auf weniger als zehn Scherben mit Gurtfurchen. Den größten Anteil haben mit etwa zwei Dritteln die kaiserzeitlichen Scherben, gefolgt von den spätmittel-alterlichen, die etwa ein Sechstel ausmachen. Das rest-liche Sechstel wird überwiegend von schwer bestimm-baren Scherben bestritten, worunter sicherlich auch ein größerer Teil der karolingisch-sächsischen Tonware fällt, sowie von einigen neuzeitlichen Scherben. Die Abbildungen 4–6 zeigen eine Auswahl der aussage-fähigsten Funde. Die früheste Besiedlung an diesem Platz wird durch die zahlreichen Funde und Befunde der älteren römischen Kaiserzeit belegt. Die Abbildun-gen 4 und 5/1–8 führen einen Querschnitt durch die zugehörige Keramik vor Augen, die größtenteils in den Schnitten der Innenfläche gefunden wurde. Das Spektrum umfasst unter anderem einfache Schalen mit eingezogenem Rand (Abb. 5/2,4), Gefäße mit geraden und ausgestellten Rändern, die fazettiert oder verdickt sein können (Abb. 4/1–3), Rautöpfe (Abb. 4/4) sowie Gefäße mit Henkeln oder Griffknubben (Abb. 5/5–7) und gehört damit in den frühesten Abschnitt der römi-schen Kaiserzeit. Stellvertretend für das Fundmaterial der spätmittelalterlichen Nutzung sind in Abbildung 6/1–13 einige Funde aus einer Abfallgrube im nord-östlichen Bereich der Innenfläche des Kastells zusam-mengestellt. Es handelt sich hier zum überwiegenden Teil um Kugeltöpfe der harten Grauware (Abb. 6/1,3–8), doch es sind auch verlagerte Scherben der vorher-gehenden Nutzungsphasen enthalten, namentlich zwei kaiserzeitliche (Abb. 6/10,11) und zwei frühmittelal-terliche Scherben (Abb. 6/12,13). Der Kugeltopf der harten Grauware in Abbildung 5/9 stammt aus der Nordwestecke des Kastells, der etwas ältere Kugel-topf (Abb. 5/10) wurde dagegen gemeinsam mit viel Brandlehm und Holzkohle in einer Herdstelle nahe am Wall der Südostecke gefunden (vgl. A in Abb. 7). Ein silberner brandenburgischer Brakteat des frühen 13. Jahrhunderts ist in ihrer Nähe im Aushub geborgen worden (Abb. 5/11) (Sprockhoff 1958b, 530. Schnuhr 1956). Es handelt sich um ein brandenburgisches Ge-präge der Askanier aus der Münzstätte Salzwedel. Die benachbarte schwarze, sehr holzkohlehaltige Brand-/
4 Für die freundliche Unterstützung bei der Durchsicht der Fun-de und die großzügige Einsicht in die Grabungsdokumentation Sprockhoffs danke ich ganz besonders Herrn Dietmar Gehrke, stellvertretend für die Mitarbeiter des Museums für das Fürsten-tum Lüneburg.
89
Abb. 5 Funde aus den Grabungen Ernst Sprockhoffs (1–12) und Carl Schuchhardts (13–14) im Höhbeck-Kastell (1920, 1956, 1958, 1960, 1963). Keramik der römischen Kaiserzeit (1–8) und des Spätmittelalters (9–10); Brakteat (11); Eisenmesser (12–13)
und Spinnwirtel (14). Erläuterungen im Text. (Zeichnungen: P. Fleischer/Verf. (1–10), Verf. (11–14)).
90
Kulturschicht in der Südostecke (B in Abb. 7) scheint in die gleiche Zeit zu gehören, denn aus ihr stammen zahlreiche Scherben der harten Grauware. Ebenfalls in diesen zeitlichen Kontext sind vermutlich auch ein Spinnwirtel und zwei Eisenmesser zu setzen. Eines der Messer (Abb. 5/12) wurde wie der Brakteat in der Süd-ostecke gefunden, das andere (Abb. 5/13) kommt aus den Altgrabungen Schuchhardts. Es trug die Inventar-nummer I l 1000c und wurde gemeinsam mit harter Grauware in „Haus III“ (Inventarbuch des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin) angetroffen. Es ist unbekannt, wo sich dieses Haus befunden hat, wahrscheinlich etwa in der Mitte der Innenfläche. Die unter I l 1000b inventarisierte, nicht abgebildete Keramik wird ebenda folgendermaßen beschrieben: „drei Scherben, gut geschlemmt [sic!], hart gebrannt, Scheibenarbeit, kräftig profiliert“. Ein Spinnwirtel aus dunkelgrauem Ton (Abb. 5/14) ist ebenfalls ein Altfund und stammt aus einem heute nicht mehr näher zu loka-lisierenden „Herd“. Er wird unter der Inventarnummer I l 1012 mit folgender Beschreibung geführt: „Spinn-wirtel, beschädigt, abgestumpft doppelkonisch mit breitwulstigem Umbruch. Auf Ober- und Unterseite je zwei kräftige konzentrische Horizontalen.“ Die zahlen-mäßig geringste Gruppe bilden die früh- bis hochmit-telalterlichen Funde, sie entsprechen im engeren Sinne der eigentlichen karolingischen Nutzungsphase der Befestigung. Einige Beispiele vor allem sächsischer Gefäße zeigt die Abbildung 6/14–19, darunter auch das einzige ganze Gefäß, das auf dem Kastellplatz gefun-den wurde (Abb. 6/19). Dieser Topf, der ohne weite-res in das späte 8./frühe 9. Jahrhundert datiert werden kann, wurde auf seiner Mündung stehend in der Nähe der Südostecke der Befestigung gefunden (C in Abb. 7). Der leicht wacklige Boden des Topfes zeigt noch deutlich eine leichte „Wunde“, die von einer flach ge-führten Schaufel herrührt und damit die Auffindungs-situation illustriert. Obwohl keinerlei Hausstrukturen dokumentiert worden sind, ist der Zusammenhang zu einem Gebäude nahe liegend, genaueres lässt sich lei-der nicht mehr sagen. Die schwarze Kulturschicht (B in Abb. 7) ist jedenfalls jünger (siehe oben). Wahrschein-lich ebenfalls sächsisch aus dem frühen 9. Jahrhundert sind die in Abbildung 6/14, 15 und 18 dargestellten Funde. Die Scherbe (Abb. 6/17) könnte slawisch sein (Typ Sukow). Ganz sicher slawisch, aber jünger, ist die Scherbe mit Gurfurchen (Abb. 6/16), die wie der Mes-serscheidenbeschlag (Abb. 1/2) in der Nordwestecke des Kastells gefunden wurde.
Rahmen und Anlass der Wiederaufnahme der Forschungen (Elbslawen-Projekt)
Im Jahre 2005 begannen die Feldarbeiten eines 5-jäh-rigen Forschungsprojektes zur slawischen Besiedlung im unteren Mittelelbegebiet (SchnEEWEiSS 2007. Will-roth 2007. lüth/MESSal 2008. SchnEEWEiSS 2011a).
Die engere Höhbeckregion im Nordosten Niedersach-sens bildete dabei den Schwerpunkt der von der Uni-versität Göttingen durchgeführten Forschungen (Abb. 8). Das zeitliche und funktionale Verhältnis der auffal-lend zahlreichen frühmittelalterlichen Befestigungen in diesem Raum war eine der Kernfragen des Projek-tes. Aus diesem Grunde rückten naturgemäß auch die Höhenburgen auf dem Höhbeck, die Vietzer Schanze und die Schwedenschanze wieder stärker in den Mittel-punkt des Interesses, denn sie bilden den Schlüssel für das Verständnis der hiesigen Verhältnisse im Frühmit-telalter. Leider schloss die ansonsten recht großzügige Förderung durch die DFG die Untersuchung dieser beiden Befestigungen im Rahmen des Projektes aus. Nur dank der finanziellen Unterstützung der Gemein-de Höhbeck und der Samtgemeinde Gartow war es möglich, die Befestigungen der beiden Anlagen durch je einen Wallschnitt zu untersuchen. Der grundlegende Ansatz lautete, nach Möglichkeit naturwissenschaft-lich datierbares Material zu gewinnen, denn letztlich stellte die eindeutige Datierung der Burgen das größte Desiderat der Forschung dar. Spätestens nach den um-fangreichen Ausgrabungen Sprockhoffs war klar, dass allein durch das Fundmaterial keine sichere archäologi-sche Datierung der Befestigung zu erreichen sein wür-de. Besonders hoffnungsvoll stimmten vor allem die mehrfach von Sprockhoff und auch Schuchhardt nach-gewiesenen verkohlt erhaltenen Konstruktionshölzer im Innern des Walles, weil eine organische Erhaltung unverbrannten Holzes praktisch ausgeschlossen wer-den konnte. Sprockhoff hatte bei seinen Grabungen auch einige Proben dieser Holzkohlen geborgen, die zusammen mit seinen Funden noch im Museum Lü-neburg aufbewahrt werden. Der Versuch einer dendro-chronologischen Datierung dieser Stücke ergab kein sicher zu belegendes Datum, allerdings in einem Falle ein mögliches Datum von 805, das jedoch statistisch nicht hinreichend abgesichert werden konnte.5 Immer-hin versprach diese Messung dem gesamten Vorhaben eine gute Aussicht auf Erfolg. Ernst Sprockhoff war in allen seinen Wallschnitten, in der Nordwestecke, im Westwall, in der Südwestecke, im Südwall, in der Süd-ostecke und sogar zum Teil im Nordwall auf Brandspu-ren und verkohlte Hölzer gestoßen. Insofern sollte die Probengewinnung eigentlich kein Problem darstellen.
Die Ausgrabungen 2008
Wallschnitt
Für den Wallschnitt wurde der noch gut erhaltene Westwall der Vietzer Schanze ausgewählt, und zwar in einem Abschnitt, in dem der Baumbestand einen geraden Schnitt durch Wall und Graben ermöglich-te (vgl. Abb. 3). Entgegen der gehegten Erwartungen zeigte das Wallprofil in seinem Inneren dann aller-
5 Mündliche Mitteilung Dr. K.-U. Heußner, Berlin.
91
dings keinerlei verkohlte Hölzer (Abb. 9). Lediglich an der Wallaußenseite befanden sich einige Brandspuren in Form von etwas verstürztem Brandlehm und Holz-
kohle über der Berme. Der Wallkörper selbst ließ da-gegen klar und deutlich nur die Spuren unverbrannter, völlig vergangener Hölzer erkennen. Der Wallkörper
Abb. 6 Funde aus den Grabungen Ernst Sprockhoffs im Höhbeck-Kastell 1958 (1–15, 17, 19) und 1960 (16, 18). Keramik aus einer spätmittelalterlichen Abfallgrube (1–13), frühmittelalterliche (14–15, 17–19) und spätslawische (16) Keramik.
(Zeichnungen: P. Fleischer/Verf.)
92
bestand nahezu ausschließlich aus gelblich-weißem Sand, durch den sich in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger horizontale bräunlich-lehmige Tonanrei-cherungsbänder zogen. Die verrottenden Hölzer hatten hier offenbar Schichtgrenzen gebildet, an denen sich die durch Sickerwasser transportierten Tonpartikel ablagerten und auf diese Weise die Lage der Hölzer nachzeichneten. Der Befund zeigte deutlich die Ein-phasigkeit des Walles. Es war keine ältere oder jüngere Phase auszumachen. Eine mächtige Pfostengrube von 0,6 m Durchmesser und 0,8 m Tiefe kennzeichnete die Wallfront und entsprach in ihrer Art und Dimension vollkommen jenen, die Sprockhoff seinerzeit entdeckt und dokumentiert hatte (Sprockhoff 1955, 55–59). Der Wall war an seiner Basis 10 m breit und wies noch eine Höhe von 2 m auf. Die ursprüngliche Breite des Wal-les hat etwa 6 m betragen. Unterhalb des Wallaufbaues war die ursprüngliche Oberfläche noch als schwach-graue sandige Schicht zu erkennen, die im Bereich des Wallschnittes jedoch keine Funde enthielt. An die Wallaußenfront, die in etwa mit der großen Pfosten-stellung zusammenfiel, schloss sich eine ca. 2 m brei-
te Bermensektion an, die offenbar nicht nur aus Sand, Hölzern und evtl. Sodenpackungen aufgebaut gewesen ist, sondern anscheinend auch durch größere Gerölle und Findlinge gestützt wurde. Der nach außen sich an-schließende Graben war im Gelände noch gut als lang-gestreckte wallparallele Depression zu erkennen, da er – im Gegensatz zum Graben vor dem Südwall – nicht vollständig verfüllt war. In seiner recht homogenen und überwiegend sandig-humosen Verfüllung fehlten eindeutige Brandspuren oder Brandversturz. Wegen des dichten Baumbestandes wurde der etwa 10 m brei-te Graben nur wallseitig 5,5 m weit aufgegraben. Er war 1,40 m tief verfüllt, seine Sohle lag 2,60 m unter-halb der ehemaligen Oberfläche. Sie war relativ flach. Demnach handelte es sich nicht um einen Spitzgraben, wie er vor dem Südwall dokumentiert worden war. Die Dimensionen entsprachen jedoch weitgehend jenen, auf die auch Sprockhoff getroffen war (vgl. Sprock-hoff 1955, 62–65 und Beilage 1; 1958a, 232–233 Bei-lage 8).
Abb. 7 Plan der Südostecke des Höhbeck-Kastells (vgl. Abb. 3) mit den Grabungsschnitten E. Sprockhoffs, wichtigen Befunden und Rekonstruktion von Wall- und Grabenverlauf. Erläuterungen zu A–H im Text. (Grafik: P. Fleischer).
93
Sondage
Da nun trotz dieser guten Ergebnisse das Ziel, verkohl-te Hölzer zu gewinnen, nicht erreicht worden war, be-schlossen wir, zu diesem Zweck den nahe gelegenen Wallschnitt Sprockhoffs von 1964 in einer Sondage wieder zu öffnen. Die bislang einzige publiziert vorlie-gende Übersicht über Sprockhoffs Grabungen (SailE 2000, 38 Abb. 8; 2007a, 113 Abb. 34; 2007b, 92 Abb. 3) blieb im Detail unvollständig und fehlerhaft und konnte daher lediglich eine näherungsweise Vorstel-lung über deren Umfang geben. Im Gelände ließen sich die alten Grabungsschnitte nicht mehr erkennen, daher musste zu ihrer Lokalisierung Sprockhoffs Messnetz wieder hergestellt werden. Dieser hatte 1956 parallel zu seinem damals angelegten 6 m breiten Suchschnitt über die ganze Länge des Kastells eine Grundlinie eingerichtet, auf die er alle seine Grabungsschnitte einmaß. Er hatte sie durch drei Eisenrohre vermarkt, eines am Nullpunkt nahe der südöstlichen Ecke des Kastellplatzes, eines ungefähr mittig bei 100 m und ein weiteres bei 150 m in der südwestlichen Ecke. Durch gezielte Aufgrabungen gelang es, diese Grundlinie wieder herzustellen. Die Bezugspunkte wurden terres-trisch eingemessen, so dass sämtliche Grabungsschnit-
te nun mit Koordinaten belegt sind. Dies ermöglichte erstmalig die Erstellung eines lagegenauen Planes der Grabungen Sprockhoffs (vgl. Abb. 3) und damit auch die Rekonstruktion der genauen Lage des Wallschnitts von 1964.
Zunächst wurde auf der Wallkrone eine Fläche von ca. 6 x 2,5 m oberflächlich im Planum geöffnet, um die genauen alten Grabungsgrenzen zu finden. Innerhalb seines alten Schnitts wurde sodann eine Sondage von 2,3 x 1,6 m abgetieft, die etwa mittig vor dem gro-ßen Wallprofil von Sprockhoff lag. In einer Tiefe von 1,2 m erreichten wir das Planum, auf das Sprockhoff seinerzeit in diesem Bereich gegangen war. Im mittle-ren Bereich des Walles war er nämlich nicht bis auf den anstehenden Boden gegangen, wie aus seiner Doku-mentation des Wallprofils hervorgeht, die erst kürzlich von SailE (2007a, 115 Abb. 36; 2007b, 94 Abb. 5) vor-gelegt wurde. Ein Grabungsfoto von 1964 lässt diesen Sachverhalt gleichfalls erkennen (vgl. SchnEEWEiSS 2011b, 374 Abb. 3). Schon im obersten Planum auf der Wallkrone kamen zahlreiche verkohlte Hölzer zutage, und im nun wiederhergestellten Planum Sprockhoffs waren die kräftigen Balken klar zu erkennen, die er vor über vier Jahrzehnten bereits dokumentiert hatte
Abb. 8 Das Tal der unteren Mittelelbe mit den frühgeschichtlichen Befestigungen (Kreise, Rechteck) und Siedlungen (Punkte) am Höhbeck. Die Siedlungsplätze nördlich der Elbe sind nicht kartiert. (Zeichnung: Verf.).
95
(vgl. Abb. 10). Beim Abtiefen bis auf den anstehenden Boden wurden noch zwei weitere Plana angelegt. Da-rin konnte die genaue Lage der vorzüglich erhaltenen Hölzer im Wall und zueinander beobachtet und doku-mentiert werden (Abb. 11 und 12). Das letzte Planum lag unterhalb des Wallaufbaus in einer geologischen Geröllschicht (Abb. 13), über der sich der ehemalige Begehungshorizont befand. Innerhalb der Sondage wurde auch ein (verkohlter) senkrechter Pfosten an-getroffen, der mittig innerhalb des Wallkörpers stand. Schon Sprockhoff hatte ihn gesehen und als einen „Mittelpfosten“ angesprochen. Er maß im Durchmes-ser fast 30 cm, der Durchmesser der Pfostengrube be-trug annähernd 0,6 m. Der verkohlt erhaltene Gesamt-befund innerhalb der Sondage stellte eine wichtige Ergänzung zu dem nur als Verfärbung erhaltenen Be-fund unseres Wallschnittes dar. Zum einen beseitigte er jeden Zweifel daran, dass die horizontalen braunen Tonanreicherungsbänder im Wallkörper tatsächlich die Lage einstiger Hölzer kennzeichneten, denn an eini-gen Stellen ließ sich feststellen, dass verkohlte Partien sich in solchen Bändern fortsetzten. Zum anderen lie-ferte er wertvolle Informationen über die konstrukti-ven Verbindungen der Hölzer miteinander – bzw. das
Fehlen von diesen. Denn an keiner Stelle konnte eine solche festgestellt werden, auch nicht mit dem Mittel-pfosten. Die Abstände der Hölzer variierten in jeder Richtung. Sie lagen außerdem nicht immer parallel, sondern bisweilen auch schräg. Wertvolle Aufschlüsse über die Art der zur Stabilisierung des Walles verwen-deten Hölzer konnten ebenso gewonnen werden. Es wurden sowohl Spaltbohlen identifiziert als auch arm-dicke Baumstämme und Astholz. Offensichtlich war im Wallkörper auch minderwertiges Holz verwertet worden. Eine Besonderheit stellte ein Stück dar, das zu einer Kopfbohle gehört haben dürfte (Abb. 14; vgl. auf Abb. 12 in situ). Seine erhaltene Länge beträgt 0,5 m, der rund ausgearbeitete Kopf ist noch 10 cm breit und hatte ursprünglich einen Durchmesser von etwa 16 cm. Die Bohle war bereits zerbrochen, als sie in den Wall kam. Der Fund deutet darauf hin, dass auch Spolien verbaut worden sein könnten. Aus welchem baulichen Zusammenhang allerdings diese Kopfbohle ursprüng-lich stammte, oder ob es sich lediglich um ein miss-lungenes Bauteil vom Kastell selbst handelte, bleibt ungewiss. Sie wurde in der Basis des Walles gefunden, etwa 0,2 m oberhalb des Laufhorizontes.
Abb. 10 Höhbeck-Kastell, Westwall. Sondage im wiederge-öffneten Wallschnitt von E. Sprockhoff 1964. Planum 1 auf dem von E. Sprockhoff erreichten Niveau (ca. 43,60 m ü.
NN), gegen West. Links im Vordergrund senkrechter Mittel-pfosten, bereits von Sprockhoff dokumentiert. (Foto: Verf.).
Abb. 11 Höhbeck-Kastell, Westwall. Sondage im wiederge-öffneten Wallschnitt von E. Sprockhoff 1964. Planum 2,
15 cm unter Planum 1, gegen Ost. Senkrechter Mittelpfosten hinten rechts vor der Fototafel. (Foto: Verf.).
96
Die Sondage ermöglichte es nach nunmehr 44 Jah-ren, die Dokumentation des Wallprofils von Ernst Sprockhoff um den Mittelteil zu ergänzen (Abb. 15). Der gesamte Befund zeigte auch hier im offensichtlich brandzerstörten Wallbereich keinerlei Nachweise einer Erneuerung oder baulichen Änderung.
Die Wallhölzer waren nicht alle gleichermaßen ver-brannt bzw. verkohlt. Diese Feststellungen sind bereits bei den älteren Grabungen gemacht worden. Schuch-
hardt hatte durch Brand verziegelten Lehm gefunden, in dem runde Löcher „mit einer Masse von weißlicher Holzasche“ die verbrannten Hölzer kennzeichneten (atlaS, 52/224. Im gleichen Sinne auch SchuchharDt 1934, 325). Sprockhoff hatte die Hölzer in sehr unter-schiedlichen Erhaltungszuständen angetroffen. Teil-weise waren sie ganz als Holzkohle erhalten, manche jedoch nur „strichweise“ oder als „Kohlestreifen“, wieder andere waren nur durch braune Randlinien zu erkennen (Sprockhoff 1955, 57). Bemerkenswert ist,
Labornummer Holzart Anzahl Ringe Fälljahr Bemerkung
C 51233 Eiche 44 810 Waldkante C 52050 Ulme 74 809 Waldkante C 52062 Ulme 61 805 Waldkante C 52065 Eiche 52 734 um/nach C 52067 Eiche 68 720 um/nach C 52060 Eiche 92 719 um/nach C 52068 Eiche 88 712 um/nach C 52056 Eiche 94 686 um/nach C 52074 Eiche 32 656 um/nach
Tab. 1 Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Datierungen.
Abb. 12 Höhbeck-Kastell, Westwall. Sondage im wiederge-öffneten Wallschnitt von E. Sprockhoff 1964. Planum 3,
25 cm unter Planum 2, gegen West. Im Zentrum des Planums liegt das Fragment einer Kopfbohle in situ. (Foto: Verf.).
Abb. 13 Höhbeck-Kastell, Westwall. Sondage im wiederge-öffneten Wallschnitt von E. Sprockhoff 1964. Planum 4,
40 cm unter Planum 3, gegen Ost. Geologische Geröllschicht unterhalb des Laufhorizontes. Vor der Fototafel ist die Pfos-
tengrube des senkrechten Mittelpfostens zu erkennen. (Foto: Verf.).
97
dass die verkohlten Hölzer bis auf die alte Oberfläche hinunterreichen, auch inmitten des Walles. Ein Feuer kann hier nicht gebrannt haben. Dieser Befund lässt sich nur durch eine Art Schwelbrand erklären, welcher durch ein Schadensfeuer an der Außenseite des Wal-les ausgelöst wurde und sich dann über einen längeren Zeitraum nach innen fortsetzte. Die mehr oder weniger gleichgerichteten und dicht liegenden langen Hölzer im Sand schufen praktisch Meilerbedingungen.
Datierung
Insgesamt konnten 25 Hölzer aus dem Wallkörper für eine dendrochronologische Datierung beprobt werden. Dadurch, dass es sich durchweg um verkohlte Hölzer handelte, hatten diese natürlich ihre innere Festigkeit eingebüßt und mussten en bloc geborgen werden. Dies gelang in zufriedenstellender Weise unter Zuhil-fenahme von PU-Schaum, der das Probengewicht in Grenzen hielt und eine gute Bearbeitbarkeit ermög-lichte. Die von Anfang an gehegten Hoffnungen auf eine möglichst genaue Datierung erfüllten sich, denn neun der 25 analysierten Proben lieferten verwertbare Daten, davon drei sogar mit Waldkante (Tab. 1).6 Diese Letzteren sind es, die für den gesamten Befund – also den Befestigungsbau – relevant sind, denn es handelt sich nicht nur um die genauesten, sondern auch um die jüngsten Daten der Serie. Sie fallen genau in den Zeit-raum, in dem das castellum hohbuoki in den Fränki-schen Annalen erwähnt wird: 805, 809 und 810.
Es verdient besondere Beachtung, dass die Streuung der Daten, die ja alle aus einem Befundzusammenhang stammen, ganz erheblich ist. Das ist methodisch für die Verwendung von dendrochronologischen Datie-rungen anhand von Holzkohle sehr aufschlussreich und bereits an anderem Orte thematisiert worden (vgl. SchnEEWEiSS 2011b, bes. 375–376). Durch diese Er-gebnisse kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass es sich tatsächlich um jenes aus den Schriftquellen be-kannte Kastell handelt. Anderslautende Thesen, die in der Vietzer Schanze etwa das bislang nicht lokalisierte Winterlager des römischen Feldherrn Tiberius aus dem Jahre 5 n. Chr. vermuten (harck 1972, 147; 1986, 97. thiEME 1986, 123–124), müssen ad acta gelegt wer-den. Der jüngste Grabungsbefund belegt zum wieder-holten Male die Einphasigkeit der Befestigung. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass hier im Frühmittelalter eine ältere, römische Anlage wiedergenutzt worden sein könnte. Das auffällige Fehlen von Reparaturnach-weisen oder mehreren Bauphasen im archäologischen Befund erfordert darüber hinaus eine ganz eigene Dis-kussion, denn die Fränkischen Annalen berichten ex-plizit von der Wiedererrichtung des castellum: „[...],
6 Die Messungen wurden im dendrochronologischen Labor des DAI Berlin von Dr. K.-U. Heußner und M. Hochmuth durchge-führt, wofür ihnen herzlich gedankt sei. Die Labornummern lauten C 51230-51233 und C 52050-52077.
unum trans Albiam in Linones, qui et ipsos vastavit et castellum Hohbuoki superiori anno a Wilzis distruc-tum in ripa Albiae fluminis restauravit, [...]“ (annalES a. 811). Die einzige Stelle, an der bislang ein Umbau erkannt worden sein wollte, war das Tor in der Mitte des Südwalles. Dazu folgen weiter unten einige nähere Ausführungen.
Abb. 14 Höhbeck-Kastell. Verkohl-tes Fragment einer Kopfbohle, die an der Basis des Westwalls gefun-
den wurde (vgl. Abb. 12). (Foto: Verf.).
98
Der Aufbau der Befestigung – Rekonstruktion
Wallaufbau
Die Konstruktion der Befestigung ist bereits detailliert und sorgfältig von Sprockhoff untersucht worden. Sei-ne Ergebnisse konnten durch unseren Wallschnitt voll-auf bestätigt werden. Demnach war der Holz-Erde-Wall wie folgt aufgebaut: Die Außenfront wurde ganz wesentlich durch mächtige Pfosten gebildet, von denen sich die Pfostengruben erhalten haben. Letztere maßen im Durchmesser etwa 0,6–0,7 m und waren zwischen 0,5 und 0,9 m tief, im Durchschnitt 0,7–0,8 m (vgl. Sprockhoff 1955, 57). Sie waren in Abständen von 1,5–2 m nebeneinander gereiht. Die derart gestaltete Wallfront des Kastells wurde von Sprockhoff vielfach aufgedeckt und dokumentiert (Sprockhoff 1955; 1958a), so auch in seinen unpublizierten Wallschnitten der 1960er Jahre in der Nordwest- und Südostecke des Kastells. Die Grabungen 1961 sind nicht von ihm selbst, sondern von Schirnek durchgeführt worden. Dieser hatte detailliert die Lage der verkohlten Hölzer im Innern des Wallkörpers der Nordwestecke doku-mentiert, aber er hatte nicht überall den anstehenden Boden erreicht und dadurch nur einen Teil der Pfosten-gruben entdeckt. Sprockhoff öffnete daher 1963 diesen Schnitt noch einmal, um diesen Missstand zu beheben. Es gelang ihm, sieben weitere Pfostengruben der Wall-front zu entdecken, die in Größe und Abstand den an-deren entsprachen. Die Abbildung 16 zeigt alle im Be-fund nachgewiesenen Frontpfosten des Westwalles und der Nordwestecke, auch die des jüngsten Wallschnittes von 2008. Ebenso dicht standen die meisten Frontpfos-ten auch in der Südostecke der Befestigung, wie die in Abbildung 7 wiedergegebenen Grabungsbefunde zei-gen. Im Unterschied zur Nordwestecke oder auch zum Südwall wurde hier aber teilweise eine Art Palisaden-graben nachgewiesen, in den die Frontpfosten einge-lassen waren (vgl. Sprockhoff 1958a, 232). Mit großer Wahrscheinlichkeit waren die Pfosten der Wallfront miteinander zu einer stabilen Holzwand verbunden, entweder durch Bretter oder Flechtwerk. Schuchhardt berichtet von gebranntem Lehm „in flachen Schichten mit Abdrücken von Flechtwerk“, den er bei seinem Wallschnitt am Nordwall beobachtet hatte. (atlaS, 52/224). Als Herkunft für diese Nachweise von Flecht-werkwänden wäre neben der Wallaußenfront auch ein schützender Zaun auf der begehbaren Wallkrone denk-bar. Die Wand der Wallaußenfront wurde nach außen durch eine Berme von variabler Breite gesichert, im Bereich des Südwalles betrug sie etwa 1,25–2 m, am Westwall dagegen 2–3 m. Besonders die bogenförmi-gen Ecken der Wallanlage verfügten offenbar über eine breitere Bermensektion, möglicherweise aus statischen Gründen. Die Bermen waren aus großen Steingeröllen und Findlingen, Grassoden und Lehmpackungen er-richtet. Die diesbezüglichen Befunde in den verschie-
denen Wallschnitten zeigten jedoch kein einheitliches Bild. Das könnte allerdings auch erhaltungsbedingt sein, da die Steine in jüngerer Zeit vielfach abgeräumt wurden, um der ackerbaulichen Nutzung der Fläche nicht im Weg zu sein. Rückwärtig schloss sich an die äußere Wallfront der eigentliche Wallkörper an. Hier ließ sich keine ausgefeilte Konstruktionsweise feststel-len. Es handelte sich offenbar um eine massive Auf-schüttung von Sand und Lehm, der durch quer zum Wallverlauf eingezogene Langhölzer Stabilität verlie-hen wurde. Diese Art des Wallaufbaus ist so ähnlich auch von anderen Befestigungen im sächsischen Ge-biet bekannt, wie z.B. von der Lüningsburg bei Neu-stadt am Rübenberge (hEinEMann u.a. 1976. hEinE, StEinau 1985). Die quer zum Wallverlauf eingezoge-nen Hölzer waren am Kastell höchstens 4–4,5 m lang und lagen in ungleichen Abständen zueinander in un-terschiedlichen Höhen im gesamten Wallkörper. In größerem Umfange wurde diese Situation in der Nord-westecke des Kastells dokumentiert, wie die von SailE (2007a, 114 Abb. 35; 2007b, 93 Abb. 4) wiedergegebe-ne Umzeichnung der Grabungsergebnisse von 1961 zeigt. Es kamen bei dieser Bauweise offensichtlich keine besonders ausgewählten Hölzer zur Anwendung, sondern es wurde alles genutzt, was zur Verfügung stand. Es sind sowohl unterschiedliche Holzarten (Ei-che, Ulme, Erle) als auch verschieden verarbeitetes Holz verbaut worden (Spaltbohlen, Astholz, ganze Stämme mittleren Durchmessers). Die gleichen Holz-arten wie im Westwall wurden auch im Südwall ver-baut (Sprockhoff 1955, 62). Wahrscheinlich wurde auch gesammeltes Totholz verwendet, wie die dendro-chronologischen Daten und der Gesamtbefund aus den jüngsten Ausgrabungen vermuten lassen. Entscheiden-de Stützen im Wallinneren bildeten senkrechte Pfos-ten, die in ihren Ausmaßen in etwa den Frontpfosten entsprachen. Ein verkohlt erhaltener Pfosten in unserer Sondage wies noch einen Durchmesser von 30 cm auf (vgl. Abb. 12). Diese Pfosten im Wallinnern bildeten, wie die Frontpfosten, eine Reihe, allerdings standen sie mit Abständen von 3–5 m weniger dicht. Gegen-über der Wallfront war diese Mittelreihe ca. 2,5–3 m zurückgesetzt. Während die Wallfront offensichtlich geschlossen gewesen ist, denn die langen Querhölzer reichten augenscheinlich nicht über sie hinaus, bilde-ten die Mittelpfosten keine geschlossene Wand. Es konnten keinerlei Hinweise darauf gefunden werden, dass sie miteinander oder mit den Querhölzern in ir-gendeiner Weise konstruktiv verbunden gewesen wä-ren. Es wurden überhaupt keine parallel zum Wall ver-bauten Hölzer gefunden (vgl. auch Sprockhoff 1958b, 523). Dennoch darf wohl mindestens aus statischen Überlegungen eine konstruktive Verbindung der mäch-tigen Mittelreihepfosten vorausgesetzt werden, die aber wohl weiter oben als in den erhaltenen Wallresten lokalisiert werden muss. Wahrscheinlich dienten diese Stützpfosten nämlich nicht nur der Stabilität des Wall-kernes, indem sie dem seitlichen Verrutschen der lan-gen Querhölzer entgegentraten, sondern bildeten
99
Abb. 15 Höhbeck-Kastell, Westwall. Nordprofil des Wallschnitts von
E. Sprockhoff 1964, im Mittelteil ergänzt durch das Profil der Sondage 2008.
(Grafik: P. Fleischer).
gleichzeitig mit den Frontpfosten vor allem das Grund-gerüst für den anzunehmenden Wehrgang auf der Wall-krone, der ansonsten auf dem mehr aufgeschütteten als aufgebauten Wallkörper nicht in der notwendigen Sta-bilität hätte eingerichtet werden können. Auf diese Weise lässt sich für den Wehrgang (und die Wallkrone) eine Breite von etwa 2,5–3 m erschließen. Über die Gestaltung der inneren Wallfront lassen sich weniger genaue Angaben machen. Aus ihrem Bereich liegen leider nur unzureichende Grabungsbefunde vor. Wahr-scheinlich ist, dass auch das nach innen gerichtete Ende der Querhölzer und der Erdaufschüttung durch eine stabilisierende Wand gestützt wurde. Dafür spre-chen nicht nur theoretische Überlegungen zur Stabili-tät, sondern vor allem die bereits von Schuchhardt auf-gedeckten und später von Sprockhoff nachuntersuch-ten inneren Pfosten im Torbereich des Südwalles (vgl. Sprockhoff 1955, Beilage 1,2). Es handelt sich um die von Sprockhoff so genannten Pfosten T2a, T2d und T2f, die auch in Abbildung 18b wiedergegeben sind. Sie wurden seinerzeit als nördliche Begrenzung des 6 x 6 m messenden Schuchhardtschen Torhauses re-konstruiert, das nach Sprockhoff die zweite Phase die-ses Tores darstellt. Stellen wir diese Deutung einmal zurück, so könnten hier ebenso gut die Pfosten der in-neren Wallfront erfasst worden sein, die allerdings schwächer ausfallen als die Front- und Mittelpfosten des Walles. Dies braucht jedoch nicht zu verwundern, sondern darf sogar erwartet werden, da der innere Wallabschluss kaum die gleiche Größe und Massivität verlangt wie die Wallaußenfront. Die Konstruktion der Befestigung war nämlich insgesamt vor allem darauf ausgelegt, die starke, palisadenähnliche Wallaußen-front von hinten zu stützen und zu stabilisieren. Die ursprüngliche Breite des Walles an seiner Basis wurde in allen Schnitten übereinstimmend mit 6 m festge-stellt, lediglich der Nordwall hatte möglicherweise eine geringere Breite, wie Beobachtungen von Schuch-hardt 1897 vermuten lassen (vgl. atlaS, 52/224). Der Wallbreite von 6 m entspricht auch die Lage der ge-nannten Pfostenstellung. Im Gegensatz zur Wallaußen-front, die auf vielen Metern Länge dokumentiert wur-de, geschah dies leider im Bereich des inneren Wallab-schlusses nicht. Dieser wurde – außer im Bereich des mutmaßlichen Tores im Südwall – nur im Zusammen-hang mit Wallschnitten untersucht, die kaum breiter als 3 m waren. Es darf also aus der fehlenden Kenntnis einer inneren Pfostenreihe jenseits des Torbereiches nicht auf ihr tatsächliches Fehlen im übrigen Wallbe-reich geschlossen werden. Dies ist einzig dem Unter-suchungsstand geschuldet und zusätzlich dem Um-stand, dass diese Pfosten möglicherweise weniger mas-siv waren. Es gibt allerdings noch einen Hinweis auf die Konstruktion des inneren Wallabschlusses. Wahr-scheinlich handelt es sich nämlich bei drei Verfärbun-gen entlang der Wallinnenfront am östlichen Ende des Südwalles um solche Pfosten (vgl. Abb. 7, D–F). Lei-der lässt sich dies nicht endgültig klären, da diese Ver-
100
färbungen lediglich im Planum dokumentiert und nicht geschnitten worden sind.
Die Frage nach dem inneren Wallabschluss berührt naturgemäß auch Überlegungen zur Höhe der Befesti-gung. Schuchhardt hatte eine Höhe von 6 m errechnet (SchuchharDt 1924, 60), wobei er und Koldewey von einer massiven stufenlosen Bauweise ausgingen, so dass der Wall im Querschnitt 6 x 6 m gewesen sein soll-te. Die bis vor Kurzem verwendete Rekonstruktions-zeichnung von R. Koldewey illustriert diese Ansicht. Sie ist bei SchuchharDt (1924, 61 Abb. 27) publiziert und später noch einmal bei SchuchharDt (1934, 325 Abb. 290). Auf welche Weise allerdings Schuchhardt und Koldewey ihre Berechnungen durchgeführt haben und mit welchen weiteren Parametern ist unbekannt.
Es ist selbstverständlich, dass Überlegungen zur ur-sprünglichen Höhe einer Befestigung und zur Ge-staltung der Wallkrone immer bis zu einem gewissen Grade spekulativ bleiben müssen. Dies gilt in hohem Maße für die karolingische Zeit, aus der praktisch kei-ne verlässlichen Beispiele bekannt sind. Nach den vor-liegenden Befunden aus dem Kastell erscheint der Wert von 6 m Höhe allerdings übertrieben. Die beschriebe-ne Konstruktionsweise des Walles dürfte kaum einem derartigen Druck haben standgehalten können. Dazu wären konstruktive Verbindungen der Hölzer, wie sie aus späteren Holz-Erde-Befestigungen bekannt sind, unerlässlich. Zahlreiche konstruktive Details sind für das späte 9. und 10. Jahrhundert aus dem slawischen Bereich bekannt: Verzapfungen, blockbauartige Käs-ten, Plankenwände mit Ankerbalken, Hakenriegel, Rostkonstruktionen etc. Für solche Techniken liegen aber keinerlei Hinweise aus dem Kastell vor, so dass von einem Fehlen solcher oder ähnlicher Verbindun-gen auszugehen ist. Möglicherweise können die Maße der verstärkenden Querhölzer einen Anhaltspunkt für realistische Werte bieten. Diese waren in der Re-gel 4–4,5 m lang (vgl. Sprockhoff 1955, 58, der eine maximale Länge von 4,5 m angibt.). Da es sich da-bei offenbar auch um qualitativ minderwertiges Holz handelte (siehe oben), kann davon ausgegangen wer-den, dass sie den Ansprüchen für die Pfosten der Wall-front und der Mittelreihe nicht genügten, sie waren also nicht gerade genug, zu kurz und/oder zu dünn. Wir können demnach annehmen, dass Hölzer mit ei-ner Mindestlänge von 5 m für eine Verwendung als senkrechte Pfosten geeignet gewesen sein müssen. An-derenfalls wären auch längere Hölzer als Querhölzer im Wallkörper zu erwarten. Abzüglich der Tiefe der Pfostengruben (0,7–0,8 m) ergibt sich daraus nun eine Höhe des Wallkörpers von etwas über 4 m. In dieser Höhe hat sich dann wohl der 2,5–3 m breite Wehrgang befunden, der auf die senkrechten Front- und Mittel-pfosten gegründet war. Nach außen war der Wehr-gang sicher geschützt, denkbar wäre beispielsweise ein einfacher oder doppelter Flechtwerkzaun. Nun hatte die Befestigung aber wahrscheinlich nicht auf
der gesamten Breite eine Höhe von 4 m. Nach innen dürfte die Befestigung abgestuft gewesen sein. Dafür spricht zum einen das Wallprofil des Westwalles (vgl. Abb. 9), zum anderen aber auch die im Vergleich zur Wallaußenfront geringere Pfostenstärke der den Wall nach innen abschließenden Wand, die eine Höhe von ca. 2 m wohl nicht überschritten hat. Auf diese Weise ergibt sich der Rekonstruktionsversuch des Aufbaus der karolingischen Befestigung, wie er in Abbildung 17 sehr schematisch wiedergegeben ist. Eine derartige Konstruktion weist hinreichende Stabilität bei verhält-nismäßig ökonomischer Verwendung des Baustoffes Holz auf. Dennoch wurden für den Bau der gesamten Wallanlage schätzungsweise 2500 m3 Holz (ohne Auf-bauten auf der Wallkrone und ohne Innenbebauung) und ca. 5700 m3 Erde (Sand oder Lehm) benötigt. Die verfügbaren Holzressourcen dürften nach dem Bau des Kastells einen ziemlichen Einschnitt erfahren haben. Anhand der vorgeschlagenen Rekonstruktion ist es möglich, die Größenordnung des für den Bau notwen-digen Holzeinschlages wenigstens näherungsweise zu ermitteln. Selbstverständlich kann es sich nur um eine Hochrechnung handeln, die von bestimmten Werten ausgeht, die zunächst kurz erläutert werden sollen. Die Holzartanalysen von insgesamt 125 Holzkohlestücken aus dem Westwall ergaben das folgende Spektrum: 55 % Eiche, 33 % Ulme, 7 % Erle und 5 % Birke.7 Es scheint geradezu charakteristisch für Holz-Erde-Be-festigungen im sächsischen Siedlungsgebiet zu sein, dass neben Eiche in großem Stil auch andere Holzarten – insbesondere Weichhölzer wie Erle und Ulme – ver-baut wurden; im Unterschied zu den slawischen Nach-bargebieten, wo fast ausschließlich Eiche Verwendung fand. Im Moment ist die Datenbasis insgesamt aller-dings noch zu gering, um dies verlässlich beurteilen zu können. Der recht hohe Anteil der eigentlich für den Bau nicht gut geeigneter Weichhölzer Ulme, Erle und Birke muss etwas relativiert werden, das Mengen-verhältnis sollte nicht ohne weiteres auf die gesamte Befestigung übertragen werden. Die beprobten Höl-zer stammen sämtlich von den Querhölzern aus dem Wallkörper, einzige Ausnahme ist ein senkrechter ver-kohlt erhaltener Mittelpfosten (siehe oben). Dieser war aus Eiche. Es ist anzunehmen, dass alle senkrechten Pfosten und wichtigeren Bauelemente aus Eichenholz waren, ebenso wie offensichtlich der Großteil des ins-gesamt verbauten Holzes. Dennoch fällt die Verwen-dung von schlechtem Bauholz in ungewöhnlich hohem Maße für die Ergänzung der Wallversteifung auf. Das mag damit zusammenhängen, dass der Höhbeck mög-licherweise auch damals schon überwiegend kahl war und die Ressource Holz entsprechend knapp gewesen sein könnte. Hinzu kommt, dass in der Niederung bei Meetschow, in nur 3 km Entfernung, etwa gleichzeitig ebenfalls eine sehr große Befestigung errichtet wurde. Auch dafür sind große Mengen Holz benötigt worden.
7 Die Holzartenbestimmung wurde von Oliver Nelle, Universität Kiel, durchgeführt.
101
Abb. 16 Plan der Nordwestecke des Höhbeck-Kastells (vgl. Abb. 3) mit den Grabungsschnitten, wichtigen Befunden und Rekonst ruktion von Wall- und Grabenverlauf. Die Lage der Profile ist eingetragen (vgl. Abb. 9, 15, 19). Erläuterungen im Text.
(Grafik: P. Fleischer).
Das Gleiche gilt natürlich auch für die noch nähere Schwedenschanze.
Für die näherungsweise Berechnung des für den Bau notwendigen Holzeinschlages wird davon ausgegan-gen, dass überwiegend Eiche verwendet wurde. Dabei wird von Eiche in Eichenreinbeständen ausgegangen, mit einer Höhenbonität der 2. Ertragsklasse nach den Ertragstafeln von JüttnEr (1955) und bauEr (1953). Ulme und Erle bilden keine flächigen Bestände und sind sicherlich in der Umgebung des Talmühlenbaches und in Elbufernähe geschlagen worden. Eine weitere grundlegende Prämisse ist die Annahme, dass die Ei-chenbestände voll bestockt waren. Da es mit Ausnah-me von Meetschow kaum eine frühere Besiedlung in
größerem Stile hier gegeben hat, dürfte vor dem Bau des Kastells auch keine nennenswerte Holznutzung in den Beständen stattgefunden haben und diese Annah-me also relativ realistisch sein. Die Durchmesser der für die Errichtung des Kastells verwendeten Stämme lagen bei etwa 20–30 cm, demnach wird das Alter der Holzbestände im Durchschnitt 130 Jahre betragen ha-ben. Unter den genannten Bedingungen stehen pro ha Waldfläche ca. 350 fm Eichenderbholz (oberirdische Holzmasse von mehr als 7 cm Durchmesser) zur Ver-fügung. In den damaligen ungepflegten Waldbestän-den kann von ca. 50 % Stammholzanteil ausgegangen werden. Um bei diesen Bedingungen die 2500 m3 Ei-chenbauholz zu gewinnen, die im Wall verbaut wur-den, musste eine Fläche von ca. 14 ha Wald komplett
102
abgeholzt werden.8 Spätestens nach dem Bau des Kas-tells dürfte der Höhbeck demnach weitgehend frei von geschlossenen Waldflächen gewesen sein.
Ein Bauwerk von der Größe des Kastells (170 x 70 m) muss auf die Zeitgenossen einen außerordentlichen Eindruck ausgeübt haben. Das Land war weithin flach und eben. Die Bauten beschränkten sich im Wesentli-chen auf die Pfosten- oder Grubenhäuser in den Sied-lungen. Näherte man sich nun der Befestigung auf dem Höhbeck, so trat einem eine riesige Anlage entgegen. Zur eigentlichen Wallhöhe addierte sich vom Stand-punkt des Betrachters aus noch der schützende Zaun des Wehrganges, für den eine Manneshöhe angenom-men werden darf, und auch noch der bis zu 3 m tiefe Graben um die gesamte Befestigung. Man stand also einer Wand von 8–9 m gegenüber, und das auf einer Länge von bis zu 170 m! Das dürfte auch aus größerer Entfernung, nämlich über den Fluss, noch großen Ein-druck gemacht und auf diese Weise Macht und Stärke demonstriert haben. Den Sachsen und den Slawen wa-ren derart monumentale Bauwerke als Manifestation der Herrschaft wohl bekannt. Ihre Errichtung erforder-te in erster Linie eine herrschaftliche Organisation und Planung, wie es sie damals vor allem im Fränkischen Reich gab. Nicht umsonst schickte Karl der Große als Antwort auf die Zerstörung des Kastells ein Heer an die Elbe. Dies sollte nämlich nicht nur den Übergriff vergelten, sondern auch das Kastell wieder aufbauen
8 Für die Berechnung danke ich herzlich Herrn Martin Bornmann, Witzenhausen.
(annalES a. 811). Auch im nordwestslawischen Sied-lungsgebiet war zu jener Zeit der Befestigungsbau in vergleichbaren Dimensionen verbreitet, denn bei den so genannten Burgen vom Feldberger Typ handelte es sich ebenfalls um regelrechte Großburgen (vgl. zusam-menfassend dazu brathEr 1998 und zuletzt biErMann 2011). Die nächste derartige slawische Anlage wurde – ebenfalls zu Beginn des 9. Jahrhunderts – auf der anderen Elbseite bei Lenzen-Neuehaus nur ein klei-nes Stück flussaufwärts errichtet (biErMann u.a. 2009, 39–40).
Tore
Es klang bereits an, dass hinsichtlich der Rekonst-ruktion des mittig gelegenen Tores im Südwall einige Ausführungen folgen müssen. Sprockhoff hatte sich seinerzeit intensiv mit den Grabungen und Deutungen Schuchhardts auseinandergesetzt, indem er sie vor Ort im Gelände überprüfte. Dabei stellte er fest, dass sich die von Schuchhardt und Koldewey gegebene Deutung zum Tor als nicht haltbar erwies (Sprockhoff 1955, bes. 53–62). Aufgrund seiner eigenen Ausgrabungen konnte er eine schlichte Toranlage von nur etwa 2,50 m Breite und mit „einwärtsbiegendem Zugang“ (Sprock-hoff 1955, 61) erschließen, wobei die rückwärtige Ge-staltung dieses Tores offen bleiben musste. Von dem ursprünglichen, 6 x 6 m großen Torhaus Schuchhardts waren vier Pfosten geblieben, die Sprockhoff nicht mit seiner Torrekonstruktion in Verbindung bringen konn-te. Er zog jedoch nicht Schuchhardts Rekonstruktion in
Abb. 17 Höhbeck-Kastell, Westwall. Schematische Rekonstruktion des Wallaufbaus auf der Grundlage des Südprofils (vgl. Abb. 9). Erläuterungen im Text. (Grafik: Verf.).
103
Zweifel, sondern deutete dessen weitaus größeres Tor als erweiterte und verstärkte jüngere Anlage, die nach der Zerstörung der Befestigung ausgeführt worden sei (Sprockhoff 1955, 61–62). Diese Zweiphasigkeit der Toranlage diente ihm und hernach auch weiterhin in der Literatur (z.B. hEinE 1990 und zuletzt SailE 2007, 90), als gefälliges Argument für die Verbindung der Vietzer Schanze mit der historischen Überlieferung aus den Annalen, nach denen das castellum hohbuoki bekanntlich nach der Zerstörung wieder hergerichtet worden sein soll. Bei den besagten vier Pfosten han-delte es sich zum einen um die schon erwähnten drei inneren Pfosten des mutmaßlichen Torhauses, die bes-ser als Teil der rückwärtigen Wallbegrenzung aufzu-fassen sind (siehe oben), und zum anderen um den äu-ßersten Pfosten der Mittelreihe von Schuchhardts Tor (vgl. Sprockhoff 1955 Beilage 1,2 und Abb. 18b: T2e), der nun mittig vor der als älter postulierten Toranlage Sprockhoffs lag (vgl. Abb. 18b). Wichtiges Argument für die Erneuerung nach der Brandzerstörung bildete für Sprockhoff die Verfüllung dieser Pfostengrube, die im Gegensatz zu den übrigen sehr viel Holzkoh-le enthielt (Sprockhoff 1955, 62). Der Umstand, dass sich die zweite Phase des Tores auf schwache Argu-mente stützte, war Sprockhoff durchaus bewusst und wurde es zunehmend, nachdem sich für eine Repara-tur oder Zweiphasigkeit nirgends sonst Anhaltspunkte finden ließen. So schrieb er 1958: „[…] die Nachricht von dem Wiederaufbau durch Karl den Großen läßt sich bisher an keiner Stelle des Walles belegen. Allein das Tor zeigt einen Umbau nach dem Brand; oder war die Instandsetzung nur behelfsmäßig?“ (Sprockhoff 1958b, 530). Auch die Ergebnisse der jüngsten Unter-suchungen im Westwall erbrachten keinerlei Hinweise für eine Zweiphasigkeit oder Reparatur der Anlage. Sie konnten überdies zeigen, dass die Brandzerstörung des Kastells offensichtlich nicht die gesamte Anlage betraf, sondern manche Bereiche stärker in Mitleiden-schaft gezogen hatte als andere. Die heftigsten Brand-spuren sind entlang des Südwalles und in der Nord-westecke dokumentiert worden. Die Reparatur oder jüngere Bauphase des Südtores ist also letztlich auf nur eine Pfostengrube begründet, weil diese nicht zu dem von Sprockhoff erschlossenen Tor zu passen schien. In Planum und Profil ist deutlich zu erkennen, dass ein kleines Gräbchen von diesem Pfosten zu dem westlich nächstliegenden Frontpfosten zieht, der an dieser Stel-le zudem eine Erweiterung aufweist (T2e in Sprock-hoff 1955, 56 (Profil) und Beilage 2 (Planum)). Die Situation im Planum ist auch in Abbildung 18b wie-dergegeben (T2e). Es spricht einiges für die Interpre-tation als ein zusätzlicher Schutz – oder auch eine Art Tarnung – des eigentlichen, zurückgesetzten Tores, das in dieser Form ein primitives Zangentor bildet. Die-se Schutzwand könnte beispielsweise in einer Flecht-werkwand ausgeführt gewesen sein. Auf diese Weise war man frontal geschützt, wenn man aus dem Tor heraustrat. Die Abbildung 18a zeigt den Versuch einer Rekonstruktion dieses Befundes. Ob der Mittelpfosten
zusätzlich eine Tür trug, die die andere, östliche Seite verschließen konnte, muss offen bleiben. Ebenso offen bleiben muss die aufgehende Gestaltung des hier gele-genen Tores. Wahrscheinlich handelte es sich bei die-sem südlichen Tor nicht um ein repräsentatives Haupt-tor, sondern möglicherweise eher um ein Nebentor. Einen Torturm gab es gewiss nicht. Schon Sprockhoff (1955, 65) war aufgefallen, dass das Schuchhardtsche Tor „in der alten Literatur […] nirgends erwähnt“ wird, obwohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der südliche Wall und der Graben noch gut erkennbar ge-wesen sein müssen, wie aus einem Bericht hervorgeht (MüllEr 1870, 363. Vgl. dazu auch Sprockhoff 1955, 64–65). Andererseits hat es offenbar einen gut erkenn-baren Eingang an der Südostecke zur Talmühle hin ge-geben, der wohl erst mit der Einebnung des Südwalles zwischen 1870 und 1890 verschwand. Die späteren Grabungen Sprockhoffs an dieser Stelle haben hierzu jedoch keine klaren Erkenntnisse liefern können (Abb. 7, siehe unten). Auch von Westen ist mindestens ein Eingang in das Kastell wahrscheinlich. Schuchhardt und Koldewey verzeichnen in ihrem generalisierten Plan zwei schmale Durchlässe von jeweils etwa 1,5 m Breite durch den Westwall, die diesen in etwa drit-teln (vgl. SchuchharDt 1924, 61 Abb. 27; 1934, 327 Abb. 292. Sprockhoff 1958b, 519 Abb. 1). Ohne dass hier noch einmal gegraben worden wäre, erinnern sie in ihrer Dimension an das Tor im Südwall nach dem Sprockhoffschen Grabungsbefund (Abb. 18). Der süd-lichere dieser Durchlässe ist heute noch deutlich als Einschnitt im Westwall zu erkennen, allerdings ist die zugehörige Erdbrücke im vorgelagerten Graben nur noch sehr schwach ausgeprägt. In der feintopographi-schen Geländeaufnahme (hEinE 1990) sind die meisten dieser Sachverhalte gut zu erkennen, die genannte Erd-brücke ist dort allerdings kaum abgebildet, während sie sich im Gelände deutlich identifizieren lässt (vgl. auch Abb. 3). Eine besser erkennbare Erdbrücke ist vor dem nördlichen der beiden Durchlässe vorhanden, wobei hier jedoch der Durchlass durch den Wallkörper nicht (mehr) zu sehen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass durch Erdbewegungen im Laufe des letzten Jahr-hunderts (z.B. die Ausgrabungen Sprockhoffs) manche Spuren im Relief verwischt worden sind. Ein mögli-cherweise weiterer wichtiger Hinweis auf ein Tor im Westwall wird durch die feintopographische Aufnah-me der Umgebung des Kastells veranschaulicht (hEinE 1990), in dem erstmalig der exakte Verlauf des westlich dem Kastell vorgelagerten Vorwalls mit Graben darge-stellt ist (Abb. 3). Hierin äußert sich ein zusätzlicher Schutz der Westseite – und eines hier gelegenen Tores.
Bedenkt man, dass in der Karolingerzeit die nächsten Bezugspunkte des Kastells einerseits die Siedlung in der Niederung bei Meetschow, bei der es sich wahr-scheinlich um den karolingischen Grenzort Schezla handelte (SchnEEWEiSS 2010), und andererseits die Schwedenschanze waren, so wird deutlich, dass die der Hochfläche des Höhbecks zugewandte Südflanke
104
des Kastells strategisch sicherlich eine untergeordne-te Rolle spielte. Der Hauptweg führte wohl einerseits nach Westen zum Elbübergang bei der befestigten Siedlung Schezla und andererseits nach Osten zum Talmühlenbach und in Richtung der Schwedenschan-ze, die möglicherweise in jener Zeit eine Art Vorposten bildete und den dortigen Elbübergang ins nördliche Slawenland deckte. Insofern erscheinen ein westwärts und ein ostwärts gerichtetes Tor sinnvoll. Der Weg von Westen dürfte oberhalb des Vorwalles entlanggelaufen sein und damit direkt auf die erhaltene Erdbrücke zu, wo demnach auch ein Tor zu vermuten wäre. Die hier angesprochenen beiden Plätze, die Siedlung in der Niederung (Schezla) und die Schwedenschanze, sind
wahrscheinlich ein weiterer Schlüssel für die konkrete Lage des Kastells auf dem Höhbeck.9 Es verwundert zunächst ein wenig, weshalb das Kastell nicht dort liegt, wo die Schwedenschanze errichtet wurde, denn von dort ließ sich der Oberlauf der Elbe bis weit nach Osten einsehen und gleichzeitig der dort zu vermuten-de Elbübergang. Vom Standort des Kastells jedoch, der zudem etwa 15 Höhenmeter tiefer liegt als die Schwe-denschanze, bleibt der Oberlauf verborgen. Hier lie-gen eher der Unterlauf und das nördliche Elbufer im
9 Die Anregung zu den im Folgenden ausgeführten Gedanken ver-danke ich Herrn Stefan Reinsch, Pevestorf, dem an dieser Stelle dafür gedankt sei.
Abb. 18 Höhbeck-Kastell. Rekonstruktion des Tores in der Mitte des Südwalles auf der Grundlage der Grabungsergebnisse. a: Rekonstruktionsvorschlag anhand des Befundplanes; b: Befundplan von E. Sprockhoff 1954 und 1956; (Zeichnung: Verf.).
105
direkten Blickfeld. Sieht man jedoch die drei Punkte als eine funktionale Einheit, dann ergibt die Lage des Kastells an dieser Stelle durchaus einen Sinn. Durch die spezielle Topographie des Höhbecks, dessen west-liche Flanke sanft zur Niederung abfällt, war es bei un-bewaldeter Oberfläche höchstwahrscheinlich möglich, vom Kastell aus nicht nur den unmittelbaren Unterlauf der Elbe zu überblicken, sondern auch Blickkontakt zum in der Niederung gelegenen rückwärtigen Elb-übergang bei Meetschow (Schezla) zu haben.10 Ande-rerseits war auch nach Nordosten der Elbübergang am Fuße der Schwedenschanze einzusehen und der Blick-kontakt zur dort gelegenen hohen Befestigung darf ebenso vorausgesetzt werden. Insofern war es vom Kastell aus möglich, beide karolingischen „Brücken über die Elbe“, wie sie schon Schuchhardt aufgrund der besonderen Topographie am Höhbeck hier vermu-tete (SchuchharDt 1924, 58–59 und Abb. 24. Schuch-harDt 1934, 324–325 (mit Abb. 290)), zu kontrollieren und dabei gleichzeitig dem gegenüberliegenden Sla-wenland Macht und Herrschaft zu demonstrieren.
Aufgrund dieser Zusammenhänge wäre es zwar nicht zwingend, aber wenigstens nahe liegend, dass ein Weg von der Niederung zur Schwedenschanze nicht am Kastell vorbei, sondern durch das Kastell hindurch führen könnte. Wenigstens jedoch besteht ausreichend Begründung für die Annahme sowohl eines west-wärts als auch eines ostwärts gerichteten Tores. Wie bereits erwähnt, hatte Schuchhardt an der westlichen Schmalseite „2 kleine Tore von nur etwa 1 ½ m Weite“ ausmachen können, die er auch „Schlupftore“ nann-te (SchuchharDt 1934, 326), und deren Spuren heute noch teilweise in Form von Einschnitten im Westwall und vorgelagerten Erdbrücken zu erkennen sind (siehe oben). Wo genau und wie Schuchhardt hier gegraben
10 Es ist seit längerer Zeit geplant, mit Hilfe eines LIDAR-Scans ein digitales Geländemodell zu erzeugen, mit dem es u.a. möglich wäre, diese Annahmen durch Viewshed-Analysen zu überprüfen. Leider wurde dafür bislang keine Finanzierung gefunden.
hat, ist ungewiss. Der einzige Hinweis ist der Satz: „An den im Graben stehengebliebenen Erdbrücken, die ja zu Karls d. Gr. Zeit noch allgemein üblich sind […], erkannten wir dann an der westlichen Schmalseite des Kastells zwei kleine Tore, die sich bei der Grabung im Wall als nur 1 ½ m weit herausstellten.“ (SchuchharDt 1924, 61).
Sprockhoff hat an keinem der Tore gegraben, so dass über deren Alter und etwaige ursprüngliche Zuge-hörigkeit zur Anlage a priori nichts gesagt werden kann. Denkbar wären z.B. spätere Walldurchstiche. Auf die sinnvolle Wegeführung zur Stelle des nördli-chen Durchlasses ist bereits hingewiesen worden. Es gibt aber auch jenseits der Grabungen Schuchhardts archäologische Hinweise darauf, dass mindestens der nördliche Durchlass tatsächlich auf eine Toranlage zu-rückgeht. Als Sprockhoff 1964 den Westwall schnitt, legte er nicht nur das große Wallprofil an (Abb. 15), sondern untersuchte auch das Innere des Walles bis zu vier Meter südwärts vor seinem Profil. Wahrscheinlich galt sein Interesse dem Verlauf der äußeren Wallfront in Form von Frontpfosten, vielleicht aber auch dem fraglichen Tor. Er fand auf jeden Fall vier Frontpfosten, die geschlossen in einer Reihe standen, so wie auch sonst an der äußeren Wallfront. Bemerkenswert aber sind die beiden Profile, die die innerhalb des Walles gelegenen Grabungsgrenzen dokumentieren (vgl. Abb. 16, Profil 1 und 2). Vor allem das Westprofil, das pa-rallel zur Wallfront etwa in Höhe der Bermensektion verläuft, zeigt Überraschendes (Abb. 19). Hier ist deut-lich zu erkennen, dass der abgebrannte und zerstörte Wall an dieser Stelle zu Ende war. Die Brandschichten laufen nach Süden aus, nichts deutet darauf hin, dass der Wall hier zu einem späteren Zeitpunkt abgegraben worden wäre. Die Brandschichten des Walles sind be-deckt von gelblich-braunem Sand, der keinerlei Brand-spuren zeigt. Wann sich diese jüngere Schicht bildete, ist aufgrund der Profilzeichnung nicht sicher zu sagen. Es kann aber vermutet werden, dass möglicherweise
Abb. 19 Höhbeck-Kastell, Westwall. Profile 1 (West) und 2 (Süd) im Wallschnitt von E. Sprockhoff 1964. Zur genauen Lage vgl. Abbildung 16. (Grafik: P. Fleischer).
106
im Zusammenhang mit den nicht lokalisierten Grabun-gen Schuchhardts 1920 an diesen Toren der nördliche der beiden Durchlässe verfüllt wurde. Wie aus einem Briefwechsel zwischen Schuchhardt und dem dama-ligen Grundeigentümer Julius Siems aus Hamburg hervorgeht, lag der Wallschnitt noch bis zum Sommer 1921 offen und ist dann von dem Arbeiter Karl Hasse aus Vietze an sechs Tagen zugeschaufelt worden. Siems schreibt am 27.8.1921: „Ich habe jetzt die Steine nach der vorjährigen Grabung auf dem Höhbeck entfernen, sowie den Wall zuwerfen lassen.“ Und später:„Es be-darf gar keiner Frage, daß der Arbeiter Hasse das große Wallloch [sic!] sehr billig zugeschaufelt hat.“ Auf der Quittung von Hasse vom 24.8.1921 steht: „gearbeitet. Steine gekarrt und Erde eben geschippt.“ (SMB-PK/MVF, Archiv, E 1921/00593 – IA6/035 - E 925/21). Es ist jedenfalls offensichtlich, dass der Abschnitt südlich dieses Durchlasses nicht abgebrannt war, während der nördliche augenscheinlich eine Brandkatastrophe er-litt. Dies wird auch durch das vollständig unverbrannt aufgedeckte Wallprofil von 2008 bestätigt. Obwohl die Hinweise, die sich aus Profil 1 (Abb. 16) ergeben, recht dürftig sind, kann es doch als wahrscheinlich an-gesehen werden, dass sich an dieser Stelle im West-wall tatsächlich ein westwärts gerichtetes Tor befun-den hat. Über Form und genauere Gestaltung kann bei heutigem Kenntnisstand nur wenig ausgesagt werden, dazu wären weitere Ausgrabungen notwendig. Der eigentliche Torbereich ist sowohl durch die Grabun-gen Sprockhoffs als auch durch unsere Ausgrabungen nicht tangiert worden, erstere vermögen aber durch das dokumentierte Profil immerhin einen Hinweis aus dem Randbereich des Tores zu geben. Im zugehörigen Planum wurden von Sprockhoff leider nur die Pfosten-gruben und die Findlinge vermerkt, nicht jedoch die Schichtgrenze der Brandspuren. In Analogie zu dem nördlichen Durchlass könnte nun auch auf den süd-lichen Durchlass als Toranlage geschlossen werden, allerdings wäre das eine recht ungewöhnliche Anord-nung von zwei Toren. Es sind jedoch aus dem frühen 9. Jahrhundert viel zu wenige Befestigungen bekannt, als dass etwas ausgeschlossen werden könnte.
In der Südostecke sieht die Situation etwas anders aus (Abb. 7). Hier wurde eine weitgehend geschlossene Wallfrontpfostenreihe dokumentiert, die auf den ersten Blick ein Tor an dieser Stelle unwahrscheinlich macht. Beim genaueren Hinsehen wird jedoch deutlich, dass die Pfostenreihe an zwei Stellen gar nicht so geschlos-sen ist, wie es zunächst schien. Zwischen den beiden Schnitten, in denen die Frontpfostengruben ausgegra-ben wurden, liegt erstens eine Lücke zwischen den großen Pfosten, die mit etwa 3 m ein ähnliches Maß aufweist, wie das Mitteltor im Südwall (Abb. 7, G). An einer weiteren Stelle in der Wallaußenfront, und zwar genau in der Ecke, liegt zweitens eine flache Verfär-bung, deren Ansprache als Frontpfosten ungesichert bleiben muss (Abb. 7, H). Sie reiht sich zwar gut in die Wallfront ein und schließt die Ecke, sie ist mit einer
Tiefe von ca. 20 cm aber deutlich flacher als die üb-rigen Pfostengruben. Der westlich benachbarte Pfos-ten ist sogar mit 40 cm noch weniger eingetieft als alle übrigen, die in der Regel zwischen 60 und 90 cm tief sind. Sollte diese Verfärbung keine massive Pfosten-stellung markieren, dann ergäbe sich hier eine weite-re Möglichkeit für ein Tor. Die Lücke zwischen den beiden angrenzenden Pfosten wäre an dieser Stelle etwa zwei Meter. Die Wallinnenfront, soweit sie in der Südostecke dokumentiert wurde, zeigt ungefähr ge-genüber der ersten Tormöglichkeit (G) einen Einzug, der hier mit einem Tor korrespondieren könnte. An der zweiten Stelle (H) bieten sich zu wenige Anhaltspunk-te, um den Verlauf der Wallinnenfront verlässlich zu rekonstruieren. Hier ist auch ein anderer Verlauf als der gezeigte denkbar, so dass ein Tor in dieser Position nicht ausgeschlossen werden kann. Der Bericht, dass ein „sehr bemerkbarer Eingang an der Ostseite“ (Mül-lEr 1870, 363) zu sehen sei, der noch in den 1950er Jahren in der Erinnerung der ansässigen Bevölkerung fortlebte (Sprockhoff 1955, 64–65), spricht sehr dafür, an dieser Stelle einen Eingang lokalisieren zu wollen, denn die gesamte übrige Ostseite liegt am sicher auch damals schon existenten Steilhang und damit in einer ausgesprochen ungünstigen Position für ein Tor. Noch vor seinen Grabungen am Südtor schrieb Schuchhardt: „Der Eingang muss in der Südseite oder vielleicht in der Südostecke gelegen haben; bei letzterer deutet der noch schwach erkennbare lünettenartige Vorbau des Terrains darauf.“ (atlaS 52, 223.) Allerdings kann gleichfalls nicht ausgeschlossen werden, dass hier erst in nachfolgenden Zeiten ein Zugang geschaffen wur-de, der dann wiederum gegen Ende des 19. Jahrhun-derts verschwand. Für diese These lassen sich in den archäologischen Funden und Befunden Hinweise fin-den, denn ausgerechnet in der Südostecke traten in grö-ßerer Zahl Funde des Spätmittelalters aus dem 12./13. Jahrhundert auf (siehe oben, vgl. z.B. Abb. 5/10–12), die eine Nachnutzung der Anlage belegen. Die grö-ßere, stark mit Holzkohle durchsetzte Brand- bzw. Kulturschicht (Abb. 7, B) könnte die Überreste eines abgebrannten Gebäudes jener Zeit darstellen, ebenso gehört die Herdstelle (Abb. 7, A) in diesen Zusammen-hang. Eine Nutzung im Spätmittelalter hätte vermut-lich einen noch erkennbaren Durchgang genutzt, so dass sie nicht als Argument gegen ein karolingisches Tor an dieser Stelle taugt. Immerhin handelt es sich bei der Südostecke um die Stelle der Befestigung, die dem Talmühlenbach am nächsten ist. Es bleibt nur zu konstatieren, dass einiges dafür spricht, aber letztlich die Frage nach einem Tor an der Ostseite bzw. in der Südostecke gegenwärtig ungeklärt bleiben muss.
Villa Hobeke
Nur am Rande sei ein weiterer Aspekt erwähnt, der in diesen Zusammenhang gehört. Die spätmittelalterli-chen Befunde in der Südostecke der Befestigung und
107
besonders der Brakteatenfund des frühen 13. Jahr-hunderts lassen daran denken, dass im Lehnbuch des Herzogs Otto von Braunschweig für das Jahr 1318 eine villa hobeke erwähnt wird: „Hennigh et fred. de gartowe milites et fratrueles eorum villam hobeke cum omni jure.“ (Zit. nach puDElko 1963, 238.) Ihre Lokalisierung ist bislang noch nicht überzeugend ge-lungen. Im frühen 19. Jahrhundert ist zu lesen: „Die frühern (und ältesten bekannten) Besitzer von Gartow und des Hohbecks, die Herren von der Gartowe, (deren Geschlecht in der Mitte des 17ten Saeculi erloschen ist) hatten einen Hof auf oder an diesem Berge (vil-la Hohbeke), dessen Lage nicht hinreichend genau bekannt ist, um erweisen zu können, daß er an der vorbezeichneten Stelle (des alten Castelli) gestanden. (Wenn gleich solches nach einigen Angaben in alten Urkunden wohl anzunehmen sein dürfte.)“ (SpangEn-bErg 1828, 199–200). Leider sind mir die alten Urkun-den, auf die sich Spangenberg bezieht, nicht bekannt, aber der Gedanke, dass sich die villa hobeke an der Stelle des ehemaligen Kastells befunden hat, gewinnt im Lichte der erwähnten Funde ein neues Gewicht. Wolf (1963, 190–191) möchte in der Formulierung villa hobeke eine Art Oberbegriff für die Dörfer auf dem Höhbeck sehen, insbesondere für Redekestorp (Restorf). Restorf liegt allerdings unterhalb des Höh-becks, an seinem Fuße, weshalb es dieser Interpreta-tion aus meiner Sicht an Überzeugungskraft mangelt. Pudelko zieht eine Lokalisierung am westlichen Rande des Höhbecks, bei der Vietzer Kapelle, in Erwägung (puDElko 1963). Die Kapelle, das älteste bekannte Steingebäude am Höhbeck, war früher umwallt und es sind aus seiner Umgebung zahlreiche mittelalterliche Funde und Befunde bekannt geworden, zuletzt nur we-nige hundert Meter entfernt ein Münzschatz des 12. Jahrhunderts (SchnEEWEiSS 2009; 2011a, 82–85). Nun sprechen aber nicht nur die archäologischen Indizien für eine Lokalisierung auf dem Kastellplatz (bzw. in seinem südöstlichen Bereich), sondern auch die Nähe zum Talmühlenbach. Aus dieser Position erklärt sich in ganz natürlicher und viel naheliegenderer Weise die Bezeichnung hobeke – „hochgelegener Bach“ – für die villa als an der Kapelle, wo der Landschaftsname he-rangezogen werden müsste. Es ist m.E. wahrscheinli-cher, dass die archäologischen Siedlungsnachweise in der weiteren Umgebung der Vietzer Kapelle mit dem wüst gefallenen „Lütteken Vitze“ zu verbinden sind,
dass im Jahre 1360 erwähnt wird (vgl. auch SchnEE-WEiSS 2011a, 83).
Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Vorgänge um die Wende vom 8. zum 9. Jahrhun-dert, als nach dem Ende der Sachsenkriege die Ost-grenze des Fränkischen Reiches an der Elbe eine Kon-solidierung erfuhr, sind für die Höhbeckregion von besonderer Bedeutung. Die wichtigsten Schriftquellen für diese Zeit sind die Fränkischen Annalen. Sie berich-
ten über mehrere Ereignisse, die mit der Elbe in Zu-sammenhang stehen. Im Jahre 789 zog Karl der Große über die Elbe gegen die Wilzen, wobei möglicherweise bereits fränkische Befestigungen im Höhbeckgebiet angelegt wurden (SchuchharDt 1924, 57–58. langEn 1989, 206–207. SailE 2007b, 91). Für das Jahr 808 wird von der Errichtung zweier namentlich nicht ge-nannter Befestigungen an der Elbe berichtet. Es liegt nahe einen Zusammenhang mit dem Feldzug Karls des Jüngeren gegen die Linonen und Smeldinger zu ver-muten, der ebenfalls am Höhbeck die Elbe überschrit-ten haben könnte. Zwei Jahre später wird dann erstmals das castellum hohbuoki erwähnt, als es von den Wilzen zerstört wird, im Folgejahr 811 dann zum zweiten und letzten Mal, als es wieder hergerichtet wird. Im Kastell lag eine ostsächsische Besatzung unter dem kaiserli-chen Legaten Odo. Es muss im Umfeld ein gewisses sächsisches Hinterland gegeben haben. Meetschow (Schezla), das Kastell und die Schwedenschanze ha-ben wahrscheinlich eine funktionale Einheit als säch-sisch-fränkischer Vorposten an der Elbe gebildet, denn ansonsten sind die Spuren sächsischer Besiedlung am Höhbeck gering. Aus dieser Schilderung wird deutlich, welche zentrale Rolle das Kastell in diesem Zusam-menhang gespielt hat, wenngleich offensichtlich nur für wenige Jahre, denn das Höhbeck-Kastell wird nach 811 nie wieder genannt. Auch Schezla wird nach sei-ner einzigen Erwähnung im Diedenhofener Kapitular von 805 nicht mehr erwähnt. Nach dem Tode Karls des Großen im Jahre 814 schweigen die Schriftquellen bis zum 10. Jahrhundert generell über die Region an der Mittelelbe. Der Einfluss der Zentralmacht ging in dieser Zeit stark zurück, die Vorgänge an der Periphe-rie lassen sich aus den Quellen nicht erschließen. Das Gebiet um den Höhbeck wurde offenbar noch vor der Mitte des 9. Jahrhunderts von den Sachsen verlassen und von Slawen besiedelt, ohne dass sich dieser Pro-zess in der schriftlichen Überlieferung niederschlug. Zur Erhellung dieser Vorgänge tragen wesentlich die Ergebnisse der archäologischen Forschungen der letz-ten Jahre am Höhbeck bei (vgl. zusammenfassend SchnEEWEiSS 2011a. Willroth 2011). Erst mit der ottonischen Expansionspolitik im 10. Jahrhundert er-scheint dieser Raum im Zusammenhang mit den Sla-wen erneut in den Quellen, als Heinrich I. im Jahre 929 die Linonen in einer Schlacht an der Elbe unterwarf, der so genannten Schlacht bei Lenzen (SchnEEWEiSS, kEnnEckE in Vorb.).
Durch die wiederholten archäologischen Untersu-chungen des Kastells konnten bis heute viele Details ans Licht gebracht werden. Aber, nachdem die erste Grundfrage Sprockhoffs, ob es sich hier um Karls Kas-tell Hohbuoki handelte (siehe oben), beantwortet ist, bleibt seine zweite Grundfrage, „wie die innere bauli-che Beschaffenheit eines solchen karolingischen Kas-tells aussieht“ (Sprockhoff 1955, 67), nach wie vor un-beantwortet. Für die Klärung dieser Frage wären neue Ausgrabungen unerlässlich. Doch es treten auch neue
108
Fragen auf den Plan. Warum lassen sich keine Spuren für einen Wiederaufbau der so offensichtlich zerstör-ten Befestigung finden? Auch das Tor im Südwall kann nicht mehr als zweiphasig angesehen werden. Wie lässt sich das dendrochronologische Datum für den Bau – frühestens 810 – sinnvoll mit den Schrift-quellen verbinden, nach denen das Kastell im Sommer 810 schon zerstört worden sein soll? War es wirklich so, dass der Angriff sofort nach Fertigstellung oder so-gar noch während des Baus erfolgte? (so SchnEEWEiSS 2011b, 377). Vielleicht ist diese Erklärung zu einfach und die historische Realität komplexer, als es uns die dürftigen Schriftquellen vermitteln? Vielleicht war es doch ganz anders? Könnte es nicht sein, dass wir es mit zwei Anlagen zu tun haben, die wir beispielsweise in der Schwedenschanze und dem Kastell sehen könn-ten? Die erste Anlage ist die ältere, sie wird spätestens 808 errichtet, vielleicht sogar noch eher, und im Jahre 810 zerstört. Wer sie errichtet hat, ist unbekannt. Es ist nur überliefert, dass Karl der Große 808 zwei Kastelle bauen ließ, nicht aber von wem. Man könnte sogar so-weit gehen und – analog zu Schuchhardts Interpretati-on der beiden Elbbrücken des Jahres 789 (siehe oben) – die beiden Kastelle von 808 in Meetschow (Schezla) und der Schwedenschanze (Hohbuoki) suchen, denn die ältere Siedlung in Meetschow wird – aus archäo-logischer Sicht – ungefähr um 800 befestigt. Auch die Schwedenschanze kann in dem Zeitraum um 800 er-richtet worden sein. Das an einer Holzkohle gewonne-ne einzige dendrochronologische Datum gibt lediglich einen terminus post quem von 730 an, so dass die Si-tuation hier weniger eindeutig ist.11 811, im Jahr nach der Zerstörung von Hohbuoki aber entsendet Karl der Große ein Heer, um das Kastell wieder zu errichten. Vielleicht sollte darüber nachgedacht werden, ob die-ses Heer nicht (nur) eine alte Anlage repariert, sondern möglicherweise sogar eine neue gebaut hat, nämlich in einer strategisch besseren Position, von der aus bei-de Elbübergänge zu überwachen waren und die funk-tionale Einheit Schezla – Kastell – Schwedenschanze besser funktionieren konnte? Das zu diesem Zwecke entsendete Heer könnte eine Erklärung für den in der Elbregion so ungewöhnlich anmutenden Grundriss bieten. Die dendrochronologischen Daten passen viel besser zu 811. Und unter Umständen ergäbe sogar das Fragment der Kopfbohle – die Spolie – auf diese Weise einen besonderen Sinn.
Letztlich existieren keinerlei Anhaltspunkte dafür, wann das Schadensfeuer das Kastell ergriffen hat. Deutlich erkennbar ist nur das Ergebnis: der vielerorts verbrannte Wall, dessen Zerstörung offenbar so umfas-send war, dass die Befestigung nicht repariert wurde. Die Sachsen verließen diese Gegend irgendwann nach
11 Messung und Datierung durch K.-U. Heußner, DAI Berlin. La-bornummer C 52076 (Eiche); Fälljahr um/nach 730. Für die Be-wertung des Datums sei noch einmal ausdrücklich auf die weite Spanne der Ergebnisse der Datierungen am Kastell verwiesen, siehe oben.
dem Tod Karls des Großen und sicher vor 850, also wahrscheinlich zwischen 814 und ca. 840. Danach besiedelten Slawen auch die linkselbischen Gebiete. Es ist nahe liegend, dass die massiven Konfrontatio-nen und Machtdemonstrationen des Jahrzehnts nach dem Ende der Sachsenkriege im sächsisch-fränkisch-dänisch-slawischen Raum auf allen Seiten nicht so schnell in Vergessenheit gerieten, zumal sie sich auch nach dem Tode Karls noch fortsetzten. Eine friedli-che Abwanderung der Sachsen ist daher wenig wahr-scheinlich. Die finale Brandzerstörung des castellum Hohbuoki, die den Abzug von Sachsen und Franken nach sich zog, kann eigentlich nur in dem genannten Zeitraum stattgefunden haben, wohl in den 820er oder 830er Jahren. Dabei muss es keine Verwunderung aus-lösen, dass über diese Niederlage nicht berichtet wird. Im Fränkischen Reich standen damals andere Themen auf der Tagesordnung. Nicht nur die inneren Macht-streitigkeiten erschütterten das Reich, sondern in eben jener Zeit begannen auch die Wikingereinfälle. Im Jahre 817 wurde beispielsweise das fränkische Kastell Esesfelth nahe der Elbmündung von Wikingern und Slawen gemeinsam angegriffen – und gehalten (anna-lES a. 817). Diese Nachricht erreichte immerhin noch die Fränkischen Annalen. Über das castellum hohbuo-ki erfahren wir nichts mehr.
Diese letzten Überlegungen zeigen, dass wir noch weit davon entfernt sind, zu wissen, was damals wirklich geschah. Aber Stück für Stück gelingt es, etwas mehr Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen. Die Su-che nach Beweisen für das castellum hohbuoki Karls des Großen auf dem Höhbeck darf als beendet gelten. Nun kann sich die Forschung neuen Fragen öffnen. Der Höhbeck hat eine besondere Geschichte, in der ein Plan Karls des Großen noch in den Anfängen schei-terte (SchnEEWEiSS im Druck). Zahlreiche Aspekte sind es, die dazu führten, dass Schezla-Hohbuoki nicht die gleiche Entwicklung nahm wie zum Beispiel Mag-deburg. Für die Archäologie bietet das die einmalige Chance, einen solchen Platz in seiner ursprünglichsten Form vorzufinden, noch lange bevor unter anderem die tief greifenden Neuerungen der ottonischen Zeit Einzug halten konnten. Die dadurch gegebene Mög-lichkeit, die Anfänge zu untersuchen, ist von ganz be-sonderem Wert, denn gerade diese bleiben uns häufig hinter späteren Entwicklungen verborgen.
Nach den letzten Grabungen 1965 und dem bald darauf folgenden Tod Sprockhoffs 1967 richtete sich das Au-genmerk der archäologischen Forschungen zum Früh-mittelalter mehr auf die Region um Hitzacker und den dort gelegenen Weinberg (zusammenfassend WachtEr 1998), in dem Sprockhoff ebenfalls Sondagen durch-geführt hatte (Sprockhoff 1966). Der Kastellplatz wurde zum Sport- und Zeltplatz für Kinder und Ju-gendliche des Hamburg-Horner Turnvereins, bis er ab den 1980er Jahren langsam verwilderte und zuwuchs. Seit den jüngsten Ausgrabungen und deren Ergebnis-
109
sen hat eine neue Wertschätzung dieses Bodendenk-mals eingesetzt, das eine Bedeutung von europäischem Rang besitzt. Es wurde begonnen, den Wildwuchs zu-rück zu schneiden und den Platz wieder in voller Grö-ße zur Geltung kommen zu lassen. Am Steilhang zur Elbe ist eine neue Schutzhütte mit Aussichtsplattform installiert worden, die in ihrer Gestaltung dezent an das karolingische Erbe erinnert. Es bleibt zu hoffen, dass das Höhbeck-Kastell nicht so bald wieder in ei-nen Dornröschenschlaf versinkt, sondern das wissen-schaftliche und öffentliche Interesse daran möglichst lange wach bleibt.
litEratur:
atlaS: Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Nie-dersachsen. Bearbeitet von A. von Oppermann und C. Schuchhardt. Hannover 1888–1916.
bauEr, f. 1953: Die Roteiche. Frankfurt/Main 1953.biErMann, f. 2011: Functions of the Large Feldberg Type
Strongholds from the 8th/9th Century in Mecklenburg and Pomerania. Sprawozdania Archeologiczne 63, 2011, 149–173.
biErMann, f., goSSlEr, n., kEnnEckE, h. 2009: Archäolo-gische Forschungen zu den slawenzeitlichen Burgen und Siedlungen in der nordwestlichen Prignitz. In: J. Müller, K. Neitmann, F. Schopper (Hrsg.), Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg. Wünsdorf 2009, 36–47.
brathEr, S. 1998: Karolingerzeitlicher Befestigungsbau im wilzisch-abodritischen Raum. Die sogenannten Feldber-ger Höhenburgen. In: J. Henning, A.T. Ruttkay (Hrsg.), Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Bonn 1998, 115–126.
DEbuS, f. 1993: Zu den deutschen Ortsnamen des Wendlan-des. In: F. Debus (Hrsg.), Deutsch-slawischer Sprachkon-takt im Lichte der Ortsnamen. Mit besonderer Berück-sichtigung des Wendlandes. Kieler Beiträge zur deutschen Sprachgeschichte 15. Neumünster 1993, 47–60.
harck, o. 1972: Nordostniedersachsen vom Beginn der jün-geren Bronzezeit bis zum frühen Mittelalter. Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens 7. Hildesheim 1972.
harck, o. 1986: Das letzte vorchristliche Jahrtausend. In: Hannoversches Wendland. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 13. Stuttgart 1986, 86–98.
hEinEMann, b., linkE, f.-a., pEtErS, h.-g. 1976: Untersu-chungen der frühgeschichtlichen Lüningsburg bei Neu-stadt am Rübenberge, Ldkr. Hannover. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 45, 1976, 155–176.
hEinE, h.-W. 1990: Burg Karls des Großen an der Elbe – Zur Neuvermessung des Höhbeck-Kastells. Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen 10, 1990, 33.
hEinE, h.-W., StEinau, n. 1985: Die Lüningsburg bei Neu-stadt am Rübenberge. Hannover 1985.
JüttnEr, o. 1955: Ertragstafel, Eiche mäßige Durchfors-tung. In: R. Schober, Ertragstafeln wichtiger Baumarten. 3Frankfurt/Main 1987.
knorr, h.a. 1938: Die slawischen Messerscheidenbeschlä-ge, Mannus 30, 1938, 479–545.
langE, h. 1926: Der Angrivarisch-Cheruskische Grenzwall und die beiden Schlachten des Jahres 16 nach Chr. zwi-schen Arminius und Germanicus. Die Kleinfunde von Leese. Prähistorische Zeitschrift 17, 1926, 107–115.
langEn, r. 1989: Die Bedeutung von Befestigungen in den
Sachsenkriegen Karls des Großen. Westfälische Zeit-schrift 139, 1989, 181–211.
lüth, f., MESSal, S. 2008: Slawen an der unteren Mittelelbe. Archäologie in Deutschland 4/2008, 6–11.
MüllEr, J.h. 1870: Bericht über Alterthümer im Hannover-schen. Alte Umwallungen und Schanzen. Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen, 1870, 345–435.
nüSSE, h.-J. 2008: Untersuchungen zur Besiedlung des Han-noverschen Wendlands von der jüngeren vorrömischen Ei-sen- bis zur Völkerwanderungszeit. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 26, 2008, 9–386.
puDElko, a. 1963: Die Kapelle bei Vietze, Kreis Lüchow-Dannenberg. (Ein Beitrag zur Lokalisierung von „villa hobeke“). Die Kunde N.F. 14, 1963, 236–239.
SailE, t. 2000: Höhbeck. In: J. Hoops (Hrsg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 15. ²Berlin, New York 2000, 37–39.
SailE, t. 2007a: Slawen in Niedersachsen. Zur westlichen Peripherie der slawischen Ökumene vom 6. bis 12. Jahr-hundert. Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 30. Neumünster 2007.
SailE, t. 2007b: Franken in den Elblanden. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 76, 2007, 87–100.
SchnEEWEiSS, J. 2007: Teilprojekt 3: Slawische Burgen und ihr ländliches Umfeld im nordöstlichen Niedersachsen. Archäologisches Nachrichtenblatt 12, 2007, 288–292.
SchnEEWEiSS, J. 2009: Der Münzschatz von Vietze. Archäo-logie in Niedersachsen 12, 2009, 130–132.
SchnEEWEiSS, J. 2010: Neue Überlegungen zur Lokalisie-rung von Schezla. Archäologische Berichte des Landkrei-ses Rotenburg (Wümme) 16, 2010, 119–161.
SchnEEWEiSS, J. 2011 a: Sachsen, Franken, Slawen – zur Geschichte einer Grenzregion an der Elbe. Ein Vorbe-richt zu den Ausgrabungen des Göttinger Seminars für Ur- und Frühgeschichte am Höhbeck. In: K.-H. Willroth, J. Schneeweiß (Hrsg.), Slawen an der Elbe. Göttinger For-schungen zur Ur- und Frühgeschichte 1. Göttingen 2011, 57–102.
SchnEEWEiSS, J. 2011 b: Die Datierung des Höhbeck-Kas-tells an der Elbe. In: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (Hrsg.), Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18. Jahrestagung des Mit-tel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Greifswald, 23. bis 27. März 2009. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 60. Langenweißbach 2011, 371–377.
SchnEEWEiSS, J., kEnnEckE, h. in Vorb.: Schezla – Hohbuoki – Lenzen – Meetschow: Neues zur Ostgrenze des Fränki-schen Reiches. In: Akten des Kolloquiums zum Abschluss des DFG-Projekts „Slawen an der unteren Mittelelbe“ vom 7. – 9.4.2010 in Frankfurt/Main.
SchnEEWEiSS, J. im Druck: Rise and fall of a Frankish inten-tion – the early history of a frontier place between Saxons and Slaves at the river Elbe (Proceedings of the ACE in Brussels 2011).
Schnuhr, E. 1956: Unbekannte und seltene brandenburg-preußische Prägungen. Ein unbekannter Brandenburger Brakteat. Berliner Numismatische Zeitschrift 22, 1956, 213–214.
SchuchharDt, c. 1921: Slavische Scherben aus dem Jahre 810 n. Chr. In: Festschrift Adalbert Bezzenberger zum 14. April 1921 dargebracht von seinen Freunden und Schü-lern. Göttingen 1921, 140–143.
SchuchharDt, c. 1924: Die frühgeschichtlichen Befestigun-gen in Niedersachsen. Niedersächsische Heimatbücher, 2. Reihe (Geschichts- und Kulturbilder), Band 3. Bad Salz-uflen 1924.
110
SchuchharDt, c. 1926: Der Angrivarisch-Cheruskische Grenzwall und die beiden Schlachten des Jahres 16 nach Chr. zwischen Arminius und Germanicus. Die Schlachten von Idistavisus und am Grenzwall. Prähistorische Zeit-schrift 17, 1926, 118–131.
SchuchharDt, c. 1934: Vorgeschichte von Deutschland. ²München, Berlin 1934.
SchuchharDt, c. 1944: Aus Leben und Arbeit. Berlin 1944.SchulzE, h.k. 1972: Das Wendland im hohen und frühen
Mittelalter. Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge-schichte 44, 1972, 1–8.
SpangEnbErg, E. 1828: Castellum Hohbuoki. Neues vater-ländisches Archiv oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannover und des Herzogthums Braun-schweig, 1828 H. 2, 197–207.
Sprockhoff, E. 1955: Neues vom Höhbeck. Germania 33, 1955, 50–67.
Sprockhoff, E. 1958a: Die Grabung auf dem Höhbeck 1956. Germania 36, 1958, 229–233.
Sprockhoff, E. 1958b: Kastell Höhbeck. In: Neue Ausgra-bungen in Deutschland. Berlin 1958, 518–551.
Sprockhoff, E. 1966: Der „unterirdische“ Ringwall auf dem Weinberg von Hitzacker, Kreis Lüchow-Dannenberg. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 3, 1966, 212–224.
thiEME, W. 1986: Die römische Eisenzeit und Völkerwan-derungszeit. In: Hannoversches Wendland. Führer zu ar-chäologischen Denkmälern in Deutschland 13. Stuttgart 1986, 99–126.
WachtEr, b. 1998: Die slawisch-deutsche Burg auf dem Weinberg in Hitzacker/Elbe. Bericht über die Grabungen von 1970–1975. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Han-
noverschen Wendlands. Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 25. Neumünster 1998.
WEDEkinD, a.c. 1828: Zwölf historische Berichtigungen. Neues vaterländisches Archiv oder Beiträge zur allseiti-gen Kenntniß des Königreichs Hannover und des Herzog-thums Braunschweig. 1828 H. 1, 214–233.
Willroth, k.-h. 2007: DFG-Projekt: Die slawische Be-siedlung an der unteren Mittelelbe. Untersuchungen zur ländlichen Besiedlung, zu Besiedlungsstrukturen und zum Landschaftswandel. Einführung. Archäologisches Nach-richtenblatt 12, 2007, 261–263.
Willroth, k.-h. 2011: Neue Untersuchungen zur Frühge-schichte der Slawen an der unteren Mittelelbe. Stationen der Geschichte von der Völkerwanderungszeit bis zum hohen Mittelalter im Hannoverschen Wendland und an-grenzenden Gebieten, In: K.-H. Willroth, J. Schneeweiß (Hrsg.), Slawen an der Elbe. Göttinger Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte 1. Göttingen 2011, 223–246.
Wolf, h. 1963: HOHBUOKI > HOBEKE > HÖHBECK. Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 12, 1963, 189–194.
Anschrift des Verfassers:
Dr. Jens SchneeweißSeminar für Ur- und Frühgeschichte derGeorg-August-UniversitätNikolausberger Weg 15D-37073 Gö[email protected]