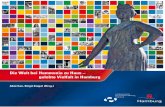In Vielfalt geteilt? Gedanken zu Joschka Fischers Blaupause für die Schaffung der \"Vereinigten...
Transcript of In Vielfalt geteilt? Gedanken zu Joschka Fischers Blaupause für die Schaffung der \"Vereinigten...
Christian J. Müller
In Vielfalt geteilt? Gedanken zu Joschka Fischers Blaupause für die Schaffung der
„Vereinigten Staaten von Europa“
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................................ 1
1.1 Zeit für Reform: Die EU in der Krise ............................................................................................ 1
1.2 Vorgehensweise ............................................................................................................................. 2
1.3 Literaturbericht .............................................................................................................................. 2
2. Einordnung des Regierungssystems der EU und seiner Reformoptionen ........................................... 2
2.1 Institutionelle Entwicklungspfade zwischen Paris und Lissabon .................................................. 3
2.2 Das Demokratiedefizit – Die Antwort auf „why bother?“ ........................................................... 5
2.3 Das Regierungssystem seit Lissabon ............................................................................................. 6
2.3.1 Jüngste Demokratisierungsbemühungen ................................................................................ 6
2.3.2 Parlamentarisch? Präsidentiell? Oder ein weiteres „Weder-noch“? ....................................... 7
2.4 Vorwärts, rückwärts oder Verharren auf dem Rubikon? ............................................................... 9
2.4.1 Supranationale Reformstrategien ........................................................................................... 9
2.4.2 Intergouvernementale Reformstrategien .............................................................................. 11
2.4.3 Zwischenfazit – Eine „weder-noch“-Alternative? ................................................................ 12
3. Eine intergouvernementale Föderation sui(sse) generis? Fischers Modell für eine europäische
Föderation .............................................................................................................................................. 13
3.1 Phase I – Ein kerneuropäischer Intergouvernementalismus ........................................................ 13
3.1.1 Institutionalisierung der Kernunion – eine Form der differenzierten Integration ................ 13
3.1.2 Eurokammer und Euroregierung – ein intergouvernemental legitimiertes Regierungssystem
....................................................................................................................................................... 16
3.2 Phase II – Eidgenössisches Modell für die Vereinigten Staaten von Europa .............................. 17
4. Politik der großen Sprünge? Eine kritische Betrachtung................................................................... 18
4.1 Pfadabhängigkeit ......................................................................................................................... 19
4.2 Hinlänglichkeit ............................................................................................................................ 20
4.3 Realisierbarkeit ............................................................................................................................ 22
5. Fazit ................................................................................................................................................... 23
Literaturverzeichnis ............................................................................................................................... 24
1
1. Einleitung
1.1 Zeit für Reform: Die EU in der Krise Mehr als sechs Jahre sind seit dem Herbst vergangen, in dem Vorsitzender der Eurogruppe Jean-
Claude Juncker die Rettung systemrelevanter Banken in der Folge der globalen Finanzkrise verkündete.
Im Frühjahr 2015 – fünf griechische Regierungen später – befindet sich die Eurozone noch immer in
einer Krise mit ungewissem Ausgang. Ein Grexit ist noch immer eine Eventualität, für viele Deutsche
sogar eine Präferenz.1 Eine breite Auffassung sieht die Schuld an den Missständen in den Krisenländern
nicht allein bei den nationalen Regierungen, sondern vor allem bei der halbherzigen Konstruktion der
Währungsunion. So verliehen der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi sowie De-
monstranten in Frankfurt am Main am 18.03.2015 ihren Wünschen nach Veränderung Ausdruck. Je-
weils mit verschiedenen Mitteln und auf der Grundlage völlig unterschiedlicher Weltanschauungen,
aber mit verwandten (zumindest nominellen) Zielen: Mehr Solidarität und Demokratie in Europa.2
Das europäische Demokratiedefizit besteht auch seit der jüngsten Vertragsreform weiter und die
Europäische Union (EU) befindet sich insgesamt in einem Dilemma zwischen Integrationsmüdigkeit
und Reformdruck. Eine Vielzahl unterschiedlicher Reformvorschläge aus Politik und Wissenschaft sind
im Umlauf, die auf mehr Effizienz des EU-Regierungssystems und einen Vertrauenszuwachs von Seiten
der Bevölkerung abzielen. Bereits in seiner berühmten Rede an der Humboldt-Universität in Berlin am
12. Mai 2000 beeindruckte Joschka Fischer sein Publikum mit einer ungewohnt klaren Vorstellung
davon, wie die finalité der Europäischen Union ausgestaltet sein sollte. In seinem im Herbst 2014 ver-
öffentlichten Buch „Scheitert Europa?“ versucht der ehemalige Außenminister erneut eine Blaupause
für eine EU zu liefern, die den gegenwärtigen und zukünftigen internationalen Herausforderungen ge-
wachsen ist.
In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern Fischers Modell ein geeig-
netes Konzept zur Lösung der institutionellen Probleme des Regierungssystems der EU darstellt. Dabei
soll vor allem der Faktor der Vereinbarkeit mit dem bisherigen institutionellen Entwicklungspfad im
Vordergrund stehen. Des Weiteren sollen allerdings auch Anregungen für eine Auseinandersetzung mit
den Kriterien der Zweckmäßigkeit und tatsächlichen Realisierbarkeit des Reformvorschlags gegeben
werden. Die Analyse dieses Reformkonzepts soll einerseits Aufschlüsse über potenzielle Entwicklungs-
richtungen des europäischen Integrationsprojekts geben und andererseits einen Beitrag zu einem besse-
ren Verständnis des bislang einzigartigen Regierungssystems der EU beitragen.
1 Vgl. Focus Online: Umfrage zu Grexit und Schuldenschnitt – Jeder zweite Deutsche plädiert für Austritt Grie-
chenlands aus der Euro-Zone, 10.02.2015 http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/umfrage-zu-
grexit-und-schuldenschnitt-jeder-zweite-deutsche-plaediert-fuer-austritt-griechenlands-aus-der-euro-
zone_id_4465472.html (letzter Zugriff: 30.03.2015) 2 Vgl. Draghi, Mario: Rede anlässlich der Einweihung des neuen Hauptsitzes der EZB, 18.03.2015
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150318.de.html (letzter Zugriff: 30.03.2015) und
Blockupy: Aufruf, Transnationale Aktionen gegen die EZB-Eröffnungsfeier – Let’s Take Over The Party!
https://blockupy.org/18m/aufruf/ (letzter Zugriff: 30.03.2015)
2
1.2 Vorgehensweise Um das nötige Verständnis für die Rahmenbedingungen der Ausgangsposition jedweder Re-
form zu erhalten, wird das EU-Regierungssystem zunächst entwicklungshistorisch und typologisch skiz-
ziert bevor die Hauptströmungen der Reformdebatte in einer kurzen Übersicht kategorisch zusammen-
gefasst und einander gegenübergestellt werden. In diesem Kapitel sollen hiermit sowohl bisherige Re-
formschritte, aktuelle Reformvorschläge, als auch die mittels Reform zu behebenden Probleme erfasst
werden. Dieser Schritt ist von erheblicher Wichtigkeit sowohl für ein Verständnis des Regierungssys-
tems der EU, als auch für die Identifikation und Einordnung von Reformideen. Das darauffolgende Ka-
pitel befasst sich mit Fischers Vorschlag für die Rettung Europas vor dessen Scheitern: einem Modell
für den Endzustand der EU und den Weg dorthin. Bereits in den Kontext der gegenwärtigen Reformde-
batte eingebettet, liegt der Fokus hier auf einer Einordnung des Modells und der Herausarbeitung ein-
zelner Teilelemente, sowie einer – wo nötig – vervollständigenden Interpretation der integrationspoliti-
schen Blaupause, die Fischer in seinem Buch präsentiert. Im Anschluss werden die Vorschläge Fischers
kritisch untersucht um schließlich zu einer Einschätzung ihrer Relevanz in Hinblick auf eine tatsächliche
Reform der EU zu gelangen. Hierbei werden weniger bestimmte funktionale Kriterien gewählt, die das
Modell an seiner Geeignetheit zur Bewältigung der angegangenen Probleme messen. Vielmehr soll eine
Einschätzung der Kompatibilität des Modells mit den bisherigen Reformpfaden in Verbindung mit ei-
nigen praktischen Erwägungen zu einer Bewertung seines Potenzials führen, politisch tatsächlich um-
gesetzt zu werden. In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse dieser Untersuchung zusam-
mengefasst und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die gegenwärtige Reformdiskussion um die Zukunft
des EU-Regierungssystems interpretiert.
1.3 Literaturbericht Die vorliegende Arbeit befasst sich primär mit Fischers jüngster Abhandlung über die Krise der
EU und sein Plädoyer für eine europäische Föderation. Zugunsten eines möglichst umfassenden Ver-
ständnisses seines Konzepts wurden auch ältere Essays und Statements ergänzend herangezogen. Da es
in dieser Untersuchung ebenso vordergründig um ein tieferes Verständnis des EU-Regierungssystems
ging, wurden einschlägige Autoren zur gegenwärtigen sowie überzeitlichen Reform- und typologischen
Debatte (z.B. Decker, Knelangen, Schäfer, Sonnicksen, Steffani, etc.) gewählt, um das Reformmodell in
Frage kontextual einzubetten. Des Weiteren wurde Literatur gewählt, die sich mit Teilelementen einer
potenziellen Reform der EU befasst, die Fischer in seinem Modell aufgreift. Hierbei hervorzuheben: die
Arbeiten zur differenzierten Integration von Maurer, Ondarza sowie Holzinger/Schimmelfennig.
2. Einordnung des Regierungssystems der EU und seiner
Reformoptionen Um geeignete Reformideen mitsamt ihrer erwartbaren Folgen und Erfolgschancen für das euro-
päische Integrationsprojekt identifizieren zu können, ist ein Verständnis der Funktionslogik des Institu-
3
tionengefüges notwendig. Die Erfassung der Gestalt der EU in aussagekräftigen Begrifflichkeiten er-
schwert sich vor allem dadurch, dass sich dieses eigentümliche Gebilde gegenüber Einordnungsversu-
chen in bekannte Kategorien so renitent verhält. Sowohl aus staatsrechtlicher Sicht, als auch aus der
Perspektive der vergleichenden Regierungslehre können insbesondere dichotome Fragen über das We-
sen der EU selten klar beantwortet werden. An Erklärungen, die mit „weder noch“ beginnen oder enden,
gerät man bereits bei der Frage, ob es sich bei der EU um einen Staat oder eine Internationale Organi-
sation handelt.3 Der Umstand, dass die EU weder Staatenbund noch Bundesstaat, ihr Institutionengefüge
weder als intergouvernemental noch supranational bezeichnet werden kann,4 führt regelmäßig zum Ver-
weis auf den wenig-sagenden „sui generis“-Ausweichbegriff5 und andere Begriffsschöpfungen6, denen
es an Erklärungskraft mangelt. Eine Erschwernis bei der Suche nach begrifflichen Kategorien, die „das
Verständnis eines komplexen sozialen Phänomens wie der EU [zu] strukturieren“7 vermögen, ist einer-
seits zweifelsohne die Präzedenzlosigkeit des Phänomens als Ganzes. Dass die EU so schwer eindeutig
kategorisierbar ist, liegt allerdings nicht zuletzt auch an der Methodik des Integrationsprozesses seit der
Entstehung ihrer Vorläufer sowie an der Vielzahl an Leitmotiven und Grundvorstellungen, die das Pro-
jekt von Beginn an bedienen musste.8 Um mithilfe einer Identifikation dieser, durchaus auch aus staats-
theoretischen Überlegungen stammenden, Konzeptionen Aufschlüsse über die Systemkompatibilität
von Reformvorschlägen für die institutionelle Weiterentwicklung zu erlangen, ist eine historische Be-
trachtung des bisherigen Systemwandels und die ihn antreibenden Leitgedanken ein notwendiger Zwi-
schenschritt.
2.1 Institutionelle Entwicklungspfade zwischen Paris und Lissabon Mit dem Inkrafttreten des „Vertrags von Paris“ und der Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1952 wurde die kriegsrelevante Kohle- und Stahlproduktion
von zunächst sechs Mitgliedstaaten einer übergeordneten Instanz unterstellt, auf welche die EU-Organe,
wie wir sie heute kennen, zurückgehen: Eine supranationale Hohe Behörde im Auftrag des Gemein-
schaftsinteresses (Vorläufer der heutigen Kommission der EU), ein Besonderer Ministerrat mit Legis-
lativkompetenzen (Vorläufer des Rats der EU), eine Gemeinsame Versammlung mit überwiegend bera-
tender Funktion (Vorläufer des EP) und ein Gerichtshof zur Klärung etwaiger Auseinandersetzungen
(Vorläufer des EuGH).9 Während die Versammlung damals noch aus 78 Mitgliedern der nationalen
3 Vgl. Gaupmann, Gloria (2008): Präsidentialismus als Leitmotiv für Europa? Eine neue Perspektive für die in-
stitutionelle Weiterentwicklung der Europäischen Union, Marburg: Tectum Verlag, S.64 4 Vgl. Göler, Daniel (2005): Das Phänomen der europäischen Integration. Die Einmaligkeit eines politischen
Systems „im Werden“, in: Salewski, Michael/Timmermann, Heiner (Hrsg.): Europa und seine Dimensionen im
Wandel, Münster: LIT, S.136-154, S.147f. 5 Vgl. Breitenmoser, Stephan (1995): Die Europäische Union zwischen Völkerrecht und Staatsrecht, in: Zeit-
schrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 55, S.951-992, S.977 6 Gemeint ist hiermit vor allem der Begriff des „Staatenverbundes“ den das Bundesverfassungsgericht in seinem
Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 geprägt hat. 7 Vgl. Knelangen, Wilhelm (2005): Regierungssystem sui generis? Die institutionelle Ordnung der EU in ver-
gleichender Sicht, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, Vol. 3, Nr.1, S.7-33, S.11 8 Vgl. Göler (2005), a.a.O., S.154 9 Vgl. Dosenrode, Søren (2012): The Road to Lisbon, in: Dosenrode (Hrsg.): The European Union after Lisbon –
Polity, Politics, Policy, Farnham: Ashgate, S.7-20, S.9
4
Parlamente bestand und nicht direkt am Gesetzgebungsprozess beteiligt war, besaß sie bereits das Recht,
die neun Mitglieder der Hohen Behörde mit einer Zweidrittelmehrheit zum Rücktritt zu zwingen. Im
klassisch intergouvernementalen Ministerrat vertraten Regierungsmitglieder die Interessen ihrer Her-
kunftsstaaten. Bemerkenswert an diesem Ausgangspunkt der europäischen Integration ist die teilweise
Kongruenz des damaligen Spannungsverhältnisses zwischen supranationalistischen und intergouverne-
mentalistischen Vorstellungen10 sowie des resultierenden Institutionengefüges, in dem es Ausdruck
fand, mit der gegenwärtigen Situation. Bis zum jüngsten Reformvertrag, welcher Dezember 2007 un-
terzeichnet wurde, fand ein schrittweiser Wandel der Organe sowie ihrer Beziehungen zueinander statt,
der durchgehend von der abwechselnden Dominanz gerade dieser beiden Modi, intergouvernemental
und supranational, überschattet und beeinflusst wurde.11
Als wichtigstes zwischenstaatliches Organ fungierte stets der Rat. Angesichts seiner dominan-
ten Position im Gesetzgebungsverfahren gab sein Abstimmungsmodus stets Anlass zu Auseinanderset-
zungen. So war bereits im Vertrag von Rom zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
von 1957/58 eine Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung (QMV) im Rat vorgesehen. Zu-
gunsten eines stärkeren Intergouvernementalismus verhinderte der damalige französische Präsident de
Gaulle diese Entwicklung zunächst, indem der sogenannte Luxemburger Kompromiss als Reaktion auf
seine Politik des „leeren Stuhls“ jeder Regierung ein Veto im Rat zusicherte.12 Erst im Zuge der Ein-
heitlichen Europäischen Akte (EEA) gegen Ende der 1980er Jahre wurde die QMV zum Standardab-
stimmungsverfahren für Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt. Mit der kontinuier-
lichen Ausweitung der QMV in den darauffolgenden Verträgen wurde der hier eingeschlagene Entwick-
lungspfad eines mehr überstaatlichen Entscheidungsmodus des Rats fortgesetzt. Demgegenüber wurden
mit der EEA die Treffen der Staats- und Regierungschefs als Teil der institutionellen Struktur anerkannt
– gleichwohl dieses zusätzliche intergouvernementale Element des Europäischen Rates (ER) faktisch
bereits seit 1975 existierte.13
Auf die aus (gemäß Art. 245 AEUV) weisungsunabhängigen Mitgliedern bestehende Kommis-
sion wird häufig als supranationale Regierung oder „zumindest“ als „etwas Ähnliches wie eine Regie-
rung“14 Bezug genommen. Was die Bestellung des Kommissionspräsidenten und der übrigen Kommis-
sare angeht, lag die Kompetenz der Nominierung und Ernennung bis zum Inkrafttreten des Vertrags von
Maastricht im Jahr 1993 ausschließlich bei den nationalen Regierungen.15 Die 1993 eingeführten Vetos
des Parlaments und des zuvor gewählten Kommissionspräsidenten bei der Ernennung der Kommission
10 Vgl. Loewenstein, Karl (1952): The Union of Western Europe: Illusion and Reality. I. An Appraisal of the
Methods, in: Columbia Law Review, Vol.52, No.1, S.59-99, S.89ff. 11 Vgl. Tömmel, Ingeborg (2008): Das politische System der EU, 3. Auflage, München: Oldenbourg, S.53 12 Vgl. Vanke, Jeffrey (2006): Charles de Gaulle’s Uncertain Idea of Europe, in: Dinan, Desmond (Hrsg.): Ori-
gins and Evolution of the European Union, Oxford: University Press, S.141-165, S.158 13 Vgl. Ludlow, N. Piers (2006): From Deadlock to Dynamism – The European Community in the 1980’s, in:
Dinan, Desmond (Hrsg.): Origins and Evolution of the European Union, Oxford: University Press, S.218-232,
S.227f. 14 Riedl, Hubertus (2012): Die Exekutive als Mitte des politischen Systems, München: Dr. Hut, S.147 15 Vgl. Wonka, Arndt (2008): Die Europäische Kommission – Supranationale Bürokratie oder Agent der Mit-
gliedstaaten?, Baden-Baden: Nomos, S.90
5
schwächten die weiterhin überproportionale Macht der mitgliedstaatlichen Regierungen nur geringfügig
ab.16 Hierbei wird deutlich, dass das häufig klar als supranational eingestufte Organ in Hinblick auf seine
Ernennung und Legitimierung einen intergouvernementalen Aspekt aufweist, wobei sich auch hier eine
supranationalistische Entwicklungstendenz abzeichnet.
Das Organ, dem bezüglich seines Kompetenzumfanges und seiner Bedeutung im Institutionen-
gefüge wohl der größte Wandel widerfahren ist, dürfte das Europäische Parlament (EP) sein. Die Mit-
glieder des Nachfolgers der Gemeinsamen Versammlung (MdEP) werden seit 1979 direkt gewählt und
verfügen somit über eine besondere, unmittelbare Legitimation. Zuvor verfügte es lediglich über Anhö-
rungsrechte im Gesetzgebungsverfahren und durfte über das Budget mitentscheiden. Seit der Einheitli-
chen Europäischen Akte (EEA) durfte das EP erstmals in bestimmten Bereichen bei der Gesetzgebung
mitentscheiden. Die zunächst geringe Anzahl an Mitentscheidungsfällen weitete sich immer weiter aus
und spätestens seit dem Lissabonner Vertrag konstituiert es „ein zentrales Organ im Entscheidungssys-
tem des europäischen Regierens“17.
2.2 Das Demokratiedefizit – Die Antwort auf „why bother?“18 Über die Jahre seit der Gründung der EGKS hat sich durch die anhaltende Vertiefung des Pro-
jekts nicht nur das legitimatorisch zu tragende Gebilde in Umfang und Gewicht vervielfacht, sondern
auch die Legitimationsgrundlage des europäischen Integrationsprojektes verschoben. Während in den
ersten Jahrzenten ein „permissive consensus“19 – in der Form stillen Zuspruchs von Seiten der Bevölke-
rung – der Europäischen Gemeinschaft ein für ihre Weiterentwicklung ausreichendes Maß an Unterstüt-
zung sicherte, erodierte dieser schleichend bis er spätestens ab 1991 und der (Post-)Maastricht-Debatte
von einem „constraining dissensus“20 abgelöst worden war. Ausgelöst wurde dieser von einer Zunahme
spürbarer Betroffenheit der europäischen Bürger von Entscheidungen, die von einer fremden Instanz
getroffen wurden, die sich gefühlt zunehmend von nationaler Kontrolle abkoppelte.
Mit der Zunahme des QMV anstelle des Einstimmigkeitsprinzips im Rat sowie der Kompe-
tenzausweitungen von EP und Kommission stieg das Bedürfnis nach einer „diffusen“ Unterstützung für
die EU.21 Da es in Europa noch an einer belastbaren kollektiven Identität, einem gesamteuropäischen
Volk, welches sich als solches versteht, einem demos fehlt, sei es unmöglich, die supranationale EU-
Entscheidungsfindung zu legitimieren.22 Die Frage, die über diesem Demokratiedefizit schwebt, ist die,
16 Vgl. a.a.O., S.94 17 Sonnicksen, Jared (2014): Ein Präsident für Europa: Zur Demokratisierung der Europäischen Union, Wiesba-
den: Springer VS, S.83 18 Dieser Ausdruck bezieht sich auf Philippe Schmitters (2000) Buch, in dem er im Anschluss an seine Vor-
schläge zur Demokratisierung der EU die Gründe nennt, wieso eine Reform notwendig ist: How to Democratize
the European Union…And Why Bother?, Oxford: Rowman & Littlefield 19 Lindbergh, Leon/Scheingold, Stuart (1970): Europe’s Would-be Polity: Patterns of Change in the European
Community, Englewood Cliffs: Prentice Hall, S.62 20 Hooghe, Liesbet/Marks, Gary (2009): A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive
Consensus to Constraining Dissensus, in: British Journal of Political Science, Vol.39, S.1-23, S.5 21 Vgl. Kielmansegg,Peter Graf (2003): Integration und Demokratie, in: Jachtenfuchs/Kohler-Koch (Hrsg.): Eu-
ropäische Integration, 2.Auflage, Opladen: Leske & Budrich, S.49-84, S.52 22 Vgl. Scharpf, Fritz W. (2009): Legitimacy in the Multilevel European Polity, MPIfG Working Paper 09/1, S.9
6
ob sich die künftige EU in der Konsequenz stärker über ihre Mitgliedstaaten oder durch Ausbau ihrer
supranationalen Demokratie legitimieren soll.
Seit diesem sogenannten „Post-Masstricht-Blues“23 und der damit einhergehenden Zunahme an
Kritik an der Legitimität der EU wurden einige Versuche unternommen, dem beklagten Defizit zu be-
gegnen. Der 2001 im belgischen Laeken tagende ER griff die Problematik auf und verpflichtete die EU
in einer Erklärung zu mehr Demokratie, Effizienz und Transparenz.24 Das heutige System der EU ist
durch eine lange Reihe von Reformen und Vertragsrevisionen im Lichte dieses Bekenntnisses zu mehr
Demokratie und Bürgernähe gekennzeichnet. Die jüngste dieser Vertragsrevisionen stellt der Vertrag
von Lissabon dar.
2.3 Das Regierungssystem seit Lissabon
2.3.1 Jüngste Demokratisierungsbemühungen Ein Fokus der jüngsten Reformen zugunsten von mehr Demokratie lag erneut auf dem einzigen
direktgewählten Organ der EU. Der Entwicklung der stetigen Aufwertung des EP folgend, wurden mit
dem Vertrag von Lissabon seine Kompetenzen weiter ausgedehnt. Das Mitentscheidungsverfahren
wurde zum „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“, womit in den meisten Politikfeldern das EP nun
neben dem Rat gleichberechtigter Gesetzgeber ist. Um die Legitimation der Kommission über ein „An-
zapfen“ des gesamteuropäischen Wahlakts zu stärken, ist bei der Ernennung des Kommissionspräsiden-
ten nicht mehr lediglich die Zustimmung des EP erforderlich. Dieser wird von nun an mit der Mehrheit
der MdEP „gewählt“, wobei bei dem Vorschlag des ER das Ergebnis der Wahlen zum EP „berücksich-
tigt“ werden soll (Art.17 Abs. 7 EUV). Außerdem entscheidet das EP per Zustimmungsvotum über das
von Rat und Kommissionspräsident im Einvernehmen vorgeschlagene Kollegium der Kommission. Die
Europawahl 2014 und die Aufstellung von Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten
haben gezeigt, dass das EP damit über weit mehr als ein Scheinwahlrecht bei der Auswahl des Kom-
missionspräsidenten gewonnen hat.
Doch auch die anderen europäischen Parlamente konnten von den Änderungen seit dem Vertrag
von Lissabon profitieren. Zum ersten Mal ist eine frühzeitige und umfassende direkte Information der
Parlamente durch die Organe der EU festgeschrieben worden (Art.12 EUV), was es nationalen Abge-
ordneten ermöglicht, die Positionen der jeweiligen Regierungen über innerstaatliche Wege zu beeinflus-
sen.25 Es wird ihnen darüber hinaus die Teilnahme bei Vertragsänderungen garantiert sowie das Subsi-
diaritätsprinzip in diesem Kontext erstmals in das Vertragswerk aufgenommen.
Im Rat wurde das QMV erneut auf weitere Bereiche ausgedehnt und – einerseits zugunsten der
Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich der gestiegenen Anzahl der Mitgliedstaaten auf 28 und andererseits
23 Eichenberg, Richard/Dalton, Russel (2007): Post-Maastricht Blues: The Transformation of Citizen Support
for European Integration, 1973-2004, in: Acta Politica, Vol.42, S.128-152, auch einsehbar auf:
http://www.palgrave-journals.com/ap/journal/v42/n2/full/5500182a.html (letzter Zugriff: 20.03.2015) 24 Siehe „Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union“ vom 15. Dezember 2001 25 Vgl. Chardon, Matthias (2008): Mehr Transparenz und Demokratie – Die Rolle nationaler Parlamente nach
dem Vertrag von Lissabon, in: Weidenfeld (Hrsg.): Lissabon in der Analyse – Der Reformvertrag der Europäi-
schen Union, Baden-Baden: Nomos, S.171-185, S.177
7
die doppelte Legitimation widerspiegelnd – mit Effekt seit November 2014 weiter angepasst.26 Um Vor-
würfen der Intransparenz zu begegnen, tagt der Rat nun bei Beratungen öffentlich. Dies soll den Bürgern
– so zumindest soll das Bild entstehen – dazu verhelfen, den Entscheidungsfindungsprozess besser ver-
folgen und ihre nationalen Repräsentanten direkt für ihre Entscheidungen zur Verantwortung ziehen zu
können.27 De facto werden relevante Verhandlungen wohl auch in Zukunft hinter verschlossenen Türen
stattfinden können.28
Eine weitere Neuerung hinsichtlich der demokratischen Strukturen der EU stellt die Einführung
der europaweiten Bürgerinitiative als direktdemokratisches Element dar (Art.11 Abs.4 EUV). Zwar han-
delt es sich noch um kein starkes direktdemokratisches Element, dennoch wird hier eine Absicht der
stärkeren direkten Einbindung der europäischen Bürger deutlich. Auf Seiten der Exekutive ist die Ein-
führung eines neuen permanenten Präsidenten des ER und die „Doppelhut“-Strategie eines Hohen Ver-
treters für Außen- und Sicherheitspolitik, der zugleich Mitglied des Rates und der Kommission ist, zu-
gunsten der Identifizierbarkeit von Führungspersonen und Kontinuität durchgesetzt worden.29
Insgesamt erzeugt das Ergebnis der jüngsten Reform ein ambivalentes Bild. Einerseits scheint
der Trend der Aufwertung des bzw. der Europäischen Parlamente(s) in Richtung einer parlamentari-
schen europäischen Demokratie fortgesetzt worden zu sein. Auf der anderen Seite scheinen diese Re-
formen bei Weitem nicht auszureichen, um das Problem der mangelnden kollektiven Identität und das
Demokratiedefizit zu überwinden. Darüber hinaus ist auch der Lissaboner Vertrag von Kompromissen
und „trade-offs“ zwischen stärkeren intergouvernementalen und supranationalen Strukturen geprägt,
was das Ergebnis des Versuchs, mehr Effizienz und Transparenz zu schaffen, in Frage stellt.30 Ange-
sichts der hohen Hürden für eine Vertragsreform sollte allerdings angemerkt werden, dass der Vertrag
von Lissabon insgesamt wohl dennoch ein verhältnismäßig großer Schritt war.
2.3.2 Parlamentarisch? Präsidentiell? Oder ein weiteres „Weder-noch“? Die Typologisierung des EU-Regierungssystems wird im Folgenden vorrangig anhand der Be-
ziehung der Organe des sogenannten „institutionellen Dreiecks“ – EP, Rat und Kommission – zuzüglich
des ER zueinander vollzogen. Zwar besteht das gesamte System der EU neben den übrigen vertraglich
festgelegten Organen (z.B. Europäische Zentralbank und Rechnungshof) auch aus weiteren Behörden
und Gremien (z.B. Ausschuss der Regionen und Eurojust), die auf unterschiedliche Weise an die Haupt-
organe rückgekoppelt sind. Da das Verhältnis der zentralen Exekutiv- und Legislativorgane zueinander
26 Zum Erreichen einer Mehrheit ist eine Zustimmung von mindestens 55% der Mitgliedstaaten, die zusätzlich
mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren, notwendig. Dazu Warntjen, Andreas (2012): Designing
Democratic Institutions: Legitimacy and the Reform of the Council of the European Union in the Lisbon Treaty,
in: Dosenrode (Hrsg.): The European Union after Lisbon – Polity, Politics, Policy, Farnham: Ashgate, S.111-
129, S.120 27 Vgl., a.a.O., S.124f. 28 Vgl. Höreth, Marcus/Sonnicksen, Jared (2008): Making and Breaking Promises – the European Union Under
the Treaty of Lisbon, Discussion Paper, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Bonn, S.6 29 Vgl. Seeger, Sarah (2008): Die Institutionen- und Machtarchitektur der Europäischen Union mit dem Vertrag
von Lissabon, in: Weidenfeld (Hrsg.): Lissabon in der Analyse – Der Reformvertrag der Europäischen Union,
Baden-Baden: Nomos, S.63-98, S.78 30 Vgl. Höreth/Sonnicksen (2008), a.a.O., S.13
8
und ihre internen Funktionslogiken allerdings die wichtigsten Bezugspunkte für die verschiedenen De-
mokratisierungsstrategien darstellen, orientiert sich die folgende Einordnung ebenfalls an den Systemty-
pologien der Vergleichenden Regierungslehre, die sich des Prinzips der Gewaltenteilung als brauchba-
res Instrument bedient.31 Steffani unterscheidet hierbei zwei alternative Strukturtypen – präsidentiell und
parlamentarisch – und unterscheidet diese anhand primärer und supplementärer Kriterien. Sowohl all-
gemein als auch in Bezug auf die EU wird von einigen Wissenschaftlern die Loslösung von dieser Di-
chotomie zugunsten einer dritten oder mehrerer Systemkategorien angeraten.32 Dies ist in Bezug auf die
EU insbesondere deshalb sinnvoll, da diese anhand der gegebenen Kriterien nicht eindeutig in dieses
dichotome Raster hineinpasst. Dies wird bereits anhand des primären und wichtigsten Unterscheidungs-
merkmals – der Abberufbarkeit der Regierung durch das Parlament – deutlich. Dass „die Kommission
[…] als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich“ ist und per Misstrauensantrag von Sei-
ten des EP zum Abtritt gezwungen werden kann (Art. 17 Abs.8 EUV), könnte eine (vor)schnelle Zuord-
nung zum Parlamentarismus zulassen. Beachtet man jedoch die bis heute dazu erforderliche Zweidrit-
telmehrheit der Stimmen im EP bei Mehrheit der MdEP sowie die funktionale Ähnlichkeit zu Amtsent-
hebungsverfahren in präsidentiellen Systemen wie dem der USA,33 so wird deutlich, dass mehr Anhalts-
punkte berücksichtigt werden müssen.
Für einen parlamentarischen Typ scheint auch auf den ersten Blick die seit dem Vertrag von
Lissabon veränderte Praxis der Bestellung des Kommissionspräsidenten zu sprechen. Die Aufwertung
der Wahlfunktion des EP erlaube es, „von einer eindeutigen Parlamentarisierung des politischen Sys-
tems der EU zu sprechen“34. Zwar wurde in der Folge der ersten Europawahl seit der Ratifizierung des
Lissaboner Vertrags der Spitzenkandidat der Fraktion mit den meisten Stimmen, Juncker, tatsächlich
auch Kommissionspräsident. Doch muss angesichts der mangelnden Formalisierung dieser Regelung –
im Vertragstext ist lediglich von einer „Berücksichtigung“ des Wahlergebnisses durch den ER die Rede
– angeführt werden, dass die tatsächliche Präsidentschaft des jeweiligen siegreichen Spitzenkandidaten
im Anschluss an die Europawahl keineswegs eindeutig war, was bei zukünftigen Europawahlen wo-
möglich auch der Fall sein könnte. Dies mag nicht zuletzt auch damit zusammenhängen, dass die stärkste
Fraktion, wie bei der diesjährigen Wahl (EVP: 29,43%35), keineswegs immer eine „Präsidentenmehr-
heit“ zustande bringen können wird.36 Eine klare Vertrauensabhängigkeit der Kommission gegenüber
dem EP, wie sie für parlamentarische Regierungssysteme üblich ist, kann aufgrund der zentralen Krite-
rien der Bestellung und Abberufung bezweifelt werden.
31 Vgl. Steffani, Winfried (1979): Parlamentarische und präsidentielle Demokratie – Strukturelle Aspekte westli-
cher Demokratien, Opladen: Westdeutscher Verlag, S.10 32 Vgl. Ganghof, Steffen (2014): Is the ‚Constitution of Equality‘ Parliamentary, Presidential, or Hybrid?, in:
Political Studies, S.14 33 Vgl. Sonnicksen (2014), a.a.O., S.201 34 Oppelland, Torsten (2010): Institutionelle Neuordnung und Demokratisierung, in: Leiße (Hrsg.): Die Europäi-
sche Union nach dem Vertrag von Lissabon, Wiesbaden: VS Verlag, S.79-96, S.90 35Europäisches Parlament, Ergebnisse der Europawahl 2014, http://www.europarl.europa.eu/elections2014-re-
sults/de/election-results-2014.html (letzter Zugriff: 25.03.2015) 36 Vgl. Riedl (2012), a.a.O., S.159
9
Eher für ein präsidentielles Regierungssystem sprächen auch sekundäre Merkmale, wie die fak-
tische Inkompatibilität von exekutiven Ämtern und Abgeordnetenmandaten, sowie die fehlende Mög-
lichkeit der Kommission und des Rates zur Auflösung des EP als Pendant zu einem parlamentarischen
Abberufungsrecht.37 Auch die Tatsache, dass mit Rat und EP von zwei in der Gesetzgebung nahezu
gleichberechtigten Kammern gesprochen werden kann, scheint eher auf eine präsidentiell-systematische
Logik der Gewaltentrennung hinzuweisen, obwohl auch Ausnahmen parlamentarischer Regierungssys-
teme (wie z.B. in Deutschland) mit bikameraler Legislative existieren und nicht alle präsidentiellen De-
mokratien über zwei legislative Kammern verfügen.38 Nicht zuletzt weist das für parlamentarische Sys-
teme zentrale Parteiensystem auf der europäischen Ebene noch erhebliche Mängel auf, die eine kompe-
titive politische Mehrheitsbildung unmöglich machen.39 Insgesamt kann auch die Zuordnung zum Prä-
sidentialismus angesichts der Entwicklungstendenzen bezüglich der Rolle des EP aber vor allem auf-
grund der Abwesenheit einer Direktwahl der Exekutive nicht durchweg überzeugen. Häufig wird des-
halb eine dritte Kategorie gewählt, um das Regierungssystem der EU als Mischform zwischen präsiden-
tiellem und parlamentarischem System zu erfassen. Während Begriffe wie „semi-parlamentarisch“,
„quasi-präsidentiell“ und „semi-präsidentiell“ vorgeschlagen werden, scheint letzterer am geeignetsten,
da er die starke Rolle der Exekutive reflektiert und darüber hinaus die doppelte Exekutive der EU aus
Kommission und ER zu erfassen vermag.40
In der vorangegangenen Darstellung ist ersichtlich geworden, dass die Entwicklungspfade der
EU von intergouvernementalen und supranationalen sowie präsidentiellen und parlamentarischen Leit-
bildern geprägt worden sind, die sie zu dem Mischsystem gemacht haben, das sie heute ist. Die Frage
ist nun, inwiefern sich das Regierungssystem der EU, ausgehend von diesem status quo als Mischform,
auch in eine dieser idealtypischen Richtungen reformieren ließe.
2.4 Vorwärts, rückwärts oder Verharren auf dem Rubikon?
2.4.1 Supranationale Reformstrategien Vor allem bis zum Vertrag von Lissabon gehörte das Leitbild der parlamentarischen Regie-
rungsform zu den häufigsten supranational ausgerichteten institutionellen Reformvorschlägen bezüglich
der demokratischen Legitimation der EU.41 Diese Ausrichtung folgt der Auffassung, dass „als einziges
direkt legitimiertes Organ […] nur das Europäische Parlament die zentrale Rolle der Legitimationsge-
winnung übernehmen“42 könne. Eine weitere Parlamentarisierung würde es darauf absehen, das EP mit
einem ausgeweiteten Wahlrecht bei der Zusammensetzung der Kommission (etwa durch mehr Einfluss
37 Vgl. Decker, Frank/Sonnicksen, Jared (2009): Parlamentarisch oder präsidentiell? Die Europäische Union
auf der Suche nach der geeigneten Regierungsform, in: Decker/Höreth (Hrsg.): Die Verfassung Europas – Per-
spektiven des Integrationsprojekts, Wiesbaden: VS Verlag, S.128-164, S.144 38 Vgl., a.a.O., S.145 39 Vgl. Oppelland (2010), a.a.O., S.91 40 Vgl. Knelangen (2005), a.a.O., S.32 41 Vgl. Sonnicksen (2014), a.a.O., S.226 42 Kirsch, Andrea (2008): Demokratie und Legitimation in der Europäischen Union, Baden-Baden: Nomos,
S.228
10
bei der Wahl einzelner Kommissare) und bestimmten Disziplinarmaßnahmen (etwa in Form einer Ver-
trauensfrage) zugunsten einer stärkeren Vertrauensabhängigkeit der Kommission vom EP zu versehen.
Zukünftig müsste, an Stelle von einzelstaatlichen Interessen, Parteizugehörigkeit entsprechend der Ver-
hältnisse im EP die überwiegende Rolle bei der Auswahl der Kommissare spielen. Das EP plädiert be-
reits dafür, dass mehr MdEP in der Kommission sitzen sollten.43 Die ehemalige luxemburgische Kom-
missarin Reding trat zugunsten einer weiteren Parlamentarisierung der EU unter anderem dafür ein, das
Amt des Kommissionspräsidenten und das des Präsidenten des ER künftig zu vereinen, was innerhalb
des vertraglichen Rahmens seit Lissabon möglich sei.44 Im Rahmen einer umfangreichen Parlamentari-
sierung würde sich auch die Frage nach der Möglichkeit einer vorzeitigen Auflösung des EP stellen.
Kritisierbar an der parlamentarischen Demokratisierungsstrategie ist vor allem das hierzu noch stark
ausbaubedürftige, unzureichend konsolidierte Parteien- und Verbändesystem. Daher fordern auch ihre
Befürworter einen verstärkten europäischen Wahlkampf und die Einführung eines einheitlichen Wahl-
rechts bei Europawahlen.45
Demgegenüber ist vor allem seit Lissabon auch die Einführung einer Direktwahl des Kommis-
sionspräsidenten von Stimmen aus Politik und Wissenschaft vermehrt vorgeschlagen worden. Eine Di-
rektwahl würde mit einer stärkeren Politisierung des Postens einhergehen, jedoch bliebe die, für die
Kommission bisher typische, Unabhängigkeit weitestgehend bestehen. Als mit der präsidentiellen Rich-
tung kompatibel erscheint auch das bestehende Koalitionsverhalten der Parteien im EP: Die Koalitions-
bildung scheint eher ad hoc und themenspezifisch stattzufinden, was für präsidentielle Systeme typisch
ist.46 Eine Frage wäre, ob die seit Lissabon eingeführte Präsidentschaft des ER neben der Repräsenta-
tivfunktion eines direkt gewählten Kommissionspräsidenten überflüssig werden würde. Da der ER je-
doch weiterhin als intergouvernementales Organ in Erscheinung treten könnte, müsste dieses Amt nicht
zwingend abgeschafft werden. Es könnte, in Anlehnung an Redings Vorschlag, jedoch auch eine Ver-
schmelzung der beiden Ämter in Frage kommen.47 Ein praktisches Problem würde die damit verbundene
unausweichliche Verkomplizierung des Wahlakts an sich darstellen, die in Hinblick auf die ohnehin
schwindende Wahlbeteiligung bei Europawahlen weitere negative Auswirkungen haben könnte. Ob par-
lamentarische oder präsidentielle Variante: in beiden Fällen müsste Reform mit Änderungen des Wahl-
43 Europäisches Parlament (2014): As many Commissioners as possible should be chosen among MEPs, says
Parliament, Pressemitteilung vom 13.03.2014, http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/con-
tent/20140307IPR38419/html/As-many-Commissioners-as-possible-should-be-chosen-among-MEPs-says-Par-
liament (letzter Zugriff: 20.03.2015) 44 Vgl. Reding, Viviane (2012): Mit einer Vision aus der Krise: Europa auf dem Weg zu einer politischen Union,
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.03.2012 45 Vgl. Kirsch (2008), a.a.O., S.228 46 Vgl. Decker, Frank/Sonnicksen, Jared (2011): An Alternative Approach to European Union Democratization:
Re-Examining the Direct Election of the Commission President, in: Government and Opposition, Vol.46, No. 2,
S.168-191, S.189 47 Vgl. Decker, Frank (2012): Electing the Commission President and commissioners directly: a proposal, in:
European View, Vol.11, S.71-78, S.77
11
rechts einhergehen um im Effekt einen nationenübergreifenden Wahlkampf zu fördern und europäische
Öffentlichkeit sowie kollektive Identität der Europäer zu stärken.48
2.4.2 Intergouvernementale Reformstrategien Demokratisierungsstrategien nach dem intergouvernementalen Leitbild orientieren sich an den
Legitimationssträngen, die von den Mitgliedstaaten ausgehen, um dem Problem der fehlenden kol-
lektiven Identität, das einer Legitimation der supranationalen EU-Organe entgegensteht, zu begegnen.
Neben einer grundsätzlichen Forderung der Stärkung der intergouvernementalen Organe – ER und Rat
– gegenüber der Kommission und dem EP, lassen sich defensivere und offensivere Strategien unter-
scheiden.49 Eher defensive Varianten sehen vor, die Legitimationszufuhr durch eine stärkere Rückbin-
dung an die nationalen Parlamente zu verbessern, was in vergangenen Reformen bereits ansatzweise
geschehen ist. Stellen etwa die Informationsrechte der nationalen Parlamente wichtige Neuerungen für
die Aufwertung ihrer Rolle im EU-Institutionengefüge dar, müssten dennoch mehr Möglichkeiten ge-
schaffen werden, die Mitglieder des Rats zur Verantwortung ziehen zu können, da nationalen Parlamen-
ten eine wichtige Aufgabe als Vermittler zwischen Rat und nationalstaatlicher Bevölkerung zukommt.50
Institutionelle Veränderungen müssten somit sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene
stattfinden.51
Offensivere Varianten sehen etwa die Effizienzsteigerung der Arbeit des intergouvernementalen
Rates durch Absenkung des Mehrheitsquorums und weitere Ausweitung des QMV vor. Dies würde
freilich die Handlungsfähigkeit der EU verbessern, aber an der Demokratieproblematik vorbeigehen.
Die Möglichkeit einer weitgehend intergouvernementalen Option stellte Fischer bereits im Jahr 2000
vor: Der ER könnte zu einer europäischen Regierung aus- und die Legislative in ein Zweikammersystem
umgebaut werden, in dem der Rat in Zukunft aus von den nationalen Parlamenten delegierten Vertretern
zusammengesetzt wäre.52 Neben der expliziten Vorstellung, sowohl intergouvernementalen als auch
supranationalen Repräsentationsmustern zu entsprechen, äußert er keine Präferenz für eine spezifische
Ausgestaltung. Eine ebenfalls von ihm vertretene Idee zur Stärkung des intergouvernementalen Leitge-
dankens ist die der institutionalisierten differenzierten Integration.53 Vertreter der differenzierten In-
tegration als Lösung für die institutionellen Probleme der EU sehen in den effizienzsteigernden und
48 Vgl. Decker, Frank (2007): Parlamentarisch oder präsidentiell? Institutionelle Entwicklungspfade des europä-
ischen Regierungssystems nach dem Verfassungsvertrag, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften,
S.181-202, S.199f. 49 Vgl. Sonnicksen (2014), a.a.O., S.222 50 Auel, Katrin/Benz, Arthur (2007): Expanding National Parliamentary Control: Does It Enhance European
Democracy?, in: Kohler-Koch/Rittberger (Hrsg.): Debating the Democratic Legitimacy of the European Union,
Lanham: Rowman and Littlefield, S.57-74, S.71 51 Ebd. 52 Vgl. Fischer, Joschka (2000): Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der europäi-
schen Integration, Rede in der Humboldt-Universität in Berlin am 12.05.2000 53 Fischer, Joschka (2010): Die Vereinigten Staaten von Europa, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Europa wa-
gen, Gütersloh, S.233-247, S.243
12
autonomieschonenden Effekten etwa von vermehrten Opt-out-Möglichkeiten54 eine Option, die die Ent-
scheidungsmacht der Mitgliedstaaten sichert.
2.4.3 Zwischenfazit – Eine „weder-noch“-Alternative? Weder intergouvernemental noch supranational orientierte Reformideen schließen die Existenz
von Elementen auf der entgegengesetzten Seite des Kontinuums im zentralen Regierungssystem aus.
Was eine Reform nach rein supranationalem Leitbild angeht, wird wohl das notwendige Einverständnis
der nationalen Regierungen zur weiteren Souveränitätsübertragung die Hürde bleiben. Was beispiels-
weise die Wahrscheinlichkeit einer umfassenden Parlamentarisierung in der nahen Zukunft angeht: Bis-
her erfolgte eine Stärkung der Stellung des EPs im EU-Regierungssystem entweder durch „pragmatische
Erweiterung“ seines Handlungsspielraums „unterhalb der förmlichen Änderung der Verträge“ oder
durch Vertragsänderung im Einvernehmen der Mitgliedstaaten – wobei letzteres „in der Regel ein zähes
politisches Ringen, den good will der Mitgliedstaaten sowie die Unterstützung der Kommission“ erfor-
derte.55 Wieviel good will zugunsten einer Supranationalisierung derzeit besteht, kann anhand der vor-
gesehenen Reduzierung der Kommissionsmitglieder (Art. 17 Abs.5 EUV) – was ein weiteres suprana-
tionalisierendes Element dargestellt hätte – veranschaulicht werden. Die Umsetzung der Regelung
wurde aufgrund der Interessen von nationalen Regierungen verweigert.
Aus Sicht der Vertreter des relativ jungen Konzepts einer demoi-kratie für Europa liegt die Ant-
wort auf die Frage der Finalität in einem Mittelweg zwischen der Schaffung einer supranationalen eu-
ropäischen Demokratie und der Rückabwicklung der EU zugunsten eines intergouvernementalen Sys-
tem der ausschließlich nationalen Verantwortungen. Metaphorisch ausgedrückt:
„[Europeans] are bound instead by the basic injunction of demoicracy: thou shalt not cross the Rubicon which separates a Union ruled by and for multiple demoi from a Union ruled by and for one single demos. On this ship, many yearn to land on one shore or the other rather than stay on the Rubicon.”56
Das kratos der EU fußt nach dem Konzept der demoi-kratie nicht auf dem sozialen Fundament eines
einzelnen europäischen demos, sondern auf mehreren demoi.57 Demoi-kratie betont den dualen Charak-
ter der EU als Gemeinschaft der Staaten bzw. Staatsvölker und Individuen in einer gemeinsamen sup-
ranationalen Polity58 – als Union der Völker und Bürger, die gemeinsam und doch nicht „wie eine
Stimme“ herrschen.59 Mag dieses Ideal einer demoi-kratie als erstrebenswerter Endzustand der europä-
ischen Integration nicht geteilt werden, so bietet dieses Konzept doch einen Ausblick auf eine mindes-
tens vorübergehende Zukunft als Mischform.
54 Vgl. Adler-Nissen, Rebecca (2011): Opting out of an ever closer union, in West European Politics, Vol.34,
No.5, S.1092-1113, S.1097 55 Bocklet, Reinhold (2007): Das Europäische Parlament: Kompetenzzuwachs durch Vertragsänderung und im
politischen Prozess von der Montanunion zum Maastrichter Unions-Vertrag, in: Patzelt/Sebaldt/Kranenpohl
(Hrsg.): Res publica semper reformanda – Wissenschaft und politische Bildung im Dienste des Gemeinwohls,
Festschrift, Wiesbaden: VS Verlag, S.612-625, S.613 56 Nicolaïdis, Kalypso (2013): European Demoicracy and Its Crisis, in: Journal of Common Market Studies,
Vol.51, No.2, S.351-369, S.366 57 Vgl. Hurrelmann, Achim (2014): Democracy beyond the State: Insights from the European Union, in: Political
Science Quarterly, Vol.129, No.1, S.87-105, S.96 58 Vgl. Cheneval, Francis/Lavenex, Sandra/Schimmelfennig, Frank (2014): Demoi-cracy in the European Union:
principles, institutions, policies, in: Journal of European Public Policy, S.2 59 Nicolaïdis (2013), a.a.O., S.351
13
Diese Darstellung verschiedenster Reformansätze zeigt, wie sich Auffassungen über das Wesen
der EU maßgeblich unterscheiden und wo sie sich doch ähneln.
3. Eine intergouvernementale Föderation sui(sse) generis60? Fischers Modell für eine europäische Föderation Fischer schlägt den Ausbau des europäischen Integrationsprojektes zugunsten einer sowohl
ökonomisch als auch politisch integrierten Föderation vor um die Probleme der doppelten Krise Europas
zu lösen: diejenigen in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise seit Ende 2008, die nicht nur den Euro
sondern das gesamte europäische Projekt bedroht,61 sowie jene, die sich seit Ausbruch der Ukraine-
Krise als geopolitische Risiken manifestieren.62 Hierbei war zum Ausbau der „Vereinigten Staaten von
Europa“ bereits in seiner Humboldt-Rede ein stufenweises Vorgehen geplant. Der Reformvorschlag in
„Scheitert Europa?“ sieht das Erreichen eines Bundesstaates nach Vorbild der Schweiz als Endphase
eines Prozesses vor, in dessen Zwischenphase eine Kernunion aus Euroländern entstehen soll, die als
Vorhut für das restliche, nach und nach nachrückende Europa die politische Integration verwirklicht.
Da hinsichtlich konkreter Reform ein Verweis auf einen Endzustand in ferner Zukunft nur be-
grenzt hilfreich ist, werden die beiden Phasen von Fischers Modell separat in den Fokus genommen, da
sie jeweils unterschiedliche Implikationen für das europäische System als Ganzes haben. Insbesondere
die mittelfristig zu bewerkstelligenden Veränderungen werden hierbei aufgrund ihrer höheren Relevanz
für potenzielle unmittelbare Reform einer eingehenden Betrachtung unterzogen.
3.1 Phase I – Ein kerneuropäischer Intergouvernementalismus Die zentralen Elemente des „entscheidenden Zwischenschritt[s] von vermutlich längerer
Dauer“63 vor Erreichen eines europäischen Bundesstaates sind die institutionelle Etablierung und Ab-
kopplung einer Kernunion von der restlichen Union sowie die Etablierung eigener Entscheidungsor-
gane innerhalb dieses Kerns.
3.1.1 Institutionalisierung der Kernunion – eine Form der differenzierten Integration Sowohl Wissenschaft als auch Politik kennen verschiedene Formen der differenzierten Integra-
tion. Während die Politikwissenschaft zahlreiche Typen differenzierter Integration unterscheidet, seien
an dieser Stelle nur einige der meistdiskutierten genannt. Aufsteigend sortiert nach Grad der Abwei-
chung von der aktuellen Rechtsauffassung der EU: „Europa der zwei oder mehr Geschwindigkeiten“ –
Differenzierung findet innerhalb der Verträge statt und ist nur temporal –, „avantgardistisches Europa“
und „Kerneuropa“ – einige Mitgliedstaaten stellen den Kern dar, der sich auf eine politische Union
einigt, während die übrigen Mitgliedstaaten einen zweiten Kreis konstituieren – und „Europa à la carte“
– jeder Staat kann, je nach Interesse, einzelnen Regimen außerhalb der Verträge beitreten, in denen nur
60 Die Bezeichnung „sui(sse) generis“ ist im Rahmen des Hauptseminars „Europa der Richter“ an der Universität
Passau von Seiten des Dozenten Uwe Kranenpohl häufig gefallen und wurde darüber hinaus im Titel eines in
dieser Arbeit aufgegriffenen Aufsatzes desselben (2007) verwendet. 61 Fischer, Joschka (2014): Scheitert Europa?, Köln: Kiepenheuer & Witsch, S.12 62 a.a.O., S.136 63 a.a.O., S.151
14
die Mitglieder des jeweiligen Regimes Entscheidungsbefugnisse besitzen.64 Diese unterschiedlichen
Konzeptionen zeichnen sich auch in der politischen Auseinandersetzung mit der Zukunft der EU ab.
1994 plädierten CDU-Politiker Wolfgang Schäuble und Karl Lamers bereits für die weitere Festigung
eines ohnehin bestehenden Kerns innerhalb der Union.65 Diese Festigung sollte darauf abzielen, die
voranschreitende Integration der (damals fünf bis sechs) Staaten, die dazu willens und in der Lage wa-
ren, zu ermöglichen. Demgegenüber plädierte der britische Premierminister David Cameron für eine
Distanzierung von der Idee eines Europas der zwei Geschwindigkeiten zugunsten einer flexiblen Ko-
operation: „We must not be weighed down by an insistence on a one size fits all approach which implies
that all countries want the same level of integration. The fact is that they don’t and we shouldn’t assert
that they do”66. Neben der Möglichkeit der Einzelstaaten, sich ihre Kooperationsbereiche zugunsten
eines in Vielfalt geeinten Europas weitestgehend frei auszuwählen, fordert Cameron des Weiteren eine
Rückführung der Entscheidungsmacht auf die nationale Ebene.
Die Idee der Institutionalisierung der differenzierten Integration besticht vor allem aufgrund
ihrer Realitätsnähe. Das entgegengesetzte Paradigma der einheitlichen Integration, dass alle Mitglieder
der EU gleichberechtigt und im Gleichschritt voranschreiten, hat bisher das dominant vertretene Leitbild
des europäischen Projekts dargestellt.67 In der Tat ergibt eine genaue Betrachtung der Integrationsstruk-
tur der europäischen Verträge, dass wohl bereits im EGKS-Vertrag Formen von nichteinheitlicher In-
tegration vorhanden waren, die durch steigende Heterogenität im Verlauf der europäischen Integration
zunehmend aufgetreten sind.68 Zwei klare Fälle von differenzierter Integration, die häufig als veran-
schaulichende Beispiele herangezogen werden, sind das Schengener Abkommen und die Währungs-
union. Gleichzeitig stellen diese aber auch Beispiele für Integrationsbereiche dar, an denen einige EU-
Mitglieder nicht teilnehmen, aber gleichzeitig einige Nicht-EU-Staaten teilnehmen.69 Bei der bisherigen
institutionellen Struktur werfen diese Bereiche der differenzierten Integration Fragen der demokrati-
schen Legitimität auf. So etwa vor allem in Bezug auf das EP, welches in verschiedenen Zusammenset-
zungen tagen müsste, damit MdEP aus von Entscheidungen nichtbetroffenen Staaten kein Mitsprache-
recht bekommen.70
64 Vgl. Holzinger, Katharina/Schimmelfennig, Frank (2012): Differentiated Integration in the European Union:
Many Concepts, Sparse Theory, Few Data, in: Journal of European Public Policy, Vol.19, No.2, S.292-305,
S.293f. 65 Vgl. Schäuble, Wolfgang/Lamers, Karl (1994): Überlegungen zur europäischen Politik, Vorschläge für eine
Reform der Europäischen Union, Positionspapier vom 01.09.1994, S.5f. einsehbar unter:
https://www.cducsu.de/upload/schaeublelamers94.pdf (letzter Zugriff: 20.03.2015) 66 Cameron, David (2013), "EU speech at Bloomberg” vom 23.01.2013, https://www.gov.uk/government/spee-
ches/eu-speech-at-bloomberg (letzter Zugriff: 20.03.2015) 67 Vgl. Keutel, Anja (2012a): Geschichte und Theorie der abgestuften Integration Europas, SEU Working Paper,
Universität Leipzig, S.9 68 Vgl. Keutel, Anja (2012b): Die Europäische Union zwischen einheitlicher Integration und Abstufung, Serie
Europa, No.5, Universität Leipzig, S.22f. 69 Vgl. Busch, Berthold (2014): Differenzierte Integration als Modell für die Zukunft der Europäischen Union?,
IW Working Paper, No.14, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, S.4f. – Nicht-EU-Staaten mit Euro als Zah-
lungsmittel sind die Sonderfälle der Mikrostaaten Europas: Andorra, Monaco, St. Marino und Vatikanstadt 70 Vgl. Ondarza, Nicolai von (2012): Auf dem Weg zur Union in der Union. Institutionelle Auswirkungen der dif-
ferenzierten Integration in der Eurozone auf die EU, in: Integration, Vol.1, S.17-33, S.30
15
Fischers Plan zur Erreichung einer europäischen Föderation sieht die vorübergehende Heraus-
bildung einer Avantgarde, eines Kerneuropas nach dem zweistufigen Vorhut-Nachhut-Modell, vor. Ob-
wohl Fischer bereits 2000 in seiner Humboldt Rede für einen Ausbau der verstärkten Zusammenarbeit
derjenigen Staaten vorsah, die enger kooperieren wollten als andere, revidierte er zwischenzeitlich diese
Ansicht,71 nur um sie in weiterentwickelter und angepasster Form wieder aufzugreifen. Prinzipiell wäre
eine Avantgarde in verschiedenen Konstellationen denkbar. Aus geopolitischen Überlegungen heraus
kämen etwa die EU-Staaten Mitteleuropas infrage, oder aus kollektiv-historischen, kulturellen Gründen
die EWG-Gründungsstaaten mit Deutschland und Frankreich als „Kern des Kerns“.72 Die Vorhut be-
stünde bei Fischer allerdings aus den Staaten der Eurozone. Die Nachhut würden die EU-Mitgliedstaa-
ten ohne Euro bilden, das EP und die übrigen Strukturen der EU würden parallel weiterbestehen.
Aufgrund der Unwahrscheinlichkeit, mit allen 28 EU-Mitgliedstaaten eine Einigung zu erzielen,
komme zunächst nur die Gruppe der 19 Euroländer als handlungsfähiger Akteur in Frage, um die poli-
tische Integration zu verwirklichen. Bereits jetzt lassen sich bezüglich der Koordination von Wirt-
schafts- und Währungsangelegenheiten drei verschiedene Gruppen identifizieren: Die Gruppe der 19
Euroländer, die Gruppe der „Pre-Ins“ – also derjenigen Staaten, die das Ziel der Einführung des Euro
aktiv verfolgen zuzüglich der Staaten, die sich freiwillig an gemeinsamen wirtschaftspolitischen Re-
formmaßnahmen wie z.B. dem Euro-Plus-Pakt beteiligen – und die Gruppe der dauerhaften Außenseiter,
welche ein Opt-Out haben oder sich ihrer vertraglichen Verpflichtungen in diesem Zusammenhang ent-
ziehen.73 Wichtig bei der festen Etablierung dieser bereits in Teilen bestehenden Vorhut-Nachhut-Struk-
tur ist, dass diese Euro-Union nach außen hin Attraktivität ausstrahlt und keine Exklusivität beansprucht.
Es sollen schließlich nach und nach alle EU-Mitgliedstaaten dieser engeren, politischen Union beitreten.
Dies könnte durch bestimmte Beobachtungs- und Informationsrechte der Pre-Ins bei Verhandlungen der
Avantgarde-Gruppe gefördert werden. In jedem Falle wäre insgesamt eine „flexible Netzwerkstruktur
mit Durchlässigkeit von der äußeren zur inneren Schale und von dort zum Kern“74 unerlässlich um die
erforderliche Zentripetalkraft für den Zusammenhalt des Gesamtprojekts zu erzeugen.
Um die Eurozone in eine vollhandlungsfähige Avantgarde zu transformieren, benötigt sie eigene
Organe. Hierzu sollen eine eigene Euro-Legislative und Euro-Regierung mit starker Rückanbindung an
die Nationalstaaten geschaffen werden.
71 In einem am 28.02.2004 veröffentlichten Interview mit der Berliner Zeitung sagte er, er hätte würde seine
Humboldt-Rede anders halten: „Ich bin zwar mehr denn je überzeugt, dass Europa mehr Integration und stärkere
Institutionen braucht. Aber klein-europäische Vorstellungen teile ich nicht mehr.“ http://www.berliner-zei-
tung.de/archiv/aussenminister-joschka-fischer-ueber-die-integration-der-tuerkei--den-ruecktritt-schroeders-als-
spd-chef-und-eine-beziehung-zwischen-koch-und-kellner--klein-europaeische-vorstellungen-funktionieren-ein-
fach-nicht-mehr-,10810590,10155702.html (letzter Zugriff: 24.03.2015) 72 Vgl. Maass, Gero/Veit, Winfried (2012): Kerneuropa – weiche Schale(n), harter Kern. Zur Debatte über Eu-
ropas Zukunft, Internationale Politikanalyse, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, S.9 73 Vgl. Ondarza (2012), a.a.O., S.20 74 Maass/Veit (2012), a.a.O., S.9
16
3.1.2 Eurokammer und Euroregierung – ein intergouvernemental legitimiertes Regie-
rungssystem Angesichts des Fehlens eines europäischen demos und des Mangels an Bürgernähe der EU-
Organe sowie Akzeptanz ihrer Entscheidungen in der Bevölkerung, schlussfolgert Fischer für die sup-
ranationale EU-Politik, „dass weder EU-Kommission noch Europaparlament über die notwendige de-
mokratische Legitimation in den nationalen Öffentlichkeiten verfügen, die für jede Demokratie uner-
lässlich ist“75. Als Konsequenz daraus folgt, dass die Legitimation für eine politische Integration Euro-
pas vor allem zunächst über die nationalen Regierungen und Parlamente erfolgen muss, mit denen die
Bürger weitaus mehr vertraut sind. Um jedoch nicht nur die nationalen Exekutiven sondern vor allem
auch die Legislativen stark in die europäische Entscheidungsfindung einzubinden, soll anstatt eines
„Rats des Euroraumes“ – als Pendant zu Rat der EU oder Ausbau der inoffiziellen Zusammenkünfte der
„Eurogruppe“ – vielmehr eine Eurokammer aus Delegierten der nationalen Parlamente die Rolle des
Gesetzgebers übernehmen. Diese Eurokammer wäre zuständig für „Haushalts-, Finanz- und Wirt-
schaftsfragen und […] alle[…] Fragen der Subsidiarität […] und in europäischen Verfassungsfragen“76.
Die proportionale Zusammensetzung dieser parlamentarischen Vertretung vollendet den intergouverne-
mentalen Charakter dieses Organs. Neben der Eurokammer soll eine Euroregierung aus der Gruppe der
Staats- und Regierungschefs entstehen. Hierbei kann an das seit Ausbruch der Schuldenkrise entstan-
dene, seit Oktober 2011 institutionalisierte77 und im Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steue-
rung (SKSV) förmlich bestätigte (Art. 12) Sonderorgan des Euro-Gipfels angeknüpft werden. Diesen
mindestens zweimal jährlich stattfindenden Sondertreffen sitzt ein Präsident vor, zu dem in der bisheri-
gen Praxis der Präsident des ER gewählt wurde. Der Ausbau dieses Formats zu einer Regierung der
Eurozone würde in dieser Hinsicht eine Abgrenzung vom ER bedeuten müssen. Eine fortgesetzte Per-
sonalunion würde nämlich entweder die Frage der Legitimation der Teilnahme eines Regierungschefs
eines Nicht-Eurolandes (wie es gegenwärtig mit dem polnischen Ministerpräsidenten und Präsidenten
von ER und Euro-Gipfel Donald Tusk der Fall ist) an der Entscheidungsfindung der Euroregierung auf-
werfen, oder aber die zukünftige ER-Präsidentschaft eines Nicht-Eurolandes ausschließen.78 Die Infor-
mationsrechte des EP und der Nicht-Euroländer nach Art.12 Abs.5 und 6 SKSV hingegen könnten zu-
gunsten einer permeablen Netzwerkstruktur des Kerns durchaus weiterbestehen.
Die großen Gewinner dieser Veränderung wären die nationalen Regierungen und noch mehr die
nationalen Parlamente. EP und Kommission als supranationale Organe würden trotz formalen Weiter-
bestehens der „übrigen“ EU substantiell geschwächt. Nicht zuletzt da zu erwarten wäre, dass sich der
Großteil der Entscheidungsfindung auf die – zumindest so beabsichtigt – effizientere Avantgarde-Ebene
75 Fischer, Joschka (2011): Es wird einsam und kalt um Europa, Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung vom
01.11.2011, http://www.sueddeutsche.de/politik/joschka-fischer-fordert-europaeische-regierung-es-wird-einsam-
und-kalt-um-europa-1.1177334 (letzter Zugriff: 27.03.2015) 76 Fischer (2014), a.a.O., S.151 77 Siehe Erklärung des Euro-Gipfels vom 08.11.2011, Brüssel http://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Standardartikel/Themen/Europa/2011-10-28-erklaerung-eu-rat-anlage-d.pdf?__blob=publication-
File&v=4 (letzter Zugriff: 20.03.2015) 78 Vgl. Ondarza (2012), a.a.O., S.24
17
verlagern würde. Durch die Schaffung der Eurokammer würde allerdings auch die Rolle des Rats an
Bedeutung verlieren. Dieses Zugeständnis an die Rolle der nationalen Demokratien soll vor allem einer
umfangreicheren Renationalisierung von Entscheidungen vorbeugen, wie sie sich ansatzweise im Nach-
spiel des Ausbruchs der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 abzeichnete: in der Entscheidung
die Krisenreaktion nicht zu europäisieren.79
Die erste Option zur Einleitung dieser Zwischenphase der institutionalisierten differenzierten
Integration und der legitimatorischen Rückankopplung an die Nationalstaaten besteht nach Fischer in
der Schließung eines zwischenstaatlichen Vertrags „außerhalb und jenseits der europäischen Ver-
träge“80. Alternativ oder ergänzend dazu könnte diese Phase im politischen Einigungsprozess unter Zu-
hilfenahme des Art.20 EUV über die Verstärkte Zusammenarbeit erfolgen. Wobei hier auf die Erforder-
lichkeit einer einstimmig beschlossenen Ermächtigung des Rats hingewiesen sei (Art.329 Abs.2 S.4
AEUV). In jedem Falle bedient sich Fischer bereits bei der Frage der Gründungslegitimation eines ty-
pisch eidgenössischen Elements: direkte Demokratie. Um eine europäische Demokratie zu schaffen,
bedürfe es an Referenden – in allen beteiligten Staaten.
3.2 Phase II – Eidgenössisches Modell für die Vereinigten Staaten von Europa Als heterogener Bundesstaat, der sich aus einem Staatenbund heraus entwickelt hat und in dem
auf Bundesebene vier Amtssprachen existieren, scheinen sich Analogien zur Schweiz in Bezug auf die
EU bereits aufgrund ähnlicher Grundparameter anzubieten. Nach Fischer dient die Willensnation, die
sich aus traditionellen Gründen noch Konföderation nennt, jedoch nicht nur aus einer historischen und
soziokulturellen Betrachtungsweise als Vorbild für die EU. Ist in der Zwischenphase für die Avantgarde-
Gruppe ein ausschließlich im intergouvernementalen Modus legitimiertes Entscheidungssystem vorge-
sehen, so schlägt Fischer ein Zweikammer-System mit direktgewählter Regierung nach eidgenössi-
schem Vorbild für das Regierungssystem der vollendeten Vereinigten Staaten von Europa vor. Im Fol-
genden werden einige Implikationen für die Übernahme des „schweizerischen Modells“ für dieses Zu-
kunftskonzept der EU herausgearbeitet ohne die Analogie zu sehr überspitzen zu wollen.
Für den europäischen Bikameralismus würde die eidgenössische Schablone die völlige Gleich-
berechtigung der beiden Kammern bedeuten. Das EP, als Äquivalent zum Nationalrat, würde als erste
Kammer die Interessen des Volkes vertreten und die Eurokammer, das Gegenstück zum Ständerat, als
zweite Kammer die Interessen der Gliedstaaten. Gerade in Bezug auf die Parteiensysteme – hoher He-
terogenitätsgrad, lockere Parteienbündnisse – sind Ähnlichkeiten offenkundig.81 In der Schweiz besitzt
das Parlament Initiativrechte in der Gesetzgebung aber auch in weiteren Bereichen wie zum Beispiel im
Agenda-Setting. Der Großteil der Gesetzesinitiativen geht trotz dieser Kompetenzen von der Regierung
79 Vgl. Fischer (2014), a.a.O., S.38 80 a.a.O., S.138 81 Vgl. Kranenpohl, Uwe (2007): Sui(sse) generis. Die Eidgenossenschaft – Referenzsystem für die institutionelle
Fortentwicklung der Europäischen Union?, in: Patzelt/Sebaldt/Kranenpohl (Hrsg.): Res publica semper refor-
manda, Wiesbaden: VS, S.597-611, S.603
18
aus.82 Der Bundesrat stellt eine Kollegialregierung dar. Der Bundespräsident ist demnach kein Staats-
oberhaupt sondern besitzt lediglich eine Repräsentations- und Vorsitzfunktion. Die Funktion des Staats-
oberhauptes und Regierungschefs übt der siebenköpfige Bundesrat als geschlossene Exekutive als Gan-
zer aus.83 Die europäische Regierung nach diesem Modell würde von Eurokammer und EP in gemein-
samer Sitzung gewählt werden, könnte aber nicht von denselben aus politischen Gründen abberufen
werden. Da sie, anders als heute, nicht aus einem Regierungsmitglied pro Mitgliedsstaat bestehen würde,
müssten geeignete Grundsätze für die Zusammenstellung der Regierung gefunden werden, die „the
sustaining of balance in the representation of the cantons, political parties, regions, language, religious,
cultural communities, and even between men and women“84 bestmöglich gewährleisten. Neben einer
„Zauberformel“ für die parteipolitische Zusammensetzung, die den wichtigsten Parteifamilien eine ver-
hältnismäßige Beteiligung an der Regierung zusichert, könnten etwa ähnlich wie in der Schweiz85 be-
völkerungsmäßig größere Staaten und Sprachregionen angemessene Berücksichtigung bei der Ernen-
nung der Regierungsmitglieder finden.
Abgesehen von den Leitsätzen – „unus pro omnibus, omnes pro uno“ und „in varietate con-
cordia“ – bestehen vor allem einige funktionslogische Ähnlichkeiten zwischen den beiden Systemen.
Zum einen sind beide von einer föderalen Struktur mit drei Ebenen geprägt,86 weshalb sich die EU auch
bezüglich des Umgangs mit dem Prinzip der Subsidiarität an dem schweizerischen Vorbild orientieren
könnte. Auch in Hinblick auf das Regierungssystem stellen beide Fälle Sonderformen dar, die nicht
ganz einfach mit den üblichen Kategorien fassbar sind. So erscheint auch die Schweiz als „Zwitter der
beiden Grundmodelle“87 der präsidentiellen und parlamentarischen Demokratie. Aufgrund der Nichtab-
berufbarkeit der Regierung wäre dieses EU-System nach Steffani als präsidentiell einzustufen. Da das
Parlament allerdings zumindest durch das Bestellverfahren Einfluss auf die Regierung hat, ist wiederum
ein Element parlamentarischer Demokratie vorhanden. Würde diese neue EU-Regierung die intergou-
vernementale Euroregierung komplett ablösen, bestünde auch das für semi-präsidentielle typische Ele-
ment der doppelten Exekutive nicht mehr weiter. Somit bestünde wiederum ein nicht eindeutig einzu-
ordnendes Regierungssystem mit überwiegender Gewaltentrennungslogik und somit starker Affinität
zur präsidentiellen Regierungsform.
4. Politik der großen Sprünge? Eine kritische Betrachtung
Auf den ersten Blick wird nicht klar, ob Fischer zu den Optimisten oder den Pessimisten in der
Debatte um das Demokratiedefizit der EU gehört. Letztere kennzeichnen sich dadurch, dass sie das
82 Vgl. Krumm, Thomas (2013): Das politische System der Schweiz – Ein internationaler Vergleich, München:
Oldenbourg, S.147 83 A.a.O., S.212 84 Tsachevsky, Venelin (2014): The Swiss Model – The Power of Democracy, Frankfurt a. M.: Peter Lang, S.73 85 Dazu Linder, Wolf (2012): Schweizerische Demokratie. Institutionen – Prozesse – Perspektiven, 3. Auflage,
Bern/Stuttgart/Wien: Haupt, S.250 86 Vgl. Kranenpohl (2007), a.a.O., S.603 87 Linder (2012), a.a.O., S.245
19
Vorhaben einer Demokratisierung zwar für „wünschenswert, aber auf absehbare Zeit unmöglich“88 hal-
ten und die nationale Demokratie durch die fortschreitende Integration gefährdet sehen. Im Wesentli-
chen hält er eine demokratische EU auf lange Sicht jedoch für möglich und erstrebenswert – allerdings
nicht in Anknüpfung an die bisherigen Entwicklungslinien. Um bei der Metapher des Rubikon zu blei-
ben, besteht Fischers Vorschlag im Wesentlichen darin, zunächst den Rückzug auf das bekannte Terrain
zwischenstaatlicher Governance-Strukturen anzutreten, um mit neuem Anlauf und einem gewagten
Sprung „das andere Ufer zu erreichen“89 Im Folgenden wird überprüft, inwieweit das zuvor erarbeitete
Modell mit der bestehenden System- und Entwicklungslogik kompatibel, den in Angriff genommenen
Problemen angemessen und in Hinblick auf die politischen und rechtlichen Hürden umsetzbar ist. Der
Fokus liegt hier auf einigen hervorzuhebenden Aspekten, die bei einer Erwägung des Vorschlags zu
diskutieren wären.
4.1 Pfadabhängigkeit Fischer greift mit seinem Vorschlag durchaus Entwicklungsrealitäten auf. Insbesondere sein
langfristiges Modell kommt dem gegenwärtigen System sehr nah. So vor allem in Bezug auf das Zwei-
kammersystem oder die Kommission als Kollegialorgan, welches bspw. in Folge eines erfolgreichen
Misstrauensantrags, geschlossen das Amt niederlegt. Vor allem greift das Zweiphasenmodell die Reali-
tät der differenzierten Integration in der EU auf. Die Stärkung der Rolle der nationalen Regierungen und
Parlamente als mittelfristige Lösung spiegelt politische Handlungsmuster im Umgang mit der aktuellen
Krise wider. Nicht zuletzt wird sich auch in EU-Europa allmählich Formen direkter Demokratie zuge-
wandt. Obwohl in der EU, streng genommen, längst keine echten direktdemokratischen Instrumente im
Sinne einer Volksabstimmung existieren,90 war die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative doch
ein erster Schritt in diese Richtung.
Insbesondere die Änderungsvorschläge für die Zwischenphase stellen insgesamt einen gravie-
renden Bruch mit bisherigen Entwicklungspfaden dar. Obwohl die gesamte Integrationsgeschichte von
der Konfliktlinie zwischen Supranationalismus und Intergouvernementalismus geprägt war, wäre die
vorgeschlagene Governance-Struktur für die Eurozone ein stark rückwärtsgewandter Schritt. Obwohl
mit der Gemeinsamen Versammlung zu Beginn der europäischen Integration bereits ein in der Zusam-
mensetzung ähnliches Organ wie die Eurokammer existierte und auch die nationalen Regierungen von
Beginn an eine sehr zentrale Rolle in der Entscheidungsfindung innehatten, war der Fortschritt der In-
tegration doch immer von einer zentralen supranationalen Instanz abhängig: der Hohen Behörde bzw.
der Europäischen Kommission. Auch die sehr starke und plötzliche Abwertung des EP liefe einer lang-
jährigen Entwicklungsgeschichte zuwider. Die Euro-Avantgarde entstünde nicht nur durch einen zwi-
schenstaatlichen Vertrag sondern hätte auch institutionell weitestgehend Ähnlichkeit mit einer typischen
88 Schäfer, Armin (2006): Nach dem permissiven Konsens. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union, in:
Leviathan, Vol.34, Nr.3, S.350-376, S.351 89 Fischer (2014), a.a.O., S.35 90 Vgl. Church, Clive/Dardanelli, Paolo (2005): The Dynamics of Confederalism and Federalism: Comparing
Switzerland and the EU, in: Regional and Federal Studies, Vol.15, No.2, S.163-185, S.180
20
Internationalen Organisation. Dass die restlichen EU-Strukturen unangetastet bleiben, bestätigt nur den
Eindruck, dass sich der Schwerpunkt der europapolitischen Aktivität intendiert sehr stark auf diese
Kernunion verschieben würde. Was die Institutionalisierung der differenzierten Integration in Bezug auf
die Eurozone angeht, so wäre dies generell tatsächlich mit jüngsten Entwicklungslinien im Einklang.
Die kürzlich entstandenen Sonderorgane der Eurozone aber auch das neue QMV-Quorum seit Novem-
ber 2014 würden es den 19 Euroländern, mit ihrer Einwohnerzahl von ca. 337,5 Mio. gegenüber der
Gesamtbevölkerung von ca. 506,9 Mio.91 (etwa 66,6%) erlauben, Beschlüsse ohne Zustimmung der üb-
rigen EU-Mitglieder zu fassen. Mit Euro-Gruppe und Eurogipfel existieren bereits heute zwei Sonder-
organe, die an das Modell der Zwischenphase erinnern. Allerdings würde Fischers Vorschlag einer Eu-
rokammer hier auch der Entwicklungstendenz einer Kompetenzverschiebung zum Rat92 zuwiderlaufen.
Vergleicht man das System der Endphase mit dem gegenwärtigen institutionellen Gefüge der
EU, so entsteht das Bild, als wären die beiden Mischsysteme gar nicht so weit voneinander entfernt.
Lediglich die Zusammensetzung des Rates müsste verändert, sowie die Bestellung der Kommission
einhergehend mit einer – bereits im Lissaboner Vertrag vorgesehenen – Reduzierung der Anzahl der
Kommissare angepasst werden. Fischer scheint den zur Überwindung des Demokratiedefizits notwen-
digen Zusammenhalt der europäischen Völker durch mehr Zeit und eine Rückanbindung an die Natio-
nalstaaten fördern zu wollen. In etwa nach dem Motto: einen Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn.
4.2 Hinlänglichkeit Mit der vorgeschlagenen Transformation sollen gleich zwei zentrale Ziele verfolgt werden. Eine
Steigerung bzw. Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der EU oder zumindest eines Kerns davon
um internationalen Herausforderungen effektiver begegnen zu können. Zweitens, eine konsequente Re-
aktion auf das Legitimitätsdefizit, verursacht durch das Fehlen eines gesamteuropäischen demos. Da das
EP auf kurze Sicht nicht die notwendige demokratische Legitimität aufbringen können wird, muss die
Legitimation indirekt über die Nationalstaaten kommen. In Anbetracht der gegenwärtigen Europa-
müdigkeit sollte eine substanzielle Reform so stark wie möglich mit einer Entscheidung der europäi-
schen Bevölkerungen verknüpft sein. Womöglich auch aus mangelnder Erfahrung mit dieser Art bei-
spiellosem System zwischen Bundesstaat und Staatenbund, könnte sich eine stärkere Orientierung an
bekannten Mustern (Föderation und Konföderation) anbieten.
Über den tatsächlichen Erfolg im Falle einer Umsetzung des Konzepts lassen sich höchstens
Vermutungen anstellen. Eine Frage wäre, ob durch den geplanten Zwischenschritt eine Europäisierung
der Öffentlichkeit in der Tat so weit befördert werden würde, wie es für den Übergang zum nächsten
Schritt aber auch für das Funktionieren des Vorhut-Nachhut-Prinzips notwendig wäre. Die Rückverla-
gerung der Nationalstaaten ins Zentrum der europäischen Entscheidungsfindung sowie die gleichzeitige
Drosselung der – nicht zuletzt aufgrund der Aufwertung des EP – entstehenden gesamteuropäischen
91 Bevölkerungszahlen vom 01.01.2014 aus Eurostat: http://ec.europa.eu/euros-
tat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tps00001&plugin=1 (letzter Zugriff: 28.03.2015) 92 Vgl. Ondarza (2012), a.a.O., S.26f.
21
politischen Konfliktlinien93 birgt gerade die Gefahr der Renationalisierung europäischer Debatten. Da
nationale Parlamente und Regierungen zumindest in der Zwischenphase nicht mehr ohne Weiteres in
der Lage wären, die Verantwortung für negative Outcomes auf supranationale Akteure abzuwälzen,
könnte dies einerseits entweder einen europabezogeneren Wahlkampf oder aber das Gegenteil hervor-
bringen. Gerade aufgrund der aufrechtzuerhaltenden Diversität der Mitgliedstaaten würden national ge-
prägte Konfliktlinien spätestens erstarken wenn sich herausstellt, dass auch dieses Konzept keine
Gleichheit der Lebensbedingungen bieten können wird. Würde diesem intergouvernementalen Modell
die Schaffung einer tragfähigen europäischen Öffentlichkeit nicht gelingen, so wäre das gesamteuropä-
ische EP auch in einer anschließenden europäischen Föderation, zumindest zu Beginn, ähnlichen Legi-
timierungsschwierigkeiten ausgesetzt wie heute. Was die Schaffung der Eurokammer und die damit
einhergehende Verlagerung klassischer „Ratsbefugnisse“ auf die nationalen Legislativen angeht, lassen
Untersuchungen bezüglich des Verhältnisses zwischen EP und nationalen Parlamenten94 daran zweifeln,
ob dieser Kompetenzzuwachs den meisten Parlamenten zugutekommt, sondern womöglich eher zu „ei-
ner nicht zu unterschätzenden Überlastung nationaler Parlamentarier durch volle doppelte Mandatsaus-
übung“95 führt. Angesichts der, planmäßig, vorübergehenden intergouvernementalen Entscheidungs-
struktur, könnte diese Rückübertragung von Verantwortung auf nationalstaatliche Akteure aus neofunk-
tionalistischer Sicht zu spill-back-Effekten führen, die negative Auswirkungen auf eine Zunahme an
Integration haben könnten. Eine Befürchtung bezüglich der abgestuften Integration ist die, dass anstatt
einer Avantgarde tatsächlich ein „Direktorium“ entsteht, welches die Integrationsrichtung vorgibt und
kleineren oder zunächst nicht zur Kerngruppe gehörenden Staaten keine gleichberechtigten Mitgestal-
tungsmöglichkeiten übrig lässt – trotz vorausgegangenen Beitritts zum europäischen Integrationspro-
jekt. In Bezug auf das Legitimationsdilemma bleibt zudem noch die Frage nach dem Entscheidungsmo-
dus in der Zwischenphase offen. Bei Einstimmigkeitsprinzip stünde die Handlungsfähigkeit und somit
die mit der Abkopplung der Avantgarde zu bezweckende Output-Legitimation nicht weniger als in der
aktuellen EU in Frage. Im Falle „supranationaler“ Entscheidungsmechanismen wäre aber eben keine
lückenlose Legitimationskette bei Entscheidungen gegeben, bei denen nicht alle Mitgliedstaaten zuge-
stimmt haben. Das Erfordernis einer europäischen Öffentlichkeit wäre also weiterhin gegeben – selbst
in einer Avantgarde der integrationsbereiten Staaten.
Abgesehen von Spekulationen über ihren Erfolg ist der Preis eines Scheiterns dieser Strategie
auf der anderen Seite ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Vor allem die Verfestigung von Strukturen
der differenzierten Integration birgt die Gefahr einer Spaltung Europas. Sollten sich die Außenseiter-
93 Vgl. Kranenpohl (2007), a.a.O., S.605 94 Vgl. hierzu Winzen, Thomas/Roederer-Rynning, Christilla/Schimmelfennig, Frank (2014): Parliamentary co-
evolution: national parliamentary reactions to the empowerment of the European Parliament, in: Journal of Eu-
ropean Public Policy, S.3ff. 95 Maurer, Andreas (2014): Die Eurozone und die Europäische Union: Demokratiepolitische Probleme der Aus-
gründungskonzepte, in: Stratenschulte (Hrsg.): Heilsame Vielfalt? Formen differenzierter Integration in Europa,
Baden-Baden: Nomos, S.61-82, S.76
22
staaten gegen ein Nachlaufen fremdbestimmter Pfade weigern, wäre etwa die Schaffung eines konkur-
rierenden Integrationsprojektes, welches die Hoffnung auf ein gesamteuropäisches Einigungsprojekt mit
Wahrscheinlichkeit hinauszögern, die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa vielleicht verun-
möglichen, aber mit Gewissheit an die Herausbildung der EFTA 1960 erinnern würde.
4.3 Realisierbarkeit Dass die supranationalen Organe der EU dem Plan eines Entzuges ihrer Kompetenzen wider-
streben, dürfte auf der Hand liegen.96 Doch auch die Inangriffnahme dieses Vorhabens von Seiten der
Regierungen, die letzten Endes über die Richtung der Integration zu entscheiden haben,97 ist fragwürdig.
Auf die Frage, wie sein Konzept umgesetzt werden soll, verweist Fischer auf die Zuständigkeit der
Politiker für die nötige Überzeugungsarbeit.98 Während sich auf dem Wege eines zwischenstaatlichen
Vertrages die Regierungen der 19 Euroländer einigen und ihre Bevölkerungen per Referendum zustim-
men müssten, würde der Weg der Verstärkten Zusammenarbeit, wie oben angesprochen, Einstimmigkeit
im Rat erfordern. Selbst wenn Deutschland und Frankreich sich intern und miteinander – das Konflikt-
potenzial allein einer deutschen Referendumsdebatte sollte nicht unterschätzt werden – auf die besagten
Maßnahmen einigen und gemeinsam als Führung vorangehen würden, wäre ihr, im Zuge der Erweite-
rungen geschrumpfter, Einfluss kaum groß genug, um die übrigen Euroländer, geschweige denn EU-
Mitglieder zu überzeugen.99 Gerade angesichts der anhaltenden Spannungen im Euroraum und vor allem
zwischen Griechenland und Deutschland sind die Aussichten auf eine Verpflichtung der Euroländer zu
einer vertieften, politischen Bindung, die so risikoreich und mit den bisherigen Strukturen auf europäi-
scher Ebene so inkongruent ist, eher schlecht. Auch hinsichtlich der geplanten Transformation vom
mittelfristigen intergouvernementalen Regime zur Föderation wäre es interessant zu sehen, wie dieser
Schritt genau aussehen könnte. Denn spätestens dann müssten sich zumindest die Staats- und Regie-
rungschefs zugunsten einer supranationalen Regierung plötzlich stark zurücknehmen. Womöglich hofft
Fischer doch noch auf ein „Pfingstwunder“100, wenn die nationalen Regierungen insgesamt bereit sind,
das nötige Stückchen Souveränität zugunsten der Vollendung der Vereinigten Staaten von Europa auf-
zugeben.
96 Zur Haltung einiger MdEP zur Schaffung einer separaten Eurokammer: Fox, Benjamin: No eurozone-only as-
sembly, say MEPs, euobserver, 6.10.2012, https://euobserver.com/news/117773 (letzter Zugriff: 20.03.2015) 97 Vgl. Ludlow (2006), a.a.O., S.225 98 Vgl. Encke, Julia: Buchvorstellung Joschka Fischer: Von der Schweiz lernen, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
14.10.2014, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/joschka-fischer-stellt-sein-buch-scheitert-europa-vor-
13208080.html (letzter Zugriff: 20.03.2015) 99 Vgl. Holzinger, Katharina/Knill, Christoph (2002): Path Dependencies in European Integration: A Construc-
tive Response to German Foreign Minister Joschka Fischer, in: Public Administration, Vol.80, No.1, S.125-152,
S.140f. 100 Vollständiges Zitat: „Es wird kein Pfingstwunder geben, und auf einmal akzeptieren die Menschen die EU-
Kommission als europäische Regierung. Der Nationalstaat ist und bleibt der Bezugsrahmen der Bürger […]“ in:
Spörl, Gerhard/Blome, Nikolaus: Ein bisschen frustriert ja, SPIEGEL-Gespräch mit Joschka Fischer,
13.10.2014, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-129736979.html (letzter Zugriff: 13.10.2014)
23
Trotz aller Bedrohlichkeit der gegenwärtigen Krisen legt die bisherige Entwicklungsgeschichte
der EU nahe, dass ihr Ausbau sehr wahrscheinlich weiterhin inkrementell101 und als Kompromiss zwi-
schen verschiedenen Leitbilden102 erfolgen wird.
5. Fazit
Was Fischer vorschlägt, ist im Grunde nicht neu. Der Ex-Politiker stellt mit seinem Konzept
bekannte Bausteine der bisherigen Reformgeschichte und -debatte zur Verfügung und setzt sie in ein
bisher eher ungewohntes Verhältnis zueinander in Bezug. War die institutionelle Geschichte des euro-
päischen Integrationsprozesses, wie gezeigt wurde, doch von Anfang an von Mischformen und Kom-
promissen zwischen Leitbildern geprägt, bricht Fischer mit dem „Weder-noch“ zwischen Internationa-
ler Kooperation und Föderation. Was allerdings das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive im
Finalitätszustand angeht, scheint er das immanente hybride Wesen der EU in seinem Reformkonzept
aufgreifen zu können – Dank Möglichkeit eines Rückgriffs auf ein systemverwandtes Präzedens. Doch
bei allen Ähnlichkeiten zur Schweiz sollte der Vergleich nicht unreflektiert und überspannt auf ein den-
noch in grundlegenden Kriterien fundamental unterschiedliches System übertragen werden.
Mag das Reformmodell in seiner gegenwärtigen Form vor allem aufgrund seiner starken Un-
vereinbarkeit mit bisherigen Entwicklungstendenzen in der EU sowie der hohen politischen Hürden eine
äußerst geringe Aussicht auf Umsetzung haben, so ist es dennoch von Nutzen für Reformdiskussion und
Verständnis des EU-Regierungssystems. Fischer zeigt mit seinem Vorschlag woran es in der politischen
und wissenschaftlichen Auseinandersetzung fehlt: konkrete Ansagen, wie ein Weg aus der Krise ausse-
hen könnte. Zwar existieren klare Befürworter einer parlamentarischen oder präsidentiellen Demokrati-
sierungsstrategie für die EU. Allerdings wirken diese Konzepte im Kontrast zu Fischers Blaupause blind
gegenüber bestimmten realen Problem der Legitimität. Dass sein Vorschlag nicht so ganz in das Schema
der Hauptströmungen passt, zeigt, wie wichtig es ist, dass frische Impulse notwendig sind, um festge-
fahrene Debatten aufzurütteln. Besonders nützlich erscheint Fischers Aufgreifen der Realität der diffe-
renzierten Integration. In der Wissenschaft schießen erste aussagekräftige Analysen aus dem Boden, die
in Zukunft nicht aus der Gleichung herausgehalten werden sollten. Dies hätte das Potenzial, die Reform-
debatte um eine weitere relevante, tatsächlich vorhandene Konfliktlinie zu bereichern.
Ein politisches Projekt mit so vielen und so unterschiedlichen Stimmen wird allerdings auch
weiterhin eines der Kompromisssuche und nicht der am Reisbrett entstandenen Masterpläne sein. Daher
wird es für ein eingehendes Verständnis der EU in Zukunft von großem Wert sein, Erklärungsmuster zu
finden, die der Einzigartigkeit Europas gerecht werden und es doch mit bekannten Kategorien in Ver-
hältnis zu setzen versuchen. Ein Beispiel wären die Ansätze der europäischen demoi-kratie.
101 Vgl. Knelangen, Wilhelm (2012): Zwischen institutionellen Erbschaften und Verfassungssprung: Das Regie-
rungssystem der Europäischen Union, in: Regierungssysteme, Politische Bildung, Schwalbach: Wochenschau
Verlag, S.100-117, S.115 102 Vgl. Göler (2005), a.a.O., S.154
24
Literaturverzeichnis
Adler-Nissen, Rebecca (2011): Opting out of an ever closer union, in West European Politics, Vol.34, No.5, S.1092-1113
Auel, Katrin/Benz, Arthur (2007): Expanding National Parliamentary Control: Does It Enhance European Democ-racy?, in: Kohler-Koch/Rittberger (Hrsg.): Debating the Democratic Legitimacy of the European Union, Lanham: Rowman and Littlefield, S.57-74
Bocklet, Reinhold (2007): Das Europäische Parlament: Kompetenzzuwachs durch Vertragsänderung und im politi-schen Prozess von der Montanunion zum Maastrichter Unions-Vertrag, in: Patzelt/Sebaldt/Kranenpohl (Hrsg.): Res publica semper reformanda – Wissenschaft und politische Bildung im Dienste des Gemeinwohls, Fest-schrift, Wiesbaden: VS Verlag, S.612-625
Breitenmoser, Stephan (1995): Die Europäische Union zwischen Völkerrecht und Staatsrecht, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 55, S.951-992
Busch, Berthold (2014): Differenzierte Integration als Modell für die Zukunft der Europäischen Union?, IW Work-ing Paper, No.14, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Chardon, Matthias (2008): Mehr Transparenz und Demokratie – Die Rolle nationaler Parlamente nach dem Ver-trag von Lissabon, in: Weidenfeld (Hrsg.): Lissabon in der Analyse – Der Reformvertrag der Europäischen Union, Baden-Baden: Nomos, S.171-185
Cheneval, Francis/Lavenex, Sandra/Schimmelfennig, Frank (2014): Demoi-cracy in the European Union: principles, institutions, policies, in: Journal of European Public Policy
Church, Clive/Dardanelli, Paolo (2005): The Dynamics of Confederalism and Federalism: Comparing Switzerland and the EU, in: Regional and Federal Studies, Vol.15, No.2, S.163-185
Decker, Frank (2007): Parlamentarisch oder präsidentiell? Institutionelle Entwicklungspfade des europäischen Re-gierungssystems nach dem Verfassungsvertrag, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, S.181-202
Decker, Frank (2012): Electing the Commission President and commissioners directly: a proposal, in: European View, Vol.11, S.71-78
Decker, Frank/Sonnicksen, Jared (2009): Parlamentarisch oder präsidentiell? Die Europäische Union auf der Suche nach der geeigneten Regierungsform, in: Decker/Höreth (Hrsg.): Die Verfassung Europas – Perspektiven des Integrationsprojekts, Wiesbaden: VS Verlag, S.128-164
Decker, Frank/Sonnicksen, Jared (2011): An Alternative Approach to European Union Democratization: Re-Exam-ining the Direct Election of the Commission President, in: Government and Opposition, Vol.46, No. 2, S.168-191
Dosenrode, Søren (2012): The Road to Lisbon, in: Dosenrode (Hrsg.): The European Union after Lisbon – Polity, Politics, Policy, Farnham: Ashgate, S.7-20
Eichenberg, Richard/Dalton, Russel (2007): Post-Maastricht Blues: The Transformation of Citizen Support for Eu-ropean Integration, 1973-2004, in: Acta Politica, Vol.42, S.128-152, auch einsehbar auf: http://www.pal-grave-journals.com/ap/journal/v42/n2/full/5500182a.html (letzter Zugriff: 20.03.2015)
Fischer, Joschka (2010): Die Vereinigten Staaten von Europa, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Europa wagen, Gü-tersloh, S.233-247
Fischer, Joschka (2014): Scheitert Europa?, Köln: Kiepenheuer & Witsch
Ganghof, Steffen (2014): Is the ‚Constitution of Equality‘ Parliamentary, Presidential, or Hybrid?, in: Political Stud-ies
Gaupmann, Gloria (2008): Präsidentialismus als Leitmotiv für Europa? Eine neue Perspektive für die institutionelle Weiterentwicklung der Europäischen Union, Marburg: Tectum Verlag
25
Göler, Daniel (2005): Das Phänomen der europäischen Integration. Die Einmaligkeit eines politischen Systems „im Werden“, in: Salewski, Michael/Timmermann, Heiner (Hrsg.): Europa und seine Dimensionen im Wandel, Münster: LIT, S.136-154
Holzinger, Katharina/Knill, Christoph (2002): Path Dependencies in European Integration: A Constructive Response to German Foreign Minister Joschka Fischer, in: Public Administration, Vol.80, No.1, S.125-152
Holzinger, Katharina/Schimmelfennig, Frank (2012): Differentiated Integration in the European Union: Many Con-cepts, Sparse Theory, Few Data, in: Journal of European Public Policy, Vol.19, No.2, S.292-305
Hooghe, Liesbet/Marks, Gary (2009): A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Con-sensus to Constraining Dissensus, in: British Journal of Political Science, Vol.39, S.1-23
Höreth, Marcus/Sonnicksen, Jared (2008): Making and Breaking Promises – the European Union Under the Treaty of Lisbon, Discussion Paper, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Bonn
Hurrelmann, Achim (2014): Democracy beyond the State: Insights from the European Union, in: Political Science Quarterly, Vol.129, No.1, S.87-105
Keutel, Anja (2012a): Geschichte und Theorie der abgestuften Integration Europas, SEU Working Paper, Universi-tät Leipzig
Keutel, Anja (2012b): Die Europäische Union zwischen einheitlicher Integration und Abstufung, Serie Europa, No.5, Universität Leipzig
Kielmansegg,Peter Graf (2003): Integration und Demokratie, in: Jachtenfuchs/Kohler-Koch (Hrsg.): Europäische Integration, 2.Auflage, Opladen: Leske & Budrich, S.49-84
Kirsch, Andrea (2008): Demokratie und Legitimation in der Europäischen Union, Baden-Baden: Nomos
Knelangen, Wilhelm (2005): Regierungssystem sui generis? Die institutionelle Ordnung der EU in vergleichender Sicht, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, Vol. 3, Nr.1, S.7-33
Knelangen, Wilhelm (2012): Zwischen institutionellen Erbschaften und Verfassungssprung: Das Regierungssystem der Europäischen Union, in: Regierungssysteme, Politische Bildung, Schwalbach: Wochenschau Verlag, S.100-117
Kranenpohl, Uwe (2007): Sui(sse) generis. Die Eidgenossenschaft – Referenzsystem für die institutionelle Fortent-wicklung der Europäischen Union?, in: Patzelt/Sebaldt/Kranenpohl (Hrsg.): Res publica semper reformanda, Wiesbaden: VS, S.597-611
Krumm, Thomas (2013): Das politische System der Schweiz – Ein internationaler Vergleich, München: Oldenbourg
Lindbergh, Leon/Scheingold, Stuart (1970): Europe’s Would-be Polity: Patterns of Change in the European Com-munity, Englewood Cliffs: Prentice Hall
Linder, Wolf (2012): Schweizerische Demokratie. Institutionen – Prozesse – Perspektiven, 3. Auflage, Bern/Stutt-gart/Wien: Haupt
Loewenstein, Karl (1952): The Union of Western Europe: Illusion and Reality. I. An Appraisal of the Methods, in: Columbia Law Review, Vol.52, No.1, S.59-99
Ludlow, N. Piers (2006): From Deadlock to Dynamism – The European Community in the 1980’s, in: Dinan, Des-mond (Hrsg.): Origins and Evolution of the European Union, Oxford: University Press, S.218-232
Maass, Gero/Veit, Winfried (2012): Kerneuropa – weiche Schale(n), harter Kern. Zur Debatte über Europas Zu-kunft, Internationale Politikanalyse, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung
Maurer, Andreas (2014): Die Eurozone und die Europäische Union: Demokratiepolitische Probleme der Ausgrün-dungskonzepte, in: Stratenschulte (Hrsg.): Heilsame Vielfalt? Formen differenzierter Integration in Europa, Ba-den-Baden: Nomos, S.61-82
26
Nicolaïdis, Kalypso (2013): European Demoicracy and Its Crisis, in: Journal of Common Market Studies, Vol.51, No.2, S.351-369
Ondarza, Nicolai von (2012): Auf dem Weg zur Union in der Union. Institutionelle Auswirkungen der differenzier-ten Integration in der Eurozone auf die EU, in: Integration, Vol.1, S.17-33, S.30
Oppelland, Torsten (2010): Institutionelle Neuordnung und Demokratisierung, in: Leiße (Hrsg.): Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon, Wiesbaden: VS Verlag, S.79-96
Philippe Schmitter (2000): How to Democratize the European Union…And Why Bother?, Oxford: Rowman & Little-field
Riedl, Hubertus (2012): Die Exekutive als Mitte des politischen Systems, München: Dr. Hut
Schäfer, Armin (2006): Nach dem permissiven Konsens. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union, in: Levia-than, Vol.34, Nr.3, S.350-376
Scharpf, Fritz W. (2009): Legitimacy in the Multilevel European Polity, MPIfG Working Paper 09/1
Schäuble, Wolfgang/Lamers, Karl (1994): Überlegungen zur europäischen Politik, Vorschläge für eine Reform der Europäischen Union, Positionspapier vom 01.09.1994, S.5f. einsehbar unter: https://www.cducsu.de/up-load/schaeublelamers94.pdf (letzter Zugriff: 20.03.2015)
Seeger, Sarah (2008): Die Institutionen- und Machtarchitektur der Europäischen Union mit dem Vertrag von Lissa-bon, in: Weidenfeld (Hrsg.): Lissabon in der Analyse – Der Reformvertrag der Europäischen Union, Baden-Ba-den: Nomos, S.63-98
Sonnicksen, Jared (2014): Ein Präsident für Europa: Zur Demokratisierung der Europäischen Union, Wiesbaden: Springer VS
Steffani, Winfried (1979): Parlamentarische und präsidentielle Demokratie – Strukturelle Aspekte westlicher De-mokratien, Opladen: Westdeutscher Verlag
Tömmel, Ingeborg (2008): Das politische System der EU, 3. Auflage, München: Oldenbourg
Tsachevsky, Venelin (2014): The Swiss Model – The Power of Democracy, Frankfurt a. M.: Peter Lang
Vanke, Jeffrey (2006): Charles de Gaulle’s Uncertain Idea of Europe, in: Dinan, Desmond (Hrsg.): Origins and Evo-lution of the European Union, Oxford: University Press, S.141-165
Warntjen, Andreas (2012): Designing Democratic Institutions: Legitimacy and the Reform of the Council of the European Union in the Lisbon Treaty, in: Dosenrode (Hrsg.): The European Union after Lisbon – Polity, Politics, Policy, Farnham: Ashgate, S.111-129
Winzen, Thomas/Roederer-Rynning, Christilla/Schimmelfennig, Frank (2014): Parliamentary co-evolution: national parliamentary reactions to the empowerment of the European Parliament, in: Journal of European Public Policy
Wonka, Arndt (2008): Die Europäische Kommission – Supranationale Bürokratie oder Agent der Mitgliedstaaten?, Baden-Baden: Nomos