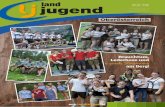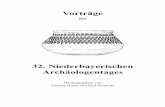Heinz Gruber, Das Neolithikum in Oberösterreich - Ein Überblick zum Forschungsstand, Fines...
Transcript of Heinz Gruber, Das Neolithikum in Oberösterreich - Ein Überblick zum Forschungsstand, Fines...
Fines TransireJahrgang 18 ● 2009
Verlag Marie Leidorf GmbH • Rahden/Westf. 2009
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich
Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko
18. Treffen
25. bis 28. Juni 2008
in Manching
Herausgeber: Miloslav Chytráček, Heinz Gruber, Jan Michálek, Ruth Sandner, Karl Schmotz
Redaktion: Ludwig Husty, Jan Michálek, Ruth Sandner, Karl Schmotz Mitarbeit: Ondřej Chvojka, Heinz Gruber, Daniela Hofmann, Joachim Pechtl
PC-Satz: Thomas Link & Ulrike Lorenz-Link GbR, Margetshöchheim
http://www.archaeologie-bay-cz-ooe.de
© 2009 Verlag Marie Leidorf GmbH, Geschäftsführer: Dr. Bert Wiegel, Stellerloh 65, D-32369 Rahden/Westf. – Tel.: +49/(0)5771/9510-74; Fax: +49(0)5771/9510-75 E-Mail: [email protected]; Internet: http://www.vml.de Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-8646-213-8ISSN 1868-2308
Auflage: 150
Gefördert durch die Ernst-Pietsch-Stiftung Deggendorf
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Grußworte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Jaromír BenešUmweltarchäologie und linearbandkeramische Kultur in Böhmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Anna-Leena Fischer – Birgit Gehlen – Thomas RichterZum Stand der Neolithisierungsforschung im östlichen Bayern: Fragestellungen,Fundstellen, Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Joachim PechtlÜberlegungen zur Historie der ältesten Linienbandkeramik (ÄLBK) im südlichen Bayern . . . . . . . . . . . . . 79
Ivan PavlůDie Anfangsprobleme des Neolithikums in Böhmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Petr ŠídaDie Gewinnung von Metabasit im Jizerské-Gebirge und ihre Rolle für die Neolithisierung Mitteleuropas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Heinz GruberDas Neolithikum in Oberösterreich – Ein Überblick zum Forschungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Franz PielerDie Linearbandkeramik im Horner Becken – Zur Neolithisierung am Ostrand der Böhmischen Masse. . . . 145
Rastislav Korený – Daniel StolzDie Anfänge der neolithischen Besiedlung in der Region Příbram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Petr Pokorný – Petr Kuneš – Petr Šída – Ondřej Chvojka – Ivo SvětlíkEnvironmental archaeology of the Mesolithic period in Bohemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Petr Šída – Ondřej Chvojka – Petr Pokorný – Petr KunešDie archäologische Untersuchung der mesolithischen Besiedlung am Teich Švarcenberk,Kr. Jindřichův Hradec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Daniela HofmannNoch mehr Häuser für die Bandkeramik: Neue Grabungen in Niederhummel und Wang, Landkreis Freising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Karl Heinz RiederMesolithikum und Altneolithikum im Ingolstädter Becken und der Altmühlalb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Petr KrištuvThe Protoeneolithic settlement of West and South Bohemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Jan John – Petr KočárTrial excavation of a talus cone at the Middle Eneolithic site of Radkovice-Osobovská skála and its archaeobotanical analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Teilnehmer und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
133Fines Transire 18, 2009
Das Neolithikum in Oberösterreich – Ein Überblick zum Forschungsstand
Heinz Gruber
Wenn man auf die Verbreitungskarte der neoli-thischen Fundstellen in Österreich blickt, ist deutlich der Schwerpunkt der archäologischen Forschung in Ostösterreich, vor allem in den Bundesländern Nie-derösterreich und Burgenland zu erkennen (Abb. 1)1. Die Fundstellendichte beruht dort auf der Verbindung zwischen früher Sammeltätigkeit einzelner Hei-matforscher seit dem 19. Jahrhundert und der For-schungsaktivität zahlreicher großer Forschungs- und Museumseinrichtungen aus dem Zentralraum Wien, wie z. B. dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums, der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Niederösterreichischen Lan-desmuseum und den zahlreichen baubegleitenden Rettungsgrabungen des Bundesdenkmalamtes.
In Oberösterreich hingegen fanden bislang verhält-nismäßig wenige archäologische Untersuchungen an neolithischen Fundstellen statt. Die Verbreitungs-karte zeigt hier vor allem die Interessensschwer-punkte einzelner Heimatforscher und -sammler. So beruht die Fundstellendichte zwischen Enns und Steyr und jene im Mühlviertler Donauraum auf den Aufsammlungen und Begehungen einiger weniger Privatpersonen.
Schon seit dem 19. Jahrhundert im Blickfeld der archäologischen Forschung sind die spätneoli-thischen Seeufersiedlungen des Salzkammergutes, an den Ufern des Mondsees, Attersees und Traunsees der Mondsee-Kultur. Nach den For-schungen J. Offenbergers in den 1970er und 1980er Jahren (Offenberger 1986; Ruttkay 1990), gab es in den letzten beiden Jahrzehnten auch hier nur wenige Aktivitäten in der Feldforschung. Erst in den letzten Jahren wurden hier durch die Österreichische Gesell-schaft für Feuchtboden- und Unterwasserarchäo logie sowie des Arbeitskreises für Unterwasserarchäo-logie der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und
Frühgeschichte wieder einige Surveys zur Erhebung des Zustandes der Seeufersiedlungen durchgeführt (Dworsky/Reitmaier 2004). Die geplante Einrei-chung der „Pfahlbauten in Seen und Mooren rund um die Alpen“ als UNESCO-Welterbe (Hafner/Harb 2008; Suter/Schlichtherle 2009) lässt auf eine ver-stärkte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den spätneolithischen und frühbronzezeitlichen See-ufersiedlungen des Salzkammergutes hoffen.
In den letzten Jahren setzte sich A. Binsteiner erst-mals intensiv mit der rohstoffkundlichen Auswer-tung der Silexinventare neolithischer Siedlungen im oberösterreichischen Zentralraum und in den Ufer-siedlungen des Mondsees auseinander (Binsteiner 2006; 2009).
Betrachtet man die kulturelle Zuordnung einzelner Fundstellen, wird der unterschiedliche Forschungs-stand in Oberösterreich und Niederösterreich/Bur-genland deutlich (Abb. 2): Während sich im Osten Österreichs die Mehrzahl der Fundstellen anhand ihrer Inventare kulturell einordnen lassen, bleibt dies in Oberösterreich die Ausnahme. Der hiesige Kenntnisstand beruht auch heute noch großteils auf Fundmaterialien von Oberflächenbegehungen, Befundungen im Rahmen archäologischer Gra-bungen bleiben leider die Ausnahme. Bei der kultu-rellen Zuordnung zeigt sich im südlichen Oberöster-reich deutlich die Bedeutung der Mondsee-Kultur, während im Linzer Zentralraum vor allem durch For-schungsprojekte und Auswertungen der vergangenen beiden Jahrzehnte genauere zeitliche und kulturelle Zuordnungen von Fundstellen und Fundmaterialen möglich geworden sind.
Die Mehrzahl der Oberflächenfunde stellen Felsstein-geräte, vornehmlich Beile, dar. Sie entziehen sich oft-mals einer genaueren kulturellen Zuordnung. Kleinere Silex-Artefakte oder Keramikfragmente wurden von Heimatforschern oft nicht als solche erkannt oder auch nicht gezielt aufgesammelt. Wie zahlreiche Oberflä-chenbegehungen in Oberösterreich zeigen, lässt der Zustand von Keramikfunden von der Ackeroberflä-che durch mechanische und chemische Einflüsse der modernen Landwirtschaft, Witterungseinflüsse und
1 Für das Einverständnis zum Abdruck der Karten sei Dr. Chris tian Mayer, Abt. für Bodendenkmale des Bundesdenk-malamtes, recht herzlich gedankt.
134 Fines Transire 18, 2009
teilweise auch durch kalkarme Böden, die Kalkstein-chen als Magerungsanteil im Scherben nahezu restlos auflösen können, oft zu Wünschen übrig.
Frühneolithikum
Eine grundlegende Zusammenfassung des For-schungsstandes über das frühe und mittlere Neolithi-kum gibt K. Grömer in ihrer Bearbeitung der neo-lithischen Siedlung von Leonding (Grömer 2001a; 2001b). Seither haben neben einigen Funden von Oberflächenaufsammlungen keine weiteren archäo-logischen Untersuchungen zu Siedlungsstellen oder Gräbern dieser Zeitstellung stattgefunden.
Während des frühen Neolithikums bleibt in Ober-österreich die Besiedlung des Alpenvorlandes auf seine Nordzone entlang der fruchtbaren Becken-landschaften des Donautals beschränkt (Abb. 3). Die frühesten neolithischen Funde in Oberösterreich sind
bereits aus der Zeit der Vornotenkopfkeramik aus Leonding und Rutzing bekannt (Grömer 2001b, 32).
Aus der Zeit der Bandkeramik sind bisher insgesamt neun Fundstellen vertreten, die sich alle im Linzer Zentralraum finden. Dies ist einerseits mit den natur-räumlichen Gegebenheiten und den fruchtbaren Löß-böden in Verbindung zu bringen, andererseits auch forschungsbedingtes Abbild. Ab der jüngeren Band-keramik zeigt sich, dass die Keramik in Oberöster-reich aufgrund der kurvo- und rektilinearen Motivik nach Osten hin in den niederösterreichischen und mährischen Raum orientiert ist. Während der späten Notenkopfkeramik ist ein aus dem Westen kommen-der Einfluss in Oberösterreich zu bemerken (z. B. Bandtypen mit Einstichen), was auf eine Lage im Grenzraum zwischen den süddeutschen und ostöster-reichisch-mährischen Gruppen hinweist, eine Situa-tion, die sich während des mittleren und späten Neoli-thikums noch weiter verstärkt (Grömer 2001b, 33).
Abb. 1: Verbreitungskarte neolithischer Fundstellen am nördlichen und östlichen Alpenrand. Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
135Fines Transire 18, 2009
Das späte Frühneolithikum kommt mit dem Šarka-Typus, der vor allem in Niederösterreich, Mähren und Böhmen, aber auch in Bayern vertreten ist, wie-derum im Linzer Zentralraum in Leonding und Haid vor. Nachweise von Stichbandkeramik sind hinge-gen in Oberösterreich bisher nicht bekannt (Grömer 2001b, 33).
Mit Spannung abzuwarten bleibt die Auswertung der früh- und endneolithischen Siedlungsbefunde der Rettungsgrabungen des Oberösterreichischen Lan-desmuseums 2001 in Tödling bei St. Florian (Pertl-wieser 2001). Dort konnten aufgrund von Pfosten-reihen mindestens elf Langhäuser mit daran ange-schlossenen Grubenobjekten dokumentiert werden, die im Norden und Westen durch Abschnittsgräben und ehemalige Wasserläufe begrenzt waren. Auf-grund der großflächigen Siedlungsbefunde sind im Rahmen der Auswertung wesentliche Ergebnisse
zum Kenntnisstand des frühen Neolithikums in Ober österreich zu erwarten.
Mittelneolithikum
Während des Mittelneolithkums dringt die Besied-lung des Alpenvorlandes bis an den Nordrand der Alpen vor (Abb. 4). Die mittlere Jungsteinzeit ist in Oberösterreich etwas stärker vertreten als das frühe Neolithikum und vor allem durch Oberflächen-aufsammlungen nachgewiesen. Lediglich die Gra-bungen des Oberösterreichischen Landesmuseums in St. Florian-Ölkam erbrachten großflächige Befunde einer Kreisgrabenanlage samt dazugehöriger Sied-lung. Zwei konzentrische und zeitlich aufeinander folgend angelegte Grabenwerke und eine unmittel-bar angrenzende Siedlung erbrachten große Mengen lengyelzeitlichen Fundmaterials. Neben Hinweisen auf die bemaltkeramische Kultur lässt die wissen-schaftliche Auswertung auch Hinweise auf südost-
Abb. 2: Kenntnisstand der kulturellen Zuordnung neolithischer Fundstellen. Rot: hoher Anteil, blau: geringer Anteil der Fundstellen einer Kultur zuordenbar. Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
136 Fines Transire 18, 2009
bayerische Kulturgruppen des Mittelneolithikums erwarten.
Nach K. Grömer wird das Mittelneolithikum in Ober österreich dadurch charakterisiert, dass sich wohl im Linzer Zentralraum die Grenze zwischen dem Südostbayerischen Mittelneolithikum (SOB) und der Lengyelkultur in Ostösterreich ziehen lässt (Grömer 2001b, 36).
Dass Oberösterreich im Schnittpunkt östlicher und westlicher Kulturerscheinungen steht, zeigten auch die Rettungsgrabungen des Oberösterreichischen Lan-desmuseums in Leonding 1994. K. Grömer konnte dort nicht nur Fundmaterial der Gruppe Oberlauter-bach des Südostbayerischen Mittelneolithikums, son-dern auch der mährisch-niederösterreichischen Len-gyelkultur nachweisen (Grömer 2001a, 74 ff.).
Eine Siedlungsstelle von Steyregg-Windegg (Gem. Steyregg, Bezirk Urfahr-Umgebung) konnte im Rah-
men des Forschungsprojektes „Höhensiedlungen im Linzer Raum“ unter der Leitung von O. Urban (Inst. für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien) und E. M. Ruprechtsberger (Nordico – Museum der Stadt Linz) teilweise archäologisch untersucht werden (Grömer 2000). Auch hier fanden sich in der älteren, mittelneolithischen Phase der Siedlung Funde der Lengyelkultur (Stufe MOG IIa) verge-sellschaftet mit Keramik der Gruppe Oberlauterbach des Südostbayerischen Mittelneolithikums (SOB II spät). Zu den Lengyel-Funden zählen Tüllenlöffel, Schüsseln und Töpfe, die teilweise die typische rot-gelbe Bemalung aufweisen. Die Gruppe Oberlauter-bach konnte vor allem durch die charakteristischen Schraffenverzierungen identifiziert werden, während sich Importfunde der Rössener Kultur durch feine Stichverzierungen zuordnen lassen und Verbin-dungen in den südwestdeutschen Raum aufzeigen (Grömer 2002, 22 f.).
Abb. 3: Verbreitungskarte der Fundstellen des frühen Neolithikums. Grabungen seit 1985: 1 Leonding (1994); 2 St. Florian-Tödling (1996). Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
137Fines Transire 18, 2009
Bei den Grabungen des Oberösterreichischen Lan-desmuseums im Mitterkirchner Hügelgräberfeld der Hallstattkultur konnte zwischen 1982 und 1989 auch eine mittelneolithische Siedlung nachgewiesen werden. Es kamen Kulturhorizonte mit größeren Mengen an Keramikobjekten zu Tage. Zahlreiche Bruchstücke von Fußgefäßen und rotgrundierte gelb bemalte Gefäße zeigen auch hier Einflüsse der Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe der Len-gyelkultur (Stufe MOG IIa). Gefäße mit geschraff-ter Verzierung begleitet von Einstichreihen zeigen auch hier Kontakte zum Südostbayerischen Mit-telneolithikum der Stufe SOB III (Grömer 2002, 23 f.)
Funde der Münchshöfener Kultur (Abb. 5) am Über-gang zum frühen Jungneolithikum kamen ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Mitterkirchner Hügelgrä-berfeldes zu Tage. Zwei Fundstellen weisen dort auf ein Gräberfeld hin: An einer Stelle fanden sich die
Reste einer Hockerbestattung mit mehreren Gefäßen, einer Knochennadel und einem Flachbeil. Nicht weit davon entfernt konnte ein komplettes epilengyel-zeitliches Fußgefäß gemeinsam mit einer Kette aus Spondylusperlen und einem Schneckengehäuse, jedoch ohne den Nachweis menschlicher Überreste, aufgefunden werden (Grömer 2002, 27).
Auf der Burgwiese in Ansfelden konnten im Zuge der Ausgrabungen 1999–2002 im Rahmen des Pro-jektes „Höhensiedlungen im Linzer Raum“ durch P. Trebsche auch Schichtbefunde der Münchshö-fener Kultur nachgewiesen werden, die sich zeitlich jedoch nicht exakt zuordnen lassen (Trebsche 2008, 41 ff.). Auch hier zeigen sich anhand der Keramik-funde, wie z.B. Buttenhenkel und Knubben, Verbin-dungen zur Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe der Bemaltkeramik (Stufe MOG IIb), die nach Rutt-kay in Österreich als „Wolfsbach-Gruppe“ benannt wird (Ruttkay 1995, 110 ff.).
Abb. 4: Verbreitungskarte der Fundstellen des Mittelneolithikums. Grabungen seit 1985: 1 St. Florian-Ölkam (1992–1996); 2 Leonding (1994); 3 Steyregg-Windegg (2000-2002); 4 Mitterkirchen (1982-1989). Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
138 Fines Transire 18, 2009
Jungneolithikum
Schon während des ausklingenden Mittelneolithi-kums machen sich in Oberösterreich Einflüsse aus dem bayerischen Alpenvorland durch die Münchs-höfener Kultur bemerkbar, wobei noch von einer Zone der Vermischung mit den ostösterreichischen Lengyel-Einflüssen auszugehen ist (Grömer 2001b, 38). Ab dem späten Neolithikum überwiegen dann die Einflüsse aus Bayern durch die Altheimer und Chamer Gruppe (Abb. 6).
Von großer Bedeutung für die Neolithforschung in Oberösterreich sind die Seeufersiedlungen der Mondsee-Gruppe im Salzkammergut. Einen zusam-menfassenden Überblick über die Erforschung der Mondseekultur wurde zuletzt im Rahmen der Ana-lyse der Silexinventare der Mondseekultur durch
E. M. Ruprechtsberger vorgelegt (Ruprechtsberger 2006b).
Die erste unterwasserkundliche Erforschung der See-ufersiedlungen in Mond- und Attersee erfolgte bereits Ende des 19. Jahrhunderts durch „Baggerungen“. Nach der Bearbeitung dieser umfangreichen Fund-komplexe in den 1920er (Franz/Weninger 1927) und 1960er Jahren (Willvonseder 1963–1968) erfolgte in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre die erste systematische wissenschaftliche Dokumentation und Forschung unter Wasser durch J. Offenberger, bei der auch mittels einer Reihe von 14C-Proben erste abso-lutchronologische Daten gewonnen werden konnten (Offenberger/Ruttkay 1997).
Auf der Burgwiese in Ansfelden konnte bei den archäologischen Untersuchungen zwischen 1999 und 2007 eine Ausdehnung der Besiedlung durch die
Abb. 5: Verbreitungskarte von Fundstellen der Münchshöfener Kultur im Vergleich mit den Fundstellen der Mondsee-Gruppe. Grabungen seit 1985: 1 Mitterkirchen (1982-1989); 2 Leonding (1994); 3 Ansfelden (1999-2007);
4 Obergrünburg (1996). Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
139Fines Transire 18, 2009
Mondsee-Gruppe auf einer Fläche von 1,9 ha nach-gewiesen werden. Neben der Fundstelle in Ober-grünburg (Hofer/Krenn/Krenn-Leeb 1997) stellt sie die bisher einzige Höhensiedlung der Mondsee-Gruppe dar (Trebsche 2008, 48 ff.). Landsiedlungen der Mondsee-Gruppe sind in Oberösterreich nur unzureichend erforscht. Seit 1985 wurden zwar Sied-lungsstellen durch Aufsammlungen nachgewiesen, doch nur in Ansfelden und Obergrünburg wurden nach 1985 Siedlungsbefunde durch archäologische Ausgrabungen dokumentiert.
Alpiner Silex im Salzkammergut
Erst jüngst wurde versucht, die Silexartefakte der Mondseekultur im Rahmen rohstoffkundlicher Ana-lysen auszuwerten (Antl-Weiser 2006; Binsteiner 2006). Nach den jüngsten Forschungen durch A.
Binsteiner begann im Alt- und Mittelneolithikum für den Raum Linz der Import bayerischer Horn-steine aus den Abbaugebieten von Flintsbach und Arnhofen und weiter östlich entfernten Lagerstätten von Krumlovský Les (Mähren) und Tokaj bzw. den Bakony Bergen in Ungarn (Binsteiner/Ruprechts-berger 2008, 33 ff.). Während der endneolithischen Chamer Kultur lassen Sileximporte aus Bayern deutlich nach, doch sind Artefakte aus bayerischem Jura hornstein von Arnhofen und Baiersdorf wei-terhin nachzuweisen (Binsteiner/Ruprechtsberger 2008, 39 ff.).
Für die spätneolithische Mondsee-Gruppe zeigt sich die primäre Nutzung lokaler Lagerstätten. Gleich-zeitig waren aber auch Plattenhornsteine aus den bayer ischen Abbaugebieten Baiersdorf und Arn-hofen sehr gefragt, und den kunstvoll gearbeiteten
Abb. 6: Verbreitungskarte endneolithischer Fundstellen der Chamer Kulturgruppe im Vergleich mit den Fundstellen der Mondsee-Gruppe. Grabungen seit 1985: 1 Ansfelden (1999-2007); 2 Steyregg-Windegg (2000–2002); 3 Steyregg-Pulgarn (1994-97). Neu entdeckte Lagerstätten von alpinem Silex im Bereich der Seen des oberösterreichisch-salzbur-
gischenen Alpenvorlandes: A Gmunden-Laudachsee; B Mondsee-Oberalm Revier. Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
140 Fines Transire 18, 2009
Klingen aus Lessinischem Feuerstein Norditaliens kam hoher Stellenwert zu (Binsteiner/Ruprechtsber-ger 2008, 40 f.).
Schon seit Anbeginn der rohstoffkundlichen For-schungen zur spätneolithischen Mondsee-Gruppe wurde aufgrund des charakteristischen Rohstoffes und seiner quantitativen Dominanz (Binsteiner 2006) eine alpine Silexlagerstätte im Umfeld der Seeufer-siedlungen des Mond- und Attersees angenommen. Erst in jüngster Zeit aber gelang durch systematische Geländebegehungen die Auffindung zweier Feuer-steinlagerstätten im oberösterreichischen Salzkam-mergut (siehe Abb. 6).
Im Jahr 2007 entdeckte R. Neuhauser in der Nähe des Ausflusses des Laudachsees nahe Gmunden eine wohl durch Hangrutschung sekundär verlagerte Silexlagerstätte. Entlang des Laudach-Baches fanden sich zahlreiche Bruchsteine mit plattenartig einge-
lagerten Schichten aus dunkelgrauem Hornstein. Unweit der Fundstelle konnten am Ufer des Lau-dachsees auch einige Abschläge und Artefakte aus dem gleichen Material aufgesammelt werden. Eine genaue geologische Analyse steht noch aus, doch könnten makroskopisch vergleichbare Artefakte, die als Oberflächenfunde auf einer weniger als 10 km entfernten Siedlungsstelle entdeckt wurden (siehe zuletzt Gruber 2001), eine Nutzung dieser Lager-stätte während des späten Neolithikums andeuten.
A. Binsteiner konnte im Sommer 2008 im Zuge einer geoarchäologischen Geländeuntersuchung im Mond-seeland in den Oberalmer Kalken eine Hornstein und Radiolarit führende Gesteinsserie des Jura auffinden, die er als „Mondsee-Oberalmer Revier“ bezeichnet (Binsteiner 2009). Das Silexvorkommen reicht vom Zwölferhorn am Wolfgangsee bis an die Salzach bei Oberalm nahe Hallein und zählt nach A. Binsteiner aufgrund seiner Ausdehnung zu den ergiebigsten
Abb. 7: Verbreitungskarte endneolithischer Fundstellen der Glockenbecherkultur. Grabungen seit 1985: 1 St. Florian-Tödling (2001); 2 Hörsching-Neubau (2005-2006). Entwurf: Chr. Mayer, BDA.
141Fines Transire 18, 2009
Silex-Lagerstätten in Europa (Binsteiner 2009, 5). Die Radiolarite des Mondsee-Oberalmer Reviers sind rot bis rotbraun mit graugrünen Adern und Schlieren, wobei die Radiolaritquerschnitte gut sichtbar sind. Die schwarzgrauen bis braunen Hornsteine führen vielfach Reste von Schwammnadeln und Schwamm-gewebe, die sich in Form einer schwachen Bände-rung in den Gesteinen abzeichnen.
Endneolithikum
Funde der endneolithischen Chamer Gruppe konn-ten in den letzten Jahren im Mühlviertel, im Linzer Zentralraum und im Innviertel nachgewiesen werden (Abb. 7). Während sich nach der Kartierung von K. Grömer die Funde der Chamer Gruppe im Mühl-viertel noch auf das Gallneukirchner Becken und seine nähere Umgebung beschränken (Grömer 2002, 35), zeigen jüngste Aufsammlungen im Oberen Mühlviertel (Gruber/Krondorfer 2006), dass sich Siedlungsstellen der Chamer Gruppe entlang des Donautals bis Bayern erstrecken und durch gezielte Begehungen weitere Fundstellen entdeckt werden können.
Neuere Grabungen in Steyregg-Pulgarn 1994–1997 (zusammenfassend Ruprechtsberger 2006a, 15 ff.) und Steyregg-Windegg 2000-2002 (Ruprechtsber-ger 2006a, 20 ff.) erbrachten Siedlungsbefunde der Chamer Gruppe. Während in Pulgarn eine Kleinst-siedlung in Spornlage nachgewiesen werden konnte, zeigen sich in der Siedlungsstelle von Windegg neben den charakteristischen Funden der Chamer Gruppe auch mittelneolithische Funde mit Einflüs-sen der Oberlauterbacher-Gruppe und der Lengyel-Kultur.
Die Höhensiedlung Burgwiese bei Ansfelden erbrachte neben größerflächigen Befunden der jung-neolithischen Münchshöfener Kultur und der Mond-see-Gruppe auch Hinweise auf eine Befestigung der Siedlung durch einen Abschnittsgraben während des Endneolithikums. Das Typenspektrum ermöglicht dabei eine Datierung in den ältesten Abschnitt der Chamer Gruppe (Trebsche 2008, 61 ff.).
Jüngste Funde aus Rettungsgrabungen im Oberöster-reichischen Zentralraum um Linz erbrachten wei-tere endneolithische Befunde. Die Untersuchungen des Oberösterreichischen Landesmuseums in Töd-ling bei St. Florian 2001 (Pertlwieser 2001, 581) erbrachten neben frühneolithischen Siedlungsresten auch eine aus fünf Hockerbestattungen bestehende Gräbergruppe der Glockenbecherkultur. In den bis-
lang leider noch unpublizierten Gräbern konnte auch ein kleiner Kupferdolch sowie Halsschmuck aus ritz-verzierten Eberhauern nachgewiesen werden.
In Neubau bei Hörsching wurde in den Jahren 2005 und 2006 im Zuge der archäologischen Begleitunter-suchungen des Bundesdenkmalamtes für die Errich-tung einer Umfahrungsstraße bei der Einfahrt zur Kaserne Hörsching auch eine endneolithische Sied-lungsstelle untersucht (Karbinski/Klimesch 2006). Deutliche Reihen von Pfostengruben ließen dabei auf einer Fläche von rund 7000 m2 die Grundrisse von Gebäuden erkennen. Innerhalb der Siedlung befand sich auch eine vermutlich zeitgleiche Sonderbestat-tung in Bauchlage. Das Fundmaterial ist derzeit noch nicht ausgewertet, doch deutet sich nach einer ersten Sichtung eine Zugehörigkeit zur Glockenbecherkul-tur an.
Rettungsgrabungen im Umfeld der hallstattzeitlichen Siedlungsstelle von Asten erbrachten im Frühjahr 2009 einige Siedlungsbefunde des Endneolithikums (Klimesch 2009). In einer Vorratsgrube konnte dabei ein großes, bauchiges Vorratsgefäß mit Kannelur und vier Ösenhenkeln entdeckt werden.
Archäozoologie
Durch neuere archäozoologische Arbeiten liegen für einige neolithische Fundstellen nun auch Auswer-tungen der Tierknochenfunde vor. Neben den Tier-knochen aus den Pfahlbaustationen des Mondsees durch E. Pucher und K. Engl (Pucher/Engl 1997), beschäftige sich G. K. Kunst mit den früh- und mittelneolithischen Faunenresten der Siedlung von Leonding (Kunst 2001) und M. Schmitzberger mit den Tierknochen aus den Siedlungen der mittelneoli-thischen Kreisgrabenanlage von Ölkam (Schmitzber-ger 2001) und den Tierknochen der Münchshöfener Kultur bzw. Mondseekultur von der Ansfeldener Burgwiese (Schmitzberger 2008).
In der frühneolithischen Siedlung von Leonding fanden sich Tierknochen nur in geringen Mengen, weshalb quantifizierende zuverlässige Aussagen über die Nutzung von Haus- und Wildtieren kaum möglich sind, doch ist ein erheblicher Wildtieranteil (etwa 50%) zu verzeichnen (Kunst 2001).
Für das mittlere Neolithikum zeigte sich in der Kreis-grabenanlage von Ölkam ein Wildtieranteil von etwa 90% der Gesamtfundzahl (Schmitzberger 2001). Beliebte Jagdtiere waren Reh, Wildschwein und vor allem Rothirsch, die überwiegend zur Fleischver-
142 Fines Transire 18, 2009
sorgung beitrugen. Der mit etwa 70% dominierende Anteil an Rothirschknochen scheint auf einer spe-zialisierten Jagd auf diese Tierart zu beruhen. Der in Relation viel geringere Haustieranteil beruhte auf der Haltung von Rindern und Schweinen, spielte aber insgesamt eine untergeordnete Rolle.
Für die Münchshöfener Kultur deutet sich in Ober österreich aufgrund eines hohen Wildtieran-teiles unter den Faunenresten aus Leonding und Ansfelden eine intensive Nutzung der natürlichen Ressourcen im näheren Umfeld der Siedlungen an. Neben den Haustieren Rind, Schaf/Ziege und Schwein sind etwa im gleichen Verhältnis auch Knochen von Wildtieren wie Rothirsch, Braunbär, möglicherweise auch Auerochse und Reh vertre-
ten. M. Schmitzberger weist aber darauf hin, dass für die Beleuchtung viehwirtschaftlicher Aspekte erst größere Materialmengen abgewartet werden müssen.
Für die mondseezeitlichen Befunde konnte M. Schmitzberger in Ansfelden einen Wildtieranteil von 25% nachweisen (Schmitzberger 2008, 284 ff.), ein Verhältnis, das auch den Materialien aus den Mond-seer Pfahlbaustationen entspricht. Die jungneoli-thischen Menschen deckten einen beträchtlichen Teil ihres Fleischbedarfes durch die Jagd ab. Während um den Mondsee vorwiegend Rotwild und Gemse ver-treten sind, dienten auf der Ansfeldener Burgwiese vor allem Rothirsch, Auerochse und Wildschwein als Fleischlieferanten.
Literatur:Antl-Weiser, W. 2006: Silexplatten als Grundform für Geräte in der Station Mondsee. Arch. Österreich 17/2, 93–103.
Binsteiner, A. 2006: Das Silexinventar der Pfahlbausied-lung See am Mondsee. In: Binsteiner, A./Ruprechtsberger, E.M., Mondsee-Kultur und Analyse der Silexartefakte von See am Mondsee. Linzer Arch. Forsch. Sonderh. 35, 23–40.
Binsteiner, A. 2009: Die Rohstoffversorgung der jung-steinzeitlichen Pfahlbausiedlung von See am Mondsee. Eine geoarchäologische Prospektion im Mondseeland. Oberösterreichische Heimatbl. 63, H. 1/2, 3–10.
Binsteiner, A./Ruprechtsberger, E.M. 2008: Jungsteinzeit-liche Silexartefakte und Keramik im Raum Linz und in Oberösterreich. Linzer Arch. Forsch. Sonderh. 41.
Dworsky, C./Reitmaier, Th. 2004: Moment, da war doch noch was! Neues zur Pfahlbauarchäologie im Mond- und Attersee 1854-2004: 150 Jahre Entdeckung der Pfahl-bauten. Arch. Österreich 15/2, 4–15.
Franz, L./Weninger, J. 1927: Die Funde aus den prähisto-rischen Pfahlbauten im Mondsee. Mat. Urgesch. Öster-reich 3.
Grömer K. 2000: Jungsteinzeitliche Kulturen in Steyregg-Windegg, Arch. Österreich 11/1, 53–56.
Grömer, K. 2001a: Jungsteinzeit im Großraum Linz. Siedlungs- und Grabfunde aus Leonding. Linzer Arch. Forsch. 33.
Grömer, K. 2001b: Neolithische Siedlung mit Lengyel-grab in Leonding. Die Stellung Oberösterreichs im Früh- und Mittelneolithikum. Jahrb. Oberösterr. Musver. 146/I, 9–41.
Grömer, K. 2002: Das Neolithikum im oberösterrei-chischen Mühlviertel. Arch. výzkumy v jižních Čechách 15, 7–54.
Gruber, H. 2001: KG Schwaigthal. Fundber. Österreich 40, 584 f.
Gruber, H./Krondorfer G. 2006: KG Niederkappel. Fundber. Österreich 45, 642–646.
Hafner, A./Harb, Chr. 2008: Die Unesco-Welterbe-Kan-didatur „Pfahlbauten in Seen und Mooren rund um die Alpen“. Arch. Schweiz 31/3, 2–13.
Hofer, N./Krenn, M./Krenn-Leeb, A. 1997: Das Fundma-terial aus der Grabung Obergrünburg in Oberösterreich. Fundber. Österreich 36, 597–612.
Karbinski, A./Klimesch, W. 2006: KG Neubau. In: Farka, Chr., Die Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenk-malamtes. Jahresber. 2005. Fundber. Österreich 44, 45 f.
Klimesch, W. 2009: Eine endneolithische Siedlung am westlichen Ortsrand von Asten. Archäologische Unter-suchungen auf Parzelle 330/4 OG Asten, VB Linz-Land. Unpublizierter Grabungsbericht, Linz.
Kunst, G. K. 2001, Archäozoologisches Fundmaterial. In: Grömer 2001a, 116–135.
143Fines Transire 18, 2009
Offenberger, J. 1986: Pfahlbauten, Feuchtbodensiedlungen und Packwerke – Bodendenkmale in einer modernen Umwelt. Arch. Austriaca 70, 205–226.
Offenberger, J./Ruttkay, E. 1997: Pfahlbauforschung in den österreichischen Salzkammergutseen. In: Schlicht-herle, H. (Hrsg.), Pfahlbauten rund um die Alpen. Arch. Deutschland Sonderh., 76–80.
Pertlwieser, Th. 2001: KG Gemering. Fundber. Österreich 40, 579–581.
Pollak, M. 2008: Die archäologische Landesaufnahme im oberösterreichischen Mühlviertel. Fines Transire 17, 23–35.
Pucher, E./Engl, K. 1997: Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich, Materialien I – Die Pfahlbaustationen des Mondsees, Tierknochenfunde. Mitt. Prähist. Komm. Österr. Akademie Wissensch. 33.
Ruprechtsberger, E. M. 2006a: Jungsteinzeit-Forschungen in Oberösterreich – Ein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte. In: Binsteiner, A., Drehscheibe Linz – Steinzeithandel an der Donau. Linzer Arch. Forsch 37, 9–32.
Ruprechtsberger, E. M. 2006b: Die Mondseekultur und ihre Erforschung – Ein Überblick, an der Donau. In: Bin-steiner, A./Ruprechtsberger, E.M., Mondsee-Kultur und Analyse der Silexartefakte von See am Mondsee. Linzer Arch. Forsch. Sonderh. 35, 7–22.
Ruttkay, E. 1981: Typologie und Chronologie der Mondsee-Gruppe. In: Das Mondsee-Land. Geschichte
und Kultur. Katalog zur Ausstellung des Landes Ober-österreich von 8. Mai bis 26. Oktober 1981 in Mondsee, 269–294.
Ruttkay, E. 1990: Beiträge zur Typologie und Chronologie der Siedlungen in den Salzkammergutseen. In: Die ersten Bauern. Pfahlbaufunde Europas. Forschungsberichte zur Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum und zum Erlebnispark/Ausstellung Pfahlbauland in Zürich Bd. 2, 111–121.
Ruttkay, E. 1995: Spätneolithikum. In: Lenneis, E./Neugebauer-Maresch, Chr./Ruttkay, E., Jungsteinzeit im Osten Österreichs. Wissenschaftl. Schriftenr. Niederöster-reich 102–105, 108–209.
Schmitzberger, M. 2001: Die Tierknochen aus der mittel-neolithischen Kreisgrabenanlage Ölkam (Oberösterreich). Jahrb. Oberösterr. Musver. 146/I, 43–86.
Schmitzberger, M. 2008: Die Tierknochen. In: Trebsche 2008, 284–306.
Suter, P. J./Schlichtherle, H. 2009: Pfahlbauten – UNESCO Welterbe-Kandidatur „Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen“ (Biel).
Trebsche, P. 2008: Die Höhensiedlung „Burgwiese“ in Ansfelden (Oberösterreich). Linzer Arch. Forsch. 38/1–2.
Willvonseder, K. 1963-1968: Die jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Pfahlbauten des Attersees in Oberöster-reich. Mitt. Prähist. Komm. 11/12.