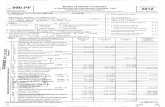Heinz Gruber, Jahresbericht zur archäologischen Denkmalpflege in Oberösterreich 2012, Fundberichte...
Transcript of Heinz Gruber, Jahresbericht zur archäologischen Denkmalpflege in Oberösterreich 2012, Fundberichte...
18 FÖ 51, 2012
Bernhard Hebert und Nikolaus Hofer
Oberösterreich
Als bemerkenswerte Tendenz zeigte sich im Lauf der ver-gangenen Jahre, dass der administrative Teil der archäolo-gischen Denkmalpflege immer stärker zunimmt. Raumord-
Hof, Dürnstein, Asparn an der Zaya, Pitten und Ebenfurth. In diesen Anlagen konnten wichtige Aspekte zu den frühen Gründungsbauten gewonnen werden.
Untersuchungen im Bereich von Stadtbefestigungen er-brachten ebenfalls hervorragende Ergebnisse. So konnte in Stein (SG Krems an der Donau) die bislang unbekannte süd-östliche Bastei der Stadtbefestigung freigelegt werden. Hier-bei handelt es sich um eine Rundbastei mit drei Schießschar-ten im Erdgeschoß und einem darüberliegenden Wehrgang aus dem frühen 16. Jahrhundert. Glücklicherweise gelang es, die Bastei im Zuge der Errichtung eines Restaurants in den Gesamtkomplex zu integrieren und dadurch zu erhalten.
Seit 2012 wird auch in Niederösterreich besonderes Au-genmerk auf die archäologische Untersuchung von Fehlbö-den und Gewölbebeschüttungen gelegt. So konnten im Zuge der Revitalisierung des sogenannten Sternhofes, eines 1399 erstmals erwähnten Baukomplexes in Krems an der Donau, aus einer Gewölbebeschüttung zahlreiche renaissancezeitli-che Kachelfragmente geborgen werden. Der grün glasierte Kachelofen aus der Zeit knapp vor oder um 1600 stand ehe-mals in einem repräsentativ ausgestatteten Renaissance-saal. Im Zuge von Umbauarbeiten nach 1800 wurde er abge-brochen und seine Einzelteile wurden als Beschüttung am Dachboden aufgebracht. Das Bildprogramm des Ofens zeigt allegorische Darstellungen (Zorn, Justitia und Frieden). Bei mehreren Kacheln fand sich das Monogramm des Hafners in Form der Buchstabenfolge TSC in einem ovalen Medaillon. Dieser Fund belegt nicht nur die hohe Ausstattungsqualität dieses renaissancezeitlichen Bauensembles, sondern stellt darüber hinaus einen weiteren Beleg für die Wichtigkeit der ›Archäologie im 1. Stock‹ dar.
Im Zuge der Aufschließung eines neuen Siedlungsge-bietes in Gneixendorf (SG Krems an der Donau) war die Er-richtung einer Baustraße Anlass für eine Untersuchung im ehemaligen Kriegsgefangenenlager STALAG XVIIb. Die im Gelände noch gut erkennbaren Fundamente von Baracken des Lagers wurden baubegleitend dokumentiert und punk-tuell Sondagen angelegt. Das gesamte Lager umfasste einen Bereich von ca. 1 km2, bestehend aus dem Gefangenenlager, einem sogenannten Vorlager im Westen, das vorwiegend gemauerte Gebäuden aufwies und die Lagerverwaltung, das Krankenrevier mit Ärzteunterkunft und die Quarantäneba-racken beherbergte, sowie dem Truppenlager für die Wach-mannschaften. Im Zuge der archäologischen Untersuchun-gen konnten Teile von zwei Baracken der Wachmannschaft sowie zwei Garagen für Lastkraftwagen befundet werden. Durch die hervorragende Kooperation mit der Bauherrschaft gelang es, die Denkmalsubstanz durch deutliche Anhebung des geplanten Straßenniveaus zu erhalten.
Bei der Unterschutzstellung von Bodendenkmalen sind für das Berichtsjahr in Niederösterreich gute Erfolge zu vermelden. Besonders hervorzuheben ist die großflächige Unterschutzstellung des westlichen Teils des Municipiums Carnuntum (MG Petronell-Carnuntum). Durch intensive Gespräche mit den betroffenen Grundbesitzern konnte das Verfahren zu einem für die Archäologie äußerst wichtigen Gebiet von insgesamt rund 12 ha ohne Einsprüche abge-schlossen werden.
Am 23. November 2012 fand der bereits traditionelle Jah-resrückblick zur archäologischen Denkmalpflege in Niederös-terreich statt. Von den rund 60 teilnehmenden Archäologin-nen und Archäologen wurde das Treffen wie stets zu einem regen Erfahrungsaustausch genutzt.
Martin Krenn und Martina Hinterwallner
Abb. 6: St. Pölten, Spratzern (NÖ.). Luftbild der Grabungsfläche.
Abb. 7: Krems an der Donau, Sternhof (NÖ.). Kachel mit der Darstellung der Justitia.
19FÖ 51, 2012
Archäologie im Bundesdenkmalamt 2012
Schon in nahezu traditioneller Weise konzentrierten sich die Maßnahmen auf den oberösterreichischen Zentralraum: So fanden allein in den Städten Linz, Wels und Enns rund 40 % aller Maßnahmen statt. Die Arbeiten in Enns umfassten klei-nere Bauvorhaben im und um das Legionslager Lauriacum. In Wels wurden vier Denkmalschutzgrabungen im Bereich des antiken Ovilava in bewährter Weise durch die Welser Stadtmuseen abgewickelt. In Linz wurden im Vorfeld von geplanten Großbauvorhaben mehrere archäologische Son-dierungen an der Donaulände und der Promenade, also unmittelbar außerhalb der mittelalterlichen Altstadt, vorge-nommen.
Einen seltenen archäologischen Befund erbrachte die Nachuntersuchung bei einem Urnengräberfeld der spä-ten Urnenfelderzeit (Stufe Ha B) in Wupping (OG Tarsdorf). Nachdem bei Bauarbeiten im Jahr 2011 zahlreiche Bronzege-genstände (darunter zwei verzierte Bronzeschwerter, eine Lanzenspitze, Lanzenschuhe, Armreife, Wagenbestandteile etc.) aufgesammelt werden konnten, erbrachte die Nach-grabung noch den Nachweis zweier Urnengräber und eines Brandschüttungsgrabes. Bemerkenswert ist der Befund eines rund 10 m langen und bis zu 0,5 m breiten Schotter-bandes, an dessen Seiten ein weiteres Bronzeschwert, eine Lanzenspitze und ein Lanzenschuh senkrecht in der Erde steckten. Möglicherweise wurden diese Waffen im Rahmen der Bestattungszeremonie an dieser besonderen Stelle in-nerhalb des Gräberfeldes deponiert.
Umfangreiche mittelalterliche und frühneuzeitliche Bau-befunde erbrachte die archäologische Voruntersuchung für die Errichtung des Oberösterreichischen Burgenmuseums auf der Ruine Reichenstein (MG Tragwein). In Absprache mit dem Bauherrn und den beauftragten Architekten wurde das Projekt derart geändert, dass nun weite Teile des freige-legten Mauerbestandes in den Museumsneubau integriert werden können. Das Ergebnis dieser Verbindung von histo-rischem Altbestand und moderner Architektur wird ab dem Frühjahr 2013 zu besichtigen sein.
Im Zuge der Bauarbeiten zur Bestandssicherung und Sa-nierung konnte auf Schloss Marsbach (MG Hofkirchen im Mühlkreis) die Verfüllung eines Brunnenschachtes archäolo-gisch dokumentiert werden. Dabei wurde ein umfangreicher Komplex des 19. Jahrhunderts mit mehr als 100 komplett er-
nungsgesetze greifen immer besser, was auch zu einem deutlich höheren Aufwand bei der denkmalpflegerischen Betreuung führt. So stieg die Zahl der diesbezüglichen Be-gutachtungen und Stellungnahmen stetig und hat sich innerhalb der letzten drei Jahre mehr als verdoppelt. Mit der Berücksichtigung der archäologischen Schutzzonen, Fundzonen und Verdachtsflächen in den Flächenwidmungs-plänen der einzelnen Gemeinden wächst parallel auch die Anzahl von Anfragen bei Bauvorhaben und -projekten. Er-freulicherweise ist es in Kooperation mit Bauträgern gelun-gen, dass für große lineare Bauvorhaben wie Leitungstras-sen oder Straßenprojekte eine archäologische Bauaufsicht beauftragt wird.
Auch aufgrund des stetig ansteigenden Zeitaufwandes für die Betreuung von Raumordnungsangelegenheiten und Bauplanungen konnten im Berichtsjahr nur einzelne Unterschutzstellungen durchgeführt werden. Für die neoli-thischen Seeuferstationen des Attersees, Seewalchen I und II sowie Kammer I, wurden die Verfahren nach Absprache mit den Gemeinden und dem Seeeigentümer eingeleitet. In Zusammenarbeit mit der Baudenkmalpflege am Landes-konservatorat für Oberösterreich konnte das Verfahren zur Unterschutzstellung der »Produktionsanlagen Steinbruch Wiener Graben« des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen erfolgreich beendet werden. Für die Unter-schutzstellung weiterer Stätten des NS-Terrors in der »Ge-denklandschaft Mauthausen – St. Georgen – Gusen« wurde von Seiten des Bundesdenkmalamtes eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der betroffenen Gemeinden, Gebietskör-perschaften und Vereine initiiert. Dabei soll in Zusammen-arbeit mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und unter archäologischer Beteiligung der schützenswerte Denkmalbestand definiert werden, um Ziele für einen adäquaten Umgang samt Möglichkeiten der Vermittlung erarbeiten zu können.
Die Anzahl der archäologischen Maßnahmen ist im Be-richtsjahr nur gering gestiegen. In Oberösterreich wurden insgesamt 35 Grabungen, Prospektionen und archäologi-sche Baubegleitungen durchgeführt. Nur etwa 14 % der Maßnahmen – vorwiegend kleinere Erkundungsgrabungen und Prospektionen – wurden amtswegig durchgeführt.
Abb. 8: Krems an der Donau, Gneixendorf (NÖ.). Freigelegte Überreste der Baracke 1 des ehe-maligen Kriegsgefangenenlagers STALAG XVIIb.
20 FÖ 51, 2012
Bernhard Hebert und Nikolaus Hofer
Wagenlasten verhindert werden sollte. Wie die dendrochro-nologische Datierung zeigt, wurde der Weg in den 1720er-Jahren errichtet. Nach Abschluss der Dokumentation konnte die Wegtrasse durch wasserbauliche Maßnahmen vor einer möglichen weiteren Freilegung gesichert werden.
Im Juni veranstaltete das Bundesdenkmalamt gemein-sam mit dem Kuratorium Pfahlbauten und der Gesellschaft für Archäologie in Oberösterreich das 22. Treffen der Ar-chäologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich in der Region Attersee/Mond-see. Anlass für die Wahl der Veranstaltungsorte war die im Vorjahr erfolgte Eintragung der Prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen als UNESCO-Welterbe. 65 Archäologinnen und Archäologen folgten der Einladung, wobei ein umfang-reiches Programm zum Themenschwerpunkt Wasser absol-viert wurde. Im Rahmen der Tagung konnte zudem der 20. Band der Schriftenreihe Fines Transire präsentiert werden, in dem auch vier zusammenfassende Beiträge zum aktuellen
haltenen kleinen Arzneifläschchen und -behältern aus Glas geborgen. In Kombination mit zahlreichen Stücken von Mi-neralwasserflaschen aus Steinzeug und Glas, vor allem aus böhmischen, aber auch aus italienischen und deutschen Mi-neralbrunnen, gibt dieser Bestand interessante Aufschlüsse über die medizinische Versorgung der Schlossbewohner.
Im Rahmen der archäologischen Baubegleitung der S 10 Mühlviertler Schnellstraße wurde im Gemeindegebiet von Kefermarkt eine ehemalige Begleitbrücke der Summerauer-bahn archäologisch und bauhistorisch befundet. Die in den frühen 1870er-Jahren für einen landwirtschaftlichen Begleit-weg errichtete Brücke war seit Jahrzehnten außer Betrieb, darüber hinaus nicht mehr benutzbar und durch dichten Bewuchs nahezu in Vergessenheit geraten. Da sich die Brü-ckenpfeiler direkt auf der geplanten Trasse der Schnellstraße befanden, wurden diese vor dem Abtrag noch fachgerecht untersucht und mittels 3-D-Laserscan dokumentiert.
Während des Berichtsjahres wurde in Oberösterreich auch die erste gartenarchäologische Untersuchung im Park der Kaiservilla in Bad Ischl durchgeführt. Für die im Jahr 2015 geplante Landesgartenschau soll der ursprüngliche historische Bestand der Wegführungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts so weit wie möglich wieder rekonstruiert werden. Dafür wurden an mehreren Stellen archäologische Sondierungen durchgeführt, um nicht nur Aufschlüsse über den ehemaligen Verlauf und den Aufbau der Wege, sondern auch Erkenntnisse über bauliche Strukturen zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen in die weiteren Planungen einfließen.
Extreme Wetterereignisse brachten schließlich auch Be-funde zu historischen Wegeführungen ans Tageslicht: In Bad Goisern legte eine Mure Teile der steingepflasterten alten Pötschenstraße frei. In die Steine eingetiefte Gleis-rinnen belegen die intensive Nutzung der seit dem Spät-mittelalter überlieferten Passverbindung zwischen dem oberösterreichischen und dem steirischen Salzkammergut. In Munderfing legte ein Starkregen am westlichen Rand des Kobernaußerwaldes einen längeren Teil eines Weges aus Holzrundlingen frei. Die archäologische Untersuchung ergab, dass durch die Unterlage dünnerer Asthölzer in Längsrichtung das Absinken der dicken Querhölzer durch die
Abb. 9: Tragwein, Burgruine Reichenstein (OÖ.). Überblicksauf-nahme des Grabungsareals.
Abb. 10: Munderfing (OÖ.). Freigelegter neuzeitlicher Weg aus Holzrundlin-gen im Kobernaußer Wald.
21FÖ 51, 2012
Archäologie im Bundesdenkmalamt 2012
gen (Be-)Funde lieferten aber auch wichtige Daten zu demo-grafischen Verhältnissen, volkskundlichen Traditionen und wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhängen. Erstmals in Salzburg wurde die anthropologische Basisauswertung pa-rallel zur archäologischen Grabung durchgeführt und abge-schlossen.
Eine schon 2011 erfolgte kleine Feststellungsgrabung sowie die 2012 darauf aufbauende, flächige Voruntersu-chung eines unter Denkmalschutz stehenden Grundstücks in der verbliebenen Kernzone der römischen Villa rustica von Loig (OG Wals-Siezenheim) bestätigten leider eindrucksvoll die akute Verschlechterung des Erhaltungszustandes. Der bestehende Schutzstatus hat keine Auswirkungen auf die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Areals und kann diese auch nicht verhindern. Bau- und Erdbefunde sind zu-meist nur mehr in ihren untersten Lagen beziehungsweise Straten erhalten und werden mittel- oder sogar kurzfristig durch die Pflugeinwirkung (kein Tiefpflügen!) undokumen-tiert verloren gehen. Die Ergebnisse einer 2004 im selben Bereich von der Salzburger Landesarchäologie beauftragten Geoprospektion konnten nicht in allen Details verifiziert werden. Die angetroffenen Baureste sind durchwegs als Umfassungsmauern zu interpretieren, ein (vermuteter) Ge-bäudegrundriss war nicht nachzuweisen. Zwei in situ aufge-deckte römische Hundebestattungen bilden eine wichtige Bereicherung unseres Kenntnisstandes zu diesem Thema, ähnliche Befunde liegen nunmehr bereits aus mehreren Salzburger Fundpunkten vor.
Im Rahmen einer Notsicherung des spätgotischen An-sitzes von Gröbendorf (OG Mariapfarr) konnte nach Entfer-nung des nach einem Teileinsturz im Winter 2010/2011 ent-standenen Schuttkegels und mittels einiger Testsondagen der Grundriss eines hochmittelalterlichen Turmes mit einer Innenfläche von etwa 6 × 10 m erfasst werden. Demnach handelt es sich beim heute noch sichtbar erhaltenen Bau-bestand um einen – eventuell sogar mehrphasigen – Anbau jüngerer Zeitstellung, in den lediglich die Westwand des Wehrturmes integriert wurde. Die übrigen hochmittelalter-lichen Bauteile wurden hingegen bis unter heutiges Gelän-deniveau abgetragen. Das spärliche Fundmaterial verweist auf eine Zeitstellung im 13. Jahrhundert.
Die zweifellos überraschendste Entwicklung im Berichts-jahr 2012 nahm eine kleine, ursprünglich lediglich als Baube-obachtung vorgesehene Maßnahme in St. Martin im Lungau (MG St. Michael im Lungau). Hier war eine Außen- und In-nendränagierung der urkundlich 1179 genannten Filialkirche Hl. Martin geplant. Die Betreuung der Arbeiten ergab letzt-lich kaum Indizien für den im näheren Umfeld vermuteten Standort eines römischen Gutshofes, erbrachte aber uner-wartete Hinweise auf die Existenz eines bislang unbekann-ten frühmittelalterlichen Gräberfeldes des ausgehenden 9. bis beginnenden 11. Jahrhunderts. Die reiche Ausstattung und die große Bandbreite an überaus qualitätvollen Tracht-bestandteilen stellen für das Bundesland Salzburg derzeit eine völlig einzigartige Erscheinung dar.
Dankenswerterweise setzte die Salzburger Landesar-chäologie ihr Geoprospektionsprogramm im Bereich römi-scher Villenstandorte fort und stellt die Ergebnisse auch für Unterschutzstellungsvorhaben zur Verfügung. Die Un-tersuchungen im Bereich des Gutshofes Kerath (OG Berg-heim) ergaben gegenüber dem bisherigen Kenntnisstand eine wesentlich größere Ausdehnung und Aufgliederung der Anlage. Zum Forschungsschwerpunkt Das Territorium von Iuvavum. Bestandsaufnahme und Forschungsstrategien
Forschungsstand der Bronze- und Eisenzeit in Oberöster-reich enthalten sind.
Heinz Gruber
Salzburg
Einen deutlichen Arbeitsschwerpunkt im Berichtsjahr 2012 bildete weiterhin die Betreuung von Grabungsprojekten. Hierbei war die Zahl der Forschungsgrabungen tendenziell leicht rückläufig, während jene der Denkmalschutzmaßnah-men auf einem unverändert hohen Stand verblieb.
Im Bereich der Salzburger Altstadt ergeben sich hierbei zwei unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Zum einen handelt es sich um Arbeiten in historischen Bestandsgebäuden, zum anderen um Leitungstrassen oder Oberflächengestaltungen der innerstädtischen Straßen und Plätze.
Erstere werden durch Lifteinbauten, die Schaffung neuer Fußbodenniveaus, Infrastruktureinbauten, die Entfernung von Fehlbödenbeschüttungen in Obergeschoßen etc., sel-ten auch durch neue Teilunterkellerungen, für die archäo-logische Denkmalpflege relevant. Als Beispiel ist etwa eine Kelleradaptierung im Haus Judengasse Nr. 3, einem schon im 15. Jahrhundert als Brauerei erwähnten Areal, zu nennen. Der zuletzt als Abstellraum genutzte, niedrige Gewölbekel-ler erwies sich im Zuge der Untersuchungen als mehrpha-siger Baukörper mit teils gut erhaltenen Bodenbelägen aus Rollsteinpflasterungen beziehungsweise Plattenziegeln, wechselnder Raumuntergliederung und ungewöhnlichem, überwiegend aus Tuffblöcken errichteten Tonnengewölbe, der in seinem ältesten Baubestand des 15. Jahrhunderts die Reste der romanischen Stadtmauer überlagert. Heute kaum mehr erkennbar, war das Haus Judengasse Nr. 3 ursprünglich durch eine schmale Gasse, von der aus man auch den Kel-ler betreten konnte, vom Nachbarobjekt getrennt. Ausstat-tung und Fundmaterial verweisen auf eine frühe Nutzung als Schankraum wohl in der Zeit des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts.
Die hinsichtlich ihrer Aussagekraft häufig gering ge-schätzten Leitungstrassen liefern trotz zahlreicher Stö-rungszonen im Bereich der Salzburger Altstadt immer wieder überraschende Ergebnisse insbesondere zum Bild der römischen Besiedlung. Dies zeigte sich 2012 beispiel-haft unter anderem in der Richard-Mayr-Gasse, wo bereits oberflächennah Baureste zumindest eines mehrräumi-gen römischen Gebäudes mit erhaltenen Bodenestrichen und Hypokaustpfeilern angeschnitten wurden. Die neuen Erkenntnisse der letzten Jahre haben eine merkliche Ver-dichtung des römischen Stadtplans von Iuvavum, vor allem im Brückenkopf rechts der Salzach, bewirkt. Dies konnte in einem 2012 erschienenen Sonderheft (FÖMat A 20) zu den Grabungen im Haus Makartplatz Nr. 6 vor Augen geführt werden; die für diese Publikation angefertigte Planübersicht ist gleichzeitig als Probelauf für die geplante Erstellung eines digitalen Stadtplans zu sehen.
Eine wesentlich größere Bandbreite zeigen die im Land Salzburg – einschließlich der Stadtrandgemeinden – durch-geführten Denkmalschutzmaßnahmen.
Eine neue Dorfplatzgestaltung in Bruck an der Großglock-nerstraße griff erheblich in das Areal des um 1910 aufgelasse-nen Ortsfriedhofes ein. Die von der ansässigen Bevölkerung mit regem Interesse verfolgte archäologische Voruntersu-chung bestätigte die historischen Angaben hinsichtlich der nach dem großen Ortsbrand von 1867 abgebrochenen Bau-ten und der Friedhofserweiterung. Die vergleichsweise jun-