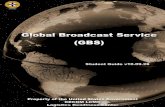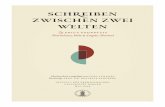Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
Einband_FÖ51+Rücken_24mm.indd 1 15.11.13 17:24Einband_FÖ51+Rücken_24mm.indd 1 15.11.13 17:24
UEZ-Montage_MG.indd 1 18.11.2013 11:37:25
Fundberichte aus ÖsterreichHerausgegeben vom Bundesdenkmalamt
Band 51 • 2012
Wien 2013Sigel: FÖ 51, 2012
Alle Rechte vorbehalten© 2013 by Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 3580 Hornhttp://www.verlag-berger.at
Herausgeber: Mag. Nikolaus Hofer Bundesdenkmalamt, Abteilung für ArchäologieHofburg, Säulenstiege, 1010 [email protected]://www.bda.at
ISSN: 0429-8926
Redaktion: Mag. Nikolaus HoferBildbearbeitung: Stefan Schwarz und Franz SiegmethSatz und Layout: Berger CrossmediaLayoutkonzept: Franz SiegmethCovergestaltung: Franz Siegmeth nach einer Vorlage von Elisabeth WölcherCoverbild: Restaurierte Puppe aus der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Foto: Irene Dworak, BDADruck: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H.
7 Editorial
Aufsätze
Bernhard Hebert und Nikolaus Hofer
11 Archäologie im Bundesdenkmalamt 2012
Burkhard Weishäupl und Alfred Pawlik
37 Ein außergewöhnliches Bergkristallartefakt aus Kapfing, OG Fügen, Tirol
Robert Schumann
43 Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
Astrid Steinegger
51 Neue Befunde der Bronzezeit und der Römischen Kaiserzeit aus Hörbing, SG Deutschlandsberg, Steiermark
Wolfgang Artner
61 Von Hallstatt auf dem Weg nach Süden. Grabfunde vom Kulm bei Aigen im Ennstal, Ober-steiermark, sowie Funde der Hallstatt- und Früh-La-Tène-Zeit zwischen Öden- und Hallstätter See
Susanne Tiefengraber
89 Ein spätantikes Frauengrab aus der Flur Trüm-meräcker in Fernitz, Steiermark
Astrid Steinegger und Susanne Tiefengraber
97 Die Filialkirche St. Johann bei Rosegg, Kärnten. Eine kleine gotische Kirche und ihre Vorgänger-bauten
Nikolaus Hofer
113 Zwei bemerkenswerte Tabakspfeifenköpfe aus Wien und Ramsee (Bayern)
Bernhard Hebert u. a.119 Archäologie des 20. Jahrhunderts
157 Rezension
Fundchronik 2012
161 Fundchronik 2012
163 Burgenland
171 Kärnten
177 Niederösterreich
259 Oberösterreich
279 Salzburg
297 Steiermark
319 Tirol
351 Vorarlberg
359 Wien
Register
373 Ortsverzeichnis
375 Autorinnen und Autoren
381 Abkürzungsverzeichnis
383 Sigel
384 Redaktionelle Hinweise
Inhaltsverzeichnis
43FÖ 51, 2012
Zusammenfassung
Bei Kristein (KG Kristein, SG Enns, PB Linz-Land) konnten im Zuge eines Straßenbauvorhabens zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit ausgegraben werden, die vermutlich den äußersten Randbereich einer Siedlung dieser Zeitstellung darstellen. Die Gruben erbrachten ein relativ reichhaltiges keramisches Inventar, das nach einer typochronologischen Analyse allgemein in die Urnenfelderzeit zu datieren ist, wobei sowohl Formen vorliegen, die ihren Schwerpunkt in der älteren Urnenfelderkultur besitzen, als auch solche, deren zeitlicher Schwerpunkt in der jüngeren Stufe zu su-chen ist. Die meisten Funde erlauben jedoch lediglich eine allgemeine Datierung in die Urnenfelderzeit. Auch wenn es sich um einen verhältnismäßig kleinen Komplex mit Sied-lungsmaterial dieser Zeitstellung handelt, scheint beim derzeitigen Forschungsstand zur Siedlungskeramik und allgemein zur Siedlungsarchäologie der Urnenfelderzeit in Oberösterreich eine Vorlage und Auswertung auch kleiner Komplexe lohnenswert, um eine Grundlage für weiterfüh-rende Fragestellungen der Siedlungsarchäologie zu schaf-fen.
Two Urnfield-period settlement pits from Kristein, Enns, Upper AustriaRobert Schumann
A road project led to the excavation of two Urnfield-period settlement pits near Kristein (Kristein village, Enns urban area, Linz-Land district), which probably lay at the outer edge of a settlement of that time. The pits produced a con-siderable pottery inventory, which was broadly dated to the Urnfield period by typo-chronological analysis. Forms are included, which date to the older Urnfield culture, while oth-ers are more typical of the younger stage. Most of the finds can only be dated to the Urnfield period in general however. De spite the relatively small size of the finds complex, it is important to evaluate and submit even small assemblages, thus laying the foundations of further settlement archaeo-
logical research. The present state of research into settle-ment pottery and the settlement archaeology of the Urn-field period in Upper Austria demands no less.
Translation: Paul Mitchell
Siedlungen der Urnenfelderzeit in Oberösterreich
Die Siedlungsarchäologie der Urnenfelderzeit in Oberös-terreich stellt im Vergleich zu anderen prähistorischen Epo-chen, wie beispielsweise der Hallstattzeit1, immer noch ein Forschungsdesiderat dar2.
In ihrer grundlegenden Arbeit zur Urnenfelderzeit in Oberösterreich konnte Monika zu Erbach zwölf Siedlungen dieser Zeitstufe zusammenstellen, von denen jedoch die wenigsten nennenswerte Ausgrabungstätigkeiten oder Fundanfall vorweisen konnten.3 Erst in den 1990er- und 2000er-Jahren erbrachten die im Rahmen des Projektes Höhensiedlungen im Linzer Raum durchgeführten Ausgra-bungen auf dem Freinberg4 und dem Luftenberg5 neue Er-kenntnisse zum Siedlungswesen der Urnenfelderkultur in Oberösterreich, doch konnten auch in diesen Höhensied-lungen keine großflächigen Untersuchungen stattfinden6. Erst bei den Ausgrabungen der Siedlung von Gilgenberg-Bierberg in den Jahren 2005 und 2009 wurde erstmals eine urnenfelderzeitliche Siedlung in Oberösterreich flächig un-
1 Vgl. zur Siedlungsarchäologie der Hallstattzeit jüngst Trebsche 2008, 165–171; Schumann 2011, 338–347.
2 Vgl. zusammenfassend Schumann 2011, 329–338. – Zum Forschungs-stand der Urnenfelderzeit in Oberösterreich Anfang der 1990er-Jahre: Zu Erbach 1995.
3 Zu Erbach 1989, 30–32.4 Urban 1994.5 Vgl. hierzu die Grabungsberichte: Erwin M. Ruprechtsberger und Otto
H. Urban, KG Luftenberg, FÖ 38, 1999, 782. – Karina Grömer, Erwin M. Ruprechtsberger und Otto H. Urban, KG Luftenberg, FÖ 39, 2000, 600. – Katharina Rebay, Erwin M. Ruprechtsberger und Otto H. Urban, KG Luftenberg, FÖ 41, 2002, 605. – Dies., KG Luftenberg, FÖ 41, 2002, 605–607.
6 Zusammenfassend zum Projekt: Ruprechtsberger und Urban 2007.
Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
Robert Schumann
Inhalt: Zusammenfassung 43 Siedlungen der Urnenfelderzeit in Oberösterreich 43 Die Fundstelle und die Ausgrabung 44 Die Siedlungsgruben 44 Das Fundmaterial 45 Literaturverzeichnis 47
Content: Summary 43 Urnfield-period settlements in Upper Austria 43 The finds site and the excavation 44 Settlement pits 44 Finds material 45 Bibliography 47
Schlagwörter: Oberösterreich | Kristein | Spätbronzezeit | Urnenfelderkultur | Siedlung | Keramik
Keywords: Upper Austria | Kristein | Late Bronze Age | Urnfield culture | Settlement | Pottery
44 FÖ 51, 2012
Robert Schumann
einen Gesamtumfang von ca. 10.000 m2 und liegt auf einer Niederung, die sich südlich entlang des Verlaufes der West-autobahn erstreckt (Abb. 2). Im Bereich der Abschubgrenze konnten im anstehenden Aulehm zwei urnenfelderzeitliche Siedlungsgruben dokumentiert werden, die an einem sanft ansteigenden Hang, direkt am Rand der beobachteten Flä-che, lagen.10 Die beiden Siedlungsgruben wurden in einer bauvorgreifenden Notbergung durch Heinz Gruber ausge-graben. Die Lage der beiden Gruben spricht dafür, dass sich die ursprüngliche Siedlungsfläche auf dem Hang befand und hier lediglich ein kleiner Randbereich angeschnitten wurde.11
Im Oktober 2009 wurde etwa 100 m bis 300 m südlich dieser Fundstelle der Humusabtrag auf weiteren Flächen archäologisch begleitet. Hier konnten jedoch lediglich die rechteckigen Überreste neuzeitlicher Teichanlagen doku-mentiert werden. Sollte sich die urnenfelderzeitliche Sied-lung auch auf diesen Bereich der abgeschobenen Fläche erstreckt haben, so ist dieser Teil der Siedlung in der Neuzeit restlos zerstört worden.12
Die Siedlungsgruben
Bei den beiden dokumentierten Siedlungsgruben handelt es sich um zwei rundliche Gruben, die etwa 4 m voneinander entfernt lagen. Grube 1 besaß einen Durchmesser von ca. 0,75 m bei einer erhaltenen Tiefe von bis zu 0,20 m. Sie wies eine dunkelbraungraue, stark humose Verfüllung auf, in der sich eine massive Scherbenlage sowie einige Tierknochen befanden. Grube 2 war noch 0,10 m bis 0,30 m tief erhalten und besaß einen Durchmesser von 0,8 m. In ihr fand sich ebenfalls eine dunkelbraungraue, stark humose Verfüllung, die nur wenige Scherben und Tierknochen enthielt. Die Gru-ben dürften ein wannenförmiges Profil besessen haben und sind somit durch ihre Form in Planum und Profil als typische Vertreter prähistorischer Siedlungsbefunde zu sehen. Auf-grund der nur sehr gering erhaltenen Tiefe und der Größe der Gruben kann eine Ansprache als Pfostengruben nicht ausgeschlossen werden. Das Profil der Gruben spricht je-doch ebenso wie die Verfüllung für eine Zuweisung zu den Siedlungsgruben.
10 Ehemals Gst. Nr. 145/1 der KG Kristein, derzeit in Kommassierung.11 Die anschließenden Grundstücke wurden aufgrund der vermuteten Sied-
lungsfläche unter Denkmalschutz gestellt; vgl. Hebert und Hofer 2009, 22.
12 Heinz Gruber, KG Kristein, FÖ 48, 2009, 379.
tersucht.7 Trotz dieser Feldforschungen und weiterer Entde-ckungen urnenfelderzeitlicher Siedlungen in Oberösterreich (Abb. 1) ist der Forschungsstand weiterhin als schlecht zu bezeichnen. Auch in Bezug auf die Siedlungskeramik – die in größeren Mengen lediglich vom Freinberg und von Gilgen-berg-Bierberg vorgelegt wurde – sind weitere Forschungen vonnöten, um eine lokale Vergleichsbasis urnenfelderzeitli-cher Siedlungskeramik zu schaffen. In diesem Sinn versteht sich auch dieser Aufsatz, der anhand eines zahlenmäßig sehr geringen Materials einen Beitrag zu dieser Problematik liefern soll. Durch die Vorlage unterschiedlicher Komplexe kann die regionale Entwicklung der urnenfelderzeitlichen Keramik am Siedlungsmaterial in Zukunft nachvollzogen werden; so wird eine Ausgangsbasis für siedlungsarchäolo-gische Forschungen mit weiterführenden Fragestellungen gebildet, wofür jedoch noch zahlreiche Schritte in Form von Materialvorlagen und -auswertungen zu tätigen sein wer-den.8
Die Fundstelle und die Ausgrabung
Im Zuge der Errichtung der Anschlussstelle Enns-West der A 1 Westautobahn wurde der Humusabschub auf einigen zu bebauenden Grundstücken in der Katastralgemeinde Kristein (SG Enns, PB Linz-Land) im August 2009 von der Abteilung für Bodendenkmale9 des Bundesdenkmalamts archäologisch begleitet. Die beobachtete Fläche besitzt
7 Schumann Gilgenberg. – Wolfgang Klimesch, KG Gilgenberg, FÖ 48, 2009, 392–393.
8 Auch im Gräbermaterial liegen aus Oberösterreich bis dato nur ver-hältnismäßig wenige keramische Funde vor. Neben den von Monika zu Erbach vorgelegten und ausgewerteten Funden ist hier insbesondere das Gräberfeld von Gusen zu nennen, das einen verhältnismäßig großen Bestand an spätbronze- und urnenfelderzeitlicher Keramik erbrachte, der im Vergleich zum ursprünglich vorhandenen Fundbestand durch die Umstände während und nach der Ausgrabung jedoch deutlich verklei-nert wurde: Trnka 1992.
9 Seit 2012: Abt. für Archäologie. – Projektleitung BDA: Heinz Gruber.
Abb. 1: Urnenfelderzeitliche Siedlungen in Oberösterreich.
Abb. 2: Kristein. Lage der Fundstelle.
45FÖ 51, 2012
Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
flächigen Grafitierung der Außenseite des Gefäßes. Ob es sich bei dem vorliegenden Gefäß um eine Trichterhalstasse mit Henkel handelt, die in der Urnenfelderzeit ebenfalls zahlreich auftritt, kann aufgrund der Erhaltung nicht ent-schieden werden. Vergleichbare Formen finden sich, mit Trichter- oder Zylinderhals, im oberösterreichischen Gräber-bestand beispielsweise in Überackern/Grab 10, Wels/Grab B X21 oder Linz-St. Peter/Brandgrab 20722. Auch im Urnenfeld von Obereching (Salzburg) lassen sich zahlreiche Vergleichs-funde aufzeigen, wie beispielsweise aus Grab 105.23 Tassen und Becher dieser Form sind vorrangig in den jüngeren Ab-schnitt der Urnenfelderzeit (Ha B) zu datieren, wie die Unter-suchungen Monika zu Erbachs, Peter Höglingers und Lothar Sperbers deutlich gezeigt haben.24
Den Trichterhalsgefäßen zuzuweisen sind zwei Frag-mente, von denen eines aus Grube 1 (Taf. 2/13) stammt und eines als Streufund (Taf. 3/27) vorliegt. Aufgrund ihrer Rand-durchmesser von jeweils 14 cm sind sie jedoch einer anderen, kleineren Grundform zuzuordnen. Die beiden Exemplare be-sitzen einen einfachen, rundlich endenden Rand, der leicht nach außen biegt. Da bei den Kristeiner Exemplaren lediglich der Rand erhalten ist, fällt es schwer, akkurate Vergleichs-funde heranzuziehen. Potenziell scheinen Trichterhalsge-fäße mit einem nach außen geschwungenen Hals-/Randteil eher in die jüngere Urnenfelderzeit zu deuten, auch wenn dieser bei Tassen bereits in der späten Bronze- und frühen Urnenfelderzeit auftritt.25 Ein weiteres Trichterhalsgefäß liegt aus Grube 2 vor (Taf. 3/21). Die Schulter geht bei diesem Exemplar ohne Umbruch in einen sehr kurzen Trichterhals über. Ränder dieser Form können zu verschiedenen Töpfen und Amphoren gehören, weshalb eine chronologische An-sprache nicht möglich ist.26 Einem weiteren Trichterhalsge-fäß dürfte ein nur sehr kleinteilig erhaltener Rand, der als Streufund aufgesammelt wurde, zuzuweisen sein (Taf. 3/26). Das Exemplar besitzt einen Randdurchmesser von 16 cm und ist einmal nach innen und einmal nach außen abgestrichen, was ihm eine charakteristische Form verleiht.
Den (Henkel-)Tassen zugehörig sind die Randscherben mit Henkel oder Henkelansatz, die in drei Exemplaren aus Grube 1 vorliegen. Eines dieser Fragmente (Taf. 3/17) besitzt einen trichterförmigen Rand und ist somit den Trichterrand-tassen zuzuweisen, die nach Monika zu Erbach ausschließ-lich in der späten Bronze- und älteren Urnenfelderzeit auf-treten.27 Gute Entsprechungen findet das Exemplar zudem in verschiedenen Henkeltassentypen des Weinviertels, die zeitlich nicht genauer angesprochen werden können.28 Die anderen beiden Exemplare (Taf. 2/12, 14) dürften eher einfa-cheren, unprofilierten Henkeltassen oder auch den Henkel-schalen zuzuweisen sein und sind aufgrund ihrer unsignifi-kanten Form nicht genauer zu datieren.29 Eines der beiden Stücke (Taf. 2/14) weist an der Außenseite den Ansatz einer vertikalen Ritzverzierung auf.
21 Zu Erbach 1985, Taf. 4/B1, Taf. 16/A3. – Vgl. auch Zu Erbach 1986.22 Adler 1965, 97, Abb. 1a.23 Höglinger 1993, Taf. 46/3.24 Sperber 1987, 197–200. – Zu Erbach 1989. – Höglinger 1993, 18–19.25 Zu Erbach 1989, 52. – Schumann Gilgenberg.26 Gut vergleichbar ist der vorliegende Rand beispielsweise mit einem Dop-
pelhenkeltopf aus Gilgenberg-Bierberg/Obj. 480: Schumann Gilgenberg, Taf. 56/A7.
27 Zu Erbach 1989, 52.28 So Typ B oder Typ F: Lochner 1991, 276–277, 300–301.29 Lochner 1991, 281, 301.
Das Fundmaterial
Das Fundmaterial aus den beiden Siedlungsgruben, dem einige Lesefunde an die Seite zu stellen sind, besteht wei-testgehend aus Keramik13, die durch einige Tierknochenfrag-mente ergänzt wird.
Der eindrucksvollste keramische Fund ist das Groß-gefäß aus Grube 1 (Taf. 1/1). Das Gefäß ist insgesamt 51 cm hoch und besitzt eine maximale Breite von 56 cm. Der Hals ist leicht trichterförmig ausgezogen und endet in einem deutlich ausgebogenen Rand, bei einem Randdurchmesser von 36 cm. Streng genommen handelt es sich somit um ein Trichterhalsgefäß; für derartige Formen hat sich in der Li-teratur jedoch der Begriff Zylinderhalsgefäß durchgesetzt, was auf die fließenden Übergänge zurückzuführen ist. Auf der Schulter befindet sich eine horizontale Leiste. Unterhalb dieser wurde eine vertikale Verzierung angebracht, die über den gesamten, in der unteren Hälfte deutlich einziehenden Gefäßkörper bis fast zum Boden reicht. Das Gefäß kann auf-grund seiner Erhaltung gut mit der urnenfelderzeitlichen Grabkeramik verglichen werden. Gefäße dieser Formgebung liegen aus verschiedenen Urnenfeldern in Oberösterreich vor, wie beispielsweise aus Linz-Kleinmünchen-Au, Wels/Grab B X oder Überackern/Grab 10.14 Auch im Gräberfeld von Gusen liegen verwandte Formen vor, die jedoch von den Pro-portionen her leicht abzusetzen sind.15 Derartige Gefäßfor-men kommen den Ergebnissen Monika zu Erbachs folgend während der gesamten Urnenfelderzeit in Oberösterreich vor, weshalb eine Feindatierung schwer zu treffen ist.16 Ul-rich Pfauth nimmt für die niederbayerischen Trichterhals-gefäße an, dass diese während der Stufe Ha A deutlich ge-bauchter und weniger schlank als die jüngeren Exemplare waren. Ebenso besitzen die älteren Exemplare einen mehr-fach abgestrichenen Rand.17 Anhand der Form ließe sich das Exemplar somit tendenziell eher den älteren Stücken zuweisen, der nur einfach abgestrichene Rand ist hier chro-nologisch nicht relevant. Eine klare Ansprache scheint auf-grund der Langlebigkeit dieser Form jedoch nicht möglich. In der typologischen Gliederung des urnenfelderzeitlichen Keramikspektrums im Waldviertel von Michaela Lochner entspricht der Fund am ehesten der Variante A des Typs C der Zylinderhalsgefäße, die vom Beginn der frühen bis zur beginnenden jüngeren Urnenfelderzeit datieren.18 Der tref-fendste Vergleichsfund stammt dabei aus Maissau.19
Ein weiteres Zylinderhalsgefäß, dessen Randabschluss leider nicht erhalten ist, stammt aus Grube 1 (Taf. 2/5). Es besitzt einen deutlich ausgebogenen Rand und eine rund-liche Schulter, die eine maximale Gefäßbreite von ca. 17,5 cm andeutet, was in etwa auch dem Randdurchmesser entspre-chen dürfte. Aufgrund der Größe ist es auch als Tasse zu be-zeichnen, der typologischen Gliederung Michaela Lochners folgend wohl als Typ A oder B.20 Auf der Schulter wurden diagonale Rillenlinienbündel angebracht. Ebenso zeigen sich sehr schlecht erhaltene Reste einer möglicherweise
13 Die Ansprache der Grundformen richtet sich, soweit der Erhaltungszu-stand eine klare Zuweisung erlaubt, nach Hellerschmid und Lochner 2008.
14 Zu Erbach 1985, Taf. 4/B3, Taf. 16/A1, Taf. 38/6. – Vgl. auch Zu Erbach 1986.15 Trnka 1992, Taf. 6/10, Taf. 7/6.16 Zu Erbach 1989, 69.17 Pfauth 1998, 22.18 Lochner 1991, 262.19 Lochner 1991, Taf. 72/2.20 Lochner 1991, 280, 301.
46 FÖ 51, 2012
Robert Schumann
Stufe LT D2.34 Somit gibt der Fund einen Hinweis zumindest auf eine Begehung des Areals in den letzten Jahrzehnten vor der Zeitenwende.
Katalog
Grube 1
1: o. Invnr.; Wandst. ca. 1,3–2,2 cm; H. 51 cm; B. 56 cm; Randdm. 36 cm; Bodendm. 19 cm; Oberflächenfarbe: mittelbraungrau; Magerung: sehr grob; Oberflä-chenbehandlung: verstrichen/geglättet bis gut geglättet.2: Invnr. Ew 14/32; Wandst. 1,0–1,5 cm; Randdm. 38 cm; Oberflächenfarbe: ocker bis dunkelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: sehr grob; Oberflächenbehandlung: grob verstrichen.3: Invnr. Ew 17; Wandst. 0,6–0,7 cm; B. 24 cm; Oberflächenfarbe: rötlichbraun bis dunkelbraungrau; Bruchfarbe: mittelgrau; teilweise sekundär gebrannt; Magerung: sehr grob; Oberflächenbehandlung: geglättet.4: Invnr. Ew 14/10; Wandst. 0,6–0,7 cm; Randdm. 24 cm; Oberflächenfarbe: rötlich bis mittelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: sehr fein; Oberflächenbehandlung: geglättet.5: Invnr. Ew 14/11; Wandst. 0,5–0,7 cm; B. 17,5 cm; Oberflächenfarbe: schwärz-lich; Bruchfarbe: schwärzlich; Magerung: sehr fein; Oberflächenbehandlung: poliert; möglicherweise Reste flächiger Grafitierung auf der Außenseite.6–11: Invnr. Ew 15/1–6; Wandst. 0,6–0,8 cm; Oberflächenfarbe: mittel-braungrau; Bruchfarbe: mittelgrau; Magerung: sehr fein, einige wenige größere Einschlüsse; Oberflächenbehandlung: gut geglättet; mutmaßlich dem gleichen Gefäß zugehörig.12: Invnr. Ew 14/1; Wandst. 0,8–1,0 cm; Oberflächenfarbe: mittelbraungrau; Bruchfarbe: mittelgrau; Magerung: sehr fein; Oberflächenbehandlung: gut geglättet/poliert?13: Invnr. Ew 14/9; Wandst. 0,4–0,6 cm; Randdm. 14 cm; Oberflächenfarbe: mittelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: mittel; Oberflächenbe-handlung: poliert; Reste von Grafitierung an der Außenseite.14: Invnr. Ew 14/3; Wandst. 0,6–1,0 cm; Oberflächenfarbe: ocker bis mittel-braungrau; Bruchfarbe: mittel- bis dunkelgrau; Magerung: mittel; Ober-flächenbehandlung: gut geglättet/poliert; Reste von Grafitierung an der Außenseite.15: Invnr. Ew 14/6+7; Wandst. 0,7 cm; Oberflächenfarbe: ocker bis mittel-braungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau bis schwärzlich; Magerung: mittel, Reste von Grafitierung an der Außenseite; Oberflächenbehandlung: gut geglättet/poliert.16: Invnr. Ew 14/9; Wandst. 0,7 cm; Randdm. 18 cm, Oberflächenfarbe: mittel-braungrau; Bruchfarbe: mittelgrau; Magerung: sehr fein, sehr wenige grobe Bestandteile; Oberflächenbehandlung: gut geglättet.17: Invnr. Ew 14/2; Wandst. 0,6–0,8 cm; Oberflächenfarbe: ocker; Bruchfarbe: ocker; Magerung: sehr fein, einige mittelgroße Einschlüsse; Oberflächenbe-handlung: poliert.weiters: 20 Wandstücke, 13 Tierknochen
Grube 2
18: Invnr. Ew 11/1; Wandst. 0,6–0,7 cm; Oberflächenfarbe: rötlichbraun bis dunkelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: sehr grob; Oberflä-chenbehandlung: verstrichen.19: Invnr. Ew 11/4; Wandst. 0,7–0,8 cm; Oberflächenfarbe: rötlichbraun bis dun-kelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: sehr grob; Oberflächenbe-handlung: unbehandelt/grob verstrichen.20: Invnr. Ew 11/2; Wandst. 0,6–1,2 cm; Randdm. 18 cm; Oberflächenfarbe: dunkelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelbraungrau; Magerung: mittel; Oberflä-chenbehandlung: gut geglättet/poliert.21: Invnr. Ew 11/3; Wandst. 0,8–0,9 cm; Randdm. 20 cm; Oberflächenfarbe: rötlichbraun bis dunkelbraungrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: grob; Oberflächenbehandlung: verstrichen/geglättet.weiters: 43 Wandstücke, 2 Tierknochen
34 So beispielsweise ausgehend von Funden aus Straubing Uenze 1975; Christlein 1981; Tappert 2002. – Mit der Grafittonkeramik der La-Tène-Zeit und deren Ende in Oberösterreich hat sich in den letzten Jahren vor allem Peter Trebsche auseinandergesetzt: z. B. Trebsche 2011, bes. 454–455.
Die Grundform der Schalen ist im Material mit drei zu-weisbaren Gefäßfragmenten vertreten, von denen zwei Ex-emplare aus Grube 1 (Taf. 2/4, 16) stammen und ein weiteres aus Grube 2 (Taf. 3/20) geborgen wurde. Der Randdurch-messer konnte bei zweien bestimmt werden und liegt bei 18 sowie 16 cm. Alle drei Schalen aus Kristein besitzen einen konischen Gefäßkörper, womit sie den konischen Schalen zuzuweisen sind, die im westösterreichischen Raum in die jüngere Urnenfelderzeit datiert werden.30
Zwei Randscherben mit einem steilen, leicht einziehen-den Hals, der in einem nach außen verdickten Rand endet, liegen aus Grube 1 (Taf. 1/2) und Grube 2 (Taf. 3/19) vor. Es han-delt sich hierbei um typische Topfformen der Urnenfelder-zeit, die vor allem aus Siedlungskontexten belegt sind.31 In der typologischen Gliederung Irmtraud Hellerschmids sind die besten Vergleiche für beide Funde wohl in verschiede-nen Varianten von Topfform 3/Typ B zu suchen.32 Bei dem Exemplar aus Grube 1 ist der Rand zusätzlich mit Finger-tupfen verziert, während der aus Grube 2 verhältnismäßig eckig ausgearbeitet wurde. Letzterer lässt sich den Töpfen mit ausladendem Rand angliedern, die Katharina Adametz am Fundmaterial von Unterradlberg (Niederösterreich) definierte und die in die Stufen Ha A und B datieren.33 Eine feinchronologische Ansprache dieser Formen ist somit nicht möglich.
Abgerundet wird das urnenfelderzeitliche Gefäßspekt-rum durch wenige verzierte Scherben. Die Gefäßfragmente 6 bis 11 (Taf. 2), die höchstwahrscheinlich demselben Gefäß angehören, besitzen eine unregelmäßige vertikale Ritzver-zierung, die auch das großteilig erhaltene Gefäßfragment aus Grube 1 aufweist (Taf. 1/3), dessen Form jedoch leider nicht signifikant genug ist, um eine Feindatierung zu erlau-ben. Als Streufund liegt zudem eine Wandscherbe mit auf-gesetzter Fingertupfenleiste vor (Taf. 3/28), die wohl langle-bigste Form prähistorischer Keramikverzierung im südlichen Mitteleuropa.
Die typologische Analyse der Kristeiner Keramikfunde lässt für viele Stücke lediglich eine allgemeine Datierung in die Urnenfelderzeit zu. Einige Exemplare scheinen dabei eher in die ältere, andere eher in die jüngere Urnenfelderzeit zu weisen. Bei einer derart geringen Fundmenge kann hier jedoch nicht von repräsentativen Zahlen ausgegangen wer-den, weshalb als Datierung dieses Fundkomplexes zunächst allgemein die Urnenfelderzeit, im Sinn der Stufen Ha A und B, angegeben werden soll.
Neben der urnenfelderzeitlichen Keramik liegen auch zwei Bodenscherben vor, die einen Hinweis auf eine La-Tène-zeitliche Nutzung dieses Areals geben. Es handelt sich um eine unverzierte Bodenscherbe aus Grafitton (Taf. 3/22) und ein direkt am Übergang zum Boden gebrochenes Ge-fäßunterteil, das aus einem grafitfreien Ton besteht und mit Kammstrich verziert wurde (Taf. 3/23). Während der Grafit-tonboden nur relativ allgemein in die La-Tène-Zeit datiert werden kann, ist für das kammstrichverzierte Exemplar eine genauere Einordnung möglich. Grafitfreie Kammstrichkera-mik gilt als typisch für die ausgehende La-Tène-Zeit, also die
30 Zu Erbach 1989, 56–57. – Höglinger 1993, 22.31 Kern 2001, 29. – Siehe auch die Töpfe mit zylindrischem bis kegelförmi-
gem Gefäßoberteil bei Wewerka 2001, 69–70.32 Hellerschmid 2006, 221–222 mit Typentaf. 31–32.33 Adametz 2011, D119–D120.
47FÖ 51, 2012
Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
Pfauth 1998: Ulrich Pfauth, Beiträge zur Urnenfelderzeit in Niederbayern, Mat. zur Bronzezeit in Bayern 2, Bonn 1998.Ruprechtsberger und Urban 2007: Erwin M. Ruprechtsberger und Otto H. Urban, Linzer Keltenforschung. Ergebnisse der wissenschaftlichen Kooperation zwischen Nordico und Universität Wien 1990–2006, LAF Sonderh. 36, 2007.Schumann 2011: Robert Schumann, 20 Jahre Archäologie der Urnenfelder- und Hallstattzeit in Oberösterreich, Fines Transire 20, 2011, 329–352.Schumann Gilgenberg: Robert Schumann, Die spätbronze- und urnenfel-derzeitliche Siedlung von Gilgenberg-Bierberg. Ein Beitrag zur metallzeitlichen Besiedlung im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich, FÖMat A 23 (in Vorbe-reitung).Sperber 1987: Lothar Sperber, Untersuchungen zur Chronologie der Urnen-felderkultur im nördlichen Alpenvorland von der Schweiz bis Oberösterreich, Antiquitas 3/29, Bonn 1987.Tappert 2002: Claudia Tappert, Ein Blick auf die jüngsten keltischen Funde in Straubing. Spätlatènezeitliche Siedlungsfunde aus der ehemaligen Lehmgrube Mayr, Jahresber. des Hist. Vereins für Straubing und Umgebung 102, 2000, 71–102.Trebsche 2008: Peter Trebsche, Die Höhensiedlung „Burgwiese“ in Ansfelden (Oberösterreich), LAF 38, 2008.Trebsche 2011: Peter Trebsche, Eisenzeitliche Grafittonkeramik im mittleren Donauraum. In: Karl Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 29. Niederbayerischen Archäologentages, Rahden/Westf. 2011, 449–481.Trnka 1992: Gerhard Trnka, Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Gusen in Oberösterreich, ArchA 76, 1992, 47–122.Uenze 1975: Hans-Peter Uenze, Ein spätlatènezeitlicher Siedlungsfund von Straubing, Jahresber. des Hist. Vereins für Straubing und Umgebung 78, 1975, 32–39.Urban 1994: Otto H. Urban, Keltische Höhensiedlungen an der mittleren Donau vom Linzer Becken bis zur Porta Hungaria. 1. Der Freinberg, LAF 22, 1994.Wewerka 2001: Barbara Wewerka, Thunau am Kamp. Eine befestigte Hö-hensiedlung (Grabung 1965–1990). Urnenfelderzeitliche Siedlungsfunde der oberen Holzwiese, MPK 38, 2001.Zu Erbach 1985: Monika zu Erbach, Die spätbronze- und urnenfelderzeitli-chen Funde aus Linz und Oberösterreich. Tafelteil, LAF 14, 1985.Zu Erbach 1986: Monika zu Erbach, Die spätbronze- und urnenfelderzeitli-chen Funde aus Linz und Oberösterreich. Katalogteil, LAF 15, 1986.Zu Erbach 1989: Monika zu Erbach, Die spätbronze- und urnenfelderzeitli-chen Funde aus Linz und Oberösterreich. Auswertung, LAF 17, 1989.Zu Erbach 1995: Monika zu Erbach, Stand und Aufgaben der Urnenfelder-Forschung in Oberösterreich. In: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Festschrift Hermann Müller-Karpe, Monogr. Röm.-Germ. Zentralmus. Mainz 35, Bonn 1995, 307–322.
AbbildungsnachweisAbb. 1: Robert SchumannAbb. 2: Heinz Gruber, BDATaf. 1–3: Ines Ruttner
Streufunde
22: Invnr. Ew 7; Wandst. 0,6–0,8 cm; Bodendm. 14 cm; Oberflächenfarbe: dun-kelgrau; Bruchfarbe: dunkelgrau; Magerung: fein, Grafittonkeramik; Oberflä-chenbehandlung: geglättet.23: Invnr. Ew 3; Wandst. 2,0 cm; Oberflächenfarbe: schwärzlich; Bruchfarbe: rötlich-braun; Magerung: sehr grob, sehr viele Magerungsbestandteile; Ober-flächenbehandlung: geglättet.24: Invnr. Ew 6/1; Wandst. 0,8 cm; Bodendm. 10 cm; Oberflächenfarbe: rötlich bis schwärzlich; Bruchfarbe: rötlich bis dunkelbraungrau; Magerung: grob; Oberflächenbehandlung: grob geglättet.25: Invnr. Ew 6/2; Wandst. 0,7–1,0 cm; Oberflächenfarbe: dunkelbraungrau bis schwärzlich; Bruchfarbe: orange bis mittelgrau; Magerung: fein; Oberflächen-behandlung: verstrichen.26: Invnr. Ew 5/2; Wandst. 0,6–1,2 cm; Randdm. 16 cm; Oberflächenfarbe: hell- bis dunkelbraungrau; Bruchfarbe: hellgrau; Magerung: sehr fein; Ober-flächenbehandlung: gut geglättet/poliert.27: Invnr. Ew 5/1; Wandst. 0,4–0,6 cm; Randdm. 14 cm; Oberflächenfarbe: dun-kelbraungrau; Bruchfarbe: mittel- bis dunkelgrau; Magerung: fein; Oberflä-chenbehandlung: geglättet/poliert.28: Invnr. Ew 2; Wandst. 1,0–1,6 cm; Oberflächenfarbe: schwärzlich; Bruch-farbe: mittel- bis dunkelgrau; Magerung: mittel, sehr viele Magerungsbe-standteile; Oberflächenbehandlung: verstrichen/grob geglättet.weiters: 48 Wandstücke, 7 Randstücke, 3 Bodenstücke, 1 Henkelfragment
LiteraturverzeichnisAdametz 2011: Katharina Adametz, Eine Siedlung der Urnenfelderkultur in Unterradlberg, Niederösterreich, FÖ 50, 2011, 67–92, D4–D493 [Digitalteil].Adler 1965: Horst Adler, Das urgeschichtliche Gräberfeld von Linz-St. Peter. Teil 1: Materialvorlage, LAF 2, 1965.Christlein 1981: Rainer Christlein, Zu den jüngsten keltischen Funden Süd-bayerns, Bayerische Vorgeschbl. 46, 1981, 275–292.Hebert und Hofer 2009: Bernhard Hebert und Nikolaus Hofer, Jahresbe-richt zur archäologischen Denkmalpflege 2009, FÖ 48, 2009, 9–44.Hellerschmid 2006: Irmtraud Hellerschmid, Die urnenfelder-/hallstatt-zeitliche Wallanlage von Stillfried an der March. Ergebnisse der Ausgrabungen 1969–1989 unter besonderer Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze Urnenfelder-/Hallstattzeit, MPK 63, 2006.Hellerschmid und Lochner 2008: Irmtraud Hellerschmid und Michaela Lochner, Keramische Grundformen der mitteldonauländischen Urnenfelder-kultur. Vorschlag für eine Typologie(-grundlage), AÖ 19/2, 2008, 45–48.Höglinger 1993: Peter Höglinger, Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Obereching, Arch. in Salzburg 2, Salzburg 1993.Kern 2001: Daniela Kern, Thunau am Kamp. Eine befestigte Höhensiedlung (Grabungen 1965–1990). Urnenfelderzeitliche Siedlungsfunde der unteren Holzwiese, MPK 41, 2001.Lochner 1991: Michaela Lochner, Studien zur Urnenfelderkultur im Weinvier-tel (Niederösterreich), MPK 25, 1991.
48 FÖ 51, 2012
Robert Schumann
Tafel 1: Kristein. Funde aus Grube 1. 1 im Maßstab 1 : 4, sonst 1 : 3.
49FÖ 51, 2012
Zwei Siedlungsgruben der Urnenfelderzeit aus Kristein, SG Enns, Oberösterreich
Tafel 2: Kristein. Funde aus Grube 1 und 2. Im Maßstab 1 : 2.