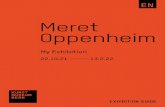Japans Abfall: Zwei Fallstudien zu Entsorgung und Verwertung aus Shibushi und Kamikatsu
Warum T. E. Lawrence Filmheld wurde und Max von Oppenheim nicht. Zwei Orientalisten, zwei Ideologien...
-
Upload
fernuni-hagen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Warum T. E. Lawrence Filmheld wurde und Max von Oppenheim nicht. Zwei Orientalisten, zwei Ideologien...
1
Warum T. E. Lawrence Filmheld wurde
und Max von Oppenheim nicht
Zwei Orientalisten, zwei Ideologien und ein Weltkrieg
Jürgen G. Nagel
Vortragsmanuskript, FernUniversität Hagen, Juli 2013
Im November 2011 strahlte der WDR ein Radiofeature über den Privatgelehrten, Orient-
experten und Diplomaten Max von Oppenheim aus. In diesem Beitrag wurde die Frage
aufgeworfen, warum eigentlich Oppenheim nicht posthum zum Filmhelden aufgestiegen
ist, obwohl sein Leben doch genauso spannend verlaufen war wie das des legendären
Thomas Edward Lawrence oder Lawrence of Arabia. Insbesondere Gabriele Teichmann,
die Leiterin des Hausarchivs der Oppenheim-Bank, hielt ihn aufgrund seines faszinieren-
den Lebens, seiner Bedeutung als Wissenschaftler und einer tragischen Liebesgeschichte
für filmtauglich. Außerdem sei Oppenheim attraktiver gewesen als Lawrence, worauf ich im
Folgenden jedoch nicht näher eingehen möchte.
2
Auf jeden Fall war diese Sendung die Geburtsstunde des heutigen Vortrags. Die im Feature
und in der Literatur genannten Begründungen – das Scheitern seiner orientpolitischen
Pläne, die angelsächsische Siegerhistoriographie, das Unspektakuläre des Archäologenda-
seins – erscheinen weitgehend evident, jedoch blieb die Einordnung der beiden Protago-
nisten in die nicht unkomplizierten Zusammenhänge ihrer Zeit unbefriedigend. Immerhin
weisen die beiden Männer in der Tat Lebenswege auf, die bei allen Unterschieden eine
vergleichende Betrachtung nahelegen.
Im Prinzip entstammten beide den sogenannten besseren Kreisen der Gesellschaft.
Gleichzeitig bedachte ihre Herkunft sie mit einer gewissen Außenseiterstellung. Max war
der Sohn des Kölner Bankiers Albert von Oppenheim und Nachfahre des legendären Un-
ternehmensgründers Salomon Oppenheim. Die Familie war 1868 geadelt worden. Ihre
Mitglieder verkehrten in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen des Kaiserreichs. Als
reiche Privatbankiers waren sie gern gesehene Gäste. Als Familie jüdischer Abstammung
erlebten die Oppenheims jedoch auch Zurückweisungen.
Thomas Lawrence war der zweite Sohn des 7. Baronet of Westmeath. Im Grunde war er
also Angehöriger der Gentry, dies aber nur peripher – weniger wegen der irischen Ab-
stammung, sondern weil er unehelich zur Welt gekommen war und in der »wilden Ehe«
seiner Eltern aufwuchs. Trotz dieses Makels führte ihn der Lebensweg nach Oxford, wo er
Geschichte studierte. Die für seinen Stand eigentlich vorbestimmte Offizierslaufbahn ge-
staltete sich schwieriger, ließ sich aber auf Umwegen auch noch realisieren. Mit Ausbruch
des Ersten Weltkriegs wurde er Offizier beim britischen Nachrichtendienst in Kairo und
brachte es schließlich bis zum Lieutnant Colonel.
Mehr noch war eigentlich Oppenheims Weg vorgezeichnet. Nach den Wünschen der Fami-
lie sollte einem Jura-Studium der Eintritt in die Bank folgen. Dem Ersten fügte er sich noch
aus familiärem Pflichtbewusstsein, dem Zweiten verweigerte er sich. Es gelang ihm aber,
seine Familie davon zu überzeugen, ihn auf seinem Weg als Gelehrter und Diplomat zu
unterstützen. Bald nach dem Studium unternahm er seine erste Reise in den Orient, von
dem er schon früh fasziniert war. Ihr folgte ein einjähriger Sprachaufenthalt Kairo. Law-
rence bereiste den Nahen Osten bereits während des Studiums, um für das Forschungs-
thema seiner Examensarbeit, die Kreuzfahrerburgen, zu recherchieren.
Beide entwickelten auf ihren Reisen eine ganz besondere Beziehung zu den arabischen
Beduinen. In der Literatur ist sogar von ihrer »Liebe« zu den Nomaden der Wüste die Re-
3
de. Oppenheim wie Lawrence interessierte sich nicht nur aus einer akademischen Perspek-
tive für sie, sondern ließen sich von ihrer Lebensart und ihren Werten so weit beeindru-
cken, dass sie diese zum Ideal erhoben.
Bei beiden nahm die Geschichte einen großen Raum in ihren Orientinteressen ein. Beide
waren führend an archäologische Ausgrabungen beteiligt. Während seiner Reisen stieß
Oppenheim 1898 auf das Ruinenfeld, das seinen Ruhm als Orientarchäologe begründete.
Er erwarb umgehend eine Grabungslizenz für den Tell Halaf, einen 8.000 Jahre alten
Siedlungsplatz an der türkisch-syrischen Grenze, und leitete dort ab 1910 die Ausgrabun-
gen.
Ausgrabungen am Tell Halaf …
… und in Karkemisch
4
T. E. Lawrence war nach seinem Examen Mitarbeiter der Grabung im hethitischen Karke-
misch, ebenfalls in der türkisch-syrischen Grenzregion. Es folgte 1914 eine archäologische
Bestandaufnahme auf dem Sinai, die allerdings schon eine wissenschaftlich getarnte Ge-
heimdienstaktion war.
Ein nicht unbeträchtlicher Patriotismus führte beide Männer schließlich in den Staats-
dienst. Gerade für Max von Oppenheim war es eine Herzensangelegenheit, kann man ihn
doch zu Recht mit den Attributen patriotisch, nationalkonservativ und kaisertreu belegen.
Dass seine jüdische Abstammung trotz katholischer Taufe eine reguläre Diplomatenkarri-
ere verhinderte, traf ihn schwer. Aufgrund seiner Orientkenntnisse wurde er jedoch 1896
als »Attaché« an der deutschen Gesandtschaft in Kairo akkreditiert, wo er bis 1909 mit der
Berichterstattung über den gesamten islamischen Raum betraut war.
Weniger mit diplomatischer als mit geheimdienstlicher Berichterstattung war Lawrence
befasst. Nach der Palästina-Expedition von 1914, die für den Geheimdienst in Kairo karto-
graphische Arbeiten erledigte, fand er selbst den Weg zum Secret Service. Während des
Ersten Weltkriegs wurde er einer der Verbindungsoffizier für die aufständischen Beduinen
des Hedjaz. Wie bei Oppenheim beruhte sein Einsatz für den Staat auf seinen Sprach- und
Kulturkenntnissen sowie auf bereits bestehenden Kontakten.
Max von Oppenheim und T. E. Lawrence teilten also einerseits die Faszination für den
Orient und seine Geschichte. Andererseits hatten sie das Bedürfnis gemein, den Interessen
ihres Vaterlands in dieser Weltreligion zu dienen. Beide standen dort im Zentrum militä-
rischer Rekrutierungsbemühungen. Oppenheim empfahl seinem Kaiser, die muslimische
Welt zum Jihad, zum »Heiligen Krieg« gegen die Entente aufzurufen. Lawrence organi-
sierte seinem König die Rebellion der Beduinen gegen die osmanische Vorherrschaft. Im
Gegensatz zu Oppenheim war er der Erfolgreiche.
Die simple Antwort auf die plakative Titelfrage lautet daher, dass Lawrence eine Holly-
woodlegende wurde, weil er erfolgreich war und an der Spitze eines siegreichen Aufstandes
gegen einen Unterdrücker stand. Dass dem Sieg im Aufstand nicht die Erfüllung der damit
verbundenen Träume folgte, lieferte die Prise an Tragik, die für einen Filmhelden unver-
zichtbar ist. All dies hatte Max von Oppenheim nicht in die Waagschale zu werfen. Sein
Gegenunternehmen verlief schlichtweg im Sande. Rein filmisch mag die Ausgangsfrage
damit bereits geklärt sein. Historisch reicht dies jedoch nicht aus. Letztendlich interessiert
5
hier nicht die Entscheidung über einen Plot in Hollywood, sondern die Gründe für das
Scheitern der alternativen Option.
Gerade in jüngster Zeit ist eine Vielzahl an Publikationen zu Max von Oppenheim und sei-
ner Verwicklung in den sogenannten »Jihad des Kaisers« erschienen. Die eingangs zitierte
Radiosendung war kein Zufall, sondern lag thematisch im Trend einer regelrechten Op-
penheim-Renaissance.
In der historischen Bewertung sind zwei Grundtendenzen zu beobachten. Schon länger
wird eine Verurteilung seiner Aktivitäten betrieben – mit dem völlig wirklichkeitsfremden
Vorwurf als Höhepunkt, die deutsche Orientpolitik hätte den heutigen Jihadismus gewalt-
bereiter Islamisten überhaupt erst hervorgerufen. Für Wolfgang Schwanitz war Oppenheim
der »Wegbereiter der islamistischen Auslegung des Heiligen Kriegs« oder der »deutsche
Vater eines islamistischen Djihads« und die »Djihadisierung des Islam im 20. Jahrhundert
ein Import mit dem Berliner Markenzeichen.« Angelsächsische Interpretationen gehen
nicht ganz so weit, stilisieren Oppenheim jedoch zum düsteren Spion des nicht minder
düsteren deutschen Kaisers und seine Vorschläge als unmoralisches weil rücksichtsloses
Gegenstück zum glorreichen Freiheitskampf unter Lawrence.
Auf der anderen Seite findet sich, vor allem in der jüngeren Forschung, eine Art Ehrenret-
tung Oppenheims. Gerade in der jüngsten Monographie von Stefan Kreutzer ist dies der
Fall, aber auch in Publikationen aus dem Oppenheim-Archiv. Alle diese sind seriöse Wis-
senschaft, haben aber doch einen Hang zur gegenteiligen Überzeichnung bis hin zu einer
Form moderner Heldenverehrung, in der Oppenheim zum anti-imperialistischen Heils-
bringer des Orients aufsteigt.
Alle Urteile über Oppenheim ergeben sich aus der Tatsache, dass die historische Bearbei-
tung von Oppenheims Beitrag zur deutschen Orientpolitik geradezu gnadenlos eurozent-
risch ist. Zwei Bereiche werden hingegen von beiden Forschungsströmungen weitgehend
unbeachtet gelassen: die politische, gesellschaftliche und religiöse Lage in der Region am
Vorabend des Weltkriegs und das Islamverständnis bei Oppenheim vor dem Hintergrund
der zeitgenössischen Islamwissenschaft. Interessanterweise begnügen sich die Oppen-
heim-Forscher diesbezüglich mit seinen eigenen Aussagen. Oppenheims Expertentum gilt
allen als unumstritten, ergo können seine Aussagen über Araber und Islam als allgemein-
gültig angesehen werden.
6
Oppenheims Pläne fanden ihren Niederschlag in dem Memorandum Denkschrift betref-
fend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde aus dem November
1914. Er hatte die Schrift mit Kriegsbeginn ausgearbeitet und sie über das Auswärtige Amt
an den Kaiser weitergeleitet. Dieser ließ sich leicht überzeugen, und so wurde Oppenheims
Vorschläge zur Grundlage der offiziellen Orientpolitik.
Der Grundgedanke bestand darin, in der islamischen Welt, die zu nicht unbeträchtlichen
Teilen unter der Herrschaft Englands, Frankreichs und Russlands stand, einen Volksauf-
stand auszulösen, der diese Kriegsgegner entscheidend destabilisieren sollte. Vorbedin-
gung war eine intensive Mitwirkung der Türkei. Ein erster Schritt sollte in einer intensiven
Propaganda bestehen zur Aufklärung über die – aus deutscher Sicht – tatsächliche Kriegs-
lage. Sie sollte in der direkten Aufforderung zu Aufständen gipfeln, worauf ein kriegerisches
Vorgehen der Türkei die Revolutionierung unmittelbar auslösen sollte. Dafür mussten dem
Bündnispartner Menschen, Geld und Material zur Verfügung gestellt werden. Mit Beginn
türkischer Aktivitäten musste der Aufruf zum »Heiligen Krieg« erfolgen. Dabei hatte ganz
klar zu sein, dass damit kein Krieg gegen die Ungläubigen allgemein gemeint war, sondern
einer gegen die »Fremdherren«.
In der Forschung wird die deutsche Nahostpolitik, und damit auch Oppenheims Denken,
gerne als un-imperialistisch oder nicht-imperialistisch bezeichnet. Sie wäre auf Freund-
schaft zur Türkei sowie auf Wirtschaft und nicht auf kolonialen Territorialerwerb ausge-
richtet gewesen. Letzteres trifft unzweifelhaft zu, ist aber noch lange nicht an-
ti-imperialistisch. Vielmehr verfolgte selbst das Deutsche Reich eine Form von »informal
empire«, was auch bei Oppenheim zu finden ist. In seiner Warnung von einer Kolonisie-
rung des Orients, die auf dem Kolonialkongress von 1905 gefordert wurde, führt er weniger
anti-koloniale Argumente im Interesse der Einheimischen an als die Befürchtung, dass eine
große Menge deutsche Auswanderer aufgrund der »Hab- und Raubsucht der wilden
Stämme« nur Streit mit den Einheimischen provozieren würden. Im Wesentlichen han-
delte es sich um eine Warnung vor einem großen Blutvergießen. Diese passt auch besser zu
dem Kolonialbefürworter Oppenheim, der engste Kontakte in die Kolonialbewegung
pflegte, auch zu radikalen Figuren wie Carl Peters, und in jungen Jahren schon als Planta-
genbesitzer in Deutsch-Ostafrika tätig gewesen war – von seinem immer wieder geäußer-
tem Misstrauen der ökonomischen und administrativen Kompetenz der Türken gegenüber
ganz zu schweigen.
7
Ungeachtet dessen beruhten Oppenheims Hoffnungen gerade auf der Wahrnehmung
Deutschlands als nicht-imperialistische Macht und dem von ihm beobachteten »ungeheu-
ren« Ansehen des Kaisers »in allen Teilen der islamischen Welt«, in der er sogar eine
»tiefgehende, aus dem Herzen kommende Verehrung« sah. Grundlage hierfür war das
Versprechen des Kaisers, der Freund aller »Mohammedaner« zu sein, ausgesprochen in
Damaskus während seiner Orientreise 1898. Die Euphorie der Oppenheim‘ schen Ein-
schätzung dürfte allerdings im Wesentlichen auf der Auswahl seiner Kontaktpersonen be-
ruht haben und kann kaum auf die Bevölkerung insgesamt bezogen werden. Eine zweite
Quelle seines Optimismus war die Wahrnehmung der noch unterschwelligen Freiheitsbe-
wegung in Indien durch das politische Establishment der arabischen Welt, die er in Kairo
hatte beobachten können. Und schließlich beruhten seine Hoffnungen auf die grenzüber-
greifenden Möglichkeiten einer anti-kolonialen Erhebung auf seinen Vorstellungen von
Islam und Panislamismus, auf die ich noch zurückkomme.
Die angesprochene Denkschrift enthält einen umfangreichen Aktionsplan mit zahlreichen
praktischen Elementen. Für die einzelnen Regionen der gesamten islamischen Welt macht
Oppenheim konkrete Vorschläge, sowohl propagandistischer Art als auch bezüglich sinn-
voller Waffenlieferungen oder Angriffsziele. Teilweise muten die Vorschläge naiv an, wenn
er zum Beispiel empfiehlt, vom Luftschiff aus gegnerischen islamischen Truppen zuzuru-
fen, dass sie auf deutscher Seite besser behandelt würden und deshalb überlaufen sollten.
Teilweise erscheinen die praktischen Vorstellungen so, als ließe sich alles von oben herab
steuern, wenn er zum Beispiel plant, die ägyptischen Beduinen in erster Linie als Hilfs-
truppen zur Kamelversorgung heranzuziehen.
Interessant für den Vergleich mit Lawrence ist Oppenheims Vorstellung von den islami-
schen Zentren Mekka und Medina. Dort wollte er nicht nur eine eigene Organisation
schaffen, um die Pilgerströme für seine Aufstandspläne zu gewinnen, sondern plante aus-
drücklich den dortigen Machthaber Sherif Hussein, den Hüter der heiligen Stätten, zu-
sammen mit dem osmanischen Gouverneur für die Leitung der Propaganda ein. Man muss
Oppenheim allerdings zugutehalten, dass der panarabisch und eben nicht panislamisch
denkende Sherif zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Spitze eines bewaffneten Aufstan-
des stand wie zwei Jahre später.
8
Oppenheim lieferte nicht nur eine Denkschrift, sondern war zentral an den praktischen
Umsetzungsversuchen beteiligt. Zunächst baute er in Berlin die Nachrichtenstelle für den
Orient auf, eine Mischung aus zentraler Stabsstelle und think tank. In ihr zog er eine ganze
Reihe von Experten zusammen, darunter auch etablierte Universitätsgelehrte wie den Is-
lamwissenschaftler Martin Hartmann oder den Ägyptologen Eugen Mittwoch. Neben der
propagandistischen Betreuung muslimischer Kriegsgefangener bestand die wesentliche
Aufgabe der Einrichtungen in der Entwicklung umfangreicher Materialien für den Einsatz
im Osmanischen Reich.
Zur konkreten Umsetzung der Propaganda war jedoch eine Präsenz vor Ort unabdingbar.
Daher ließ sich Oppenheim 1915, als die Nachrichtenstelle hinreichend konsolidiert war,
9
nach Istanbul versetzen, um ein System von sogenannten Nachrichtensälen aufzubauen.
Bezog sich die Denkschrift mit Indien, Ägypten, Persien und Afghanistan noch zu großen
Teilen auf Gebiete außerhalb des Osmanischen Reichs, verblieben die realen Aktivitäten
Oppenheims nun auf türkischem und arabischem Boden.
Die Organisation der Nachrichtensäle und die Erstellung der Propaganda nahm Oppen-
heim ganz für sich in Anspruch. Folgt man seinen Berichten, wurde dies von den Türken
auch sehr begrüßt, »da sie selbst propagandistisch nicht geschickt waren.« Über 70 Säle
dieser Art wurden eingerichtet. In ihnen wurden Tagesdepeschen aus dem Kriegsgesche-
hen ausgelegt, türkische und regionale Zeitungen, deutsche illustrierte Zeitschriften – auch
Frauenzeitschriften! – mit türkischen Beilagen oder Übersetzungen, Bilder von Kriegs- und
Tagesereignissen, Broschüren und Flugschriften. Ergänzt wurde das Angebot durch
Wandschmuck aus Porträts verbündeter Herrscher und Karten der Kriegsschauplätze.
Wichtig erschien Oppenheim neben der Verächtlichmachung der Feinde und der Verdeut-
lichung eigenen Kriegserfolgte auch wirtschaftliche Propaganda, um der Bevölkerung
Deutschland als einzig wahren Handelspartner nahezubringen.
10
Eine Bewertung der Nachrichtensäle ist nicht ganz einfach. Sicherlich unsinnig ist die In-
terpretation, es habe sich um ein Spionagenetzwerk gehandelt. Ebenso unglaubwürdig er-
scheinen aber auch Oppenheims eigene Angaben, die Nachrichtesäle wären von 10.000 bis
20.000 interessierten Arabern pro Tag besucht worden. Besucher dürfte es gegeben haben,
schon allein aus Neugier. Wie viele es waren, wird nicht mehr zu ergründen sein. Eines
jedoch ist sicher: Der »Jihad made in Germany« versandete, ehe er überhaupt wahrge-
nommen werden konnte. Insofern dürfte die Propaganda, die vielen Beobachtern schon
damals dilettantisch vorkam, eher bedeutungslos gewesen sein. Auch die wenigen realen
Aktionen in Persien und Afghanistan, wohin eine schlecht ausgerüstete Militärexpedition
entsandt wurde, werden gerne überschätzt.
Die gängigsten Begründungen für das Scheitern werden in der Unschlüssigkeit der leiten-
den deutschen und türkischen Stellen gesucht, in ihren unterschiedlichen Zielen und un-
klaren Kompetenzen sowie in personellen und materiellen Problemen. Für Autoren wie
Stefan Kreutzer hätten ohne diesen Hintergrund die Pläne Oppenheims durchaus durch-
geführt werden können und keineswegs einen amateurhaften Charakter gehabt. Es war also
nur eine unfähige Zentrale, die dem Experten vor Ort in den Rücken fiel. Bei so viel Be-
wunderung sollte der Blick doch auf die realen Verhältnisse im Nahen Osten zu Beginn des
20. Jahrhunderts gerichtet werden.
Auf der politischen Ebene war Oppenheims Ansatzpunkt stets das Osmanische Reich, und
dort vor allem der Sultan. Einerseits, weil er der Verbündete des Kaiserreichs war. Ande-
rerseits, weil sich der Sultan als Kalif aller Muslime verstand. Der osmanische Vielvölker-
staat hatte jedoch eine komplexe politische Struktur, die sich vor allem in der Phase der
Desintegration bemerkbar machte. Auch wenn Oppenheim selbst gelegentlich von der
wichtigen Rolle der lokalen Notablen in Wirtschaft und Politik schreibt, wird er in seinen
Überlegungen dieser Komplexität nicht gerecht.
Grundsätzlich war Realität der Machtverhältnisse im arabischen Raum von einer Dualität
geprägt. Der osmanischen Vorherrschaft und ihrer Verwaltung standen lokale Eliten ge-
genüber. Die führenden, zumeist in den Städten ansässigen Familien bauten vertikale und
horizontale Machtstrukturen auf: vertikal durch Patron-Klient-Beziehungen, horizontal
durch Netzwerke von interfamiliären Bündnissen. Dadurch bestand ursprünglich ein
konkurrierendes Verhältnis zwischen ihnen und der osmanischen Administration. Ein
Wandel trat mit der Reformära des Tanzimats seit den 1830er Jahren ein, einer Phase der
11
Integration solcher Eliten. Dieser folgte eine zunehmend von der jungtürkischen Bewegung
geprägte Phase, in der die offizielle Zentralisierungs- und »Türkisierungspolitik« zu einer
Marginalisierung der lokalen Eliten führte. Gleichzeitig bot eine modernisierte Verwaltung
Aufstiegsmöglichkeiten für neue Gruppen, die in Konkurrenz zu traditionellen Eliten treten
konnten.
Damit ist das komplizierte Geflecht regionaler Beziehungen noch nicht erschöpfend skiz-
ziert. Es existierten verschiedene politische Loyalitätsstrukturen nicht nur nebeneinander,
sondern auch miteinander. Weder die familiär begründeten Gemeinschaftsbildungen noch
die Patron-Klient-Beziehungen setzten eine identische Verortung aller Beteiligten voraus.
Urbane Notablen waren auch mit den nomadisierenden Beduinengruppen verflochten.
Gerade in der Beduinenkultur waren verschiedene Loyalitätsformen bekannt. Freundschaft
konnte zu sogenannter Blutbrüderschaft ausgebaut werden, die gleichrangig zur ver-
wandtschaftlichen Bruderbeziehung stand. Oppenheim selbst führte über Jahre eine solche
Beziehung. Die sogenannte »Milchbruderschaft«, durch eine gemeinsame Amme gestiftet,
hatte die gleiche Wirkung. Zur Festigung ihrer Netzwerke beschäftigten städtische Familien
gerne beduinische Ammen. Daneben existierten Schutzbündnisse zwischen sesshaften
Städtern und nomadisierenden Beduinen – ganz abgesehen davon, dass zahlreiche Bedui-
nen ganz ohne europäisches Zutun sesshaft wurden oder zwischen den Lebensstilen wech-
selten. Auf diese Weise entstanden vielfältige Verflechtung zwischen Stadt und Wüste, auch
von großer politischer Relevanz, die in Oppenheims Plänen keinerlei Rolle als Transmis-
sionsriemen der Revolutionierung spielten.
Auf der ideologischen Ebene setzte Oppenheim auf die integrative Kraft des Panislamis-
mus. Auch dabei sah er den osmanischen Sultan in der Schlüsselposition. Dieser propa-
gierte gerade in Kriegszeiten den Zusammenhalt der islamischen Welt. Letztendlich war
dieser Panislamismus jedoch nur ein Vehikel zur Legitimation und Absicherung seiner
Macht. Darin kam die beinahe schon verzweifelte Hoffnung des Sultans zum Ausdruck, ein
neues einigendes Band für sein zerfallendes multiethnisches, aber primär muslimisches
Reich zu finden. Wie bei den politischen Strukturen zeigt sich hier Oppenheims undiffe-
renzierter Blick. Denn die panislamische Politik – oder besser: Rhetorik – des Sultans ist
nicht einfach mit dem Panislamismus als intellektueller Bewegung gleichzusetzen, ge-
schweige denn mit den Reformorden, die die religiöse Landschaft noch komplizierter
machten. Verschiedene Vordenker wollten den Islam modernisieren und vor allem verei-
12
nen, um ihn für die Herausforderung durch die westliche Moderne »fit« zu machen. Ge-
nannt seien nur der Perser Jamal ad-Din al-Afghani in Paris und der Ägypter Muhammad
Abduh in Kairo oder der in Libyen aktive Senussi-Orden. Die Intellektuellen waren gut
vernetzt, entfalteten aber nur einen überschaubaren Wirkungskreis. Weder die panislami-
sche Propaganda der Hohen Pforte noch der intellektuelle Panislamismus, nicht einmal die
salafistischen Erneuerer hatten je die Kraft, eine politisch relevante Massenbewegung ins
Leben zu rufen.
Auf der religiös-rechtlichen Ebene spielte der Begriff Jihad für Oppenheim die Schlüssel-
rolle. Auf die theologische Frage, was Jihad eigentlich bedeutet, will ich hier nicht näher
eingehen, sondern nur kurz auf den Unterschied hinweisen zwischen »großem Jihad«, der
das spirituelle Bemühen des Einzelnen bezeichnet, und »kleinem Jihad«, der für die krie-
gerische Auseinandersetzung des dar al-islam und des dar al-harb steht und je nach Aus-
legungsschule die Verteidigung der islamischen Welt oder ihre gewaltsame Ausdehnung
bezeichnet. Wichtig für unseren Zusammenhang ist die politische Vokabel des »Heiligen
Krieges«.
Für deren Bedeutung lässt sich sehr gut ein zeitgenössischer Kronzeuge anführen, nämlich
der Leidener Islamwissenschaftler Christiaan Snouck Hurgronje. Von seinen deutschen
Kollegen schlicht in das feindliche Lager verwiesen und von den Historikern der Oppen-
heim-Renaissance mit dem Vorwurf belegt, die freiheitlichen Ziele der deutschen Orient-
politik bewusst zu ignorieren, führte er doch 1915 in erster Linie eine publizistische Ausei-
nandersetzung um ein realistisches Verständnis von Jihad. In seiner Schrift Jihad Made in
Germany kritisiert er zwar deutlich die deutsche Vorgehensweise, zeigt dabei aber die
Problematik des Panislamismus treffend auf. Er beschreibt den Jihad als eine gängige
Kriegsfloskel und betont in diesem Zusammenhang, dass es einen nicht-heiligen Krieg im
Islam gar nicht geben kann. Entweder wendet sich der Krieg gegen Ungläubige oder Ag-
gressoren – dann ist er immer Gottes Gebot und muslimische Pflicht – oder er tut dies
nicht, dann ist er erst gar nicht erlaubt. Zudem sieht er die Akzeptanz des osmanischen
Kalifats in der gesamten islamischen Welt als problematisch an und sein Mobilisierungs-
potential als gering. Unterfüttert waren seine Einschätzungen von persönlichen Erfahrun-
gen im muslimisch geprägten Niederländisch-Indien, wo er als Kolonialbeamter gearbeitet
hatte.
13
Der in der traditionellen Rechtsliteratur, dem fiqh, definierte Jihad verlor nach der expan-
siven Phase der ersten Dynastien seine einheitsstiftende Relevanz schon allein deshalb,
weil Einheitlichkeit unter einem Kalifen spätestens mit der Festsetzung in Spanien auch
unter den Sunniten ein Ende hat. Die Unterscheidung in die Häuser des Islams und des
Krieges wurde immer diffiziler, wie in Indien, und führte in einigen Rechtsschulen zur
Einführung eines dritten Hauses, des Hauses des Vertrags, des dar al-sulh. Denn wie geht
man mit verbündeten Ungläubigen um, wie im Falle des Ersten Weltkriegs mit dem Deut-
schen Reich? Eine zunehmende Regulierungs- und Legitimierungsnotwendigkeit ging
einher mit Bedeutungsverlust des realen Phänomens Jihad. Die politische Vokabel blieb
dessen ungeachtet stets allgegenwärtig. Gerade in der Auseinandersetzung mit kolonialer
Herrschaft gab es keinen Aufstand mit muslimischer Beteiligung, der nicht als »Heiliger
Krieg« firmierte. Und wie Hurgronje treffend feststellt, blieb auch kein Krieg, den das Os-
manische Reich führte, ohne eine entsprechende Titulierung durch den Sultan. Die Prob-
lematik, einen »Heiligen Krieg« in Form eines Volksaufstandes zu entfachen, war also in
der Diskussion gegenwärtig, wurde aber von der deutschen Islamwissenschaft dezidiert
und von Oppenheim stillschweigend beiseitegeschoben.
Proklamation der »Jihad-Fatwa«, 14. November 1914
14
Ganz im deutschen Sinne wurde am 14. November 1914 in Istanbul eine Jihad-Fatwa des
Sheik-ul-Islam verkündet. Als Fatwa hatte sie den Charakter eines – nicht verbindlichen –
Rechtsgutachtens; durch den Sultan als Auftragsgeber erhielt sie jedoch die Verbindlichkeit
eines Befehls des obersten Religionsführers. So zumindest die Sicht des Sultans und seiner
deutschen Verbündeten. Die Resonanz war beeindruckend, allerdings nicht im Sinne der
Genannten: Es gab sie einfach nicht. Zum einen, weil der Begriff Jihad eben eine allzu
gängige Floskel in der staatlichen Rhetorik war. Zum anderen, weil der Sultan in vielen
Weltgegenden nicht im klassischen Sinne als Kalif wahrgenommen wurde. Es kann davon
ausgegangen werden, dass nur wenige Imame in ihren Predigten diese Fatwa überhaupt
verbreiteten. Angesichts der zentralen Rolle religiöser Mobilisierung in den Gedanken
Oppenheims fällt auf, dass in seine Schriften nie von den Imamen die Rede ist, die für das
religiöse Selbstverständnis der Bevölkerung auf der lokalen Ebene entscheidend waren.
Damit blendete Oppenheim eine wesentliche, wenn nicht die für seine Pläne entscheidende
Gruppe innerhalb der islamischen Gemeinschaft aus.
Überhaupt lässt Oppenheims Lebensweg eine deutliche Elitenorientierung erkennen. Er
lebte stets ein Leben der Oberschicht, im Kaiserreich wie im Orient. Seine unvollendeten
Lebenserinnerungen stellen über weite Strecken eine Materialsammlung über seine
Freunde, Bekannten und Kontaktpersonen dar. Sie zeichnen das Bild eines Netzwerkes vor
allem in den höchsten politischen und wissenschaftlichen Kreisen.
Die Tatsache, dass er als einziger Diplomat in Kairo in einem rein arabischen Viertel lebte,
bedeutete noch nicht, dass er dort zum einfachen
Araber wurde. Sein Lebensstil nahm arabische Aus-
drucksformen an bis hin zur Ehe auf Zeit, blieb aber
letztendlich elitär. Sein Verhalten im Orient war kein
simples Mimikry, aber die Fortführung seines ge-
wohnten gesellschaftlichen Stils im islamischen Ge-
wand.
Seine wissenschaftliche Perspektive blieb davon
nicht unberührt. Sein Ruf als Orientkenner und Be-
duinenexperte beruhte nicht zuletzt auf dem Detail-
reichtum seines Wissens, wie es in seinem mehr-
Oppenheims Haus in Kairo
15
bändigen Beduinenwerk zu Ausdruck kommt oder in dem systematischen Verzeichnis aller
arabischen Zeitungen, das er während seiner Zeit in Kairo anlegte. Zusammen mit dem
Anspruch, »von Cairo aus die Bewegungen der ganzen islamischen Welt zu beobachten«,
verweist dies eigentlich auf intime Kenntnisse der politischen Strömungen in der arabi-
schen Welt. Er verfügte also durchaus über die Grundlagen für eine weitaus differenziertere
Sichtweise, als sie in seiner Denkschrift von 1914 und den darauf beruhenden Aktivitäten zu
erkennen ist.
Hier tritt eine Ambivalenz in Oppenheims Denken auf, die nicht gänzlich aufzulösen ist.
Die Möglichkeit, dass die Revolutionierungs-Denkschrift nicht wirklich ernst gemeint war,
kann man aufgrund seines Engagements ausschließen. Vielleicht aber handelte es sich um
eine bewusste Unterordnung des Wissenschaftlichen unter politische Erfordernisse. Oder
er eignete sich viele Kenntnisse erst später an. Immerhin erschien sein beeindruckendes
Beduinenwerk erst ab 1939. Vielleicht aber auch ist die Ambivalenz der Ausdruck eines
spezifischen Oppenheim‘schen Orientalismus.
Ich habe selbst in der Lehre gerne betont, dass die deutsche Orientalistik einen guten An-
satzpunkt für Kritik an der Orientalismusthese von Edward Said bietet. Sie wird von Said
nicht berücksichtigt, weil sie anders gelagert war und aus einem Kontext stammte, der
nicht durch konkrete Machtinteressen im Orient bestimmt war. Während Lawrence für
Edward Said ein Paradebeispiel des Orientalisten darstellt, hätte man Oppenheim tatsäch-
lich für das entsprechende Gegenbeispiel halten können. Seit ich mich allerdings näher ihm
befasse, bin ich nicht mehr ganz meiner Meinung.
Auch Oppenheims Orient ist ein westliches Konstrukt, das besonders dann deutlich zutage
tritt, wenn es um Fragen der Macht und der Kriegsführung geht. Spätestens dann wird der
Islam als eine monolithische Entität gesehen, und der Kalif ist als Oberhaupt, als eine Art
Symbiose aus Papst und Kaiser, gesetzt. Der Islam war für Oppenheim das uneinge-
schränkt einigende Band aller Menschen dieses Bekenntnisses. Der Panislamismus »blüh-
te« zu seiner Zeit, wurde von Istanbul aus »gehegt und geschürt« mit dem Ziel, »die
Muhammedaner der ganzen Welt einander als Brüder näherzubringen.« Der Jihad war die
seit altersher bei den Muslimen verankerte Form der Massenmobilisierung. Und angesichts
»der Eigenart des Orients« bedurfte es langwieriger, nachdrücklicher Einflussnahme, um
die Orientalen auf die richtige Richtung einzustimmen.
16
Die angesprochene Ambivalenz kommt auch in Oppenheims Beduinenforschung zum
Ausdruck. Wenn in Oppenheims Erinnerungen die Sprache auf die Beduinen kommt, er-
hält der sowieso freundschaftliche Duktus Arabern und dem Islam gegenüber eine Note des
»Edlen«.
Die entscheidenden Schlagworte lauteten: Ritterlichkeit, Tapferkeit, Kühnheit, Zähigkeit,
Großmut, Gastfreundschaft, Zuverlässigkeit, Liebe zur Freiheit der Wüste, Vornehmheit,
edle Haltung oder aristokratische Tugenden. Dies unterscheidet sich auf den ersten Blick
kaum von der Begeisterung eines T. E. Lawrence. Auf den zweiten Blick bringt Lawrence,
wenn es ihm um militärtaktische Fragen geht, auch weniger euphorische Aspekte vor wie
ihre vermeintliche Fixierung auf Beutezüge – ein Topos übrigens, den gerade die aktuelle,
Lawrence-kritische Literatur wiederum als gesichert annimmt. Insgesamt ist jedoch von
einer Art »edlem Wilden des Orients« die Rede, eine Stereotype, der sich bis in das 18.
Jahrhundert zurückverfolgen lässt und von Edward Gibbon für die Orientalistik nachhaltig
geprägt wurde. Zu diesem Bild gehört auch die völlige Trennung der beduinischen Le-
benswelt in der Wüste von der Stadt, in welcher der »despotische Türke« den Ton angab.
Auch diese imaginierte Trennung findet sich in den Schriften von Oppenheim, obwohl un-
sere Kenntnis über beduinische Loyalitäten vielfach genau auf diese zurückgeht.
Oppenheims Denken muss im Zusammenhang mit der Entwicklung der deutschen Islam-
wissenschaft gesehen werden. Er rezipierte die aktuellen Forschungsdebatten und stand
darüber hinaus zumindest mit einem Teil der Fachwissenschaftler in engem Kontakt.
Mehrere von ihnen waren in der Nachrichtenstelle für den Orient engagiert. Ein fachlicher
Austausch war also gegeben, ebenso wie ein Integrationswunsch seitens Oppenheims, der
kritische Hinterfragungen aufgrund seiner Erfahrungen auch unterbinden konnte.
Denn in der sehr jungen deutschen Islamwissenschaft setzte sich zu dieser Zeit ein recht
monolithisches Bild durch. Das Fach befand sich in einem Ablösungsprozess von der al-
tertumswissenschaftlich geprägten Orientalistik. Dabei setzte sich der am Hamburger Ko-
lonialinstitut lehrende Carl Heinrich Becker, der eine »historisch-kritische« Ausrichtung
bevorzugte, als bis heute anerkannter Gründungsvater des Fachs durch. Insbesondere
lehnte er einen gegenwartsbezogenen, mitunter als »soziologisch« bezeichneten Ansatz,
wie in Martin Hartmann in Berlin vertrat, ab. Sein Paradigma, religiöse, rechtliche, intel-
lektuelle, wirtschaftliche und politische Aspekte des Islams als eine Einheit zu verstehen,
war eigentlich innovativ und fortschrittlich, ebenso seine Suche nach den historischen
17
Wurzeln. Im Zuge dessen löste Becker den Islam aus seiner engen Verknüpfung mit der
Geschichte der Araber. Er verstand den Islam nicht nur als Glaubensgebäude, sondern vor
allem als Kultur, und diese war »hellenistisch« und »asiatisch«. Die damit verbundene
Vorstellung der »Einheitszivilisation« führte aber schnell zu normativen, vereinheitli-
chenden und damit indifferenten Sichtweisen, die auch Oppenheims Denken prägten.
Was war nun bei Thomas E. Lawrence anders? Auf Oppenheims Selbstverständnis als Ge-
lehrter wurde mehrfach hingewiesen. Nach dem Ersten Weltkrieg ging er endgültig den
Weg des Wissenschaftlers. Seine politische Praxisorientierung entsprang situationsbedingt
seinem konservativem Patriotismus, war aber für sein Werk nicht dauerhaft bestimmend.
Lawrence war als Historiker und Archäologe ebenfalls an Wissenschaft interessiert, wech-
selt aber während des Krieges die Fronten. Nach dem Krieg flüchtete er, sich selbst ent-
wurzelt fühlend, in den Militärdienst und in eine Selbststilisierung bezüglich seiner Rolle
im Arabischen Aufstand. Oppenheim leitete ernsthafte Schritte der Selbstdarstellung erst
ein, als durch den Zweiten Weltkrieg sein sichtbares Lebenswerk als Forscher in Schutt und
Asche lag.
Das unterschiedliche Osmanenbild hat sich ebenfalls schon angedeutet. Bei Oppenheim
führte die grundsätzlich positive Einstellung zum Bündnispartner auf den Pfad einer unre-
alistischen Jihad-Vorstellung. Bei Lawrence führte die entsprechende Abneigung in das
Lager des arabischen Nationalismus. Hier tut sich nun ein alternativer Ansatzpunkt für die
Mobilisierungsaktivitäten europäischer Mächte im islamischen Orient auf.
Ein arabischer Nationalismus hatte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Ohne
die europäische Moderne als Ideengeber war dieser nicht denkbar, allerdings auch nicht
ohne den Islam. Deswegen war diese Ideologie aber noch lange kein Panislamismus, wie
nicht nur bei Oppenheim immer wieder anklingt. Vielmehr hatte sie drei Wurzeln. Zum
einen waren es christliche Araber, vornehmlich im Libanon und in Syrien, die nach gesell-
schaftlicher Gleichberechtigung in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft strebten.
Zum anderen waren es auch – zahlenmäßig sogar deutlich überlegen – muslimische Ara-
ber, darunter viele Vertreter traditioneller Eliten, die dem aktuellen Niedergang der isla-
mischen Welt das Ideal eines lange vergangenen, dynamischeren und vor allem arabischen
Islam entgegenstellten. Schließlich spielten Aufsteiger eine wichtige Rolle, die ihre Aus-
bildung in den modernisierten osmanischen Schulen und Universitäten absolvierten und
sich dort den türkischen Nationalismus zum Vorbild nahmen. Sozial gesehen war der ara-
18
bische Nationalismus nicht ausschließlich ein Phänomen der »Stämme«, wie es der Law-
rence-Film nahelegt, aber auch nicht nur der urbanen Eliten.
Der arabische Nationalismus war von den Vordenkern zwar als einigendes Band gedacht,
benötigte aber nicht zwingend die grenzüberschreitende Kooperation, sondern eignete sich
auch als Triebfeder und Legitimation für kleinere Einheiten. Der von den Sherifen von
Mekka geführte Arabische Aufstand ist ein beredtes Beispiel dafür. Hussein träumte von
einem arabischen Großreich unter seiner Führung auf nationalistischer Grundlage.
Sherif Hussein
Prinz Faisal
Husseins großarabisches Reich
Sykes-Picot-Abkommen
19
Dies setzte nicht zwingend voraus, alle Araber ins Feld zu führen. Militärisch handelte es
sich um einen begrenzten Beduinenaufstand mit Sympathisanten in den Städten – auch
dann noch, als das Sykes-Picot-Abkommen zur Aufteilung der britischen und französischen
Interessensphären unter den Arabern längst bekannt war.
Unter dem Einfluss von Lawrence richteten sich die Interessen der Aufständischen auf das
in diesem Rahmen durchaus noch mögliche innersyrische Reich. Der Versuch, dieses durch
einen schnellen Vorstoß auf Damaskus militärisch zu realisieren, war wohl die größte Ei-
genleistung des Lawrence of Arabia in diesem Krieg.
Für die britische Mobilisierungsstrategie reichte also eine Teilentität, während Oppenheim
immer vom Islam als einer großen Einheit ausging. Lawrences Vorgehen war in dieser
Hinsicht, vielleicht sogar unbewusst, pragmatisch und »partikularistisch«. Das Ergebnis
war eine Kriegsführung, die ganz von einer Guerillataktik bestimmt wurde. Auch in seinen
systematischen Abhandlungen zu diesem Thema bliebe er auf dieser pragmatischen Ebene.
Der Jihadismus-Ansatz hingegen konnte aus Oppenheims Sicht nur auf einen Volksauf-
stand hinauslaufen – schließlich herrschte der als Führer auserkorene Kalif-Sultan real nur
über den kleineren Teil der Muslime.
Der Eliteorientierung bei Oppenheim stand auf der Seite von Lawrence etwas gegenüber,
das gemeinhin als »going native« bezeichnet wird. Während Oppenheim im Stile eines
Millionärs in einem wohlhabenden arabischen Viertel lebte und ansonsten seine zahlrei-
20
chen Besuche in betont westlicher Kleidung unternahm, sah sich Lawrence regelrecht ge-
zwungen, mit den Beduinen in ihren Kleidern und in ihrem Alltag zu leben.
Offensichtlich ermöglichte dies Lawrence, einen wichtigen Schritt zur Überwindung mo-
nolithischer orientalistischer Sichtweisen zu tun, denen Oppenheim trotz allen seriös er-
arbeiteten Expertentums dauerhaft anhing. Dazu gehört auch, dass er die Eigendynamik
einer arabischen Revolte zu entfesseln half, während Oppenheim mit Muslimen, auch mit
seinen geliebten Beduinen, wie ein General am Sandkasten umging. Im Sandkasten bis ins
Einzelne vorausgeplant, mussten seine Vorschläge Papier bleiben – was Oppenheim in
seinem weiteren Lebensweg als Wissenschaftler wohl kaum einschränkte, während Law-
rence durchaus Schwierigkeiten hatte, wieder in die Welt des loyalen Briten zurückzufin-
den, sowohl hinsichtlich seiner ambivalenten Rolle in den folgenden Friedensverhandlun-
gen als auch im persönlichen Bereich.
Der Ruhm des Lawrence of Arabia, der Mythos, der ihn schnell umgab und bis heute
umgibt, beruht auf fünf Säulen. Für die Erste sorgte er selbst. Ganz offenbar hatte er schon
immer einen Hang zur Selbstdarstellung und Selbstüberhöhung. Einer seiner Vorgesetzten
in Ägypten klagte, wie sehr er seinem gesamten Umfeld – vom Admiral bis zum jüngsten
Schiffsjungen – auf die Nerven ging. Die Krönung der Selbstdarstellung war schließlich
1926 das Buch The Seven Pillars of Wisdom, das nur vordergründig ein Tatsachenbericht
des Araberaufstandes darstellt und das sein bislang letzter und kritischster Biograph Peter
Thorau für ein Stück fiktionale Weltliteratur hält.
21
Für die beiden nächsten Säulen sorgte sein persönliches Umfeld, die Lawrence früh in Bi-
ographien sowie in einer vielbeachteten Unterhaltungsshow ein Denkmal setzten. Dem
wollte die britische Geschichtswissenschaft nicht nachstehen und interpretierte bis in die
jüngere Vergangenheit den Araberaufstand als Glanzleistung eines einsamen britischen
Helden in der Wüste. Die letzte, aber wohl wirkungsmächtigste Säule bildet der Holly-
woodfilm von David Lean mit Peter O‘Toole in der Heldenrolle.
Der tatsächliche Einfluss des Thomas Edward Lawrence dürfte bei weitem nicht dem ent-
sprochen haben, das in diesen Säulen zum Ausdruck kommt. Er war Teil einer Gruppe bri-
tischer Offiziere und Orientexperten, die pragmatisch und erfolgreich auf die nationalisti-
sche Karte setzten. Lawrence selbst eignete sich dabei ausgezeichnet als Figur, in der sich
diese Gruppe verdichten ließ. Immerhin war er die Persönlichkeit, die sich in einer ent-
scheidenden Phase im Zentrum des Geschehens aufhielt – und eine schillernde dazu. Auf
der deutschen Seite existierte eine solche Gruppe vor Ort jedoch nicht. Was es gab, war eine
Reihe »Lehnstuhlwissenschaftler« in der Zentrale und ein Einzelkämpfer vor Ort, der auch
22
dort akademisch blieb, von einem sehr deutschen Orientalismus geprägt, und im Nach-
hinein wenig Interesse an den Tag legte, ein Kriegsmythos zu werden. Ein faszinierender
Stoff für eine filmische Bearbeitung mag dies durchaus sein, da will ich der Kollegin
Teichmann gar nicht widersprechen. Eine Hollywoodlegende wird man auf diese Weise
aber nicht.
23
Auswahlbibliographie
BONNER, Michael 2008: Jihad in Islamic History, 4. Aufl., Princeton: University Press.
DAWN, C. Ernest 1973: From Ottomanism to Arabism. Essays on the Origins of Arab Nationalism, Urbana: University of Illinois Press.
ESSNER, Cornelia/WINKELHANE, Gerd 1988: Carl Heinrich Becker (1876-1933). Orientalist und Kulturpolitiker, in: Die Welt des Islams 28, S. 154-177.
FARAH, Irmgard 1993: Die deutsche Pressepolitik und Propagandatätigkeit im osmanischen Reich von 1908-1918 unter besonderer Berücksichtigung des "Osmanischen Lloyd" (Beiruter Studien und Texte, 50), Berlin, Stuttgart: Steiner.
FIRESTONE, Reuven 1999: Jihad. The Origin of Holy War in Islam, New York: Oxford Univerity Press.
FREITAG, Ulrike 1995: Schutzmacht aller Muslime? Zur Geschichte deutscher Orientpolitik, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 40, S. 1460-1469.
FRIEDMAN, Isaiah 2010: British Pan-Arab Policy, 1915-1922. A Critical Appraisal, New Brunswick: Transaction Publishers.
GOREN, Haim (Hg.) 2003: Germany and the Middle East. Past, Present, and Future, Jerusalem: Hebrew University Magnes Press.
HADDAD, Mahmoud 1994: The Rise of Arab Nationalism Reconsidered, in: International Journal of Middle East Studies 26, S. 201-222.
HAGEN, Gottfried 1990: Die Türkei im Ersten Weltkrieg. Flugblätter und Flugschriften in arabi-scher, persischer und osmanisch-türkischer Sprache aus einer Sammlung der Unviversitätsbibio-thek Heidelberg (Heidelberger orientalistische Studien, 15), Frankfurt/Main: Lang.
HAGEN, Gottfried 2004: German Heralds of Holy War. Orientalism and Applied Oriental Studies, in: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 24, S. 145-162.
HARIDI, Alexander 2005: Das Paradigma der "islamischen Zivilisation" – oder die Begründung der deutschen Islamwissenschaft durch Carl Heinrich Becker (1876-1933). Eine wissenschaftsge-schichtliche Untersuchung (Mitteilungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der islamischen Welt, 19), Würzburg: Ergon-Verlag.
HEINE, Peter 1984: C. Snouck Hurgronje und C. H. Becker. Ein Beitrag zur Geschichte der ange-wandten Orientalistik, in: Die Welt des Islams 23/24, S. 378-387.
HOURANI, Albert: Arabic Thought in the Liberal Age 1789-1939, London: Oxford University Press.
KARSH, Efraim/KARSH, Inari 1999: Empire of the Sand. The Struggle for Mastery in the Middle East 1789-1923, Cambridge/Mass.: Harvard University Press.
KEDDIE, Nikki R. 1994: The Revolt of Islam, 1700 to 1993. Comparative Considerations and Rela-tions to Imperialism, in: Comparative Studies in Society and History 36, S. 463-487.
KHALIDI, Rashid/ANDERSON, Lisa/MUSLIH, Muhammad/SIMON, Reeva S. (Hg.) 1991: The Origins of Arab Nationalism, New York: Columbia University Press.
KREUTZER, Stefan M. 2012: Dschihad für den deutschen Kaiser. Max von Oppenheim und die Neu-ordnung des Orients (1914-1918), Graz: Ares Verlag.
LAWRENCE, Thomas E. 1939: Oriental Assembly, London: Williams and Norgate.
LAWRENCE, Thomas E. 1988: The Letters of T. E. Lawrence, hg. von Malcolm Brown, London: Dent.
24
LAWRENCE, Thomas E. 1991: Secret Despatches from Arabia and Other Writings, hg. von Malcolm Brown, London: Bellew Publishers.
LOTH, Wilfried/HANISH, Marc (Hg.) 2014: Erster Weltkrieg und Dschihad. Die Deutschen und die Revolutionierung des Orients, München: Oldenbourg.
LÜDKE, Tilman 2005: Jihad Made in Germany. Ottoman and German Propaganda and Intelligence Operations in the First World War (Studien zur Zeitgeschichte des Nahen Ostens und Nordafrikas, 12), Münster: Lit.
MANGOLD, Sabine 2004: Eine "weltbürgerliche Wissenschaft". Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert (Pallas Athene, 11), Stuttgart: Steiner.
MARCHAND, Suzanne L. 2009: German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race and Scholarship, Cambridge: University Press.
MARLOWE, John 1961: Arab Nationalism and British Imperialism. A Study in Power Politics, Lon-don: Cresset Press.
MCKALE, Donald M. 1997: "The Kaiser's Spy". Max von Oppenheim and the Anglo-German Rivalry before and during the First World War, in: European History Quarterly 27, S. 199-219.
OBERHAUS, Salvador 2006: "Zum wilden Aufstand entflammen". Die deutsche Ägyptenpolitik 1914 bis 1918. Ein Beitrag zur Propagandageschichte des Ersten Weltkrieges, Diss. Düsseldorf.
PHILIPP, Hans-Jürgen 1985: Der beduinische Widerstand gegen die Hedschasbahn, in: Die Welt des Islams 25, S. 31-83.
SCHULZE, Reinhard 1982: Die Politisierung des Islams im 19. Jahrhundert, in: Die Welt des Islams 22, S. 103-116.
SCHUMANN, Christoph (Hg.) 2008: Liberal Thought in the Eastern Mediterranean. Late 19th Century until the 1960s, Leiden: Brill.
SCHWANITZ, Wolfgang G. 2004a: Max von Oppenheim und der Heilige Krieg. Zwei Denkschriften zur Revolutionierung islamischer Gebiete 1914 und 1940, in: Sozial.Geschichte 19, S. 28-59.
SCHWANITZ, Wolfgang G. 2004b: Paschas, Politiker und Paradigmen. Deutsche Politik im Nahen und im Mittleren Orient, 1871-1945, in: Comparativ 14.1, S. 22-45.
SNOUCK HURGRONJE, Christiaan 1915: The Holy War "Made in Germany", New York, London: G. P. Putnam's Sons.
TARVER, Linda J. 1978: In Wisdom's House. T. E. Lawrence in the Near East, in: Journal of Con-temporary History 13, S. 585-608.
TEICHMANN, Gabriele (Hg.) 2001: Faszination Orient. Max von Oppenheim. Forscher – Sammler – Diplomat, Köln: DuMont.
TREUE, Wilhelm 1969: Max Freiherr von Oppenheim. Der Archäologe und die Politik, in: Histori-sche Zeitschrift 209, S. 37-74.
THORAU, Peter 2010: Lawrence von Arabien. Ein Mann und seine Zeit, München: C. H. Beck.
WATENPAUGH, Keith D. 2006: Being Modern in the Middle East. Revolution, Nationalism, Coloni-alism and the Arab Middle Class, Princeton: University Press.
WESTRATE, Bruce 1992: The Arab Bureau. British Policy in the Middle East 1916-1920, University Park: Pennsylvania State University Press.
ZEINE, Zeine N. 1976: The Emergence of Arab Nationalism. With a Background Study of Ar-ab-Turkish Relations in the Near East, Delmar: Caravan Books.