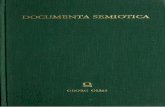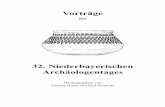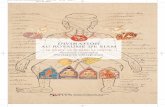Divination im Alten Orient: Ein Überblick
Transcript of Divination im Alten Orient: Ein Überblick
Divination in the Ancient Near EastA Workshop on Divination Conducted during the
54th Rencontre Assyriologique Internationale, Würzburg, 2008
Edited byJeanette C. FinCke
Winona Lake, Indiana eisenbrauns
2014
Offprint From:
v
Contents
Bibliographical Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viiPreface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiVorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Divination im Alten Orient: Ein Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Jeanette C. FinCke
Hethitische Orakelspezialisten als Ritualkundige . . . . . . . . . . . . . . . . 21Daliah bawanypeCk
Analyse hethitischer Vogelflugorakel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37yasuhiko sakuma
The Babylonian ikribs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53w. G. lambert†
Zur altorientalischen Opferschaupraxis: Opferschaudurchführungen über das Wohlbefinden und über das Nicht-Wohlbefinden . . . . . . . 57
an De Vos
Die Beobachtung der Nieren in der altorientalischen Opferschau: und die Stellung der Nieren-Omina innerhalb der Opferschau-Serie bārûtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
nils p. heessel
New Readings in YOS 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77ilya khait
The Halo of the Moon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91lorenzo VerDerame
Laws and Omens: Obverse and Inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105ann k. Guinan
Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123General Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Akkadian / Hittite / Sumerian / Logograms / Akkadograms . . . . . . 124Texts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 A. Museum Numbers 125 B. Publication Numbers 125 C. CTH Numbers 127
1
Divination im Alten Orient: Ein Überblick
Jeanette C. FinckeleiDen
Die Idee, während der 54. Rencontre Assyriologique Internationale in Würzburg einen Workshop mit dem Thema Divination im Alten Orient zu organisieren (22. Juli 2008), entstand angesichts der Feststellung, daß sich dieses bislang besonders in der Hethitologie stark vernachlässigte Thema gerade in der jüngsten Vergangen-heit starker Beliebtheit erfreute. 1 Im Rahmen dieses neuen Forschungsinteresses wurden zahlreiche, bis dahin meist nur dem Namen nach bekannte Divinations-methoden 2 anhand der hethitischen Schriftzeugnisse näher untersucht (zum Bei-spiel die Vogelschau [siehe unten S. 8–9], das KIN-Orakel und die Leberschau [siehe unten S. 13–14]), 3 wodurch ein Vergleich der Divination Mesopotami-ens (nach sumerischen, assyrischen und babylonischen Quellen) mit derjenigen der hethitischen Überlieferung erst ermöglicht wurde. Aber auch in der Assyriologie ist die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Divinationsmethoden 4 (zum Beispiel
1. Die Art und Weise, wie die Hethiter Divination nutzten, um das gewünschte Ergebnis, näm-lich eine Antwort auf ihre Fragen, zu erhalten, ist kürzlich in der Habilitationsschrift von Joost Hazen-bos unter dem Arbeitstitel „Wir stellten eine Orakelfrage“: Untersuchungen zu den hethitischen Orakel-texten untersucht worden, welche sich in der Publikationsvorbreitung befindet.
2. Vergleiche die Übersicht von Richard H. Beal, „Hittite Oracles“, in Magic and Divination in the Ancient World (herausgegeben von L. Ciraolo und J. Seidel; Leiden • Boston • Köln: Brill-Styx, 2002) 57–81, und von Theo van den Hout, „Omina (Omens). B. Bei den Hethitern“ und „Orakel (Oracle). B. Bei den Hethitern“, in Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Vol. 10 (herausgege-ben von D. O. Edzard und M. P. Streck; Berlin • New York: De Gruyter, 2003) 88–90, 118–24, jeweils mit weiterführender Literatur.
3. Vergleiche die Dissertationen von Dr. Daliah Bawanipeck, Die Rituale der Auguren (Texte der Hethiter, 25; Heidelberg: Winter, 2005), von Dr. Yasuhiko Sakuma, Hethitische Vogelorakel (frei zugäng-lich über opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/docId/6786), und von Dr. An de Vos, Die Lebermodelle aus Boğazköy (Studien zu den Boğazköy-Texten Beiheft 5; Wiesbaden: Harrassowitz, 2013). Einen ersten, stärker ins Detail gehenden Einblick in das KIN-Orakel gibt Julia Orlamünde, „Überlegungen zum hethitischen KIN-Orakel“, in Kulturgeschichten. Altorientalische Studien für Vol-kert Haas zum 65. Geburtstag. (herausgegeben von Th. Richter, D. Prechel, und J. Klinger; Saarbrücken: Saarbrücker Druckerei und Verlag, 2001) 295–311.
4. Einen Überblick über die verschiedenen Methoden sowie über den jeweiligen Publikationsstand bis 2002 gibt Stefan M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, in Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Vol. 10 (herausgegeben von D. O. Edzard und M. P. Streck; Berlin • New York: De Gruyter, 2003) 45–88. Später erschienene Textpublikationen oder Studien werden im Ver-laufe der folgenden Ausführungen jeweils bei der Behandlung der entsprechenden Divinationsmethoden genannt. Kürzlich sind divinatorische Texte aus dem Metropolitan Museum of Arts, New York (Lit-erary and Scholastic Texts of the First Millennium B.C. [herausgegeben von I. Spar und W. G. Lam-bert; Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of Art, Vol. II; Madrid: Brepolis, 2005] Nummern
Offprint from:Divination in the Ancient Near East: A Workshop on Divination Conducted During the 54th Rencontre Assyriologique Internationale, Würzburg, 2008 edited by Jeanette C. Fincke© Copyright 2014 Eisenbrauns. All rights reserved.
Jeanette C. FinCke2
denjenigen basierend auf besonderen Ereignissen am Himmel [siehe unten S. 15] oder auf der Erde [siehe unten S. 16], auf äußeren Erscheinungen am gesunden [siehe unten S. 16] oder erkrankten 5 menschlichen Körper sowie bei fehlgebilde-ten Früh- oder Neugeborenen 6, oder auf Merkmalen bei der Eingeweideschau [siehe unten S. 9–14]) sowie des ihnen zugrundeliegenden Weltbildes und ihrer ri-tuellen Einbettung nie abgebrochen. 7 Es schien daher an der Zeit, Hethitologen und Assyriologen zusammenzubringen, um die Divinationsmethoden der unterschiedli-chen Überlieferungen vorzustellen und zu vergleichen. Es ist mir eine große Freude, daß so viele Spezialisten auf diesem Gebiet meiner Einladung gefolgt sind und sich bereit erklärt haben, je einen Aspekt dieses interessanten Themas in einem Vortrag darzustellen. Die meisten dieser Vorträge finden sich im vorliegenden Band in einer überarbeiteten schriftlichen Fassung wieder, wodurch der Diskussion über die Divi-nation im Alten Orient auch über den Workshop hinaus Raum geboten werden soll.
Das Thema Divination ist im Rahmen der Rencontre Assyriologique Interna-tionale nicht neu: Bereits 1965 (2.–6. Juli) stand das 14 internationale Treffen der Assyriologen, das damals in Strasbourg stattfand, unter dem Thema „La divination en Mésopotamie ancienne et dans les régions voisines“. In der Publikation 8 die-ser fünftägigen Zusammenkunft finden sich 12 Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekten der mesopotamischen Divination beschäftigen, also der Divination nach
34–35 [Leberomina], 36–38 [Sonnen- und Gestirns-Omina; enūma anu enlil], 39 [terrestrische Omina; šumma ālu] 40–41 [Omina von fehlgebildeten Früh- oder Neugeborenen; šumma izbu], 71 [Kommentar zu enūma anu enlil Tafel 4]), sowie aus den Grabungen in Assur (Nils P. Heeßel, Divinatorische Texte I.Terrestrische, teratologische, physiognomische und aneiromantische Omina [Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts, 1; WVDOG 116; Wiesbaden: Harrassowitz 2007]) publiziert worden; vergleiche für letztere auch J. C. Fincke, „KAL 1 Nr. 59: Ein mittelassyrisches Fragment der Serie iqqur īpuš“, N.A.B.U. 2011.3, 70–2 Nr. 63, und dieselbe, „ KAL 1 Nr. 64: Ein Eingeweideschau-Omentext aus Assur“, N.A.B.U. 2011.3, 72–3 Nr. 64.
5. Vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 64–6 § 5.1, sowie Nils P. Heeßel, „Diagnosis, Divination and Disease. Towards an Understanding of the Rationale Behind the Babylonian Diagnostic Handbook“, in Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and Graeco-Roman Medicine (herausgegeben von H. F. J. Horstmanshoff und M. Stol; Studies in Ancient Medicine, 27; Leiden • Bos-ton: Brill, 2004) 97–116, und J. C. Fincke, „ana KI GIG GAM in den diagnostischen Omina“, N.A.B.U. 2010.2, 47–8 Nr. 40.
6. Für die Omenserie šumma izbu, die sich primär auf Fehlbildungen von neu- oder frühgeborenen Tieren, aber auch auf entsprechende menschliche Säuglinge und Föten bezieht (es handelt sich nicht um Fehlgeburten, denn diese wurde im Alten Orient als kūbu bezeichnet), vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 62–4 § 4.2, sowie zuletzt Irving L. Finkel, „On an izbu VII commentary“, in If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty (herausgege-ben von A. K. Guinen et al.; Leiden • Boston: Brill, 2006) 139–48.
7. Vergleiche zum Beispiel die Darstellung des Grundkonzeptes der akkadischen Löserituale, welche den Menschen vor den Folgen ungünstiger Vorzeichen schützen sollten, aus der Feder von Ste-fan M. Maul, Zukunftsbewältigung. Eine Untersuchung altorientalischen Denkens anhand der babylo-nisch-assyrischen Löserituale (Namburbi) (Baghdader Forschungen, 18; Mainz am Rhein: Von Zabern, 1994). Vergleiche auch Ann Kessler Guinen, „A Severed Head Laughed: Stories of Divinatory Interpre-tation“, in Magic and Divination in the Ancient World. (herausgegeben von L. Ciraolo und J. Seidel; Ancient Magic and Divination II; Leiden • Boston • Köln: Brill-Styx, 2002) 7–40, und S. M. Maul, „Die Wissenschaft von der Zukunft. Überlegungen zur Bedeutung der Divination im Alten Orient“, in Baby-lon. Wissenskultur in Orient und Okzident (herausgegeben von E. Cancik-Kirschbaum, M. von Ess und J. Mahrzahn; Berlin • Boston: De Gruyter, 2011) 135–51. Für das Opferschauritual siehe auch unten S. 9–13.
8. La divination en Mésopotamie ancienne et dans les régions voisines–Travaux du Centre d’études supérieures spécialisé d‘histoire des religions de Strasbourg (edited by anonymous; Paris: Presses Univer-sitaires de France, 1966).
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 3
sumerischen, babylonischen und assyrischen Quellen, sowie je ein Beitrag zur Divi-nation im Alten Testament, in Ägypten sowie nach etruskischen und nach griechi-schen Quellen. Die beiden Vorträge über entsprechende Überlieferungen aus den hethitischen Texten von Douglas Kennedy 9 und von Viktor Korošec 10 wurden leider nicht bzw. an anderer Stelle publiziert.
Hethitische Divination im Gegensatz zur mesopotamischen Divination
Der Schwerpunkt des Workshops Divination im Alten Orient liegt auf dem Ver-gleich zwischen den hethitischen und den mesopotamischen Methoden zur Erlan-gung von Hinweisen auf zukünftige oder auf Gründe für bereits eingetretene Ereig-nisse. In Mesopotamien wurde nicht nur jede beliebige Begebenheit im alltäglichen Leben, sondern auch besonders Naturereignisse sowie auffällige Sternenbewegun-gen als ominöse Zeichen der Götter betrachtet (unprovozierte Vorzeichen; omina oblativa). Die Babylonier und Assyrer verstanden diese von den Göttern ungefragt „gesandten“ ominösen Zeichen nicht nur als Hinweis auf ein ganz bestimmtes zu-künftiges Ereignis, sondern zugleich als dessen Verursacher, indem die vom Zeichen ausgehende Energie den Verlauf der Dinge gewissermaßen infizierte und in der be-absichtigten Richtung veränderte. 11 Ein derart vorhergesagtes und verursachtes Er-eignis konnte, sobald es eingetreten war, nicht rückgängig gemacht werden. Es war demnach besonders wichtig, daß das entsprechende ominöse Zeichen erkannt und richtig gedeutet wurde, damit sein fortwährender Einfluß durch ein entsprechendes Löseritual (namburbi) unterbrochen und damit das vorhergesagte Unheil in seiner vollen Ausprägung verhindert werden konnte. 12 Handelte es sich bei dem vorher-gesagten Ereignis um den Tod des Königs, konnte ein sogenanntes Ersatzkönigs-ritual 13 durchgeführt werden, im Verlaufe dessen ein Ersatzkönig (šar pūḫi) den Platz des Königs für die Dauer der Vorhersage einnahm. Am Ende des vorhergesag-ten Unglückszeitraumes starb der Ersatzkönig entsprechend der Vorhersage des ominösen Zeichens eines unnatürlichen Todes, und der legitime König übernahm wieder seinen Platz auf dem Thron. Auf diese Weise wurde sowohl die Zuverlässig-keit der Vorhersage bestätigt als auch das Leben des Königs gerettet.
Seit der altbabylonischen Zeit wurde in Mesopotamien das Wissen um die rich-tige Interpretation der von den Göttern gesandten, unprovozierten ominösen Zei-chen in Bedingungssätzen niedergeschrieben: „Wenn (das ominöse Zeichen) A zu sehen ist (bzw. sichtbar wird), wird (das Ereignis) B eintreffen.“ Diese Omensätze, deren Formulierungen sicher nicht zufällig mit denjenigen der Gesetzessammlungen
9. „Notes sur l’astrologie ancienne l’auspicine hittite“, siehe den Hinweis bei Richard Caplice, „XIVe Rencontre Assyriologique Internationale“, OrNS 32 (1965) 344.
10. Der Beitrag wurde unter dem Titel „La sorcellerie et l’ordalie dans les textes hittites, hist-priques et juridiques“ in Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. VI (herausgegeben von L. Aru; Milano: Giuffrè, 1971) 413–18, publiziert.
11. S. M. Maul, Zukunftsbewältigung, 5–10.12. S. M. Maul, Zukunftsbewältigung. Siehe auch unten Anmerkung 25.13. Hans M. Kümmel, Ersatzrituale für den hethitischen König (StBoT 3; Wiesbaden: Harrassowitz,
1967) 169–87, und Simo Parpola, Letters from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assur-banipal, Part II: Commentary and Appendices (AOAT 5/2; Kevelaer: Butzon & Bercker / Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1983) XXII–XXXII.
Jeanette C. FinCke4
übereinstimmen, 14 wurden gesammelt, sortiert und entsprechend der Natur ihrer Vorzeichen in verschiedenen Omensammlungen festgehalten. Obwohl diese Divina-tionsmethoden in der hethitischen Überlieferung in Anatolien spätestens während der mittelbabylonischen Zeit auftauchen, 15 die entsprechende akkadische Omenli-teratur in ihren Gelehrtenstuben bis in die Spätzeit des hethitischen Reiches hinein nicht nur rezipiert 16, sondern auch teilweise ins Hethitische übersetzt wurden, 17 werden in den genuin hethitischen Quellen außergewöhnliche Himmelserscheinun-gen lediglich als Zeichen dafür betrachtet, daß etwas generell nicht in Ordnung ist, bzw. daß die Weltordnung auf die eine oder andere Weise gestört wurde, nicht aber als präzise Hinweise auf zukünftige Ereignisse. Dies läßt sich besonders gut an der Geschichte um die babylonische Tawananna, die Witwe des verstorbenen hethitischen Königs Šuppiluliuma I., und ihren Stiefsohn, den amtierenden König Muršili II. und Sohn Šuppiluliumas I. mit dessen erster Ehefrau, aufzeigen: 18 Das Auftreten einer Sonnenfinsternis interpretierte die in babylonischer Divination of-fensichtlich bewanderte Tawananna als Hinweis auf den bevorstehenden Tod des Königs. Unverzüglich warnte sie ihren Stiefsohn und das hethitische Volk vor der Gefahr. In Mesopotamien wäre aufgrund dieser Warnung ein Ersatzkönigsritual durchgeführt worden, um die Manifestation des vorhergesagten Unheils an der Per-son des Königs zu verhindern. 19 Die Hethiter hingegen betrachteten diese Warnung als Verfluchung und Mordkomplott am König mit dem Versuch, an seiner statt dem eigenen Sohn auf den hethitischen Thron zu verhelfen, und stellten die königliche Ehefrau dementsprechend vor Gericht.
Die Hethiter verstanden astrale und meteorologische Phänomene, sogar die für die Menschen im 2. Jahrtausend v. Chr. sicher unerklärbaren Sonnenfinsternisse,
14. Vergleiche hierfür zuletzt J. C. Fincke, „Omina die göttlichen “Gesetze” der Divination“, JEOL 40 (2006–07) 131–47.
15. Durch die Verwendung des Logogramms ŠÈ für akkadisch ina, „in“, statt des später übli-chen einfachen waagerechten Keils (AŠ), läßt sich die Vorlage der in Ḫattuša gefundenen Sonnen- und Sonnenfinsternis-Omina (CTH 534.I) in die –– wohl späte –– altbabylonische Zeit datieren. Die Texte KUB 4, 63 (Sonnen- und Sonnenfinsternis-Omina) und 64 (Mondfinsternis-Omina) sowie KUB 34, 5 (Ölomina) werden dabei als altbabylonische Importe betrachtet (vergleiche Th. van den Hout, „Omina (Omens). B. Bei den Hethitern“, 89 § 3), was jedoch zunächst nur über die Datierung der Tontafeln, nicht aber über den Zeitpunkt des Importes Auskunft gibt.
16. Kaspar K. Riemschneider, Die akkadischen und hethitischen Omentexte aus Boğazköy (Dresdner Beiträge zur Hethitologie, 12; Dresden: Technische Universität Dresden, 2004); Yoram Cohen, „Akkadian Omens from Hattuša and Emar: The šumma immeru and šumma ālu Omens“, ZA 97 (2007) 233–51; J. C. Fincke, „KBo 36, 70: Duplikat zum Text mit Sonnenomina KUB 4, 63 und KUB 30, 9+“, N.A.B.U. 2009.3, 52–3 Nr. 40; dieselbe, „KBo 36, 36: Duplikat zum Text mit Erdbebenomina KUB 37, 163“, N.A.B.U. 2010.1, 9–11 Nr. 11; dieselbe, „KBo 9, 56: Ein Eingeweideschautext aus Ḫattuša“, N.A.B.U. 2011.1, 24–5 Nr. 20. Diejenigen akkadischen Omentexte, welche von den in Ḫattuša ausgebildeten Schreibern auf Tontafeln niedergeschrieben wurden, zeigen den mittel- und neu- bzw. späthethitischen Duktus, was etwa in den Zeitraum von 1500–1180 v. Chr. fällt.
17. K. K. Riemschneider, Die akkadischen und hethitischen Omentexte aus Boğazköy, und J. C. Fincke, „Zu den hethitischen Übersetzungen babylonischer Omentexte: Die kalendarischen und astrolo-gischen Omina in KUB VIII 35”, SMEA 46.2 (2004) 215–41.
18. KUB 14, 4 (CTH 70). Vergleiche unter anderem Stefano de Martino, „Le accuse di Muršili II alla regina tawananna secondo il testo KUB XIV 4“, Eothen 9 (1998) 19–48, und Itamar Singer, Hittite Prayers (Leiden • Boston • Köln: Brill, 2002) 73–9 (no. 17).
19. Den Hethitern war das Ersatzkönigsritual (siehe Anmerkung 13) durchaus bekannt, wie die adaptierten Fassungen des Rituals belegen, die H. M. Kümmel, Ersatzrituale für den hethitischen König, ediert hat.
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 5
lediglich als generelle Vorwarnung auf ein gestörtes Verhältnis zwischen Menschen und Göttern. Die genaue Ursache für die derart angezeigte gestörte Weltordnung versuchten die Hethiter dann durch provozierte Divinationstechniken herauszu-finden, damit sie anschließend die Ordnung durch individuelle Rituale wieder her-stellen konnten. Die hethitische Divination beschränkt sich also in der Regel auf die-jenigen Methoden, welche provozierte ominöse Zeichen als Antworten auf die zuvor von den Menschen präzis formulierten Fragen hervorrufen (omina impetrativa). 20
Entsprechende Methoden kannte man in Mesopotamien natürlich auch, und sie wurden auch angewendet. In einer Beschwörung, die derjenige dreimal ausspre-chen soll, welcher einen schlechten Traum hatte und von den Beklemmungen, die sich seiner seitdem bemächtigt hatten, befreit werden möchte, wird der Sonnengott Šamaš folgendermaßen angesprochen: 21
„Beschwörung: Sobald du, Šamaš, bei den Zedernbergen aufgehst (wörtlich: aufleuchtest), grüßen dich alle Götter jubelnd, alle Menschen sind erfreut über dich. Der Opferschauer (bārû) bringt dir Zedernholz, die Witwe (bringt kukkušu-Mehl oder) upumtu-Mehl, die arme Frau Öl, der Reiche bringt dir von seinem Reichtum ein Lamm, aber ich bringe Dir einen Klumpen Erde, das Erzeugnis der Unterwelt!“
Obgleich es sich hier in erster Linie um die Aufzählung von Geschenken für Šamaš handelt, welche die Menschen je nach ihren individuellen finanziellen Möglichkeiten auswählten und dem Gott darbrachten, 22 lassen sich bis auf den Klumpen Erde, der im vorliegenden Fall mit Bezug auf einen Alptraum eine wichtige Rolle spielt, alle Materialien auch im Zusammenhang mit Divination nachweisen: Zedernholz spielte beim neuassyrischen Opferschauritual eine große Rolle, 23 und Verfahren mit Mehl (Aleuromantie),24 Öl (Lekanomantie) 24 und Opferlämmern –– letzteres weist
20. In der Hethitologie wird daher auch von Orakeln und mantischen Texten gesprochen.21. K. 3333+ iii (Sally A. L. Butler, Mesopotamian Conceptions of Dreams and Dream Rituals [AOAT
258; Münster: Ugarit-Verlag, 1998] Plate 4) 7′–11′: ÉN ⸢tá⸣-tap-ḫa dUTU ina KUR GIŠ⸢EREN⸣ (8′) ri-šu-nik-ka DINGIRMEŠ ḫa-da-tak-ka a-me-<lu>-⸢te⸣ (9′) na-šak-ka DUMU.LÚḪAL GIŠEREN MUNUSal-mat-tú (K. 3286 fügt hinzu: ku-uk-ku-šú) ⸢ZÍD⸣ MAD.GÁ (10′) la-pu-un-tu4 Ì×GIŠ šá-ru-u ina šá-ru-ti-šú na-ši ⸢UDU.SILA4⸣ (11′) ana-ku na-šá-ka-ak-ku LAG bi-nu-ut ZU.AB. Für die Varianten der Paralleltexte –– K. 3286 (ŠRT pl. III) Vs. 1–8 und KAR 252 iii 20–24 –– vergleiche S. A. L. Butler, Dreams and Dream Rituals, 274–75 Zeilen 20–24. Für eine Übersetzung dieser Textpassage vergleiche unter anderem A. Leo Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East with Translation of an Assyrian Dream-Book (Transactions of the American Philosophical Society, New Series 46.3; Philadelphia: The American Philosophical Society, 1956) 301, Marie-Joseph Seux, Hymnes et prieres aux dieux de babylo-nie et d’assyrie (Littératures anciennes du Proche-Orient, 8; Paris: Éditions du Cerf, 1976) 369–70, und S. A. L. Butler, Dreams and Dream Rituals, 298.
22. Ähnlich auch zum Beispiel im Handerhebungsgebet an Marduk KAR 25 ii 19: MUNUSal-mat-tu ina ZÍD <MAD.>GÁ šá-ru-[ú] ina >BA< UDU.NÍTA!(SU) i-qar-ru-<bu->ku-nu-ši, „es nähern sich euch eine Witwe mit upuntu-Mehl (und) ein Reicher mit einem Lamm“; vergleiche Erich Ebeling, Die akka-dische Gebetsserie „Handerhebung“ von neuem gesammelt und herausgegeben (Berlin: Akademie-Verlag, 1953) 14–5, und CAD Š II 130b.
23. Hinweise auf die Bedeutung von Zedernholz im Opferschauritual, in welchem es unter ande-rem der Reinigung diente, finden sich auch bei Wilfred G. Lambert, „The Qualifications of Babylonian Diviners“, in Festschrift für Rykle Borger zu seinem 65. Geburtstag am 24. Mai 1994 tikip santakki mala bašmu . . . (herausgegeben von S. M. Maul; Cuneiform Monographs, 10; Groningen 1998) 141–58.
24. Mehl: J. Nougayrol, „Aleuromancie babylonienne“, OrNS 32 (1963) 381–86. Eine neue Be-arbeitung und Interpretation des einzigen Textes, der über diese Divinationsmethode Auskunft gibt, stammt von Stefan M. Maul, „Aleuromantie. Von der altorientalischen Kunst, mit Hilfe von Opfermehl das Maß göttlichen Wohlwollens zu ermitteln“, in Von Göttern und Menschen. Beiträge zu Literatur und
Jeanette C. FinCke6
selbstverständlich auf die Eingeweideschau hin –– sind aus zahlreichen Keilschrift-texten bezeugt. Diese Gaben für Šamaš können daher gleichzeitig als Materie für die Aufnahme von ominösen Zeichen dienen, denn Šamaš fällt als oberster Richter-gott die Urteile über jeden einzelnen Menschen und teilt ihnen anschließend seinen Richterspruch durch ominöse Zeichen mit. 25 Auf diese Weise beantwortet Šamaš die zuvor an ihn gerichteten Fragen der Menschen über zukünftige Ereignisse.
Ein weiteres Indiz für die weite Verbreitung von Divinationstechniken in Meso-potamien, welche provozierte ominöse Zeichen hervorrufen, ist die Bezeichnung des Divinationsspezialisten bārû (LÚḪAL), die einzige solche Bezeichnung, die in den akkadischen Texten sowohl des 2. als auch des 1. Jahrtausend v. Chr. bezeugt ist. Bei diesem Wort handelt es sich um eine Partizipialbildung des Verbs barû, einem verbum vivendi, dem grundsätzlich „die Erwartung zugrunde liegt, etwas Bestimm-tes, aber noch Unbekanntes zu sehen“ 26. Akkadisch bārû wird deshalb entsprechend als „Opferschauer“, „Seher“ bzw. „diviner“ übersetzt. Die Divinationsmethoden, die in Quellen des 1. Jahrtausends v. Chr direkt mit dem bārû in Verbindung gebracht werden, sind die Eingeweideschau (Extispizien), sowie Verfahren mit Rauch (Liba-nomantie) 27 und Öl (Lekanomantie) 28. Daraus läßt sich schließen, daß der bārû in erster Linie für die provozierten Divinationsverfahren zuständig war, bei denen die Götter um Beantwortung einer ganz speziellen Frage gebeten wurden. Entsprechend bezieht sich die Bezeichnung bārûtu, „Opferschaukunst“, auf die im Alten Orient am weitesten verbreitete provozierte Divinationsmethode, die Eingeweideschau. In der bārûtu-Serie wurden im 1. Jahrtausend v. Chr. alle mit der Eingeweideschau zusammenhängenden Omina systematisch angeordnet zusammengestellt. Erst im 1. Jahrtausend v. Chr. ist der ṭupšar enūma anu enlil bezeugt, wörtlich übersetzt
Geschichte des Alten Orients für Brigitte Groneberg (herausgegeben von D. Shehata, F. Weihershäuser, und K. Zand; Cuneiform Monographs 41; Leiden • Boston, 2010) 115–30.
Öl: Giovanni Pettinato, Die Ölwahrsagung bei den Babyloniern (Studi Semitici, 21–22; Roma: In-stituto di Studi del Vicino Oriente, Università di Roma, 1966), und S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 83–4 § 9.
25. Weil jedes provozierte und unprovozierte ominöse Zeichen als ein vom Richtergott Šamaš be-stimmtes Strafmaß für ein in der Vergangenheit liegendes Vergehen des Menschen galt, konnte dieses Urteil nur durch ein erneutes Gerichtsverfahren (namburbi), gleichsam durch ein Revisionsverfahren, wieder aufgehoben werden (vergleiche Claus Wilcke, „Das Recht: Grundlage des sozialen und politischen Diskurses im Alten Orient“ in Das geistige Erfassen der Welt im Alten Orient. Beiträge zu Sprache, Reli-gion, Kultur und Gesellschaft [herausgegeben von Cl. Wilcke; Wiesbaden: Harrassowitz, 2007] 282, 239 sowie 228). Das Löseritual ist dementsprechend ein rituell nachgestelltes Gerichtsverfahren vor Šamaš als vorsitzenden Richter, in dem das ominöse Zeichen angeklagt wird, den Menschen zu Unrecht mit seiner negativen Energie beeinträchtigt zu haben; letztendlich fällt Šamaš erneut ein Urteil, demzufolge der Mensch vom Einfluß des ominösen Zeichens befreit wird (S. M. Maul, Zukunftsbewältigung, 5–10).
26. J. C. Fincke, Augenleiden nach keilschriftlichen Quellen. Untersuchungen zur altorientalischen Medizin (Würzburger medizinhistorische Forschungen, 70; Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000) 27 Abschnitt II.A.1.b.
27. Vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 84–5 § 10, sowie den Eintrag in Zeile 22′ der zweiten Tafel der lexikalischen Liste LU = ša Kolumne iii: níg-na-ri-ga-igi-bar-ra = bārû ša qutrenni, „Opferschauer des Räucherwerks“ (MSL 12, 120 Zeile 22′).
28. Siehe oben die in Anmerkung 24 genannte Literatur sowie KAR 151 Rückseite 31: šumma DUMU LÚḪAL šamna ana mē iddī-ma „Wenn, sobald der Opferschauer Öl auf das Wasser ‘wirft’,. . .” oder das neuassyrische Opferschauritual, BBR 82 Zeile 25: DUMU LÚḪAL ina mê šamna [inaṭṭal], „der Opferschauer [betrachtet] das Öl im Wasser.” Vergleiche aber auch folgendes Zitat aus dem neuassyri-schen Opferschauritual, das neben dem Opferschauer auf einen Spezialisten der Libanomantie hinweist, BBR 1–20 Zeile 120: NUN.ME Ì×GIŠ DUMU LÚḪAL GIŠERIN ušašša-ma “der ‘Meister des Öls’ wird den Opferschauer die Zeder tragen (oder: anheben) lassen.”
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 7
der „Schreiber (der Omenserie) enūma anu enlil“ (für diese siehe unten S. 15), dem die Beobachtung des Himmels oblag, wobei er nicht nur für das Erkennen und Interpretieren ominöser Zeichen zuständig war, sondern sich auch als „Astronom“ im heutigen Sinne betätigte. In Anbetracht der religiösen Einbettung provozierter und unprovozierter ominöser Zeichen (siehe oben S. 3–6 mit Anmerkung 25) verwundert es nicht, daß sich auch der Beschwörer (āšipu) Kenntnis derjenigen Li-teratur erwerben mußte, in welcher die Regeln für die Interpretation unprovozier-ter ominöser Zeichen festgehalten sind (Omentexte), 29 zumal der āšipu derjenige Experte war, welcher gemäß der diagnostischen und prognostischen Omen serie die Zeichen bzw. Symptome erkrankter Personen identifizierte. 30 Eine einzelne Be-rufsbezeichnung, die vorwiegend mit der Interpretation unprovozierter ominöser Zeichen im Zusammenhang steht, läßt sich nicht ermitteln. Die Beschäftigung mit unprovozierten Zeichen scheint vielmehr Teil verschiedener Berufsfelder gewesen zu sein. Das Wissen um diese Techniken wurde stets –– auch wenn es in schrift-licher Form festgehalten wurde –– als Geheimwissen betrachtet, was sich nicht nur an der im starken Maße logographischen und damit gleichsam verschlüsselten Schreibweise, sondern auch an entsprechenden Zusätzen in den Schreiberkolopho-nen absehen läßt: „ein Nicht-Wissender darf (die beschriebene Tafel) nicht sehen“ (lā mūdû lā immar) 31. Dies bedeutet jedoch nicht, daß es in den Städten nicht auch Experten gegeben hat, die, obwohl sie nicht dem Kreis dieser Gelehrten angehörten, dennoch über Kenntnis in verschiedenen Divinationsverfahren verfügten. So ist zu erwarten, daß es in jeder größeren Stadt mindestens eine Person gegeben hat, die im Ruf stand, sich mit Methoden zur Erlangung provozierter Zeichen besonders gut auszukennen, und dementsprechend von den Menschen aufgesucht wurde, um sich ihre Fragen von den Göttern beantworten zu lassen. Über diese Personengruppen und deren Verfahren geben die Texte der Gelehrten freilich keine Auskunft.
Provozierte Divinationsverfahren nach den hethitischen Quellen
Obwohl es aus Mesopotamien zahlreiche Hinweise auf die Durchführung von Divinationsverfahren gibt, die provozierte ominöse Zeichen hervorrufen, ist die schriftliche Überlieferung in diesem Bereich wesentlich dünner als bei den Hethi-tern. Darum sind die überwiegend aus der Zeit zwischen 1500 und 1180 v. Chr. stammenden hethitischen Orakeltexte bzw. mantischen Texte, welche Informa-tionen über verschiedenartige provozierte Divinationsmethoden geben, vorzüglich
29. So nach dem sogenannten „Leitfaden der Beschwörungskunst“, in dem nicht nur Beschwö-rungsserien und die „Löserituale für Vorzeichen des Himmels und der Erde, so viele vorhanden sind“ (Zeile 29), sondern auch Omenserien genannt werden (Zeilen 6, 25, 39); vergleiche die Neubearbeitung des Textes von Markham J. Geller in Wisdom, Gods and Literature. Studies in Assyriology in honour of W. G. Lambert (herausgegeben von A. R. George und I. L. Finkel; Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2000) 242–54.
30. Der ursprüngliche Titel der diagnostischen Omenserie lautet: „Wenn der Beschwörer zum Haus eines Kranken geht, . . .“ (enūma ana bīt marṣi āšipu illaku). Erst später erhielt die Serie eine neue Ord-nung gemäß SA.GIG (akkadisch: sakikkû), „Symptome“, die Mitte des 11. Jahrhunderts v. Chr. von dem Gelehrten Esagil-kīn-apli geschaffen wurde; vergleiche hierfür zuletzt Nils P. Heeßel, Babylonisch-assy-rische Diagnostik (AOAT 43; Münster: Ugarit, 2000) 104–09 (mit früherer Literatur).
31. Vergleiche Rykle Borger, „Geheimwissen“, in Reallexikon der Assyriologie, Vol. 3 (herausgege-ben von Ernst Weidner; Berlin: De Gruyter, 1957) 188–91, für ähnliche Vermerke in anderen Kolophonen.
Jeanette C. FinCke8
dafür geeignet, unser eher einseitiges Bild von der mesopotamischen Divination zu korrigieren und zu vervollständigen. Besonders aufschlußreich sind dabei diejeni-gen hethitischen Texte, welche sich auf Auspizien beziehen, also auf die Vorhersage anhand des Vogelfluges. 32 In Bezug auf diese Methode lassen uns hethitische Texte die entsprechenden Spezialisten, die „Auguren“ (LÚIGI.MUŠEN oder LÚMUŠEN.DÙ), getrennt von den Orakeltexten betrachten. Dabei wird deutlich, daß die Tätig-keit der hethitischen Auguren 33 nicht nur die Durchführung der Auspizien umfaßte, sondern auch rituelle Handlungen, welche, in ein größeres Ritualgeschehen einge-bettet, sogar Teil eines umfangreichen, meist mehrtägigen Rituals werden konnten. Die rituellen Handlungen der Auguren standen dabei ebenso wie ihre divinatori-schen Praktiken in direkter Verbindung mit Vögeln und dem Flug von ‘Vögeln’, zu denen unter anderem auch Seuchenerreger gehören –– so zum Beispiel im Falle der sogenannten „Seuchenrituale“ aus Arzawa 34. Die mit hethitischen Auguren im Zu-sammenhang stehenden Rituale lassen sich dabei in zwei Gruppen aufteilen: Ritu-ale, welche unter Beteiligung von Auguren von anderen Experten geleitet werden, und Rituale, deren Durchführung den Auguren selbst obliegt. Daliah Bawanipeck analysiert diese beiden Ritualgruppen in ihrem Artikel „Hethitische Orakelspezia-listen als Ritualkundige“ (siehe S. 21–36) und arbeitet die Unterschiede hinsichtlich der Auftraggeber und der Ritualhandlungen heraus.
Die divinatorische Tätigkeit der hethitischen Auguren bezieht sich auf die Be-obachtung von Vögeln, deren Flug sie ominös ausdeuteten, um mit dieser Methode (Auspizien) gezielt die Beantwortung bestimmter Fragen zu ermitteln. 35 Zu die-sem Zweck beobachteten und bewerteten sie die Bewegung von Vögeln in einem speziell dafür abgegrenzten bzw. definieren Terrain. Diese Tätigkeit spiegelt sich auch in der Berufsbezeichnung wieder: In den hethitischen Texten wird vorwiegend das Logogramm LÚIGI.MUŠEN verwendet, während eine neuassyrische Liste von verschiedenen am assyrischen Hof in Ninive tätigen Experten hierfür die halblo-gographische Schreibung da-gíl–MUŠEN 36 aufweist. Beide Schreibungen stehen für akkadisch dāgil iṣṣure, was mit „derjenige, welcher den Vogel beobachtet“ zu übersetzen ist. Durch den Beleg des „Auguren“ in der Liste aus Ninive steht außer Zweifel, daß entsprechende Verfahren auch in Mesopotamien durchgeführt wur-den, auch wenn die Hinweise hierfür äußerst spärlich sind und ausschließlich aus dem Assyrien der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. stammen. 37 Somit ist es als glücklicher Umstand zu werten, daß die Dokumentation der Hethiter wert-volle Hinweise auf die tatsächliche Durchführung dieser Divinationsmethode gibt. Yasuhiko Sakuma hat sich als erster Hethitologe mit dieser Textgruppe eingehend beschäftigt und die Bedeutung des in diesen Texten verwendeten Fachvokabulars
32. Auch in Mesopotamien wurde der Vogelflug ominös ausgedeutet, vergleiche Nicla de Zorzi, „Bird Divination in Mesopotamia: New Evidence from BM 108874“, KASKAL 6 (2009) 85–136.
33. Zu den hethitischen Auguren vergleiche auch Joost Hazenbos, „Der Mensch denkt, Gott lenkt. Betrachtungen zum hethitischen Orakelpersonal“, in Das geistige Erfassen der Welt im Alten Orient. Beiträge zu Sprache, Religion, Kultur und Gesellschaft (herausgegeben von Cl. Wilcke; Wiesbaden: Har-rassowitz, 2007) 95–109.
34. D. Bawanypeck, Die Rituale der Auguren, 292–98.35. R. Beal, „Hittite Oracles“, 71–3; Th. van den Hout, „Orakel (Oracle). B. Bei den Hethitern“,
119–20 § 2.3.36. SAA VII 1 Rückseite i 11.37. Vergleiche hierfür die Übersicht bei S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 85–86
§ 12.
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 9
ermittelt. 38 Auf den Seiten 37–51 erläutert er in seiner „Analyse hethitischer Vo-gelflugorakel“ die entsprechenden Orakelprotokolle und das darin beschriebene Verfahren.
Die Antwort, die man durch provozierte Divinationstechniken erhält, ist in der Regel entweder eine Bejahung (SIG5) oder eine Verneinung (NU.SIG5) der zuvor an die Götter gerichteten Frage. Um eine zuverlässige Antwort zu erhalten, muß die Frage dabei so präzise wie möglich formuliert werden. Das Verfahren wird also um so komplizierter, je unklarer das zugrundeliegende Problem ist, für dessen Lösung von den Göttern eine Antwort erbeten wird. Um zum Beispiel den Grund für die Verstimmung einer bestimmten Gottheit in Erfahrung zu bringen, müssen mehrere Fragen gestellt werden, damit durch das Ausschlußverfahren letztendlich die tat-sächliche Ursache für die Verärgerung ermittelt werden kann. Die Beantwortung jeder einzelnen Frage wird dabei durch ein eigenes Divinationsverfahren ermit-telt. Das bedeutet, daß das verwendete Verfahren entweder mehrfach nacheinander durchgeführt oder mit anderen Verfahren kombiniert werden muß. In den hethi-tischen Orakeltexten (bzw. Orakelprotokollen) 39 erscheinen die einzelnen Fragen, die jeweils im Bezug auf ein bestimmtes Divinationsverfahren formuliert wurden, mit den entsprechenden Antworten notiert. In einigen Orakeltexten gibt es aber Passagen, in denen die Antworten der Orakel fehlen. Diese Fälle geben Anlaß zur Spekulation: Fehlt die Antwort der Götter aus einem bestimmten Grund, oder ist das Ergebnis der Divination in diesem Fall nicht eindeutig? Einige dieser Passagen hat Joost Hazenbos in seinem Vortrag unter dem Titel „Ergebnis noch offen“ behan-delt. Eine ausführliche Analyse der hethitischen Orakelanfragen ist in seiner in der Druckvorbereitung befindlichen Monographie (siehe Anmerkung 1) nachzulesen.
Die Eingeweideschau (Extispizien) 40
Die Eingeweideschau von Opfertieren ist die im Alten Orient am weitesten ver-breitete Divinationstechnik. Sie läßt sich bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. in su-merischen Quellen nachweisen, 41 und Keilschrifttexte, die sich mit dem Verfahren selbst beschäftigen, finden sich in babylonischer, assyrischer, hethitischer, hurriti-scher, ugaritischer und elamischer Sprache. Die fast drei Jahrtausende währende Anwendung der Eingeweideschau in Mesopotamien hat eine Vielfalt von Texten hervorgebracht, welche verschiedene Aspekte des Verfahrens beleuchten. Dadurch sind wir in der Lage, gerade diese Methode am besten zu verstehen. Es liegt auf der Hand, daß ein Verfahren, in welchem Götter um Antworten auf bestimmte Fragen
38. Siehe auch Anmerkung 3.39. Vergleiche Th. van den Hout, „Orakel (Oracle). B. Bei den Hethitern“, 121–23 § 5 und 6.40. Vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 69–82 § 7, sowie Ulla S. Koch,
Secrets of Extispicy. The chapter Multābiltu of the Babylonian extispicy series and Niṣirti bārûti. Texts mainly from Aššurbanipal’s library (AOAT 326; Münster: Ugarit-Verlag, 2005); Wilfred G. Lambert, Ba-bylonian Oracle Questions (Mesopotamian Civilizations, 13; Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2007). Mit der Eingeweideschau in Mari beschäftigt sich Jean-Jacques Glassner, „L’aruspicine paléo-babylonienne et le témoignage des sources de Mari“, ZA 95 (2005) 276–300.
41. Vergleiche hierfür zuletzt Piotr Steinkeller, „How to read the liver–in Sumerian“ in If a man builds a joyful house: Assyriological studies in honor of Erle Verdun Leichty (herausgegeben von A. K. Guinen et al.; Leiden • Boston: Brill, 2006) 247–57, sowie Alfonso Archi, „Divination in Ebla“ in Fest-schrift für Gernot Wilhelm anläßlich seines 65. Geburtstages am 28. Januar 2010 (herausgegeben von J. C. Fincke; Dresden: ISLET, 2010) 45–56.
Jeanette C. FinCke10
gebeten werden, in ein Ritual eingebettet ist. Dieses Ritual läßt sich bislang zwar nur in einer sehr späten Form aus der neuassyrischen Zeit rekonstruieren, 42 aber die Logik des Ritualablaufes macht deutlich, daß die einzelnen Ritualabschnitte –– mit Ausnahme vielleicht der Anzahl und Art der jeweils dargebrachten Opfer –– im Laufe der Zeit sicher nicht wesentlich verändert wurden: 43 Selbstverständlich wird das Ritual nur an einem günstigen Tag (UD ŠE.GA, ūmu magiru) durchgeführt. Hierfür stehen in jedem der zwölf Monate jeweils 15 Tage zur Verfügung. 44 Die Ritualvorbereitungen beginnen am Nachmittag mit der Auswahl des Opfertieres aus der Schafherde. Der erfahrene Opferschauer (bārû) betrachtet dabei die äußere Erscheinung und das Verhalten des noch lebenden Opferschafes, um daraus erste Hinweise auf das Ergebnis der Opferschau zu gewinnen. 45 Anschließend reinigt sich der Opferschauer und bekleidet sich mit einem „reinen Gewand.“ Der Großteil des Ritualgeschehens besteht aus einer Reihe von Invokationsriten: Die verschie-denen Götter werden zum Ritualschauplatz herbeigerufen, indem ihnen mit Hilfe von angenehm duftenden und wohlschmeckenden Opfergaben die Teilnahme an ei-nem Gastmahl angeboten wird. Die Sequenz beginnt am späten Nachmittag mit der Heilsgöttin Gula, denn der Umstand, daß überhaupt eine Anfrage bei den Göttern stattfindet, macht bereits deutlich, daß das Gleichgewicht des Opfermandanten mit den Göttern gestört ist; ein derartiges Ungleichgewicht ist im Alten Orient gleichbe-deutend mit einer Krankheit. 46 Während der Dämmerung findet die Invokation der Sterne statt. Sie erfolgt durch ein Gebet, das bereits aus der altbabylonischen Zeit in zwei Abschriften bekannt ist, das sogenannte Gebet an die „Götter der Nacht.“ 47 Da die Sterne weder ein aktive Rolle beim Gerichtsprozeß spielen, der über die bei
42. Die Textedition des Opferschaurituals stammt von Heinrich Zimmern, Beiträge zur Kenntnis der babylonischen Religion. Die Beschwörungstafeln Šurpu. Ritualtafeln für den Wahrsager, Beschwörer und Sänger (Assyriologische Bibliothek, 12; Leipzig: Hinrichs, 1901), 82–91, 96–121 (Texte 1–25), 186– 219 (Texte 71–101).
43. Für das Opferschauritual vergleiche zuletzt unter anderem Piotr Steinkeller, „Of Stars and Men: The Conceptual and Mythological Setup of Babylonian Extispicy“ in Biblical and Oriental Essays in Memory of William L. Moran (herausgegeben von Augustinus Gianto; Biblica et orientalia, 48; Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2005), 11–47; Cl. Wilcke, „Das Recht“; Jeanette C. Fincke, „Ist die mesopota-mische Opferschau ein nächtliches Ritual?“, BiOr 66 (2009) 519–58.
44. Ein Kommentartext zu Eingeweideschauomina gibt die „15 für eine Opferschau günstigen Tage eines jeden Monats“ (15 UDMEŠ šá ḪAL-ti šá ITU-us-su) an: „der [2.], 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 15., 16., [20.], [2]2., 23., 24. und 26. Tag“ (KAR 151 Rs. 53–56, vergleiche Ulla Jeyes, „Divination as a science in Ancient Mesopotamia“, JEOL 32 [1991–92] 31 Anmerkung 39). Eine Hemerologie, in welcher die für verschiedene Tätigkeiten günstigen und ungünstigen Tage des Jahres bezeichnet werden, nennt im An-schluß an die Ausführungen zu den einzelnen Monaten die Unglückstage (UD.ḪUL.GAL[MEŠ]), an denen der Opferschauer keine Vorhersage machen darf: „der [1.], 7., [9.], 14., 15., 19., 21., 28, [29.] und 30. Tag“ (KAR 178 Rückseite i 65–70, vergleiche Maria C. Casaburi, Ūmē ṭābūti „I giorni favorevoli“ [History of the Ancient Near East – Studies, Volume VIII; Padova: S.a.r.g.o.n., 2003] 113 § 362). Auffällig ist, daß der 15. Tag in beiden Listen erscheint, obwohl sich auch die Hemerologie nicht auf einen bestimmten Monat festlegt, und die Angaben demzufolge für jeden beliebigen Monat gültig sein sollten; diese Diskre-panz ist wohl auf unterschiedliche Traditionen zurückzuführen.
45. Bruno Meissner, „Omina zur Erkenntnis der Eingeweide des Opfertieres“, AfO 9 (1933–34) 118–22, 329–30. Ungeklärt bleibt die Frage, wie diese Theorie im Verhältnis zur Rolle der Götter steht, welche den Ritualbeschreibungen zufolge erst am frühen Morgen das Ergebnis ihres Gerichtsverfahrens in die Eingeweide schreiben.
46. In einem Opferschautext wird Gula zudem als „Herrin der Entscheidung“ (bēlet purussê) be-zeichnet (BBR 98–99).
47. Vergleiche J. C. Fincke, BiOr 66 (2009) 519–41 und die dort genannte Literatur. Neben diesem Gebet an die „Götter der Nacht“ gibt es auch an individuelle Sterne gerichtete Gebete, in denen diese
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 11
der Opferschau zu gebende Antwort entscheidet, noch an der Einbringung der omi-nösen Zeichen –– die Antwort auf die bei der Opferschau gestellten Frage –– in das Opfertier beteiligt sind (siehe unten), sie aber gleichwohl um „Rechtsverbindlich-keit“ (kittum) bei der Opferschau gebeten werden, muß ihnen innerhalb des Ritual-geschehens eine andere Aufgabe zukommen. In einem altbabylonischen „Gebet an die Götter der Nacht“ findet sich folgender Eintrag (CBS 574 Zeilen 8–11): 48
nakdū ilū ina mušītim naṣāru napšātim ašar namtarri[m] . . . in suen u dUTU iterbū-[ma] ēṭirū napšātim malû nubat[ū-šunu]
„Es fürchten die Götter in der Nacht um das Schützen der Lebenden vor den (lit.: am Ort der) namtaru-Dämonen . . . Erst nachdem Sîn und Šamaš (ihre Kam-mern) betreten haben, können die ‘Retter der Lebenden’ [ihre] nächtlichen Posi-tionen füllen.“
Die Götter des Tages sorgen sich demnach wegen der ständigen Anwesenheit der Dämonen auf der Erde um die Sicherheit der Menschen während des kurzen Zeit-abschnittes zwischen Sonnenuntergang und Aufgang der Sterne, weil dieser Schutz erst durch die Anwesenheit der Sterne, der ‘Retter der Lebenden’, wieder gege-ben ist. Da Dämonen grundsätzlich danach streben, sowohl in Gebäude als auch in Menschen oder andere Körper durch jede mögliche Öffnung –– Türen, Fenster, natürliche Körperöffnungen oder Wunden –– einzudringen, um sich darin wie eine Krankheit auszubreiten und Unglück zu erzeugen, 49 ist diese Befürchtung dem mesopotamischen Weltbild zufolge als durchaus real zu verstehen. In Anbetracht dieser Vorstellung könnte die Bitte um „Rechtsgültigkeit“ bei der Opferschau die Sterne dazu bewegen, ihre Schutzfunktion auch auf das Opferschaf auszuweiten, denn spätestens mit dem Schächten des Tieres wird eine zusätzliche Körperöffnung geschaffen, durch welche Dämonen und ungebetene Kräfte eindringen und die Ein-geweide verändern könnten. Dadurch würden sie die „Tafel der Götter“, also die Leber, bereits ‘beschreiben’ bevor die Götter Zugang zu ihr haben, wodurch das Ergebnis verfälscht werden würde.
Sobald die ersten Sterne am Himmel aufgegangen sind, beginnt die Invoka-tion von Marduk, dem obersten Gott des babylonischen Pantheons, 50 sowie des persönlichen Schutzgottes und der persönlichen Schutzgöttin des Opfermandan-ten. Mit der Anwesenheit dieser Götter, welche aufgrund der Bereitstellung der
um „Rechtsgültigkeit“ bei der Opferschau gebeten werden; vergleiche ibidem, 550–51 mit Anmerkungen 155–60.
48. Erstpublikation des Textes von Marten Stol, „Two Old Babylonian Literary Texts”, in Language, Literature, and History. Philological and historical studies presented to Erica Reiner (herausgegeben von F. Rochberg-Halton; American Oriental Series, 67; New Haven, CN: American Oriental Society, 1987) 383–87. Korrekturen finden sich bei Wayne Horowitz und Nathan Wasserman, „Another Old Babylonian prayer to the Gods of the Night”, JCS 48 (1996) 57–60, und P. Steinkeller, „Of Stars and Men“, 38–9. Für die hier angeführte Interpretation dieser Zeilen vergleiche auch J. C. Fincke, BiOr 66 (2009) 539, 551–52.
49. Gebäude sind diesbezüglich besonders während des Bauprozesses anfällig, wenn das Funda-ment ausgehoben wird, was Folgen für alle Menschen haben kann, die sich später in dem entsprechen-den Gebäude aufhalten, vergleiche Claus Ambos, Mesopotamische Baurituale aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. (Dresden: ISLET, 2004). Auch die Krankheitsdämonen, die sich eines Menschen bemächtigt ha-ben, können ihre negative Energie auf die Umgebung des Erkrankten ausweiten und somit andere Men-schen mit ihrer Krankheit anstecken.
50. Die Beteiligung dieses Gottes am Opferschauritual dokumentiert eine babylonische Herkunft dieser Version des Rituals, auch wenn der Text bislang nur aus assyrischen Quellen bekannt ist, die in den Bibliotheken der assyrischen Königsresidenz Ninive aufbewahrt wurden.
Jeanette C. FinCke12
Opferzurüstungen vorausgesetzt wird, werden Opfermandant und Opferschaf an dem Ritualgeschehen beteiligt. Während der Opfermandant das Opferschaf fest-hält, führt der Opferschauer Reinigungsriten am Schaf durch. Anschließend spricht der Opfermandant die Opferschauanfrage mittels eines Zedernrohres in das linke Ohr des Opferschafes. 51 Anschließend wird das Schaf nach althergebrachten Regeln geschächtet, 52 während es vom Opfermandanten gehalten wird. Das Verhalten des Schafes während dieses Vorganges wird selbstverständlich ebenfalls genau beo-bachtet und ominös ausgedeutet. 53
Sobald sich der neue Tag durch die ersten Verfärbungen des Horizontes ankün-digt, die Sonne aber noch nicht aufgegangen ist, werden Opfer für die beiden Götter der Divination, Šamaš und Adad, sowie für die Ehefrau und den Wezir von Ša-maš, Aja und Bunene, dargebracht. Alle vier Gottheiten spielen eine zentrale Rolle beim göttlichen Gerichtsverfahren, in dem die Frage des Opfermandanten beurteilt und in Form eines Rechtsentscheides mit den ominösen Zeichen beantwortet wird. Bei Sonnenaufgang erfolgt die Invokation einer Gruppe von Göttern, unter denen sich auch die bereits vor Sonnenaufgang beopferten Götter befinden. Die wie die Beschreibung einer Götterprozession anmutende Nennung der genannten Götter, bei denen der oberste Richtergott Šamaš vorangeht, direkt gefolgt von Adad und Marduk, den engsten Vertrauten von Šamaš, bestehend aus Aja und Bunene, sowie Kettu (die „Rechtsverbindlichkeit“), Mēšaru (die „Gerechtigkeit“) und dem persön-lichen Schutzgott des Opfermandanten, erinnert an moderne Gerichtsverfahren, bei denen die prozeßvorsitzenden Richter und Schöffen ebenfalls in einer festgeleg-ten Reihenfolge den Gerichtssaal betreten und später wieder verlassen. Im Falle des Rituals handelt es sich um die am nächtlichen Prozeß beteiligten Göttern in der Reihenfolge ihrer Bedeutung innerhalb des Gerichtsverfahrens, welche den Ort des Prozesses verlassen und sich nun dem Ritualschauplatz zur offiziellen Verkündung des Urteils nähern. Erst wenn diese Götter am frühen Morgen anwesend sind, kann Šamaš das Ergebnis des Prozesses in die Innereien des Opferschafes schreiben. Erst im Anschluß hieran ist es überhaupt sinnvoll, die Eingeweide zu inspizieren.
Jede Aktion des Opferschauers während dieses Rituals wird von einem soge-nannten ikribu-Gebet begleitet, in welchem die auszuführende Handlung genau be-schrieben wird. In der Regel gibt auch der Titel des ikribu-Gebetes Auskunft auf die gerade anstehende Tätigkeit, wie zum Beispiel „ikribu-Gebet beim das kallu-Gefäß mit Feinmehl füllen und hinstellen“ (BBR 89–90 Zeile 11: ikrib kalli upunta mullî-ma kunni). Weil die Textüberlieferung dieser ikribu-Gebete getrennt von der Textüber-lieferung der Beschreibungen des Ritualablaufes erfolgte, können sich beide Text-quellen zum Teil ergänzen und unser Bild vom Opferschauritual vervollständigen. Über die Anrufung der Sterne am frühen Abend und deren Bedeutung innerhalb des Opferschaurituals gibt zum Beispiel das bekannte ikribu-Gebet an die „Götter der Nacht“, das ikrib mušītim, „ikribu-Gebet an die Nacht“, Auskunft, welches aus der altbabylonischen Zeit in zwei Abschriften überliefert ist (siehe Anmerkung 47).
51. So nach dem Text BBR 98–99 Zeilen 8–9: ta-mit ŠÀ-ka ina GIŠERIN ina GEŠTU 150-[šu . . .] (9) [D]U11.DU11-ub „Die Opferschauanfrage deines Herzens sprichst du mittels eines Zedern(rohres) in [sein] linkes Ohr.“
52. Daniel A. Foxvog, „A manual of sacrifiial procedure“, in DUMU-E2-DUB-BA-A. Studies in Honor of Åke W. Sjöberg (herausgegeben von H. Behrens, D. Loding und M. T. Roth; Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 11; Philadelphia, PA, 1989) 167–76.
53. Vergleiche zuletzt Y. Cohen, ZA 97 (2007) 233–51 mit früherer Literatur.
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 13
Da die Ritualbeschreibung jedoch in der Regel nur die Grundzüge des Ablaufes und die wichtigen Opferzurüstungen nennt, aber nicht auf jeden einzelnen Handgriff eingeht, lassen sich viele der ikribu-Gebete nicht in das Opferschauritual einfügen, wie zum Beispiel das „ikribu-Gebet beim zum dritten Mal Feinmehl auf das Räu-cherbecken schütten“ (BBR 75–87: 75: ikrib upunta ana niknakki III-te-šu sarāki). In seinem Beitrag „The Babylonian ikribs“ (siehe S. 53–55) nähert sich Wilfred G. Lambert dem Problem der Überlieferung dieser Gebete und deren Bedeutung inner-halb des Opferschaurituals.
In ihrem Beitrag „Zur altorientalischen Opferschaupraxis: Opferschaudurch-führungen über das Wohlbefinden und über das Nicht-Wohlbefinden“ (siehe S. 57–66) widmet sich An De Vos dem praktischen Aspekt der Opferschau. Dabei hält sie zunächst fest, daß sich die hethitische Eingeweideschau von der mesopotamischen nicht wesentlich unterscheidet, obwohl der unbestrittene ungleiche rituelle Hin-tergrund der Opferschau in beiden Kulturräumen dies zunächst vermuten läßt. In beiden Textüberlieferungen versucht die Eingeweideschau auf ganz präzise formu-lierte Fragen positive oder negative Antworten zu erhalten (omina impetrativa). Dabei ist eine positive Antwort auf eine positiv formulierte Frage positiv zu werten, während eine positive Antwort auf eine negativ formulierte Frage negativ ist. Kul-turelle Unterschiede können deshalb nur beim Opferschauritual selbst und bei der Interpretation und Wertung individueller Kennzeichen der Eingeweide beobachtet werden. Auch wenn mesopotamische und hethitische Schriftquellen unterschied-liche Aspekte der Eingeweideschau behandeln, wodurch sie sich bereits auf den ersten Blick deutlich voneinander unterscheiden, finden sich viele Parallelen, die durchaus zur gegenseitigen Erklärung von Abläufen herangezogen werden können. So lassen sich die in Mesopotamien bezeugten und mit EGIR oder piqittu (SI.LÁ) bezeichneten zweiten Durchgänge einer Eingeweideschau, die offensichtlich einer Überprüfung des Ergebnisses des jeweils ersten Durchganges dienen, mit den bei den Hethitern IGI („erster“) und EGIR („folgender“) genannten Befunden ein und derselben Opferschau (mit zwei Durchgängen) vergleichen. Indizien weisen darauf hin, daß sich die Bezeichnungen EGIR und piqittu auf die Art der Fragestellung be-ziehen (positive oder negative Formulierung der Frage), die entweder eine Wieder-holung der ersten Anfrage ist oder im logischen Gegensatz zu ihr formuliert wird.
Bei der Eingeweideschau (Extispizien) hat die Begutachtung der Leber (Hepa-toskopie) einen sehr hohen Stellenwert. Entsprechend nehmen diejenigen Omina, welche die möglichen Veränderungen der Leber individuell ausdeuten, in der etwa 10 Unterserien umfassenden bārûtu-Serie des 1. Jahrtausends v. Chr. drei Kapitel mit insgesamt 27 Tafeln ein. 54 Die anderen Unterkapitel dieser Serie beschäftigen sich mit den Darmwindungen 55, der Galle, dem „Finger“ (processus caudatus bezie-hungsweise pyramidalis), der „Keule“ und der Lunge; das letzte Kapitel der offiziel-len bārûtu-Serie nimmt ein Kommentarteil zu den zuvor genannten Omina namens
54. Ulla Koch-Westenholz, Babylonian Liver Omens: The Chapters Manzāzu, Padānu and Pān tā-kalti of the Babylonian Extispicy Series Mainly from Aššurbanipal’s Library (Carsten Niebuhr Institute Publications, 25; Copenhagen: Musem Tusculanum Press) 2000.
55. Für ein kürzlich publiziertes Tonmodel mit den Zeichnungen von Darmwindungen und den In-terpretationen dieser Besonderheiten vergleiche Mirjo Salvini, „I documenti cuneiformi della campagna del 2001“ in Tell Barri / Kaḫat. la campagna del 2001 : relazione preliminare (Paolo Emilio Peccorella und Raffaela Pierobon; Ricerche e materiali del vicino oriente antico, 2; Firenze: University Press, 2004) 148–51 mit Photos auf S. 150.
Jeanette C. FinCke14
multābiltu 56 ein. In die Ergebnisfindung einer Eingeweideschau fließen aber auch Besonderheiten ein, die an anderen Eingeweiden zu beobachten sind, wie zum Bei-spiel am Herzen, an der Milz oder an den Nieren, wie sich unter anderem auch an der Tatsache ablesen läßt, daß offenbar auch Tonmodellen dieser Eingeweide hergestellt wurden. Mit einem dieser in der Literatur bislang weniger beachteten Eingeweideteilen der Opferschau befaßt sich Nils P. Heeßel in seiner Untersuchung „Die Beobachtung der Nieren in der altorientalischen Opferschau und die Stellung der Nieren-Omina innerhalb der Opferschau-Serie bārûtu“ auf den Seiten 67–76.
Ilya Khait schließt die Sequenz der Untersuchungen mit Bezug auf die Einge-weideschau ab, indem er sich den Textquellen selbst, dem Keilschrifttext, widmet. Er zeigt, daß im Bereich der Divination nicht nur durch die Interpretation bereits publizierter Kompendien unter einer neuen Fragestellung oder die Publikation bislang unbekannter Texte neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Wie bei jeder anderen Textart ist es auch bei den divinatorischen Keilschrifttexten notwen-dig, stets zu den Keilschrifttexten selbst zurückzukehren und selbst etablierte Le-sungen zu hinterfragen. Am Beispiel von altbabylonischen Omenkompendien de-monstriert er sehr eindrücklich, daß es sich lohnt, auch diejenigen Texte nochmals eingehender zu betrachten, welche bereits vor mehr als 60 Jahren publiziert und im Anschluß daran mehrfach untersucht und ausgewertet wurden. Denn auch hier lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, wie er am Beispiel von einigen in YOS X publizierten Omentexten in seiner Studie namens „New Readings in yos 10“ (S. 77–89) zeigen wird.
Unprovozierte ominöse Zeichen nach mesopotamischen Quellen
Schriftquellen, die unprovozierte ominöse Zeichen zum Gegenstand haben, sind in Babylonien und Assyrien in zahllosen Exemplaren aufgefunden wurden. Die ungefragt von den Göttern gesandten ominösen Zeichen können sich in ver-schiedenen Bereichen materialisieren (siehe auch oben S. 1–2) und müssen dabei nicht unbedingt als besonders außergewöhnlich auffallen: Sogar auf den ers-ten Blick unscheinbare Ereignisse des täglichen Lebens, wie etwa das Herabfallen eines Geckos, 57 können wichtige Hinweise auf zukünftiges Geschehen sein. Diese Ereignisse müssen jedoch vom Menschen zunächst als ominös erkannt werden. Erst dann kann er zu den Experten gehen, die in der Interpretation dieser Zeichen be-wandert sind. Hierfür stehen ihnen verschiedene Kompendien zur Verfügung, in denen die ominösen Zeichen mitsamt ihrer Interpretation in Form von Konditional-sätzen niedergeschrieben sind (siehe oben S. 3–4). Im 1. Jahrtausend v. Chr. stützten sich die Gelehrten nicht mehr auf unsystematisch zusammengestellte und daher unvollständige Omenkompendien, sondern hatten offiziell anerkannte Serien (iškaru) zur Konsultation vorliegen. Sollten sie in diesen Omenserien jedoch nicht fündig werden, konnten sie ausgehend von den vorhandenen Omina auch neue ab-
56. U. S. Koch, Secrets of Extispicy.57. šumma ālu Tafel 35 Omen 47′: DIŠ MUŠ.GIM.GURUN.NA ana EGIR NA ŠUB-ut KI.ŠÚ DIB-
su, „Wenn ein Gecko hinter einen Mann fällt, wird das Gefängnis ihn ‘ergreifen’“, vergleiche, Sally M. Freedman, If a City Is Set on a Height: The Akkadian Series Šumma alu ina mēlê šakin, Volume 2: Ta-blets 22–40 (Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund 19; Philadelphia: Samuel Noah Kramer Fund, 2006) 206–07.
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 15
leiten. Dies konnte jedoch nicht jeder Gelehrte für sich alleine entscheiden, denn schließlich wurden nicht nur die ominösen Zeichen von den Göttern gesandt, son-dern auch die Omenserien, in denen die Regeln für die Interpretation dieser Zei-chen niedergeschrieben ist, wurden ursprünglich als von den Göttern, speziell vom Gott des Süßwasserozeans und der Weisheit Ea, geschaffen betrachtet. 58 Um diesen neuen Omina die notwendige Autorität zu geben, erfolgte die Formulierung erst nach ausführlichem Diskurs unter den Gelehrten. Mit dem Zusatz „nach dem Wort-laut der Gelehrten“ (šūt pî ummāni) 59 werden die auf diese Weise neu formulierten Omina anschließend gekennzeichnet.
Eine eigens zu betrachtende Gruppe unprovozierter ominöser Zeichen betrifft die sogenannten oberen Gefilde und umfaßt die tagsüber oder während der Nacht am Himmel zu beobachtenden Besonderheiten. In der je nach verwendetem Format der Tontafel zwischen 63 und 70 Tafeln umfassende Serie enūma anu enlil, „Als Anu und Enlil“, finden sich diese Omina thematisch sortiert in vier Abschnitten unterteilt. Dabei sind diejenigen Götter, welche die einzelnen Himmelskörper oder -bereiche repräsentieren, namensgebend für die einzelnen Abschnitte: Sîn (Mond-gott: Mond), Šamaš (Sonnengott: Sonne), Adad (Wettergott: Wettererscheinungen und Erdbeben) und Ištar (Venus als Repräsentantin für alle Sterne und Planeten). 60 Die beiden ersten Kapitel, die sich auf Sonne und Mond beziehen, sind bereits wäh-rend der Konzeption der Serie zusätzlich in Erscheinungsformen (IGI.DU8) und Fin-sternisse (AN.GE6) unterteilt worden, während eine vergleichbare Unterteilung der letzten beiden Kapitel aufgrund der Diversität des Materials –– wie zum Beispiel Wolken, Regen, Donner, Blitze oder die einzelnen Sterne und Planeten –– nicht möglich ist. 61 Weil diese Zeichen am Himmel im Prinzip von jeder Person gesehen werden können, richten sich die Vorhersagen auch nicht an ein Individuum, son-dern beziehen sich auf die ganze Bevölkerung des Landes, die Land- und Viehwirt-schaft sowie auf den König als Repräsentanten des Landes. Lorenzo Verderame, der sich im Bereich der ‘astrologischen’ Omina auf die Erscheinungsformen des Mondes spezialisiert hat, widmet sich in seiner Untersuchung über „The Halo of the Moon“ (siehe S. 91–104) gezielt dem Phänomen von speziellen Lichteffekten, die den Mond umrahmen können.
58. Dies gilt einem Katalog zufolge explizit für die Serie enūma anu enlil, die sich auf Ereignisse am Himmel bezieht, für die physiognomischen Serien alandimmû (‘Gestalt’) und kataduggâ (‘Ausspruch’) sowie für die diagnostische Omenserie SA.GIG, vergleiche Wilfred G. Lambert, „A Catalogue of Texts and Authors“, JCS 16 (1962) 64–5 Zeilen 1–4.
59. Zum Beispiel SAA X 8 Rückseite 1–2: šu-mu an-ni-u la-a ša ÉŠ.QAR-ma šu-u (2) ša pi-i um-ma-ni šu-ú, „dieses Omen ist nicht aus der Serie – es ist nach dem Wortlaut der Gelehrten.“
60. Vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 51–7 § 2, sowie Erica Reiner und David Pingree, Babylonian Planetary Omens, Part 4 (Cuneiform Monographs, 30; Groningen: Styx, 2005), Erlend Gehlken, „Die Adad-Tafeln der Omenserie Enūma Anu Enlil. Teil 2: Die ersten beiden Don-nertafeln (EAE 42 und EAE 43)“, Zeitschrift für Orient-Archäologie 1 (2008) 256–314, und derselbe We-ather Omens of Enūma Anu Enlil. Thunderstorms, Wind and Rain (Tablets 44–49) (Cuneiform Monogra-phs 43; Leiden: Brill, 2012). Vergleiche auch E. Gehlken, „Die Serie DIŠ Sîn ina tāmartīšu im Überblick“, N.A.B.U. 2007.1, 3–5 (no. 4), und Matthew T. Rutz, „Textual transmission between Babylonia and Susa: A new solar omen compendium“, JCS 58 (2009) 63–96. Für Omenberichte vergleiche auch J. C. Fincke, „Astrologische Omenreporte aus Assur: Mondfinsternisse im Monat nisannu“, in Assur-Forschungen (he-rausgegeben von S. M. Maul und N. P. Heeßel; Wiesbaden: Harrassowitz, 2010) 35–63.
61. Die Schwierigkeit, die Reihenfolge der einzelnen Tafeln dieser beiden Abschnitte zu rekonstru-ieren, ist am Beispiel der Wettertafeln zuletzt sehr eindrucksvoll von Erlend Gehlken, „Die Adad-Tafeln der Omenserie Enūma Anu Enlil, BaM 36 (2005) 235–73, gezeigt worden.
Jeanette C. FinCke16
Neben den ominösen Zeichen des Himmels bilden die Zeichen, welche tagsüber auf der Erde sichtbar werden, eine zweite wichtige Gruppe unprovozierter Zeichen. Die terrestrische Omenserie šumma ālu ina mēlê šakin, „Wenn eine Stadt auf einer Anhöhe liegt“, 62 deutet Ereignisse und Situationen ominös aus, welche im Alten Orient jedem beliebigen Menschen in seinem alltäglichen Leben zustoßen bzw. be-gegnen können. Dabei werden diejenigen Ereignisse, welche weithin sichtbar sind oder viele Menschen betreffen, wie zum Beispiel der Anteil einer bestimmten Per-sonengruppe in einer Stadt, in Bezug auf Städte, Länder und Könige ausgedeu-tet. Ereignisse, die einzelne Personen betreffen oder nur von einzelnen Personen gesehen werden können, haben hingegen Vorhersagen zur Folge, die sich nur auf den betreffenden Menschen beziehen. Aufgrund der Vielfältigkeit der in šumma ālu behandelten Themen und der Wertigkeit der einzelnen Ereignisse, die sich aus den Vorhersagen der Omina (positiv oder negativ) ergibt, lassen sich verschiedene Aspekte des alltäglichen Lebens im Alten Orient erforschen. Ann Guinen konzen-triert sich in ihrer Untersuchung „Laws and Omens: Obverse and Inverse“ (siehe S. 105–121) auf die Frage, die in der Altorientalistik bereits seit langem heftig diskutiert wird, nämlich die Beziehung zwischen den Omina und den Rechtssamm-lungen. Zu diesem Zweck untersucht sie die Vorhersagen derjenigen Tafeln, die sich mit Heirat und sexuellen Beziehungen von Mann und Frau beschäftigen, und ver-gleicht die Vorhersagen der Omina mit Bezug auf Heirat, Ehebruch oder Scheidung mit den Strafen der Gesetzestexte, was zu eindrücklichen Erkenntnissen führt.
Die mesopotamische Omenliteratur behandelt wesentlich mehr Themen, als in einem eintägigen Workshop vorgestellt werden können. Auf die physiognomischen Omina, 63 die sich mit der äußeren Erscheinung von gesunden Menschen beschäf-tigen (šumma alandimmû, aber auch besondere Angewohnheiten beim Sprechen behandeln (šumma kataduggû), ist Barbara Böck in ihrem Vortrag „Physiognomic divination between theory and practice“ eingegangen. 64 Die anderen Omenserien –– zum Beispiel šumma izbu, iqqur īpuš, SA.GIG, Ölomina oder Schlafomina 65 –– konnten dagegen in diesem Rahmen nicht mehr angesprochen werden. Gleiches gilt für die vielen anderen hethitischen Divinationsmethoden 66 –– zum Beispiel die KIN-, šašt-, ḫurri-Vogel-, MUŠ- oder SU-Orakel ––, deren genauer Ablauf immer noch unklar bleibt. Das Thema Divination im Alten Orient bietet demnach noch viel Material für zahlreiche zukünftige Workshops und Symposien.
62. Vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 58–62 § 4.1 sowie Sally M. Freedman, If a City Is Set on a Height: The Akkadian Series Šumma alu ina mēlê šakin, Vol. 2: Tablets 22–40 (Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 19; Philadelphia: Samuel Noah Kra-mer Fund, 2006), und dieselbe, „BM 129092: A commentary on snake omens“ in If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty (herausgegeben von Ann K. Guinen et al.; Leiden • Boston: Brill, 2006), 149–66.
63. Vergleiche S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, 66–8 § 5.2, sowie N. P. Hee-ßel, „Neues von Esag-kīn-apli. Die ältere Version der physiognomischen Omenserie alandimmû“, in As-sur-Forschungen (herausgegeben von S. M. Maul und N. P. Heeßel; Wiesbaden: Harrassowitz, 2010) 139–87.
64. Publiziert als „Physiognomy in Ancient Mesopotamia and Beyond: From Practice to Handbook“, in Divination and Interpretation of Signs in the Ancient World (herausgegeben von A. Annus; Oriental Institute Symposium 6; Chicago 2010) 199–224.
65. Vergleiche für alle S. M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“ sowie die oben in den Anmerkungen 4–6 genannte Literatur.
66. Siehe die in Anmerkung 2 und 3 genannte Literatur.
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 17
BibliographieAmbos, Claus. Mesopotamische Baurituale aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. Dresden: ISLET,
2004.Anonymus. La divination en Mésopotamie ancienne et dans les régions voisines – Travaux du
Centre d‘études supérieures spécialisé d‘histoire des religions de Strasbourg. Paris: Presses Universitaires de France, 1966.
Archi, Alfonso. „Divination in Ebla“. Seiten 45–56 in Festschrift für Gernot Wilhelm anläß-lich seines 65. Geburtstages am 28. Januar 2010. Herausgegeben von J. C. Fincke. Dresden: ISLET, 2010.
Bawanypeck, Daliah. Die Rituale der Auguren. Texte der Hethiter, 25. Heidelberg: Winter, 2005.
Beal, Richard H. „Hittite Oracles“. Seiten 57–81 in Magic and Divination in the Ancient World. Ancient Magic and Divination II. Herausgegeben von L. Ciraolo und J. Sei-del. Leiden • Boston • Köln: Brill-Styx, 2002.
Borger, Rykle. „Geheimwissen“. Seiten 188–91 in Reallexikon der Assyriologie, Vol. 3. Her-ausgegeben von Ernst Weidner. Berlin: De Gruyter, 1957.
Böck, Barbara. „Physiognomy in Ancient Mesopotamia and Beyond: From Practice to Hand-book“. Seiten 199–224 in Divination and Interpretation of Signs in the Ancient World. Herausgegeben von A. Annus. Oriental Institute Symposium 6. Chicago: University of Chicago, 2010.
Butler, Sally A. L. Mesopotamian Conceptions of Dreams and Dream Rituals. AOAT 258. Münster: Ugarit-Verlag, 1998
Caplice, Richard. „XIVe Rencontre Assyriologique Internationale“, OrNS 32 (1965) 343–44.Casaburi, Maria C. Ūmē ṭābūti „I giorni favorevoli“. History of the Ancient Near East – Stu-
dies, Volume VIII. Padova: S.a.r.g.o.n., 2003.Cohen, Yoram. „Akkadian Omens from Hattuša and Emar: The šumma immeru and šumma
ālu Omens“, ZA 97 (2007) 233–51.de Martino, Stefano. „Le accuse di Muršili II alla regina tawananna secondo il testo KUB XIV
4“, Eothen 9 (1998) 19–48.De Vos, An. Die Lebermodelle aus Boğazköy. Studien zu den Boğazköy-Texten Beiheft 5.
Wiesbaden: Harrassowitz, 2013.de Zorzi, Nicla, „Bird Divination in Mesopotamia. New Evidence from BM 108874“, KASKAL
6 (2009) 85–136.Ebeling, Erich. Die akkadische Gebetsserie „Handerhebung“ von neuem gesammelt und he-
rausgegeben. Berlin: Akademie-Verlag, 1953.Fincke, Jeanette C. Augenleiden nach keilschriftlichen Quellen. Untersuchungen zur altori-
entalischen Medizin. Würzburger medizinhistorische Forschungen, 70. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000.
______ . „Zu den hethitischen Übersetzungen babylonischer Omentexte: Die kalendarischen und astrologischen Omina in KUB VIII 35“, SMEA 46.2 (2004) 215–41.
______ . „Omina die göttlichen “Gesetze” der Divination“, JEOL 40 (2006–07) 131–47.______ . „Ist die mesopotamische Opferschau ein nächtliches Ritual?“, BiOr 66 (2009) 519–58.______ . „KBo 36, 70: Duplikat zum Text mit Sonnenomina KUB 4, 63 und KUB 30, 9+“,
N.A.B.U. 2009.3, 52–3 Nr. 40.______ . „KBo 36, 36: Duplikat zum Text mit Erdbebenomina KUB 37, 163“, N.A.B.U. 2010.1,
9–11 Nr. 11.______ . „ana KI GIG GAM in den diagnostischen Omina“, N.A.B.U. 2010.2, 47–48 Nr. 40.______ . „Astrologische Omenreporte aus Assur: Mondfinsternisse im Monat nisannu“. Sei-
ten 35–63 in Assur-Forschungen. Herausgegeben von S. M. Maul und N. P. Heeßel. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010.
______ . „KBo 9, 56: Ein Eingeweideschautext aus Ḫattuša“, N.A.B.U. 2011.1, 24–25 Nr. 20.
Jeanette C. FinCke18
______ . „KAL 1 Nr. 59: Ein mittelassyrisches Fragment der Serie iqqur īpuš“, N.A.B.U. 2011.3, 70–2 Nr. 63.
______ . „KAL 1 Nr. 64: Ein Eingeweideschau-Omentext aus Assur“, N.A.B.U. 2011.3, 72–3 Nr. 64.
Finkel, Irving L. „On an izbu VII commentary“. Seiten 139–48 in If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty. Herausgegeben von Ann K. Guinen et al. Leiden • Boston: Brill, 2006.
Foxvog, Daniel A. „A manual of sacrificial procedure“. Seiten 167–76 in DUMU-E2-DUB-BA-A. Studies in Honor of Åke W. Sjöberg. Herausgegeben von H. Behrens, D. Lo-ding und M. T. Roth. Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 11. Philadelphia, PA, 1989.
Freedman, Sally M. If a City Is Set on a Height: The Akkadian Series Šumma alu ina mēlê šakin, Volume 2: Tablets 22–40. Occasional Publications of the Samuel Noah Kra-mer Fund, 19. Philadelphia: Samuel Noah Kramer Fund, 2006.
______ . „BM 129092: A Commentary on Snake Omens“. Seiten 149–66 in If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty. Edited by Ann K. Guinen et al. Leiden • Boston: Brill, 2006.
Gehlken, Erlend. „Die Adad-Tafeln der Omenserie Enūma Anu Enlil“, BaM 36 (2005) 235–73.______ . „Die Serie DIŠ Sîn ina tāmartīšu im Überblick“, N.A.B.U. 2007.1, 3–5 Nr. 4.______ . „Die Adad-Tafeln der Omenserie Enūma Anu Enlil. Teil 2: Die ersten beiden Donner-
tafeln (EAE 42 und EAE 43)“, Zeitschrift für Orient-Archäologie 1 (2008) 256–314.______ . Weather Omens of Enūma Anu Enlil. Thunderstorms, Wind and Rain (Tablets 44–
49). Cuneiform Monographs 43. Leiden: Brill, 2012.Geller, Markham J. „Incipits and Rubrics“. Seiten 225–258 in Wisdom, Gods and Literature.
Studies in Assyriology in Honour of W. G. Lambert. Herausgegeben von A. R. George und I. L. Finkel. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2000.
Glassner, Jean-Jacques. „L’aruspicine paléo-babylonienne et le témoignage des sources de Mari“, ZA 95 (2005) 276–300.
Hazenbos, Joost. „Der Mensch denkt, Gott lenkt. Betrachtungen zum hethitischen Orakel-personal“. Seiten 95–109 in Das Geistige Erfassen der Welt im Alten Orient. Heraus-gegeben von C. Wilcke. Wiesbaden: Harrassowitz, 2007.
Heeßel, Nils P. Babylonisch-assyrische Diagnostik. AOAT 43. Münster: Ugarit, 2000.______ . „Diagnosis, Divination and Disease. Towards an Understanding of the Rationale Be-
hind the Babylonian Diagnostic Handbook“. Seiten 97–116 in Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and Graeco-Roman Medicine. Herausgegeben von H. F. J. Horstmanshoff und M. Stol. Studies in Ancient Medicine, 27. Leiden • Boston: Brill, 2004.
______ . Divinatorische Texte I. Terrestrische, teratologische, physiognomische und aneiro-mantische Omina. Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts, 1. WVDOG 116. Wiesbaden: Harrassowitz 2007.
______ . „Neues von Esag-kīn-apli. Die ältere Version der physiognomischen Omenserie alan-dimmû“. Seiten 139–87 in Assur-Forschungen. Herausgegeben von S. M. Maul und N. P. Heeßel. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010.
Horowitz, Wayne, und Nathan Wasserman. „Another Old Babylonian Prayer to the Gods of the Night“, JCS 48 (1996) 57–60.
Jeyes, Ulla. „Divination as a Science in Ancient Mesopotamia“, JEOL 32 (1991–92) 23–41.Koch-Westenholz, Ulla. Babylonian Liver Omens. The Chapters Manzāzu, Padānu and Pān
tākalti of the Babylonian Extispicy Series Mainly from Aššurbanipal’s Library. Car-sten Niebuhr Institute Publications, 25. Copenhagen: Musem Tusculanum Press, 2000.
Divination im Alten Orient: Ein Überblick 19
Koch, Ulla S. Secrets of Extispicy. The Chapter Multābiltu of the Babylonian Extispicy Series and Niṣirti bārûti. Texts Mainly from Aššurbanipal’s Library. AOAT 326. Münster: Ugarit-Verlag, 2005.
Korošec, Viktor. „La sorcellerie et l’ordalie dans les textes hittites, histpriques et juridiques“. Seiten 413–18 in Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. VI. Herausgegeben von Luigi Aru. Milano: Giuffrè, 1971.
Kümmel, Hans M. Ersatzrituale für den hethitischen König. StBoT 3. Wiesbaden: Harrasso-witz, 1967.
Lambert, Wilfred G. „A Catalogue of Texts and Authors“, JCS 16 (1962) 59–77.______ . „The Qualifications of Babylonian Diviners“. Seiten 141–58 in Festschrift für Rykle
Borger zu seinem 65. Geburtstag am 24. Mai 1994 tikip santakki mala bašmu . . . Herausgegeben von Stefan M. Maul. Cuneiform Monographs, 10. Groningen: Styx, 1998.
______ . Babylonian Oracle Questions. Mesopotamian Civilizations, 13. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2007.
Maul, Stefan M. Zukunftsbewältigung. Eine Untersuchung altorientalischen Denkens an-hand der babylonisch-assyrischen Löserituale (Namburbi). Baghdader Forschungen, 18. Mainz am Rhein: Von Zabern, 1994.
______ . „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“. Seiten 45–88 in Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Vol. 10. Herausgegeben von D. O. Edzard und M. P. Streck. Berlin • New York: De Gruyter, 2003.
______ . „Aleuromantie. Von der altorientalischen Kunst, mit Hilfe von Opfermehl das Maß göttlichen Wohlwollens zu ermitteln“. Seiten 115–30 in Von Göttern und Menschen. Beiträge zu Literatur und Geschichte des Alten Orients für Brigitte Groneberg. He-rausgegeben von D. Shehata, F. Weihershäuser und K. Zand. Cuneiform Mono-graphs, 41. Leiden • Boston, 2010.
______ . „Die Wissenschaft von der Zukunft. Überlegungen zur Bedeutung der Divination im Alten Orient“. Seiten 135–51 in Babylon. Wissenskultur in Orient und Okzident. Herausgegeben von E. Cancik-Kirschbaum, M. von Ess, und J. Mahrzahn. Berlin • Boston: De Gruyter, 2011.
Meissner, Bruno. „Omina zur Erkenntnis der Eingeweide des Opfertieres“, AfO 9 (1933–34) 118–22, 329–30.
Nougayrol, Jean. „Aleuromancie babylonienne“, OrNS 32 (1963) 381–86.Oppenheim, A. Leo. The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, With a Transla-
tion of an Assyrian Dream-Book. Transactions of the American Philosophical Soci-ety, New Series 46.3. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1956.
Orlamünde, Julia. „Überlegungen zum hethitischen KIN-Orakel“. Seiten 295–311 in Kul-turgeschichten. Altorientalische Studien für Volkert Haas zum 65. Geburtstag. He-rausgegeben von Th. Richter, D. Prechel und J. Klinger. Saarbrücken: Saarbrücker Druckerei und Verlag, 2001.
Parpola, Simo. Letters from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal, Part II: Commentary and Appendices. AOAT 5/2. Kevelaer: Butzon & Bercker, Neukirchen: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins, 1983.
Pettinato, Giovanni. Die Ölwahrsagung bei den Babyloniern. Studi Semitici, 21–22. Roma: Instituto di Studi del Vicino Oriente, Università di Roma, 1966.
Reiner, Erica, und David Pingree. Babylonian Planetary Omens, Part 4. Cuneiform Mono-graphs, 30. Groningen: Styx, 2005.
Riemschneider, Kaspar K. Die akkadischen und hethitischen Omentexte aus Boğazköy. Dresd-ner Beiträge zur Hethitologie, 12. Dresden: Technische Universität Dresden, 2004 (postume Publikation des Manuskriptes seiner Habilitationsschrift von 1973?).
Rutz, Matthew T. „Textual Transmission between Babylonia and Susa: A New Solar Omen Compendium“, JCS 58 (2009) 63–96.
Jeanette C. FinCke20
Sakuma, Yasuhiko. Hethitische Vogelorakel. opusbibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/docId/6786.
Salvini, Mirjo. „I documenti cuneiformi della campagna del 2001“. Seiten 147–52 in Tell Barri / Kaḫat. La campagna del 2001 : relazione preliminare. Paolo Emilio Pecorella und Raffaela Pierobon Benoit mit einem Beitrag von Mirjo Salvini und George Mar-chand. Ricerche e materiali del vicino oriente antico, 2. Firenze: University Press, 2004.
Seux, Marie-Joseph. Hymnes et prieres aux dieux de babylonie et d’assyrie. Littératures an-ciennes du Proche-Orient, 8. Paris: Les Éditions du Cerf, 1976.
Singer, Itamar. Hittite Prayers. Leiden • Boston • Köln: Brill, 2002.Spar, Ira, und W. G. Lambert (Herausgeber). Literary and Scholastic Texts of the First Mil-
lennium B.C. Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of Art, Vol. II. Madrid: Brepols, 2005.
Steinkeller, Piotr. „Of Stars and Men: The Conceptual and Mythological Setup of Babylonian Extispicy“. Seiten 11–47 in Biblical and Oriental Essays in Memory of William L. Moran. Herausgegeben von Augustinus Gianto. Biblica et orientalia, 48. Roma: Pon-tificio Istituto Biblico, 2005.
______ . „How to Read the Liver—in Sumerian“. Seiten 247–57 in If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty. Herausgegeben von Ann K. Guinen et al. Leiden • Boston: Brill, 2006.
Stol, Marten. „Two Old Babylonian Literary Texts“. Seiten 383–87 in Language, Literature, and History. Philological and Historical Studies Presented to Erica Reiner. Heraus-gegeben von F. Rochberg-Halton. American Oriental Series, 67. New Haven, CT: American Oriental Society, 1987.
van den Hout, Theo P. J. „Omina (Omens). B. Bei den Hethitern“. Seiten 88–90 in Reallexi-kon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Vol. 10. Herausgegeben von D. O. Edzard und M. P. Streck. Berlin • New York: De Gruyter, 2003.
______ . „Orakel (Oracle). B. Bei den Hethitern“. Seiten 118–24 in Reallexikon der Assyrio-logie und Vorderasiatischen Archäologie, Vol. 10. Herausgegeben von D. O. Edzard und M. P. Streck. Berlin • New York: De Gruyter, 2003
Wilcke, Claus. „Das Recht: Grundlage des sozialen und politischen Diskurses im Alten Ori-ent“. Seiten 209–44 in Das geistige Erfassen der Welt im Alten Orient. Beiträge zu Sprache, Religion, Kultur und Gesellschaft. Herausgegeben von Cl. Wilcke; Wiesba-den: Harrassowitz, 2007.
Zimmern, Heinrich. Beiträge zur Kenntnis der babylonischen Religion. Die Beschwörungsta-feln Šurpu. Ritualtafeln für den Wahrsager, Beschwörer und Sänger. Assyriologische Bibliothek, 12. Leipzig: Hinrichs, 1901.