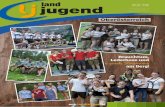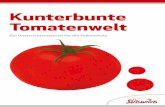"Finanzierung der Creative Industries in Oberösterreich" – Ein-und Ausblicke
Transcript of "Finanzierung der Creative Industries in Oberösterreich" – Ein-und Ausblicke
„Finanzierung der Creative Industries in Oberösterreich“
– Ein- und Ausblicke.
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Magistra“ im individuellen Diplomstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt: Kunst- und
Kulturmanagement
Begutachter: Univ.-Prof. Dr. Norbert Kailer
Autorin: Doris Kaiserreiner
Linz, August 2013
3
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde
Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die
wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die
vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.
Linz, im August 2013
Doris Kaiserreiner
_______________________________________________________________________________________________________________
5
DANK AN
Mein besonderer Dank gilt jenen Personen, die mir mit Rat und Information bei der Erstellung
der Diplomarbeit zur Seite standen und mich durch Zurverfügungstellung von Unterlagen und
Daten und ihren Netzwerken unterstützt haben:
Julian Breitenecker / media4equity und onemangroup
Gabriele Gerbasits / IG Kultur Österreich
Roland Gruber / nonconform
Michaela Gutmann / creativ wirtschaft austria, WKO
Christian Henner-Fehr / stART12
Hannes Kollross-Schinnerl / 1000x1000
Martin Lengauer / die jungs kommunikation
Melina / wemakeit
Harald Murlasitis / Statistik Austria
Wolfgang Preisinger / Die Fabrikanten
Sabine Raab und Katrin Kneissl / Cultural Contact Point
Petra Riegler / AWS Impulse
Paul Stepan / Eurozine
Gerfried Stocker / Ars Electronica
Martin Sturm / OK-Zentrum
Georg Tremetzberger / Creative Region Linz & Upper Austria GmbH
Simone Weinbacher-Traun / AWS
Ursula Witzany / Alumniclub Kunstuniversität Linz
Ganz besonders danke ich jenen InterviewpartnerInnen, die im Anhang I und II namentlich
genannt sind.
7
INHALTSVERZEICHNIS:
1 EINLEITUNG ............................................................................................................................................. 19 1.1 Einführung in die Thematik der Creative Industries ..................................................................................................................... 19 1.2 Ausgangspunkt der Arbeit .......................................................................................................................................................................... 21 1.3 Ziel der Arbeit ................................................................................................................................................................................................... 21 1.4 Methodik der Arbeit ...................................................................................................................................................................................... 22 1.5 Abgrenzung der Erhebungseinheiten ................................................................................................................................................... 26 1.6 Aufbau der Arbeit............................................................................................................................................................................................ 26
2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN UND VORHANDENE FINANZIERUNGSANGEBOTE 29 2.1 Definition Creative Industries (CI) / Kreativwirtschaft (KW) .................................................................................................. 29 2.2 Vorhandenes Datenmaterial ...................................................................................................................................................................... 30 2.3 Ökonomische Bedeutung und Potentiale ............................................................................................................................................ 31
2.3.1 Österreichs Wirtschaft allgemein ........................................................................................................................ 32 2.3.2 Creative Industries in Österreich ......................................................................................................................... 34 2.3.3 Creative Industries in Oberösterreich ............................................................................................................... 37
2.4 Finanzierung...................................................................................................................................................................................................... 49 2.4.1 Allgemein ........................................................................................................................................................................ 49
2.4.1.1 Innen- und Außenfinanzierung ................................................................................................................... 51 2.4.1.2 Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung ..................................................................................................... 52 2.4.1.3 Finanzierung innerhalb der Unternehmensphasen ........................................................................... 55
2.4.2 Öffentliches Förderangebot .................................................................................................................................... 56 2.4.2.1 Bundesebene ........................................................................................................................................................ 58
2.4.2.1.1 Beratung und Information .................................................................................................................... 60 2.4.2.1.2 Kredite und Darlehen.............................................................................................................................. 60 2.4.2.1.3 Haftungen ..................................................................................................................................................... 60 2.4.2.1.4 Zuschüsse und Subventionen .............................................................................................................. 61 2.4.2.1.5 Preise und Auszeichnungen ................................................................................................................. 61 2.4.2.1.6 Der Mikrokredit ......................................................................................................................................... 61 2.4.2.1.7 Neufög ............................................................................................................................................................ 63 2.4.2.1.8 WIFI Unternehmerservice .................................................................................................................... 63 2.4.2.1.9 Evolve – Förderungen für die Kreativwirtschaft ........................................................................ 64 2.4.2.1.10 aws ................................................................................................................................................................ 65
2.4.2.1.10.1 Filmförderung - FISA ................................................................................................................... 65 2.4.2.1.10.2 impulse XS, XL, Lead .................................................................................................................... 67 2.4.2.1.10.3 Kreativwirtschaftsscheck .......................................................................................................... 69 2.4.2.1.10.4 i2 Business Angel Börse ............................................................................................................. 70 2.4.2.1.10.5 Förderung durch Partnering – Vinci Voucher .................................................................. 70
2.4.2.1.11 Kunst- und Kulturförderung ............................................................................................................. 71 2.4.2.1.12 Filmförderung – Österreichisches Filminstitut ........................................................................ 71 2.4.2.1.13 SKE Fonds .................................................................................................................................................. 74 2.4.2.1.14 Forschungsförderung (FFG) .............................................................................................................. 75
2.4.2.2 Land Oberösterreich......................................................................................................................................... 76 2.4.2.2.1 Beratung und Information .................................................................................................................... 77 2.4.2.2.2 Kooperationsförderung ......................................................................................................................... 78 2.4.2.2.3 Cluster und Netzwerke ........................................................................................................................... 79
2.4.2.2.3.1 Förderung durch die Creative Region Linz & Upper Austria GmbH ......................... 79 2.4.2.2.3.2 Netzwerk Design & Medien ......................................................................................................... 80 2.4.2.2.3.3 Forum MozARThaus ....................................................................................................................... 81
2.4.2.2.4 Haftungen/Garantien/Bürgschaften................................................................................................ 81 2.4.2.2.5 Beteiligungen .............................................................................................................................................. 82 2.4.2.2.6 Zuschüsse und Subventionen .............................................................................................................. 83 2.4.2.2.7 Wirtschaftsimpulsprogramme (WIP) .............................................................................................. 83 2.4.2.2.8 Förderung „kreatives Handwerk“ ..................................................................................................... 84 2.4.2.2.9 Filmförderung – touristisch und kulturell ..................................................................................... 85
8
2.4.2.2.10 Kulturförderung ..................................................................................................................................... 85 2.4.2.3 Stadt Linz ............................................................................................................................................................... 86
2.4.2.3.1 Creative Community ................................................................................................................................ 86 2.4.2.3.2 Kulturförderung ........................................................................................................................................ 87 2.4.2.3.3 Preise und Stipendien ............................................................................................................................. 88
2.4.3 Förderung durch Interessensgruppen und Vereine .................................................................................... 88 2.4.3.1 WKO ......................................................................................................................................................................... 88
2.4.3.1.1 Gründerservice .......................................................................................................................................... 88 2.4.3.1.2 arge creativ wirtschaft austria ............................................................................................................ 89 2.4.3.1.3 Hotline Creativwirtschaft Austria ..................................................................................................... 89 2.4.3.1.4 CreativDepot ............................................................................................................................................... 89 2.4.3.1.5 JungunternehmerInnen-Coaching..................................................................................................... 90 2.4.3.1.6 Expert Network Kreativwirtschaft ................................................................................................... 90 2.4.3.1.7 Junge Wirtschaft OÖ. der WKO ........................................................................................................... 90 2.4.3.1.8 WKOÖ - Gründerservice ........................................................................................................................ 91
2.4.3.2 Hochschulen ......................................................................................................................................................... 92 2.4.3.2.1 StartUp-Center des IUG .......................................................................................................................... 92 2.4.3.2.2 Akostart OÖ. ................................................................................................................................................ 92 2.4.3.2.3 tech2b ............................................................................................................................................................ 93 2.4.3.2.4 EDISON Der Preis ...................................................................................................................................... 94
2.4.4 Finanzmittel von nicht öffentlicher Seite ......................................................................................................... 95 2.4.4.1 Equity Capital ...................................................................................................................................................... 95
2.4.4.1.1 Founder, Family, Friends & Foolhardy Investors ....................................................................... 96 2.4.4.1.2 Business Angels ......................................................................................................................................... 96 2.4.4.1.3 Private Venture Kapitalgeber .............................................................................................................. 97
2.4.4.2 Sponsoring ............................................................................................................................................................ 99 2.4.4.3 Eigenleistungen .................................................................................................................................................. 99 2.4.4.4 Fremdkapital Kredite und Darlehen der Banken ............................................................................. 100
2.4.5 Kreative Wege der Finanzierung ...................................................................................................................... 101 2.4.5.1 Tauschgeschäfte – „Bartering“ .................................................................................................................. 101 2.4.5.2 Merchandising und Merchandising Licensing ................................................................................... 102 2.4.5.3 Crowdfunding ................................................................................................................................................... 102 2.4.5.4 Fördervereine ................................................................................................................................................... 103 2.4.5.5 Stammkapital durch GmbH-Gründung ................................................................................................. 103 2.4.5.6 Mikrokredite ..................................................................................................................................................... 104 2.4.5.7 Micro-money über flattr .............................................................................................................................. 105
2.4.6 Exkurs: Crowdfunding - Bedeutung als Finanzierungsalternative .................................................... 105 2.4.6.1 Crowdsourcing ................................................................................................................................................. 106 2.4.6.2 Crowdfunding ................................................................................................................................................... 107 2.4.6.3 Crowdfinancing................................................................................................................................................ 109 2.4.6.4 Zum Stand der wissenschaftlichen Forschung .................................................................................. 112 2.4.6.5 Anforderungen und Voraussetzungen .................................................................................................. 119 2.4.6.6 Best Practice – Beispiele: GeoGebra / SIERRA ZULU / Data-Dealer ........................................ 123 2.4.6.7 Einsatz als Finanzierungsinstrument .................................................................................................... 132 2.4.6.8 Potentiale von Crowdfunding ................................................................................................................... 132
3 EMPIRIE - ERGEBNISSE DER ERHEBUNG ..................................................................................... 135 3.1 Allgemeines ..................................................................................................................................................................................................... 135 3.2 Beschreibung der Stichprobenstruktur ............................................................................................................................................ 135
3.2.1 Verteilung der Unternehmen (n=25) nach Sparten ................................................................................. 135 3.2.2 Dauer des Unternehmertums (n=23) ............................................................................................................. 137 3.2.3 Rechtsformen (n=25) ............................................................................................................................................. 138 3.2.4 MitarbeiterInnenanzahl (n=23) ........................................................................................................................ 138 3.2.5 Alter der befragten Personen (n=22) ............................................................................................................. 139 3.2.6 Reichweite/Internationalisierungsgrad (n=25) ........................................................................................ 140 3.2.7 Entrepreneurs (n=22) ........................................................................................................................................... 140 3.2.8 Vernetzungsgrad ...................................................................................................................................................... 143
3.3 Bekannte Finanzierung ............................................................................................................................................................................. 146 3.3.1 Die Bekanntheit von öffentlichen Förderungen und Förderstellen .................................................. 146 3.3.2 Die Bekanntheit von weiteren Finanzierungsquellen ............................................................................. 148
9
3.4 Genutzte Finanzierung .............................................................................................................................................................................. 149 3.5 Erfahrungen mit Finanzierung .............................................................................................................................................................. 153 3.6 Besonderheiten ............................................................................................................................................................................................. 154 3.7 Stellung des Crowdfunding bei Kreativen (n=23)........................................................................................................................ 156 3.8 Hemmnisse der KU (n=25) ...................................................................................................................................................................... 158 3.9 Unterstützungsbedarfe der Creative Industries ........................................................................................................................... 162
4 DISKUSSION DER ERGEBNISSE ........................................................................................................ 167 4.1 Finanzierung Allgemein ............................................................................................................................................................................ 167
4.1.1 Bekanntheit von öffentlichen Förderungen und Förderstellen .......................................................... 167 4.1.2 Bekanntheit von weiteren Finanzierungsquellen ..................................................................................... 168
4.2 Zielgruppenspezifische Finanzierung ................................................................................................................................................ 168 4.2.1 „Einzelkämpfer“ (n=7) ........................................................................................................................................... 170 4.2.2 „Teams“ (n=7) ........................................................................................................................................................... 171 4.2.3 „Teams im juristischen Kleid“ (n=9) ............................................................................................................... 171 4.2.4 Die Finanzierung der drei Gruppen ................................................................................................................. 173
4.2.4.1 Die Finanzierung der „Einzelkämpfer“.................................................................................................. 174 4.2.4.2 Die Finanzierung der „Teams“ .................................................................................................................. 174 4.2.4.3 Die Finanzierung der „Teams im juristischem Kleid“ ..................................................................... 174
4.2.5 Bedarfe zur Nutzung von Crowdfunding ....................................................................................................... 175 4.2.5.1 Unterstützungsbedarfe der „Einzelkämpfer“ an Crowdfunding ................................................ 176 4.2.5.2 Unterstützungsbedarfe der „Teams“ an Crowdfunding ................................................................ 176 4.2.5.3 Unterstützungsbedarfe der „Teams im juristischem Kleid“ an Crowdfunding ................... 177
4.2.6 Gruppenspezifische allgemeine Bedarfe ....................................................................................................... 178 4.2.6.1 Bedarfe der „Einzelkämpfer“ ..................................................................................................................... 178 4.2.6.2 Bedarfe der „Teams“ ...................................................................................................................................... 178 4.2.6.3 Bedarfe der „Teams im juristischem Kleid“ ........................................................................................ 179
4.3 Ansatzpunkte zum Abbau von Hemmnissen .................................................................................................................................. 180 4.4 Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien ................................................................................................................................. 183
4.4.1 Kreativwirtschaft ..................................................................................................................................................... 183 4.4.2 Crowdfunding ............................................................................................................................................................ 185
4.5 Nachhaltige Kreativwirtschaftsförderung ....................................................................................................................................... 187
5 Zukünftiger Forschungsbedarf ....................................................................................................... 189
6 Ausblick ................................................................................................................................................... 191
7 Literaturverzeichnis ........................................................................................................................... 193
8 ANHÄNGE ................................................................................................................................................ 205
Anhang I: Liste der interviewten Experten ........................................................................................ 207
Anhang II: Liste der interviewten Kreativen .................................................................................... 209
Anhang III: Interviewleitfaden ............................................................................................................... 211
Anhang IV: Önace / Statistik Austria .................................................................................................... 215
Anhang IVb: Strukturdaten 2011 / Statistik Austria ..................................................................... 219
Anhang V: Sonstige Wirtschaftsförderung der aws ........................................................................ 223 8.1 ERP-Kleinkredit ............................................................................................................................................................................................ 223 8.2 Haftungsübernahme für Mikrokredite .............................................................................................................................................. 223 8.3 JungunternehmerInnenförderung ....................................................................................................................................................... 224 8.4 Tecnet – Markt- & Technologierecherchen ..................................................................................................................................... 225 8.5 Tools – Plan4You Businessplansoftware .......................................................................................................................................... 225 8.6 Gründungssparen - Gründungsbonus ................................................................................................................................................ 225 8.7 Double Equity Garantiefonds ................................................................................................................................................................. 226 8.8 KMU – Innovationsförderung „Unternehmensdynamik“ ......................................................................................................... 226 8.9 KMU-Haftungen ............................................................................................................................................................................................ 227 8.10 ProTrans .......................................................................................................................................................................................................... 227
Anhang VI: bundesweite Kunstförderung - Kulturförderung ..................................................... 229
Anhang VII: Förderungsrichtlinien - Referenzfilmförderung ..................................................... 231
10
Anhang VIII: weitere Netzwerke............................................................................................................ 235 8.11 Kupf – Kulturplattform OÖ. .................................................................................................................................................................... 235 8.12 afo – Architekturforum OÖ. .................................................................................................................................................................... 235 8.13 OK Offenes Kulturhaus OÖ. .................................................................................................................................................................... 236 8.14 Ars Electronica ............................................................................................................................................................................................. 236 8.15 OTELO ............................................................................................................................................................................................................... 236 8.16 sonstige Netzwerke .................................................................................................................................................................................... 237 8.17 überregionale Interessensgemeinschaften .................................................................................................................................... 237
Anhang VIX: ausgewählte Crowdfunding-Plattformen ................................................................. 239
11
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Ablauf theoretischer Überblick ...................................................................................................... 24 Abbildung 2: Ablauf der Befragung ......................................................................................................................... 25 Abbildung 3: Unternehmensneugründungen in OÖ. 2010 ............................................................................ 34 Abbildung 4: Kreativ-Ballungszentren in OÖ. ..................................................................................................... 39 Abbildung 5: Branchenverteilung der KWU (Durchschnitt 2005-2008) ................................................. 40 Abbildung 6: Finanzierungsquellen der Kultur- und Kreativwirtschaft .................................................. 50 Abbildung 7: Eigenkapitalentwicklung .................................................................................................................. 53 Abbildung 8: Finanzierungsquellen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien ................................ 55 Abbildung 9: evolve-Organigramm Kreativwirtschaftsförderung ............................................................. 64 Abbildung 10: Förderablauf der FISA ..................................................................................................................... 66 Abbildung 11: impulse-Förderungen ..................................................................................................................... 67 Abbildung 12: Investment Structure, Media4Equity Invest, 04/2013 ..................................................... 98 Abbildung 13: Arten von Crowdfunding ............................................................................................................ 106 Abbildung 14: Anspruchsgruppen ........................................................................................................................ 119 Abbildung 15: Durchführung eines erfolgreichen CF ................................................................................... 120 Abbildung 16: Best Practice GeoGebra ............................................................................................................... 124 Abbildung 17: Best Practice SIERRA ZULU ....................................................................................................... 125 Abbildung 18: Best Practice Data Dealer ........................................................................................................... 126 Abbildung 19: eingesammeltes Kapital mittels Crowdinvesting in DE ................................................. 133 Abbildung 20: Unternehmensalter ....................................................................................................................... 138 Abbildung 21: Rechtsformen .................................................................................................................................. 138 Abbildung 22: Zahl der MitarbeiterInnen .......................................................................................................... 139 Abbildung 23: Alter der UnternehmerInnen .................................................................................................... 139 Abbildung 24: Internationalisierungsgrad ........................................................................................................ 140 Abbildung 25: Finanzierungsmix .......................................................................................................................... 149 Abbildung 26: Förderanteil bei KU (n=17) ....................................................................................................... 150 Abbildung 27: Anteil Eigenleistung (n=25) ...................................................................................................... 150 Abbildung 28: Basisfinanzierung und Projektfinanzierung ....................................................................... 152 Abbildung 29: beobachtetes Selbstverständnis der Kreativen ................................................................. 169
13
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Konjunkturprognosen und -statistiken ............................................................................................ 32 Tabelle 2: Struktur der Kreativwirtschaft nach Bereichen 2010/2011 ................................................... 34 Tabelle 3: Finanzierungsstruktur der Kreativwirtschaft zur Gesamtwirtschaft 2008/09 u. 2010 .............. 36 Tabelle 4: Struktur der Kreativwirtschaft im Bundesländervergleich 2010 ......................................... 38 Tabelle 5: Anzahl KU je Bereich in OÖ. ................................................................................................................... 41 Tabelle 6: Zahl der Beschäftigten in OÖ. KU ........................................................................................................ 42 Tabelle 7: Zahl der unselbständig Beschäftigten in OÖ. KU .......................................................................... 43 Tabelle 8: Zahl der selbständig Beschäftigten in OÖ. KU ................................................................................ 44 Tabelle 9: Umsatzerlöse OÖ. KU................................................................................................................................ 45 Tabelle 10: Investitionen OÖ. KU.............................................................................................................................. 45 Tabelle 11: Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten von OÖ. KU ................................................................. 47 Tabelle 12: typische Finanzierungsformen der Kreativen ............................................................................ 56 Tabelle 13: Überblick Förderdatenbanken .......................................................................................................... 58 Tabelle 15: Kulturelle Sonderförderung ............................................................................................................... 87 Tabelle 16: Literatur zu Crowdfunding .............................................................................................................. 118 Tabelle 17: Ranking von Erfolgskriterien nach Likert-Skala ..................................................................... 121 Tabelle 18: Ranking der verwendeten Werbekanäle .................................................................................... 123 Tabelle 19: Ranking von Erfolgskriterien nach Durchschnittssummenscores/Likert-Skala ....... 128 Tabelle 20: weitere Erfolgskriterien für CF lt. Literatur .............................................................................. 129 Tabelle 21: Ranking der Medienkanäle/Best Practice GeoGebra, SIERRA ZULU, Data Dealer .... 131 Tabelle 22: Kreativbereiche der Interviewten ................................................................................................. 136 Tabelle 23: Beweggründe für Kooperationen .................................................................................................. 143 Tabelle 24: Ranking der genannten Finanzierungsquellen ........................................................................ 148 Tabelle 25: Erfahrung mit Förderstellen............................................................................................................ 153 Tabelle 26: Erfahrung mit anderen ...................................................................................................................... 153 Tabelle 27: Anwendung von Crowdfunding ..................................................................................................... 156 Tabelle 28: Voraussetzungen für Crowdfunding ............................................................................................ 157 Tabelle 29: Hemmnisse ............................................................................................................................................. 158 Tabelle 30: Hemmnisse Crowdfunding anzuwenden ................................................................................... 161 Tabelle 31: Unterstützungsbedarfe ...................................................................................................................... 162 Tabelle 32: Drei Gruppen.......................................................................................................................................... 172 Tabelle 33: Gegenüberstellung CF Voraussetzungen und Erfolgskriterien nach Harzer............... 185 Tabelle 34: Abgrenzung von Kreativwirtschaft nach ÖNACE 2008 ........................................................ 217 Tabelle 34: Jungunternehmerförderung ............................................................................................................ 224 Tabelle 35: ausgewählte Crowdfundingplattformen .................................................................................... 239
15
ABKUT RZUNGSVERZEICHNIS
afo Architekturforum Oberösterreich AICO Angel Investment Club Oberösterreich AplusB Akademiker plus Business Art. Article ASW Austrian Wirtschaftsservice AWO Außenwirtschaft Österreich ASRÄG Arbeitssozialrechtsänderungsgesetz BPP Best Practice Projekt BMUKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend CEE Vertriebsgebiet: Central and Eastern Europe (Mittel- und Osteuropäische Länder) CF Crowdfunding CI Crowdinvesting CIs Creative Industries; die UnternehmerInnen der Creative Industries CSR Corporate Social Responsibility COM European Commission cwa arge creativ wirtschaft austria D-A-CH Vertriebsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz DB Dienstgeberbeitrag (Lohnnebenkosten) DE Deutsch d.h. das heißt d.i. das ist DZ die Kammerumlage 2 (Lohnnebenkosten) dzt. derzeit EC European Commission EFRE Europäische Fonds für Regionale Entwicklung EGV Europäische Gemeinschafts- Vertrag EN English, Englisch ERP „European Recovery Program“ - Europäisches Wiederaufbau-Programm etc. et cetera EU Europäische Union/European Union evtl. eventuell FB Firmenbuch f.d. für die FFG Forschungsförderungsgesellschaft FH Fachhochschule FMA Finanzmarktaufsicht FSWE Verein zur Förderung des Sozial- und Wirtschaftslebens in Europa GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GSVG Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz IBB Investitionsbank Berlin IBB Bet Investitionsbank Berlin Beteiligungsgesellschaft ICCM International Centre for Culture and Management ICT Information and Communication Technology (Informations- und Kommunikationstechnologien) i.d. in den / in der idHv. in der Höhe von IHS Institut für Höhere Studien IUG Institut für Unternehmensgründung und –entwicklung an der JKU
16
iwS. im weiteren Sinn JCI Junior Chamber International JKU Johannes Kepler Universität Linz k.A. keine Angaben KEA KEA European Affairs KGG OÖ. Kreditgarantiegesellschaft KMU’s Klein- und Mittelunternehmen KU Kreativunternehmen/-er/-in KWU Kreativwirtschaftsunternehmen COIN Cooperation and Innovation KOM Europäische Kommission KU Kreativunternehmen/er/in KuKw Kultur- und Kreativwirtschaft MBI Management Buyin MBO Management Buyout Mikro klein/kleinst Mio. Millionen NACE statistische Klassifikation der ökonomischen Aktivitäten in der EU Neufög Neugründungsförderungsgesetz bzw. Neugründungsförderung No Number; o.g. oben genannt OÖ. Oberösterreich ÖNACE statistische Klassifikation der österreichischen ökonomischen Aktivitäten ORF Österreichischer Rundfunk OTELO Offenes Technologie Labor p.a. per anno/jährlich PCs Personal Computer RTR Rundfunk und Telekom Regulierungsbehörde SKE Soziale und kulturellen Einrichtungen (SKE) der austromechana SMEs small-to-medium sized enterprises sog. sogenannt/e TFEU Treaties of the European Union u.a.m. und andere mehr UBG OÖ. Unternehmensbeteiligungsgesellschaft u.g. unten genannten UK United Kingdom UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNIDO United Nations Industrial Development Organization URA Urheberrechtsabgabe US United States usw. und so weiter v.a. vor allem VC Venture Capital, Risikokapital/Wagniskapital vgl. vergleiche WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut WIFO Wirtschaftsforschungsinstitut WIP Wirtschaftsimpulsprogramm/-e WKOÖ Wirtschaftskammer Oberösterreich WWW World Wide Web XL X-large XS X-small z.B. zum Beispiel z.n. zitiert nach z.T. zum Teil
17
ABSTRACT
Untersucht wurde die Finanzierung der Creative Industries in OÖ aus Sicht von
KreativunternehmerInnen (KU) und ExpertInnen. Ein besonderer Fokus lag auf der neuen
Finanzierungsform des „Crowdfunding“. Im November 2012 wurden 25 KU (darunter 3 Start-
Ups und 7 bereits mehrere Jahre tätige KU) und 10 ExpertInnen in Form teilstrukturierter
Interviews befragt.
Hauptergebnisse:
• Rund 74 % der Kreativen nutzen Kooperationen zum Zweck der Ressourcenteilung, Arbeitsteilung, Finanzierung, gegenseitiger Befruchtung, und zum Wissenstransfer.
• 68 % nutzen aktuell Förderungen. • Erfahrungen mit Finanzierungsquellen sprechen die Beziehungsebene und das Vertrauen
der Kreativen an. • Haupthemmnisse der Kreativarbeit sind Kapitalmangel, Aufwand bei Förderungen,
Wissensmangel über Förderungen. • Die KU zeigen unterschiedliche Finanzierungsverhalten und Bedarfe. Es können grob drei
Gruppen unterschieden werden: "Einzelkämpfer", „Kleinstteams“ und „Teams mit Rechtsform (OG, GmbH, Verein)“.
• Hauptunterstützungsbedarfe bestehen in der Information zu Finanzierung, zu relevanten
Themen, in Weiterbildung, Vernetzung und Medienarbeit. • Crowdfunding ist den meisten KU grundsätzlich bekannt. Das Ausmaß der Information
darüber sowie die Einstellung dazu sind allerdings unterschiedlich. • Haupthemmnisse bei Crowdfunding sind der Mangel an geeigneten Projekten, nicht
Internet-affine Zielgruppen, zu kleiner Freundeskreis im „Netz“ und Mangel an Wissen über Crowdfunding. Genannte Voraussetzungen divergieren stark mit erforschten Erfolgsfaktoren.
• Gerade Ein-Personen-Unternehmen und Kleinstteams benötigen noch weitere
Informationen über Crowdfunding. Die Kleinstteams wünschen sich darüber hinaus insbesondere Hilfestellung bei der Evaluierung, ob ihr Projekt sich für Crowdfunding eignet, Workshops über die konkrete Gestaltung und Vorgehensweise von Crowdfunding-Projekten sowie personelle Unterstützung (für das Marketing) bei der Durchführung von Crowdfunding-Kampagnen. Austauschtreffen mit erfahrenen CrowdfunderInnen werden genannt. Die größeren KU räumen Crowdfunding wegen der geringen Projektsummen und des hohen Aufwandes eher wenig Bedeutung für sich ein.
• Aus Expertensicht ist erst noch der Boden für Crowdfunding aufzubereiten: Crowdfunding
muss erst noch bekannter gemacht werden. Ein Problem stellt aus ihrer Sicht eine teils geringe "Internettaffinität" der KU und der Financiers dar. Zusätzlich ist noch Wissen über „Campaigning“, Marketingstrategien und Kommunikation im Internet und in sozialen Netzwerken zu vermitteln.
18
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation:
Es lassen sich aufgrund der Bedarfe der KU eine Reihe von Ansatzpunkten als Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation ableiten, diese könnten in Form der u.g. Punkte umgesetzt werden.
• Eingehen auf Bedarfe der drei Gruppen, ungeachtet der Bereiche von Kreativwirtschaft
• Stärkung der bestehenden Kooperationen durch „Gemeinschaftslabors“, „Partnerbörsen“
• Anfachen der Kooperationsbereitschaft: Einladung zu regelmäßigem
Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche, mit Experten, Geschäftsführern und
Entwicklungsteams anderer Branchen, Vertretern von Best Practice in Vertrieb,
Marketing, Logistik, u.a. Themen, ausgerichtet nach den Bedarfen der Kreativen
• Koordination von gemeinsamen Förderanträgen
• Stärkung der Eigenleistung durch „Auftragsbörsen“, PR & Marketing, mediale
Berichterstattung in Internet, Radio und Fernsehen sowie Presse
• Informationsweitergabe zu Finanzierungsmöglichkeiten durch
Informationsveranstaltungen und zu Bewerbungen von Förderungen
• Weiterbildungsangebote bzw. deren Vermittlung nach Bedarfen der Kreativen
• Intensivierung des Beratungsangebotes: Steuerberatung, Plan- u. Kostenrechnung und
dgl. mehr
• Beratungs- und Informationsangebote bündeln (Effizienzsteigerung bei
Förderdatenbanken, Direktvergabe von Fördermitteln1)
Mehrwert der Arbeit:
Die vorliegende Arbeit gibt einen Gesamtüberblick über vorhandene Förderungen für die
Kreativwirtschaft in Oberösterreich, aktuelle Strukturdaten, einen Einblick in alternative
Finanzierungsquellen abseits von Förderungen und Krediten, einen Überblick über letzte
Forschungen im Bereich Crowdfunding/-investing samt Diskussion von Erfolgsfaktoren anhand
dreier Best Practice Beispiele, einen empirischen Einblick in die Kreativwirtschaft
Oberösterreichs betreffend die Finanzierung, Finanzierungshemmnisse und -bedarfe. Sie zeigt
den Bekanntheitsgrad von Crowdfunding, und die Hemmnisse bei dessen Anwendung.
1 durch Kaskadierung von Förderleistung bleiben Fördermittel in der Verwaltung gebunden;
19
1 EINLEITUNG
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst eine Einführung in die Thematik der Creative
Industries gegeben. In weiterer Folge werden Ausgangspunkt, Ziel und Methodik beschrieben.
Darauf folgt die Abgrenzung der Erhebungseinheiten. Kapitel 1.6 erklärt den Aufbau der Arbeit.
1.1 Einführung in die Thematik der Creative Industries
Wurde der Kreativwirtschaft in den 90er Jahren und weiter bis etwa 2003, erst in geringem
Ausmaß wirtschaftspolitische und wirtschaftswissenschaftliche Beachtung geschenkt, so gilt
dieser Wirtschaftsbereich neben dem der „Life-Sciences“2 nun EU-weit als Wachstumsbranche,
meinen Gavac et al. 3 . Das damals vermeintliche Desinteresse von Politik für die
Kreativwirtschaft mag daran liegen, dass dieser Sektor schwer greifbar, sprich die
Unternehmensgegenstände schwer oder kaum in die klassischen Unternehmensvorhaben
einzuordnen war. Viele der in der Kreativwirtschaft beschäftigten Personen waren sog.
Freelancer und „Neue Selbständige“, die erst durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz (ASRÄG)
1997 in Österreich unter das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (GSVG) nach Tomandl und
Fink et al.4 fielen, was ein wachsendes Interesse der Wirtschaftspolitik für die Kreativwirtschaft
vermuten lässt. Dieses Interesse ist durch die Veröffentlichung der Studie der Europäischen
Kommission Kultur, Kulturwirtschaft und Beschäftigung 19985 erstmals festzumachen, meint
Rammer,6 2003 war außerdem das Gründungsjahr der „creativ wirtschaft austria“7.
Neue Gewerbe wurden kreiert, die u.a. im Zuge der Informatisierung durch das World Wide Web
(WWW) entstanden. Dieser Entwicklung ist es auch zu verdanken, dass neue Businesskonzepte
reüssieren und Beachtung finden, und die Kreativwirtschaft als Hoffnungs-, weil
Wachstumsbranche, in der hohes wirtschaftliches Potential schlummert, von der Politik
wahrgenommen wird. Die hohe Varianz der Kreativwirtschaftsinhalte hat die Schwierigkeit
wissenschaftlicher Analysen zur Folge. Dieser Problematik begegnet der 4. Österreichische
2 Darunter sind zu verstehen: Biotechnologie, Gentechnik, Pharmazie und Bioinformatik.
3 (KMU-Forschung Austria 2003)
4 (Tomandl 1999, : 53) und (Fink, Riesenfelder und Tálos 2003) und (M. Fink, et al. 2006)
5 (Europäische Kommission, 1998)
6 (KMU-Forschung Austria 2008)
7 Die creativ wirtschaft austria ist eine Arbeitsgemeinschaft für die Kreativwirtschaft zum Zweck der Förderung der
„Kreativen“ sowie den im Kreativwirtschaftsbereich tätigen Unternehmen, Institutionen und Personen. Sie bietet eine
Plattform die helfen soll deren Potential für die Wirtschaft sichtbar und nutzbar zu machen. vgl. (KMU-Forschung
Austria 2003)
20
Kreativwirtschaftsbericht8. Es gibt in weiterer Folge erstmals, basierend auf dem definierten
Kreativwirtschaftsbegriff, der im 2. Kapitel kurz erläutert wird, aufbereitetes Zahlenmaterial.
Die statistischen Daten gehen auf die Berichtspflicht der UnternehmerInnen9 für 2011 zurück,
die im kürzlich erschienenen „Fünften Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht“ 10 für
Gesamtösterreich, bzw. in der Bereichs- und Potentialanalyse für Linz und Oberösterreich11
aufbereitet wurden. Diese arbeiten mit den sog. ÖNACE-Klassifizierungen12, die seit dem Jahr
200813 in abgeänderter Form von der Statistik Austria erhoben werden. 2010 gab die EU
Kommission das Grünbuch zur Erschließung des Potentials der Kultur- und Kreativindustrien
heraus, darin ist zu lesen: (Europäische Kommission 2012)
„ ... Die Kultur- und Kreativindustrien verfügen über viel Potential, das es auszuschöpfen gilt, um Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu muss die EU neue Quellen für intelligente, nachhaltige und integrative Wachstumsmotoren erschließen und in sie investieren. ...“14
Am 26. September 2012 gab die EU-Kommission die „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS
EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN“ heraus, mit dem Aufruf heraus, die
Kultur- und Kreativwirtschaft als Motor für Wachstum und Beschäftigung in der EU zu
unterstützen.15
Dieser Zielsetzung kommt auch Österreich mit seinen Förderungen nach, die im 0. Kapitel näher
erläutert werden.
8 (KMU-Forschung Austria, 2010)
9 Verpflichtende Berichterstattung von jährlichen Wirtschaftsdaten der Unternehmen an die Statistik Austria. vgl.
(Statistik Austria 2013)
10 (KMU-Forschung Austria, 2013)
11 (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012)
13 Alle österreichischen Unternehmen müssen für statistische Zwecke klassifiziert werden. Diese Zuordnung bildet die
Basis für die Erstellung von Wirtschafts- und Unternehmensstatistiken und wird im Unternehmensregister der
Statistik Austria gespeichert. Die Önace-Klassifikation 2003 wurde am 1.1.2008 mit der neuen Önace-Klassifikation
2008 abgelöst. Weitere Informationen siehe Anhang IV: Önace / Statistik Austria.
14 (Europäische Kommission, „Europa 2020...“, 2010)
15 vgl. (Europäische Kommission 2012)
21
1.2 Ausgangspunkt der Arbeit
Als Ausgangspunkt der Arbeit ist zum einen die Erkenntnis aus dem „Dritten Österreichischen
Kreativwirtschaftsbericht“ zu sehen, die als zweitgrößtes Hemmnis für Wirtschaftswachstum
der Kreativwirtschaft, das der Finanzierung sieht.16 Die Finanzierungslücke, das sog. „Early-
Stage-Gap“17 in der Unternehmensfrühphase, stellt eine besondere Problematik auch für
Kreativunternehmen dar. Ein zweites Argument für die Erarbeitung des Themas bildet die
Forschungslücke im Bereich Kreativwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf das Thema
Finanzierung und deren Hemmnisse. Lange Zeit wurde der Kreativwirtschaft zu wenig
Beachtung geschenkt. Zum einen, weil der Sektor Kreativwirtschaft inhaltlich sehr weit gefasst
ist, zum anderen weil sich einzelne Teilbranchen und interdisziplinäre Bereiche gerade erst
entwickeln. Ein drittes Argument liegt im vorhandenen Datenmaterial zu diesem Bereich. Erst
Studien der letzten Jahre erschließen den „neuen“ Wirtschaftszweig Kreativwirtschaft in seinen
Dimensionen. Ein Kernproblem dafür, welches nach wie vor besteht, liegt in der nicht
einheitlichen Definition von Kreativwirtschaft und länderspezifischen, aber auch regional
unterschiedlichen Ausprägungen. Für Crowdfunding, dem sehr jungen Finanzierungsthema gibt
es fast keine wissenschaftlichen Studien.
1.3 Ziel der Arbeit
Ziele dieser Arbeit bestehen darin, einerseits empirisch zu erforschen, wie Kreative in
Oberösterreich ihre Unternehmungen finanzieren, welche Finanzierungsquellen bekannt sind,
welche genutzt werden, ob es Besonderheiten gibt. Mögliche Finanzierungshemmnisse sowie die
Bedarfe der Kreativunternehmen (KU) sollen sichtbar gemacht werden. Um der Leserschaft
dafür den Einblick zu erleichtern, ist ein weiteres Ziel, die Kreativwirtschaft, insbesondere jene
Oberösterreichs, anhand von Strukturdaten darzustellen. Ziele bestehen andererseits darin, den
Fokus auf Crowdfunding als mögliche Finanzierungsalternative zu Förderungen und Krediten zu
legen. Dazu ist es notwendig, die für die Oberösterreichische Kreativwirtschaft offen stehenden
Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, sowie alternative Finanzierungsmöglichkeiten, die bereits
vorhanden sind, bzw. die gerade erprobt werden, wie z.B. Crowdfunding vorzustellen. Da sowohl
zu Oberösterreichs Kreativwirtschaft, als auch zu Crowdfunding wenig Literatur vorliegt, soll
diese Arbeit als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten zu diesen Themen dienen.
16 (KMU-Forschung Austria, 2008)
17 Als „Early-Stage-Gap“ wird die Finanzierungslücke in der frühen Unternehmensgründungsphase genannt.
22
1.4 Methodik der Arbeit
Zunächst wurde mittels Desktop-Recherche eine Literatur- und Dokumentenanalyse
durchgeführt. Explorative Experteninterviews dienten als Impuls für die Entwicklung des
Leitfades, aber auch zur Kontrastierung der Sichtweise der KreativunternehmerInnen (KU).
Daraus wurde ein teilstrukturierter Fragebogen entwickelt und KU in Oberösterreich befragt.
Die gewählte Form der Interviewbefragung hat nach Lamnek18 den Vorteil, dass die zu
befragenden Personen einem Interview zugänglicher sind als einer schriftlichen Befragung.
Nach Atteslander19 handelt es sich bei teilstrukturierten Befragungen um Gespräche, für die
Fragen vorbereitet und vorformuliert werden, die Abfolge der Fragen jedoch offen ist. Sich aus
dem Gespräch ergebende Themen können so aufgenommen und weiterverfolgt werden.20 Diese
Vorgangsweise lässt dem Interviewer die Freiheit, auf die Person gegenüber einzugehen, da
weder die Reihenfolge, noch die Formulierung verbindlich sind.21 Es wurden Bekanntheitsgrad,
Nutzung und Einschätzung unterschiedlicher Finanzierungsquellen erhoben. Besonderer Fokus
lag auf einer neuen Finanzierungsform, dem Crowdfunding. Zusätzlich wurden auch generelle
Unterstützungsbedarfe von KreativunternehmerInnen ermittelt. Dabei wurde sowohl die
Sichtweise von KreativunternehmerInnen als auch von ExpertInnen (Gründungshelfern iwS in
diesem Bereich) erhoben.
Für die Recherche von InterviewpartnerInnen aus der Kreativwirtschaftsszene wurden
einerseits im Schneeball-Verfahren Gespräche mit Szene-Insidern geführt, andererseits mittels
Desktop-Recherche Absolventen der Universitäten Kunstuniversität Linz, Johannes Kepler
Universität Linz, sowie der FH Hagenberg ermittelt. Das Schneeball-Verfahren funktioniert über
Personen, die keine „Schlüsselpositionen“ innehaben und daher nicht die Umweltbeziehungen
im Feld kontrollieren. Der/die Forscher/in fragt Personen, die er oder sie kennt, ob sie Personen
kennen, die bestimmte Kriterien für die Interviewteilnahme erfüllen.22 Diese Personen werden
nach Helfferich „kleine“ Gatekeeper genannt.23
Aus den Recherchen ergaben sich 25 Interviews mit KU, darunter waren 3 StartUps, weiters
wurden auch elf ExpertInnen befragt. Die Interviewdauer war durchschnittlich eine Stunde,
18 vgl. (Lamnek, 2005)
19 vgl. (Atteslander, 2003, S. 148)
20 vgl. (Atteslander, 2003, S. 148)
21 vgl. (Gläser & Laudel, 2009, S 42)
22 vgl. (Schnell, Hill und Esser 2005, S. 300) und (Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten 2005, S. 156)
23 (Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews 2011, 176)
23
zwei davon sehr kurz. Zusätzlich fanden weitere informelle Gespräche mit ExpertInnen und KU
bei Veranstaltungen, sowie am Telefon statt. Die Liste der interviewten ExpertInnen ist in
Anhang I: Liste der interviewten Experten, die der KreativunternehmerInnen in Anhang II: Liste
der interviewten Kreativen, angeführt.
Die Interviews mit den Kreativen wurden größtenteils via Skype, mit Videoübertragung,
durchgeführt. Der Interviewleitfaden ist im Anhang III beigefügt. Mit erfolgreichen
„Crowdfundern“ und Finanzierungsexperten fanden weitere Gespräche statt.
Mittels Desktop-Recherche wurde nach oberösterreichischen Crowdfundingprojekten gesucht.
Eine Auswertung vorhandener aktueller Studien wurde vorgenommen. Recherchierte
Gründungsförderprogramme, private Kapitalquellen und moderne Finanzierungsversuche
wurden deskriptiv dargestellt.
Zur weiteren Informationsgewinnung wurden drei Veranstaltungen in Linz besucht, der Open
Commons Kongress 2012, bei dem Crowdfunding eines der Themen darstellte, das Creative
Region Symposium zu Crowdfunding, sowie eine Veranstaltung der WKOÖ zu alternativen
Finanzierungsformen im November 2012. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurden
informelle Gespräche und Interviews geführt und Aussagen von Vortragenden aufgenommen.
24
Der Aufbau der Arbeit ist zweigeteilt. Einleitend erfolgt ein theoretischer Überblick,
anschließend werden die empirischen Erhebungen beschrieben und besprochen. Der Ablauf für
den theoretischen Überblick stellt sich wie folgt dar:
Abbildung 1: Ablauf theoretischer Überblick24
24 Eigendarstellung
Theoretischer Bezugsrahmen
und vorhandene
Finanzierungsangebote
Literatur/Studien Experteninterviews 3 Kongresse
Recherchen zu:
• Kreativwirtschaft
• Creative Industries
• Kulturwirtschaft
• Finanzierungsthemen
• Förderungen
• Private
Finanzierungsquellen
• Crowdfunding
• ...
Best Practice Beispiele
Crowdfunding
25
Der Ablauf der Befragungen kann wie folgt zusammengefasst werden:
Abbildung 2: Ablauf der Befragung25
25 Eigendarstellung
Literatur/Studien Experteninterviews 3 Kongresse
Fragebogen
teilstrukturiert, explorativ mit den
Themen:
• Tätigkeitsbereich
• Art der Finanzierung
• praktische Erfahrungen
• Wachstums- und
Finanzierungsziele
• Bekanntheit von
Crowdfunding
• Nutzung von
Crowdfunding
• Beweggründe
• Hemmnisse
• Bedarfe
Typen von Kreativunternehmen
gruppenspezifische Nutzung von Finanzierung,
Crowdfunding, spezifische Bedarfe
26
1.5 Abgrenzung der Erhebungseinheiten
Es wurden Kreative aus den Kreativwirtschaftsbereichen Mode, Design, PR, Musikwirtschaft,
Software insb. Spielesoftware, Architektur, Audio-Video und Film angesprochen. Dabei wurden
Personen aus dem Netzwerk des ICCM-Alumniclub26, der Absolventen aus Hagenberg sowie der
Kunstuniversität Linz, aus dem Netzwerk der Creative Region Linz und OÖ, des Clusters für
Design in OÖ und dem Architekturforum Linz ausgewählt und angeschrieben, aber auch nach
freier Recherche im Internet schriftlich kontaktiert.
Es wurde versucht, je drei InterviewpartnerInnen aus den Bereichen Architektur, Design,
Filmwirtschaft, Mode, Musikwirtschaft, PR, Software- insbesondere Spieleentwicklung zu
gewinnen. Bei den Recherchen stellte sich jedoch heraus, dass sehr stark die Bereiche PR,
Architektur und Design, jedoch sehr schwach die Spieleentwickler- und Modeszene
repräsentiert ist. Diese Tendenz spiegelte sich auch bei den durchgeführten Interviews wieder.
Eine Einstufung der vorgefundenen Kreativunternehmen in Einpersonenunternehmen,
Kleinstunternehmen (bis 10 MitarbeiterInnen) und Kleinunternehmen über 10
MitarbeiterInnen), wie das für Unternehmen in klassischen Branchen zutreffend ist, erschien
nicht zielführend. Oft stellte sich erst beim Interview heraus, in welchen Bereichen die Kreativen
aktuell arbeiten und dass die Zusammenarbeit mit anderen stark variiert. Stattdessen wurde
eine Gliederung in drei Gruppen vorgenommen, welche dem Wesen der Kreativen27 besser
Rechnung trägt. Diese drei Gruppen werden im empirischen Teil, im 4. Kapitel, näher erläutert.
1.6 Aufbau der Arbeit
Zunächst wird der theoretische Bezugsrahmen in Kapitel 2 abgesteckt. Dieser besteht aus der
Auseinandersetzung mit dem Begriff Creative Industries/Kreativwirtschaft. Anschließend wird
auf das vorhandenes Datenmaterial, die ökonomische Bedeutung und das Potential der Creative
Industries in Österreich bzw. Oberösterreich eingegangen.
Aktuelle Studienerkenntnisse werden aufbereitet und das Thema Finanzierung allgemein und
mit Fokus auf die Kreativwirtschaft betrachtet. Daran schließt eine Zusammenstellung von
ergreifbaren Finanzierungsquellen und Unterstützungsmaßnahmen. Crowdfunding wird
besprochen, sowie drei Best Practice Beispiele von erfolgreichen Crowdfunderin mit
Oberösterreich-Bezug vorgestellt. Im empirischen Teil der Arbeit, in Kapitel 3, werden die aus
26 der AbsolventInnenverein des International Center for Cultural Management (ICCM), einer Ausbildungsstätte für
KulturmanagerInnen auf Universitätsniveau
27 vgl. (Mavellia, 2010) und (UNIDO and UNESCO, 2005)
27
den Interviews erhobenen Aussagen strukturiert zusammengefasst. Im vierten Kapitel werden
diese Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Es wird insbesondere auf die Finanzierung, die
Hemmnisse und die Bedarfe eingegangen. Abschließend wird der zukünftiger Forschungsbedarf,
Kapitel 5, besprochen sowie ein Ausblick, Kapitel 6, gegeben.
29
2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN UND VORHANDENE
FINANZIERUNGSANGEBOTE
2.1 Definition Creative Industries (CI) / Kreativwirtschaft (KW)
Seit der Zweitausenderwende wird das Schlagwort Creative Industries sehr häufig verwendet.
Die Bezeichnung kommt aus dem Anglo-Amerikanischen Raum. CI werden in dieser Arbeit aber
aus einer europäischen Perspektive betrachtet, da ein Vergleich mit US-amerikanischen
Konzepten aufgrund der Komplexität den Rahmen sprengen würde, was für diese Arbeit als
wenig zielführend erachtet wird. Außerdem sind die Kulturbegriffe zu unterschiedlich, um
sinnvoll behandelt werden zu können. Darüber hinaus wäre eine vertiefte Auseinandersetzung
mit den Begriffen „Creative“ und „Kultur“ nötig, was nicht Hauptgegenstand dieser Arbeit ist und
deshalb auch nicht problematisiert wird. Towse28 sieht die Kreativwirtschaft als jenen
heterogenen Bereich der Wirtschaft, der Güter und Dienste mit künstlerisch-kreativem Inhalt
für ein Massenpublikum herstellt. 29 Die Autorin greift jedoch auf den österreichischen
„wirtschafts- und regionalpolitisch generierten Begriff“30 zurück und betrachtet das Phänomen
„Creative Industries“ aus einer praxisnahen Perspektive. Demnach besteht Österreichs
Kreativwirtschaft aus neun Bereichen:
• Architektur
• Design
• Musik, Buch und künstlerische Tätigkeit
• Radio und TV
• Software und Games
• Verlage
• Video und Film
• Werbung
• Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten31
Die creativ wirtschaft austria hat im Laufe der Auseinandersetzung mit der Thematik32 eine, die
Kernelemente aufgreifende Definition entwickelt:
28 (Towse 2003)
29 (Towse 2003) z.n. (Mayerhofer und Huber 2005, S. 1)
30 (KMU-Forschung Austria 2006, S. 28)
31 (KMU-Forschung Austria, 2010, S 40)
32 zunächst wurden die Kreativwirtschaftsbereiche nach Likus-System, seit 2008 nach ÖNACE-System zugeordnet; vgl.
dazu (KMU-Forschung Austria 2013), (KMU-Forschung Austria 2010), (KMU-Forschung Austria 2008), (KMU-Forschung
Austria 2006)
30
„Kreativwirtschaft umfasst demnach erwerbsorientierte Unternehmen, die sich mit der Schaffung, Produktion und/oder (medialen) Distribution von kreativen und kulturellen Gütern und Dienstleistungen beschäftigen.“33 Dieser Begriff zielt auf die Erwerbsorientierung ab. Daraus kann geschlossen werden, dass auch
jene Kreativen zugerechnet werden dürfen, die „nur“ ihren „angemessenen Lebensunterhalt“34
bestreiten wollen.
In dieser Arbeit werden die Teilbereiche Buch, Verlage und Bibliotheken, Museen sowie
botanische und zoologische Gärten auf Wunsch der Creative Region Linz & Upper Austria
ausgenommen.35 Aufgelistete Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten sind aber auch für
diese Bereiche durchaus relevant.
2.2 Vorhandenes Datenmaterial
Da erst ab 2008 statistische Daten im Rahmen einer neuen Klassifizierung36 erhoben werden,
gab es lange Zeit keine umfassende Zusammenführung von Wirtschaftsdaten in Bezug auf die
Kreativwirtschaft. Erstmals liegt mit dem Vierten und Fünften Österreichischen
Kreativwirtschaftsbericht, Datenmaterial aufbereitet vor, das Aufschluss über die ökonomische
Bedeutung, die betriebswirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen gibt, sowie
Bundesländer-spezifische Auswertungen anspricht. 37 38 Eine auf Oberösterreich bezogene
Bereichs- und Potentialanalyse 39 wurde Ende 2012 veröffentlicht. Die neusten, online
zugänglichen, Daten zu Önace 2008-Klassen wurden am 28.06.2013 von der Statistik Austria
erstellt40. Es handelt sich um die Gesamtösterreich-bezogene Leistungs- und Strukturstatistik
2011. Diese führt jedoch nicht alle Klassen, die die creativ wirtschaft austria für die
Kreativwirtschaft ausgemacht hat,41 an, wodurch ein Herleiten des Zahlenmaterials für 2011 nur
sehr eingeschränkt möglich ist.42 Darum kann größtenteils „nur“ auf die bereits veröffentlichten
33 (KMU-Forschung Austria, 2013, S 139)
34 sinngemäße Aussage von mehreren interviewten Kreativen
35 Die Creative Region Linz & Upper Austria hat als „quasi-Auftraggeberin“ ein Interesse am Ergebnis dieser Studie,
daher wurde dem Wunsch der Abgrenzung oben genannter Bereiche entsprochen.
36 „Önace 2008“, siehe Anhang IV: Önace / Statistik Austria
37 vgl. (KMU-Forschung Austria 2013)
38 vgl. (KMU-Forschung Austria 2010)
39 (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012)
40 vgl. (Statistik Austria 2013)
41 siehe dazu Anhang IV: Önace / Statistik Austria
42 Sonderauswertungen der Statistik Austria oder der KMU-Forschung sind kostenpflichtig und für diese Arbeit
budgetär nicht möglich.
31
Daten im Fünften Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht aus 2010 zurückgegriffen werden.
In dieser Arbeit wird erstmals Oberösterreichs Kreativwirtschaft in so detailliertem Ausmaß wie
möglich, in Zahlen festgehalten.
Der Problembereich bezüglich des vorhandenen Datenmaterials zur Kreativwirtschaft betrifft
zusammengefasst vier Punkte:
1. die Zuordnung der Tätigkeiten der Kreativen zu Önace Klassen43
2. nicht alle Önace-Klassen-Daten wurden veröffentlicht44
3. es sind kaum Daten in Bezug auf die Bundesländer vorhanden
4. das Alter der veröffentlichten Daten
Darüber hinaus werden Metadaten der Kulturfinanzierung45 im LIKUS-Schema46 festgehalten,
was auch problematisch ist wie die Statistik Austria festhält:
„Die eigentliche Schwierigkeit bei der Aufarbeitung besteht darin, die kulturbezogenen Ausgaben zu identifizieren und auf dem Aggregationsniveau der Voranschlagsansätze Zuordnungen zu den LIKUS-Feldern vorzunehmen, was vielfach nur schwerpunktmäßig möglich ist und ohne Zweifel einen Präzisionsverlust bedeutet.“47 Von diesen Einschränkungen ausgehend werden im folgenden Kapitel die ökonomische
Bedeutung und die Potentiale der Kreativwirtschaft in Oberösterreich aufgezeigt.
2.3 Ökonomische Bedeutung und Potentiale
Aus einer wirtschaftspolitischen Sicht betrachtet, ist die Bedeutung der Creative Industries in
ihrer Funktion von Kreativität und neuen Ideen als Produktionsfaktor in der
Informationsgesellschaft zu sehen.48 „Ähnlich wie technische Innovationen werden kreative
Schöpfungen (als Informationsgüter und –dienste) hier zu standortbildenden Inputfaktoren hoch
entwickelter Wissensgesellschaften“.49 Darüber hinaus haben Creative Industries eine enorme
Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit. So schreiben Florida50 und auch Howkins51 dem
kreativen Potential einer Region eine entscheidende Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit
neuer Aktivitäten bzw. ganzen Regionen zu.52
43 siehe Empirie Kapitel 3.2.1. Verteilung der Unternehmen nach Sparten
44 kostenlos
45 öffentliche Stellen verwenden dieses Schema für ihre Förder-Berichte
46 LIKUSkreativ-domains: cultural heritage, performing arts, audio & audiovisual, visual arts, books and press,
interdisciplinary, vgl. (KMU-Forschung Austria 2006, S. 34)
47 (Statistik Austria 2013 „Metadaten: Kulturfinanzierung“)
48 vgl. (Mayerhofer und Huber 2005)
49 (Mayerhofer und Huber 2005, S. 1)
50 (Florida 2002)
51 (Howkins 2001)
52 vgl. (Florida 2002) und (Howkins 2001) z.n. (Mayerhofer und Huber 2005, S. 1)
32
Die EU unternimmt große Anstrengungen, um innovative und kreative Potentiale in der
europäischen Wirtschaft zu heben und sieht dabei die Kreativwirtschaft als einen der
Wachstumsbereiche der nächsten Jahre. Das unterstreicht sie in Aussagen wie:
„Wenn die EU in dieser sich ständig verändernden globalisierten Umgebung wettbewerbsfähig bleiben will, muss sie die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit Kreativität und Innovation innerhalb einer neuen unternehmerischen Kultur florieren können.“53 „Durch ihre Schnittstellenposition zwischen Kunst, Wirtschaft und Technologie ist die Kultur- und Kreativwirtschaft dafür prädestiniert, Spillover-Effekte in andere Branchen anzustoßen. (...) Kultur und Kreativität üben auch eine unmittelbare Wirkung auf Sektoren wie den Tourismus aus und sind Bestandteil der gesamten Wertschöpfungskette anderer Sektoren, etwa der Mode- und Luxusgüterbranche, wo ihre Bedeutung als ‚Basiskapital’ immer weiter zunimmt.“54
Und aufgrund dieser Bemühungen und Aussagen wie dieser:
„Die Kultur- und Kreativindustrien verfügen über viel Potential, das es auszuschöpfen gilt, um Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu muss die EU neue Quellen für intelligente, nachhaltige und integrative Wachstumsmotoren erschließen und in sie investieren.“55
ist von einem gehörigen Wachstum der Kreativwirtschaft im Allgemeinen sowie in einzelnen
Teilbereichen auszugehen.
2.3.1 Österreichs Wirtschaft allgemein
Den aktuellen Konjunkturprognosen von IHS und WIFO nach wird sich Österreichs Wirtschaft
wie unten angeführt von 2012 bis 2014 positiv entwickeln:
Prognose WIFO 2012 2013 2014
Wachstum reales BIP 0,8 % 0.4 % 1,6 %
Warenexport real 0,2 % 1,8 % 5,5 %
Staatsdefizit (in % des BIP) -2,5 % -2,3 % -1,7 %
Prognose IHS
Wachstum reales BIP 0,8 % 0,6 % 1,8 %
Warenexport real 0.1 % 1,5 % 6,8 %
Staatsdefizit (in % des BIP) -2,5 % -2,2 % -1,5 %
lt. Statistik Austria real56 0,9 %
Tabelle 1: Konjunkturprognosen und -statistiken57
53 vgl. „Politische Leitlinien für die nächste Kommission“ von Kommissionspräsident Barroso; Volltext:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_DE.pdf (Kommissionspräsident Barroso
2009)
54 (Europäische Kommission 2012, S. 3)
55 vgl. Mitteilung der Kommission „Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum“, KOM(2010) 2020. - (Europäische Kommission 2010)
56 (Statistik Austria 2013, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
57 Quelle: (WKO, Konjunkturprognosen und –statistiken, 2013)
33
Da Oberösterreichs Wirtschaft mit diesem österreichweiten Trend immer mitzieht, kann von
einer positiven Konjunkturentwicklung auch in OÖ. ausgegangen werden. Die Bank Austria sieht
für 2012 eine spürbare Konjunkturabkühlung für Oberösterreich nach dem Wachstumstrend
von 2011. Wichtigster Motor für die Konjunktur in OÖ. ist die Industrie, die lt. Bank Austria
Creditanstalt 2012 40 % des Wachstums in OÖ. getragen hat.58 Diese Konjunkturdaten sind
deshalb im Kontext der Kreativwirtschaft relevant, da diese, vor allem was den Industriefilm, als
auch das Design anlangt, stark von den Aufträgen der Industrie abhängig ist.59 Das Wachstum
der Industrie lag im Jahr zuvor (2011) noch bei 7 %, hingegen wird es für 2012 mit 1,2 %
geschätzt. Die Prognose für das Wachstum der Industrie wird für 2013 auf etwa 1 % geschätzt,
was aber leicht über dem österreichischen Durchschnitt sein dürfte.60
Die Erwerbsquote der 15-64jährigen steigt seit 2010 und liegt in OÖ. bei 75,5 %, die
Arbeitslosenquote per 06/2013 liegt bei 2,9 % lt. Statistik Austria. 2010 lag sie noch bei 71,7 %
und die Arbeitslosenquote bei 4,4 %. Für Gesamtösterreich beträgt sie 72,5 %.61 Die
Beschäftigungsentwicklung wird voraussichtlich für das Jahr 2012 auf 1,3 % zurückfallen, im
Vergleich zum Jahr 2011, das 2,2 % Beschäftigung aufwies.62 Das Bruttoregionalprodukt pro
Kopf lag 2010 bei 33.800 Euro.63
Die Zahl der Unternehmensneugründungen stieg 2010 ebenfalls, die Neugründungsquote lag
österreichweit bei 6,5 %64. Den größten Anteil haben dabei Ein-Personen-Unternehmen, bzw.
Unternehmen ohne angestellte MitarbeiterInnen (50,2 %).65 Die Zahl der Neugründungen nach
Bundesländern ist im Schaubild s.u. dargestellt. OÖ. verzeichnet dabei einen
Unternehmensneugründungsanteil von 14,3 %.
58 vgl. (Bank Austria Member of UniCredit 2013, S. 15f)
59 vgl. (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012)
60 vgl. (Bank Austria Member of UniCredit 2013, S. 17)
61 vgl. (Statistik Austria 2013, http://statcube.at)
62 vgl. (Bank Austria Member of UniCredit 2013, S. 17)
63 (Statistik Austria 2013, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
64 vgl. (Statistik Austria 2013, Unternehmen, Arbeitsstätten)
65 vgl. (Statistik Austria 2012, Statistik zur Unternehmensdemographie)
34
Abbildung 3: Unternehmensneugründungen in OÖ. 2010
2.3.2 Creative Industries in Österreich
Das Bild Österreichs Kreativwirtschaft kann anhand des Datenmaterials in Anzahl an
Unternehmen, Beschäftigten, Umsatzerlöse, Bruttowertschöpfung und Bruttoinvestitionen
gezeichnet werden. Die folgende Tabelle zeigt diese Daten in acht Bereichen:
Bereich Unternehmen Beschäftigte gesamt
unselbständig Beschäftigte
Umsatzerlöse in € Mio.
Bruttowert-schöpfung zu Faktorkosten in € Mio.
Bruttoinves-titionen 2011 in 1.000 €
Architektur 5.535
(2011:5.491) 14.924 (2011:
15.027) 9.466 (2011:
9.618) 1561 (2011:
1.658) 790 (2011: 775) 35.929
Design 1.398 (2011:
1.484) 2.183 (2011:
2.318) 762 (2011: 815) 135 (2011: 152) 63 (2011: 67) 3.946 Musik, Buch und künstlerische Tätigkeit 11355 33532 21.537 3.529 1588 -
davon Tonstudios u. Musikverlage 2011: 631 1.067 410 103 (2011: 37) 5.705
Radio und TV 84 (2011: 83) 4.964 (2011:
5.020) 4.915 (2011:
4.970) 1.245 437 (2011: 489) 66.335
Radio 2011: 42 455 433 28 2.032
TV 2011: 41 4.565 4.537 461 64.303
Software un Games 8746 35667 27.899 4.594 2180 -
Verlage 969 9793 9.049 2.324 728 -
Video und Film 1721 5695 4.080 680 229 -
Werbung 8605 23713 15.409 4.164 983 - Kreativwirtschaft ges. 38.413 130.471 93.117 18.232 6.998 -
Tabelle 2: Struktur der Kreativwirtschaft nach Bereichen 2010/201166
Die Tabelle weist bereits Daten aus 2011 auf, jedoch nur für jene Bereiche, die eindeutig aus der
Önace 2008 ableitbar sind und auch öffentlich zur Verfügung stehen. Es zeigt sich, dass in den
Bereichen Architektur, Radio und TV und vor allem Design ein Anstieg sowohl bei der
66 Quelle: (KMU-Forschung Austria 2013, S. 28) und (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
35
MitarbeiterInnenzahl, als auch im Umsatz stattgefunden hat. Hingegen sind weniger
Architekturbüros und um ein Unternehmen weniger im Bereich Radio und TV zu verzeichnen.
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten hat sich gegenüber 2010 im Jahr 2011 bei Architektur
erniedrigt, im Bereich Design, Radio und TV hingegen erhöht. Die Zahl der unselbständig
Beschäftigten bei Radio und TV erscheint bemerkenswert hoch angesichts divergierender
Insider-Aussagen, die besagen, branchenspezifisch wäre eine hohe Anzahl an Selbständigen die
Regel, insbesondere sei ein „Abdrängen der MitarbeiterInnen in die Selbständigkeit der Trend“.67
In der Branche Architektur wäre es lt. Insidern ebenfalls üblich, viele selbständige Architekten
als Subauftragnehmer zu beschäftigen.68 Diese SubauftragnehmerInnen gehen ebenfalls nicht
aus der Kennziffer hervor.69
Anhand der Tabelle lässt sich außerdem ablesen, dass im Musik – bzw. allgemeinen
künstlerischen Bereich die größte Zahl an Unternehmen zu finden ist. An zweiter Stelle rangiert
der Bereich Software- und Games und gleich danach an dritter Stelle Werbeunternehmen.
Letztere beiden übertreffen bei weitem den ersten Bereich hinsichtlich Umsätze. Die höchste
Wertschöpfung generiert der Bereich Software- und Games, gefolgt von Musik- bzw.
künstlerischen Unternehmen. Die Zahl der Beschäftigten ist im Bereich Design am niedrigsten,
im Bereich Software- und Games am höchsten.
Der Anteil der Kreativwirtschaft an der Gesamtwirtschaft lag 2008 bei den Unternehmen bei
10 %, bei den Beschäftigten bei 4 %, bei den Umsatzerlösen bei 2,6 % und bei der
Bruttowertschöpfung bei 3,5 %.
Beachtenswert ist eine weitere Erhebung der Statistik Austria vom Mai/Juni 2010, für die
Unternehmen der österreichischen Kreativwirtschaft befragt wurden. Das Ergebnis zeigte, dass
was den Anteil der Vorleistungsbeziehenden unter den 22 Wirtschaftsbranchen betrifft, die
Kreativwirtschaft mit 20,2 % die zweitgrößte Branche darstellt. Davor rangiert
Unterhaltung/Kultur/Sport, danach Unterricht, Bekleidung.70 Die rund 20 % Vorleistung bzw.
Zukauf von Kreativleistungen bestehen nach dem Vierten Österreichischen
67 Aussage eines Kamera- und Tontechnikers, Subkontraktor des ORF, tätig seit 20 Jahren
68 vgl. (Tiefenböck 2013, Interview)
69 eine mögliche Erklärung wäre: erst ab einem Betrag von 10.000 Euro werden Selbständige in der Statistik
festgehalten; vgl. (Statistik Austria 2013, Strukturdaten) und (KMU-Forschung Austria 2013, Anhang)
70 vgl. ZEW-Befragung der Statistik Austria z.n. (KMU-Forschung Austria 2010, S. 60)
36
Kreativwirtschaftsbericht allerdings nur als Form der Zusammenarbeit zwischen den
Kreativen.71
Die Finanzierungsstruktur der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft in Prozent
des Gesamtkapitals wurde aus Daten von 2008/09 und 2010 von der KMU Forschung Austria
erhoben und zeigt folgende Unterschiede:
Kreativwirtschaft
2008/09
2010 Gesamtwirtschaft72
2008/09
2010
Eigenkapital 23,4 30,8 30,1 31,6
Sozialkapital 6,2 8,7 4,2 3,3
Passive Rechnungsabgrenzung 2,1 3,0 1,2 0,7
Langfristige Bankverbindlichkeiten 7,3 9,3 10,8 25,1
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 3,1 5,1
Kurzfristiges Fremdkapital 57,9 48,1 48,5 39,3
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 9,2 10,7
Erhaltene Anzahlungen 5,2 4,5
Lieferverbindlichkeiten 11,0 8,5
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 32,6 24,8
Summe Aktiva 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabelle 3: Finanzierungsstruktur der Kreativwirtschaft zur Gesamtwirtschaft 2008/0973 u. 201074
Die o.a. Tabelle weist einen niedrigeren Eigenkapitalanteil von 23,4 % für die Kreativwirtschaft
im Vergleich zur Gesamtwirtschaft von 30,1 % im Jahr 2008/09 aus. Hingegen ist der Anteil des
Sozialkapitals um 2 % höher. 2010 liegt die Eigenkapitalquote bereits bei 30,8 und das
Sozialkapital ist ebenfalls gestiegen. Die Kreativwirtschaft bedient sich im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft eines höheren kurzfristigen Fremdkapitalanteils, der aber 2010 stark
zurückgegangen ist. Die Gesamtwirtschaft hat den Anteil an langfristigen Bankverbindlichkeiten
stark erhöht, bei der Kreativwirtschaft ist er nur moderat gestiegen.
Die Eigenkapitalquote der Kreativwirtschaft nach Bereichen lag 2008/09 bei Architektur bei
21,2 %, bei Design bei 10,3 %, bei Musik/Buch/künstlerischer Tätigkeit bei 14 %, bei Software &
Games bei 24,9 %, Verlagen bei 26,2 %, Video & Film bei 23,1 % und bei Werbung bei 25,4 %.75
71 vgl. (KMU-Forschung Austria 2010, S. 60)
72 exkl. Realitätenwesen und Holdings
73 Quelle: (KMU-Forschung Austria 2010, S. 91) Bilanzdantenbank
74 vgl. (KMU-Forschung Austria 2013, S. 35)
75 vgl. (KMU-Forschung Austria 2010, S. 93)
37
2.3.3 Creative Industries in Oberösterreich
Dem Fünften Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht ist zu entnehmen, dass gemessen an
anderen Bundesländern Oberösterreich 201076:
• die vierthöchste Zahl (3.848) an Unternehmen in der Kreativwirtschaft,77
• die zweithöchste Zahl (15.162) an Beschäftigten in der Branche,78
• die zweithöchste Zahl (11.516) an unselbständigen Beschäftigten,79
• die zweithöchst Zahl (1.683 Mio. Euro) an Umsatzerlösen
hatte, und die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten ebenfalls mit 751 Mio. Euro die
zweithöchste war. Nicht ungewöhnlich ist, dass die Bundeshauptstadt die höchsten Kennzahlen,
die Kreativwirtschaft betreffend, aufwies80. Gerechnet nach der Zahl der Unternehmen, lag
Oberösterreich an vierter Stelle nach Wien, Niederösterreich und der Steiermark, was im
Vergleich zur Beschäftigtenzahl einen interessanten Aspekt darstellt. Oberösterreich hatte
schlussfolgernd mehr Beschäftigte pro Unternehmen vorzuweisen. Im Zeitraum 2008 bis 2010
stieg der Anteil an Oberösterreichs Kreativunternehmen um 6,4 %.81
Die Zahl der unselbständigen Beschäftigten war ebenfalls sehr hoch verglichen mit anderen
Bundesländern und zeigt im Vergleich mit der Gesamtbeschäftigtenanzahl einen sehr hohen
Anteil.
76 (KMU-Forschung Austria 2013, S. 56f) z.n. KMU Forschung Austria und Statistik Austria
77 nach Wien, Niederösterreich, Steiermark
78 nach Wien, vor Niederösterreich und Steiermark
79 nach Wien
80 vgl. (KMU-Forschung Austria 2013, S. 56) z.n. (Power und Nielsen 2010)
81 (KMU-Forschung Austria 2013, S. 58)
38
Die unten stehende Tabelle gibt den Bundesländerüberblick nochmals wieder:
Bundes-land
Unter-nehmen
Beschäf-tigte gesamt
Unselb-ständig Beschäf-tigte
Selbst. Beschäf-tigte*82
%-Anteil Unselbst. zu Gesamt-beschäf-tigungs-zahl*
UE in Mio. Euro
UE pro Beschäf-tigteRm im Durch-schnitt i.T.*
UE pro selbst. Beschäf-tigtem im Durch-schnitt i.T.*
Bruttowert-schöpfung zu Faktorkosten in Euro
Bgld. 746 2.101 1.366 735 65,02 203 96.621 276.190 90
Krnt. 1.560 4.544 3.048 1.496 67,08 478 105.194 319.519 219
NÖ. 5.571 15.063 9.617 5.446 63,85 1.576 104.627 289.387 653
OÖ. 3.848 15.162 11.516 3.646 75,95 1.683 111.001 461.602 751
Szbgl. 2.425 7.814 5.403 2.411 69,15 841 107.627 348.818 359
Stmk. 3.911 12.930 8.976 3.954 69,42 1.280 98.995 323.723 583
Tirol 2.887 8.060 5.089 2.971 63,14 842 104.467 283.406 374
Vlbg. 1.352 4.165 2.798 1.367 67,18 484 116.206 354.060 200
Wien 16.113 60.632 45.304 15.328 74,72 10.845 178.866 707.529 3769
Österreich ges.
38.413 130.471 93.117 37.354 71,37 18.232 139.740 488.087 6.998
Tabelle 4: Struktur der Kreativwirtschaft im Bundesländervergleich 20108384
Interessant ist auch, dass nach eigener Berechnung der Prozentanteil an unselbständig
Beschäftigten in Oberösterreich am höchsten ist und bei fast 76 % liegt. Die Beschäftigten
(gesamt) erwirtschaften einen durchschnittlichen Umsatz von rund 111.000 Euro pro Person,
und nach dieser Berechnung liegt Oberösterreich an dritter Stelle. Weitere eigene Berechnungen
wurden hinsichtlich der Zahl der Selbständigen, dem Prozentanteil der unselbständig
Beschäftigten, der durchschnittlichen Umsatzerlöse pro Beschäftigte, sowie pro selbständig
Beschäftigten zum Vergleich angestellt. Das Ergebnis zeigt weit höhere durchschnittliche
Umsatzwerte, als Kreativunternehmen in Studien85 als Unternehmensumsätze angeben. Eine
mögliche Erklärung wäre, dass es wenige Unternehmen gibt, die sehr hohe Umsätze machen und
sehr viele Kreativwirtschaftsunternehmen gibt, die relativ geringe Umsätze erwirtschaften.
Vergleicht man mit soeben genannte Zahlen über die Kreativwirtschaft, die vorhergehenden
Daten zur Erwerbsquote und unterstellt, wie in einigen Studien86 festgestellt wurde, dass
82 * Eigenberechnung
83 Quelle: KMU-Forschung, Statistik Austria in: (KMU-Forschung Austria 2013)
84 die leicht grün gefärbten Spalten wurden von der Autorin hinzugefügt
85 vgl. (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012)
86 vgl. (KMU-Forschung Austria 2010) und (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012)
39
steigende Umsätze, höhere Personalkosten verursachen, so lässt sich daraus eine Prognose für
die Entwicklung in den Jahren seit 2010 konstruieren. Auszugehen ist daher von höheren
Umsätzen und höheren Beschäftigtenzahlen auch in der Kreativwirtschaft Oberösterreichs. Dazu
im Vergleich das Ergebnis der Befragung von rund 100 Kreativunternehmen in OÖ. anlässlich
der Bereichs- und Potentialanalyse 2012: rund 43 % rechneten in den kommenden 12 Monaten
mit steigenden Umsätzen, 38 % erwarteten keine Veränderung und 19 % gingen von sinkenden
Gesamtumsätzen aus.87 Die Erwartung der Kreativen fiel zu 80 % für eine gleichbleibende
MitarbeiterInnenzahl aus, 15 % erwarteten eine Steigerung, 5 % einen Rückgang. 68 % der
Befragten erwirtschaftete 2012 Gewinne.88
Das kreative Schaffen, gekoppelt an andere Wirtschaftsbereiche, ist in den
Ballungszentren am höchsten. Wie in der nebenstehenden Abbildung in
Rot gezeigt, sind das die Gebiete von Linz, Wels, Steyr, Urfahr-Umgebung
und Linz-Land.89
Abbildung 4: Kreativ-Ballungszentren in OÖ.90
Der Anteil der Kreativwirtschaft in OÖ. gemessen an der marktorientierten Wirtschaft lag in
Gebieten mit hohem Urbanisierungsgrad bei 10,6 %, mit mittlerem Grad bei 6,6 % und bei
niedrigem Urbanisierungsgrad bei 4,4 %. Der Durchschnittswert für Österreich gesamt, ohne
Wien, lag bei 11,4 % bei hohem, 7,8 % bei mittlerem, und 4,8 % bei niedrigem
Urbanisierungsgrad.91
Die Verteilung der Kreativwirtschaftsunternehmen in die zugehörigen Bereiche darzustellen, ist
für Oberösterreich schwierig, da kaum Datenmaterial frei zur Verfügung steht. In der Bereichs-
und Potentialanalyse der Kreativwirtschaft Linz und Oberösterreich92 von 2012 wurden 104
Unternehmen befragt.
87 vgl. (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012, S. 11)
88 vgl. (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012, S. 11)
89 vgl. (KMU-Forschung Austria 2013, S. 70)
90 vgl. (KMU-Forschung Austria 2013, S. 70)
91 vgl. (KMU-Forschung Austria 2013, S. 70)
92 (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012)
40
Von diesen 104 Unternehmen waren den Bereichen:
• 29 % der Musik, Buch und künstlerischer Tätigkeit
• 25 % dem Bereich Werbung
• 23 % dem Bereich Software & Games sowie
• 14 % dem Bereich Architektur
• und 9 % sonstige (Design, Film & Video, TV & Radio, sowie Verlage)
zuzuordnen.93 Allerdings handelt es sich bei dieser Erhebung um eine Stichprobe.
Die unten angeführte Grafik zeigt eine Auswertung von 2009 über Daten der
Kreativwirtschaftsunternehmen aus den Jahren 2005 bis 2008. Dabei ist zu beachten, dass die
Branchenabgrenzung nach einem deutschen Forschungsbericht vorgenommen wurde.94
Abbildung 5: Branchenverteilung der KWU (Durchschnitt 2005-2008)95
Die Grafik zeigt den sehr hohen Anteil an Architektur im Vergleich zu anderen Bereichen. Der
Handel mit Kulturgütern ist extra angegeben, nach Branchenverteilung der creativ wirtschaft
austria ist er eine Subkategorie im Bereich Musik, Buch & künstlerische Tätigkeit.
Ein paar Tage vor Beendigung dieser Arbeit wurden Strukturdaten aus 2011 von der Statistik
Austria veröffentlicht. Diese beziehen sich auf die ÖNACE-2008-Klassen, und es können erstmals
detailliertere Datenauswertungen zu Oberösterreichs Kreativwirtschaft im Überblick
präsentiert werden. Diese wurden anhand der von der creativ wirtschaft austria abgeleiteten
ÖNACE-Klassen die Kreativwirtschaft betreffend, abgeleitet.
93 vgl. (KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen 2012, S. 61)
94 vgl. (Amann 2009, S. 23)
95 Quelle: AMS-Datawarehouse, ÖNACE 2008, 4-stellig (Dienstgeberkonten & Erwerbskarrierenmonitoring 2005-08)
in: (Amann 2009, S. 23) Restriktion: Branchenabgrenzung wurde nach deutschem Modell vorgenommen
0 10 20 30 40
Tonträgerindustrie 0,62%
Rundfunkwirtschaft 0,79 %
Bibliotheken/Museen 1,07 %
Design 1,62 %
Filmwirtschaft 2,62 %
Verlagsgewerbe 3,06 %
Kulturelle Wirtschaftsweige 3,42 %
Handel mit Kulturgütern 11,02 %
Werbung 19,37 %
Software/Games 19,79 %
Architektur 36,61 %
Datenreihen1
41
Beginnend mit der Anzahl an Unternehmen je Bereich ergibt sich folgendes Zahlenbild:
Bereich* 2009 2010 2011
Zahl der Unternehmen gesamt 0-9 MA gesamt 0-9 MA Gesamt 0-9 MA
Architektur 529 498 556 522 550 517
Design 133 132 143 142 155 154
Radio & TV 10 8 12 10 12 9
Radios 4 3 5 4 5 4
TV 6 5 7 6 7 5
Software & Games 888 792 933 839 995 888
Verlage 68 52 66 50 68 50
Video & Film 144 135 146 136 142 133
Werbung (nur ÖNACE 73120) 20 17 17 14 16 14
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit
Tonstudios 53 53 58 58 60 60
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT 1845 1687 1931 1771 1998 1825
Tabelle 5: Anzahl KU je Bereich in OÖ. 9697
Da der Anteil an Unternehmen mit null bis neun MitarbeiterInnen am größten ist, werden auch
diese Zahlen angeführt. Im Verlauf dieser drei Jahre ist erkennbar, dass die Zahl der
Unternehmen im Bereich Architektur schwankt, ebenfalls im Bereich Verlage und Video & Film
Bereich. Im Bereich Design, sowie im Teilbereich Tonstudios, zugehörig dem Bereich Musik,
Buch & künstlerische Tätigkeit, ist die Anzahl an Unternehmen steigend. Der Bereich Werbung
verweist nur auf eine Unterklasse, die veröffentlicht ist, der Bereich Bibliotheken, Museen sowie
botanische und zoologische Gärten ist von der Betrachtung ausgenommen worden.
96 Eigenberechnung, Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
97 die einzelnen Bereiche wurden grundsätzlich addiert; rot: unvollständiges Datenmaterial, grau: Unterbereich der
Klasse
42
Der Bereich Radio & TV wurde in seine zwei Unterklassen differenziert dargestellt, da diese
unterschiedliche Entwicklungstendenzen aufweisen.
Zahl der Beschäftigten
Bereich 2009 2010 2011
Architektur 1748 1792 1816
Design G G G
Radio & TV 107 106 121
Radios 62 57 62
TV 45 49 59
Software & Games 5567 5343 5933
Verlage 767 898 963
Video & Film* 466 452 479
Werbung (nur ÖNACE 73120) 242 254 222
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit ka ka Ka
Tonstudios 106 112 109
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT 9003 8957 9643
Tabelle 6: Zahl der Beschäftigten in OÖ. KU9899
Die o.g. Tabelle führt die Zahl der Beschäftigten je Bereich an. Wo Daten gesichert vorhanden
sind, sind diese schwarz, rote Zahlen sind aufgrund von Restriktionen ungenau oder
unvollständig. Es kann jedoch gesagt werden, dass die Zahl der Beschäftigten im Bereich
Architektur seit 2009 im Steigen begriffen ist, ebenso im Bereich Video & Film sowie im
Teilbereich TV.
98 Eigenberechnung, Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
99 * kein Datenschutz erforderlich im Jahr 2011; G: Datenschutz kommt zur Anwendung für < 3 Unternehmen; ka:
keine Angaben/Daten fehlen
43
In anderen Bereichen fluktuiert die Zahl der Beschäftigten, oder es sind ungenügende Daten
vorhanden.
Zahl der unselbständig Beschäftigten
Bereich 2009 2010 2011
Architektur 1256 1276 1312
Design G G G
Radio & TV 101 98 121
Radios 61 55 62
TV 40 43 59
Software & Games G 4537 5042
Verlage G G G
Video & Film 346 G 355
Werbung ka ka 2048
73120 228 239 222
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit ka ka Ka
Tonstudios 46 45 39
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT G G G
Tabelle 7: Zahl der unselbständig Beschäftigten in OÖ. KU100
Die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Bereich Architektur ist im Steigen begriffen, in
Verbindung mit der sinkenden Zahl an Unternehmen kann interpretiert werden, dass
Architekturbüros strukturell wachsen. Der Teilbereich TV zeigt ebenfalls ein Ansteigen der Zahl
der unselbständig Beschäftigten. Andere Bereich zeigen Schwankungen oder es kann keine
Aussage darüber gemacht werden.
100 Eigenberechnung, Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
44
Im Umkehrschluss die Zahl der selbständig Beschäftigten je Bereich betrachtet wurden folgende
Daten berechnet:
Zahl der Selbständigen (inkl. Neue Selbständige, UnternehmerInnen)
Bereich 2009 2010 2011
Architektur 492 516 504
Design G G G
Radio & TV 6 8 0
Radios 1 2 0
TV 5 6 0
Software & Games G 806 891
Verlage G G G
Video & Film 120 G 124
Werbung ka ka Ka
73120 14 15 0
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit ka ka Ka
Tonstudios 60 67 70
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT G G G
Tabelle 8: Zahl der selbständig Beschäftigten in OÖ. KU101
Die o.g. Zahlen bezüglich selbständig Beschäftigter zeigen im Bereich Architektur ein Sinken.
Keine selbständig Beschäftigten werden im Bereich Radio & TV ausgewiesen, weder bei Radio,
noch TV. Das kann möglicherweise darin begründet sein, dass nur Unternehmen mit mehr als
10.000 Euro Umsatz in die Statistik aufgenommen wurden, oder schlicht alle Beschäftigten in ein
Dienstverhältnis umgewandelt wurden, oder keine selbständig Beschäftigten benötigt wurden.
Der Bereich Video & Film zeigt im Jahr 2011 eine höhere Zahl an selbständig Beschäftigten als
im Jahr 2009. Der Teilbereich Tonstudios verweist auf steigende selbständig
Beschäftigtenzahlen.
101 Eigenberechnung; Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
45
Umsatzerlöse i.T. €
Bereich 2009 2010 2011
Architektur 174.353 176.274 191.622
Design G G G
Radio & TV 17.162 17.024 16.722
Radios 8.173 7.204 7.584
TV 8.989 9.820 9.138
Software & Games G 556.463 658.475
Verlage G G G
Video & Film 40.245 G 39.820
Werbung (nur ÖNACE 73120) Ka ka 381.459
73120 66.835 66.033 68121
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit
Tonstudios 4.212 3.900 4.857
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT G G G
Tabelle 9: Umsatzerlöse OÖ. KU102
Die Umsätze der Architekturbüros stiegen in den Jahren 2009 bis 2011, was mit der steigenden
Beschäftigtenzahl korrespondiert. Hingegen im Bereich Radio & TV sind Schwankungen
erkennbar. Der Trend bei Software & Games kann ein Ansteigen sein, aber auch eine
Schwankung. Umgekehrt bei Video & Film liegt entweder ein Schwanken, oder ein Sinken vor.
Der Teilbereich Tonstudios zeigt ein Schwanken, insgesamt aber einen Anstieg.
Investitionen i.T. €
Bereich 2009 2010 2011
Architektur 3.778 4.660 3.752
Design G G G
Radio & TV 1.396 1.384 1.402
Radios 198 187 247
TV 1.198 1.197 1.155
Software & Games G 13.588 15.914
Verlage G G G
Video & Film 813 G 7.208
Werbung (nur ÖNACE 73120) 899 1.328 1.598
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit ka Ka ka
Tonstudios 119 189 212
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT G G G
Tabelle 10: Investitionen OÖ. KU103
102 Eigenberechnung; Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
46
Obige Tabelle zeigt die Investitionen, die Oberösterreichs Kreativunternehmen in den Jahren
2009 bis 2011 tätigten. Konkret schwankten die Investitionsbeträge im Bereich Architektur.
Ebenso im Bereich Radio & TV, wobei sie im Teilbereich TV sanken, im Teilbereich Radios
schwankten. Im Bereich Video & Film ist ein enormer Anstieg 2011 im Vergleich zum Jahr 2009
zu sehen. Im Teilbereich Werbung stiegen die Investitionen kontinuierlich, ebenso im
Teilbereich Tonstudios. Im Bereich Software & Games ist innerhalb der Klassen ein Unterschied
zu beobachten104, im Teilbereich Beratung sanken die Investitionen, im Teilbereich sonstige IT-
Dienstleistungen stiegen sie an. Ebenfalls sehr große Unterschiede dürften in den Teilklassen im
Bereich Video & Film vorliegen. In der Klasse 5914 – Kinos, ist ein extrem hoher Anstieg105 an
Investitionen von Jahr zu Jahr zu bemerken.
103 Eigenberechnung; Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten)
104 das Anführen aller Teilbereiche würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen
105 2009/458, 2010/1.524, 2011/8.685, jeweils in Tausend Euro
47
Abschließend wird ein Blick auf die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten der einzelnen
Bereiche der Kreativwirtschaft in OÖ. geworfen. Diese hat sich in den Jahren 2009 bis 2011 wie
folgt entwickelt:
Bruttowertschöpfung i.T. €
Bereich 2009 2010 2011
Architektur 99.618 98.895 97.106
Design G G G
Radio & TV 6.768 7.520 7.589
Radios 3.470 3.148 3.757
TV 3.298 4.372 3.832
Software & Games G G G
Programmierleistungen 257.448 207.651 243.526
so. IT-Dienstleistungen 21.404 27.561 42.425
Verlage G G G
Video & Film 15.362 G 15.991
5911 6.016 4.577 6.286
5912 74 G 165
5913 1.169 G 855
5914 8.103 7.719 8.685
Werbung ka Ka 106.409
73120 15.902 17.634 9.025
73111 ka Ka 84.795
73112 ka Ka 12.589
Musik, Buch & künstl. Tätigkeit ka Ka Ka
Tonstudios 1.570 1.342 1.904
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten
GESAMT G G G
Tabelle 11: Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten von OÖ. KU106
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, wie sie obige Tabelle ausweist, war in den Bereichen
Architektur und sonstige IT-Dienstleistungen (Teilbereich) im Steigen begriffen. In allen
anderen Bereichen schwankte sie, oder es kann gar keine Interpretation aufgrund fehlender
Daten angestellt werden.
106 Eigenberechnung; Datenquelle: (Statistik Austria 2013, Strukturdaten) und Sonderauswertung Fünfsteller (Statistik
Austria 2013)
48
Anteil an EU-geförderten Projekten
In Bezug auf EU-geförderte Projekte in Österreich, ist der OÖ. Anteil bei Kultur- und
Kreativwirtschaft ebenfalls sehr hoch und machte im Beobachtungszeitraum 2007 bis 2010 im
Bereich Kunst & Kultur fast 78 % oder 60 Projekte aus, und über 22 %, das sind 17 EU-
geförderte Projekte fallen auf die Kreativwirtschaft.107
107 (Ratzenböck, Kopf und Lungstraß 2011, S. 119)
49
2.4 Finanzierung
Das Thema Finanzierung kann aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden. Aus der
Perspektive des Unternehmens unterscheidet man, ob Finanzmittel von „Innen“ oder von
„Außen“ dem Unternehmen zugeführt werden. Der Blick auf die Art des Kapitals,
„Betriebseigenes“ oder „Fremdes“, ist sowohl für den Unternehmer, als auch für den
Kapitalgeber von Interesse, denn mit der Art des Kapitals gehen Rechte und Pflichten einher, die
Finanzierungsentscheidungen erheblich mitbestimmen. Bei Fremdkapital wird nicht an der
Wertsteigerung des Unternehmens partizipiert, bei der Finanzierung von außen in Form von
Eigenkapital jedoch schon. Dies gilt es bei der Zusammenstellung des individuell optimalen
Finanzierungsmix zu beachten. Aus der Perspektive, wer Finanz- oder Sachmittel ins
Unternehmen einbringen kann, wird fortfolgend zwischen öffentlichen Förderangeboten,
Förderungen durch Interessensgruppen und Vereine, Finanzmittel von nicht öffentlicher Seite
und kreative Finanzierungsquellen unterschieden.
2.4.1 Allgemein
Für die Mehrzahl der in der Kreativwirtschaft Tätigen sind Finanzmittel nur in eingeschränktem
Maße zugänglich, das gilt vor allem bei der Gründung. Eigenkapital, besonders jenes, das der/die
Gründer/in selbst einbringt, ist zumeist zu wenig für benötigte Investitionen. Solch eine
Situation, in der nur ein geringes Budget vorhanden ist, und in der der/die GründerIn sich
mittels eigener Arbeitskraft selbstfinanzieren muss, wird auch als Self-Feeding-Ansatz
bezeichnet. Eine Aufnahme von Fremdkapital ist zumeist keine Alternative dazu, da für
bankübliche Sicherheiten keine oder nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.108 Mittel,
die nach einer Studie für die europäische Kreativwirtschaft109 typischerweise zur Verfügung
stehen, stellt das folgende Diagramm in
Abbildung 6, dar. Dieses wurde ergänzt um die Crowdfunding-Varianten.
108 vgl. (Volkmann, Tokarski, & Grünhagen 2010, S. 295)
109 Es wurde eine Untersuchung in Frankreich, Deutschland, Irland, Großbritannien und Niederlande durchgeführt.
50
Abbildung 6: Finanzierungsquellen der Kultur- und Kreativwirtschaft110111
Generell gilt dieses Schaubild auch für Österreich mit der Einschränkung, dass steuerliche
Vergünstigungen in geringerem Ausmaß oder aber auch gar nicht gewährt werden. Die
steuerliche Spendenabsetzbarkeit112113 ist taxativ auf bestimmte Institutionen beschränkt, in der
Mehrzahl handelt es sich um mildtätige oder soziale Vereine wie Rotes Kreuz oder Caritas und
ist als Steuerbegünstigung für die Kreativwirtschaft nur relevant, wenn es sich um ein Museum
handelt oder beispielsweise einen Verein, der wissenschaftlich tätig ist.114
110 Quelle: (KEA European Affairs 2010)110, erweitert um CF, CI
111 lt. UNESCO belaufen sich die Spenden auf insgesamt 4 Mio. Euro, davon sind 1 % für die Kulturfinanzierung lt.
Spendenbericht 2010 des Fundraising Verband Austria. vgl. (Fundraising Verband Austria 2010)
112 „Abzugsfähig sind Spenden an Einrichtungen, die im Gesetz (§ 4a Abs. 3 Z 1 bis 3, Abs. 4 und Abs. 6 EStG) ausdrücklich
aufgezählt werden und an Einrichtungen, die zum Zeitpunkt der Spende über einen gültigen
Spendenbegünstigungsbescheid verfügen und daher in der Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen auf der Website
des BMF ohne Gültigkeitsende aufscheinen.“ (BMF 2013, Liste der begünstigten Spendenempfänger)
113 „Eine Spende ist eine freiwillige monetäre oder nichtmonetäre Leistung an Dritte, der keine direkte Gegenleistung
gegenüber steht.“ (Gerlach-March, 2010, S. 60)
114 Liste der begünstigten Spendenempfänger vgl. (BMF 2013, Liste der begünstigten Spendenempfänger)
Indirekte Unterstützung
51
Die steuerliche Begünstigung für Sponsorenleistungen ist in Österreich auch eingeschränkt.
Obwohl viele Kreative ihre Aufträge durch Kulturprojekte sichern, der Aufwand für
Kultursponsoring wird jährlich auf ca. 40 Mio Euro geschätzt, wurde der „Sponsoringerlass“ von
1987 115 noch nicht zugunsten der Kreativwirtschaft geändert. Der Sponsorenerlass des
Finanzministeriums vom Mai 1987 und das Bundes-Kunstförderungsgesetzt 1988 definieren,
unter welchen Voraussetzungen Sponsorenleistungen für kulturelle Veranstaltungen „ein für den
Abzug als Betriebsausgaben ausreichender Werbeeffekt zukommt“.116 Eine Abzugsfähigkeit für die
Sponsorenzahlung ist für das jeweilige Unternehmen nur dann möglich, wenn über das
Sponsoring in Massenmedien redaktionell berichtet oder durch kommerzielle Firmenwerbung
wie Inserate und Plakate eine große Öffentlichkeit informiert wird, eine bloße Nennung im
Programmheft genügt nicht. Außerdem ist das „persönliche Sponsoring für Kunstschaffende aus
einer persönlichen Neigung des Unternehmers“117 nicht absetzbar. Als Vermittler zwischen
Wirtschaft und Kultur im Bereich Kultursponsoring berät und vermittelt KulturKontakt Austria
unentgeltlich.118
Alle anderen abgebildeten Finanzierungsquellen werden in den folgenden Kapiteln abgehandelt.
Vorab sei festgehalten, dass sich öffentliche Unterstützungsmaßnahmen nicht rein auf monetäre
Hilfe beschränken. Es werden in Oberösterreich insbesondere in Linz subventionierte
Büroräumlichkeiten, aber auch Beratung angeboten. Dazu aber mehr in Kapitel 2.4.2.2.
2.4.1.1 Innen- und Außenfinanzierung
Je nachdem von wo Geldmittel kommen, lassen sich Finanzierungsformen in zwei Bereiche,
Innen- und Außenfinanzierung untergliedern. Von Innenfinanzierung wird gesprochen, wenn
„innerhalb des Unternehmens“, d.h. aus der Geschäftstätigkeit heraus, ausreichend Mittel zur
Verfügung stehen. Zur Innenfinanzierung gehören Mittel aus dem Cashflow sowie Mittel durch
Generierung von Abschreibungen und Rückstellungen, Selbstfinanzierungsvarianten, wie offene
und stille Selbstfinanzierung, und Vermögensumschichtungen (Working Capital Management).
Unter offener Selbstfinanzierung wird der Gewinnverbleib, des gesamten, oder eines Teils des
im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinns, verstanden. Unter einer stillen Selbstfinanzierung
wird das Hinausschieben der Steuerleistung verstanden. Bei der Außenfinanzierung fließen
115 Sponsoringerlass von 1987. vgl. (BMF 2013, Sponsoringerlass)
116 (BMUKK 2013, Glossar S-T, Sponsoring)
117 (BMUKK 2013, Glossar S-T, Sponsoring)
118 (BMUKK 2013, Glossar S-T, Sponsoring)
52
Mittel „außerhalb des Unternehmens“ ein. Diese können beispielsweise Beteiligungen oder
Grundstücke sein. Von Bedeutung ist dabei die Rechtsstellung des Gebers. Handelt es sich um
einen (Mit-)Eigentümer so wird von Eigenfinanzierung oder Beteiligungsfinanzierung
gesprochen. Bleibt der Geber „Draußen“ oder ein „Fremder“, so werden Mittel zur Verfügung
gestellt, die rückbezahlt werden müssen. Ein unternehmerisches Risiko geht nicht über; es wird
von Fremdfinanzierung gesprochen. 119
2.4.1.2 Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung
Eigenkapitalfinanzierung
Das Konzept der Eigenkapitalfinanzierung (Equity Financing) umfasst das Einbringen von
Kapital in das Unternehmen, aber auch das Rückbehalten von erwirtschafteten Gewinnen im
Unternehmen. Im Zuge der Unternehmensentwicklung verändert sich der Finanzbedarf. Ist
dieser in der Unternehmensfrühphase noch gering und mitunter durch den/die GründerInnen
selbst aufbringbar, so kann er bei rasch wachsenden Unternehmen enorm zunehmen. Abbildung
7 zeigt schematisch welche Eigenkapitalquellen bei ansteigendem Kapitalvolumen im
Entwicklungsverlauf eines Unternehmens in Betracht kommen. Dabei zeigt die Darstellung auch,
dass je fortgeschrittener ein Unternehmen in seiner Entwicklung ist, desto höher auch der
Kapitalbedarf ist. Kapital wird zunächst meist von den GründerInnen selbst eingebracht,
manchmal mit Unterstützung der Familie und Freunde. Die Abbildung s.u. wurde um
Crowdfunding ergänzt und zeigt auch, wo Crowdfunding und Crowdfinancing im
Unternehmensverlauf bzw. für welchen Kapitalbedarf in etwa einzuordnen sind.
119 vgl. (Guserl & Pernsteiner, 2011) und (Brettel, 2005)
53
120
Abbildung 7: Eigenkapitalentwicklung121
Die Unterstützung durch Eigenkapital, ob von öffentlicher Seite oder privater, bzw. die
Beteiligung hat gegenüber der Fremdkapitalfinanzierung durch Kredit den Vorteil, dass es sich
nicht um Schuldausweitung in wirtschaftlicher Sicht handelt. Das Vertrauen fremder
Kapitalgeber ist dadurch höher und die Bonität bzw. das Rating ist ein besseres im Sinne von
Basel III122. Das schafft auch zusätzlichen Finanzierungsspielraum.123
Fremdkapitalfinanzierung
Die Fremdkapitalfinanzierung für die Kreativwirtschaft in Form von Krediten und
Mikrokrediten gilt als wichtige Source aus europäischer Sicht.124 Sie wird durch die öffentliche
Hand oder von Privatbanken kurz- mittel-, oder langfristig zur Verfügung gestellt. Ein
Fremdkapitalgeber partizipiert nicht an der Wertsteigerung eines Unternehmens, wie jemand,
der/die Eigenkapital zur Verfügung stellt. Im Erfolgsfall erhält er/sie als KreditgeberIn nur die
Kreditsumme zuzüglich der Zinsen und einen Betrag für die Abwicklung des Geschäfts, im Falle
des Misserfolges, verliert die Bank. Da Sicherheiten zur Deckung dieses Risikos bei
120 „4F“: das sog. „4 F-Kapital“ kommt von: Founder, Family, Friends, Foolhardy investors
121 Quelle: (Volkmann, Tokarski und Grünhagen 2010, S. 295) erweitert um CF u. CI
122 Basel III tritt mit 2014 (geplant war 2013) in Kraft; es reformiert (verschärft) die Kreditanforderungen von Basel II
betreffend der Eigenkapitalbasis (Erhöhung der Kapitalanforderungen für Kredit- und Marktrisiken) und den
Liquiditätsvorschriften; vgl. (BMF 2013, zu Basel III)
123 vgl. (Remplbauer 08.11.2012)
124 (Europäische Kommission 2010, Mitteilung der Kommission)
Stand der Entwicklung
KapitalbedarfEigenkapitalentwicklung
Gründer, Familie, Freunde, Foolhardy
Eigenkapital von öffentlicher Seite
Business Angel
Private Equity (Venture Capital)
Börsegang
Crowdfinancing/-investing
Crowdfunding
54
Jungunternehmen oftmals nicht vorhanden sind, halten sich Banken sehr mit der Kreditvergabe
zurück.125
In Großbritannien haben 2006 67 % der Designunternehmen angegeben eine
Fremdkapitalfinanzierung zu nutzen, 12 % waren es im Musiksektor 126 . Wie die
unterschiedlichen Zahlen vermuten lassen, variiert die Nutzung von Subsektor zu Subsektor.
Generell kann vermutet werden, dass eher größere KMUs in der Kreativwirtschaft von
Fremdkapitalfinanzierung durch Banken profitieren, da Banken verpflichtet sind Risiken zu
minimieren und die hohen Risiken der Kreativwirtschaft eher zu meiden versuchen. Abhilfe
sollen hier spezielle Garantieübernahmen durch die öffentliche Hand schaffen, wie sie
beispielsweise das aws anbietet. Für EinzelunternehmerInnen und Kleinstunternehmen bieten
Mikrokredite Chancen für die Finanzierung ihrer Vorhaben. Aber auch die kurz- und
mittelfristige Fremdfinanzierung durch Lieferantenkredite, Kundenanzahlungen und
Kontokorrentkredit spielen für Kreative eine wichtige Rolle und dürfen nicht außer Acht
gelassen werden. Ein Beispiel hierfür wäre ein Designer, der eine Verkaufsfläche gestaltet und
mit seinen Lieferanten vereinbart, erst bei Abnahme durch den Kunden zu zahlen, oder mit
seinem Kunden eine Anzahlung zur Beauftragung einer Tischlerei, oder mit seiner Hausbank
einen bestimmten Kreditrahmen für diesen Zweck, vereinbart.
125 (Junge Wirtschaft Österreich 2012)
126 vgl. (Clayton & H., 2006)
55
2.4.1.3 Finanzierung innerhalb der Unternehmensphasen
Forschungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich manche Finanzierungsformen in
bestimmten Unternehmensphasen häufen. Den Einsatz von Eigen- und Fremdkapitalarten im
idealtypischen Verlauf der Unternehmensfinanzierungsphasen zeigt die unten angeführte
Darstellung, Abbildung 8.
Seed-Phase Start-up Expansion Börsegang
persönliche Ersparnisse
Familiendarlehen
Private Investoren (BA)
strategische Partner
staatliche Unterstützung
Hypotheken IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII
Leasing IIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bankkredit
Venture Capital IIIIIIIII
Börse
Legende:
Eigenkapital
hellgrau
Fremdkapital
dunkelgrau Abbildung 8: Finanzierungsquellen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien 127
Für wachstumsorientierte StartUps, wie beispielsweise aus dem Softwarebereich, der Medien-
und Spieleindustrie, kann ein solcher idealtypischer Verlauf durchaus auch nachvollzogen
werden. Jedoch zeigt sich beim primären Projekt- und Auftragsgeschäft, der in
Einzelunternehmerschaft aktiven Kreativen, ein ganz anderes Bild. Aus diesem Grunde wurde
der oben angeführte „idealtypische“ Verlauf bei der lebenszyklusorientierten Finanzierung auf
den „real-typischen“ Verlauf bei Kreativunternehmen umgearbeitet. Die unten angeführte
Tabelle 12 zeigt zwei zentrale Phasen, die Frühphase (Early Stage), sowie die Expansionsphase
(Expansion Stage) mit jeweils typischen Finanzierungsquellen. Eine Unternehmensspätphase
wird aufgrund der Projekt- und Auftragscharakteristik ausgeklammert. Vielmehr ist von einer
Aneinanderreihung von Projektlebenszyklen auszugehen, manche Finanzierungsformen wie
öffentliche Förderungen sind daher ein sich wiederholendes Thema. Die unterschiedliche
Helligkeit demonstriert die Bedeutung der Finanzierungsquellen in der jeweiligen Phase.
Dunkler dargestellte Finanzierungsquellen sind wichtiger als heller dargestellte.
127 (McKinsey & Company 2007, 147)
56
Finanzierungs-
phasen
Early Stage Expansion Stage
Late
Stage
Seed start-up Expansion
typische
Unternehmens-
aktivitäten
product concept enterprise foundation start of production
market analysis product development market entry
enterprise conception marketing concept growth financing
Charakteristik Projektfinanzierung Projektfinanzierung Projektfinanzierung
typische
Finanzierungs-
quellen
Erspartes Erspartes
Geborgtes Geborgtes
Eigenleistung Eigenleistung Eigenleistung
Familie Familie
Freunde Freunde
"Foolhardy Investors" "Foolhardy Investors" "Foolhardy Investors"
Förderungen Förderungen Förderungen
Crowdfunding Crowdfunding Crowdfunding
Sponsoring Sponsoring
Kredite
Tabelle 12: typische Finanzierungsformen der Kreativen128
2.4.2 Öffentliches Förderangebot
Auf EU-Ebene, Bundes, Landes und Stadt Linz-Ebene ist man sehr bemüht optimale
Fördermaßnahmen für die Kreativwirtschaft bereit zu stellen. Dabei werden die meisten
Finanzierungshilfen von EU-Programmen nicht von der Europäischen Kommission direkt,
sondern über nationale und regionale Behörden der Mitgliedsstaaten ausgezahlt. Oberösterreich
erhält beispielsweise aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
Unterstützung für Aktivitäten im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Für die Bedürfnisse
128 vgl. die ideal-typischen Entwicklungsphasen von Unternehmen in: (Volkmann, Tokarski und Grünhagen S 293),
(Gompers und Lerner 1999), (Kailer und Weiß 2012, 89), sowie (Fueglistaller, et al. 2012, S. 259) und mit Crowdfunding-
Erweiterung: (Forster 2013, S.85f)
57
der Kreativwirtschaft zugeschnitten, bietet überregional evolve129, die aws130, sowie regional die
Creative Community131 und die Creative Region Linz & Upper Austria132 Unterstützung. Neben
diesen Förderstellen gibt es auch noch Cluster- und Netzwerkbemühungen, die teils
überregional, aber vor allem auch regional, organisiert sind. Diese werden in den Kapiteln
Cluster und Netzwerke133, sowie in Kapitel Förderungen durch Interessensgruppen und
Vereine 134 besprochen. Aber auch allgemeine Wirtschaftsförderungen stehen für
UnternehmerInnen der Kreativwirtschaft offen. Ausgenommen die Förderprogramme auf EU-
und Gemeindeebene, werden in den folgenden Kapiteln die wichtigsten Fördermaßnahmen in
Österreich von Bund, Land Oberösterreich und der Stadt Linz zusammengestellt. Information zu
EU Förderungen sind vom österreichischen Enterprise Europe Network, das in der
Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung EU-Koordination angesiedelt ist, erhältlich.135
Das öffentliche Förderangebot ist so groß, dass es zahlreiche Förderdatenbanken braucht, um
die geeignete Förderung finden zu können. Erschwerend ist, dass manche Förderungen nur zu
bestimmten Zeiten beantragt werden können. Das Angebot reicht von Information geben, über
Sachmittel wie z.B. günstige Geschäftsmieten, bis hin zu finanziellen Mitteln. In den folgenden
Kapiteln werden die Wichtigsten davon genannt. Die unten angeführte Tabelle 13 gibt einen
selektiven Überblick über vorhandene Datenbanken und „Tools“ ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.
129 Kapitel 2.4.2.1.8
130 Kapitel 2.4.2.1.10
131 Kapitel 2.4.2.3.1
132 Kapitel 2.4.3.1.1.
133 Kapitel 2.4.2.2.2
134 Kapitel 2.4.3
135 vgl (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Portal)
58
Einen sehr guten Überblick über die Förderprogramme bietet die Datenbank des Netzwerks
Design & Medien in Oberösterreich.
Förderdatenbank WWW-Adresse
Förderassistent der FFG http://www.ffg.at
Förderassistent des aws http://www.awsg.at/Content.Node/foerderungen/67204.php#
Förderdatenbank der WKO http://www.wko.at/foerderungen
Förderdatenbank des Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds
http://www.wwff.gv.at
Förderkompass des BMVIT http://www.foerderkompass.at
Finanzierungs- und Förderdatenbank
des Wirtschaftsblattes
http://www.wirtschaftsblatt.at/foerderungen
Förderportal BMWA http://www.foerderportal.at
Förderprogramme des FWF –
Wissenschaftsfonds
http://www.fwf.ac.at
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur
http://www.bmbwk.gv.at
Technologieförderung http://www.technologiefoerderung.at
arge creativ wirtschaft austria http://www.creativwirtschaft.at/infosservices/foerderungen
Netzwerk Design & Medien http://www.netzwerk-design.at/1325_DEU_HTML.php
Tabelle 13: Überblick Förderdatenbanken136137
2.4.2.1 Bundesebene
Auf Bundesebene gibt es drei große Förderstellen, die für die Kreativwirtschaft relevant sein
können. Erstens für nicht gewinnorientierte Kreative, die Kunstförderung des
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, deren Abteilungen V/1 bis 7 die Sparten
Architektur bis Mode bedienen (siehe Anhang VI), (das Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung nur am Rande durch die FWF), zweitens das Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend (BMWFJ) mit der FFG (Forschungsfördergesellschaft), und drittens vor allem
das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) durch die allgemeine
Wirtschaftsförderung und insbesondere durch evolve, die Kreativwirtschaftsförderung. In
136Eigendarstellung, Zusammenstellung einer kleinen Auswahl (WWW-Abfrage jeweils vom 23.02.2013)
137 (Förderdatenbanken Zugang über WKO-site, aws-Förderdatenbank, Business-Angels Börse des aws,
https://www.creativdepot.at, creativhotline.at, und http://eufoerderguide.wko.at/default.aspx, Abfrage vom
23.02.2013)
59
beiden Fällen sind die Aufgaben der Förderungen auf die WKO und das aws aufgeteilt. Die
Aufgabenteilung ist in der Abbildung 9 138zu evolve dargestellt.
Förderungen werden in Form von Beratungs- und Informationsleistungen, in Form von
Haftungsübernahmen, auch für Ausfallshaftungen, in Form von Garantien, Vergaben von
Krediten und Darlehen, und in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Darlehen, Preisen
und Prämien vergeben. Die Richtlinien sind gesetzlich festgehalten.
Um eine möglichst wettbewerbsverzerrende Förderung hintanzustellen ist zumeist eine De-
Minimis139-Beschränkung verbindlich. Diese besagt, dass ein Förderwerber innerhalb der letzten
drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahre Förderungen des EU-Staates im Gesamtausmaß von
max. 200.000 Euro ohne Meldung erhalten darf, ungeachtet des öffentlichen Fördergebers.140 Im
jeweiligen österreichischen Förderprogramm wird auf die De-Minimis Beschränkung explizit
hingewiesen, so die Förderung dieser Bestimmung unterliegt.
Neben der De-Minimis Beschränkung ist in manchen Förderungen wie z.B. dem VINCI-
Voucher141 die Einschränkung „nicht kombinierbar mit anderen Förderungen“ festgehalten.
Relevant für die Art der Förderung ist, in welcher Phase sich ein Unternehmen, das um
Förderung ansucht, befindet. Je nachdem reicht das Angebot an Förderungen von der
Startförderung bis zu Förderungen für etablierte Unternehmen, und es wird versucht, möglichst
treffsicher auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe einzugehen.
Interdisziplinarität ist in der Kreativwirtschaft häufig anzutreffen. Manche Vorhaben können
daher auch durch andere Ministerien gefördert werden, wenn ein Vorhaben inhaltlich und den
jeweiligen Förderkriterien entspricht. Das ist z.B. bei umweltrelevanten Themen der Fall, sodass
sich der Blick bzw. der Kontakt zu anderen Ministerien für den/die FörderwerberIn lohnen kann.
138 Kapitel 2.4.2.1.8
139 De-Minimis: Geringfügigkeitsgrenze; Die ursprünglich in (EC) No 69/2001 festgelegte Grenze von 100.000 Euro
staatlicher Förderung wurde im Jahr 2006 verdoppelt, dies wurde in der Commission Regulation (EC) No 1998/2006
vom 15. Dezember 2006 „on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid, gesetzlich
festgehalten und ist für alle EU-Staaten bindend. vgl. (Europäische Kommission 2013, Regulation)
140 vgl. (Europäische Kommission 2013, Regulation)
141 siehe Kapitel 2.4.2.1.10.5
60
Als Anlaufstelle für diesen Informationszugang steht die creativ wirtschaft in der WKO bzw. die
Hotline für Kreative beratend zur Seite. 142
2.4.2.1.1 Beratung und Information
Für Beratung und Informationsweitergabe können alle bereits genannten Förderstellen befragt
werden. Damit Vorhaben nicht an der Finanzierung scheitern, stehen dafür eingerichtete
Beratungsstellen zur Verfügung. Sie vermitteln, oder beantworten direkt Fragen rund um die
Betriebsanalyse, Kapitalbeschaffung, Budgetierung, Finanz- und Liquiditätsplanung. Zentrale
Auskunftsstellen sind die creative wirtschaft in der WKO, die Abteilungen V/1-7 des BMUKK, die
FFG, die aws und auf Land OÖ. bezogen die WKOÖ, Junge Wirtschaft, Creative Community, die
Creative Region Linz & Upper Austria, das Amt der Landesregierung OÖ. und die
Netzwerkcluster sowie zahlreiche weitere Stellen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden.
2.4.2.1.2 Kredite und Darlehen
Der Zugang zu Krediten und Darlehen ist für Jungunternehmen, insbesondere jene der
Kreativwirtschaft oft nicht gegeben. Um diesem Problem zu begegnen bietet die öffentliche Hand
spezielle Kredite und Darlehen für die Wirtschaft an. Diese bieten günstigere Zinsen bei längere
Laufzeit als herkömmliche Kredite und Darlehen. Zu diesem Zweck sind Banken, wie z.B. die aws
eingerichtet. Die Förderung durch Kredite und Darlehen wird über eine Bank, zumeist die
Hausbank des Antragstellers, bei der aws eingereicht. Diese und auch die aws überprüfen bzw.
beurteilen, ob eine Fördermöglichkeit im individuellen Fall besteht. Informationen darüber sind
über das Kundencenter der aws einzuholen.
2.4.2.1.3 Haftungen
Um den Zugang zu Krediten für die Kreativwirtschaft bzw. JungunternehmerInnen zu
ermöglichen werden neue Fördermodelle, die eine Übernahmen der Haftung für Kredite
vorsehen, angeboten. Die Übernahme von Haftungen und Bürgschaften ist ein Bankgeschäft, das
von der aws abgewickelt wird. Die Haftungsübernahme für Mikrokredite wird in Kapitel
Haftungsübernahme für Mikrokredite143 besprochen.
142 vgl. (evolve, 2012, evolve-weitere Angebote) 143 Kapitel 8.2
61
2.4.2.1.4 Zuschüsse und Subventionen
Von besonderer Bedeutung für die Kreativwirtschaft sind Förderungen in Form von nicht
rückzahlbaren Zuschüssen und Subventionen, insbesondere für junge oder startende
Unternehmen. Dieses im Volksmund genannte „geschenkte Geld“ wird im Kultur- und
Kunstbereich meist als Hauptfinanzierungsquelle benötigt.144
2.4.2.1.5 Preise und Auszeichnungen
Preise und Auszeichnungen werden in Österreich in verschiedenen Disziplinen und
Kompetenzbereichen vergeben. Das Wirtschaftsministerium verleiht beispielsweise alleine 15
Staatspreise, u.a. den Staatspreis für Multimedia und e-Business, den Staatspreis für Innovation,
den e-Business-Award und andere mehr. 145 Mit dem Businessplan-Wettbewerb des
Wissenschaftszentrums Wien werden „Teams for Future“ ausgezeichnet.146 Besonders wichtig
sind Preise und Auszeichnungen für KreativunternehmerInnen im Bereich Architektur, Medien
und Design. Diese werden entweder als Preise für GewinnerInnen von Wettbewerben verliehen,
oder aber als Würdigung für (langjährige) besondere Leistungen. Zumeist werden Preise und
Auszeichnungen im zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. Eine solche Auszeichnung ist für die PR
eines Unternehmens sehr wertvoll, jedoch kann sie nicht als Finanzierungsinstrument
betrachtet werden. So es Preisgelder gibt, liegen diese zumeist zwischen 5.000 bis 20.000
Euro.147
2.4.2.1.6 Der Mikrokredit
Der Mikrokredit (Kleinkredit) wurde mit dem Zweck vom Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) geschaffen, um „benachteiligten Selbständigen“148,
den Zugang zu Kapital zu ermöglichen, ohne dass diese Eigenkapital oder Sicherheiten haben. 149
144 vgl. (Harzer 2013, S. 18)
145 vgl. (Innovation 2013) und (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Preise und Auszeichnungen) und (Bundesministerium f.
Wirtschaft, Familie und Jugend 2013, Staatspreis Multimedia)
146 vgl. (WZW 2013)
147 vgl. (BMUKK 2013, Preise) und (Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend 2013, Staatspreise)
148 das sind jene, die die Voraussetzungen erfüllen
149 vgl. (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2013)
62
Eine der folgenden Voraussetzungen muss gegeben sein, um einen Antrag stellen zu können:
• Beschäftigungslosigkeit
• von Beschäftigungslosigkeit bedroht
• atypisch beschäftigt
• bereits selbstständig, aber nur für wenige Auftraggeber tätig
• bereits selbständig, und Investitionen müssen vorgenommen werden
• am Beschäftigungsmarkt benachteiligt
• von Armut betroffen oder bedroht
Zusätzlich müssen alle Voraussetzungen wie unten angeführt vorliegen:
• Volljährigkeit
• Hauptwohnsitz seit mind. sechs Monaten in Ö.
• österr. Staatsbürgerschaft oder Arbeitserlaubnis
• keine laufende Pfändung, Exekutions- oder Konkursverfahren
• Verfolgen einer Geschäftsidee, die nach Art und Umfang einer Versicherungspflicht nach
GSVG oder BSVG unterliegt
• Ausüben einer Tätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze, auch keine freiberufliche
selbständige Tätigkeit nach FSVG
• die Geschäftsidee wird hauptberuflich verfolgt150
• Neugründung, Fortführung oder Übernahme eines Unternehmens
• als bereits Selbständige/r: Erweitern oder Verändern einer Geschäftsidee
• der Zugang zum Kreditmarkt ist erschwert oder ausgeschlossen
Der Mikrokredit dient dazu den Weg in die Selbständigkeit zu erleichtern bzw. notwendige
Investitionen vorzunehmen. Er kann für alle Investitionen und Betriebsmittel eingesetzt werden,
jedoch nicht für private Ausgaben oder zur Umschuldung genutzt werden. Die ordnungsgemäße
Verwendung ist nachzuweisen. Beratend stehen u.a. die WKO zur Verfügung.
Der Bewerbungsprozess ist mehrstufig und sieht u.a. die Beratung, ein Hearing sowie die
Abwicklung über die Bank nach positivem Zuspruch vor. Über die verpflichtende online-
Registrierung erhalten die BewerberInnen Zugang zu nützlichen Informationen zur Erstellung
eines Geschäftskonzepts und Business Plans und zu wichtigen Teilschritten, wie
Produktportfolio, Marketingmaßnahmen, Markt- und Konkurrenzanalysen, Risikoanalyse, Zeit-,
Investitions-, und Liquiditätsplan u.dgl. mehr. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, die Höhe des
geförderten Kredits ist für Einzelpersonen maximal 12.500 Euro, für Personengesellschaften
maximal 25.000 Euro. Dieser Kredit ist jederzeit vorzeitig tilgbar. Die Zinsen sind fixiert mit dem
3-Monats-Euribor plus 3 %, monatlich oder quartalsweise zahlbar. Die ersten sechs bis neun
150 ein Nebeneinkommen im Rahmen eines Dienstverhältnisses von max. 20 Wochenstunden ist möglich
63
Monate sind tilgungsfrei.151 Die zu dieser Förderung passende Haftungsübernahme152 wird vom
aws angeboten.
2.4.2.1.7 Neufög
Die Neugründungsförderung (Neufög) gibt es bereits seit 1999, seit 2001 auch für
Betriebsübernahmen. Sie wird im Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG) geregelt und bietet
wie der Name vermuten lässt, ein Förderpaket für NeugründerInnen. Dieses umfasst
Befreiungen von Gebühren und Abgabe,n die unmittelbar durch die Gründung veranlasst sind,
konkret: die Befreiung von Stempelgebühren und Bundesabgaben von unmittelbar zur
Gründung benötigten Schriften und Amtshandlungen, von der Grunderwerbsteuerabgabe „für
die Einbringung von Grundstücken auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage unmittelbar im
Zusammenhang mit der Neugründung der Gesellschaft, soweit Gesellschaftsrechte oder Anteile am
Vermögen der Gesellschaft gewährt werden“153, sowie von Gerichtsgebühren für die Eintragung
im Grundbuch, von Gerichtsgebühren für die Eintragung im Firmenbuch, Gesellschaftsteuer für
den Erwerb von Gesellschaftsrechten, und die Einstellung von MitarbeiterInnen ist bei
Neugründung von einigen Lohnnebenkosten befreit. Die erlassenen Lohnnebenkosten sind der
Dienstgeberbeitrag (DB) zum Familienlastenausgleichsfonds, die Kammerumlage 2 (die sog. DZ),
der Wohnbauförderungsbeitrag und der Unfallversicherungsbeitrag.154 Diese Befreiung wird für
12 Monate ab der ersten beschäftigten Person gewährt und kann innerhalb der ersten 36
Monate in Anspruch genommen werden. Werden bereits in den ersten 12 Monaten mehrere
DienstnehmerInnen beschäftigt, so gilt die Befreiung von Lohnabgaben für alle. Insgesamt
können maximal 6,84 % Kostenreduktion entstehen.155
2.4.2.1.8 WIFI Unternehmerservice
Das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) bietet mit seinem WIFI Unternehmerservice
umfassende Informationen, auch mittels Publikationen und OnlineTools, sowie geförderte
Beratungsprogramme zum Schwerpunkt Entwicklungs- und Innovationsprojekte. Mit dem
Service Projektmanagement begleitet das WIFI UnternehmerInnen von der Planung (Sondierung
151 vgl. (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK))
152 siehe Kapitel 8.2
153 vgl. (Grünstäudl, Teil 1: Das Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG) 2013, S. 3)
154 vgl. (Grünstäudl, Leitfaden_NeuFoeg 2013, S. 3ff), und (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Gründerservice)
155 vgl. (Österreichische Wirtschaftskammer 2013, WKO-Neufög)
64
betriebswirtschaftlicher Bedarfe), der Erarbeitung eines schriftlichen Projektkonzepts bis zum
Marketingplan und –maßnahmen. Das Unternehmerservice des WIFI unterstützt auch bei der
Optimierung des Fördermix und bei der Erstellung von Einreichunterlagen. Gemeinsam mit
UnternehmensberaterInnen können die Kosten- und die Ertragslage analysiert werden,
kurzfristige Liquiditätsrechnung, Kennzahlenberechnung angestellt werden, und der Aufbau des
betrieblichen Controllings als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen erarbeitet
werden.156
2.4.2.1.9 Evolve – Förderungen für die Kreativwirtschaft
evolve ist die Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) zur
Innovationsförderung im Bereich Kreativwirtschaft in Österreich. „Unser Ziel ist es (...), das hohe
Innovationspotential des immer wichtiger werdenden Kreativsektors auszuschöpfen, um die
hervorragende Innovationsentwicklung Österreichs im europäischen Vergleich nicht nur
abzusichern, sondern weiter auszubauen.“ 157 Die Träger von evolve sind die austria
wirtschaftsservice (aws) mit der Programmlinie impulse und die arge creativ wirtschaft austria
(cwa) in der Wirtschaftskammer Österreich. Diese beiden setzen gemeinsam die Leistungen von
evolve um. Das nachfolgende Organigramm gibt einen Überblick über die organisatorische
Gliederung von evolve.
Abbildung 9: evolve-Organigramm Kreativwirtschaftsförderung158
156 vgl. (evolve 2013, Mission Statement)
157 vgl. (aws 2013, evolve)
158 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2012, Evolve-Netzwerk2012)
65
Evolve will ein Maßnahmenbündel zur Unterstützung von Kreativen bieten. Dieses umfasst alle
Branchen österreichweit und diese in allen unternehmerischen Entwicklungsstufen. Neben der
direkten Unterstützung von UnternehmerInnen und Projekten der Kreativwirtschaft, will evolve
die Awareness für die Belange der Kreativwirtschaft erhöhen. Evolve lädt regionale oder
themenspezifische Initiativen und VermittlerInnen aus dem Kreativbereich ein, „sich unter dem
gemeinsamen Dach in einem österreichweiten Netzwerk zu organisieren.“ Die Netzwerktreffen
finden unter dem Titel „Expert Network“ statt.159
2.4.2.1.10 aws
Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist eine von Österreichs Spezialbanken. Ihr Zweck ist
unternehmensbezogene Wirtschaftsförderungen zu gewähren. Sie bietet mehr als 90
Förderinstrumente für alle Unternehmensphasen: von der Gründung bis zur
Internationalisierung. Mit Impulse, dem Kreativwirtschaftsscheck und der Filmförderung bietet
das aws speziell auf die Bedürfnisse der Kreativwirtschaft ausgerichtete Förderungen. Ihr Ziel
ist die Unterstützung von Unternehmen in der Kreativwirtschaft und die Steigerung der
Bedeutung kreativer Leistungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Angebot umfasst finanzielle
Förderungen, wie „impulse support“, Aus- und Weiterbildungsangebote wie „impulse training“,
Awarenessmaßnahmen wie „impulse awareness“, Haftungsübernahme für Kleinkredite und
zuletzt, die in Evaluation befindlichen Kreativwirtschaftsschecks, die als auftragsankurbelnde
Maßnahme gesehen werden können.
2.4.2.1.10.1 Filmförderung - FISA
Der Filmstandort (FISA) ist Fördergegenstand dieses gleichgenannten Programms. Ziel ist,
nachhaltige Impulse für den Filmproduktionsstandort Österreich zu geben und die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Österreich zu verbessern. Ein besonderes Ziel ist die
Finanzierung von Kinofilmen für Hersteller in Österreich zu erleichtern. Dadurch sollen höhere
Produktionsbudgets ermöglicht werden, „um künstlerische Spielräume, die Qualität, die
Attraktivität und damit auch die Verbreitung von Kinofilmen zu fördern“160. Durch höhere Budgets
erhöhen sich auch die Kosten, damit erhofft sich der Fördergeber, eine verbesserte Auslastung
der filmtechnischen Betriebe. Die Regelungen für die Vergabe der Förderung ist mit 01.07.2010
159 siehe Kapitel: 2.4.3.1.6; und vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Evolve)
160 (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
2012, Finanzen-Filmstandort)
66
in Kraft getreten. 161 Es werden österreichische Kinoproduktionen mit einem nicht
rückzahlbaren Zuschuss gefördert. Es kann nur der Hersteller des Films um Förderung ansuchen.
Dieser muss entsprechend fachlich qualifiziert162 für die Ausübung seiner Tätigkeit sein. Der/die
Förderwerber/in muss einen echten163 Eigenanteil von mindestens 5 % beitragen. Darüber
hinaus muss der österreichische Anteil an den Herstellungskosten mindestens 20 % ausmachen.
Besonders an dieser Förderung ist, dass ein „kultureller Eigenschaftstest“ sowohl für Spiel-, als
auch für Dokumentarfilme online gemacht werden kann, um vorab zu überprüfen, ob eine
Förderwürdigkeit besteht.164 Nach § 12. (1) der Richtlinie165 beträgt die Förderung maximal
25 % der förderungsfähigen Herstellungskosten, jedoch höchstens 15 % der jährlich zur
Verfügung stehenden Mittel.166 Zu Beginn jedes Förderungsjahres kann der Beirat eine für das
jeweilige Förderjahr geltende Empfehlung abgeben167. In den letzten beiden Jahren wurden
jeweils acht Filmproduktionen gefördert. Nachfolgend wird der Ablauf und die Dauer einer
Einreichung in Abbildung 6 gezeigt: �
Einreichun g �
2 Wochen Prüfung auf Antragsberechtigung und formelle Vollständigkeit (aws / ABA) �
Zulassung zur Beurteilung ggf. Nachfristsetzung / Nachforderung �
Vorlage der vollständigen Unterlagen
7 Wochen
� Prüfung Plausibilität / Eigenschaftstest (ABA)
Prüfung Wirtschaftlichkeit / Förderfähigkeit (aws) �
Genehmigung durch BMWFJ �
Information über Entscheidung (aws) Abbildung 10: Förderablauf der FISA168
161 vgl. (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen 2012, Finanzen-Filmstandort)
162 „das heißt künstlerisch und filmwirtschaftlich ausreichend qualifizierte und erfahrene juristische und natürliche Personen mit einer Betriebsstätte oder Zweigniederlassung in Österreich“ ( (Bundesminister für Wirtschaft F. u. Jugend, 2012) und (Filmstandort-Austria 2013)
163 damit ist gemeint, dass dieser Eigenanteil nicht öffentlich gefördert sein darf; vgl. (Bundesminister für Wirtschaft
Familie u. Jugend, 2012)
164 vgl. (Filmstandort Austria 2013)
165 (Bundesminister für Wirtschaft F. u. Jugend, 2012)
166 (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
2012, Finanzen-Filmstandort)
167 die Empfehlung im Jahr 2010 betrug 750.000 Euro für die zur Verfügung stehenden Mittel
168 Quelle: FISA (Filmstandort-Austria 2013, Richtlinien)
67
Neben dieser Bundesförderung, stehen den Filmschaffenden Förderungen des Österreichischen
Filminstituts sowie länderspezifische Förderungen zur Verfügung. Die Förderungen der
Bundesländer haben meist die Voraussetzung eines Regionaleffektes. Ein oberösterreichischer
Filmhersteller kann daher durchaus eine Förderung z.B. vom Land NÖ. oder Salzburg erhalten,
wenn nach den jeweiligen Richtlinien ein entsprechender Werbe- bzw. Wertschöpfungseffekt
für das Bundesland gegeben ist. Die für das Land OÖ. gewährten Förderungen werden in Kapitel
2.4.2.2 Förderungen des Landes OÖ, kurz dargestellt.
2.4.2.1.10.2 impulse XS, XL, Lead
Die aws wickelt die Förderprogramme Impulse XS, XL und Lead ab. Dabei handelt es sich um
Förderungen, die speziell für die Kreativwirtschaft konzipiert wurden. Damit soll die fehlende
Finanzierung und das damit verbundene wirtschaftliche Risiko abgefedert werden. Unterstützt
werden Projekte, bei denen „der kreativwirtschaftliche Beitrag im Projekt die Innovation
definiert.“169 Wie Konfektionsgrößen bei Bekleidung, sind diese drei Förderungen bezeichnet
und haben ihre unterschiedlichen Support-Schwerpunkte je nach Projektreifegrad, wie im
Schaubild, Abbildung 11, zusammengefasst dargestellt. Diese zeigt auch, in welchem Sinn der
Kreativwirtschaftsscheck, die neue Förderung (in Evaluation) ab 2013 inhaltlich eingebettet ist.
Abbildung 11: impulse-Förderungen170
Alle drei Förderungen richten sich an UnternehmerInnen aus den Bereichen Design, Mode,
Grafik, Architektur, Kunstmarkt, zusammengefasst als Kategorie DESIGN. In der Kategorie
169 (aws impulse 2011, S. 1)
170 Quelle: impulse (aws 2012)
impulse LEAD Entwicklung, erste Anwendung, ggf. Marktüberleitung
(über das einzelne Unternehmen / Projekt hinausgehend! Disseminierung / Diffundierung!)
Schaffung kritischer Massen / durchgängiger
Wertschöpfungsketten
Professionalisierung von Abläufen / Prozessen
Steigerung der öffentlichen Sichtbarkeit / Public
Understanding
Modellcharakter / Disseminierung /
Diffundierung
Kreativ-Wirtschafts-Scheck
(in Planung) Inanspruchnahme kreativwirtschaftlicher
Leistungen im Rahmen eines Innovationsvorhabens
Projekt-reifegrad
Innovationsgrad vorhanden sehr hoch
Frühphase: Marktorientierung / Wirtschaftlichkeit
noch nicht klar, hohes Potential
Entwicklungsphase: Marktorientierung /
Wirtschaftlichkeit plausibel und nachvollziehbar
Projekte mit Best-
Practice-Charakter (Aufbau nach-haltiger / wirtschaftlich tragfähiger
Strukturen)
impulse XL Entwicklung, erste Anwendung, Marktüberleitung
impulse XS Prüfung der inhaltlichen und wirtschaftlichen
Machbarkeit
Ideengenerierung, Positionierung
Konzeption
Entwicklung
(erste) Anwendung
Umsetzung
Marketing / Marktüberleitung
Vision, F&E …
68
INNOVATIVE MEDIA sind Multimedia/Spiel, Musikwirtschaft insb. Musikverwertung,
Audiovision und Film insb. Filmverwertung, Medien- und Verlagswesen und Werbewirtschaft,
zusammengefasst. Unterstützt wird in allen Drei in Form eines nicht rückzahlbaren monetären
Zuschusses (auch Eigenleistung wird eingerechnet), ausschließlich online. Kosten vor
Antragstellung werden nicht gefördert. Alle Drei unterliegen der De-Minimis Bestimmung. Die
Auswahl trifft eine international besetzte Jury.
impulse XS
Mit impulse XS werden „first mover Aktivitäten“ adressiert. Diese Projekte befinden sich in einer
Phase, in der die inhaltliche und wirtschaftliche Machbarkeit noch nicht abgeschätzt werden
kann, jedoch ein hohes Potential erkennbar ist. Das Projekt muss eine aus o.g. Bereichen
eigeninitiierte Innovation sein und einen deutlichen Nutzen für diesen Bereich darstellen. Die
Ausschreibung für impulse XS erfolgt zweimal jährlich. Es können Kleinstunternehmen (Mikro)
bis max. 10 Beschäftigte und einem Umsatz, oder einer Bilanzsumme von weniger als zwei Mio.
Euro, einreichen. Die Förderhöhe beträgt bis zu 70 % der förderbaren Projektkosten und ist mit
45.000 Euro gedeckelt. Die Auszahlung erfolgt zumeist in drei Teilbeträgen (50, 40 und 10 %).
Es gibt keine Mindestprojektsumme. Die Laufzeit beträgt ein Jahr.171
impulse XL
Ziel von impulse XL ist, die Barrieren aufgrund fehlender Finanzierung für die Entwicklung, die
erste Anwendung, und die Marktüberleitung von neuen innovativen Produkten, Verfahren und
Dienstleistungen abzubauen. Das ist auch der Kernbereich der Förderung. XL ist zweimal
jährlich ausgeschrieben und adressiert Kleinst- (Mikro) bis mittelgroße Unternehmen und zwar
aller Branchen. Das Projekt muss lt. Bestimmungen inhaltlich den o.g. Kreativbereichen
zuzuordnen sein. Die Leistung und das Know-how müssen maßgeblich zur Wertschöpfung im
Projekt beitragen und wesentlich für den Projekterfolg sein. Eine Besonderheit ist, dass mehrere
gleichberechtigte Projektpartner gemeinsam einreichen können. Die Höhe der Förderung
beträgt bis zu 50 % der förderbaren Projektkosten, jedoch max. 200.000 Euro. Darüber hinaus
darf die Laufzeit nicht länger als drei Jahre betragen. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in
der Regel in drei Teilbeträgen zu 30 %, 40 % und 30 %.172
171 vgl. (aws impulse 2011) und (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2010)
172 vgl. (aws impulse 2011) und (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2010)
69
impulse Lead
Mit impulse Lead wird die Etablierung von zukunftsweisenden Best-Practice-Modellen „mit
deutlichem Disseminierungs- und Diffundierungscharakter“ unterstützt. Zweck ist die
Verbesserung der internationalen Positionierung Österreichs als Kreativstandort. Dazu ist es
nötig, die Kreativwirtschaft als Wertschöpfungsfaktor sichtbar zu machen und deren
Leistungsfähigkeit zu verbessern. Gefördert werden daher Projekte, die den o.g.
Kreativbereichen zuzuordnen sind, und die einen deutlichen Nutzen für die
Kreativwirtschaftsbereiche erkennen lassen. Das Projekt muss Modellcharakter haben und
„konkrete Disseminierungs- und Diffundierungsstrategien vorsehen“. Darüber hinaus soll das
Projekt wirtschaftlich selbständig sein bzw. werden. Als weitere Voraussetzung gilt, dass das
Projekt von einem Zusammenschluss aus mindestens drei Partnern oder einem Verein bzw.
einer Arbeitsgemeinschaft mit mindestens fünf Mitgliedern umgesetzt werden muss. Außerdem
muss das Projekt spezifischen Fördervoraussetzungen entsprechen, diese hier anzuführen,
würde zu weit führen. Die Mindestprojektsumme beträgt 100.000 Euro, die Laufzeit mindestens
ein Jahr bis max. drei Jahre, die jedoch u.U. um 12 Monate verlängert werden kann. Die maximale
Förderung beträgt bis zu 80 % der förderbaren Projektkosten, in Summe aber nicht mehr als
300.000 Euro, wobei die De-Minimis-Grenze von 200.000 Euro innerhalb der letzten drei
Steuerjahre gilt!173 Eines der in letzter Zeit geförderten Best-Practice-Modelle ist OTELO.174
2.4.2.1.10.3 Kreativwirtschaftsscheck
Seit 2013 gibt es erstmals den Kreativwirtschaftsscheck. Es handelt sich um einen Zuschuss in
Höhe bis zu 5.000 Euro für KMU’s , die kreativwirtschaftliche Leistungen in Anspruch nehmen.
Förderbar sind Kosten für Leistungen, die dem Kernbereichen Design, Architektur,
Multimedia/Spiele, Mode, Musikwirtschaft/Musikverwertung, Audiovision und
Film/Filmverwertung, Medien- und Verlagswesen, Grafik, Werbewirtschaft, Kunstmarkt
zuordenbar sind. Am 11. Februar 2013 wurden 300 solcher Schecks aufgelegt, am 21. Februar
2013 um 300 Schecks erweitert, und am 5. März 2013 wurde ein Einreichstopp aufgrund
erschöpften Kontingents verhängt. Nach erfolgter positiver Evaluierung werden für 2014 solche
Kreativwirtschaftsschecks in Aussicht gestellt. Informiert wird darüber auf der Homepage der
AWS und über Newsletter.175
173 vgl. (aws impulse 2011, 1) und (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2009)
174 siehe Kapitel 8.15
175 vgl. (aws 2013)
70
2.4.2.1.10.4 i2 Business Angel Börse
i2 ist die Business Angel Börse176, die vom aws (austria wirtschaftsservice) betreut wird. i2 ist
Mitglied im europäischen Netzwerk „eban“ (European Business Angel Network) und gut
vernetzt zu Oberösterreichs WKOÖ Gründerservice, der JKU, dem IUG StartupCenter, AICO und
tech2b. Sie stellt den Kontakt zwischen StartUps und Business Angels aus Österreich her. Dabei
bietet sie Services im Rahmen der Vermittlungstätigkeit, wie technische, betriebswirtschaftliche
und patentrechtliche Analysen und Bewertungen, sowie eine Auswahl gelisteter i2 Projekte,
potentiellen Business Angels an. Für Gründer liegt der Vorteil bei rascher Vermittlung, Expertise
und einer hohen Kontaktzahl zu Business Angels, deren Bonität und Verhalten gegenüber
Gründern geprüft bzw. beobachtet wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass höchste Diskretion seitens
der AWS zugesichert werden kann, da diese dem Bankgeheimnis verpflichtet ist.
Dienstleistungen sind durch das BMWFJ finanziell gestützt.177
2.4.2.1.10.5 Förderung durch Partnering – Vinci Voucher
Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung des Innovationsprozesses in Klein- und
Mittelbetrieben (mit Firmensitz in Salzburg) durch Einbeziehung von kreativwirtschaftlichen
Leistungen, durch PartnerInnen aus der Kreativwirtschaft. Bei den PartnerInnen gibt es keine
Einschränkung auf das Bundesland, somit können auch Kreative aus OÖ. davon profitieren. Das
Finanzierungsvolumen beträgt maximal 5.000 Euro.178
Sonstige Wirtschaftsförderungen der aws finden sich im Anhang V.
176 siehe Kapitel Business Angels S.77
177vgl. (aws 2013, i2) und (Litzka 2012) und (Business Angels Austria 2012), und (aws, erp-fonds 2012)
178 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich, creativ wirtschaft austria 2012) und (aws 2012, erp-fonds)
71
2.4.2.1.11 Kunst- und Kulturförderung
Die Kunst- und Kulturförderung soll an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt werden,
da sie mitunter für Projekte der Kreativwirtschaft in Frage kommen kann. Eine genaue Prüfung
würde jedoch diesen Rahmen sprengen. Es sei hier auf die zentrale Anlaufstelle, das
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), verwiesen. Die Kunstförderung
nach Kunstförderungsgesetz 1988179 umfasst die folgend genannten Bereiche, die in den
Abteilungen V/1 bis V/7 des Bundesministeriums behandelt werden:
• Abteilung V/1 Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode, Fotografie, Video- und
Medienkunst
• Abteilung V/2 Musik, Darstellende Kunst Kunstschulen, Allgemeine Kunstangelegenheiten
• Abteilung V/3 Film
• Abteilung V/5 Literatur und Verlagswesen
• Abteilung V/6 Bilateraler Künstleraustausch
• Abteilung V/7 Regionale Kulturinitiativen180
Im Anhang VI findet sich ein zusammengestellter Überblick der Kunst- und Kulturförderungen.
2.4.2.1.12 Filmförderung – Österreichisches Filminstitut
Neben der Bundesförderung des BMWFJ gibt es überregional die Förderung des
Österreichischen Filminstitutes. Ziel ist die Unterstützung der Entstehung, die Verbreitung und
Vermarktung von neuen österreichischen Filmen. Diese müssen das Potential für eine
entsprechende Publikumsakzeptanz und internationale Anerkennung haben. Gefördert wird die
Stoffentwicklung (idHv. 12.000 bis 15.000 Euro), Projektentwicklung (idHv. 40.000 Euro),
Herstellung (Richtsatz: 440.000 Euro), Vermarktung und Verbreitung181 von professionellen,
abendfüllenden Kinofilmen nach dem Auswahl- und dem Erfolgsprinzip, das mittels einer
Referenzfilmförderung unterstrichen wird. Die Referenzfilmförderung wird in Form nicht
rückzahlbarer Zuschüsse, der sog. Referenzmittel, vergeben. Als Voraussetzung wird genannt,
dass mindestens 40.000 Referenzpunkte erreicht werden müssen, um die Förderung zu erhalten.
Diese Referenzpunkte gehen aus dem ZuschauerInnenerfolg im Inland sowie durch Preise und
Teilnahmen an international bedeutsamen Festivals, hervor. Eine detaillierte Liste,
herausgegeben vom Aufsichtsrat des Österreichischen Filministituts ist im Anhang VII: beigefügt.
Förderbar ist auch die berufliche Weiterbildung in der Höhe von monatlich ca. 1.000 Euro. Mit
179 (BMUKK 2013, Förderungen)
180 vgl. (BMUKK 2013, Förderungen)
181 ein Höchstbetrag von 40.000 Euro als Grundbetrag ist definiert; hinzu kommen Förderbeträge für z.B.
Festivalbeteiligungen, Synchronisation, DVD-Herausbringung; eine detaillierte Aufstellung ist im Anhang VIII
beigefügt.
72
der Änderung der Richtlinien im April 2013 wurde unterstrichen, dass nur ausreichend
beruflich qualifizierte HerstellerInnen, DrehbuchautorInnen, RegisseurInnen, etc. zur
Einreichung gewünscht sind.182 Diese haben entweder die österreichische Staatsbürgerschaft,
oder sind aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Sollte es sich um juristische Personen
handeln, muss der Firmensitz in Österreich sein, für ausländische Firmen gilt, dass eine
Niederlassung in Österreich existieren muss. Es gibt auch das Erfordernis, dass deren
geschäftsführende Organe für alle Verpflichtungen, die der/die FörderwerberIn eingeht,
persönlich mithaften. Gefördert wird in der Regel bis zu 50 % der Gesamtkosten,was aus der
Datenbank des Netzwerk Design hervorgeht.183 Eine der Voraussetzungen ist, dass das Projekt
„ohne Förderung durch das Filminstitut nicht durchführbar oder nur in unzureichendem
Umfang184“ durchführbar wäre. Außerdem muss es ein österreichischer Film oder eine
Koproduktion mit einem ausländischen Partner sein. Der Förderwerber unterstellt sich dem
Gleichbehandlungsgesetz.185 Hat ein/e FörderwerberIn Mittel aus der Herstellungsförderung
erhalten, so müssen diese aus dem Verwertungserlös, abzüglich einer angemessenen
Vertriebsprovision rückgezahlt werden. Die Richtlinie regelt wann und wie dies erfolgen muss.
Das Filminstitut fördert in den Bereichen: Koproduktion, Kofinanzierung und
Referenzfilmförderung. Es bietet aber auch Services und Information, wie beispielsweise eine
Filmdatenbank, Statistiken, Publikationen und sein Netzwerk, an. Zusätzlich ist im Filminstitut
der Media Desk angesiedelt. Dieser berät und betreut Antragsteller für EU-Einreichungen und
fungiert als Bindeglied zwischen nationaler Fördereinrichtungen und der Europäischen
Kommission.186
ORF Film/Fernseh-Abkommen
Es besteht seit 1981 als Vertrag zwischen dem ORF und dem Österreichischen Filminstitut. Seit
1991 wurden vom ORF rund 135 Mio. Euro in den heimischen Kinofilm investiert. 2011 wurde
das Abkommen neu geregelt und läuft bis Ende 2013.
Wurde eine der genannten Förderungen für die Herstellung eine Kinofilms gewährt, die den
Voraussetzungen des Filmförderungsgesetz und Rundfunkgesetz entsprechen, so ist es auch
möglich, durch das ORF Film/Fernseh-Abkommen ebenso eine Förderung zu erhalten.
182 vgl. (Österreichisches Filminstitut 2013)
183 vgl. (Netzwerk-Design 2013, Datenbank)
184 meint Teichmann (Österreichisches Filminstitut 2013)
185 vgl. (Österreichisches Filminstitut 2013)
186 vgl. (Österreichisches Filministitut 2013) und (BMUKK 2013, Förderungen)
73
Voraussetzung für eine Mitfinanzierung ist eine Förderzusage des Österreichischen Filminstituts
bzw. im Rahmen der „Innovations- und Nachwuchsfinanzierung“ einer anderen öffentlichen
Filmförderstelle. Die Förderhöhe entspricht zumeist der zugesprochenen Summe des
Primärförderers. Der beabsichtigte Zweck ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Film
und Fernsehen.187
Fernsehfonds Austria
Der Fernsehfonds Austria ist eine der Förderungen, die die Rundfunk und Telekom
Regulierungsbehörde (RTR) verwaltet.188 Gefördert wird die Herstellung von Fernsehfilmen und
–serien, sowie Fernsehdokumentationen mit einer Mindestlänge von 23 Minuten. Die Filme
müssen einen kulturellen Inhalt haben. Dieser muss überprüfbar nationalen Kriterien
entsprechen. Gefördert werden nur förderbare Kosten nach den Richtlinien.189 Mit dieser
Förderung ist beabsichtigt, die Qualität der Fernsehproduktion und der Leistungsfähigkeit der
österreichischen Filmwirtschaft zu steigern. Als Förderwerber kommen hier, wie bei der
Herstellungsförderung des Österreichischen Filminstituts, nur fachlich ausreichend qualifizierte
und erfahrene natürliche und juristische Personen mit Zweigniederlassung oder Betriebsstätte
in Österreich in Frage. Außerdem muss der Förderwerber nachhaltig Kulturgüter mit
österreichischer Prägung herstellen.190 Die Förderhöhe beträgt 20 % der angemessenen
Gesamtherstellungskosten. Die Höchstfördergrenze liegt bei Fernsehserien bei 200.000 Euro
pro Folge, bei Fernsehfilmen bei 1 Mio. und bei Fernsehdokumentationen bei 200.000 Euro.
2013 vergibt der Fernsehfonds Austria mehr als 5,8 Mio Euro für 21 Fernsehprojekte, das
Fördervolumen für dieses Jahr wäre beinahe ausgeschöpft, schreibt der Fernsehfonds Austria in
einer Presseaussendung vom 17.06.2013. Neben dem Fernsehfonds Austria kommen für die
Kreativwirtschaft (freie Radios und freie Fernsehsender) auch noch der Digitalisierungsfonds
und der Nichtkommerzielle Rundfunkfonds in Frage, die vom Fachbereich Medien verwaltet
werden.191192
187 vgl. (Österreichisches Filminstitut 2013)
188 vgl. (RTR 2013, Fernsehfonds)
189 Die Richtlinien über die Gewährung von Mitteln aus dem FERNSEHFONDS AUSTRIA, sind seit 01.01.2012 gültig. Gemäß § 23 Abs. 1 KommAustria–Gesetz (KOG), BGBl. I Nr 32/2001 idF BGBl. I Nr. 50/2010 hat die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) folgende Richtlinien für die Gewährung von Mitteln aus dem FERNSEHFONDS AUSTRIA gemäß §§ 26 bis 28 KOG erstellt und bekannt gemacht. (RTR 2013, FFAT-Richtlinie)
190 vgl. (RTR 2013)
191 vgl. (RTR 2013, Fernsehfonds)
74
Neben den oben genannten Förderungen, gibt es Unterstützung von anderen Bundesländern in
Österreich, wenn ein sachlicher oder personeller Bezug zum Bundesland, oder ein gesamt- bzw.
filmwirtschaftlicher Effekt gegeben ist.193 Bezüglich der Filmförderungen des Landes OÖ. sei auf
das Kapitel Landesförderungen194 verwiesen.
2.4.2.1.13 SKE Fonds
Die Sozialen und kulturellen Einrichtungen (SKE) der austromechana speisen sich aus Mitteln
der Urheberrechtsabgabe (URA)195 für privates Kopieren. Die austromechana ist berechtigt die
Abgaben einzuheben und diese Gelder zu verteilen. 50 % der Gelder werden direkt an die
UrheberInnen verteilt, die anderen 50 % an die Kunstschaffenden verschiedener
Kunstgattungen in Form von Förderungen und Zuschüssen verteilt.196 Die SKE sind eine
Fördereinrichtung für KomponistInnen. Der Auftrag197 lautet für die Anspruchsberechtigten und
deren Angehörige Einrichtungen zu schaffen, die
a. sozialen Zwecken
b. kulturellen Zwecken
dienen. 198 Die Mittel müssen direkt oder indirekt an die, die mit der austromechana einen
Wahrnehmungsvertrag zur Einhebung ihrer Urhebertantiemen abgeschlossen haben, und ihren
Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Österreich haben, zu Gute kommen. Förderungen und
Zuschüsse erfolgen in Form von:
• SKE Jahresstipendien (zwei pro Jahr in Höhe von 12.000 Euro an KomponistInnen im
Bereich aktueller populärer Musik)
• sozialen Zuschüsse für Notfälle (rund 100 Musikschaffende pro Jahr) und
Sozialversicherung (Zuschuss zu Kosten der Sozialversicherung bzw. Altersversorgung)
• Information und Beratung zu Sozialversicherungsangelegenheiten und Förderungen
• Kunst- und Kulturförderungen
192 Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) ist außerdem für die Vergabe der Presseförderung des
Bundes, sowie der Förderung nach Abschnitt II des Publizistikförderungsgesetzes zuständig. vgl. (RTR 2013,
Richtlinien)
193vgl. (Netzwerk-Design 2013, Datenbank)
194 Kapitel 2.4.2.2
195 Die URA wurde 1980 als „Leerkassettenvergütung“ in Österreich eingeführt. vgl. (austromechana 2013)
196 vgl. (Urheberrechtsgesetzesnovelle 1980 z.i. austromechana 2013)
197 gemäß § 13 VerwGesG 2005 iVm § 42b (5) UrhGNov 2003 in der Fassung der UrhGNov 2005 z.i. austromechana
2013)
198 vgl. (austromechana 2013)
75
Letztere werden für Ton-/Bildproduktionen und die sog. „Sommerstudios“ in Kooperation mit
dem RadioKulturhaus (ORF) vergeben. Die Selbstvermarktung, sowie Musikproduktionen bzw.
lizenzierte Vertriebe im Internet, Musikinstallationen, die Aus- und Weiterbildung im Ausland
und Workshops, sowie Kompositionsaufträge und Notendruck (auch zu Film, Tanz,
Installationen, etc.) werden vergeben. Für Gratis-Konzerte ist die SKE Förderung
ausgeschlossen.199
2.4.2.1.14 Forschungsförderung (FFG)
FFG steht für zweierlei, einerseits für die Forschungsförderung, andererseits die ausübende
Forschungsförderungsgesellschaft. Letztere wurde mit 1. September 2004 durch das
„Forschungsförderungsgesellschaft Errichtungsgesetz“ (FFG-Gesetz)200, gegründet. Die Republik
Österreich ist zu 100 % Eigentümerin, die Gesellschaftsrechte üben zwei Ministerien aus: Das
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), sowie das
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ).
Die zur Verfügung stehenden Forschungsförderungen finden, wie die EU-Förderungen nur
nachrangig, der Vollständigkeit halber Erwähnung. Geeignete Förderungen können mit dem
Förderassistenten, der Datenbank der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), abgerufen
werden. Sie bietet einen guten Überblick über sämtliche Förderprogramme, die die FFG
abwickelt. Darüber hinaus gewährt es einen Einblick bei welchen Programmen aktuell
Ausschreibungen offen sind und eingereicht werden kann.201
Im Rahmen der Programmlinie „Kooperation und Netzwerke“ vergibt die FFG das
Förderprogramm COIN (Cooperation & Innovation) seit 2010, sowie den Innovationsscheck in
Höhe von 5.000 Euro an, von der Jury ausgewählte BewerberInnen, die die formalen
Voraussetzungen erfüllen.
COIN (Cooperation & Innovation)
Das Ziel, das mit dieser Förderung verfolgt wird ist die Verbesserung der Innovationsleistung
Österreichs, hinsichtlich Innovationsfähigkeit, - intensität und –output. Zielgruppen von COIN
sind KMUs, große Unternehmen, Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren,
Forschungseinrichtungen, Start-Ups und (gemeinnützige) Vereine. Der Forschungsschwerpunkt
ist breit gefasst und beginnt bei Humanressourcen und reicht über Material und Produktion,
199 vgl. (austromechana 2013, SKE-Fonds)
200 Bundesgesetzblatt I Nr. 73/2004 z.i. (FFG 2013) und vgl. (FFG 2013)
201 vgl. (FFG 2013, Förderangebot)
76
Mobilität und Sicherheit bis zum Weltraum. Auch Dienstleistungen können seit der
„Dienstleistungsinitiative“202 eingereicht werden. Die Fördersumme beträgt maximal 500.000
Euro, bei Gesamtkosten von mindestens 100.000 Euro, und maximal 500.000 Euro innerhalb
einer Laufzeit von 12-24 Monaten.203
Innovationsscheck
Der Innovationsscheck in Höhe von 5.000 Euro wird nach Prüfung der formalen
Voraussetzungen (wie Unternehmensgröße, „De-Minimis“, u.am.) für Leistungen eines
Forschungspartners nach Wahl abgegolten. Forschungspartner können außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen und Universitätsinstitute sein, nicht aber Labors
von Großunternehmen, Forschungsunternehmen und Consultants. Für die Vermittlung von
geeigneten Forschungspartnern ist eine Hotline (Hotline 05 7755-5000) eingerichtet. Gefördert
werden beispielsweise Studien zur Umsetzung innovativer Ideen, Vorbereitungsarbeiten für ein
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben, Unterstützung bei der
Prototypenentwicklung und bei Potentialanalysen.204
Innovationsscheck Plus 10.000,- mit Selbstbehalt
Der Innovationsscheck Plus ist die Erweiterung des Innovationsschecks. Es soll damit ein
vertiefter Einstieg für KMUs in eine kontinuierliche Forschungs- und Innovationstätigkeit
ermöglicht werden. Darüber hinaus soll die Hemmschwelle zu Kooperationen mit
Forschungseinrichtungen aufgeweicht werden und der Wissenstransfer zwischen KMUs und
dem Wissenschaftssektor stimuliert werden. Gefördert werden deren förderbare Leistungen bis
zu max. 12.500 Euro, ein Selbstbehalt von 2.500 Euro ist dabei zu berücksichtigen. Somit ist die
tatsächliche Förderhöhe 10.000 Euro. AntragstellerIn ist das KMU, welches den Scheck bei einer
Forschungseinrichtung (FE) einlöst.205
2.4.2.2 Land Oberösterreich
Die Creative Community, die Creative Region Linz & Upper Austria, die Cluster- und
Netzwerkstellen, die Kulturförderstellen der Stadt Linz, sowie des Landes OÖ. und vor allem die
202 vgl. (FFG 2013, Dienstleistungsinitiative)
203 vgl. (FFG 2013, Programmlinie „Kooperation und Netzwerke“)
204 vgl. (FFG 2013) (FFG 2013, Folder-Der Innovationsscheck)
205 vgl. (FFG 2013, Innovationsscheck Plus)
77
Wirtschaftskammer OÖ. (WKOÖ) bieten Beratung und Information zu Förderungen,
AnsprechpartnerInnen, bzw. vermitteln gegebenenfalls an entsprechende Stellen weiter.
2.4.2.2.1 Beratung und Information
Mit dem Förderprogramm „InnovationsassistentInnen/-beraterInnen für KMU“ werden
kleine und mittlere Unternehmen, junge AbsolventInnen einer Universität oder FH, oder
BeraterInnen in Oberösterreich gefördert. Der/die Innovationsassisten/in unterstützt KMUs bei
der Durchführung innovativer Projekte. So können lt. Fördergeber „Engpässe bei Ressourcen
abgebaut und Qualifikationen (Technologien, Kooperation, F&E) erweitert werden. 206 “ Den
InnovationsassistentInnen wird so der Berufseinstieg erleichtert. Gefördert wird in Form eines
Zuschusses zu den Personalkosten der Innovationsasstistentin/des Innovationsassistenten
zuzüglich der Personalnebenkosten für zwei Jahre. Die förderbare Obergrenze des
Monatsbruttogehalts beträgt dabei 2.000 Euro. Gefördert werden 50 % der Personalkosten im
ersten Jahr, im zweiten 25 %. Zusätzlich werden bis zu 13 Tagen Beratungskosten bei einem
Tagessatz von maximal 945 Euro inkl. Reisespesen gefördert, und die Kosten für die
Zusatzausbildung übernommen. Die Abwicklung stellt die CATT Innovation Management
GmbH. 207 Im Bereich Kultur gibt es die jährliche Ferialjobaktion, um zusätzliche
Ferialarbeitsplätze bei OÖ. Kulturvereinen zu schaffen. 208
CATT Innovation Management GmbH
Die CATT Innovation Management GmbH (folgend CATT genannt) ist ein wichtiger Impulsgeber
bei Technologieförderungen, internationalen Austauschprogrammen, Technologietransfer und
Innovationsmanagement im Technologienetzwerk OÖ. Sie ist gut vernetzt mit österreichischen
Unternehmen sowie mit Ministerien, dem Land OÖ, der WKOÖ, der Arbeiterkammer OÖ. und der
Stadt Linz. Auf internationaler Ebene bestehen Kontakte zur Europäischen Kommission, zu
Organisationen in ganz Europa, sowie zu internationalen Netzwerken.
Die CATT ist ein Beratungsdienstleistungsunternehmen im Bereich Innovationsmanagement
(innovative Ideen in Forschung, Technologie und Training). Ziel ist oberösterreichische
Unternehmen und Institutionen bei der Etablierung ihrer Innovationsprojekte über den
gesamten Lebenszyklus hinaus zu unterstützen.
206 vgl. (Land Oberösterreich 2013, InnovationsassistentInnen)
207 (CATT, 2013)
208 vgl. (Land Oberösterreich 2013)
78
Die CATT bietet in folgenden Bereichen ihre Dienstleistungen an:
• Durchführung einschlägiger Informations- und Bildungsveranstaltungen und Sammlung,
Weiterleitung und Verbreitung von wissenschaftlichen Informationen
• Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprojekten
• Förderung von Hochschulaufgaben
• Zuführung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen an die Wissenschaft und
Wirtschaft
• Technologiebewertung
• Einbindung von Experten (Kontaktherstellung, projektbezogener Einsatz)
• Förderberatung im Bereich Forschung, Technologie, Innovation
• Initiierung von Kooperationen (Planung und Begleitung)
• Technologiescouting (Hilfe beim Aufspüren von Zukunftstechnologien und Trends)
• internationale Verwertungskooperationen (Suche und Kontaktherstellung)
• Training im Innovationsmanagement 209
2.4.2.2.2 Kooperationsförderung
Das Land OÖ. fördert Kooperationen unter dem Titel „easy2innovate“ sowie für Netzwerk-
Kooperationsprojekte im Rahmen der EFRE-Förderung. Nachfolgend sollen beide
Fördervarianten kurz beschrieben werden.
easy2innovate – OÖ Kooperationsförderung KMU
Mit easy2innovate werden innovative Produkt- und/oder Verfahrensentwicklungen mit
wesentlichem Neuheitswert gefördert. Ansuchen können KMUs mit Sitz in Oberösterreich. Sie
sollen bereits erste Schritte in Forschung & Entwicklung gemacht haben und, in den letzten drei
Jahren:
• einen FFG-Innovationsscheck eingelöst haben,
• oder eine TIM210-Expertenberatung beansprucht,
• oder ein TIM-Machbarkeit-Transferprojekt beansprucht,
• keine Förderungen seitens der FFG, außer dem Innovationsscheck, erhalten haben
Als weitere Voraussetzungen gilt:
• Projektstandort in Oberösterreich
• Projektlaufzeit zwischen vier und 12 Monaten
• Projektvolumen zwischen 20.000 und 60.000 Euro
Das Land beabsichtigt mit dieser Förderung die Stärkung des Innovationspotentials der Unternehmen und
einen leichteren Zugang zu neuem technologischen Know-how. Gleichzeitig soll diese Förderung an
209 vgl. (CATT Innovation Management GmbH 2013)
210 TIM: Initiative TIM – Technologie- und Innovationsmanagement
79
größere Projekte wie beispielsweise der Cluster-Kooperationsprojekte, oder der FFG-Projekte
heranführen. 211 Für die Förderung im Rahmen der „EFRE-Förderung“ bzw. Netzwerk-
Kooperationsprojekte ist Voraussetzung, dass das Netzwerk Design & Medien Partner ist. Gefördert
wird lt. Richtlinien in Höhe von 30 % der förderbaren Kosten je Projektpartner, aber maximal mit 25.000
Euro je Partner, und 100.000 Euro Gesamtfördersumme je Projekt. Informationen darüber erhalten
Interessierte von der Koordinations- und Vermittlungsstelle, dem Netzwerk Design & Medien.212
2.4.2.2.3 Cluster und Netzwerke
Unter einem Cluster ist nach Porter213 ein wirtschaftliches Stärkefeld (Cluster) zu verstehen, das
die folgenden Merkmale erfüllt und besondere Wettbewerbsvorteile trotz globalisiertem
Wettbewerb generiert:
• eine kritische Masse von Unternehmen an einem Standort,
• verbundene Industrien und Institutionen (von Zulieferern über Universitäten bis öffentliche Stellen)
• deren Aktivitäten sich entlang einer, oder mehrerer Wertschöpfungsketten ergänzen,
oder deren Aktivitäten miteinander verwandt sind
Als berühmte Beispiele führt Porter das Silicon Valley und Hollywood an. 214 Um dieses
beschriebene Phänomen entstehen zu lassen wurden in OÖ. Cluster und Netzwerk-Service-
Organisationen und Impulszentren215 eingerichtet.216 Im Bereich Kreativwirtschaft kann das
Netzwerk Design & Medien, und auch die Creative Region Linz & Upper Austria gesehen werden.
Aber auch das Forum MozARThaus kann im weitesten Sinn als solches gesehen werden.
2.4.2.2.3.1 Förderung durch die Creative Region Linz & Upper Austria GmbH
Die Creative Region ist von der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich gegründet worden und
nahm 2012 seine operative Arbeit auf. Mit dieser Institution wollen die beiden
GesellschafterInnen Wachstum und Erfolg der Kreativbranchen in der Region unterstützen. 217
211 vgl. (Netzwerk Design & Medien 2013, easy to innovate), und (CATT Innovation Management GmbH 2012, easy to
innovate)
212 vgl. (Netzwerk-Design 2013)
213 vgl. Porter, M.E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. The Free Press: New York. z.i. (Netzwerk-Design
2013)
214 Vgl. (Porter 1998, S 77ff)
215 Z.B. Softwarepark Hagenberg, Business- u. Innovationszentrum Wels (BIZ Wels)
216 Vgl. (Land Oberösterreich 2013, Clusterland)
217 vgl. (Creative Region Linz & Upper Austria 2013)
80
Die Creative Region bietet Leistungen und Beratung unter folgenden Programmschienen an:
• Co-Creative Region ist ein speziell gestaltetes interaktives Beratungs-, Coaching- und
Vernetzungsprogramm für Kreativschaffende (Workshops zu betriebswirtschaftlichen
Themen, Marketing, etc. und „impulse lectures“)
• In Residence: Oö. Kreativschaffende erhalten ein Stipendium für zwei Monate in
„residence“ außerhalb Österreichs um ihr Projekt voranzutreiben und sich zu vernetzen.
• In Music bietet Workshop-, Vernetzungs- und Marketingprogramme für Musikschaffende
in OÖ.
• Open Design ist ein Projekt zur Etablierung der Region als Knotenpunkt für Open Design-
Entwicklungen. PartnerInnen sind die Kunstuniversität Linz, Otelo, die Open Commons
Region Linz und die Ars Electronica.218
• On Show: Ob ProduktdesignerInnen, Multimedia- und GrafikdesignerInnen oder
ArchitektInnen, sie erarbeiten gemeinsam eine professionelle Präsentation, die zu einer
internationalen Messe, fährt.219 Im Rahmen dessen wird durch Workshops relevantes
Marketingwissen vermittelt.
• Show me the Money ist ein „Guide“, der Infos zu Förderungen, Stipendien oder
Residencies kompakt zusammenfasst und bereitstellt und in Workshops individuelle
Bedarfe und Steuerangelegenheiten bespricht.
• Think out loud: Die Creative Region organisiert mit oö. Hochschulen Symposien zu
kreativwirtschaftlichen Themen.
Die Services und Veranstaltungstermine, sowie aktuelle Einreichtermine für Förderungen,
werden über die online-Plattform und einen Blog220 bekannt gegeben.
2.4.2.2.3.2 Netzwerk Design & Medien
Das Netzwerk Design und Medien ist „ ... das Kooperations-Kompetenz-Zentrum für die Bereiche
Design und Medien ...“221 in Oberösterreich. Es fördert Kooperationen, den Wissenstransfer und
die Vernetzung und bietet eine Datenbank über seine Mitglieder, sowie einen sehr guten
Überblick über relevante Förderungen durch die Förderdatenbank, die sie online zur Verfügung
stellt. Darüber hinaus ist es eine erfahrene Anlaufstelle für Information zu EU-, Bundes- und
Landesförderungen.222
218 Ziel ist es, die Philosophie der Open Source Bewegung auf die Entwicklung von physischen Produkten, Maschinen
und Anlagen durch den Einsatz von öffentlich geteilten Design-Informationen anzuwenden. Die Voraussetzung für
den Einsatz von Open Design ist der schwellenlose Zugang zu Informationen, Technologien, Infrastrukturen und
Produktionsmöglichkeiten. vgl. (Creative Region Linz & Upper Austria 2013, Projekte/open-design)
219 gefördert durch die Außenwirtschaft, sowie Mitteln des BMWFJ und der WKO.
220 (Creative Region Linz & Upper Austria 2013)
221 (Netzwerk-Design 2013)
222 vgl. (Netzwerk-Design 2013)
81
Mit der Creative Community verbindet sie ein gemeinsames Kooperationsprojekt, die Creative
DienstleisterInnen Datenbank „Cdi“. In dieser Datenbank finden sich alle
KreativdienstleisterInnen. Sie stellt eine Marketing- und PR-Plattform dar, auf der ein
detailliertes Unternehmensprofil, das Know-how und erfolgreiche Projekte präsentiert werden
können. 223 Für die Mitgliedschaft wird ein jährlicher fixer Betrag, gestaffelt nach
Unternehmensgröße, in Höhe von dzt. 320 bis 1.265 Euro netto, eingehoben.
2.4.2.2.3.3 Forum MozARThaus
Das Forum MozARThaus ist im Mozarthaus in Linz ansässig. Es ist eine oberösterreichische
Netzwerk-Plattform für UnternehmerInnen, KünstlerInnen, DesignerInnen und „kreative Köpfe“.
Das Forum bezweckt damit Synergieeffekte zwischen kreativen Branchen und anderen
wirtschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Das Bewusstsein für kreative Prozesse in der
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft soll erhöht werden. Es stellt Räumlichkeiten für
Diskussionsveranstaltungen und Ausstellungen zur Verfügung. Außerdem beherbergt es auch
das Institut „Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, das sich mit dem Thema zukunftsorientierte
Wirtschaftspolitik in Oberösterreich befasst.
Weitere Netzwerke, die aus Eigeninitiative der Kreativen entstanden sind, werden im Anhang
VIII zusammengefasst dargestellt.
2.4.2.2.4 Haftungen/Garantien/Bürgschaften
Das Land Oberösterreich bietet gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der
OÖ. Kreditwirtschaft224 Bürgschaften für Kredite und Private Kapitaleinlagen durch die OÖ.
Kreditgarantiegesellschaft (KGG) und die OÖ. Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (UBG).
Die KGG als Spezialbank bietet Bürgschaften für Kredite, die für Investitionen wie betriebliche
Sachinvestitionen, immaterielle Investitionen, Übernahmekosten (MBO225, MBI226, ...) oder
Betriebsmittel oder Bankgarantien gegeben werden. Diese sind ihre sog.
Standardbürgschaften. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit einer
223 vgl. (Creative Community Linz 2013) und (Netzwerk-Design 2013, Datenbank)
224 dazu zählen: BAWAG P.S.K., Oberbank, Oberösterreichische Landesbank (Hypo), Österreichische Volksbanken AG,
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Sparkassen-Landesverband, UniCredit Bank Austria AG, Volkskreditbank (vgl.
Remplbauer, Alternative Finanzierungs- und Förderinstrumente, JW OÖ, 08.11.2012)
225 Management Buyout
226 Management Buyin
82
Konsolidierungsbürgschaft für Sanierungsfinanzierungen. Für private Kapitaleinlagen
vergibt sie Eigenkapitalgarantien. Förderbare Unternehmen sind KMU’s mit geordneten
wirtschaftlichen Verhältnissen bzw. positiven Zukunftsaussichten. Begünstigte Kapitalgeber
sind natürliche Personen wie z.B. Eltern, Geschwister, MitarbeiterInnen. Ausgeschlossen sind
Unternehmensinhaber, Gesellschafter über 25 %, handelsrechtliche Geschäftsführer und
verdeckte Mitteleinbringung. Der Bürgschaftsumfang ist 80 % der Kapitaleinlage, aber maximal
75.000,-- Euro pro Kapitalgeber, und maximal 225.000,-- Euro pro Unternehmen und einer
Laufzeit von 10 Jahren. Die Besonderheit ist die Risikofreiheit für Banken und dass auch
Haftungspromessen möglich sind.227
2.4.2.2.5 Beteiligungen
Der Zweck der UBG ist Eigenkapital für kleine und mittlere Unternehmen zu günstigen
Konditionen zu vergeben. Für die Kreativwirtschaft können dabei die
Gründerfondsbeteiligungen, die echte stille Beteiligungen in Höhe von 20.000 Euro bis 75.000
Euro sind, interessant sein. Diese stellt auf Unternehmensgründungen und Betriebsübernahmen
sowie junge Unternehmen, deren Gründung nicht länger als drei Jahre zurückliegt, ab. Für die
OÖ. Gründerfonds sind ein schriftliches Unternehmenskonzept (Business Plan), Eigenmittel von
mind. 30 % der Beteiligung, sowie eine Gewerbeberechtigung Voraussetzung. Förderbare
Kosten sind materielle und immaterielle Investitionen, Umlaufvermögen (z.B. Warenlager-
Erstausstattung und Anlaufkosten für sechs Monate. Die Laufzeit beträgt fünf bis maximal 10
Jahre. Ab dem sechsten Jahr, d.h. in der zweiten Laufzeit-Hälfte ist die Beteiligung wieder
rückzuführen. Es wird in den ersten drei Jahren kein Gewinnanteil, sondern nur eine
Bearbeitungsgebühr von derzeit 360 Euro abverlangt. Es muss darüber hinaus ein
zinsbegünstigter Bankkredit in gleicher Höhe vorhanden sein.228 Diese o.g. Bürgschaften und
Garantien werden eher nur den größeren Unternehmen der Kreativwirtschaft zugesprochen
werden und auch nur dann, wenn sie den Antrag vor Projektbeginn stellen.229
Für Unternehmen, die einen höheren Kapitalbedarf haben, wie StartUps, gibt es die Möglichkeit
sich um eine Standardbeteiligung zu bewerben. Dabei müssen sie die fachliche und
kaufmännische Qualifikation der Unternehmensführung, eine ausreichende Rendite, und die
vertragsmäßige Abwicklung der Beteiligung, gewährleisten. Damit sollen kleine und mittlere
227 vgl. (Remplbauer, 08.11.2012) und (KGG-UBG 2012) und (Land Oberösterreich 2013, Bürgschaften)
228 vgl. (Remplbauer, 08.11.2012), und (KGG-UBG 2012)
229 (Remplbauer, 08.11.2012) und (Land Oberösterreich 2013, Wirtschaftsförderungen)
83
Unternehmen längerfristig auf eine breitere Eigenkapitalbasis gestellt werden. Diese
Beteiligungsförderung ist zweckgebunden für die Finanzierung von Strukturänderungen,
Innovative Entwicklungen, Betriebsgründungen und –übernahmen und
Marktwachstumsprojekte und –phasen. Die Beteiligung ist eine echte stille Beteiligung, d.h. das
Management bleibt autonom in seinen Entscheidungen, und beträgt mindestens 75.000 Euro
und maximal 500.000 Euro. Die Laufzeit wird individuell vereinbart und liegt zwischen 10 und
15 Jahren. Kosten, die der/die Antragsteller/in zu tragen hat sind einmalige
Bearbeitungsgebühren und ergebnisabhängige Kosten, sowie eine Mindestverzinsung und ein
einmaliges Abschichtungsagio.230 231
2.4.2.2.6 Zuschüsse und Subventionen
Für Projekte, die im Rahmen der aws-Förderung Jungunternehmerprämie und
Jungunternehmer-Topprämie einschließlich Gründungs-/Nachfolgebonus zugesprochen werden,
erhalten vom Land OÖ. zusätzliche Fördergelder. Ein Antrag ist über den Weg der Hausbank,
oder direkt an das Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche
und ländliche Entwicklung zu stellen.232233
2.4.2.2.7 Wirtschaftsimpulsprogramme (WIP)
Das Land OÖ. hat ein Wirtschaftsimpulsprogramm für materielle Investitionen für 2011-2013
aufgelegt. 234 Gefördert werden kleine, mittlere und große (ausschließlich in nationalen
Regionalfördergebieten) Unternehmen, die als Voraussetzung einen einschlägigen
Gewerbeschein besitzen, und entweder einen neuen Betrieb gründen, oder sich in OÖ. ansiedeln
wollen, oder aufgrund öffentlichem Interesse verlegen, oder den Betrieb um eine grundlegende
Verfahrens-, Produkt- oder Dienstleistungsinnovation erweitern wollen. Gefördert wird nur,
wenn auch eine der Bundesförderstellen einen positiven Bescheid erteilt hat und noch nicht mit
Maßnahmen begonnen wurde. Die Landesförderung betrifft dann die Betriebsverlegung,
Übernahmekosten einer Betriebsstätte die geschlossen worden ist, die Errichtung und
Verbesserung von Transport- oder Logistikeinrichtungen, den Auf- und Ausbau von regionalen
Informationssystemen und Investitionen bis max. 100.000 Euro von Mittelunternehmen.
Gefördert wird in einer Höhe ab 100.000 Euro bei Bundes- und Landesförderungen, und ab
230 1 Mal max. Jahresgewinnanteil
231 vgl. (Land Oberösterreich 2013, Wirtschaftsförderungen)
232 vgl. (Land Oberösterreich 2013, Wirtschaftsförderungen)
233 vgl. (Land Oberösterreich 2012, Förderungen)
234 vgl. (Land Oberösterreich 2013, Wirtschaftsförderungen)
84
25.000 Euro bei Landesförderungen. Außerhalb der nationalen Regionalfördergebiete beträgt
die Förderhöhe maximal 20 % bei kleinen Unternehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich zur
Investitionsförderung eine Arbeitsplatzprämie, ein Humanressourcen- bzw. ÖKO-Bonus gewährt
werden.235Wirtschaftsimpulse sollen auch durch die Förderung von Ausbildungsmaßnahmen
gesetzt werden. So werden Kurs- und Prüfungskosten von KMUs bis zu 25 %, bei mittleren
Unternehmen bis zu 15 % netto gefördert. KMUs müssen Mitglieder der WKO sein.236 Mit
Exportfördermaßnahmen sollen ebenfalls Wirtschaftsimpulse für oö. Unternehmen gesetzt
werden. Angeboten wird eine Förderung für KMUs in Form einmaliger, nicht rückzahlbarer
Beihilfen für u.a. externe Beratungskosten zu exportfördernden Marketingmaßnahmen.237
Bezüglich Exportförderung bietet die Außenwirtschaft Österreich zusätzlich zwei Förderungen
an. Mit dem „Exportscheck für Europa“ und dem „Exportscheck für Fernmärkte“ werden
Beratungs-, Marketing-, Veranstaltungs-, sowie Reise- und Nächtigungskosten in Höhe von 50 %
der direkten Markteintrittskosten, maximal jedoch 5.000 bzw. 10.000 Euro gefördert.
Förderwerber können KMUs sein.
2.4.2.2.8 Förderung „kreatives Handwerk“
Diese regionale Förderung soll oberösterreichische Gewerbe- und Handwerksbetriebe
ansprechen und motivieren mit Produkt- und Industriedesignern zusammenzuarbeiten. „Ziel ist
es, die vielfach vorhandenen kreativen Ideen für neue Produkte und Innovationen mit Designern
weiterzuentwickeln und umzusetzen.“ Angestrebt ist die Etablierung einer nachhaltigen
Zusammenarbeit von Unternehmen und Industrial Designern. Die Zielgruppe sind „alle
oberösterreichischen Kleinst- und Kleinunternehmen, die der Sparte Gewerbe und Handwerk der
Wirtschaftskammer Oberösterreich angehören, und Betriebe, deren Leistungserstellung dem
traditionellen Gewerbe und Handwerk ähnlich ist.“238 Gefördert werden, durch eine Fachjury
bewertete Projekte, mit einem Zuschuss im Ausmaß von höchstens 50 % der förderbaren
Projektkosten. Diese dürfen nicht bei einer anderen österreichischen Förderstelle eingereicht
werden. Das Förderprogramm Kreatives Handwerk wird von der austria wirtschaftsservice
GmbH (aws) und vom Land OÖ. gemeinsam finanziert.239
235 vgl. (Land Oberösterreich 2013, Wirtschaftsförderungen)
236 vgl. (Netzwerk Design & Medien 2013)
237 vgl. (Land Oberösterreich 2013, Wirtschaftsförderungen)
238 vgl. (Netzwerk-Design 2013, Förderdatenbank)
239 vgl. (Netzwerk-Design 2013, Förderdatenbank) und (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Evolve)
85
2.4.2.2.9 Filmförderung – touristisch und kulturell
Das Land Oberösterreich bietet zwei Filmförderungen an. Zum einen ist das die touristische
Filmförderung, mit der Produktions- bzw. Herstellkosten von TV-, Spiel- und
Dokumentationsfilmen, sowie TV-Serien gefördert werden. Die Förderhöhe beträgt maximal
10 % der förderbaren Produktions- bzw. Herstellkosten. Förderwerber können gewerbliche
ProduzentInnen sein, die ihre Betriebsstätte in Oberösterreich, am Filmdrehort gründen.
Abgezielt wird von Seiten des Landes auf die Umwegrentabilität, die einen wirtschaftlichen
Regionaleffekt hat. Einzureichen ist bei der Geschäftsstelle der OÖ. Filmkommission, Direktion
Kultur in einfacher Ausfertigung für Projektvolumen unter 15.000 Euro. Für Summen darüber
ist in sechsfacher Ausfertigung an jeweils spätestens vier Wochen vor den Sitzungsterminen,
beim Amt der oö. Landesregierung, Direktion Kultur das Ansuchen einzureichen.240
Die zweite Filmförderung betrifft den kulturellen Film aus den Bereichen Experimental-,
Dokumentar- und Spielfilm mit künstlerischem Schwerpunkt und Regionalbezug. Gefördert wird
gemäß der Empfehlung der OÖ. Filmkommission bis maximal 10 % der förderbaren
Projektentwicklungs-, Herstellungs- und Verwertungsförderung. Das Projektvolumen muss
allerdings höher als 15.000 Euro sein. Die Auszahlung erfolgt in mehreren Raten. Die letzte
Auszahlung erfolgt erst nach Fertigstellung des Films und nach ordnungsgemäßer Abrechnung.
Als Förderwerber kommen fachlich, dh. künstlerisch ausreichend qualifizierte und erfahrene
natürliche oder juristische Personen in Betracht. Das Förderansuchen ist in sechsfacher
Ausfertigung einzureichen. Diese Förderung stellt auf die Stärkung des Filmstandortes OÖ. ab, in
dem es oberösterreichische FilmemacherInnen fördert.241 Fördergebende Stelle ist das Amt der
oö. Landesregierung,Direktion KulturInstitut für Kunst und Volkskultur.242
2.4.2.2.10 Kulturförderung
In den Bereichen Gegenwartskunst und Zeitkultur Bildende Kunst, Musik, Darstellende Kunst,
Literatur, Filme/Video/Neue Medien, Kino, Zeitkultur, Gemeindekultur/Kulturzentren und EU-
Strukturförderung, sowie im Bereich Volkskultur/Jugendkultur und Kulturelles Erbe, und
Wissenschaft wird in Form von Ankäufen, Zuschüssen und Stipendien gefördert. Dazu gehört
auch die Vermittlung, und Beratung nach dem Kulturförderungsgesetz des Landes.
Vorausgesetzt wird, dass ein Projekt nur mit dieser Förderung durchführbar ist und eine
Perspektive auf Animation, Innovation, Dezentralisierung, Vermittlung, erkennen lässt. Eine
240 (Land Oberösterreich 2013) (Land Oberösterreich 2011) und (Land Oberösterreich 2008)
241 vgl. (Land Oberösterreich 2011)
242 vgl. (Land Oberösterreich 2008)
86
soziale Rechtfertigung ist, sowohl in Bezug auf die Position des Projektträgers, als auch die
Wirkungsweise des Projekts, zu beachten. Der Antrag ist an das Institut für Kunst und
Volkskultur in Linz zu stellen.243 Im Bereich Kulturförderung (Kunst im interkulturellen Dialog)
vergibt das Land Oberösterreich auch einen großen und einen kleinen Landeskulturpreis mit
den Dotierungen: 7.500 Euro für den großen, und 3.000 Euro für den kleinen. Diese Preise
werden nur einmalig an ein und dieselbe Perons vergeben. Beide Preise werden über Vorschlag
einer unabhängigen Jury von der oö. Landesregierung verliehen. 244
2.4.2.3 Stadt Linz
Die Stadt Linz bietet Förderungen im Bereich Wirtschaftsförderung und Kulturförderung, sowie
durch Preise und Stipendien. Die Creative Community wickelt die
„Kreativwirtschaftsförderung“ der Stadt ab.
2.4.2.3.1 Creative Community
Das Wirtschaftsservice der Stadt Linz bietet die GründerInnenförderung „Mietzuschuss Creative
Community, Magistrat der Landeshauptstadt Linz“ an. Es handelt sich um eine Mietförderung für
GründerInnen in Höhe von 5,70 Euro/m2, bei maximal 40 m2 Geschäftsfläche. Die Förderung ist
gestaffelt und beträgt im ersten Jahr 50 %, im zweiten Jahr 40 %, und im dritten und letzten
Förderjahr 30 %. Damit soll dem hohen Bedarf der Kreativwirtschaft an preiswerten Büro- und
Geschäftsflächen Rechnung getragen werden und kreative Gründerinnenzentren aufgebaut
werden. Es werden freie Flächen am Linzer Hafen, im Q70-Business Center, sowie im H40-
Humboldtstraße 40 angeboten. Derzeit sind in den geförderten Räumlichkeiten 18
Kreativunternehmen tätig. 245
Neben diesem monetären Förderangebot für die Kreativwirtschaft, bietet das Wirtschaftsservice
der Stadt Information und Vermittlung zu relevanten Förderstellen des Landes OÖ. Auf der
Homepage der Creative Community ist die Möglichkeit einer Newsletter-Subskription
eingerichtet. Der Newsletter informiert über aktuelle Termine und Wissenswertes für die
Kreativwirtschaft. Mit dem Netzwerk Design & Medien verbindet sie ein gemeinsames
Kooperationsprojekt, die Creative DienstleisterInnen Datenbank – Cdi. Ein weiteres
Kooperationsprojekt ist das Forum MozARThaus.246
243 vgl.(Land Oberösterreich 2012, Kulturförderung)
244 vgl. (Land Oberösterreich 2012, Kulturförderung)
245 (vgl. (Creative Community 2009) und (Creative Community Linz 2013)
246 (Creative Community Linz 2013)
87
2.4.2.3.2 Kulturförderung
Der Schwerpunkt der Kunst- und Kulturförderung der Stadt Linz liegt bei der Förderung von
gemeinsamen Kommunikations- und Organisationsbüros, Produktionsstätten und Schnittstellen
mit speziellen Schwerpunkten wie Neue Medien, Video-Schnittstelle, Public Access-Arbeitsplatz,
Werkstätten/Labors und der Bereitstellung von Hardware für Veranstaltungen und Produktion
(z.B. Gerätepool). Weitere Schwerpunkte der Förderpolitik sind die Bereitstellung von
„Risikokapital“ für innovative Kunst- und Kulturprojekte, der Ausbau von Netzwerk-Zugängen,
die Förderung einer autonomen Stadtzeitung und des Freien Radios. Der Fokus der Förderungen
liegt in einer längerfristigen Unterstützung, die mittels mehrjähriger Fördervereinbarungen
geschlossen werden sollen. Die Stadt Linz will zukünftig, gemeinsam mit dem Land OÖ., einen
Förderfonds zur Förderung von besonders innovativen und experimentellen Kunstprojekten
einrichten. Für 2013 schreibt die Stadt Linz kulturelle Sonderförderprogramme und
Förderpreise aus, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:
Programm/Preis Förderfokus Fördersumme in Euro
LINZimPULS Innovative Kunst- u.
Kulturprojekte247
90.000
LinzEXPOrt Experimentelles u. künstlerisches
Arbeiten
50.000
LinzIMpORT Einladung auswertiger
Kunstschaffende u.
KulturarbeiterInnen
20.000
LinzKultur/4 Innovative Stadtteilkulturarbeit 10.000
Stadt der Kulturen DialogpartnerInnen für
interkulturelle Projekte
10.000
3.500248
Kunstförderstipendien Für noch nicht etablierte Kunst- u.
Kulturschaffende249
2.500 pro Sparte
Tabelle 14: Kulturelle Sonderförderung250
247 Förderung für freiberuflich tätige KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen mit Linz-Bezug
248 Anerkennungspreis für herausragendes interkulturelles Engagement in pädagogischen Einrichtungen
249 Sparten: Architektur und Stadtgestaltung / Bildende Kunst und interdisziplinäre Kunstformen / Literatur und
Kulturpublizistik / Medien-, Produkt- und Kommunikationsdesign / Musik und Darstellende Kunst.
250 Eigendarstellung
88
2.4.2.3.3 Preise und Stipendien
Seit 1960 vergibt die Stadt Linz alle zwei Jahre Kunstförderstipendien an junge KünstlerInnen in
den Sparten Architektur, Bildende Kunst, Design, Literatur und Musik. In der Sparte Bildende
Kunst werden zusätzlich zwei Künstlerateliers vergeben. Weitere Preise sind der
„Kunstwürdigungspreis“, ein jährlicher Förderpreis für interkulturelles Engagement „Stadt der
Kulturen“, sowie als Anreiz zum kulturellen Austausch und künstlerischen Auseinandersetzung
mit dem Stadtteil/Viertel der „LinzKultur/4“-Förderpreis für innovative Stadtteilkulturarbeit.
Der Frauenausschuss des Linzer Gemeinderats und das Linzer Frauenbüro haben einen
alternierenden Preis, den „Marianne.von.Willemer-Preis für digitale Medien“ sowie den
„Marianne.von.Willemer-Frauen.Literatur.Preis“ herausgegeben. Dieser wird in Kooperation mit
dem Ars Electronica Center Linz und dem ORF vergeben.
2.4.3 Förderung durch Interessensgruppen und Vereine
Zahlreiche Interessensgruppen und Vereine bemühen sich um ihre Mitglieder. Die Aktivitäten
reichen von Services wie Beratung und Information, bis hin zur Interessensvertretung
gegenüber der Politik. In diesem Kapitel werden jene Angebote zusammengefasst, die für die
Kreativwirtschaft besonders interessant sind. Darüber hinaus werden weitere Netzwerke aus
der Region, die auf Privatinitiativen gründen exemplarisch im Anhang VIII zusammengefasst.
2.4.3.1 WKO
Die Wirtschaftskammer bietet eine breite Palette an Fördermaßnahmen an, dazu gehören das
Gründerservice, die arge creativ wirtschaft austria, die insbesondere für
Kreativwirtschaftsthemen Ansprechpartnerin ist, das JungunternehmerInnen-Coaching, das
Expert Network Kreativwirtschaft, sowie die Junge Wirtschaft und die WKOÖ auf Regionalebene.
2.4.3.1.1 Gründerservice
Das Gründerservice der WKO unterhält eine eigene Homepage mit allen relevanten Themen
rund um die Gründung, Unternehmensnachfolge oder Franchise eines Unternehmens. Es bietet
Information und Beratung251 Das Gründerservice stellt eine Applikation, das „Gründernavi“ für
Mobiltelefone zur Verfügung, dadurch werden JungunternehmerInnen in vier Phasen Schritt für
Schritt durch den Gründungsprozess begleitet. Eine Aufgabenliste zum abhaken und eine
251 vgl. (Gründerservice 2013)
89
Statusanzeige verschaffen den nötigen Überblick. Informationen über Zugang zu Services und
Beratungsstellen werden gegeben.252
2.4.3.1.2 arge creativ wirtschaft austria253
Die arge creativ wirtschaft austria (cwa) ist das Kompetenzzentrum für Kreative. Es nimmt seit
2003 bundesweit die Interessen der österreichischen KreativunternehmerInnen wahr.
Eingegliedert in die Wirtschaftskammer Österreich bildet sie die Nahtstelle zur Wirtschaft
allgemein und unterstützt alle Kreativen, die sich unternehmerisch entwickeln wollen. Dabei ist
es nicht nötig Mitglied der Wirtschaftskammer zu sein. Die cwa ist in dreierlei Hinsicht tätig.
Durch Unterstützung mit Serviceleistungen und als Interessensvertretung setzt sie sich für
günstige Rahmenbedingungen ein und drittens fungiert sie als Wissensdrehscheibe für die
Belange der Kreativwirtschaft.254
2.4.3.1.3 Hotline Creativwirtschaft Austria255
Die Hotline für Kreative der Creativwirtschaft Austria stellt einen zentralen telefonischen
Informationszugang bereit bzw. steht sie per Email, für die Kreativwirtschaft zur Verfügung. Sie
ist eine PR-Maßnahme, aber auch ein sehr nützlicher Erstzugang zu Informationen rund um
öffentliche Förderungen und AnsprechpartnerInnen in der Kreativwirtschaft. Unter der
österreichweiten Telefonnummer 05-90900-4000 bzw. der Email-Adresse
[email protected] sind die MitarbeiterInnen der Creativwirtschaft Austria direkt
erreichbar. Sie stehen mit Rat und Tat rund um Unternehmensgründung und
Geschäftsentwicklung, zu Weiterbildung und Netzwerken, Förderungen und Kooperationen
sowie bei Rechtsfragen gerne zur Verfügung. Gegebenenfalls wird je nach Bedarf an kompetente
PartnerInnen und Servicestellen weitervermittelt.256
2.4.3.1.4 CreativDepot257
Das CreativDepot ist ein Online-Service der Creativwirtschaft Austria. Kreative können ihre
Geschäftsideen und Erfindungen in einen „Online-Postkasten“ deponieren. Diese Ideen erhalten
252 vgl. (Gründerservice 2013)
253 vgl. (evolve 2012)
254 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, creativ wirtschaft austria)
255 vgl. (evolve 2012)
256 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2012, creativ wirtschaft austria)
257 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, creativ wirtschaft austria)
90
durch einen Time-Stamp des „Einwurfs“ einen gewissen Urheberrechtsschutz. Das erfolgt in drei
Schritten: 1. kostenlos registrieren, 2. Nutzungsrechte festlegen und 3. Werk hochladen.258
2.4.3.1.5 JungunternehmerInnen-Coaching
Die Wirtschaftskammer bietet ein kostengünstiges und finanziell unterstütztes Coaching für
JungunternehmerInnen im Bereich Marketing, Controlling, Finanzierung, MitarbeiterInnen-
motivation, Engagement für MitarbeiterInnen und Umwelt an. Das geförderte
JungunternehmerInnen-Coaching können Ein-Personen-Unternehmen, Klein- und Mittelbetriebe
in Anspruch nehmen. Das „WIFI Unternehmerservice“ des WIFI der Wirtschaftskammer ist
organisatorisch für die Koordination in den Bundesländern verantwortlich.259
2.4.3.1.6 Expert Network Kreativwirtschaft
Das Expert Network Kreativwirtschaft soll Intermediären und wichtigen AkteurInnen der
österreichischen Kreativwirtschaft als Vernetzungsmöglichkeit und zum Erfahrungsaustausch
dienen. Organisiert werden die Netzwerktreffen von der Creativwirtschaft Austria.260
2.4.3.1.7 Junge Wirtschaft OÖ. der WKO
Die Junge Wirtschaft der WKO ist die Interessensvertretung von JungunternehmerInnen. Sie hat
Dependancen in allen Bundesländern und Bezirken. Mit regelmäßigen Veranstaltungen, wie der
„InnovierBAR“, „GestaltBAR“, „VermarktBAR“, „FinanzierBAR“, „KooperationsBAR“, und
„SchützBAR“, ist sie mit zentralen Gründungsthemen in den Bundesländern präsent. Sie bietet
auch Beratung und Vermittlung in diesen Bereichen an. Sie informiert via Newsletter über
politische Themen und Serviceleistungen der Jungen Wirtschaft. Die Junge Wirtschaft ist auch
erste Anlaufstelle für das europäische Austauschprogram Erasmus für JungunternehmerInnen.
Als Mitglied des Dachverbandes Junior Chamber International (JCI) erhalten Mitglieder der JW
Zugang zum Netzwerk mit über 160.000 Mitgliedern in mehr als 110 Ländern. Die JW
organisiert gemeinsam mit der Außenwirtschaft Österreich (AWO) Reisen zu internationalen
Leitmessen.261
258 vgl. (creativ wirtschaft austria 2013)
259 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Jungunternehmerförderung)
260 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, creativ wirtschaft austria)
261 vgl. (Junge Wirtschaft 2013)
91
2.4.3.1.8 WKOÖ - Gründerservice
Die WKOÖ ist die oberösterreichische Zweigstelle der WKO und bietet die breite Palette der
Services der WKO an. Diese umfassen u.a. die Themen Arbeitsrecht, Steuern und Förderungen,
Unternehmensgründung, Wirtschafts- und Gewerberecht und Außenwirtschaft. Im
Zusammenhang mit dieser Arbeit sind die Bereiche Gründungsservice und Beratung und
Information zu Förderungen und Finanzierungsquellen relevant. Die WKOÖ kann als
Erstanlaufstelle für Information zu Förderungen und Finanzierungsquellen gesehen werden. Sie
lädt zu Informationsveranstaltungen über aktuelle Wirtschaftsthemen, wie alternative
Finanzierungsmöglichkeiten zu Förderungen und Bankkrediten, ein. Als ein weiteres Beispiel für
die Informationsweitergabe und Beratung, sind die Vorbereitung auf das Bankgespräch, die
Optimierung der Finanzlage für KMUs, u.am. zu nennen. 262
Geförderte Beratungsleistungen, die die WKOÖ anbietet, sind Themen wie:
• „Durchgängiges Innovationsmanagement“,
• „Innovations-Check“,
• „innovative Strategie und Konzepte entwickeln“,
• „mit effizienten Geschäftsprozessen rascher zu Innovation“,
• „Wachstum durch neue Ideen“,
• „Innovationen vermarkten und verwerten“
• „Logistik-Check“
Bis auf den „Innovations-Check“, der mit 100 % d.s. 700 Euro gefördert wird, werden alle
anderen Beratungsleistungen mit 50 % der Nettokosten, jedoch maximal 1.050 Euro
gefördert.263 Das Gründerservice bietet Information und Beratung speziell zu Themen rund um
die Gründung eines Unternehmens. Von der persönlichen Voraussetzung, der Idee, der
rechtlichen Voraussetzung, dem Businessplan, zu Finanzierung, Förderung und Amtswegen
bietet die WKOÖ Information und Beratung. Manche Informationen sind in Form von Online-
Checks und Mobiltelefonapplikationen verpackt.264
Mit dem Film Forum Linz schreibt die WKOÖ. den Wettbewerb der „BESTEN FILME
ÖSTERREICHS“ in der Kategorie Werbe- und Wirtschaftsfilme aus. Dieser wurde im November
2012 zum vierten Mal in fünf Kategorien vergeben. Diese Kategorien sind IMAGE FILM,
CORPORATE VIDEO, TECHNOLOGIE FILM, TOURISMUS FILM, TV- UND KINO SPOT, sowie
FUTURE - DER JUNGE FILM. Sonderpreise wurden für die beste Kamera und die beste Musik
262 vgl. (WKO 2013 WKO Portal/OÖ.)
263 vgl. (Netzwerk Design & Medien 2013, Datenbank)
264 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Portal/OÖ.)
92
vergeben. Es handelt sich um eine Imagewerbung für den österreichischen Film, die
Einreichgebühr beträgt 50 Euro.265
2.4.3.2 Hochschulen
Um die Gründerzahl von Hochschulabsolventen zu erhöhen und ihnen bei den ersten Schritten
bis zur Gründung unterstützend zur Seite zu stehen, wurden in den letzten Jahren einige
Aktivitäten an Hochschulen gesetzt und es haben sich Institutionen herausgebildet, die im
Folgenden vorgestellt werden.
2.4.3.2.1 StartUp-Center des IUG
Das StartUp-Center des Instituts für Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung
(IUG) unterstützt gründungs- und übernahmeinteressierte Studierende, AbsolventInnen,
MitarbeiterInnen und ForscherInnen der Johannes Kepler Universität Linz in Form von
Awarenessveranstaltungen, Netzwerkmöglichkeiten, Weiterbildungskursen und Beratungs-
sowie Coachingangeboten (teils in Kooperation mit externen FachexpertInnen, sowie mit
Einrichtungen der Gründungsinfrastruktur). Eine der Aktivitäten findet im Rahmen des sog.
„Gründercafés“ statt. Das Gründercafé wird vierteljährlich am Campus abgehalten. Es soll
gründungsinteressierte StudentInnen der technischen sowie der sozialwirtschaftlichen
Fakultäten der Kepler Universität Linz in einer ungezwungenen Atmosphäre zum Netzwerken
anregen. Es wird die Möglichkeit geboten mit GründungsexpertInnen in Kontakt zu treten.266
Das StartUp Center fungiert auch als Schnittstelle zu bestehenden Fördereinrichtungen des
Landes Oberösterreich. Das StartUp-Center ist ein Angebot des Instituts für
Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung und damit organisatorisch sowie
rechtlich dem IUG eingegliedert.267
2.4.3.2.2 Akostart OÖ.
Akostart ist das akademische StartUp Netzwerk in Oberösterreich und wurde als Verein 2012
gegründet. Die Träger des Vereins sind die Kunstuniversität Linz, die Johannes Kepler
Universität Linz, sowie die FH Oberösterreich. Er hat seinen Sitz im Stadtzentrum von Linz und
bietet unbürokratisch Unterstützung für gründungswillige StudentInnen. Unterstützung
erfahren Gründungswillige durch eine Office-Infrastruktur im „Coworking-Space“, sowie in der
265 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Filmforum Linz)
266 vgl. (Kepler Universität Linz 2013, IUG)
267 vgl. (Kepler Universität Linz 2013, IUG)
93
Überprüfung und im Coaching von technischer, wirtschaftlicher und persönlicher Machbarkeit
ihrer Vorhaben und Zugang zu unternehmerischen Rahmenbedingungen wie Netzwerk, Kapital
und Infrastruktur. Es werden Workshops, Netzwerktreffen und Veranstaltungen in Kooperation
mit der Creativen Region Linz und Upper Austria, der Jungen Wirtschaft und Anderen zu
wichtigen Gründungsthemen abgehalten. Akostart hat vor in Räumlichkeiten der Tabakfabrik
Linz einzuziehen, um Synergieeffekte mit den Kreativen Vorort zu nutzen. 268
2.4.3.2.3 tech2b
tech2b ist der Hightech-Inkubator269 in Oberösterreich. Tech2b unterstützt und begleitet
innovative technologie- und designorientierte Gründungsvorhaben. Für das
Förderungsprogramm, steht AplusB270 (Akademiker plus Business) Pate, daher ist auch
Voraussetzung, dass zumindest eine Person im Gründungsteam eine akademische Ausbildung
vorweist. Gefördert werden entwicklungsintensive Geschäftsideen, im innovativen
technologischen Bereich oder mit kreativen Aspekten. Eine dritte Voraussetzung ist, dass die
Firmengründung in Oberösterreich erfolgt. Die Projektlaufzeit beträgt zwischen 12 und 14
Monaten, eine Auszahlung der Förderung erfolgt in mehreren Raten und kann pro Projekt bis zu
100.000 Euro betragen. Gefördert werden zweckgebunden Personalkostendarlehen bis 40.000
Euro, Büro, Schulungen, Mentoren bis zu 15.000 Euro, und F&E Material, Marketing, Patente,
Dienstleistungen, etc. frei verfügbar bis zu 45.000 Euro.271
Seit April 2013 kooperiert tech2b mit der Creative Region Linz & Upper Austria. Dadurch
können StartUps aus der Kreativwirtschaft, die den Voraussetzungen entsprechen nun auch
diese Förderungen in Anspruch nehmen. Das Portfolio umfasst Trainings, Coachings,
Infrastruktur, Netzwerk-Community und finanzielle Förderungen, wie bereits oben genannt.272
268 Weiß im Interview (Weiß 2012) und vgl. (akostart 2013)
269 Die Bezeichnung ist eine Metapher und geht auf den Inkubator von Frühgeborenen zurück, in dem das Baby
gewärmt und versorgt wird, bis es ohne medizinische Hilfe überlebensfähig ist.
270 AplusB (Akademiker plus Business) ist ein Förderprogramm des BMVIT u. FFG zur Förderung innovativer,
technologieorientierter Unternehmensgründungen aus dem akad. Sektor, es hat österreichweit acht Zentren, eines
davon ist tech2B in OÖ.
271 vgl. (AplusB 2013, Factsheet)
272 vgl. (AplusB 2013, Creative Region und tech2B)
94
2.4.3.2.4 EDISON Der Preis
Der Edison ist ein zweistufiger Ideenwettberb für technologie-, innovativ- und kreativ-
wirtschaftliche Ideen aus Oberösterreich. Träger des Wettbewerbes sind tech2b, die Johannes
Kepler Universität Linz, die FH Oberösterreich, sowie die Kunstuniversität Linz. Unterstützung
erfährt der Wettbewerb auch von business pro austria273 und der Creative Region Linz & Upper
Austria. Ziel des EDISON ist Innovation zu ermöglichen und erfolgreiche Unternehmen zu
formieren. Mit der engen Kooperation von Wissenschaft, Kreativität und Wirtschaft sollen
Innovationsprozesse in Gang gesetzt werden. Mit dem EDISON sollen dafür Impulse gesetzt
werden. Von den Teams, die sich bewerben, werden die besten gefiltert. Diese erhalten ein
Coaching von ExpertInnen gratis. Die Coaches begleiten bei der Entwicklung von
Umsetzungsstrategien und bereiten die Teams auf Investitionsgespräche vor. Am Ende des
Prozesses treten die Teams mit einer Präsentation vor die Jury. Diese vergibt in jeder der drei
Kategorien: technologie-orientierte Idee, innovativ-orientierte Idee und kreativ-wirtschaftliche
Idee, die drei EDISON Preise in Gold mit 3.000 Euro, in Silber mit 2.000 Euro, und in Bronze mit
1.000 Euro. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis für besondere wissenschaftliche Leistungen in
der Kategorie „technologie-orientierte Ideen“ in Höhe von 500 Euro vergeben.
273 business pro austria ist eine Coachinginitiative des Verbandes der Technologiezentren Österreichs (VTÖ), die
Gründern durch den Entwicklungsprozess bis zur Gründung eines Unternehmens begleitet.
95
2.4.4 Finanzmittel von nicht öffentlicher Seite
Da Förderungen alleine nur einen Anschub leisten können, stellt sich die Frage nach der
Abdeckung des Finanzbedarfs in anderer Weise. Der Vorteil gegenüber öffentlichen
Förderungen liegt in der Möglichkeit höhere Summen auftreiben zu können, und in einer
rascheren Gewissheit, ob Dritte bereit sind Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. In diesem
Kapitel sind Finanz- und Sachmittel in Form von Equity Capital, Sponsoringleistungen,
Eigenleistung, und Fremdkapital in Form von Krediten und Darlehen der Banken, angesprochen.
2.4.4.1 Equity Capital
Unter Equity Capital wäre Beteiligungskapital zu verstehen, meint Franke.274Die Definition von
Lowinski & Schiereck unterstellt, dass der Equity Capital Geber für seine Geldleistung
Eigenkapitalanteile erhält, die Vergütung ausschließlich in Aktien erfolgt.275 Equity Capital ist
hauptsächlich interessant für junge, stark wachsende, technologiebasierende Unternehmen der
Kreativwirtschaft mit hohem Kapitalbedarf,276 wie beispielsweise Unternehmen aus dem
Bereich Spielesoftware.
Eigenkapital und Beteiligungskapital muss aber nicht notwendigerweise monetär sein, meinen
Volkmann/Tokarski/Grünhagen. Auch das Einbringen von Know-how und Arbeitsleistung kann
als Equity Capital betrachtet werden.277 Ein Beispiel dafür könnte ein erst kürzlich gegründetes
Unternehmen „STARTeurope“ sein, das Gründungswillige auffordert in einer Art Partnerbörse
Live zueinanderzufinden und eine Idee bis zur Unternehmensgründung gemeinsam zu
entwickeln.
STARTeurope
Bezeichnet sich selbst als „The Makers of Pioneers Festival – Pioneers unplugged“ und
organisiert drei Tage dauernde StartUp-Events europaweit, und bietet damit ein Netzwerk,
Ressourcen und Incentives für Einzelpersonen und Teams. Promotet wird, dass innerhalb eines
Wochenendes ein StartUp entstehen kann. Es wurde im Dezember 2012 in Wien gegründet.278
274 vgl. (Franke et al, 2006, S. 3)
275 vgl. (Lowinski und Schiereck 2005, S 1-22)
276 vgl. (Volkmann, Tokarski und Grünhagen 2010, S 88ff)
277 vgl. Volkmann, Tokarski und Grünhagen 2010, S. 85f)
278 vgl. (Starteurope 2013)
96
2.4.4.1.1 Founder, Family, Friends & Foolhardy Investors
Die sog. „3 F“ Familie, der Freundeskreis und die Foolhardy Investors, unter letzteren sind lt.
Volkmann279 Privatinvestoren und Business Angels gemeint, werden immer wieder als wichtige
Kapitalgeber vor allem in der Vor- und Gründungsphase genannt. In der Praxis, so geht aus
geführten Interviews hervor, hat der Familien- und Freundeskreis jedoch kaum Bedeutung.
Wichtig in der Vor- und Gründungsphase ist vor allem das eigene Ersparte des/der Gründers/in,
das vierte F (Founder). Dieses reicht aber oft nicht aus, sodass Förderungen für
Finanzierungslücken in Betracht kommen. Um aus dem Ersparten finanziell das Bestmögliche
herausholen zu können, gibt es, wie in Kapitel Gründungssparen S. 225 genannt, das sog.
Gründungssparen bzw. den Gründungsbonus.
2.4.4.1.2 Business Angels
Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung mit Eigenkapital bieten sog. Business Angels. Unter
Business Angels sind nach Brettel „Privatpersonen, die sich im Austausch mit Anteilen an
Unternehmen direkt und ohne formellen Mittler beteiligen“ und in zweierlei Hinsicht ihre Leistung
einbringen, einerseits in Form von Kapital, und andererseits als informelle Unterstützung, zu verstehen.
Letztere kann sich bis zur aktiven Mitarbeit im Unternehmen ausweiten.280 In Österreich gibt es einige
Netzwerke rund um Business Angels, vier davon werden nun exemplarisch genannt:
AAIA
In Österreich gibt es eine als Verein organisierte Vertretung der Business Angels, die Austrian
Angel Investors Association (AAIA). Diese versteht sich zwar nicht als „Matching
Plattform“ leitet jedoch gerne kurz gehaltene Projektvorstellungen an ihre Mitglieder,
potentielle Investoren weiter. 281
AICO
AICO ist der Angel Investment Club Oberösterreich. Er hat sich 2009 neu organisiert und ist
nunmehr beim Inkubator tech2b operativ angesiedelt. Sein Zweck ist die Vermittlung von
Finanzierung und Unterstützung von Know-how für die Unternehmensfrühphase innovativer
und technologischer Gründungen. AICO versteht sich als Plattform für die oberösterreichischen
Business Angels und Investoren.282
279 vgl. (Volkmann, Tokarski und Grünhagen 2010, S 295f)
280 vgl. (Brettel 2005, S 233)
281 vgl. (aaia - Austrian Angel Investors Association 2013)
282 vgl. (tech2b Inkubator GmbH 2013)
97
i2
In Kapitel Förderungen/aws auf S.70 wurde die i2 Business Angel Börse bereits beschrieben.
SpeedInvest
SpeedInvest ist ein aus 30 PartnerInnen bestehender Business Angel Fund, der bis zu 500.000
Euro Investment bei einem Kapitalvolumen von 10 Mio. Euro vergibt. SpeedInvest wurde im
Februar 2012 von erfolgreichen StartUp-Gründern ins Leben gerufen. Zielinvestments betreffen
die Internet- und Mobilkommunikationsbranche.283
2.4.4.1.3 Private Venture Kapitalgeber
Unter Venture Capital ist Wagniskapital zu verstehen. Der Begriff umfasst grundsätzlich alle
Formen der Eigenkapitalfinanzierung, meinen Kailer und Weiß. Der Begriff würde nach Meinung
der Autoren eher für die Finanzierung junger, wachstumsstarker Unternehmen mit besonderem
Risiko verwendet werden.284 In Form von Venture-Capital-Fonds wird das Fondsvermögen für
die Finanzierung von Venture-Capital-Beteiligungen herangezogen. Als Beispiel eines solchen
Fonds kann der „VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin“ genannt werden. Dieser Risikokapitalfonds
(Höhe 30 Mio Euro) wurde vom Land Berlin und der Investitionsbank Berlin (IBB) 2008
installiert. Finanziert werden damit Beteiligungen in Höhe von durchschnittlich 15 – 20 %,
maximal jedoch 49 % des Stamm- bzw. Grundkapitals, an Unternehmen aus den Bereichen
Film/Rundfunk/Fernsehen, Verlage, Musik/Entertainment, Werbung, Mode/Design/Architektur,
Multimedia/Games/Software, aber auch Kunst und Kultur. Die Fonds sind teilfinanziert durch
EU-Gelder des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).285 In Österreich existiert
ein solcher VC Fonds dediziert für die Kreativwirtschaft noch nicht. Was allerdings schon
existiert sind Eigeninitiativen von gut florierenden Unternehmen wie z.B. der Magora Group, die
für „gute und innovative New Media Konzepte“ Venture Partnerschaften anbietet.286
Media4Equity Invest
Nach dem Motto „First the Cash then the Media Boost!“ bietet diese Plattform Equity Capital für
StartUps an. Der Fokus liegt auf Cash-investments in der Seed/Startup Phase. Darüber hinaus
bieten die Betreiber Hilfe bei Promotion in Österreich und international an, und stellen ihre
Dienste als Media-Investment ab der zweiten Unternehmensentwicklungsphase im Bereich
283 vgl. (SpeedInvest GmbH 2012)
284 vgl. (Kailer und Weiß 2012, S. 84)
285 vgl. (Gerlach-March 2010, S14) und (Investitionsbank Berlin 2008)
286 vgl. (Magora Group GmbH 2013)
98
Werbung und Marketing zur Verfügung. Das Finanzierungsmodell ist im folgenden Schaubild
Abbildung 12, dargestellt und umfasst vier Bereiche: Cash, Media (Werbeplatzierung in
österreichischen Medien), Work (consulting/mentoring, network) und Sales (sales team).
Abbildung 12: Investment Structure, Media4Equity Invest, 04/2013287
Angesprochen werden ICT (Mobil-, webbasierte Services und Consumer Internet) und Neue
Medienunternehmen der D-A-CH Regien, CEE und Europa. Die Plattform wurde im April 2013
von Wienern gegründet, und ist im Aufbau begriffen. 288
Seedcamp
Seedcamp ist seit 2007 aktiv, und hat bereits mehr als 80 StartUps zu Investments verholfen.
Seedcamp bietet Zugang zu Investoren international. Ausgewählte StartUps erhalten einen
dreimonatigen Büroraum, Dienstleistungen im Gegenwert von 150.000 Euro und eine
vierwöchige Mentoring Tour. Zunächst bewirbt sich ein/e UnternehmerIn online, wird er/sie
ausgewählt, startet er/sie mit einer Kennenlernrunde – einem einwöchigen „Seedcamp“. 289
287 (media4equity Invest GmbH 2013)
288 (vgl. media4equity Invest GmbH 2013)
289 (vgl. (seedcamp 2013)
99
HackFwd
HackFwd ist ein amerikanisches Unternehmen, dessen Unternehmenszweck die Investition in
europäische Technologie-Talente ist. HackFwd kann auch als sog. Inkubator290 bezeichnet
werden. HackFwd unterstützt u.a. drei junge Linzer Talente, die als PRO 3 GAMES GmbH
firmieren. Es bietet eine einjährige Finanzierung gemessen am jährlichen Einkommensbedarf.
HackFwd nimmt dafür 27 % Anteil, für die Advisors ist ein Anteil von 3 % definiert. Das
Unternehmen versteht sich als Pre-Seed Investment Firma. Neben dem Investment bietet sie
Unterstützung im Management und Marketing.
2.4.4.2 Sponsoring
Sponsoring leitet sich vom englischen Wort „sponsor“ ab, was Förderer, Gönner, Geldgeber,
Schirmherr, bedeutet. Ein Sponsor finanziert oder veranstaltet etwas. Für Haibach291 ist
Sponsoring ein besonderes Fundraising-Instrument, bei dem, anders als bei anderen
Fundraising-Instrumenten, der Gesponserte eine Gegenleistung erbringen muss.292 Sponsoring
ist für KreativunternehmerInnen mit Schwerpunkt Kunst- und Kultur ein großes Thema.
2.4.4.3 Eigenleistungen
Ein-Personenunternehmen und Kleinstunternehmen der Kreativbranchen finanzieren ihre
Vorhaben zumeist durch die Aufträge bzw. den Cashflow selbst oder durch das Einbehalten von
Gewinnen. Reicht dies nicht aus, so ist vielfach üblich, über den Umweg einer Anstellung oder
von Subaufträgen, oder evtl. Merchandising, bei anderen Unternehmen, Geld für Vorhaben zu
verdienen.293
Eigenleistungen können demnach in Primäreinkommen und Sekundäreinkommen unterteilt
werden und sind nach Klein294 und Gerlach-March295 in Kulturbetrieben üblich. Unter
Primäreinkommen werden alle Einnahmen durch das Kerngeschäft verstanden, z.B. Erlöse aus
Kartenverkauf von Vorstellungen und Konzerten u.ä. hingegen umfassen Sekundäreinkommen
Erlöse aus zusätzlichen Aktivitäten, z.B. durch Merchandising, Café- oder Barbetrieb, Vermietung
290 Die Bezeichnung ist eine Metapher und geht auf den Inkubator von Frühgeborenen zurück, in dem das Baby
gewärmt und versorgt wird, bis es ohne medizinische Hilfe überlebensfähig ist.
291 (Haibach, 2012)
292 (vgl. (Haibach 2012, 17)
293 (vgl. geführte Interviews, Kapitel 3)
294 (Klein 2008)
295 (Gerlach-March 2010)
100
von Räumlichkeiten oder Equipment, Anzeigenverkauf, Dienstleistungseinnahmen für
Workshops oder Vorträge, u.dgl.m.296
2.4.4.4 Fremdkapital Kredite und Darlehen der Banken
Die klassische Geldaufbringung ist Fremdkapital in Form von Krediten und Darlehen der Banken.
Für KreativunternehmerInnen ist es jedoch sehr schwierig solches zu bekommen. Banken
wünschen sich kalkulierbare Risiken und verlangen Sicherheiten von ihren Kunden, weil im Fall
des Misserfolgs nur diese verwertbar sind. JungunternehmerInnen und UnternehmerInnen der
Kreativwirtschaft können das aber oft nicht bieten.297
„Die mangelnden Sicherheiten, das ist das Hauptproblem, (…) und einfach die rigorose Vorgangsweise der Banken in den letzten drei, vier Jahren, dass man eben ohne Sicherheiten ja wirklich nichts mehr kriegt, nicht, weil früher, (...) vor 20 Jahren hat jeder Mensch einen kleinen Überziehungsrahmen gekriegt, (...) und jeder Angestellte, der, weiß ich nicht zwölfhundert oder dreizehnhundert Euro im Monat verdient, bekommt einen Überziehungsrahmen, und ein Kreativer, der sich selbständig macht, kriegt keinen, also das ist ein bisschen skurril. (...) Also Sie werden als Selbständiger deutlich schlechter behandelt bei den Banken als als Unselbständiger.“ (Tiefenböck, Steuerberater) Ein höheres Vertrauen scheint zwischen Hausbank und Kunden zu bestehen, dennoch scheitert
es oft an strengen Vorgaben seitens Basel II.298
„Zum Thema Basel I, II, III möchte ich (...) die aktuelle Studie, da wurden österreichische KMUs zum Thema Kreditgrenze befragt, das Ergebnis ist recht interessant, weil wenn man mit Banken redet, sagen die immer wieder es gibt keine Kreditgrenze, man muss die Kredite heute vergeben (...)- das kommt bei den österreichischen KMUs definitiv nicht so an. Hier beantworten 2 Drittel also 65 % der österreichischen KMUs, dass die Hausbanken wesentlich restriktiver geworden sind in den letzten Jahren, es werden, das sagen 70 % wesentlich mehr Sicherheiten verlangt als in der Vergangenheit und ganz allgemein ist die Bankenfinanzierung aufwändiger geworden. Es dauert alles viel länger, es werden mehr Unterlagen verlangt, der ganze Entscheidungsprozess ist aufwändiger.“299
Einige Banken bemühen sich verstärkt um JungunternehmerInnen und UnternehmerInnen der
Kreativwirtschaft. Von Banken, wie der Erste Bank und Sparkasse und im Rahmen des „Der
Mikrokredit“ werden neuerliche Bemühungen um die Zielgruppe JungunternehmerInnen
erkennbar. 300 Banken sind aber auch eine wichtige Informationsschnittstelle zwischen
Förderwerber und Fördergeber und sie können daher gezielt Auskunft über geförderte Kredite
und Darlehen geben.
Im nun folgenden Kapitel geht es um zum Teil experimentelle Wege an Kapital zu kommen.
296 vgl. (Gerlach-March 2010, S 97)
297 vgl. (Junge Wirtschaft Österreich, 2012)
298 vgl. (Langwieser, 2012)
299 (Langwieser, 2012)
300 vgl. (Erste Bank und Sparkasse 2013) und (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)
2013)
101
2.4.5 Kreative Wege der Finanzierung
Die in diesem Kapitel zusammengestellten Finanzierungsformen befinden sich z.T. aktuell in
Erprobung. Manche von ihnen werden sich in den nächsten Jahren etablieren können, andere
werden möglicherweise wieder verworfen werden. Manche sind im Zusammenhang mit
Kreativem Schaffen bereits bekannt.
2.4.5.1 Tauschgeschäfte – „Bartering“
Bei Tauschgeschäften werden Leistung und Gegenleistung getauscht, ohne dass eine
Geldleistung erbracht wird.301 In geführten Interviews hat sich gezeigt, dass Tauschgeschäfte
manchmal eine Relevanz für Kreative haben. Der Vorteil liegt darin, dass Know-how und
Sachgüter so nicht zugekauft werden müssen, die Liquidität geschont wird, da nur ein
materieller Austausch stattfindet. Beispielsweise wird PR-Text für Fotografie oder Video für
Programmierleistung getauscht. Das war der Anlass, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu
schenken und durch Recherche zu überprüfen, ob sich weitere Ansatzpunkte finden lassen.
Gefunden wurde das Tauschgeschäft in einer organisierten Form als Tauschring zwischen
KMU`s, das aus Amerika bekannt unter „Bartering“ ist, was Tausch bzw. Tauschgeschäft
bedeutet302. In Österreich und Deutschland gab es noch bis 2010 Versuche über eine Institution
bzw. online, den Leistungstausch zwischen Unternehmen zu propagieren. Aus mehreren
Gründen ist diese Idee gescheitert. Einerseits waren systemische Fehler ausschlaggebend, der
Idee wurde jedoch der Dolchstoß vermutlich durch die negativen Schlagzeilen in denen von
Geschäftsbetrug, Strafverfahren, Sozialversicherungsbetrug und 2010 von einer
Parlamentsanfrage über Millionenbetrug der Firma ABC vormals BCI Barter Clearing303 zu lesen
ist, versetzt. Wie gut Bartering in den USA funktioniert bleibt unklar, jedenfalls ist in einem
Dokument der Steuerbehörde in Washington State zu lesen, dass Bartering trotz dessen, dass
kein Geld fließt, der Besteuerung unterworfen ist. Vermutet kann dadurch werden, dass das
Thema Besteuerung/Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Bartering sehr bedeutend
ist.304 In seriösem Kontext wird Bartering in Europa zwischen Medienunternehmen praktiziert.
Diese tauschen Werbeplätze untereinander, z.B. ein Werbespot im Fernsehen gegen eine
Werbeseite in einem Wochenmagazin, oder Portalseiten, die Link-, Banner- oder Content
tauschen. Unter einer weiteren Form ist Bartering in Europa bekannt: durch das
Kompensationsgeschäft, wo eine Exportleistung unmittelbar an eine Importleistung gekoppelt
301 vgl. (Vertical Media GmbH 2013)
302 vgl. (Vertical Media GmbH 2013)
303 (Parlament 2013)
304 (vgl. (Department of Revenue 2013)
102
wird.305 Nach zahlreichen Versuchen in den frühen 2000er Jahren existieren Tauschkreise in
Oberösterreich nur noch unter Privatpersonen als „Talentetauschkreis“ in Linz und Steyr.
2.4.5.2 Merchandising und Merchandising Licensing
Merchandising ist nach Gerlach-March306 „ein strategisches Instrument für Kulturinstitutionen zur
Erzielung von Betriebseinnahmen mit einer Marketing-Dimension“. Klein 307 definiert
Merchandising als „die Verwertung bestimmter identifikationsfähiger Produkte (einschließlich
Personen und Namen) durch den Rechteinhaber zu Gewinn- und Marketing-, insbesondere zu
Kundenbindungszwecken.“ Merchandising Licensing ist demnach die „kommerzielle,
gewinnorientierte Nutzung einer Popularität durch einen Dritten, der die Lizenz dazu bzw.
Nutzungsrechte gegen eine Lizenzgebühr vom Rechteinhaber gekauft hat“308. Aber nicht nur für
Kulturinstitutionen wie Museen kann dadurch eine Nebeneinkunft erzielt werden, manche
KreativunternehmerInnen nutzen Merchandising und Merchandising Licensing für Plattenlabels,
Filme, Design, u.a.m. 309
2.4.5.3 Crowdfunding
Darunter wird allgemein die Finanzierung von Projekten durch zahlreiche, größtenteils
unbekannte, Förderer und Finanziers, verstanden. Auch die Weiterentwicklung des Sourcing
Ansatzes, der in Kapitel 2.4.6.1 beschrieben wird, ist darunter zu verstehen.310 Crowdfunding,
stellt eine hochaktuelle Finanzierungsalternative zur klassischen Kapitalbeschaffung dar. Die
Hoffnung, dass sich dieses Instrument als alternative Finanzierungsmöglichkeit etabliert, scheint
Realität zu werden. Fördergeber, Investoren, ja sogar Banken stellen Überlegungen an, wie
dieses Finanzierungsinstrument bestmöglich genutzt werden kann. Die Brisanz dieses Themas
unterstreicht die große Zahl der neu gegründeten Corwdfunding-Plattformen, aber auch die
erstmalig erreichte Finanzierungsmarke von über einer Million Euro für ein Projekt auf
seedmatch.de. Auf Crowdfunding wird in Kapitel 2.4.6, Exkurs: Crowdfunding, näher
eingegangen.
305 vgl. (Vertical Media GmbH 2013)
306 (Gerlach-March 2010, S. 110)
307 (Klein 2008, S. 219)
308 (Gerlach-March 2010, S. 111)
309 vgl. (Pritzkow, Schambach und Ulbricht 2009, S. 32)
310 Vgl. (Forster, 2013, S. 16f) und (Hemer, Schneider, Dornbusch, & Frey, 2011, S. 17f)
103
2.4.5.4 Fördervereine
Im Bereich öffentlicher Kunst- und Kulturinstitutionen und Vereine sind Fördervereine für die
finanzielle wie informelle Unterstützung nicht mehr wegzudenken. Definitionen findet man in
Österreich nicht, das mag daran liegen, dass diese als gewöhnliche Vereine nach dem
Vereinsgesetz zu sehen sind. In Deutscher Literatur finden sich jedoch Hinweise und
Definitionen. Sie werden dort als junges Phänomen beobachtet. So z.B. bei steuerlichen Fragen:
„Fördervereine sind Vereine, deren Zweck darauf beschränkt ist, Mittel für die steuerbegünstigten
Zwecke einer anderen Körperschaft zu beschaffen. Fördervereine können grundsätzlich
gemeinnützig sein.“ 311 Fördervereine erfüllen intermediäre Funktionen durch das
bürgerschaftliche Engagement ihrer Mitglieder, die eine Vielzahl an Aktivitäten initiieren.
Nutznießer ist die Institution, die durch die Zuwendung von Spendengeldern, Sachgütern,
Werbung oder Know-how Unterstützung erfährt.312 Auch in Österreich sind Fördervereine nicht
mehr wegzudenken und stellen ein wichtiges Fundraisinginstrument313 dar. So finden sich in
Statuten von Museen und Musikvereinen Hinweise über den Umgang mit assoziierten
Fördervereinen. Auch jede Universität erhält bereits Unterstützung von Fördervereinen, ob
Alumni-Clubs, oder wie im Fall der Fachhochschulen Oberösterreichs: „Die Fördervereine
unterstützen die FH OÖ finanziell sowie ideell und wirken als Bindeglied zwischen der Wirtschaft
und den FH-Studiengängen.“314, oder der Bruckneruniversität „UNIsono“.315 Auch die Museen der
Stadt Linz erfahren Unterstützung auf diese Weise. Diese Variante der finanziellen
Unterstützung bzw. als „neue“ Form des Sponsorings wird von drei Interviewpartnerinnen
(Radio Fro, Radio Freistadt sowie dorf.tv) angewandt.
2.4.5.5 Stammkapital durch GmbH-Gründung
Für manche Leser mag dieses Kapitel seltsam anmuten, denn im Prinzip hat die verpflichtende
Einzahlung von Stammkapital in der Höhe von mindestens 35.000 Euro bei Gründung einer
GmbH nach Willen des Gesetzgebers den Sinn, etwaige offene Forderungen von Gläubigern bei
Scheitern des Unternehmens zu tilgen. Die Überlegung der oberösterreichischen Radiomacher
rund um Radio Fro, war jedoch vordergründig die, dieses Stammkapital als Finanzierung für die
nötigen Anschaffungen z.B. der Radiolizenz bei Gründung des Radios zu verwenden. Dazu wurde
ein Dachverband von Kulturvereinen aus Oberösterreich gegründet, der mit der Radio Fro
311 vgl. (Bundesrat 2013)
312 vgl. (Braun 2013)
313 vgl. (Gerlach-March 2010, S. 30)
314 (FH OÖ 2013)
315 (Bruckneruniversität Linz 2013)
104
GmbH, vertraglich abgesichert, einen Finanzierungsplan samt Tilgungsplan ausgearbeitet hat.
Das Ausfallrisiko wurde von den beteiligten Vereinen und Personen getragen. An eine
Finanzierung durch die Bank wäre nicht zu denken gewesen, berichtete der Geschäftsführer von
Radio Fro im Interview.316 Der Zugang zu Förderungen und ehrenamtlichem Engagement
(Crowdsourcing) wurde durch die Gemeinnützigkeit der GmbH erleichtert. Diese
„Gemeinnützigkeit“ musste mit der Finanzbehörde erst erstritten werden, und bringt zusätzlich
eine steuerliche Begünstigung. Diese Vorgehensweise bzw. dieses Finanzierungsproblem war
Vorbild für alle, in Österreich existierenden Freien Radios. Dieses Beispiel zeigt eine kreative
Herangehensweise, wie das anfängliche Finanzierungsproblem umschifft werden kann. Schon
die Hürde die Stammeinlage aufzubringen, konnte durch die Beteiligung von Vereinen leichter
aufgebracht werden. Zukünftig ist eine Erleichterung für KreativunternehmerInnen auch
bezüglich persönlicher Haftung durch die Novellierung des Unternehmensrechts zu erwarten.
Diese wird die Gründung einer GmbH ohne Veröffentlichungspflicht mit nur 10.000 Euro
Stammkapital vorsehen. Gründungskosten werden dann niedriger sein, da die
Notariatsaktpflicht und Veröffentlichungspflicht wegfallen, sowie der
Mindestkörperschaftssteuersatz gesenkt werden. 317
2.4.5.6 Mikrokredite
Mittels sog. Mikrokredite wird versucht unterjährige niedrige Finanzierungsbedarfe zu decken.
Erstmals wurde diese Art der Finanzierung für Kleinstunternehmen für Gewerbetreibende in
Bangladesh verwendet.318 Das Problem der Finanzierung durch Bankkredite aufgrund des
unkalkulierbaren Risikos in der Kulturwirtschaft kann nach Auffassung von Gerlach-March u.a.
durch Mikrokredite behoben werden. 319 Die Vergabe von Mikrokrediten wäre als
Wirtschaftsförderung von hoher Bedeutung für die Kreativwirtschaft, ist u.a. auch der
Bremische Senat der Auffassung.320 Auch in Österreich wird mit der Übernahme von Haftungen
für Mikrokredite gefördert. (siehe Haftungen in Kapitel 2.4.2.1.3). Die Unternehmensgründung
aus der (drohenden) Arbeitslosigkeit heraus kann durch den Mikrokredit, der Förderung des
Sozialministeriums, finanziert werden.321 „Der Mikrokredit“ wird in Kapitel 2.4.2.1.6 besprochen.
Für Hemer et al. sind Mikrofinanzierungen wie Mikro-Kredite, Social (Micro) Lending und Micro-
316 (Tremetsberger 2012)
317 vgl. Junge Wirtschaft 2013) und (Wirtschaftskammer Niederösterreich 2013)
318 vgl. (Paeßens und Schirmeister 2005)
319 vgl. (Gerlach-March 2010, S 52f)
320 vgl. (Gräfe 2010, S. 12)
321 vgl. (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2013, dermikrokredit.at)
105
Equity, Varianten von Crowdfunding-Finanzierungsmodellen. Wobei Mikro-Kredite und Social
(Micro) Lending als Kredite gesehen werden, die zwischen zwei Personen, ohne Zutun eines
Finanzinstituts abgewickelt werden. 322
2.4.5.7 Micro-money über flattr
Die Beschaffung von Kleinbeträgen kann für manche Projekte auch über flattr erfolgen. Konkret
lassen sich WWW-Inhalte jeder Art als „Favorite“, „Like“ oder „Start“ klicken z.B. Inhalte auf
YouTube, Instagram oder Soundcloud, etc. Der Ablauf ist folgender:
1. zunächst ist ein Account auf flattr zu errichten
2. dann ist ein Höchstbetrag bzw. ein Budget zu wählen
3. der genannten Betrag ist dann auf das eigene flattr-Konto zu überweisen
4. anschließend werden die Inhalte, die gemocht werden „geflattrt“
5. Am Ende eines Monats wird das genannte Budget auf diese geflattrten“ Inhalte von flattr
zu gleichen Teilen aufgeteilt. Aber nur unter jenen, die ihrerseits einen falttr-Account
eröffnen. Sind es beispielsweise zehn, so bekommt jeder den zehnten Teil von 90 %,
flattr behält sich 10 % ein.
Die Frage, ob ein solches Spendensammelmodell längerfristig praktikabel ist und sich durchsetzt
bleibt offen. Auf jeden Fall erscheint es für die PR günstig zu sein, und flattr erhält neue Kunden
sowie 10 % jeder Spende.323
2.4.6 Exkurs: Crowdfunding - Bedeutung als Finanzierungsalternative
Da Crowdfunding eine sehr neue Materie ist, werden nun die wichtigsten Merkmale anhand von
Definitionen besprochen, beginnend mit Crowdsourcing, womit Crowdfunding den Ausgang
nahm. Folgende Darstellung, Abbildung 13: Arten von Crowdfunding, gibt einen Überblick über
die verschiedenen Formen von Crowdfunding, die in der Literatur diskutiert und definiert
werden. Da es sich bei Crowdfunding in dieser Arbeit um ein Exkursthema handelt, wird nur auf
die zentralen Begriffe: Crowdsourcing, Crowdfunding und Crowdfinancing/-investing
eingegangen. Wobei bei letzteren nach Forster bei Crowdfinancing von der
Unternehmerperspektive, und bei Crowdinvesting von der Investorensicht ausgegangen wird.324
322 vgl. (Hemer, et al. 2011)
323 vgl. (flattr.com 2013)
324 vgl. (Forster 2013, S 28)
106
Abbildung 13: Arten von Crowdfunding325
Crowdsourcing ist für umfangreiche Entwicklungsprojekte, vor allem im Softwarebereich für die
erfolgreiche Umsetzung von Projekten von enormer Bedeutung. Crowdfunding hingegen wird
als vielversprechende Finanzierungsmöglichkeit für StartUps und Jungunternehmen, sowie für
Projekt- und Prototypenentwicklungsfinanzierung gehandelt. Ein wichtiger Nebeneffekt ist
dabei die Marketingfunktion, das Bekanntmachen und das Austesten des Marktes.
2.4.6.1 Crowdsourcing
James Surowiecki schreibt erstmals über das Phänomen Crowdsourcing, ohne es als solches zu
nennen, in seinem Buch „The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and
How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations’.326 Zwei Jahre später
taucht der Begriff „Crowdsourcing“ erstmals in einem Artikel „The Rise of Crowdsourcing“ von
Jeff Howe im Wired Magazine auf327328. Daran C. Brabham definiert den Begriff erstmals in einem
wissenschaftlichen Artikel 2008 als: „ ... an online, distributed problem-solving and production
model.“.329 Später wird das Phänomen, mit seinen Facetten Rechnung tragend, von Estellés-
Arolas und Ladrón-de-Guevara wie folgt definiert:
„Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. The undertaking of the task, of variable complexity and modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the development of individual skills, while the
325 vgl. (Leimeister, 2012, S. 389)
326 (Surowiecki 2004/2005)
327 (Howe, Wired Magazine 2006)
328 Anmerkung der Autorin: Wired ist ein US-Amerikanisches Technologie-Magazin, das es seit 1993 gibt. Es ist ein
„must read“ für alle Technik-Freaks und bespricht auch aktuelle Entwicklungen rund um Netzkultur, Architektur,
Design oder Politik; vgl. (Howe, The Rise of Crowdsourcing 2013)
329 (Brabham, 2008)329
107
crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what the user has brought to the venture, whose form will depend on the type of activity undertaken.330
Marita Haibach versteht unter Crowdsourcing „über Webplattformen vermittelte
Wertschöpfungsprozesse, bei denen Menschen außerhalb eines Unternehmens Dienstleistungen und
Problemlösungen einbringen“.331 In Kapitel 2.4.6.6 Best Practice wird ein Linzer Projekt,
GeoGebra, besprochen, das mit Crowdsourcing (z.B. Programmierleistungen, Übersetzungen)
und Crowdfunding (Geldmittel) sehr erfolgreich umgesetzt wird.
2.4.6.2 Crowdfunding
„Crowdfunding ist eine Form des Crowdsourcing“.332 Es handelt sich um ein sehr junges
Finanzierungsinstrument, das noch wenig wissenschaftlich beforscht ist. Eine der Definitionen
lautet: „Unter Crowdfunding soll ein webbasiertes und partizipatives Finanzierungsmodell
verstanden werden, bei dem Projektideen durch die Unterstützung von einer unbestimmten
Personenmenge finanziert werden“333. Bei Crowdfunding ist zu unterscheiden, ob Gelder
gespendet werden, oder ob es sich um eine Beteiligung am Produkt oder Unternehmen handelt.
Ein Unterstützer/eine Unterstützerin erhält beim Crowdfunding weder Unternehmensanteile,
noch Gewinne als Gegenleistung bei einer erfolgreichen Finanzierung. Daher wird zwischen den
Begriffen „Crowdfunding“ und „Crowdfinancing/-investing“ unterschieden. Eine
Zusammenstellung ausgewählter Crowdfunding-Plattformen wird im Anhang VIX gegeben. Zu
differenzieren ist beim Crowdfunding auch von Fundraising. Unter Fundraising sei nach Haibach
die umfassende Mittelbeschaffung einer nicht kommerziellen Organisation zu verstehen. Dazu
würden vor allem die Einwerbung von Finanzmitteln, aber auch Sachmittel, Rechte und
Informationen, Arbeits- und Dienstleistungen dazu gehören.334. „Anders als beim Fundraising
bekommen die Geldgeber beim Crowdfunding zum Beispiel das fertige Werk (Vorfinanzierung),
individuelle Geschenke (Dankeschöns), Medialeistungen (Sponsoring), Möglichkeit der
Kulturförderung (CSR), eine Spendenquittung oder eine Gewinnbeteiligung.“335 Das Besondere ist
aber auch, dass UnterstützerInnen eine emotionale Beteiligung am Projekt wiederfährt. Sie
werden im Projektverlauf unterhalten und haben durch ihr Engagement einen
330 (Estellés-Arolas und and Ladrón-de-Guevara, Towards an Integrated Crowdsourcing Definition 2012, S 189-200)
331 (Haibach 2012, 317)
332 (Haibach 2012, 317)
333 (tyclipso.me (Hrsg.) , 2012, S 74)
334 (Haibach 2012, 16)
335 (startnext.de 2013)
108
Wissensvorsprung durch interne Informationen, die nur für UnterstützerInnen bereit gestellt
werden.336
Gegenüber anderen Finanzierungsformen hat Crowdfunding den Vorteil, dass die Öffentlichkeit
und Interessierte bereits frühzeitig eingebunden werden. „Dabei vermischen sich Fundraising
und Öffentlichkeitsarbeit bereits am ersten Tag.“337 Ein Nachteil besteht im immensen Aufwand,
den die Kommunikation mit potentiellen Spendern verursacht. Haibach meint, dass jemand
der/die ein Projekt auf diese Weise finanziert bekommen will, es auch wiederholt bewerben
muss.338
Es gibt bis Dato drei österreichische Crowdfunding-Plattformen, wovon Respekt.net bereits seit
2010 aktiv ist und für Kultur- und Soziale Projekte genutzt wird. Respekt.net hat bereits eine
Gesamtsumme von 482.615,- Euro339 an Gelder für Projekte gebracht. Projektsummen über
30.000 Euro sind in Abstimmung mit dem Betreiber auch möglich, zumeist geht es bei
Crowdfunding aber um durchschnittliche Projektsummen von wenigen hundert bis maximal
3.950 Euro.340 Die zweite Plattform ist gerade im Entstehen, es ist dies jumpandup341. Welche Art
von Projekten hier unterstützt werden können geht aus der Homepage jedoch noch nicht
hervor.342 Ein weiteres neues Plattformprojekt namens „querk.at“343 wird von einem Verein
betrieben. Hier wird um Sponsoring und CSR344 geworben.
Am Ende dieses Kapitels sei die Initiative einer Bank in Deutschland erwähnt. Die Volksbank
Bühl bietet seit einigen Wochen unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ eine Crowdfunding-
Plattform. Unter ähnlichen Bedingungen wie andere Crowdfunding-Plattformen auch, können
gemeinnützige Vereine und Institutionen aus dem regionalen Geschäftsgebiet der Bank, Projekte
zur Unterstützung anlegen. Grundbedingung ist ein Geschäftskonto bei der Bank zu eröffnen,
über das die Finanzierung abgewickelt wird. Dafür lockt sie mit einem Spendentopf in
336 vgl. (startnext.de 2013)
337 (Eisfeld-Reschke/Wenzlaff 2011, S. 11).
338 (Haibach 2012, 317)
339 (respekt.net 2013)
340 Durchschnittswert pro Crowdinvesting-Projekt von Inkubato, mySherpas, Pling, Startnext, VisionBakery; Anstieg
gegenüber 2011: 2.694 Euro (Für-Gründer.de 2013, S 16)
341 (Verein zur Förderung des Sozial- und Wirtschaftslebens in Europa (FSWE) 2013)
342 (jumpandup.com 2013)
343 (Denk- und Ideenschmiede querverkehr 2013)
344 CSR: Corporate Social Responsibility
109
Gesamthöhe von 10.000 Euro für die ersten 2000 Projekte. Derzeit sind jedoch nur
Musterprojekte online.345 Möglicherweise wird diese Idee auch in Österreich bei einer Bank
fruchten, die die Initiative ergreift und eine Crowdfunding-Plattform gründet.
2.4.6.3 Crowdfinancing
Unter Crowdfinancing wird nach ikosom eine Beteiligungsfinanzierung verstanden.346 Forster
unterscheidet darüber hinaus zwischen Crowdinvesting, der Investorensicht und
Crowdfinancing, der Unternehmenssicht.347 Durch die niedrigen Beteiligungsbeträge lässt sich
das Risiko von Kapitalgebern minimieren. Andererseits besteht die Chance für
UnternehmerInnen ein höheres Beteiligungskapital unbürokratisch für ihre Vorhaben zu
erhalten.348 Von Amerika kommend, stößt Crowdfinancing/-investing in Europa, und auch in
Österreich auf bestehende Gesetze, die diese Formen der Finanzierung nicht kennen.
Insbesondere spießt es sich bei der Prospektpflicht und –haftung sowie am Bankwesengesetz.
Problematisch ist, dass das österreichische Kapitalmarktgesetz349 eine Prospektpflicht ab einer
Summe von 100.000 Euro vorsieht, das Finanzierungsvolumen somit auf diese Höhe limitiert ist.
Auch ist die Tätigkeit Beteiligungen entgegenzunehmen und dafür eine Zinszahlung zu leisten,
Banken vorbehalten, wie durch das Crowdfinancing-Projekt „Sparverein Apfelbäumchen“ der
Firma GEA medial publik wurde.350
Ein ähnliches Konzept, vorgewarnt vom Fall „Waldviertler“351, versucht die oberösterreichische
Firma Grüne Erde, die ihrem KundInnenkreis „Grüne Erde-Freundeskreis-Bausteine“ zu je 200
Euro anbietet. Als Gegenleistung erhalten InvestorInnen sechs Jahre lang jeweils einen
Warengutschein in Höhe von 50 Euro. Eine zweite Möglichkeit der Investition wird durch ein
„Grüne Erde-Darlehen“ mit 6 % Verzinsung angeboten. Die Beweggründe der Geschäftsführer
Kepplinger und Haas liegen in der finanziellen Unabhängigkeit von Großkonzernen und
Investmentfonds „Um die Unabhängigkeit zu bewahren, wollen wir alternative, von Banken
345 (Volksbank Bühl 2013)
346 (ikosom 2011) bzw. (Röthler und Wenzlaff 2011)
347 (Forster, 2013, S. 28)
348 vgl. (tyclipso.me (Hrsg.) , 2012) und (ikosom 2011) bzw. (Röthler und Wenzlaff 2011)
349 österreichisches Kapitalmarktgesetz in der geltenden Fassung: vgl. (BKA.GV.AT 2013)
350 Bankwesengesetz,/Fall Staudinger – FMA: Der GF Staudinger hat im Freundeskreis 3 Mio Euro bei 4 % Zinsen für
die Finanzierung seines Unternehmensausbaus eingesammelt. (vgl. (oe1.orf.at 2013), und (APA/GEA Presseaussendung
vom 22.11.2013, 2013)
351 Fa. GEA, Geschäftsführer Staudinger vulgo „Waldviertler“
110
unabhängige Wege der Finanzierung gehen.“352 Für interessierte Investoren, institutionelle
Anleger ausgenommen, die höhere Beträge als 25.000 Euro geben wollen, wird ein
„nichtöffentliches“ Angebot gestellt.353
Bemühungen um die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich gehen
von mehreren Seiten aus. Zunächst die Österreichische Wirtschaftskammer unter Führung von
WKO Präsident Leitl bemüht sich Hemmnisse durch das Bankwesengesetz und die
Prospektpflicht zu entschärfen. 354 Auch weitere Politiker sind auf die Möglichkeit, wie
Unternehmen Finanzierungslücken beikommen können aufmerksam geworden und zeigen sich
offen, was durch zahlreiche Aussagen in der Öffentlichkeit und in Medien sichtbar ist.
„Ich glaube wir sollten hier einfach pragmatisch vorgehen und sagen, wenn wir draufkommen es ist etwas zu ändern, dann sollten wir es auch noch ändern, und zwar auch vor der Wahl, es geht darum pragmatisch (betont), gute Lösungen für den Wirtschaftsstandort zu finden“, meint Finanzstaatssekretär Schieder.355
EZB-Rat Ewald Nowotny, sagte bei einer Pressekonferenz, dass er Crowdfunding "gar nicht so
uninteressant" finde.356 „Die SPÖ hat eine Enquete abgehalten, auch Junge Wirtschaft und Grüne wollen alternative Finanzierungsformen auf solide Beine stellen“357
In Österreich gibt es seit Beginn 2013 nun zwei Crowdinvesting Plattformen. Es ist dies die
Plattform 1000x1000, sowie Conda. Um nicht mit dem herrschenden Gesetz in Konflikt zu
geraten, haben sich die Betreiber dieser Finanzierungsplattformen besondere Geschäftsmodelle
überlegt.
1000x1000
1000x1000 wirbt um Finanzierungsmitglieder, die je Projekt zwischen 250,- und 5.000,- Euro
investieren wollen. Je nach Höhe ihres Investments werden diese
352 (Kepplinger & Haas, 2013, S 3)
353 (Kepplinger & Haas, 2013, S 11)
354 „Um Crowdfunding auf rechtlich sichere Beine zu stellen, schlägt die Arbeitsgruppe eine Änderung des Begriffs „Einlagengeschäft“ im Bankwesengesetz vor, wonach die Finanzierung realwirtschaftlicher Projekte wie etwa der Kauf einer Maschine dem Unternehmen vorbehalten und nicht als Bankgeschäft angesehen wird“, so WKÖ-Präsident Leitl. (z.n. Wirtschaftskammer NÖ 2013, S. 7) 355 Staatssekretär für Finanzen Andreas Schieder im Interview am 8.03.2013 (Lemberger, Ellen, ORF Ö1 2013)
356 APA-Meldung: PK Nowotny vom 13.2.2013. vgl. (APA 2013)
357 (Der Standard, 2013)
111
„Crowdinvestoren“ prozentuell mittels Genussscheinen358 am jährlichen Gewinn, sowie am
Substanzwert bei Verkauf, beteiligt. Je Projekt werden so bis zu 100.000 Euro finanziert. Die
Deckelung mit 100.000 Euro wurde aufgrund der gesetzlichen Prospektpflicht nach
österreichischem Kapitalmarktgesetz359 ab einer Summe von 100.000 Euro gewählt. Eine
Risikominimierung soll für die Investoren dadurch erreicht werden, dass eine Expertenjury eine
Vorab-Auswahl der Projekte trifft. Eine Variante stellt die Möglichkeit dar, vorab die
Geschäftsideen zunächst auf der Ideenplattform Neurovation.net360 vorzustellen und einer
Community-Bewertung zu unterziehen. Der Kreis der InvestorInnen hat nach Vorschlag der Jury
zur Finanzierung die Möglichkeit, sich über die jeweilige Geschäftsidee online zu informieren
und erhält einen Zugang zum Businessplan, der ihm/ihr als Entscheidungsgrundlage für sein/ihr
Investment dient. Wenn er/sie investieren will, so hat er/sie nun den jeweiligen Betrag auf ein
Treuhandkonto zu überweisen. Der/die Unternehmer/in hat zuvor einen Schwellenwert
festgesetzt, ab dem die Beteiligung als erfolgreich umgesetzt gilt. Wird der Schwellenwert
innerhalb gesetzter Frist nicht erreicht, so kommt es zur verlustfreien Rücküberweisung. Die
Zeitdauer zur Beteiligung wird vom Plattformbetreiber mit durchschnittlich zwei Monaten
angegeben. Entwickelt sich das Unternehmen gut, so werden Gewinnanteile, wie vereinbart,
jährlich ausgeschüttet. Nach fünf Jahren ist ein Rückkauf der Genussscheine durch den/die
UnternehmerIn möglich. 361
Conda
Conda wurde im März 2013 gestartet und bietet Investoren ab 100 Euro Beiteiligung an bis dato
zwei Projekten Wohnwagon und Evntogram (OÖ)an. 362 Zusätzlich bietet Conda
Werbemaßnahmen an. Der/die Investor/in kann einen zu definierenden Vorzugsgewinnanteil
jährlich erhalten, sowie Anteil an Gewinnausschüttungen haben. Eine vertragliche
Kündigungsfrist ist mit zehn Jahren fixiert. Conda sieht sich als alternatives Investmentportal
und kann bereits auf 43 Investoren für Wohnwagon sowie 10 Investoren für Evntogram
verweisen.363
358 Genussscheine: sind Wertpapiere, gehören zur Kategorie des Mezzaninkapitals, da sie Eigen- wie auch
Fremdkapitalcharakteristik aufweisen und sind entweder Inhaber- oder Namenspapiere.
359 österreichisches Kapitalmarktgesetz in der geltenden Fassung: vgl. (BKA.GV.AT 2013)
360 (Neurovation.net 2013)
361 vgl. (1000x1000.at 2013)
362 die Geschäftsführer von Evntogram sind Teil der interviewten UnternehmerInnen in dieser Arbeit
363 (Conda.at 2013)
112
KraudMob
KraudMob verfolgt einen bis jetzt einzigartigen Fokus auf Applikationen für Mobilgeräte, wie
Smartphones und Tablet PCs. Die Plattform KraudMob wurde im April 2013 von einem Wiener
gegründet. Sie bietet sich als Werbe- und Crowdfundingplattform für Mobile Apps364 an. 365
Weitere österreichische Plattformen sind bis Einreichung der Arbeit bekannt geworden. Es sind
dies „DasErtragreich.at“, und „Innovation.at“366, die beide Eigenkapital vermitteln.367
Wemakeit
Ist eine Schweizer Plattform, die 2012 gegründet wurde. Unter dem Motto „Entdecke und
ermögliche kulturelle und kreative Projekte“ steht sie vor allem für Kunst-, Musik-, Film- und
Designprojekte in drei Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, zur Verfügung. Auch
österreichische Projekte können lt. Auskunft der Betreiber darauf beworben werden.368 Die
Gegenleistung besteht aus „Belohnungen“.
In Deutschland wird schon länger als in Österreich Crowdfinancing betrieben. Hier ist
seedmatch.de erwähnenswert, das mit dem ersten Projekt – AoTerra 369 - eine
Projektunterstützung von mehr als 1 Mio Euro seit 12. Juni 2013 vorweisen kann, und damit für
Furore sorgen wird. Es ist anzunehmen, dass solch ein Beispiel die Bekanntheit, vielleicht sogar
die Finanzierungsbereitschaft bei einer breiteren Investorenschicht erhöht.
2.4.6.4 Zum Stand der wissenschaftlichen Forschung
Crowdfunding wird in den letzten Jahren zunehmend beforscht. Waren es zu anfangs noch
Auseinandersetzungen mit Begriffsdefinitionen und den ersten Plattformmodellen, so sind in
den letzten Jahren inhaltliche Fragen zu den Akteuren und der Projektbeschaffenheit ins
Zentrum gerückt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Arbeiten370 zu Crowdfunding
364 Mobile Apps – sind Applikationen für mobile Geräte wie Smartphones und Tablet PCs.
365 (kraudmob.com 2013)
366 (Innovation.at/GF. Willfort 2013)
367 (DasErtragreich.At Mgmt. GmbH 2013)
368 vgl. (wemakeit.ch 2013)
369 AoTerra: Ist ein „green economy“ Projekt. Es nutzt bestehende Computer in Rechenzentren bzw. deren Abwärme
für die Beheizung von Gebäuden (aoterra.de 2013)
370 Die zusammengestellte Liste fußt auf punktuellen Desktop-Recherchen und kann daher nicht vollständig sein.
Nicht wissenschaftliche Arbeiten und Dokumente auf Websites wurden zum größten Teil nicht berücksichtigt.
113
aus den letzten vier Jahren und den Stand der aktuellen Forschungsthemen. Wie ersichtlich ist,
gibt es zahlreiche Dokumente zum Phänomen Crowdfunding generell. Nur wenige Arbeiten
bedienen sich der wissenschaftlichen Methode der direkten Befragung in qualitativer und
quantitativer Art, viele hingegen analysieren Projekte oder Themen über Sekundärdaten auf
Plattformen. Die Tabelle veranschaulicht, dass die Auseinandersetzung mit Crowdfunding
praxisgetrieben ist, oder im Bereich der Bachelor und Masterarbeiten angesiedelt ist.
Umfangreichere Studien sind erst wenig, und nur in Teilaspekten über Crowdfunding vorhanden.
116
Titel Fragestellung/Thema Crowdfunding Art der wissenschaftlichen Arbeit
Methode/fußt auf: Autor/en Erscheinungs- Jahr
Erfolgsfaktoren im Crowdfunding Erfolgsfaktoren; Allgemein Quantitative Analyse potentieller Financiers und InitiatorInnen
Online Befragung Harzer, Alexandra371 2013
Leveraging Customers As Investors. The driving forces behind Crowdfunding,
Einflussfaktoren auf Investoren Literaturanalyse, Analyse von 735 InvestorInnen auf Plattformen;
Desktop Research, quantitative Analyse mittels Fragebogen
Berglin, H., Strandberg, Ch.; Bachelor Study372
2013
Crowdfunding als Instrument der Kulturfinanzierung am Beispiel von museuminmotion – Menschen für´s Museum begeistern
CF als Instrument der Kulturfinanzierung, Case Study
Literaturanalyse, Case Study;
Desktop Research, Analyse anhand Kriterien, Interview mit Initiatorin
Slyschak, Tatjana; Bachelor Study373
2013
Crowdfinancing – (k)eine Finanazierungsalternative für Start-ups und Jungunternehmen?
Crowdfinancing, Finanzierungsalternative für GründerInnen Allgemein, Plattformen, Zuordnung EK, Unternehmenszyklusfinanzierung
Literaturanalyse, qualitative Analyse
Desktop Research, Analyse anhand Kriterienkatalog
Forster, Markus; Diplomarbeit374
2013
dasco:fundinghandbuch Allgemein, Plattformanalyse, Beispiele von Projekten, Co-funding-Modelle/ CF-Typologie
Literaturanalyse Desktop Research Ikosom/tyclypso.me (Hrsg.)375 2012
Crowdfunding - Eine Möglichkeit zur Finanzierung von Jungunternehmen?
Geeignetes Finanzierungsmodell für GründerInnen; Plattformen
Literaturanalyse Desktop Research Schönthaler, Tamara, DA376 2012
Crowdfunding, Crowdvoting, Crowdcreation
CF-Typologie; Allgemein
Literaturanalyse Desktop Research Leimeister, Jan Marco377 2012
371 (Harzer, 2013)
372 (Berglin & Standberg, 2013)
373 (Slyschak, 2013)
374 (Forster, 2013)
375 (tyclipso.me (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit startnext.de, 2012)
376 (Schönthaler, 2012)
377 (Leimeister, 2012)
117
Crowdfunding. Der neue Weg für private, öffentliche und unternehmerische Förderung in der Kultur- und Kreativwirtschaft
Crowdfunding, Finanzierung der Kreativwirtschaft; Allgemein
Literaturanalyse, Akteure CF, Kulturförderung
Desktop Research Theil, Anna, Bartelt, Denis378 2012
Angels, VC & Co. Alternative Finanzierungen abseits von Banken und Förderungen
Finanzierungsaspekt, Allgemein
Beschreibung Desktop Research WKO, Junge Wirtschaft (Hrsg.)379
2012
Crowdfunding im Kultur- und Sozialbereich
Allgemein Beschreibung Desktop Research Gumpelmaier, Wolfgang; Vortragspaper380
2012
Crowdfunding. Material Incentives and Performance
CF Material Incentives und Performance, Plattformen
Quantitative Analyse, Literaturanalyse
Desktop Research Da Cruz Matos, H. N. F., Dissertation381
2012
Can the concept of crowdfunding be adopted by an academic environment?
Allgemein, Eignung für das akademische Umfeld
Literaturanalyse, 7 qualitative Interviews
Desktop Research, qualitative Interviews von 7 StudentInnen zur Nutzung von akad. Plattformen für Projekte
Lacoma, et. al.382 2012
Untersuchung aus Forschungsprojekt im Rahmen der Evaluierung von Förderungs- und Finanzierungsmaßnahmen für Existenzgründungen und junge Unternehmen der KuKw.
Evaluierung von Förderungs- und Finanzierungsmaßnahmen für Existenzgründungen und junge Unternehmen der KuKw.
Literaturanalyse, ExpertInnenbefragung, Analyse von Hemmnissen und defizitären Faktoren für Finanzierung
Synopsis d. Literatur
Fronz, C, Konrad, E.D., Vortragspaper383
2012
Schwärmen für Pop Crowdfunding im Social Web
Durchführung von CF in der Populärmusik
Literaturanalyse Desktop Research Scherer, David384 2012
Crowdfunding Studie 2010/2011 CF im deutschsprachigen Raum, Literaturanalyse, Desktop Research, Eisfeld-Reschke, J., Wenzlaff, 2011
378 (Theil und Bartelt 2012)
379 (WKO J. W., 2012)
380 (Gumpelmaier, 2012)
381 (da Cruz Matos, 2012)
382 (Berndorff-Nybo, Rohner, Lichtenberger, Zinser, & Torres, 2012)
383 (Fronz & Konrad, 2012)
384 (Scherer, 2012)
118
Untersuchung des plattformbasierten Crowdfundings im deutschsprachigen Raum.
InitiatorInnenbefragung; Analyse der Projekte, Plattformen und ProjektinitiatorInnen; Gründe für die Nutzung einer Plattform, Herausforderungen, Werbeaufwand und Wiederholungsbereitschaft einer CF-Kampagne
quantitative Analyse Online Erhebung K.385
Crowdfunding und andere Formen informeller Mikrofinanzierung in der Projekt- und Innovationsfinanzierung
CF in der Projekt- und Innovationsfinanzierung, Potentialanalyse von Plattformen
Literaturanalyse Desktop Research Hemer, et. al., Fraunhofer Institut (Hrsg.)386
2011
Crowdfunding Schemes in Europe CF-Modelle in Europa, Allgemein, rechtliche Aspekte
Literaturanalyse Desktop Research Röthler, D., Wenzlaff, K., EENC (Hrsg.)387
2011
The development of an application to manage investing involvement during and after and online crowdfunding project for starting companies.
CF-Applikation für Investor Involvement; Technisch
Stots, F., Master Thesis388 2011
Crowd-funding: transforming customers into investors through innovative service platforms
Vom Kunden zum Investor, empirische Untersuchung von drei CF-Initiativen; Plattformen
Qualitative Analyse von drei Plattformen
Desktop Research Ordanini, et. al., 389 2011
Fightin for Funds: An Exploratory Study into the Field of Crowdfunding.
Motivation hinter einer finanziellen Unterstützung eines CF-Projektes
Quantitative Befragung, online
Desktop Research Van Wingerden, Ralph, Ryan, Jessica390
2011
Crowdfunding. Mikrofinanzierung Flattr & Co. Ein Überblick über neuartige Finanzierungsformen für Kreativprojekte
Arten/Typologie von CF; Allgemein
Beschreibung Desktop Research Stadt Stuttgart, Abt. Wirtschaftsförderung (Hrsg.)391
2010
Tabelle 15: Literatur zu Crowdfunding392
385 (Eisfeld-Reschke & Wenzlaff, Crowdfundingstudie 2010/2011, 2011b)
386 (Hemer, Schneider, Dornbusch, & Frey, 2011)
387 (Röthler & Wenzlaff, 2011)
388 (Stots, 2011)
389 (Ordanini, Miceli, Pizzetti, & Parasuraman, 2011)
390 (Van Wingerden und Ryan, 2011)
391 (Stadt Stuttgart, 2010)
392 Eigendarstellung
119
2.4.6.5 Anforderungen und Voraussetzungen
Die in der Literatur oftmals genannten Anforderungen und Voraussetzungen sowie
Problembereiche lassen sich von den drei Anspruchsgruppen, sowie von den einzelnen
Stationen bei der Durchführung von Crowdfunding, ableiten. Diese drei Anspruchsgruppen sind
in der folgenden Grafik dargestellt.
Abbildung 14: Anspruchsgruppen393
Zu den Anforderungen gehören ein geeignetes Projekt/Vorhaben, Projektinitiatoren, eine
geeignete Plattform394, sowie die richtige Zielgruppe, die Crowd. Wobei offen bleibt, welche
Beschaffenheit die einzelnen Anspruchsgruppen und Projekte/Vorhaben aufweisen müssen um
eine erfolgreiche Finanzierung sicherzustellen. Interessante Ergebnisse liefert dazu die Studie
von Harzer 2013395, die folgend nochmals Erwähnung findet, und diese Ergebnisse mit den
Erhebungen der vorliegenden Arbeit in Teilaspekten verglichen wird. Ein weiterer wichtiger
Aspekt liegt in der Finanzierungsgeneigtheit der Crowd. Diese wurde ebenfalls erst kürzlich in
einer Arbeit von Berglin und Strandberg 2013396 untersucht. Die beiden kommen zum Schluss,
dass die wichtigsten Faktoren in der Motivation in ein Projekt/Vorhaben zu investieren, beim
„Wunsch einem Projekt zum Gelingen zu verhelfen“, bzw. den Protagonisten dazu, weil sie „eine
gute Sache unterstützen wollen“, „ein Teil zur Realisierung des Projekts sein wollen, weil sie den
Projektinitiatoren vertrauen“, liegen. Weitere Ergebnisse dieser Untersuchen waren, dass die
Hälfte der UnterstützerInnen einen „persönlichen Bezug“ zum Projekt haben, und dass diese
Faktoren Einfluss auf die Höhe der Unterstützungssumme nehmen, 10 % der Unterstützer
finanzieren im Ausmaß von 60 % ein Vorhaben.397
393 Eigendarstellung
394 hier wird nur die Variante des Crowdfunding über eine Internetplattform besprochen
395 (Harzer 2013)
396 (Berglin und Standberg 2013)
397 vgl. (Berglin und Standberg 2013, S. 27)
Projekt
InitiatorIn
PlattformbetreiberCrowd
120
Erfolgreiches Crowdfunding erfolgt anhand einer Kampagne398 und wird folgendermaßen
propagiert, s.u.:
Abbildung 15: Durchführung eines erfolgreichen CF399
Beginnend mit der Wahl der geeignetsten CF-Plattform, auf beispielsweise Musik, Film, sonstige
Kreativprojekte fokussiert, soll anschließend ein realistisch erreichbares Ziel (Projektsumme)
sowie ein Zeitlimit definiert werden. Vorbereitet werden soll ein Kampagnen-Video und andere
ansehnliche Informationen. Außerdem müssen geeignete Gegenleistungen überlegt werden,
um die SpenderInnen/“backer“ zu locken. Ist alles vorbereitet soll mittels Mundpropaganda
zunächst im Freundeskreis, und anschließend auf Social Media die Kampagne kommuniziert
werden. Empfohlen wird auch regelmäßige Zwischenberichte zu „posten“ um UnterstützerInnen
„bei der Stange“ zu halten. Als eines der kritischen Merkmale ist das zumeist angewandte „Alles-
oder-nichts-Prinzip“ zu sehen. Das bedeutet, erreicht ein Projekt nicht die kolportierte Summe,
so wird es nicht finanziert, alle bis dahin zugesagten Beträge werden storniert.
Wissenschaftlich erhoben sind nur wenige Teilbereiche von Crowdfunding und Crowdfunding-
Kampagnen.400 So können nach jüngsten Forschungen von Harzer401 Erfolgsfaktoren, anders
398 sehr ähnlich einer Marketing-Kampagne
399 (Intuit.com 2013)
400 siehe dazu: Tabelle 15: Literatur zu Crowdfunding
401 (Harzer 2013)
121
gewichtet als bisherige Arbeiten es beschreiben, oder von der Praxis beobachtet wird, wie folgt
genannt werden:
Rang Erfolgskriterium
1 Projektlaufzeit
2 Projektdynamik
3 Zielbudget
4 Anzahl der Unterstützer
5 Gegenleistungen
6 Persönliche Verbindungen
7 Bisher erreichtes Budget
8 Unterhaltung
9 Video
10 Info zur Person (Sympathie)
11 Netzwerkeffekt einer Plattform
12 Multiplikatoren/Empfehlungen
13 Professionelle Projektdarstellung
14 Info zu Projektfortschritt/Blog
15 Projektbeschreibung
16 Projektidee
Tabelle 16: Ranking von Erfolgskriterien nach Likert-Skala402
Aufgrund des quantitativ erhobenen Rankings ist ersichtlich, dass kurze Projektlaufzeiten, eine
hohe Projektdynamik, die Höhe des Zielbudgets und die Anzahl bisheriger Unterstützer den
Erfolg eines Projektes positiv beeinflussen. Kriterien wie die reine Projektidee und
Projektbeschreibung, sowie Information zu Projektfortschritt, beispielsweise durch Bloggen,
haben nur einen geringen Anteil am Erfolg eines Crowdfundingprojektes.403 Der anschließenden
qualitativen Auswertung (n=33) von Harzer ist zu entnehmen, dass in Bezug auf
Kampagnenplanung, Verbreiterung des Netzwerkes, Zielbudget, Zeitrahmen,
festgestellten Problemen während der Kampagne und der Bewerbung des Projektes, sich
insgesamt 18 InitiatorInnen bis zu einem Monat vorbereiten, sieben ProjektinitiatorInnen
würden mehr als zwei Monate dazu verwenden, und weitere sieben bereiteten sich überhaupt
nicht vor, oder machten keine Angaben. Mit hohen Erwartungen würden Projektinitiatoren auf
die Verbreiterung ihres Netzwerkes hoffen, ernüchternd war lt. Aussagen der Interviewten die
Tatsache, dass UnterstützerInnen zumeist aus dem eigenen Freundes-, Familien- und
402 (Harzer 2013, S. 112f)
403 vgl. (Harzer 2013, S. 112)
122
Bekanntenkreis enstammten. „22 Projektinitiatoren kannten mehr als die Hälfte ihrer
Unterstützer persönlich.“404
In Bezug auf die Definition der Zielsumme wurde lt. Harzer405 von neun ProjektinitiatorInnen
nach tatsächlicher Kostenkalkulation, zumeist aber nach Schätzung vorgegangen, jedoch ein
Mindestbetrag für die Gewährleistung der Umsetzung gewählt. Hinsichtlich des Zeitraumes kann
festgehalten werden, dass dieser durchschnittlich 59 Tage betragen hat. Mehrheitlich wurde
dieser analog zum Zeitpunkt des Projektabschlusses gewählt, wobei sich die
ProjektinitiatorInnen zum Teil von Plattformbetreibern beeinflussen ließen und den Zeitrahmen
kürzer setzten. Harzer schreibt weiter von Problemen während der Crowdfunding-Kampagne.
Diese zusammengefasst betreffen die:
• Weigerung der potentiellen UnterstützerInnen sich auf einer CF-Plattform anzumelden
• Stagnation in der Projektdynamik in der Mittelphase (Lösung: erhöhter Werbeaufwand)
• teilweise Überforderung/Überlastung der ProjektinitiatorInnen mit Vorbereitung und
Durchführung, sowie persönlicher Betreuung einzelner UserInnen
• Aufmerksamkeitsdefizite bei UserInnen
• Probleme mit Funktionalität und Handhabung der CF-Plattformen406
Zum Thema Bewerbung des Projektes fand Harzer407 heraus, dass Social-Media Kanäle (fast
ausschließlich Facebook) für die Kommunikation verwendet wurden. Neben der
Kommunikation via Social-Media Kanälen fand vor allem auch eine persönliche Ansprache von
Freunden, Bekannten und Fans für die Akquise von UnterstützerInnen statt. „Musiker nutzten
vor allem Live-Auftritte für die Bewerbung ihrer Projekte und stellten mehrheitlich einen
Finanzierungsanstieg nach Konzerten fest.“408 Eine erfolgversprechende Vorgehensweise wurde
geäußert:
• Leute unterhalten
• nicht um Gelder betteln
• gezielte, wohldosierte Neuigkeiten bieten
Eine aktive Pressearbeit zur Bewerbung des Projektes wurde von 50 % der Befragten angestellt,
und nach Aussage der Interviewten dürfte es notwendig sein, sich etwas einfallen zu lassen, um
sich vom Rest der Werber abheben zu können. Anhand des folgenden Rankings kann ersehen
werden, welche Werbekanäle lt. der Studie verwendet wurden:
404 (Harzer 2013, S. 120)
405 (Harzer 2013)
406 vgl. (Harzer 2013, S. 121ff)
407 (Harzer 2013)
408 (Harzer 2013, S. 122)
123
Rang Werbekanal
1 Facebook
2 Persönliche Ansprache
3 Regionale Medien/Presse
4 Weitere Social-Media Kanäle
5 Newsletter
6 Homepage
7 Veranstaltungen
8 Multiplikatoren
9 Flyer
10 Thematisches Umfeld
11 Google-Werbung
Tabelle 17: Ranking der verwendeten Werbekanäle409
Anzumerken ist, dass durch die Studie die verwendeten Werbemaßnahmen aufgezeigt werden,
nicht jedoch, welchen Anteil die einzelnen Werbekanäle auf den Erfolg der Projekte hatten.
Die ProjektinitiatorInnen wurden auch gefragt, ob sie eine weitere CF-Kampagne genauso
wieder durchführen würden. Diese Frage wurde von der Mehrheit bejaht, mit der
Einschränkung, dass sie den Umfang der Projektplanung erweitern, und die Intensität der
Projektwerbung verstärken würden.410
2.4.6.6 Best Practice – Beispiele: GeoGebra / SIERRA ZULU / Data-Dealer
Ausgewählt wurden drei Best Practice Beispiele mit Oberösterreich-Bezug, wovon das erste ein
erfolgreiches Linzer Crowdsourcing und Crowdfunding Projekt ist. Es ist dies „GeoGebra“, eine
Open Source Umgebung für mathematische Anwendungsbeispiele. Hauptnutzer/Zielgruppe sind
LehrerInnen und SchülerInnen, die Geogebra bereits nutzen. GeoGebra lebt von Crowdsourcing.
Es ist am Institut für Didaktik der Mathematik an der Kepler Universität Linz angesiedelt.
Markus Hohenwarter, Institutsleiter und Professor seit 2010, hat mehrere Kontaktstellen
international aufgebaut, GeoGebra ist an weiteren Universitäten, aber auch in Form von
Privatinitiativen als „GeoGebra Institut“ weltweit verankert. GeoGebra gibt es seit 2006. Es hat
bereits erfolgreich Erstversionen umgesetzt. Zahlreiche OS-Betriebssysteme wie Debian, etc.
haben es portiert. Zweck der Crowdfunding-Kampagne war, die Applikationsumsetzung für
Mobile Devices zu finanzieren.
409 Eigendarstellung nach (Harzer 2013, S. 123)
410 vgl. (Harzer 2013, 124)
124
Name des Projekts: GeoGebra
Website: www.GeoGebra.org
Kurzbeschreibung – Ziel: GeoGebra auf Touchscreen finanzieren;
GeoGebra ist ein OS-Projekt und bietet eine kostenlose Softwareumgebung und dynamische
Mathematik für zu Hause, Schule und Uni. GeoGebra bietet: Interaktive Geometrie, Algebra, Statistik
und Analysen, sowie zehntausende gesammelte kostenlose Materialien von UserInnen. Es wurde 2006
gegründet und hat eine Fan-Gemeinde von 70.000 Interessierten weltweit.
InitiatorInnen: Markus Hohenwarter (hat 537 fans auf facebook)
Bisherige Geldgeber aus der Crowd: Privatpersonen, Unternehmen
Plattform/Zahl der UnterstützerInnen:
CF auf kickstarter/310 backers; 70.000 Interessierte weltweit; 106 facebook shares;
Zielbetrag: US $ 10.000 Erreichter Betrag: US $ 12.010
Zeitraum: 60 Tage / 2012
weitere Finanzierungsquellen: Förderungen, Spenden, Merchandising
sonstige Unterstützung: Crowdsourcing i.d. Programmierung, Tools, Materialien, Übersetzungen, OS
Community, vorhandene erfolgreiche Softwareumgebung
Sprachenangebot: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Basque, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese
(Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (UK, USA, Australia), Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, Georgian,
German (Germany, Austria), Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Irish, Japanese, Kazakh, Korean,
Lithuanian, Macedonian, Malay, Malayalam, Marathi, Mongolian, Nepaleese, Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Persian, Polish,
Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Serbian, Sinhala, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tamil,
Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yidish
Abbildung 16: Best Practice GeoGebra411
Ein weiteres erfolgreiches Projekt ist ein Filmprojekt der Gruppe monochrom in Wien. Dieses
hat ebenfalls auf kickstarter mehr als die Zielsumme eingespielt. Das Künstler- und
TechnikerInnen-Kollektiv ist seit 20 Jahren tätig und ist für seine „monochrom-
411 Quelle der Daten und Texte: Projekt GeoGebra (kickstarter 2012) und (GeoGebra / Hohenwarter 2012)
125
Name des Projekts: SIERRA ZULU
Website: www.sierra-zulu.com / www.monochrom.at
Kurzbeschreibung und Ziel: Filmfinanzierung
„Sierra Zulu is a dark political sci-fi action comedy about the grotesque world we live in. Let’s call it the
bastard offspring of Catch-22 and Buckaroo Banzai, reborn with the soul of Harun Farocki. It is a feature
film for activists and pessimists, historians and makers, diplomats and mercenaries, hot tub lovers and
peasants, cell biologists and beer punks. And it has a bloody CREATURE!“
InitiatorInnen: Johannes Grenzfurtner / monochrom (KünstlerInnen und TechnikerInnenkollektiv)
Bisherige Geldgeber: Privatpersonen, Förderungen, Unternehmen
Plattform/Zahl der UnterstützerInnen:
CF auf kickstarter/426 backers; 4029 facebook friends; Netzwerk USA/EMEA
Zielbetrag: US $ 50.000 Erreichter Betrag: US $ 51.585
Zeitraum: 27 Tage / 2012
weitere Finanzierungsquellen: Förderungen, Spenden, Merchandising
sonstige Unterstützung: ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Materialien aus 20 Jahren, parallel Tournee
durch USA; Netzwerk Roboexotika; Netzwerk Netz-Community Wien; Social-Networks; flickr;
surrealen“ kabarettistischen Performances bekannt. Mindestens ein Mitglied der Gruppe stammt
aus Oberösterreich.
Abbildung 17: Best Practice SIERRA ZULU412
Das dritte Best-Practice Crowdfunding Projekt ist ein Spiel und gleichzeitig eine „Awareness-
Kampagne“ gegen Datenmissbrauch und für Privacy, und heißt DATA-DEALER. Das junge
Unternehmen mit Sitz in Wien ist sehr aktiv in der Netz-Community und setzt sich aus
EntwicklerInnen, SpieledesignerInnen. KünstlerInnen, „OS-Advocates“, „Researchers“ und
„Digital Rights Activists“ zusammen. Mindestens ein Mitglied der Gruppe stammt aus
Oberösterreich.
412 Quelle der Daten und Texte: Projekt SIERRA ZULU (monochrom 2012) und (kickstarter 2012)
126
Name des Projekts: Data-Dealer
Website: data-dealer.com
Kurzbeschreibung: Finanzierung der Tablet-Version
Data Dealer, the bitingly clever game about personal data & privacy. Run your own Tracebook & crush
those whiny privacy critics!
Data Dealer is an award winning online game about collecting and selling personal data - full of irony and
gleeful sarcasm. It´s about surveillance, privacy, the social impact of technology, and fun. What if you
had control over millions of Internet users' personal data? Ever wanted to run your own Smoogle &
Tracebook, track your users & ruthlessly collect loads of detailed personal profiles? Now you can!
Data Dealer lets you 'play god' with personal data. It's a browser game, 100 % free to play and released
under Creative Commons. Let's call it a bastard offspring of certain shiny 2010 Facebook Games and the
1990 TV simulation game Mad TV, reborn with the souls of South Park and Bruce Schneier. Or simply:
PRISM. The Game.
InitiatorInnen: Cuteacute
Bisherige Geldgeber: Privatpersonen, Förderungen, Unternehmen
Plattform/Zahl der UnterstützerInnen:
CF auf kickstarter/754 backers; Netzwerke weltweit, facebook
Zielbetrag: US $ 50.000 Erreichter Betrag: US $ 50.362
Zeitraum: 27 Tage / 2013
weitere Finanzierungsquellen: Förderungen, Spenden, Agentur-Dienstleistungen
sonstige Unterstützung: ehrenamtliche MitarbeiterInnen, erfolgreiche Release vorhanden
Abbildung 18: Best Practice Data Dealer413
413 Quelle der Daten und Texte: Projekt Data Dealer (kickstarter 2013) und (cuteacute 2013)
127
Aufgrund der Interviews mit den Protagonisten kann das Erzählte anhand der weiter oben besprochenen Erfolgskriterien von Harzer414 mittels einer
tabellarischen Gegenüberstellung analysiert werden:
Rang Erfolgskriterium nach Harzer (quantitativ) Schilderung zusammengefasst lt. Interview bei CF-Projekt:
GeoGebra SIERRA ZULU Data Dealer
1 Projektlaufzeit (möglichst kurz, meist 1 Monat) 60 Tage 27 Tage 27 Tage
2 Projektdynamik Langsamer Anlauf, die
letzten zwei Wochen
dynamischer
Rascher Anlauf, Tempo
größtenteils gehalten, in der
Mitte etwas stagnierend,
dynamischer Endspurt
Rascher Anlauf, mach wenigen
Tagen stagnierend ca. zwei
Wochen lang, zum Ende hin
dynamischer Endspurt
3 Zielbudget (meist geschätzt) 10.000 US $ 50.000 US $ 50.000 US $
4 Anzahl der Unterstützer 310 426 754
5 Gegenleistungen umgesetzt wie geplant zwischendurch adaptiert zwischendurch adaptiert; sehr
viele Backer ohne Reward
6 Persönliche Verbindungen ka. ka. ka.
7 Bisher erreichtes Budget - - -
8 Unterhaltung -, Nutzen im Vordergrund ja, ganze Kampagne war
danach aufgebaut
-, Spiel
9 Video ja (Amateur-Video) ja, kabarettistische Bewerbung
des Films
ja, war zu lang
10 Info zur Person (Sympathie) - Performance im Video -
11 Netzwerkeffekt einer Plattform Auswahl aufgrund
Bekanntheitsgrad und
Auswahl aufgrund
Bekanntheitsgrad und Größe
Auswahl aufgrund
Bekanntheitsgrad und Größe
414 (Harzer 2013)
128
Größe
12 Multiplikatoren/Empfehlungen Partner in Miami haben
eingereicht, waren sehr
wichtig für Erfolg
waren sehr wichtig für Erfolg waren sehr wichtig für Erfolg
13 Professionelle Projektdarstellung Ja Ja Ja
14 Info zu Projektfortschritt/Blog ja in Form von 4 Updates ja in Form von 23 Updates mit
Fun-Charakter
ja in Form von 15 Updates
15 Projektbeschreibung Verweis auf Vorhandenes Video, Verweis auf Arbeiten
der letzten Jahre; Story-board
zu Film
zu langes Video415, Verweis auf
vorhandenes online-game;
16 Projektidee innovativ, nützlich innovativ – passend zum
Trademark
innovativ, Fun-Aspekt,
Medienhype um
Überwachungsskandale waren
unterstützend
Tabelle 18: Ranking von Erfolgskriterien nach Durchschnittssummenscores/Likert-Skala416
Anzumerken ist, dass bei der Befragung der Projektinitiatoren nicht nach dem gewichteten Einfluss der Kriterien auf den Gesamterfolg gefragt wurde.
Die Gewichtung mag von den Projektinitiatoren durchaus anders ausfallen, als es bei der quantitativen Erhebung von Harzer417 der Fall war. Weitere
Erfolgskriterien, die der einschlägigen Literatur zu entnehmen sind, werden nun auszugsweise418 ebenfalls tabellarisch zusammengefasst
präsentiert:
415 außer für Datenschutz-Insider lt. Aussage von Wolfgang Christl
416 (Harzer 2013, S. 112f)
417 (Harzer 2013)
418 insofern sie erzählt wurden
129
Weitere Erfolgskriterien lt. Literatur419
(hauptsächlich qualitativ)
Schilderung zusammengefasst lt. Interview bei CF-Projekt:
GeoGebra SIERRA ZULU Data Dealer
Vorhandenes Netzwerk sehr wichtig, ca. 70.000 Interessenten;
weltweit über 100 GeoGebra Institute
als Ansprechpartner, Sprachangebot
von über 20 Sprachen
sehr wichtig, Netzwerk aus
20 Jahren künstlerischer
wie auch Internet-
Aktivitäten
sehr wichtig; „Backer“ waren zu 50 %
unbekannt
Team / Ressourcen Team und helfende Hände
international, Team in Miami hat auf
kickstarter eingereicht
Team von ca. 4-5 Personen Team von 2-4 Personen; insgesamt 2
Vollzeit
Motivierbarkeit der Crowd / Werbeaufwand leicht, keine hohe Gesamtsumme,
Renomé durch internationale Preise
und gut etabliertem Projekt; Nutzen für
User
z.T. leicht, jedoch sehr
aufwändig, 23 Updates
z.T. leicht (zu Beginn), z.T. schwer
(Mitte bis Ende des CF-Verlaufs), 15
Updates
Internetaffinität der Crowd/Zielgruppe war gegeben war gegeben war gegeben
Nachbearbeitung ka. Aufwand der Abwicklung
von Rewards;
Aufwand der Abwicklung von Rewards,
Aufwand aus losen Kontakten
Partnerschaften zu bilden
Wiederholungsbereitschaft ja ja für andere Projekte evtl. für andere Projekte, der Aufwand
muss jedoch in Relation zum Nutzen
stehen
Tabelle 19: weitere Erfolgskriterien für CF lt. Literatur420
Was in den Studien bisher nicht befragt wurde, ist z.B. ob das Crowdfunding-Ziel eher finanzierungsorientiert oder marketingorientiert ist.
Außerdem werden die in den Interviews darüber hinaus aufgetauchten erfolgsrelevanten Themen nun tabellarisch veranschaulicht:
419 vgl. (Harzer 2013), (Eisfeld-Reschke und Wenzlaff, 2011), (Hemer, et al. 2011), quantitativ: (Van Wingerden und Ryan 2011)
420 Eigendarstellung
130
Weitere Erfolgskriterien lt. Gespräch (qualitativ) Schilderung zusammengefasst bei CF-Projekt:
GeoGebra SIERRA ZULU Data Dealer
Ziel/e der CF-Kampagne ist primär Finanzierungsorientiert finanzierungsorientiert internationaler Durchbruch;
Finanzierungsaspekt
Besonderheiten außerordentlich großes Netzwerk
und Zielgruppe
Die Eigenart des
Künstlerkollektivs
außerordentlich hohe Medien- und
Multiplikatoren-Unterstützung
Aufwand von CF im Vergleich zu Förderansuchen nicht alles ist durch Förderungen
finanzierbar
Aufwand von CF ist höher Aufwand von CF ist höher
Erreichbarkeit der Summe war „leicht“ zu schaffen hat viel Aufwand bedurft hat viel Aufwand bedurft
Aufwand im Vergleich zu Förderansuchen geringer, und kurzfristiger
möglich
fast höher, da zum Ersten
mal ausprobiert; können gut
Fördergelder akquirieren
höher als Förderansuchen
Fehler die gemacht wurden k.a. Unterschätzung des
Aufwandes, (Rewards
wurden ergänzt)
Video war zu lange; Rewards nicht gut
genug überlegt, Unterschätzung des
Aufwandes; Ressourcenmangel
während Auslandsaufenthalten
Parallelkampagnen Keine USA-Vortrags-Tour USA und Prag – Teilnahme an Events
Tabelle 19b: weitere Erfolgskriterien für CF lt. Literatur421
421 Eigendarstellung
131
Zum angeführten Ranking der Medienkanäle, siehe unten, ist folgendes festzuhalten, dieses
entstammt der Befragung von Harzer422, im Fall der drei Best Practice Beispiele würde sich das
Ranking mitunter verschieben.
Rang Werbekanal Angewandt lt. Interview
GeoGebra SIERRA ZULU Data Dealer
1 Facebook Ja ja ja
2 Persönliche Ansprache Ja ja ja
3 Regionale Medien/Presse sehr wenige wenig ja, intern. viel
4 Weitere Social-Media Kanäle k.a. zahlreiche wenige
5 Newsletter/mailings Ja ja ja
6 Homepage Ja ja ja
7 Veranstaltungen Nein ja nein
8 Multiplikatoren Ja ja ja
9 Flyer Nein ja ja
10 Thematisches Umfeld Ja ja ja
11 Google-Werbung Nein nein nein
Tabelle 20: Ranking der Medienkanäle423/Best Practice GeoGebra, SIERRA ZULU, Data Dealer
Festzustellen ist, dass „Persönliche Ansprache“ und „Newsletter/mailings“ für die drei Best
Practice Projekte sehr wichtig waren, ebenfalls die „Multiplikatoren“ und das „Thematische
Umfeld“. Von hoher Relevanz lt. Initiatoren scheint „Facebook“ zu sein. Die „regionalen Medien
und die Presse“ dürften nicht so wichtig sein, wenn von vorneherein eine große Community, die
auch im Internet kommuniziert, vorhanden ist, was bei allen drei Projekten der Fall war.
Hingegen spielte die internationale Presse sehr wohl beim Projekt Data Dealer eine
herausragende Rolle. Der Hype rund um die Medienberichterstattung betreffend Überwachung
der BürgerInnen hat Data Dealer für sich sehr gut nutzen können. Parallel zur Kampagne wurde
viel in internationalen Medien, wie The Gardian, New Yorker, Fast Company Magazine, Le
Monde, Think Progress, MBC-News, u.dgl. sowie in der New York Times zwei Tage vor Schluss,
über Data Dealer berichtet. Wichtige Multiplikatoren waren beispielsweise David Pogue (1,5 Mio
persönliche followers), sowie die namhafte Jury und TeilnehmerInnen beim „Games for Change
Festival“ in New York, wo der Initiator des Projekts Data Dealer einen Preis entgegen nahm.424
422 (Harzer 2013)
423 Quelle: (Harzer 2013, S. 123) erweitert um Ergebnisse aus Interviews mit (Hohenwarter 2012), (Grenzfurtner 2012),
(Christl 2013)
424 (Christl 2013)
132
2.4.6.7 Einsatz als Finanzierungsinstrument
Grundsätzlich bietet Crowdfunding die Chance Projekte oder Produkte fremdfinanzieren zu
können. Wird eine vorhandene Plattform genutzt, erspart das selbst die technische Infrastruktur
aufzubauen und finanzielle Prozesse selbst abzuwickeln zu müssen. Der Vorteil, der daraus
entsteht ist, dass Initiatoren sich auf die Bewerbung des Vorhabens konzentrieren können, da
sie sich nicht um Rahmenbedingungen kümmern müssen. Die Plattformbetreiber bieten zudem
umfassende Projektbetreuung. Durch die Vorstellung des Projektes und die Werbung im
Zeitverlauf wird erkennbar, ob das Vorhaben auf Interesse stößt und die gewünschte
Finanzierungshürde erreichbar wird. Hat das Vorhaben genügend UnterstützerInnen, so liegt
nahe, dass es nach Fertigstellung auch Absatz findet. Kann es hingegen nicht finanziert werden,
so erleiden die Investoren beim „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ keinen finanziellen Schaden, da
entweder kein Zahlungsfluss zustande kommt, oder dieser rückabgewickelt wird. Für den/die
Initiator/in ist der finanzielle Aufwand für die Projektvorstellung sehr gering. Für ihn/sie ist das
auch eine Möglichkeit die Markttauglichkeit vor Fertigstellung zu testen. Findet das Vorhaben
keinen Anklang, hat er/sie auch nicht die finanziellen Konsequenzen zu tragen. Er/sie kann sich
auch unterstützende Ideen und Know-how der Crowd zu Nutze machen. Zu beachten ist, dass
sich ein Projekt nicht von alleine finanziert, es erheblichen Aufwand bedarf UnterstützerInnen
ständig auf dem Laufenden über den Projektverlauf zu halten, und die Öffentlichkeitsarbeit über
die Kommunikationskanäle zu managen. Da die Unterstützung in zumeist sehr niedrigen
Beträgen erfolgt, ist der Aufwand um eine kritische Masse zu erreichen sehr hoch,
möglicherweise ist dabei hinderlich, dass Crowdfunding im deutschsprachigen Raum noch zu
wenig bekannt ist und genutzt wird.
2.4.6.8 Potentiale von Crowdfunding
Aufgrund fehlender Daten zu Österreich werden zur Diskussion der Potentiale von
Crowdfunding Daten aus Deutschland herangezogen, da davon ausgegangen werden kann, dass
dieser Trend auch für Österreich gilt. In der von Eisfeld-Reschke und Wenzlaff verfassten
Crowdfunding Studie425 wurde mit August 2011 eine Erfolgsquote von Crowdfundingprojekten
von 49,3 % genannt. Die Überschreitung der Zielsummen machte 112 % aus, und eine
Unterfinanzierung von nur 6 % wurde auf den Plattformen GamesPlant, inkubato, mySherpas,
pling, querk, respekt.net, startnext und VisionBakery zusammen festgestellt. 426 Der
Crowdfunding Industry Report 2011 geht von einer Summe von fast 1,5 Billionen US Dollar aus,
425 (Eisfeld-Reschke und Wenzlaff, Crowdfundingstudie 2010/2011 2011b)
426 vgl. (Eisfeld-Reschke und Wenzlaff, Crowdfundingstudie 2010/2011 2011b)
133
die weltweit auf Crowdfundingplattformen gesammelt wurden. 427 Aktuelle Zahlen aus
Deutschland ergeben im ersten Halbjahr 2013 fast 10 Mio. Euro an eingesammeltem Kapital
zum Stichtag 30.06.2013. Diese Zahlenangabe bezieht sich rein auf Crowdinvesting Plattformen.
Auf nachstehend angeführter Grafik lässt sich die Kapitalentwicklung der Crowdinvesting
Plattformen in Deutschland ablesen. Waren es zu Beginn aller Crowdinvesting-Tätigkeiten noch
449.228,- Euro, so ist diese Zahl auf das Zwanzigfache bis 30.06.2013 angestiegen. Für-
Gründer.de hält auch fest, dass sowohl die Zahl der beendeten Projekte428, als auch die Zahl der
erfolgreichen Projekte429, sich im steigen befinden, siehe u.a. Grafik.430 Ebenso dürften die
besprochenen Best Practice Modelle, siehe weiter oben, bereits vom Trend der steigenden
Projektsummen profitiert haben.
Abbildung 19: eingesammeltes Kapital mittels Crowdinvesting in DE431
427 (massolution - Crowdfunding Industry Report 2011, 2013)
428 ein Anstieg von 160 % 2012 im Vergleich zum Vorjahr
429 ein Anstieg von 190 % 2012 im Vergleich zu 2011
430 (Für-Gründer.de 2012)
431 (Für-Gründer.de 2013)
134
Erwähnenswert ist auch, dass 73 % der Projekte einen wirtschaftlichen Zweck
verfolgen.432433Als Prognose für 2013 gibt Für-Gründer.de folgendes an:
• Mehr Wachstum, aber mit Umbrüchen im Markt und Konsolidierung434
• Eine Steigerung der Kommunikation innerhalb der Plattform-Community und die
Usability der Plattform, stehen im Vordergrund.435
Für die Jahresmitte liegen erste Zahlen vor, wonach mit knapp über 2 Mio. Euro das
Finanzierungsvolumen aus 2012 bereits übertroffen worden ist, und das Tausendste Projekt
erfolgreich finanzierte wurde.436
432 bezogen auf allen finanzierten Projekte zum Stichtag 31.12.2012;
433 (Für-Gründer.de 2012)
434 mySherpas hat beispielsweise 2012 seine Aktivitäten eingestellt;
435 (Für-Gründer.de 2012)
436 vgl. (Für-Gründer.de 2013)
135
3 EMPIRIE - ERGEBNISSE DER ERHEBUNG
3.1 Allgemeines
Dieses Kapitel ist der Beschreibung der empirischen Erhebung gewidmet. Zunächst wird die
Stichprobenstruktur besprochen. Es wird auf die Verteilung nach Sparten, die Dauer des
Unternehmertums, auf die Rechtsformen, die MitarbeiterInnenzahl und das Alter der befragten
Personen, sowie die Reichweite bzw. den Internationalisierungsgrad eingegangen. Relevante
Beispiele für die Charakteristik der Entrepreneurs und deren Vernetzungsgrad werden ebenfalls
genannt.
3.2 Beschreibung der Stichprobenstruktur437
So gut wie alle Interviewten (n=23) verfügen über einen akademischen Abschluss, mit einer
Ausnahme. 13 Personen verfügen über einschlägige Vorkenntnisse, die sie durch eine
Ausbildung erworben haben. Das aktuelle Betätigungsfeld hat aber bei neun Personen nicht oder
nur zum Teil mit der Fachrichtung zu tun, in der sie ihre Ausbildung erworben haben. Unter den
Interviewten sind nur zwei Frauen. Die 23 interviewten Personen sind für 25
Kreativunternehmen tätig, und haben für das jeweils andere Unternehmen auch die Fragen
beantwortet.
3.2.1 Verteilung der Unternehmen (n=25) nach Sparten
Die Gliederung nach Sparten zeigt eine Häufung im Bereich Musik und künstlerische Tätigkeit,
sowie Architektur und Design. Das liegt möglicherweise daran, dass unter den angefragten
AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz vermehrt diese zu einem Interview bereit waren. Zu
beachten ist, dass aufgrund der tatsächlichen Tätigkeiten (Interdisziplinarität, Schnittmenge aus
mehreren Bereichen, „Ausflüge“ in andere Themenbereiche wie Umwelt, etc.) eine
437 Es wurden mit 23 UnternehmerInnen Interviews geführt, die für 25 Unternehmen gesprochen haben.
136
Kategorisierung den eigentlichen Tätigkeitsbereich exakt beschreibt.
Arbeitsfeld / Bereich Anzahl
Architektur/- umfeld 5
Musik, Buch und künstlerische Tätigkeit 5
Design (Mode, industrielles Design, Grafik Design) 4
Radio und TV 3
Software und Games 4
Video und Film 2
Werbung 2
Tabelle 21: Kreativbereiche der Interviewten438
Bei zehn InterviewpartnerInnen viel es schwer, sie den vorhandenen Kategorien zuzuordnen. Als
Beispiel sei ein Künstler genannt, dessen Betätigungsfeld nach einschlägigem Studium
Architekturdesign ist, und der sich aktuell mit Umweltprojekten auseinandersetzt. Welcher der
drei erstgenannten Kategorien soll dieser zugeordnet werden? Ein anderer Interviewpartner hat
an der Kunstuniversität Architektur studiert, und verkauft künstlerische Fotografie an
Auftraggeber wie Architekturbüros, Zeitschriftenverlage, die Werbewirtschaft, etc. Abgesehen
davon scheint Fotografie beispielsweise gar nicht explizit als Betätigungsfeld auf. Fotografie wird
auch als „kreatives Handwerk“ gesehen. Ähnliche Situationen begegnen MitarbeiterInnen von
Förderstellen, die in der Berichterstattung für statistische Zwecke angeben müssen, welcher
Kategorie sie den Projektantrag zurechnen.
„(...) meistens ist die Zuordnung total schwer (...) „Bei uns in der AWS (...) müssen wir die Önace Codes immer angeben, eben für verschiedene statistische Auswertungen, (...) und das was Önace anbietet spiegelt oft das nicht wieder, was die Leute machen. (...) Es gibt eigentlich noch zuwenig Önace Codes für das was die Leute machen (...).“ (MitarbeiterIn, aws)
Vorab müssen die Antragsteller selbst im online-Antrag die jeweilige Gruppe ankreuzen,
„ (...) damit wir dann wissen, was für eine Jurygruppe dann ist.“ (MitarbeiterIn, aws)
Auch die Kreativen haben manchmal Schwierigkeiten ihre eigene Bereichszugehörigkeit zu definieren: „Das ist schwierig, weil ich ja auch nicht wirklich einer Branche angehöre, finde ich.“ (EPU, interdisziplinär tätig) „Ja, das ist jetzt ein bissel Definitionsfrage. Wir sind zwar noch in das Beuteschema des aws-Impuls-Programmes hinein gefallen, aber sehr am Rande. Dadurch, dass wir an und für sich ein Hardware-Produkt machen und aus der Sensortechnologie-Ecke kommen. Aber es hat gereicht, um eine Förderung zu kriegen.“ (GF, IT-Projekt)
438 Eigendarstellung
137
„Was wir sind? Schwierig. Früher waren wir eine kleine Internet-Agentur, aber das ist eigentlich Vergangenheit. - Ich würd uns als "Social Enterprise" sehen oder als "Agentur für Social Impact" oder für "kritische Netzkultur" oder so. NGO ist wahrscheinlich das falsche Wort, wir sind so ein Mittelding.“ (Christl 2013)
Die creativ wirtschaft austria ist sich dieser Problematik bewusst und meint „es kommt immer
darauf an, um welche Sache es geht“, teilweise solle man sich „nur auf Kernbereiche und das
Kreative Element berufen“.439 2010 hat die creativ wirtschaft austria eine Abgrenzung von
Kreativwirtschaft nach ÖNACE 2008 zur Hilfestellung vorgenommen, die zum besseren
Verständnis im Anhang IV: Önace / Statistik Austria beigefügt ist. Generell sind Auswertungen
nach dem Önace Katalog mit Vorsicht zu genießen, da die Kategorisierung subjektiv teils von
Unternehmen selbst, teils von Förderstellen vorgenommen wird und es auch vorkommt, dass
ein einzelnes Projekt eines IT-Dienstleisters unter Kreativwirtschaft fällt, was die
Datenauswertung verfälschen kann.
Unter den 23 InterviewpartnerInnen sind sieben, die teilweise in anderen Bereichen tätig sind,
oder Artverwandtes ausüben. Neun wollen Ideen umsetzen, die ein anderes Kernthema
(darunter sind häufig Umwelt- und soziale Themen) haben.
3.2.2 Dauer des Unternehmertums (n=23)
Bis auf die drei jungen StartUps sind alle Interviewten bereits mehrere Jahre kreativ tätig (was
u.a. bedeuten kann, dass für manche Kreativunternehmen bestimmte Förderungen für die
Kreativwirtschaft von vornherein nicht in Betracht kommen). Acht Unternehmen bzw.
UnternehmerInnen befinden sich in den ersten drei Jahren ihrer unternehmerischen Laufbahn.
Weitere fünf UnternehmerInnen befinden sich im vierten bis zum sechsten Jahr. Alle anderen
sind seit zehn bis zwanzig Jahren tätig. Ein Familienunternehmen ist bereits seit 30 Jahren am
Markt. Die u.a. Grafik fasst das Ergebnis nochmals zusammen:
439 (creativ wirtschaft austria HOTLINE 2013)
138
Abbildung 20: Unternehmensalter440
3.2.3 Rechtsformen (n=25)
Unter den 25 Unternehmen befinden sich zwei Vereine, drei gemeinnützige GmbHs, fünf weitere
GmbHs und zwei OGs. Der Rest, das sind 13 Unternehmen, teilt sich auf Neue Selbständige und
EPUs (zwei davon sind im Firmenbuch eingetragen), sowie zwei Angestellte auf.
Abbildung 21: Rechtsformen441
3.2.4 MitarbeiterInnenanzahl (n=23)
Von den o.g. Unternehmen haben 17 keine angestellten MitarbeiterInnen. Nur zwei haben
jeweils eine/n Mitarbeiter/in angestellt. Weitere zwei haben eineinhalb bis drei
MitarbeiterInnen angestellt, darunter befinden sich Teilzeitkräfte, sowie Geringfügig
Beschäftigte. Drei Unternehmen haben 11 bis 17 MitarbeiterInnen, ein Unternehmen, der
Familienbetrieb, hat 70 Angestellte.
440 Eigendarstellung
441 Eigendarstellung
Unternehmensalter
0-2 Jahre (3 StartUps)
2-3 Jahre (8 Unternehmen)
4-6 Jahre (5 Unternehmen)
10-20 Jahre (6 Unternehmen)
30 Jahre (1 Familienbetrieb)
Rechtsformen
2 Vereine3 gemeinnützige GmbHs5 weitere GmbHs2 OGs11 Neue Selbständige/EPUs/Angestellte2 EPUs im FB eingetragen
139
Abbildung 22: Zahl der MitarbeiterInnen442
Die Zahl der Freelancer ist recht unterschiedlich. Eine OG, es ist ein PR-Unternehmen hat eine
Person angestellt, jedoch 10-15 Freelancer. Acht nutzen überhaupt keine Freelancer, und
manche EPUs haben wiederum vermehrten Bedarf. Es lässt sich keine Tendenz weder
hinsichtlich Bereich, Größe oder Unternehmensalter belegen, sodass der Grund für das
Hinzuziehen von Freelancern möglicherweise in der Art des Projektes liegt.
3.2.5 Alter der befragten Personen (n=22)
Von den 23 Interviewten befinden sich fünf im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Acht sind im
Alter von 31 bis 40, und acht weitere im Alter zwischen 41 und 50. Eine Person ist im Alter bis
60 Jahre. Eine Person hat ihr Alter nicht angegeben. Die unten angeführte Grafik fasst
zusammen:
Abbildung 23: Alter der UnternehmerInnen443
442 Eigendarstellung
Zahl der MitarbeiterInnen2 Unternehmen mit jew. 2Angestellten2 Unternehmen mit 1,5-3Teilzeit+Geringfügig Beschäftigte3 Unternehmen mit 11-17 Angestellte
17 Unternehmen haben keineAngestellten1 Unternehmen hat 70 Angestellte
Alter der UnternehmerInnen
5 im Alter zw. 21-30
8 im Alter von 31-40
8 im Alter von 41-50
1 im Alter bis 60
140
3.2.6 Reichweite/Internationalisierungsgrad (n=25)
Unter den 25 Unternehmen sind zwölf Unternehmen, die nicht allein auf Österreich, sondern
international orientiert sind. Drei Unternehmen sind auf Österreich und den EU-Raum
ausgerichtet. Zehn Unternehmen fokussieren ihren Markt in Österreich, davon sind acht, deren
Zielgruppen in OÖ. liegen.
Abbildung 24: Internationalisierungsgrad444
3.2.7 Entrepreneurs (n=22)
Es wurden bis auf einen Fall (Angestellte) immer GeschäftsführerInnen befragt, aufgrund dessen
ergibt sich eine Anzahl von 22. Unter den interviewten Kreativen befinden sich sehr
unterschiedliche Unternehmerpersönlichkeiten, die die Ergebnisse der Arbeit mitbestimmen.
Eine Untersuchung, ob diese UnternehmerInnen den Definitionen von Entrepreneurship, wie sie
beispielsweise Kraus zusammenfasst: „The process of creating valueby bringing together a unique
package of resources to exploit an opportunityand converting this into marketable products or
services.“445 entsprechen, ist nicht beabsichtigt. Vielmehr scheint es nötig, ihre geäußerten
Überzeugungen, Werte und Vorstellungen exemplarisch hervorzuheben, damit die handelnden
Personen, deren Aussagen festgehalten sind, greifbarer für den/die Leser/in werden.
Folgend sind diese Aussagen zu
• Wirtschaftsethik,
• finanzieller Lage und zu Wachstumszielen
angeführt.
443 Eigendarstellung
444 Eigendarstellung
445 Definition: (Kraus, 2011, S. 7)
12 international ausgerichtete U.
3 Österreich und EU
10 österreichweit
8 davon rein auf OÖ. ausgerichet
141
Aussagen zu Wirtschaftsethik:
„Keine Gewinnmaximierung auf Kosten von Anderen. Natürlich ist in jeder GmbH, die nicht gemeinnützig ist, das Ziel gewinnorientiert zu arbeiten, das ist klar, man muss sich auch irgendwo einen Puffer schaffen, um durch Krisen zu kommen.“ (GF einer GmbH, IT-Projekte) „Das bedeutet, dass man im Endeffekt klar nach 7 Jahren, oder nach 5 Jahre oder 3 Jahren - also meistens sind es 5 Jahre - das Unternehmen dann wird es an den Meistbietenden verkloppt und diese Business Angels sagen, "wow" ich will eigentlich eine Rendite von 12 % und so wird das Ganze aufgeblasen und aufgetuned. - Ja. Dem wollen wir uns widersetzen, uns interessiert so etwas zu machen überhaupt nicht.“ (GF einer GmbH, Musikprojekt) „Weil die Geiz ist geil Mentalität die geht seit 6 Jahren, und in Österreich seit 5 Jahren, wo das so überhand nimmt, dass es nicht mehr lustig ist. (...)Wir sind immer mehr Firmen, die sich untereinander zusammenschließen, die sich untereinander sagen, wir wollen mit diesem Strom, dieser Tendenz eigentlich nicht mit.“ (GF einer GmbH, IT-Projekte) „ (...) wir sind keine BWLer wir haben uns das alles so learning-by-doing entwickelt, aber das spannende ist, dass wir mehrere Standbeine haben und über diese Standbeine ein Grundeinkommen beziehen oder Grundumsätze erzielen mit denen wir eigentlich unsere Leute durchbringen.“ (GF einer GmbH, Musikprojekt) „Also wenn einer Geld verdienen möchte, dann ist er bei uns eigentlich an der falschen Seite. Bei uns gibt es Spaß, interessante Projekte und Langlebigkeit, und viel OS, und viel Einbringung und Selbstverantwortung usw. Wir sind eher a-typische Chefs.“ (GF einer GmbH, IT-Projekte) „(...) aber so rein aus der Struktur her, glaube ich schon, dass es vielen so ähnlich geht. Dass sie halt die Kohle zusammenkratzen, dass sie überleben. Und so von Projekt zu Projekt leben, das ist eigentlich das Charakteristische, was Viele haben. Und was glaube ich auch bezeichnend ist, wenn Du mich so fragst, einen Businessplan und so, dass ich das nicht habe, oder in den Geschäftsalltag so hineinlebe, dass ist glaube ich auch typisch. Also das kenne ich halt von Vielen. Dass das kaum so betrachtet wird, wie es klassischerweise im unternehmerischen Sinn betrachtet wird. Ich habe auch sehr viel mit Musikern zu tun, und vor allem dort ist das ganz stark, ein ganz anderes Ethos.“ (EPU, KünstlerIn) „Also diese Creative Industries ist halt auch so ein politisches Schlagwort, und da habe ich schon das Gefühl, das ist eigentlich ein ganz enges Bild, das - das merkt man auch bei den geförderten Wohnungen der Stadt, die haben halt, da ist so eine bestimmte vorgefasste Meinung eben auch von diesem erfolgreichen StartUp, der dann eine tolle Idee hat, die sich entwickelt und mordsmäßig die Wirtschaft - ist eine Einschränkung, weil ein ganz großer Teil von denen, die sich als kreativ Arbeitende begreifen überhaupt nicht - für die überhaupt nicht greift. - Die Gefahr ist halt schon, dass man die Kunst auch zu weit weginstrumentalisiert in Richtung - ja, in Richtung Wirtschaft halt, ganz romantisch gesagt. Es gibt ja außer der Tabakfabrik auch andere Wertschaffende Faktoren, das wird beiseite geschoben, das finde ich schade. Ich meine das wäre das Potential, wenn man Kreative fördert, dass man auch, dass man das auch sieht als Wertschöpfung auch in anderen Bereichen, nicht nur im monetären.“ (EPU, KünstlerIn) „Bei uns ist nebenbei arbeiten auch Familie, also wir sehen Familienarbeit als eine Arbeitstätigkeit, die man neben dem, ein zweiter Job, den man halt hat und der höchste Priorität hat für alle MA im Unternehmen. Dh. wenn bei uns jemand, wenn Kinder krank sind usw., dann bleibt man bei den Kinder, man kann von zH. aus arbeiten. Eigentlich ist jeder selbst verantwortlich für das was er tut und kann sich das auch frei einteilen, das ist ganz wichtig. Und das darf jetzt nicht nur der Chef, sondern es dürfen, sollen und müssen alle tun. (lacht)“ (GF einer GmbH, Musikprojekt)
Aussagen zur Finanziellen Lage und Wachstumszielen:
„Puh, da fragen Sie jetzt den Falschen. Ich weiß nur unsere Umsatzzahlen 2011, 640.000 Euro.“ (GF einer GmbH, Design)
142
„Meine Lebensausgaben monatlich? Keine Ahnung. 1.500 Euro.“ (EPU, KünstlerIn) „Wachstumsziele gibt es keine, wichtig ist mir nur, dass die Projekte, die ich machen will, egal ob riesengroß oder ein kleines Projekt – es ist wichtig, dass genug Personen mitarbeiten, dass das auch umgesetzt werden kann. (...)“ (EPU, Design) Wenn das Projekt nicht subventioniert wird: „Dann muss ich's billiger machen (lacht). Dann mache ich es meistens trotzdem, aber irgendwie anders, günstiger sozusagen.“ (EPU, Film) „Man muss nicht immer wachsen, man kann auch die Qualität steigern.“ (GF, Indust. Design) „Meine Idealvorstellung wäre als freier Kunstschaffender zu überleben.“ (EPU,KünstlerIn) „(...) Längerfristige Ziele? - wir sind sehr stark im Projektgeschäft, und da ist bei uns keine sehr große Langfristigkeit, also das ist da so bei uns gar nicht abgesteckt (...)“ (GF, Design) „(...) Längerfristige Ziele? - So weit kann ich gar nicht denken, weil das geht immer von einem Film zum nächsten.“ (EPU, Film) „Finanzierungsziele - Nein, haben wir nicht. Was wir schon machen ist, dass wir für Projekte unterschiedlichste Finanzierungsformen andenken, wie Donation, Micro-funding, usw. (...)“ (GF, Musikprojekt) „(...) Gewinnabsicht? Nein, also ich habe den Anspruch, dass ich natürlich ein gutes Leben leben kann, wobei ich einigermaßen genügsam lebe. Also ich habe kein Auto, ich bewege mich halt vorwiegend mit Öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Dafür lebe ich halt in der Innenstadt und leiste mir eine ein bissel teurere Wohnung, die dafür halt gut erreichbar ist.“ (EPU, interdisziplinär tätig) „Das bedeutet alle von unseren Gesellschaftern haben alle nebenbei gearbeitet und arbeiten immer noch nebenbei. Ja, aber das macht auch Spaß und das bringt auch wieder immenses Potential, weil man nicht so betriebsblind wird, dass man so nur in seinem, in seiner eigenen Bude steckt, sondern, man öffnet sich, man sieht halt auch noch andere Systeme, andere Firmen usw.“ (GF, IT-Projekte)
Darüber hinaus gibt es auch UnternehmerInnen, die energisch und exakt die Schritte ihrer
Unternehmensentwicklung planen und ganz konkrete Strategien verfolgen, was besonders bei
den StartUps und GmbHs ins Auge sticht..
143
3.2.8 Vernetzungsgrad
Vernetzung wird in den Interviews durch „Kooperation“, „Partner/-schaft“, „Netzwerk“,
„Mitgliedschaft“ ausgedrückt. Besonders im Zusammenhang mit Kooperation und Partnerschaft
werden Beweggründe beschrieben. Von 23 Unternehmen nutzen 17 fallweise und
projektbezogen Kooperationen, fünf davon meinen, sie kooperieren mit vielen, sechs sind
hingegen noch keine Kooperation eingegangen.
Beweggründe für Kooperationen (n=17) Anzahl Nennungen
Ressourcen nutzen 15
Arbeitsteilung 14
Finanzierung 10
gegenseitige Befruchtung 9
Synergieeffekt: Wissenstransfer 5
Tabelle 22: Beweggründe für Kooperationen446
Der wichtigste Beweggrund Kooperationen einzugehen besteht darin, gegenseitig Ressourcen zu
nutzen, die Arbeitsteilung wird an zweiter Stelle genannt. Im Zusammenhang mit Finanzierung
wird Kooperation erst an dritter Stelle gesehen. Gegenseitige Befruchtung und Wissenstransfer
sind weitere wichtige Beweggründe, um Kooperationen einzugehen.
In Bezug auf Vernetzung kann aufgrund der Erzählungen festgehalten werden, dass 11 von 25
gut vernetzt sind, fünf davon sehr gut, drei eher nicht, und von sechs gibt es keine Aussage dazu.
18 von 25 Unternehmen sind Teil von Interessengruppen oder in Netzwerken aktiv.
Folgend einige Statements zu den Beweggründen, warum Kooperationen eingegangen werden:
Beweggrund: Ressourcen nutzen
Der Beweggrund Ressourcen zu nutzen, liegt in der Schonung der eigenen Ressource Kapital.
„(...) wir sind Partner der Kunstuniversität Linz und als solcher nutzen wir beispielsweise den Raum, das Studiobüro und Produktionsräumlichkeiten (...) im Rahmen der Kooperation.“ (GF, Radio) „Und diese Kooperationen sind natürlich Sachleistungen, die so nicht im Umsatz dargestellt sind, ohne diese Sachleistungen der Gesellschafter, die uns zwar kein Geld aber die Ressourcen zur Verfügung stellen wie Produktionsmöglichkeiten usw., uns mit Personal unterstützen oder Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wäre der Betrieb kaum aufrecht zu erhalten.“ (GF, Fernsehen) „Ich kooperiere teilweise mit einem anderen Studiobetreiber, der macht uns teilweise das Mastering für unsere Musik.“ (AngestellteR, Musik)
446 Eigendarstellung
144
„Das ist für Jungakademiker die Möglichkeit wirklich Projekte, neue Projekte zu lancieren, und auch Ressourcen zu haben um auch Förderungen anzuzapfen“ (GF eines StartUps) „Was wir nutzen, ist die Tatsache, dass die Studenten dort (Hagenberg) Berufspraktika machen müssen, und das natürlich gerne in der Nähe der Uni machen, so dass wir immer sehr gute Praktikanten haben.“ (GF eines StartUps)
Beweggrund: Arbeitsteilung
„Kooperationen“ werden auch für die Aufgabenaufteilung eingegangen, jede/r macht das, was
er/sie besser kann, z.B. Aufteilung zwischen Produktion und Öffentlichkeitsarbeit. Gängige
Kooperationen im Kreativbereich sind Medienpartnerschaften, in denen ein Austausch von
„News-Content“ und Publicity für das Projekt stattfindet.
„(...) wir arbeiten immer in Netzwerken, (...) immer mit mindestens zwei bis drei Partnern und einfach weil unsere Ressourcen und Kernkompetenzen natürlich sehr IT-lastig sind und wir sozusagen durch die Partner z.B im Maschinenbau, oder im Judikativen-Bereich oder im Design-Bereich die Kompetenzen bündeln und solche Gemeinschaftsprojekte kann man nur mit einer externen Förderung, also über Förderungen erzielen und schaffen, weil das stemmt man jetzt einfach nicht einfach aus dem eigenen Cash-Flow.“ (GF, IT-Projekte) „Also das ist ein großer Schwerpunkt bei uns mit anderen Agenturen, also offizielle Kooperationen, dann Zulieferform, also wir sind für andere Agenturen tätig, aber scheinen nicht auf bzw. Kooperationen mit Freelancern, mit eben Einzelunternehmern, die selbständig sind im Beratungsbereich, im Grafikbereich etc.“ (GF, PR-Agentur)
Beweggrund: Finanzierung
In einem Gespräch wurde geschildert, dass nicht nur wegen der Aufgabenteilung Kooperationen
eingegangen werden, sondern auch um gemeinsam ein Projekt zu finanzieren bzw. mehr
Fördergeld zu erhalten, und dass durch die Zusammenlegung von Kontakten eine größere
Zielgruppe erreicht wird.
„Außerdem gibt es immer wieder Ausschreibungen, wo man Partner, sei es aus Österreich oder aus dem Ausland haben muss, vom dem her, wäre es interessant sich (...) europaweit zu vernetzen, eben bei Ausschreibungen Partner zur Hand zu haben, wo man weiß, die verlässlich sind.“ (GF, Musikprojekt) „wir haben uns auch vorzeitig zusammen geschlossen, (...) und gebeten, dass sie mit uns mitkommen bei der Jurysitzung. Macht ein anderes Auftreten, wirkt glaubwürdiger einfach. (..) für Förderanträge oder so was ist das natürlich absolut Hammer hilfreich, wenn man so einen mit an Bord hat.“ (GF eines StartUps)
Der Finanzierungsaspekt wird auch durch die Absicht des Fördergebers Projekte zu
unterstützen unterstrichen, Projekte, die einen Mehrwert für die Allgemeinheit haben:
„bei Impulse Lead ist es so, dass ich das Ergebnis auch gerne mit Anderen teile, sozusagen, es werden neue Best Practice Modelle im Projektverlauf erarbeitet, so muss man das sehen, und kann man nicht alleine einreichen (...)“ (MitarbeiterIn, aws)
145
Beweggrund: gegenseitige Befruchtung
Unternehmen schaffen und teilen sich Infrastruktur miteinander, um sich gegenseitig zu
befruchten:
(...) mitten in der Stadt, und wir sind mittlerweile 25 Menschen, die dort gemeinsam arbeiten. Unsere Firma plus 14 Andere. Insgesamt sind es 6 Firmen, die da zusammenarbeiten. Wo es untereinander sehr viele Kooperation gibt und Austausch und gemeinsame Projekte in unterschiedlichsten Konstellationen, Freundschaften. (…) (GF, IT-Projekte)
Ein Interviewpartner erzählt, dass er deswegen öfter in Kooperation mit einem anderen (EPU)
gemeinsam Projekte erarbeitet. Es handelte sich um Kooperationen im Bereich Kunst auch in
Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität.
Beweggrund: Wissenstransfer
Für Projekte, in denen Universitätsinstitute involviert sind, werden sehr häufig Kooperationen
mit kommerziellen PartnerInnen eingegangen. Dies geht aus einem weiteren Gespräch hervor.
Außerdem wird von Synergieeffekten gesprochen, die für beide Partner notwendig sind:
„Institute sind auch sehr interessiert, ihr Wissen irgendwie nach Außen zu transportieren. (...) ein typisches Beispiel, Dr. Wolfgang Beer, arbeitet im Bereich „Recommendation Engines“, (...) der braucht einen Proof, irgendwo eine Anwendungsmöglichkeit für sein Konzept. Das heißt, wir geben ihm eine User-Basis, wir geben ihm einen Kanal nach Außen, das ist wirklich so win-win. Wir haben ihn, dass wir diese Technologie bei uns einbauen können und er hat uns, um diese Technologie zu verifizieren, zu prüfen.“ (GF eines StartUps) „(...) ich glaube, dass es sehr wichtig ist für Start-Ups, – sich wirklich Gedanken über das zu machen und zu schauen, wo gibt’s Unternehmen, Institute, die Interesse haben könnten. Und einfach mal hingehen und anquatschen. Oft sind die wirklich eh offen für so was.“ (GF eines StartUps)
Ein Gespräch fokussierte auf die Notwendigkeit von Kooperationen in Bezug auf die
Qualitätssteigerung. Andere Kreative argumentieren mit dem Know-how Erwerb durch die
Kooperation mit Technologiepartnern.
„(...) die größten Partnerschaften, die wir eigentlich eingehen, ist eigentlich mit unseren Mitarbeitern. - Dh. wir streben eigentlich keine kurzfristigen Arbeitsverhältnisse, wie es jetzt so Usus ist, (...) das sagen wir auch den Leuten direkt. Also wir wollen schon, dass die Leute bei uns über vielleicht ihr halbes Leben oder was, bei uns in der Firma bleiben. Und das ist unser Kapital.“ (GF, IT-Projekte)
Mehrfach wurde festgestellt, dass Kooperationen im Laufe des Bestehens der Unternehmen
häufiger werden und auch offensiver angegangen werden:
...“ das Interesse an Kooperationen mit uns wächst eigentlich spürbar ...“ (GF, Radio) ...“wir sind in der Zwischenzeit organisatorisch, wirtschaftlich konsolidiert, haben jetzt die Möglichkeit Kooperationen offensiver anzugehen und merken, dass es von größeren Einrichtungen, Initiativen oder auch von der öffentlichen Hand verstärkt Interesse gibt mit uns zusammenzuarbeiten.“ (GF, Fernsehen) ...“ wir wissen ganz genau welche Einrichtungen und Kooperationen für uns in Frage kämen, und die klappern wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sukzessive ab“. (GF, Radio)
146
3.3 Bekannte Finanzierung
Die Kreativen wurden in zweierlei Hinsicht auf ihnen bekannte Finanzierungsmöglichkeiten
befragt. Einerseits explizit in Bezug auf ihnen bekannte Förderungen, andererseits, welche
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten ihnen darüber hinaus geläufig sind. Es fließen auch
genannte Beispiele im Rahmen ihrer Schilderungen mit ein.
3.3.1 Die Bekanntheit von öffentlichen Förderungen und Förderstellen
17 der 25 Unternehmen hatten bereits mit Förderungen zu tun. Jedoch werden nur
stichwortartig Fördermodelle oder Förderstellen genannt. Förderungen auf Bundesebene sind
zum Teil bereichsspezifisch bekannt. Details sind zumeist nicht bekannt. Die
Fördermöglichkeiten durch das AWS etwa sind bei 10 Unternehmen, zum Teil davon sehr gut
bekannt. Details wurden angesprochen und werden auch von fünf genutzt. Die Förderungen
durch die Stadt Linz und das Land Oberösterreich sind hingegen nur bei 10 von 25 bekannt,
Details werden nur von zwei genannt, manche Förderungen auf Bundesebene werden sogar als
Landesförderungen genannt. Fast besser Bescheid wissen die Kreativen von „Departure“ in Wien
(von 11 bekannt), um das sie die Wiener beneiden: „so etwas gibt es in Oberösterreich leider
nicht“, meint ein Kreativunternehmer aus dem Musikbereich. Auffallend ist auch, dass generell
betrachtet, nur vages Wissen über Fördermöglichkeiten vorhanden ist. Das ist u.a. darauf
zurückzuführen, dass sich die Kreativen zum Teil nur im Anlassfall über Fördermöglichkeiten
informieren:
„Ich habe das schon alles wieder irgendwie aus den Augen verloren, muss ich sagen, das ist schon wieder so lange her. Da habe ich mich einmal intensiv damit beschäftigt, aber habe es dann wieder versickern lassen.“ (GF, Design)
Förderungen werden in Form von monetären Zuwendungen wahrgenommen.
Auffallend ist, dass keine/r der Interviewten eine nicht-monetäre Förderung genannt hat.
Interpretiert kann dieses Ergebnis dahingegen werden, dass öffentliche Förderungen nur in
Form von monetären Zuwendungen wahrgenommen werden. Die Unterstützung der
verschiedenen Beratungs- und Informationsstellen sind zumeist nicht genannt worden.
„Also ich habe die letzten 5 Jahre sicher Subventionen im sechsstelligen Bereich akquiriert, also ich glaube, dass ich das durchaus gut kann.“ (EPU, interdisziplinär tätig) „(...) und es ist halt dann immer leichter, wenn, gerade die lokalen Stellen kennen einen ja, und wenn man dann halt von einer Stelle eine Finanzierung kriegt, dann ist es halt leichter, bei den anderen auch vorstellig zu werden (...) und so kommt man relativ schnell auf ganz gute Projektbudgets.“ (EPU, interdisziplinär tätig)
147
Förderungen werden bereichs- und branchenspezifisch wahrgenommen. Mögliche
relevante allgemeine Fördermöglichkeiten sind eher nicht bekannt.
Förderungen der Stadt Linz werden mit Kulturförderung, Preisen und „Linz Impuls“ sowie Open
Commons Initiative Linz und „geförderte Miete“ assoziiert.
Förderungen des Landes OÖ sind für die interviewten Kreativen die „Kulturförderung“, der
„Innovationsscheck plus“, „Forschungsscheck“, „OÖ-2010 Plus-Programm“,
„Technologieunterstützungsprogramm“, „geförderte Kredite“, im Zusammenhang mit „Regio 13“,
die „Filmförderung“, „Impulse OÖ“, „Bürgschaft“, „Überbrückungskredit“ und „Double Equity
Programm“, sowie die „Kooperationsförderung“. Nicht alle soeben genannten sind das auch
tatsächlich, es werden zum Teil Bundesförderungen fälschlich als Förderungen des Landes OÖ.
betrachtet. Tatsächlich bietet das Land OÖ., wie in Kapitel 2.4.2 zusammengefasst, geförderte
Kredite, Förderungen im Zusammenhang mit Regio 13, Filmförderung, und
Kooperationsförderung.
Die genannten Förderungen auf Bundesebene sind folgende Förderungen: SKE der austro
mechana, Innovationsscheck plus, RTR Fonds, die AWS Förderungen,
Jungunternehmerförderung, Filmförderung, Kunstförderung, Stipendien, aws impulse, aws erp-
Kredit, Bürgschaft, Überbrückungskredit, Mikrokredit, Arbeitsstipendium, BMFF; BMUKK, Preise,
Lebensministerium, ÖFI. Alle diese genannten Förderungen sind auch tatsächlich auf
Bundesebene angesiedelt, und somit für Kreative aus ganz Österreich zugänglich.
„Naja, für mich sind das halt immer dieselben Anlaufstellen, das ist das Land Oberösterreich, Stadt Linz, BMUKK in Wien. Und dann probiere ich halt jetzt da immer mehr andere Förderungen, z.B. was weiß ich, ich habe ein Stipendium gekriegt von der Wirtschaftskammer einmal.“ (EPU, Film) „Also Finanzierung CF, AWS, FFG (...)“ (GF eines StartUps, EPU PR und interdisziplinär tätig) „Was ich sehr toll finde ist diese vom Austrian Wirtschaftsservice diese Impulse Lead, Impulse XL, XS, die Innovation schätzt, die sehr (Anmerkung: Gelder) unbürokratisch ausgeben werden und über diese Schiene kann man sehr gut eigentlich so Ideen, wo es einfach noch keinen Markt gibt, wo es wirklich noch eine Idee ist zuerst mal anfangen mit einem Innovationsscheck etwas auszuformulieren (...)“ (GF, Musikprojekt) „Also da gibt’s auch Fördermöglichkeiten, haben wir selbst in Anspruch genommen, geförderte Kredite für Unternehmensausbau.“ (GF, Design)
Förderungen anderer Bundesländer sind bis auf das Wiener„Departure“ nicht genannt worden.
148
3.3.2 Die Bekanntheit von weiteren Finanzierungsquellen
Die Nennung anderer Finanzierungsquellen als Förderungen reicht von Sponsoring bis Abo-
Modell bis zu konkreten Angeboten. Interessanterweise wurden bei dieser Frage dennoch
immer wieder Förderungen genannt. Die am häufigsten genannten
„anderen“ Finanzierungsquellen können der unten angeführten Tabelle entnommen werden:
Art Anzahl der Nennung
Kredit 9
Förderungen in irgendeiner Form 8
Sponsoring 7
Beteiligung in irgendeiner Variante 7
Eigenleistung 5
Kooperation 5
FFF-Kapital (Familie, Erbschaft, Vermögen,...) 5
Crowdfunding („Crowdfunding ist mir ein Begriff“) 2
Tabelle 23: Ranking der genannten Finanzierungsquellen447
Die verschiedenen Finanzierungsquellen, die genannt wurden, sind folgende:
Das Abo-Modell (Pay-TV), Sponsoring, Beteiligungen, Eigenleistung, stille Teilhaberschaft,
Kooperations- und Clusterförderung, MitarbeiterInnen-Beteiligungsmodell, sonstige
Beteiligungen, Business Angels, Erspartes, Privatvermögen, Familie, Freunde, Kredite,
Crowdfunding, Anstellung, aber auch beispielsweise Fördervereine.
Aussagen dazu sind u.a:
„(...) natürlich Kredite, ja, nur wird es schwierig sein, dass man einen Kredit kriegt.“ (EPU, Design) „öffentliche Förderung, aber auch über Architektur Geld zu verdienen und es für Projekte umschichten und wenn es nicht ausreicht wird trotzdem weiter daran gearbeitet.“ (GF, Kunst am Bau/Architektur) „Ich versuche es jetzt dann bei einer Bank (Sponsoring zu erhalten).“ (EPU, Film) „Eigenfinanzierung bzw. dann weiteres Venture Capital“ (GF eines StartUps) „Aber für ein kleines Kreativprojekt würde ich heutzutage mit Crowdfunding starten.“ (EPU, PR- und interdisziplinär tätig)
447 Eigendarstellung
149
3.4 Genutzte Finanzierung
Die oben angeführten konkret genannten Förderungen werden zum größten Teil genutzt, die
AWS Impulse Förderungen beispielsweise von fünf Unternehmen. Genaue Zahlen sind nicht
vorhanden, da sie im Interview nicht durch einen Förderkatalog abgefragt wurden. Abgefragt
wurde jedoch, wie sich der Finanzierungsmix bei den Kreativunternehmen in etwa darstellt. Die
Frage nach dem Finanzierungsmix wurde wie folgt beantwortet und kann der folgenden Grafik
entnommen werden.
Abbildung 25: Finanzierungsmix448
Die in der oben angeführten Grafik genutzten Mittel sind zum größten Teil Förderungen, das 3F-
Kapital wird von fünf Unternehmen genutzt, aber lt. Angabe der Kreativen nur zu einem Ausmaß
von zwei bis drei Prozent. Sonstige private Mittel beziehen sich auf Business Angel- und Venture
Capital, sowie Beteiligungen, zwei Unternehmen verfügen über einen Kapitalzufluss von außen
in einem Ausmaß bis 10 %, zwei weitere Unternehmen in einem Ausmaß von 70 % bis 95 %.
Erspartes ist nicht nur für Jungunternehmer relevant, auch bereits länger unternehmerisch
Tätige nutzen es für die Betriebserweiterung. Die Frage nach Eigenleistungen wird von 23
Unternehmen beantwortet, vier haben eine Eigenleistung von 0 %, das lässt auf StartUps
schließen, die in der Anfangsphase noch keinen Cashflow haben, sowie auf einen Kreativen, der
derzeit von einem Stipendium oder Ähnlichem lebt.
Förderungen werden von 17 Unternehmen in sehr unterschiedlichem Ausmaß genutzt, wie in
folgender Grafik veranschaulicht:
448 Eigendarstellung
ehrenamtliche Hilfe (7; k.A.)
Tauschgeschäfte (7; 1-8%)
so. Private Mittel (4; 2 zw. bis 10%, 2 zw. 70-95%)
Erspartes (3; 0-20%)
Förderungen (17; zw. 5-90%)
3F-Kapital (5; 2-3%)
Eigenleistung (21)
150
Abbildung 26: Förderanteil bei KU (n=17)
Der Anteil an Eigenleistung wurde von 19 von 23 wie folgt angegeben:
Abbildung 27: Anteil Eigenleistung (n=25)
Nachgefragt wurde auch, wie sich die Kreativen zukünftig finanzieren bzw. wie zukünftig der
Finanzierungsmix aussehen soll, ob die Unternehmen expandieren wollen. Dazu meinen die drei
Geschäftsführer der StartUps, sie haben vor stark zu wachsen, drei Geschäftsführer von GmbHs
bzw. OG rechnen mit einem mäßigen Wachstum, sieben Kreative mit einem ähnlichen
Wachstum, fünf sagen es bleibt gleich, fünf machten dazu keine Aussage.
Für die Finanzierung in den Anfangsjahren liegen detailreiche Schilderungen vor.
Anlassbezogene Förderungen, beispielsweise für neue Projekte, Geschäftsentwicklung,
Neuinvestitionen, werden erst in den Folgejahren in Anspruch genommen. Abseits der
Förderungen werden das Ersparte, Gelder von anderen Jobs, Gelder von Business Angels,
Venture Kapital und sonstigen Beteiligungen, die Eigenleistung, Tauschgeschäfte, Sponsoring
Förderanteil:
90%: 2 KU
80%: 2 KU
60%: 2 KU
40-50%: 7 KU
20-30%: 2 KU
5%: 1 KU
ka: 1 KU
Eigenleistung (n=25):
1 unter 10%
7 zw. 10-14%
4 zw. 90-100 %
3 zw. 70-80%
1 bei 20%
3 zw. 40-50%
4 0%
2 k.A.
151
und Gelder von Fördervereine herangezogen. Etliche dieser Möglichkeiten wurden bei der
Abfrage des Finanzierungsmix nicht genannt.
Schilderungen der Anfangsphase:
„Das Gute war das bei mir, (...), dass ich nach Beendigung des Studiums ein Stipendium gewonnen habe, und das war eigentlich mein Startkapital, das ich gehabt habe. Und habe eigentlich zu Beginn nicht viel gebraucht außer einen Computer und ein bisschen Ausrüstung usw.“ (DesignerIn) „Jetzt mit diesem aws XS, finde ich, ist wirklich eine absolut klasse Möglichkeit, Start-Ups gerade in der ersten Phase zu finanzieren. Ohne dem würde es uns wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben. Wir würden sicher weiter machen, aber halt sehr reduziert. Jeder hätte sicher einen Job nebenbei und könnte das halt nur stundenweise machen. Und die Förderung gibt uns wirklich Luft auch, das Ding auch weiter zu pushen, weiter zu entwickeln.“ (GF eines StartUps) „Wir finanzieren uns „Derzeit über einen aws XS und Erspartes“ (GF eines StartUps) „Zum Start haben wir begonnen mit Null. Mit einfach einbringen unserer Arbeitsleistung, arbeiten von zu Hause, mit dem ersten Geld den ersten Server gekauft, mit dem zweiten Geld eine GmbH gegründet.“ (GF, IT-Projekte) „Also die Zeiten, wo wir uns kein Gehalt zahlen, sind längst vorbei. Das haben wir ganz am Anfang gemacht für fast ein Jahr, aber das ist natürlich kein nachhaltiges Modell. Und ich würde auch niemandem empfehlen das zu tun, oder lassen sie es mich so formulieren: man kann natürlich vorübergehend sich nichts auszahlen, aber das Unternehmen als Rechtsperson schuldet einem dann was.“ (GF, StartUps)
Der Charakter eines Projektes/Vorhabens ist ausschlaggebend für die Art der Finanzierung.
Bei Projekten mit starkem künstlerischem Anspruch überwiegt die Nutzung von Förderungen
und Sponsoring bei gleichzeitiger Reduktion der Lebenshaltungskosten. Gründer, insbesondere
StartUps versuchen, möglichst viele Geldquellen, besonders solche, die nicht rückgezahlt werden
müssen, „anzuzapfen“, da sie jede Möglichkeit ausschöpfen müssen. Es gibt aber auch
gegenteilige Aussagen von StartUps, die meinen, der Aufwand wäre für die potentiellen
Fördersummen zu hoch. Diese Unternehmen hoffen auf die Beteiligung von Business Angels
oder Venture Capital Gebern.
„Ich habe zum ersten Mal so, Projektentwicklung nennt sich das, beantragt. Die habe ich auch bekommen.“ (DesignerIn) „Und finanzieren tun wir uns hauptsächlich über Förderungen von BMUKK, die letzten drei Jahre auch über Förderungen vom Lebensministerium bzw. auch Sponsoren, bzw. haben wir einzelne Projekte, wo wir beauftragt werden, wo wir für unsere Aufwendungen ein Budget haben. Also da bekommen wir unsere Aufwendungen und Stunden unter.“ (GF, Kunst am Bau/Architektur) „Sponsoring, das ist ein klassischer Förderverein, so wie ihn fast jede Kultureinrichtung fast in der Zwischenzeit hat, der Freundesverein wird getragen von, wenn man so will honorigen Mitgliedern der Gesellschaft, die in ihrem Umfeld, dass Leute einen bestimmten Betrag an den Verein spenden, und mit diesen Spenden unterstützt der Verein dorf.tv bzw. die Tätigkeit von dorf.tv. Genauso wie es die Freunde vom Lentos, oder die Freunde vom Burgtheater, usw. gibt, so gibt es auch einen Freundesverein von dorf.tv.“ (GF, dorf.tv)
152
„Ein Kredit nicht - es ist gescheiter, dass wir selber Geld verdienen so quasi wie es uns schon Ansatzweise gelingt, wo uns Veranstaltungen übergeben werden, und wir mit dem Budget so arbeiten, dass da etwas für den Verein übrig bleibt. Wir schauen, dass wir das verstärken und somit nicht in so einem starken Ausmaß von Förderungen oder Sponsoring abhängig sind.“ (GF, Architektur)
Es gibt Finanzierungsquellen, die als Basisfinanzierung genutzt, und Finanzierungsquellen,
die projekt-vorhabenspezifisch gesehen werden:
Aus den Gesprächen geht hervor, dass Finanzierungsquellen für zwei Hauptbereiche genutzt
werden: als Basisfinanzierung und punktuell um ein Vorhaben oder Projekt umzusetzen. Die
folgende Darstellung zeigt die Aufteilung der Finanzierungsquellen in diese beiden Bereiche. Bei
der Basisfinanzierung geht es um die finanzielle Grundausstattung überhaupt aktiv zu werden,
entweder ein Unternehmen zu gründen, oder um die laufenden Fixkosten (= minimale
Lebenserhaltungskosten) decken zu können. StartUps können ohne Beteiligung von Business
Angels und ohne Venture Capital ihren laufenden Kapitalbedarf bis zum Verkauf/IPO449 nicht
finanzieren.
Abbildung 28: Basisfinanzierung und Projektfinanzierung450
449 (Initial Public Offering)
450 Eigendarstellung
Vorhaben-bezogene Finanzierung:
Sponsoring, Eigenleistung, Zuschüsse, Technologieförderung, OCI Linz, Linz Impuls, BMUKK, so.
Förderungen
Basisfinanzierung:
Erspartes, anderer Job, Kulturförderung Land OÖ, Stadt Linz, SKE Fonds, Gesellschafteranteil, Tauschgeschäft,
BA, VC, sonstige Beteiligungen, Sponsoring, Förderverein
153
3.5 Erfahrungen mit Finanzierung
Erfahrungen, die im Zusammenhang mit Förderungen gemacht wurden, sind wie folgt
zusammengefasst und
betreffen: Anzahl Erwähnungen
die Förderstellen selbst 7
die Förderbeträge 9
den Aufwand in Bezug auf Förderhöhe und Zeit 17
die Freundlichkeit und Hilfestellung der Förderstellen 4 (1 davon negativ)
die Richtlinien 7
Tabelle 24: Erfahrung mit Förderstellen451
Erfahrungen zu anderen Finanzierungsquellen sprechen mehrheitlich die Beziehungsebene und
das Vertrauen an:
Beziehungsproblematik / Vertrauen Anzahl Nennungen
(n=8)
rigide Bankenpraxis 2
gutes Verhältnis zur Hausbank, vertraue ihr 3
Vertrauen in Business Angels (2 positiv) 3
Haftungsproblematik 4
Tabelle 25: Erfahrung mit anderen452
Folgende Beispiele zeigen das auf:
„Venture Capitalists sind auch nur Menschen, begeisterbar“ (GF eines StartUps) „Ich bin auch schon langjähriger Kunde dort bei der Bank und habe auch andere Aktivitäten, also einen Verein, wo es immer wieder um größere Summen geht, (...) dementsprechend einfach geht die Geschichte dann natürlich auch für mein Unternehmen, weil man mich kennt, weil Persönliches herrscht.“ (EPU, Mode) „Finanzierung durch Sponsoring erfolgreich schaffen, ist ein sehr schwieriger Weg, besonders bei großen Unternehmen bis Konzept an Entscheider kommt (...)“ (GF, Kunst am Bau/Architektur) „Mit guter Arbeit hast du guten Ruf, Aufträge durch Mundpropaganda, das hat einige Zeit gedauert.“ (EPU, interdisziplinär tätig) „die persönliche Ebene ist sehr relevant, und Mundpropaganda“ (EPU, PR- und interdisziplinär tätig) „Es ist extrem schwierig in der Anfangsphase als "No-name", Unternehmen haben Hemmungen mit Künstlern zusammen zu arbeiten.“ (EPU, KünstlerIn) „ (...) Da kommt es sehr stark darauf an, bei welcher Bank man ist und welche Person man als Ansprechpartner hat.“ (GF, IT-Projekte)
451 Eigendarstellung
452 Eigendarstellung
154
Bei „Förderungen auf drei Jahre“ wird eine Indexanpassung vermisst. Die Einreichung bei Stadt
und Land wäre „mühsam, bürokratisch, dauert lange“. Grundsätzlich wird ein sehr guter Support
in OÖ festgestellt, „Cluster Netzwerk bringt was, weil das gefördert wird“. Die MitarbeiterInnen
der aws werden von vielen für ihre Hilfestellung gelobt:
„ausgezeichnete Betreuung, persönliches Vorstellen in Wien sehr positiv“. „Ich habe sehr gute Erfahrung gemacht mit FFG und Design-Cluster, mit Creative Region habe ich noch keine Erfahrung.“ „Einfach bei der Stelle anrufen ist am Effizientesten“. (GF eines StartUps) „(...) eine gute Beratung? - Nein, nicht sehr, war eher mäßig, war eher sich selbst darum kümmern.“ (GF eines StartUps) „da haben wir am Anfang geschaut, was man raus holen kann, aber wenn es irgendwo abschreckend war, dann vor allem die Formalitäten und der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen und zu dem, was man raus holen kann.“ (GF eines StartUps) „Die Einreichung war sehr umfangreich, da habe ich mir schon fast 2 Monate Zeit genommen dazu, das zu machen.“(EPU, Mode)
Es wird jedoch auch Kritik am Reglement der Förderungen geübt:
„Jede Stelle hat ihre Art der Berechnung- und Abrechnung - kompliziert.“ „Departure war damals sehr mühsam, weil bürokratisch, alles war genau zu dokumentieren, aws im Vergleich, habe ich nicht so bürokratisch empfunden.“ (EPU, PR- u. interdisziplinäre Projekte) „Ich habe um Jungunternehmerförderung angesucht und zu wenig Startkapital gebraucht, es wurde abgelehnt.“ (GF, Film) „Die Förderung konnte ich nicht nutzen, da ich die Anschaffung schon vorher getätigt habe“ (EPU, PR) man müsse: „so formulieren, dass DIE ja sagen können“ (GF eines StartUps) „(...) geförderte Miete - Resträume im Sozialamt, da ist die Grundmiete zu hoch, es war nicht lebendig, Tabakfabrik wird dann schon mehr Netzwerkcharakter haben, viele sind davon aber wieder abgesprungen weil vieles unklar war.“ (EPU, Design) „die Mikrokreditberatung war nicht gut.“ (AngestellteR, Musik) "die Informationsbörse für Film ist in Wien" (EPU, Architekturdesign)
3.6 Besonderheiten
Besonderheiten beziehen sich auf die Standortfrage und den gegenseitigen unentgeltlichen
Austausch von Dienstleistungen, sowie auf die Kritik an der Fördervergabe.
Standortfrage:
Die finanzielle Lage, die Förderlandschaft – so erschien es zunächst bei einigen Interviews – wird
als Grund für Abwanderung angegeben, dies trifft zumindest zu einem geringen Anteil bei jenen
zu, die mit PR, Bühnenbild/Design, Spieleentwicklung erfolgreich sein wollen.
155
Für die Standortfrage ist relevant, ob Absatzmärkte unmittelbar in nächster Nähe gegeben sind.
Die Betroffenen haben angegeben, dass sie nach Wien gehen würden, z.B. jene Kreativen die in
der Filmbranche und Spieleindustrie aktiv sind. Für andere EinzelunternehmerInnen ist die
familiäre Nähe und Partnerschaft ausschlaggebend für den Verbleib in Oberösterreich und Linz.
Die Nähe zur Industrie und die geographische Lage Oberösterreichs (Nähe zu Deutschland und
anderen Bundesländern Österreichs), ist vor allem für Designer und im Architekturgewerbe
tätige Kreative relevant und vorteilhaft für ihr unternehmerisches Handeln. Jene, die im Bereich
PR aktiv sind, nutzen den Vorteil geringerer Konkurrenz in OÖ.
„Linz hat einerseits die Kultur, die man ja auch holt. Dann der Reiz der Stadt an sich, also diese Mischung aus Industriestadt und inzwischen Kunst-Kultur-Medienstadt, die sich da ein bissel auftut. Und trotzdem irgendwo, für uns persönlich, das Kleinformatige. Also eine gewisse Überschaubarkeit (...) und ja, finanziell ist es natürlich auch, betreffend Miete etc., ist natürlich Linz interessanter als Wien. Trotzdem hat man eigentlich einen großen Wirtschaftsstandort mit Oberösterreich und Linz. Das merken wir bei unseren Projekten und Kunden, dass sich da sehr viel tut.“ (GF, Design)
„(...) es ist glaube ich für mein Feld jetzt ein super Standort, weil es städtisch ist von der Kultur her, es gibt einen bestimmten Bedarf an Objekten, Ausstellungen etc, aber zugleich nicht eine so riesige Konkurrenz wie Du sie in Wien hast.“ (EPU, Raumkunst)
Tauschgeschäfte:
Besonders in der Kreativwirtschaft sind kleine Tauschgeschäfte häufig. Mögliche Beweggründe
dafür liegen im Ressourcenmangel von Geld und Know-how. JungunternehmerInnen berichten
darüber, aber auch länger unternehmerisch Tätige belegen das mit Beispielen:
„Ja es passiert oft, dass wir uns gegenseitig helfen und dafür halt auch nicht bezahlt werden. Ja, ganz normal ist das eigentlich.“ (EPU, Film) „Tauschgeschäfte, sprich jetzt ein Tischler, mit dem wir eng zusammen arbeiten, braucht irgendeinen Folder oder Prospekt oder sonstiges, das wir ihm machen, und wir wiederum brauchen irgendwie einen Prototypen eines Sessels z.B., weil wir einfach bestimmte Proportionen usw. anschauen wollen, und es wird in dem Sinne gegenverrechnet.“ (GF, PR-Agentur)
Fördervergabe:
Für den Geschäftsführer eines Familienunternehmens (100 % eigenfinanziert, 70
MitarbeiterInnen) ist die Fördervergabepraxis noch zu intransparent. Er zweifelt einerseits die
Qualität der Juryentscheidungen insofern an, dass sie zwar über großes Fachwissen verfügt,
aber auch „Copy-Cats“ für förderwürdig erachtet, andererseits auch die Förderstelle: „das wird
nicht überprüft ob das ein marktfähiges Produkt ist, ob da irgend etwas heraus kommt, - was
daraus gemacht worden ist, ob da ein Return of Investment ist“. Außerdem kritisiert er
UnternehmerInnen, die versuchen das unternehmerische Risiko „auf Kosten der
Allgemeinheit“ durch in Anspruchnahme zu minimieren. Außerdem würden „(...) Sachen als ganz
156
tolle Neuheiten präsentiert, die seit 30 Jahren so was von bekannt sind, aber einfach ignoriert
wurden, wo Forschungen da waren, wo es wissenschaftliche Arbeiten darüber gibt. Und jetzt stellen
sich ein paar hin und tun so, als wenn sie das gerade erfunden hätten.“
3.7 Stellung des Crowdfunding bei Kreativen (n=23)
Die Stellung des Crowdfunding bei Kreativen wurde aus mehreren Perspektiven abgefragt.
Zunächst wurde in einem ersten Schritt hinterfragt, ob Crowdfunding überhaupt bekannt ist
(n=23), und in welchem Kontext schon davon gehört wurde. Im zweiten Schritt wurde bei
Bejahung (n=20) nachgefragt, ob eine Anwendung schon überlegt wurde oder sogar bereits
ausprobiert wurde, und/oder zukünftig angewendet werden würde. Außerdem wurde gefragt
welche notwendigen Voraussetzungen die Kreativen für ein erfolgreiches Crowdfunding sehen.
Zwanzig UnternehmerInnen haben bereits von Crowdfunding gehört, hauptsächlich über
Medien, zumeist positiv. Sechs Mal wurde der Fall „Waldviertler“ genannt, der in negativer
Erinnerung behalten wurde. Vierzehn haben bereits für sich überlegt, ob Crowdfunding für sie
von Relevanz ist. Fünf Kreative haben Crowdfunding bereits angewandt, nur einer davon bzw.
ein Projekt konnte reüssieren. Die Frage, ob Crowdfunding zukünftig eine Finanzierungsoption
sein könnte, wurde von sechs bejaht. Ein Argument dazu war: „Förderungen dauern länger, bei
ähnlichem Aufwand.“ (GF, StartUps)
Antworten zur Anwendung von Crowdfunding (CF) (n=20)
Anzahl Ja
habe überlegt CF anzuwenden 14 habe CF angewandt 5 habe ein Projekt durch CF finanziert bekommen 1 Werde zukünftig CF anwenden 6
Tabelle 26: Anwendung von Crowdfunding453
Unter den fünf Kreativen, die Crowdfunding angewandt haben, waren zwei, die die „kritische
Masse“ nicht erreicht haben, und Crowdfunding auch eher nicht mehr anwenden wollen. Jene die
es nicht versuchen wollen, argumentieren entweder mit „Aufwand lohnt nicht“, „vielleicht“,
„eventuell“, „möglich“, oder „es kommt auf das Projekt an.“
Voraussetzungen:
Die Interviewten haben recht klare Vorstellungen, welche Voraussetzungen für Crowdfunding
vorhanden sein müssen. Dabei konnte festgestellt werden, dass, auch jene, die Crowdfunding
453 Eigendarstellung
157
selbst noch nicht angewandt haben, durchwegs gleiche Voraussetzungen nannten, wie die
Erfahrenen. Unterschiedliche Aussagen gibt es in Bezug auf die Einschätzung des Aufwandes
und der notwendigen planerischen Tätigkeiten und bezüglich der Betreuung der
UnterstützerInnen.
Die zumeist genannten Voraussetzungen für Crowdfunding sind:
Voraussetzung Anzahl Nennungen Kritische Masse erreichen 10 geeignetes Projekt/Produkt (Innovation, zivilgesellschaftlich od. community-relevant, ..)
8
höhere Projektsummen (1 direkte, 6 indirekte Aussagen)
7
Know-how und Social Media Kompetenz 6 Marketing/PR/Medienunterstützung 6 Planung/Vorbereitung notwendig (Verteiler, Kommunikationskanäle, Film, Video, Texte, ...) (indirekte Aussagen)
6
Personalressourcen 5 aktive/wiederholte Betreuung der UnterstützerInnen 5 Vertrauen (in das Projekt, die Plattform, in handelnde Personen, Zahlungssystem durch Gütesiegel, Copyright, Datenschutz)
4
CF-Kampagne durch Multiplikatoren unterstützen 4 Bewusstsein schaffen 3 Gegenleistung (gut überlegen) 2 Bekanntheit des/r Projektanten/in 1 keine besondere Voraussetzung notwendig 1
Tabelle 27: Voraussetzungen für Crowdfunding454
Aussagen dazu sind:
„Es braucht Know-how wie man eine kritische Masse erreicht.“ (meinen sowohl Crowdfunding erfahrene, wie auch unerfahrene UnternehmerInnen) „Die wichtigsten Dinge: private Kontakte, soziale Medien nutzen, eine größere Plattform, und eben realistisch bleiben.“ (EPU, PR- und interdisziplinär tätig) „Es wird suggeriert dass das einfach ist, es ist aber verdammt schwierig.“ (GF, Musikprojekt) „Wenn man erfolgreich sein will, muss man sehr sehr viel Zeit in Werbung und laufender Begleitung investieren.“ (EPU, interdisziplinär tätig)
454 Eigendarstellung
158
3.8 Hemmnisse der KU (n=25)
Hemmnisse wurden nicht direkt abgefragt. Diese können nur aus dem Erzählten entnommen
werden, entweder weil sie direkt genannt wurden oder indirekt im Zusammenhang mit
Erfahrungen angesprochen wurden. Zu den 23 Interviews werden auch zwei Kurzgespräche
(Interviews von kürzerer Dauer) mit einbezogen. Die Haupthemmnisse können wie folgt
zusammengefasst werden:
Art der Hemmnisse Anzahl
Nennungen
Ressourcenmangel Kapital 17 Formalitäten und Aufwand bei Förderungen 14 Wissensmangel über Förderungen 12 Ressourcenmangel Zeit 6 Auftragsmangel 6 Ressourcenmangel Arbeitskraft 5 Organisationsprobleme 5 Mangel an Planungssicherheit bei Förderungen (Kurzfristigkeit, Ungewissheit bis Zusage, Wideruf von Zusage)
5
Fehlen von leistbaren Krediten 5 rigide Bankenpraxis 5 Einschränkung der unternehmerischen Selbstbestimmung 5 Mangel an Risikokapital 4 unterschiedliche Standards bei Förderungen 4 Vergabepraxis 4 Fehlen von Referenzen / Bekanntheit 4 fehlende Förderungen für Markteinführung 3 fehlende Förderungen für Pre-Seed- und Seed-Phase 3 Fehlen von leistbaren Mietobjekten 3 Mangel an Sicherheiten 3 Medienberichterstattung, regionale Medien 3 Finanzierungsengpass in Zusammenhang mit 13./14. Monatsgehalt 2 Finanzierungsengpass in Zusammenhang mit Sozialversicherung 1 branchenspezifische Hemmnisse 1
Tabelle 28: Hemmnisse455
Der Ressourcenmangel an Kapital betrifft die meisten Interviewten. Das Fehlen von leistbaren
Mietobjekten wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls genannt. Weitere Ressourcenmängel
wie Zeit und Arbeitskraft beziehen sich einerseits auf das Bewältigen des Arbeitsalltags
insbesondere beim Projektgeschäft, und andererseits auf das sich Informieren über
Fördermöglichkeiten bzw. das Einreichen von Förderungen, und ist eng mit dem Wissensmangel
über Förderungen gekoppelt.
„brauche einen Mitarbeiter für Administratives“ (Künstler, setzt Großprojekte um) „Business Angel, Venture Kapital, Förderstellen, sehr, sehr wichtig, extrem wichtig. Ich meine, das ist ja nicht so das erste Start-Up, was ich probiert hätte. (...) keiner von uns hat irgendeine Ahnung gehabt, was gibt’s denn für Förderungen? Und, ja, da hast du dann zwar vielleicht ein Produkt, das noch nicht ganz ausgereift
455 Eigendarstellung
159
ist, aber du hast keine Ahnung, wie du es weiter finanzieren sollst. Das war bis jetzt immer das Problem.“ (GF eines StartUp) Der Wissensmangel in Bezug auf Förderungen, wirkt sich dann besonders zum Nachteil von
Unternehmen aus, wenn die ersten Schritte bereits gemacht wurden. Das ging aus drei
Interviews hervor.
Für den ersten Mitarbeiter was ich weiß, oder, glaube ich, (..:). Aber ich glaube, dass haben wir uns eh schon vertan, da weiß der XX besser Bescheid, weil wir schon uns einen Geringfügigen angenommen haben, und der zählt aber für das auch schon, haben wir im Nachhinein erfahren.456 (GF, StartUp)
Der Aufwand rund um Förderansuchen schreckt ab. Generell wird weniger Bürokratie
gewünscht, diese wird als ein Grund, keine Ansuchen zu stellen, genannt. Die Planungssicherheit
im Zusammenhang mit Förderungen stellt ein weiteres Hemmnis dar. Ein Hemmnis liegt für
freie Radios in der Kurzfristigkeit, gewünscht werden längere Förderzeiträume (z.B. Förderung
für 3 Jahre), bei StartUps in der zu langen Ungewissheit, ob die Förderungen bewilligt werden.
„Jedes Finanzierungsinstrument hat während der Auszahlung 2, 3, 4 Meilensteine, die man erreichen muss, und 8 mal 3 ist 24, das heißt, sie haben über 2 Jahre jedes Monat einen Meilenstein im Schnitt, den sie erreichen müssen. Jedes Mal verbunden mit einem Bericht, mit endlosen Diskussionen, ob er jetzt erreicht ist. Und das ist eines der größten Probleme, die wir da haben in Österreich.“ (GF, Technologie-StartUp)
„Förderungen sind nicht tragbar für bestehende Unternehmen wegen des Nutzen/Aufwandes, "Geld fürs Antragschreiben“, „dauert, ist ungewiss und kompliziert.“ „weil wir ein kleines Unternehmen sind (...) der Aufwand dann relativ schnell explodiert für das, was man dann gefördert kriegt.“ (Meinungen von GF von StartUps und etablierten Unternehmen)
In einem anderen Fall war führte das Zurückziehen eines bereits in Auftrag gegebenen
Kunstobjekts beinahe in den Ruin.457 Weitere Hemmnisse in Bezug auf Förderungen sind das
Fehlen von standardisierten Einreich- und Förderabwicklungsprozessen und standardisierten
Einreichunterlagen. Auch die Vergabepraxis wurde angesprochen. In zwei Fällen wurde
argumentiert, dass es das System zu durchschauen gilt, um eine Förderung zu erhalten, in einem
anderen Fall, dass ohne Reputation keine Förderung erhalten wurde, in einem vierten Fall
wurde die Bevorzugung von ansässigen Kreativen genannt. Von den vier Kritiken zur
Förderpraxis betreffen drei OÖ. Förderstellen und eine davon eine bundesweite Förderstelle.
„nur Söhne und Töchter der Stadt Linz werden gefördert“ (Künstler, hat in Linz studiert, lebt und arbeitet in Graz)
456Wissensmangel über Förderung vor Gründung: Förderung eine/r/s Mitarbeiters/in bzgl.
Sozialversicherungsbeiträgen
457 Auftraggeber: Landesregierung Stmk.
160
„(...) es ist halt dann immer leichter, wenn, gerade die lokalen Stellen kennen einen ja, und wenn man dann halt von einer Stelle eine Finanzierung kriegt, dann ist es halt leichter, bei den anderen auch vorstellig zu werden (...) und so kommt man relativ schnell auf ganz gute Projektbudgets.“ (EPU, interdisziplinär tätig)
„Also wenn man das System durchschaut und weiß wie es läuft, dann bekommt man das Geld und es ist egal was hinten heraus kommt.“ (GF, Familienunternehmen, 100 % Eigentum) „Ja, wenn man einreicht – ich habe ja zigmal in den letzten 5 Jahren irgendwo eingereicht – und habe nie etwas bekommen oder ganz selten, und jetzt bekomme ich ganz viel auf einen Schlag (...) und wenn diese Dinge klarer sind, man sich schon durchgesetzt hat, und schon etwas umgesetzt hat, ist es natürlich einfacher für eine Jury das Potential von Jemandem zu sehen und zu sagen, ja das Projekt ist unterstützenswert. Aber die Anfangsphase ist extrem holprig und mühsam, ich kann es nur Jedem wünschen, da möglichst schnell durchzubrechen – diese Mauer, weil (...) es sind viele interessante Einreichungen am Jurytisch, da wette ich was, aber als Noname, oder als Jemand, der Niemand kennt muss man überzeugen, und das ist schon ein extrem harter Wettbewerb. (...)“ (EPU, KünstlerIn, interdisziplinär tätig)
Das Fehlen von Förderungen wurde in Bezug auf die Markteinführung, sowie für die
Unternehmensentwicklungsphasen Pre-Seed- und Seed-Phase festgestellt.
„Sie bekommen keine öffentlichen Förderungen für Markteinführungen. Es gibt nur eine Ausnahme, beim AWS Impulse Programm, das ist das einzige Programm das wir kennen im europäischen Umfeld, wo man Förderungen bekommt, wo am Ende ein Produkt herauskommen soll.“ (GF, Software/OS, 17 Angestellte)
Im Kontext mit Ressourcenmangel zu Projektspitzenzeiten tauchen immer wieder
Organisationsprobleme auf. Als weitere Hemmnisse werden die fehlende Bekanntheit und
Reputation sowie mangelnde Berichterstattung in Medien genannt.
„Eine Bekanntheit muss erst mühsam aufgebaut werden, dann kommen Aufträge.“ (Designer) (...) ganz klar, kennen mich die Leute, kennen mich meine Auftraggeber über meine ehrenamtlichen nicht bezahlten Tätigkeiten (...) (EPU, interdisziplinär tätig)
Das Fehlen von leistbaren Krediten, betreffend Zinssatz und Rückzahlungsdauer, die
empfundene rigide Bankenpraxis und der Mangel an Sicherheiten werden ebenso genannt.
„Also ich rate jedem ab, mit seinem Privatvermögen zu haften für einen Unternehmenserfolg. Daher finde ich auch die Einführung einer, das, was immer als kleine GmbH. bezeichnet wird, so wichtig. (...) Generell, Unternehmen fremd zu finanzieren ist nicht gut.“ (GF, Technologie-StartUp)
Die Angst vor Abhängigkeit von Förderungen, von Business Angels und von Sponsoren, wird als
Einschränkung der unternehmerischen Selbstbestimmung gesehen.
„Beteiligung am Unternehmen bedeutet Abgabe von Rechten, Partner muss daher stimmen.“ (GF, Mode, sucht Beteiligungskapital) „Risikokapital fehlt, die Banken lassen aus“ (GF eines StartUp) „Also wir verwenden nicht diese typischen Bankkredite, wo man Sicherheiten stellt, mit dem Privatvermögen haftet etc. (...) weil, wir sind ein Technologie-Start-Up, und so was mit Bankkrediten zu finanzieren ist ein No-Go.“ (GF, Start-Up)
161
Weitere Hemmnisse stellen Finanzierungsengpässe in Zusammenhang mit dem 13. und 14.
Monatsgehalt dar, wie von UnternehmerInnen mit einer Anzahl um die 10 MitarbeiterInnen
berichtet wurde. Ein Alleinunternehmer hat auch den Finanzierungsengpass in Zusammenhang
mit der Sozialversicherung genannt. Ein weiteres, branchenspezifisches Problem, bezog sich auf
den Verfall von Lizenzgebühren, die Auftraggeber zahlen.
Hemmnisse bei Crowdfunding
Diese beziehen sich auf Überlegungen Crowdfunding anzuwenden bzw. nicht anzuwenden. Sie
stehen in engem Zusammenhang mit den Voraussetzungen, die im vorhergehenden Kapitel
besprochen wurden. Die Haupthemmnisse sind in folgender Tabelle zusammengefasst:
Hemmnisse im Zusammenhang mit Crowdfunding Anzahl
Nennungen
geeignetes Projekt 14 Zielgruppe nicht Internet-affin 9 Freundeskreis im „Netz“ zu klein 9 Mangel an Wissen über Crowdfunding 8 Aufwand 6 Mangel an Ressourcen 6 ungeklärte Rechte 6 niedrige Summen 4 Mangel an Erfahrungsberichten 4 Negativ-Beispiel „Waldviertler“ 4 Alles oder Nichts-Prinzip 4 Medienpräsenz 4 Restbeträge selbst einzahlen 2 Ideen für Gegenleistungen 2
Tabelle 29: Hemmnisse Crowdfunding anzuwenden458
Für die 14 Personen459, die überlegt haben Crowdfunding anzuwenden, steht diese Überlegung im
Zusammenhang mit einem noch nicht näher definierten Projekt. Weitere Überlegungen werden
hinsichtlich Zielgruppe, Netzwerk und Freundeskreis angestellt. Acht kommen zum Schluss, zu wenig
über Crowdfunding zu wissen. Weitere Argumente, die meist gegen ein Weiterverfolgen von
Crowdfunding sprechen, betreffen den Aufwand, den Mangel an Ressourcen, ungeklärte Rechte und
niedrige Summen, die den Aufwand nicht rechtfertigen würden.
„Die Rechte sind bei Crowdfunding nicht geklärt“ (Designer, Einzelunternehmer)
458 Eigendarstellung
459 siehe Kapitel 3.7
162
In gleicher Anzahl wurden Mängel an Erfahrungsberichten, das Negativ-Beispiel „Waldviertler“,
fehlende Medienpräsenz und das Alles oder Nichts-Prinzip genannt. UnternehmerInnen vermuten,
dass bei letzterem oft die Notwendigkeit besteht, Fehlbeträge selbst einzahlen zu müssen.
„Restbeträge werden selbst drauf bezahlt, um Summe zu erreichen.“ (EPU, Künstler) Jene beiden, die in den nächsten Monaten Crowdfunding ausprobieren wollen, überlegen geeignete
Gegenleistungen.
„muss mir gut überlegen, was ich als pledges460 anbieten kann“ (EPU, interdisziplinär und in Werbung)
3.9 Unterstützungsbedarfe der Creative Industries
Unterstützungsbedarfe allgemein betrachtet ergeben sich im Zusammenhang mit dem Abbau
von Hemmnissen, darunter wird der Zugang zu:
• Information
• Finanzierungsquellen
• potentiellen Auftragsgebern
• Ressourcen: Arbeitskräfte, Kapital
• Know-how
• Medien
verstanden. Unterstützungsbedarfe wurden im Zusammenhang mit der neuen Förderstelle, der
Creative Region Linz & Upper Austria abgefragt, und bestehen in den Bereichen:
Bedarf (n=23) Anzahl Nennungen
Information zu Finanzierung 10
Information zu relevanten Themen 8
Weiterbildung 7
Vernetzung 6
Medienarbeit 6
Vermittlung 5
Netzwerktreffen 5
Marketing & Vertrieb 5
Beratung 4
Erfahrungsaustausch/Best Practice 3
Skriptwriting, Pitch, Ideen umsetzen 3
kein Bedarf 2
Bewußtsein schaffen 2
explizit kein Weiterbildungsbedarf 2
Tabelle 30: Unterstützungsbedarfe461
460 Gegenleistung beim Crowdfunding für Spender
461 Eigendarstellung
163
Aus der Anzahl der Nennungen lässt sich der besondere Bedarf über Information zu
Finanzierungsmöglichkeiten ablesen, besonders wichtig ist den Kreativen Information zu
Förderungen, aber auch zu Alternativen dazu, wie beispielsweise Crowdfunding. Darüber hinaus
sind Informationen zu rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, branchenspezifischen Themen
relevant. Weiterbildung wurde hauptsächlich in Form von Workshops zu Crowdfunding,
Förderantragstellung und Marketingkonzeptentwicklung verstanden. Darüber hinaus erhoffen
sich die Kreativen Unterstützung bei ihrer Medienarbeit sowie im Zugang zu Medien, bei
Marketing und Vertrieb. Vernetzung und Vermittlung von Kontakten sind ihnen aber auch sehr
wichtig. Zwei Mal wurde explizit kein Weiterbildungsbedarf genannt, zwei Nennungen beziehen
sich auf keinen Bedarf. Belege dafür finden sich in den folgenden Aussagen zu den Punkten:
• Information zu Finanzierungsquellen
• Veranstaltungen mit Netzwerkcharakter
• Bedarfe aus Sicht Dritter
• Vermittlung von interessanten Mietobjekten
Information zu Finanzierungsquellen:
„Also wenn man einfach davon rechtzeitig und laufend Bescheid weiß, dann kann man dann, wenn's einmal drum geht, zu dem Zeitpunkt auch besser reagieren oder sich dann an die betreffende Stelle wenden.“ (GF, Design) „Information über Förderungen, sodass man nicht lange recherchieren muss.“ (EPU, Architektur) „(...) immer wiederkehrender Information, die Möglichkeiten, die es gibt, oder das wieder einmal aufzuzeigen, also diese ganze Newsletter-Thematik und so, wie wir sie aber eh nutzen von der Creative Region. Und was sich gerade tut, das sehe ich einmal so wirklich als Hauptpunkt, dass man einfach weiß, was läuft. Nachdem wir jetzt keine konkreten Anforderungen haben oder auf der Suche sind oder etwas konkret wissen wollen, ist es einfach gut, wenn man so in bestimmten Abständen einfach immer mitkriegt, was sich tut, oder was es für Möglichkeiten gibt und was es Neues gibt an Möglichkeiten und an Förderungen beispielsweise.“ (GF, IT-Projekte) „Information über Finanzierung, das könnte ich mir gut vorstellen – und zwar unabhängige Informationen. Weil mir hilft es nicht wenn die – weil ich will nicht zu einer Bank gehen, wenn ich über Finanzierung reden will.“ (EPU, Design)
Veranstaltungen mit Netzwerkcharakter:
„Aber halt so Veranstaltungen, die halt einen Netzwerkcharakter verbinden mit einer Situation des Lernens.“ (GF, Musikprojekt) „Weiterbildung, Ausbildung und Erfahrungsaustausch. Ich glaube einfach, man muss sich Menschen herholen, die solche Sachen schon durchgeführt haben, professionell und erfolgreich, und von dieser Erfahrung lernen (...) - die Creative Region hat das teilweise schon gemacht, soweit ich weiß, aber da kann man noch sehr viel mehr machen.“ (EPU, Design) „Vernetzen, Vernetzung, Vernetzung. Das spannende ist, die richtigen Leute zusammenzubringen und durch Vernetzungen - zu versuchen, die Projekte entstehen zu lassen. Da ist die Finanzierung ein Teil, ein kleiner Teil davon, sage ich eher.“ (GF, IT-Projekte, mehrere MA)
164
„Auch die simpelste Web-Plattform lässt sich da gar nicht realisieren. Da brauchen sie ganz viel, Partner, wo die Kompetenzen verteilt sind. (...) und da glaube ich, dass die Creative Region voll viel Unterstützung bieten kann, oder tut.“ (GF eines StartUps) „Aber Unterstützung würde ich mir wünschen mehr in verschiedenster Hinsicht alles, was die Präsentation nach Außen betrifft, sprich sobald man irgendwelche Messeauftritte hat, oder sobald man einfach, sage ich mal, die Stadt oder das Land eben auf irgendeine Art und Weise nach außen präsentiert und repräsentiert, dass das durchaus eben unterstützt wird.“ (EPU, Mode)
Bedarfe aus Sicht Dritter:
„Das heißt, die brauchen schon in irgendeiner Form ein Schulungsprogramm, und die üblichen Themen sind eh immer Buchhaltung, Rechnungswesen, ein bissel Juristerei, diese Dinge. Worauf muss ich aufpassen, wenn ich Leute anstelle etc. Was nicht passieren darf, (...) dass man Gründer, wenn man sie fördert, mit Vertrag dazu zwingt, bestimmte Kurse zu machen, die sie dann auch bezahlen müssen, (...) dann geht das völlig in die falsche Richtung. Ich muss ein Angebot machen, aber letztlich müssen die Gründer das selbst annehmen, sie tragen auch selber das Risiko.“ (GF eines StartUps) „Was glaube ich sinnvoll wäre, was öffentliche Stellen machen sollten, wäre dafür zu sorgen, dass in dem Gebiet Wissensaufbau passiert. Dass sie Projekte unterstützen, die die Konzeption von Crowdfunding bekannt machen und den Wissenstransfer unterstützen. Dh. dass eben Stellen, wie eine Creative Region, dass die genug Geld bekommen um Veranstaltungen zu machen, Workshops zu machen um z.B. wo Starter mit potentiellen Investoren zusammengebracht werden, also Vernetzungsarbeit leisten.“ (GF eines StartUps) „Bedarf hat man da immer, es gibt immer etwas, was man noch dazu lernen kann oder was man in Erfahrung bringen kann, an was man selber noch gar nicht gedacht hat. Von dem her ist Informationsbedarf einmal zu allen Punkten gegeben.“ (GF, IT-Projekte)
Vermittlung von interessanten Objekten:
Das Angebot der subventionierten Miete, wie sie die Creative Community anbietet, ist für 17
Befragte uninteressant, weil es sich um Mietobjekte handelt, die zusammengefasst:
• kein kreatives Umfeld bieten
• an Orten, abseits der „kreativen Szene“ liegen
• nur für drei Jahre in Anspruch genommen werden können
• das Unternehmensalter lt. Förderregel bereits zu hoch ist
Ein Kreativer aus dem Musikbereich meinte, dass mögliche Räumlichkeiten der Creative
Community oder des Sozialamtes „ab vom Schuss“ lägen, oder nicht die gewünschte Befruchtung
(Austausch mit anderen Branchen, meinte beispielsweise ein Architekt) durch andere
Büromieter brächte. Die sechs UnternehmerInnen, die das Angebot bereits genutzt haben oder
gerade nutzen, sind damit zufrieden.
Das neue Angebot in der Tabakfabrik erscheint sehr interessant, wird von manchen Kreativen
(drei) jedoch nicht mehr angenommen, da die Mieten im Vertrag letztendlich höher seien als
zuvor angekündigt, weil „Rechtsunsicherheit herrsche“, weil die Räumlichkeiten noch nicht
165
umgewidmet wurden, weil sie auch noch nicht für Büros adaptiert wurden, „ (...) die Verträge
sind solche, die man besser nicht unterschreibt, und überdies das Projekt Tabakfabrik ist ein sehr
politisches und dauert sehr lange“, meinte ein am Einzug interessiertes Architekturunternehmen.
167
4 DISKUSSION DER ERGEBNISSE
Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt zu den Themen:
• Finanzierung allgemein
• zielgruppenspezifische Finanzierung
• Ansatzpunkte zum Abbau von Hemmnissen
• Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien
• nachhaltige Kreativwirtschaftsförderung
Auf genderspezifische Unterschiede kann dabei nicht eingegangen werden, da das aufgrund der
Stichprobe (nur zwei Unternehmerinnen) nicht zielführend ist.
4.1 Finanzierung Allgemein
Diskussionsgegenstand in diesem Kapitel ist die Bekanntheit von öffentlichen Förderungen und
Förderstellen einerseits, und von weiteren Finanzierungsquellen andererseits.
4.1.1 Bekanntheit von öffentlichen Förderungen und Förderstellen
Wie bereits in Kapitel 3.3.1 aufgezeigt, ist das Wissen über Förderungen ein ungefähres, nur
manche bereichspezifischen Förderungen sind bekannt, oder das Wissen darüber veraltet.
Manche Förderungen auf Bundesebene (z.B. Kreativwirtschaftsförderung, Kunstförderung,
Filmförderung, Forschungsförderung) sind bekannter, als das Angebot Vorort. Dazu bemerkt
Patrick Bartos462:
„Es gibt keine dezidierte Kreativwirtschaftsförderung. (...) Es gibt halt eine normale EPU-Förderung und KMU Förderung und, an die man als kreativwirtschaftlicher Betrieb natürlich auch andocken kann. Aber eine explizite Förderung gibt es nicht – und die ist derzeit auch nicht angedacht.“ (Bartos, GF Creative Region Linz & Upper Austria). „(...) Förderungen sind im Kreativbereich sehr sehr selten, weil die meisten Förderungen hängen auf Anlagevermögen, und das Anlagevermögen eben bei Kreativen sehr gering ist. Was in Anspruch genommen wird, ist manchmal diese kleine Kreditförderung durch die Wirtschaftskammer, weil man da ein bisschen Stützung hat, vom Zinssatz her, weil diese Billigkredite muss man auch sehr langsam zurückzahlen. Aber sonst, also wirkliche Förderungen, Öffentliche bei Kreativen sind sehr sehr selten.“ (Tiefenböck, Steuerberater/Unternehmensberater)
In Kapitel 2.4.2 wird das vorhandene Förderangebot für oberösterreichische
Kreativwirtschaftsunternehmen aufgelistet, nur ein geringer Anteil dessen wird von den
Interviewten genannt.
„Das Angebot für Gründer ist absolut ausreichend, da gibt es wirklich viel für GründerInnen“. (Kovsca-Sagmeister, Creative Community Linz)463
462 Bartos im Interview (Bartos 2012)
463 Kovsca-Sagmeister im Interview (Kovska-Sagmeister 2012)
168
„Wir leben in einem Land, das im Prinzip ein Förderhimmel ist in Österreich, aber auch gleichzeitig ein Förderdschungel. (...) (Weiß, GF von Akostart)
Neuere Fördermaßnahmen sind nur bei den JungunternehmerInnen bekannt. Förderungen
werden in Form von monetären Zuwendungen wahrgenommen und bereichs- und
branchenspezifisch. Zusammenfassend kann interpretiert werden, dass es sich um ein bedarfs-
oder anlassbezogenes Wissen handelt. Hat ein Unternehmer oder eine Unternehmerin Bedarf an
Finanzierung, so informiert er/sie sich nur anlassbezogen, womit ihm/ihr Fördermittel und
Unterstützung entgehen, die er/sie beanspruchen könnte, an die er/sie nicht gedacht hat, oder
davon nichts weiß, oder zu spät davon erfahren hat. Trotz des Bedarfes an Förderungen sind
Ressourcen wie Zeit und Arbeitskraft nicht immer vorhanden und damit die Haupthemmnisse,
um sich entsprechend zu informieren.
4.1.2 Bekanntheit von weiteren Finanzierungsquellen
Das Ranking der am häufigsten genannten „anderen“ Finanzierungsquellen in Kapitel 3.3.2 kann
dahingehend interpretiert werden, dass Kredite, Förderungen, Sponsoring und Beteiligungen
sehr geläufig im Zusammenhang mit der Finanzierung der Kreativwirtschaft sind. Hingegen ist
Crowdfunding kein sehr präsentes Finanzierungsthema. Das Abo-Modell ist als
bereichsspezifisch zu interpretieren. Kooperation und Eigenleistung sind nicht so stark präsent
bei der Frage nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.
4.2 Zielgruppenspezifische Finanzierung
In Kapitel 3 wurde aufgezeigt, wie die Stichprobe strukturiert ist, wie sie nach Sparten verteilt
ist, wie hoch das Unternehmensalter ist, welche Rechtsformen vorhanden sind, die Anzahl der
MitarbeiterInnen, der Internationalisierungsgrad, wie sich die Unternehmerschaft präsentiert,
und wie vernetzt die UnternehmerInnen sind. All das gibt einen Einblick in die Kreativwirtschaft,
bei der Auswertung der vorliegenden Daten zeigen sich jedoch Schwierigkeiten. Das
Hauptproblem liegt darin, dass der Anteil an alleintätigen Kreativen sehr hoch ist. Nach der
aktuellen Statistik liegt der Anteil bei Kreativwirtschaftsunternehmen mit einer
MitarbeiterInnenzahl von „0-9“ bei durchschnittlich über 75 % in manchen Bereichen wie
Architektur über 90 %464, das Ergebnis der Stichprobe ergibt 17 alleintätige UnternehmerInnen
von insgesamt 25 Unternehmen. Von den Gesprächen ist jedoch bekannt, dass diese 17
UnternehmerInnen nicht immer alleine arbeiten, sie sich unterschiedlich finanzieren und auch
unterschiedliche Bedarfe haben. Die Einteilung nach Größenklassen gemäß EU-
464 siehe Kapitel 2.3.3 Creative Industries in Oberösterreich, S. 28ff
169
Wettbewerbsrecht 465 definiert KMUs nach Anzahl der MitarbeiterInnen nach den
Schwellenwerten, von 0 bis 9 sind Kleinstunternehmen, 10 bis 50 Kleine Unternehmen, 51 bis
249 Mittlere Unternehmen, oder nach Umsatz oder Bilanzsumme. Beide Größenparameter sind
für die Auswertung des Finanzierungsthemas und der Bedarfe von Oberösterreichs
Kreativunternehmen466 und für die vorliegende Stichprobe ungeeignet. Aufgrund dessen wurde
eine andere Einteilung aus vorliegendem Material der Stichprobe entwickelt, das die Struktur
der Mikrounternehmen und das Wesen der Kreativwirtschaft mitberücksichtigt (siehe
Abbildung 29: beobachtetes Selbstverständnis der). Unter dieser Einteilung werden die Themen
Finanzierung und Bedarfe nochmals betrachtet und interpretiert. Es werden dazu Daten von 23
Unternehmen herangezogen und diese in drei Gruppen wie folgend beschrieben, eingeteilt:
Unterschieden werden EinzelunternehmerInnen, UnternehmerInnen mit ein bis vier
MitarbeiterInnen („Teams“) und jene, deren Strukturen und Unternehmensgegenstand einen
größeren Rechtskörper, OG, GmbH oder Verein („Teams mit juristischem Kleid“) benötigen.
Letztere haben auch ein bis 17, in einem Fall sogar 70 MitarbeiterInnen, auch ehrenamtliche
MitarbeiterInnen und fallweise Arbeitskräfte. Kooperationen und lose Partnerschaften mit
anderen EinzelunternehmerInnen wurden ebenfalls mit einbezogen.
In Abbildung 29: beobachtetes Selbstverständnis der Kreativen wird schematisch dargestellt,
wie sich die drei Gruppen der interviewten Kreativen in ihrem Selbstverständnis beobachten
lassen. Bei der Gruppe der „Einzelkämpfer“ dominiert ein künstlerischer Anspruch, hingegen
dominieren bei den „Teams“ und der Gruppe der „Teams mit juristischem Kleid“ überwiegend
unternehmerische Elemente (Gewinnorientierung, Effizienz, Pragmatismus, ...).
Tendenz:
Künstler <--------------------------------> Unternehmer
Einzelkämpfer Teams Teams mit juristischem Kleid
Abbildung 29: beobachtetes Selbstverständnis der Kreativen467
Spannungen zwischen kreativ Tätigen und Unternehmern werden als typisch für viele kulturelle
und kreative Unternehmen gesehen: „Sie ergeben sich oft durch den Wunsch des Künstlers, den
465 Europäische Kommission ABl. L124 vom 20.5.2003, S. 36ff in: (Land Oberösterreich 2013)
466 siehe vorliegendes statistisches Zahlenmaterial in Kapitel 2.3.3. Creative Industries in OÖ.
467 schematische Eigendarstellung
170
kulturellen Wert in den Vordergrund zu rücken, wohingegen der Unternehmer den wirtschaftlichen
Aspekt über den kulturellen Wert stellt.“468
4.2.1 „Einzelkämpfer“ (n=7)
Dies sind Einzelpersonen, freie Selbständige oder Selbständige, die ein freies Gewerbe ausüben
oder sog. Neue Selbständige. Sie beschäftigen maximal ein bis drei Freelancer bei Bedarf oder
vergeben Subaufträge. Bei diesen Kreativen ist das Prekariat sehr präsent. Eine
Gewinnorientierung, die als Kennzeichen für die Kreativwirtschaft genannt wird, relativiert sich,
man „trachtet nach einem angemessenem Einkommen für einen gewissen Lebensstil“, meint ein
Designer.
„Auch bei erfolgreichen KünstlerInnen bleibt die finanzielle Situation regelmäßig beklemmend. Überschüsse werden in neue Projekte investiert, Rückhalt ist keiner gegeben, die Arbeit hängt an einem seidenen Faden der eigentliche Lebensstandard bleibt niedrig.“ (SKE Fonds, austro mechana469)
Kooperationen werden nur von einer Minderheit der Befragten eingegangen: mit
Firmenpartnern (in Richtung Sachsponsoring) oder mit Einzelpersonen, die selbst freiberuflich
tätig sind um Projekte „finanziell heben zu können“. Gerade in dieser Gruppe ist das eigene
Netzwerk für Kooperationen und für Aufträge wichtig (und dementsprechend wird
Unterstützung gewünscht, insbesondere von der Creative Region Linz & Upper Austria).
Tendenziell überwiegt hier das künstlerische Handeln. Unter den 23 Unternehmen wurden
sieben dieser Gruppe zugeordnet. Ihre oft sehr breiten Betätigungsfelder sind künstlerischer
Dokumentarfilm, Design/Kunst am Bau, Musik/DJ, Design/Architekturfotografie,
Architektur/Raumkunst, Mode/Design, interdisziplinäre Bereiche/Design.
Diese Kreativen leben nach eigenen Angaben „sehr bescheiden“, werden teils von ihrer Familie
unterstützt oder verfügen über eine Erbschaft (n=3). Jene, die im breiten Umfeld von Architektur
tätig sind, sind stark von der Bauwirtschaft und deren Konjunktur beeinflusst. Jene in
Mode/Design und Musik/DJ Tätigen sähen den Standort Wien als für sie besser („auf sie
ausgerichtete Förderungen, bleiben aber aus anderen Gründen (z.B. Mietersparnis durch
geerbtes Haus) am bisherigen Standort.
468 (Utrecht School of the Arts (HKU) 2011)
469 (austromechana 2013, SKE Jahresstipendien)
171
4.2.2 „Teams“ (n=7)
Unter dieser Klassifizierung ist die informelle Zusammenarbeit in Team-Form gemeint. In dieser
Gruppe wurden jene Kreativen zusammengefasst, die sich entweder als Einzelunternehmen
gemeinsam mit einem weiteren Einzelunternehmen partnerschaftlich (GeschäftspartnerIn)
zusammentun oder mit bis zu drei weiteren MitarbeiterInnen ihre Aufträge erarbeiten. Der
Unterschied zur ersten Gruppe liegt in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, in der
gleichberechtigten Erarbeitung eines Projektes. Diese MitarbeiterInnen sind sowohl geringfügig
Beschäftigte als auch Teil- und Vollzeitangestellte. Auch der Anteil an Freelancern, die
projektbezogen mitarbeiten, ist bereits höher als in der Gruppe 1 (bis zu 30 Freelancer werden
genannt). Sie verfügen bereits über ein Netzwerk, in dem sie fallweise bis zu 100 Personen
ehrenamtlich für ihr Projekt begeistern können.
Diese Gruppe ist sehr inhomogen, hier finden sich JungunternehmerInnen, alteingesessene
Einzelunternehmerteams, ein Verein, ein im Firmenbuch eingetragener Einzelunternehmer,
sowie ein Einzelunternehmer, der über ein, wie er sagt „besonders gutes Netzwerk“ verfügt, das
ihm „Aufträge zuschanzt“. Aufträge, die nicht alleine bewältigt werden können, werden als
Subaufträgen vergeben. Die KreativunternehmerInnen dieser Gruppe arbeiten im Bereich
Software, Architektur, Design, Radio/Fernsehen, Film/Video, interdisziplinär, sowie in PR-
Bereich. Was ihnen gemein ist, ist die Orientierung nach Auftraggebern in Industrie und
Tourismus und zweckorientierte Kooperationspartnerschaften. Insgesamt konnten sieben
InterviewpartnerInnen dieser Gruppe zugeordnet werden.
4.2.3 „Teams im juristischen Kleid“ (n=9)
Unter dieser Gruppe wurden jene Kreativen zusammengefasst, die sowohl mit zumindest
einem/r PartnerIn, als auch sich in einer Rechtsform der GmbH, OG, oder gemeinnützigen GmbH
nach außen zeigen. Das Element der Rechtsform ist dominierend. Diese Gruppe besteht aus vier
GmbHs, drei OGs und zwei gemeinnützigen GmbHs. Deren Geschäftsgegenstand erfordert
bereits eine größere Struktur und somit auch mehr Personal. Hier finden sich auch die
sogenannten StartUp Unternehmen. Nebst dem/der Geschäftspartner/in werden ein bis 17, in
einem Fall sogar 70 MitarbeiterInnen beschäftigt. Die Zahl der Freelancer mag mitunter geringer
sein als in der Gruppe der Teams und liegt zwischen zwei und 15 Personen. Hingegen werden in
dieser Gruppe nur mehr fallweise bis zu fünf ehrenamtlich tätige Personen benötigt.
Interpretiert werden kann daraus ein Ansteigen von festen Beschäftigungsverhältnissen. Eine
Ausnahme bilden hier das freie Radio, sowie das freie Fernsehen, das von Freiwilligen (zwischen
350 bis 400 Personen) bespielt wird. Beim Open Source Software Projekt ist es ähnlich, für
172
Übersetzungen und Programmierung helfen ca. 300 Personen international mit. Hier ist als
Gegenleistung nicht das Monetäre, sondern das Sozialkapital zu sehen. Die Kreativen in dieser
Gruppe arbeiten im Bereich Software, PR, Industrial Design, Software/Spieleindustrie sowie
Radio/Fernsehen und Medien. Als Merkmal für diese Gruppe kann abgeleitet werden, dass sie
sich auf eine Disziplin konzentrieren und klare Wachstumsziele über einen Zeitraum von mehr
als einem Jahr hinaus haben, sowie ihre Strategien konsequent verfolgen. Insgesamt konnten
neun der 23 InterviewpartnerInnen dieser Gruppe zugeordnet werden. Die folgende Tabelle gibt
einen zusammenfassenden Überblick:
Einzelkämpfer (n=7) „Teams“ (n=7) „Team im juristischem Kleid“ (n=9)
UnternehmerIn selbst, 0 MA 1-4 MA, Anstellungsverhältnisse,
formieren sich als Teams
1-70 MA, größere Strukturen, mehr
Personal
Vergeben nach Bedarf
Subaufträge
suchen sich Geschäftspartner Rechtsform selbst und Partner: GmbH, OG,
gemeinnützige GmbH, Verein
Prekariat hoher Kapitalbedarf, vor allem StartUps
Ziel: angemessenes
Einkommen und Lebensstil
Ziel: angemessenes Einkommen und
Lebensstil
Ziel: gewinnorientiert
leben bescheiden leben angemessen, machen auch
Gewinne
leben angemessen, sind gewinnorientiert
Kooperationen selten Kooperationen häufig Kooperationen zweckorientiert
Netzwerk für Kooperationen
und Aufträge lebensnotwendig
großes Netzwerk, Orientierung nach
Auftraggebern in Industrie u.
Tourismus
Netzwerk für Kooperationen und Aufträge
künstlerisches Handeln im
Vordergrund
Aufgabenteilung, kfm. Überlegungen, Aufgabenteilung, kfm. Überlegungen,
Wachstumsziele, Planung über 1 Jahr
hinaus
breites Betätigungsfeld,
bereichsübergreifend
fokussiert auf Tätigkeit, anzutreffen
in allen Bereichen
Konzentration auf eine Disziplin,
anzutreffen in Software, PR, Industrial
Design, Spieleindustrie, Radio/Fernsehen,
Medien
Unterstützung von Familie
wichtig
Beteiligungen
Tabelle 31: Drei Gruppen470
„Der Unterschied zwischen klassischem Kreativen, Künstler, und Software Unternehmen liegt natürlich einmal in den Ressourcen, in der Höhe des Kapitalbedarfs sind die Unterschiede“. (Weiß, GF von Akostart)
470 Eigendarstellung
173
4.2.4 Die Finanzierung der drei Gruppen
Die Unterteilung in diese drei Gruppen zeigt auch ein unterschiedliches Bild ihres Finanzbedarfs
und ihres Finanzierungsmix. Alle drei versuchen die Finanzierung durch Bankkredite eher zu
meiden. Hin und wieder sind diese nötig, jedoch nur als Überbrückungskredit und für
Investitionen, die sich nicht anders finanzieren lassen. Der Überziehungsrahmen am Girokonto
wird überraschenderweise nur selten in Anspruch genommen. Besonders betont wird von den
Kreativen, dass Kredite, aber auch Gelder der FFF (family, friends and foolhardy investors) keine
Option der Finanzierung für sie sei. Die Kreativen äußern sich ablehnend zur Möglichkeit der
Kreditaufnahme, da es ihnen zu unsicher erscheint, ob sie das Geld zurückzahlen können. Eine
konträre Aussage dazu macht ein Steuerberater über seine Klienten:
„Ja, der Großteil hat in irgendeiner Form ein Kreditverhältnis, ja das tun sie sehr wohl, ob es sich um einen Abstattungskredit, oder um einen Kontorahmen handelt, es gibt beide Möglichkeiten, und in manchen Betrieben auch beides, aber das ist durchaus gang und gäbe, wobei aber die Tendenz in den letzten 2, 3 Jahren zu beachten ist, dass es für neue Kreative sehr viel schwieriger ist, überhaupt einmal einen Rahmen zu bekommen oder auch einen Kredit, weil Sicherheiten verlangt werden, die viele nicht einbringen können.“ (Tiefenböck, Steuerberater in Wien, über 300 Kreative Klienten aller Größen)
Bei der Verwendung der FFF liegt die Ablehnung eher bei kulturellen Ressentiments. Bei
etwaigen privaten Investoren und Beteiligungen wird zu viel Einmischung gesehen und
außerdem wird der Verlust der freien Entscheidung befürchtet. Tendenziell ist ablesbar, dass
kein Vermögen belehnt werden soll. Die Begründung war zumeist die, das hohe Rückzahlungen
und der ungewissen Ausgang, ob der Kredit rückgezahlt werden kann, nicht riskiert werden will.
„Das 3F-Kapital ist ein Mythos. Wir predigen es zwar immer in den Vorlesungen, und dass es existiert ist auch klar und gerade in Amerika existiert es, aber in Österreich ist es ein Mythos. Weil wir in Österreich anders ticken (...) Wir wachsen auf aus der Familie mit dem Ziel, eine ordentliche, fixe Anstellung zu haben. (...) Wir sind sehr auf Sicherheit bezogen. Und das spielt schon eine sehr große Rolle (...). Diese 3F (...) die Eltern, Familie und Freunde in den wenigsten Fällen hergehen und sagen: ‚Du, pass auf. Das Geld, was du jetzt eigentlich kriegst – als Aussteuer de facto oder zum Außezahlen vom Haus, das mag man nicht in eine Firma einistecken, sondern das sparst du.’“ (Weiß, GF von Akostart)
Die vorherrschende Meinung der Einzelkämpfer und Teams ist jene, erst das benötigte Geld
selbst zu verdienen, erst wenn das erreicht ist, wird investieren.
Der Großteil dieser ersten beiden Gruppen wünscht sich eine Entlastung im administrativen
Bereich um sich voll auf das kreative Schaffen konzentrieren zu können. Wobei die
Einzelkämpfer primär das Projekt selbst versuchen umzusetzen, während in den Teams das
durch Aufgabenteilung versucht wird. Viele haben nur vages Wissen über ihren zukünftigen
Finanzbedarf, nur wenige haben klar formulierte Vorhaben und Ziele, für die sie kalkulieren. Am
klarsten vermögen dies die Softwareunternehmen und StartUps der dritten Gruppe zu
definieren.
174
Was die Unterstützung von Bürogemeinschaften anbelangt, gibt es sowohl Drop-Down (von
einer öffentlichen Institution offerierte Räumlichkeiten) als auch von den Kreativen selbst
Bottom-Up Lösungen (von den Kreativen selbst ausgesuchte oder selbst geschaffene oder
gestaltete Räumlichkeiten). In Linz ist ein breites Angebot vorhanden, das auch bekannt ist.
Genannt werden Akostart, Ateliers der Stadt Linz, Mietzuschüsse in Bürogemeinschaften,
leerstehende, ebenerdige Objekte bzw. deren Zwischennutzung (Bottom-Up-Modell), sowie
zukünftig die Räumlichkeiten der Tabakfabrik nebst einigen selbst initiierten
Bürogemeinschaften, welche sich im Raum Linz verteilen. Zusammenfassend kann interpretiert
werden, dass Orte, Cluster von Unternehmen, die Synergieeffekte erzeugen, gewünscht werden,
und diese auch finanzierbar für die kreativen „Einzelkämpfer“ sein müssen.
4.2.4.1 Die Finanzierung der „Einzelkämpfer“
Sie erhalten sich hauptsächlich durch Aufträge (Honorare), aber auch durch Förderungen in
Form von Stipendien oder „seed capital“, durch die „impulse“-Programme oder Subventionen
(SKE-Fond), durch Preise und Forschungsaufträge und eigene Rücklagen. Sie finanzieren ihre
Vorhaben (zum Teil auch sehr häufig) durch Sponsoring und durch die Ausübung anderer (auch
mehrerer) Jobs. Obwohl dies bei der Frage nach dem Finanzierungsmix nicht so beantwortet
wurde. Überbrückungskredite kommen vor, größere Projekte werden durch Kooperation
abgewickelt. Sie behaupten von sich bescheiden zu leben, und keine hohen Lebenskosten zu
tragen. Nicht ungewöhnlich ist beispielsweise ein Einkommen von monatlich um die 900 Euro.
Manche von ihnen werden von der Familie unterstützt.
4.2.4.2 Die Finanzierung der „Teams“
Die Gruppe der Teams finanziert sich primär durch Aufträge. Die Zahl und Art der genutzten
Förderungen ist jedoch deutlich größer als bei den Einzelkämpfern. Förderungen von AWS
impulse xl und xs, FFG, RTR Fonds und Förderungen der Stadt Linz werden lukriert. Es werden
Kooperationen (mit Universitätsinstituten) sowie Partnerschaften aus dem Netzwerk
eingegangen, die bei größeren Förderansuchen helfen. Hier wird, den Aussagen zufolge, kein
Privatvermögen direkt eingebracht, es aber genutzt.
4.2.4.3 Die Finanzierung der „Teams im juristischem Kleid“
Die Besonderheit dieser Gruppe im Vergleich zu den anderen liegt, neben den Rechtsformen, am
höchsten Bedarf von Kapital. Einerseits zur Erhaltung der Infrastruktur, andererseits für
175
kapitalintensive Vorhaben. Sie trachten danach, möglichst viele Finanzierungsmöglichkeiten
auszuschöpfen. Ihnen allen gemein ist, dass sie zahlreiche öffentliche Förderungen nutzen, sie
sehr gut über die Förderlandschaft in Österreich Bescheid wissen, oder sehr gut beraten werden.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie sich strategische Partner für Projektanträge (z.B.
Universitätsinstitute, Technologiepartner) suchen, um ihrem höheren Bedarf der Finanzierung
zu begegnen. Je nach Bereich versuchen Kreative Venture Capital, Business Angels oder sonstige
Beteiligungen Dritter zur Finanzierung zu gewinnen. Um Förderungen wird dann angesucht,
wenn eine Restfinanzierung oder eine Absicherung von Krediten nötig ist, und der
„bürokratische Aufwand in Relation zur möglichen Fördersumme steht“, meinte einer der
StartUp Unternehmer. „Für das Tal des Todes in der „Seed-Phase“ gibt es keine adäquate Hilfe in
Oberösterreich, lediglich die Fonds des AWS“, so ein anderer StartUp Unternehmer aus dem
Softwarebereich.
Eine Besonderheit für die Finanzierung der Seed-Phase haben sich freie Rundfunkstationen
einfallen lassen. Mehrere Vereine gründen gemeinsam eine GmbH, mit dem Stammkapital kann
die neue Rundfunkstation die Vorphase finanzieren, mittels Vertrag ist vereinbart, dass das
Stammkapital wieder zurückbezahlt wird. Außerdem kann das startende
Rundfunkunternehmen die Infrastruktur und das Equipment der anderen nutzen. Die
Gründervereine tragen ein relativ geringes Risiko. Das neue Rundfunkunternehmen hat für die
Gründervereine auch den Vorteil, dass es zukünftig als eine weitere Werbeplattform nutzbar ist,
also als Investition gesehen werden kann. Sie haben per Bescheid der Finanz mittlerweile auch
den Status einer „gemeinnützigen GmbH“ und verrechnen so mit einem niedrigeren
Mehrwertsteuersatz. Dieses Modell ist laut Aussagen der InterviewpartnerInnen ein Good-
Practice-Modell für den Aufbau freier Rundfunkstationen in Österreich und möglicherweise
auch international.
4.2.5 Bedarfe zur Nutzung von Crowdfunding
Crowdfunding wird nicht nur als Finanzierung über Plattformen gesehen. Dazu gehört auch die
Mittelbeschaffung durch direktes Ansprechen von möglichen Financiers (Bsp. „Waldviertler“).
Sowohl von den Kreativen gewünscht, als auch von Experten empfohlen ist ein von der Creative
Region und anderen Vernetzungsstellen durchgeführtes unterstützendes Marketing für aktuelle
Crowdfunding-Projekte in Oberösterreich. Dabei könnte diese Stelle als Referenz zur
Verstärkung des Vertrauens in die publizierten Projekte und deren Projektanten fungieren. Auch
das Publizieren und Bewerben der kreativen Projekte der Unternehmen durch weitere
Kommunikationskanäle, über die Creative Region verfügt, wird gewünscht.
176
Als grundsätzliche Voraussetzung sehen die interviewten Experten, dass sowohl die Gruppe der
Geldsuchenden, als auch die Gruppe der Financiers internetaffin sein müssen. Grundlegende
Marketingstrukturen und Marketingwissen, sowie ein Netzwerk müssen bei Geldsuchenden
vorhanden sein.471
Mehrere Experten sind der Meinung, dass die Projektvolumen auf den
Crowdfundingplattformen (noch) zu gering sind.
„Crowdfunding ist etwas für kleinere Projekte, durchschnittlich geht es um Summen von 3.000 Euro“ (sinngemäßes Zitat, Henner-Fehr, CF Experte) „(...) die erfolgreichen Projekte waren eher kleinere, das nicht erfolgreiche war ein Kinderfilm um 50.000 Euro, (...) da waren aber mehr Gründe als nur die Höhe (...)“ (Gumpelmaier, CF Experte) Kreative, die ein hohes Kapital benötigen, sprechen diese Problematik auch an. Die
Projektsummen, die generierbar wären, stünden dem enormen administrativen Aufwand
ungleich gegenüber, sodass viele die Einreichung bei öffentlichen Förderstellen vorziehen
würden, obwohl auch der damit verbundene Aufwand bekrittelt wird.
4.2.5.1 Unterstützungsbedarfe der „Einzelkämpfer“ an Crowdfunding
Von der Finanzierung mit Crowdfunding haben fast alle Einzelkämpfer schon gehört. Einerseits
wurden manche direkt via Email angesprochen, ein Crowdfundingprojekt zu unterstützen, oder
Freunde haben bereits Erfahrung damit gemacht und davon erzählt, besonders im
Zusammenhang mit der Musik- und Filmbranche, oder sie haben in Medien darüber gelesen.
Insbesondere der „Fall des Waldviertlers472“ wurde von mehreren Kreativen sehr abschreckend
empfunden. Grundsätzlich lässt sich ableiten, dass die kreativen Einzelkämpfer dem Thema
offen gegenüber stehen, jedoch nähere Information, insbesondere auch über das „Wie tue ich
es“ benötigen, um sie für eine etwaige Finanzierung ins Auge fassen zu können.
4.2.5.2 Unterstützungsbedarfe der „Teams“ an Crowdfunding
In dieser Gruppe haben alle bereits von Crowdfunding gehört, ziehen es zum Teil in Erwägung,
benötigen jedoch eingehendere Information darüber. Es als PR-Instrument zu nutzen wird
überlegt. Konkret werden Workshops, Informationen über die strategische Vorgehensweise
beim Campaigning, Hilfestellung bei der Evaluierung, ob das Projekt oder Vorhaben für
Crowdfunding taugt, benötigt. Andere nennen den Bedarf eines helfenden Teams, das bei der
471 Henner-Fehr, Gumpelmaier und Weiß, sowie Grenzfurtner im Interview (Henner-Fehr 2012), (Gumpelmaier,
Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für die Kreativwirtschaft OÖ. 2012), (Weiß 2012), (Grenzfurtner 2012)
472 Fa. GEA, Geschäftsführer Staudinger vulgo „Waldviertler“
177
Durchführung der Crowdfunding-Kampagne mit Manpower zur Verfügung steht. Auch wurde
von einem Gütesiegel gesprochen, das von einer staatlichen Stelle für die Transparenz, den
Datenschutz und das Verrechnungssystem als vertrauensstiftendes Zeichen an
Crowdfundingplattformen vergeben werden soll.
Der andere Teil dieser Gruppe hat Crowdfunding als Finanzierungsinstrument bereits
verworfen.
„ ... macht wenig Sinn, weil der Aufwand dafür zu groß ist und generierbare Summen zu klein, das Netzwerk im Netz nicht präsent ist, noch zu wenig Bewusstsein dafür da ist, man alles oder nichts bekommt ...“ (zit. sinngemäß aus mehreren Interviews zusammengefasst).
4.2.5.3 Unterstützungsbedarfe der „Teams im juristischem Kleid“ an Crowdfunding
Diese Gruppe hingegen fasst Crowdfunding aufgrund des hohen Aufwandes und der geringen
Projektsummen (mit Ausnahme der Vereine für einzelne Projekte) erst gar nicht ins Auge und
hat somit auch keinen besonderen Bedarf.
Ein Interviewpartner räumt jedoch ein, Crowdfunding als „Plan B“ in Erwägung zu ziehen, falls
die nötigen Mittel nicht anders aufgebracht werden können. Ein Interviewpartner aus dem
Bereich Software/OS, hat Crowdfunding bereits erfolgreich angewandt. Diesem ging es nicht nur
um die Finanzierung durch Geldspenden, sondern auch um Sourcing und Werbung. Er wird
Crowdfunding nach eigenen Aussagen, wieder als Instrument verwenden. Auch in dieser Gruppe
wird der „Fall des Waldviertlers“473 genau beobachtet. Dieser wird ebenfalls als abschreckendes
Beispiel „das ist ein Risiko das will keiner haben“ (GF, Software/OS) gesehen.
Die Meinung der Experten Gumpelmaier, Henner-Fehr und Weiß zu Crowdfunding deckt sich
insofern, als sie alle der Meinung sind, dass es sowohl als Finanzierungsmittel, wenn auch in
bescheidenem Ausmaß, als auch als Marketinginstrument gute Dienste leisten kann. Alle geben
zu bedenken, dass es nötig ist Bewusstsein dafür aufzubauen und „eine Social Media Kompetenz,
Kommunikation“ 474 notwendig ist. Differenter Meinung sind die drei zur Frage, ob sich
Crowdfunding im deutschsprachigen Raum durchsetzen wird. Henner-Fehr argumentiert, dass
die nötigen Projektvolumina auf Plattformen nicht gegeben sind „das Volumen gar nicht
aufgebracht werden kann, wie z.B. bei Kickstarter, von dem die Plattform dann lebt“.475 Dem
473 Fa. GEA, Geschäftsführer Staudinger vulgo „Waldviertler“
474 Gumpelmaier im Interview (Gumpelmaier, Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für die Kreativwirtschaft OÖ.
2012)
475 Henner-Fehr im Interview (Henner-Fehr 2012)
178
stimmt zwar Weiß zu, aber er gibt auch zu bedenken, dass darüber hinaus eine
Investitionskultur bei der „Crowd“ gegeben sein muss. „(...) der durchschnittliche, normal
denkende Bürger in Europa mit dem Wort Crowdfunding erstens einmal nichts anfangen kann, und
das zweite, diesem Crowdfunding nicht traut.“476 Deswegen sei es notwendig, „erst einmal
Vertrauen aufzubauen (...) und dafür braucht es Medienpartner.“477
Für den Zweck Crowdfunding als Marketinginstrument einzusetzen, ist ein großer Bedarf an
Beratung und Weiterbildung hinsichtlich Marketing- und Marktmechanismen, sowie Social Web
und Kommunikation im Internet gegeben, meint Henner-Fehr. Außerdem müsse das
Angebotene jemanden interessieren, einen Bedarf oder ein Bedürfnis erregen, oder ideellen
Nutzen stiften.478
4.2.6 Gruppenspezifische allgemeine Bedarfe
Allgemeine Bedarfe werden folgend nochmals gruppenspezifisch für „Einzelkämpfer“, „Teams“,
und „Teams mit juristischen Kleid“ zusammengefasst. Den Bedarf der Kreativen subsummiert
ein Experte, wie folgt:
„Unterstützung, Vermarktung, und ein gewisses betriebswirtschaftliches Denken“. (Weiß, GF von Akostart)
4.2.6.1 Bedarfe der „Einzelkämpfer“
Die Gruppe der Einzelkämpfer nennt Bedarfe rund um ihre Existenz, wie Pensions- und
Gesundheitsvorsorge, Vernetzung mit anderen EinzelkämpferInnen für Kooperationen, sie hat
Interesse an einer Auftragsplattform, PR und Wissenstransfer zu kaufmännischen Themen wie
Kalkulation, Vermarktung und Werbung. Sie möchte Workshops, um z.B. Förderanträge leichter
stellen, „wie man einen Pitch macht“, und benötigt auch unabhängige Information zu
Rechtsmaterien, die ihre Arbeit betreffen (z.B. Patentrecht, Urheberrecht).
4.2.6.2 Bedarfe der „Teams“
Die Bedarfe der Teams sind Wissenstransfer und Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen. Sie
wünschen sich Vernetzungstreffen, Vermittlungsangebote und Workshops zu Finanzierung und
Marketing. Die Vernetzungsarbeit soll ihnen auch helfen, zu weiteren Aufträgen zu kommen, um
mit mehr Einnahmen einen weiteren Wachstumsschritt in Angriff nehmen zu können. Sie
476 Weiß im Interview (Weiß 2012)
477 Weiß im Interview (Weiß 2012)
478 Henner-Fehr im Interview (Henner-Fehr 2012)
179
wünschen sich praktische Unterstützung bei Förderansuchen, beim Konzipieren und Umsetzen
von Ideen.
4.2.6.3 Bedarfe der „Teams im juristischem Kleid“
Informationsweitergabe über Finanzierung („früh genug“) und andere aktuelle Themen (z.B.
über neue Marketingstrategien) die sie betreffen könnten, sollen geliefert (z.B. per Newsletter)
werden. Information zu potenten Finanzpartnern wie Business Angels, sowie höheres
Beteiligungskapital werden dringend gewünscht. An Workshops und Weiterbildungsangeboten
hat diese Gruppe keinen Bedarf, „wir holen uns die Information auf need-to-know-Basis“, bringt
einer der Interviewten es auf den Punkt.
180
4.3 Ansatzpunkte zum Abbau von Hemmnissen479
„(...) vor 10 Jahren beispielsweise, da hat man von den Creative Industries überhaupt noch nichts gehört. Da waren das die Freaks, die an der Kunstuni studiert haben, aber mittlerweile werden die auch schon ernst genommen und sieht man auch die Probleme, die die haben.“ (Weiß, GF von Akostart)
Ansatzpunkte zum Abbau von Hemmnissen liegen zunächst im Abbau der Haupthemmnisse,
zusammengestellt auf Seite 158, oder strategisch ausgedrückt im „Schwächen von Schwächen“,
Lösungsansätze die diese zusammengefasst berücksichtigen, können in
• Verbesserungen des Kapitalzugangs,
• kooperationsfördernden Maßnahmen,
• Verbesserungen hinsichtlich monetären und beratenden Förderungen und
• bekanntheitssteigernden Maßnahmen
gesehen werden.
Kapitalzugang:
Für die „Einzelkämpfer“ und „Teams“ kann das Hemmnis des Kapitalzugangs primär durch
informations- und kooperationsfördernde Maßnahmen weitgehend reduziert werden, denn es
bestehen bereits Fördermaßnahmen, die den Mangel an Sicherheiten und hohe
Bankkonditionen adressieren, aber noch zu wenig bekannt sind, um genutzt werden zu können.
Die Informationsweitergabe sollte durch eine zentrale Ansprechstelle organisiert und
durchgeführt werden. Informationen müssen rechtzeitig und im erforderlichen Ausmaß an
Kreative weitergegeben werden, es wird nicht genügen, diese bloß auf einer Homepage zu
veröffentlichen.
„Also wenn man einfach davon rechtzeitig und laufend Bescheid weiß, dann kann man dann, wenn's einmal drum geht, zu dem Zeitpunkt auch besser reagieren oder sich dann an die betreffende Stelle wenden.“ (GF, OG, Design)
„Immer wiederkehrender Information, die Möglichkeiten, die es gibt, (...) und was sich gerade tut, das sehe ich einmal so wirklich als Hauptpunkt, dass man einfach weiß, was läuft.“ (GF, Software/OS)
Es wird nötig sein den direkten Kontakt zu suchen, ungeachtet dessen, dass es auch im eigenen
Interesse der Kreativen liegen muss sich zu informieren. Es gilt zunächst, diese Möglichkeiten
der Förderungen auszuschöpfen und sie für alle Kreativbereiche, in geeigneter Höhe bereit zu
stellen. Für die „Teams im Rechtskleid“, die einen höheren Kapitalbedarf haben, sollten in einem
ersten Ansatz der Mangel an Risikokapital abgefedert werden, und
Crowdfinanzierungsvarianten, nicht nur jene über Plattformen, rechtlich, mit
vertrauensbildenden Maßnahmen wie z.B. mit „Zertifikat“, sowie medial unterstützt werden. Es
479 Informationslücke - aktuelle Information über Förderungen, Aufwand bei Förderungen und CF zu Betragshöhe,
Arbeitsaufwand – Teamgröße, Auftragssicherheit, Seed Kapital zu gering, Risikoübernahme, udgl.
181
wird nötig sein, die „Crowd“ auf diese Investitionsmöglichkeit aufmerksam zu machen, und das
erforderliche Vertrauen dafür herzustellen, was mithilfe vertrauensbildender Maßnahmen von
Seiten der öffentlichen Hand unterstützt werden kann.
„Vertrauen zu haben in eine Anlage (...) und da muss das Image von Crowdfunding jetzt einmal so gefestigt sein, dass man sagt, schaut her, was da Tolles entstehen kann, wie z.B. Iron Sky. (...) Da muss man aber dem auch vorrechnent, damals 500 Euro oder 1.000 Euro investiert hat, der hat jetzt so oder so viel Geld zurück gekriegt. Und dann sagt er: ‚Aha, das könnte man auch einmal probieren’. Aber das dauert, sage ich, 10 Jahre.“ (Weiß, GF von Akostart)
Kooperationsfördernde Maßnahmen
Kooperationsfördernde Maßnahmen können darin bestehen, Orte zu schaffen, die den Bedarfen
der Kreativen und anderer Wirtschaftszweige entsprechen. Ob dies reale Mietobjekte sind, wie
beispielsweise die Tabakfabrik oder Treffpunkte, ist irrelevant, wichtig ist, dass diese auf die
Erfordernisse der Nutzer abgestimmt sind, eine Grundausstattung aufweisen, und die
Interdisziplinarität gewahrt wird.
„(...) so Veranstaltungen, die halt einen Netzwerkcharakter verbinden mit einer Situation des Lernens.“ (wünscht sich ein Designer, EPU)
Wichtig ist außerdem, dass die inhaltliche Bestimmung auf Seiten der Nutzer bleibt um
angenommen zu werden.
„(...) die Verträge sind solche, die man besser nicht unterschreibt, und überdies das Projekt Tabakfabrik ist ein sehr politisches und dauert sehr lange“ (ein am Einzug interessierter Architekt)
Kooperationsfördernde Maßnahmen können auch dazu beitragen, den Ressourcenmangel und
Organisationale Probleme abzufedern.
monetäre Förderungen
„Wir leben in einem Land, das im Prinzip ein Förderhimmel ist in Österreich, aber auch gleichzeitig ein Förderdschungel. Nur ist der bürokratische Aufwand bei den Förderungen enorm. Das heißt ich kriege eigentlich das Geld nicht für das Projekt, sondern für den Antrag, den ich schreiben muss. Und vor allen Dingen, dann muss ich warten bis zu 6 Monaten, bis eine Förderzusage kommt oder eine Förderablehnung. Und in den sechs Monaten kann ich gerade im IKT-Bereich, kann ich tot sein. Da ist der Markt einfach dynamisch (...)“ (Weiß, GF von Akostart)
Maßnahmen zum Abbau von Hemmnissen in Bezug auf Förderungen betreffen in erster Linie die
Förderpolitik. Diese kann die Formalitäten und den Aufwand, sowie den Mangel an
Planungssicherheit betreffend Widerruf von Förderzusagen und fehlende längerfristige
Fördermodelle, beeinflussen und diese Hemmnisse abbauen. Die Ungewissheit bis die Zusage
kommt, kann diese nur bedingt beeinflussen, indem die Bearbeitungszeiträume verkürzt, und
standardisierte Modi für alle Förderungen eingeführt werden. Auch die Höhe der Förderung
182
kann nur von der Politik entschieden und per Weisung bestimmt werden. Dass ausreichend
öffentliche Förderungen vorhanden sind, war lediglich eine Einzelmeinung bei den Kreativen.
„Also ich würde mir wünschen, dass ich von diesen Stellen (...), irgendwie mehr Geld kriege. Weil das, was ich kriege, ist immer irgendwie so, so tröpfchenweise irgendwie. Man kann's dann schon machen, aber irgendwie wäre es einmal super, wenn das irgendwie besser finanziert wird. Damit ich auch selbst auf ein anderes Level kommen kann sozusagen.“ (EinzelkämpferIn, Kunst-/Dokumentarfilm)
Beratungsleistungen
Finanzierungsengpässe, die steuerliche und sozialversicherungstechnische Zahlungen betreffen,
können primär durch Beratungsleistungen reduziert werden, deren Vermittlung die Creative
Region Linz & Upper Austria, sowie andere Wirtschaftsserviceeinrichtungen übernehmen
können. Darüber hinaus können etwaige Weiterbildungsbedarfe ebenfalls von diesen Stellen
vermittelt werden. Information zu Finanzierungsquellen ist auch unter diesem Aspekt von hoher
Relevanz.
„In Information über Finanzierung, das könnte ich mir gut vorstellen – und zwar unabhängige Informationen. Weil mir hilft es nicht wenn die – weil ich will nicht zu einer Bank gehen, wenn ich über Finanzierung reden will.“ (EPU, interdisziplinär tätig)
„Wenn ich versuche, die Gründer in ein Schulungsprogramm zu zwingen, und das ist das, was ich als Verschulung der Inkubation in Oberösterreich bezeichne, dann geht das völlig in die falsche Richtung. Ich muss ein Angebot machen, aber letztlich müssen die Gründer das selbst annehmen, sie tragen auch selber das Risiko.“ (GF, StartUp)
„(...) also da wird viel nicht beraten und den Leuten einfach nicht klar gemacht, dass sie von Beginn weg einen gewissen Betrag ihrer Einnahmen oder ihres Gewinns auf die Seite legen müssen, auf ein Steuersparbuch, wie wir es nennen, und das wird nicht angegriffen, Pasta Schluss aus.“ (Tiefenböck, Steuerberater)
Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit
Kreative erleben es als schwierig, am Markt zu reüssieren ohne entsprechende Referenzen und
ohne einen gewissen Bekanntheitsgrad. Besonders für JungunternehmerInnen ist es daher
schwierig als „No-Name“ Aufträge zu erhalten oder sogar eine Förderung. Um diese Hemmnisse
abzubauen, kann die Creative Region Linz & Upper Austria mittels Presseaussendungen,
Präsentation auf der Homepage und bei Veranstaltungen, und beim Herstellen von Kontakte zu
regionalen und internationalen Medien, helfen. Die Vernetzung mit dem freien Radio und
Fernsehen, sowie anderen Medien als Teil der eigenen Community-Aktivitäten wäre eine
weitere Möglichkeit kreatives Schaffen präsenter zu machen.
„Also ich habe es eigentlich so verstanden, es sollte Marketing sein für Creative Industries.“ (EPU, Designer) „ (...) aber da braucht man ein gewisses Marketing dahinter. Ich muss mich einfach einmal positionieren, genauso vermarkten wie ein Christian Ludwig Attersee oder wie andere. Die haben es schon geschafft, das sind aber Einzelfälle. Oder ich muss es über Ausstellungen finanzieren, die mir bezahlt werden.“ (Weiß, GF von Akostart)
183
4.4 Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien
Die Ergebnisse der Erhebung können ansatzweise mit zwei Studien der letzten Jahre verglichen
werden, einerseits im Hinblick auf vorhandenen Studienergebnissen der Bedarfsanalyse der
Kreativwirtschaft in der Stadt Linz aus 2009480 von Kailer und Gruber-Mücke, andererseits in
Bezug auf die Ergebnisse der Crowdfunding-Aussagen mit der Studie von Harzer zu
Erfolgsfaktoren im Crowdfunding aus dem Jahr 2013.
4.4.1 Kreativwirtschaft
Die Ergebnisse der Befragung durch Interview der Stichprobe von 25 Unternehmen werden nun
mit den vorhandenen Studienergebnissen der Bedarfsanalyse der Kreativwirtschaft in der Stadt
Linz aus 2009481 (Online-Befragung einer Stichprobe von 165 Unternehmen) in den Punkten
• Bereiche der Stichprobe
• Unternehmerteams versus AlleinunternehmerInnen
• Bekanntheit von Förderungen
• Nutzung von Beratungsangeboten
• Weiterbildungsbedarf
• Kooperationsverhalten
• Finanzierungsbedarf und
• Investitionsplanung
gegenüber gestellt.
Bereiche der Stichprobe und AlleinunternehmerInnentum
Dabei zeigt sich dass die Größenordnung der Bereiche sehr unterschiedlich ist. In der kleineren
Stichprobe aus 2013 sind Architektur, Musik, Buch und künstlerische Tätigkeit am häufigsten,
hingegen in der größeren Stichprobe Werbung/Werbewirtschaft und IKT/Multimedia. In beiden
Stichproben sind jedoch mehr als 70 % als AlleinunternehmerInnen tätig.
Bekanntheit von Förderungen
Ein klarer Unterschied besteht in der Bekanntheit von Förderungen. Bei den Interviews wurden
narrativ zu einem sehr geringen Anteil Förderstellen genannt, in der Online-Befragung wurde
durch geschlossene Fragen nach der Bekanntheit einer konkreten Förderstelle gefragt, die einen
hohen Bekanntheitsgrad bewirkt hat, darin liegt vermutlich auch der große Unterschied.
480 vgl. (Kailer und Gruber-Mücke 2009)
481 vgl. (Kailer und Gruber-Mücke 2009)
184
Nutzung von Beratungsangeboten
Zur Nutzung von Beratungsangeboten kann gesagt werden, dass in beiden Stichproben ein sehr
hoher Nutzungsgrad von rund 74 % bei der kleinen Stichprobe, bei der großen Stichprobe
zwischen 40 % und 44 % bzw. das WKO Gründerservice zu 95 % bekannt ist und genutzt wird.
Weiterbildungsbedarf
Zum Weiterbildungsbedarf kann gesagt werden, dass in der kleinen Stichprobe der Bedarf an
Vernetzungstreffen und Erfahrungsaustausch am häufigsten genannt wurden, gefolgt von
Workshops zur Erstellung von Förderanträgen und zu Crowdfunding, der rechtlich-
betriebswirtschaftliche Bedarf an Weiterbildung war gering. In der größeren Stichprobe war der
Bedarf an rechtlichen Fachgebieten (Markenrecht, Datenschutz, Urheberrecht, etc.) am größten
(rund 33 %), der Bedarf an Kreativitätsworkshops und Austausch mit KollegInnen betraf ein
Viertel. Dieser Unterschied könnte in den unterschiedlichen Anteilen der Bereiche liegen.
Kooperationsverhalten
Das Kooperationsverhalten, das in der Stichprobe von 165 Unternehmen untersucht wurde,
ergab als Ergebnis einen wesentlichen Stellenwert. Nur 12,3 % der UnternehmerInnen
kooperieren überhaupt nicht, 40,7 % der UnternehmerInnen kooperieren auftragsbezogen. Die
Stichprobe von 25 Unternehmen hat als Ergebnis ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert für
Kooperationen erbracht. Immerhin nutzen oder nutzten 17 von 25 Unternehmen fallweise oder
regelmäßig Kooperationen. Der Zweck der Ressourcennutzung ist am höchsten, knapp gefolgt
von Arbeitsteilung als Beweggrund.
Finanzierungsbedarf & Investitionsplanung
Der Finanzierungsbedarf wurde in der Stichprobe von 165 Unternehmen knapp nach der
Wirtschaftskrise 2009 von 65 % verneint. Für die Stichprobe von 25 Unternehmen kann gesagt
werden, dass der Finanzierungsmix sich von einem auf das andere Jahr nach Aussage der
meisten Unternehmen kaum verändern wird, einen konkreten Finanzierungsbedarf haben die
drei StartUps genannt. Dieses Ergebnis ist verwunderlich, da andererseits, in Kapitel 3.8
zusammengefasst, der „Ressourcenmangel Kapital“ als Hemmnis am häufigsten genannt wurde.
Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass der Finanzierungsbedarf mit unternehmerischer Vorsicht
zusammenhängt. Kailer/Gruber-Mücke482 sehen einen Zusammenhang im Investitionsverhalten
und dem Alter der UnternehmerInnen. Sie vermuten, dass UnternehmerInnen mit höherem
Alter ein gebremstes Investitionsverhalten an den Tag legen, als dies im Vergleich jüngere
482 vgl. (Kailer und Gruber-Mücke 2009)
185
UnternehmerInnen tun.483 Das Alter der UnternehmerInnen aus der kleinen Stichprobe ergibt
einen Anteil von 17 von 22 Personen, die älter als 31 sind, bei einer gleichbleibenden
Investitionsabsicht für das kommende Jahr. Das stützt die Annahme des Zusammenhanges,
insbesondere auch, weil die UnternehmerInnen der StartUps unter 30 Jahre alt sind.
4.4.2 Crowdfunding
Die erfassten Ergebnisse aus der Stichprobe „Voraussetzungen um Crowdfunding erfolgreich
anzuwenden“ auf Seite 157 werden als Vergleich den von Harzer 484 erforschten
„Erfolgskriterien“ auf Seite 121 gegenübergestellt. Interessanterweise ist ein Vergleich nur zu
neun Erfolgskriterien von 15 möglich. Ohne näher auf alle Erfolgskriterien eingehen zu wollen,
ist anhand der u.a. Tabelle erkennbar, dass von der Stichprobe Voraussetzungen genannt
werden, die mit den erhobenen Erfolgskriterien von Harzer nicht übereinstimmen. Die erste
ungefähre Übereinstimmung ist in punkto kritischer Masse bzw. Anzahl der Unterstützer zu
sehen. Kreative der Stichprobe meinen, „ein geeignetes Projekt“ wäre Voraussetzung, die
Analyse von Harzer zeigt das Projekt jedoch erst an sechzehnter Stelle. Was die Projektsumme
(das Zielbudget) betrifft, wird ihr ähnliche Bedeutung beigemessen.
Voraussetzung Anzahl Nennungen
Rang Erfolgskriterium
kritische Masse erreichen 10 4 Anzahl der Unterstützer
geeignetes Projekt/Produkt (Innovation, zivilgesellschaftlich od. community-relevant, ..)
8 16 Projektidee
höhere Projektsummen (1 direkte, 6 indirekte Aussagen)
7 3 Zielbudget
Know-how und Social Media Kompetenz 6 Marketing/PR/Medienunterstützung 6 5 Gegenleistungen
Planung/Vorbereitung notwendig (Verteiler, Kommunikationskanäle, Film, Video, Texte, ...) (indirekte Aussagen)
6 9 13 15
Video Professionelle
Projektdarstellung Projektbeschreibung
Personalressourcen 5 aktive/wiederholte Betreuung der UnterstützerInnen
5 14 Info zu Projektfortschritt/Blog
Vertrauen (in das Projekt, die Plattform, in handelnde Personen, Zahlungssystem durch Gütesiegel, Copyright, Datenschutz)
4
CF-Kampagne durch Multiplikatoren unterstützen 4 12 Multiplikatoren/Empfehlungen
Bewusstsein schaffen 3 Gegenleistung (gut überlegen) 2 Bekanntheit des/r Projektanten/in 1 keine besondere Voraussetzung notwendig 1
Tabelle 32: Gegenüberstellung CF Voraussetzungen und Erfolgskriterien nach Harzer485
483 vgl. (Kailer und Gruber-Mücke 2009, S. 49)
484 vgl. (Harzer 2013)
485 (Harzer 2013, S. 112f)
186
Die bei Harzer im ersten und zweiten Rang stehende Projektlaufzeit und Projektdynamik wird
von der Stichprobe überhaupt nicht erwähnt. Daraus lässt sich schließen, dass sehr
divergierende Ansichten zwischen Crowdfunding-Erfahrenen und potentiellen unerfahrenen
Crowdfunding-Anwendern bestehen und möglicherweise falsche Annahmen zum Gelingen von
Crowdfunding-Kampagnen bestehen, die es gilt durch Workshops, Erfahrungsaustausch u.dgl.
aufzuklären.
187
4.5 Nachhaltige Kreativwirtschaftsförderung
Die Vernetzung innerhalb der Kreativwirtschaft ist enorm wichtig. Auch die Vernetzung der
Creative Region Linz & Upper Austria zu anderen Förderstellen, die Kreativwirtschaft bedienen
(europaweit, USA, ...), soll stattfinden. Die Vernetzung der Kreativen untereinander sowie mit
anderen Branchen in ganz Oberösterreich, österreichweit und international wäre
wünschenswert und ist bis dato noch in zu geringem Ausmaß der Fall, meinen Experten wie
auch Kreative. Gemeinsam könnte man mehr erreichen.
Als Fazit aus den Ergebnissen ist darauf zu drängen, dass Förderungen, sowohl monetärer als
auch nicht-monetärer Art ausreichend zur Verfügung gestellt und bekannt gemacht werden, und
nach dem Motto „Stärken stärken, Schwächen schwächen“ ausgerichtet werden. Daran
anknüpfend, sollten die Stärken der Kreativwirtschaft „gelebte Kooperationen“, „vorhandene
Kreativität“ verstärkt gefördert werden, und ihre Schwächen mithilfe des Abbaus von
Hemmnissen, geschwächt werden. Dabei müssen Angebote an die Bedarfe der Kreativen
angepasst werden, um eine nachhaltige Kreativwirtschaftsförderung zu gewährleisten.
Wünschenswert wäre, dass dies als Serviceleistung verstanden würde. Beim Abbau von
Hemmnissen ist zentral die Wirtschaftspolitik und die Kulturpolitik des Landes OÖ.
angesprochen, diese müssen die Weichen dafür stellen. Ansatzpunkte dafür geben die
eigentlichen Experten selbst, die Kreativen.
Konkrete Erstmaßnahmen wurden in den vorhergehenden Kapiteln bereits angesprochen, diese
nochmals zusammenfassend, könnte die Umsetzung in folgenden Punkten angegangen werden:
• Eingehen auf Bedarfe der drei Gruppen, ungeachtet der Bereiche von Kreativwirtschaft
• Stärkung der bestehenden Kooperationen durch „Gemeinschaftslabors“, „Partnerbörse“
• Anfachen der Kooperationsbereitschaft: Einladung zu regelmäßigem
Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche, mit Experten, Geschäftsführern und
Entwicklungsteams anderer Branchen, Vertretern von Best Practice in Vertrieb,
Marketing, Logistik, u.a. Themen, ausgerichtet nach den Bedarfen der Kreativen
• Koordination von gemeinsamen Förderanträgen
• Stärkung der Eigenleistung durch „Auftragsbörse“, PR & Marketing, mediale
Berichterstattung in Internet, Radio und Fernsehen, sowie Presse
• Informationsweitergabe zu Finanzierungsmöglichkeiten durch
Informationsveranstaltungen und Bewerbung von Förderungen
• Weiterbildungsangebote bzw. deren Vermittlung nach Bedarfen der Kreativen
• Intensivierung des Beratungsangebotes: Steuerberatung, Plan- u. Kostenrechnung und
dgl. mehr
188
• Beratungs- und Informationsangebote bündeln (Effizienzsteigerung bei
Förderdatenbanken, Direktvergabe von Fördermitteln486)
Oberösterreich ist reich an innovativen und kreativen UnternehmerInnen, die einen Umsatz von
1.683 Mio Euro487 erwirtschaften. Es verfügt über eine interessante Medienlandschaft, ist stark
in den Branchen Tourismus und Industrie, verfügt über einen überregionaler Bekanntheitsgrad
durch Ars Electronica, Brucknerhaus, Hagenberg, u.a. Diese Kräfte zu bündeln könnte einen
„Medici Effekt“ 488 auslösen, der Oberösterreich zu einem begehrten Kreativ-Wirtschafts-
Standort mit Anziehungskraft macht.
486 durch Kaskadierung von Förderleistung bleiben Fördermittel in der Verwaltung gebunden
487 Umsätze aus 2010, siehe (KMU-Forschung Austria 2013)
488 vgl. Johansson, Frans, The Medici Effect. What Elephants & Epidemics can teach us about Innovation, Boston:
Harvard Business School Press, 2006.
189
5 Zukünftiger Forschungsbedarf
Ein zukünftiger Forschungsbedarf kann in mehreren Bereichen ausgemacht werden. Zum einen
in der Definition von Kreativwirtschaft, die Auswirkungen auf statistische Daten und deren
Auswertung, und in Folge auch Auswirkungen auf Fördermaßnahmen hat. Ein weiterer Bereich
ist die Erhebung und Auswertung von Strukturdaten zur Kreativwirtschaft in OÖ. Diese sollte
jährlich erfolgen und die Bereiche der Kreativwirtschaft einzeln betrachten um Veränderungen
wahrnehmen zu können. Nicht nur quantitative Analysen sollten angestellt werden, auch
qualitativ wird es notwendig sein weiter zu forschen, da derzeit in manche Bereich-
Strukturdaten aufgrund des Datenschutzes nicht vertieft Einblick genommen werden kann.
Teambildung und Kooperationsformen erscheinen aufgrund der Forschungsergebnisse der
Stichprobe besonders wichtig für das Wachstum und die Entwicklung der
Kreativwirtschaftsunternehmen, was einen weiteren Forschungsschwerpunkt qualitativer
Analysen darstellen könnte.
Durch die empirischen Ergebnisse der Stichprobe zur Finanzierung der Kreativwirtschaft
ergeben sich Forschungsbedarfe in Kreativbereichen, die in der vorliegenden Studie nicht
miteinbezogen worden sind, oder in denen der Anteil an Befragten zu gering war, wie
beispielsweise im Teilbereich Mode. Der Bereich Musik, Buch und künstlerische Tätigkeit ist
sehr breit gefächert, hier nachzustoßen und Befragungen durchzuführen, wäre lohnenswert, da
dieser Kreativwirtschaftsbereich österreichweit der mit der größten Anzahl an Unternehmen ist,
und die zweithöchste Wertschöpfung nach dem Bereich Software aufweist. Die effektive
Bedeutung geht jedoch über die Wertschöpfung der Branche hinaus, die vertikale Integration
der relevanten Vorleistungen wurde von der EU-Kommission erkannt. Dieser Nutzen der
Kreativwirtschaft auf andere Wirtschaftsbereiche könnte auch in der Region OÖ untersucht
werden.
Um Förderangebote für die Kreativwirtschaft optimieren zu können, ist es notwendig, vertieft zu
hinterfragen, wo und in welchem Zusammenhang mit welcher Förderung oder Förderstelle
Hemmnisse vorhanden sind. Dieser Frage konnte nur allgemein nachgegangen werden,
vereinzelt wurden jedoch Themen aufgeworfen wie z.B. die De-Minimis Beschränkung, die
Vereinheitlichung von Förderansuchen und –abläufen, die Nachhaltigkeit von Förderungen und
dgl. mehr. Sie alle würden ein Nachforschen rechtfertigen. Dies könnte in Form eines
längerfristigen Forschungsprojektes durchgeführt werden, in dem ausgehend von der
Forschungsfrage genutzte Finanzierungsinstrumente aufgenommen und in einer nachgelagerten
Forschungsphase die Effizienz der genutzten Instrumente, unter Berücksichtigung von speziell
190
für die Kreativwirtschaft evaluierten Einflussfaktoren, gemessen wird.489 Die vorliegende Arbeit
könnte durchaus dafür als Ausgangsbasis dienen.
Eine nachfolgende Studie könnte beispielsweise die erhobenen Schwächen/Hemmnisse, der
Stichprobe von Kreativen mit jenen Ergebnissen aus der Stichprobe von Experten zur Bereichs-
und Potentialanalyse 2012 heranziehen und aus einer vorhandenen SWOT Analyse
entsprechende TOWS-Strategien ableiten. Diese könnten als Entscheidungsgrundlagen für die
Förderprogrammentwicklung der Kreativwirtschaft in Oberösterreich dienen.
Forschungsbedarf besteht auch im Bereich Crowdfunding. Ess ist sozusagen eine „Erfindung der
Kreativwirtschaft“ und „ein“ Ausweg zur Finanzierung von Projekten abseits von Banken und
Förderungen. Ob es als Finanzierungsinstrument für andere Wirtschaftsbereiche längerfristig
eine Option ist, wird daran liegen, ob die entsprechenden Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und
Einflussfaktoren gegeben sind oder aufgebaut werden können. Welche das sind wird gerade und
in nächster Zukunft erforscht. Diese Forschungen sollten aber nicht nur aus der Perspektive von
erfolgreichen Crowdfundern und Experten oder der Plattformbetreiber erfolgen, sondern auch
aus der Perspektive der anzusprechenden Zielgruppen bzw. Financiers. Außerdem sollten auch
andere Modelle von Crowdfunding, als die über Internetplattformen abgewickelten, untersucht
werden. Es scheint, dass Crowdfunding selbst für Teilbereiche der Kreativwirtschaft kein
geeignetes Finanzierungsinstrument ist, jedoch zur Steigerung des Bekanntheitsgrades viel
beitragen kann. Auch in diesem Bereich fehlen derzeit noch entsprechende Erkenntnisse von
Forschungsaktivitäten.
489 z.B. wird das gerade am Institut für unternehmerisches Handeln von Fronz und Konrad für Deutschlands KuKw
durchgeführt;
191
6 Ausblick
Ziel dieser Arbeit war es, aufzuzeigen, wie Kreative in Oberösterreich ihre Unternehmungen
finanzieren, welche Hemmnisse und Bedarfe bestehen, welche Finanzierungsquellen bekannt
sind, welche genutzt werden, ob es Besonderheiten gibt und ob Crowdfunding eine geeignete
Finanzierungsform für Kreative ist. Das konnte in der Diskussion der Ergebnisse aufgezeigt
werden. Genannte Bedarfe können als Chance gesehen werden, vorhandene
Unterstützungsmaßnahmen zu optimieren und auszubauen. Da es sich bei der vorliegenden
Arbeit aber um eine Stichprobe und Momentaufnahme der Situation handelt und Crowdfunding
ein sehr junges Thema ist, das gerade erst an Bekanntheit gewinnt, die Creative Region Linz &
Upper Austria erst vor kurzem ihre Tätigkeit aufgenommen hat, sowie laufend neue
Fördermöglichkeiten entwickelt werden, ist anzunehmen, dass Finanzierungsquellen bekannter
werden und Kreative diese und die Angebote an Unterstützung vermehrt nutzen. Das wiederum
würde dazu führen, dass sich die wirtschaftliche Situation für Oberösterreichs Kreativwirtschaft
verbessert und sich das positiv auf die gesamte Region auswirkt.
193
7 Literaturverzeichnis
Bücher, Studien und Berichte
Amann, S. (Juli 2009). Kreativwirtschaft Oberösterreich. Linz: Land Oberösterreich - Direktion Kultur. Atteslander, P. (2003). Methoden der empirischen Sozialforschung (Bd. 12.). Berlin: ESV (S. 148). Bachinger, e. a. (2013). Fünfter Österreichsicher Kreativwirtschaftsbericht. (C. Austria, Hrsg.) Wien. Berglin, H., & Standberg, C. (2013). Leveraging customers as investors. The driving forces behind
crowdfunding. Uppsala. Berndorff-Nybo, Z. L., Rohner, N., Lichtenberger, V., Zinser, D., & Torres, G. A. (2012). Can teh concept of
crowdfunding be adopted by an academic environment? Kopenhagen: RUDAR. Clayton, L., & Mason, H. (2006). The financing of UK Creative Industries SMEs. London: BOP & Pembridge. Dörflinger. (2012). Kreativwirtschaft Linz und Oberösterreich, Bereichs- und Potentialanalyse. (C. R. Austria,
Hrsg.) Wien: KMU-Forschung Austria und Institut für qualitative Analysen. da Cruz Matos, H. N. (2012). Crowdfunding. Material Incentives and Performance. Lissabon. Eisfeld-Reschke, J., & Wenzlaff, K. (2011b). Crowdfundingstudie 2010/2011. (ikosom, Hrsg.) Berlin: ikosom. Eisfeld-Reschke, J., & Wenzlaff, K. (2010/2011a). Studie: Crowdfunding. Untersuchung des
plattformbasierten Crowdfundings im deutschsprachigen Raum. Juni 2010 bis Mai 2011. (ikosom, Hrsg.) Berlin: ikosom.
Fink, M., Riesenfelder, A., Talós, E., & Wetzel, P. (2006). Neue Selbständige in Österreich. In B. f. Arbeit (Hrsg.), Wiener Beiträge zur empirischen Sozialwissenschaft (Bd. 1, S. 11ff). Wien: Lit Verlag.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books. Forster, M. (2013). Crowdfinancing - (k)eine Finanzierungsalternative für Start-ups und
Jungunternehmen? Linz: Tauner Verlag. Fueglistaller, U., Müller, C., Müller, S., & Volery, T. (2012). Entrepreneurship. Modelle - Umsetzung -
Perspektiven. Mit Fallbeispielen aus Deutschland, Österreich und Schweiz. (3. Auflage Ausg.). Wiesbaden: Gabler Verlag.
Gerlach-March, R. (2010). Kulturfinanzierung (1. Auflage Ausg.). (A. Hausmann, Hrsg.) Wiesbaden: Springer VS.
Gläser, J., & Laudel, G. (2009). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden: Gabler. Gompers, P., & Lerner, J. (1999). The venture capital cycle. Cambridge. Gumpelmaier, W. (2012). Crowdfunding im Kultur- und Sozialbereich. Linz. Guserl, R., & Pernsteiner, H. (2011). Finanzmanagement. Grundlagen - Konzepte - Umsetzung (1. Auflage
Ausg.). Wiesbaden: Gabler. Haibach, M. (2012). Handbuch Fundraising. Spenden, Sponsoring, Stiftungen in der Praxis (4. Auflage
Ausg.). Frankfurt: Campus Verlag. Harzer, A. (2013). Erfolgsfaktoren im Crowdfunding. Ilmenau: Universitätsverlag Ilmenau. Helfferich, C. (2005). Die Qualität qualitativer Daten (Bd. 3). Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften. Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews
(4. Auflage Ausg.). Wiesbaden: Springer VS Verlag. Hemer, J., Schneider, U., Dornbusch, F., & Frey, S. (2011). Crowdfunding und andere Formen informeller
Mikrofinanzierung in der Projekt- und Innovationsfinanzierung. (F.-I. f.-u. ISI, Hrsg.) Berlin: Fraunhofer Verlag.
Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Allen Lane. Johansson, F. (2006). The Medici Effect. What Elephants & Epidemics can teach us about Innovation.
Boston: Harvard Business School Press. Kailer, N., & Gruber-Mücke, T. (2009). Bedarfsanalyse der Kreativwirtschaft in der Stadt Linz - eine
empirische Erhebung. Projektbericht FIN-URB-ACT. Linz: Institut für Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung Johannes Kepler Universität Linz.
Kailer, N., & Weiß, G. (2012). Gründungsmanagement kompakt. Von der Idee zum Business Plan (4. erw. Auflage Ausg.). Wien: Linde Verlag.
KEA European Affairs. (2010). Promoting Investment in the Cultural and Creative Sector: Financing Needs, Trends and Opportunities . ECCE Innovation. Nantes: Nantes Métropole.
Klein, A. (2008). Der exzellente Kulturbetrieb. Wiesbaden: VS Verlag.
194
KMU-Forschung Austria. (2013). Fünfter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht, Studienfassung. (Studienfassung Ausg.). (Ö. K. KMU-Forschung Austria, Hrsg.) Wien: creativ wirtschaft austria, Wirtschaftskammer Österreich.
KMU-Forschung Austria; Linzer Institut für qualitative Analysen. (2012). Kreativwirtschaft Linz und Oberösterreich, Bereichs- und Potentialanalyse. (C. R. (Auftraggeber), Hrsg.) Wien.
KMU-Forschung Austria. (2010). Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht, Studienfassung. (Z. f. KMU-Forschung Austria, Hrsg.) Wien: creativ wirtschaft austria, Wirtschaftskammer Österreich.
KMU-Forschung Austria. (2008). Dritter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht. (A. C. KMU-Forschung Austria, Hrsg.) Wien: creativ wirtschaft austria, Wirtschaftskammer Österreich.
KMU-Forschung Austria. (2006). Zweiter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht. (c. w. austria, Hrsg.) Wien: creativ wirtschaft austria, Wirtschaftskammer Österreich.
KMU-Forschung Austria. (2003). Erster Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht. (c. w. austria, Hrsg.) Wien: creativ wirtschaft austria, Wirtschaftskammer Österreich.
Lamnek, S. (2005). Qualitative Sozialforschung. PVU. Basel: Beltz. Mayerhofer, P., & Huber, P. (2005). Arbeitsplatzeffekte und Betriebsdynamik in den Wiener "Creative
Industries". (A. I. (WIFO), Hrsg.) Wien: Austrian Institute of Economic Research (WIFO). McKinsey & Company. (2007). Planen, gründen, wachsen. Mit dem professionellen Businessplan zum Erfolg.
(4. Auflage Ausg.). Heidelberg: Redline Wirtschaft. Power, D., & Nielsen, T. (2010). Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries. Extension. (E.
Kommission, Hrsg.) Luxemburg: Europäische Kommission. Röthler, D., & Wenzlaff, K. (2011). Crowdfunding Schemes in Europe. (E. Report, Hrsg.) Brüssel. Ratzenböck, V., Kopf, X., & Lungstraß, A. (2011). Der Kreativ-Motor für regionale Entwicklung. Kunst- und
Kulturprojekte und die EU-Strukturförderungen in Österreich. Wien: österreichische Kulturdokumentation.
Sax, A. (2010). Methoden der empirischen Sozialforschung. Methoden der strategischen Planung und Steuerung der IT. , S 49-114.
Schönthaler, T. (2012). Crowdfunding - Eine Möglichkeit zur Finanzierung von Jungunternehmen? Wien. Scherer, D. (2012). Schwärmen für Pop. Crowdfunding im Social Web. Stuttgart: Raabe Verlag. Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2005). Methoden der empirischen Sozialforschung (Bd. 6. Auflage).
München: Oldenbourg. Slyschak, T. (2013). Crowdfunding als Instrument der Kulturfinanzierung am Beispiel von
museuminmotion - Menschen für´s Museum begeistern. Frankfurt. Stots, F. (2011). The development of an application to manage investing involvement during and after and
online crowdfunding project for starting companies. Delft: TU Delft. Surowiecki, J. (2004/2005). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Scoieties and Nations' (Bd. 2). New York: First Anchor Books Edition.
Theil, A., & Bartelt, D. (2012). Crowdfunding. Der neue Weg für private, öffentliche und unternehmerische Förderung in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Berlin: KMP.
Tomandl, T. (1999). Sozialversicherung 2000, freie Dienstnehmer und "neue Selbständige“. Wien. Volkmann, C. K., & Tokarski, K. O. (2006). Entrepreneurship: Gründung und Wachstum von jungen
Unternehmen. Stuttgart: UTB. Volkmann, C. K., Tokarski, K., & Grünhagen, M. (2010). Entrepreneurship in a European perspective -
concepts for the creation and growth of new ventures. Wiesbaden: Gabler.
Beiträge in Zeitschriften und Sammelwerken Brabham, D. C. (2008). Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases.
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. , 14 (1), 75-90. Braun, S. (2013). Fördervereine als freiwillige Vereinigungen. In S. Braun, & e. al, Bürgerschaftliches
Engagement an Schulen (S. 69-75). Wiesbaden: Springer Fachmedien. Brettel, M. (2005). Business Angels. In Entrepreneurial Finance (S. 233-258). Springer. Estellés-Arolas, E., & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an Integrated Crowdsourcing
Definition. Journal of Information Science , 38 (2), 189-200. Fink, M., Riesenfelder, A., & Tálos, E. (2003). Schöne neue Arbeitswelt? Geringfügige Beschäftigung und
freie Dienstverhältnisse: Phänomene und Regelungen in Österreich, Deutschland, Großbritannien und Dänemark,. Zeitschrift für Sozialreform , 2 (2003), S. 271-312.
195
Franke, N., Gruber, M., Henkel, J., & Hoisl, K. (2006). Die Bewertung von Gründerteams durch Venture-Capital-Geber. Eine empirische Analyse. 1-22. Wien/München.
Leimeister, J. M. (2012). Crowdfunding, Crowdvoting, Crowdcreation. ZfCM, Controlling & Management , 56. Jg. (H6), S. S 388-392.
Lowinski, F., & Schiereck, D. (2005). Consulting for Equity als anreizkompatible Vergütungsalternative in der Beratung von Unternehmensgründern. Entrepreneurial Finance , S. 449-470.
Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., & Parasuraman, A. (2011). Crowd-funding: transforming customers into investors through innovative service platforms. Journal of Service Management , Vol. 22 (Iss: 4), S. pp. 443-470.
Paeßens, P., & Schirmeister, R. (2005). Mikro-Gründungsfinanzierung als Entwicklungsstrategie. Entrepreneurial Finance: (Kompendium der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung), S. 103-123.
Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review , 76 (6), S. 77-90.
Towse, R. (2003). "Cultural industries". In R. Towse, A Handbook of Cultural Economics (S. 170-176). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
tyclipso.me (Hrsg.) . (2012). Co:funding Handbuch (2. Ausgabe). (t. i. startnext.de, Hrsg.) Berlin.
Beiträge im Internet
AplusB. „AplusB Factsheet.“ 01. 06 2013. http://e-incubator.at/wp-
content/uploads/2013/04/t2b_Factsheet_AplusB_Final.pdf (Zugriff am 01. 06 2013). aws. „awsg.at - Liste der Treuhandbanken.“ 18. 06 2013.
http://www.awsg.at/Content.Node/files/ergaenzendeinfos/erp-Treuhandbanken.pdf (Zugriff am 18. 06 2013).
Bundeskanzleramt. „Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Kapitalmarktgesetz, Fassung vom 13.07.2013.“ BKA.GV.AT. 13. 07 2013. http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003020 (Zugriff am 13. 07 2013).
Europäische Kommission. „(EC) No 69/2001, (EC) No 1998/2006, state aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, notification requirement laid down in Article 108(30) TFEU,.“ http://europa.eu. 22. 03 2013. http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26121_en.htm (Zugriff am 22. 03 2013).
—. „Commission Regulation on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid; 32001R0069/EN, Datum: 22.03.2013; 31996Y0306(01)- Commission notice on the de minimis rule for State aid (mutatis mutandis), UPDATED: JIF 15/10/2002;.“ 14. 06 2013. http://iate.europa.eu/iatediff/FindTermsByLilId.do?lilId=2108019&langId=de (Zugriff am 14. 06 2013).
Für Gründer.de. „Crowd_funding-Monitor_2012, S 1-36.“ fuer-gruender.de. Herausgeber: René S. (Hrsg.) Klein. 2012. http://www.fuer-gruender.de/fileadmin/mediapool/Unsere_Studien/Crowd_funding_2012/Crowd_funding-Monitor_2012.pdf (Zugriff am 07. 07 2013).
Filmstandort Austria. —. „filmstandort-austria.at - Richtlinien.“ 20. 06 2013. https://www.filmstandort-austria.at/upload/Richtlinien_Filmstandort_Oesterreich18122012(inkl_Anlagen)_FINAL.pdf (Zugriff am 20. 06 213).
Grünstäudl, Martin. „Leitfaden_NeuFoeg.“ 22. 05 2013. http://www.gruendungswissen.at/uploads/media/Leitfaden_NeuFoeg.pdf (Zugriff am 22. 05 2013).
—. „Teil 1: Das Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG).“ Gruendungswissen.at. Herausgeber: Gruendungswissen.at. 2013. http://www.gruendungswissen.at/uploads/media/Leitfaden_NeuFoeg.pdf (Zugriff am 30. 05 2013).
Howe, Jeff. „The Rise of Crowdsourcing.“ Herausgeber: Wired Magazine. 03. 03 2013. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (Zugriff am 03. 03 2013).
—. Wired Magazine. 14. 06 2006. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (Zugriff am 03. 03 2013).
196
ikosom. ikosom - Crowdfunding-Studie 2011. 13. 06 2011. http://www.ikosom.de/2011/06/13/crowdfunding-studie-2011/ (Zugriff am 05. 05 2013).
Kommissionspräsident Barroso. „„Politische Leitlinien für die nächste Kommission“, Pressemitteilung.“ 03. 09 2009. http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_DE.pdf (Zugriff am 08. 08 2012).
Mavellia, Clara. „Cultural Entrepreneurship: Eine Einführung.“ 26. 10 2010. http://www.cultural-entrepreneurship-institute.de/eine-einfuhrung-2/ (Zugriff am 22. 02 2013).
Pritzkow, Angela, Gabriele Schambach, und Sabine Ulbricht. „Analyse "Ich allein?! Mehr als Ich! Gründerinnen in der Kreativwirtschaft.“ Herausgeber: F3 Marketing. F3 Marketing. 2009. http://f3-kreativwirtschaft.de/fe_buch-h-print.pdf (Zugriff am 14. 06 2013).
RTR. „RTR - FFAT-Richtlinien.“ 21. 06 2013. https://www.rtr.at/de/ffat/Richtlinien (Zugriff am 21. 06 2013).
Statistik Austria. „Metadaten: Kulturfinanzierung.“ 21. 07 2013. http://www.statistik.at (Zugriff am 21. 07 2013).
—. Statcube.at. 06 2013. http://statcube.at/statistik.at/ext/superweb/setTableState.do?x_0&totals=false (Zugriff am 16. 07 2013).
—. „Statistik zur Unternehmensdemografie. Stand der Daten: Juli 2012.“ Wien, (Zugriff am 23. 07 2012). —. statistik.at. Herausgeber: Statistik Austria. 03. 02 2013. http://www.statistik.at (Zugriff am 03. 02
2013). —. „Strukturdaten.“ 21. 07 2013. http://www.statistik.at (Zugriff am 21. 07 2013). —. „Unternehmen, Arbeitsstätten.“ Unternehmensdemographie. 21. 07 2013. http://www.statistik.at
(Zugriff am 21. 07 2013). —. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 16. 07 2013.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/index.html (Zugriff am 16. 07 2013).
tech2B. „tech2b_Einladung_Startup-Mingle.pdf.“ Herausgeber: e-incubator.at. 2013. http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2013/04/tech2b_Einladung_Startup-Mingle.pdf (Zugriff am 31. 05 2013).
Utrecht School of the Arts (HKU). „Die unternehmerische Dimensionder kulturellen und kreativen Industrien.“ Herausgeber: European Commission. 13. 01 2011. http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc3124_en.htm (Zugriff am 30. 05 2013).
Van Wingerden, Ralph, und Jessica Ryan. „crowdsourcing.org.“ crowdsourcing.org. 13. 10 2011. http://www.crowdsourcing.org/document/fighting-for-funds-an-exploratory-study-into-the-field-of-crowdfunding-/6544 (Zugriff am 20. 10 2012).
Wirtschaftskammer Österreich. Konjunkturprognosen und -statistiken - WKO.at. 16. 07 2013. http://portal.wko.at/ (Zugriff am 16. 07 2013).
Sonstige Web-Dokumente
1000x1000.at. 1000x1000.at. 20. 02 2013. http://www.1000x1000.at (Zugriff am 20. 02 2013). aaia - Austrian Angel Investors Association. aaia.at. Herausgeber: aaia - Austrian Angel Investors
Association. 2013. http://www.aaia.at (Zugriff am 31. 05 2013). AFO. afo.at. 14. 12 2012. http://www.afo.at (Zugriff am 14. 12 2012). akostart. akostart. 15. 05 2013. http://www.akostart.at (Zugriff am 15. 05 2013). aoterra.de. aoterra.de. 11. 05 2013. https://www.aoterra.de (Zugriff am 11. 05 2013). APA. „APA Meldung: PK Nowotny vom 13.2.2013.“ 10. 03 2013. http://www.apa.at (Zugriff am 10. 03
2013). APA/GEA Presseaussendung vom 22.11.2013. 16. 03 2013. http://www.w4tler.at/geaneu/3041/fma-vs-
gea/apa (Zugriff am 16. 03 2013). —. Creative Region und tech2B intensivieren Zusammenarbeit. 01. 06 2013. http://e-
incubator.at/2013/04/creative-region-und-tech2b-intensivieren-zusammenarbeit/ (Zugriff am 01. 06 2013).
Ars Electronica Linz GmbH. aec.at. 04. 04 2013. http://aec.at (Zugriff am 04. 04 2013). austromechana. SKE Jahresstipendien. Herausgeber: austromechana. 2013. http://www.austromechana.at
(Zugriff am 31. 05 2013).
197
—. SKE-Fonds Grundlagen. Herausgeber: austromechana. 28. 06 2013. http://www.ske-fonds.at/show_content.php?sid=1 (Zugriff am 28. 06 2013).
aws. awsg.at. 04. 09 2012. www.awsg.at (Zugriff am 04. 09 2012). —. awsg.at/Content.Node/46841.php. 31. 05 2013.
http://www.awsg.at/Content.Node/46841.php&backid=3027237 (Zugriff am 31. 05 2013). —. awsg.at/Content.Node/79110.php. 06. 03 2013. http://www.awsg.at/Content.Node/79110.php (Zugriff
am 06. 03 2013). aws. evolve Mission Statement. 07. 03 2013. http://www.evolve.or.at/mission_statement/ (Zugriff am 07.
03 2013). —. i2. 31. 05 2013. http://i2.awsg.at (Zugriff am 31. 05 2013). aws. impulse infohour. Herausgeber: aws impulse. 22. 10 2012. http://www.awsg.at (Zugriff am 22. 10
2012). —. Service plan4you. 04. 06 2013. http://www.awsg.at/Content.Node/service/plan4you/46850.php
(Zugriff am 04. 06 203). Bank Austria Member of UniCredit. „Bank Austria - Bundesländer Überblick Oberösterreich.“ Bank Austria
Economics & Market Analysis Austria. 05 2013. http://www.bankaustria.at/mediathek-wirtschaftsanalysen-und-studien-oesterreich-analysen.jsp (Zugriff am 16. 07 2013).
Bruckneruniversität Linz. Förderverein UNIsono der Bruckneruniversität. 16. 06 2013. http://www.bruckneruni.at/Universitaet/Foerderverein-UNIsono (Zugriff am 16. 06 2013).
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK). „Mikrokreditrichtlinie.“ 2013. http://www.dermikrokredit.at (Zugriff am 22. 06 2013).
Bundesministerium für Finanzen. BMF - zu Basel III. Herausgeber: BM f. Finanzen. https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/finanz-kapitalmaerkte-eu/basel-iii.html (Zugriff am 22. 06 2013).
—. BMF.gv.at. Herausgeber: BM f. Finanzen. 17. 05 2013. http://www.bmf.gv.at (Zugriff am 17. 05 2013). —. „Liste der begünstigten Spendenempfänger.“ BMF.gv.at. Herausgeber: BM f. Finanzen. 17. 05 2013.
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Einkommensteuer/AbsetzbarkeitvonSpenden/ (Zugriff am 17. 05 2013).
—. „Sponsoringerlass von 1987.“ Herausgeber: BM f. Finanzen. 17. 05 2013. http://www.bmf.gv.at (Zugriff am 17. 05 2013).
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Herausgeber: BM f. UKK. 20. 02 2013. http://www.bmukk.gv.at (Zugriff am 20. 02 2013).
—. BMUKK - Förderungen. Herausgeber: BM f. UKK. 09. 04 2013. http://www.bmukk.gv.at/kunst/foerderungen/index.xml (Zugriff am 03. 06 2013).
—. BMUKK.gv.at. Herausgeber: BM f. UKK. 23. 02 2013. http://www.bmukk.gv.at/ministerium/preise/index.xml (Zugriff am 23. 02 2013).
—. „Glossar S-T, Soziale Förderungen.“ Herausgeber: BM f. UKK. 15. 05 2013. http://www.bmukk.gv.at/kunst/glossar_s_t.xml (Zugriff am 15. 05 2013).
—. „Glossar S-T, Sponsoring.“ Herausgeber: BM f. UKK. 02. 02 2013. http://www.bmukk.gv.at/kunst/glossar_s_t.xml (Zugriff am 02. 02 2013).
—. „Kunstförderungsgesetz 1988 BGBl. 146/1988.“ Herausgeber: BM f. UKK. 20. 05 2013. http://www.bmukk.gv.at (Zugriff am 20. 05 2013).
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. BMWFJ.gv.at. 01. 06 2013. http://www.bmwfj.gv.at/ministerium/staatspreise/seiten/default.aspx (Zugriff am 01. 06 2013).
—. Staatspreis-mulitmedia.at. 22. 02 2013. http://www.staatspreis-multimedia.at (Zugriff am 22. 02 2013).
Bundesminster für Wirtschaft, Familie und Jugend. „Staatspreis-Multimedia.“ 22. 02 2013. http://www.staatspreis-mulitmedia.at (Zugriff am 22. 02 2013).
Bundesrat. „Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages Drucksache 73/13.“ Herausgeber: Deutscher Bundesrat. 08. 02 2013. http://www.stiftungen.org/fileadmin/bvds/de/News_und_Wissen/Recht_Steuern_und_Finanzen/Reformprozess_ab_1.3.2013/Gesetz_BR_Drs.73_13.pdf (Zugriff am 20. 05 2013).
Business Angels Austria. business-angels.at. 09. 11 2012. http://www.business-angels.at (Zugriff am 09. 11 2012).
CATT Innovation Management GmbH. CATT.at. 07. 07 2013. http://www.catt.at (Zugriff am 07. 07 2013). —. www.catt.at/easy2innovate. 2012. http://www.catt.at/easy2innovate (Zugriff am 20. 09 2012). CATT. Innovationsassistent. 21. 06 2013. http://www.innovationsassistent.at (Zugriff am 21. 06 2013). Conda.at. Conda.at. 24. 05 2013. http://www.conda.at (Zugriff am 24. 05 2013).
198
creativ wirtschaft austria. Creativdepot. 13. 05 2013. https://www.creativdepot.at (Zugriff am 13. 05 2013).
Creative Community Linz. Creative Community Linz. 21. 06 2013. http://www.linz.at/wirtschaft/33299.asp (Zugriff am 21. 06 2013).
Creative Region Linz & Upper Austria. 2013. http://creativeregion.at (Zugriff am 31. 05 2013). —. „Creative Region - Projekte/open-design.“ Herausgeber: Creative Region Linz & Upper Austria. 2013.
http://creativeregion.org/projekte/open-design/ (Zugriff am 04. 04 2013). —. Creativeregion.org - Gesellschafterinnen. Herausgeber: Creative Region Linz & Upper Austria. 2013.
http://creativeregion.org/creative-region/gesellschafterinnen/# (Zugriff am 04. 04 2013). cuteacute. datadealer.com. 07. 07 2013. http://www.datadealer.com (Zugriff am 11. 07 2013). DasErtragreich.At Mgmt. GmbH. dasertragreich.at. 12. 07 2013. http://www.dasertragreich.at (Zugriff am
12. 07 2013). Denk- und Ideenschmiede querverkehr. querk.at. 12. 07 2013. http://www.querk.at (Zugriff am 12. 07
2013). Department of Revenue. „dor.wa.gov.“ Herausgeber: Department of Revenue Washington State. 2013.
http://dor.wa.gov/Content/GetAFormOrPublication/PublicationBySubject/TaxTopics/Bartering.aspx (Zugriff am 15. 06 2013).
Designstiftung Österreich. designaustria.net. Herausgeber: Designstiftung Österreich. 2013. http://www.designaustria.net (Zugriff am 23. 02 2013).
Ecodesign. ecodesign.at. Herausgeber: Wolfgang Wimmer. 2013. http://www.ecodesign.at (Zugriff am 23. 02 2013).
Erste Bank und Sparkasse. „Freie-Berufe.“ Herausgeber: Erste Bank und Sparkasse. 2013. http://www.sparkasse.at/erstebank/Freie-Berufe (Zugriff am 12. 05 2013).
evolve. evolve-Finanzierungsangebote. 07. 03 2013. http://www.evolve.or.at/more_offers/financing/ (Zugriff am 07. 03 2013).
—. evolve-weitere Angebote. 07. 09 2012. http://www.evolve.or.at/more_offers/ (Zugriff am 07. 09 2012). —. „Mission Statement.“ http://www.evolve.or.at/mission_statement (Zugriff am 07. 03 2013). Für-Gründer.de. „Crowd funding-Monitor H1 2013.“ Crowd funding-Monitor. Frankfurt am Main: Für-
Gründer.de, (Zugriff am 16. 07 2013). —. Fuer-Gruender.de. Herausgeber: René S. (Hrsg.) Klein. 07. 07 2013. http://www.fuer-
gruender.de/blog/2013/07/crowd-investing-halbjahr-2013/ (Zugriff am 07. 07 2013). FFG. http://www.ffg.at/dienstleistungsinitiative (Zugriff am 07. 03 2013). —. „FFG Homepage.“ 31. 05 2013. http://www.ffg.at (Zugriff am 31. 05 2013). —. „FFG.at - Dienstleistungsinitiative.“ 07. 03 2013. http://www.ffg.at/dienstleistungsinitiative (Zugriff
am 07. 03 2013). —. „FFG.at - Förderangebot.“ 31. 05 2013. http://www.ffg.at/foerderangebot (Zugriff am 31. 05 2013). —. „Folder - Der Innovationsscheck.“ 07. 03 2013. www.ffg.at (Zugriff am 07. 03 2013). —. Innovationsscheck Plus 10.000,- mit Selbstbehalt. 16. 06 2013.
http://www.ffg.at/innovationsscheck10000 (Zugriff am 16. 06 2013). —. Programmlinie "Kooperation und Netzwerke". 07. 03 2013. http://www.ffg.at/print/5244 (Zugriff am
07. 03 2013). FH OÖ. fh-ooe.at. 16. 06 2013. http://www.fh-ooe.at/forschung-
kooperation/kooperation/foerdervereine/ (Zugriff am 16. 06 2013). Filmstandort Austria. „filmstandort-austria.at - Eigenschaftstest.“ 20. 06 2013. https://www.filmstandort-
austria.at/foerderung/eigenschaftstest/ (Zugriff am 20. 06 2013). Filmstandort-Austria. „filmstandort-austria.at - Förderungen/Ablauf.“ 20. 06 2013.
https://www.filmstandort-austria.at/foerderung/ablauf/ (Zugriff am 20. 06 2013). flattr.com. how flattr works. 13. 06 2013. http://flattr.com/howflattrworks (Zugriff am 13. 06 2013). FSWE Verein zur Förderung des Sozial- und Wirtschaftslebens in Europa. jumpandup. Herausgeber: FSWE.
17. 05 2013. http://www.jumpandup.com (Zugriff am 17. 05 2013). GeoGebra / Hohenwarter. GeoGebra.org. 20. 08 2012. http://www.geogebra.org/cms/de/ (Zugriff am 07.
07 2013). Gründerservice, WKO. 28. 05 2013. http://www.gruenderservice.at/startseite.wk (Zugriff am 28. 05
2013). Innovation. innovation.co.at. Herausgeber: Willfort. 23. 02 2013. http://www.innovation.co.at/MS_12.html
(Zugriff am 23. 02 2013). Innovation.at/GF. Willfort. Innovation.at. 12. 07 2013. http://innovation.at (Zugriff am 12. 07 2013). Intuit. Intuit Small Business Blog. 2013. http://blog.intuit.com/trends/crowd-power-what-is-
crowdfunding-infographic/ (Zugriff am 07. 07 2013).
199
Investitionsbank Berlin. „Presseaussendung vom 19.05.2008.“ Herausgeber: Investitionsbank Berlin. 19. 05 2008. http://www.ibb.de/ (Zugriff am 14. 06 2013).
Junge Wirtschaft. JungeWirtschaft.at. 22. 06 2013. (http://www.jungewirtschaft.at/startseite.wk?chid=16 (Zugriff am 22. 06 2013).
Kepler Universität Linz. JKU - StartUp. 05. 25 2013. http://www.jku.at/startup/content/e108354/ (Zugriff am 05. 25 2013).
—. JKU-StarUp. 25. 05 2013. http://www.jku.at/startup/content (Zugriff am 25. 05 2013). KGG-UBG. 2012. http://www.kgg-ubg.at (Zugriff am 10. 11 2012). kickstarter. kickstarter/datadealer. 07. 07 2013. http://www.kickstarter.com/projects/cuteacute/data-
dealer (Zugriff am 12. 07 2013). —. kickstarter/GeoGebra. 20. 08 2012. http://www.kickstarter.com/projects/geogebra/geogebra-for-the-
ipad (Zugriff am 20. 10 2012). —. kickstarter/SIERRA-ZULU. 03. 07 2012. http://www.kickstarter.com/projects/monochrom/sierra-zulu
(Zugriff am 03. 08 2012). kraudmob.com. kraudmob.com. 20. 05 2013. http://kraudmob.com (Zugriff am 20. 05 2013). KUPF. kupf.at. 14. 12 2012. http://kupf.at (Zugriff am 14. 12 2012). —. Clusterland.at. Herausgeber: Land OÖ. 2013. http://www.clusterland.at/740_DEU_HTML.php (Zugriff
am 04. 04 2013). —. „KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht / Europäische Kommission ABl. L124 vom 20.5.2003, S.
36 ff.“ Land OÖ. Europäische Kommission. 23. 02 2013. http://www.land-ooe.gv.at (Zugriff am 23. 02 2013).
—. „KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht.“ Herausgeber: Land OÖ. 20. 05 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at (Zugriff am 20. 05 2013).
—. Land OÖ - JungunternehmerInnenförderung. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/26533_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land OÖ. - Bürgschaften. Herausgeber: Land OÖ. 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/25872_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land OÖ. - InnovationsassistentInnen/-beraterInnen für KMU. Herausgeber: Land OÖ. 21. 06 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/25158_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land OÖ. - Standardbeteiligung. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/26541_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land Oberösterreich - Wirtschaftsförderungen. Herausgeber: Land OÖ. 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/22693_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land Oberösterreich - Kulturförderung. 2012. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/32554_DEU_HTML.htm (Zugriff am 18. 10 2012).
—. Land Oberösterreich - OÖ. Gründerfonds. Herausgeber: Land OÖ. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/26542_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land Oberösterreich - Wirtschaftsimpulsprogramm für materielle Investitionen 2011 - 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/26536_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
—. Land Oberösterreich Förderungen. 2012. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12835_DEU_HTML.htm (Zugriff am 18. 10 2012).
—. Landeskulturpreis für Kunst im interkulturellen Dialog 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/118476_DEU_HTML.htm (Zugriff am 18. 10 2012).
—. Land-OÖ. - Innovationsasstistent. 21. 06 2013. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/90893_DEU_HTML.htm (Zugriff am 21. 06 2013).
Lemberger, Ellen, ORF Ö1. „"Crowdfunding" vom 08.03.2013.“ 08. 03 2013. http://oe1.orf.at/artikel/333619 (Zugriff am 08. 03 2013).
Magora Group GmbH. „magora.com.“ Herausgeber: Magora Group GmbH. 2013. http://www.magora.com/headernav/venture-capital/ (Zugriff am 01. 03 2013).
massolution - Crowdfunding Industry Report 2011. crowdsourcing.org. 07. 07 2013. http://www.crowdsourcing.org/editorial/total-global-crowdfunding-to-nearly-double-in-2012-to-3b-massolution-research-report/14287 (Zugriff am 07. 07 2013).
media4equity Invest GmbH. „media4equity.com.“ Herausgeber: media4equity Invest GmbH. 04 2013. http://media4equity.com (Zugriff am 31. 05 2013).
monochrom. www.sierra-zulu.com. 03. 07 2012. http://www.sierra-zulu.com/about-sierra-zulu/story/ (Zugriff am 03. 08 2012).
200
Netzwerk Design & Medien. CDi. http://www.netzwerk-design.at/1125_DEU_HTML.php (Zugriff am 21. 06 2013).
—. easy2innovate - OÖ. Kooperationsförderung KMU. http://www.netzwerk-design.at/573_DEU_HTML.php (Zugriff am 13. 06 2013).
—. Einzelprojektförderungen. http://www.netzwerk-design.at/572_DEU_HTML.php (Zugriff am 20. 09 2012).
Netzwerk iNNO iNi. innoini.at. Herausgeber: StartUp-Netzwerk iNNO iNi. 2013. http://innoini.at (Zugriff am 31. 05 2013).
Netzwerk-Design. Netzwerk-Design - Datenbank. 11. 01 2013. http://www.netzwerk-design.at/1311_DEU_HTML.php (Zugriff am 31. 05 2013).
—. Netzwerk-Design. 20. 06 2013. http://www.netzwerk-design.at/1311_DEU_HTML.php (Zugriff am 20. 06 2013).
Neurovation.net. Neurovation. 05. 05 2013. http://neurovation.net (Zugriff am 05. 05 2013). oe1.orf.at. ö1. 08. 03 2013. http://oe1.orf.at/artikel/333619 (Zugriff am 08. 03 2013). Österreichisches Filministitut. „Filministitut - Media-Desk.“ 20. 06 2013.
http://www.filminstitut.at/de/media-desk/ (Zugriff am 20. 06 2013). Österreichisches Filminstitut. „Förderung der Stoffentwicklung.“ Herausgeber: Roland Teichmann. 04. 04
2013. http://www.filminstitut.at/de/richtlinien/ (Zugriff am 04. 04 2013). —. filministitut.at. 20. 06 2013. http://www.filministitut.at/de/menu97/ (Zugriff am 20. 06 2013). OK Centrum. ok-centrum/okfriends/traumstipendium. 2013. http://www.ok-centrum.at (Zugriff am 14. 06
2013). OTELO. 2012. http://www.otelo.or.at (Zugriff am 20. 09 2012). Parlament. „BCI Barter 5095/J und 5035/AB.“ Herausgeber: Österreichisches Parlament. 2013.
http://www.parlament.g.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_05095/index.shtml (Zugriff am 15. 06 2013). respekt.net. respekt.net. 18. 05 2013. http://www.respekt.net (Zugriff am 18. 05 2013). RTR. 23. 06 2013. https://www.rtr.at (Zugriff am 23. 06 2013). —. RTR - Förderungen. 23. 06 2013. https://www.rtr.at/de/foe/Foerderungen (Zugriff am 23. 06 2013). —. RTR - Fernsehfonds. 20. 06 2013. https://www.rtr.at/de/ffat/Fernsehfonds (Zugriff am 20. 06 2013). seedcamp. „seedcamp.com.“ Herausgeber: Saul Klein. 2013. http://seedcamp.com (Zugriff am 20. 05
2013). SpeedInvest GmbH. speedinvest.com. Herausgeber: SpeedInvest GmbH. 2012.
http://speedinvest.com/idea/ (Zugriff am 31. 05 2013). Starteurope. starteurope.at. Herausgeber: Andreas Tschas. 2013. http://starteurope.at (Zugriff am 21. 05
2013). startnext.de. startnext.de. 02. 02 2013. http://www.startnext.de (Zugriff am 02. 02 2013). tech2b Inkubator GmbH. tech2b.at. Herausgeber: tech2b Inkubator GmbH. 2013. http://www.tech2b.at
(Zugriff am 31. 05 2013). Verein zur Förderung des Sozial- und Wirtschaftslebens in Europa (FSWE). jumpandup. 12. 07 2013.
http://www.jumpandup.com (Zugriff am 12. 07 2013). Vertical Media GmbH. Barterin. Herausgeber: Vertical Media GmbH. 2013.
http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/bartering (Zugriff am 16. 06 2013). Volksbank Bühl. Volksbank Bühl - Viele schaffen mehr. 12. 06 2013. http://volksbank-buehl.viele-schaffen-
mehr.de/ (Zugriff am 12. 06 2013). wemakeit.ch. wemakeit.ch. 13. 05 2013. http://wemakeit.ch (Zugriff am 13. 05 2013). Wirtschaftskammer Österreich. 02. 06 2013.
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=655200&dstid=686, (Zugriff am 02. 06 2013).
—. „creativ wirtschaft austria.“ 07. 03 2013. http://www.creativwirtschaft.at (Zugriff am 07. 03 2013). —. „creativ wirtschaft.at.“ 10. 11 2012. (Zugriff am 10. 11 2012). —. evolve - Kooperationen und Netzwerke. 07. 03 2013.
http://www.evolve.or.at/more_offers/cooperations_networks/index.php#0304 (Zugriff am 07. 03 2013).
—. Evolve - Netzwerk. 10. 11 2012. http://www.evolve.or.at/network (Zugriff am 10. 11 2012). —. „Evolve - Organisations.“ 07. 02 2013. http://www.evolve.or.at/network/organisations/ (Zugriff am
07. 02 2013). —. „Evolve.“ 02. 02 2013. http://www.evolve.or.at (Zugriff am 02. 02 2013). —. evolve.or.at - Netzwerkpartner. 07. 03 2013. http://www.evolve.or.at/network/partners (Zugriff am 07.
03 2013).
201
—. Förderungsservice - Jungunternehmerförderung. 02. 05 2013. http://www.foerderungsservice.at/jungunternehmerfoerderungen.php (Zugriff am 02. 05 2013).
—. Förderungsservice.at - Jungunternehmerförderungen. 02. 05 2013. http://www.foerderungsservice.at/jungunternehmerfoerderungen.php (Zugriff am 02. 05 2013).
—. Gründerservice. 31. 05 2013. http://www.gruenderservice.at, Abfrage vom 31.05.2013 (Zugriff am 31. 05 2013).
—. „Portal WKO - Fördermöglichkeiten für Jungunternehmer.“ 02. 06 2013. http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=655200&dstid=686 (Zugriff am 02. 06 2013).
—. „Preise und Auszeichnungen.“ Herausgeber: Wirtschaftskammer Österreich. 13. 02 2013. http://wko.at (Zugriff am 13. 02 2013).
—. „Unternehmerservice.at.“ 22. 11 2012. http://www.unternehmerservice.at (Zugriff am 22. 11 2012). —. WKO - Neufög. Herausgeber: WKO. 13. 05 2013.
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=421851&DstID=714&titel=NEUFÖG,-,Neugründungsförderung (Zugriff am 13. 05 2013).
—. WKO Portal - Plan4You. 03. 06 2013. http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=564356&DstID=686 (Zugriff am 03. 06 2013).
—. WKO Portal. Herausgeber: Wirtschaftskammer Österreich. 30. 05 2013. http://wko.at (Zugriff am 30. 05 2013).
—. WKO Portal/OÖ. 13. 05 2013. http://portal.wko.at/wk/startseite_dst.wk?ftyp=2&dstid=678 (Zugriff am 13. 05 2013).
—. wko.at/wien/webnett/. 23. 02 2013. http://www.wko.at/wien/webnett/ (Zugriff am 23. 02 2013). Wirtschaftskammer Österreich, creativ wirtschaft austria. „creativ wirtschaft austria.“ 07. 09 2012.
http://www.creativwirtschaft.at/aktuelles/32177 (Zugriff am 07. 09 2012). —. evolve - Network. 07. 03 2013. http://www.evolve.or.at/network/partners, Abfrage vom 07.03.2013
(Zugriff am 07. 03 2013). Wirtschaftskammer Österreich, Filmforum Linz. 13. 06 2013. http://www.filmforumlinz.at (Zugriff am 13.
06 2013). WZW. WZW.at. 23. 02 2013. http://www.wzw.at/frames.htm (Zugriff am 23. 02 2013). Zentrales Förderungsservice, WKO Steiermark. Zentrales Förderungsservice. 02. 05 2013.
http://www.foerderungsservice.at/jungunternehmerfoerderungen.php (Zugriff am 02. 05 2013).
Sonstige Dokumente aws. (2012). Folder VINCI, Vouchers in Creative Industries. Wien: aws. aws impulse. (01. 12 2011). Fragen & Fakten - impulse LEAD. (a. impulse, Hrsg.) Wien. aws impulse. (01. 12 2011). Fragen & Fakten - impulse XL. (a. impulse, Hrsg.) Wien. aws impulse. (01. 12 2011). Fragen & Fakten - impulse XS. (a. impulse, Hrsg.) Wien. aws, erp-fonds. (22. 10 2012). i2 - Die Börse für Business Angels. Kurzinformation für Förderungswerber
ab 1. Jänner 2007 , 2. Auflage. (a. erp-fonds, Hrsg.) Wien: aws, erp-fonds. aws erp-fonds. „Markt- & Technologierecherchen - Tecnet.“ Kurzinformation ab 1. Jänner 2008.
Herausgeber: aws erp-fonds. Wien: aws erp-fonds, 2012. aws, erp-fonds. (2012). Sparen mit Gründungsbonus. Kurzinformation für Förderungswerber ab 1. Jänner
2007 , 1. Auflage. (a. erp-fonds, Hrsg.) Bartos, P. (16. 11 2012). Finanzierung der Kreativwirtschaft in OÖ. (DK, Interviewer) Christl, W. (12. 07 2013). Crowdfunding für Data Dealer. (DK, Interviewer) creativ wirtschaft austria HOTLINE. (22. 02 2013). mögliche Förderungen für oberösterreichische
Kreativwirtschaft. Hotline: creativ wirtschaft austria. Creative Community. (2009). Folder Creative Community. (W. d. Linz, Hrsg.) Linz. Der Standard. (13. 02 2013). Polit-Bemühungen um legales Crowdfunding. Der Standard. erp-fonds, a. (2012). ERP-Kleinkredit. Kurzinformation für Förderungswerber (2. Ausgabe) . (a. erp-fonds,
Hrsg.) erp-fonds, a. (2012). Haftungen für Mikrokredite für kleine Unternehmen. Kurzinformation für
Förderungswerber ab 19. Mai 2009 , 1. Auflage. (a. erp-fonds, Hrsg.) Wien: aws, erp-fonds. erp-fonds, a. (2012). KMU-Innovationsförderung "Unternehmensdynamik". Kurzinformation für
Förderungswerber ab 19. Mai 2009 , 1. Auflage. (a. erp-fonds, Hrsg.)
202
Europäische Kommission. (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions. Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU. Brüssel.
Europäische Kommission. (26. 09 2012). Die Kultur- und Kreativwirtschaft als Motor für Wachstum und Beschäftigung in der EU unterstützen. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen . Brüssel: COM (2012) 537 final.
Europäische Kommission. (2012). Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft als Motor für Wachstum und Beschäftigung in der EU zu unterstützen. Brüssel.
Europäische Kommission. (2010). KOM (2010) 183/3, Grünbuch. Erschließung des Potentials der Kultur- und Kreativindustrien; z.n.: Mitteilung der Kommission "Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum". Brüssel: KOM (2010) 2020.
Europäische Kommission. (2010). Mitteilung der Kommission "Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum". (K. 2020, Hrsg.) Brüssel.
Europäische Kommission. (2010). The European Agenda for Culture - progress towards shared goals (Bd. COM (2010)390). (E. Kommission, Hrsg.) Brussels: SEC(2010)904.
Europäische Kommission. (2009). Arbeitsdokument der Kommission: "Challanges for EU support to innovation services - Fostering new markets and jobs through innovation". (SEC(2009)1195, Hrsg.) Brüssel.
Europäische Kommission. (1998). Kultur, Kulturwirtschaft und Beschäftigung. GD X und V, Brüssel. Fronz, C., & Konrad, E. (2012). Hemmnisse bei der Kapitalakquise - Eine Analyse der kritischen
Einflussfaktoren der Gründungsfinanzierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Untersuchung aus Forschungsprojekt . Mainz: Institut für unternehmerisches Handeln der FH Mainz.
Fundraising Verband Austria. (2010). Spendenbericht 2010. (F. V. Austria, Hrsg.) Wien. Gräfe, B. (2010). Kulturwirtschaftsbericht für Bremen. In B. Senat (Hrsg.), Mitteilungen des Senats, (S. 16).
Bremen. Grenzfurtner, J. (28. 08 2012). Crowdfunding für Sierra Zulu. (DK, Interviewer) Gumpelmaier, W. (28. 08 2012). Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für die Kreativwirtschaft OÖ.
(DK, Interviewer) Henner-Fehr, C. (25. 07 2012). Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für die Kreativwirtschaft OÖ.
(DK, Interviewer) Hohenwarter, M. (25. 09 2012). Crowdfunding/ Finanzierung von GeoGebra. (DK, Interviewer) Junge Wirtschaft Österreich. (2012). Angels, VC & Co. Alternative Finanzierungen abseits von Banken und
Förderungen. (W. G. Junge Wirtschaft Österreich, Hrsg.) Kepplinger, R., & Haas, K. (28. 03 2013). Die Zeit ist reif! Grüne Erde . Scharnstein. Werbematerial Kovska-Sagmeister, B. (08. 11 2012). Finanzierung der Kreativwirtschaft in OÖ. (DK, Interviewer) Kraus, S. (2011). Entrepreneurship Einführung. 25. Linz. Paper. Langwieser, A. (2012). Vortrag zu Alternative Finanzierungs- und Förderinstrumente. Linz: JW OÖ, WKOÖ. Litzka, B. (08. 11 2012). Vortrag zu Alternative Finanzierungs- und Förderinstrumente. Linz: JW OÖ, WKOÖ. Remplbauer. (08.11.2012). Vortrag zu Alternative Finanzierungs- und Förderinstrumente. Linz: JW OÖ,
WKOÖ. Stadt Stuttgart, A. f. (2010). Crowdfunding, Mikrofinanzierung Flattr & Co. Ein Überblick über neuartige
Finanzierungsformen für Kreativprojekte. Stuttgart. Statistik Austria. (23. 07 2012). Statistik zur Unternehmensdemografie. Stand der Daten: Juli 2012. Wien. Tiefenböck, R. (21. 06 2013). Expertenbefragung Finanzierung der Kreativwirtschaft. (DK, Interviewer) Tremetsberger, O. (17. 09 2012). Interview zur Finanzierung von Radio Fro. Linz. (DK, Interviewer) UNIDO and UNESCO. (2005). Creative Industries and Micro & Small Scale Enterprise Development. A
Contribution to Poverty Alleviation. Project XP/RAS/05/002 As a Joint Initiative. (P. S. Division, Hrsg.)
Weiß. (30. 10 2012). Kreativwirtschaft in OÖ., akostart. (DK, Interviewer) Wirtschaftskammer Österreich. (2012). Angels, VC & Co. Alternative Finanzierungen abseits von Banken
und Förderungen. (J. Wirtschaft, Hrsg.) Wien. Wirtschaftskammer NÖ. (12. 04 2013). Besserer Zugang zu alternativer Finanzierung.
Niederösterreichische Wirtschaft , 15 . (WKNÖ, Hrsg.) St. Pölten: WKNÖ. Wirtschaftskammer Niederösterreich. (05. 07 2013). Das ist neu bei der GmbH. Niederösterreichische
Wirtschaft (27), S. 10.
203
Richtlinien und Gesetzestexte
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen. (18. 12 2012). Filmstandort Österreich. Förderungsrichtlinien . (B. f. WFJ, Hrsg.) Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. (Mai 2010). Programmteil impulse.
Förderungsmaßnahmen impulse XL und impulse XS. Sonderrichtlinien des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen . (B. f. WFJ, Hrsg.) Wien.
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. (12/2009). Programmteil impulse/Fördermaßnahme impulse LEAD. Sonderrichtlinien für das Programm zur Innovationsförderung im Bereich Kreativwirtschaft (evolve) im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen . (B. f. WFJ, Hrsg.) Wien.
Europäische Kommission. (2013). VO 69/2001 KOM Anwendung Art. 87 u. 88 EGV auf "De-minimis"-Beihilfen, ABl. L_10/2001, S.30 (Bde. ABl. L_10/2001, S.30). Brüssel: EC.
Abgabenordnung (AO) §§ 51 - 68 i. d. Fassung des Ehrenamtsstärkungsgesetzes . Abgabenordnung (AO) i.d. Fassungdes Ehrenamtsstärkungsgesetzes . DE. 2013
Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich (i.d. aktuellen Fassung). (L. Oberösterreich, Hrsg.) Linz. 2008
OÖ. Kulturförderungsgesetz vom 2.10.1987 über die Förderung der Kultur in Oberösterreich i.d.F. Nr. 140/2011. (L. Oberösterreich, Hrsg.) Linz. 2011
UrhGNov 1980, BGBL 321/80. Urheberrechtsgesetzesnovelle 1980 . Wien. VerwGesG 2005 § 13;. § 13 VerwGesG 2005 iVm § 42b (5) UrhGNov 2003 in der Fassung der UrhGNov
2005. Wien.
205
8 ANHÄNGE
Anhang I – Liste der interviewten Experten
Anhang II – Liste der interviewten Kreativen
Anhang III - Interviewleitfaden
Anhang IV – Önace / Statistik Austria
Anhang IVb – Strukturdaten 2011 / Statistik Austria
Anhang V – sonstige Wirtschaftsförderung der aws
Anhang VI – Kunstförderung und Kulturförderung
Anhang VII – Förderrichtlinien – Referenzfilmförderung
Anhang VIII – weitere Netzwerke
Anhang VIX - ausgewählte Crowdfunding-Plattformen
207
Anhang I: Liste der interviewten Experten
Mit folgenden Personen wurden im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit qualitative
Interviews durchgeführt, ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Interviewte ExpertInnen:
Patrick Bartos (Creative Region Linz & Oberösterreich)
Nikolaus Dürk (X-Net)
Wolfgang Gumpelmaier (GumpelMEDIA)
Christian Henner-Fehr (Crowdfunding- u. Kulturförderungsexperte berät u.a. aws und
Kulturkontakt Austria)
Barbara Kovsca-Sagmeister (Creative Community Linz)
Bernd Litzka (aws Programmmanager Business Angels Matching Services)
Petra Riegler (aws „Impulse“)
Rainer Tiefenböck (Tiefenböck Steuerberatung/Unternehmensberatung)
Gerold Weiß (AKOSTART)
erfolgreiche kickstarter:
Wolfie Christl (cuteacute, erfolgreicher Kickstarter, Wien)
Johannes Grenzfurtner (monochrom, erfolgreicher Kickstarter, Wien)
Markus Hohenwarter (geogebra, erfolgreicher Kickstarter, Linz)
209
Anhang II: Liste der interviewten Kreativen
Mit folgenden Personen wurden im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit qualitative
Interviews durchgeführt, ihnen allen sei an dieser Stellle nochmals herzlich gedankt.
Die Liste der Interviewten Kreativen:
Architektur/Interdisziplinär/Künstler/Designer Markus Jeschaunig
Architektur Jürgen Haller (any-time)
Architektur/Ausstellungen
Baukultur/Architekturjournalismus Thomas Moser (Architektur & Kommunikation, landluft)
Architektur/dzt. Ausstellungsgestaltung, Journalistisches Tobias Hagleitner (nextroom.at)
Architektur/Design Christoph Fürst
Architektur/Fotographie Dietmar Tollerian
Design/Kunst am Bau Gerhard Bogner
Dokumentarfilm/Künstlerin Ella Raidel
Filmwirtschaft Mario Hauser (Prime Production, Media Art)
Filmwirtschaft/Design Hansjörg Mikesch
Industrial Design Marek Gut (March Gut industrial design OG)
Mode Wolfgang Langeder (UTOPE)
Musik – DJ
Musik – Label
Johannes Staudinger
Sabine Köfler
PR Walter Stromberger (Werbeagentur KES)
PR Wolfgang Gumpelmaier
PR/Kultur Thomas Diesenreiter
Radio Udo Danielczyk u. Sabine Köfler (radio fro)
Radio/Fernsehen Otto Tremetsberger (dorf.tv, Radio Freistadt)
Software Markus Hohenwarter (geogebra)
Software Nikolaus Dürk (X-Net)
Software/eigentlich Hardware Richard Ebner (isiqiri)
Software Sandor Herramhof (Evntogram)
Spieleentwicklung/Software
AV Hardware
Alexander Seifert (pro3games)
Reinhold Stumpfl (AVStumpfl GmbH)
Im Rahmen der Veranstaltung „THINK OUT LOUD #2“ – Crowdfunding – Get Your Stuff Financed
von 15. bis 16. November 2012 in der Tabakfabrik Linz, wurden weitere Gespräche mit
folgenden Personen geführt:
210
Jenny Gand, Filmemacherin, Kurzfilm: „Schneeglöckchen“490
Madeleine Plass, studiert Design, Möbelprojekt: Kinderhochstuhl
Robi Faustmann und Lisa Keiner, Filmprojekt: „Keiner mag Faustmann“491
Karl Martin Pold und Sarah Nörenberg, Dokumentarfilmprojekt: „Sie nannten ihn Spencer“492
490 3.180 Euro erreicht, geplant waren 3.000 Euro Crowdfunding; http://www.startnext.at/schneegloeckchen und
http://www.schneegloeckchen.at/Schneegloeckchen_-_Ein_Film_von_Jenny_Gand/home.html (Abfrage vom
10.02.2013)
491 3.171 Euro erreicht, geplant waren 3.000 Euro Crowdfunding; http://www.keinermagfaustmann.com,
http://www.startnext.de/keinermagfaustmann/blog/ (Abfrage vom 10.02.2013)
492 8.177 Euro erreicht, geplanten waren 5.000 Euro Crowdfunding, http://www.startnext.de/budspencermovie,
(Abfrage vom 10.02.13)
211
Anhang III: Interviewleitfaden
Introfragen:
In welchem Bereich der Creative Industries sind Sie tätig?
Seit wann?
Sind Sie ein/e AlleinunternehmerIn? (Rechtsform?/Kooperation mit?)
Wieviele MitarbeiterInnen haben Sie?
Von wievielen Freelancer werden Sie unterstützt?
Von wievielen Ehrenamtlichen werden Sie unterstützt?
Kernfragen:
Wie finanzieren Sie sich?
Welche Finanzierungsformen kennen Sie?
Welche Finanzierungsmöglichkeiten wenden Sie an?
Was sind/waren Beweggründe für (Förderansuchen von Land und Bund? – EU?)
Welche Finanzierungsformen machen aus Ihren Augen Sinn für Ihre Vorhaben?
Welche praktischen Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Gibt es Wachstumsziele?
Welches Finanzierungsziel haben Sie für das nächste Jahr? Für die nächsten 5 Jahre?
Welchen jährlichen Finanzbedarf suchen Sie zu decken?
Ist hierin ein Betrag für Ihre Arbeitsleistung einberechnet?
Wie setzt sich die Finanzierung Ihrer Gesamtvorhaben/Jahr derzeit zusammen – Bitte Angabe in
Prozent:
Wie wird sie sich zukünftig zusammensetzen – Bitte Angaben in Prozent?
212
Derzeit Family, Friends and Foolhardy Investors (FFF) Förderungen, eigenes Erspartes, so. Private Mittel Sachleistungen Tauschgeschäfte /ehrenamtliches, und Mittel durch Eigenleistung (Verkauf der DL oder Produkts)
– und zukünftig
ausmachen werden.
Wann/welche Phasen der Unternehmerschaft brauchen Sie/brauchten Sie von wem welche
Mittel?
Ist Ihre finanzielle Lage (als Person, für das Projekt, das Unternehmen) typisch für Ihren Bereich
der Creative Industries?
Haben Sie schon einmal von Crowdfunding gehört ?
In welchem Zusammenhang?
Haben Sie bereits Crowdfunding als Finanzierungsinstrument angewandt?
Was sind/waren die Beweggründe?
Handelte es sich um eine Projektförderung?
War dies erfolgreich?
Warum ja – warum nicht?
Was waren (was meinen Sie sind) die Fallstricke Ihres bisherigen Bemühens um Crowdfunding?
(Welche positiven, welche negativen Erfahrungen haben Sie gemacht?)
Welche Chancen liegen für Sie im Crowdfunding?
Welche Risken liegen für Sie im Crowdfunding?
213
Was sind Ihrer Meinung nach die Voraussetzungen um Crowdfunding anwenden zu können?
(gegebenenfalls Welches Know-how, welche Vorkehrungen, .... brauchen Sie für einen nächsten
Versuch?
Werden Sie zukünftig Crowdfunding (wieder) anwenden?
In welchen Bereichen (Information, Finanzierung, Förderungen, Weiterbildung, Netzwerke, ...)
haben Sie Bedarf an Unterstützung? (Bitte breiter ausführen!)
Zu welchen Themen haben Sie im Bereich Weiterbildung Bedarf?
In welcher Art erwarten Sie Unterstützung durch öffentliche Förderstellen wie beispielsweise
von der Creative Region Linz u. OÖ?
Unterstützen Sie selbst Vorhaben mittels Spenden oder Arbeitskraft, Ihr eigenes Netzwerk, ...
(nutzen Sie als Investor Crowdfunding-Plattformen?)
Was bestimmt Ihre Standortwahl? (Warum sind sie in OÖ, .... tätig?)
215
Anhang IV: Önace / Statistik Austria
Die Wirtschaftstätigkeitenklassifikation ÖNACE 2008
Die ÖNACE 2008 ist die nationale Fassung der auf europäischer Ebene geltenden Systematik der
Wirtschaftszweige NACE Rev.2 (Das Akronym „NACE“ leitet sich aus der französischen Bezeichnung der
Europäischen Wirtschaftstätigkeitenklassifikation ab Nomenclature générale des activités économiques
dans les communautés européenes). Diese trat per Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 (ABl. Nr. L391/ vom 30. Dezember 2006, S. 1) am 1.
Jänner 2008 in Kraft.
Die ÖNACE 2008 ist eine alle Wirtschaftstätigkeiten umfassende, hierarchisch strukturierte statistische
Klassifikation. Die Elemente der ÖNACE 2008 sind auf der untersten hierarchischen Ebene
("Unterklassen") durch einen fünfstelligen Code (z.B. "10.71-2", "43.32-2", "47.71-0") und einen Titel (z.B.
"Herstellung von Zuckerbäcker- und Konditorwaren", "Bauschlosserei", "Einzelhandel mit Bekleidung")
gekennzeichnet. Die Inhalte jedes Elements sind durch Erläuterungen beschrieben und definiert ("diese
Unterklasse umfasst ...", "diese Unterklasse umfasst ferner ...", "diese Unterklasse umfasst nicht ...").
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Erläuterungstexte nicht alle Tätigkeiten
einer Unterklasse aufzählen, sondern sich auf die wesentlichsten Tätigkeiten, die einer Unterklasse
zugeordnet sind, beschränken. Sie finden alle ÖNACE-Codes, deren Bezeichnungen und Erläuterungstexte
sowie ein rund 25.500 Begriffe umfassendes Alphabetikum in unserer Klassifikationsdatenbank.
Vorgehensweise bei der klassifikatorischen Zuordnung
Jedes Unternehmen ist - entsprechend der ausgeübten Wirtschaftstätigkeit(en) - einer Unterklasse der
ÖNACE 2008 im Register der Statistik Austria zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Basis der tatsächlich
ausgeübten Tätigkeiten. Werden nur Tätigkeiten ausgeübt, die zu einer Unterklasse der ÖNACE 2008
gehören, ist die Zuordnung einfach. Werden jedoch Tätigkeiten ausgeübt, die in verschiedene
Unterklassen der ÖNACE 2008 fallen, ist der wirtschaftliche Schwerpunkt zu bestimmen.
Als Hilfsgröße zur Bestimmung des wirtschaftlichen Schwerpunktes eines Unternehmens wird dabei der
der Anteil des Umsatzes der erzeugten Produkte bzw. der erbrachten Dienstleistungen herangezogen.
Der wirtschaftliche Schwerpunkt eines Unternehmens kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern. In
diesem Fall ist auch die klassifikatorische Zuordnung zu korrigieren.
ENTNOMMEN:
http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/klassifikationsmitteilung/beschreibung/index.html (Abfrage vom
08.03.2013)
216
ABLEITUNG FÜR DIE KREATIVWIRTSCHAFT:
Die creativwirtschaft austria hat im Vierten Österreichischen Kreativwirtschaftbericht 2010 die
von der Statistik Austria definierten ÖNACE Codes die Kreativwirtschaft betreffend, wie folgt
zusammengestellt. Nach dieser Einteilung richten sich die meisten statistischen Auswertungen
in Bezug auf Kreativwirtschaft.
„Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Branchen in welchem Ausmaß in die Darstellung der
Kreativwirtschaft Österreichs einfließen. Diese Abgrenzung war auch Grundlage für die durchgeführte
Primärerhebung.“493
Architektur
71110 Architekturburos
Design
74100 Ateliers fur Textil-, Schmuck-, Grafik- u.a. Design
Musik, Buch und künstlerische Tätigkeit
47591 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien
47610 Einzelhandel mit Buchern
47789 Kunsteinzelhandel als Teil (19 %) von „Sonstiger Einzelhandel a.n.g. in Verkaufsraumen (ohne Antiquitaten und Gebrauchtwaren)“
59200 Tonstudios; Herstellung von Horfunkbeitragen; Verlegen von bespielten Tontragern und Musikalien
85521 Tanzschulen
85529 Sonstiger Kulturunterricht
90010 Darstellende Kunst
90020 Erbringung von Dienstleistungen fur die darstellende Kunst
90030 Kunstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
90040 Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen
Radio und TV
60100 HorfunkveranstalterIn
60200 FernsehveranstalterIn
Software und Games
58210 Verlegen von Computerspielen
58290 Verlegen von sonstiger Software
62010 Programmierungstatigkeiten
62020 Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
62090 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Verlage
5811 Verlegen von Buchern
5812 Verlegen von Adressbuchern und Verzeichnissen
5813 Verlegen von Zeitungen
493 (KMU-Forschung Austria, 2013, S 139)
217
5814 Verlegen von Zeitschriften
5819 Sonstiges Verlagswesen (ohne Software)
Video und Film
5911 Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
5912 Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik
5913 Filmverleih und -vertrieb (ohne Videotheken)
5914 Kinos
Werbung
73111 Werbegestaltung
73112 Werbemittelverbreitung
73120 Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflachen
Bibliotheken, Museen sowie botanische und zoologische Gärten*
91010 Bibliotheken und Archive
91020 Museen
91030 Betrieb von historischen Statten und Gebauden und ahnlichen Attraktionen
91040 Botanische und zoologische Garten sowie Naturparks Anmerkung: *Dieser Bereich wurde in die Strukturdaten nicht miteinbezogen, da nur ein geringer Teil zur Privatwirtschaft zählt und daher Daten nur in eingeschränktem Maß verfügbar sind.
Tabelle 33: Abgrenzung von Kreativwirtschaft nach ÖNACE 2008494
494 Quelle: creativ wirtschaft austria 2010. (KMU-Forschung Austria, 2010, S. 139ff) und (KMU-Forschung Austria, 2013,
S 183ff)
Anhang IVb: Strukturdaten 2011 / Statistik Austria
Hauptergebnisse im Dienstleistungsbereich 2011 nach Klassen (4-Stellern) der ÖNACE 2008
ÖNACE
2008 Kurzbezeichnung NA
1 NA2
NA3
NA4
NACE-
Stufe
Unter- nehme
n
Beschäftigte im
Jahres- durchsch
nitt insgesa
mt
darunter unselbst
.
Personal- aufwand in 1.000
EUR
Erlöse und Erträge in 1.000
EUR*
Umsatz- erlöse
in 1.000 EUR*
Produktions-
wert in 1.000
EUR*
Waren- und Dienstleistu
ngs- käufe 1)
insgesamt in 1.000
EUR*
dar. zum Wiederver
kauf in 1.000
EUR*
Bruttowert- schöpfung
zu Faktorkost
en in 1.000
EUR*
Brutto- betriebs- überschu
ss in 1.000
EUR
Brutto- investitio
nen in 1.000
EUR*
INSGESAMT (Abschnitte G -N, S95) 0 250.0
37 1.800.3
47 1.567.4
18 61.290.
151 473.309.
716 440.434.
855 196.070.
093 304.678.4
13 223.647.
698 108.601.
374 47.311.
223 26.580.
388
Handel G 1 74.765 628.922 561.57
0 19.794.
413 245.046.
059 240.587.
393 61.206.2
88 208.563.5
53 183.876.
035 30.998.5
30 11.204.
117 2.547.8
19
G47 Einzelhandel G 47 2 40.427 350.454 310.95
2 8.217.4
79 58.874.3
46 57.521.7
03 19.953.1
12 47.101.95
9 38.842.7
26 11.616.4
66 3.398.9
87 1.079.7
80 G4759
EH - Möbel und Einrichtungsgegenstände G 47 5 9 4 2.600 27.888 25.505 756.154
4.469.177
4.341.805
1.901.079 3.402.481
2.549.880
1.041.312 285.158 86.375
G4761 EH - Bücher G 47 6 1 4 467 5.124 4.684 123.185 730.860 714.766 298.704 554.594 435.449 178.408 55.223 14.433
G4778
Sonst. EH in Verkaufsräumen G 47 7 8 4 2.395 11.987 9.705 284.609 2.268.712
2.228.181
720.856 1.826.595 1.563.322
446.895 162.286 47.689
J Information und Kommunikation J 1 17.20
7 98.552 83.043 5.319.463
20.833.951
19.543.687
14.007.174
12.112.410
6.365.844
8.263.802
2.944.339
1.438.272
J58 Verlagswesen J 58 2 1.144 12.127 11.238 659.192 2.859.961
2.712.941
2.088.069 1.864.655 720.170 911.650 252.458 58.281
J581 Verlagswesen (ohne Software) J 58 1 3 966 10.240 9.478 544.108 2.554.116
2.435.351
1.857.994
1.725.070 648.540 748.610 204.502 50.030
J5811 Verlegen v. Büchern J 58 1 1 4 335 1.990 1.713 76.830 307.150 297.029 205.624 198.268 97.966 105.715 28.885 13.380
J5812 Verlegen v. Adressbüchern J 58 1 2 4 16 568 552 29.530 107.680 101.639 88.186 47.526 17.993 58.616 29.086 4.113
J5813
Verlegen v. Zeitungen J 58 1 3 4 150 4.238 4.131 276.153 1.405.220
1.323.065
1.048.884
994.705 319.197 353.153 77.000 19.608
J5814 Verlegen v. Zeitschriften J 58 1 4 4 374 3.084 2.799 148.789 684.033 664.040 485.377 454.707 193.577 211.507 62.718 12.297
J5819
Sonst. Verlagswesen (ohne Software) J 58 1 9 4 91 360 283 12.806 50.033 49.578 29.923 29.864 19.807 19.619 6.813 632
J582 Verlegen von Software J 58 2 3 178 1.887 1.760 115.084 305.845 277.590 230.075 139.585 71.630 163.040 47.956 8.251 J5821 Verlegen v. Computerspielen J 58 2 1 4 7 45 43 2.722 4.860 4.146 4.294 1.452 561 3.407 685 24
J5829
Verlegen v. sonst. Software J 58 2 9 4 171 1.842 1.717 112.362 300.985 273.444 225.781 138.133 71.069 159.633 47.271 8.227
J59 Filmherstellung/-verleih; J 59 2 2.422 6.888 4.508 149.827 894.628 830.456 552.484 569.880 309.656 302.616 152.789 38.122
220
Kinos
J591 Filmherstellung/-verleih, Kinos J 59 1 3 1.791 5.821 4.098 136.738 789.137 727.765 485.243 502.356 272.942 265.865 129.127 32.417 J5911
H.v. Filmen und Fernsehprogrammen J 59 1 1 4 1.529 3.498 2.016 93.529 461.332 430.819 288.871 295.241 165.196 169.840 76.311 13.075
J5912
Nachbearbeitung und sonst. Filmtechnik J 59 1 2 4 82 174 94 4.485 17.107 16.706 15.085 8.312 1.725 8.498 4.013 1.377
J5913
Filmverleih und -vertrieb J 59 1 3 4 77 281 204 10.570 126.252 101.458 49.704 81.085 54.940 25.007 14.437 1.185
J5914 Kinos J 59 1 4 4 103 1.868 1.784 28.154 184.446 178.782 131.583 117.718 51.081 62.520 34.366 16.780
J592 Tonstudios und Musikverlage J 59 2 3 631 1.067 410 13.089 105.491 102.691 67.241 67.524 36.714 36.751 23.662 5.705 J5920 Tonstudios und Musikverlage J 59 2 0 4 631 1.067 410 13.089 105.491 102.691 67.241 67.524 36.714 36.751 23.662 5.705
J60 Rundfunkveranstalter J 60 2 83 5.020 4.970 397.161 1.381.257
1.291.810 772.616 873.351 588.135 489.308 92.147 66.335
J601 Hörfunkveranstalter J 60 1 3 42 455 433 20.495 71.194 67.163 60.246 40.205 9.910 28.348 7.853 2.032 J6010 Hörfunkveranstalter J 60 1 0 4 42 455 433 20.495 71.194 67.163 60.246 40.205 9.910 28.348 7.853 2.032
J602 Fernsehveranstalter J 60 2 3 41 4.565 4.537 376.666 1.310.063
1.224.647
712.370 833.146 578.225 460.960 84.294 64.303
J6020 Fernsehveranstalter J 60 2 0 4 41 4.565 4.537 376.666
1.310.063
1.224.647 712.370 833.146 578.225 460.960 84.294 64.303
J62 IT-Dienstleistun gen J 62 2 9.363 40.536 32.070 1.971.048
6.069.682
5.808.400
4.281.604 3.236.211 1.745.45
3 2.801.86
8 830.820 324.639
J620 IT-Dienstleistungen J 62 0 3 9.363 40.536 32.070 1.971.048
6.069.682
5.808.400
4.281.604
3.236.211 1.745.453
2.801.868
830.820 324.639
J6201 Programmierungstätigkeiten J 62 0 1 4 4.523 21.066 16.956 975.221
2.897.003
2.760.881
2.133.806 1.493.800 754.031
1.399.862 424.641 215.058
J6202
Erbringung v. IT-Beratungsleistungen J 62 0 2 4 2.212 9.432 7.465 510.923 1.694.59
0 1.622.41
0 1.005.40
1 991.375 680.708 694.623 183.700 40.260
J6203
Betrieb v. Datenverarbeitungsanlagen
J 62 0 3 4 349 3.632 3.314 247.584 670.520 641.446 602.315 337.381 63.227 328.411 80.827 56.248
J6209 Sonst. IT-Dienstleistungen J 62 0 9 4 2.279 6.406 4.335 237.320 807.569 783.663 540.082 413.655 247.487 378.972 141.652 13.073
J63 Informationsdienstleistungen J 63 2 3.864 17.157 13.691 860.060 3.020.567
2.874.953
2.273.802 1.653.120 660.839 1.282.37
7 422.317 165.599
J631 Datenverarbeitung und Hosting J 63 1 3 3.747 15.871 12.493 772.497 2.824.316
2.688.937
2.118.527
1.573.892 628.627 1.172.572
400.075 163.815
J6311 Datenverarbeitung und Hosting J 63 1 1 4 3.592 15.061 11.790 738.468
2.683.464
2.566.826
2.023.393 1.497.501 596.981
1.122.351 383.883 157.963
J6312 Webportale J 63 1 2 4 155 810 703 34.029 140.852 122.111 95.134 76.391 31.646 50.221 16.192 5.852
J639 Sonst. Informationsdienstleistungen
J 63 9 3 117 1.286 1.198 87.563 196.251 186.016 155.275 79.228 32.212 109.805 22.242 1.784
J6391
Korrespondenz- und Nachrichtenbüros J 63 9 1 4 59 923 877 74.123 156.647 149.761 124.555 61.826 26.511 89.154 15.031 888
J6399
Informationsdienstleistungen a.n.g. J 63 9 9 4 58 363 321 13.440 39.604 36.255 30.720 17.402 5.701 20.651 7.211 896
221
M Freiberufliche/t echn. Dienstleistungen M 1 60.80
1 215.089 156.662
7.478.977
39.893.281
26.862.076
20.650.697
15.989.873
7.356.469
12.179.897
4.700.920
1.413.836
M7111
Architekturbüros M 71 1 1 4 5.491 15.027 9.618 378.406 1.716.562
1.658.352
1.218.016
904.819 462.544 774.517 396.111 35.929
M72 Forschung und Entwicklung M 72 2 1.005 8.985 8.191 487.926 1.172.745 915.660 840.106 655.743 167.833 520.817 32.891 145.770
M73 Werbung und Marktforschung M 73 2 9.074 27.619 18.788 693.912 4.653.12
3 4.544.38
7 1.968.29
9 3.451.645 2.638.839
1.149.145 455.233 67.756
M731
Werbung M 73 1 3 8.817 25.427 16.837 640.080 4.490.358
4.388.576
1.858.449
3.362.470 2.591.950
1.081.618
441.538 63.614
M7311 Werbeagenturen M 73 1 1 4 8.669 23.286 14.802 529.975
3.239.095
3.183.010
1.508.560 2.326.255
1.708.052 890.034 360.059 52.480
M7312
Vermittlung v. Werbezeiten/-flächen M 73 1 2 4 148 2.141 2.035 110.105 1.251.26
3 1.205.56
6 349.889 1.036.215 883.898 191.584 81.479 11.134
M74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten M 74 2 6.117 11.378 5.253 172.415 992.383 958.726 745.132 584.213 242.853 409.498 237.083 32.547
M741 Ateliers für Design M 74 1 3 1.484 2.318 815 23.650 154.789 152.741 124.381 88.778 31.299 67.221 43.571 3.946
M7410 Ateliers für Design M 74 1 0 4 1.484 2.318 815 23.650 154.789 152.741 124.381 88.778 31.299 67.221 43.571 3.946
M742
Fotografie und Fotolabors M 74 2 3 1.667 3.446 1.740 38.923 209.771 206.848 169.102 121.976 40.827 88.413 49.490 12.347
M7420 Fotografie und Fotolabors M 74 2 0 4 1.667 3.446 1.740 38.923 209.771 206.848 169.102 121.976 40.827 88.413 49.490 12.347
M749 Sonst. freiberufliche Tätigkeiten M 74 9 3 1.908 4.129 2.306 103.129 546.994 519.015 391.997 323.883 149.213 222.125 118.996 14.258
M7490
Sonst. freiberufliche Tätigkeiten M 74 9 0 4 1.908 4.129 2.306 103.129 546.994 519.015 391.997 323.883 149.213 222.125 118.996 14.258
N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen N 1 13.04
9 203.988 192.466
5.804.546
20.520.918
19.752.326
13.539.605
10.671.673
6.629.726
9.480.784
3.676.238
4.805.548
Q: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturstatistik 2011. Erstellt am: 28.06.2013. - * Ohne Umsatzsteuer. 1) einschl. Investitionen in geringwertige Wirtschaftsgüter. - G: Alle Daten, die weniger als drei Unternehmen betreffen, wurden aufgrund der gesetzlichen Geheimhaltungsbestimmungen unterdrückt und durch ein "G" ersetzt.
Die o.g. Tabelle stellt einen Auszug der Leistungs- und Strukturstatistik 2011 dar. Die Markierungen hellgrün: Architektur, rot: Bereich Design, türkis: Musik (keine eindeutige Zuordnung möglich, ausgenommen Tonstudios), grün: Radio und TV, blitzblau: Software und Games (keine eindeutige Zuordnung möglich), rotbraun: Verlage (keine eindeutige Zuordnung möglich), violett: Video und Film (keine eindeutige Zuordnung möglich, da Videotheken inkludiert), grünblau: Werbung (keine eindeutige Zuordnung möglich); Bereich Biblioheken, Musseen, botanische und zoologische Gärten ausgenommen;
Anhang V: Sonstige Wirtschaftsförderung der aws
Neben den auf die Kreativwirtschaft speziell ausgerichteten Förderungen, bietet die aws auch
Unterstützung für UnternehmerInnen anderer Branchen. Die für die Kreativwirtschaft
interessanten Fördermöglichkeiten und Services werden folgend beschrieben.
8.1 ERP-Kleinkredit
Der ERP-Kleinkredit ist eine zinsgünstige Kreditförderung, die die aws Kleinunternehmen (max.
50 Beschäftigte, max. 10 Mio Euro Umsatz) für die Konjunkturbelebung zur Verfügung stellt.
Förderbare Kosten sind Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen sowie der Aufbau
neuer oder substanzieller Erweiterungen bestehender Dienstleistungen oder Geschäftsfelder.
Förderbare Projektkosten müssen zwischen 10.000 und max. 50.000 Euro liegen. Die Höhe der
Zinsen p.a. sind fix mit 2,0 %, davon ist ein Jahr tilgungsfrei. Maximal kann ein Kreditbetrag
zwischen 10.000 und 30.000 Euro für eine Laufzeit von 6 Jahren unterstützt werden. Besichert
wird durch Bankhaftung oder durch Haftungsübernahme der aws. Eingereicht wird bei den
Treuhandbanken495 des ERP-Fonds. Dieser Kleinkredit ist mit einer Haftung der aws und mit der
Jungunternehmerförderung kombinierbar.496
8.2 Haftungsübernahme für Mikrokredite
Die aws übernimmt eine Ausfallshaftung, damit MikroKredite leichter in Anspruch genommen
werden können. Diese sind für kleine Unternehmen und für die Kreativwirtschaft konzipiert.
Ausgenommen sind Unternehmen der Tourismus und Freizeitwirtschaft, für die es eine eigene
Förderbank gibt. Es können Haftungen bis max. 80 % von Mikrokrediten übernommen werden.
Das Finanzierungsvolumen beträgt bis zu 30.000 Euro für Investitionen und, bzw. oder
Betriebsmittel. Die Laufzeit beträgt bis zu 10 Jahre für Investitionen, und bis zu 7,5 Jahre für
Betriebsmittel. Es wird kein Bearbeitungsentgelt, sondern nur ein Haftungsentgelt in Höhe von
0,6 % p.a. verrechnet. Eingereicht muss vor Durchführung des Vorhabens497 über die Hausbank
495 Die Liste der Treuhandbanken ist im WWW abrufbar bei der aws. vgl. (aws 2013, Treuhandbanken)
496 vgl. (erp-fonds 2012)
497 es darf kein älteres Datum, als das Einreichdatum geben
224
werden. Die Zinssätze der Kreditinstitute werden durch die Förderung begrenzt und werden auf
der Homepage der aws veröffentlicht.498
8.3 JungunternehmerInnenförderung
Die JungunternehmerInnenförderung besteht aus nicht rückzahlbaren Prämien und
Haftungsübernahme im Fall der Gründung oder Betriebsübernahme. Abgewickelt wird wieder
durch die aws. Je nach Höhe der förderbaren Investitionskosten kommt ein anderes
Förderinstrument in Frage, (siehe Tabelle 34). Zum Teil können die Förderungen miteinander
kombiniert werden. Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:
• die erstmalige wirtschaftliche Selbständigkeit, jedenfalls nicht innerhalb der letzten fünf
Jahre
• die Gründung bzw. Übernahme eines kleinen Unternehmens
• die Betriebsgründung bzw. –übernahme erfolgte längstens drei Jahre vor der
Einreichung
• ausgenommen sind Tourismus- und Freizeitwirtschaftsbetriebe, für diese existiert eine
eigene Abwicklungsbank und Förderungen
Gefördert wird in Form von nicht rückzahlbaren Prämien für aktivierungsfähige Investitionen
und geringwertige Wirtschaftsgüter, und in Form der Übernahme von Haftungen für
Investitionen, Übernahmekosten und Betriebsmittel.
Die Förderinstrumente sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Name Höhe der Investitionskosten Zuschusshöhe
Jungunternehmer-Scheck
ab 5.000 EUR bis 20.000 EUR 1.000 EUR (jährlich ausnutzbar)
Jungunternehmer-Prämie zum ERP-Kleinkredit
ab 20.000 EUR bis 100.000 EUR 5 % Prämie, wenn ERP-Kleinkredit gewährt wird (jährlich ausnutzbar)
Jungunternehmer-Topprämie
ab 100.000 EUR bis 750.000 EUR 10 % Prämie
Jungunternehmer-Haftung bis 600.000 EUR Haftungsquote: 80 % Tabelle 34: Jungunternehmerförderung499
Fördermöglichkeiten für Jungunternehmen aus dem Bereich Tourismus- und
Freizeitwirtschaft:
Für Jungunternehmen aus dem Bereich Tourismus- und Freizeitwirtschaft gibt es (Bar-
)zuschüsse zu definierten Investitionen, geförderte Kredite (wie z.B. günstiger Zinssatz,
498 vgl. (erp-fonds, Haftungen für Mikrokredite für kleine Unternehmen 2012) und (aws 2012, erp-fonds)
499 Quelle: (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Jungunternehmerförderung)
225
Zuschuss zu Zinsen und Besicherung), Ausfallshaftung gegenüber Banken, und Unterstützung
bei Fortbildung und Beschäftigung von MitarbeiterInnen.500
8.4 Tecnet – Markt- & Technologierecherchen
Die aws bietet zusätzlich ein besonderes Service für die Zielgruppe technologieorientierte
UnternehmensgründerInnen und bestehende Unternehmen, insbesondere
technologieorientierte KMUs. Es können Markt- und Technologierecherchen – „Tecnet“ in
Auftrag gegeben werden. Es ist ein Aufwandsersatz nach tatsächlichen Stunden- und
Sachaufwand zu leisten, ein Angebot wird vor Aufnahme der Recherche erstellt und besprochen.
Diese Förderung kann laufend und direkt von der aws in Anspruch genommen werden.501
8.5 Tools – Plan4You Businessplansoftware
Die aws bietet eine Software (Plan4You) zur Erstellung eines Businessplans inkl. der
Planrechnung kostenlos zur Verfügung. Wirtschaftliche Daten können optimal mit dieser
Planungs- und Kalkulationssoftware aufgearbeitet werden, und dadurch kann eine
professionelle Darstellung der unternehmerischen Vorhaben für Banken, InvestorInnen und
Förderinstitutionen erreicht werden. Plan4You bietet ein Planungsprogramm für GuV und
Bilanz, bzw. für die Einnahmen- Ausgabenrechnung. Der Planungszeitraum beträgt vier Jahre
und die Planung ist quartalsweise im ersten Jahr möglich. Des weiteren bietet sie eine
Umsatzplanung, Aufwands-, Investitions- und Finanzplanung sowie Cash-flow Berechnung und
einiges mehr.502
8.6 Gründungssparen - Gründungsbonus
Alle JungunternehmerInnen können einen Gründungsbonus für das Ansparen von Eigenkapital
für die Unternehmensgründung (Gründungssparen) von derzeit 14 %, jedoch maximal 8.400
Euro beanspruchen, sofern sie die Kriterien der Förderung erfüllen.503 504 Die Sparform kann frei
gewählt werden, sie darf aber nicht eine bereits geförderte Variante sein, wie beispielsweise das
Bausparen. Als zentrale weitere Voraussetzung ist, die Anmeldung mittels Antragsformular bei
500 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Jungunternehmerförderung)
501 vgl. (aws erp-fonds 2012)
502 vgl. (aws 2013, plan4you)
503 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Gründerservice)
504 vgl. (Zentrales Förderungsservice, WKO Steiermark 2013)
226
der aws mindestens ein Jahr vor Gründung einzureichen.505
8.7 Double Equity Garantiefonds
Damit wird durch eine Kreditbürgschaft bis zu 80 % des Kreditbetrages, die das aws übernimmt,
gefördert. Diese Förderung soll die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen
erleichtern, dabei wird das Eigenkapital verdoppelt. Wie beim ERP-Kleinkredit wird der Zinssatz
des finanzierenden Kreditinstitutes begrenzt, die Laufzeit kann ebenfalls bis 10 Jahre sein, evtl.
auch länger. Gefördert werden nur KMUs506, deren Gründung oder Übernahme nicht länger als
fünf Jahre zurückliegt, und die nachweisen können, dass sie das Eigenkapital, auch durch Dritte,
aufbringen können. Als Eigenkapital sind alle bar eingezahlten Einlagen auf das
Gesellschaftskapital, oder in eigenkapitalähnlicher Form eingebrachte Barmittel zu verstehen.
Das maximale Finanzierungsvolumen ist mit 2,5 Mio Euro begrenzt. Dafür sind eine einmalige
Bearbeitungsgebühr von 0,5 % und ein Haftungsentgelt von 1 % fix, plus mindestens 1 % pa.
erfolgsabhängig zu bezahlen. Die Einreichung kann jederzeit über die Hausbank stattfinden.
8.8 KMU – Innovationsförderung „Unternehmensdynamik“
Das Förderziel dieser Maßnahme ist die Stärkung und Festigung des Innovationspotentials von
bestehenden und neugegründeten wirtschaftlich selbständigen, gewerblichen KMUs aller
Branchen (ausgenommen Unternehmen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft). Beurteilt wird
u.a. der Innovationsgrad des Vorhabens sowie der Innovationssprung. Diese Förderung besteht
aus Zuschüssen in Höhe bis zu 15 % für innovative Investitionen und bis zu 80 %
Haftungsübernahmen für Kredite. Das Finanzierungsvolumen ist mit 2,5 Mio Euro für
Investitionen bzw. Betriebsmittel gedeckelt. Die Laufzeit beträgt bis zu 10 Jahre für
Investitionen und bis zu 5 Jahre für Betriebsmittel. Für die Inanspruchnahme sind 0,5 %
einmalige Bearbeitungsgebühren zu bezahlen. Für die Haftung sind ab 0,6 % p.a. zu bezahlen.
Eingereicht muss vor Durchführung über die Hausbank werden, bei einer
Eigenmittelfinanzierung direkt bei der aws.507
505 vgl. (Wirtschaftskammer Österreich 2013, erp-fonds) und (aws erp-fonds 2012)
506 nach den Definitionen der Europäischen Union, vgl. (Land OÖ. 2013, Förderungen)
507 vgl. (erp-fonds, KMU-Innovationsförderung "Unternehmensdynamik" 2012) und (evolve 2013)
227
8.9 KMU-Haftungen
Zur soeben genannten KMU-Innovationsförderung gibt es die Möglichkeit der
Haftungsübernahme für Kredite bis zu 80 % der Summe. Das Finanzierungsvolumen beträgt
ebenfalls 2,5 Mio. Euro für Investitionen bzw. Betriebsmittel. Die Laufzeit ebenfalls 10 Jahre für
Investitionen, bzw. 5 Jahre für Betriebsmittel. Die Kosten sind in der o.g. Höhe ebenfalls gleich.
Eingereicht muss wiederum vor Durchführung, über die Hausbank, werden. Förderbare
Projektkosten sind materielle und immaterielle Investitionen, Unternehmenskäufe und
Unternehmensnachfolgen (MBO/MBI) und Betriebsmittel.508
8.10 ProTrans
Mit ProTrans soll die Innovationsleistung von KMUs durch Kooperation auf Basis konkreter
Forschungs- und Entwicklungs- bzw. Technologietransfer-Projekte gestärkt werden. Gefördert
werden Kooperationsprojekte von KMUs aller Branchen der Sachgütererzeugung und des
produktionsnahmen Dienstleistungssektors, die mit Universitäten, außeruniversitären
Forschungseinrichtungen oder anderen Unternehmen mit hoher Technologiekompetenz aus
dem In- und Ausland zusammenarbeiten wollen. Ziele von ProTrans sind die Erhöhung der
Innovationskraft von KMUs, die Erschließung neuer Märkte, Förderung substanzieller
Innovationen, sowie die Verbesserung der strategischen Produktfindung. Maximal wird mit
35 % bzw. 300.000 Euro pro Projekt in Form eines Barzuschusses gefördert.509
508 (evolve 2013, evolve-Finanzierungsangebote)
509 (Wirtschaftskammer Österreich 2013, Kooperation-Netzwerke)
229
Anhang VI: bundesweite Kunstförderung - Kulturförderung
Ab
teil
un
g
V/1
Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode, Fotografie, Video- und Medienkunst
V/2
Musik, Darstellende Kunst Kunstschulen, Allgemeine Kunstangelegenheiten
V/3
Film
V/5
Literatur und Verlagswesen
V/6
Bilateraler Künstleraustausch
V/7
Regionale Kulturinitiativen
Fö
rde
run
g
Jahresprogramme aller Sparten
Jahresförderung Drehbuch Jahrestätigkeit Reise-, Aufenthalts- und Tournee-
kostenzuschuss
Jahrestätigkeit
Einzelvorhaben aller Sparten
Produktions- und Projektkostenzuschuss
Projektentwicklung Projektförderung Artist-in-Residence Projekt- und Programmkostenzuschuss
Mode (durch die Abteilung aber auch durch
Modeförderung durch unitF Büro für Mode)
Prämien Herstellung Verlagsförderung Investitionskostenzuschuss
Stipendien für alle Sparten inklusive Startstipendien und
Auslandsateliersförderung
Festspiele und ähnliche Saisonveranstaltungen
Festivalverwertung Druckkostenbeitrag Reisekostenzuschuss
Ateliers (Bildende Kunst und Fotographie)
Investitionsförderung Kinostart Zeitschriftenförderung Startstipendium für Kulturmanagement
Galerienförderung (Museumsankäufe und
Auslandsmesseförderung)
Fortbildungskostenzuschuss für Kunstschaffende
Filmaufzeichnung Übersetzungskostenzuschuss Dokumentation, Evaluation, Kulturforschung
Ankäufe von Arbeiten Materialkostenzuschuss für KomponistInnen und
Musikverlage
Reisekostenzuschuss Stipendien Preise
Preise (Staatspreise u.a.) Tourneekostenzuschuss Stipendien (auch Startstipendien)
Arbeitsbehelfe
soziale Leistungen (Künstlerinnenhilfe)
Verbreitungsförderung für Tonträger und Publikationen
Preise Prämien
Kompositionsförderung Kinodigitalisierung Preise Stipendien
Preise Soziale Leistungen
(Anmerkung: die Aufgaben der Abteilung V/4 sind Nachweiskontrolle, Budget und Statistik)
Kunstförderung im Überblick, Eigendarstellung. (vgl. http://www.bmukk.gv.at/kunst/foerderungen/index.xml, Abfrage vom 03.06.2013)
230
Kulturförderung:
Grundsätzlich ist die Kulturförderung in der Verantwortung der Bundesländer. In Fällen von bundesweitem Interesse übernimmt der Bund eine
überregionale Verantwortung. Die Kultursektion fördert regionale Museen, volkskulturelle Aktivitäten und das öffentliche Büchereiwesen in ganz
Österreich. Gefördert wird konkret in vier Teilbereichen: öffentliches Büchereiwesen, Volkskultur, Förderungen für Museen, Österreichischer
Museumspreis. (vgl. http://www.bmukk.gv.at/kultur/foerderungen/index.xml, Abfrage vom 03.06.2013)
„In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Förderungen gesetzt, um die Transparenz, die Treffsicherheit und
Zielorientierung zu verbessern. So wurde die Museumsförderung neu strukturiert und ein Museumsbeirat eingerichtet. Für die öffentlichen
Büchereien konnten mit der Neupositionierung des Förderwesens eine Reihe von Maßnahmen zu deren Sicherung und Stärkung umgesetzt werden,
wie etwa eine erhöhte Bücherei-Förderung, Österreich weite Zielstandards und die Kooperation mit dem Büchereiverband als zentrale Servicestelle
für das öffentliche Büchereiwesen. Im Bereich Volkskultur werden neben der verlässlichen Basisförderung für die aktiven Dachverbände und der
Förderung bilateraler und internationaler Kontakte insbesondere mit der neu gestalteten Anreizfinanzierung auch Länder und Gemeinden zur
Mitfinanzierung innovativer Projekte angeregt.“ (http://www.bmukk.gv.at/kultur/foerderungen/index.xml, Abfrage vom 03.06.2013)
231
Anhang VII: Förderungsrichtlinien - Referenzfilmförderung
Österreichisches Filminstitut - Förderungsrichtlinien 05. April 2013 Seite 22 von 30
Anlage A
Referenzfilmförderung – Internationale Filmfestivals Spielfilm
Preise (260.000 Punkte)
Academy Award („Oscar” – Best Foreign Language Film) Berlin („Goldener Bär”)Cannes („Palme d’Or”, „Grand Prix”, „Jury Prize”) Venedig („Goldener Löwe”)
Preise (200.000 Punkte)
Berlin („Großer Preis der Jury”, Preis für die beste Regie „Silberner Bär”) European Film Award (Bester Film, Beste Regie)Golden Globe (Best Foreign Language Award)
Preise (150.000 Punkte)
Cannes („Camera d’Or”) Venedig („Special Jury Prize”)
Preise (110.000 Punkte)
Cannes („Un Certain Regard Prize”)European Film Award („Fipresci-Preis”)Karlovy Vary (Grand Prix „Crystal Globe”)Locarno („Goldener Leopard”, „Special Jury Prize”) Rotterdam („VPRO Tiger Awards” - drei Preise) San Sebastian („Golden Shell”)
Preise (60.000 Punkte)
Berlin („Preis für den besten Erstlingsfilm”, Caligari-Preis) Karlovy Vary („Special Jury Prize”)Saarbrücken („Max Ophüls Preis”)San Sebastian („Special Jury Prize”)
Toronto („People’s Choice Award”)Venedig („Luigi de Laurentiis Award for a Debut Film”) Venedig („Orizzonti Prize”)
Teilnahmen (260.000 Punkte)
Academy Awards (Nominierung „Oscar” - Best Foreign Language Film)
Teilnahmen (200.000 Punkte)
Cannes (Wettbewerb)
Teilnahmen (110.000 Punkte)
Berlin (Wettbewerb)Golden Globe (Nominierung Best Foreign Language Film) Venedig (Wettbewerb)
Teilnahmen (30.000 Punkte)
Berlin (Panorama Spezial, Forum)Cannes („Quinzaine des Réalisateurs”, „Semaine de la Critique”, „Un Certain Regard”) European Film Award (Nominierung bester Film, beste Regie)Rotterdam (Wettbewerb „VPRO Tiger Awards”)Venedig („Orrizonti”, „Settimana de la Critica”, „Giornate degli Autori”)
Österreichisches Filminstitut - Förderungsrichtlinien 05. April 2013 Seite 23 von 30
Zusatzliste für Dokumentarfilm
232
Preise (110.000 Punkte)
Amsterdam („Best feature length Award”) European Film Award (Best Documentary)
Preise (60.000 Punkte)
Kopenhagen CPH:DOX („Dox Award“, New Visions Award“)Leipzig („Goldene Taube”)Marseille („Grand Prix of the International Competition”)Nyon („Grand Prix – Visions du Réel”, „Prix SRG SSR”)Toronto Hot Docs („Best International Documentary”)Yamagata („The Grand Prize - The Robert and Francis Flaherty Prize”)
Preise (30.000 Punkte)
Karlovy Vary („Best Documentary”)
Teilnahmen (30.000 Punkte)
Amsterdam (Wettbewerb)Kopenhagen CPH:DOX (Wettbewerb)European Film Award (Nominierung – Best Documentary) Nyon (Wettbewerb)Toronto Hot Docs (International Spectrum)
Zusatzliste Kinderfilm
Preise (60.000 Punkte)
Amsterdam, Cinekid („Cinekid Lion”; „Jury Award”)Berlin, Kinderfilmfest „Generation” („Gläserner Bär” der Kinder- bzw. Jugendjury) Chicago („Adult Jury Prize for Live Action Feature Video“)Giffoni („Goldener Gryphon”; „Jury Grand Prix”)Zlin („Golden Slipper”)
Teilnahmen (30.000 Punkte)
Amsterdam, CinekidBerlin, Kinderfilmfest „Generation” Chicago CICFF
Redaktioneller Hinweis: Preise und Teilnahmen für Spielfilme gelten sofern nicht gesondert geregelt ausnahms- los auch für Dokumentar- und Kinderfilme.
Anlage B:
Höchst- und Richtsätze von finanziellen Förderungen
Für nachfolgende finanzielle Förderungen gelten nach Maßgabe der dem Filminstitut zur Verfügung stehenden Mittel im Einzelfall als Höchstsätze bzw. Richtsätze:
Förderung der StoffentwicklungDrehbuch/Drehkonzept (Pkt. 4 der Richtlinien)12.000 Euro (Höchstsatz) – FörderungswerberIn: qualifizierte/r AutorIn; 12.500 Euro (Höchstsatz) – FörderungswerberIn: AutorIn und FilmherstellerIn; 15.000 Euro (Höchstsatz) – FörderungswerberIn: qualifizierte/r AutorIn und DramaturgIn/RegisseurIn oder mehrere entsprechend qualifizierte AutorInnen;
Drehbuchentwicklung im Team (Pkt. 4 der Richtlinien) 15.000 Euro (Höchstsatz);
Förderung der Projektentwicklung (Pkt. 5 der Richtlinien) 40.000 Euro (Höchstsatz)
Förderung der Filmherstellung (Pkt. 6 der Richtlinien)440.000 Euro (Richtsatz);bei Förderungen nach dem Projektprinzip ab einer Förderungssumme von 10 vH des Förderungsbudgets (2012: 1.476.000 Euro) und bei Kumulation mit Förderungen nach dem Erfolgsprinzip (Referenzfilmförderung) ab einer Gesamt- förderungssumme von 15 vH des Förderungsbudgets (2012: 2.214.000 Euro) ist die Genehmigung des Aufsichtsrats erforderlich;
Verwertungsförderung (Pkt. 9 der Richtlinien)Verleihförderung (Kinostartförderung): Grundbetrag
233
40.000 Euro (Höchstsatz; nicht rückzahlbarer Zuschuss); Zusatzbetrag 50.000 Euro (Höchstsatz; erfolgs- bedingt rückzahlbarer Zuschuss; Eigenanteil gemäß Pkt. 9.1);Sonstige Verbreitungsmaßnahmen:Festivalbeteiligung(en) pauschaliert 20.000 Euro (Richtsatz; nicht rückzahl- barer Zuschuss);fremdsprachige Synchronisation 26.000 Euro (Höchstsatz; zinsenfreies Dar- lehen);DVD-Herausbringung pauschaliert 3.000 Euro (Richtsatz; nicht rückzahlbarer Zuschuss)
Förderung der beruflichen Weiterbildung (Pkt. 10 der Richtlinien) für Einzelpersonen 1.000 Euro/Monat (Richtsatz);
Quelle: Österreichisches Filminstitut - Förderungsrichtlinien 05. April 2013 Seite 22-24 von 30
235
Anhang VIII: weitere Netzwerke
In diesem Kapitel werden ausgewählte Netzwerke in OÖ. genannt. Diese Institutionen basieren
auf dem Engagement und der Initiative von KreativunternehmerInnen selbst und sind mit einer
Ausnahme dem Netzwerk Design und Medien, nicht von Seiten des Landes, oder der Stadt
gegründet, oder initiiert worden.
8.11 Kupf – Kulturplattform OÖ.
Die Kulturplattform OÖ. ist ein eingetragener Verein, dessen Mitgliederzahl 120 freie
Kulturinitiativen in Oberösterreich übersteigt. Die Kupf kann als kulturpolitische und
gewerkschaftliche Interessensvertretung ihrer Mitglieder gegenüber öffentlichen Förderstellen in
OÖ. bzw. Österreich gesehen werden. Sie setzt sich u.a. für eine Änderung des
Lustbarkeitsabgabegesetzes ein. Darüber hinaus bietet sie ihren Mitgliedern Beratung und Service
selbst an, oder vermittelt zu PartnerInnen innerhalb ihres Netzwerkes.510
8.12 afo – Architekturforum OÖ.
Die Aktivitäten des Architekturforums OÖ. (afo) umfassen nach Außen die Promotion hoher
architektonischer Qualität in Oberösterreich und Imagebildung für Architekturanliegen. Es
fungiert als Drehscheibe für den inhaltlichen Austausch seiner Mitglieder und Interessierten und
sieht sich als „Teil eines Netzwerkes einer offenen und lebendigen Szene, insbesondere im Austausch
mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, Architekten, Kunst- und Kulturschaffenden“.511 Das
afo steht als Informations- und Kompetenzzentrum für alle Fragen zur Baukultur zur Verfügung
und unterhält eine Baudatenbank. Es stellt seine Räumlichkeiten für Ausstellungen, Vorträge,
Workshops, Seminare und Tagungen zur Verfügung, aber auch für „offene Ateliers“, die den
Freiraum für interdisziplinäre Experimente erlauben. Für seine Mitglieder bietet es ein Forum für
den Austausch und das Netzwerken. Es unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten Aktivitäten
in Oberösterreich, „die den Diskurs für einen zeitgemäßen Umgang mit Architektur forcieren“, und
unterstützt Projekte von engagierten StudentInnen. Zu den Aktivitäten gehört auch Wettbewerbe
und Projektentwicklungen durchzuführen. Es gibt das „architekturmagazin“, eine Sendung, die auf
Radio FRO ausgestrahlt wird, heraus, und bietet Interessierten „ArchitektTOUREN“ an.
510 vgl. (KUPF 2012)
511 (AFO 2012)
236
Publikationen zu aktuellen Themenfeldern der Architektur können ebenfalls vom afo bezogen
werden. Das afo ist im Haus der Architektur in Linz situiert.512
8.13 OK Offenes Kulturhaus OÖ.
Das Offene Kulturhaus OÖ. ist ein Präsentations- und Vernetzungsort für zeitgenössische Kunst in
Linz. Es lädt KünstlerInnen zur vernetzten Entwicklung von Arbeiten ein. Das OK schreibt mit
Hilfe des Sponsors Energie AG ein Stipendium „OK friends Traumstipendium“ für bildende
KünstlerInnen in Höhe von 6.000 Euro bis 18. Juni 2013 aus. Die Jury wählt die innovativste Idee
der Einsendungen aus, die eine Reise oder einen Residency-Aufenthalt anderswo bedingen. Den
Abschluss bildet eine Ausstellung in den Räumlichkeiten des Sponsors.513
8.14 Ars Electronica
Ars Electronica wirkt in mehrerlei Hinsicht positiv auf Oberösterreichs Kreativwirtschaft durch
seine Aktivitäten, als Auftraggeber, Impulsgeber und Motor von Netzwerken. Dazu gehören das
internationale Festival, das jährlich in Linz stattfindet, der Prix Ars Electronica, das Ars
Electronica Center und das Futurelab in Linz. Die Kernthemen sind Kunst, Technologie,
Gesellschaft, die den Rahmen aller Aktivitäten bilden.514
8.15 OTELO
OTELO ist „das Offene Technologie Labor“, das 2010 gegründet wurde und an vier Standorten
präsent ist: Gmunden, Vöcklabruck, Kremstal und Ottensheim. Die dahinter stehende Idee ist,
Menschen einen offenen Raum für kreative und technische Aktivitäten zu ermöglichen.515 An den
vier Standorten sind dafür sog. Node-labs (das sind Kleinlabore) und offene Werkstätten, sowie
weitere Räumlichkeiten, eingerichtet bzw. geplant, die zum „Brainstormen“ anregen sollen.
Workshops und Vorträge können abgehalten, und kreative, technische Ideen umgesetzt werden.
„OTELO Now“ soll eine offene Einrichtung sein, die im ländlichen Raum wertschöpfende
kreativwirtschaftliche Strukturen bietet. „Otelo Now“ wurde im Rahmen von impulse Lead
gefördert. KooperationspartnerInnen sind u.a. das ScienceCenter-Netzwerk, sowie die Ars
Electronica Linz GmbH.516
512 vgl. (AFO 2012) und (Creative Community Linz 2013)
513 vgl. (OK Centrum 2013)
514 vgl. (Ars Electronica Linz GmbH 2013)
515 vgl. (OTELO 2012)
516 vgl. (OTELO 2012) und (Ars Electronica Linz GmbH 2013)
237
8.16 sonstige Netzwerke
Unter dieser Rubrik werden exemplarisch weitere Netzwerkaktivitäten im Raum Oberösterreich
aufgezeigt. Mit dem Start-Up Mingle beispielsweise, lassen sich erste Vernetzungsaktivitäten
zwischen bestehenden Netzwerken in Oberösterreich beobachten.
iNNO iNi
iNNOiNi versteht sich als Netzwerk von technologieorientierten GründerInnen. Es will die
Erfahrungen und das Wissen ehemaliger GründerInnen als Gründer-Community jungen
GründerInnen und Interessierten zur Verfügung stellen.517
Start-Up Mingle
Erstmals haben sich am 28. Mai 2013 durch Initiative von tech2b, akostart OÖ und iNNOiNi
StartUps aus Oberösterreich zu einem Netzwerktreffen versammelt. Ziel dieses Mingle ist der
formlose Austausch, das Kennenlernen und das Schaffen von Synergien zwischen
Gründungswilligen, GründerInnen und erfahrenen GründerInnen. Consultants, Investoren u.dgl.
sind bei der Zusammenkunft ausgeschlossen.518
8.17 überregionale Interessensgemeinschaften519
Besonders hohe Aktivität scheint überregional im Bereich Design zu herrschen, was mit folgend
angeführten überregionalen Interessensgemeinschaften, wie der designaustria, der
österreichischen Designstiftung und dem ECOdesign Österreich verdeutlicht werden soll.
designaustria
Die designaustria ist der Berufsverband der Grafik-Designer, Illustratoren und Produkt-Designer
und hat rund 1.000 Mitglieder. Designaustria bietet Information über Honorar- und
Wettbewerbsrichtlinien, ein Mitgliederverzeichnis, Erfolgsnachweise sowie internationale
Links.520
517 vgl. (Netzwerk iNNO iNi 2013)
518vgl. (tech2B 2013)
519 IG Kultur Österreich, (IG Autoren), IG Bildende Kunst, (IG Freie Theaterarbeit), Dachverband freier Radios
520 vgl. (Designstiftung Österreich 2013)
238
Die österreichische Designstiftung
Die Ziele der österreichischen Designstiftung sind Öffentlichkeitsarbeit sowohl national, als auch
international zu leisten. Mit ihrer Tätigkeit will sie den Wirtschaftsstandort und die in Österreich
tätigen Unternehmen und DesignerInnen stärken. Sie will darüber hinaus Designaktivitäten
fördern und präsentieren und die handelnden Akteure vernetzen.521
ECOdesign Österreich
ECOdesign Österreich ist eine Initiative des BMVIT (der Abteilung Energie- und
Umwelttechnologien) und der TU Wien (Institut für Konstruktionslehre). Die Website bietet
Information und Hinweise zu „ECODESIGN“, zur umweltgerechten Produktgestaltung.522
Darüber hinaus gibt es weitere überregionale Organisationen wie beispielsweise die IG Kultur
Österreich, die IG Autoren, die IG Bildende Kunst, die IG Freie Theaterarbeit und den
Dachverband freier Radios, die als Servicestelle für die Interessen ihrer Mitglieder fungieren.
521 vgl. (Designstiftung Österreich 2013)
522 vgl. (Ecodesign 2013)
239
Anhang VIX: ausgewählte Crowdfunding-Plattformen
Crowdfunding-Plattformen für die Kreativwirtschaft (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Plattform Fundi
ng
Financi
ng
internatio
nal Regional
A
T Art d. Projekte
Respekt.net x
AT X x Soziales und Kultur, Dauerspenden
Querk.at X AT X
Soziales, so. Ideen; CSR-taugliche
Projekte
Startnext.de, Startnext.at x
DE
x Kultur
1000x1000.com
x AT X x Kreativwirtschaft, Wirtschaft
Conda.com x AT X x Kreativwirtschaft, Wirtschaft
DasErtragreich.at X AT X X Kreativwirtschaft, Wirtschaft
KraudMob x X Mobile Applikationen
Innovation.at X X X Kreativwirtschaft, Wirtschaft
greenrocket.at X AT X X ökologische Wirtschaftsvorhaben
Kickstarter.com x
x, US US, UK
Kreativprojekte
Wemakeit.ch x
CH, DE, FR,
AT Kreativprojekte
MySherpas.com x
DE
Projekte aller Art; Portal wird 2013
eingestellt.
Seedmatch.de
x DE dzt. nur DE StartUps
VisionBakery.com x*
DE
Ideen aller Art
Sonicangel.com x x, BE
US, BE, NL,
DE, FR, Musik
flattr.com – micropayment x
X
Social Payment
IndieGoGo.com x
X
haupts. Musik, Charity, Film,
Kleinunternehmen
ArtistShare.com x*
X
Künstler, v.a. Musiker
Sellaband.de x
x, DE
Musik
Rockethub.com x
X
Projekte aller Art
Inkubato.de
x DE
Kunst- und Kulturprojekte
Pling.de x DE Kreativprojekte aller Art
* mit selbstgewählter Gegenleistung zum selben Wert
* Fanfunding
Tabelle 35: ausgewählte Crowdfundingplattformen523
523 Eigendarstellung (Zusammenstellung der Daten per Abfrage vom 27.05.2013 bzw. 15.10.2013)