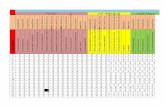Heft 3/2011 - MOECK
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Heft 3/2011 - MOECK
Weitere Informationen und Anmeldung: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K.,Lückenweg 4, D-29227 Celle | Tel. 05141-8853-0 | [email protected] | www.moeck.com
Veranstalter: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K. und Kreismusikschule Celle
Termin: Samstag, 5. November 2011, 10.00–17.00 Uhr Ort: Kreistagssaal, Trift 26, 29221 Celle
MOECK Seminare2/2011
Beim Moeck Seminar am 5. November 2011 erar-beitet Bart Spanhove Sätze aus Werken von Men-delssohn, Schumann, Tschai kowsky, Grieg u. a. ingenial-blockflötengerechten Bearbeitungen. Esist ein ganz besonderes Ver gnü gen, die großenWerke der Musik geschichte auf Blockflöten zuspielen, aber nicht jedes Stück eignet sich für die-se Instrumente. Die Bearbeitungen aber, die mitBart Spanhove musiziert werden, sind sorgfältigausgewählt und vielfach erprobt. Fast könnteman meinen, sie seien überhaupt für Blockflötenkomponiert worden. Allerdings sind sie, ebensowie die Originale selbst, nicht ganz einfach zuspielen. Deshalb Vorsicht! Dieser Blockflöten-tag ist nichts für Anfänger, sondern eher für er-fahrenere Spieler. Auch für Spieler, die sich vorkniffligen Solopartien nicht scheuen, sind einigeHeraus forderungen dabei.
Die Teilnehmer an diesem Seminar sollten min-destens zwei Blockflöten beherrschen. Gute
Vom-Blatt-Spiel-Fähigkeit ist erforderlich. Auchrhythmisch stellen die Stücke einige An for de -rungen. Die Werke im Original anzuhören kanndabei sehr hilfreich sein. Diejenigen, die gernmitspielen möchten, aber nicht ganz sicher sind,ob ihr Können ausreicht, finden einen Teil derPartituren in einer Ansichtsversion auf unsererWebsite. Prüfen Sie selbst, ob Sie sich zutrauen,beim Musizieren mitzuhalten.
Für Spieler, die gern noch einen Schwierigkeits-grad höher gehen, bietet Bart Spanhove von17.00–18.00 Uhr, also nach dem offiziellen Ver-anstaltungsende, eine Happy hour for recordermaniacs (zu Deutsch: Blaue Stunde für Blockflö-tenbesessene) an. Hier ist das Stück der Wahl das3. Brandenburgische Konzert von Johann Sebas -tian Bach in einer Bearbeitung von Joris VanGoethem, die aber nur von sehr erfahrenen, si-cheren Spielern zu bewältigen ist. Dieses zusätz-liche Angebot ist kostenfrei.
Die sinfonische Blockflötemit Happy hour for recorder maniacs
Bart SpanhoveBart Spanhove wurde 1961 in Eeklo (Be lgi en) geboren. Er studierteBlock flöte am Lem mensinstituut im belgischen Leuven und ist seit1984 Professor und Leiter der Abteilung Blockflöte am selben Institut.Außerdem ist er Mitglied des Block flöten ensembles Flanders RecorderQuartet. Mit diesem Ensemble hat er bisher zwölf CDs eingespielt,über tausend Konzerte gegeben und zahlreiche Meisterkurse undWork shops in ganz Europa und Amerika, in Japan, Singapur und Süd-afrika geleitet.
Teilnahmegebühr: € 40,00
Titelbild: Travers-Flaute, aus Johann Christoph Weigel, Musicalisches Theatrum,Nürnberg, um 1720Diese Ausgabe enthält folgende Beilagen: ERTA, Deutschland; Kreismusikschule,Celle
TIBIA · Magazin für Holzbläser 36. Jahrgang · Heft 3/2011
InhaltRüdiger Thomsen-Fürst: … unsere wonneduftende Flöte … –Überlegungen zur Kammermusik mit Flöte am Hofe Carl Theodors in Mannheim 483Das Porträt: Peter Spohr im Gespräch mit Peter Thalheimer 495Anne Kräft: Carl Rosier und seine Werke für Blockflöte – Sonaten auseinem bisher kaum beachteten Manuskript 500
Summaries 505
BerichteMeinrad Schweizer: Die Ambivalenz des Zeitgeschehens –Zum 100. Geburtstag von Konrad Lechner 506Peter Thalheimer: Eine Entdeckung: Das Repertoire der BogenhauserKünstlerkapelle 508Ulrike Teske-Spellerberg / Christoph Zehm: Friedrich Zehm –Komponist zwischen Tradition und Moderne 509
Moments littéraires 514
RezensionenBücher 519Noten 523Tonträger und AV-Medien 538
Neues aus der Holzbläserwelt 545
Veranstaltungen 557
Impressum 560
TIBIA 3/2011 481
MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K. Tel. +49-(0)5141-8853-0 | [email protected] Celle | Postfach 3131 Fax: +49-(0)5141-8853-42 | www.moeck.com
GEORGE GERSHWIN
Summertimefrom Porgy and Bessfor recorder orchestra
adapted bySylvia Corinna Rosin
Edition Moeck Nr. 3320ISMN M-2006-3320-7€ 17,00
SATBGb(Sb) Edition 3320
George Gershwin (1898–1937)
Ihren Ruhm und ihren Platz in der Geschichteverdankt die Mannheimer Hofkapelle in ersterLinie der Orchestermusik und mit Abstrichenauch der Oper und der Kirchenmusik. Vergli-chen damit ist der Kammermusik der Kompo-nisten aus den Reihen der Hofmusik Carl Theo-dors wenig Beachtung geschenkt worden. Diesliegt zum einen daran, dass die musikhistorischrelevanten Entwicklungen, für die der Begriff„Mannheimer Schule“ steht, nicht auf diesemGe biet stattfanden. Berühmt war die Hofkapellefür ihre Orchesterkultur, für die Präzision desgroßen Apparats und die darauf abgestimmteMusik. Über die Kammermusikpflege am Mann-heimer Hof liegen zudem nur spärliche Quellenvor. Zwar sind zahlreiche Kompositionen über-liefert, doch weiß man wenig über konkreteAufführungen. Musikalieninventare fehlen, unddie wenigen zeitgenössischen Berichte erwäh-nen, dass, aber nicht was musiziert wurde.
Erhalten sind dagegen in großer Zahl die Druck-ausgaben, die in den Musikzentren des 18. Jahr-hunderts – also in Paris und London, später füreine kurze Zeit auch in Mannheim – veröffent-licht oder durch Abschriften verbreitet wurden.
Mit einiger Vorsicht lassen sich aus diesem Cor-pus Rückschlüsse auf das Mannheimer Kammer-musik-Repertoire ziehen.
Auffällig ist der große Anteil, den Kompositio-nen für die Flöte daran haben. Unter den bis1778 in Mannheim entstandenen Werken findensich nur sehr vereinzelt solche für andere Blasin-strumente, dagegen entstanden Solo- und Trio-sonaten, Duette und Trios mit bzw. für Travers-flöte in sehr großer Zahl. Seit der Mitte der1760er Jahre nehmen dann Flötenquartette (Flö-te, Violine, Viola, Violoncello) einen prominen-ten Rang ein.
Die Sonderstellung der Flöte wird auch in derWertschätzung deutlich, die der Kurfürst CarlTheodor dem Instrument entgegenbrachte: Erselbst spielte es auf hohem Niveau und wurdevon Virtuosen ersten Ranges, von Matthias(auch Martin Friedrich) Cannabich1 (um 1690–1773) und Johann Baptist Wendling2 (1733–1797), unterrichtet. Man kann Carl Theodors In-strumentenwahl zunächst mit dem individuellenGeschmack des Kurfürsten begründen, doch be-friedigt diese Annahme letztlich nicht. Die fol-genden Überlegungen wollen daher den Versuchunternehmen, weitere Erklärungen für den gro-ßen Anteil der Flötenkammermusik am Reper-toire der Mannheimer Hofmusiker zu gebenund die Rolle, die das Flötenspiel im Rahmender höfischen Repräsentation spielte, zu unter-suchen.
Ähnliche Fragestellungen hatte bereits Hans-Peter Reinecke in seinem Aufsatz Mutmaßun-gen über das Flötenspiel Friedrichs des Großenerörtert: „Warum zum Beispiel spielte Friedrichdie Traversflöte? Warum bevorzugte er sie undspielte mit deutlich weniger Liebe das ,Clavier‘?Warum wandte er sich nicht dem Violin- oder
Rüdiger Thomsen-Fürst
… unsere wonneduftende Flöte … – Überlegungen zur Kammer-musik mit Flöte am Hofe Carl Theodors in Mannheim
Dr. Rüdiger Thomsen-Fürst studierte an der Uni-versität Hamburg Histori-sche und SystematischeMusikwissenschaft sowieNeuere Deutsche Literatur-wissenschaft. 1994 wurde ermit der Arbeit Studien zurMusikgeschichte Rastatts im18. Jahrhundert promoviert.Thomsen-Fürst arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungs-stellen „Geschichte der Mannheimer Hofkapelle“(1996–2006) und „Südwestdeutsche Hofmusik“ (seit2006) der Heidelberger Akademie der Wissenschaf-ten.
TIBIA 3/2011 483
… unsere wonneduftende Flöte …
dem Lautenspiel zu? Antworten auf solche Fra-gen erscheinen auf den ersten Blick eigentlichnebensächlich; sie sind mithin innerhalb des tra-ditionellen musikwissenschaftlichen Diskurseskaum von Belang. Doch bei näherem Hinsehenzeigen sich auch in solchen Nebensachen Un-tertöne, die vielleicht ein anderes Licht auf dieWelt des sogenannten ,Musicalischen‘ werfen,um das oft hart gerechtet wird.“3
Gleich zweimal ließ sich der pfälzische Kurfürstmit der Flöte porträtieren. Das erste, jüngerePorträt zeigt Carl Theodor im roten Uniform-rock beim Flötenspiel. Dieses Bild existiert inzwei Ausführungen in den Bayerischen Staats-gemäldesammlungen bzw. in den Reiss-Engel-horn-Museen in Mannheim4 (s. Abb. 1). Sowohlzur Zuschreibung als auch zur Datierung gibt esunterschiedliche Angaben; diese zu diskutierenist hier nicht der richtige Ort und sollte dem
Kunsthistoriker vorbehalten bleiben. Bemer-kenswert ist jedoch, dass die Münchner Ausfüh-rung des Bildes wesentlich detailreicher ist alsdie Mannheimer: Hier lassen sich sowohl Ein-zelheiten hinsichtlich des Instruments als auchder auf einem kleinen Tisch aufgeschlagenenNoten erkennen. Die Traversflöte, wahrschein-lich aus Buchsbaum gefertigt, trägt die Marke„Carlo Palinca“, wobei es sich sehr wahrschein-lich um den Turiner Instrumentenbauer CarlosPalanca (ca. 1688/1690–1783) handelt. Die auf-geschlagenen Noten bilden ein nicht näher zuidentifizierendes Menuett in G-Dur ab. Auf derdarunter liegenden Seite ist der Schriftzug „Flau-to traverso di Schneider“ lesbar. Alle diese In-formationen lassen sich jedoch nicht eindeutigmit dem Mannheimer Hof in Verbindung brin-gen: Weder ist ein Komponist oder Flötist Schnei -der in der Hofkapelle tätig gewesen noch ist be-kannt, dass Flöten in Turin gekauft wurden.
Als Ausgangspunkt für unsere Fragestellungwesentlich ergiebiger ist das zweite Bild desKurfürsten von der Pfalz, nämlich das be-reits 1757 entstandene Carl-Theodor-Por-trät von Johann Georg Ziesenis5 (s. Abb. 2).Es zeigt den Kurfürsten in einer scheinbarintimen Atmosphäre, „en négligé“, im Haus-mantel und mit rutschenden Strümpfen.Diese Art der Darstellung hat in der Kunst-geschichte kein direktes Vorbild.6 Es ist des-halb anzunehmen, dass Ziesenis dieses Bildauf Anweisung oder doch zumindest mitausdrücklicher Billigung des Kurfürsten ge-fertigt hat. Das Gemälde ist Teil eines Dop-pelporträts, das Gegenstück zeigt die Kur-fürstin mit Handarbeitszeug. VerschiedeneAutoren haben bereits darauf hingewiesen,dass es sich hier nicht um die fotografisch-realistische Abbildung der privaten Lebens-umgebung des Kurfürsten handelt, sondernum eine emblematische Darstellung, die
Abb. 1: Heinrich Carl Brandt nach Johann HeinrichTischbein: Carl Theodor mit Traversflöte, um 1770,Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim. Foto: Wikimedia
484 TIBIA 3/2011
Rüdiger Thomsen-Fürst
wiederum eine Selbstinszenierung des Regentenist. Ob der abgebildete Raum einem konkretenKabinett in den Schlössern von Schwetzingen7
oder Mannheim8 entspricht, ist für unsere Fra-genstellung nebensächlich.
Die Geste der rechten Hand und der Vorhangsind gleichsam Vokabeln des barocken Herr-scherporträts, der Hund unter dem Tisch ließesich in dieser Tradition ebenfalls als Allegorievon Mut und Treue verstehen. Umgeben ist derKurfürst aber auch von Gegenständen, die seineLiebe zu den Künsten und Wissenschaften repräsentieren: Einer Uhr, Schreibzeug und ei-ner umfangreichen Bibliothek, die im Hin-tergrund durch einen Türdurchbruch im an-grenzenden Zimmer sichtbar wird. Be-sonders prominent vertreten ist die Musik.Auf dem Tisch liegen Notenblätter, in derlinken unteren Bildecke lehnt ein Violoncelloan der Wand, ein Instrument, das der Kur-fürst ebenfalls beherrschte. In seinen Hän-den hält Carl Theodor jedoch eine Travers-flöte, die damit in das Bildzentrum gerücktist.
Schon Helmut Börsch-Supan kam bei derBetrachtung von Ziesenis’ Carl-Theodor-Porträt zu der Einschätzung, dass die Attri-bute ein neues Bild des aufgeklärten absolu-tistischen Fürsten veranschaulichen sollen.9
Seiner Annahme, dass die abgebildeten Ge-genstände in „keiner echten Beziehung zumPorträtierten10 stehen, ist insofern zu wider-sprechen, als es sich bei der Traversflöte miteiniger Sicherheit um ein Instrument desfranzösischen Instrumentenbauers ThomasLot (1708–1787) handelt.11 Im BayerischenNationalmuseum in München wird ein Flö-tenpaar dieses Instrumentenbauers aus demBesitz des Kurfürsten aufbewahrt. Es istaußerdem bekannt, dass Carl Theodors Leh-
rer, Johann Baptist Wendling, Geschäftsbezie-hungen zu Lot unterhielt. Die Darstellungswei-se kann insgesamt als programmatisch für dieRegentschaft Carl Theodors angesehen werden:Die Musikliebe des Kurfürsten ist bekannt.Auch die Forschung förderte er maßgeblich, bei-spielsweise durch die Gründung der Akademieder Wissenschaften im Jahre 1763 und die Ein-richtungen von Sammlungen, etwa der Antiken-bzw. Gemälde-Sammlung.12 Dass in diesem Zu-sammenhang die Flöte derart exponiert wird, istkaum zufällig zu nennen, was im folgenden zuzeigen sein wird.
Abb. 2: Johann Georg Ziesenis: Kurfürst Carl Theo-dor von der Pfalz (1757, Ausschnitt): BayerischesNationalmuseum, München
TIBIA 3/2011 485
… unsere wonneduftende Flöte …
wehenden Geist der Aufklärung zugetan, ver-schrieb sich Friedrich dem Instrument und ge-riet darüber in heftige Konflikte mit seinem Vater, König Friedrich Wilhelm I. Dem Solda-tenkönig missfiel die Haltung seines Sohnes, zuder er ausdrücklich auch das Flötenspiel zählte,außerordentlich: „Was gilt es, wenn ich Dir rechtDein Herz kitzelte, wenn ich aus Paris einenmaître de flûte mit etlichen zwölf Pfeifen undMusique-Büchern, imgleichen eine ganze BandeKomödianten und ein großes Orchester kom-men ließe, wenn ich lauter Franzosen und Fran-zösinnen […] verschriebe […]; so würde Dir die-ses gewiß besser gefallen, als eine KompanieGrenardiers; […] aber ein petit maître, ein Fran-zösechen, ein bon-mot, ein Musiquechen undKomödiantechen, das scheinet was Nobleres,das ist was Königliches das ist digne d’unPrince“18, spottete der Vater am 28. August 1731in einem Brief an den Sohn. Reinecke bemerktin seinem bereits zitierten Aufsatz dazu: „ImHintergrund aber – und auch hintergründig, je-denfalls hinter dem Rücken des Vaters – warFriedrich schon in jene zweite Welt eingetaucht,in die der Aufklärung. Sie zielte […] auf die Zu-wendung zu dem, was man für die Natur hielt.Unter den vielen Symbolen dieser Hinwendungbefanden sich auch solche, die zum Erklingengebracht wurden: die Traversflöte oder auch dieMusette du cour. Sie färbten den klingendenHintergrund der Atmosphäre dieses Auf-bruchs.“19
Bereits zu dieser Zeit – also noch vor seinem Re-gierungsantritt als König von Preußen –verschaffte sich Friedrich einen Ruf alsausgezeichneter Musiker und Flötist. Sowürdigt ihn Johann Philipp Eisel in sei-nem 1738 erschienenen Musicus autodi-daktos in dem Artikel über die Travers-flöte: „Dieses belobte Instrument hatwegen seines insinuanten [sanften] Tho-nes sowohl in Frankreich als Teutsch-land viele hohe und vornehme Liebha-
bers gefunden, welche solches vortrefflichexcoliret, inmassen vielen nicht unbekannt seynwird, daß Ihro Königliche Hoheit, der Cron-Printz in Preussen es auf diesen Instrument so
„Travers-Flaute.Manch grosen Cavalier kan ich nach Wunsch ergötzenwan Mars vor Blut Wuth bißweilen Friede gibt:so kan den freyen geist mein Schall in Ruhe setzenja fast bey jederman bin ich allzeit beliebt,das zarte Frauen Volck pflegt selbsten mich zu ehrenund offt bey stiller Nacht mit Lusten anzuhören.“17
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wur-de in Frankreich aus der zweiteiligen Querflötemit zylindrischer Bohrung ein dreiteiliges In-strument mit einer Klappe und konischer Boh-rung entwickelt.13 Entscheidenden Anteil daranhatten die Mitglieder der Instrumentenbauer-und Musikerfamilie Hotteterre. Ausgehend vonFrankreich wurde die Traversflöte in der erstenHälfte des 18. Jahrhunderts zu einem der belieb-testen Instrumente überhaupt. Jacques Hotte-terre „le Romain“ (1674–1763) veröffentlichte1707 die erste Anleitung (Schule) für die FlûteTraversière.14 In der Einleitung zu dem 1728 inAmsterdam erschienenen Nachdruck seinerPrincipes nennt Hotteterre die Flöte „un Instru-ment des plus agreables, & des plus à la mode“.15
Joachim Neimetz berichtet etwa zur selben Zeit aus Paris: „Les instrumens, auxquels on s’attachoit le plus en ce tems là à Paris, sont leClavessin & la Flûte Traversière ou Allemande.Les François jouënt aujourd’hui de ces instru-mens, avec une dellicatesse nonpareille.“16
Beschränkte sich das Repertoire zunächst in ers-ter Linie auf Werke der Kammermusik, so wur-de durch das Auftreten Michel Blavets (1700–1768) in den Pariser Concerts spirituels ab 1726die Flöte auch als Soloinstrument im Konzertetabliert. Bemerkenswert ist, dass sie von An-fang an in Kreisen des Adels geschätzt wurde.So wird schon in der um 1720 entstandenen Bil-derfolge Musikalisches Theatrum von JohannChristoph Weigel der Flötist folgendermaßencharakterisiert:
Nicht ohne Einfluss auf die Rezeption des In-struments in Deutschland blieb das Flötenspieldes preußischen Kronprinzen und späteren Kö-nigs Friedrich II. Ohnehin dem aus Frankreich
486 TIBIA 3/2011
Rüdiger Thomsen-Fürst
ästhetischen Ideal der Zeit, für Reinecke ist siein der Konsequenz eine Metapher einer neuenWeltsicht: „Die Traversflöte hatte im 18. Jahr-hundert von der ,Querpfeiffen […]‘ […] einemeher rohen Instrument von Bauern und Lands-knechten, in der naturorientierten Ideenwelt vonBukolik und Landidylle eine symbolträchtigeUmdeutung erfahren, die mit einer deutlichenklanglichen Veränderung einherging: Die Weich -heit des Klanges und ,naturgemäße‘ Verwen-dung machten sie zu einer Metapher von Emp-findsamkeit und ,Natur‘, die Flûte traversière
färbte über die Musik hinaus den Charakter einerneuen Weltsicht.“22
Christian Friedrich DanielSchubart benennt in seinenIdeen zu einer Ästhetik derTonkunst die Flöte alsHerrscherinstrument: „Diegrössten Fürsten, wieFriedrich der Grosse, undder Churfürst Carl Theo-dor von Pfalzbayern, habendiess Instrument zu ihrem
Lieblinge gewählt, und die trefflichsten Flöten-spieler an ihren Höfen unterhalten. […] Da mansie leichter als ein anderes Instrument überall mitsich herumführen kann, so ist dadurch heutigesTages die zahllose Menge von Dilettanten aufder Flöte entstanden.“23
Auch in Mannheim wurde die Flöte als idealty-pisches Instrument der arkadischen Schäferweltangesehen, wie Georg Joseph Voglers Ausfüh-rungen im Artikel „Flöte“ der Deutschen Ency-clopädie belegen: „Diese unsere wonneduftendeFlöte ist das in der Musik, was man in der Male-rey den Ton nennet, der einer Landschaft beyschönem duftigen Herbstwetter zukömmt, derdas Sanfte und Gefällige einer Gemüthsart cha-racterisirt […]. Die Flöte ist kein Hirten= aberein Schäferinstrument, sie schickt sich zu keinerBauernstimme; denn hier sind die kleine Flöt-chen und andere Pfeifen passender angebracht,sie aber ist das Mittel, eine edle Bergerie oderPastorale auszuzieren. […] Die Flöte ist dasjeni-
„Unvollständiges Verzeichniß nur der uns bekannten musikalischenErdengötterDer Kaiser, spielt das Clavier und das Violoncello.Die Königin von England, das Clavier, Ihr Lieblingskomponist istAbel.Ihr Gemal und der König von Preussen die Flöte.Der Churfürst von Pfalz=Bayern, das Clavier und die Flöte, abermit ausserordentlicher Schüchternheit. […]Der Marggraf von Baden, hat ehmals die Flöte,Der Marggraf von Brandenburg das Violoncello gespielt.“21
hoch gebracht, daß Sie viele Virtuosen darinnenübertreffen.“20
Auch wenn die Auseinandersetzung der Kom-ponisten mit dem Instrument nach 1740 zu-nächst nachließ, erfreute sich die Traversflöte ge-rade in Deutschland und gerade bei Dilettantenweiter großer Beliebtheit. Unter diesen ist diegroße Zahl regierender Fürsten besonders auf-fällig. Im Musikalischen Almanach auf das Jahr1782 wurde eine Statistik der musizierenden Re-genten veröffentlicht:
Immerhin hatten von den insgesamt 14 genann-ten hochgeborenen Musikern und Musikerinnenvier, also knapp ein Drittel die Flöte (König vonPreussen, König von England, Carl Theodorund Carl Friedrich von Baden) zu ihrem Instru-ment gemacht. Die Liste der blaublütigen Flö-tisten ließe sich problemlos verlängern: zu nen-nen wären beispielsweise Herzog LudwigRudolf von Braunschweig-Lüneburg, HerzogChristian IV. von Zweibrücken, Johann Fried-rich von Schwarzburg-Rudolstadt, Ludwig Wil-helm Fürst zu Bentheim-Steinfurt oder AnnaAmalia von Sachsen-Weimar.
Die Gründe für den Siegeszug des Instrumentszu Beginn des 18. Jahrhunderts waren vielfältig.Gegenüber anderen Instrumenten war die Flöteeinfach zu handhaben und ließ sich leicht an je-den beliebigen Ort transportieren. Verschleiß-teile, wie etwa Rohrblätter oder Saiten, die manbeständig ersetzen musste, waren nicht vorhan-den. Außerdem entsprach die Traversflöte dem
TIBIA 3/2011 487
… unsere wonneduftende Flöte …
ge Instrument, das die gekrönten Häupter, Re-genten und Fürsten vor allen andern zu wählenpflegen.“24
Ein ganz besonderes Instrument findet sich heuteim Museum der Pfalz in Speyer25 (s. Abb. 2). Eshandelt sich dabei um eine Flöte aus bemaltemPorzellan mit vergoldeten Verbindungsmuffenund Endstücken. In der älteren Literatur wirddieses wunderschöne Instrument der Franken-thaler Porzellan-Manufaktur zugeschrieben undauf „um 1760“ datiert.26 1755 war diese mit ei-nem kurfürstlichen Privilegium gegründet wor-den. Carl Theodor hatte ein besonderes Interes-se an der neu angesiedelten Industrie und ihrenProdukten. Er förderte das Unternehmen nachKräften, auch durch Subventionen. Als es den-noch zu einem finanziellen Misserfolg geriet, er-warb der Kurfürst die Manufaktur im Jahre 1762und führte sie zumindest nominell bis 1800 fort.Diese Flöte wie auch verschiedene andere ausPorzellan gefertigte Instrumente wurden nichtihres Klanges wegen hergestellt, sondern warensehr kostbare Schauobjekte. Die Spekulation,die Flöte könnte ein Geschenk oder ein Leis-tungsnachweis an den die Manufaktur protegie-renden Kurfürsten gewesen sein, hat natürlicheinen großen Reiz. Allerdings sind in jüngster ZeitZweifel an der Provenienz des Instruments auf -getaucht, und auch eine Herkunft aus der Kopen-hagener Manufaktur wird inzwischen für mög-lich, ja sogar für wahrscheinlicher gehalten.27
Seit den frühen 1750er Jahren vollzog sich dasLeben am Mannheimer Hof im saisonalenWechsel:28 Während der Wintermonate, diedurch die Festkreise anlässlich der Namens- undGeburtstage des Herrscherpaares im Novemberund des Karnevals geprägt waren, residierte derKurfürst in Mannheim. Prächtige Opernauffüh-rungen und Kirchenmusiken sowie die Orches-terakademien im Rittersaal des Schlosses warendie Höhepunkte des musikalischen Lebens. DenSommer verbrachte der Hof in Schwetzingen.Ihn begleitete nicht die gesamte Hofkapelle,sondern nur ausgesuchte Musiker. Insgesamtwurde in einer etwas kleineren Besetzung musi-ziert. Auf dem Spielplan des kleineren Schwet-zinger Theaters stand die Opera buffa, und auchdie Kammermusik erlangte eine größere Bedeu-tung. Im Schwetzinger Schlosspark ließ CarlTheodor mit dem sogenannten Badhaus auch einprivates Refugium errichten. Nach neueren For-schungsergebnissen wurde das Gebäude bereits1772 fertig gestellt und spätestens seit dem Julidieses Jahres genutzt.29
Einen anschaulichen Bericht über das Leben inder Sommerresidenz gibt Schubart in seiner au-tobiographischen Schrift Leben und Gesinnun-gen. Wann genau Schubart Mannheim undSchwetzingen besuchte, lässt sich nicht mit letz-ter Sicherheit klären, sein Besuch dürfte aber um1773 stattgefunden haben.30 Eingeschlossen inseine Aufzeichnungen ist die Beschreibung einer
Abb. 3: Querflöte, um 1760/80, Frankenthal oder Kopenhagen, Porzellan, Kupfer, Länge: 63,5 cm, Historisches Museum der Pfalz, Speyer, Inventarnummer HM 1975/45. Foto: Peter Haag-Kirchner
488 TIBIA 3/2011
Rüdiger Thomsen-Fürst
Zusammenkunft im Badhaus des SchwetzingerSchlossgartens: „Mitten unter diesen Ergözzun-gen erhielt’ ich schleunigen Befehl mich nachSchwezzingen zu begeben und vor dem Kur-fürsten zu spielen. Ein Befehl, der mir umso an-genehmer war, je schwerer es sonst viel, bei die-sem Fürsten Gehör zu finden. Ich fuhr mit demjungen Grafen von Nesselrodt dahin und wurdesogleich vor den Kurfürsten gerufen. Er befandsich seiner Gewohnheit nach, im Badhause, einem im schwezzingischen Garten liegendenzwar kleinen, aber ungemein geschmack-vollen Gebäude, die Prinzen Gallian und Ysen-burg, die Frau von Sturmfeder und noch ein PaarKavaliers waren bei ihm. Er hatte beinah allenGlanz, jede Miene der zweiflenden Hoheit –nach Klopstocks Ausdruk – abgelegt und schiennur guter Mensch und liebenswürdiger Gesell-schafter zu seyn. Sein Aeußeres kündigte Ge-sundheit und männliche Stärke an. Sein freund-licher Blik, den er auf Fremde und Einheimischeausstrahlt, mildert das Zurükschrökende seinerMacht und seines Ansehens. Man vergißt im An-blik seiner lichten Miene den Stern bald, der anseiner Brust flammt und seine Fürstengröße an-kündigt. Er empfieng mich so gnädig, daß sichmeine Blödigkeit, bald in Freimuth verwandelte.
Nachdem er sich sehr liebreich nach meinenUmständen erkundigt hatte; so spielte er selbst,beinah etwas furchtsam, ein Flötenkonzert vonzween Toeschi und dem Violonzellisten Danzybegleitet. Nach diesem spielte ich verschiedeneStükke auf dem Fortepiano, sang ein russischesKriegslied, das ich soeben gemacht hatte, standauf, sprach über Litteratur und Kunst und ge-wann des Kurfürsten vollkommenen Beifall. ,Ichwill Ihn öfters hören und sprechen,‘ sagt’ er mitder heitersten Miene, als ich Abschied nahm.“31
Schubarts Text ist eine der wenigen Quellen zurAufführung von Kammermusik am kurpfälzi-schen Hof überhaupt. Besonders wertvoll ist siedurch die ausführliche Beschreibung des gesell-schaftlichen Rahmens. Zusammenkünfte dervon Schubart beschriebenen Art fanden demzu-folge regelmäßig statt („seiner Gewohnheitnach“) und hatten in Schwetzingen ihren Platzim neu errichteten Badhaus. Die anwesendenPersonen waren außer dem Kurfürsten, einigeMitglieder der Hofgesellschaft und die Musiker.Schubart schildert Carl Theodor als Menschen,nicht als Herrscher, „er schien nur guter Menschund Gesellschafter“. Nach einer Begrüßung mu-sizierte der Kurfürst mit den Hofmusikern ein
Abb. 4:Das Badhaus im Schwet zingerSchlosspark, kolorierter Stahl-stich von Jury, ca. 1830 (Privat-besitz)
TIBIA 3/2011 489
… unsere wonneduftende Flöte …
„Flötenkonzert“. Anschließend spielte Schubartselbst und man trieb Konversation über Gegen-stände der Künste.
Sucht man nach Vorbildern für diese Szene, sodrängt sich der Vergleich mit derfranzösischen Salonkultur des an-cien régime geradezu auf. Kenn-zeichnend für den Pariser Salonwaren die Zusammenkünfte zu ei-ner bestimmten Zeit an einem be-stimmten Ort, veranstaltet von ei-ner Zentral-Person, meistens einerFrau, der Salonière, seltener aberauch von Männern. Zu den Salongesellschaftengehörten die Stammgäste, die Habitués, sowieKünstler und Gelehrte. Im Zentrum der Salon-aktivitäten stand das Gespräch, die Konversati-on, über Künste und Wissenschaften, je nachNeigung der Salonière aber auch das Musizieren,die Lektüre oder das Betrachten von Kunstwer-ken. Wichtig war das gleichberechtigte Ge-spräch, die scheinbare, temporäre Aufhebungder Standesunterschiede, die einen Dialog derpolitischen und der Geisteselite überhaupt erstermöglichte. Verena von der Heyden-Renschkonstatiert eine Rezeption dieser Pariser-Salon-kultur auch an den deutschen Höfen des 18.Jahrhunderts:„Aus der in den Pariser Salons ge-stifteten Begegnung zwischen Mitgliedern desHofes und den Repräsentanten der ,Républiquedes Lettres‘, den Gelehrten und Künstlern, gingeine neue Kultur der Eliten hervor, die sich überganz Europa ausbreitete, denn Paris als Haupt-stadt der Kultur wurde mannigfach nachgeei-fert.“32
Die Musiker, die Schubart im Schwetzinger Bad-haus antraf, gehörten zu einer erst in den Jahren1772/1773 neu geschaffenen Formation inner-halb der Hofmusik, der Kabinetmusik. Erstmalserscheint der Begriff im Hofkalender auf dasJahr 1773, im Zusammenhang mit dem „Cabi-netscopisten“ Andreas Buchsbaum, der anschei-nend für die neue Sparte 1772 angestellt wordenwar und zumindest bis 1774 auch als Bratscherin der Hofkapelle mitwirkte.33 Wahrscheinlichnur kurze Zeit später erfolgte die Ernennung des
Musiker der KabinetmusikCarl Joseph Toeschi (Direktor der Kabinetmusik, Violine)Johann Baptist Toeschi (Violine)Innozenz Danzi (Violoncello)Georg Ritschel (Violine)Andreas Buchsbaum (Kopist/Bratsche?)
bisherigen Konzertmeisters Carl Joseph Toeschizum Direktor der Kabinetmusik, der erstmalsim Hofkalender für 1774 erwähnt wird. AußerToeschi und Buchsbaum gehörten noch dreiweitere Musiker dieser Untergliederung an:
Es ist wohl kaum ein Zufall, dass die Fertigstel-lung des Schwetzinger Badhauses und die Ein-richtung der Kabinetmusik nahezu zeitgleich er-folgten. Viel mehr ist anzunehmen, dass dieKabinetmusik auch als Spezialensemble für ebendiesen neu geschaffenen Raum diente.
Eine auf Mannheim bezogene Definition des Be-griffs „Cabinetmusik“ gibt wiederum Georg Jo-seph Vogler in dem Artikel „Cammermusik“ derDeutschen Encyclopädie: „Cammermusik, istdiejenige musicalische Ergötzung, die in einemZimmer, oder gegen die gewöhnliche Musicsälegenommen, kleinern Gemache gehalten wird.Sie sollte eigentlich aus mehr als 5 oder 6 Perso-nen nicht bestehen. Sie ist das Mittel zwischenConcert- und Cabinetmusik, wie man diejenigezu nennen pflegt, wenn ein grosser Herr gewisseStunden bestimmt, wo er sich selbst in der Musicüben und belustigen will, wozu niemand, ausserden zur Begleitung erforderlichen Tonkünstlern,eingelassen wird. In Mannheim war ein beson-derer Cabinetscopist, der sonst nichts als Triosund die auch hinzu gehörigen Quatros ab-schrieb.“34 Ein solches „Quatro“ – von ihm alsFlötenkonzert bezeichnet – hörte Schubart beiseinem Besuch. Er folgt damit dem Sprachge-brauch der Zeit, wie er in verschiedenen ge-druckten und handschriftlichen Quellen auf-scheint und als Synonym für das Flötenquartettden Begriff „Concertino“ verwendet.35
Das Flötenquartett war eine Variante des Quar-tettsatzes ohne Generalbass, der sich lediglich
490 TIBIA 3/2011
Rüdiger Thomsen-Fürst
durch seine Besetzung mit Flöte, Violine, Brat-sche und Violoncello und den daraus resultie-renden Instrumentenspezifika, nicht aber in dergroßformalen Anlage und in den Satztechnikenvon den frühen Streichquartettkompositionenunterschied. Vermutlich wiederum von Parisausgehend wurde diese Besetzungsvariante nach1760 populär. Die ersten gedruckten Flötenquar-tette dürften Christian Ernst Grafs (1723–1804)sechs Quartette op. 2 sein, die 1760 in Paris er-schienen.36 Es folgten eine ganze Reihe weitererWerke, die entweder durch den Druck oder alsManuskript Verbreitung fanden. Seit der Mitteder 1760er Jahre veröffentlichten auch Mann-heimer Komponisten Flötenquartette. Zunächsttraten Christian Cannabich (1731–1798) undCarl Joseph Toeschi (1731–1788) hervor, die sichin dieser Zeit als Gäste des Herzogs ChristianIV. von Zweibrücken in Paris aufhielten (Toeschi1762/63; Cannabich 1764/65). Später publizier-ten Ignaz Fränzl, Georg Metzger und JohannBaptist Wendling weitere Sammeldrucke.
Dass Carl Joseph Toeschi zum wichtigstenKomponisten von Flötenquartetten in Mann-heim wurde – und das sowohl quantitativ alsqualitativ – ist nur konsequent: Die Organisati-on der Hofkapelle sah eine Arbeitsteilung vor,die den Kapellmeistern (Oper, Kirchenmusik)und Konzertmeistern bzw. Direktoren der In-strumentalmusik (Konzert, Ballett, Kammer-musik) sehr präzise formulierte Aufgabenberei-che zuwies.37 Die 35 bekannten Quartette vonToeschi belegen, dass er als Direktor der Kabi-netmusik auch für die Komposition neuer Wer-ke verantwortlich war und zum Repertoire bei-trug.
Die französische Salon- und Gesprächskulturdes 18. Jahrhunderts hatte auch einen erhebli-chen Einfluss auf die Kompositionspraxis, wieLudwig Finscher wiederholt hervorgehobenhat.38 Besonders das solistische (Streich-)Quar-tett wurde lange vor Goethes berühmter Äuße-rung als Gespräch unter vier vernünftigen Men-schen begriffen. Aus der Konversationskulturentlehnte Begriffe („dialogués“, „conversation“etc.) fanden seit der Mitte der 1760er Jahre in Pa-
ris und London verstärkt als Titelzusätze inDruckausgaben Verwendung. Eine Sammlungvon sechs Flötenquartetten Carl Joseph Toe-schis, die 1767 bei Venier in Paris erschien, trägtetwa den Titel Il Dialogo musicale. Bei dieserAusgabe findet sich, wie bei vielen anderen vonMannheimer Musikern herausgegebenen Wer-ken, der Hinweis auf den Dienstherren, denKurfürsten von der Pfalz. Zum einen war diesein Gütesiegel, zum anderen bedeutete die Er-wähnung natürlich auch einen Prestigegewinnfür den Regenten, der solch herausragendeKomponisten zu seinen Bediensteten zählte.Dass Mannheim zu einer wichtigen Pflegestättedes Flötenquartetts wurde, ist naheliegend: Eswar modern, auf der Höhe der Zeit und bot – imGegensatz zum reinen Streichquartett – demKurfürsten selbst eine adäquate Möglichkeit,seine musikalischen Fähigkeiten zu präsentieren.
Carl Theodors Flötenspiel und die Bevorzugungdieses Instruments in der Kammermusik Mann-heimer Hofmusiker lassen sich allein mit der in-dividuellen Vorliebe des Regenten nur vorder-gründig erklären. Diese Präferenzen sind auchals bewusste Adaption der französischen Kulturder Aufklärung zu verstehen. Sie sind damit Teilder (Selbst-)Inszenierung des Kurfürsten als auf-
TIBIA 3/2011 491
Musiklädle’sBlockflöten- und NotenhandelDer kompetente Partner an Ihrer Seite
Neureuter Hauptstraße 316D-76149 Karlsruhe-Neureut
Tel. 07 21/707291, Fax 07 21/78 2357e-mail: [email protected] (kostenlos) recherchieren und bestellenauf unserer Homepage: www.schunder.deUmfangreiches Blockflötennotenlager, weltweiterNotenversand, großes Blockflötenlager namhafterHersteller, Versand von Auswahlen, Reparatur-
service für alle Blockflötenmarken.
Kennen Sie unser Handbuch?Über 40.500 aktuelle Informationen im BereichBlockflötenliteratur & Faksimile. Als Download
auf unserer Homepage.
… unsere wonneduftende Flöte …
geklärten und fähigen („habilen“) Herrscher, ge-hören also ebenso, wenn auch weniger augenfäl-lig, zur höfischen Repräsentation, wie die prächtigen Opernaufführungen und die musi-kalischen Akademien. Dieses Herrscherbild ver-mitteln sowohl Ziesenis’ Gemälde von 1757 alsauch Schubarts Beschreibung aus den 1770erJahren und letztlich auch die zahlreichen No-tendrucke, die auf die Anstellung ihrer Urheberin der Hofkapelle Carl Theodors hinweisen.
______________ANMERKUNGEN1 Vgl. Stephan Hörner, Art. Cannabich, in: MGG 2, Per-sonenteil 4, Kassel [u.a.] 2000, Sp. 87–96.2 Vgl. Emily Jill Gunson: Johann Baptist Wendling(1723–1797): Life Works, Artistery, and Influence; includ-ing a thematic catalogue of all his compositions, Diss.Univ. of Western Australia 1999, S. 70–71.3 Hans-Peter Reinecke, Mutmaßungen über das Flöten-spiel Friedrichs des Großen. Ein Aspekt Preußischer Kul-turgeschichte, in: Hermann Danuser (Hg.): Das musika-lische Kunstwerk. Festschrift Carl Dahlhaus zum 60.Geburtstag, Laaber 1988, S. 395–401, hier: S. 397.4 Vgl. RIdIM online (http://mdzx.bib-bvb.de/ridim/in-dex.php): München, Bayerische Staatsgemäldesammlung,Inventarnummer/Signatur 3620, RIdIM-Sigel Mstag -786; Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen, Inventar-nummer/Signatur O 390, RIdIM-Sigel MHrm - 5.5 Vgl. ebd.: München, Bayerisches Nationalmuseum, Inv.Nr. R5783, RIdIM-Sigel Mbnm - 24 & Mstag - 750.6 Karin Schrader: Der Bildnismaler Johann Georg Ziesenis(1716–1776). Leben und Werk mit kritischem Oeuvreka-talog (= Göttinger Beiträge zur Kunstgeschichte 3),Münster 1995, S. 71.7 Bettina Wackernagel: Musikinstrumente des 16. bis 18.Jahrhunderts im Bayerischen Nationalmuseum, München1999, S. 107.8 Karin Schrader: Der Bildnismaler Johann Georg Ziese-nis, a.a.O., S. 70.9 Helmut Börsch-Supan: Deutsche und skandinavischeMalerei, in: Harald Keller (Hg.): Die Kunst des 18. Jahr-hunderts (= Propyläen Kunstgeschichte in zwölf BändenX), Berlin 1984, S. 410–411.10 Ebd.11 Ebd.; vgl. Wackernagel: Musikinstrumente des 16. bis18. Jahrhunderts, a.a.O., S. 107–109 u. 160, s. a. Emily JillGunson, Johann Baptist Wendling, a.a.O., S. 84–86.12 Vgl. dazu u. a. Stefan Mörz: Aufgeklärter Absolutismusin der Kurpfalz während der Mannheimer Regierungszeitdes Kurfürsten Karl Theodor (1742–1777) (= Veröffentli-chungen der Kommission für Geschichtliche Landeskun-de in Baden-Württemberg, Reihe B, 120), Stuttgart 1991;Jörg Kreutz: Aufklärung und französische Hofkultur im
Zeitalter Carl Theodors in Mannheim, in: Ludwig Fin-scher (Hg.): Die Mannheimer Hofkapelle im ZeitalterCarl Theodors, Mannheim 1992, S. 1–19; Lebenslust undFrömmigkeit. Kurfürst Carl Theodor (1724–1799) zwi-schen Barock und Aufklärung, Ausstellungskatalog undHandbuch, hg. von Alfried Wieczorek, Hansjörg Probstund Wieland Koenig, 2 Bde, Regensburg 1999.13 Zur Geschichte der Querflöte s. Walter Kreyszig, Art.Querflöte, in: MGG 2, Sachteil 8, Kassel [u.a.] 1998, Sp.1–50.14 Jacques Hotteterre: Principes de la flute traversière ouflute d’allemagne, de la flute à bec ou flute douce, et duHaut-bois par le Sieur Hotteterre-LeRomain, Faksimile-Nachdruck [der Ausgabe Amsterdam 1728] mit deut-scher Übertragung und einem Nachwort von Hans Joa-chim Hellwig (= Documenta Musicologica, Erste Reihe,Druckschriften-Faksimiles XXXIV), Kassel [u. a.] 1982.15 Ebd., Preface o. S.16 Joachim Christoph Nemeitz: Sèjour de Paris, Leyden1727, zitiert nach: Carla Christine Bauer: Michel BlavetsFlötenmusik: Eine Studie zur Entwicklung der französi-schen Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert (= Hoch-schulsammlung Philosophie/Musikwissenschaft 2), Frei-burg 1981, S. 20, Fn 27.17 Johann Christoph Weigel: Musicalisches Theatrum, hg.von Alfred Berner, Nachdr. der Ausg. Nürnberg (= Do-cumenta musicologica, Erste Reihe, Druckschriften-Fak-similes XXII), Kassel [u.a.] 1961, Blatt 11.18 Brief vom 28. August 1731, zitiert nach: Horst Richter:„Ich bin Komponist“. Friedrich II. von Preußen in seinenmusikalisch-schöpferischen Kronprinzenjahren in Ruppinund Rheinsberg, in: Ulrike Liedtke (Hg.): Die Rheinsber-ger Hofkapelle von Friedrich II. Musiker auf dem Wegzum Berliner „Capell-Bedienten“, Rheinsberg 1995, S. 11–50, hier: S. 17.19 Reinecke: Mutmaßungen über das Flötenspiel Friedrichsdes Großen, a.a.O., S. 398–399.20 Johann Philipp Eisel: Musicus autodidaktos oder dersich selbt informirende Musicus, Nachdruck der AusgabeErfurt 1738, Leipzig 1976, S. 86–87.21 Musikalischer Almanach auf das Jahr 1782, Alethinopel[Berlin], o. S.22 Reinecke: Mutmaßungen über das Flötenspiel Friedrichsdes Großen, a.a.O., S. 399.23 Christian Friedrich Daniel Schubart: Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, herausgegeben von Fritz und Mar-grit Kaiser, Hildesheim [u. a.] 1990, S. 324–325.24 Georg Joseph Vogler: Art. Flöte, in: Deutsche Encyclo-paedie 5, Frankfurt a. M. 1785, S. 247.25 Speyer, Historisches Museum der Pfalz, Inv. Nr. H. M.1975, 45 a–e.26 Emil Mohr: Eine Querflöte aus Frankenthaler Porzel-lan, in: Pfälzer Heimat, 28 (1977), S. 68–70.27 Freundliche Mitteilung von Dr. Ludger Tekampe (His-torisches Museum der Pfalz).28 S. dazu Bärbel Pelker: Sommer in der Campagne – Im-pressionen aus Schwetzingen, in: Silke Leopold/Bärbel
492 TIBIA 3/2011
Rüdiger Thomsen-Fürst
Pelker (Hg.): Hofoper in Schwetzingen. Musik Bühnen-kunst Architektur, Heidelberg 2004, S. 9–37.29 Ralf Richard Wagner: In seinem Paradiese Schwetzin-gen … Das Badhaus des Kurfürsten Carl Theodor von derPfalz, Ubstadt-Weiher [u. a.] 2009, S. 59 ff.30 Wiltrud Heber: Die Arbeiten des Nicolas de Pigage inden ehemals kurpfälzischen Residenzen Mannheim undSchwetzingen (= Manuskripte zur Kunstwissenschaft inder Wernerschen Verlagsgesellschaft 10), Worms 1986, S. 505 u. 508.31 Christian Friedrich Daniel Schubart: Leben und Gesin-nungen. Von ihm selbst im Kerker aufgesetzt, Nachdruckder Ausgabe Stuttgart 1791 und 1793 mit einem Nach-wort von Claus Träger, Leipzig 1980, S. 208–209.32 Verena van der Heyden-Rynsch: Europäische Salons.Höhepunkte einer versunkenen weiblichen Kultur, Mün-chen 1992, TB-Ausgabe Reinbek 1995, S. 91.33 Hofkalender geben in der Regel den Personalstand vomHerbst des dem Nennjahr vorhergehenden Jahres wie-der.34 Georg Joseph Vogler: Art. Cammermusik, in: DeutscheEncyclopaedie 4, Frankfurt a.M. 1780, S. 874–875, hier: S.874.35 Als Beispiel lässt sich etwa ein Quartett Christian Can-nabichs anführen, das in einem Sammeldruck mit dem Titel Six Quartetti et Quintetti (RISM BII S. 295; 1766)als Nr. 1 enthalten und in den Stimmen als Concertino oQuartetto bezeichnet ist. Johann Baptist Wendlings dreiFlötenquartette op. 10 von 1781 tragen den Titel TroisQuatuors Concertants, in den Stimmen lautet die Be-zeichnung wiederum Concertino, eine handschriftlicheSammlung von sechs Quartetten Carl Joseph Toeschis istals VI Concertini bezeichnet (Samtarchiv der Schenkenzu Schweinsberg, Hessisches Staatsarchiv Marburg, Be-stand 340, Musikalien Nr. 48).36 Vgl. Ute Omonsky: Art. Graf, in: MGG 2, Personenteil7, 2002, Sp. 1460–1464. Möglicherweise muss die Datie-rung durch weitere Untersuchungen präzisiert werdenund auch die Frage nach der Autorschaft der Brüder Grafist evtl. neu zu entscheiden.37 Vgl. Bärbel Pelker: Ein ›Paradies der Tonkünstler‹? DieMannheimer Hofkapelle des Kurfürsten Carl Theodor,in: Ludwig Finscher, Bärbel Pelker, Rüdiger Thomsen-Fürst (Hg.): Mannheim – Ein Paradies der Tonkünstler?Kongressbericht Mannheim 1999 (= Quellen und Studienzur Geschichte der Mannheimer Hofkapelle 8), Frankfurta. M. [u. a.] 2002, S. 9–33.38 Vgl. u. a. Ludwig Finscher: Studien zur Geschichte desStreichquartetts, I: Die Entstehung des klassischenStreichquartetts. Von den Vorformen zur Grundlegungdurch Joseph Haydn (= Saarbrücker Studien zur Musik-wissenschaft 3), Kassel 1974, S. 83–84; ders., Galanterund gelehrter Stil. Der kompositionsgeschichtliche Wandelim 18. Jahrhundert, in: Sabine Ehrmann-Herfort, LudwigFinscher, Giselher Schubert (Hg.): Europäische Musik-geschichte 1, Kassel 2002, S. 587–665, hier: S. 588–596.
TIBIA 3/2011 493
22. BERLINER TAGEFÜR ALTE MUSIK
14. - 16. Oktober 2011
Konzerthaus BerlinFranzösische Friedrichstadtkirche
St. Hedwigs-KathedraleKonzerte
(Änderungen vorbehalten)Ensemble Speculum-Mariví Blasco (Sopran)Orchester B'Rock-Rodolfo Richter (Violine)
Ensemble Les CyclopesBibiane Lapointe - Thierry MaederAntonio Politano (Blockflöte)
Claudia Pasetto (Viola da gamba)Salvatore Carchiolo (Cembalo)
Ensemble Fontana di Musica (Berlin)Kinderprogramm u.a.
MusikinstrumentenmarktInternationale Ausstellung mit Kopien historischer Instrumente 14./15. Oktober
Workshops/VortragBlockflöte, Cembalo u.a.
Auskünfte/Anmeldungars musica, Postfach 580411, 10414 Berlin Tel. (030) 447 365 72; Fax: (030) 447 60 82
Anmeldeschluss für Instrumentenbauer/
Musikalienhändler: 01.10.2011
… unsere wonneduftende Flöte …
494 TIBIA 3/2011
Blockflötenorchester und Ensemblespielmit unterschiedlichen Spielniveausfür Kinder und Jugendliche ab 7 JahrenWorkshops für Blockflötenlehrer
mit Nadja SchubertKinderkonzert „Julius der Flötenspieler“
mit Flautando KölnGroßes gemeinsames Abschlusskonzert
Marktplatz rund um die BlockflöteRahmenprogramm für die ganze Familie!
Kanonenstr.4 29221 Celle Tel.: 05141/916 [email protected] www.kreismusikschule-celle.de
10.September 201110.00 - 18.00 UhrCD Kaserne Celle
Informationen und Anmeldungwww.kreismusikschule-celle.de
Anmeldeschluss ist der 20. Juli 2011
Das junge BlockflötenfestivalROCK around the BLOCK!
Spiel
mit!
TIBIA 3/2011 495
Peter Spohr wurde 1949 in Frankfurt am Maingeboren. Nach langjährigem Klavierunterrichtmachte er an Dr. Hoch’s Konservatorium inFrankfurt bei Werner Richter eine Ausbildungauf der Böhmflöte. Anfang der 1970er Jahrelernte er autodidaktisch das Spiel auf der baro-cken Traversflöte, später vertiefte er seine Kennt -nisse und Fertigkeiten in Kursen, u. a. bei Ste-phen Preston. Er ist leidenschaftlicher Sammlerhistorischer Querflöten und stellte schon meh-rere Ausstellungen mit fremden und eigenen In-strumenten zusammen. Er hält Vorträge und hatauch Aufsätze zur Flötengeschichte, zu histori-schen Flöten und Flötenbau und zur Auffüh-rungspraxis Alter Musik veröffentlicht. Außer-dem konzertiert er auf barocken, klassischenund modernen Flöten. Im Hauptberuf ist PeterSpohr Inhaber und Leiter eines Betriebes in derMessgerätebranche.
Peter Thalheimer: Du besitzt eine der bedeu-tendsten privaten Querflötensammlungen. Wiewird man zum Flötensammler? Gab es ein„Schlüsselerlebnis“?
Peter Spohr: Ja, das gab es schon. Ich habe mitFreunden schon zu Schulzeiten Kammermusik
gemacht, und der Lehrer des Oboenspielerswusste, dass wir zusammen musizieren. Er hattenoch einige alte Flöten im Schrank, und die hater mir damals geschenkt. Dadurch wurde meinInteresse an alten Instrumenten und auch andem Spiel auf diesen geweckt in einer Zeit, alsdie damals „historisierend“ genannte Auffüh-rungspraxis noch wenig verbreitet war.
Welches sind Deine Sammlungsschwerpunkte,wo liegen die Grenzen?
Ich sammle nur Querflöten der europäischen so-genannten Kunstmusik. Bedingt durch das An-gebot beginnt die Sammlung mit der Barockzeitund reicht – von wenigen späteren Ausnahmenabgesehen – bis in die Zeit vor dem 2. Weltkrieg.Zu den Schwerpunkten: Instrumente reizenmich, wenn sie gut spielen, eine hohe Hand-werkskunst repräsentieren, interessante Mecha-niken bzw. Griffsysteme oder andere konstruk-
Das Porträt:Peter Spohr
Peter Thalheimer im Gespräch mitdem Flötensammler Peter Spohr
Foto: Robert Bigio
Peter Spohr
496 TIBIA 3/2011
Buchsbaumflöte von Charles Bizey, Paris ca. 1735
tive Details aufweisen oder wenn sie, z. B. durcheinen berühmten Vorbesitzer, noch weitere –auch außermusikalische – Anknüpfungspunktebieten. Der Reiz des berühmten Erbauers fälltglücklicherweise meist mit hervorragendenSpielqualitäten und einer überdurchschnittli-chen Handwerkskunst zusammen.
Das Sammeln historischer Musikinstrumentewurde in der Anfangszeit der Alte-Musik-Bewe-gung sehr aktuell: Die Instrumente wurden zumSpielen gebraucht und deshalb gesucht und ge-kauft. Wie hat sich der Trend zum Spielen aufKopien oder freien Nachbauten auf die Samm-ler-Szene ausgewirkt?
Es ist sicher richtig, dass noch in den 1960er und1970er Jahren historische Instrumente aus Man-gel an Kopien von Spielern gekauft wurden.Auch heute gibt es glücklicherweise noch pro-fessionelle Spieler, die sich aus Interesse auch einOriginalinstrument anschaffen, was z. B. beimehrklappigen Flöten von nicht allzu berühm-ten Erbauern deutlich preiswerter als eine Kopiesein kann. Ich denke aber, dass die großen In-strumentensammlungen, von denen sich heuteviele in Museen befinden, nur ausnahmsweisevon Musikern auf der Suche nach geeignetenSpielinstrumenten angelegt wurden.
Was ich in den bald vier Jahrzehnten meinerSammlertätigkeit beobachten konnte, ist einstarker Rückgang des Angebotes an interessan-ten originalen Holzblasinstrumenten. Währendbesonders in den Jahren um das Jahr 1990 bei in-ternationalen Auktionshäusern jeweils mehr-mals im Jahr ein riesiges Angebot an historischenHolzblasinstrumenten zu finden war, hat z. B.Sotheby’s in London Auktionen mit diesen In-strumenten schon seit vielen Jahren eingestellt.
Auch Online-Auktionen wie eBay haben hier –zumindest auf qualitativem Gebiet – keinenAusgleich geschaffen. Die Gründe hierfür sindschwer herauszufinden: Ich denke, der Erfolgder Alte-Musik-Bewegung mit der Benutzunghistorischer Instrumente und vielleicht auch ge-legentliche Sensationsmeldungen mit Rekord-preisen für alte Instrumente (natürlich haupt-sächlich Geigen) haben in der Vergangenheitdazu geführt, dass auch schon fast vergesseneHolzblasinstrumente im Privatbesitz vonNicht-Sammlern in der Hoffnung auf einen guten Preis zum Verkauf angeboten wurden, bisdieser Bestand sich entsprechend verminderthat. Ein anderer Trend ist die Stagnation undteilweise der deutliche Rückgang der Werte bzw.der Verkaufspreise bei historischen Musikin-strumenten seit einiger Zeit, wozu sicher auchweltweite Wirtschafts- und Finanzkrisen beige-tragen haben. Wie auch bei Antiquitäten und anderen Kunstobjekten sind hiervon nur die allerseltensten und erlesensten Stücke ausge-nommen.
Mehrere Exemplare Deiner Sammlung sind heu-te als Vorlagen für Kopien bekannt. Wie schätztDu die Qualitäten der Kopien im Vergleich zuden Originalen ein?
Die meisten jetzt auf dem Markt befindlichenKopien sind sehr gut, insbesondere was Hand-habbarkeit und Intonation betrifft. Auch sindsie an die heute normierten Stimmungen ange-passt. Das Problem ist, dass die heutigen Instru-mentenbauer viel Rücksicht darauf nehmenmüssen, dass ein Instrument universell verwend-bar ist, weil es sich die Musiker in der Regel nichtleisten können, für jeden Musikstil (und dannnoch für verschiedene Stimmungen) ein Extra-Instrument anzuschaffen und sich dazu noch je-
Porträt
TIBIA 3/2011 497
Einhandflöte aus Kokusholz von Hill, late Monzani, London ca. 1830, gebaut für Chevalier Rebsomen
weils auf dieses einzustellen. Was zugegebener-maßen schwer definierbare Eigenschaften wieCharakter, Spielgefühl, Klangschönheit, leichteAnsprache usw. betrifft, „gewinnen“ gute Ori-ginale im direkten Vergleich fast immer. Es istdurchaus wahrscheinlich, dass viele Originaledurch lange Benutzung in dieser Beziehung bes-ser geworden sind, trotzdem glaube ich, dass diesogenannten Geheimnisse der früheren Instru-mentenbauer noch nicht völlig aufgedeckt sind.Nach meiner Meinung resultiert die Qualitätnicht aus wenigen Einzelheiten (man denke anden Kult um Stradivaris mysteriösen Lack), son-dern aus dem Zusammenwirken aller klangbe-stimmenden Faktoren. Ich denke, bei Kopiensollte z. B. die Skala (Tonlochlage und -größe)und der Bohrungsverlauf mit den Unterschnei-dungen nicht für eine möglichst klaviermäßigeIn tonation angepasst werden, sondern die klang -lichen Auswirkungen dieser Faktoren beim Ori-ginal sollten besser berücksichtigt werden.
Durch die verbesserten Ausbildungsmöglichkei-ten wächst die Zahl der professionellen Spielerhistorischer Querflöten ständig. Wie groß ist de-ren Interesse an Originalen? Kommen etwa vielePalanca-Spieler zu Dir, um das Original der Flö-te zu sehen und zu spielen, die sie täglich in Kopiebenutzen?
Einige schon, teilweise sogar Hochschullehrermit ihren Studenten, worüber ich mich sehrfreue. Unabhängig davon, wer die – wie zuvorerwähnt meist sehr guten – Kopien gemacht hat,sind die Besucher in der Regel sehr erstaunt überdie beträchtlichen Unterschiede zum Original.Das lässt vielleicht auch Zweifel an der in man-chen Museen gern vertretenen These aufkom-men, zur Beurteilung der klanglichen und spiel-technischen Eigenschaften genüge eine (mög-
lichst auf 1/100mm genau gemachte!) Kopie.Andere Besucher sind natürlich Sammlerfreun-de und Instrumentenbauer, die überprüfenmöchten, ob ihre Kopien dem Charakter desOriginals nahe kommen, unabhängig von denschon genannten Zwängen des Marktes.
Es ist immer wieder verwunderlich, dass Spielereine Kopie benützen und das Original nie gese-hen haben, das aber auch nicht als wirklich stö-rend empfinden.
Ein professioneller Spieler, der sich meist auchaus Gründen des harten Berufsalltages nicht beijedem neuen Stück auf ein anderes Instrumenteinstellen kann, ist in der Regel zufrieden, wennseine Kopie gut funktioniert bezüglich Anspra-che, Intonation, Klang und Lautstärke bzw.Tragfähigkeit. Wenn man ein intonatorisch heik-les Stück spielen muss, wie z. B. das MusikalischeOpfer, wird man kein Original nehmen, bei demdie Gabelgriffe schlecht stimmen – das ist derZwang der Verhältnisse. Sich trotzdem noch mitOriginalen zu beschäftigen, ist ein sich – aus mei-ner Sicht auch musikalisch – lohnender Luxus.
Die heutigen Einheitsstimmungen 392, 415, 430und 466 Hz haben den Siegeszug angetreten.Was bedeutet das für die Verwendung und denNachbau der Originale?
Die genannten Einheitsstimmungen sind beiOriginalen selten zu finden, eine Normierungist aber für große Besetzungen ein unvermeid -licher, wenn auch oftmals nicht befriedigenderKompromiss. Viele barocke Originale stehenzwischen 400 und 410 Hz, und ihr Klang undihre Spieleigenschaften verändern sich deutlichbei den heute üblichen Umrechnungsmethodenauf die genormten Stimmungen. Die Verwen-
Peter Spohr
498 TIBIA 3/2011
Silberflöte Nr. 53 von Theobald Boehm, München 1851
dung von Originalen oder von in der Stimmungunveränderten Kopien findet man deshalb meistnur bei Solostücken bzw. bei kleineren Beset-zungen.
Nach den Anfängen mit der Barockmusik ist dieAufführungspraxis mit historischen Instrumen-ten mittlerweile ja bei Wagner und Brahms an-gekommen. Hat sich das auf den Sammler-Markt ausgewirkt?
Ja, ein wenig bestimmt. Andererseits war schonlänger bekannt, dass auch die späteren Instru-mente wie z. B. die Wiener Flöten von Koch undZiegler oder die Instrumente von Liebel undMeyer interessant sind. Sie waren unter Samm-lern schon immer gesucht und wurden dann imZuge der Verwendung historischer Instrumentefür die romantische und spätromantische Musikauch kopiert.
Schon die Notenhandschrift kann entscheidendeHinweise auf die musikalische Gestaltung ge-ben. Um wieviel mehr kann dies das Instrument,welches dem Komponisten zur Verfügungstand. Es ist hochinteressant, z. B. die Schulender Zeitgenossen Nicholson und Drouët mit ih-ren originalen Flöten zu erarbeiten, und die Ver-wendung einer originalen Grenser-Flöte beiMozart oder einer originalen Meyer-Flöte in ei-nem konsequent mit historischen Instrumentenbesetzten Orchester bei Brahms (wie ich esschon erlebt habe) kann neue klangliche und ge-stalterische Welten eröffnen. Um Missverständ-nisse zu vermeiden, möchte ich anfügen, dass ichdas historische Instrument natürlich nicht fürausschlaggebend oder gar für unverzichtbar füreine überzeugende Interpretation halte.
Viele interessante Originalinstrumente werdenheute in Museen aufbewahrt. Während es vor 30
oder 40 Jahren für Fachleute noch möglich war,diese Instrumente anzuspielen, hat sich in denletzten Jahrzehnten die Politik der Restaurato-ren vom Restaurieren zum Konservieren gewan-delt. Damit wurden historische Flöten zu An-schauungsobjekten, die mit Handschuhenanzufassen sind und keinesfalls angeblasen wer-den dürfen. Wie siehst Du diese Tendenzen alsPrivatsammler?
Ich kann die Verantwortlichen bei den Museenverstehen, dass sie ängstlich sind, oftmals auchaus mangelnder Sachkenntnis, und weil in derVergangenheit einiges beim Spielbarmachen –vielleicht noch mehr als beim Spielen – beschä-digt und falsch gemacht wurde. Andererseits istmir in fast 40 Jahren kein einziges Instrumentmeiner Sammlung beim Spielen neu gerissen,und ich habe auch auf den empfindlicherenEbenholz- und Elfenbeinflöten Konzerte gege-ben. Eine behutsame Vorbereitung und Behand-lung der Instrumente, eine genaue Beobachtungund die Vermeidung einer Überbeanspruchungsowie viel Fachkenntnis und Erfahrung sindhierfür natürlich Voraussetzung. Ich denke, an-dere vermeidbare Risiken für Museumsobjektewie Transporte innerhalb und außerhalb desMuseums werden trotzdem eingegangen, beiden Holzblasinstrumenten wird aber die Be-stimmung und wichtigste Eigenschaft des Ob-jektes, nämlich die Erzeugung von Klang, selbstzu Test- und Vergleichszwecken, unterbunden,was den Sinn der musealen Aufbewahrung re-duziert. Glücklicherweise versuchen alle mir be-kannten Privatsammler hier einzuspringen.
Europäische Musikinstrumentenmuseen habennur geringe Ankaufs-Etats. Das führt dazu, dasshäufig neu entdeckte Spitzeninstrumente nachAmerika oder Fernost verkauft werden. Ist daseine unvermeidliche Globalisierungs-Folgeer-
Porträt
TIBIA 3/2011 499
scheinung, die wir hinnehmen müssen? Odersollte diesem Trend entgegengetreten werden,wenn ja, wie?
Ein Instrument ist, wenn es nach Amerika oderFernost geht, für uns natürlich mühsamer er-reichbar. Es gibt dort aber genau so viele verant-wortliche Museen und Privatsammler. Es war inder Geschichte immer so, dass Kunstwerkedorthin gegangen sind, wo das meiste Geld oderdas größte wirtschaftliche Potenzial vorhandenwar. In einigen Ländern, z. B. in Italien undFrankreich, können Ausfuhrverbote für wert-volle oder bedeutende nationale Kulturgüterausgesprochen werden, was selbst bei Holzblas-instrumenten schon gelegentlich geschehen ist.Es gibt durchaus Argumente dafür, bedeutendeKulturgüter in ihrem Ursprungsland zu belas-sen, und ich kenne auch Flötensammler in meh-reren Ländern, die nur Instrumente ihres Hei-matlandes sammeln.
Das Auffinden und Erwerben von alten Musikin -strumenten gleicht ja oft einem Krimi. Besitzt Duein Instrument mit einer besonders ungewöhn -lichen oder kuriosen Entdeckungsgeschichte?
Da gibt es einige. In Amerika habe ich vor vielenJahren mehrere Instrumente aus einem Nachlassgekauft. Bei einer interessant aussehenden koni-schen Böhmflöte von einem mir damals unbe-kannten J. D. Larrabee fehlte das Fußstück, wel-ches der Besitzer dann nach längerem Suchendoch noch in einem Pappkasten fand. Ich nahmdie Flöte mit, und bei meinen Recherchen zuHause fand ich in einem Buch des bekanntenamerikanischen Flötenbauers Badger aus dem19. Jahrhundert, dass die erste Böhmflöte inAmerika von Larrabee gebaut wurde, aber leiderkein Instrument von ihm mehr erhalten sei. Dashat mich dann doch sehr gefreut.
Eine Sammlung muss wachsen. Gibt es Instru-mententypen, die Du noch suchst, die Dir nochfehlen?
Obwohl eine möglichst große Menge von In-strumenten nie mein Ziel war, gibt es immer
noch Angebote, denen ich nicht widerstehenkann. Es „fehlen“ natürlich hauptsächlich sehrgroße Raritäten, die vielleicht in meinem Lebennicht mehr zum Kauf angeboten werden oderdann völlig unerschwinglich sind. Dazu fallenmir momentan eine originale Renaissance-Flöte,eine Quantz-Flöte, eine Bassflöte des 18. Jahr-hunderts, ein Panaulon, ein Giorgi-Schaffner-Modell und eine schöne Porzellanflöte ein.
Lieber Peter, im Namen der Tibia-Leser dankeich Dir für dieses Gespräch.
Celle Tel: 05141 / 217298
ROHMER
Peter Spohr
500 TIBIA 3/2011
Der aus Lüttich stammende Komponist CarlRosier (1640–1725) gehört sicher zu den eherunbekannteren Musikern seiner Zeit. Dochkönnte ein Manuskript, das bisher kaum beach-tet worden ist, diesen Umstand – jedenfalls fürdie Blockflötisten – bald ändern. So sind in dembesagten Manuskript acht Sonaten für Blockflö-te und Basso continuo überliefert, die wiedereinmal das Blockflötenrepertoire um wertvolleund reichhaltige Originalliteratur erweitern. Eheein Blick auf die „neuen“ Stücke geworfen wer-den soll, lohnt es sich, der Frage nachzugehen,wer Carl Rosier eigentlich war.
Dank der Dissertation von Ursel Niemöller1 ha-ben wir ein relativ klares Bild über das Lebenvon Carl Rosier und sein kompositorischesSchaffen. Ein Taufregistereintrag vom26.12.1640 belegt seine Geburt in Lüttich. Überdie Jugend von Carl Rosier ist nur so viel be-kannt, dass er wohl eine Ausbildung als Geigergenoss. So wird er auch 1664 als solcher am Bon-ner Hof, der von 1650 bis 1688 von KurfürstMaximilian Heinrich regiert wurde, erwähnt,ehe er dann zwischen 1668 und 1673 das Amt alsVizekapellmeister am Hof bekleidetet. NachAusbruch des Holländischen Krieges 1672 flohder Kurfürst nach Köln und blieb bis zu seinemTod im Jahr 1684 in seinem Exil. Die Bonner
Hofkapelle wurde unter diesen Umständen auf-gelöst. Ursel Niemöller vermutet, dass Rosierzunächst dem Kurfürst nach Köln folgte. In denfolgenden Jahren verliert sich seine Spur etwas.Allerdings belegen der Druck Pièces choisies, ala manière italienne (1691) und zwei mit „CR“signierte Autographe (1695/96)2 ein Wirken inden Niederlanden, speziell in Amsterdam gegenEnde des 17. Jahrhunderts. Als Geigenvirtuosegründete er unter anderem mit dem aus Thürin-gen stammenden Organisten Hendrik Anders(1657–1714) ein Collegium Musicum, das Kon-zerte in den Niederlanden veranstaltete. Zu Be-ginn des neuen Jahrhunderts übernahm Carl Ro-sier dann eine Anstellung als Domkapellmeisterin Köln. In dieser Zeit entstanden vor allemMesswerke und Motetten3. Dadurch konnte erbei besonderen Anlässen, wie bei der KölnerHuldigungsfeier zu Ehren des damals neu ge-krönten Kaiser Joseph I. (1687–1711), durch ei-gene Kompositionen hervortreten. Am 12. De-zember 1725 starb Carl Rosier.
Auch mehr als 280 Jahre nach seinem Tod ist dasKapitel Carl Rosier für die Musikwissenschaftnoch längst nicht abgeschlossen. Immer wiedertauchen an den unterschiedlichsten Orten4 Wer-ke auf, die das Leben und Schaffen Carl Rosiersum ein neues Detail erweitern. So befindet sich
Anne Kräft
Carl Rosier und seine Werke für Blockflöte – Sonaten aus einembisher kaum beachteten Manuskript
Anne Kräft studierte Blockflöte bei Michael Schneider und Martin Hublow im Studien-gang Instrumental pädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst inFrankfurt am Main. 2011 schloss sie außerdem ihr Studium der Musikwissenschaften beiProf. Dr. Peter Ackermann an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt ab.Neben ihrer Unterrichtstätigkeit und der Arbeit an ihrer Dissertation ist sie derzeit dabei,ihr Künst lerisches Studium im Fach Blockflöte zu beenden.
Anne Kräft
TIBIA 3/2011 501
aktuell in der Sibley Library der Eastman Schoolof Music in Rochester, New York, ein Manu-skript (hier „Rochester-Manuskript“ genannt),das bisher acht unveröffentlichte Sonaten fürBlockflöte und Basso continuo von Carl Rosier(im Manuskript als Roziers verzeichnet) bein-haltet. Das bisher nahezu unbeachtete Manu-skript, überschrieben mit Recueil de pieces choi-sies a une et deux fleutes enthält neben denRosierschen Werken weitere 33 Stücke von ver-schiedenen Komponisten. In einem ersten Teil,der mit „Flûte Seule / avec Basso continuo“ be-titelt ist, finden sich neben zwei Suiten (eine vonMarais, die andere anonym) 14 weitere Soloso-naten unterschiedlichster Komponisten, u. a.Finger, Paisible, Fiocco. In einem zweiten Teil,der mit „A deux Flutes / sans Basse“ überschrie-ben ist, sind 17 Blockflötenduette, ebenfalls vonFinger, Paisible, aber auch von Courteville sowieWilliams und Morgans enthalten5. Die Begriffe„Flute“ oder auch „Flauto“ wurden bis ca. 1750üblicherweise für die Blockflöte gebraucht.Auch der Ambitus von f1 bis e3 bestätigt die Be-setzung der Oberstimme mit einer Blockflöte.Neben den französischen Titeln sowohl derHandschrift, als auch der einzelnen Sonatenweist auch die im französischen Violinschlüssel
notierte Oberstimme auf den französischenSchreiber des Manuskripts – Charles Babel(1636–1716?). Alle Stücke stammen aus seinerHand. Peter Holman geht davon aus, dass Babeldie acht Sonaten von Carl Rosier direkt von demKomponisten in Holland erhalten hat.6 Ein Auf-enthalt in den Niederlanden gegen Ende desJahrhunderts ist ebenfalls für Charles Babel be-legt7, so dass ein Zusammentreffen durchausdenkbar erscheint. Um 1700 hielt Babel sich inLondon auf und nahm seine Handschrift, die aufdas Jahr 1698 datiert ist, wohl nach England mit.Für wen Babel diese Sammlung angelegt hat,kann bisher nicht geklärt werden. Mutmaßlichkönnte die Handschrift für einen Liebhaber ge-schrieben worden sein. Darauf deuten einigeAbweichungen mit vergleichbaren bekanntenKonkordanzen hin. So erscheint hier die Block-flötensonate von James Paisible in Es-Dur in derHandschrift von Babel in einer Transpositionnach F-Dur, was u. a. eine grifftechnische Er-leichterung für den Spieler zur Folge hat (vgl.Abb. 1). Ähnlich verhält es sich bei der bekann-ten Sonate in g-Moll des selbigen Komponisten.Hier allerdings wurde das virtuose Ende desletzten Satzes einfach weggelassen. Vermutlichwar es schlichtweg zu schwierig.
Abb. 1: James Paisible: Sonata XIII in Es-Dur nach dem Detroit-Manuskript8, Neufieme Sonnate in F-Dur nach demRochester-Manuskript, jeweils 1. Satz
Carl Rosier und seine Werke für Blockflöte
502 TIBIA 3/2011
Da bisher keine Konkordanzen zu den acht So-naten von Carl Rosier aus dem Rochester-Ma-nuskript bekannt sind, muss hier offen bleiben,ob und in welcher Form Änderungen aus derHand Babels vorgenommen worden sind. Eineninteressanten Umstand stellen vor allem Bezügeund Parodien aus Henry Purcells Semi-OperThe Fairy Queen dar. 1692 wurde das Stück erst-mals im Queen’s Theatre des Dorset Garden inLondon aufgeführt. Noch im selben Jahr er-schien in London ein Druck mit dem Titel SomeSelect Songs as they are sung in the Fairy Queen.Aus dieser Ausgabe erscheinen drei Lieder alsSätze in Rosiers Solosonaten9. Ob diese Sätzevon Rosier selber eingefügt worden sind oderob Babel dieses später vornahm, kann bishernicht geklärt werden. Fakt ist jedoch, das auchbei einer Sonate von Finger aus dem Rochester-Manuskript zwei Sätze zusätzlich im Vergleichzu anderen Quellen erscheinen. Es wurde bereitsangedeutet, dass die Handschrift eventuell füreinen englischen Liebhaber angelegt worden istund vielleicht wurden die Sätze ihm zum Gefal-len hinzugefügt. Vielleicht hat Carl Rosier aber
auch die Aufführung von Purcells Semi-Oper inLondon gesehen oder er kannte den Druck. Al-les das sind Spekulationen.
Um zu bestätigen, dass die acht Blockflötenso-naten auch tatsächlich von Carl Rosier stammen,kann ein Druck von ihm mit zwölf Triosonaten– ebenfalls für Blockflöte – herangezogen wer-den. Der Druck, der mit Pièces choisies, a la ma-nière italienne betitelt ist, erschien 1691 in Ams-terdam bei Amedée le Chevallier. Einige derdarin enthaltenen Sonaten wurden bereits in mo-dernen Ausgaben neu ediert10. Den Sonaten desDrucks und des Manuskripts ist eine unregel-mäßige Satzanzahl, von drei bis sieben Sätzen,gemein. Allerdings zeigt sich bei den Solosona-ten eine Hinwendung zur Viersätzigkeit, wie eszur Jahrhundertwende durch das Vorbild Co-rellis üblich wurde. Besonders auffällig ist derGebrauch der Satzbezeichnung „Canzon“ füreinen zumeist auf Imitation beruhenden Satz,der besonders in den Triosonaten oftmals nochein typisches Canzonenthema erkennen lässt(vgl. Abb. 2a). Markant ist außerdem eine gar
Abb. 2b: Canzonenthema aus der Solosonate Nr. 11, 3. Satz nach dem Rochester-Manuskript von Carl Rosier
Abb. 2a: Canzonenthema aus der Triosonate Nr. I, 4. Satz nach dem Druck Pièces choisies, a la manière italienne (1691)von Carl Rosier
Anne Kräft
TIBIA 3/2011 503
regelhafte Plazierung dieses Satztypus’ an dritteroder vierter Stelle innerhalb der Sonaten. So er-scheint auch in der Solosonate Nr. 11 des Ro-chester-Manuskripts als dritter Satz eine „Can-zon“, zwar nicht als ein imitierender Satz, aberdoch mit klar erkennbarem Canzonen-Thema(vgl. Abb. 2b).
Die Gesamtanlage der Trio- und Solosonaten fürBlockflöte zeichnet sich bei Carl Rosier durchden Gebrauch unterschiedlichster Satztypenaus. Alle Sonaten beginnen zumeist mit einemEinleitungssatz, der häufig ein langsames Tempoverlangt. Folgend wechseln sich Fugati, Tänzeoder freie Sätze mit Tanzcharakter mit langsa-men Zwischensätzen ab. Am Ende jeder Sonatefindet sich zumeist ein Tanzsatz. Am häufigsten
gebraucht Rosier die Allemanda, der er oftmalseine Courante folgen lässt, ohne diese als solchezu betiteln. Damit bedient er sich einer seit dem16. Jahrhundert belegten Tradition, bei der dieAllemande mit einer Courante zu einem Paarzusammengefasst wurde, um eine Kontrastie-rung geschrittener und gesprungener Schritte zuerreichen. Weiterhin lassen sich Giguen, Sara-banden und Tänze mit ostinaten Formprinzi-pien, wie der Passacaglia, finden.
Viele Sätze ähneln sich hinsichtlich ihrer Melo-diebildung und weisen Merkmale auf, die für dieKomposition von Gebrauchsmusik typischsind, wie ein enger Ambitus, einfacher Bau undtypisierte Rhythmik. Die gleichartige Melodie-bildung geht sogar so weit, dass er eine melodi-
Abb. 3: Gleichartige Melodiebildung in der Sonate Nr. 7, 1. und 4. Satz von Carl Rosier nach dem Rochester-Manu-skript
Carl Rosier und seine Werke für Blockflöte
504 TIBIA 3/2011
sche Idee in einer Sonate in mehreren Sätzen ver-wendet (siehe Abb. 3).
Rosiers Sonaten zeichnet vor allem ein Stilmixaus. Der Spieler findet neben barocken Fugenmanchmal noch fast frühbarocke Elemente, wiein den Canzonenthemen, und dann wiederumTänze sowohl im italienischen als auch im fran-zösischen Stil.
Die bislang fast vergessene Musik eines doch in-teressanten Komponisten verdient es, in Zu-kunft wieder hörbar gemacht zu werden.11 Vorallem lohnt sich eine weiterführende Beschäfti-gung mit Carl Rosier, da immer wieder neueQuellen zu Tage kommen, die das Repertoire er-weitern.
Editionshinweis: In Kürze erscheinen alle achtSolosonaten für Blockflöte und Basso continuoaus dem Rochester-Manuskript sowie sechs derzwölf Triosonaten für zwei Blockflöten undBasso continuo aus dem Druck Pièces choisies, ala manière italienne von Carl Rosier bei EditionWalhall, Magdeburg.
______________ANMERKUNGEN1 Niemöller, Ursel (1957): Carl Rosier (1640?–1725), Köl-ner Dom- und Ratskapellmeister, in: Beiträge zur Rheini-schen Musikgeschichte, hrsg. von der Arbeitsgemein-schaft für rheinische Musikgeschichte, Bd. 23, Köln 1957.2 In der Rowe Music Library des King’s College Cam-bridge werden zwei autograph überlieferte Sonaten vonCarl Rosier aufbewahrt. Über den Hinweis diesbezüglichbin ich Peter Holman zu Dank verpflichtet.3 Insgesamt sind 12 Messen im Autograph (darunter einefragmentarisch) und acht Einzelmotetten in der Zeit zwi-schen 1705 und 1721 überliefert. Für eine genaue Über-sicht siehe Niemöller, Ursel: Carl Rosier (1640?–1725),Kölner Dom- und Ratskapellmeister, a.a.O., S. 200-202.4 Neben den Bibliotheken in Rochester und Cambridgeverwahrt auch das Marien-Gymnasium in Jever eineSammlung, in der eine Sonate Carl Rosier zugeschriebenwird. Über Informationen diesbezüglich bin ich HartmutPeters sehr dankbar.5 Der Druck Quatorze Sonates a 2 Flustes, dont les 6 pre-miers sont composés par Mr. Fingher, les 6 suivants par Mr.Courtevill, et les 2 derniers par Mr. Paisible, der ebenfallsim Jahr 1698 bei Estinne Roger in Amsterdam erschien,stellt eine Konkordanz zu den Duetten aus der Hand-schrift von Babel dar.
6 Holman, Peter (1996): Booklettext zur CD TrioBasiliensis – Concerning Babell & Son, Music composed,arranged and transcribed by Charles and William Babell,erschienen 1996 bei Ars Musici, AM 1167-2.7 Gustafson, Bruce (1999): Artikel Babel, Charles, in: DieMusik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von LudwigFinscher, Personenteil Bd. 1, Kassel 1999, Sp. 1250-1251.8 Das Manuskript Sonates pour une fluttes et Basse wirdin der Detroit Public Library aufbewahrt.9 Es handelt sich um die Arien I am come to look all fast(Z629/12), If love’s a sweet passion (Z629/17) und Thusthe ever greatful spring (Z629/33); Werkeverzeichnis-nummern nach: Zimmerman, Franklin B. (1963): HenryPurcell (1659–1695) An analytic catalogue of his music,London 1963.10 Niemöller, Ursel (1957): Carl Rosier (1640?-1725), Aus-gewählte Instrumentalwerke, in: Denkmäler RheinischerMusik, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für rheinischeMusikgeschichte, Bd. 7, Düsseldorf 1957; Charles Rosier:3 Triosonaten für zwei Altblockflöten und Basso Conti-nuo, hrsg. von Ernst Kubitschek, bei Breitkopf & Härtel,Kammermusik-Bibliothek 2165, Wiesbaden 1982; CarlRosier: Zwei Triosonaten für zwei Altblockflöten undBasso Continuo, hrsg. von Hugo Ruf, bei Hortus Musi-cus, Nr. 231, Kassel 1986.11 Die einzige Aufnahme mit zwei Solosonaten von CarlRosier aus dem Rochester-Manuskript ist bislang: TrioBasiliensis – Concerning Babell & Son, s. Fußnote 6.
MA EUR CE STEGER G R TE T ST TC STI E R A M U
9 b 4 Septttt b r 20 1 0 1 2 1 e 0b r m e e be p e e S pt 4 e 1 4. 4. i b s 14. S is 9 i 9. bis 14. S9 SSch �h u er Block�öt t öt nn gt gea ette tae t öt k� e k öt c o k� l k B oc e s r u a se �h � a h �h c � a c
Bitt Bitt Bitt Bitt D D Bitte Bitte Bitt Bitt Bitt Bitt
N I BE N I
990041 (0)52 630 0999 9 99 09 99 99 63 09 6 0 0999 3 5 63 0) 2 630 0999 (0) (0 )5 0) (0 04 41 (0)52 630 09990 4 04 00 D D ffffo f f foorrd r : w wwwww kkkk kg b ockcko kl kb oc-gn -be -u n. uw k w wwn wr : e d rdo f d n o a o nfo s n os i o l nfiatet D aete
L L L LOCKFLLLLÖÖÖÖT NFEST FÜR AMMATEURE UND PRATEURE UND PRATEURE UND PRAAAA N T URE UND PR U D R U E TE RE UND PRT T ATE A T A Ü M F R ST ES T F ST N AES E T T N AÖ E KF T CK ÖCO KFOCK B OCKFLO
BLLLLOCKFLLLÖÖÖÖ ETENENSEMBLESL SB SMESNETET NTÖTKF TK ÖCO KFOB CO STRED PRIEST E T ST R S P I E R D
MA EUR C ST G R G R TE TC SE R I M U A
�o tt cch. hn he c.eto e�oetoeo�
PR R R SOFIS!I !OFIS!!OO I P OO R
SS
Anne Kräft
Summaries for our English Readers
Anne KräftCarl Rosier and his works for recorder. Sonatasfrom a manuscript almost neglected until now
A manuscript, almost neglected until now, withthe title Recueil de pieces choisies a une et deuxfleutes contains eight original recorder sonatasby the composer Carl Rosier (1640–1725) whowas born in Liege. The manuscript which at themoment is housed at the Sibley Library of theEastman School of Music in Rochester, NewYork, was transcribed by Charles Babel and isdated 1698. These handwritten pieces, which ad-ditionally include 33 further solo sonatas andduets also by Finger, Paisible, Fiocco, were pre-sumably written for an English lover. Up tillnow the manuscript is the only source which in-cludes the eight solo sonatas by Rosier. Thecomparison with the print of his twelve triosonatas Pieces choisies, a la manière italienne(Amsterdam, 1691) proves by the style of com-
position that he is the author. The eight solosonatas as well as the six trio sonatas for recorderand basso continuo by Carl Rosier are publishedby Edition Walhall in Magdeburg.
Rüdiger Thomsen-Fürst… unsere wonneduftende Flöte … [our blissfulfragrant flute]. Comments on chamber music forflute at the court of Carl Theodor in Mannheim
By their quantity alone, compositions with theflute have a prominent position in the repertoireof chamber music at the court in Mannheim inthe 18th century. This exceptional position em-phasises the appreciation that the Duke CarlTheodor had for the instrument. In this article,the author endeavours to interpret the compar-atively large proportion of chamber music forthe flute notwithstanding the Duke’s own pref-erence and to investigate its role in the contextof its representation at the court.
CoCoolsmaolsmaAura / ZamraAura / ZamraCoolsma soloCoolsma solo
&&
DolDolmmetschetschFür Qualität undFür Qualität und
exzellenten Serviceexzellenten Service
www.aafwww.aafab.nlab.nl
Jeremiestr. 4-6, 3511 TW Utrecht NLJeremiestr. 4-6, 3511 TW Utrecht NL+31 30 2316393 / [email protected]+31 30 2316393 / [email protected]
Montag bis Samstag 9 - 17 UhrMontag bis Samstag 9 - 17 Uhr
TIBIA 3/2011 505
Summaries for our English Readers
506 TIBIA 3/2011
Am 24. Februar 2011 wäre Konrad Lechner ein-hundert Jahre alt geworden, und just an diesemTag versammelte sich in der Staatlichen Musik-hochschule Freiburg (seiner letzten offiziellenWirkungsstätte) eine große Festgemeinde, umdieses besonderen und in vielerlei Hinsicht au-ßergewöhnlichen Menschen und Musikers zugedenken.
Die Feierstunde wurde einerseits mit Kammer-musik aus der Feder des Jubilars gestaltet undandererseits ergänzt mit Musik seiner Vorliebe:Motetten von Guillaume Dufay und Gamben-musik von Heinrich Isaac standen – pars prototo – ebenso auf dem Programm wie eine Im-provisation für Balinesischen Gong, Waldhornund Schalen, die Lechners Sohn Florian zusam-men mit der Hornistin Bettina Wojtalla darbot.
Die gesprochenen Beiträge begannen mit der Be-grüßung durch den Hausherrn Dr. Rüdiger Nol-te, der die Räumlichkeiten der Hochschule fürdiesen Anlass angesichts der herausragenden
Persönlichkeit des Musikers, Lehrers, Kom-ponisten und Gesprächspartners KonradLechner gerne zur Verfügung stellte.
Die lebendigst vorgetragenen ErinnerungenHans-Martin Lindes an seine Studienzeit beiLechner, der 1948 an die Freibuger Musik-hochschule kam, riefen bei den Anwesendenbreite Zustimmung hervor, weil so treffendgeschildert, und sie machten deutlich, wieüberaus herzlich, kritisch, polemisch, aus-drucksstark und eindrucksvoll der Unter-richt und die umfassende Musikvermittlungdieses Meisters gewesen sein muss.
Wie sehr sich die Musikerziehung seit denspäten 40er Jahren bis heute gewandelt hat,
beleuchtete Ludwig Holtmeier in seinem treff-lich gehaltenen Referat Gedanken zum Wandelzweier Berufsbilder – Anmerkungen zu KonradLechner als Theorielehrer. Ein anregender Bei-trag zu unseren aus heutiger Sicht fast selbstver-ständlichen Spezialisierungsvorgaben an dieMusiker-Ausbildung, denen Konrad Lechnerzeitlebens nicht nur kritisch, sondern – als mu-sikalischer Philosoph – vehement ablehnend ge-genüber stand.
Bevor Cordula-Maria Lechner, die Witwe desGeehrten, den Dank der Familie an die versam-melten Freunde, Kollegen und Schüler über-brachte, stand der eigentliche Höhepunkt der Fei-erstunde an: Die Buchvernissage und Vorstellungder Gedenkschrift In statu viatoris – Konrad Lech-ner: Leben, Werk, Erinnerungen, Dokumente1.
Sie bildete das Kernstück dieses Abends. PeterReidemeister überreichte als Herausgeber daserste Exemplar dem Rektor der FreiburgerHochschule und berichtete in groben Zügen von
Meinrad Schweizer
Die Ambivalenz des Zeitgeschehens – Zum 100. Geburtstag vonKonrad Lechner
Konrad Lechner 1977 Foto: Florian Lechner
Berichte
TIBIA 3/2011 507
der mehrjährigen Unternehmung des Zusam-mentragens von Dokumenten und Beiträgenehemaliger Schüler (Gerhard Braun, ErnstSchelle, Otto Laske, Hans Darmstadt, MatthiasSpahlinger u. a.), von Erinnerungen (FlorianLechner, Werner Heider, Dieter Schnebel, Jo-hann Georg Schaarschmidt, Hans Michael Beu-erle u. a.) und Zeitzeugnissen, Kommentarenund Berichten. Es ist das nicht hoch genug zulobende Verdienst des Lechner-Freundes und -Schülers Peter Reidemeister, der hier ein bril-lant gestaltetes, tiefgründiges und berührendesBuch voller Imagination und Bewegung heraus-brachte – nicht nur als Erinnerung an den großen
Menschen Konrad Lechner, sondern mehr nochals intensive Anregung zur Reflexion über unserheutiges Musikschaffen. Die darin angesproche-ne Vielfalt, das ungeheuer breite Spektrum, dieFaszination und das Suggestive des MusikersKonrad Lechner zeugen von einer fast ver-schwundenen Welt, und allein darum schon seidas Buch allen Musikliebenden wärmstens zurLektüre empfohlen.______________ANMERKUNGEN1 Konrad Lechner: In statu viatoris – Leben, Werk, Erin-nerungen, Dokumente. Eine Gedenkschrift, herausgege-ben von Peter Reidemeister, Bad Schwalbach 2011(edition gamma), EGA 242
Berichte
Traum und Tag (1975), zwölf Impressionen für Sopranblockflöte allein • Inhalt: How do you do, Mr. Byrd?; Traumflug; Bonjour, M. de laHalle; Leggiero; Hello, Mr. Dvorak; Schwarzer Schwan; Good Morning, Mr. Gibbons; Ferner Vogelsang; Fuge; Ferne Stunde; Doppia misura;Es sungen drei Engel • Spielpartitur • Sopranblockflöte solo • Edition Moeck Nr. 436 • € 3,00
Über den Sternen (ca. 1939) • Inhalt: Über den Sternen ruht mein Gedanke (SAT); Es sungen drei Engel (SAT); Ich hab die Nachtgeträumet (SAA); Tanzlied (SSA); Es gingen zwei Gespielen gut (SAT); O Magalima (SST); All voll (AAT), z. T. mit Texten • Spielpartitur •3 Spieler mit Sopran- bis Bassblockflöten in verschiedenen Kombinationen • Edition Moeck Nr. 460 • € 3,00
In dulci jubilo. Elf Weihnachtslieder • Inhalt: Nun kommt der Heiden Heiland (SAT); Es kommt ein Schiff (SAT); Was soll das bedeuten(SSA); In dulci jubilo (ST); Vom Himmel hoch, o Englein kommt (SAT); Christkindelein, komm doch zu uns herein (SAT) • Spielpartitur •3 Spieler mit Sopran- bis Bassblockflöten in unterschiedlichen Kombinationen • Edition Moeck Nr. 475 • € 3,00
Ziehende Wolken (1979). Tanzstücke für Blockflötenquartett. • Inhalt: Lento; Reigen; Litanei; Leggiero; Kontratanz • Spielpartitur •4 Blockflöten (SATB) in unterschiedlichen Kombinationen • Edition Moeck Nr. 496 • € 3,00
Spuren im Sand (1976) • Spielpartitur • Sopranblockflöte solo • Edition Moeck Nr. 1526 • € 7,30
Ludus juvenalis I (1975). Zwei Canzonen • Partitur und 1 Stimme • Sopranblockflöte und Klavier • Edition Moeck Nr. 2506 • € 11,50
Varianti (1976) • Spielpartitur • Tenorblockflöte solo • Edition Moeck Nr. 2508 • € 8,40
Engramme (1983/83) • 3 Spielpartituren • 1 Spieler mit Blockflöten (SinoSATB) im Wechsel, Cembalo und Schlagzeug • Edition MoeckNr. 2516 • € 15,20
Lumen in tenebris (1980) • 3 Spielpartituren • 3 Spieler mit Sopran- bis Bassblockflöten in verschiedenen Kombinationen und Schlag-zeug • Edition Moeck Nr. 2521 • € 13,00
Vom anderen Stern (1987). Zwanzig Epigramme • Inhalt: Hommage à Debussy; Fäden im Unsichtbaren; Teppich des Lebens; LockendesGestade; Grelle und harmlose Gestalten; Spiralen des Schweigens; Nürnberger Tand; Stampfende Füße; Flüsternde Wirbel; Hic est MagisterJacobus de Bononia; Leichter Sinn • Spielpartitur • Sopranblockflöte solo • Edition Moeck Nr. 2546 • € 9,40
Echo des Schweigens (1988). Acht Miniaturen • Inhalt: Echo des Schweigens; Aufbruch - wohin?; Unwirkliches; Spirale abwärts, Spiraleaufwärts; Irgendwo ist Ungarn; Schwebendes; Komm übers Wasser, Julietta; Vergilbtes Notenblatt, vom Vogel aufgepickt • Spielpartitur •Sopranblockflöte solo • Edition Moeck Nr. 2558 • € 6,30
Konrad Lechner im Programm des MOECK Verlags
MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K. Tel. +49-(0)5141-8853-0 | [email protected] Celle | Postfach 3131 Fax: +49-(0)5141-8853-42 | www.moeck.com
508 TIBIA 3/2011
Basel unter Leitung von Thilo Hirsch erstmalsseit seiner Entstehung wieder zum Klingen ge-bracht. Luis Benduschi, Andreas Böhlen, Hans-Christof Maier, Hans-Jürg Meier (Blockflöten),Thilo Hirsch (Trumscheit), Josef Focht (Bogen-gitarre) und Markus Schmied (Pauken, Perkus-sion) waren die Mitwirkenden. Als Kontrapunktzu dem Bogenhauser Repertoire wurden zweiKompositionsaufträge an Abril Padilla (*1965)und Hans-Jürg Meier (*1964) vergeben, „um dieExperimentierfreude der Bogenhauser Künstler-kapelle auch ins 21. Jahrhundert zu tragen.“
Das Konzert fand am 2. April 2011 im klassizis-tischen Saal des Naturhistorischen Museums Ba-sel statt, vorbereitet durch Vorträge von MartinKirnbauer, Thilo Hirsch und Josef Focht imMusikmuseum Basel. Weitere Aufführungensind in München und Berlin geplant.
Thilo Hirsch und sein Ensemble haben damitwichtige Aspekte der Wiederbelebung AlterMusik und alter Instrumente erlebbar gemacht.Dazu waren vielfältige Aktivitäten nötig, so dieRekonstruktion einer speziellen Spieltechnikdes Trumscheits und der Neubau einer Bogengi-tarre. Die Blockflötenspieler hatten es mit unge-wöhnlichen Hochtönen zu tun, die auf den Ori-ginalinstrumenten spielbar waren, auf denheutigen „Kopien“ jedoch nur mit geschlosse-nem Schallloch hervorgebracht werden können.Die Kombination von Alter Musik und For-schung, Neuer Musik und künstlerischen Fähig-keiten erreichte bei diesem Projekt einen Höhe-punkt. Das Ensemble um Thilo Hirsch agierteauf höchstem Niveau.
Allen, die in der Alte-Musik-Szene nicht nurmitschwimmen, sondern auch die Wurzeln derBewegung kennenlernen wollen, sei diese „ver-gessene Avantgarde der Alten Musik“ ans Herzgelegt. Hoffentlich wird bei den Aufführungenin München und Berlin die Zahl der zuhörendenAlte-Musik-Profis höher als in Basel.
Peter Thalheimer
Eine Entdeckung: Das Repertoire der Bogenhauser Künstlerkapelle
Berichte
In den Jahren 1897 bis 1939 wirkte in Münchendie Bogenhauser Künstlerkapelle. Sie war eineder Keimzellen des Spiels auf Originalinstru-menten, weil sie u. a. im Besitz einer großen Zahlbedeutender Holzblasinstrumente des 18. Jahr-hunderts war. Darunter befanden sich z. B. auchBlockflöten von Denner und Bressan. Der Zeit-zeuge Carl Orff hat dieses Ensemble gehört undberichtet: „Es gab in München ein Blockflöten-quartett, eine Gruppe kauziger älterer Maler, dieauf von Urvätern ererbten kostbaren Instrumen-ten mit Begeisterung alte Musik spielten.“ Nochbevor Arnold Dolmetsch in England und PeterHarlan für Deutschland die Blockflöte propa-gierten, wurde also in München mit Originalin-strumenten Quartett gespielt.
Die Wiederentdeckung dieser Aktivitäten ver-danken wir insbesondere Rainer Weber undMartin Kirnbauer, die das noch erhaltene Instru-mentarium und die Musizierpraxis der „Künst-lerkapelle“ dokumentiert haben. Dabei wurdeauch das Repertoire der Bogenhauser Musikerwieder aufgefunden, ein Satz Stimmbücher fürvier Blockflöten, Trumscheit, Gitarre und Pau-ken. Darin enthalten sind neu komponierte Stü-cke und Bearbeitungen für diese Besetzung, diein ihrer stilistischen Vielfalt alle Grenzen spren-gen: Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts (Arca-delt, Bendusi, Corelli, Bach, Mozart) steht nebenStücken aus dem 19. Jahrhundert (Pleyel, Bizet),Märschen und melodramatischen Neukomposi-tionen der Ensemblemitglieder.
Dieses Repertoire der Bogenhauser Künstlerka-pelle wurde nun von dem ensemble arcimboldo
TIBIA 3/2011 509
Am 22. Januar 2013 jährt sich zum 90. Mal derGeburtstag des 2007 verstorbenen KomponistenFriedrich Zehm. „Zehm gehörte einer Schulebzw. Nachfolge an, deren Existenz bisher wenigin das Bewusstsein getreten ist, der NachfolgeHindemiths, Bartóks und Strawinskys. Erschrieb zeitgenössische, moderne, aber nichtmodische Musik, die sich durch eine große Prä-senz auf der Bühne, auf Tonträgern und imRundfunk auszeichnete. Diese Öffentlichkeits-präsenz macht die Musik Zehms zu einem wich-tigen Aspekt der Geschichte des Musiklebensund verleiht ihr historische Bedeutung“, schreibtdie Musikwissenschaftlerin Heidrun Miller 2003in ihrer Dissertation über Leben und WerkFriedrich Zehms.1
„Im Zeitraum von circa 1950 bis 1990 entstan-den rund 200 Kompositionen, in deren Mittel-punkt die Kammermusik steht. Einen weiterenSchwerpunkt bildet die Vokalmusik, speziell dasLied bzw. der Liederzyklus. Daneben umfasstdas Werkverzeichnis Orchesterkompositionen,zahlreiche Konzerte, Musik für Klavier, Orgelund Cembalo sowie eine kleinere Anzahl vonBühnen- und Hörspielmusiken, aber keineOper. Das Werkverzeichnis enthält darüber hinaus Unterrichtsliteratur und Orchesterschul-werke bzw. Kompositionen für Amateuror-chester.“2
Nur selten hat sich Friedrich Zehm in seinemumfangreichen und vielseitigen Instrumental-werk mit der Blockflöte befasst. Bekannt undbeliebt sind die Vortragsstücke für 2-3 Blockflö-ten und Schlagwerk ad libitum, die in 4 Heftenbereits zwischen 1969 und 1971 bei B. Schott’sSöhne in Mainz erschienen sind.
Völlig zu Unrecht führen zwei weitere Werkebis heute ein Schattendasein, in denen der Kom-ponist die Blockflöte mit anspruchsvollen und
Ulrike Teske-Spellerberg / Christoph Zehm
Friedrich Zehm – Komponist zwischen Tradition und ModerneUnveröffentlichte Werke für Blockflöte(n) aus dem Nachlass
inspirierten Partien bedacht hat. Die Rede isthier von den Sieben Stücken für zwei Altblock-flöten aus dem Jahr 1975 und dem Konzert fürBlockflöte, Streicher und Schlagwerk, das 1971geschrieben wurde. Beide Werke lassen erken-nen, wie intensiv und einfühlsam sich FriedrichZehm mit der Spielweise und Klangwelt derBlockflötenfamilie auseinandergesetzt hat.
Das Concerto per flauto dolce, archi e percussione(wie Zehm es in seiner Originalpartitur überti-telt hat) mit einer Spielzeit von ca. 16 Minutenist viersätzig angelegt: Introduzione – Allegrocon spirito – Intermezzo – Finale/Allegro viva-ce. In dem technisch anspruchsvollen Konzertfinden sich Partien für Sopranino-, Sopran-, Alt-und Bassblockflöte. Als Perkussionsinstrumentewählte der Komponist Marimbaphon und Vi-
Friedrich Zehm (1923–2007) Foto: privat (ca. 1983)
Berichte
510 TIBIA 3/2011
braphon, die allerdings nur einen Spieler erfor-dern, da beide Instrumente nie gleichzeitig ein-gesetzt werden. Die alternierende Verwendungverschiedener Blockflöten in der nicht alltäg -lichen Kombination mit Marimba- und Vibra-phon bietet eine außerordentliche klanglicheVielfalt und farbliche Fülle. Dieser Reichtum anKlangfarben und die Experimentierfreudigkeit imHinblick auf Klangkombinationen kann als ge-radezu kennzeichnend für Friedrich Zehms Stilangesehen werden. Im ersten Satz des Concertofinden wir eine Kombination von Altblockflöteund Vibraphon; das Perkussionsinstrument istim Verlauf dieses Satzes auch an der themati-
schen Entwicklung betei-ligt. Eine Besonderheit bie-tet der zweite Satz – hierkommt auch erstmals dasMarimbaphon zum Ein-satz –, in dessen Mittelteil(„à la musette“) Sopran-und Altblockflöte gleich-zeitig gespielt werden (s.Abb. 1). Die Sopranblock-flöte wird in der linken, dieAltblockflöte in der rech-ten Hand gehalten, ähnlichwie man es von Abbildun-gen des antiken Doppelau-los kennt. Der dritte Satzist überwiegend der Bass-blockflöte gewidmet, derZehm hier zusammen mitdem Vibraphon einen um-fangeichen Part gewidmethat. Für das schmale Re-pertoire der Bassblockflöteist dieser Satz eine will-kommene Bereicherung!Das Finale – an dieser Stelleschließt sich der Kreis –wird zunächst von der Alt-blockflöte bestritten, derMittelteil wird von der So-praninoblockflöte vorge-tragen (s. Abb. 2). Eine Ur-
aufführung dieses originellen und vielseitigenWerks wäre wirklich wünschenswert. Sollte dieBesetzung mit Schlagwerker(n) einen unverhält-nismäßig hohen Aufwand darstellen, ließe sichder Schlagwerk-Part möglicherweise auch miteinem modernen Digital-Piano bestreiten, wennes mit hochwertigen Marimba- und Vibraphon-Sounds ausgestattet ist.
Ebenfalls weder veröffentlicht noch aufgeführtsind die Sieben Stücke für zwei Altblockflöten.Über diese schrieb Zehm im August 1975 an Ni-kolaus Delius (1971–1992 Professor für Flöte ander Staatlichen Hochschule Freiburg und 1976-1995 Mitherausgeber von Tibia), auf dessen An-regung diese Kompositionen wohl entstanden
Abb. 1: Blockflötenkonzert, 2. Satz, Allegro con spirito
Berichte
TIBIA 3/2011 511
sind: „Den Schwierigkeits-grad habe ich nach meinenMöglichkeiten nicht geradetief angesetzt, hoffe aber,daß er nicht zu hoch reicht(…) Auch habe ich hie undda bewußt auf alte, denBlockflöten gemäße Ele-mente zurückgegriffen.“
Die sieben Duette tragendie Titel Sinfonia, Air, EchoB-A-C-H, Marionette, Ca-price, Kanonspiel und Salta-rello. Der dreiteilig ange-legten Sinfonia mit ihrenschillernden Intervallspie-gelungen folgt ein Air, indem einzelne Themen undMotive in der Wiederho-lung durch ausgeschriebeneVerzierungen variiert wer-den. Das Echospiel erweistsich als reizvoller, zunächstdeklamatorisch gestalteterDialog, aus dem nach und
Abb. 2: Blockflötenkon-zert, 4. Satz, Finale/Alle-gro vivace
Berichte
Abb. 3: Echo B-A-C-H, in: SiebenStücke für zwei Altblockflöten
512 TIBIA 3/2011
nach das Motiv B–A–C–H entwickelt wird (s.Abb. 3). Demgegenüber lebt das Stück Mario-nette von seiner stringenten, motivischen Ge-staltung und zündenden Rhythmik. Ein wenigspielerisch und eigenwillig präsentiert sich dasCaprice; hier dominieren im lombardischenRhythmus geformte Motive, die von den Block-flöten wechselseitig imitiert und umgekehrt wer-den (s. Abb. 4). Im Kanonspiel führt der Kom-ponist die Imitationen sehr streng durch. Einen
besonderen Reiz erhält diesesStück durch die auskomponier-ten Ritardandi am Ende des ers-ten und zweiten Teils. Der Salta-rello, schwungvoll und virtuos,bildet mit seinen häufigen Takt-wechseln ein eindrucksvolles Fi-nale. Aufs Ganze betrachtet sinddie Blockflötenpartien diesesZyklus’ nicht unbedingt leicht,aber sie sind von guten Blockflö-tenschülern (Schwierigkeitsgrad:mittel bis schwer) zu bewältigen.Es lohnt sich in jedem Fall, dieseMusik zu entdecken!
Friedrich Zehm, geb. 1923 inNeusalz/Oder, wuchs in Pom-mern auf, studierte in Freiburg,arbeitete lange Zeit in Mainz undlebte in Wiesbaden, wo er 2007im Alter von 84 Jahren starb.Sein Leben erfuhr einen tiefenEinschnitt, als er im ZweitenWeltkrieg schwer verwundetwurde und ein Auge einbüßte.Nach dem Krieg absolvierte ereine musikalische Ausbildung –als Komponist bei Harald Genz-mer und als Pianist bei EdithPicht-Axenfeld – an der Musik-hochschule in Freiburg. Nachdem Studium war er als Musik-referent am Amerika-Haus inFreiburg, später als Lektor beimSchott-Verlag in Mainz tätig. DieKomposition betrieb er in der
verbleibenden freien Zeit, niemals hauptberuf-lich. Seit Anfang der 1990er Jahre komponierteer nicht mehr, da er sein Werk und seine Aussa-gen als abgeschlossen betrachtete. Doch wenigeMonate vor seinem Tod entstanden noch einmalViolinduos und Klavier-Inventionen (letztere2010 erschienen bei Schott-Musik) – Zehmnannte sie seine Alterswerke.
„Es bleibt noch vorbehalten, Komponisten wieZehm in der Musikgeschichtsschreibung zu be-
Abb. 4: Caprice, in: Sieben Stücke für zwei Altblockflöten
Berichte
TIBIA 3/2011 513
rücksichtigen, um ein historisch getreues Bildder Musikgeschichte der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts zu erhalten. Das allgemeine Phä-nomen Ende der 1970er Jahre, dass sich Kom-ponisten verstärkt eines traditionsorientierten,handwerklich fundierten Stils bedienten, derauch heute noch das aktuelle kompositorischeSchaffen prägt und dem Stil der „gemäßigtenModerne“ nach 1945 nahe kommt, macht Kom-ponisten wie Zehm letztlich zu Vorreitern dieserEntwicklung.“3
Nicht nur der Anlass des Jubiläums 2013 bietetvielfältige Möglichkeiten, Friedrich ZehmsWerk aus fünf Jahrzehnten des 20. Jahrhundertsaufleben und präsent werden zu lassen. Dabeibieten sich einige Werke an, die noch zur Urauf-führung gebracht werden können. Verwiesen seihier auch – neben einem reichhaltigen Kammer-musik-Repertoire insbesondere für Holzbläser– auf das Konzert für Flöte und kleines Orchester
(1962) sowie die bislang nicht aufgeführten Wer-ke Concerto da camera für Oboe und Streichor-chester (1967) und Sonate für Oboe und Klavier(1956).
Das aktualisierte Werkverzeichnis FriedrichZehms ist einzusehen und downloadbar unterwww.friedrich-zehm.de. Kontakt: ChristophZehm, Gaugasse 32, 65203 Wiesbaden, E-Mail:[email protected]
______________ANMERKUNGEN1 Heidrun Miller: Friedrich Zehm – Komponist zwischenTradition und Moderne. Schriften zur Musikwissenschaft,hg. vom Musikwissenschaftlichen Institut der JohannesGutenberg-Universität Mainz, 2003, S. 250. ZugleichMainz 2002, Univ., Diss. Der Komponist Friedrich Zehm.Leben und Werk, 350 Seiten, zahlreiche Abbildungen undNotenbeispiele, Werkverzeichnis. © 2003 Are Musik Ver-lags GmbH, ISBN 3-924522-15-4.2 ebd., S. 2393 ebd., S. 250-251
Musik für Blockflöte von Friedrich ZehmEinzug der Gaukler (SS)Cantilene (SS)beides in: Franz Lehn/Heinrich Rohr (Hg.): Vor-tragsbüchlein für die Schule, für 1-3 Sopranblock-flöten, Schlagwerk ad lib., Heft 2, 1969, SchottMusik ED 6093
Präludium (SSS)Barkarole (SSS)beides in: Franz Lehn/Heinrich Rohr (Hg.): Alt-flötenschule für den Anfang, Vortragsbüchlein zurAltflötenschule, für 1-3 Altblockflöten, Schlag -werk ad lib., 1970, Schott Musik ED 6351
Geschwindmarsch (AA), in: Franz Lehn/Hein-rich Rohr (Hg.): Altflötenschule für den Anfang,Vortragsbüchlein zur Altflötenschule, für 1-3 Alt-blockflöten, Schlagwerk ad lib., 1970, SchottMusik ED 6351
Sonatina 1 (SA)Perpetuum mobile (SSA)beides in: Franz Lehn/Heinrich Rohr (Hg.): Vor-tragsbüchlein für das Zusammenspiel, Sopran-
und Altblockflöten, Schlagwerk ad lib., 1971,Schott Musik ED 6358
Divertimento ritmico Moderne Tanzrhythmen zu4 Stimmen, für Orchester, Streichorchester oderBlockflötenchor mit Schlagwerk (1970) Dauer:ca. 16’; Inhalt: Fancy (Moderato) – Samba –Samba carioca – Badinerie (Allegro scherzando)– Bolero (Andante) – Großes Finale (Mo de -rato/Allegro); B. Schott’s Söhne, Mainz 1970
Konzert für Blockflöte, Streicher und Schlagwerk(Xylophon und Marimbaphon) (1971), Dauer: ca.16’, Introduzione – Allegro con spirito – Inter-mezzo – Finale; auch als Klavierauszug für Block-flöte und Schlagwerk (Xylophon undMarimbaphon) vorhanden, Manuskript, Auffüh-rungsmaterial auf Anfrage.
Sieben Stücke für zwei Altblockflöten (1975),Dauer: ca. 16’, Sinfonia – Air – Echo „B-A-C-H“– Marionette – Caprice – Kanonspiel – Saltarello;Manuskript, auf Anfrage.
Berichte
514 TIBIA 3/2011
Eine unspielbare (Weiden-)Flöte bringt Er-Lösung
Was dem Tibia-Titelbild recht ist (Tibia II/2011),kann den Moments littéraires nur billig sein –auch wir greifen heute gerne das Thema „Wei-denpfeife“ auf, dessen nähere Betrachtung inte-ressante Schlaglichter auf die Kunst und Litera-tur des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu werfenvermag. Gestaltet hat die Vorlage für dieses Ti-bia-Titelbild der 1846 im thüringischen Allstedtgeborene Otto Hermann Piltz.1 Nach seinerAusbildung ließ er sich als Kunstmaler in Wei-mar nieder, wechselte aber 1886 nach Berlin und1889 nach München, wo er sich an der „Sezes -sion“ beteiligte. Ab 1893 wohnte er in Pasing beiMünchen, wo er in seinen letzten LebensjahrenKontakt zu dem jungen Franz Marc hatte, derganz in der Nähe wohnte. In Pasing starb Piltz1910. Mit seinen idyllischen Genrebildern warPiltz durchaus erfolgreich, nicht zuletzt, weil er„das Erzählerische in seinen Bildern nie verlas-sen“ und insbesondere auf die präzise Wieder-gabe von Details, etwa der bäuerlichen Tracht,größten Wert gelegt hat.
Sein Bild Die Weidenpfeife erschien nicht nur(wie in der Tibia angegeben) als Kunstdruck imMünchner Verlag Franz Hanfstaengl, sondern1899 auch als Illustration in der weit verbreitetenFamilienzeitschrift Die Gartenlaube.2 Beigege-ben war ihm dort ein Gedicht von Walter Schultevom Brühl (1858–1921), der als Journalist,Schriftsteller und Maler tätig war und – gleich-zeitig mit Otto Piltz – von 1878–1884 in Weimarlebte.3 Auch Schulte ist, allerdings literarisch, einGenremaler; seine Weidenpfeife beschwört dieidyllische Kinderzeit: „Dann kommt der Lenzin unsre Lande/ Und bringt die alten Klängemit/ Wie einst, als selbst am Teichesrande/ Als
Knab’ daheim ich Pfeifen schnitt“. Dabei wer-den alle Versatzstücke der Romantik beschwo-ren: „Dotterblumenkränze“ und der sein Hornblasende „Postillon“, klingende „Schmiedehäm-mer“ und dadurch hervorgerufene Kindheitser-innerungen („wie im Traume/ Steigt meiner Ju-gend Lenz empor“). So redet der Autor in denletzten vier Zeilen den Weidenpfeifer unmittel-bar an und vermischt seine eigenen Gefühle undErinnerungen mit dem Pfeifenklang:
Froh laß, o Knab im Weidenhage,Dein Pfeifchen tönen hell und frei;Sein Klang weckt neue Frühlingstage, Und mir – und mir der Jugend Mai.4
Fünf Jahre später, bereits im neuen Jahrhundert,erschien 1904 in Berlin eine Erzählung Die Wei-denflöte in einem Band mit dem Titel Federspiel.5
Geschrieben hatte sie ein Autor, der heute nurnoch eine Fußnote der Literaturgeschichte ist,zu seiner Zeit aber durchaus erfolgreich und an-gesehen war. Der Untertitel seiner Sammlung er-klärt sich aus seiner Biographie. Der Schriftstel-ler Carl Busse wurde am 12. November 1872 inLindenstadt bei Birnbaum/Posen (also im seit1793 preußischen Teil Polens) geboren, studiertein Berlin und promovierte in Rostock; danachlebte er ab 1898 als Schriftsteller und Literatur-kritiker in Berlin. So spielen seine Erzählungenvon 1904, die in „Westliche“ und „Östliche Ge-schichten“ unterteilt sind, teils in den östlichen,teils in den westlichen Gebieten Deutschlands,wobei Die Weidenflöte in einem (wohl mittel-deutschen) Dorf und in Berlin spielt. Weit er-folgreicher als mit seinen heute weitgehend ver-schollenen Erzählungen war Busse allerdings
Moments littérairesSerie von Ulrich Scheinhammer-Schmid
Moments littéraires
TIBIA 3/2011 515
mit seiner Lyrik – seine Gedichte wurden umdie Jahrhundertwende von namhaften Kompo-nisten wie Richard Strauss, Hans Pfitzner undanderen vertont.6
Besonders beachtet wurde die von Carl Busseherausgegebene Reihe Neue Deutsche Lyriker,in der der damals noch weitgehend unbekannteHermann Hesse 1902 auf Einladung Busses ei-nen umfangreichen Band veröffentlichte,7 derimmerhin bis 1922 eine Auflage von 14.000Exemplaren erreichte. Mehrere Briefe Hessesund eine späte Erinnerung an Carl Busse, zehnJahre nach dessen Tod 1928 in der Neuen Zür-cher Zeitung veröffentlicht, zeigen die Bedeu-tung dieses Kontakts für den angehenden Dich-ter, der hier bekennt: „[…] daß ich von einemberühmten Schriftsteller ohne mein Zutun zurPublikation eingeladen worden war, daß meinGedichtband bei einem angesehenen Verleger er-scheinen konnte, das hielt meinen Glauben wie-der für zwei Jahre am Leben. Eine ähnlicheFreude habe ich nur noch einmal erlebt“ – alsihn nämlich zwei Jahre später der angesehene S. Fischer-Verlag einlud, ihm Hesses nächstesManuskript zu senden.8 Aufschlussreich und be-zeichnend für Busses Ruf ist auch die Tatsache,dass Theodor Heuss, der spätere Bundespräsi-dent, damals aber noch Jungautor und Journa-list, 1907 ebenfalls eine Sammlung seiner Ju-gendgedichte (allerdings ohne Erfolg) an denHerausgeber der angesehenen Reihe schickte.9
Auch Carl Busses Weidenflöte beruht, wie dasGedicht in der Gartenlaube, auf dem Gegensatzzwischen den unbeschwerten Kinderjahren unddem Ernst der Erwachsenenwelt – freilich in vieleindringlicherer und psychologisch tieferer Wei-se als das idyllische Gedicht in der Familienzeit-schrift. Die Handlung beginnt in einem unge-nannten Dorf, wo der Hirtenjunge Fritze Winteres zu „einer seltenen Kunstfertigkeit im Schnei-den von Weidenflöten“ gebracht hat (149).10
„Wenn der Saft in die Ruten stieg […], lugte eroft zu den Büschen am Flußufer hin, bis er esnicht mehr aushielt […] und in großen Sprüngender Herde davonlief. Mit wogender Brust undheißem Gesicht kehrte er dann zurück und prüf-
te sorgsam, was er geschnitten. Je weniger Knor-ren und Knorpel die grüne Rinde aufwies, um sobesser war’s. Dann schälte er wohl einen Streifenab, um zu prüfen, ob die Gerte auch saftig genugwar, worauf er genau die nötigen Einschnittemachte und so lange vorsichtig von allen Seitenmit der Messerschale auf das Rutenstück klopf-te, bis die unverletzte Rinde sich abstreifen ließ.“(149 f.) Zu diesem Hirtenjungen stößt häufig dieTochter des Dorfarztes, Toni Leonhardt, einquirliges achtjähriges Mädchen, die vormittagsfrei hat, weil sie „mit den Töchtern des Pastors“am Nachmittag vom Schullehrer des Dorfes Pri-vatunterricht erhält (151). Der „Wildfang“ istvon Fritzes Weidenflöten und seiner Musik sobegeistert, dass sie bei ihm mit ihrer Puppe still-sitzt und den Fischreiher beobachtet oder demKiebitz lauscht. Allerdings will sie nun unbe-dingt auch ein solches Instrument, was ihr derHütejunge schlicht abschlägt, weil er aus Prinzipnie eine seiner Weidenflöten hergibt: „Fassungs-los weinte das Kind vor sich hin. Ein immer wil-deres Begehren faßte das kleine Herz.“ (153)
Erst als der Doktor eine Arztpraxis in Berlinübernimmt und seine Tochter von Fritze Ab-schied nehmen muss, kommt der Junge, eine Wei-denflöte blasend, zum Wagen und schenkt derÜberglücklichen seine Flöte: „Es war die seligsteStunde ihrer Kindheit“ (156). Und als die Pferdeam Wagen schon anziehen wollen, „da kam derHütejunge noch einmal an“, keuchend vomschnellen Lauf: „Ich hab’ … vergessen … AmAbend mußt du sie ins Wasser legen, da bleibt siegeschmeidig und platzt nicht. Adje!“ (156)
Der zweite Teil der Erzählung beginnt „fünf-unddreißig Jahre später“ auf einem BerlinerFriedhof, wo „der Doktor der Medizin Fried-rich Alten“ zu Grabe gebracht wird (157). SeineWitwe, die einstige Toni Leonhardt, verlässt das
Moments littéraires
Ahorn naturBuchsbaumPalisanderOliveRosenholz
www. .com
516 TIBIA 3/2011
Lexikon passend zu berichten weiß: „Salcional(Salicet, Weidenpfeife), angenehme, offene, me-tallene Stimme von ganz enger Mensur, schwerzu intoniren“.11
______________ANMERKUNGEN1 Alle Angaben zu Otto Piltz nach der sehr informativenWebsite: www.otto-piltz.net (22.5.2011, 21:55 h).2 Die Gartenlaube, 1899, Nr. 10, S. 149. – 1903 erschien inder Gartenlaube (ebenfalls in Nr. 10, S. 169) ein weiteresBild von Otto Piltz: Die erste Weidenpfeife, diesmal ohnebeigefügten Text. 3 Wikipedia-Eintrag Walter Schulte vom Brühl (22.5.2011,22:18 h).4 Das Gedicht wird hier zitiert nach der in Anm. 1 ge-nannten Website zu Otto Piltz.5 Carl Busse. Federspiel. Westliche und östliche Geschich-ten, Berlin: Albert Goldschmidt 1904 (Die Weidenflötedarin S. 149-165). – Das „Federspiel“ ist ein Begriff ausder Falkenjagd; es bezeichnet einen (oder zwei) Vogelflü-gel oder Attrappen, die der Falkner zum Zurücklockendes Falken, wenn der die Beute geschlagen hat, an einerSchnur über dem Kopf schwingt.6 1897 erschienen beispielsweise von Richard Strauss VierLieder von Carl Busse und Richard Dehmel im BerlinerVerlag Adolph Fürstner; Hans Pfitzner vertonte Busse-Texte in den Fünf Liedern (op. 11; 1901), in den Vier Lie-dern (op. 15; 1904) und in Zwei Lieder (op. 19; 1905), je-weils für Singstimme und Klavier, wobei er das LiedGretel (op.11, 5) auch als Orchesterlied gesetzt hat. Wei-tere Vertonungen von Gedichten Carl Busses stammenetwa von Alexander von Zemlinsky, Heinrich KasparSchmid und Alban Berg.7 Hermann Hesse: Gedichte. Herausgegeben und einge-leitet von Carl Busse. Berlin: Grote’sche Verlagsbuch-handlung 1902 (Neue deutsche Lyriker III).8 Hermann Hesse: Gesammelte Briefe. Erster Band1895–1921. Hg. von Ursula und Volker Michels. Frank-furt am Main: Suhrkamp 1973, S. 495 (Briefe Hesses anBusse ebd. S. 83-85, 90, 109, 118f.) – Zu diesem Gedicht-band Hermann Hesses vgl. auch: Renate Schipke: Her-mann Hesse und Carl Busse. Genese eines frühen Ge-dichtbandes (1902). In: editio. Jahrbuch für internationaleEditionswissenschaft, Bd. 15 (2001), S. 187-190.9 Theodor Heuss: Aufbruch im Kaiserreich. Briefe 1892bis 1917. Hg. und bearb. von Frieder Günther, München:K. G. Saur 2009 (Theodor Heuss: Stuttgarter Ausgabe,Briefe), S. 209 (Brief an Lulu von Strauß und Torney, 20.Juni 1907) und S. 231 f. (Brief an Dr. Carl Busse, 24. Au-gust 1907).10 Seitenzahlen in Klammern beziehen sich im Folgendenauf den in Anm. 5 genannten Erstdruck.11 Pierer’s Universal-Lexikon, 4. Auflage, 1857-1865, Bd.12, S. 355 (Stichwort „Orgel“); zitiert nach der Ausgabeder Digitalen Bibliothek Berlin 2005, S. 157-176.
Grab allerdings nicht voll Trauer, sondern in ei-ner seelisch verhärteten Stimmung: „Es ist etwasStarres in ihr, aber nicht die Starrheit des großenSchmerzes, die jählings eintritt und mählichweicht, – sondern die Starrheit der Verbitterung,die langsam alles ertötet und sich über ein ganzesLeben legt“ (158).
Der Begrabene hatte in seinen jungen Jahren be-rechtigte Aussichten auf eine große wissen-schaftliche Karriere und seine Frau hatte ihn ge-heiratet, „weil die Mutter es gewollt, weil sieauch keinen Grund gehabt, seinen Antrag abzu-lehnen“ (159). Als aber aus der glänzenden Lauf-bahn nichts wird, entwickelt der Enttäuschte„einen Dünkel, der ihm die besten Freunde ent-fremdete, der unerträglich war“ und gibt allendie Schuld an seinem Schicksal, nur nicht sichselber. Schließlich wendet sich der frustriertePraxisarzt auch gegen seine ihm noch treue Fraumit dem Vorwurf, „daß aus ihm nichts gewordenwar, nichts werden würde […], weil er geheiratethatte, weil er die Wissenschaft, seine hohe Wis-senschaft, einem Weibe geopfert!“ (160)
„Mit den Jahren stumpfte sie ab. Die Bitterniskam auch über sie. Nicht mehr Tränen setzte sieseinem Hohn entgegen, sondern wieder Hohn.Immer kälter und starrer ward es in ihr. […] IhrGesicht versteinte.“ (160) Und so empfindet siedie Diagnose eines unheilbaren Leidens bei ih-rem Mann und die Nachricht, dass er nur nochein halbes Jahr zu leben habe, als Erlösung:„‘Also in einem halben Jahre frei!‘ sagte sie vorsich hin. Die Stimme war hart.“ (161). Noch zuseinen Lebzeiten mietet sie „eine kleine Woh-nung in einem kleinen thüringischen Landstädt-chen, in das sie gleich nach dem Begräbnis über-siedeln wollte“ (161), und noch vor derBeerdigung beginnt sie schon „mit den Vorbe-reitungen zum Umzug“.
An dieser Stelle setzt nun unser Ausschnitt, derSchluss der Erzählung, ein, der für sich selbstspricht, so dass wir unsere Betrachtung von CarlBusses Weidenflöte mit einem Hinweis auf dasgleichnamige Orgelregister abschließen wollen,über das die 4. Auflage von Pierers Universal-
Moments littéraires
TIBIA 3/2011 517
Im Zimmer ihres Mannes, das sie fast nie be-treten – während der Krankheit war er im Ne-bengemache aufgebettet worden –, stand einaltertümlicher Familienschrank, unten mitKartons und vielem Trödel vollgepackt. Sie öff-nete einen Karton nach dem andern, suchtedies und jenes aus und stellte das Übrige zumVerbrennen oder Verschenken beiseite.
Als sie die Schnur vom letzten, arg bestaubtenund vergrauten löste, sah sie als Adresse »Fräu-lein Toni Leonhardt« darauf stehen. Es mochteallerlei Wäsche zur Ausstattung in der Papp-schachtel gewesen sein, die ein Geschäft ihrwohl damals zugesandt.
Toni Leonhardt … Als lese sie den Nameneiner längst Toten, hielt Toni Alten einen Au-genblick inne. Dann hob sie rasch den Deckel.Ein muffiger Geruch kam ihr entgegen, Spinn-web zeugte davon, daß jahrzehntelang nie-mand daran gerührt hatte. Da lagen Bänder,Kotillon- [Ball-] und Brautbouquets, all derTand, den junge Mädchen wohl bewahren.Auch Briefe dazwischen, lange Handschuhund noch mancherlei anderer Kram.
Verächtlich flog alles heraus. »Auf den Keh-richt damit!« murmelte sie. Und die welken,braunen und trockenen Blumen zerstäubten,als sie niederfielen.
Ganz unten in der Ecke lag ein sonderbaresDing von schwärzlich-grüner Farbe. Eigentlichwar es schon ganz schwarz und rissig geworden.
Kopfschüttelnd betrachtete sie es. Was wardas?
Und mählich dämmerte es ihr auf: eine Flöte… eine Weidenflöte …
Hatte sie die nicht einst als Kind bekommenvon … von … ja, von wem denn gleich?
Sie wußte den Namen nicht mehr. Seltsamstarrte sie auf die alte Flöte nieder. Dann gingsie auf und ab, auf und ab, bis sie es wußte.
Fritze Winter … und … und die Kühe … undihr Dorf … und die Pastortöchter und ihreKindheit … und Vater und Mutter …
Eins schloß sich ans andere; immer deutlicher,farbiger, reiner ward die Erinnerung. Die Weltleuchtete, die Wiesen leuchteten. Oben flog derFischreiher und schrie der Kiebitz. Unten wei-deten die Kühe. Die Blässe wollt’ in die Felder.Da jagte sie Fritze … Winter, der Hütejunge,heraus. Und er blies mit solcher Flöte ihrePuppe ein [in den Schlaf]; sie schlief dabei ambesten. Und er blies, wie das Schilf rauschteund das Wasser rann, er blies das Singen undKlingen der Luft, und sie hörte ganz ruhig zu,ohne mit den Füßen zu schlenkern – sie, dasperpetuum mobile. So hatte der liebe Vater siegenannt. Damals, als sie durch die sonnige Weltgaloppierte.
Die Flöte hier … die Weidenflöte …
Beim Abschied hatte Fritze Winter sie ihr ge-schenkt – war sie jemals wieder so selig gewe-sen?
Ins Wasser sollt’ sie sie legen, dann blieb sie ge-schmeidig.
Ein Zittern ging über Toni Altens Gesicht. Obdie Flöte noch klang?
Sie hob sie zum Munde, blies. Kein Ton, nurwie ein ganz leise klagender Seufzer wich dieLuft aus den Rissen. Die alte Flöte war ja rissigund vertrocknet.
Da half es nichts mehr, ob man sie auch insWasser legte! Es – half – nichts mehr!
Und plötzlich umkrampften die Finger dereinsamen Frau die Flöte, als wollten sie sie zer-brechen, ein wildes, schmerzhaftes Zuckenging durch die Starrheit des Gesichts – unddann neigte sich dieses Gesicht auf die Händeund auf die Flöte, und aus einem krampfhaftenStoßen und Schlucken ward ein anhaltendes,bitteres Weinen.
Carl Busse: Die Weidenflöte
Moments littéraires
518 TIBIA 3/2011
Es war ein Weinen, das den ganzen Menschenmitnahm; erst eins voll Trotz und Haß undVerbitterung, aber immer mehr löste sich dasalles, immer leichter und wohltuender rannendie Tränen.
Seit einem Jahrzehnt und länger hatte sie nichtmehr geweint – nun war’s eine Wohltat und Er-lösung.
Über die Finger rannen die Tropfen auf dieFlöte. Im Wasser sollt’ sie liegen – dieses Was-ser konnt’ die harte, rissige Rinde nicht mehrgeschmeidig machen. Aber in den Tränen löstesich die harte Kruste, die ihr Herz umschlos-sen, löste sich die Starrheit. Als wollten sieallen Haß und Hohn, allen Trotz und alle Bit-terkeit für immer fortschwemmen, rannen sieohne Aufhören. Und es ward ihr wärmer undweicher und leichter darin; in diesem Weinenfand sich Toni Alten wieder zurück zu ToniLeonhardt. Es konnt’ nicht verwischen, was siegelitten und ertragen; die Narben blieben. Aberes erlöste eine versunkene Welt, die danebenaufstieg, herrlich und tröstend.
Immer fester, wie es Toni Leonhardt einst alsglückliches Kind getan, preßte Toni Alten dieWeidenflöte an sich, als wär’s ihr größterSchatz wieder und das Beste, was ihr vom gan-zen Leben geblieben war.
Und aus Leid und Dunkel, das sie umschattetgehalten, rang sich zag und schüchtern, aberimmer heller werdend, ein Licht auf, nach demsie selig und versunken hinsah, – ein Trost, derdas glückentwöhnte Herz wie ein heiligesFeuer wärmte. Als sie aufstand, zitterte ein Lä-cheln, noch weh und voll Schmerzen wohl,aber ohne alle Bitterkeit, über die verweintenZüge. Toni Alten lächelte, denn sie wußte nun,daß neben Leid und Schmerz auch jedesGlück, das rein und voll ein Menschenherz ein-mal erfüllt hat, weiterwirkt und unsterblich ist.
[Carl Busse: Die Weidenflöte. In: Carl Busse: Feder-spiel. Westliche und östliche Geschichten. Berlin: AlbertGoldschmidt 1904, S. 149-165 (abgedruckter Text S. 162-165)]
Moments littéraires
MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K. Tel. +49-(0)5141-8853-0 | [email protected] Celle | Postfach 3131 Fax: +49-(0)5141-8853-42 | www.moeck.com
ROBERT SCHUMANN
Romanzefrom Symphony No. 4, D-minor op. 120for recorder orchestra adapted by Irmhild Beutler
SSAATTBBBGbSb
Edition Moeck Nr. 3321 | ISMN M-2006-3321-4 | € 17,00
TIBIA 3/2011 519
Bücher
Michael Wersin: Bach hörenEine Anleitung. Mit 22 Abb. und 26 Notenbeispielen,Stuttgart, Reclam 2010; geb., ISBN 978-3-15-010779-9,€ 19,95
Dieser handliche Band hat einen gravierendenFehler – das ist sein Titel. Denn es geht natür-lich nicht um das bloße Bach Hören, sondernum das „Bach Verstehen“, und ohne Kenntnisder Notenschrift und musikalischen Grund be -griffe hat man nur den halben Genuss an denpräzis-knappen und doch informationsgesättig-ten neun Kapiteln (plus eines Präludiums) in die-ser Ein führung.
Den Autor Michael Wersin, als Mu sik wis sen -schaft ler und -praktiker in St. Gallen und Lu -zern tätig, hatten wir bereits mit seinem Führerzur lateinischen Kirchenmusik in Tibia 3/2007vorgestellt. In seinem neuesten Band deckt eralle wichtigen Bereiche des gewaltigen Werksdes Mannes ab, der nach einem bekannten Dik -tum nicht Bach, sondern richtiger „Meer“ hei-ßen sollte. Dabei setzt der Autor in jedem Ka-pitel einen gewichtigen Schwerpunkt mit einerSpannweite, die von der Meisterschaft auch inder kleinen Form (Die Inventionen und Sin -fonien) über die theologischen Dimensionen von Bachs Kompositionen bis zum Weg zurVollendung (die Goldbergvariationen und dieKunst der Fuge) führt. Dieser Weg wird immerüberzeugend und zugleich anschaulich am gutgewählten Einzelbeispiel erläutert: einem ein-zelnen Konzert, einem Choralvorspiel, einerArie aus einer Kantate oder sogar an einer auto-graphen Partiturseite der h-Moll-Messe, an derman Bachs Parodieverfahren unmittelbar undanschaulich ablesen kann. Freilich beschränktsich die Darstellung nicht auf die rein musikali-sche Analyse, sondern zeigt immer zugleich dietheologischen und/oder (geistes-)geschichtli-chen Tiefenstrukturen des jeweiligen Werks und damit stellvertretend des gesamten Bach -
schen Komponierens auf,wobei die biographischenBezüge nicht außer Acht gelassen werden. Dienicht tastengebundene In stru men tal musik wirdallerdings nur durch das Cembalo-Konzert d-Moll repräsentiert; Tibia-Leser dürf ten hierein Kapitel über Bachs umfangreiches Kammer-musikœuvre vermissen.
Eine biographische Zeittafel, (knappe) Li te ra- tur- und CD-Hinweise sowie ein gründlichesRegister der Personen und Werke runden dashöchst empfehlenswerte Werk ab, mit dem sichjeder Musikinteressierte in bestens lesbarer unddoch sachkundiger Form den Kosmos Bach -schen Komponierens vergegenwärtigen unddurchleuchten kann.
Ulrich Scheinhammer-Schmid
HUBERs w i s s m u s i c a l i n s t r u m e n t s
Musik ist ...Musik ist ...... die Farbe im Grau des Alltags
Bücher
520 TIBIA 3/2011
András Adorján/Lenz Meierott (Hg.): Lexi-kon der FlöteFlöteninstrumente und ihre Baugeschichte, Spielpraxis,Komponisten und ihre Werke, Interpreten, Laaber2009, Laaber-Verlag, ISBN 978-3-89007-545-7, 912 S.,18,5 x 25,5 cm, geb., € 128,00
Schon 2003 war es als „in Vorbereitung“ ange-kündigt worden, 2009 ist es dann endlich er-schienen, das Lexikon der Flöte. Herausgebersind jetzt András Adorján und Lenz Meierott.Dass mehrere früher angekündigte Herausge-berteams bei der vorliegenden Fassung nichtmehr in Erscheinung treten, steigerte die Erwar-tungen.
Der Band gehört zu einer Reihe von Instrumen-ten-Lexika, in der im Laaber-Verlag schonNachschlagewerke zur Violine, zum Klavier undzur Orgel erschienen sind. Laut Vorwort richtetsich das Lexikon der Flöte an alle, die beruflichoder privat mit Flöteninstrumenten zu tun ha-ben, also an Flötistinnen und Flötisten, Pädago-gen, Fachwissenschaftler, Instrumentenbauer so-wie an alle Liebhaber der Flöte und der Block -flöte. Obwohl im Titel des Lexikons die Flötenur im Singular genannt wird, sollen nicht nurAspekte der (Quer)Flöte, sondern auch die derBlockflöte und weiterer Flöteninstrumente an-gemessen behandelt werden. Aurèle Nicolet hatsicher recht, wenn er im Geleitwort schreibt,dass die reichhaltige Literatur zu Interpreten,Flötenmusik, Komponisten, Audio- und Video-aufnahmen, Instrumentenbau, Technik, Ton,Atmung und Haltung (…) kaum jemals syste-matisch gesammelt worden sei. Ob das Lexikondem Anspruch der Herausgeber gerecht wird,soll anhand von einigen wenigen der über 800Lexikonartikel geprüft werden.
Unter vielen Stichworten sind gute Zusammen-fassungen des derzeitigen Forschungsstandes zulesen, z. B. unter Carl Maria von Weber, SaverioMercadante, Doppler (Familie) oder unter Fla-geolett und Flauto d’amore. Erfreulich sind auchviele Artikel, die Informationen enthalten, diesonst in der deutschsprachigen Literatur nichtzu finden sind, z. B. unter Alexander Murrayund Jacques Castérède. Offensichtlich ist es für
viele Bereiche gelungen, kompetente Mitarbeiterzu finden.
Problematisch wird es dort, wo sich die Interes-sengebiete der Querflöten- und der Blockflö-ten-Spieler überschneiden. Hier bleibt die Block -flöte oft unberücksichtigt. So fehlen z. B. beiGeorg Friedrich Händel die sogenannten Fitz-william-Sonaten und die Triosonate F-DurHWV 405 mit Blockflöte(n), bei Johann Sebas-tian Bach die Kantaten mit Blockflöte, bei CarlPhilipp Emanuel Bach das Trio Wq 163 mit Bass-blockflöte, bei Giuseppe Sammartini die Block-flötensonaten, bei Luciano Berio dessen Solo-stück Gesti und bei Cristóbal Halffter dieImprovisación sobre el „Lamento di Tristano“.Unter dem Stichwort Vierteltöne – Mikrointer-valle kommt das Wort „Blockflöte“ überhauptnicht vor. Nach der Lektüre des Artikels Vibratomuss man annehmen, dass dieses Phänomennach 1700 für die Blockflöte nicht mehr erwäh-nenswert war. Eine deutliche Bevorzugung derQuerflöten-Spielpraxis spricht auch aus den Ar-tikeln Neue Spieltechniken: Der Querflöte wer-den etwa acht Seiten eingeräumt, der Blockflöteetwa eine.
Auch beim Querflötenrepertoire stößt man aufempfindliche Lücken. So findet man z. B. diebekannte g-Moll-Sonate BWV 1020 weder bei J. S. Bach noch bei C. Ph. E. Bach – vielleicht,weil auch das C. Ph. E. Bach-Werkverzeichnisvon E. Eugene Helm (New Haven and London1989) totgeschwiegen wird? Bei Johann JoachimQuantz werden die Duette für Querflöten oderBlockflöten in der Liste ausgewählter Werkeübergangen. Die oft gespielte Triosonate mitBlockflöte und Traversflöte (QV 2: Anh. 3; Au-thentizität von Horst Augsbach angezweifelt)wird verschwiegen, dafür präsentiert die Verfas-serin aber die von ihr entdeckten Quadros aus-führlich. Vergeblich sucht der Leser auch nachBeethovens Jugend-Flötensonate in B-Dur, dietrotz der Zweifel an ihrer Echtheit einige Zeilenwert gewesen wäre. Bei Wenzel Matiegka wer-den die Informationen zu den beiden Notturniop. 21 und op. 25 vermischt: Franz Schubert hatdas op. 21 für Querflöte, Viola, Gitarre und Vio-loncello bearbeitet und erweitert, aber es ist
Bücher
TIBIA 3/2011 521
nicht ursprünglich für Csakan geschrieben; diesgilt nur für das Notturno op. 25.
Obwohl unter Querflötenfamilie viele selteneund kurzlebige Instrumententypen erwähntwerden, sucht man vergeblich nach der Boehm-Altflöte in F, die z. B. Otto Mönnig und ConradMollenhauer gebaut haben. Weil sie (nach HansKunitz) u. a. von Nikolaj Rimskij-Korsakov undAleksandr Glazunov vorgeschrieben wurde,sollte sie wenigstens in der tabellarischen Auf-zählung nicht fehlen.
Ein Umfang von höchstens etwa 900 Seiten warwohl durch die einbändige Konzeption vorge-geben. Die Herausgeber mussten deshalb die Ar-tikel nach ihrer Relevanz im Textumfang be-grenzen und wohl auch manches interessanteStichwort streichen. Vermutlich würde jedochmancher Leser gerne auf Bemerkungen zu eini-gen noch lebenden Flötisten verzichten, wenn erdafür z. B. kurze Notizen über Julius Rietz (So-nate g-Moll op. 42) und Flötenmusik-Kompo-nisten wie Maki Ishii und Ryohei Hirose findenwürde. Beim Stichwort Telemann könnte manwohl eine Kürzung bei den biographischen De-tails verschmerzen zugunsten einer Erwähnungder vielen handschriftlich überlieferten Kam-mermusikwerke, die jetzt in praktischen Ausga-ben vorliegen. Sie sind für die heutige Praxismindestens genauso wichtig wie die zu Lebzei-ten Telemanns gedruckten Werksammlungen,insbesondere für Blockflötenspieler.
Kritisch wird es, wenn in einem Lexikon an ver-schiedenen Stellen widersprüchliche Informa-tionen gegeben werden. So wird z. B. das Kon-zert für Flauto d’amore von Johann MelchiorMolter unter drei Stichwörtern erwähnt, jedochmit drei verschiedenen Tonarten: Einmal stehtes in D-Dur, einmal in H-Dur und nur einmal(richtig) in B-Dur. Einmal wird Molter sogar aufden zweiten Vornamen Michael getauft. Oder:Der Verfasser des Artikels Harald Genzmerweiß, dass Genzmer – damals Kompositionsstu-dent Hindemiths – bei der Uraufführung desHindemithschen Blockflötentrios mitgewirkthat. Unter Hindemith erfährt man dann, dassdas Trio dem Umkreis der Sing- und Spielmusi-ken mit pädagogischem Charakter entstammt
und für eine Aufführung mit Lehrern und Schü-lern des Gymnasiums Plön gedacht war. Weiterbei Hindemith: Brauchen wir zu seinen AchtStücken für Flöte solo (1927) Wertungen wie teilsskurrile, aber auch hübsche Miniaturen? BeiHindemith wird außerdem ein Blockflötentriovon 1942 erwähnt, es sei als Gelegenheitskom-position (…) zu sehen. So sehr sich die Blockflö-tenspieler über die Entdeckung eines weiterenWerkes freuen würden – derzeit müssen wir an-nehmen, dass das genannte Stück nicht existiert.Allerdings hat Harald Genzmer 1942 ein Block-flötentrio geschrieben …
Ein so umfangreiches Lexikon kann nicht feh-lerlos und schon gar nicht lückenlos sein. Trotz-dem vertraut der Benützer darauf, dass auch De-tails korrekt wiedergegeben werden. Von einergewissen Fehlerzahl an wird jedoch dieses Ver-trauen mit jedem weiteren entdeckten Irrtummehr untergraben.
Bleibt die Frage, ob die Erwartungen der im Vor-wort beschriebenen Zielgruppen erfüllt werden:Vielleicht sind die Liebhaber der Querflötedurch dieses Buch zufriedenzustellen. Für Block -flötisten und professionelle Querflötisten sowiefür Fachwissenschaftler und Instrumentenbauermuss jedoch gelten: Ein Lexikon ist nur so gutwie der schwächste darin enthaltene Artikel. Vorder Übersetzung in andere Sprachen, die AurèleNicolet im Geleitwort empfiehlt, sollte deshalbeine gründlich revidierte deutsche Fassung erar-beitet werden. Nur so können die vielen gutenLexikonbeiträge ein adäquates Umfeld finden.Allerdings hört man heute, insbesondere von derjüngeren Genera tion, immer öfter die Frage:Braucht man im Zeitalter von Wikipedia über-haupt noch ein gedrucktes Lexikon?
Peter Thalheimer
NEUEINGÄNGE
Walter, Elmar: Blas- und Bläsermusik, Musik zwi-schen Volksmusik, volkstümlicher Musik, Mili-tärmusik und Kunstmusik, Tutzing 2011, VerlagDr. Hans Schneider, ISBN 978-3-86296-016-3,438 S., 16,5 x 24,5 cm, geb., € 55,00
Bücher
MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K. Tel. +49-(0)5141-8853-0 | [email protected] Celle | Postfach 3131 Fax: +49-(0)5141-8853-42 | www.moeck.com
PETER I. TCHAIKOVSKY
Ouverture miniaturefrom The Nutcracker Ballet, op. 71
arranged for recorder orchestra and triangleby Dietrich Schnabel
Peter I. Tchaikovsky (1840–1893)
Warum sollte man die Nussknacker-Ouver ture im Blockflötenorchesterspielen? Was kann diese Bearbeitungbieten, was das Original nicht kann?Ganz einfach. Tschai kowsky versuchtbereits in der Ouverture seiner Bal lett -musik Der Nussknacker den Hörer indie Stimmung der Aus gangs si tu a tionzu versetzen: ein Weihnachts abend des19. Jahrhunderts, ganz dem idealisier-ten, naiven Kind-Ideal einer sich selbstgenügenden, bürgerlichen Gesellschaftzu ge wandt. Dieses ideell Kindhafteversucht er durch die Schlichtheit derformalen Anlage, Re duk tion der In -stru mentierung, klare kurzgliedrigeAnlage der Melodien und Leichtigkeitder Artikulation auszudrücken. Selbstwenn das Ballett ursprünglich mit demganz großen Apparat eines Sympho-nieorchesters aufgeführt wurde, kannein Block flötenorchester durch seineneinheit lichen Klang sowie durch dieVer trautheit mit der hohen Lage, in derdas Stück komponiert ist, dieses Werktatsächlich in der von Tschaikowskyintendierten natürlichen Selbst ver -ständlichkeit und Schlicht heit interpre-tieren, die diese Musik zum Er blühenbringt. (D. Schnabel)
Edition Moeck Nr. 3318 | ISMN M-2006-3318-4 | € 30,00
SinoSSAATTBBBGbTr Edition 3318
TIBIA 3/2011 523
Noten
Agnès Blanche Marc: Meine Blockflöte undichSchule für Sopranblockflöte, Band 1, mit Ori gi nal -stücken von Graham Waterhouse, Reihe: Mein Mu sik -instrument und ich, München 2010, Edition Delor,ISBN 978-3-9813665-0-1, € 24,90
Recht ungewöhnlich, greife ich bei diesem Re-zensionsexemplar zu allererst zur Waage. Auf-wendig gemacht, doch unnötig schwer, prä -sentiert sich Meine Blockflöte und ich und bringtmit 760 Gramm mehr als doppelt so viel Ge-wicht auf die Waage als andere Schulen, die zu-sätzlich noch eine CD enthalten. Man kann esjeden Tag in Augenschein nehmen: das, wasGrundschüler täglich auf dem Rücken mit sichschleppen, würde jeder erwachsene Ge schäfts -mann in einem Rollkoffer hinter sich her ziehen.Es wäre sträflich, sie mit noch mehr Ge wicht zubelasten. Hefte sollten inhaltlich schwer wiegenund nicht auf dem Rücken drücken.
Das Heft ist mit viel Sorgfalt gestaltet und machtden Eindruck, aus der Praxis heraus ge boren zusein. Aber Vorsicht: Eine gute Leh rerin kann mitihrem Konzept große Erfolge verbuchen, wasnicht heißt, dass diese Methode auch bei derMehrzahl der Kolleginnen und Kol legen funk-tioniert.
Einige der Hauptunterscheidungsmerkmalemöchte ich gerne herausgreifen und zur Diskus-sion stellen. Der Leser mag selbst entscheiden,in wieweit diese Argumente aussagekräftig sind.
Unübersichtlichkeit: Für eine Anfängerschulesind die Seiten mit zu viel Informationen ge füllt,die sich an eine wesentlich ältere Ziel gruppewenden. Das Format ist unhandlich, der dicke,farbig hervorgehobene Rand bietet noch mehrInformationen, die selbst von erfahrenen Leh-rern nicht auf einen Blick zu überschauen sind.
Die meisten Kinder können noch nicht oder nurmit Mühe lesen und werden durch zu lange
Texte demotiviert. Die Annahme, man könntedie Texte mit den Kindern durchlesen, ist illuso-risch und wird bei jedem Lehrer oder Elternteilein ironisches Grinsen auslösen. Kinder wollensich bewegen, wollen spielen, und wenn sie ineiner Ruheposition verharren müssen, um zublasen, muss sich wenigstens die Musik bewegen.
Tonraum: Die Schule arbeitet am Anfang ohneNoten und führt den ersten Ton h auf Seite 26ein. Im ganzen Heft werden 10 Töne eingeführt:nach h2, a2, g2 kommen c3 und d3, das tiefe e2 undd2 und danach werden das hohe e3, g3 und a3 ein-geführt. Die erste Note erscheint auf Seite 45,fast auf der Hälfte des Bandes.
Mit diesen Tönen können die Kinder keine Ton -leiter spielen, haben keinen Leitton, kein Vorzei-chen gelernt und keine Möglichkeit, ein Gefühlfür harmonische Zusammenhänge zu ent -wickeln. In den Lehrernoten kommt fis vor, aberdie Schüler dürfen es nicht spielen. Warum?
Die meisten deutschen Volkslieder und nahezualle Weihnachtslieder sind nicht spielbar. Er-staunlicherweise habe ich bei Recherchen fürdiese Rezension festgestellt, dass viele englischeund französische Kinderlieder mit diesen Tönenauskommen. Aber statt Jakob van Eycks Wat zalman op den avond doen seiner beiden fs zu be-rauben und umzuschreiben, hätte man lieber einanderes Lied aussuchen sollen, das dem ausge-wählten Tonraum entspricht. (z. B. My Bonnieis over the ocean). Zudem stellt das hohe a3 einetechnische Schwierigkeit auf den meisten Anfän-gerflöten dar, auf denen hohes e und g relativeinfach zu produzieren sind, nicht aber das a.
Falsch dargestellt: Die Blockflöte wird nicht anzwei Auflagepunkten gehalten, sondern ineinem Haltedreieck mit Druck und Ge gen -druck: Die Unterlippe und der rechte Daumenbilden zwei Teile des Dreiecks unterhalb des In-
Noten
struments, einer oder mehrere Finger bilden dennotwendigen Gegenpart auf der Oberseite.
Wenn man den Kindern am Anfang aber keineTöne/Griffe beibringt, versäumt man dieChance, eine gute Handhaltung von Anfang anzu lehren.
Auf den zahlreichen Fotos ist zu sehen wie dieKinder die freien Finger der rechten Hand alsStützfinger verwenden, statt mit richtigen Grif-fen eine ganz natürliche Haltung zu haben. Wei-tere verbesserungswürdige Punkte fänden sichin der Behandlung der modernen Spiel technikenund der Einführung von Vorschlägen und klei-nen Verzierungen.
Einen weiteren Widerspruch findet man aufSeite 46. Während der Schüler g2 und h2 in gan-zen Noten spielt, ist die Oberstimme für Alt -blockflöte notiert. Jeder Lehrer weiß, dassSchü ler am Anfang auf die Finger des Lehrersschauen; und den gleichen Ton mit einem ande-ren Fingersatz zu sehen, scheint mir eine zu -sätzliche Hürde zu sein.
Als Materialsammlung ist diese Schule durchauswertvoll, denn die kurzen Stücke sind gut ge-macht und die Klavierbegleitung ausgezeichnetund sehr fantasievoll. Besonders hervorzuhebensind die Sätze, die Graham Waterhouse für dieseSchule komponiert hat. Noch nie habe ichHänschen klein mit einer so charmanten Beglei-tung gespielt.
Fazit: viel guter Willen, interessantes Material,aber keine überzeugende neuartige Ge samt kon -zeption. Inés Zimmermann
Ronald J. Autenrieth: Tango & MoreLateinamerikanische Lieder und Tänze für zwei Block -flöten (SA) und Klavier, Reihe: Recorder World, Nr. 10,Manching 2010, Musikverlag Holzschuh, Par ti tur undStimmen, VHR 3710, € 12,00
In der Reihe Recorder World, die u. a. jiddische,irische und afrikanische Stücke enthält, ist alsneues Heft die Sammlung von neun Tangos fürSopran- und Altblockflöte mit Kla vier be glei -tung erschienen. Ronald J. Autenrieth, der diese
Reihe betreut, ist ein sorgfältiger Arrangeur undkann durch seine Arbeit als Komponist Werkeso bearbeiten, dass sie in ihrer Übersetzung nochan Aussagekraft ge winnen.
Diesmal hat er sein Talent für die Bearbeitungvon südamerikanischer Tanzmusik für zweiBlock flöten eingesetzt. Die Oberstimme für So -pran behält trotz der Pausen ihre melodischeKraft und macht Spaß, die Altstimme ist unter-geordnet, doch weit von langweilig entfernt. DerKlavierpart ist im Schwierigkeitsgrad den ande-ren Stimmen angepasst und bewusst einfach ge-halten, setzt aber genau die richtigen Mittel ein,um die Oberstimmen zu unterstützen oder Ak-zente zu setzen.
Abwechslungsreich und in allen Partien durch-dacht, ist auch das 10. Heft dieser Serie zu emp-fehlen. Inés Zimmermann
Niccolò Paganini: Cantabile op. 17bearbeitet für Altblockflöte (oder Querflöte) und Gitarre (Cassignol & Démarez), Leipzig 2009, FriedrichHofmeister Musikverlag, Partitur und Stimme, FH 3273,€ 7,80
Selbstverständlich ist dieser knappe Cantabile-Satz im Original (D-Dur) für Violine und Gitarre komponiert (1823); über einer ruhigen,meist akkordisch schlichten Gitarrenbegleitungsteigert sich das Soloinstrument vom einfachenC-Dur-Dreiklang als Ausgangspunkt in immerwildere Verzierungswolken, die den Hauptreizdieses kurzen Stücks ausmachen. Der Ton um -fang der Violine ist natürlich größer als der derQuer- bzw. Altblockflöte, Ok tav ver schie bun -gen nach oben sind also mehrfach unvermeid-lich. Wer als Altblockflötenspieler die Heraus- for derung eines tiefen fis in schneller Bewegungund eines a3 als Spitzenton schätzt, wird mit dieser Bearbeitung seiner Selbstverwirklichungein Stück näher kommen: Alle anderen Block -flötisten sollten sich fragen, ob es unbedingt(dieser) Paganini sein muss? Für Querflötistenbietet dieses Cantabile freilich eine durchaus in -te ressante Gestaltungsaufgabe.
Ulrich Scheinhammer-Schmid
524 TIBIA 3/2011
Noten
Rainer Lischka: Genau!fünf Sätze für Blockflötenquartett (SATB), Reihe 12: perflauto dolce, Celle 2011, Girolamo Musikverlag, Parti-tur, G 12.033, 16,00
Genau! nennt Rainer Lischka seine fünf Sätze fürBlockflötenquartett (SATB), und das Ausrufezei-chen ist wichtig. Hier ist wohl nicht ein pedan-tisch gemeinter Aufruf zur Perfektion gemeint,auch wenn gerade diese für alle 4 Sätze verlangtwird, sondern eine Bestätigung eines homogenenEnsembles, das Spaß daran hat, melodische Lini-en durch die Stimmen weiter zu geben, als wäre esein einziges Instrument. Dies mag wohl eine dergrößten Herausforderungen bei der Interpreta -tion dieser Stücke sein: Durch die Verwendungunterschiedlicher Größen und Instrumentallagenmuss z. B. ein Staccato technisch jeweils dem In-strument angepasst werden, um die Artikulationauch gleichlautend klingen zu lassen und somittatsächlich homogen zu erscheinen. Aber auchder Rhythmus, zumeist gleichlautend in allenStimmen fortschreitend, verlangt von den Spie-lenden eine Exaktheit im Timing, einen gemein-samen Puls, verbunden mit flinker Zunge undFingern, wenn z. B. drei Stimmen gleichzeitig be-tonte Achtel mit Vorschlägen einwerfen.
Diese Stücke, die sich einer durchaus traditio-nellen Klangsprache bedienen und – abgesehenvon vereinzelten Glissandi, Sputati und Flatter-zungen – ohne moderne Techniken auskommen,sind daher eine grifftechnisch nicht allzu schwie-rige, aber spritzige und durchaus lohnende Etü-de im Ensembleklang, die durch ihren Spielwitz
jedoch auch auf Vortragsabenden durchaus ihrebelebende Wirkung ausüben können – voraus-gesetzt, ein gut aufeinander eingespieltes Ensem-ble vergisst vor lauter Pflege einer perfektenSpielkultur nicht auf Spritzigkeit und Witz inder Umsetzung der musikalischen Textur.
Regina Himmelbauer
Allan Rosenheck: ReldaDas Königreich des Adlers, ein musikalisches Märchenfür junge Herzen, für Blockflötenensemble und Spre-cher, Karlsruhe 2011, Ursus-Verlag (Vertrieb: Musik-lädle, Karlsruhe), Ursus-Verlag 11145, € 10,00
Es war einmal … So beginnt zwar nicht die Ge-schichte von Relda, dem Königreich des Adlers,aber ein Märchen ist es allemal: Die Prinzessinwill sich vermählen, und viele Tiere sind zurHochzeit geladen, die aber rasch arrangiert wer-den muss, da die Braut schon über dem Nach-wuchs brütet. Allan Rosenheck hat dieses „musi-kalische Märchen für junge Herzen, für Block-flötenensemble und Sprecher“ mit illustrierenderMusik versehen, die witzig (wie z. B. in derOuverture Anklänge an Mendelssohns berühm-ten Hochzeitsmarsch) und – wie bei diesemKomponisten gewohnt – swingend vor allem dieTiere illustriert. Gedacht sind die einzelnen Sät-ze für ein Blockflötenquartett (SATB), wobeiaber die einzelnen Stimmen durchaus auchmehrfach besetzt bzw. unterschiedlich „regis-triert“ werden können. Nur ein Satz ist fünf-stimmig (in zwei Fassungen: S-A-T-B-SB oderS-S-A-T-B). Die Spielhinweise geben auch Tipps
TIBIA 3/2011 525
Noten
526 TIBIA 3/2011
für Klangillustrationen zu der fortschreitendenErzählung. Die Geschichte ist nicht unbedingtvoller Überraschungen; die Charakterisierungder einzelnen Tiere steht dabei sowohl vom Er-zählstrang als auch von der Musik her im Vor-dergrund. Eine nette kleine mit Musik unter-malte Geschichte, von der Idee und demmusikalischen Schwierigkeitsgrad her geeignetfür Vortragsabende jüngerer Blockflötenkinder(– wobei man für Tenor und Bass wohl auf dieschon „Größeren“ zurückgreifen wird müssen).
Regina Himmelbauer
Frans Geysen: City of Smile I5 Solowerke für Blockflöte, Münster 2010, MieroprintMusikverlag, EM 1213, € 10,00
Frans Geysen: City of Smile II5 Solowerke für Blockflöte, Münster 2010, MieroprintMusikverlag, EM 1214, € 10,00
Geysens Blockflötenmusik hat – durchaus zuRecht – seit längerem viele Spieler fasziniert. DieAbkehr von chromatisch bestimmtem Serialis-mus und üblichem Ausdrucks-Pathos wirktüberzeugend und eröffnen andere Zugänge zuheutiger Klangsprache. Die nunmehr vorliegen-den beiden Sammlungen enthalten Stücke, die –laut Vorwort – für „Solotanz mit Begleitung ei-nes Blockflötenspielers“ geschrieben wurden.Für diese Besetzung dürfte es wohl nicht allzuviele Gelegenheiten geben, obwohl der Fluss dereleganten Linien mit ihren vielen Wiederholun-gen dazu einlädt. Aber auch im Solovortrag tundie zweimal fünf Stücke ihre Wirkung.
In minimalistischer Beschränkung auf ein knappgehaltenes Tonmaterial entstehen einprägsameTongirlanden. Sie beruhen auf einer – innerlichmitgehörten – einfachen und stabilen Harmo-nik. Durch subtile Melodieverschiebungen undAkzentwandel ergibt sich ein andauerndes Wei-tergehen ohne Abschnittsbildung. Abschlüsseund Fortführungen überlappen sich in unmerk-lichem Wechsel. So entsteht eine Musik, die „inder Schwebe“ bleibt. Aufgehobenes Taktgefühlkann einen gelegentlich ein wenig ins Taumelnbringen. In dieser City of Smile spürt man – auch
Noten
TIBIA 3/2011 527
in teilweise weit gesponnenen Tonketten – hei-tere Ruhe und einen Schein von Absichtslosig-keit. Dem Rezensenten hat das gefallen!
Hans-Martin Linde
Arcangelo Corelli: 6 Triosonatenfür 2 Altblockflöten und B. c., Faksimile des Erstdrucks,Münster 2010, Mieroprint Musikverlag, 3 Stimmen, EM2120, € 15,00
Die Triosonaten von Arcangelo Corelli führenim Vergleich zu den Concerti grossi und denViolinsonaten in unserem aktuellen Konzertle-ben eher ein Schattendasein, obwohl sie mit vierOpera von je zwölf Werken den Löwenanteilvon Corellis veröffentlichtem Œuvre ausma-chen. Dass dessen Triosonaten zu Beginn des18. Jahrhunderts ebenfalls Gegenstand des Inte-resses von Liebhabern der Blockflöte waren,dokumentiert die vorliegende Faksimile-Editi-on mit Bearbeitungen von Kammersonaten ausop. 2. Die Sammlung wurde ursprünglich unterdem Titel Sonate da Camera a trè, Due Violini,e Violone o Cembalo 1685 in Rom veröffentlichtund Kardinal Benedetto Pamphili, einem derwichtigsten Gönner Corellis, gewidmet.
Der Amsterdamer Verleger Pierre Mortier ließdaraus sechs Sonaten (Nr. 1, 2, 4-7) für zweiBlockflöten einrichten und verlegte diese1707/08. Bei lediglich zwei Sonaten wurde dieübliche Transposition um eine kleine Terz nachoben vorgenommen; die übrigen wurden in ih-rer Originaltonart belassen. Die Behauptungvon Winfried Michel, der für die hier bespro-chene Ausgabe verantwortlich zeichnet, dass„Mortiers Flötenfassung praktisch identisch mitdem Original“ sei, da Corelli weder Doppel-griffe noch hohe Lagen verwendet hat, kannnicht unwidersprochen bleiben. Vergleicht mangründlich die Vorlage mit der Bearbeitung, be-merkt man an unzähligen Stellen ungeschickteKnicks, die nicht immer nur dem begrenztenTonumfang der Altblockflöte in f1 geschuldetsind. Uneinheitlich ist der Umgang mit dem tie-fen fis1: in einigen Fällen hat sich der Bearbeiterfür eine Oktavierung entschieden, um die fürAmateure unbequeme Halblochdeckung zuvermeiden, in den meisten Fällen wird sie je-
doch in Kauf genommen. Für das Umgehen deshohen f3 im ersten Satz der Sonata V durch einesehr ungeschickte Oktavierung gibt es heutekeine Berechtigung mehr. Abweichungen vonden Artikulationsbezeichnungen des römischenErstdruckes, der wohl von Corelli überwachtwurde, sind häufig. Zusammen mit einigen fal-schen Noten und Vorzeichenfehlern hätten die-se unterschiedlichen Lesarten einen gründ -lichen kritischen Bericht gerechtfertigt, der esdem interessierten Spieler ermöglichen würde,sich nicht im Blindflug mit Mortiers Bearbei-tung auseinandersetzen zu müssen. Hier machtes sich Winfried Michel mit einem knappen Vor-wort zu leicht. Auch hätte die für die Faksimi-lierung verwendete Vorlage (Mikrofilm?) drin-gend einer Säuberung bedurft. Dass Tintenfraßden Reiz, aus Originalnotation zu spielen,durchaus erhöht, ist verständlich. Jedoch Kratz-spuren neueren Datums, vor allem solche, dieparallel zum Fünf-Liniensystem verlaufen, sodass man genau hinschauen muss, um diese vonHilfslinien zu unterscheiden, sind ein Ärgernis.
Noten
528 TIBIA 3/2011
Ich empfehle jedem an Corelli interessiertenBlockflötisten, sich die Originalversionen derTriosonaten zur Hand zu nehmen und ganz imSinne der professionellen Musizierhaltung desBarock eigene Versionen zu erarbeiten. Dannerkennt man mitunter, dass die Auswahl Mor-tiers nicht die allerglücklichste ist und sich mit-unter nicht berücksichtigte Sonaten besser fürzwei Blockflöten eignen; oder dass die ein oderandere Sonate ideal für Blockflöte und ein ande-res Blasinstrument liegt. Nicht zuletzt bringtuns die eigene, kreative Bearbeitungspraxis demWerkverständnis näher als jede vorgefertigteMeinung. Michael Form
Georg Philipp Telemann (?): Sonate c-Moll„Harrach-Sonate Nr. 1“ für Blockflöte & B.c. (Hg. BrianClark), Reihe: Magdeburger Telemann Edition, Magde-burg 2010, Edition Walhall, Erstausgabe mit Faksimile,Partitur und Stimmen, EW 809, € 12,80
Und noch einmal der Graf Harrach! In Tibiahatte ich ja bereits Gelegenheit, sowohl auf den
New Yorker Fund seiner für uns Blockflöten-spieler so kostbaren Hinterlassenschaft hinzu-weisen, die u. a. das hochvirtuose Konzert vonJ. Fr. Fasch und zahlreiche italienische Sonatenbeinhaltet, als auch auf den österreichischenTeil, der als gewichtigstes Werk das Harrach-Concerto in g-Moll enthält, das ebenfalls G. Ph.Telemann zugeschrieben wurde und bereits inder Edition Walhall von Reinhard Goebel ediertist. Wie im Falle des Concertos ist sich die mu-sikwissenschaftliche Telemannforschung auchangesichts dieser Sonate sicher, dass „wir Tele-mann als Komponisten dieses Werkes ausschlie-ßen dürfen“ (Brit Reipsch im MitteilungsblattNr. 23 vom Dezember 2009 der InternationalenTelemann-Gesellschaft).
Eine andere, auch Telemann zugeschriebene undbereits für eine Neuausgabe unter seinem Namenvorgesehene Sonate der Sammlung war als dieerste der Sonaten von J. Chr. Pepusch identifi-zierbar, die ihrerseits bereits in mehreren Neu -editionen vorliegt. Wie dem auch sei: die viersät-zige Sonate mit einem etwas unproportioniertkurzen zweiten Satz liegt mit c-Moll und Es-Dur(Satz III) hervorragend auf der Blockflöte und istes auf jeden Fall wert, gespielt zu werden.
Zwingend nach Telemann klingt sie aber in kei-nem Moment; allerdings auch nicht nach einemanderen bekannten Komponisten.
Und dennoch sei mir ein Hinweis erlaubt, derevtl. weitere Untersuchung wert sein könnte:
Es bestehen auffallende Übereinstimmungen et-wa bezüglich der kompositorischen Anlage desersten Satzes oder der Spielfiguren der Flöte imletzten Satz mit einer anderen, auch möglicher-weise zu Unrecht Telemann zugeschriebenenSonate, nämlich der „kleinen“ f-Moll-Sonate ausdem Brüsseler Manuskript. (Dieses wiederumenthält ja mindestens eine falsche Autorenanga-be bezüglich der D-Dur-Sonate von Händel(HWV 378), die hier „Signor Weise“ zuge-schrieben wird. Diese beiden Stücke scheinenmir wirklich aus derselben Werkstatt zu stam-men! Also vielleicht dann doch Telemann??
Die Ausgabe von Brian Clark bei Edition Wal-hall enthält nicht nur alles, was man von einer
Noten
TIBIA 3/2011 529
The Early Music Schop, Salts Mill, Victoria Road, Saltaire, West Yorkshire BD18 3LAEmail: [email protected] www.earlymusicshop.com
Tel.: +44 (0)1274 288100 Fax: +44 (0)1274 596226
guten Neuedition erwarten darf, sondern auchnoch den vollständigen Abdruck der Faksimile-Stimmen. Für Blockflötisten eine unumgäng -liche Anschaffung! Michael Schneider
Johann Christoph Pepusch: Sonata á 3für Blockflöte, Violine und Fagott (Hg. Jean-Pierre Boul-let), Magdeburg 2010, Edition Walhall, Partitur undStimmen, EW 802, € 12,80
Johann Christoph Pepuschs Name ist bis heutemit der Beggar’s Opera verbunden, jener 1728 inLondon mit sensationellem Erfolg aufgeführtengesellschaftskritischen „Bettleroper“, die nochzwei Jahrhunderte später der nicht weniger er-folgreichen Dreigroschenoper von Bert Brechtund Kurt Weill Modell stand. Pepusch, der, 1667in Berlin geboren, schon als Jugendlicher in denDienst des preußischen Hofes trat, sah sich 1698,nachdem er zufällig Zeuge eines brutalen Akteskurfürstlicher Herrscherwillkür geworden war,zur Flucht genötigt und kam im Jahre 1700 nachLondon. In England konnte er rasch als prakti-scher Musiker wie als Komponist und zuneh-mend auch als gesuchter Lehrer Fuß fassen.Nach und nach begann er auch, wissenschaft -liche Neigungen zu entfalten. 1710 wurde erMitbegründer der Academy of Ancient Music,die sich der Aufführung älterer Musik widmete.1713 wurde er in Oxford zum Doktor der Musikpromoviert, 1731 veröffentlichte er einen Trea-tise on Harmony. 1752 starb er, hoch angesehen,in London.
Pepuschs umfangreiches Œuvre umfasst zahl-reiche Kammermusikwerke. Besonders die Blä-ser verdanken ihm manch schönes Stück füroder mit Blockflöte, Querflöte oder Oboe. SeineKompositionen sind stets handwerklich solidegearbeitet, freilich nicht immer gleichermaßeninspiriert, und manchmal wünschte man sich etwas mehr Poesie, Affekt und harmonischeWürze, aber in jedem Falle verdient seine Musikdas Prädikat „gediegen“.
Das gilt auch für das Trio für Blockflöte, Violineund Fagott, das jetzt in einer Ausgabe von Jean-Pierre Boullet vorliegt. Der erste der vier Sätze,
ein Adagio, präsentiert sich als kantables Ober-stimmenduett. Das folgende Allegro zeigt dengelehrten Kontrapunktiker: Es ist eine Fuge miteinem markant mit zwei Halbenoten beginnen-den Thema und einem bewegten Kontrasubjekt,die gemeinsam besonders in der zweiten Satz-hälfte kunstvoll in Engführung und mit Aug-mentation des Themenkopfes durchgeführt wer-den. Das zweite Adagio bezieht seinen besonde-ren Reiz aus beständigen Synkopierungen („allazoppa“, hinkend, wie man damals sagte) und engverschränktem Motivspiel der Oberstimmen, denBeschluss bildet ein hübsches, abwechslungsrei-ches Menuett mit der Vortragsangabe Vivace.
Nicht ohne weiteres wird man das Prädikat „ge-diegen“ auch der Edition Boullets erteilen kön-nen. Er hat offenbar allzu bedenkenlos seinerQuelle vertraut. Diese Quelle, die Boullet imVorwort zumindest missverständlich als „Ori-ginalmanuskript“ bezeichnet, ist keineswegs Pe-puschs Autograph, sondern eine Dresdner Ko-pistenabschrift aus der Zeit um 1730. Es handeltsich um eine Partitur ohne Generalbassbeziffe-
Noten
rung. Daraus ist aber, anders als Boullet an-nimmt, keineswegs zu folgern, dass das Stückvom Komponisten als unbegleitetes Trio gedachtwar. Das Fehlen der Bezifferung, zumal in einerPartitur, ist alles andere als ungewöhnlich undlässt keine weitreichenden Schlüsse zu. Beden-ken hätte im übrigen die Musik selbst weckenmüssen mit ihrem oft extrem weiten Abstandzwischen Bass und Oberstimmen, gerade auchan nur zweistimmigen Stellen, so etwa in T. 10und 24 des 3. Satzes, wo die Distanz zwischenBlockflöte und Bass fast vier Oktaven beträgt.Auch leicht vermeidbare, aber vom Komponis-ten nicht vermiedene Akkordterz-Verdopplun-gen zwischen thematischem Kontrapunkt undBass wie in Satz 1, T. 5 (6. Taktachtel) und 6 (2.Achtel) oder das klanglich heikle Zusammen-treffen von c2, h1 und a am Beginn von T. 39 des2. Satzes zeigen, dass Pepusch mit akkordischerStützung rechnete. Erwähnt sei, dass das Werkauch in einer Ausgabe mit Generalbassausset-zung vorliegt: Johann Christoph Pepusch, Trio-Sonate für Flöte, Violine und Basso continuo inG-Dur, herausgegeben von Frank Nagel, Edi -tion Eulenburg, Adliswil-Zürich 1974.
Der Notentext der Edition von Jean-PierreBoullet enthält eine Reihe von Mängeln, von de-nen einige auch in der Ausgabe von Frank Nagelauftreten und demnach aus der Dresdner Hand-schrift stammen dürften. In T. 19 des 1. Satzesbildet die Blockflöte mit dem Bass Oktavparal-lelen – ein Satzfehler, der für Pepusch äußerstungewöhnlich wäre; nach den Parallelstellen inT. 4, 10, 11 und öfter muss das Achtelnotenpaarin der Oberstimme d3–e3 statt h2–c3 lauten (beiNagel korrekt). In T. 8 des 2. Satzes wird manzur Vermeidung einer Akzent-Oktavparallelemit dem Bass in der Blockflöte als 4. Sechzehntelbesser c2 statt a1 spielen. Und im 4. Satz sollte ausdemselben Grund in T. 18 die Violinstimme mitihren beiden ersten Noten den Parallelstellen T. 24 und 42 entsprechend aus d2–fis2 in a2–d2 ge-ändert werden (bei Nagel: d2–d2). In T. 15 dessel-ben Satzes lautet die 5. Note der Violine c3, beider Wiederkehr des Taktes im Rahmen einer aus-gedehnten Reprise als T. 67 aber h2; offenbar isth2 richtig (so auch bei Nagel). Bedenklich er-scheint mir außerdem eine merkwürdigerweise
an zwei Parallelstellen auftretende Lesart. Eshandelt sich um die letzte Sechzehntelgruppe derVioline in T. 33 und 49. Sie passt gar nicht gut indie von den Außenstimmen und vom 1. Sech-zehntel der Violine vorgegebene Harmoniefolge(die an der analogen Stelle in T. 37 ungetrübt er-scheint). Vielleicht müssen die drei folgendenSechzehntelnoten jeweils eine Sekunde höhergelesen werden, also in T. 33 h1–h1–d2 statt a1–a1–cis2 und in T. 49 g1–g1–h1 statt fis1–fis1–ais1.
Der Notentext der Neuausgabe ist gut lesbar ge-druckt. In den Einzelstimmen sind Wendestelleninnerhalb der Sätze vermieden. Etwas befremd-lich wirkt, dass in der Partitur die Taktstricheohne ersichtlichen Grund zwischen dem 2. und3. System durchgezogen sind wie bei einer Kla-vierakkolade. Hier hätte das Verlagslektorat ein-greifen müssen.
Eine Schlussbemerkung: Eine Frage für sich ist,ob die Dresdner Abschrift die Originalfassungder Sonate überliefert. Ingo Gronefeld erwähntin seinem thematischen Verzeichnis Flauto tra-verso und Flauto dolce in den Triosonaten des 18.Jahrhunderts (Band 3, Tutzing 2009, S. 140) eineim Katalog des Leipziger MusikalienhändlersBreitkopf 1762 angezeigte Fassung für Flauto,Viola da gamba und Basso continuo. Hier wärealso die Violinstimme der Dresdner Abschrift –eine Oktave tiefer – der Gambe übertragen ge-wesen. Zu fragen bliebe, welche der beiden Be-setzungen die authentische ist oder ob mögli-cherweise der Part im Original gar für ein drittesInstrument bestimmt war. Gegen die Violine wiegegen die Gambe könnte die insgesamt relativhohe Lage der Stimme sprechen: Der Violinpartkommt gänzlich ohne die G-Saite aus; die D-Saite wird zwar mehrfach in den beiden schnel-len Sätzen in Anspruch genommen, in den bei-den langsamen Sätzen aber nur je einmal berührt(gis1 in T. 15 des 1. und T. 19 des 3. Satzes). DerGesamtumfang ist d1–d3. Meines Erachtens ha-ben wir es eher mit einem Traverso-Part zu tun.Vielleicht handelt es sich ja in Wirklichkeit umjenes angeblich verschollene Trio für Block- undQuerflöte aus Pepuschs Feder, das Boullet in sei-nem Vorwort – allerdings ohne Quellenangabe –erwähnt. Klaus Hofmann
530 TIBIA 3/2011
Noten
TIBIA 3/2011 531
James Hook: 12 Duettinos op. 42für 2 Altblockflöten (Querflöten, Violinen) (Hg. Jo han -nes Bornmann), Schönaich 2010, Musikverlag Born-mann
– Vol. 1 (Duettinos 1-6), MVB 96, € 12,00
– Vol. 2 (Duettinos 7-12), MVB 97, € 12,00
James Hook (1746–1827) hat eine erstaunlicheAnzahl von Werken hinterlassen und war mehrals 50 Jahre als Dirigent, Arrangeur und Kom -ponist in verschiedenen Pleasure Gardens in En g lands Hauptstadt beschäftigt. Diese Ver- gnü gungsparks waren um 1800 die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Frei zeit ge -staltung. Als Park angelegt boten diese Er ho -lungs areale mit Pavillons, Live-Musik, Res tau -ra tionsbetrieben und abendlichem Feuerwerkalles, was im Zeitalter des Regency up to date war.
Im Vergleich zu der Masse an Opern und Vo kal -stücken nimmt sich die Zahl der Kam mer -musikwerke eher bescheiden aus. Die für 2Flö ten oder Violinen gedachten 12 Duettinos,
er schienen 1785, sind bereits im klassischen Stilgeschrieben und klingen gefällig und charmant.Die Sonaten haben alle zwei Sätze, die moderatbis schnell im Tempo sind; in Band 2 schließendie Sonaten, von zwei Ausnahmen abgesehen,alle mit Minuetti.
Hervorzuheben und wirklich gut sind Nr. 5, 7,8 und Nr. 9, sowie einige zweite Sätze, die kür-zer und damit prägnanter als die Anfangssätzesind. Der Umfang der ersten Stimme ist größerund erreicht regelmäßig das hohe f, während diezweite Stimme eindeutig mehr eine begleitendeFunktion hat, ohne jedoch langweilig zu sein.
Johannes Bornmann hat sich bereits in früherenAusgaben um das Werk von James Hook be -müht und es einem breiteren Publikum präsen-tiert. Dafür verdient er Anerkennung. BeideHefte sind empfehlenswert, wenngleich es sichempfiehlt, nicht alle Sonaten hintereinander weg zu spielen, da sich bei Überfütterung an klas -sischem Schaumschlagen eine leichte Un päss -lichkeit einstellen kann. Inés Zimmermann
Noten
532 TIBIA 3/2011
Friedrich Kuhlau: 3 Grands Duospour 2 Flûtes (Hg. Philippe Bernold), Paris 2010, Gér-ard Billaudot Éditeur, Partitur, G 7918 B
Für den französischen Verlag Billaudot arbeitenso bekannte Flötisten wie András Adorján,Pierre-Yves Artaud und Philippe Bernold, letz-terer als Herausgeber der Sammlung FF Thefrench flutists propose. Bernold hat sich wie sein2000 verstorbener Kollege Jean-Pierre Rampalum das Werk des dänischen Komponisten Fried-rich Kuhlau (1786–1832) verdient gemacht, undes scheint vorläufig noch genug Repertoire vor-handen zu sein, das eine Neuausgabe lohnt. Bisjetzt sind allein mehr als ein Dutzend Hefte mitDuetten Kuhlaus erschienen.
Kuhlaus Opus 39 entstand um 1821 und wardem berühmtesten Flötisten seiner Zeit AntonBernhard Fürstenau (1792–1852) gewidmet.
Die Artikulation wird durch Legato- oder Phra-sierungsbögen dominiert, der Charakter ist ab-wechselnd lyrisch oder hoch dramatisch und dieStil-Figuren zeigen deutliche italienische Ein-flüsse. Elegante Linienführung, viele Sechzehn-tel, schnelle Tempi und der häufige Gebrauchdes auf den damalige Klappenflöten schwierigzu produzierenden hohen Registers verleihendiesen Duetten einen hohen Schwierigkeitsgrad.
Das erste Duett in e-Moll ist dreisätzig: Allegroassai con molto fuoco–Adagio ma non troppo–Allegro. Der erste Satz wird seinem Titel gerecht.Er ist wirklich ein Feuerwerk. Kuhlaus Opern-kompositionen haben eindeutig Einfluss auf dieDuette gehabt. Nach der spritzigen Einleitungfolgt die große romantische Geste, die den in C-Dur dahin plätschernden Mittelsatz bestimmt.Der dritte Satz ist spitzbübisch, büxt kurzzeitignach E-Dur aus und endet in voller Fahrt.
Das B-Dur Duett enthält eine Folge von dreischnellen Sätzen, beginnt aber dennoch verhal-ten: Das erste Allegro ist nachdenklich, das Alle-gro lagrimoso, tragisch aber nicht verheult, unddas Rondo trostbringend und versöhnlich.
Am „rundesten“ ist das nun folgende viersätzigeD-Dur-Duett mit den Sätzen: Allegro scherzan-do, Adagio con anima, Canon und Rondo alla
Polacca. Volksliedhafte Melodien, romantischeSchaumschlägereien wechseln sich mit virtuo-sen Einwürfen voll Sturm und Drang ab. Ton-artenwechsel sorgen für zusätzliche Farbigkeit.
Unverständlich erscheint mir immer noch dasKonzept, derart lange Werke nur als Partitur herauszubringen, aus der ohne einen Blattwen-der nicht zu spielen ist.
Viel zu selten sind Kuhlaus Duette in Musik-schul-Vorspielen oder im Konzertbetrieb zu hö-ren, obwohl sie sehr unterhaltsam sind. Ist es dieLänge der Sätze, die Durchhaltevermögen erfor-dert und manch einen versierten jungen Flötis-ten abschreckt? Oder macht es mehr Spaß, dieseMusik zu spielen, als sie anzuhören?
Eine empfehlenswerte Neuauflage der alten Costallat Edition. Inés Zimmermann
Johann Christoph Friedrich Bach: Sonate inA-Durfür Flöte, Violine und B. c., aus Musikalisches Vielerley,Hg. und Continuo-Aussetzung Winfried Michel, Winter-thur (Schweiz) 2010, Amadeus Verlag, Partitur undStimmen, BP 1732, € 14,00
Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795),der zweitjüngste Sohn Johann Sebastian Bachs,stand schon zu Lebzeiten im Schatten seiner be-rühmteren Brüder. Als Mensch und Künstlerteilte er weder die exzentrischen Neigungen sei-nes ältesten Halbbruders Wilhelm Friedemann(1710–1784) noch den Drang zu öffentlicherWirksamkeit, der Carl Philipp Emanuel (1714–1788) und Johann Christian (1735–1782) zu in-ternationalem Ruhm führte. Johann ChristophFriedrich verbrachte vielmehr sein ganzes Musi-kerleben in relativer Zurückgezogenheit imDienste des Bückeburger Hofes. Vom Vater zueinem der besten Klavierspieler seiner Zeit undzu einem fähigen Komponisten ausgebildet, ver-ließ er nach kurzem Jurastudium Ende 1749 dasLeipziger Elternhaus, wurde in Bückeburg alsKammermusikus angestellt und rückte 1759zum Konzertmeister und damit zum Leiter derkleinen Hofkapelle auf. Als Persönlichkeit warer hoch geachtet: Von „Güte des Herzens und
Noten
TIBIA 3/2011 533
Rechtschaffenheit der Gesinnungen“ wie von„zuvorkommender Gefälligkeit“ ist die Rede.Vom Elternhaus ebenso geprägt wie dem Neuenaufgeschlossen, steht er als Komponist stilistischzwischen Barock und Wiener Klassik. 1778 be-suchte er seinen Bruder Johann Christian inLondon, erlebte dort das aktuelle Musiklebender Metropole und empfing vielerlei künstleri-sche Impulse, die fortan als progressive Elementesein kompositorisches Schaffen prägen sollten.
Die Sonate in A-Dur für Flöte, Violine und Bas-so continuo des „Bückeburger Bach“ erschien1770 in der von Carl Philipp Emanuel Bach inHamburg herausgegebenen Sammlung Musika-lisches Vielerley. Die Sammlung richtete sich vorallem an bürgerliche Musikliebhaber, und dementspricht der moderate spieltechnische An -spruch dieser Sonate. Zu den praktischen Be -dürfnissen dieses Adressatenkreises passt aucheine vom Komponisten vorgesehene Besetzungs-variante; zu der Violinstimme nämlich ist ver-merkt: „Violino o Cembalo“. Der Violinpartkann also auch von der rechten Hand des Cem-balisten übernommen werden, der dann zusam-men mit dem Bass diese Stimme anstelle der durchdie Bezifferung angegebenen Akkorde spielt.
Das schöne, noble und von dem nachbarock-vorklassischen Stilideal edler Simplizität gepräg-te Stück, das seit 1956 in einer Neuausgabe vonGotthold Frotscher bei Sikorski Verbreitung ge-funden hat und 1995 auch in einer Ausgabe vonDerek McCulloch bei Corda Music Publicationserschienen ist, liegt nun in einer weiteren Neu-ausgabe von Winfried Michel bei Amadeus vor.Sie besticht, wie alle Ausgaben dieses Verlags,durch ein erstklassiges Notenbild und erfreutdarüber hinaus durch ein wohlgewähltes Fron-tispiz mit einer historischen Ansicht des Bücke-burger Schlosses.
Der Notentext von 1770 scheint, nach den An-gaben in den drei Ausgaben zu schließen, prak-tisch fehlerfrei zu sein, so dass sich ein KritischerBericht erübrigt. Soweit es den originalen No-tentext betrifft, sind die Unterschiede zwischenden Ausgaben denn auch marginal. Anders beiden Generalbassaussetzungen: Während dieAusgabe von Frotscher vermutlich am moder-
nen Klavier entworfen ist und dem Begleiter miteinem teils sehr vollgriffigen und oft unklavie-ristischen Satz eher zuviel abverlangt, McCul-loch dagegen die Fähigkeiten des Accompagnis-ten äußerst niedrig ansetzt, rechnet Michel miteinem gewandten Spieler und bietet ihm einengeschmeidigen Klaviersatz, der ausnahmslos gutin der Hand liegt. Allerdings entfernt er sich da-bei weit von einer bloßen Transformation derBezifferung in einen akkordischen Satz. Undwären da nicht die Generalbassziffern, könnteman das Stück auf den ersten Blick für ein Kla-viertrio mit obligatem Tastenpart halten.
Hier scheint mir auch das Problem zu liegen.Natürlich ist in der Spätzeit der generalbassge-bundenen Kammermusik mancherlei an Freihei-ten in der Ausführung des Klavierparts möglich.Aber nach meinem Eindruck drängt sich der Be-gleiter hier zu sehr in den Vordergrund, steuertmit viel Phantasie auch allerhand profiliertesMotivmaterial bei, das im Prinzip durchaus inden Oberstimmen weiter durchgeführt werdenkönnte (wenn es sich um ein „echtes“ Klaviertriohandelte), verdeckt aber stellenweise zugleichdurch einen gewissen Aktionismus die vomKomponisten gewollte Simplizität. Zu beden-ken bleibt, dass der Komponist sein Werk auchin der rein dreistimmigen Darstellung von Flöte,Klavierdiskant und Klavierbass ohne Begleitungfür vollkommen erachtete. Auch das begrenztdie Rolle des Generalbassbegleiters, ohne ihndeshalb gleich auf die schmuck- und phantasie-lose Aneinanderreihung von Akkorden zu be-schränken. Gleichwohl: anregend ist MichelsBearbeitung allemal. Klaus Hofmann
Luigi Pagani: Quartett op. 4 D-Dur (1874)für drei Querflöten und Altquerflöte (Hg. Peter Thal -heimer), Ilshofen 2008, NotaBene, Partitur und 4 Stim-men, NB 1.007, € 25,00
Über Leben und Werdegang von Luigi Pagani(1805–1885) ist heute kaum etwas bekannt. Erwar ein Vertreter der „alten“ Flöte und wirktevermutlich in Mailand. Mit Giulio B. Briccialdi,Michele Carafa, Cesare Ciardi, Raffaele Galli,
Noten
534 TIBIA 3/2011
Emanuele Krakamp, Antonio Sacchetti und –etwas später – Giuseppe Gariboldi und Fer -rante Cigarini gehört er zu jenen Flötisten, dieim 19. Jahrhundert in Italien als Virtuosen undKomponisten nachhaltig zur Entwicklung ihresInstruments, seiner Musik und Spielweise bei-trugen. Ähnlich wie das flötenfreundliche Eng -land stand Italien in dieser Hinsicht in derWahrnehmung des musikinteressierten Publi -kums jedoch lange Zeit im Schatten der seiner-zeit tonangebenden Flöten-Nationen Frank- reich und Deutschland. Erst in jüngerer Zeit gibtes für die spezifisch italienische Flö ten tra ditionganz allgemein wieder ein größeres In teresse.Ein Beispiel dafür ist die vorliegende Neu ver -öffentlichung.
Neben unserem Flötenquartett, so vermerkt esder Herausgeber, sind von Luigi Pagani noch einDivertimento für Flöte und Klavier sowie ver-schiedene Duos und Trios für Flöten nachweis-bar. Darüber hinaus nennt Emil Prills Führerdurch die Flötenliteratur um 1900 noch weitereKompositionen, insbesondere Opern be ar bei tun -gen für Flöte und Klavier. Das Quartett op. 4setzt im Original in allen Stim men Flöten miteinem in der Tiefe bis a erweiterten Umfang vor-aus. Solche Instrumente wurden seinerzeit inAnlehnung an Wiener Modelle auch in Mailandgebaut. Da auf heutigen Flöten Partien miteinem Tonumfang von (klingend) a bis a3 nichtdarstellbar sind, entschloss sich der Herausgeberzu einer praxisorientierten Bearbeitung: Er teiltedie vier ur sprünglich gleichberechtigten Stim-men so auf, dass alle tiefen Stellen in die vierteStimme verlegt wurden, die nun problemlos aufeiner Alt flöte in G zu spielen ist. Dies muss aller-dings außerordentlich intonationssensibel ge-schehen. Sonst könnten nämlich die harmoni schenEska paden des ersten Allegro-Satzes nicht ver-ständlich (und vergnüglich) dargestellt werden.
Gleich im zweiten Takt muss z. B. ein übermä-ßiger Quintsextakkord her, um die Dominanteder Grundtonart D-Dur zu erreichen. In denbeiden Molto più lento-Abschnitten finden sichAusweichungen bis nach Fis-Dur und As-Dur;häufiger Gebrauch von verminderten Sep tak -kor den, Chromatik und Querstand bestimmen
weiter den Verlauf des Satzes – Pagani kanntesein harmonisches Handwerkszeug. Im übrigenist der Satz auf solistisch-konzertante Wirkungangelegt: flötengerechtes Spielwerk nach allenRegeln der Virtuosität der Zeit, hübsch ab -wechselnd verteilt auf die drei Oberstimmen,wird nur gelegentlich unterbrochen durch wir-kungsvolle Tutti-Effekte. Jeweils zwei oder dreiStimmen finden sich zu einer Begleitung zu -sammen, deren vor allem rhythmische Schlicht -heit einen starken Kontrast zu den virtuosenSolopartien bildet. Mit seinem flötischen An -spruch und einer Länge von 282 Takten recht-fertigt allein dieser Satz den Originaltitel desErstdrucks Grande Quartetto.Zurückhaltender hinsichtlich des kompositori-schen Aufwandes und der spieltechnischen An-forderungen stellen sich die beiden folgendenSätze dar. Im Andante bildet ein 16-taktigesThema in der Art einer Kavatine, das kaum dieGrundtonart verlässt, die Vorlage für vier Varia-tionen. Hierin haben bald eine, dann zwei undzum Schluss alle vier Flöten stets durchgehendeSechzehntel zu spielen, während die jeweils an-deren dazu einfache Begleitakkorde ausführen.Abgesehen von der wechselnden Besetzung lie-gen die Unterschiede zwischen den einzelnenVariationen in der Art der Figuration und derArtikulation – zweifellos eine originelle Ausfüh-rung der Variations-Idee. Der das Quartett be-schließende Walzer folgt, bei großflächiger undübersichtlicher harmonischer Anlage, wiederüberwiegend dem Prinzip des solistischen Kon-zertierens von ein oder zwei, dann meist in par-allelen Terzen geführten Oberstimmen, währenddie anderen Flöten eine einfache Walzerbeglei-tung ausführen.Mit Paganis Quartett ist ein schönes Beispiel italienischer virtuosità di flauto wieder verfüg-bar. Wer als Flötist diese spezielle Form des Virtuosentums kennen lernen und üben oder imKonzert vorführen möchte, dem sei, mit dreiGleichgesinnten, diese Ausgabe empfohlen. Wersich darüber hinaus tiefer mit Geist und Machartdes Werkes befassen möchte, der dürfte sichfreuen, wenn – zumindest on demand – aucheine Kopie des Originals erhältlich wäre.
Hartmut Gerhold
Noten
Ludwig van Beethoven: Drei Stücke für dieFlötenuhrfür Flöte, Englischhorn, Klarinette und Fagott (Hoth),Düsseldorf 2007, Manfred Hoth, Partitur und Stim-men, Vertrieb: [email protected], € 15,80
Bearbeitungen von Flötenuhrstücken für allemöglichen Besetzungen gibt es zuhauf, so vonWerken Beethovens, Mozarts, Haydns, in neue-rer Zeit auch von Stockhausen (Tierkreis).Schließ lich wollen die Komponisten noch gernihre guten Ideen weiterverwerten und Bearbei-ter andererseits suchen gute Werke für ihreWunschbesetzung. Die drei hier vorgelegtenStücke Beethovens für Holzbläserquartett gibtes z. B. auch bei Amadeus in Beethoven Sechsleichte Stücke für Flöte und Klavier. (Das „leicht”wollen wir dabei einmal so hingestellt lassen.)
Die Besetzung der vorliegenden Bearbeitungmit Englischhorn ist außergewöhnlich und reiz-voll, schon wegen ihres weichen, volleren war-men Klangs. Unseres Wissens gibt es da nurnoch ein allerdings originales Werk in gleicherBesetzung: Hans Mielenz’ Scherzo aus der 1.Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Die Bear-beitungen sind geschickt und mit Fantasie ge-macht. Einem melodischen Adagio assai in F-Dur folgen zwei Sätze in G-Dur: ein Scherzomit Trio und ein Allegro. Diese Bearbeitung istsicher eine Bereicherung für jeden Holzbläser-quartettabend, zumal alle Instrumente auch ihreVorzüge und Farben vorstellen können.
Frank Michael
„Edition Schott“ auf dem Umschlag den An -spruch, „hohe Qualität und editorische Zu ver -lässigkeit mit gut lesbarem Notensatz, sinnvol-len Wendestellen und hochwertigem Papier“ zuverbinden. Peinlich nur, wenn dann in der Flötenstimme der Valse Espagnole die einzigeWen destelle von der ersten zur zweiten Seiteausgerechnet mitten in einer übergebundenenNote liegt, obwohl sich bei einer anderen An -ordnung der Seiten eine bequeme Wendestelleim Takt 106 ergeben hätte. Merke: Was draußenangekündigt wird, sollte auch drinnen drin sein(die anderen Ankündigungen allerdings sinddurchaus zutreffend)!
Von dieser kleinen Meckerei abgesehen, sind die beiden Stücke sehr empfehlenswert: Bonsoirist eine – wie das 19. Jahrhundert geschriebenhätte – wunderhübsch sentimentale Pièce imwiegenden Neunachtel-Takt (Andante soste-nuto), und der spanische Walzer eine schwung-volle, für den Mann oder die Frau am Klavierebenso reizvolle Aufgabe wie für den oder dieFlötenspieler(in). Wie bei Köhler selbstverständ-lich, liegen beide Stücke in einer für die Flöte optimalen und klangreichen Region (und sindauch für Schüler der Mittelstufe gut erreichbar).
Ulrich Scheinhammer-Schmid
Ernesto Köhler: BonsoirRomanze für Flöte und Klavier op. 29 (Hg. ElisabethWein zierl/Edmund Wächter), Mainz 2009, SchottMusic, FTR 203, € 6,95
Ernesto Köhler: Valse Espagnolefür Flöte und Klavier op. 57 (Hg. Elisabeth Wein zierl/Edmund Wächter), Mainz 2009, Schott Music, FTR 204,€ 6,95
Beide Titel liegen schon seit längerer Zeit in denSalonstücken für Flöte und Klavier der EditionKunzelmann vor, dort freilich als Faksimile desOriginaldrucks. Demgegenüber betont die
TIBIA 3/2011 535
Angelo Savinelli: Quintetto (1821)per Flauto, Corno Inglese, Viola, Fagotto e Violoncello,Düsseldorf 2009, Manfred Hoth, Partitur und Stim-men, Vertrieb: [email protected], € 19,80
Die Bedeutung dieses Werkes liegt vor allem inseiner ungewöhnlichen Besetzung: Flöte, Eng-lisch-Horn, Viola, Fagott und Violoncello. Savi-nelli, circa 1800 geboren, war selbst u. a. Fagot-tist und mag das Werk wohl für Freunde undden Eigenbedarf komponiert haben. Das 15-mi-nütige Werk präsentiert nach einem kurzen Ein-gangssatz in Es-Dur Adagio/Allegro einen län-geren Variationensatz in G-Dur. In diesem Satzerhalten alle Instrumente Gelegenheit sich in ih-rer spezifischen Eigenart solistisch vorzustellen.Das ist sehr spielerfreundlich und dabei abwechs -lungsreich durchgeführt. Nach einer lang samenEinleitung mündet der 3. Satz, wieder in Es-
Noten
536 TIBIA 3/2011
Dur, in ein rossini-ähnliches, umtriebiges, bril-lantes 3/8-Finale. Dieses Werk wird mit seinenvielen Sext- und Terz-Parallelen sicher auch Lieb -habern Freude machen und ebenso in einem Serenadenabend einen schönen Erfolg erringenkönnen. Das Werk ist mit einem instruktivenVorwort versehen und sauber in Partitur undStimmen gedruckt. (Im 2. Satz in Takt 37 derFlötenstimme muss der 10. Ton wohl auch ein gsein). Frank Michael
NEUEINGÄNGE
Bärenreiter-Verlag, KasselDebussy, Claude: Syrinx, pour flûte seule (Hg.Douglas Woodfull-Harris), Reihe: BärenreiterUrtext, 2011, BA 8733, € 5,50Gérard Billaudot Éditeur, ParisAvinée, Nicolas: Le château hanté, pour 2 flûtespiccolos, 7 flûtes et 1 flûte alto, 2010, Partiturund Stimmen, G 8664 BCiardi, Cesare: La capricieuse, pour flûte pic-colo (Beaumadier) et piano, 2011, Partitur undStimme, G 8882 BGuiot, Raymond: Sweet project, pour flûte piccolo et piano, 2011, Partitur und Stimme, G 8866 BTchesnokov, Dimitri: Tableaux féeriques, opus40, pour trio de flûtes, 2011, Partitur und Stim-men, G 8799 BBreitkopf & Härtel, WiesbadenReinecke, Carl: Trio, für Klavier, Oboe undHorn in a-Moll op. 188, Reihe: Musica Rara,2011, Partitur und Stimmen, MR 2265, € 20,00Zender, Hans: Lo-Shu VI, 5 Haikai für Flöteund Violoncello, 2011, Spielpartitur, EB 9067, € 20,50Carus-Verlag, StuttgartTelemann, Georg Philipp: O selig Vergnügen, oheilige Lust (TVWV 1:1212), Kommunionskan-tate für Alt, Bass, 2 Altblockflöten und Bassocontinuo (Hg. Klaus Hofmann), Reihe: Tele-mann-Archiv, Stuttgarter Ausgaben, Urtext,2010, Partitur, CV 39.121, € 14,00Eres Edition Musikverlag, LilienthalBach, Johann Sebastian: 15 zweistimmige In-ventionen, für 2 Oboen und 2 Fagotte (Sulyok),
Heft 1 (Nr. 1, 2, 3, 15), 2011, Partitur und Stim-men, eres 2981, € 14,80Bach, Johann Sebastian: 15 zweistimmige In-ventionen, für Oboe, Fagott, Violine und Vio-loncello (Sulyok), Heft 2 (Nr. 4, 5, 6, 7, 11), 2011,Partitur und Stimmen, eres 2982, € 16,80Bach, Johann Sebastian: 15 zweistimmige In-ventionen, für Flöte, Oboe, Klarinette in Bb undFagott (Sulyok), Heft 3 (Nr. 8, 9, 10, 12, 13, 14),2011, Partitur und Stimmen, eres 2983, € 16,80Sulyok, Tamàs: Drei Fagotte, 16 Übungen,2011, Partitur und Stimmen, eres 2952, € 26,80
Heinrichshofen Verlag, WilhelmshavenBach, Johann Sebastian: Sinfonia d-Moll, ausder Kantate „Geist und Seele wird verwirret“[BWV 35], für 4 Blockflöten SSAT, Cembalound Violoncello oder für 5 Blockflöten SSATB(Scherschmidt), 2010, Partitur und Stimmen, N2622, € 12,90Ernst, Christian: Vocalise & Tanz, op. 49, fürVioline/(Block-)Flöte/Oboe und Klavier, 2011,Partitur und Stimme, N 2503, € 12,50Heider, Werner: Ereignisse, für Fagott solo,2010, N 2673, € 5,90Heider, Werner: Motivirrungen, für Oboe solo,2010, N 2672, € 5,90Heider, Werner: Solfeggio, für Oboe solo, 2010,N 2671, € 3,90Kummer, Kaspar: Drei leichte Duette „zur Bil-dung des Taktgefühls und des Vortrags“, für 2Flöten, op. 146 (Hg. Frank Nagel), Reihe: L’artedel flauto, 2011, Partitur, N 2634, € 9,90Maute, Matthias: Sonata per flauto e piano, fürAltblockflöte (Flöte) und Klavier, 2010, Partiturund Stimme, N 2709, € 11,50Roelcke, Christa: Interpretation leicht gemacht,lebendiges Musizieren nach Spielregeln AlterMusik, 30 Duos für Altblockflöten, 2010, N2531, € 11,90Teschner, Hans Joachim: Flötenclub, für 3 Alt-blockflöten oder Querflöten, Band 2, 2011, Par-titur, N 2691, € 9,90Volkhardt, Ulrike/Priesner, Vroni: Die kleineZauberflöte, das Blockflötenkonzept für denKlassen- und Gruppenunterricht, Schülerband,2011, N 2750, € 13,50Volkhardt, Ulrike/Priesner, Vroni: Die kleine
Noten
TIBIA 3/2011 537
Zauberflöte, das Blockflötenkonzept für denKlassen- und Gruppenunterricht, Lehrerband in5 Bänden, 2011, N 2751, € 34,90
Musikverlag Holzschuh, ManchingErtl, Barbara: Jede Menge Flötentöne!, dieSchule für Sopranblockflöte mit Pfiff, Band 2,2011, inkl. 2 CDs, VHR 3618-CD, € 21,80
Moeck Verlag, CelleBizet, Georges: Carmen – Entr’acte II, forrecorder orchestra (SAT5B4Gb3Sb Harp adlib.), adapted by Ferdinand Steinhöfel, 2011,score and 5 parts, EM 3319, € 20,00Gershwin, George: Summertime, from Porgyand Bess, for recorder orchestra (SATBGb/Sb),adapted by Sylvia Corinna Rosin, 2011, scoreand 6 parts, EM 3320, € 17,00Rosin, Sylvia Corinna: Raindrops, for recorderorchestra (Sino3S2A2TBGbSb), 2011, score and7 parts, EM 3323, € 20,00Schumann, Robert: Romanze, from SymphonyNo. 4, D-minor op. 120, for recorder orchestra
(SSAATTBBBGbSb), adapted by Irmhild Beut-ler, 2011, score and 5 parts, EM 3321, € 17,00Tchaikovsky, Peter I.: Ouverture miniature,from The Nutcracker Ballet, op. 71, arranged forrecorder orchestra (SinoSSAATTBBBGb) andtriangle by Dietrich Schnabel, 2011, score and 13parts, EM 3318, € 30,00
Otto Heinrich Noetzel Verlag, Wilhelmshaven (Ver-trieb: Heinrichshofen Verlag, Wilhelmshaven)Heger, Uwe: Straßenmusik à 3, für 3 Querflö-ten, Klezmer, Blues, Ragtime und Latin-Folk,Heft 2, 2010, Partitur, N 4778, € 11,00Heger, Uwe: Straßenmusik à 3, für SAT-Block-flöten plus Bassinstrument ad libitum, Klezmer,Blues, Ragtime und Latin-Folk, Heft 2, 2009,Partitur, N 4889, € 11,00
G. Ricordi & Co., MünchenVoss, Ingrid und Richard: Blockflötenfieber 2,Schule für Sopranblockflöte (Tenorblockflöte)barocke Griffweise, 2011, inkl. 1 CD, Sy. 2891,€ 15,80
Blockflöten von A bis ZAnsichtssendung anfordern.
Anspielen.Vergleichen.
Gerne beraten wir Sie ausführlichund stellen mit Ihnen gemeinsam Ihre Auswahl zusammen.
einfach anrufen: 0 23 36 -990 290
Testen Sie uns!
early music im Ibach-HausWilhelmstr. 43 · 58332 Schwelm · [email protected] · www.blockfloetenladen.de
�und samstags in Schwelm: Konzerte, Workshops,
Noten
538 TIBIA 3/2011
Tonträger
Flautando Köln: Musik für Blockflötenen-sembleKatharina Hess, Susanne Hochscheid, Ursula Thelenund Kerstin de Witt (Blockflöten), Carus-Verlag, Stutt-gart 2010, 1 CD, Carus 83.360
Mit seiner neusten Einspielung schlägt Flau-tando Köln einen Weg ein, den andere Blockflö-tenquartette zuvor bereits gegangen sind. Dievier Musikerinnen aus Köln vereinen gewichtigeOrgelwerke Johann Sebastian Bachs oder Teiledaraus mit Kammermusik-Kompositionen vondessen Söhnen Johann Christian und WilhelmFriedemann. Eingefasst wird das Programm vonvier Contrapuncti aus der Kunst der Fuge, undzum Abschluss erklingt J. S. Bachs letzter Cho-ral Vor deinen Thron tret’ ich hiermit BWV 668.
Was auf dem Papier einigermaßen kohärent aus-sieht, erweist sich allerdings beim Anhören derCD als nicht geglückter Spagat. Vor allem wirddie Konzeption nicht den galanten Werken derBach-Söhne gerecht; zu groß ist der stilistischeBruch als dass er sinnstiftend wäre. Zugespitztkönnte man sagen, die hier zusammengestelltenWerke vereint nur eines: den gemeinsamen Nach -namen ihrer Autoren!
Dabei fängt alles so an, dass man sich kein Endewünscht. Selten hat man die Fantasia et Fuga inc BWV 537 so beseelt und transparent gehört,wie in diesem Arrangement von Flautando Köln;und es beschleicht einen der Verdacht, dass dieOrgel im Grunde doch nur eine gigantische Pro-these ist: ein Ersatz für die vom menschlichenOdem geblasene Kernspaltflöte. Dabei lässt mansich problemlos über den ein oder anderenKnick besonders der Pedalstimme hinweg trös-ten. Der ruhige Fluss des tiefen Flötenregistersund vor allem die Plastizität der Bassflöten sindbeeindruckend und geben dem Werk eine neue,unerhörte Dimension. Hier liegt der wahre Sinn
des Bearbeitens: im Aufzeigen von Aspekten,die sich in der Originalgestalt nicht ohne weite-res erschließen und freilich im Halten eines mu-sikalischen Niveaus, das keinen Vergleich zuscheuen braucht. Beides ist hier geglückt.
Die weitere Präsentation der Werke von VaterBach bleibt leider allzu fragmentarisch. AusBWV 538 nur die Toccata und aus BWV 550 nurdie Fuge einzuspielen, ist unbefriedigend undwird dem vom Komponisten intendierten Werk-zusammenhang nicht gerecht. Gerade nach demaußerordentlich gelungenen Auftakt der CDhätte man sich gewünscht, dass Flautando Kölnnicht so schnell die Flinte ins Korn geworfenund sich auf die Suche nach mehr für Block -flötenensemble realisierbarer Orgelmusik vonJohann Sebastian begeben hätten – und es gibtsie freilich gerade am Rande des ausgetretenenKanons der berühmten Stücke! Dadurch hättesich das Projekt sogar einen beachtlichen Reper-toirewert sichern können. Wir warten also aufbeherzte Fortsetzung. Michael Form
Aldo Abreu: Telemann – Twelve Fantasiasand other worksAldo Abreu (performing on 18th-century recorders fromthe von Huene collection), with Suzanne Stumpf(transverse flute) and the Musicians of the Old PostRoad, Bressan Records 2009, 1 CD, Bressan 0901,www.aldoabreu.com
Frans Brüggens legendäre Einspielungen auf 17historischen Blockflöten seiner Privatsammlunghaben nicht wirklich Schule gemacht. Es existie-ren nur wenige Aufnahmen mit originalenBlockflöten des 17./18. Jahrhunderts – darunterallerdings ein paar herausragende Produktionenvon Hugo Reyne, Saskia Coolen und anderen.2009 hat nun der Blockflötist Aldo Abreu eineCD produziert, auf der erstmalig die Instrumen-te der Sammlung Friedrich von Huene präsen-tiert werden – ein seltenes Unternehmen und für
Tonträger
TIBIA 3/2011 539
den Freund des authentischen Klangbildeshochinteressant. Um es gleich vorweg zu neh-men: Bei der vorgelegten Einspielung handelt essich keinesfalls nur um ein exotisches Projektmuseal-intellektuellen Charakters. Abreu er-weist sich sowohl als ausgesprochen stilsichererund zugleich phantasievoller Interpret als auchals virtuoser Blockflötist, dem dynamisch undklanglich eine beeindruckende Bandbreite ge-stalterischer Möglichkeiten zur Verfügung steht.Um den spezifischen Charakter eines jeden In-strumentes so deutlich wie möglich vorzustellen,wählt Abreu ausschließlich Solorepertoire: Eserklingen die bekannten 12 Flötenfantasien vonGeorg Philipp Telemann, ergänzt um zwei Ein-zelsätze von Johann Joachim Quantz und Jo-hann Christoph Pepusch sowie Telemanns be-rühmtes Doppelkonzert in e-Moll für Block-und Traversflöte, Streicher und B. c. UntermStrich lässt sich der Gesamteindruck rasch zu-sammenfassen: Der Hörer sieht sich einer Far-bigkeit ganz verschiedener Blockflötenklängegegenüber, die der zeitgenössische Markt an„Kopien“ historischer Originale bei weitemnicht bereitstellt, und es ist absolut verblüffend,wie enorm die Unterschiede etwa zwischen In-strumenten von Peter Bressan, Georg HeinrichScherer oder Johann Christoph Denner sind:Bressans Alt erinnert mit seiner konturiertenTiefe und etwas „spuckigen“ Höhe sofort an dasPendant aus der Brüggen-Sammlung, und eineVoiceflute – ebenfalls von Bressan – bestichtdurch eine nahezu betörende klangliche Vielfalt:Satte Tiefe, sonore Mittellage, mal gläsern, malfast streichend, leichte Ansprache in der Höhe.
Sehr eigen fällt das fast metallische Timbre einesAltes von Thomas Stanesby junior aus. Lieblich,fein und elegant dagegen kommt seine Fourth-flute (Sopran in b2) daher. Es mag an dieser Stellenicht auf den Charakter aller insgesamt 9 Flötender CD eingegangen werden. Dem Liebhaberder Materie wird ohnehin schon klar gewordensein, dass er am Kauf der CD nicht vorbeikommt.Nur auf ein köstliches Unikum sei noch hinge-wiesen: Telemanns 8. Fantasie erklingt auf einerBassblockflöte(!) aus der Werkstatt von ThomasBoekhout – absolut einzig im Klang, mit ganzerheblichem Luftanteil im Ton und dennochsehr charakterstark, ausgestattet allerdings mitzwei derart ohrenbetäubend schepperndenKlappen, dass man unweigerlich aufspringenund die Lautstärke seiner Anlage drosseln muss.Von dieser akustischen Zumutung abgesehen, istes aber auch oder gerade die Aufnahmequalität,die Abreus Platte so gelungen macht: Nicht un-nötig viel Hall und Raum, sehr direkt, so als obder Hörer ganz dicht am Instrument säße. Wun-derbar! Einziger Wermutstropfen (vielleichtaber auch eine Sache des persönlichen Ge-schmacks) ist Telemanns Doppelkonzert – of-fenbar ins Programm der CD aufgenommen, da-mit auch von Huenes Traversflöte von Schererzum Einsatz kommen konnte. Ein Telemann-Duett, besetzt mit Block- und Traversflöte, hättemich im Kontext der intimen, einstimmigenFantasien eher überzeugt, zumal der Orchester-klang der Musicians of the Old Post Road ver-gleichsweise diffus abgebildet ist und sich diegestalterische Absicht dadurch zu indirekt mit-teilt. Karsten Erik Ose
Blockflötenbau Herbert Paetzold- Blockflöten in handwerklicher Einzelfertigung- Nachbauten historischer Blockflöten - Viereckige Bassblockflöten von Basset bis Subkontrabass
Schwabenstraße 14 – D-87640 Ebenhofen – Tel. 08342-899111 – Fax: [email protected] · www.alte-musik.info
Tonträger
540 TIBIA 3/2011
Stefan Temmingh & Ensemble: The Gentle-man’s FluteHändel-Arien in Bearbeitungen des 18. Jahrhundertsfür Blockflöte und Basso continuo, Stefan Temmingh(recorder), Olga Mishula (psaltery), Olga Watts (harp-sichord), Domen Marinčič (viola da gamba), LyndonWatts (baroque bassoon), Axel Wolf (lute & theorbo),Loredana Gintoli (baroque harp), Oehms Classics,München 2010, 1 CD, OC 772
Mit Bearbeitungen von Arien und der Sonate ing-Moll op. 1 (HWV 360) von Georg FriedrichHändel stellt der Südafrikaner Stefan Temminghnach Corelli à la mode bereits seine zweite Solo-CD im Jahresabstand vor. Es handelt sich um ei-ne solide gemachte, vom ganzen Ensemble ge-tragene Produktion, die die zeitlose Schönheitder Händelschen Melodien in einer innigen undunaufgeregten Manier präsentiert.
Eindrücklich sind z. B. Credete al mio doloreaus Alcina und Tu mia speranza aus Amadigi diGaula, beim letzteren ist es die reizvolle Klang-kombination aus Psalterio und Blockflöte, dieim Gedächtnis bleibt und elegant ausgeführtwird.
The Gentleman’s flute ist eine professionelleAufnahme, die Möglichkeiten aufzeigt, das be-kannte Repertoire neu in anderer Besetzung zupräsentieren. Die Zusammenstellung dieser CDkönnte viele Liebhaber der Blockflöte animie-ren, sich auf die Suche nach anderen Bearbeitun-gen von Vokalmusik für die Blockflöte zu ma-chen und diese im Ensemblespiel zu genießen.
Inés Zimmermann
The Lost ModeAnnette Bauer (recorders, sarode), Shira Kammen(vielle, harp, violin d’amore), Peter Maund (percus-sion), Derek Wright (oud), Berkeley (USA) 2010, 1 CD,TLMCD 01, Info: www.annettebauer.com
„The lost mode“ – damit ist der „Modus“ ge-meint, jener Begriff für Kirchentonarten, der je-doch weitaus mehr meint als die Abfolge vonGanz- und Halbtönen, sondern auch Ambitus,zentrale Töne und Abschlussfloskeln mit ein-schließt. Auf der gleichnamigen CD von Annet-te Bauer (Blockflöten, das indische Saiteninstru-
ment Sarod), Shira Kammen (Drehleier, Harfe,Violine), Peter Maund (Perkussion) und DerekWright (Oud) stehen wie selbstverständlich mit-telalterliche Tänze aus französischen, italieni-schen, englischen oder spanischen Manuskriptenneben traditionellen türkischen, armenischen,griechischen oder sephardischen Melodien. Da-bei stellen sich oft ähnliche Probleme: Die oraleÜberlieferungskultur traditioneller Melodienbedarf ebenso eines Arrangements und einer im-provisierenden Annäherung wie die nur skiz-zenhaften Niederschriften mittelalterlicher Tän-ze. Das Ensemble umschifft dabei gekonnt dieGefahr, allen Stücken einen Einheitsklang zuverpassen: Wohl ist die Blockflöte bei fast jederder 17 Nummern das zentrale Instrument, aberdas abwechselnd verwendete Instrumentariumsowie die Einbettung in die jeweilige Gesamt-idee eines Stückes lassen verbindende Elementeerahnen, die Unterschiede jedoch beleben dieAbfolge dieser Ausbrüche aus den bekanntenDur-Moll-Schemata. Die Tänze sind nicht zu-letzt auch spannend zu hören aufgrund ihrerrhythmischen Raffinesse, die vor allem im uni-sonen Musizieren betont wird. Die ruhigerenStücken schwelgen hingegen in wechselndenKlangmischungen, die durchaus vergessen lassen,dass hier keineswegs historisch korrekte Instru-mentenkombinationen zusammenkommen –„World Music“ nicht nur über regionale, son-dern auch zeitliche Grenzen hinweg.
Regina Himmelbauer
Mr. Corelli in London: Blockflötenkonzertenach Corellis op. 5Maurice Steger (Blockflöte); The English Consort unterder Leitung von Laurence Cummings; booklet in Eng-lisch, Deutsch und Französisch; Harmonia Mundi 2010;HMU 907523
Blockflötisten, die schon lange im Geschäft sind,gibt es einige. Aber nicht alle von ihnen sind mitder Gabe ausgestattet, sich von Zeit zu Zeitimmer wieder neu zu erfinden. Der SchweizerMaurice Steger, der durch harte Ar beit, Fleißund Können seit Jahrzehnten ein gefragter Gastauf den europäischen Kon zert bühnen ist undsowohl mit Spezialisten der Alten Musik wie mit
Tonträger
TIBIA 3/2011 541
namhaften modernen Ensembles als Solist kon-zertiert, gehört jedoch dazu.
Weit ist er gekommen seit er 1994 An ItalianGround aufnahm, aber bereits damals war seinSpiel interessant, seine Technik ausgereift undsein Gespür, sich mit den richtigen Mitspielernzu umgeben, ausgeprägt.
Anno 2010 ist alles wie immer, nur besser. DieAufnahmetechnik ist besser geworden, MauriceSteger ist als Musiker und Interpret gereift undhat mit dem Cembalisten Laurence Cummingsund The English Consort wieder einmal Mit -spieler gleichen Kalibers gefunden. In einer derbesten und fantasievollsten Einspielungen hat erCorellis verschiedene Facetten eingefangen, wiez. B. sein Talent, wunderschöne gesangliche Me-lodien zu schreiben, und seine selbstverständli-che Virtuosität. Überhöht werden diese für sichausreichenden Qualitätsmerkmale durch die ro-saroten englischen Arrangements von Gemi-niani „and severall other eminent masters“ seinesNummer-eins-Hits, des Opus 5. Selten hat manso viele Verzierungen in einem Atemzug gehört,die verzaubern und gleichzeitig durch die Stärkeihres Parfüms betäubend wirken.
Maurice Steger kann nun die Qualität eines inGnade alt gewordenen Spitzenweins anbieten,nur ist er der Geist mehrerer Flaschen, die ver-schiedene ausgewogene Bouquets zu bietenhaben. Sein Repertoire hat sich erweitert, unddabei ist er sich selbst treu geblieben.
The English Consort glänzt mit der Or ches ter -bearbeitung von Corellis La Follia-Version. Esist ein guter Schachzug, hier nicht die x-te Ver -sion mit Blockflöte, sondern eine reine Strei-cherversion anzubieten.
Überhaupt ist das Orchester an dem lasziv-sinn-lichen Klangergebnis maßgeblich beteiligt, mitsamtig-seidigem, gerne in die Vollen gehenden,aber niemals zu offensivem Klang.
Corellis Opus 5 ist als Original für Geige undBasso continuo herrliche Musik. Mit Corelli inLondon hat Maurice Steger daraus Musik fürBlockflöte und B. c. gemacht, ebenso herrlich!Kaufen und als lustvolles Abenteuer genießen!
Inés Zimmermann
Michael Schneider: The Virtuoso RecorderBlockflötenkonzerte von Fasch, Schickhardt, Scheibe,Schultze, Graupner und Stulick, Michael Schneider(Blockflöte/Leitung), Cappella Academica Frankfurt,cpo, Georgsmarienhütte 2010, 1 CD, cpo 777 534-2
Frans Brüggen hat vor Jahrzehnten gesagt, seineSchüler spielten inzwischen schneller als erselbst, und damit hat er gemeint, sie hätten ihnfinger- und zungentechnisch überrundet. Dabeiwird Brüggen wohl an Walter van Hauwe undKees Boeke gedacht haben. Beide haben längstselbst „Schule gemacht“, und auch sie wurdenspieltechnisch von ihren Schülern zum Teil über-troffen. Einer von ihnen ist Michael Schneider,der bereits während seines Studiums eine Vir-tuosität entwickelt hat, die seinerzeit buchstäb-lich „unerhört“ war und spätestens nach seinemErfolg beim ARD-Musikwettbewerb 1978 in-ternational aufhorchen ließ. Seit 1983 hat er dieBlockflötenprofessur an der Musikhochschulein Frankfurt am Main inne und leitet den vonihm gegründeten Studiengang „Historische In-terpretationspraxis“. Auch er hat unzählige Stu-denten ausgebildet – darunter auch solche, dieauf sich aufmerksam machen konnten, in jünge-rer Zeit etwa der „Newcomer“ Stefan Tem-mingh. Wer nun allerdings meint, auch Schnei-der würde allmählich von einem seiner Zöglingeüberboten, der wird durch die vorliegende Auf-nahme gründlich eines besseren belehrt; dennvor allem das neuentdeckte Konzert von Faschist derartig schwer zu bewältigen – manche Pas-sagen gehen über die technischen Anforderun-gen der Vivaldi-Konzerte hinaus ! –, dass wohlweltweit nur wenige Blockflötisten in der Lagesein dürften, sich dieser Herausforderung er-folgreich zu stellen. Schneider selbst gibt zu,noch mal „ordentlich geübt zu haben“, bis er’s„drauf hatte“, und alleine das imponiert. Handaufs Herz: Welcher Musiker stellt sich in reife-rem Alter noch neuen, höchst kniffeligen Auf-gaben? Aber längst nicht nur die ans Akrobati-sche grenzende Virtuosität lässt diese CD fürjeden Blockflötenfreund und -spieler zum„Muss“ werden. Es ist vor allem das Repertoire,es sind die allesamt entweder wenig oder garnicht bekannten Werke deutscher Komponisten,
Tonträger
542 TIBIA 3/2011
die zusammen mit den populäreren Konzertenvon Telemann beinahe den kompletten Bestanddeutscher Blockflötenkonzerte bilden. Das mussman einfach kennen, zumal die musikalischeSubstanz der eingespielten Stücke ausgespro-chen gehaltvoll und stilistisch abwechslungs-reich ist: Graupner verblüfft – wie so oft – durchseinen gänzlich unorthodoxen Umgang mitForm, Phrasen- und Melodiebildung, im Kon-zert eines mir zuvor nicht bekannten JohannMatthäus Stulick tritt als Dialogpartner derBlockflöte ein Fagott auf den Plan, SchickhardtsKonzert präsentiert von Satz zu Satz ganz un-terschiedliche Besetzungsvarianten von Block-flöte, 2 Oboen, Fagott, Streichern und B. c. (nachArt eines „Gruppenkonzertes“), und Scheibesconcerto di camera – sprich mit reduzierter Be-gleitung des Solisten von 2 Violinen und B. c. –kommt stilistisch sehr fortschrittlich daher, trägteindeutig nicht mehr die typischen Züge derspätbarocken Tonsprache, sondern verweist be-reits in Richtung des Galanten, an einigen Stellensogar der musikalischen „Klassik“. Fast über-
flüssig scheint zu erwähnen, dass SchneidersSpiel sich aufs rein Technische nicht reduzierenlässt. Auch in puncto klanglicher Schönheit, Far-bigkeit und stilistischer Souveränität bleibtnichts zu wünschen übrig, und wieder einmalfällt angenehm auf, dass der Interpret sich nichtdurch ausgetüftelte Mätzchen und eitle Manie-ren in den Vordergrund zu spielen versucht, wo-durch auch das wiederholte Hören der CD nichtzu nerven beginnt, was im Falle so mancher jün-gerer Aufnahmen mit Alter Musik gerne einmalder Fall ist. Schneider, seine Kollegen und derenehemalige Schüler (so setzt sich die Capella Aca-demica Frankfurt zusammen) beleben die Werkeaus dem Geist ihrer Entstehungszeit heraus undbegnügen sich mit den entsprechenden gestalte-rischen Mitteln, spielen sauber, gut und offen-sichtlich auch mit viel Freude zusammen. Manringt nicht um Effekte, wo sie in der Komposi-tion nicht angelegt sind, sondern vertraut demKomponisten und glaubt an die Qualität und dieWirkung seiner Musik. Interpretatorisch um je-den Preis verblüffen, das möchte diese Aufnah-me offenbar gar nicht. Und gerade deswegen …tut sie es! Karsten Erik Ose
NotenschlüsselMusikalienhandlung S.Beck & CoKG
Metzgergasse 8 D-72070 Tübingen
RUF 0 70 71- 2 60 81 FAX 2 63 95
Internet: www.notenschluessel.net
Seit über 25 Jahren :
Alles für BlockflötistenFlöten
Noten
Zubehör
Marion Fermé: Abbonda di virtù800 years of Italian music with the recorder, MarionFermé (recorder), Elisabeth Seitz (psaltery), JohannaSeitz (gothic harp), Isolde Kittel-Zerer (harpsichord),Martina Schänzle (soprano), Gerhart Darmstadt (baro-que cello), ambitus Musikproduktion, Hamburg 2010,1 CD, amb 96928
„Abbonda di virtù“ – „Reich an Tugenden“lockt der Titel einer Sammlung von italienischerBlockflötenliteratur aus 8 Jahrhunderten, die diefranzösische Blockflötistin Marion Fermé zu-sammengestellt hat. Der Titel spielt auf eine Bal-lata des blinden Musikers Francesco Landini an,die auch im ersten Teil zu hören ist, der der Mu-sik des Trecento, also der italienischen Musikdes 14. Jahrhunderts gewidmet ist. Sehr fein ab-wechslungsreich artikuliert und auch klanglichhöchst differenziert klingen „Gebrauchsmusik“wie Saltarelle (mit einleitenden Improvisatio-nen) neben komplexen Stücken eines Landinioder Jacopo da Bologna oder den virtuos ver-
Tonträger
TIBIA 3/2011 543
zierten Instrumentalfassungen aus dem FaenzaCodex. Klanglich anreichernd treten ein Psalte-rion (Elisabeth Seitz) bzw. eine gotische Harfe(Johanna Seitz) hinzu.
Ein zeitlicher Sprung versetzt uns dann in dieWelt des Frühbarocks: Castellos 2. Sonata oderCimas Sonata in g (mit souveränen Passagi amBarockcello: Gerhart Darmstadt) dürfen danicht fehlen. Auch hier bestechen die Klarheitder Ansprache sowie die packende Durchgestal-tung der musikalischen Textur. Ein Solostück fürCembalo ist ebenfalls in dieser Abteilung zu hö-ren: Ercoles Pasquinis Canzona in a-Moll inter-pretiert Isolde Kittel-Zerer mit fein abgestimm-ten Gesten des Zögerns und Zupackens.
Für das Hochbarock hat sich das Ensemble füreine Kantate von Antonio Vivaldi entschieden.All’ ombra di sospetto (RV 678) ist für mich aller-dings das am wenigsten überzeugende Stück:Die Stimme der Sopranistin Martina Schänzleund der Klang der Blockflöte mischen sich nichtunbedingt, was auch nicht zuletzt an dem unter-schiedlichen Artikulationsstil liegt: Fast „ge-sprochen“ wirkt das Spiel von Marion Fermé,hingegen vergleichsweise linear der Gesang.Restlos überzeugend hingegen die in den letztenJahren immer beliebtere virtuose Sonate von Signor Detri. Den Ausklang bilden zwei musi-kalische Kontrapunkte: Der geheimnisvolle Ab-schluss von Berios Gesti geht in Teddes nichtminder ausdrucksstarkes Austro über.
Regina Himmelbauer
Kasseler Avantgarde-Reihe III: Casale, Götte,Kenguô, Michel, Schmidtmann, Töpp, Yoshi-mineAnna Stegmann, Wolf Meyer, Zoë-Marie Ernst, UteSchleich, Silvia Backhaus, Fumiharu Yoshimine (Block-flöten), Leonie Garmond (Violoncello), Christof Back-haus (Cembalo), Peter Kennel, Susanne Lohmiller(Gesang), Mieroprint Musikverlag, Münster 2010, 1 CD,inkl. Beiheft, EM 6004, € 19,00
Nach einer längeren Pause ist nun die dritte CDder Kasseler-Avantgarde-Reihe erschienen. Die-ses Mal umfasst die Zusammenstellung neben
Solostücken für die Blockflöte auch Komposi-tionen von Blockflöte mit Gesang oder anderenInstrumenten bzw. Elektronik. Überdies wagtman auch einen Sprung im Zeitrahmen: DerGroßteil der Kompositionen stammt aus demletzten Jahrzehnt und umfasst vor allem deut-sche Komponisten, wie zwei in ihrer Grund-stimmung meditative Werke von Winfried Mi-chel (odi et amo für Gesang und Tenorblock-flöte, 2008, sowie Still ist’s, 2001). Neben jünge-ren Werken von Thorsten Töpp (a due, 2003/05,für Tenorblockflöte und Violoncello) und UlliGötte (Mural, 2007, für verschiedene Blockflö-ten solo) ist auch eine dreisätzige Sonatine fürAltblockflöte solo von Friedrich Schmidtmannzu hören, die wohl auch zu ihrer vermutlichenEntstehungszeit um 1970 nicht unbedingt zurAvantgarde gezählt haben dürfte, die jedoch vorallem im letzten Satz durch ihren Spielwitz zuüberzeugen vermag.
Eröffnet wird die CD aber mit einem modernen„Klassiker“: Fumiharu Yoshimines Mudai(1999). Von diesem Komponisten ist auch dasStück Kai zu hören. Die beiden Tenorblockflö-tenstimmen wurden von Fumiharu Yoshimineim Playback-Verfahren selbst eingespielt undverweisen sowohl in der Komposition als auchin ihrer rauschenden Klanggebung auf die japa-nische Shakuhachi-Tradition. Auch den Ab-schluss der CD bildet ein japanischer „Klassi-ker“, nämlich Shakuhachi-Variationen des Lie desRokudan no shirabe von Yatsuhashi Kengyô (17.Jahrhundert). Wenn man mit „Avantgarde“ dasBeschreiten eher ungewohnter (Hör-)Wegemeint, hat dieses Stück für europäische Ohrendurchaus seine Berechtigung, in dieser Kompi-lation aufgenommen zu werden. Eine – wie auchauf den anderen CDs – bunte Zusammenstel-lung, die auch nicht so häufig im Repertoire ver-tretenen Stücken erfreulicherweise zu einer Re-ferenzeinspielung verhilft.
Wie auch bei den anderen CDs dieser Reihe gibtes ein Begleitheft, das knapp die wichtigsten Informationen zu Komponist und Werk gibt.Besonders praktisch sind die Übetipps der In-terpreten – ein hilfreicher Wegweiser zur Annä-herung an diese Stücke. Regina Himmelbauer
Tonträger
544 TIBIA 3/2011
NEUEINGÄNGE
arcadie quartett: bazaar, Wolfgang AmadeusMozart: „Varia“: Fuga; Claude Debussy: Pourinvoquer Pan, dieu du vent d’été, Rêverie, 2ième
Arabesque; Georg Philipp Telemann: Quar tettin e-Moll; Wolfgang Bartsch: Schritte; MauriceRavel: Pavane pour une infante défunte; FelixMendelssohn Bartholdy: Fünf Lieder ohneWorte II; Wolfgang Amadeus Mozart: „Varia“:Adagio, Menuett, Kleine Gigue; Johannes Brahms:Vier Stücke aus op. 76; Mike Mower: Here we goagain; Heike Beckmann: Bazaar; Judith Konter,Susanne Schrage, Tho mas Brinkmann, MatthiasSchmidt (Flöten), Klassiklabel querstand, Al-tenburg 2011, 1 CD, VKJK 1118
J. S. Bach: French & English Suites, Siciliano (fromthe violin sonata in C minor, BWV 1017), ‘Pedal-Exercitium’ in A minor (BWV 598), EnglishSuite No. 2 in A minor (BWV 807), Prelude in DMajor (BWV 1006), French Suite No. 5 in C ma-jor (BWV 816), French Suite No. 3 in B minor(BWV 814), „Wachet auf, ruft uns die Stimme“in E-flat major (BWV 645), Fugue in G Minor(BWV 1000), Stefan Temmingh (recorder & di-rection), Domen Marinčič (viola da gamba), Ax-el Wolf (lute), Oehms Classics, München 2011,1 CD, OC 795
Concordi Musici: Scarlatti – Mancini – Vivaldi, An-tonio Vivaldi: Concerto „La Notte“ in G minor,RV 104; Concerto in D major, RV 93; Concertoin F major, RV 100; Concerto in D major, RV 92;Francesco Mancini: Sonata No. 4 in A minor;Alessandro Scarlatti: Sonata No. 9 in A minor;Leonard Minsuk Kwon (recorder), Rebecca Hu-ber & Tomasz Plusa (violin), Ji Yun Kang (cello),Josep Casadella (bassoon), Cristian Gutierrez(guitar & theorbo), Edoardo Valorz (harpsi-chord), Audioguy Records, Seoul 2010, 1 CD,AGCD0022
Mauro Giuliani: Works for Flute and Guitar, GrandPotpourri op. 126, Qual mesto gemito, Vari-azione op. 84, Notturno op. 86 Nr. 16, Notturnoop. 86 Nr. 11, Polonese o. op., PreußischerMarsch. Allegro, Marsch der Schweden, Öster-reichischer Marsch, Serenata op. 127, AndreaLieberknecht (flute), Frank Bungarten (guitar),Musikproduktion Dabringhaus und Grimm,Detmold 2011, 1 CD, MDG 905 1635-6
Gerald Stempfel: Engels Liedt, Music for solo re-corder from the Fluyten Lust-hof by Jacob vanEyck: Lof-zangh Marie, Engels Nachtegaeltje,Janneman en Alemoer, O Heiligh Zaligh, Twee-de Lavignone, Prins Robberts Masco, Bocxvoet-je, Engels Liedt, Lanterlu, Pavaen Lachrymae,Courante, Stil, stil een reys, Rosemont, Rosemontdie lagh gedoken, Lavignone, Frans Ballet, Ge-rald Stempfel (Blockflöten), Carpe Diem Re-cords, Bremen 2011, 1 CD, CD-16284
The Playfords: Nova! Nova!, Christmas Carolsfrom Europe (14th–18th Century), Frankreich 15.Jh.: Veni, veni Emmanuel; Köln 1638: O Hei-land, reiß die Himmel auf; Villancico aus Spa-nien: Ríu, ríu, chíu; England 15 Jh.: Nova! nova!;Spörls Liederbuch 1392: Marien wart ein bot ge-sant; Köln 1608: Es kommt ein Schiff geladen;Spanisch-maurische Melodie: Weihnachtsapfel I;Satz nach Michael Praetorius: Der Morgensternist aufgedrungen; Englisches Weihnachtslied:On Christmas Night; Liederbuch der Anna vonKöln, um 1500: Puer natus in Bethlehem; Frank-reich 17. Jh.: Entre le bœuf et l’âne gris; RaoulAuger Feuillet (ca. 1653–ca. 1709): Masters inthis Hall („La Matelotte“); Spanisch-maurischeMelodie: Weihnachtsapfel II; aus der Sammlungvon John Playford (1623–1686) The EnglishDancing Master: Playford Christmas Medley(Puddings and Pies/Drive the Cold WinterAway/Twelvth Eve/Three Sheep Skins);Thomas Mawdycke: Coventry Carol; Kat-alonien ca. 17. Jh.: Fum, fum, fum; Frankreich15. Jh.: Noël Nouvelet; Björn Werner (Gesang),Annegret Fischer (Blockflöten), Erik Warken- thin (Barockgitarre/Erzlaute), Benjamin Dreß-ler (Viola da gamba), Nora Thiele (Perkussion),Gast: Claudia Mende (Barockvioline), CovielloClassics, Darmstadt 2010, 1 CD, COV 21012
Tonträger
www.moeck.com
c c
c c
c a
TIBIA 3/2011 545
Neues aus der Holzbläserwelt
Von Freitag, dem 18., bis Sonntag, dem 20. Fe-bruar 2011, fand in der malerischen DomäneCoubertin in St. Remy-les-Chevreuse im Südenvon Paris der erste Kongress der ERTA (Euro-pean Recorder Teachers Assossiation) Frank-reich statt. Am 10. Januar 2011 war der Verbandunter dem Vorsitz von Anne Leleu aus der Taufegehoben worden. Bisher mit ca. 100 Mitgliedernnoch recht klein, kannten sich die Mitgliederüberwiegend persönlich, da sich der Großteilaus dem Raum Paris rekrutiert. Dies zeigt sichderzeit noch in einer etwas problematischenMitgliederstruktur auf: Da die übrigen Landes-teile relativ schwach vertreten sind, werdenwechselnde Standorte z. B. für Kongresse undandere Veranstaltungen erschwert.
Wie immer bei Kongressen dieser Art fandenKonzerte und Vorträge statt, und es gab eine
Blockflötenaustellung mit einer Reihe bekannterWerkstätten aus Frankreich, England undDeutschland.
Ganz besonders faszinierte mich der Beitrag desBlockflötisten und Komponisten Joseph Grauzusammen mit dem Komponisten, Englisch-Horn-Spieler und Improvisator Etienne Rolinmit zeitgenössischen Improvisationen undSound painting (Musikmalerei). Hier wird vomLeiter der Aufführung mithilfe von bis zu 45Handzeichen eine freie Improvisation „gemalt“.Seinem Plan entsprechend bestimmt er alle Pa-rameter, dem die Musiker folgen. Jeglicher Ton,Klang, jegliches Geräusch, jede Verfremdung isterlaubt. Der Blockflöte steckte Rolin zum Bei-spiel bei einem seiner Soundpaintings ein Klari-nettenmundstück auf. Es liegt in der Natur derSache, dass ein sehr avandgardistisches Klang -
Guido Klemisch
ERTA-Kongress in Frankreich
Neues aus der Holzbläserwelt
546 TIBIA 3/2011
gebilde entsteht. Selbstver-ständlich ist es möglich,bestimmte Absprachenüber Instrumentierung,Ausführung, ja Stil zu ma-chen. Etienne Rolin legteWert darauf, festzustellen,dass Ensembles mit unter-schiedlichen Instrumentenden Vorzug für „Sound-paintings“ genießen. Den-noch, Block flötenorchesterlandauf, landab, nichts wieran!
Einen wirklichen „Kontra-punkt“ dazu gaben Emma-nuel Lemare mit seinemaußerordentlich detaillier-ten Vortrag über irischeVolksmusik und der Bei-trag von Robin Tromamüber die slowakische Fuja-ra. Nicht ganz nebenbei:Lemare ist Leiter der EcoleMusique Traditionelle Tro-don (VolksmusikschuleTrodon). Eine Schule die-ser Art wäre in Deutsch-land wohl nicht (mehr)denkbar. Da sich irischeMusik allenthalben großer Popularität erfreut,sei ein Blick auf eine für diese Musik typischeBlockflötenart gestattet: Das Whistle; eine in derRegel zweiteilige Blockflöte in d2 (Sopranflöten-lage), sowie das Low Whistle in d1 (Tenorflöten-lage) mit jeweils 6 vorderständigen Tonlöchern.Eine derartige Blockflöte (nur in hoher Lage)wird übrigens bei Marin Mersenne in seinerHarmonie Universelle (1636) als „Fluste à sixtrous“ beschrieben, mit wohl (umgekehrt) koni-scher Bohrung (vgl. Wolfgang Köhler: Die Blas-instrumente aus der „Harmonie Universelle“,Moeck Verlag, Celle 1987).
In der heutigen Form wird das Whistle seit demfrühen 19. Jahrhundert aus „Tin“ (Blech) gebaut.Überblasen wird es entsprechend unserer Block-
flöte in die Oktave ohneÜberblasloch (Daumen-loch) und besitzt einenTonumfang von ca. 2 Ok-taven. Bei zylindrischerBohrung von ca. 13 mm,bzw. 22 mm, erhält das In-strument seinen rauen,leicht rauschigen Klang vorallem durch seinen extremhohen Aufschnitt (d. i. derAbstand des Labiums zumKernspalt). In irischer undkeltischer Musik (Breta-gne) überzeugt das Instru-ment in seiner herbenSchönheit in besonderemMaße. Aus edlen Hölzernhergestellte Instrumente er-freuen sich in letzter Zeitgrößer werdender Beliebt-heit.
Vielleicht noch mehr lohntes sich, auch die Fujara et-was näher zu betrachten.Diese Hirtenflöte in Bass-lage, aus Holunderholz ge-fertigt, ist einteilig, ca. 1,60m lang und besitzt auf-grund der Länge eine An-
blasvorrichtung in Form einer parallel zum Tu-bus laufenden Holzröhre, die oben in den Tubuseingesteckt wird und unterhalb mit Leder fest-gebunden ist. Die gleiche Konstruktion findetsich übrigens bei Blockflöten der südamerikani-schen Andenvölker. Sie hat eine sehr enge Men-sur und ist wie Schwegel oder Galoubet (Tamer-lin) mit nur drei tiefständigen Tonlöchern einesogenannte „Obertonflöte“, da das Grundton-register kaum anspricht und in der traditionellenMusik auch nicht eingesetzt wird. Bekanntlichlässt sich die Obertonflöte mit drei Tonlöchernvom ersten Obertonregister an chromatischspielen. Die klanglichen Möglichkeiten wie auchdie traditionelle Musik dieser Blockflöte sindverblüffend. Es ist schon erstaunlich, dass wirvon allen möglichen Arten außereuropäischer
Neues aus der Holzbläserwelt
TIBIA 3/2011 547
musikalischer Erscheinungsformen fasziniertsind und dieses großartige Kulturgut – nur we-nige hundert Kilometer von uns entfernt – nichtzur Kenntnis nehmen.
„Table ronde“ mit Christian Chandellier und„Roundabouts“ mit Eva-Maria Schieffer runde-ten den Tag ab. Abends gab es die Möglichkeit,im nahegelegenen Städtchen Thoiry einem Kon-zert mit Maurice Steger beizuwohnen. Aller-dings gehörte dies nicht zum offiziellen Pro-gramm des Kongresses.
Sonntags berichtete Anne Leleu über ihre inüber 30 Jahren Berufserfahrung entstandeneMethode des Blockflötenanfängerunterrichtsmit Kindern im Alter von 6 – 9 Jahren: Pédagogieergonomique – Ergonomische Pädagogik: Es-sentiell ist die richtige Reihenfolge des Erlernensder Griffkombinationen basierend auf traditio-nellen Liedmotiven. Diese werden – mit Textenversehen – gesungen und dann erst gespielt. Dieersten Griffkombinationen (Zeigefinger – Dau-men) ist unser bekannter Kuckusruf c – a, diezweite aber schon a – cis (Daumen). Die Einfüh-rung eines neuen Griffs erstreckt sich immerüber zwei Unterrichtsstunden. In der erstenStunde wird das Motiv/die Melodie melodischund rhythmisch singend erfasst, in der zweitenStunde (normalerweise eine Woche später) aufder Flöte erarbeitet: Man spielt, was man singenkann. Bemerkenswert dabei: Zunächst wird oh-ne Einsatz der Zunge geblasen, der dann in derdritten Stunde eingeführt wird. Für das Noten-lesen gilt ebenfalls: Man liest, was man schonspielen kann. Es würde den Rahmen dieses Be-richts sprengen, noch weiter ins Detail zu gehen.Es wäre zu hoffen, dass Anne Leleu jetzt, nach-dem sie etwas vorzeitig in den Ruhestand getre-ten ist, Zeit hat, ihre Methode und Erfahrung ineiner Publikation für den pädagogischen Nach-wuchs darzulegen.
Was ist mir insbesondere nach drei sehr intensi-ven Tagen bei unseren französischen Freundenaufgefallen? Barock- und Renaissancemusikspielten keine Rolle, zumindest nicht bei dieserVeranstaltung. Zufall oder nicht?
ERTA Frankreich wertschätzt insbesondere(kleine) Blockflötenbau-Werkstätten, die hand-gefertigte Instrumente anbieten. In der Satzungheißt es, dass nur natürliche Personen – Flöten-bauer sind ausdrücklich als Mitglieder willkom-men – Mitglied werden können. Firmen könnendemnach keine Mitgliedschaft erwerben. Flöten-bauer, die Mitglied sind, sollen gewisse Vorteileim Rahmen der ERTA-Aktivitäten genießen.
In der französischen Musikpädagogik ist nachwie vor (französische) traditionelle Musik dietragende Säule. Da Volksmusik (musique tradi-tionelle) – nicht zu verwechseln mit Scheußlich-keiten wie „Feste der Volksmusik“ im Deut-schen Fernsehen z. B. – einen festen Platz imBewusstsein unserer französischen Nachbarneinnimmt, ist ihr Interesse an traditioneller Mu-sik mit den dazugehörenden Instrumenten auchaus anderen europäischen Regionen ganz selbst-verständlich. So überrascht es nicht, wenn wirunter den französischen Blockflötisten Liebha-ber europäischer traditioneller Blockflöten wieder slowakischen Fujara finden.
Eine zweite wichtige Säule der Blockflötenbewe-gung in Frankreich scheint mir die Neue Musikzu sein. Joseph Grau sagt es klar: Ohne zeitge-nössische Musik ist die Blockflöte auf Dauer tot.
Hier sind sich deutsche und französische Prota-gonisten sicher einig. Ob der (Um-)Weg überdie Popmusik – wie hin und wieder propagiertwird – nötig ist, darf bezweifelt werden: Pop-musik meint Grau nämlich gerade nicht!
Ob Fujara, avangardistische Musik wie EtienneRolins Renaissance Time Warp von 2011, Re-naissance-Blockflöten-Consorts im Quintab-stand und Musik des 16. Jahrhunderts der dama-ligen Zeit gemäß realisiert, ob Barock flöten-quartett und die entsprechenden zeitgenössi-schen Kompositionen, (aber unter Verzicht auf„Neobarockbassflöten“, die es mit ihrer Klap-penkonstruktion im 18. Jahrhundert gar nichtgab): es gibt einfach zu viele wirkliche musika -lische Schätze, die noch gehoben werden könn-ten.
Neues aus der Holzbläserwelt
548 TIBIA 3/2011
Beim Wandeln durch denInnenhof des Alten Schlos-ses Stutt gart fällt dem auf-merksamen Betrachter einaußergewöhnliches Detailun mit telbar ins Auge: DieSäulen sind allesamt miteingemeißelten Renais-sance Traversflöten unter-schiedlicher Größe ver-ziert. Was fast ganz inVergessenheit geraten ist:Stuttgart war im 16. Jahr-hundert eine Hochburg derRenaissance-Querflöte. Ineiner Buchveröffentlichungder Clarendon Press Ox-ford „The Early Flute“kann folgendes nachgelesenwerden: The large numberof flutes listed in inventoriesgives an indication of thepopularity ot the instru-ment: the Stuttgart courtpossessed 220 (1589), HenryVIII 74 (1547), Maria ofHungary more than 50(1555), Philip II of Spain 54(1598), and the AccademiaFilarmonica in Verona 51(1628) …
Die IRT-Tage sind eine Fortsetzung der in Baselan der Scola Cantorum Basiliensis erstmals imJahr 2002 organisierten Zusammenkunft vonnamhaften Künstlern, Dozenten, Wissenschaft-lern, sowie von Studenten, Instrumentenbauernund interessierten Musikern zum Zwecke einesinternationalen Erfahrungsaustauschs. 2005 inStuttgart (Leitung: Hans-Joachim Fuss), 2007 inMünchen am Leopold Mozart Konservatorium(Leitung: Marion Treupel) und nun wiederumin Stuttgart an der Hochschule (Studio Alte Mu-sik, Masterprojekt C. Caponi, Klasse Hans-Joa-chim Fuss).
Flötistinnen und Flötisten aus Israel, Tsche-chien, Italien, Frankreich, Russland, Brasilien,
Weißrussland, Lettland und Deutschland nah-men am diesjährigen Treffen teil, das unter demMotto „Renaissancemusik für größere Beset-zungen“ stand.
Werke für 8 bis 12 Stimmen von Gastoldi, Me-rulo, de Wert und weiteren Renaissancekompo-nisten wurden von den Teilnehmern an den bei-den Festivaltagen einstudiert und in einemöffentlichen Konzert am Samstag (9.10.2010) ei-nem interessierten Publikum vorgetragen.
In Konzerten hatten verschiedene feste Ensemblesdie Möglichkeit, sich vorzustellen und mit inte-ressanten Werken und ungewöhnlichen Instru-menten aufzuwarten. Ein Highlight: Die Glas-Traversflöten des Ensembles Rafi aus Italien.
In einem Workshop wurden Instrumente ver-schiedener Hersteller vermessen, ausprobiertund vergleichend gespielt. Nach vielen angereg-ten Gesprächen und Diskussionen waren musi-kalische Standpunkte erörtert und neue Kontak-te gefestigt.
Cássio Rafael Caponi
Internationale Renaissance Traversflöten Tageim Studio Alte Musik der Hochschule Stuttgart
Gruppenphoto mit einigen Teilnehmerinnen und Teilneh-mern der Renaissance Flöten Tage Stuttgart 2010
Neues aus der Holzbläserwelt
TIBIA 3/2011 549
Vom 11. bis zum 13. Märzfand in diesem Jahr der ersteRecorder Summit statt, eineZusammenkunft von allenBlock- und Traversflötenin-teressierten, Profis, Laien, In-strumentenbauern und Spie-lern. Solch eine Veranstaltungkann nur gelingen, wenn esMenschen gibt, die viel Ar-beit, Engagement und Liebeaufbringen und die Organisa-tion in die Hand nehmen. Ste-fanie und Georg Göbel habendies, wie schon bei vielen an-deren Veranstaltungen, getanund dieses neue Festival auf die Beine gestellt.Eine große Besonderheit bei dem Summit war,dass Georg seine Vision, Menschen zusammen-zubringen, auch in den Konzerten umgesetzthat. So gab es erstmalig ein gemeinsames Kon-zert mit dem Flanders Recorder Quartet undFlautando Köln. Wir alle haben es als eine großeBereicherung empfunden zu acht zu musizieren,haben uns von Anfang an blendend verstandenund jede Menge Freude und Spaß gehabt.
Alle Bedenken, ob wir wohl so schnell eine ge-meinsame Intonation finden, ob unsere Instru-mente zusammenpassen oder die Probenzeitausreichen würde, waren schnell aus dem Wegegeräumt.
Das Programm war im Vorfeld am Schreibtischentstanden, nach einigen e-Mails hatten wir unsfür eine Mischung aus Repertoirestücken undNeuheiten entschieden, u. a. ein achtstimmigesStück von Steve Marshall, das extra zu diesemAnlass komponiert wurde.
Jeder, der sich mit modernen Blockflötenensem-bles beschäftigt, weiß, dass eine Unmenge an In-strumenten nötig ist, um das umfangreiche Re-
pertoire zu spielen, bzw. dem Klangreichtumund dem Anspruch von Spielern und Publikumzu genügen (Zitat Joris nach der Probe: „Ichglaube, dass wir nicht fürs Spielen, sondern fürsSchleppen bezahlt werden …“). So hatten wirbei diesem Projekt auf einmal eine Auswahl anverschiedenen Groß- und Subbässen, die mehrals reichhaltig war. Wir haben viel ausprobiertund kombiniert, trotz verschiedener Stim-mungssysteme und Stimmtonhöhen. An dieserStellen seien auch die Blockflötenhersteller er-wähnt, die nicht müde werden und den Block-flötenbau immer in Bewegung halten. Die Re-sultate sind großartig! Ein besonderer Dank gehtan Herbert Paetzold und Geri Bollinger, dienoch vor Ort kurzfristig kleinere Reparaturenvornahmen und auch ein Leihinstrument zurVerfügung stellten.Zwei Quartette, die seit vielen Jahren ihr eigenesProfil geformt haben, zusammenzubringen, bie-tet für jeden eine Menge Inspiration. Wir vonFlautando Köln haben es sehr genossen, dankenunseren überaus sympathischen belgischen Kol-legen und Stefanie und Georg Göbel für diesessehr positive Projekt.
Kerstin de Witt
Das Flanders Recorder Quartet und Flautando Köln im gemein-samen Konzert beim Recorder Summit 2011 in Schwelm
Neues aus der Holzbläserwelt
Foto: Markus Berdux
550 TIBIA 3/2011
Neues aus der Holzbläserwelt
Fotos vom Recorder Summit2011 in SchwelmFotos: Markus Berdux
552 TIBIA 3/2011
Neues aus der Holzbläserwelt
Erst vier Monate ist es her, dass im Ballungsgebietzwischen Ruhrgebiet und Köln-DüsseldorferRaum die Idee eines wirklich umfassenden Block-flötenfestivals Gestalt annahm: Mit über 60 Aus-stellern, Konzerten vom Feinsten und den vielfäl-tigen Workshops war beim ersten recordersummit in Schwelm bei Wuppertal wirklich fürjeden etwas dabei. „Bis nächstes Jahr wieder inSchwelm!“ – so verabschiedeten sich die Besucher,Künstler oder Aussteller nach diesem vor allemauch atmosphärisch gelungenen Wochenende.
Am 9. bis 11. März 2012 ist es wieder so weit –Schwelm lädt ein zum zweiten recorder summit.
Schon jetzt haben nahezu alle Aussteller zuge-sagt, die im März in Schwelm ihre Blockflöten,Traversflöten, Gemshörner oder Noten gezeigtoder verkauft haben, und weitere werden sicher-lich folgen. Auch die Anzahl der Workshopswird sich erhöhen, ergänzt durch zwei „lectu-res“, in denen sich Vortrag und lebendiges Mu-sikbeispiel zu einer animierend vitalen Darbie-tung verbinden.
Welche Konzerte wird es geben? The RoyalWind Music, das einzige professionelle Blockflö-tenconsort mit einer Klanggewalt von 16 Stim-men macht am Freitagabend in der großen evan-gelischen Christuskirche den Anfang, gefolgtvom jazzig-rockigen Nachtkonzert mit TobiasReisige und der Formation Wildes Holz in derkleinen nahegelegenen Bandfabrik. Dan Laurinim Solo-Recital – eine Blockflötenerfahrungwahrlich unerhörter Art übrigens! – und dieachtköpfige magisch musizierende bunte TruppeRayuela & CorDatum teilen sich die einstün -
digen Kurzkonzerte am Samstag, während derAbend in französischem Barock ausklingt, dar-gebracht in der unnachahmlichen Idiomatik desHugo Reyne und seiner Mitsteiter an der Gambeund Laute bzw. Theorbe. Der besondere Höhe-punkt im zweiten Teil dieses Konzerts ist sicher-lich das Aufeinandertreffen von Hugo Reyneund Dorothee Oberlinger – eine Konstellation,die es noch nie gab, und die eine Schwelmer Tra-dition weiterführt, Interpreten unanfechtbarenNiveaus erstmals zusammenzubringen.
Da dieses Mal die neo-romanische Christuskir-che mit der großen Akustik den Konzerten ihrenschlicht-erhabenen Raum leiht, ist jetzt auch einSonntagskonzert möglich: Eingebunden in dieIdee, den Sonntag besonders als Familien- undMusikschultag zu gestalten – es gibt neben einemKinder- und einem Jugend-Workshop auch eine„Meisterklasse für den Nachwuchs“ mit GudrunHeyens und ihrem Korrepetitor am Cembalo –,zeigt „Flautando Köln“ gemeinsam mit demreichhaltigen percussion-set Torsten Müllers,was die Blockflöte im Zusammenspiel so allesvermag: eine kurzweilige Reise durch die ganzpersönlichen Highlights oder Zugabestücke desQuartetts, ebenso kurzweilig moderiert und da-mit ideal geeignet für Kinder, Schüler, Familienoder auch andere.
Details zu allem und jedem gibt’s über den infor-mativen Flyer, den early music im Ibach-Hausauf Wunsch gern versendet, sowie ab Augustüber die festivaleigene website www.recordersummit.com.
Kontakt: early music im Ibach-Haus / Stephanie GöbelWilhelmstr. 43, 58332 Schwelm
Tel. 02336-990290, Mail: [email protected]
recorder summit
Logo: Heida Vissing
Nach dem recorder summitist vor dem recorder summit ...
TIBIA 3/2011 553
Das Interview zum Festival führtDörte Nienstedt, Präsidentin derERPS.
Matthias Weilenmann wurde in Zürichgeboren. Zu seinen wichtigsten Leh-rern im Fach Blockflöte gehörten Con-rad Steinmann, Kees Boeke und beson-ders Walter van Hauwe. BedeutendsteImpulse erhielt er von Nikolaus Har-noncourt, unter dessen Leitung er seit1975 in vielen Orchestern mitwirkte.Als Blockflötist spielt er in verschiede-nen Besetzungen und mit Dirigentenwie Nikolaus Harnoncourt, Marc Min-kowski, Franz Welser- Möst, Adam Fischer, WilliamChristie u.v.a. Lehrtätigkeiten und Konzerte in den USA,Europa und Taiwan. Seit 1982 ist Matthias WeilenmannDozent, seit 2004 Professor an der Hochschule für Musikund Theater Zürich, deren Abteilungsleiter im BereichAlter Musik er seit 1998 ist. Seit 2004 ist er künstlerischerLeiter des Zürcher Barockorchesters, dessen erste CD imSeptember 09 mit Werken von Vivaldi (u. a.) erschien.Sein starkes Interesse an Neuer Musik ist mit zahllosenUraufführungen, Rundfunkeinspielungen und einer ge-rade herausgekommenen CD mit Neuer Schweizer Mu-sik für Blockflöte belegt.
Nienstedt: Lieber Matthias, zunächst freue ichmich und danke Dir schon jetzt auch im Namenunseres Vereins, dass Du die Leitung der 5.ERPS-Biennale in Zürich übernommen hast. Duhast das Festival unter das Motto „Spotlights: …vor 1550 … nach 2008“ gestellt. Warum der Titelund wie kam es zu der zeitlichen Eingrenzung?
Weilenmann: In den im Team geführten Diskus-sionen war bald einmal klar, dass wir sozusagenRänder ausleuchten wollen, dass unser Interesse
5. ERPS–Biennale Spotlights in ZürichVom 2.- 4. September 2011 findet zum fünften Male das Blockflötenfestival der European RecorderPlayers Society e.V. (ERPS) statt. Unter der künstlerischen Leitung von Prof. Matthias Weilenmannwird die Zürcher Hochschule der Künste zum Zentrum für Begegnungen, Konzerte, Vorträge und In-strumentenpräsentationen.
Neues aus der Holzbläserwelt
nicht hauptsächlich im gängigen Blockflötenre-pertoire liegt. „Ausleuchten“ führte dann zumTitel Spotlights und „Ränder“ bedeutet für unsMehrfaches: die Zeit vor 1550 führt natürlichhauptsächlich zu Ensemblemusik und zu Frage-stellungen des Arrangements, der Bearbeitung,der Mischung von Farben und zu einem Reper-toire, das nicht so häufig bearbeitet wird. Derandere Gedanke fußt auf dem Wunsch nachNeuem, nach Werken, die nach der letzten Bien-nale der ERPS in Bremen entstanden sind. Auchda geht es um Ränder: auf der einen Seite um Si-tuationen zwischen Komposition und Improvi-sation und auf der anderen um den Einbezugvon Elektronik, das Auflösen von live auf derBühne erzeugten Klängen in Raumklänge.
Angekündigt sind für die drei Tage in Zürich Be-gegnungen, Konzerte, Vorträge und Workshopsund eine Instrumentenpräsentation. Erzähle unsetwas über die einzelnen Beiträge, was genau er-wartet den Zuhörer und Besucher des Festivals?
554 TIBIA 3/2011
Neues aus der Holzbläserwelt
Noch ist die Planung [Stand Mai], vor allem wasdie Instrumentenbauer angeht, noch etwasschwebend. Dennoch: es werden kurzweiligeTage werden mit 9 Konzerten und 9 Urauffüh-rungen, einem gewichtigen Referat von ConradSteinmann zu seiner jahrelangen Forschung zurMusik und den Instrumenten der Antike (vorallem Griechenlands) und einer „Night-Session“am Samstag, in der einfach alle zusammen musi-zieren und improvisieren. Am Samstag findet ein„CH-Label“-Tag statt, an dem vor allem diewichtigsten Schweizer Blockflötenbauer in Aus-stellungsräumen ihre neuesten Entwicklungenpräsentieren und in Kurzbeiträgen um die Kon-zerte herum von ihren Philosophien des Bauensund der Forschung berichten. Und wenn wirschon bei der Schweiz sind: Die beiden Abend-konzerte vom Freitag und Samstag werden vonEnsembles bestritten, die aus unserem Landkommen. Am Freitag stellt das Ensemble derZHDK ein Programm mit englischer Musik um1550 vor, verbunden mit drei Uraufführungen.Am Samstag spielt das Ensemble Diferenciasunter der Leitung von Conrad Steinmann einProgramm mit dem Titel „Von den RändernEuropas“.
Und der unkonventionelle Programmablauf amSamstag? Statt des üblichen Workshops findetman wie einen roten Faden zwischen den Kon-zerten immer wieder die Präsentation der In-strumentenbauer.
Ja, wir sind ein wenig vom gewohnten Rasterabgewichen und erhoffen uns im lebendigen
Wechsel von Konzerten und Präsentationen ei-nen Samstag voller Kontraste, erhoffen Begeg-nungen von klingender Musik und inhaltlichemFragen, die öffnend sein sollen. Deshalb gibt esfür einmal in Zürich keinen „Workshop“ derherkömmlichen Art.
Es ist phantastisch, dass die Zürcher Hochschuleder Künste ihre Räumlichkeiten für die Ausrich-tung des Festivals zur Verfügung stellt. Doch vorallem sind es die Inhalte und die Menschen, diedas Gesicht eines Ausbildungsinstituts prägenund die interessieren. Welche Inhalte sind fürDich in Deiner Arbeit an der ZHDK bestim-mend, wie läuft die Zusammenarbeit unter Kol-legen und nicht zuletzt: in welcher Hinsicht wa-ren diese Punkte bestimmend für die Inhalte derdiesjährigen Biennale?
Das ist eine wichtige und tolle Frage und ich binsehr, sehr dankbar, dass die ZHDK das ProjektBiennale voll und ganz mitträgt. Als Leiter derAbteilung Alte Musik war mir immer klar, dasswir in Zürich keine zweite Schola führen könnenoder anstreben wollen. Unsere Arbeit basiert aufdem Gedanken, dass die aufführungsprakti-schen Fragestellungen durch die ganze Schulewirken müssen, dass wir zwar auf der einen SeiteUnterricht für Barockinstrumente (und die da-zugehörenden theoretischen Fächer) im Ange-bot haben, mit u. a. einer großen und wunderba-ren Blockflötenklasse. Andererseits geht es umVernetzungen mit den „normalen“ Instrumen-ten, geht es um die intensive Zusammenarbeitmit der Abteilung Neue Musik und Elektronik
TIBIA 3/2011 555
und auch um interdisziplinäre Projekte. Dieseentstandene Offenheit hat zu vielen erfolgrei-chen Resultaten geführt und prägt eben auch un-ser Programm für die Biennale. Das habe ich jaam Anfang schon zu beschreiben versucht.
Gibt es Programmpunkte, die Dir persönlich be-sonders am Herzen liegen?
Nein, eigentlich nicht: ich freue mich einfach vonHerzen, dass wir ein sehr vielfarbiges Programmmit ganz vielen, wunderbaren Musikern „ge-schenkt“ bekommen haben und dass nach jetzi-gem Stand 41 Spieler in Zürich spielen werden.
… von denen viele aus den Reihen unseres Ver-eins kommen. Das Wort „Begegnungen“ findetsich in der Reihenfolge der aufgezählten Festi-valstichpunkte an erster Stelle. Ich lese darinauch eine Anspielung auf die Begegnung ver-schiedener Blockflöten-Szenen.
Genau das wird, hoffe ich, in diesen Tagen ge-schehen, die Begegnung auch von ganz verschie-denen Generationen von Spielern. Allerdingswürde ich den Begriff „Blockflötenszenen“nicht unbedingt gebrauchen, das ist mir zu stark.Eher spreche ich von ganz verschiedenen Per-sönlichkeiten, die mit ganz unterschiedlichenProgrammen und in unterschiedlichen Beset-zungen das Festival prägen werden.
Kannst Du uns einen Einblick in die SchweizerBlockflöten-Szene geben? Man hört immer mal,
dass es in der Schweiz irgendwie anders läuft unddass es eben etwas „speziell“ sei. Du bist ja so-wohl in der Schweiz als auch in Deutschland inunterrichtender und konzertierender Weise be-heimatet. Was fällt Dir dazu ein?
Eigentlich erstaunt mich die Frage etwas, undich stelle einen so großen Kontrast nicht wirk-lich fest. Natürlich gibt es in Deutschland viel-leicht „Schulen“ in gewissem Sinne, die auf einerje eigenen Tradition aufbauend ihre Arbeit wei-tertreiben. Da sind schon Kontraste festzustellenzwischen pauschal gesagt Süddeutschland, Ge-gend Köln/Frankfurt, Norddeutschland – sonehme ich das jedenfalls wahr. Für die Schweizkann man vielleicht folgendes sagen: neben denzwei Zentren für Alte Musik in Basel und Genfgibt es eine starke Ausrichtung auf neueste Mu-sik in Lausanne (mit Antonio Politano) unddann eben die Hochschulen Zürich und Bern/Biel (auch Luzern in gewissem Maße), die wieoben beschrieben funktionieren. Und von die-sen Ausrichtungen profitieren dann die Block-flötisten, profilieren sich mit den inhaltlichenOrientierungen.
Lieber Matthias, mein Interview startete mit ei-nem Dank und ein Dankeschön soll es beschlie-ßen. Du hast neugierig gemacht auf ein span-nendes Blockflötenfestival im spätsommerlichenZürich, und ich wünsche Dir alles Gute bei derweiteren Planung und natürlich viele Gäste.
FlötenhofKurse
Konzerte
Musikunterricht
Schwabenstrasse 14
87640 Ebenhofen
Tel.: 08342-899 111
www.alte-musik.info
25 Jahre 1984-2009
Neues aus der Holzbläserwelt
556 TIBIA 3/2011
Neues aus der Holzbläserwelt
Der Bau von Musikinstrumenten hat Margret Löbnerschon in der Kindheit fasziniert. Viel Zeit verbrachte sie inder Geigenbauwerkstatt ihres Schwagers und nach Been-digung ihrer Schulzeit im Jahr 1981 machte sie zunächstein Praktikum beim Holzblasinstrumentenmacher Hans-Peter Springer in München, der zu der Zeit eine eigeneReparaturwerkstatt für Oboen betrieb. Im Jahr 1982 be-gann sie dann ihre eigene Ausbildung zur Holzblasinstru-mentenmacherin bei der Firma Roessler- Blockflötenbauin Dithmarschen und schloss der dreijährigen Ausbildungeinen Arbeitsaufenthalt bei dem Blockflötenbauer Jean-Luc Boudreau in Montreal an.
Nach ihrer Rückkehr im Jahre 1986 gründete sie, geradeerst 23 Jahre alt, das erste Fachgeschäft nur für Blockflötenmit angegliederter Werkstatt in Deutschland. Am Oster-deich 59 A in Bremen eröffnete sie ihren Laden, mit ei-nem großen Sortiment von Qualitätsblockflöten, sowohlvon sogenannten „Einzelherstellern“ als auch von renom-mierten Blockflötenfirmen. Das Angebot reicht vom Gar-klein bis zum Sub-Kontrabass und von der Schulflöte biszum Spitzen-Profi-Instrument. Hier können die Kundenin Ruhe Instrumente anspielen und testen und ihre Aus-wahl treffen, bei Bedarf unterstützt und beraten vom Löb-ner-Team. Da die Werkstatt räumlich dem Ladengeschäftangeschlossen ist, sind auch Reparaturen an mitgebrach-ten Blockflöten schnell gemacht.
Für Kunden, die nicht direkt vor Ort das große Angebotwahrnehmen können, stellt Margret Löbner auch An-sichtssendungen zusammen. Dieser Service wird gernwahrgenommen und so hat das Blockflötenzentrum Bre-
men mittlerweile Kunden in ganz Europa, USA, Moskauund Singapur …
Auch Noten, natürlich nur Blockflötennoten, gehörenmittlerweile zum Sortiment. Man kann vor Ort in demgroßen Angebot stöbern oder aber Notenhefte per Postordern.
Seit 8 Jahren gibt es im Blockflötenzentrum Bremen auchKurse für Blockflötenensembles. Freiheit für die Blockflöte– Easy Jazzy Recorder Playingmit Tobias Reisige und Wil-des Holz z. B. oder Deutsche und Englische Consortmusikdes 17. Jahrhunderts für Blockflötisten und Sänger mitPaul Leenhouts und Ralf Popken boten 2011 interessanteMusiziermöglichkeiten. Im Oktober dieses Jahres wird eseinen weiteren Kurs geben, der unter dem Titel Festmusik– vier- bis sechsstimmig, und das mit vielen! steht undvon der Blockflötistin Martina Bley geleitet wird.
Der Bau eigener Blockflöten kommt bei so viel Engage-ment leider oft zu kurz. Drei Kinder und lange Arbeitstagelassen Margret Löbner wenig Zeit. Es gibt sie aber, dieSteenbergen-, Bizey-, Debey-, Denner- und Dupuis-Mo-delle, und auch eine mittelalterliche Flöte hat MargretLöbner in ihrem eigenen Programm.
Zum 25-jährigen Jubiläum des Blockflötenzentrums wirdgefeiert! Am 17.9. sind bei einem Tag der offenen Tür inden Geschäftsräumen am Osterdeich in Bremen alle In-teressierte herzlich eingeladen mit dem Löbner-Team an-zustoßen und den Laden und die Werkstatt zu besichti-gen. Vom 1.9.-1.11.2011 gibt es außerdem Jubelwochenmit Extra-Sonder-Jubelangeboten.
2255 JJaahhrreeBlockflötenzentrum
Bremen –Margret Löbner
Weitere Informationen: Blockflötenzentrum Bremen – Margret Löbner, Osterdeich 59A, 28203 Bremen, Tel.: 0421/702852
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr, Sa. 9.00-13.00 Uhr; www.loebnerblockfloeten.de
Septem
ber
Aug
ust
Juli
TIBIA 3/2011 557
31.07.–06.08.2011 Musikkurswoche Blockflöte, Ort:Arosa/Schweiz, Ensemblespiel in großen undkleinen Besetzungen, für fortgeschrittene Laien,Leitung: Lydia Gillitzer, Info: Lydia Gillitzer,Von-Stauffenberg-Str. 85, 82008 Unterhaching,Tel./Fax: +49 (0)89 616861, [email protected].–07.08.2011 Musizieren mit Blockflöten, Ort:Freiburg-Littenweiler, für Spieler ab 16 Jahren,die das gesamte Blockflötenquartett beherr-schen, Leitung: Anna Irene Stratmann undChristina Jungermann, Info: InternationalerArbeitskreis für Musik e.V., Am Kloster 1a,49565 Bramsche-Malgarten, Tel.: +49 (0)546199630, Fax: +49 (0)5461 996310, [email protected], www.iam-ev.de07.08.–13.08.2011 Sommerwoche für Blockflöte,Gambe und Chor, Ort: Donndorf, für Erwachsenemit besonderer Freude am gemeinsamen Musi-zieren; bei den Blockflötisten ist die Beherr-schung des halben Quartetts Voraussetzung, beiden Gamben sind Spieler mit Erfahrung in Con-sort- und Sololiteratur willkommen, Leitung:Silke Wallach (Blockflöte/Tanz), Anja Eckert(Gambe), Steffen Hinger (Chor, Broken Con-sort, histor. Blasinstrumente), Info: Internatio-naler Arbeitskreis für Musik e.V., Am Kloster1a, 49565 Bramsche-Malgarten, Tel.: +49 (0)546199630, Fax: +49 (0)5461 996310, [email protected], www.iam-ev.de02.09.–04.09.2011 5. ERPS-Biennale – Spotlights: …vor 1550 – nach 2008, Ort: Zürich, Begegnungen,Konzerte, Vorträge und Workshops, Instrumen-tenpräsentation und Ausstellung, mit AndreasBöhlen/Genesis, Effusions, Lucia Mense, Dörte Nienstedt, Quartetto con affetto, Con-rad Steinmann/Diferencias, Trio Axolot, Trio Viaggio, Matthias Weilenmann (Ltg.) und Stu-denten der ZHDK, Info: www.erps.info08.09.–11.09.2011 Meisterkurs Traversflöte, Ort:Georgsmarienhütte, Meisterklasse, Einzelunter-richt, Technik und Interpretation, das Kurs -repertoire ist frei wählbar, aktive und passiveTeilnahme möglich, Leitung: Prof. Barthold
Veranstaltungen
Kuijken, Info: Forum Artium, Am Kasinopark1-3, 49114 Georgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)540134160, Fax: +49 (0)5401 34223, [email protected], www.forum-artium.de
10.09.2011 BaRock around the Block! Ort:Celle, Blockflötenorchester und Ensemblespielfür Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren, Work-shops für Blockflötenlehrer, Konzerte, Rahmen-programm auch für Familienmitglieder, Anmel-deschluss: 20.07.2011, Info: KreismusikschuleCelle, Kanonenstr. 4, 29221 Celle, +49 (0)51419162100, [email protected], www.kreismusikschule-celle.de
26.09.–30.09.2011 Barockorchester-Atelier, Ort:Trossingen, der Kurs beinhaltet instrumentalenEinzelunterricht und das Spiel im Orchester undist somit bestens geeignet, die aufführungsprak-tischen Kenntnisse sowohl im Solo-Spiel undder Kammermusik, als auch im Orchesterspielzu vertiefen, Dozenten: u. a. Linde Brunmayr-Tutz (Traverso), Paolo Grazzi (Barock-Oboe),Christian Binde (Naturhorn), Eckehard Lenzing (Barock-Fagott), Anmeldeschluss:01.08.2011, Info: Institut für Alte Musik, Schult-heiß-Koch-Platz 3, 78647 Trossingen, Tel.: +49(0)7425 949152, www.mh-trossingen.de
29.09.–03.10.2011 Flöte auf neuen Wegen, Ort:Weikersheim, für fortgeschrittene Querflöten-spieler, Studierende und Pädagogen, zur Erwei-terung des eigenen Unterrichtsrepertoires, aberauch zur (Aufnahme-) Prüfungsvorbereitunggeeignet, Leitung: Carin Levine, Info: JMD Mu-sikakademie Schloss Weikersheim, Marktplatz12, 97990 Weikersheim, Tel.: +49 (0)7934 99360,Fax: +49 (0)7934 993640, [email protected], www.jmd.info
30.09.–02.10.2011 Martin Luther und die Musik sei-ner Zeit – Workshopwochenende für Blockflöte,Ort: Neuwied-Engers, für Blockflötisten, diemittelschwere Werke erarbeiten wollen, das Be-herrschen von mindestens zwei Typen in baro-cker Griffweise sowie das oktavierende Lesenauf f-Instrumenten wird vorausgesetzt, Leitung:
Veranstaltungen
Oktob
erNovem
ber
558 TIBIA 3/2011
Angela Eling und Frank Oberschelp, Info: Internationaler Arbeitskreis für Musik e.V., AmKloster 1a, 49565 Bramsche-Malgarten, Tel.: +49 (0)5461 99630, Fax: +49 (0)5461 996310, [email protected], www.iam-ev.de
07.10.–09.10.2011 „Festmusik – vier- bis sechs-stimmig, und das mit Vielen“!, Ort: Bremen, fürLaienspieler, die mind. Sopran- und Altflöte sicher vom Blatt spielen können, Leitung: Mar-tina Bley, Info: Blockflötenzentrum Bremen,Tel.: +49 (0)421 702852, Fax: +49 (0)421 702337,[email protected], www.loebnerblockfloeten.de
15.10.–22.10.2011 Blockflötenensemble Kurs, Ort:St. Moritz/Schweiz, der Schwerpunkt des Kur-ses liegt auf der stilgerechten Interpretation vonConsort-Literatur des 16. und frühen 17. Jahr-hunderts aus England und Italien in drei- biszwölfstimmiger, auch mehrchöriger Besetzung,für Studenten, Musiklehrer und fortgeschritteneLaien, die sich mit den Grundlagen des Ensem-blespiels und den Details der Literatur auseinan-dersetzen möchten, Leitung: Martina Joos, An-meldeschluss: 01.09.2011, Info: Hotel Laudi-nella, CH-7500 St. Moritz, Tel.: +41 (0)818360000, Fax: +41 (0)81 8360001, [email protected], www.laudinella.ch
22.10.–23.10.2011 2. Rohrbaukurs, Ort: Beeden-bostel, es sollen „innen-geschabte“ Rohre her-gestellt werden, die in der Herstellung schwieri-ger sind als die normal geschabten Rohre, dafüraber besondere Klang- und Spieleigenschaftenhaben (werden häufig von professionellen Spie-lern bevorzugt), Voraussetzung für die Teilnah-me an diesem Kurs ist die Fähigkeit, normal-ge-schabte Rohre herzustellen, Leitung: Dr. Wil-helm Strauß, Info und Anmeldung: MartinPraetorius, Am Amtshof 4, 29355 Beedenbostel,Tel.: +49 (0)5145 93234, [email protected]
28.10.–01.11.2011 Bau einer Renaissance-Blockflöte,Ort: Ebenhofen, Leitung: Herbert Paetzold, An-meldeschluss: 16.10.2011, Info: Flö ten hof e.V.,Schwabenstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49(0)8342 899111, Fax: +49 (0)8342 899122, [email protected], www.alte-musik.info
30.10.–04.11.2011 Blockflötenwoche Feldberg –Musique en France, Ort: Feldberg, Blockflöten-orchester, Blockflötenconsort, Einzelunterrichtund weitere Angebote (u. a. Vorträge) zum The-ma Musik in Frankreich vom Mittelalter bis zumBarock, Dozenten: Marianne Lüthi, AndreasSchöni, Johannes Kurz (Leitung), Info: Johan-nes Kurz, Tel.: +49 (0)7825 879966, [email protected], www.editionparnass.de01.11.–06.11.2011 Meisterkurs Flöte,Ort: Georgs-marienhütte, für Flötisten vor, während oderkurz nach dem Studium, willkommen sind auchFlöte spielende Jugendliche sowie engagierte„Amateure“, Leitung: Prof. Michael Faust, Info:Forum Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114 Ge-orgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax:+49 (0)5401 34223, [email protected],www.forum-artium.de04.11.–06.11.2011 Resonanzen der Musik des Mit-telalters – Das Fasanenbankett 1454, Ort: BurgFürsteneck, es wird Tanz-, Instrumental- undVokalmusik der burgundischen Epoche aus derersten Hälfte bis Mitte des 15. Jahrhunderts ein-studiert, für erfahrene Musiker, die ihr Instru-ment oder ihre Stimme sicher beherrschen, be-sonders willkommen sind Lauten, Fideln,Harfen und Flöten, Leitung: Marc Lewon undUri Smilansky, Info: Burg Fürsteneck – Aka-demie für berufliche und musisch-kulturelleWeiterbildung, Am Schlossgarten 3, 36132Eiter feld-Fürsteneck, Tel.: +49 (0)6672 92020,Fax: +49 (0)6672 920230, [email protected], www.burg-fuersteneck.de05.11.2011 Die sinfonische Blockflöte, Ort: Celle,erarbeitet werden Sätze aus Werken von Men-delssohn, Schumann, Tschaikowsky, Grieg u. a.in genial-blockflötengerechten Bearbeitungen,Leitung: Bart Spanhove, Info: Moeck Musikin-strumente + Verlag e.K., Lückenweg 4, 29227Celle, Tel.: +49 (0)5141 88530, Fax: +49 (0)5141885342, [email protected], www.moeck.com05.11.–06.11.2011 Tatort Eisenach, Ort: Eisenach,Ensemblespiel quer durch die Epochen, drei In-strumente der Blockflötenfamilie sollten im En-semble spielbar oder die Bereitschaft etwas Neu-es auszuprobieren vorhanden sein, für Spieler ab10 Jahren, Leitung: Heida Vissing, Info: Edition
Veranstaltungen
Dezem
ber
TIBIA 3/2011 559
Tre Fontane, Ronald Brox, Eckenerstr. 12, 48147Münster, Tel. + Fax: +49 (0)251 2301483, [email protected], www.edition-tre-fontane.de
05.11.–13.11.2011 Bundesmusikwoche 50plus,Ort: Marktoberdorf, für Musikfreunde über 50Jahre, die Freude am Singen haben, ein klassi-sches Orchesterinstrument oder Blockflöte spie-len, Kursinhalt: Sinfonieorchester, Blockflö-tenchor und Kammerchor, Leitung: u. a. JürgenBruns, Bernd Fröhlich und Thomas Hoferei-ter, Info: Bundesverband Deutscher Liebhaber-orchester e.V., Berggartenstr. 11, 01227 Dresden,Tel.: +49 (0)351 8104238, Fax: +49 (0)3518023023, [email protected], www.bdlo.de
07.11.–12.11.2011 Musizieren im Blockflötenor-chester, Ort: Inzigkofen, die Literatur reicht vonder Renaissance bis heute, ein Schwerpunkt wirdauf neuen, meist groß angelegten Kompositio-nen liegen, die speziell für vielstimmiges Block-flötenorchester geschrieben oder eingerichtetwurden, die Teilnehmer sollten mindestens 3Blockflöten (SAT) beherrschen, Leitung: Diet -rich Schnabel und Eileen Silcocks, Info: Volks-hochschule Inzigkofen, Parkweg 3, 72514 Inzig-kofen, Tel.: +49 (0)7571 73980, Fax: +49 (0)7571739833, [email protected], www.vhs-heim.de
17.11.–20.11.2011 Ensemblemusik aus fünf Jahr-hunderten, Ort: Kloster Börstel, Ensemblemusikverschiedener Epochen und Stile in vielfältigenEnsemblegrößen und Besetzungen, für Block-flötisten mit guten Grundkenntnissen im Um-gang mit Tonumfang, Spieltechnik, Basisrhyth-men und Vom-Blatt-Spiel, Leitung: Dörte Nien-stedt, Info: musica viva musikferien, FabianPayr, Kirchenpfad 6, 65388 Schlangenbad, Tel.:+49 (0)6129 502560, Fax: +49 (0)6129 502561,[email protected], www.musica-viva.de
19.11.2011 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl-feld, Literatur verschiedener Stilepochen in ver-schiedensten Besetzungen, Voraussetzung ist dieBeherrschung von mindestens Tenor- oder Bass-blockflöte, Leitung: Petra Menzl, Info: PetraMenzl, Tel.: +49 (0)9129 26004, Fax: +49 (0)9129402584, [email protected], www.petra-menzl.de
Veranstaltungen
25.11.–27.11.2011 Kammermusik – Neue Musik –Improvisation,Ort: Osterode, für jugendliche In-strumentalisten (Blockflötisten, Holzbläser,Blechbläser, Streicher, Gitarristen u. a.), die vorallem in unterschiedlichen Ensembleformatio-nen gemeinsames Musizieren von Werken un-terschiedlicher Epochen erleben möchten, Lei-tung: Prof. Helmut W. Erdmann, Info: Jeu-nesses Musicales Niedersachsen, An der Münze7, 21335 Lüneburg, Tel. und Fax: +49 (0)4131309390, [email protected], www.neue-musik-lueneburg.de27.11.–02.12.2011 Meisterkurs Flöte,Ort: Georgs-marienhütte, Meisterklasse, Einzelunterricht,Technik und Interpretation, Probespieltraining,das Kursrepertoire ist frei wählbar, Leitung:Prof. Felix Renggli, Info: Forum Artium, AmKasinopark 1-3, 49114 Georgsmarienhütte, Tel.:+49 (0)5401 34160, Fax: +49 (0)5401 34223, [email protected], www.forum-artium.de02.12.–04.12.2011 Kurs für Traversflöte,Ort: Eben-hofen, Leitung: Karl Kaiser, Anmeldeschluss:12.11.2011, Info: Flötenhof e.V., Schwabenstr.14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342 899111,Fax: +49 (0)8342 899122, [email protected], www.alte-musik.info05.12.–09.12.2011 Musizieren im Advent – mitBlockflöten, Ort: Inzigkofen, besinnliche Tagegemeinsamen Musizierens zur Einstimmung aufdie festliche Zeit, es werden Werke von der Re-naissance bis zur Moderne für Quartett und gro-ßes Ensemble gespielt, die Teilnehmer solltenmindestens 2 Blockflöten spielen und das Okta-vieren auf der Altflöte beherrschen, Leitung:Dietrich Schnabel und Eileen Silcocks, Info:Volkshochschule Inzigkofen, Parkweg 3, 72514Inzigkofen, Tel.: +49 (0)7571 73980, Fax: +49(0)7571 739833, [email protected], www.vhs-heim.de05.12.–09.12.2011 Meisterkurs Flöte,Ort: Georgs-marienhütte, Meisterklasse, Einzelunterricht,Probespieltraining, das Kursrepertoire ist freiwählbar, Leitung: Prof. Andrea Lieberknecht,Info: Forum Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114Georgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160,Fax: +49 (0)5401 34223, [email protected],www.forum-artium.de
560 TIBIA 3/2011
Erscheinungsweise: viermal jährlich – Januar, April, Juli, Oktober. Redaktionsschluss: 15. November, 15. Februar, 15. Mai und 15. August
Bezugskosten: Jahresabonnement im Inland € 20,00, Ein zelheft € 6,50; Jahresabonnement im Ausland € 22,50; zuzüglich Versand kosten
Anzeigenverwaltung:Ulrich Gottwald,Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K.Postfach 31 31, D-29231 CelleTelefon : 0 5141/88 53 67, Fax: 0 5141/88 53 42E-Mail: [email protected] Zeit gilt Preisliste Nr. 21, € 34,00 (1/16 Seite,) bis € 470,00 (1/1 Seite) zuzüglich Mehrwertsteuer; an -fallende Satz- und Bearbeitungs kosten werden geson-dert in Rechnung gestellt.Anzeigenschluss: 1. Dezember, 1. März, 1. Juni,1. September
Satz: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K., CelleDruck: müllerDITZEN, Bremerhaven© 2011 by Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K., Celle,
Printed in Germany, ISSN 0176-6511
Impressum
TIBIA · Magazin für Holzbläser36. Jahrgang · Heft 3/2011Herausgeber: Sabine Haase-Moeck, Michael Schneider,
Peter ThalheimerSchriftleitung: Sabine Haase-Moeck
E-Mail: [email protected] der Redaktion:
Moeck Musikinstrumente +Verlag e. K., Postfach 31 31, D-29231 CelleTelefon: 0 5141/88 53 0, Fax: 0 5141/88 53 42E-Mail für redaktionelle Beiträge:[email protected]
Gezeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Mei-nung der Herausgeber, der Schriftleitung oder desVerlages dar. Sämtliche Rechte für alle Länder blei-ben vorbehalten. Nachdruck – auch teil weise – nurmit vorheriger Genehmigung des Verlages. Fürunver langt eingesandte Manuskripte und Fotos über-nehmen Verlag und Redaktion keine Haftung. DieRedak tion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zuver öf fentlichen.
Pressemitteilung
Arbeitsfeld MusikunterrichtEine Seminarreihe der Bundesakademie in Zusammenarbeit mit dem DTKV, dem VdMund der Fachgruppe Musik in ver.di
Kompetenzen – Strategien – Impulse
Das diesjährige Seminar der Reihe „Arbeitsfeld Musikunterricht“ nimmt die Chancenund Möglichkeiten aktiven und kreativen Gestaltens des eigenen beruflichen Werde-gangs in den Blick. Im Rahmen des Wochenendes werden Techniken und Strategien vor-gestellt, die MusikerInnen unterstützen und motivieren sollen, ihre persönlichenFähigkeiten und Stärken zielorientiert einzusetzen.Themen: Sicher auftreten, frei sprechen, überzeugend darstellen; Kreativitätstechnikensinnvoll einsetzen; Simulation eines Bewerber-Hearings; selbständig denken – selbstän-dig arbeiten etc.Dozenten: Prof. Dr. Andreas Roser (Universität Passau) und Bianka Hockun (Beraterinund Trainerin); Christina Hollmann (Leitung)
Datum: 01. bis 03. Oktober 2011 Anmeldeschluss: 01. September 2011Information und Anmeldung: Tel. 07425. 9493-0, www.bundesakademie-trossingen.de
Impressum
NOTENim
NETZ
NiN
MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K. www.moeck.com
Notenshop des MOECK Verlags zum Kauf elektroni-scher Notendateien, die Sie auf Ihrem PC speichernund dann ausdrucken können.
DEMO
Noten im Netz
DEMO
NiN-1802Komponist: Chi-hin Leung (*1984)
Titel: Feng Qing Yun Dan (2009)
Besetzung: Blockflötenquartett (SATB)
Schwierigkeitsgrad: 3
Ausgabe: SpielpartiturPreis: 4,50 €
Feng Qing Yun Dan ist ein zweisätziges Werk für Blockflötenquartett, inspiriert durch die Formenvielfalt von Wind und Wolken.Wind und Wolken unterliegen ständigen Veränderungen und haben daher keine feste Gestalt. Diese Komposition versucht diesin Musik auszudrücken. Das Werk ist 2009 als Auftragskomposition des Hong Kong Institute of Education entstanden.
Neben ihrem Wert als eigenständige musikalische Erzählung, hat die Komposition auch eine interessante didaktische Funk-tion, gerade weil diese Musik keine komplizierten Spieltechniken beinhaltet. An Feng Qing Yun Dan kann man mit Schülernund Studenten die moderne Musikgeschichte, sowie Spieltechniken und Intonation in der Neuen Musik behandeln. Die vielenaleatorischen Stellen bieten dem Lehrenden gute Möglichkeiten, mit Schülergruppen an verschiedenen Ensemblespiel-Techni-ken und Interaktionen zu arbeiten. Die Klangwelt bereitet dabei auf größere und komplexere Werke von Komponisten wie Ry-ohei Hirose und Isang Yun vor. (Karel van Steenhoven im Vorwort zur Ausgabe)
†
&
&
Ê
Soprano Recorder
Alto RecorderAlto RecorderAlto Recorder
Tenor RecorderTenor RecorderTenor Recorder
Bass RecorderBass RecorderBass Recorder
œ œ œ#, œ# œb œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
A Andante, rubato
f p
f p
f p
f p
F p f p
F p
F
F p F
J
! ! !
! ! ! ! ! ! !
!
Chi-hin LEUNG-!.!/
NiN-1801Komponist: Sarah Nemtsov (*1980)
Titel: Lobgesang (2009)
Besetzung: Sopranblockflöte solo
Schwierigkeitsgrad: 4
Ausgabe: SpielpartiturPreis: 2,00 €
Die Komposition basiert auf dem Thema mit 2 Variationen De Lof Zangh Marie (Marias Lobgesang) aus dem Fluyten Lust-hofdes blinden niederländischen Musikers Jakob van Eyck (ca. 1590–1657). Form und musikalisches Material folgen subtil demOriginal, verschleiern es und widersprechen ihm zuweilen, wenngleich momenthaft sogar tatsächliche Zitate aufblitzen.
Der Lobgesang ist 2009 anlässlich eines Konzerts zum 90. Geburtstag von Ilse Reil – auf Anregung der Block flötistin UlrikeVolkhardt, die die Komposition uraufführte – entstanden.



























































































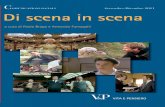



![Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 3. [Felvételi a régi Eötvös Collegiumba: a fejkopogtatás] = ECloga, 3. (2011. január 20.) 49-51.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314ba9b3ed465f0570b45b9/meltonak-lenni-a-nagy-elodoekhoez-3-felveteli-a-regi-eoetvoes-collegiumba.jpg)