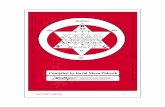Grabungsalltag im Vorderen Orient - Lust und Leid in der Vorderasiatischen Archäologie
Transcript of Grabungsalltag im Vorderen Orient - Lust und Leid in der Vorderasiatischen Archäologie
1
4.11 18-20:00
Grabungsalltag im Vorderen Orient – Lust und Leid der Vorderasiatischen Archäologie
Gehalten in gut besuchten Bestattungsinstituten Oktober 2006
R. Dittmann/Münster – Uni-Kunsttage
Abb. 1a Weihnachten in Assur 1903 1b Assur 1986 „Wir trinken keine Spirituosen, gehen um 9:00 schlafen und stehen um 5:00 auf“. So Robert Koldewey 1901 in Babylon. Der entsagungsvolle Kern dieses Satzes verweist auf ein Archäologenbild, des edlen, hilfreichen und guten Menschen, der – nur der Wissenschaft verpflichtet – allen sinnlichen Verlockungen Widerpart leistet. Diese schon fast religiöse Hingabe an die Pflicht und die Wissenschaft berührt den Hörer zutiefst. Solchen Vorbildern nachzueifern sollte die vornehmste Pflicht eines jeden Studiosus sein! Statt dessen – man sehe sich nur um - und erschaudere vor der Unerträglichkeit der Leichtigkeit des Seins und der allgegenwärtigen Gleichgültigkeit, die einen umgibt und die in so unglaublich bescheuerten Sätzen gipfelt, wie „Your disco needs you!“. Ist es also heute noch „cool“ Archäologe zu sein - besonders Archäologe im Vorderen Orient – in diesen potenziellen Schurkenstaaten, die Teil der Achse des Bösen – wenn nicht gar die kollektive Verkörperung des Antichristen schlechthin sind?
2
Früher, na klar, war alles besser, es gab ein wissenshungriges Bildungsbürgertum, im Stresemann und gestärkten Hemd, welches nach Berichten über den Orient nur so lechzte und begehrlich alle Informationen in sich aufsog. Orient war „in“ und das gebildete Populus hatte ein Gefühl des Dazugehörens, des Teilhabens an diesem Erschließungsprozess des ungeheuren Erbes vermeintlich auch unserer westlichen Kultur und den gewaltigen historischen Dimensionen, die es zu entdecken galt. Selbst der Kaiser, jawohl unser Willy II. förderte die Orientarchäologie und was dem Kaiser recht war... na sie wissen schon! Dass es hierbei in erster Linie um einen Bahnhof der Eitelkeiten im Ranking der Nationen ging, also darum ebenso reiche Kunstschätze wie der Louvre oder das BRM zu erhalten, wurde nicht wahrgenommen – wie auch, wenn sogar der Kaiser.... und überhaupt – der Türke war doch gar nicht in der Lage die Denkmäler zu erhalten. Stimmt - als guter Moslem interessierten ihn wahrlich keine alabasterfarbenen nackten Knaben so wurden Teile der Reliefs und der Statuen anfänglich zu Gips verarbeitet – Na bitte! Dass aber heutzutage das archäologische Museum von Ankara, international mit höchsten Preisen ausgezeichnet, oder das von Bagdad, inzwischen die meisten europäischen Sammlungen zum Teil hinter sich lassen, wird kaum wahrgenommen. Der Vorderasiatische Archäologe befand sich also von Anfang an in der Rolle des Retters, des Bewahrers, ja des.... – wir wollen es nicht vertiefen, denn wir wissen ja, „Hochmut kommt vor dem Fall“ und im Supergau endet das Ganze an einem Holzgestell – „à la lanterne!“ Aber wir, Teil der Spaßgesellschaft, von der Glotze verblödet, von der Politik systematisch verkohlt – und ansonsten komplett abgestumpft – was sollte uns an diesem ollen Orient reizen? Ok, Antalya- aber in die Pampa, um dort zu buddeln, kein Sangria, kein Bier, keine Disco – und natürlich auch kein Türsteher –, nur Dreck und Staub, gleißende Hitze und eklige Krabbeltiere. Wozu also das alles? - Auf diese schlechterdings hinterhältige und entmutigende Frage kann es nur eine intelligente Antwort geben – weiß ich auch nicht! Aber - schaun wir mal... Als Koldewey im Jahre 1897 von dem Orientkomitee des Kaisers in den Orient geschickt wurde, um eine Ruine auszusuchen, die des Reiches würdig war, betrat er ein Land, welches es so nicht mehr gibt. Die Ruinenstätten waren noch weitgehend unberührt, mit Ausnahme der von Franzosen und Engländern geplünderten Orte, wie zum Beispiel das aus der Bibel bekannte Ninive oder Nimrud. - Nein unser Koldewey war anders, er hatte eine Liste mit mehreren Kandidaten als Favoriten und selbstredend trickste er seinen Philologen, der ihn gezwungenermaßen mehr schlecht als recht auf der Reise begleitete, bei der
3
Wahl der geeigneten Ruine aus, obwohl anfänglich für Koldewey die Chancen schlecht standen. Wie schrieb er nach seiner Rückkehr: „Die Gesellschaft ist mir widerlich, der Stammtisch langweilig, die Kollegenschaft öde, schlafen kann man auch nicht immer, der stille Suff in gutem Wein hat zwar viel für sich, aber es ist auch keine Lebensbeschäftigung..“ und „.. Leute wie X können noch so dumm sein, dass man die Wände damit einrennen kann, es schadet ihnen nichts – sie steigen höher und höher; - Leute wie Y können sich sterblich blamieren – es schadet ihnen nicht. Unsereiner kommt und kommt nicht weiter...“. Mit einem erfreulichen Etat von 140.000 Mark für das erste Jahr ausgestattet, war die langfristige Finanzierung des Projektes gesichert – zumal der Kaiser...., na das hatten wir schon! Als die Grabung dann in Babylon im Jahre 1899 begann, gab es vor Ort so gut wie gar nichts, alles musste aus dem Stand improvisiert und organisiert werden. Wie schrieb Koldewey: „Beim Dorfältesten Habib el Alaui wurde das ‚Mudif’ gemietet, ein von Palmen umgebener Hof, der von einer hohen Lehmmauer umzogen war und einen einzigen stallartigen, palmenbalkengedeckten Raum enthielt. Die Lage unmittelbar am Euphratufer war so günstig, wie nur möglich: Das Wasser zum Trinken, Waschen, Baden floss vor dem Hause...“.. Hundertschaften von Arbeitern legten dann über 18 Jahre hinweg ungeheure Flächen frei und drangen bis gut 20 m Meter unter der damaligen Ebene in das Erdreich vor, nur vom Grundwasserspiegel daran gehindert, dem unsinnigen Glauben an eine Unterwelt durch Grabung endgültig den Garaus zu machen.
5
2c Babylon Tiefschnitt Das Ergebnis ist allgemein bekannt und macht einen noch heute fassungslos, wenn man Babylon betritt, zumal die restaurierten Teile die Ungeheuerlichkeit des Koldwey´schen Schaffens erschütternd und schon fast gewalttätig dokumentieren.
6
Die bis heute noch nicht vollständig aufgearbeiteten Befunde Babylons bildeten, zusammen mit den dann einsetzenden Grabungen in Assur und Warka, dem biblischen Erech, wichtige Grundpfeiler der Vorderasiatischen Archäologie, die als Fach schließlich 1948 an der FU-Berlin von Anton Moortgat begründet wurde. So erfreulich dieser Schritt auch war, und so euphorisch die Gründerjahre auch waren, so war das sanfte Läuten des Totenglöckleins zwar nicht zu überhören, sondern – es wurde erfolgreich verdrängt. Die bisher an die Baugeschichte und Klassische Archäologie gekoppelte Orient-Archäologie wurde selbstständig, wurde „eine Wissenschaft“ verlor damit ihre bisherige Exotik, ihr bisheriges methodisches Rüstzeug und, da nunmehr auch weitgehend losgelöst von der Keilschriftforschung, ihre Unschuld. Selbstredend arbeitete anfänglich ein zunehmendes Heer an „Fach-Leuten“ an der Konsolidierung dieses zerbrechlichen Gebildes, doch die Luft war eigentlich schon raus, der Reiz verflogen und auf dem Altar der rein technischen Aspekten einer Wissenschaft geopfert worden – oder? Genug der Nestbeschmutzung! Will man ein Fach bewerten, so empfiehlt es sich, ganz unten anzufangen, also bei der Beschaffung der Grunddaten. – Genau, darum ausgraben. Man kann zwar auch die aus allen Ländern zusammengeklauten schönen Objekte des Kunsthandels analysieren – ist aber irgendwo unmoralisch, da dadurch der Kunstraub nur weiter gefördert wird und außerdem sind diese Objekte ohne ihren vormaligen funktionalen Kontext auf uns überkommen – na und? Ja eben! Schauen wir mal in die Studienordnung, was wir eigentlich wollen und wie wir dahin kommen. „Die Vorderasiatische Altertumskunde verfolgt das Ziel, anhand von Bodenfunden, gegebenenfalls philologischen Hinterlassenschaften und im Verbund mit modellhaften Überlegungen, die Kulturentwicklung im präislamischen Orient zu rekonstruieren. Idealiter umfasst der Alte Orient in seiner geografischen Ausdehnung von West nach Ost: die Türkei bis Nordwest-Indien; von Nord nach Süd: die ehemaligen südrussischen Republiken bis zum Jemen. Der zeitliche Rahmen umfasst die Spanne vom akeramischen Neolithikum (ca. 9. Jahrtausend v. Chr.) bis zur Islamisierung der altorientalischen Kulturen (ab dem 7. Jahrhundert n. Chr.)...“ und weiter: „Das Ziel des Studiums ist es, die Befähigung zu erlangen, Rekonstruktionsmodelle zu den altorientalischen Kulturen (also komplexen Systemen) wissenschaftlich fundiert kritisch zu bewerten, selbst solche Konstrukte
7
auf entsprechender Basis zu erstellen und damit wissenschaftlich fundierten Einfluss auf die heutige Rezeption dieser Konstrukte zu nehmen. Folglich versteht es sich von selbst, dass eine ausschließlich artefaktbezogene Betrachtungsweise ungenügend ist. Will man vergangene Ideologiesysteme (profaner und sakraler Form), politische Organisationsformen, Ökonomie- und Ökosysteme als integrale Subsysteme vergangener Kulturen rekonstruieren, müssen zwangsläufig auch Fragestellungen und Modelle aus nichtarchäologischen Disziplinen berücksichtigt werden.“ Aha! Darum geht’s! Komplexe Systeme! Na Bravo! Vorderasiatische Archäologen wollen also so weit wie möglich vergangene Gesellschaften und Kulturen rekonstruieren. Wie soll das funktionieren, wenn wir unsere eigene Gesellschaft und Kultur nicht in Gänze begreifen? Das Problem ist: Seit die materialistischen Ansätze des Marxismus vermeintlich Pfui-Baba sind, erfinden wir Segmente und Spielformen davon ständig neu, wir bewegen uns also in einer erkenntnistheoretischen Endlosschleife: um bezogen auf unser Fach nur die Stichworte New Archaeology, Systemtheorie, Strukturalismus etc. zu nennen. Na toll, wenn einer gar nichts mehr rafft, dann versteckt er sich hinter irgendeinem „Ismus“ oder wie? - Na und?! Hat uns nicht die Kirche Jahrhunderte lang eingeredet die Erde sei eine Scheibe und der Mittelpunkt des Alls – war doch genau so ein Käse!
8
Abb. 3a-b Giordano Bruno, der geliebte Ketzer An diesem Punkt stellen wir die Debatte ein, denn wir wissen, was sie mit Giordano Bruno gemacht haben, dem edelsten Ketzer, der heute noch hoch verehrt, - wäre er nicht verbrannt worden, die Kirchenspaltung und somit den 30jährigen Krieg verhindert hätte. - Jetzt wird’s gleich eng. Zumal, wer sind wir, dass wir unsere Geschichtsinterpretationen mit den Dogmen der Kirche vergleichen könnten?! Tun wir gar nicht - wir bieten nur historische Konstrukte an, stellen sie in einen kulturwissenschaftlichen Diskurs und - das war‘s. Wenn alle Diskursteilnehmer ihre mehr oder weniger intelligenten und fundierten Beiträge geleistet haben, wird aus diesem Wust sich schon ein nicht richtiges, aber gemäß der angewandten Methoden passendes Ergebnis herausschälen. Die Methoden werden natürlich immer liebevoll kritisch hinterfragt – wir beobachten schließlich von außen! Wir sind selbstredend interdisziplinär und reden überall mit – Hauptsache ist die Begeisterung, die uns trägt, vorantreibt und unsere peinliche Halbbildung unter
9
viel Getöse und unter Einsatz aller unser körpersprachlichen und rhetorischen Kompetenz geschickt versteckt. So erfüllt von den Synergieeffekten des interdisziplinären kulturwissenschaftlichen Diskurses haben wir zwar immer noch keine umfassende Methodik, geschweige denn eine historisch verwertbare Systematik der Ereignisse– aber was soll´s, es war ja so interessant! Gut – zurück zum Kern des Themas: Wie beschaffen wir die Grunddaten für unser Tun und was bringt das? Wenn wir heute ein Ausgrabungsprojekt starten wollen, haben wir zunächst im Vorfeld eine Reihe von Hindernissen zu überwinden. Suchte man früher eine Ruine nach ihrer Größe und vermutlichen Bedeutung aus, ist dies heute verpönt. Wir benötigen eine Fragestellung, also letztlich eine Hypothese, die durch die Ausgrabung getestet wird. Dieses – deduktiv genannte - Vorgehen wirkt ungeheuer wissenschaftlich, bloß gibt’s bisher kaum eine Ruine, wo das Verfahren letztendlich geklappt hätte, da die Befunde eigentlich nie den Vorannahmen entsprechen. Menschliches Verhalten – und folglich auch das Siedlungsverhalten, ist eben nicht immer vorhersagbar, zumal im Alten Orient. Dies ist natürlich jedem bekannt, dennoch muss die vermeintliche Wissenschaftlichkeit gewahrt bleiben. Dabei geht’s eigentlich nur darum, dass heute kaum einer mehr die Mittel hat, größere Objekte zu ergraben. Also, da man dies nicht so zugeben will, wird’s wissenschaftlich und es werden folglich nur Ausschnitte „getestet“; diese bewegen sich fast immer in der Größenordnung von wenigen Prozent der Ruinenfläche. - Tolle Einsichten!
10
Abb.03c Der Kaiser, der Sultan und der Ausgräber Als nächster Schritt muss von den lokalen Behörden eine Grabungslizenz erworben werden, dies setzt unendliche Geduld, viel Sitzfleisch und vor allem einen eisernen Magen voraus, denn das Warten in der Kafkawelt orientalischer Ämter wird durch Liter von schwarzem Tee versüßt. Vorbei sind die Zeiten, als der Sultan unserem Kaiser Assur als Ruine noch geschenkt hatte! Als Grabungsleiter wäre man dann, einem Konsul gleich, der Vertreter der eigenen Nation im Fremdland und könnte gegebenenfalls den eigenen Pass verlängern! Als nächstes Hindernis ist die Drittmitteleinwerbung zu nennen. Hierbei muss eine sich Gott-ähnliche gebarende Schar von Gutachtern überzeugt werden, die - pikanterweise - auch alle Antragsteller mit Großprojekten beim gleichen Geldgeber sind! Man muss also trickreich versuchen, das von ihnen für ihr Vorhaben beantragte Geld für das eigene Projekt zu reduzieren. Hat dies geklappt, liegt das Primat der Unterstützung zunehmend bei den Sachmitteln, bei gleichzeitigem Abbau der Personalmittel. Dies ist systematischer Wahnsinn, denn wer soll dann die ergrabenen Befunde kompetent bearbeiten? Unser neu geschaffener BA, der gerade mal gelernt hat, wie man ein Buch richtig rum hält? Egal, dieses System der Förderung überzeugt umgehend, da es völlig unsinnig ist. Macht aber auch nichts, denn –Pisa hin oder her -, 6 Jahre nach der Dissertation schmeißen wir unseren hoch qualifizierten Nachwuchs neuerdings sowieso aus der Uni und somit gibt’s demnächst keine Grabungspublikationen mehr aber wir buddeln munter weiter!
11
Das Problem ist aber so alt wie unser Fach, was die verspäteten Veröffentlichungen betrifft, denn wie schrieb Koldewey an seinen Kollegen und Freund Puchstein: „..Im Übrigen kann das so nicht weitergehen. Was in aller Welt soll denn daraus werden? Wünscht du überhaupt die Herausgabe der Tempel noch zu erleben, so beeile dich gefälligst ein bisschen; denn wir können beide, da wir das 30. Lebensjahr bereits überschritten haben – mithin eigentlich statistisch schon gestorben sein sollten – täglich aus dieser Zeitlichkeit abberufen werden, in welchem Falle doch der übrig Gebliebene sich schauderhaft ärgern würde, was wir offenbar beide voreinander nicht verantworten können. Ich bin freilich auch noch nicht fertig. Aber erstens ist ein schlechtes Beispiel dem edlen Manne nicht nachahmenswert, und zweitens tue ich doch was daran und habe bereits 8 Quartseiten des allgemeinen Kapitels fertig und das meiste übrige in der Anlage. Du scheinst mir dagegen deine kostbare Zeit, die dir das Kolleg doch zweifellos übrig lässt, ausschließlich in der Gesellschaft gleisnerischer, heuchlerischer Krokodielenbrut bei Gänsebraten, Sekt und Austern zu verprassen unter dem windigen Vorwand, dass dir die Literatur mangele!“
Abb.4a Grabungssklaven Assur/Iraq 1989 4b 1988 Doch zurück. Als kleines Zwischenhindernis auf unserem Weg zur Grabung sind dann Beschaffung eines geeigneten Fahrzeuges, der benötigten Ausrüstung und die Requirierung geeigneter Mitarbeiter zu nennen. Letzteres ist höllisch, denn wer kennt schon seinen Nächsten? Klar, die lieben Schleimer und Speichellecker werden immer bevorzugt, man ist schließlich auch eitel – aber packen sie es unter den extremen Bedingungen einer Orientgrabung? Sind die Leute auch engagiert? Werden sie den Dauerstress von Aufstehen kurz nach 4:00, dann 12 Stunden Arbeit, gepaart mit Hitze und Staub ertragen? Ist ein Grabungskoller, ausgelöst durch den unvermeidlichen Kulturschock zu befürchten? Und wenn ja, wie würde der Betroffene sich verhalten? Aggression gegen andere oder – bevorzugt - gegen sich selbst? Die Auswahl des Personals ist teuflisch schwer – und geht oft schief.
12
Abb. 5a Öltanker im Türkisch-Iraqischen Grenzgebiet
5b Straße in Beluchistan Als nächstes Hindernis ist der Weg in den Orient, also der Transport von Personal und Ausrüstung zu nennen; dies ist eigentlich der angenehmste Teil, vorausgesetzt man fällt nicht einem orientalischen Kamikazefahrer zum Opfer.
Abb.6a Göksu-Tal/Türkei - hier ertrank Barbarossa 6b Pamukkale/Türkei
13
6c Göreme/Türkei Die eine einwöchige Autofahrt mit gutem Essen und prächtiger Landschaft stimmt einen friedvoll - bis man an die Grenze des Bestimmungslandes kommt. Hier kann es bunt werden. In einem Jahr standen wir 46 Stunden an der irakischen Grenze, in einem anderen Jahr wurde die gesamte Ausrüstung beschlagnahmt. Abstumpfen mit Hilfe von Hektolitern von schwarzem Tee ist angesagt. Sich aufregen ist völlig sinnlos, denn anders herum - man stelle sich vor, man sei Orientale und versuchte mit entsprechendem Gepäck durch den deutschen Zoll zu kommen – Danke!
Abb.7a Arapkantara/Türkei - Hausausbau 1979
7b Arbeitszimmer in Adiyaman/Türkei
14
Nun endlich angekommen muss man sich einrichten, sei es dass man etwas mietet, gestellt bekommt oder selber baut. In jedem Fall fängt man bei null an, investiert unsinnig viel Eigenkapital, das in dem bodenlosen Fass des Bakschisch-Systems versinkt, denn die Geldgeber fördern zwar die Forschung, nicht aber in eine länger zu nutzende Unterkunft.
Abb.8 Latrine in Quetta/Pakistan Wenn man Glück hat, ist in einer Woche alles so, dass man loslegen kann – vorausgesetzt man hat die Teeorgien bei den lokalen Behörden vor Ort überstanden, hat den Dauerdurchfall überwunden und endlich eine Latrine und einen Brunnen gebaut. Zur Not muss man sich mit dem lokalen Flusswasser behelfen, was zunächst zum Wasseraustritt aus allen Körperöffnungen gleichzeitig führt, also einen Akt der hydrologischen Katharsis darstellt - aber wie heißt es sinngemäß – in einem gereinigten Körper – ein gesunder Geist!
Abb.9a Echse in Assur
15
9b Tote Königskobra neben der Küche in Harappa/Pakistan Hinderlich ist auch die lokale Fauna, die mitunter recht hartnäckig ist. Echsen, Schlangen, Skorpione und Kamelspinnen müssen zunächst vertrieben werden, richten sich aber unverschämterweise doch immer wieder in ihrer angestammten Heimstatt ein. Immerhin führt dies zu einem fortwährenden sportlichen Wettkampf zwischen den Vertretern des homo sapiens und den untergeordneten Spezies, der den Adrenalinspiegel in Wallung hält und mitunter zu leichten, zum Teil auch zu finalen Ausfällen bei der Grabungsmannschaft führt – dies sind aber nur grabungstypische Kollateralschäden.
16
Abb.10a 10b Infektionswege der Lechmaniose Aus ungeklärten Gründen pflegen viele, meist weibliche Grabungsteilnehmer räudige Köter und Katzen liebevoll im Grabungshaus. Nicht, dass man über so viel Zuneigung als Grabungsleiter eifersüchtig wäre – wer würde nicht gerne liebkost und mit Leckereien verwöhnt, - nein, es ist einfach vergeblich, diese Viecher entfernen zu wollen. Nebenan sterben die Kinder, wen kümmert´s - aber fasse eine Katze an und schmeiß sie über den Zaun, schon gilt man als herzlos und widerlicher, tierquälender Gefängnis-Wächter. Erst wenn die lieben Parasiten, die diese pelzigen Tierchen als Wirt benutzen, aktiv werden und die perfekten, sonnenölgefetteten Gliedmaßen der gesundheitsfanatischen und dem Körperkult verfallenen Mannschaftsmitgliedern zerfressen, sodass Löcher entstehen, die bis auf den Knochen reichen – wie die weitverbreitete optisch hochinteressante eitrige Aleppobeule – dann ist das Geschrei groß. Egal - als Grabungsleiter ist man trotzdem das Schwein und wer weiß...
Abb.11a-b Fleischerei in Sherqat/Iraq
17
Ein weiterer Punkt der täglichen Erheiterung ist die Ernährung: Fleisch ist ob der Hitze und der mitunter interessanten Lagerbedingungen nur für todesverachtende Mitarbeiter von Interesse, hier feiern die Vegetarier in der Regel wahre Triumphe. Das Überleben aller und die allgemeine Stimmungslage hängen jedoch nicht unwesentlich von der Auswahl eines Kochs ab. Oft hat man Pech und – so man die Kocherei nicht selbst übernimmt – isst man 2 Monate lang einen Wechsel von nur 3-4 Gerichten.
Abb.12a-b Simulant Allen diesen kulinarischen Finessen zum Trotz gibt es immer eine Gruppe von subversiven Mitarbeitern, die zunächst vorgeben zu kränkeln, um dann schließlich für viele Tage auszufallen. Es gibt zwei altbewährte Verfahren diese Kandidaten wieder in die Spur zu bringen: Das eine ist weitgehender Nahrungsentzug um dieses parasitäre Verhalten zu sanktionieren, schließlich kostet die Versorgung nicht tätiger Mitarbeiter unnütz Geld – noch erfolgreicher ist aber die Androhung der Überstellung des Simulanten in ein örtliches Krankenhaus und der zwangsläufig damit verbundenen Infusion. Allein die Stärke und der bedenklich hygienische Zustand der Injektionsnadeln führen hier selbst bei den Härtesten zur schlagartigen Gesundung. Kommen wir schließlich zum heikelsten aller Probleme des Grabungsalltags, das quer durch alle Altergruppen so manche Grabung schon im Chaos hat versinken lassen. Aus unerfindlichen Gründen gibt es immer wieder Mitarbeiter, die die sengende Sonne zu nur einem animiert, nämlich dem zermürbenden Verlangen nach schnellem und zügellosen S E X!
18
Abb.13a ? 13b ? 13c ? Von wegen alle denken nur an das eine, doch dazu ist es viel zu heiß! Ist dieses Problem erst einmal aufgetaucht, dann ist es kaum noch zu bändigen. Eigentlich hülfe die Vergabe von reichlich Brom. Dies ist aber verpönt – von wegen des Reinheitsgebotes von Speisen und Getränken und in Hinblick auf die zunehmende Abgeschlafftheit der Mitarbeiter. Das einzige Gegenmittel ist eine Aufstockung der Arbeitsanforderungen, doch selbst dann lauert die Lüsternheit potenziell hinter jeder dunklen Ecke.
Abb.14a-b Luxor/Ägypten Doch zurück zu unseren Ruinen. Im Vergleich zu Ägypten, wo man nach spätestens 2 Tagen einen steifen Hals bekommt, weil man permanent hoch anstehende Säulen und Reliefs betrachten muss, erkennt man altorientalische Ruinenstätten mitunter gar nicht. Zumindest, wenn es sich um größere Anlagen von über 100 ha handelt, was in Mesopotamien nicht selten ist.
19
Abb.15a Feld in Kar-Tukulti-Ninurta/Iraq 15b Kinder in Kar-Tukulti-Ninurta/Iraq Da diese Stätten meist landwirtschaftlich genutzt sind, kaschiert ein Gemenge aus Tomaten, Kürbissen, Zucchini, Auberginen und Getreide, nicht zu reden vom Kleinvieh, jeder Menge Abfall und den allgegenwärtigen lärmenden Gören, vergangenen Ruhm und Pracht vollständig. Nur die unvermeidlichen Scherben auf der Oberfläche künden von tiefer liegenden Strukturen.
Abb. 16 Savi Höyük/Türkei 2001 Im Gegensatz zu Ägypten, wo die alten Baumeister ihre Anlagen aus Stein errichteten, stand den Altorientalen meist nur der anstehende lehmige Boden als Baumaterial zur Verfügung. Aus diesem Dreck, vermischt mit Häcksel, wurden dann Ziegel geformt und an der Luft getrocknet. Gebrannt wurden sie selten, denn Brennmaterial war rar. Folglich zerfielen die altorientalischen Bauten nach kurzer Zeit und wurden wieder zu – genau – zu Dreck. Da dies über die Jahrtausende immer an der gleichen Stelle erfolgte schichtete sich dieser Müll zu künstlichen Hügeln, sogenannten Tells oder Höyüks auf, die bis über 40 m hoch werden können.
20
Abb.17a Survey in Dabar Kot/Beluchistan 17b Begehung in Kar-Tukulti-Ninurta/Iraq Egal, wie groß die Anlage ist, auf jeden Fall erfolgt vor der eigentlichen Grabung eine penible Begehung der Ruine um etwaige auffällige Strukturen oder Artefaktverteilungen an der Oberfläche zu erfassen und dementsprechend eine geeignete Grabungsstelle auszuwählen. All dies geschieht natürlich in engster Übereinstimmung mit dem Antrag beim Geldgeber, sonst gibt’s was auf die Finger. Diese ersten Tage sind hocherfreulich, da noch nicht an die Hitze gewöhnt, man sturzbachähnliche Schweißausbrüche hat, die zu einer willkommenen weiteren Abspeckung führen.
Abb.18 Reinigung in Assur/Iraq Endlich erfolgt der erste entscheidende Schritt in Richtung Ausgrabung, denn die Ruine wird nunmehr geodätisch exakt kartiert, die Grabungsareale eingemessen und abgesteckt. Daraufhin wirkt der Archäologe als Gärtner und lässt die Grabungsstellen reinigen.
21
Abb.19a-b Feinarbeit in Assur/Iraq Nun beginnt der eigentliche Ausgrabungsakt. Hatten unsere Altvorderen noch Hundertschaften von Arbeitern zur Verfügung, so könnte dies heute keiner mehr bezahlen. Größere Schuttbereiche müssen heute mechanisch bewegt werden. Dass dazu benötigte Feinwerkzeug, also gegebenenfalls Bulldozer und Förderbänder erlaubt subtilstes Vorgehen.
Abb.20a-b Skelette 20c Ecke eines Tempels in Kar-Tukulti-
Ninurta/Iraq Wie immer man den Schutt letztendlich bewegt hat, irgendwann stößt man auf irgendetwas. Mit hoher Wahrscheinlichkeit starren einen zunächst irgendwelche Leichen an, die aus unerfindlichen Gründen meist haufenweise auftreten. Hier gilt die Grundregel: je bedeutender der darunter liegende Befund, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nekropole das Ganze stört. Das nervt, denn es hält auf und ruiniert die darunter liegenden Baubefunde meist empfindlich. Aber irgendwann brillieren auch diese frei geputzt vor den Augen des Ausgräbers. Nun muss alles zeichnerisch erfasst und fotografiert werden. Letzteres ist wichtig, denn gute Fotos bedeuten gute Reklame, sprich Geld.
22
Abb.21a-b Sandsturm in Tell Beydar/Syrien Hierbei sind plötzlich aufkommende Staub- oder gar Sandstürme der natürliche Feind jedes Ausgräbers, denn der Dreck verklebt einem nicht nur die Augen und führt damit zu üblen Störungen der Grobmotorik, sondern er verschmutzt die Befunde und überdeckt selbst in geschlossenen Räumen alles, wie mit Mehltau. Abgesehen von diesem Unbill, gilt es aber noch eine andere Regel des Ausgrabens zu benennen: Es versteht sich von selbst, dass monumentale Befunde auf das Konto des Grabungsleiters gehen – schließlich hat er ja die Stelle ausgewählt! Unbedeutende Hütten oder gar Areale, die nur mit Gruben übersät sind, sind selbstredend den renitenten Schnittleidern die wahrscheinlich schlimmstenfalls um den Grabungsleiter zu necken, die besseren Befunde wegpräpariert haben, geschuldet.
Abb.22a-b Verschütteter Arbeiter, abstürzende Kleinfundbearbeiterin
23
Ausgrabungen bergen aber auch ganz konkrete Gefahren: Gemeint sind nicht die Schlangen oder Steine, die plötzlich aus der Grabungswand, dem sogenannten Profil stürzen können, oder die Skorpione, die sich in putziger Familienidylle zuhauf unter Steinen verbergen, nein die größte Gefahr geht vom verschlafenen Arbeiter aus, der mit seiner Schubkarre ins tiefe Loch fällt oder von dem von der Sonne gestochenen Mitarbeiter, der in seinem Dusel und Taumel einen Schnitt erst dann erkennt, wenn er drin liegt. Hier muss man als Grabungsleiter, sich ärgerlicherweise von seinem kühlen Schattendach wegbewegen, die Drinks beiseitestellen und mitunter helfend eingreifen, was ebenfalls nicht ohne Gefahren ist. Da die von uns heute ergrabenen Flächen, - wie erwähnt - verglichen mit den Zeiten Koldeweys, winzig sind, gelangen wir nur zu beschränkten Einblicken, die aus sich heraus meist keinen Sinn machen. Nur der Vergleich mit den Befunden der alten Ausgrabungen erlaubt es die von uns ergrabenen Segmente sinnvollen Strukturen zuzuordnen, auch wenn diese ihrerseits oft mehr rekonstruiert als ergraben sind. Dieses Manko wird jedoch durch eine feinst mögliche Fundbeobachtung aufgefangen. Wenn man schon den strukturellen und funktionalen Kontext nicht versteht, so will man wenigstens die Erdkrümel um den Fund herum verstehen. All dies wird liebevoll dokumentiert, katalogisiert und abgespeichert. Was weg ist, ist weg!
24
Abb.23 „Konsistorialrat“ aus Assur Um einen Kontext zu verstehen, befleißigen sich einige Kollegen oft einer Methode, die als Ethnoarchäologie bezeichnet wird. Die Grundidee ist, dass menschliches Verhalten zu allen Zeiten und in mehr oder weniger allen Gesellschaften nicht grundsätzlich verschieden ist. Der Ausdruck „grundsätzlich“ bekommt damit letztlich eine schon fast kosmische Dimension. In diesem Konzept ist der Begriff der Homologie das Zauberwort, was so viel bedeutet, wie „funktional-analog“. Diese Vorstellung ist interessant und führt zu erstaunlichen Erkenntnissen. Bestimmte Rundbilder des Orients wurden so
25
jüngst zum Beispiel in funktionale Analogie mit Ahnenbildnissen aus Westafrika gesetzt und ihnen eine entsprechende Funktion auch im Alten Orient zugewiesen. Dies ist interessant, denn im Umkehrschluss bedeutet dies, dass unsere sumerischen Bildwerke, wie zum Beispiel der sogenannte Konsistorialrat aus Assur aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend, in irgendeiner Beziehung zu Westafrika stand – rein funktional-analog versteht sich! Gott behüte uns erst vor transatlantischen Homologien!
Abb.24a-b Scherben in Arapkantara und Scherben in Assur 1989 Ein anderer Umstand einer orientalischen Grabung treibt vor allem prähistorisch vorgebildete Ausgräber schier in die Verzweiflung, denn eine Fundgattung, nämlich Keramik, die in Europa vergleichsweise selten ist und hier liebevoll scherbenspezifisch, also einzeln dreidimensional eingemessen wird, kommt in orientalischen Grabungen meist tonnenhaft auf uns über.
26
Abb.25a-b Scherbensklaven Hier hat man nur die Wahl: eine kleine repräsentative Auswahl zu treffen und den Rest abzupacken und auf bessere Zeiten hoffen (so geschieht es bei den meisten Großgrabungen) oder man findet einen oder mehrere Irre, die das Ganze vor Ort zeichnen und statistisch erfassen. Diese Form der Arbeit führt bei längeren Kampagnen zu typischen Verzerrungen der Gesichtszüge, die mitunter noch Wochen später sich nicht abbauen. Die Alternative nämlich, dass man den Großteil des ganzen Krempels wegschmeißt, gilt als unfein. Eingedenk der kurzen Verfallszeit, die nach der Dissertation den akademischen Mitarbeitern heute nur noch zugebilligt wird, werden wir aber auch hier noch wissenschaftliche Begründungen erfinden, die das Ganze dann rechtfertigen.
Abb.26a Bronzekopf, Akkad-Zeit 26b Lamassu, Neuassyrisch
27
Die meisten Grabungen im Orient träumen jedoch nicht von Keramik, sondern von schönen Funden, wie Siegeln, Rund- und Flachbilder oder gar Tontafeln. Diese Artefakte sind es, die nicht nur den Ausgräber, sondern auch die Gutachter verzücken können. Zwar sind wir selbstredend der Wissenschaftlichkeit verpflichtet, eine etwaige gewisse Fundarmut in einer Grabung führt aber durchaus zur Missstimmung. Mitunter könnte sogar der Eindruck entstehen, dass nur für solche edlen Funde gegraben wird und ein weitgehendes Fehlen solcher Goodies dem Ausgräber persönlich angelastet wird. Sei es, dass dann an seinen Auswahlkriterien betreffs der Ruine gezweifelt oder ihm mangelnde Sorgfalt bei der Beobachtung unterstellt wird.
Abb.27 Dem Alkohol verfallen (gestellt) Überhaupt, diese Kritik von außen wäre ja letztlich noch erträglich, da man die Konkurrenz eh für ignorant und kleinkariert hält. Schlimmer ist jedoch die nicht enden wollende Nörgelei im Inneren der „Mannschaft“. Anders als früher, wo der Grabungsleiter in militärischer Manier der unangefochtene Herrscher über alles war, und auch beim gemeinsamen Essen das Recht auf die besten Stücke und mitunter sogar auf einen leicht erhöhten Sitz hatte, ist er heute meist ein ob der permanenten Anfeindungen gebeuteltes neurotisiertes Wesen, dessen Paranoia sich oft in unkontrollierten Ticks, zumeist gepaart mit einem hemmungslosen Alkoholismus spiegelt.
28
Abb.28a Im Schoße der Arbeiter/Beluchistan
28b Sherqatis in Assur/Iraq Der einzige Hort der Ruhe und Harmonie ist der Kreis der lokalen Arbeiter, die einen liebevoll Hodja - also Lehrer - nennen und einen beständig mit Zigaretten und – wer hätte es gedacht – mit Tee füttern. Mitunter bekommt man auch als besonderen Leckerbissen und Ehrenmal ein Kalbs- oder Schafsauge gereicht, eine Situation aus der einen nur der Verweis auf religiöse Tabus retten kann! Diese harmonische Runde ist allerdings deswegen so harmonisch, weil man die Einheimischen zunächst in ihrem Lokalkauderwelsch kaum versteht und der erfrischenden Boshaftigkeit des orientalischen Humors nicht gleich gewahr wird. Nichts ist befriedigender als über die einem unterstellten Potenzprobleme zu lachen in dem Irrglauben der Witz bezöge sich auf einen anderen. Dies führt zur Sympathie und Hochachtung und dokumentiert auf prächtigste Weise die europäische Überlegenheit. Wenn es ums Geld, also um den Arbeiterlohn geht, dann ist es mitunter allerdings vorbei mit der Gemütlichkeit. Wildes Geheul, geballte Fäuste und gnadenloses Streiken treiben den Grabungsleiter mitunter in den Wahnsinn, da ihm die Zeit davonläuft und er somit sein Programm nicht erfüllen kann, was zu entsprechend abwertenden Reaktionen der Gutachter führen könnte. Aber der Orient wäre nicht er selbst, wenn sich nicht alles bei mehreren Tassen Tee, gewichtigen Gesprächen, wissendem Kopfnicken und endlosen Zigaretten in Wohlgefallen auflösen würde – zumindest bis zum nächsten Mal.
29
Abb.29a-b Arbeiterfest in Assur/Iraq Trotzdem, man liebt sich, und da man ja der Patron also der Boss ist, gibt man sich am Ende der Grabung die Ehre und läd zu einem Arbeiterfest. Dies ist der krönende Abschluss jeder Grabung und versöhnt für so manches erfahrene Ungemach. Sind die lokalen Arbeiter meist die Freunde des Ausgräbers – und sei es auch nur wegen des willkommenen regelmäßigen zusätzlichen Einkommens, so kann ein weiterer Einheimischer sich schlimmstenfalls zur Hölle auf Erden entwickeln. Gemeint ist die Spezie der Repräsentanten der staatlichen Antikenverwaltung, die sogenannten Kommissare. Ihre Aufgabe besteht darin, die Arbeiten in Bezug auf ihre wissenschaftliche Durchführung zu überwachen und vor allem dafür zu sorgen, dass keine Funde unterschlagen werden. Letzteres ist völlig in Ordnung. Kritisch bleibt es nur in Bezug auf die Kompetenz, wenn es um die Beurteilung der Wissenschaftlichkeit unserer Arbeit geht, wenn der Repräsentant selbst keinerlei Ahnung von Archäologie hat und schlimmstenfalls normalerweise als Sekretärin tätig ist. Um es vorab zu sagen, in der Regel sind die Kommissare liebenswerte Zeitgenossen, die oftmals auch unschätzbare Hilfe leisten. Es gibt aber auch die üblen, die Ausländerhasser, Antialkoholiker, die Mister-Wichtig, die Mitarbeiterinnengrapscher und einfachen Widerlinge. Kurzum sie spiegeln die gesamte Palette des Menschseins, wie in allen Ländern. Nur das Ärgerliche ist, dass man ihnen komplett ausgeliefert ist und nur selten sich ihrer erwehren
30
kann. Am besten gelingt dies, wenn man sein Projekt in Zusammenarbeit mit einer lokalen Institution durchführt, auf die man gegebenenfalls das Problem liebevoll abwälzen kann, um dann ungestört weiterzuwerkeln, wie bisher.
Abb.30a Norsun-Tepe/Türkei 30b Grabungsschnitte in Assur Ein Aspekt muss noch erwähnt werden, neben allen anderen, ausnahmslos wissenschaftlichen Tätigkeiten ist der Vorderasiatische Archäologie selbstredend auch ein Künstler. Die monotonen Siedlungshügel oder die anödenden landwirtschaftlichen Nutzflächen der Flachsiedlungen werden von uns in Landschaftskunst umgewandelt, veredelt, ähnlich Christo nur genau umgekehrt. Wir verdecken nichts, sondern enthüllen es, decouvrieren also den verborgenen Kern bei gleichzeitiger Neustrukturierung des Weichbildes. Nichts wäre sträflicher als die Grabungsschnitte nur dem Befund anzupassen! Selbstredend haben diese auch damit etwas zu tun aber in erster Linie soll eine Grabung ästhetisch wirken. Leider sind unsere Kunstwerke nicht von Dauer, sei es, dass die winterlichen Regen unsere Großwerke zerstören oder das ein ganzer Stausee alles überflutet und somit sind nur unsere Fotos, nicht die Opera selbst vermarktbar. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, denn so eine Ausgrabung kann langwierig sein. Nicht nur, dass einzelne Kampagnen mitunter drei Monate dauern, nein die Grabungsobjekte sind in der Regel so groß, dass Grabungen, die mehr als 10 Kampagnen dauern, keine Seltenheit sind. Dies erfreut das Archäologenherz, denn es bedeutet, 10 Jahre lang keine Ferienkataloge wälzen zu müssen und qualvoll einen passenden Ferienort auszusuchen, sondern seinen Urlaub immer am gleichen Ort zu verbringen, immer wieder die gleichen Leute zu treffen, immer das gleiche zu essen und zu trinken, jedes Jahr sich erneut von den lieben Händlern übers Ohr hauen zu lassen – und wenn’s nur der Versuch ist, und in der Gesamtdauer der Grabung mindestens 30 Mitarbeiter zu verschleißen.
31
Diese Regelmäßigkeit ist gut für den Intellekt, da dieser durch die Stumpfheit der Wiederholung geschont wird. Mitunter führt dies auch zu einer beeindruckenden verbalen Karg- und Schlichtheit mancher Ausgräber, gepaart mit dem Irrglauben, dass ihr Grabungsprojekt der Nabel des Universums sei. Und letztlich ist es auch so, denn alles andere wird plötzlich unwichtig und dies ist verständlich, denn – kaum das man wieder in der Heimat angekommen ist, muss schon der nächste Grabungsantrag abgefasst und eingereicht werden, da man sonst keinerlei Gelder für die nächste Kampagne erwarten kann. Zur weiteren Legitimation werden noch schnell 1-2 knappe Vorberichte auf die Schnelle zusammengeschustert und der Rest des Jahres geht sowieso mit den Vorbereitungen der nächsten Kampagne verloren. Diese Hektik ist erfrischend und führt zwangsläufig zu gut durchdachten und fundierten Berichten, die dann sofort in den wissenschaftlichen Diskurs einfließen, diesen bereichern und das eigene Renommee fördern. Die während der Grabung liebevoll abgepackten Funde füllen bei größeren Projekten tonnenweise die Magazine vor Ort. Scherbensäcke müssen regelmäßig gewechselt und neu etikettiert werden, da sie sonst vom Schimmel und den Mäusen zerfressen werden. Das Ganze wird von einem vertrauensvollen Wächter durchgeführt und bewacht. Dessen übrige Dienstleistungen – also zuvörderst die Versorgung mit Tee – wird gerne von den Bearbeitern in Anspruch genommen.
Abb.31a-b Arapkantara/Türkei im November Letztere sind die oben schon erwähnten Rauswurfkandidaten. In der vergeblichen Hoffnung auf den durch die Publikation des hier bearbeiteten Materials unmittelbar folgenden Karrieresprung, verkriechen sie sich entsagungsvoll mehrere Monate, zumeist zu einem Großteil auf eigenen Kosten, in den Magazinen der Grabungshäuser. Da dies meist in der Winterperiode geschieht, entschädigt die schwermütige Romantik der Regenzeit die Monotonie
32
des Dorf- und Arbeitsalltages ihres Aufenthalts. Eingeschlossen in den Grabungshäusern und weitgehend abgeschnitten von der restlichen Welt versuchen sie dann verzweifelt aus den zum Teil 10-15 Jahre alten Tagebüchern und Skizzen, Plana und Profilen der damaligen Schnittleiter eine Grabung zu verstehen und zu rekonstruieren, an der sie mitunter noch nicht einmal teilgenommen haben. Dies erfordert ohne Zweifel kreative Intelligenz, ähnlich der eines Dokumentenfälschers. Es wäre interessant ein und denselben Befund von verschiedenen Bearbeitern aufarbeiten zu lassen, ohne dass sie in Kenntnis voneinander wären und dann die unterschiedlichen Konstrukte miteinander zu vergleichen. Diese Nachbearbeitung erfolgt oft bis in die Wintermonate hinein und die völlig zerrüttete Psyche der Bearbeiter wird von der romantischen Tristesse eines verregneten orientalischen Dorfes auf subtile weise aufgeheitert. Es wurde leider bisher noch nie untersucht, wie hoch die Trefferquote dieser Konstrukte von Grabungen im Verhältnis zum ehemaligen Befund ist. Letztlich ist dies auch egal, denn die meisten ursprünglichen Mitarbeiter sind eh längst in einem anderen Beruf, verdummt oder gnadenvoll entschuldigt, will sagen - verstorben. Auch ein Nachfragen beim Grabungsleiter selbst führt in der Regel zu keiner Erkenntnis, da dieser sich meist nie um die Details gekümmert hat, sondern das Ganze bestenfalls verklärt. Einige dieser quasi Endlosprojekte werden von manchen Kollegen bis zur Pensionsgrenze und darüber hinaus betrieben, schließlich sind ihre Projekte von höchster Bedeutung! Dies erfreut die, die nachrücken, denn Forschungsgelder für die Projekte der Nachfolgegeneration werden somit erfolgreich blockiert. Wird der Kollege dann mit den Jahren zu tüterig oder verstirbt endlich und liegen die Endpublikationen dann noch nicht vor, so hat der Neue auf dem Lehrstuhl ein Projekt am Hals, das ihn jahrelang bindet und schlimmstenfalls überhaupt nicht interessiert. Auch dieses System führt zu hochqualitativer Forschung und innovativen Impulsen. Selbstredend wird unsere Generation ebenso verfahren und sei es nur aus Rache an den Alten, also letztlich dann an uns selbst.
Abb.32a Robert Koldewey 32b Babylon, die hängenden Gärten,
Rekonstruktion
33
Wie auch immer, der unvermeidliche Tod des Ausgräbers beendet das hier diskutierte Trauerspiel. Aber so leicht wird man uns nicht los, denn wir kommen noch als verrotteter Leichnam mit jeder Grabungspublikation der Unsterblichkeit ein Stück näher und nur das zählt! Denn jeder Orientarchäologe wird fortan die Ergebnisse, die der Ausgräber hat erarbeiten lassen und die unter seinem Namen herausgegeben werden, zitieren müssen, egal ob kritisch oder wohlwollend. Bedenkt man wer und was alles bis dorthin auf der Strecke geblieben ist, wird die subtile Ironie, die unserem Beruf zugrunde liegt erkennbar. Wenn Sie immer noch nicht begriffen haben, warum wir das alles machen – dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.