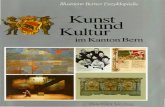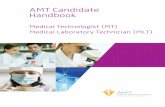A7 - Amt für Archäologie - Kanton Thurgau
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A7 - Amt für Archäologie - Kanton Thurgau
* «
lâ taW : !8 -•'■
i" # ’' A :
A7 - Ausfahrt Archäologie
Prospektion und Grabungen im Abschnitt Schwaderlohbandesgrenze
Archäologie im Thurgau 10
Erwin Rigert
A7 - Ausfahrt ArchäologieProspektion und Grabungen im Abschnitt Schw aderloh-Landesgrenze
m it Beiträgen vonHansjörg Brem, Jost Bürgi, W alter Ebinger, M arcel Joos, Philippe Rentzel, Thomas Specker, Thomas Stehrenberger
Archäologie im Thurgau 10
Veröffentlichung des Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau
ISBN 3-905405-09-1 ISSN 1420/0570
Erwin Rigert
A7 - Ausfahrt ArchäologieProspektion und Grabungen im Abschnitt Schwaderloh-Landesgrenze
mit Beiträgen von Hansjörg Brem, Jost Bürgi, W alter Ebinger, M arcel Joos,Philippe Rentzel, Thomas Specker, Thomas Stehrenberger
2001Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau
Behörden, Bauherrschaft und Mitarbeiter
Behörden und Bauherrschaft
Ingenieurbüros und Bauleute
Untersuchung und AuswertungAm t für A rchäologie
R egierungsrat H ans Peter R uprecht, C h e f des D epartem ents für Bau und Um w elt Jü rg B aerlocher, K antonsingenieur W alter Ebinger, C h e f N ationalstrassenbau
IPG K eller AG, K reuzlingen; BHA AG B ernhard, H errm ann und A rnold, Frauenfeld; A d o lf Keller A G ,W einfelden; R ibi und B lum AG. W einfelden; M oggi AG, K reuzlingen; E g o lf AG, A ltnau; Vago AG, M üllheim -W igoltingen; B runner Erben AG, K reuzlingen; Vetter AG, Com m is.
O berleitung: Projektleitung: Ö rtliche Leitung: Prospektion:
Jost Bürgi, K antonsarchäologe H ansjörg Brem , A djunkt E rw in R igertH ansjörg B rem , H einz H am m ann, U rs Leuzinger, E rw in R igert, T hom as Specker
Technik / D okum entation: E rw in R igert, A ntonio G iannuzzi, T hom as Keiser. M argrit Lier, Eva Schön, M atth ias Schnyder, T hom as S tehrenberger. D aniel Steiner, M ilena Stojic, A lbert W idm ann
G rabungsm itarbeiter: C hristian B ensch, B ettina B ichsel, M anfred B ienert, M yrta Börner,M artina B rägger, C arla B runetti, C onrad Bürgi, M erujan D em irciyan,A nne Fiechter, Irene Fiechter, A ntonio G iannuzzi, G iu liano G iannuzzi, Pascal H äuptle, Susanne Keller, Jörg K irchm eier, R oland K ressebuch, L iubjsa M irojkovic, B arbara P(affli. D avid Renz, Kai R iebli, M arkus R öthlisberger, A ndreas Schildknecht, Jost Schm id, A ude Schönenberger, Frank Schüepp, Pascal Sieber, C hristoph Singer, C laudia Sollberger, Jürg S täheli, A nja Tobler, A ida Turkalj, B arbara W ollinski, A ndreas Zünd
Fundausw ertung: E rw in R igert, A nne F iechter, T hom as S tehrenbergerFundrestaurierung: C hristoph M üllerFundzeichnungen: Erw in R igert, A nne Fiechter, Thom as S tehrenbergerFundfotos: D aniel Steiner
U nterstü tzung und H inw eise
Dritte G eologie/Sedim entologie: M arcel Joos, Philippe R entzel, R ichard VogtD endrochronologie: Büro für A rchäologie der Stadt Zürich14C -D atierungen: R ad iokarbon labor des Geogr. Institutes der U niversität Z ürich; Institut für
Teilchenphysik E T H -H önggerberg
R obert K önig, H erbert B öhler und Fritz Plüer, Fam ilie B insw anger, Landw irte T ägerw ilen; E lias Ribi, T itus W inkler, K urt O nken und R oland H enke, K reuzlingen; Fam ilie G öpfrich, H elm ut M aier, Volker M artin-B eck, K onstanz; C hristian M athis, A -M einigen
A ndrea B ach, B odenseebib lio thek Friedrichshafen; B arbara W aibel. Z eppelinm useum Friedrichshafen; H elm uth M aurer, S tadtarchiv K onstanz; H arald D erschka, U niversität K onstanz; Bettina H edinger und Eduard G ross, K antonsarchäologie Z ürich; H ansjürg und M onika Leuzinger, R iehen; H ansjörg F röm m elt und U lrike M ayr, A rchäologie L iechtenstein; C atherine Leuzinger-P iccand, W interthur; G eorg Strasser, H eim atm useum K reuzlingen; M arkus T halm ann, G em einde T ägerw ilen; W alter Fasnacht, Schw eizerisches Landesm useum , Z ürich; Beat G nädinger, S taatsarchiv Thurgau; Irm gard Bauer, M useum für U rgeschichte, Zug; B odo D ieckm ann, L andesdenkm alam t, D -G aien- hofen-H em m enhofen
Impressum
G edruckt m it U nterstü tzung des K antons T hurgau, der Stadt K reuzlingen. der E inheitsgem einde T ägerw ilen , der IPG K eller AG K reuzlingen und der B ernhard H errm ann & A rno ld Ingenieur-, P lanungs- und V erm essungsbüro AG Frauenfeld
U m schlag: Von Schw aderloh zu r L andesgrenze, A ufnahm e D E S A IR AG, W erm atsw il/U sterR edaktion: Jost Bürgi, C laudia B artlett, A nne Fiechter-W ahli, E rnst G ra f
Texterfassung: Die A utorenDruck: H uber & Co. AG, G rafische U nternehm ung und V erlag, 8501 Frauenfeld
A uslieferung: A m t für A rchäologie, S chlossm ühlestrasse 15, C H -8 5 10 Frauenfeld, Telefon 052 724 15 70,Telefax 052 724 15 75 ISBN 3-905405-09-1; ISSN 1420/0570
5
Zum Geleit
Der Titel des Buches «A7 - A usfahrt Archäologie» weist au f die Verbindung von Strassenbau und Ausgrabungen hin. Der Bundesrat beschloss 1961, dass die Aufwendungen für archäologische Untersuchungen zu den Erstellungskosten der N ationalstrassen gehören. So waren auch im Thurgau die Abklärungen au f den letzten vier K ilom etern der A7 von Schwaderloh zur Landesgrenze der Strassenrechnung zu belasten. Für einmal schreibt deshalb der C hef des Depar- tem entes für Bau und Umwelt das Geleitwort zu einem Band der Reihe «Archäologie im Thurgau», die vom Departem ent für Erziehung und Kultur verlegt wird.
Die Arbeiten bedingten eine enge Zusam m enarbeit zw ischen dem Tiefbauam t und dem Amt für Archäologie. Trotz sehr unterschiedlichen Interessen ist es den beiden Am tsstellen gelungen, ihre Programm e aufeinander abzustimmen und ohne gegenseitige Behinderungen auch durchzuziehen.
Die A rchäologen nutzten die Gelegenheit, in einem, allerdings nicht von ihnen selbst gewählten, Geländestreifen eine sorgfältige Bestandesaufnahm e vorzunehmen. Die Resultate sprechen für sich. Unter der M asse der Funde sind zwar nur wenige Stücke für Ausstellungszwecke geeignet, der Wert der Untersuchungen liegt hauptsächlich bei den Erkenntnissen zum A blauf der Besiedlungsgeschichte. Dank dem
Nationalstrassenbau stiess man erstm als im Kanton au f Lagerplätze der späten mittleren und au f Siedlungen der frühen jüngeren Steinzeit. Die Zahl eisenzeitlicher Stationen im Kanton hat sich verdoppelt. Weiter zu verfolgen sind die Hinweise, w ie sich die Ausweitung des Siedlungsgebietes vom Rand des Tägerm ooses zu den höheren Lagen des Seerückens entwickelt haben könnte. Interessant ist auch die Feststellung, dass Rodungen bereits in der Jungsteinzeit und der Bronzezeit zu Erosion führten.
Die au f N ationalstrassengebiet neu entdeckten Fundstellen geben aber auch zu denken. Wenn in einem eng begrenzten Gebiet so viel an Inform ationen zur Geschichte gewonnen wird, lässt sich ausrechnen, wie viel bei anderen, nicht m it der gleichen Intensität überwachten Bauvorhaben für im m er verloren geht.
Die Archäologen haben sich an die zeitlichen und finanziellen Vorgaben gehalten. Die Auswertung der reichen Funde und Befunde erfolgte zügig, und es freut mich, dass es den Bearbeitern gelungen ist, die Resultate relativ kurz nach Abschluss der Untersuchungen vorlegen zu können.
Hans Peter RuprechtC hef des D epartem ents für Bau und Umwelt
7
Inhalt und Zusammenfassung
Bauleute und Archäologen
N ationalstrassenbau und Archäologie - Jost Bürgi 15
Professoren und Laien D er B und kom m t ins Spiel D ank des K antonsarchäologen
D er B undesrat besch loss am 13. M ärz 1961, also vor 40 Jahren , dass d ie A ufw endungen für die A usgrabung , d ie B ergung oder die w issenschaftliche A ufnahm e h is to rischer Funde im Trassee künftiger N ationalstrassen zu den E rste llungskosten der Strassen gehören.D ieser E n tscheid erlaub t es, im B oden erhaltene Q uellen zu r G eschichte vor ihrer Z erstö rung durch d ie B auarbeiten zu dokum entieren . Parallel dazu fordert er die Entw icklung neuer G rabungs-, K onserv ierungs- und D atierungsm ethoden.
A7. Von Schwaderloh zur Landesgrenze - Walter Ebinger 19
Die A7 im T hurgau P lanung und Projektierung D ie B auausführungSchw aderloh - A nschluss K reuzlingen Süd G irsbergtunnelA nsch luss K reuzlingen N ord - L andesgrenze Sch lussbetrach tung
Die N ationalstrasse A 7 zw eigt in A ttikon bei W in terthur von der A l ab und führt über Frauenfeld und M üllheim nach K reuzlingen bis zur L andesgrenze Schw eiz/D eutschland.Das 1. generelle P ro jek t g ing anfangs 1969 in die V ernehm lassung. N ach langem H in und H er konnte 1997 m it dem B au des A bschnittes Schw aderloh bis L andesgrenze begonnen w erden.Das B auw erk um fasst neben offen geführten A bschnitten einen 1750 m langen Tunnel, die G em einschaftszo llan lage bei K reuzlingen und m ehrere A nschlussstrassen .
Wer sucht, der findet! - Hansjörg Brem 24
A lles Z ufall?W er sucht, der findet!D ie B evölkerung m ach t m it M it dem U nbekann ten rechnen A ufw and......u n d Ertrag
A rchäologische U ntersuchungen können nur dann zuverlässig geplant, budgetie rt und ohne lästige Inkonvenienzen fü r d ie B auherrschaft d u rchgeführt w erden, w enn Lage und G rösse der Fundstellen bekannt sind. D er v orsorglichen P rospektion kom m t deshalb g rosse B edeutung zu. D ie system atische Suche a u f N ationa lstrassen geb iet führte n icht nur zu r E n tdeckung neuer, sondern auch besonderer Fundste llen des M esolith ikum s, des frühen N eolith ikum s, der m ittleren B ronze- und der E isenzeit.
8 Inhalt und Zusammenfassung
Vom Untersee zum Seerücken - 10000 Jahre Siedlungsgeschichte
W ichtige Resultate vorneweg - Jost Bürgi 28
Süd Nord
altes SeegebietM itte lste inzeit / M esolith ikum
Vor 9000 Jahren bestand im G ebiet, das w ir heute T ägerm oos nennen, noch e in See, an dessen U fern m esolith ische Fischer-, Jäger- und Sam m lergruppen lagerten. M it der Z eit verlandete der See zum S u m p f oder eben M oos. A n seinem R ande en tstanden d ie ersten jungste inze itlichen D örfer und m an begann, d ie südlich ang renzen den H angterrassen zu roden, ab der späten M itte lb ronzezeit auch zu besiedeln . In der Spätb ronzezeit w ar das T ägerm oos trockener und besser begehbar, w as ab e tw a 1200 v. Chr. den B au von Siedlungen an R hein und K onstanzer T richter e rlaubte.
Zelte am alten Seeufer - Erwin Rigert 28 M ESOLITHIKUM
. M
Die ersten Bauern am Tägerm oos - Erwin Rigert
Die m eso lith ischen L agerp lä tze fin d en sich w estlich von K onstanz fast ausnahm slos a u f ca. 400 m ü .M .. also en tlang der U ferlin ie der Z eit zw ischen 9000 und 5500 v. Chr.Bis vor kurzer Z eit sind im Thurgau nur Funds tellen des frühen M eso lith ikum s bekannt gew orden, zum eist im Seebachtal. D ank den G rabungen a u f N ationa lstrassengeb ie t w urden erstm als auch so lche des späten M eso lith ikum s entdeckt. E rhalten geblieben sind m eist nu r M ikrolithen , k le ine W affen- und G eräteeinsätze aus Silex. K eram ik gab es noch nicht.
32 NEOLITHIKUM
Das T ägerm oos verlandet D ie B evölkerungszahl steigt R odungen und B odenerosion
U m 5000 v. Chr. w ar das G ebiet des T ägerm ooses Sum pf. N och in der Z e it zw ischen 4 500 und 2200 v. Chr. m ieden d ie jungste inze itlichen B auern das Feuchtgebiet und w ählten den R and des T äg erm ooses m it seinem festen U ntergrund fü r den B au ih rer Siedlungen. D ie A ckerflächen w urden a u f d ie südlich angrenzenden trockenen Terrassen ausgew eitet. A ls Folge der R odungen setzte die E rosion ein.
Vom Stein zur Bronze - Erwin Rigert 36 BRONZEZEIT
B eeindruckende Siedlungsdichte D er Seerücken w ird S iedlungsgebiet D ie Seeufer w erden w ieder interessant
#* É
SpätbronzezeitUntersee / Rhein
0 11 km |2 km |3 km |6 km
W ie im N eolith ikum bevorzugte m an zw ischen e tw a 1800 und 1500 v.C hr., d .h . in der Frühbronzezeit und der frühen M itte lbronzezeit, den R and des T ägerm ooses zum B au der Dörfer. Das änderte sich ab etw a 1450 v.Chr., d .h . ab der jü n g eren M itte lbronzezeit. Sukzessive begann m an auch a u f den hoch gelegenen H angterrassen des Seerückens b is a u f ca. 550 m ü. M . zu siedeln. In der Spätbronzezeit, um ca. 1200 v. Chr., lag der Seespiegel tiefer als heute, und d ie U fer von U ntersee und R hein boten sich als gute S iedlungsplätze an.
Inhalt und Zusammenfassung 9
Von der Bronze zum Eisen - Thom as Stehrenberger 38 EISENZEIT
Die Funddichte n im m t abK elten im Raum K reuzlingenD ank dem S trassenbau w issen w ir m ehr
Röm er und A lem annen - Erwin R igert
Wo sind die R öm er?M an spricht A lem annisch
41
U m 800 v.Chr. endete die Spätbronzezeit. D as K lim a versch lech terte sich und d ie S eeufersiedlungen w urden aufgelassen , dafü r aber die H öhen w ieder besiedelt.A us der ä lteren E isenzeit (H alls ta ttzeit) sind hauptsächlich G rabhügel erhalten geblieben.A b ca. 450 v.Chr., dem B eginn der L atènezeit, kennen w ir deren Träger, d ie K elten. D ank den A u tobahngrabungen konnten m ehrere S ied lungsstellen en tdeck t und erstm als d ie ä lteste D rehscheibenw are im T hurgau nachgew iesen werden.
RÖM ERZEIT - M ITTELALTER
A u f N a tiona lstrassengeb ie t kam en nu r w enige röm ische Funde und G räber zum V orschein. D ie N ähe zu K onstanz hatte m ehr als d ie paar w enigen E inzelfunde erw arten lassen.N ach dem A bzug der röm ischen T ruppen begann d ie E inw anderung a lem annischer Fam ilien. Aus frühm itte la lterlichen S iedlungen entw ickelten sich d ie heutigen Dörfer. D ie A 7 um fährt die D orfkerne, es w urden fo lg lich keine W ohnstätten gefunden. D er V ollständigkeit ha lber w erden frühere G rabfunde vorgestellt.
Was wäre Konstanz ohne Hinterland? - Thom as Specker 42 NEUZEIT
Platz fü r V ieh, Ä cker und G ärten Tongruben und A bfallen tsorgung Frisches T rinkw asser für d ie Stadt D ie T ägerm oos-S trasse
Jede S tadt b rauch t e in H interland, sei es für W eiden, Ä cker u nd G ärten , sei es fü r den W asserbezug, d ie G ew innung von R ohstoffen oder die D eponierung von A bfällen und A braum .D ie S tadt K onstanz versuchte über Jahrhunderte im m er w ieder, R echte am T ägerm oos zu erw erben, w as ih r auch gelang. In verschiedenen Erlassen ordnete sie d ie N utzung des G ebietes.
Alte Bunker und rostiger Stacheldraht - Jost Bürgi 52 20. JAHRHUNDERT
G efahr von N ordenD er W erkgürtel um K reuzlingenB unker und der S trassenbau von heute
D er R hein und der See w aren n ich t im m er, aber im m er w ieder eine G renze, deren Schutz im B ereich der See-Enge bei K onstanz jew eils Problem e bot.D ie jüngsten g rossen A nstrengungen zu r A briegelung der E infallsachse e rfo lg ten unm itte lbar vo r un d w ährend des 2. W eltkrieges. U m K reuzlingen en tstand das dichteste N etz m ilitärischer A nlagen der Schw eiz. E in g rosser Teil der B efestigungen hat ausged ien t und w ird abgebaut, andere b le iben a ls Z eugen der G eschichte stehen.
10 Inhalt und Zusammenfassung
N ationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Fundstellen am Tägermoos
56 M E S - N E O - F B Z - M B ZTägerwilen: ARA-Strasse - Erwin Rigert
E ntdeckung und Lage D ie B efunde D ie Funde
Fundstelle am R and des T ägerm ooses a u f 400 m ü .M . U nm itte lbar u n te r der H um usdecke 15 cm starke K ulturschicht m it spätpaläo lith isch /früh- m eso lith ischen S ilices der Z eit zw ischen 10000 und 7000 v.Chr., S te ingeräten und K eram ik aus dem frühen Jungneo lith ikum um 4200 v.Chr. sowie K eram ik der jü n g eren F rühbronzezeit zw ischen 1650 und 1550 v.Chr.
Tägerm oos - Erwin Rigert 61 M E S - N E O - B Z
O beres T ägerm oos und R uet Funde am R and des T ägerm ooses- A n der V ierten S trasse und N oppelsgu t- A n der Z w eiten S trasse
0
E inzelfunde von versch iedenen Fundorten: R öhrenperleSilices: B ohrer und P feilspitze SteinbeileB ronzen: R inglein, P feilsp itze
Tägerwilen: Gottlieberw ise - Erwin Rigert 62 MES - NEO
Dörfer der Jungsteinzeit am Untersee D ie G ottlieberw ise ist seit langem als F undort bekannt. D as G elände w ird intensiv landw irtschaftlich genu tzt und ist stark überpflüg t. D er Fundbereich um fasst rund 10000 m 2 und ist m it H underten von H itzeste inen übersät.
Kreuzlingen: Töbeli - Erwin Rigert, Philippe Rentzel, M arcel Joos 5000 Jahre Siedlungsgeschehen am Tägerm oos 64 M E S - N E O - F B Z - M B Z
E ntdeckung und Lage D er A b lau f der G rabung G eoarchäologische B eobachtungen D ie B efunde D ie Funde
Fundstelle am R and des T ägerm ooses a u f 400 m ü.M .Schichtfo lge von ü ber 2 m m it Funden des späten M esolith ikum s, des Jungneo lith ikum s, der jü n g e ren Frühbronzezeit um 1650 v.Chr. und der frühen M ittelbronzezeit.
Inhalt und Zusammenfassung 1 1
Fundstellen auf M oränenterrassen
Tägerwilen: Hochstross - E. Rigert, Th. Stehrenberger, Ph. Rentzel, M. Joos Dörfer oder Gehöfte der Bronze- und Eisenzeit 71 FBZ - MBZ - SBZ - HA - LT - R
E ntdeckung und LageA b lau f der G rabungen und B efundeDie Funde
Fundstelle a u f M oränen terrasse südlich des T ägerm ooses.R odungszeiger des E ndneolith ikum s, erste B es ied lung ab der späten Frühbronzezeit. R este von B auten der späten FB Z /frühen M B Z , späten M B Z /frühen SB Z und der Latènezeit.U nter den Funden neben S ilices und B ronzeobjekten vor allem K eram ik. Für den Thurgau von besonderer B edeu tung sind d ie e isenze itlichen B efunde und Funde, darun ter auch keltische M ünzen.
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg - Erwin Rigert S iedlungsspuren aus der m ittleren Bronzezeit MBZ
E ntdeckung und Lage D ie B efunde D ie Funde
F undstelle a u f M oränen terrasse südlich des T ägerm ooses.Ü berw iegend K eram ik der jü n g eren M itte lbronzeze it m it vereinzelten E lem enten der frühen Spätbronzezeit. D olch und N adeln aus Bronze.
Tägerwilen: Ribi-G irsbergtunnel - Erwin Rigert 93 M B Z -S B Z
E ntdeckung und Lage D ie B efunde D ie Funde
Bei der A nlage e iner B aup iste a u f dem A u to bahn trassee fanden sich im A bschn itt R ibi- G irsbergtunnel zw ei Z onen m it präh isto rischen Fundschichten.D er S treubereich der Funde von 500 mal 200 m lässt eher an E inzelgehöfte als an ge schlossene D örfer denken.
Tägerwilen: Ribi - Erwin Rigert 95 M B Z -S B Z
E ntdeckung und Lage D ie B efunde D ie Funde
F undstelle a u f flacher M oränen terrasse, 423 m ü. M ., zw ischen K reuzlingen und T ägerw ilen . K ultu rsch ich treste sind nu r in Sedim entfallen (M ulden und G ruben in der M oränenoberfläche) e rhalten geblieben, und zw ar unm itte lbar unter der m odernen Pflugsohle.Im N orden vorw iegend m itte lb ronzezeitliche, im Süden spätb ronzezeitliche Funde.
12 Inhalt und Zusammenfassung
Tägerwilen: Spuelacker - Erwin Rigert 101 FBZ - M BZ - SBZ - Röm - MA
Lage und B efunde D ie Funde
Fundstelle a u f M oränen terrasse, 414 m ü .M . R odungszeiger des E ndneo lith ikum s, K ultursch ich t m it H itzeste inen und K eram ik der frühen M itte lb ronzezeit, Sch ich treste m it früh- und spätb ronzezeitlichem Inhalt, etw as röm ische K eram ik.D as H ochm itte la lter ist m it F ragm enten von handgew ulste ten und überdreh ten T öpfen des 11./12. Jhs. n. Chr. vertreten .
Tägerwilen: Trafostation - Erwin Rigert 102 SBZ
Lage und B efunde D ie Funde
Fundste lle a u f G eländeterrasse zw ischen T ägerw ilen und K reuzlingen in 418 m Höhe.H inw eise a u f zwei R odungsphasen. S pätb ronzezeitliche K eram ik der Z eit um 950 v.Chr.
Tägerwilen: M üller-T hurgau-S trasse-T hom as Stehrenberger Eisenzeitliche Siedlungsfunde 104 LT
Lage und B efunde D ie Funde
F undstelle a u f G eländeterrasse zw ischen T ägerw ilen und K reuzlingen in 413 m Höhe.E rste r B eleg fü r S ied lungsak tiv itä ten im R aum T ägerw ilen in der jü n g eren E isenzeit (L atène- zeit).U nter der K eram ik fallt ein S tück der frühen D rehscheibenw are auf, das in der Z e it des Ü bergangs von der H allstattzeit zu r L atènezeit, also am A nfang des 5. Jhs. v.Chr. p roduziert w orden sein m uss. Es handelt sich um den ältesten B eleg fü r d ie schnell ro tierende T öpferscheibe im G ebiet des K antons.
Tägerwilen: G irsberg -G ugger- Erwin Rigert Prähistorische und röm ische Funde beim Schlösschen Girsberg 105 N EO - BZ - Röm
Lage und B efunde Die Funde
F undstelle a u f M oränen terrasse nordw estlich des Schlösschens G irsberg.W enig präh isto risches M aterial, e tw as röm ische K eram ik des 1. Jhs. n. Chr.
Inhalt und Zusammenfassung 13
Fundstellen am Seerücken
Kreuzlingen: Schlossbühl - Erwin Rigert 106 M B Z - S B Z - H A - M A
L age und F orschungsgeschichte D ie G rabung von 1972/73 Ein G rabhügel aus der H allstattzeit? D ie m itte la lterliche Burg
Kreuzlingen: Bernrain - Erwin R igertEine Siedlung der m ittleren und späten Bronzezeit
M itte lalterliches E rdw erk und prähistorische Fundstelle am B ernrain tobel südlich von K reuzlingen.Z unächst als e isenzeitliches R efugium oder F luchtburg angesehen. G ra f Z eppelin und später Dr. J. von Sury legten Schnitte durch den m itte la lterlichen B urghügel, w as erstm als zu r E n tdeckung einer p räh isto rischen L andsied lung im T hurgau führte.U nter dem Wall m öglicherw eise R este e ines hallstattzeitlichen G rabhügels.K eine schriftlichen Q uellen zu r m itte la lterlichen B urg des 11./12. Jhs. n .C hr.
112 M B Z - S B Z - H A
Forschungs- und Spionagegeschichten Sondierungen K eller-T arnuzzers G rabungen bedingt durch den A utobahnbau D ie Funde
Fundstelle am B ernrain tobel 200 m nordw estlich der K irche B ernrain.E n tdeckung durch A lfons Beck, K onstanz, ausgerechnet zu r Z e it des B unkerbaus vo r dem2. W eltkrieg.H auptsäch lich K eram ikfunde der m ittleren und späten B ronzezeit, w enige hallstattzeitliche Scherben.
Kreuzlingen: A nschluss Süd - Erwin Rigert 117 M B Z - S B Z - R
B efunde und Funde im B ett des Saubachs B efunde und Funde im Junkholz B efunde und Funde im Schreckenm oos
Drei be ie inander liegende Fundste llen in le ichter Senke 500 m nordw estlich der K aserne B ernrain a u f 520 m ü. M.Funde der jü n g eren M itte lbronzezeit, der frühen Spätb ronzezeit und vereinzelte röm ische Scherben.Im Schreckenm oos ovale G rube, m öglicherw eise B randgrab , m it R esten e ines sekundär verbrannten röm ischen Tellers.
14 Inhalt und Zusammenfassung
Jüngere Fundstellen am Tägermoos
Zurück in der Ebene des Tägerm ooses 119 L T - R - F M A
G ottlieben: Rheinweg - Thom as Stehrenberger, Erw in R igert T ägerw ilen: Z ie g e lh o f - E rw in R igert T ägerw ilen: G rabfunde - E rw in R igert
Fundste lle am R heinufer a u f 398 m ü. M.Erster B eleg fü r eine spätkeltische S iedlung bei G ottlieben. W enige Funde des 2. und 1. Jhs. v. Chr. Z iegelhof: Fundste lle an k le iner Bucht. R öm ische Funde, da run te r M ünzen des späten3. und 4. Jhs. n .C hr. M öglicherw eise Schiffsanlegestelle .T ägerw ilen: D ie frühm ittelalterlichen G räberfe lder R üllensträsschen/B ahnlin ie SBB, Leberen- Schanz und R üselstrasse sind bereits früher an- gegrabcn worden. T rotz in tensiver Suche beim B au des Trassees der M ThB und d er Seetalstrasse keine N cufunde.
Hinterland von Konstanz 122 MA
T ägerw ilen: K onstanzerstrasse - E rw in R igert T ägerw ilen: Z o llbach - T hom as Specker Tägerw ilen: L ehm gruben im T ägerm oos - E. R igert
S trassenkoffer aus dem S pätm ittela lter und der frühen N euzeit. F ragm ente von H ufeisen , Huf- und S chuhnägeln usw.W asser fü r K onstanz. A b dem M itte lalter bezog d ie S tadt ihr T rinkw asser aus Fassungen südlich des T ägerm ooses. Z um T ransport d ienten T euchelleitungen.D ie S tadt besass R ech te am T ägerm oos, unter anderem auch zu r L ehm gew innung. D ie L ehm gruben füllte m an ansch liessend m it A bfallen auf. Im T ägerm oos befanden sich auch die W asenplätze und der G algen.
Anhänge
Katalog der Funde 125
Literaturverzeichnis 248
O rtsverzeichnis 251
Zusam m enfassung: deutsch, französisch, italienisch 252
Tabellen 14C-Daten aller Stationen 255
15
Bauleute und Archäologen
Nationalstrassenbau und Archäologie
Jost Bürgi, Kantonsarchäologe
Professoren und Laien
Nach der M einung vieler wird mit A rchäologie buchstäblich Geld verlocht und ganz sicher weder Weizen noch Wein produziert. Es erstaunt deshalb nicht, dass bis spät in die Fünfziger-, ja vielerorts bis weit in die Sechzigerjahre hinein die archäologische Forschung in der Schweiz schlecht und recht vor sich hin dümpelte. Die Archäologie hatte den Anstrich von etwas Elitärem, allenfalls auch Kuriosem. Und so waren denn die Vertreter dieser Sparte entweder studierte Professoren und M useum sleute oder dann zwar interessierte, meist aber etwas verschrobene Laien. N ur die wenigsten Kantone verfügten über Kantonsarchäologen, geschweige denn Kantonsarchäologinnen. A usgebaute archäologische Dienste im heutigen Sinne gab es nicht.
Auch wenn in den Universitätskantonen oft die Lehrstuhlinhaber und Sem inardirektoren und in K antonen m it grösseren, staatlichen oder privaten M useen die Konservatoren der ur- und frühgeschichtlichen Sam m lungen sich der archäologischen Betreuung ihres Gebietes annahmen, geschah dies imm er nebenher und zudem wegen der kargen Finanzen und der oft m angelhaften gesetzlichen Grundlagen in unbefriedigender Weise. M eist begnügte man sich mit Rettungsgrabungen oder beschränkte sich, und auch das nur selten, au f die Durchführung punktueller, isolierter Forschungsgrabungen. Die personell hoffnungslos unterdotierten Institutionen waren schlichtweg zu nichts anderem in der Lage.
Im Thurgau zog noch 1958 der seit 1923 m ehr ehren- als nebenam tlich tätige Karl Keller-Tarnuzzer als velom obiler Kantonsarchäologe und gleichzeitig gefürchteter Schul- inspektor seine Kreise, deren Wellenkraft m it zunehm ender Distanz von Frauenfeld abnahm (Abb. 1). In Zürich hatte im selben Jahr Walter Drack mit einer 50% -Stelle im Alleingang alle Belange der Kantonsarchäologie und der kantonalen Denkmalpflege abzudecken. So wundert es nicht, dass an eine system atische Prospektion im heutigen Sinne oder gar an präventive Untersuchungen nicht zu denken war.
Abb. 1: Karl K eller-T arnuzzer (1 8 9 0 -1 9 7 3 ), K antonaler K onservator und K antonsarchäologe von 1923 b is 1962. S ekretär der Schw eizerischen G ese llschaft fü r U rgeschichte von 1928-1956 .
Der Bund kommt ins Spiel
Mit der Hochkonjunktur und insbesondere mit dem beginnenden A utobahnbau erhielt die archäologische Forschung Auftrieb. 1960, vor gut 40 Jahren, em pfing der dam alige Vorsteher des Eidgenössischen Departem ents des Innern, Bundesrat Philipp Etter, die Professoren H.G. Bandi, Bern, R. Laur-Belart, Basel, M. R. Sauter, Genf, und E. Vogt, Zürich. Er Hess sich überzeugen, dass das grösste Bauvorhaben der Schweiz das kulturelle Erbe des Landes gefährde. A u f A ntrag Etters beschloss der Bundesrat an seiner Sitzung vom 13. M ärz 1961, es gehörten die A ufwendungen für die Ausgrabung, die Bergung oder die w issenschaftliche Auf-
16 Bauleute und Archäologen
nähm e historischer Funde im Trassee künftiger Nationalstrassen zu den Erstellungskosten der Strassen (Abb. 2).
Dieser Bundesbeschluss erwies sich in vielen Kantonen als eine Art G eburtshelfer beim Aufbau der kantonalen archäologischen Dienste. Allerdings konnten diese nicht einfach so aus dem Boden gestam pft werden, da dam als nur sehr wenig ausgebildetes Fachpersonal, d. h. Archäologen, Techniker oder Zeichner, rekrutierbar war. Um doch die notwendigsten Streckenbearbeitungen und G rabungen durchführen zu können, erhielt die Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte den Auftrag, au f Bundeskosten die Archäologische Zentralstelle für den Nationalstrassenbau AZN einzurichten. Nach gut eidgenössischem Brauch wurde die AZN einer Aufsichtskom m ission unterstellt, in welche das Bundesam t für Strassenbau, die Kantone und verschiedene Interessengruppen Vertreter abordneten. Die AZN versuchte m it sehr beschränkten M itteln die gestellte A ufgabe zu lösen. In der Regel wurde sie au f Verdacht hin tätig, vornehm lich an Stellen, die wegen ihrer topographischen Lage oder aufgrund früherer Entdeckungen fundträchtig waren. Eigentliche Prospektion, also aktive Suche nach neuen Fundstellen, gab es zwar auch, aber in weit geringerem Um fang als heute. So kann z. B. die völlige Fundleere zw ischen G enf und Lausanne, also au f einem der ältesten Teilstücke der A l, unm öglich der urgeschichtlichen Realität entsprechen. Sie ist das Resultat unterbliebener archäologischer Feldforschung.
Wohl nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen begann man Ende der 60er-Jahre die dem Strassenbau vorangehende Prospektion zu intensivieren. Als Erste sondierte Hanni Schwab, Kantonsarchäologin in Freiburg, nicht m ehr nur au f Verdacht hin, sondern legte au f dem ganzen Trassee in A bständen von 20 m Sondierschnitte. Sie erhielt ein viel präziseres Bild, und die Zahl an Neuentdeckungen nahm exponentiell zu, um gekehrt natürlich zugleich die Neigung, die entdeckten Kulturzeugnisse auch auszugraben. Diese flächendeckende Prospektion ist heute Norm. Die reichlich fliessenden Nationalstrassenm ittel erm öglichten den Kantonen, aufwändiger zu graben und zu dokum entieren, als das früher üblich war.
Als alter Hase - ich nahm 1967 als Vertreter des Kantons Nidwalden Einsitz in der Aufsichtskom m ission der AZN, meist N ationalstrassenkom m ission genannt, und bin, heute zwar als Vertreter des Thurgaus, längst am tsältestes M itglied - erlaube ich m ir die Bemerkung, dass bezüglich des A nspruchs- und Leistungsstandards und damit des Finanzbedarfs grosse, ja riesige regionale Unterschiede bestehen. Der Versuchung, mit Hilfe der N ationalstrassenm ittel m aximale statt optim ale Resultate anzustreben, sind einige Kantonsarchäologen nur zu gern erlegen. Einige archäologische Dienste wurden dabei so aufgebläht, dass m it dem
Rückgang der Bautätigkeit die Frage «das Ende des N ationalstrassenbaus, was nun?» zu einem Dauerbrenner an den Tagungen der Nationalstrassenkom m ission und des Verbandes Schweizerischer Kantonsarchäologen geworden ist.
Wir Thurgauer jam m ern da nicht mit, weil wir, abgesehen von einer kurzen Untersuchung zu Beginn der Siebzigerjahre, erst in den letzten drei Jahren für die Arbeiten au f dem Teilstück Schwaderloh - Landesgrenze N ationalstrassengelder beanspruchten und weder unseren Personalbestand au f Dauer erhöhten noch bei der Beschaffung und dem Ersatz unserer A usrüstung vom Strassenbau abhängig geworden sind. Trotz der thurgauischen Bescheidenheit beliefen sich die dem N ationalstrassenbau verrechneten A ufwendungen in den letzten drei Jahren au f insgesam t rund 720000 Franken.
Zusam m enfassend ist jedoch festzuhalten, dass die schweizerische und mit ihr, wenn auch als Trittbrettfahrerin, die thurgauische Archäologie von den je nach Rechnungsmodell zw ischen 220 und 250 M illionen Fr., die in unserem Lande in den letzten 40 Jahren für archäologische U ntersuchungen au f A utobahngebiet aufgewendet worden sind, gewaltig profitiert haben und profitieren. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel lösten einen vorher undenkbaren Technologieschub aus, das fachtechnische W issen wuchs exponentiell, und die für die Archäologen wichtigen naturw issenschaftlichen Disziplinen wie D endrochronologie, Geoelektrik, Paläobotanik, Paläozoologie usw. konnten entscheidend gefordert und erstm als in grossem M assstab eingesetzt werden. Der Gesam taufwand beläuft sich übrigens au f rund drei Promille der Baukosten, was dem europäischen Mittel, z. B. dem Aufwand der Franzosen beim Bau des TGV, entspricht.
Dank des Kantonsarchäologen
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die für unsere Anliegen Verständnis aufgebracht und unsere Arbeiten unterstützt haben, allen voran den Herren Regierungsrat Hans Peter Ruprecht, Kantonsingenieur Jürg Baerlocher, Nationalstrassenbauleiter Walter Ebinger sowie den am Bau beteiligten Ingenieurbüros und Baufirm en, aber auch allen Landwirten, die uns vor Beginn der Bauarbeiten den Zutritt zu ihren Liegenschaften erm öglichten. Ein besonderer Dank gilt Herrn Erwin Rigert und den M itarbeitern des Amtes für Archäologie, die bei Wind und Wetter nicht nur nach Fundstellen gesucht und sie entdeckt, sondern diese auch unter vorbildlicher Einhaltung der zeitlichen und finanziellen Vorgaben untersucht und dokum entiert haben.
Jost Bürgi, Kantonsarchäologe
Abb. 2: B undesratsbeschluss vom 13. M ärz 1961. ►
S I T Z U N G D E S S C H W E I Z E R I S C H E N B U N D E S R A T E SA U S Z U G A U S D E M P R O T O K O L L
S É A N C E D U C O N S E I L F É D É R A L S U I S S EE X T R A I T D U P R O C È S - V E R S A L
S E D U T A D E L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R OE S T R A T T O D E L P R O C E S S O V E R B A L E
Montag; 1 3 » März 1961.
N a t i o n a l s t r a s s e n / A r c h ä o lo g ie .
D epartem en t des I n n e r n . A n trag vom 3 0 . Dezember i9 6 0 ( B e i l a g e ) .J u s t i z - und P o l i z e i d e p a r t e m e n t . M i tb e r i c h t vom 6 . / 1 3 - F e b ru a r 1961
( B e i l a g e ) .D epartem en t des In n e rn . V ernehm lassung vom 9• März 1961 ( B e i l a g e ) .F in a n z - und Z o l ld e p a r te m e n t . M i tb e r i c h t vom 1 0 . J a n u a r 1961
(Einverstanden).Auf Grund ehr B e ra tu n g h a t d e r B u n d e s ra t
b e s c h l o s s e n :
1 . Die K osten d e r A usgrabung, d e r Bergung od e r d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Aufnahme ( F o to s , S k iz z e n , Verm essungen) h i s t o r i s c h e r Funde im T ra s s e k ü n f t i g e r N a t i o n a l s t r a s s e n s in d E r s t e l l u n g s k o s t e n d e r N a t i o n a l s t r a s s e n im S in n e von A r t i k e l 4 des B u n d e sb e sc h lu s se s vom 2 3 - Dezember 1959 ü b e r d ie Verwendung des f ü r den S t r a s s e n b a u bestim m ten A n te i l s am T r e i b s t o f f z o l l e r t r a g . Der Bund b e t e i l i g t s i c h an d ie s e n K osten aus N a t i o n a l s t r a s s e n k r e d i t e n im g l e i c h e n Umfange wie an den E r s t e l l u n g s k o s t e n des e n tsp re c h e n d e n N a t i o n a l s t r a s s e n z u g e s ü b e r h a u p t .
2 . Die K o n se rv ie ru n g , B e a rb e i tu n g und Aufbewahrung d e r Funde i s t d a gegen Sache d e r K antone.
An d ie K a n to n s re g ie ru n g e n d u rch P r o to k o l l a u s z u g i n 4 Exem plaren . ( D i s p o s i t i v ) .
An d ie S c h w e iz e r is c h e G e s e l l s c h a f t f ü r U r g e s c h ic h te , R heinsp rung 20 , B a s e l , d u rch P r o to k o l l a u s z u g i n 4 E xem plaren . ( D i s p o s i t i v )
P r o to k o l la u s z u g an das D epartem en t des In n e rn (Amt f ü r S t r a s s e n - und F lu s s b a u 6 , m i t den A kten , S e k r e t a r i a t des D ep artem en ts des I n n e r n ) , an das J u s t i z - und P o l i z e id e p a r t e m e n t und an das F in a n z - und Z o l ld e p a r te m e n t z u r K e n n tn is .
Für g e t r e u e n Auszug, d e r P r o t o k o l l f ü h r e r :
18 Bauleute und Archäologen
HP gebiet
«. ° v / “ ~
\ 1
g KONSTANZ& £: z*~Jl
n tilp n ,S‘ H
Sty-T & gerro ilén . M T h
R jL llen /
^LKllKUZ LINOENJ/o/Jbslrpss cjRòtf ' • 'mWB 4 * -Z/S/fil -Ar '
OberstròssS ^ ^ f S e ^KlLünjœlmoos
_ Castel
Kr-eiixliiiacn"'
Ri eiÀsberùf/l
i r e K m &
Türlix
■ Y'-''\Sc.hn
ïïÙfïjt) " " ^ N ë u W le W 8 a Eia@«^»i Hippishmcsert
i J p n t e r ^ W y
Abb. 3: N ationalstrasse A7. Von Schw aderloh-L andesgrenze: die letzten v ier Kilom eter. R eproduziert m it B ew illigung des V erm essungsam tes des K antons
Thurgau vom 28.05.2001.
Bauleute und Archäologen 19
Nationalstrasse A7. Von Schwaderloh zur Landesgrenze: Die letzten vier Kilometer
W alter Ebinger, Leiter N ationalstrassen, Tiefbauam t des Kantons Thurgau
Die A7 im Thurgau
Die Nationalstrasse A7 zweigt in Attikon bei W interthur von der A l ab und führt über Frauenfeld und M üllheim nach K reuzlingen bis zur Landesgrenze Schweiz/Deutschland. A uf deutscher Seite w ird die A7 durch die Bundesstrasse B33 abgenom m en, die von Konstanz nach Singen führt und dort den Anschluss an die Bundesautobahn A 8 1 S ingen -S tu ttga rt findet.
Die A7 wurde zwischen Attikon und Schwaderloh in den Jahren 1968 bis 1992 in Etappen gebaut. Mit dem Bau des Abschnittes von Schwaderloh bis zur Landesgrenze wird in den Jahren 1997 bis 2002 das letzte, vier Kilometer lange Teilstück der au f Thurgauer Boden liegenden, 30 Kilometer langen, vierspurigen und richtungsgetrennten Nationalstrasse realisiert (Abb. 4). Zum Projekt gehören der Anschluss Kreuzlingen Süd mit der Anschlussstrasse bis zur Bernrainstrasse,
der Anschluss Kreuzlingen N ord mit der A nschlussstrasse von der K onstanzerstrasse in Kreuzlingen bis nach Tägerwi- len, der 1750 M eter lange Girsbergtunnel, 12 Hektaren ökologische A usgleichsfläche sowie die Gem einschaftszollanlage Kreuzlingen/Konstanz. Damit w ird auch verständlich, warum die letzten vier K ilom eter mit rund 330 M illionen Franken beinahe gleich viel kosten wie die 375 M illionen teuren ersten 26 Kilometer.
Planung und Projektierung
Als anfangs der 60er-Jahre die ersten generellen Studien für die Anbindung der schweizerischen N ationalstrasse A7 an die deutsche Bundesstrasse B33 erstellt wurden, hätten wohl nicht einmal die unverbesserlichsten Pessimisten den Eröffnungsterm in der gesam ten Anlage erst im folgenden Jahrtau
Abb. 4: N ationalstrasse A7. A bschn itt Schw aderloh -L andesg renze . A ufnahm e D E S A IR AG , W erm atsw il/ Uster.
20 Bauleute und Archäologen
send vorausgesagt. Damalige «realistische» Schätzungen prognostizierten dieses Ereignis für die 70er-.lahre.
Nun, die W irklichkeit hat inzwischen gelehrt, dass Vorhaben dieser G rössenordnung ein G enerationenwerk darstellen. Von der Annahm e der neuen Verfassungsartikel durch Volk und Stände im Jahre 1958, die den Bund beauftragten, für die E rrichtung eines unter seiner O beraufsicht stehenden N ationalstrassennetzes zu sorgen, sowie der Festlegung des N ationalstrassennetzes durch die eidgenössischen Räte im Jahre 1960 bis zum Baubeginn vergingen rund 40 Jahre. Dem gegenüber ist die reine Bauzeit m it zwei bis fünf Jahren sehr bescheiden. Die folgende Tabelle (Abb. 5) fasst die lang währende Geschichte der Planungs- und Bauzeit zusammen.
Die Bauausführung
Nachdem das dam alige Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartem ent am 2. Juli 1997 das A usführungsprojekt genehm igt hatte, wurden bereits sechs Tage
später durch den Thurgauer Regierungsrat die ersten Bauarbeiten vergeben, und eineinhalb M onate später, Mitte August 1997, w urde mit der Ausführung der Bauarbeiten begonnen. Diesem enorm en Tempo musste sich natürlich auch das Amt für Archäologie anpassen, das auftragsgem äss säm tliche Baubereiche vorgängig nach archäologisch relevanten Spuren absuchen und A usgrabungen veranlassen musste. Das Bauprogramm basierte au f folgenden Eckdaten:
Baubeginn August 1999
Schw aderloh - A nschluss Kreuzungen Süd
Inbetriebnahme 0 4 .1 1 .1 9 9 9
A nschluss Kreuzungen Nord - Landesgrenze
Inbetriebnahme 2 0 .1 0 .2 0 0 0
Kreuzlingen Süd - Kreuzlingen Nord (Girsbergtunnel)
Inbetriebnahme Ende 200 2
1. Generelles Projekt 1:5000 V ernehm lassung Kanton Zustimmung Regierungsrat TG V ernehm lassung Bund G enehm igung Bundesrat
0 6 .0 1 .- 0 4 .0 2 .6 912 .08 .70
1 9 7 0 - 1 9 7 216 .08 .72
1. Ausführungsprojekt 1:1000 AuflageKeine Bereinigung der Einsprachen. Projekt sistiert.
2 2 .1 1 .- 2 1 .1 2 .7 6
Überprüfung von sechs Nationalstrassenstrecken, u.a.A7, Müllheim - Landesgrenze
Projektierungs- und BaustoppSchlussbericht NUP (20 :0 für A7) Nationalrat ( 1 1 6 :3 6 für A7) Ständerat (27 :1 für A7)
1 9 7 7 - 1 9 8 6 1982
März 86 S ept. 86
Volksabstimmungen im Kanton Thurgau
Volksinitiative zu einer Standesinitiative g eg en die A7. Abgelehnt 2 5 7 3 5 JA / 3 3 2 7 2 NEIN.
23 .1 0 .8 3
Volksinitiative zum Schutz d e s Kulturlandes und der natürlichen Landschaften vor übertriebenem Strassenbau (Kulturlandinitiative).Abgelehnt 1 7 4 9 0 JA / 2 4 9 5 4 NEIN.
24 .0 8 .8 6
2. Generelles Projekt 1:5000 V ernehm lassung Kanton Zustimmung Regierungsrat TG V ernehm lassung Bund G enehm igung Bundesrat
2 2 .03 . - 20 .0 4 .9 316 .08 .93
1 9 9 3 - 1 9 9 407 .0 9 .9 4
2. Ausführungsprojekt 1:1000 AuflageBehandlung Einsprachen (28) E insprachenentscheide B eschw erden Verwaltungsgericht (5) Rückzug B eschw erden VG G enehm igung Regierungsrat G enehm igung EVED (heute UVEK)
29 .0 . - 2 7 .0 6 .9 5 Juli 95 - April 96
15 .05 .96 Juni 96
Juli 96 - Febr. 970 8 .0 4 .9 70 2 .0 7 .9 7
Bauausführung BaubeginnBauausführung
August 97 1 9 9 7 - 2 0 0 2
Verkehrsübergaben A7, Schw aderloh - A nschluss Kreuzlingen SüdA7, A nschluss Kreuzlingen Nord - L andesgrenze inkl. GZAA7, Kreuzlingen Süd - Kreuzlingen Nord (Girsbergtunnel)
0 4 .1 1 .1 9 9 92 0 .1 0 .2 0 0 0 Ende 2002
Abb. 5: N ationalstrasse A 7. M ehr als 30 Jahren P lanung stehen 2 - 5 Jahre B auzeit gegenüber.
Bauleute und Archäologen 21
% -
A bb. 6: N ationalstrasse A 7. G irsbergtunnel, A usbruch der K alo tte m it der Teilschnittm aschine. Im First ist der P ilo tsto llen erkennbar. A ufnahm e E lectrow att E ng ineering AG , B au leitung G irsbergtunnel.
Schwaderloh" Anschluss Kreuzlingen Süd
Der Abschnitt Schwaderloh - Anschluss Kreuzlingen Süd um fasst nebst dem 700 m langen A7-Trassee im W esentlichen den Anschluss K reuzlingen Süd m it der 600 m langen Anschlussstrasse bis zum Kreisel au f der Bernrainstrasse, die 50 m lange W ildbrücke Junkholz, die Verlegung der Saubäche Ost und West au f einer Länge von 1900 m, zwei Störfall- und Speicherbecken für die Autobahnentwässerung sowie die 12 Hektaren grosse ökologische Ausgleichsfläche Schreckenm oos m it einem Rückhaltebecken und Ersatzlaichgewässern.
D er A bschnitt Schwaderloh bis zum Anschluss K reuzlingen Süd wurde am 4. November 1999 in Betrieb genom men.
Girsbergtunnel
Der Girsbergtunnel bildet mit einer Länge von 1750 m einen w ichtigen Bestandteil des letzten A7-Teilstückes. Das maximale Gefälle beträgt 5,5 Prozent, damit wird die H öhendifferenz von 84 m zwischen den beiden Tunnelportalen au f dem Seerücken und bei der Unterseestrasse überwunden. Die 80 m lange Tagbaustrecke Süd und die 1200 m lange Untertagbaustrecke bestehen aus zwei Doppelspurröhren, die 470 m lange Tagbaustrecke Nord aus einem Zw illings
gewölbe. Die U ntertagbaustrecke liegt geologisch zur Hauptsache in der oberen Süsswasserm olasse, bestehend aus einer W echsellagerung von Sandsteinen, Mergeln und Kalken. Das darüber liegende Lockerm aterial besteht im W esentlichen aus M oränenmaterial.
Die beiden Tagbaustrecken N ord und Süd wurden konventionell erstellt. Die U ntertagbaustrecke wurde im W esentlichen von Süden nach N orden fallend vorgetrieben, um die Anwohner im Siedlungsgebiet im Norden vor Immissionen zu schützen. Die Durchörterung der Lockergesteinsstrecke Süd erfolgte in kleinen Etappen im Schutze eines Jetting- gewölbes, einer Bauhilfsmassnahme, bei welcher der Boden um das Tunnelgewölbe vorgängig mit H ochdruckinjektionen verfestigt wurde. Bei der Lockergesteinsstrecke N ord wurde als Bauhilfsm assnahm e ein Rohrschirm erstellt. In der Felsstrecke der W eströhre wurde in einer ersten Phase mit einer Tunnelbohrm aschine ein Pilotstollen von 4,00 m D urchm esser aufgefahren. D ieser diente der detaillierten Erkundung der Geologie, der Bergwasserdrainage und der Belüftung für den weiteren Ausbruch. D er Tunnelausbruch erfolgte im K alottenvortrieb mit anschliessendem Strossen- und Sohlenabbau. Das kom pakte M oränenm aterial und der M olassefels wurden m it einer Teilschnittmaschine abgetragen (Abb. 6). Zur Sicherung des A usbruchprofils wurde neben A nkern und G itterträgern nach jedem Abschlag ein 20 bis 25 cm starkes Spritzbetongewölbe aufgebracht. Das anfallende Aus-
22 Bauleute und Archäologen
A bb. 7: N ationalstrasse A7. K reisel A nsch luss K reuzlingen N ord, im H in tergrund d ie G em einschaftszo llan lage. A ufnahm e C hristian H errm ann , Frauenfeld.
bruchm aterial w urde in die Deponie bei Lamperswil transportiert. A nschliessend wurden die Innengewölbe betoniert und der Innenausbau erstellt. Die technische Erschliessung erfolgt von je einer Portalstation bei den Tunnelportalen. Im A bstand von rund 300 m gewährleisten Querverbindungen den für die Sicherheit erforderlichen D urchgang zwischen den beiden Röhren. Die Q uerverbindung in Tunnelmitte ist für E insatzfahrzeuge befahrbar, vier weitere sind begehbar.
Anschluss Kreuzlingen Nord - Landesgrenze
Abb. 8: N ationalstrasse A7. G em einschaftszo llan lage K reuz lingen /K on- stanz, F ahrbahnüberdachung R eisendenverkehr, G ebäude W aren- und R eisendenverkehr. A ufnahm e C hristian H errm ann , Frauenfeld.
Ab dem Portal Nord des Girsbergtunnels befindet sich die A7 bereits im Tägerm oos. Das Tägerm oos ist geologisch gekennzeichnet durch bis zu 50 m mächtige, weiche, mit zunehm ender Tiefe in breiige Konsistenz übergehende Seebodenlehme. Der Seebodenlehm weist eine geringe Scherfestigkeit, sehr schlechte W asserdurchlässigkeit und grosse Setzungsem pfindlichkeit auf, ist also ein denkbar schlechter Baugrund.
Die Teilstrecke Anschluss Kreuzlingen N ord bis Landesgrenze um fasst nebst dem A7-Trassee die G em einschaftszollanlage Kreuzlingen/K onstanz (Abb. 8), den Anschluss Kreuzlingen N ord mit der Anschlussstrasse zwischen K reuzlingen und Tägerwilen, die A ufhebung der Bahnübergänge an der K onstanzerstrasse in Kreuzlingen und in Tägerwilen durch Unterführungen sowie den neuen Saubach im Täger-
Bauleute und Archäologen 23
moos. Der Anschluss Kreuzlingen Nord ist als Kreisel au f der A7 ausgebildet, der über eine Spange m it einem weiteren Kreisel au f der Anschlussstrasse verbunden ist (Abb. 7).
Der A bschnitt vom Anschluss K reuzlingen Nord bis zur Landesgrenze m it der G em einschaftszollanlage und der Seetalstrasse wurde zusam m en mit der deutschen Bundesstrasse B33 von der Landesgrenze bis zur Schänzlebrücke über den Rhein und der Grenzbachstrasse am 20. Oktober 2000 in Betrieb genommen.
Schlussbetrachtung
Im A ugust 1997 w urden die Bauarbeiten am letzten Teilstück der N ationalstrasse A7 zwischen Schwaderloh und der Landesgrenze bei K reuzlingen/Konstanz in A ngriff genom men. Ende 2002 wird dieser v ier K ilom eter lange, m it einem finanziellen Aufwand von 330 M illionen Franken erstellte Abschnitt durchgehend befahrbar sein. Damit endet eine rund vierzigjährige Planungsgeschichte in einer landschaftlich reizvollen, sehr sensiblen Gegend. Durch eine die Landschaft schützende Wahl der Trassierung mit dem 1750 m langen Girsbergtunnel, durch das Entwässerungskonzept mit offenen Störfall- und Speicherbecken, die um fangreichen ökologischen A usgleichsm assnahm en, die W ildbrücke Junk- holz, die an die bestehenden Strukturen im Tägerm oos angepasste, sehr kompakt gebaute Gem einschaftszollanlage
sowie naturnah erstellte neue Bäche ist ein N ationalstrassenbauwerk entstanden, welches die Eingriffe in die Natur akzeptieren lässt.
D er Weg von den ersten Planungen und Projektierungen bis zur Ausführung und Inbetriebnahme war lang und schwierig. Die Aufgabe, ein Werk von dieser G rössenordnung und Kom plexität zu verwirklichen, bedeutete jedoch für alle Beteiligten eine äusserst interessante und faszinierende Herausforderung. An dieser Stelle sei auch dem Amt für Archäologie mit seinen M itarbeiterinnen und M itarbeitern herzlich für ihren Beitrag an «unsere» A7 gedankt. Die Zusam m enarbeit war jederzeit unkom pliziert, kollegial und der Sache dienlich. Es ist das Verdienst der Archäologen, bei vielen M itarbeitenden von Ingenieurbüros, Bauunternehm ungen, Ä m tern und Behörden das Interesse an geschichtlichen Zusam m enhängen geweckt zu haben!
24 Bauleute und Archäologen
Wer sucht, der findet!
Hansjörg Brem, Adjunkt Amt für A rchäologie, Projektleiter
Alles Zufall?
Die häufigste Frage von Besucherinnen und Besuchern au f unseren G rabungen au f der Autobahn war: W ie wusstet ihr eigentlich, dass ihr hier etwas findet? Und darauf folgte gleich die Feststellung, es sei doch m erkwürdig, dass im Thurgau ausgerechnet au f den letzten paar A utobahnkilom etern so viel zum Vorschein komme, während früher au f all den vielen Kilometern von A l und A7 nichts gefunden worden sei. Die Antwort ist einfach: Es wurde dam als nicht gesucht.
Jost Bürgi hat bereits darauf hingewiesen, dass sich M ethoden und Rahm enbedingungen für archäologische Untersuchungen beim A utobahnbau in der Schweiz unterschiedlich entwickelt haben. Im Gegensatz zu anderen Landesteilen war im Thurgau der Aufbau des archäologischen Dienstes nicht eine Folge des A utobahngesetzes. Der Kanton verfügte in der Person von Karl Keller-Tarnuzzer bereits 1923 über einen Kantonsarchäologen. Dieser baute das Fundstellenarchiv au f und förderte als Sekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte mit vielen Zeitungsartikeln, Radiobeiträgen und Führungen das Interesse an der Ur- und Frühgeschichte im Kanton und in der ganzen Schweiz.
Die Pensionierung Kellers in den frühen Sechzigerjahren fiel in eine Periode zunehm ender Bautätigkeit. Staatsarchivar Bruno Meyer, dem als M useum sdirektor dam als auch der Kantonsarchäologe unterstand, liess die dringendsten N otgrabungen von Aushilfen ausführen. Eine konsequente Überwachung der Bauarbeiten au f den thurgauischen Abschnitten der A l war so nicht möglich. 1967 wurde die Kantonsarchäologenstelle m it M adeleine Sitterding neu besetzt. Dank ihrem W irken erhielten die Anliegen der Archäologie bei der Nationalstrassenplanung m ehr Gewicht. 1972/1973 erfolgten Grabungen au f dem Schlossbühl bei Kreuzlingen.
Wer sucht, der findet!
Als Jost Bürgi im April 1973 M adeleine Sitterding ablöste, kannte man kaum m ehr Fundstellen als bereits Keller- Tarnuzzer. Wie fast überall in der Schweiz gab es im Thurgau kein Konzept für eine system atische archäologische Prospektion. Es fehlten auch die Mittel und die Zeit dazu. Man beschränkte sich au f N otgrabungen und die Untersuchung gefährdeter Objekte. Grabungen, wie etwa au f dem Hügel Waldi bei Toos, Gemeinde Schönholzerswilen, waren an sich zu gross für das personell schwach ausgestattete Büro des Kantonsarchäologen.
Die Suche nach archäologischen Fundstellen mit m odernen M ethoden setzte Ende der Siebzigerjahre mit der A ufnahme des Ist-Zustandes von Wall- und Grabenanlagen
sowie Burgstellen ein. Am Bodensee suchten Josef W iniger und Albin Hasenfratz 1980 - 1982 erstm als seit fast hundert Jahren w ieder nach Spuren prähistorischer Ufersiedlungen. 1982 liefen die Arbeiten am Inventar H istorischer Verkehrswege an, einem Projekt, das w ir im Thurgau ab 1987 mit der gleichzeitigen Kartierung von Burgstellen, Köhlerplätzen, Terrassierungen und W ölbäckern ergänzten. 1988 kam der Wechsel von der bedarfsweisen zur system atischen Prospektion aus der Luft und schliesslich 1995 die Begleitung des Baus der Gasleitung B ischofszell-W interthur. A llein au f diesem schm alen Streifen wurden über zehn neue Fundstellen entdeckt, die meisten in Gegenden, wo bis anhin keine archäologischen Funde bekannt waren (Abb. 9).
A uf dem Trassee der A7 von der zürcherischen Grenze bis Schwaderloh beschränkten sich die Prospektionsarbeiten zu Beginn der Siebzigerjahre au f Begehungen und wenige M assnahm en. A ufgenom m en wurden W ölbäcker im Raum Engwilen und bronzezeitliche G ruben bei W igoltingen (Abb. 10). Beim Bau der U m fahrung von Arbon, dem «Sauschwänzli» der A l, kam en trotz intensiver Über-
Abb. 9: G asle itung B isch o fszell-W in te rth u r 1995. In der P rofilw and R este von Feuerstellen.
Abb. 10: N ationalstrasse A 7 nördlich von W igoltingen 1990. In der B öschung bronzezeitliche G ruben.
Bauleute und Archäologen 25
mm
Abb. 11: N ationalstrasse A 7. O berflächenprospek tion im F rüh jahr 1997.
wachung keine Spuren der römischen Strasse P fy n -A rb o n zum Vorschein.
Die Bevölkerung macht mit
Ab Ende der Siebzigerjahre standen etwas m ehr Mittel und Personal zur Verfügung. Das Interesse der Bevölkerung an der Archäologie wuchs, sie begann, sich in der Freizeit damit zu beschäftigen und den Kontakt zu Fachleuten zu suchen. Die Resultate waren überraschend: der Luzerner Ruedi M ichel z.B. entdeckte bei system atischen Begehungen im Seebachtal Lagerplätze aus der Zeit von ca. 8500 bis 5500 v.Chr., womit sich die Zahl nachgew iesener m ittelsteinzeitlicher Fundstellen im Thurgau innert weniger Jahre verzehnfachte.
Das Amt für Archäologie erhielt 1996 mit dem neuen M useum in Frauenfeld ein Schaufenster, welches die Information der Bevölkerung erleichtert und das Interesse an der Bodenforschung fordert. A nlässlich der jährlich durch- geführten M useum sbestim m ungstage erhält das Amt auch Kenntnis von bis anhin privat gehüteten Fundstücken.
Mit dem Unbekannten rechnen
Wie Walter Ebinger in seinem Artikel schildert, dauerte das Ringen um den Baubeginn der A7 Jahre. D ies erlaubte
uns, von den Erfahrungen anderer Kantone zu profitieren und geeignete Prospektionsverfahren auszuwählen.
Als die Linienführung feststand, begannen wir im August 1996 mit der Begehung des Trassees. Neben der Ü berprüfung von angeblichen Funden aus früheren Zeiten galt es, das Gelände auf seine «Fündigkeit» hin zu bewerten (Abb. 11). Schliesslich waren für das Tiefbauam t ein M assnahm enkatalog und ein Budget zu erstellen.
Frühere Seeufer, sanfte, landwirtschaftlich genutzte Hangterrassen und das Vorgelände der Stadt Konstanz stuften w ir als archäologische Risikozonen ein. A n anderen Orten, z.B. in den W aldgebieten bei Schwaderloh, verfügten wir über praktisch keine A nhaltspunkte; neu war die Beschäftigung mit m ilitärischen Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Schlecht beurteilen Hessen sich Bereiche, die nicht direkt vom Strassenbau, sondern von dam it verbundenen U m gebungsarbeiten, Güterzusam m enlegungen, Deponien usw. betroffen waren. H ier ereignete sich auch die erste Panne: M it einer kurz hingetraxten, ungeplanten Waldstrasse wurde der Schlossbühl bei Kreuzlingen unnötig beschädigt (Abb. 12). Immerhin förderte die folgende Diskussion die Zusam m enarbeit mit den Planungsorganen ungemein.
M it der M ittelthurgaubahn, die in Abstim m ung mit den Strassenbauern ihre Geleise verlegte, gab es zu Beginn einige Probleme. Ohne unser W issen wurden Baupisten gebaut und andere Eingriffe gemacht. Nur im Bereich T ägerw ilen -T ägerm oos waren rechtzeitige Sondierungen möglich.
26 Bauleute und Archäologen
A bb. 12: K reuzlIngen: Schlossbühl. B eim B au e iner W aldstrasse w urde im S om m er 1996 ein Teil der W älle unbeobach tet abgetragen.
Die Arbeiten im Zusam m enhang mit dem Strassenbau begannen m it der U m legung von W aldwegen. Die Resultate unserer ersten Feldbegehungen waren unterschiedlich: Sondierungen um Bernrain waren ernüchternd anders dagegen die Begehungen im Tägerm oos und au f den Hangterrassen im Frühjahr 1997. Die A uswertung alter und neuer F lugaufnahm en brachte wenig. Archivalien im Stadtarchiv Konstanz bestätigten die Vermutung, dass mit Resten der m ittelalterlichen W asserleitungen der Stadt im Tägerm oos zu rechnen war.
A bb. 14: Tägerw ilen: A R A -Strasse. R obert K önig, L andw irt in T ägerw ilen , en tdeck te S teinw erkzeuge a u f seinem Acker. D ie K ulturschicht ist verpflügt.
A bb. 13: «M iste r A utobahn» E rw in R igert und A llrounder A ntonio G iannuzzi.
Rasch w ar klar, dass nur eine enge Begleitung der Bauarbeiten zum archäologischen Erfolg und vor allem zu wenig Reibungen m it anderen Interessen führen konnte. Die Hoffnung, dass es dem im Som m er 1997 angestellten A rchäologen Erwin Rigert als «M ister A utobahn» gelingen würde, Konflikte gering und die Ausbeute gross zu halten, wurde nicht enttäuscht (Abb. 13). Seine Aufgabe war nicht leicht: Die strengen Budgetlim iten der A m tsleitung au f der einen und die ständig steigende Fundm enge au f der anderen Seite waren schwer in Einklang zu bringen. Erfreulich war die Begeisterung der M itarbeiterinnen und M itarbeiter sowie die Unterstützung durch Landbesitzer, Firm en und Einzelpersonen (Abb. 14). Dies erleichterte unsere Arbeit vor allem in den W intermonaten: So erlaubten die Familien Onken und Binswanger die Benützung ihrer sanitären Anlagen und ermöglichten Strom- und W asseranschlüsse.
Erwin Rigert begann im August 1997 mit Baggersondierungen im Raum Schwaderloh. Relativ rasch konnte ein Einblick in den Boden gewonnen und auch die Schichtenbildung verstanden werden.
Die vielen «M aulwurfshaufen» in der W aldschneise bei Schwaderloh erregten am A nfang da und dort Stirnrunzeln (Abb. 15), doch Erwin Rigert fand nicht nur Spuren der ersten Bauern in der Gegend, sondern schaffte es auch, aus diesen Spuren den anderen Teams au f dem Trassee eine lebendige Geschichte zu erzählen. Prompt m eldeten in der Folge Bauarbeiter ihre Beobachtungen: So entdeckten M itarbeiter der Firm a Geiges die m ittelbronzezeitliche Siedlung beim Saubach.
Die Begleitung der Bauarbeiten zeigte Erfolg: Im Septem ber 1997 wurde bei Tägerwilen die Fundstelle Hochstross und im Novem ber bei Kreuzlingen die Station Töbeli entdeckt.
Vom August 1997 bis in den Spätsom m er 1999 waren Erwin Rigert und sein Team ununterbrochen im Raum K reuzlingen-Tägerw ilen tätig. Oft liefen gleichzeitig zwei grössere Grabungen und m ehrere baubegleitende A bklärungen. Die knapp kalkulierten Mittel erlaubten es nicht, eine grössere Equipe ständig zu beschäftigen: So wechselten M itarbeiterinnen und M itarbeiter häufig. Der besondere Einsatz aller Beteiligten wog diesen Nachteil aber auf. Gerne gaben die M itarbeiter Schulklassen und Passanten Auskunft über den Stand der Arbeiten.
Bauleute und Archäologen 27
Abb. 15: N ationa lstrasse A7. W ildenw is-Junkholz , Schw aderloh: «M aulw urfshaufen».
Aufwand...
Die A ufwendungen von rund Fr. 720000 - für die G rabungen au f N ationalstrassengebiet und deren Dokum entation gingen zu Lasten des Baubudgets. Die Arbeiten au f dem Bahntrassee und au f weiteren Flächen ausserhalb des Strassenperim eters mussten aus den ordentlichen M itteln des Am tes finanziert werden. Schwer zu beziffern sind die Leistungen, die von Personen aus Einsatzprogram m en für Stellenlose und Zivildienstleistende erbracht wurden.
...und Ertrag
Es war zu erwarten, dass beim Strassenbau archäologische Funde zum Vorschein kommen würden. Erstaunlich war
weniger die M enge der Funde als deren zeitliche Verteilung. Gut vertreten waren erfreulicherweise bis anhin im Thurgau schlecht bekannte Epochen wie das M esolithikum und die m ittlere Bronzezeit. Die sonst überall präsenten Röm er hin- terliessen dagegen wenige Spuren.
Die Arbeiten au f der Autobahn machen deutlich, dass in den m eisten Gegenden des Thurgaus m it einer dichten Folge von Fundstätten zu rechnen ist. Das Amt für Archäologie kann leider nur einen Bruchteil davon bergen und dokum entieren.
N ach drei Jahren intensiver Arbeit au f der A utobahn stellt sich die Frage, was denn nun als vernünftiges Mass an archäologischer Forschung zu gelten habe. Neben politischen Beurteilungen, die bisweilen zwischen Extrem en schwanken, gibt es objektive Faktoren. Für uns ist dabei heute das Kriterium entscheidend, ob die ausgegrabenen und damit angehäuften Inform ationen über die Vergangenheit überhaupt noch bewältigt werden können. Bewältigen heisst: Restaurieren, katalogisieren, aber auch dem Publikum zugänglich machen. Die an den Feldarbeiten Beteiligten sollten ihre Sicht der Dinge bei der Auswertung und Publikation einbringen können. Wenn dies gelingt, ist ein wichtiges Ziel erreicht.
Je m ehr gebaut wird, desto m ehr Zeugen der Vergangenheit gehen unbeobachtet verloren. Der R uf nach m ehr M itteln zur Erforschung und Erhaltung unserer Kulturgüter genügt nicht. G efordert ist in erster Linie eine offene Diskussion über die Bedeutung unserer Geschichte für unser tägliches Leben.
28
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
Diverse Autoren, siehe Inhaltsverzeichnis
W ichtige Resultate vorneweg
Wir wollen und können hier nicht eine Ur- und Frühgeschichte der Region Kreuzlingen schreiben, vielm ehr versuchen wir, im Folgenden einen Überblick über die letzten 10000 Jahre in einem eng begrenzten Gebiet zu geben, das nicht aus wissenschaftlichen Überlegungen als Untersuchungsobjekt gewählt worden ist, sondern einzig deshalb, weil man hier die Nationalstrasse A7 baut. Im ersten M oment scheint dieser Grund für archäologische Interventionen etwas dürftig. Die Resultate zeigen aber, dass sie sich lohnten.
W ir stützen uns hauptsächlich au f die archäologischen Befunde und Funde, nur im Falle der spätm ittelalterlichen und neuzeitlichen W asserleitungen und Strassen ziehen wir in beschränktem Um fang auch schriftliche Quellen bei.
Was die Siedlungsgeschichte der vorröm ischen Epochen betrifft, sind die Flauptresultate der Grabungen au f Autobahngebiet in Abb. 16 schem atisch dargestellt:
1. In der M ittelsteinzeit (M esolithikum ) war der See breiter und reichte ungefähr bis zur 400-m -Höhenkote.
Am Ufer dieses Sees lagerten zwischen 8000 und 5000 v.Chr. Jäger- und Sammlergruppen.2. In der Jungsteinzeit (Neolithikum ) ab etwa 4500 v.Chr. verlandeten Teile des Sees, und es bildete sich das Täger- moos. An seinem Rand entstanden Dörfer, und man begann, die Hangterrassen zu roden.3. In der Frühbronzezeit und der frühen M ittelbronzezeit wurde an ähnlichen Lagen gesiedelt wie in der Jungsteinzeit.4. Ab etwa 1450 v.Chr., d.h. ab der späten M ittelbronzezeit, wurden auch die Höhen besiedelt.5. In der Spätbronzezeit war das Tägermoos trockener und besser begehbar, was ab etwa 1200 v. Chr. den Bau von Siedlungen am Untersee und im Konstanzer Trichter erlaubte.6. Dank den A utobahngrabungen ist die Zahl hallstatt- und latènezeitlicher Fundstellen wesentlich gestiegen. Erstmals konnte im Thurgau Drehscheibenware aus der M itte des 5. Jhs. v.Chr. nachgew iesen werden.
Zelte am alten Seeufer
Unser U ntersuchungsgebiet und mit ihm grosse Teile des heutigen Thurgaus waren zwischen 25000 und etwa 17000 Jahren vor heute eisbedeckt. Zwar lag dam als der eine oder andere Höhenzug aper, und es lässt sich nicht ausschliessen, dass es eiszeitliche Jägergruppen au f ihren Streifzügen zeitweilig dorthin verschlug. Spuren dieser M enschen sind aber bis anhin nicht entdeckt worden.
Erst aus der Zeit nach dem Zurückweichen des Eises, das heisst aus dem M esolithikum, das zwischen 8000 und 5000 v.Chr. anzusetzen ist, stammen die ältesten bei uns gefundenen Steingeräte. Sie gingen bei der Jagd verloren oder wurden an den Rastplätzen liegen gelassen (Abb. 17).
Die Leute hatten es dam als nicht leicht. Sie waren gezwungen, im Laufe der Jahreszeiten ihre Lagerplätze ständig zu verlegen, um das A ngebot an Jagdwild und Sammelpflan- zen1 nutzen zu können (Abb. 18). Ein Vorteil war sicher, dass in der Bodenseeregion die Vegetationstypen rasch und kleinräum ig wechseln. Der See und die Ufergürtel erlaubten den Fischfang und die Jagd au f W asservögel, die M oränenzüge im hügeligen, von Hasel- und Eichenm ischw äldern bedeckten Hinterland die Jagd au f Hirsche, Rehe, W ildschweine, Auerochsen und andere Säugetiere.
Nach dem Ende der letzten Eiszeit sanken die Seespiegel kontinuierlich. Die ehem aligen W asserstände und Uferlinien lassen sich am Bodensee anhand von Sedim entuntersuchungen an alten Strandwällen, Uferterrassen und in Verlandungszonen zeitlich einordnen.2 Vor ca. 11 000 Jahren waren weite Teile des heutigen Tägerm ooses noch nicht verlandet. Im frühen M esolithikum reichte der See - oder zum indest einzelne Seearm e - nach 14C-datierten Sedimenten noch bis zur 400-M eter-Höhenlinie; heute liegt der Seespiegel mit einer mittleren Höhe von 396 m ü.M . rund 4 m tiefer, kann aber, wie das Hochwasser von 1999 gezeigt hat, kurzfristig bis a u f 398 m ü.M . steigen.
Als Beispiel für die fortschreitende Verlandung sei Kreuz- lingen-Töbeli erwähnt. W ir trafen dort a u f Seeablagerungen aus der Zeit um ca. 7500 v.Chr., während die ältesten datierbaren Verlandungssedimente aus der Zeit vor 5000 v.Chr. stammen.
Neben den alten Uferlinien und Strandwällen dokum entiert auch die Lage der mesolithischen Fundstellen den ehem aligen U ferverlauf (Abb. 16-17). Man lebte vom Fisch-1 H aas u. H adorn 1998. 223.2 Schlichtherle 1985, 23, Schlichtherle 1994, 64: 1994.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 29
Süd Nord|6 km1 km 2 km 3 km 4 km
500 m
400 m
altes Seegebiet Untersee / RheinM ittelste in zeit / M esolithikum
500 m ____
• •Untersee / Rhein
J u n g ste in z e it / N eolithikum
500 m ____
Untersee / Rhein■ S p ä te F rühbronzezeit / Frühe M ittelbronzezeit
500 m
400 m ____
Untersee / RheinS p ä te M ittelbronzezeit
■ Siedlungen
e Einzelfunde
Rodungszeiger
500 m ____
400 m ____
Untersee / RheinS p ä tb ro n zez e it
|3 km 4 km1 km 2 km
Abb. 16: Idea lp rofil vom U ntersee und R hein zum Seerücken. D ie Fundste llen der M itte lste inzeit lagen am ehem aligen Seerand. In der Jungste inzeit w urden angrenzende M oränen terrassen gerodet; d ie D örfer fanden sich am R and des T ägerm ooses, w ie später auch je n e der jü n g eren Frühbronzezeit und älteren M itte lbronzezeit. D as anste igende H in terland w urde erst ab der späten M itte lb ronzeze it besiedelt.
30 Vom Untersee zum Seerücken -1 0 000 Jahre Siedlungsgeschichte
Abb
. 17
: M
ittel
stei
nzei
tlich
e Fu
ndst
elle
n. '
Täg
erw
ilen
Unt
erfü
hrun
g AR
A St
rass
e,
2Kre
uzlin
gen
Töb
eli,
3
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 31
Abb. 18: M eso lith ischer Z e ltp la tz nach e inem M odell im M useum für U rgeschichte Zug. A ufnahm e R es E ichenberger.
fang und bevorzugte deshalb für Lagerplätze die Uferzone. A u f deutscher Seite sind diese heute zum Teil einige hundert M eter vom Ufer des Bodensees zurückversetzt. Besonders gut lässt sich dies in der Radolfzeller Bucht beobachten. Die dortigen Siedlungsstellen befinden sich au f einer Höhe von 398 bis 400 m ü.M .; ihre Lage zeichnet sehr eindrücklich die Uferlinie in der Zeit von 9000 bis 5500 v.Chr. nach.3
A uf Schweizer Seite waren bis zu unseren U ntersuchungen nur wenige Fundstellen aus dieser Zeit bekannt, so bei Kreuzlingen-Helebarden-Fischerhaus und beim G eleisedreieck bei Kreuzlingen (Abb. 17, 3, 4). Beide sind in den 1930er-Jahren vom Konstanzer Alfons Beck entdeckt und beschrieben worden.4
Dank den Arbeiten an der A7 konnten die früheren Beobachtungen verifiziert und ergänzt werden. Beim Bau der U nterführung ARA-Strasse in Tägerw ilen und im Töbeli (Abb. 17, 1, 2) wurden zwar keine als solche erkennbare Lagerplätze, wohl aber M ikrolithen, winzige Steingeräte aus dem M esolithikum , entdeckt. Diese Einsätze von G eschossspitzen sind oft kaum grösser als ein Daumennagel. Keramische Gefässe gab es im M esolithikum noch nicht.
Bis vor kurzer Zeit waren im Kantonsgebiet nur Fundstellen des frühen M esolithikum s, also der Zeit von ca. 9000 bis 7000 v.Chr., bekannt geworden, darunter insbesondere jene im Seebachtal5. Den N euentdeckungen bei Kreuzlingen und Tägerwilen kom m t eine besondere Bedeutung zu, weil sie sich zeitlich recht zuverlässig einordnen lassen. Zeitgleich zu den Seebachtalfunden ist das Fundinventar von
der Unterführung ARA-Strasse in Tägerwilen: alles Feuerstein/Silexartefakte, darunter Rückenm esserchen, Stichel und ausgesplitterte Stücke (Abb. 19 und 20). Demgegenüber kann die Fundstelle Töbeli als erste au f Kantonsgebiet ins späte M esolithikum, also in die Zeit um 6000 v.Chr., datiert werden. Charakteristisch für diese Zeit sind trapezförm ige M ikrolithen.6
Schlich therle 1985, 39, Abb. 4; Sch lich therle 1994, 48. TB 69, 1932, 118; L euzinger 1997 ,43 .L euzinger 1997. 45.Taute 1977, 19.
Abb. 19: T ägerw ilen: U nterführung A R A -Strasse.K erbreste (M 3:1), A bfallp roduk te bei der H erstellung von R ückenlam ellen . M esolith ikum .
Abb. 20: T ägerw ilen: U nterführung A R A -Strasse. M eso lith ische S tichel aus Silex zu r B earbeitung von G eweih und H olz (M 2:1).
32 K;/h Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
Das spärliche Fundmaterial lässt vermuten, dass sich die M enschen im M esolithikum nicht lange au f den heute ARA und Töbeli genannten Arealen, dam als seenahe Auenland- schaften, aufhielten. A uf ihren Rastplätzen hinterliessen die Jäger- und Fischergruppen kaum Siedlungsspuren. Die alten Geh- und Tram pelhorizonte wurden in der Folgezeit nur ge
ringfügig überdeckt. M echanische Veränderungen, sei es durch Wasser, Wind und Wetter, spätere Siedlungstätigkeit oder Ackerbau, zerstörten sie. So zeugen nur spärliche Werkzeuge und einige hitzeversehrte Steine von der Anwesenheit und den Tätigkeiten der m ittelsteinzeitlichen Bewohner dieser Gegend.
Die ersten Bauern am Tägerm oos
Das Tägermoos verlandet
In der M itte des 6. Jahrtausends v.Chr. wechselte au f den guten Böden nördlich des Rheins und des Untersees die W irtschaftsform von Sammeln und Jagen zu Ackerbau und Viehzucht. Man begann zu produzieren! Die Entw icklung des Bauerntum s bedingte Rodungen, führte zur Sesshaftigkeit und damit zum Bau von D örfern.7 Die Kultur dieser ersten Landwirte nennt man nach den Verzierungen au f den Tonge- fässen Linearbandkeramik.
In der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends v.Chr. wurden auch die Gebiete südlich des Bodensees und des Untersees langsam zum Bauerngebiet. Ä lteste Zeugen sind die so genannten Schuhleistenkeile, geschliffene Felsgesteinklingen sowie Gelasse der Rössener-Kultur in Konstanz- Rauenegg.8
Das Gebiet des heutigen Tägerm ooses war bereits um 5000 v.Chr. weitgehend verlandet, die ehem alige Seebucht zum ausgedehnten Sum pfgebiet geworden. Trotz der geänderten Um weltbedingungen blieben die Standorte der m ittelsteinzeitlichen Rastplätze attraktiv. Dank ihrer günstigen Lage wählte man sie auch in der Jungsteinzeit und in der frühen Bronzezeit gerne als Siedlungsplätze (Abb. 16 und Abb. 21, 1-17).
Am Rand des Tägerm ooses entdeckten w ir Geräte sowie Reste m ehrerer jungsteinzeitlicher Dörfer (Abb. 22).* An die Fundstellen grenzen flache M oränenterrassen mit trockenen, gut bewirtschaftbaren Böden. Das Feuchtgebiet wurde als Siedlungsstandort gemieden.
Aus dem Zentrum des Tägerm ooses fehlt trotz intensiver Suche bislang jeder Hinweis au f prähistorische Siedlungen.
Hingegen finden sich weitere Siedlungsstellen au f dem schmalen Uferstreifen zwischen See und ansteigender M oräne westlich von Tägerw ilen10 wie auch bei K reuzlingen11. Sie wurden bei dam als niedrigem Seespiegel au f trockenem Boden errichtet. Die gleiche Situation stellen wir am N ordufer des Untersees fes t.12
Aus dem Seerhein bei G ottlieben stammt ein schnurkeram ischer B echer13 aus der Zeit zw ischen 2700 und 2500 v. Chr. Dies ist ein Hinweis, dass am Rheinufer m öglicherweise weitere Fundstellen zu entdecken wären (Abb. 23).
Im Raum Kreuzlingen/Tägerwilen konnten au f den ansteigenden M oränen des Seerückens bislang keine Siedlungsstellen des Jungneolithikum s nachgewiesen werden. Haben sich hier keine Siedlungen befunden, oder entziehen sie sich infolge Erosion einem archäologischen Nachweis? Da es zahlreiche eindeutige Siedlungsspuren aus der Bronze
zeit in allen Höhenstufen der M oränenterrassen gibt, fallt letztere Annahm e schwer.
Interessanterweise fehlen auch au f den M ineralböden im Hegau Siedlungen des Jung- und Endneolithikum s, obwohl auch dort, weit abseits der Seeufer, im Alt- und M ittelneolithikum die flachen Terrassen des H interlandes bewohnt gewesen w aren.14
Im Jungneolithikum scheint man in unserer Region selten ausserhalb der Seeuferzonen und M oorgebiete gesiedelt zu haben. Künftige Funde mögen diesen Eindruck korrigieren und das Siedlungsbild des Jungneolithikum s auch auf den hoch gelegenen M oränen des Seerückens verdichten. Die schnurkeram ische Siedlung au f dem Ottenberg über dem Thurtal ist hierfür vielleicht ein Ind iz .15 Der geplante Bau der Südum fahrung Kreuzlingen w ird m öglicherweise neue Antworten zu dieser Frage beisteuern.
Die Bevölkerungszahl steigt
Zwischen 4500 und 3900 v.Chr. stiegen die Bevölkerungszahl und die Zahl der Siedlungen rasch und stark an. A uf N ationalstrassengebiet ist die bei Tägerwilen neu entdeckte Fundstelle U nterführung ARA-Strasse von besonderem Interesse, fanden sich doch dort in den Kulturschichtresten Kugelbecher (Abb. 24), verwandt mit den Bechern vom Typ Schellenberg-Borscht (Abb. 25), D ickenbännli-Bohrer (Abb. 26) und das Fragment eines Silexbeiles. Diese Fundkom bination tritt in frühen Fundstellen am Bodenseeufer des öfteren au f .16 Sie gehört ins U m feld der Epirössener Gruppen (um 4200 v. Chr.), der Lutzengütle und A ichbühler Kulturen.
Weitere Kugelbecher fanden sich au f Schweizer Seite einzig in S teckborn-Turgi17, wo sie verm ischt m it etwas jüngerem Fundmaterial der älteren Pfyner Kultur vorkamen, die nach Dendrodaten aus der Seeufersiedlung Hornstaad-Hörn- le I in die Zeit um 3900 v.Chr. zu stellen is t18. Auch das Fund-
7 Schlichtherle 1990c, 138, D ieckm ann 1990, 157.8 Schlichtherle 1990a, 137.9 Tägerw ilen: A R A -S trasse; an der V ierten S trasse; N oppelsgut; K reuz
ungen: Töbeli.10 T ägerw ilen-U nderi und O beri G ottlieberw ise; T riboltingen-H ofw iesen.11 K reuzlingen: Seeburg-H örnli; H elebarden-F ischerhaus.12 Schlichtherle 1985, 35, Abb. 14; D ieckm ann 1990, 158, Abb. 1.13 W iniger u. H asenfratz 1985, 172.14 Schlichtherle 1990b, 214.15 H asenfratz 1997, 50.16 Schlichtherle 1990b, 2 1 6 -2 1 7 , 220 Abb. 8; G leser 1995, 2 4 2 -2 4 5 .17 W iniger u. H asenfratz 1985, 56.18 D ieckm ann et al. 1997, 16.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 33
Abb
. 21
: Ju
ngst
einz
eit
/ N
eoli
thik
um.
Fun
dste
llen.
Tä
gerw
ilen:
1 U
nter
führ
ung
AR
A-S
tras
se;
Chä
lhof
wie
se;
2Obe
res
Täg
erm
oos;
3An
der
Vie
rten
Stra
sse;
4R
uet;
5Lün
zelm
oos;
6U
nder
i G
ottl
iebe
rwis
e;7O
beri
G
ottl
iebe
r-
wis
e;'T
rafo
stat
ion
;9Sp
uela
cker
; l0
Hoc
hstr
oss;
11 N
oppe
lsgu
t; K
reuz
linge
n:
l2T
öbel
i; 13
Ber
nrai
n;
l4H
eleb
arde
n-F
isch
erha
us;
l5Se
ebur
g-H
ömli
; 16
Tri
bolt
inge
n-H
ofw
isen
;17G
ottli
eben
; ''K
onst
anz-
Fra
uenp
fahl
; l9
Kon
stan
z-
Rau
eneg
g.
34 Fom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
-X
Abb. 22: T ägerw ilen: G ottlieberw ise. Jungste inzeitliche Steinbeile aus dem schm alen U ferstreifen . Sam m lung R. K önig, T ägerw ilen .
m aterial aus Kreuzlingen-Töbeli kann in diese Zeit datiert werden. Siedlungsstellen der älteren Pfyner Kultur finden sich au f Schweizer Seite noch in Erm atingen, au f der Insel Werd bei Eschenz sowie am Nussbaumersee.
Abb. 23: G ottlieben, R heinbett. B echer der Schnurkeram ik. Privatbesitz 0 . Z ack, S iegershausen.
In der Jungsteinzeit war das südliche Bodenseeufer um 3700 v.Chr., d.h . in der Zeit der entwickelten Pfyner Kultur, am dichtesten besiedelt. W ie auch die rund 700 Jahre jüngere Horgener Kultur hinterliess diese zahlreiche Spuren. Wir entdeckten m ehrere neue Fundstellen19 mit reichhaltigem M aterial, vorwiegend Geräte aus Felsgestein und Silex. Hinweise au f die Nutzung der flachen M oränenterrassen und selbst hoch gelegener M oränen geben Altfunde, ein Steinbeil aus Tägerwilen-Lünzelm oos (Abb. 21, 5) sowie je ein Kupfer- und Steinbeil von Kreuzlingen-Bernrain (Abb. 21, 13).
Für das Endneolithikum sind die Inform ationen im Raum Kreuzlingen/Tägerwilen weitaus spärlicher. Ein Einzel fund, der schnurkeram ische Becher aus dem Rhein bei Gottlieben, w urde bereits erwähnt. In Tägerwilen-Underi Gottlieberwise fand Robert König einen Dolch aus Grand-Pressigny-Silex. Dieser Fund, ein Importstück aus M ittelfrankreich, sowie die M erkmale an einigen am gleichen Ort geborgenen Beilklingen sprechen für die Zuordnung der Fundstelle zur schnurkeram ischen Kultur. Die nächstgelegene bekannte Siedlung gleicher Zeitstellung liegt in Erm atingen, ca. 5 km entfernt. W eitere schnurkeram ische Funde kennen w ir vom U ntersee, aus dem Seebachtal und vom Ottenberg.20 In Kreuzlingen und Tägerwilen dürfen w ir au f G rund von 14C- datierten Bodenproben m it der Anwesenheit von M enschen im Endneolithikum rechnen.
19 T riboltingen: H ofw iesen; Tägerw ilen: Underi und O beri G ottlieberw ise,A n der V ierten Strasse und N oppelsgut.
20 W in ig e ru . H asenfratz 1985, 16.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 35
Abb. 24: T ägerw ilen: U nterfiihrung-A R A -S trasse . Scherbe e ines K ugelbechers. D ie V erzierungen w urden m it den G elenkenden von K leintieren e ingepresst. F rühes Jungneolith ikum .
A bb. 26: K reuzlingen. T öbeli. W inziger B ohrer zu r H erstellung von Schm uckperlen (M 3:1). F rühes Jungneolith ikum .
Rodungen und Bodenerosion
Um Landw irtschaft treiben und Vieh züchten zu können, m usste gerodet werden (Abb. 27). Auffällige Zeugen der Landerschliessung durch Brandrodung sind H olzkohlebänder, dunkle Schichten mit Holzkohlepartikeln, oftm als auch brandgerötete Sedimente, welche der eiszeitlichen M oräne aufliegen. Bei unseren Untersuchungen fehlten archäologische Begleitfunde, hingegen konnten wir ehem alige W urzelgruben dokum entieren, die man offensichtlich ausgebrannt hatte. Horizonte m it Feuerzeigern finden sich vorwiegend in Senken oder am Hangfuss, wo sie nicht erodiert, sondern überdeckt wurden. Wie Dünnschliffe zeigen, kam die dunkle Färbung dieser Sedimente nicht durch Staunässe, sondern durch m ikroskopische Holzkohlepartikel zustande.
Ein ins frühe Jungneolithikum um 3900 v.Chr. 14C- datierter Rodungshorizont bei Tägerw ilen21 stim m t zeitlich
Abb. 25: Schellenberg-B orscht, E p irössener Becher. Foto H. J. F röm m elt. 21 Trafosta tion (Abb. 2 1 ,8 ) .
Abb. 27: B eispiel e iner m odernen B randrodung in V enezuela. Foto K. W iehn.
36 yom Untersee zum Seenicken - 10000 Jahre Siedlungsgeschichte
gut überein mit der archäologisch nachweisbaren Präsenz von neolithischen Siedlern in der näheren Region.
Rodungstätigkeit ist auch für die Zeit zwischen 2600 und 2300 v.Chr. belegt22, d.h . in der späten Schnurkeram ik- und der Glockenbecherkultur.
Ab dem Endneolithikum und in der beginnenden Bronzezeit wurde die Rodungstätigkeit stark ausgeweitet. Die Öffnung der W aldgebiete zugunsten von Ackerland hatte starke Erosion zur Folge. Das weggeschwemmte Material lagerte sich in Senken und am Hangfuss in mächtigen Schichten ab. Wann die Bildung dieser Kolluvien begann, lässt sich bislang nur schwer abschätzen, sie dürfte jedoch be
reits im Jungneolithikum eingesetzt haben. Indizien hierfür fanden sich z.B . in Tägerwilen-Trafostation. Zeitlich recht gut eingrenzen lässt sich die Kolluvienbildung in den beiden Tägerw iler Fundstellen Hochstross und Spuelacker: Dort liegt sie zwischen einem endneolithischen Horizont mit Rodungszeigern und frühbronzezeitlichen Kulturschichten.
Bronzezeitliche Siedlungsspuren liegen in allen Bodenprofilen innerhalb der hellen, ockerfarbenen Kolluvien, die oftm als innert kurzer Zeit entstanden sind. So wurden in Hochstross bis 80 cm m ächtige Schwem m sedim ente zwischen später Frühbronzezeit, um 1500 v.Chr., und der Spätbronzezeit, endend um 800 v.Chr., abgelagert.
Vom Stein zur Bronze
Beeindruckende Siedlungsdichte
Die Frage nach den ältesten Siedlungen der Frühbronzezeit im Bodenseeraum lässt sich schwer beantworten.23
In Kreuzlingen-Töbeli deutet lediglich ein 14C-Datum um 2000 v.Chr. au f eine m ögliche, sehr frühe bronzezeitliche Siedlungsphase. Reich verzierte Keramik, wie sie in Arbon- Bleiche 2 vorliegt, und 14C-Daten belegen indes eine Besiedlung in der späten Frühbronzezeit oder beginnenden M ittelbronzezeit. Aus diesem Zeitabschnitt entdeckten wir über eine Distanz von zwei Kilom etern gleich vier neue Siedlungsstellen. Diese Siedlungsdichte ist beeindruckend.
Interessanterweise lagen säm tliche Siedlungen der jüngeren Frühbronzezeit und älteren M ittelbronzezeit au f einer Höhe zwischen 400 m und 415 m. Sie beanspruchten, wie zuvor bereits die jungsteinzeitlichen Dörfer, den Rand des Tägerm ooses sowie zusätzlich die angrenzenden flachen M oränenterrassen (Abb. 28). A uf den trockenen Halden fanden sich gute A ckerböden, die wohl seit dem N eolithikum genutzt wurden.
Eine kontinuierliche Siedlungstätigkeit ist fürTägerw ilen- Hochstross belegt. A uf der Keramik aus einer 14C-datierten Schicht des 17. Jhs. v. Chr findet sich der reiche Verzierungsstil der späten Frühbronzezeit. Eine Serie von 14C-Daten, die zw ischen das 16. und das 14. Jh. v. Chr. fallen, belegt zusam men mit Keram ikm erkm alen den Fortbestand der Siedlung bis in die ältere und jüngere M ittelbronzezeit. Pfostengruben, eingetieft in die Kolluvien, geben Hinweise au f Siedlungsphasen in der späten Bronzezeit. Die zugehörigen Kulturschichten sind allerdings nicht erhalten.
Im Randbereich des Tägerm ooses und an den Ufern des Rheins und Bodensees sind bislang keine Siedlungen der M ittelbronzezeit festgestellt worden. Die tiefst gelegene Siedlung, m it Spuren der jüngeren M ittelbronzezeit um 1450-1350 v.Chr., liegt in Tägerwilen-Hochstross a u f der flachen M oränenterrasse, 407 m ü.M . In vergleichbarer topographischer Lage finden sich im Abstand von ca. 200 M etern weitere m ittelbronzezeitliche Siedlungsspuren (Abb. 2 9 ) "
Der Seerücken wird Siedlungsgebiet
Ab der jüngeren M ittelbronzezeit begann man, weit ab vom See, flache Terrassen bis in Höhen von 550 m sowie die hoch gelegenen M oränen des Seerückens als Baugrund zu nutzen. So wurde in der M ittelbronzezeit ein D orf in Kreuzlingen-W ildenwis-Saubach (Abb. 28, 13) angelegt. Siedlungsspuren der m ittleren und der späten Bronzezeit finden sich in Kreuzlingen-Bernrain und Kreuzlingen- Schlossbühl (Abb. 2 8 ,1 1 ,1 2 ), dessen spornartiger Vorsprung den dam aligen Bewohnern Schutz bot. Die G rabungsbefunde lassen darauf schliessen, dass die heute sichtbaren W allanlagen jedoch erst aus dem M ittelalter stammen.
In der näheren Region existieren weitere m ittelbronzezeitliche Fundstellen in vergleichbarer topographischer Lage, z. B. in kaum vier K ilom eter D istanz au f der beinahe höchsten Stelle des Seerückens die bedeutende Fundstelle W äldi-Hohenrain. Auch zeugt ein Grab, das bereits 1879 bei N euw ilen-Schwaderloh entdeckt wurde, von M enschen, die in der M ittelbronzezeit die Höhenzüge des Seerückens bewohnten.25
Der Einbezug der Höhen ist nicht nur für unser Gebiet belegt. Auch nördlich des Bodensees und am Zürich- und Zugersee rückte man in der M ittelbronzezeit von den Seeufern weg und besiedelte zunehm end Höhenlagen und M oränen.26 Eine Ursache dafür könnte die für die M ittelbronzezeit belegte Klim averschlechterung sein, welche verbunden m it verstärkter Erosion w ahrscheinlich zu einer Verknappung von nutzbarem Land geführt hat. Man war also gezwungen, das Siedlungsgebiet au f die hoch gelegenen M oränen auszudehnen, obwohl diese für eine Bewirtschaftung sicherlich weniger günstig waren als die vorher bevorzugten flachen Terrassen nahe dem See.
Den Seerücken prägte in der Bronzezeit eine Landschaft mit kleinen M ooren und Rieten, die zw ischen trockenen22 Tägerw ilen: Spuelacker; H ochstross; K reuzlingen: Töbeli.23 S ingener G räber um 2 2 0 0 -1 9 0 0 v.Chr. (K rause 1988); Seeufer
siedlung B odm ann-Schachen (D), Schicht A m it D endrodaten des 18./19. Jhs. v.Chr. (H ochuli, K öninger u. R uoff 1994, 276).
24 Tägerw ilen: R ibi; K reuzlingen: R ibi-B runegg; R ibi-G irsbergtunnel.25 H ochuli 1997 ,65 .26 M enotti 1998/99, 62; Schlichtherle 1994b, 61.
Vom Untersee zum Seerücken -1 0 000 Jahre Siedlungsgeschichte 37
Abb
. 28
: B
ronz
ezei
tlich
e Fu
ndst
elle
n.
Täge
rwile
n:
'Rib
i; 2H
ochs
tros
s; 3
An
der
Drit
ten
Stra
sse;
4T
äger
moo
s-A
n de
r Zw
eite
n S
tras
se;5
Unt
erfü
hrun
g A
RA
-Str
asse
;6T
rafo
stat
ion;
’Sp
uela
cker
; K
reuz
linge
n:
8Töb
eli;
’Rib
i-
Bru
negg
; l0
Rib
i-G
irsb
ergt
unne
l;
"Ber
nrai
n;
12Sc
hlos
sbüh
l; "W
ilde
nwis
; "J
unkh
olz;
15
Sch
reck
enm
oos,
16K
onst
anz-
Fra
uenp
fahl
,17K
onst
anz-
Rau
eneg
g.
38 Vom Untersee zum Seerücken - 10000 Jahre Siedlungsgeschichte
M oränenterrassen lagen. Die Siedler wussten diese stark gegliederte Landschaft zum Bau von Dörfern und zur Anlage von Äckern geschickt zu nutzen.
A bb. 29: D ie K unst der B ronzegiesser: S chm ucknadeln und D olch aus b ron zezeitlichen S iedlungen bei T ägerw ilen und K reuzlingen.
Die Seeufer werden wieder interessant
In der Spätbronzezeit lag der Seespiegel tiefer als heute. Erneut finden sich im U ferstreifen Siedlungen, so Konstanz- Frauenpfahl und Konstanz-Rauenegg (Abb. 28, 16, 17).
Die Lage der spätbronzezeitlichen Siedlungen ähnelt jener der mittelbronzezeitlichen. Auch sie folgen sich in kurzer Entfernung. Die frühe Spätbronzezeit des 13./12. Jhs. v.Chr. hinterliess in Kreuzlingen-Ribi-Brunegg ihre Spuren. In Tägerwilen finden sich im Ribi Hinweise au f Siedlungsphasen für fast alle Stufen der Spätbronzezeit vom 11. bis ins 9. Jh. v.Chr. Eine Siedlung des 1 L/10. Jhs. v.Chr. ist bei der Trafostation an der Spuelackerstrasse (Abb. 28, 6), eine andere der Zeit um 850 v. Chr., also kurz vor dem Übergang zur Eisenzeit, in Hochstross belegt.
Die zum Teil sehr grossflächigen Fundstellen, welche die Reste mehrerer, nicht gleichzeitig existierender D örfer oder gehöftähnlicher Siedlungseinheiten umfassen können, boten etliche Schwierigkeiten bei der Interpretation der Befunde. Schlechte Erhaltungsbedingungen lassen Aussagen zur Art der D örfer und zur Bauweise der H äuser kaum zu. Zahlreiche Einzelfunde belegen die Nutzung der Landschaft im näheren Umkreis der bewohnten Gebiete.
Von der Bronze zum Eisen
Die Funddichte nimmt ab
Mit dem Ende der Spätbronzezeit, um ca. 800 v.Chr., verschlechtert sich die archäologische Quellenlage. W ährend der Kanton Thurgau eine Vielzahl von bronzezeitlichen Fundstellen aufzuweisen hat, kennen w ir bislang noch relativ wenig Fundmaterial aus dem Abschnitt der älteren Eisenzeit (Hallstattzeit: ca. 8 0 0 -4 5 0 v.Chr.). Nach Auflassen der Seeufersiedlungen in der 2. Hälfte des 9. Jhs. v.Chr. wurden einzelne Areale au f Höhen, die in der Bronzezeit bewohnt waren, neu besiedelt, so zum Beispiel W äldi-H ohenrain au f dem Seerücken oder Toos-Waldi bei Schönholzerswilen. Siedlungsreste fanden sich auch au f dem Uerschhauserhorn, wo zwischen 663 und 638 v. Chr. unm ittelbar neben der alten spätbronzezeitlichen Dorfanlage eine neue angelegt w urde.27 Die G ründe für das Verlassen der Seeufer dürften in einem Seespiegelanstieg verbunden m it einer K lim averschlechterung gelegen haben. Vermutlich wurde diese Situation durch m enschliche Eingriffe in die Umwelt - z.B. intensive Rodung und A uflichten der Landschaft durch Acker- und W eideflächen - zusätzlich verschärft, was die M enschen zwang, die Siedlungen ins Hinterland oder zum indest in
höher gelegene Uferzonen zu verlagern. So fand m an in Tägerwilen 1997 bis 1999 hallstattzeitliche Keramik au f M oränenterrassen, und zwar an der M üller-Thurgau-Strasse und bei H ochstross (Abb. 30). N eben diesen neuen Siedlungsfunden sind es vor allem die Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v.Chr. von Kreuzlingen-Geissberg28, welche die Anwesenheit von Bewohnern in diesem Gebiet bezeugen (Abb. 31). Bei der N eubearbeitung von A ltfunden aus dieser Region gelang es ausserdem , nur wenige Kilom eter von K reuzlingen-Geissberg entfernt, einen weiteren Grabhügel aus der älteren Eisenzeit au f dem Schlossbühl bei Kreuzlingen zu lokalisieren. Hallstattzeitliche Grabhügel des 6. Jhs. v.Chr. finden sich überdies au f dem Wolfsberg bei Ermatingen.
Kelten im Raum Kreuzlingen
Mit dem Beginn der jüngeren Eisen- oder Latènezeit, ca. 4 5 0 -1 5 v. Chr., treten die Bewohner unserer Region erst-
27 B illam boz u. G olln isch 1996/97. 102-103 .28 Z uletz t bei G olln isch 1997, 71.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 39
iM Ä liH
Abb
. 30
: E
isen
zeitl
iche
un
d rö
mis
che
Fun
dste
llen.
Tä
gerw
ilen:
' H
ochs
tros
s; 2
Rib
i;3M
ülle
r-T
hurg
au-S
tras
se;
4Spu
elac
ker;
5An
der
Drit
ten
Stra
sse;
6G
irsb
erg;
7C
aste
l-R
öhre
nmoo
s;8S
chlo
ssäc
ker/
See
äcke
r; ’
Got
tlie
ben-
R
hein
weg
; '"
Got
tlieb
en;
11 T
ribo
ltin
gen-
Hof
wis
en;
Kre
uzlin
gen:
12
Töb
eli;
13R
ibi-
Gir
sber
gtun
nel;
'“'R
ibi-
Bru
negg
; 15
Ber
nrai
n;
16Sc
hlos
sbüh
l; 17
Schr
ecke
nmoo
s;
l8W
ilde
nwis
-Jun
khol
z;
'‘'Gei
ssbe
rg-O
bere
s M
ösli;
20
Kon
st
anz;
21 T
äger
wile
n Z
iege
lhof
.
40 Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
Abb. 31 : K reuzlingen-G eissberg-O beres M ösli. K eram ik aus den ha lls tattze itlichen G rabhügeln . 8. Jh. v. Chr.
mais aus der A nonym ität der Urgeschichte. Es beginnt die grosse Zeit der Kelten, die um 500 v. Chr. erstm als historisch belegt sind. Entgegen der gängigen Volksmeinung handelt es sich bei den Kelten nicht um ein Volk, denn es gab w eder eine nationale Einheit noch eine politische Geschlossenheit. Das «keltische Volk» hat es also nie gegeben. Vielmehr handelt es sich um verschiedenste Stämme, deren Zusam m engehörigkeit sich m ittelbar zeigt: die keltische Sprache, die Religion und insbesondere die m aterielle H interlassenschaft. Die Kulturreste der Latènezeit aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends v.Chr., Schm uck und Geräte m it ihrem Verzierungsstil, gelten als typisch keltisch.
Wie die ältere Eisenzeit hat auch die Latènezeit im Thurgau nur sehr wenige Spuren hinterlassen. Interessanterweise konzentrieren sich die latènezeitlichen Fundstellen bislang vor allem au f den westlichen Teil des K antonsgebietes. Siedlungsstellen Hessen sich bis 1997 nur durch spärliche Funde z.B. in Pfyn, Diessenhofen oder B edingen lokalisieren. Grabfunde sind aus Frauenfeld und A adorf bekannt. Einen Glücksfall stellt die 1997 entdeckte spätla- tènezeitliche Siedlung au f einer H angterrasse am Fusse des Thurbergs bei W einfelden dar. Dort konnte erstm als ein Gebäude aus der jüngeren Eisenzeit im Thurgau nachgewiesen werden.29
Eindeutige Siedlungsreste aus der jüngeren Eisenzeit sind aus Konstanz bekannt (Abb. 30, 20).30 Im unm ittelbar angrenzenden Thurgauer Gebiet dagegen fehlten bislang Siedlungsbefunde, einzig keltische M ünzen aus Gottlieben
und den Tägerw iler Fundstellen Castell und Hochstross sowie ein frühlatènezeitlicher Grabfund aus Kreuzlingen w iesen au f Ansiedlungen hin.31 Die G rabungen au f dem A utobahntrassee und die baubegleitenden Untersuchungen in der näheren Um gebung boten eine gute M öglichkeit, der letzten vorröm ischen Epoche besondere Aufm erksam keit zu schenken. Die Ergebnisse zeigen, dass sich im Bereich des natürlichen Rheinübergangs im Raum Konstanz- Kreuzlingen ein Siedlungsschwerpunkt befand. Sowohl in Gottlieben-Rheinweg als auch in Tägerwilen-Hochstross konnten latènezeitliche Siedlungsreste nachgewiesen werden.In Tägerwilen wurde an der M üller-Thurgau-Strasse ausser- dem die älteste Drehscheibenkeram ik au f Thurgauer Boden gefunden. Einige K eram ikscherben unter den N eufunden der A utobahnsondierungen zeigen im Übrigen neben möglichen rheintalisch-alpinen Einflüssen auch überregionale Beziehungen zum süddeutschen Raum.
Auch wenn sich die Quellenlage in den letzten Jahren stark verbessert hat, ist es nach wie vor schwierig, aus den archäologischen Funden und Befunden der jüngeren E isenzeit im Thurgau eine lückenlose Besiedlungsgeschichte zu rekonstruieren. Die latènezeitlichen G räber aus A adorf oder Frauenfeld geben uns zw ar einen Einblick ins keltische Totenbrauchtum, die dazugehörigen Siedlungen kennen wir
29 JbSG U F 82, 1999, 276, und S tehrenberger 2000.30 O exle u. C ord ie-H ackenberg 1984, 76 ff.31 Z uletz t B rem 1997, 73.
Kim Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 41
allerdings noch nicht. Ursache fur den spärlichen Fundniederschlag ist eine stark zerstreute Siedlungsweise in Form von kleineren Gehöften. Ausserdem zeigen die Untersuchungen im Rahmen des A7-Projektes, dass zahlreiche Ansiedlungen und ihre Befunde durch Erosion und m oderne Bodeneingriffe zerstört wurden. Zahlreiche keltische Siedlungsplätze dürften darüber hinaus unter heutigen Dorfkernen liegen und für im m er ihre Geheim nisse bewahren.
Die Fundstellenkonzentration im westlichen Teil des Kantons scheint nicht zufällig zu sein, liegen die Fundplätze dort doch m eist nahe an natürlichen Verkehrswegen in einem klim atisch günstigen Gebiet, das zudem eine hervorragende Bodenqualität für Subsistenzwirtschaft bietet. Trotzdem ist nicht anzunehm en, dass der Hinterthurgau gänzlich unbe- siedelt war. Die weissen Flecken a u f der Fundstellenkarte des Thurgaus sind wohl eher A usdruck geringerer m oderner Bautätigkeit.
Dank dem Strassenbau wissen wir mehr
Die A utobahngrabungen und die baubegleitenden Untersuchungen im Raum K rcuzlingen-K onstanz haben wichtige neue Erkenntnisse zur Frühgeschichte unseres Kantons geliefert. Dank intensiver Beobachtungen in einem kleinräum igen Gebiet ist es gelungen, das Siedlungsnetz am w estlichen Bodensee weiter zu verdichten. Offen bleiben muss allerdings nach wie vor die Frage nach dem Übergang von der Spätlatenezeit zur röm ischen Epoche. Eindeutige Funde und Befunde aus dem letzten A bschnitt der Spätlatenezeit (LTD2) in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v.Chr. scheinen bislang au f Thurgauer Boden imm er noch zu fehlen. Es ist anzunehm en, dass weitere intensive Beobachtungen im Raum Kreuzlingen sowie die A ufarbeitung von Altbeständen aus Konstanz hinsichtlich dieser wichtigen Fragestellung zu neuen Ergebnissen führen werden.32 Gleiches gilt für die nahezu fundleeren Gebiete im südlichen und östlichen Teil des Kantons: Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann neue Fundstellen der E isenzeit entdeckt werden.
Röm er und Alemannen
Wo sind die Römer?
Bei den Arbeiten au f N ationalstrassengebiet kam en nur wenige röm ische Funde zum Vorschein. Die Nähe zu Konstanz hatte etwas ganz anderes erwarten lassen.
Dort, wo sich heute die A ltstadt von Konstanz befindet, errichteten die Röm er näm lich bereits um die M itte des 1. Jhs. n.Chr. eine Siedlung direkt beim seit alters her bekannten, wichtigen Übergang über den Seerhein. Der Bauplatz, ein trockener M oränenrücken, war dam als au f drei Seiten von Sum pf und W asser um geben und bot guten Schutz. Deshalb wählte m an ihn auch im 4. Jh. n.Chr. als Standort des Kastells, das, wie auch die Anlagen von Eschenz, Pfyn und Arbon, zur Sicherung der Reichsgrenze beitragen sollte, die gegen Ende des 3. Jhs. n.Chr. au f die Linie R hein-Iller-D onau zurückgenom m en worden war.
Zum Verlauf einer röm ischen Strasse von Konstanz nach Pfyn gibt es keine direkten A nhaltspunkte wie z. B. Strassen- koffer, sondern nur indirekte. Zu Letzteren gehören die Gräber, die man in röm ischer Zeit ausserhalb der Siedlungen und meist entlang der Strassen anlegte. Bei den paar G rabfunden im Bereich der heutigen A ltstadt von Konstanz und au f A utobahngebiet im Schreckenm oos oberhalb von Kreuzlingen könnte es sich um solche W egbegleiter handeln.
Von Konstanz nach Eschenz und um gekehrt benützte man in röm ischer Zeit vorzugsweise den Wasserweg. Ob es dazu eine parallel zum See verlaufende Strasse gab, ist unbekannt. Bei Triboltingen entdeckte man um 1940 ein Brandgrab. Als isolierter Einzelfund genügt dieses nicht als Beleg für eine Fernverbindung, es m ag aber an einer lokalen Strasse gelegen haben.33 Solche Wege sind au f Grund der recht zahlreichen röm ischen Glas- und Keram ikfunde im Tägerm oos und von den flachen G eländeterrassen zwischen Tägerwilen
und Kreuzlingen anzunehm en (Abb. 30). Fibeln w urden bei Em m ishofen34 und in den Tägerw iler Stationen Ribi und H ochstross entdeckt (Abb. 32). Aus der U m gebung des Schlösschens Girsberg kennen w ir eine eiserne Axt und Scherben von Terra-Sigillata-Gefassen. Öfters kam en auch M ünzen zum Vorschein, z. B. beim Z iegelhof und bei Rüllen in Tägerwilen, bei Tägerwilen-Castell, in G ottlieben und in K reuzlingen35.
Wie sollen all diese röm ischen Funde gedeutet werden? Römische Gebäudereste konnten w ir nirgends feststellen. Wo bei unseren G rabungen röm ische Scherben in den Fundschichten auftauchten, stammten sie aus alten Pflughorizonten, die bis in die röm ische Zeit zurück reichen, oder
32 V gl. R ychener 1995, 82, und F ischer 1990, 2 9 -4 2 .33 Thurg. B eiträge 74, 1937, 77.34 N otizen H eierli V III, 10, o. J. im SLM Z; K eller u. R einerth , 1925, 228.35 K eller u. R einerth 1925, 244, 248, 256.
Abb. 32: T ägerw ilen: H ochstross: R öm ische Fibel. 1. Jh. n. Chr.
42 Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
sie wurden von der heutigen A ckeroberfläche aufgesamm elt. Die Äcker im Tägerm oos und au f den flachen Hangterrassen könnten sowohl vom röm ischen Konstanz wie auch von noch unentdeckten Gutshöfen südlich von Kreuzlingen aus bew irtschaftet worden sein.
Man spricht Alemannisch
Nach dem Abzug der röm ischen Truppen zu Beginn des 5. Jahrhunderts begann die Einwanderung alem annischer Familien. Anders als anderswo scheinen diese sich im Gebiet des heutigen Thurgaus kaum um die von den Röm ern geschaffene Infrastruktur geküm m ert zu haben: Nur wenige röm ische O rte und Ortsnam en - so z. B. Arbon von Arbor Felix, Pfyn von Ad Fines und Eschenz von Tasgetium - haben sich bis heute halten können, das röm ische Strassennetz zerfiel.
Viele der heutigen D örfer haben sich aus frühm ittelalterlichen Siedlungen entwickelt. Im Laufe der Zeit sind deren Reste durch jüngere Bauten überdeckt oder durch U m lagerungen und Erosion weitgehend zerstört worden. Da das Trassee der A 7 die Dorfkerne nicht tangiert, w äre es ein
Zufall gewesen, bislang unbekannte frühm ittelalterliche W ohnstätten finden zu können, obwohl au f Grund alter O rtsund Flurnamen, wie z.B . Tägerwilen, oder der Nähe zum frühm ittelalterlichen Bischofssitz Konstanz sowie Funden aus den vergangenen Jahrzehnten Neuentdeckungen nicht auszuschliessen waren.
Bekannt sind aus dem Gebiet K reuzlingen/Tägerwilen m ehrere abseits der Dörfer angelegte G räberfelder (Abb. 33). Die um 1870 entdeckten G räber am Rüllensträsschen in Tägerwilen enthielten Beigaben des frühen 7. Jahrhunderts n.Chr. (Abb. 34). Zu den frühm ittelalterlichen Gräbern in Tägerw ilen-Leberen-Schanz gibt es kaum Informationen; besser dokum entiert wurden 1973 drei Grablegungen mit Steineinbauten und spärlichen Beigaben in Tägerwilen- Rüsel.
Anders als die grossen G räberfelder im nahe gelegenen Erm atingen oder gar im benachbarten Konstanz gehören die kleinen Grabgruppen von Tägerwilen nicht zu grossen Siedlungen, sondern zu verstreut gelegenen Gehöften. Diese sind kaum in grosser Distanz zu den Bestattungsorten zu suchen, konnten sich jedoch bislang dem archäologischen Nachweis entziehen.
Was wäre Konstanz ohne Hinterland?
Platz für Vieh, Äcker und Gärten
Jede m ittelalterliche und frühneuzeitliche Stadt brauchte für ihr w irtschaftliches Funktionieren ein grösseres, nahe gelegenes Vorgelände. Für Konstanz waren dies das Usser- feld/Brühl und das Tägerm oos. Sie waren durch die äussere Stadtbefestigung voneinander getrennt und dienten als Allmend, au f der vor allem die Stadtbürger ihr Vieh weiden lassen konnten. Im Tägerm oos wurde auch Ackerbau betrieben, und Tägerwilen besass gewisse Weiderechte, vor allem für Pferde.36
Bis ins 16. Jahrhundert hatte sich die Stadt im m er w ieder Rechte am Tägerm oos erworben und dieses Gebiet auch allm ählich in ihre Niedere Gerichtsherrschaft integriert. Ab 1560 übernahm die Stadt vom K loster Kreuzlingen dessen Rechte und kam so zu etwas wie Eigentum .37 Aber auch fortan überlagerten sich verschiedenste Rechte im Tägermoos: Niedere und Hohe Gerichtsbarkeit, Landeshoheit der Eidgenossen, Gerichtsrechte des Bischofs usw. führten zu endlosen Streitereien. Dies geht aus dem Plan von 1751 klar hervor (Abb. 35).
Erst im Jahre 1800 teilte die Stadt die bis anhin als A llm end genutzte Fläche unter die Bürger au f.38 Damals entstanden auch die regelm ässigen Parzellierungen mit dem Wegnetz.
Eine Liste der N utzungen des Gebietes um fasste Weide, Acker- und G artenbau, Erholung für Spiele und Feste, Reservegebiet für die Stadterweiterung, Rohm aterialgewinnung, Gewerbeproduktion, H inrichtungsstätte, Wasserversorgung, A bfallentsorgung, Verkehrserschliessung -
kurz, fast die ganze Stadtgeschichte lässt sich auch «von aussen» aufrollen.
Aus dieser enorm en Vielfalt werden nur drei Sachkom- plexe herausgegriffen, welche sich in archäologischen Befunden niedergeschlagen haben: Ton- und Abfallgruben, die Frischwasserleitungen in die Stadt und die Tägerm oos- strasse.
Tongruben und Abfallentsorgung
Aufm erksam e Schrebergärtner lasen schon im m er in ihren Bünten alle möglichen Gegenstände auf. Andere legten sich eigentliche Sam m lungen an. Zwei der grösseren sind die Sammlung Göpfrich, Konstanz, und Böhler, Tägerwilen (Abb. 36 und 37).
Unsere erste archäologische Prospektion erbrachte an vielen Stellen Konzentrationen von Funden unterschiedlichster Zeitstellung. In grösseren abgedeckten Flächen fanden sich dicht nebeneinander liegende Gruben, deren Inhalt sich eindeutig als Abfall mit viel Dung erwies und gewaltig stank (Abb. 38). Wie und wann kam en diese Abfälle ins Tägerm oos?
Die Abfalle und Fäkalien stammen aus privaten Latrinen, aus den Ehgräben und den städtischen Strassen. Seit dem 16. Jahrhundert war in Konstanz ein städtischer Angestellter,
36 L eutenegger 1 9 3 2 ,3 3 ,4 1 .37 L eutenegger 1932, 31 ; K aufvertrag: Stadtarchiv K onstanz, Fasz. C V 46,
Nr. 7.38 B urkart 1991 ,437 .
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 43
S È I
Abb
. 33
: Fr
ühm
itte
lalt
er:
Grä
ber:
1 T
äger
wil
en-L
eber
en-S
chan
z; 2
Täg
erw
ilen
-Rül
lens
träs
sche
n /
Bah
nlin
ie
SBB
; 4T
äger
wil
en-R
üsel
;5K
onst
anz-
St.
Step
han.
Kir
chen
: ’’T
äger
wil
en;7
Kon
stan
z-M
ünst
er
St.
Mar
ien.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 45
litt*/?.!
E lS #: (VtVkftaj: roiti E
*****
%W * ♦<"’<» £ « e r t u b i f ' « . t . i v r i T K j t i n d ,
Abb. 35: D as T ägerm oos 1751. N utzung des s tädtischen U m landes: Strassen, H ochgericht, Z iegelhof, B runnenstuben usw. Bild: S tadtarchiv K onstanz
und zw ar der «Nachrichter», wie m an den Henker auch nannte, mit der Entsorgung der Abfälle beauftragt. Auch der Spitalkarrer sammelte täglich Strassenabfall ein. Beide führten den wertvollen Dünger ins Tägerm oos und ins U sserfeld.39 Die Abfälle kam en entweder in G ruben oder w urden sofort flächig ausgetragen. Das zur N ahrungsm ittelproduktion für die Stadt genutzte Gelände wurde so gedüngt und der S toffkreislauf geschlossen.
Die Gruben im Tägerm oos dienten zuerst als Tongruben und erst sekundär der Abfallentsorgung. Nicht nur der N achrichter und der Spitalkarrer hatten für das Auffüllen und W iedereindecken der G ruben zu sorgen, auch die Hafner der Stadt waren seit dem 16. Jahrhundert dazu verpflichtet:
«...Ordnung, wo und wie man lätt graben soll...§ 1) als das Usserfeld, wo man dis dahär lett gegraben hat,
übel ergraben ist, hat ain ersamer rat verordnet, das man fürohin u ff dem Tegermoss by dem Vogelsang an dem ort, das man darzu ussgezeichnet hat, graben solle.
4 Abb. 34: T ägerw ilen-R üllensträsschen . E isenschw erter. 7. Jh. n. Chr. G efun den 1875 beim B au der SB B -B ahnlin ie.
§ 2) Diewil aber von des fä ch s wegen not ist, das die waid in eren gehalten werd, so hat ain ersam er rat verordnet, welher hinfüro an dem verordneten ort lett graben wil, das er an das alt ort, wo es ergraben ist, so vii kat, als er lett harin fürt, hinus fü ren s o l l ...»
Das heisst, dass im Tägerm oos neue Gruben eröffnet werden sollten, aber die alten Gruben im Usserfeld näher bei der Stadt aufzufüllen waren. Die schlechtere Tonqualität und sicher auch der weitere Transportweg führten zunächst zu W iderstand bei den Hafnern. Der Beschluss vom September 1545 musste daher bereits im Dezember wieder abgeändert werden:
«§ 3) Nun hat sich aber befunden, das der lett der orten den hafnern zu irem geschier ze brennen untauglich ist, dann vii kissling stainli darin sind, die darnach im brennen zu kalch werdent; derhalben ist den hafnern ugelassen, das sy zum geschier, das sy brennent, am alten ort lett graben mögent, doch inderthalb den marken. Sy söllent ouch lut obermelter Ordnung fü r je d e fa r t ain fa r t kat dahin fü ren oder 9 d dafür geben. »w” M eisel 1957, 131-140.40 zit. nach Junkes 1991, 1 9 6 -1 9 7 .
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 47
A bb. 37: T ägerm oos. Porzellanpuppen. 2. H älfte 19. Jahrhundert. S am m lung G öpfrich , Konstanz.
Für diese Zeit ist somit noch nicht mit der Entsorgung grösserer A bfallm engen im Tägerm oos zu rechnen. A ngeblich gab es wegen der Beeinträchtigung der Weiden sogar ein Verbot, Ton zu graben.41 Da dies dem Beschluss von 1545 w iderspricht und dort dieselbe Begründung nicht für das Tägerm oos, sondern für das Usserfeld gegeben wird, dürften die beiden Örtlichkeiten verwechselt worden sein.42
Der Entsorgung im Tägerm oos standen wohl bis ins 16. Jh. auch die Besitzverhältnisse entgegen. In noch früherer Zeit, zw ischen dem ausgehenden 13. und dem Ende des 15. Jhs., w urden Abfälle und Bauschutt vor allem verwendet, um die Stadt im Osten system atisch seewärts zu vergrössern.43 Der zur M agerung des Tones benötigte Sand konnte im 17. Jh. offenbar z.T. in der Stadt selber gegraben werden. Die Gruben wurden dann mit Brennabfällen aufgefüllt.44
Der Beginn der Nutzung des Tägerm oos-Tones und der Abfallentsorgung lässt sich somit einkreisen: Etwa ab dem 16. Jahrhundert entstand ein Druck a u f die Hafner, ihren Rohstoff weiter ausserhalb der Stadt zu suchen. Die W iederauffüllungspflicht wurde eingeführt und auch in späteren Jahrhunderten beibehalten. Das zeitliche Spektrum der Funde aus den Gruben passt gut zu dieser Feststellung. Im 16. und 17. Jahrhundert sind die Abfälle näher bei der Stadt, ab dem 17. Jahrhundert, m it Schwerpunkt im 18. Jahrhundert und später, im Tägerm oos abgelagert worden.
Neben den Hafnern gab es weitere Verbraucher von Ton, die aber z.T. auch mit schlechterer Qualität auskommen konnten. Etwa 10 m3 Lehm benötigte man beim Bau eines Hauses zur Ausfachung, für den Lehm putz und die Lehm böden. Die Glockengiesser waren au f Ton angewiesen, und
i Abb. 36: T ägerm oos. G lasscherben. S pätm ittela lter und N euzeit. Sam m lung G öpfrich, Konstanz.
beträchtliche M engen verbrauchte man zum Abdichten der städtischen Teuchelleitungen. So wurden 1536 bei der A nlage der Rickenbacher Leitung 36 Fuhren Lehm und 256 Platten benötigt.45
Ein G rossverbraucher war der städtische Ziegelhof, zunächst bei der Unteren Laube - beim Ziegelgraben - , seit 1446 am Nordende des Tägerm ooses gelegen. Er ist in Diebold Schillings Luzerner Chronik von 1513 au f Blatt 184r abgebildet (Abb. 39). Der Z iegelhof beanspruchte drei grosse Gruben nahe beim Rhein, zw ischen Ziegelstrasse und Zie- gelgraben/Vogelsang. Nach 1800 wurde das A bbaugebiet im
41 M eisel 1957, 140.42 O elze 1996, 43 , verw echselt d ie beiden Ö rtlichkeiten e indeutig .43 O exle 1992 ,356 ; Junkes 1991, Teil 1 1 ,6 -10 .44 O exle 198 5 :4 7 5 ; R öber 1 9 9 6 ,582 .45 B runnenbuch 1582: fol. 4.
Abb. 38: T ägerm oos. K onstanzer A bfall aus den L ehm entnahm egruben. Ì 8 . / Ì 9 . Jh. n .C hr.
48 Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
m , ■' \ * *
A bb. 39: D as T ägerm oos in der Schlacht von 1499 in der S ch illing ’schen C hronik von 1513. O ben der neue Z iegelhof.
neu parzellierten Tägerm oos zwar ausgeweitet, beschränkte sich aber anscheinend weiterhin au f den nördlichen Teil.46
Die Konstanzer Ziegler dürften in einem grösseren U m feld eine M onopolstellung besessen haben. So sicherte
sich im Verkaufsvertrag von 1560 das Kloster Kreuzlingen «auf ewige Zeiten» den Ziegelbezug zum Vorzugspreis. Dies geschah möglicherweise im Austausch gegen eine kloster-" Bär 1995, 144; Oelze 1996: 26.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 49
eigene Produktion. Ein eigentliches Monopol sicherte sich der Rat auch gegenüber Tägerwilen 1792.47 Im südlichen Tägerm oos entstand 1867/68 die Ziegelei Noppelsgut, die aber wegen der schlechten Tonqualität bald Konkurs anm elden m usste.48
Die Gruben sind wenig tief, trotzdem gibt es aber ohne eine Leiter kaum ein Entkommen. Es konnten weder Hebeeinrichtungen noch Zugänge festgestellt werden. Die oberste Tonschicht ist ein eher heller, kalkreicher Ton von «lässiger Qualität, der sich 1545 als ungenügend erw iesen hatte. Erst darunter findet sich der bessere, blaue Ton, von dem wegen des allgegenw ärtigen Grundwassers nur gerade der oberste Teil zugänglich ist.
Frisches Trinkwasser für die Stadt
Die Versorgung der Stadt m it sauberem W asser war enorm wichtig. Bereits um 1377 taucht das Amt des Brunnenmeisters in den Quellen auf, es dürfte aber älter sein. Die Brunnenm eister wurden als w ichtige Beamte früh auch schon vereidigt. 1390 besteht eine Brunnenordnung, und 1433 werden auch die Brunnenpfender erwähnt, welche
jew eils die ihnen zugeteilten Brunnen, respektive deren Nutzerinnen, überw achten.49
Anfänglich gab es in Konstanz nur Ziehbrunnen, auch Galgenbrunnen genannt, mit welchen das G rundw asser im Stadtgebiet genutzt wurde. Die Zahl dieser Brunnen stieg stetig an: 1381: 8 Brunnen, 1390: 9, 1433: l l . 50 Gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts genügten die Sodbrunnen in der Stadt nicht mehr. 1436 erschloss man die Rickenbacher Quellen und anfangs des 16. Jahrhunderts die Em m ishofer Quellen m it Teuchelleitungen.51 Diese Leitungen speisten die öffentlichen Brunnen in der Stadt.
Offensichtlich bestand um 1530 erneute W asserknappheit. Daher unternahm man Anstrengungen, die Versorgung und das Brunnenwesen sorgfältiger zu verwalten und auch neue Quellen zu erschliessen. Diesen Anstrengungen verdanken w ir eine interessante Archivquelle: Der städtische Oberbaum eister Joachim Brendlin legte das Brunnen- und Teuchelbuch an, in dem bis ins 17. Jahrhundert alle Baumassnahm en zur W asserversorgung verzeichnet w urden.52
Jetzt erst erschloss man die Quellen im Tägerm oos. Die Stadt kaufte 1536 «by derpfarrersw aid» einen «wyßplätz sam pt dem brunnen u n d flu ß darzue».5-1 D iese Quelle wurde 1540 m it einer Brunnenstube versehen. Das W asser wurde mit so genannten «Tolen» gefasst und in die Brunnenstube geleitet. Im Brunnenbuch findet sich sogar ein Plan der W asserfassung.54
Dieses gänzlich neue System war also in etwa 100 Jahren errichtet worden und diente bis ins 19. Jahrhundert hinein der W asserversorgung.55 Es blieb im m er bei drei Leitungen, einer von Kurzrickenbach her, der Em m ishofer Leitung (aus der Finkeren?) und der Leitung aus dem Tägerm oos (Abb. 40).
Trotz dieser Kontinuität ist das, was in den jüngeren Quellen und in den archäologischen Befunden fassbar wird, nicht so einfach datierbar. Die aufwändige Anlage wurde näm lich unablässig erneuert und umgebaut. Bereits 1540
Abb. 40: T ägerm oos. B runnenplan von 1784. D er A usschn itt zeig t d ie drei in d ie S tadt führenden L eitungen. B ild: S tadtarchiv K onstanz
hatte man ja im Tägerm oos eine steinerne Brunnenstube errichtet. Rund 20 Jahre nach dem Erwerb der Tägerm oos- quellen setzte ein Investitionsschub ein. Ein Vertrag mit Tägerwilen regelte 1564 die Nutzung, insbesondere die Viehtränke der Gem einde T ägerw ilen.56
Die verm utlich neben dem N eubau von 1540 stehen gebliebene alte W asserstube «ob der pfarrers waid» und als «hülzin buw wasserstub» gekennzeichnete alte W asserfassung wurde 1569 aufgehoben und durch eine steinerne Brunnenstube ersetzt.57 Im Jahr zuvor hatte man eine dritte, weiter entfernte Brunnenstube, die «alt hölz[erne] stub am Rüllen» aufgehoben und durch «die stainin wasserstub am Rüllen» ersetzt.58
Es gab je tzt also drei steinerne Brunnenstuben: Die beiden wohl nahe beieinander gelegenen in der Pfarrersweid, welche gelegentlich auch die «ober bnm nenstuben u f f dem
47 B är 1995, 144; L eu tenegger 1932, 40; Stadtarchiv K onstanz, Fasz. CV 46, Nr. 7: K aufvertrag 1560.
« B är 1995, 136.49 M eisel 1957, 129; H ö h e r u. IM 1992, 360.50 H ö h e r u. IM 1992 ,361 .51 H echt 1939, Teil 1.52 B runnenbuch 1582: fol. 1 ff.53 B runnenbuch 1582: fol. 135; H echt 1939 gib t irrtüm lich 1565 an
und liest fa lsch « jarren w aid»; L eu tenegger 1932, 36 liest «Forrersw eid».54 B runnenbuch 1582: fol. 136.55 M eisel 1957, 129; R im m ele, B runnenplan 1784.56 B runnenbuch 1582: fol. 137 u. 138.57 B runnenbuch 1582: fol. 139: 1.58 B runnenbuch 1582: fol. 142: 1.
50 Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte
thegermoß» genannt wurden, und die dritte, tiefer (nördlicher) gelegene am R üllen.59
Die Herstellung von Teuchelleitungen erforderte einen beträchtlichen Aufwand. M öglichst gerade Stämm e von ca. 3 m Länge mussten beschafft werden. Die Stämm e wurden m it einem speziellen Bohrer der Länge nach durchbohrt und dann m it eisernen Muffen zusam m engesteckt. Da sie nie austrocknen durften, w urden sie zum Aufbewahren ins W asser gelegt. Dafür hob man gelegentlich eigens kleine Teiche aus, welche Teuchelrosen, -gruben oder -weiher genannt wurden. Die Teuchelgrube, welche dem Konstanzer Brunnenm eister diente, lag nach der Uferkarte von 1751 um 1750 südlich der Stadt nahe am Bodenseeufer (Abb. 35). Die Teuchel hielten sich im Boden fünf bis zehn Jahre, konnten aber in dichtem Lehm auch 40 Jahre halten.
Die Leitungen wurden mehrfach erneuert. Zwischen 1569 und 1604 wurde von der Stube «ob der pfarrersweid» eine eiserne Leitung gelegt, an welche sich dann zw ölf alte Teuchel anschlossen. Diese speisten eine Viehtränke, welche die Tägerw iler nutzen konnten. 1568 wurde auch zur Rüllen- stube ein «ayserne tüchel» gelegt, an welchen sich fünf neue Teuchel anschlossen.60 Diese eisernen Leitungsstücke waren w ahrscheinlich nur kurz. Etwa in den 1890er-Jahren wurde die Holzleitung stillgelegt und m it einer eisernen ersetzt. Diese erschloss beide W asserfassungen.
Bei den archäologischen Untersuchungen wurde die Holzleitung von der Brunnenstube quer über das Tägerm oos zum G eltingertor beim Zollbach und bei der Seetalstrasse angeschnitten (Abb. 41). Es handelt sich in beiden Fällen sicher um die Holzleitung, welche im 19. Jahrhundert zur Brunnenstube Untere Rülle führte. Die eiserne Leitung wurde nicht aufgefunden.
Rätsel gibt die völlig saubere G rubenfullung auf: das Profil Hess nicht erkennen, dass hier ein Leitungsgraben ausgehoben worden war. Da so eine Holzleitung höchstens 40 Jahre, meistens weniger lang brauchbar war, hätte die Leitung im Tägerm oos mindestens zehnmal erneuert werden müssen. Es ist nur bei absolut sauberem Arbeiten vorstellbar, dass dies ohne Vermischung m it dunklerem Material m öglich war. V ielleicht gab m an sich angesichts der Kosten einer Leitungserneuerung besonders M ühe, die Leitung so sauber wie m öglich im anstehenden Lehm einzupacken.
Die T ägermoos- Strasse
Für Konstanz als Handels- und Gewerbestadt war der See die w ichtigste Verkehrsader, wobei auch die Landverbindungen ins Hinterland und entlang dem Seeufer eine grosse Rolle spielten. Der Landweg war rascher, aber ungünstiger für W arentransporte.
Die Landstrasse Richtung Westen wird bereits 1273 erwähnt, als « a u f offener Strasse» ein wichtiges Rechtsgeschäft getätigt wurde. 1574 wird die Strasse «Weisser Weg» genannt und gilt als « Landstrasse».M
Wir kennen einige prominente, frühe Benutzer dieses Weges, z.B . Bernhard von Clairvaux um 1146. Den Vorzug der Raschheit zu Lande nutzte Papst Johannes X X III., als er bei N acht und Nebel 1415 vom Konstanzer Konzil flüchtete.62
Abb. 41: T ägerm oos. D er Teuchel beim Z ollbach . A n der S tirnseite die eiserne T euchelzw inge zu r V erbindung zw eier H olzröhren.
Wo genau die ältere m ittelalterliche Verbindung verlief und wie sie sich präsentierte, wissen w ir nicht. Zw ischen den Konstanzer Torausgängen und Tägerwilen blieb allerdings nur wenig Raum für grössere Verlagerungen. Das wird auch vom archäologischen Befund gestützt. Eine frühe Darstellung bietet die Stum pfsche Chronik von 1548. H ier ist die Strasse als breites, schlängelndes Band sichtbar. In der Mitte des 18. Jahrhunderts verlief sie in einigerm assen gerader Linie vom G eltingertor nach Westen (Abb. 35).
Dass nahe einer Stadt im M ittelalter in den Strassenbau viel investiert wurde war eher unüblich. Archäologische Befunde erlauben aber doch Aussagen zur Bautätigkeit in der Zeit zw ischen 1500 und dem späten 18. Jahrhundert. Wegen des unstabilen Untergrundes im Tägerm oos nutzte man näm lich das einmal gewählte Trassee im m er wieder. Der Schichtaufbau zeugt von einer Folge von Baumassnahm en.
Das gut verfestigte Schotterpaket der untersten Schicht ist nach den Funden in die Zeit um 1500 zu datieren. Die um 20 cm dicke Schicht scheint in einem Zuge eingebracht worden zu sein; in einem A bstand von ca. vier M etern geben flache Seitengräben Hinweise a u f die Strassenentwässerung.
59 B runnenbuch 1582: fol. 2; H echt 1938 w eist d ie Fassung(en) P farrersw eid fä lschlicherw eise der m ittleren E m m ishofer L eitung zu.
60 B runnenbuch 1582: fol. 139: 2; fol. 143: 2.61 TU B Bd. 4 , Nr. 27, 16. Nov. 1273; L eu tenegger 1932, 36, 98.62 TU B Bd. 2, Nr. 28, 1 1 .-1 4 . Dez. 1146; M aurer 1989, 21; IVS D oku
m entation Thurgau: TG 41.
Vom Untersee zum Seerücken - 1 0 000 Jahre Siedlungsgeschichte 51
Leider gibt es keine Archivquellen zu dieser Bauphase. Eine m ächtige Einschwem m schicht über dem Strassenkoffer zeigt aber deutlich, dass hier längere Zeit wenig für den Unterhalt getan wurde. Der nächstfolgende Strassenkoffer datiert nach den Funden näm lich erst ins 18. Jahrhundert. Es handelt sich wahrscheinlich um die Zeit um 1770, als die Landstrasse von Frauenfeld via W äldi nach Konstanz neu angelegt wurde. Erste Korrespondenzen zwischen Rat und Obervogt in G ottlieben finden sich ab 1768; au f thurgauischer Seite w urde für das ganze Projekt ein prächtiger Plan erstellt (Abb. 42) und die Strasse dann auch gebaut.63 Die Stadt oder das Dom kapitel Konstanz beteiligten sich an den Kosten.
Es ergeben sich aus den Archivquellen wenige Hinweise au f die Bautechnik in der frühen Neuzeit: Verwendet wurden Sand und grober Kies. D iese stammen aus unm ittelbarer U m gebung vom Eichhorn und vom Schöpften oder wurden per Schiff von der Insel M ainau hergebracht.64 Dies passt soweit ganz gut zum Charakter beider Strassengenerationen.
W asser und einige seiner N utzungsm öglichkeiten scheinen dam it das verbindende Element in diesem kleinen Rundgang durch das Tägerm oos zu sein: Ablagerungen in der ehem aligen Seebucht w urden für die Z iegelherstellung ausgebeutet, die Stadt Konstanz bezog ihr W asser über eine Leitung durch das Tägerm oos, und der K am pf m it der Feuchtigkeit bedingte w iederholt eine Aufschotterung der Strasse. Zum Schluss sei ein 1947 ausgearbeitetes, aber nicht verw irklichtes riesiges Hafenprojekt erwähnt, welches grosse Flächen in A nspruch genom m en hätte.
63 S tadtarchiv K onstanz: Fasz. C V 59, B riefe 28. Feb. 1769 und 15. Okt. 1769; IVS D okum entation Thurgau: TG 3; S au ter 1777. Plan oder G rundriss über d ie L andstrasse durch das Thurgaw ; S taatsarchiv Zürich, B laues R egister: P fyn 1779, Is lik o n -K o n s ta n z 1782.
64 S tadtarchiv K onstanz: Fasz. C III 32 bezüg lich Sandgrube fü r Strassen- reparatur, 1768. Fasz. C II 4, 1727. Fasz. C 111 17, 1803.
4 4» '
1 1 4 >• %
Abb. 42: T ägerm oos. D er P rojektp lan von 1777, der bis zu r G renze be im O chsen den auch w irk lich gebauten oder ausgebau ten S trassenverlau f zeigt.
52 Him Untersee zum Seerücken - 10 00t) .Jahre Siedlungsgeschichte
Alte Bunker und rostiger Stacheldraht
Gefahr von Norden
D er Rhein war im m er w ieder Grenze: hie und da, aber nicht immer, eine ethnische, ein anderm al, auch nicht immer, eine politische, dann w ieder eine w irtschaftliche oder gar eine militärische. Selbstverständlich alles auch in beliebiger Kombination.
Als südlich des Rheins noch Reste der eiszeitlichen G letscher weite Flächen bedeckten, lagerten im Kesslerloch bei Schaftbausen bereits Rentierjäger. Als bei Kreuzlingen noch m ittelsteinzeitliche Jäger und Fischer zelteten, ackerten au f den Lössböden des Klettgaus bereits Bauern. In der Jungsteinzeit, in der anschliessenden Bronze- wie auch der frühen Eisenzeit scheint der Rhein keine völkertrennende Grenze gewesen zu sein. Dies änderte sich jedoch im Laufe des 1. Jahrtausends v. Chr. Damals wichen keltische Stämme dem Druck der Germ anen über den Rhein aus. Linksrheinisch entstand dam it eine Pufferzone zwischen den Germ anen im Norden und den Römern im Süden, ln röm ischer Zeit w ar die Nordgrenze der Schweiz von Basel bis St. M argrethen zweimal Reichsgrenze, einmal kurz um Christi Geburt, wohl zur Sicherung der geplanten Offensiven Richtung Donau und Neckar, dann w ieder ab Mitte des 3. Jahrhunderts, diesmal als befestigte Abwehrstellung.
Nach der relativ ruhigen alem annischen Landnahme in nachröm ischer Zeit war der Rhein in unserem Raum vom frühen bis ins hohe M ittelalter kein völkertrennendes Hindernis mehr. W eltliche Fürsten, aber auch Klöster, besassen beidseitig Ländereien. Erst m it der Eroberung des Thurgaus durch die Eidgenossen im Jahre 1460 m inderten sich die früher engen Verbindungen zum Hegau und zum süddeutschen Raum. Der Rhein wurde allm ählich w ieder zur Grenze, deren Schutz imm er w ieder Probleme stellte. Es sei hier kurz an den Schwabenkrieg 1499 oder an den Dreissigjährigen Krieg erinnert, in dessen V erlau fes 1633 den schwachen eidgenössischen G renztruppen nicht gelang, den schwedischen General Gustav Horn daran zu hindern, in einer überraschenden Aktion den rechten Flügel seiner Truppen über die Brücke bei Stein am Rhein zum Zangenangriff au f Konstanz zu führen. Im Schicksalsjahr 1799 wurde der Rhein w iederholt zum Kam pfgebiet zwischen Ö sterreichern und Russen au f der einen und Franzosen auf der anderen Seite. Auch im 19. Jahrhundert waren Truppenaufgebote zum Schutz des Grenzflusses nötig, so z. B. 1849 im eher kuriosen Büsingerhandel, als hessische Truppen per Schiff von Konstanz durch schweizerisches Hoheitsgebiet nach Büsingen fuhren, was der junge Bundesstaat gar nicht goutierte, oder 1856/57, als Preussen mit der Neuregelung der Stellung Neuenbürgs nicht einverstanden war.
Betrachtet man die G renzkarte des Thurgaus, so fallen einem sofort zwei Einfallsachsen auf: einerseits jene, die vom Hegau zum Rheinabschnitt zw ischen Stein am Rhein und Schaffhausen führt, andererseits die etwas beschwerlichere über den Bodanrücken zur See-Enge bei Konstanz. Beide Einfallspforten hat man seit röm ischer Zeit imm er
wieder befestigt, wobei die Geländeverstärkungen in der Regel gegen Angriffe aus Norden gerichtet waren. Ausnahmen bilden die Schanzen aus dem zweiten Koalitionskrieg von 1799 im Schaarenwald, die Erzherzog Karl, der G egenspieler Napoleons, zur Sicherung seines Brückenkopfes aufwerfen Hess, und die mittelalterlichen Stadtm auern von Diessenhofen oder die um Konstanz errichteten Befestigungswerke des 17. Jahrhunderts, die gegen Attacken aus dem Süden gebaut wurden.
Sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg schloss man die Grenzen fast hermetisch. Dadurch wurden die im G renzgebiet seit Jahrhunderten gepflegten w irtschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland gewaltig erschwert. Insbesondere war dies nach dem Aufstieg Hitlers der Fall. E indrücklich geben von dieser Zeit neben dem heute löchrigen Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz die militärischen Anlagen am Rhein und der so genannte Werkgürtel um Kreuzlingen Zeugnis.
Der Werkgürtel um Kreuzlingen
Der alte Kern von Konstanz liegt linksrheinisch. M ilitärisch gesehen ist er ein deutscher B rückenkopf au f Schweizer Seite. Die Befürchtung, dass deutsche Truppen in Konstanz ungehindert die Rheinbrücke benützen und aus Konstanz durch Kreuzlingen über den Seerücken zur Thur-Ebene stossen könnten, führte kurz vor und während des Zweiten Weltkrieges zum Bau einer der dichtesten Bunkerlinien weit und breit. Im darauf folgenden Kalten Krieg verstärkte und ergänzte man die Sperrstellung laufend.
Die rund 11,5 km lange Frontlinie mit der M asse der betongeschützten Kampfstände beginnt im Westen am See bei Triboltingen, steigt Richtung Süden zu den W aldrändern am Seerücken hoch und führt dann in südöstlicher Richtung nach Lengwil, wo sie gegen Norden zum See bei Bottighofen abbiegt. Sie um schliesst also Gottlieben, Tägerwilen und Kreuzlingen, oder, anders gesagt, grenzt diese O rtschaften aus. Die Kette um fasst m ehr als 80 Werke, von denen die eine Hälfte ab 1935 vom Büro für Befestigungsbauten geplant und ab 1937 gebaut wurde. Das Sap Bat 6 begann zur gleichen Zeit mit dem Bau von G eländehindernissen. 1939 waren zu Beginn des Aktivdienstes 42 Werke im Rohbau fertig (Abb. 43). Ab 1941 füllte die Grenzbrigade 7 die Lücken zwischen den Bunkern mit dem Bau weiterer Befestigungen. Zu den m it M aschinengewehren und Panzerabwehrkanonen ausgerüsteten Kampfbauten kam eine Riesenzahl weiterer Anlagen wie Beobachtungsposten, Panzersperren, Drahthindernisse, M inenfelder, Unterstände, Kommandobauten, M unitions- und M aterialstollen sowie Baracken usw. Ursprünglich bei W einfelden geplante A rtillerieforts mit 10,5-cm -Turm haubitzen wurden nicht ausgeführt, hingegen ergänzte man nach dem Krieg das Dispositiv mit jederzeit schussbereiten M inenwerferstellungen und zusätzlichen Unterständen.
54 Vom Untersee zum Seerücken - 10000 Jahre Siedlungsgeschichte
EichhofS JG. 275 /
5,73 O ^
Weiherhaur TG,2 2 6
Bernrain Nord1 6 .2 2
t m f : cBernrain 5üd
^TG 2 2 9 > _ .
^ V^Kiierne TG. 223
^ öO S 7 0
T r \
Abb. 44: K reuzlingen, W erkgürtel. Sektor E ichhof. B unker und H indernisse . F lugaufiiahm e und K artenausschn itt m it eingetragenem W irkungsraum der
Panzerabw ehrkanone im W erkhof Eichhof.
Vom Untersee zum Seerücken - 10 000 Jahre Siedlungsgeschichte 55
Abb. 45: K reuzlingen, W erkgürtel. S ek to r E ichhof. B lick aus dem W erk E ich h o f a u f das H indern is und zum W erk W eierhau.
Bunker und der Strassenbau von heute
Die Bedrohungslage und die W affentechnik haben sich verändert; die Arm ee wird in mehreren Schritten reorganisiert und verkleinert. Sie braucht zahlreiche Bauten nicht m ehr und m ustert gesam tschweizerisch über 13000 aus. So hat auch der gut sechzigjährige W erkgürtel um Kreuzlingen bis au f wenige Führungs- und Kampfbauten ausgedient.
Aus der Sicht des Archäologen ist die Kreuzlinger Bunkerlinie historisch nicht weniger bedeutend als die röm ischen W achttürme des 4. Jahrhunderts am Rhein, die auch etwa 60 Jahre die Grenze schützten. Eine integrale Erhaltung aller A nlagen ist allerdings weder sinnvoll noch finanzierbar. W ichtig und m achbar sind eine m öglichst gute D okum entation und die Erhaltung ausgewählter Objekte. 1999 übernahm der Kanton Thurgau eine Reihe von Kampfbauten.
Dem Strassenbau und den durch ihn bedingten G üterzusam m enlegungen mussten Teile des Bunkergürtels von Kreuzlingen weichen. W ährend im Bereich des Südportals des A utobahntunnels bei Bernrain nur wenige Bunker abgerissen wurden, verschwanden praktisch alle Infanterie- und Panzerhindernisse, die bis vor kurzem dem von Schwaderloh Richtung Kreuzlingen fahrenden Autom obilisten auffallen mussten.
In der beim Strassenbau ausgeschiedenen ökologischen A usgleichsfläche bei Bernrain erinnern zwei Bunker, es handelt sich um Infanteriewerke mit M aschinengewehren und Panzerabwehrkanonen, sowie ein Stück eines Infanteriehindernisses, d.h. eines Stacheldrahtverhaus, an die Zeiten des 2. W eltkriegs und des Kalten Krieges (Abb. 44, 45 ,46 ).
Abb. 46: K reuzlingen, W erkgürtel. W erk R öhrenm oos.
56
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter FundstellenDiverse Autoren, siehe Inhaltsverzeichnis
Fundstellen am Tägerm oos
Tägerwilen: ARA-Strasse
Entdeckung und Lage
Bei der Vorbereitung unserer Arbeiten lernten w ir Robert König, einen archäologisch interessierten Landwirt aus Tägerw ilen kennen. E r meldete uns den Fund der zwei Steinbeile 41 und 42. D arauf fanden wir das Steinbeil 43, m ehrere Silices, darunter den m esolithischen Kerbrest 7 sowie spärliche, bronzezeitliche Keram ikfragm ente. Diese Funde waren der erste Beleg dafür, dass w ir im Bereich zwischen Seerücken und Tägerm oos mit prähistorischen Fundstellen rechnen m ussten.65
Die Fundstelle liegt im ebenen Gelände, am Rand des Tägerm ooses, nahe der 400-m -Kote (Abb. 47, 1). Der U ntergrund besteht aus eiszeitlichem Seeton, der von Bachsedimenten überlagert ist. Bei Begehungen im März 1997 und im Februar 1998 beobachteten wir au f einer Fläche von ca. 40000 m- hunderte von aufgepflügten Fundobjekten: verw itterte Hitzesteine, Steinbeile, Silices und stark zersetzte, spärliche Keram ikfragm ente. W ir entschlossen uns, lediglich baubegleitende Untersuchungen durchzuführen.
Abb. 47: T ägerw ilen . S ituationsplan 1 :10000. ‘A R A -S trasse; H äg erm o o s; 3 A n der V ierten S trasse; “Ruet.
N ur unterhalb der gering fundierten ARA-Strasse, einem ehem aligen Feldweg, und dem angrenzenden W iesenstreifen entdeckten w ir Reste von Kulturschichten. Ein kleines Team untersuchte die Felder 1 -3 (Abb. 48).
Die Befunde
In Feld 1 stiess man im Mai 1998 a u f zwei parallele Reihen von undatierbaren Gruben.
Im Juni 1998 und August 1999 untersuchten w ir die Felder 2 und 3, wo wir die unm ittelbar unter dem Humus liegende Fundschicht 200/300 OK freilegten (Abb. 49).
Der sandige Lehm war spärlich mit H itzesteinen, Keram ikfragm enten und Steinartefakten durchsetzt (Abb. 50). Die Kulturschichtreste gingen fliessend in eine alte dunkle Bodenbildung mit zahlreichen Holzkohlepartikeln über. Hier fanden sich kaum Hitzesteine, nur wenige Keram ikfragm ente, dafür aber verm ehrt Silices. Unterhalb der Fundschicht folgte ein ockerfarbener Kies, Schicht 400, eine Ablagerung des benachbarten Baches. Die Basis der beobachteten Schichtabfolge bildet der blaugraue Seeton Schicht 500.
Die Funde(KNr. 1-128; Abb. 16 3 -1 6 8 ,8 . 126-137)
Winzige Geräte aus Silex -Zeugen der frühesten Bewohner des Thurgaus
Die kaum 15 cm mächtige Fundschicht enthielt oben vorwiegend bronzezeitliche, unten überwiegend neolithische und m esolithische Funde.
Aus den tiefen Abstichen der Fundschicht stam m en zahlreiche Silices (vgl. Tabelle Abb. 54). Abgesehen von einigen neolithischen A rtefakten fanden sich hier die Lam ellen 12 und 13, die fünf Rückenm esserchen 1 bis 5 sowie die Kerbreste 8 und 9, Abfallprodukte bei der Herstellung von Rückenlamellen und M ikrolithen. Der kleine Stichel 10 mit Endretusche und drei ausgesplitterte Stücke, z.B . 11 (Abb. 52), passen aufgrund ihrer geringen Grösse gut in ein Inventar, wie es für das späte Paläolithikum und das frühe M esolithikum in der Ostschweiz und in Süddeutschland belegt ist.66 Das kleine Fundensem ble lässt sich gut
65 JbSG U F 81, 1998 ,256 .66 G rotti 1993, 208, 212; Schlichtherle 1994a, 46.
Obere dritteS
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 57
710
Ausdehnung der erhaltenen Fundschichten (geschätzt)
Streuung der Oberflächenfunde auf dem Acker
351
7 ^ Ausdehnung XI (Bauprojekt)
^ \x \\x x ^ x < x c ^ x x \\\7 \
3 5 3
150m100m50mOm
Abb. 48: T ägerw ilen: A R A -S trasse . S ituation 1:1000.
Abb. 49: Tägerw ilen: A R A -Strasse. D ie G rabung im B ereich der A R A - Abb. 50: T ägerw ilen: A R A -Strasse. K ulturschichtreste m it h itzeversehrtenStrasse. U nterhalb der F undschichten sind der helle B achkies und der eis- S teinen und K eram ik. Im angrenzenden A cker w eggepflügt,
zeitliche blaugraue Seeton gut sichtbar.
58 Nationalstrasse A l - Katalog aus gewählter Fundstellen
Abb. 51 : H erstellung eines G eschosseinsatzes.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 59
Abb. 52: T ägerw ilen: A R A -S trasse . D ie A ussp litterungen an d iesem Silex- Abb. 53: Tägerw ilen: A R A -Strasse. N eolithische Pfeilspitzen aus Silex (M 2:1 ).G erät s tam m en von einer m eisse ia rtigen V erw endung des W erkzeuges.M eso lith ikum (M 3:1).
vergleichen m it jenen des Seebachtals, welche zusätzlich Dreiecke enthalten, die für das frühe M esolithikum charakteristisch sind. Die zahlreichen Stichel jener Fundstellen erinnern an die spätpaläolithische «Fürsteiner- Fazies».67 Das Fundmaterial aus Tägerwilen-ARA datiert in die Zeit zw ischen 10 0 0 0 -7 0 0 0 v.Chr. und ist damit älter als jenes der nahe gelegenen Fundstelle Töbeli, die aufgrund der trapezförm igen M ikrolithen eher ins späte M esolithikum einzustufen ist.68
Keramik und Steingeräte aus der JungsteinzeitAus dem oberen Bereich der Fundschicht gibt es nur we
nige neolithische und bronzezeitliche Objekte. Die M ehrzahl der A rtefakte stammt aus dem unteren Bereich. Im verm ischten Fundbestand können nicht alle Scherben einwandfrei als neolithisch erkannt werden. Dies gilt etwa für die klein fragm entierten Stücke 54 bis 64 mit gerundeten und ausladenden Rändern. Zu den identifizierbaren neolithischen Funden gehören die zwei fein gearbeiteten, einfach durchlochten Henkelösen 52 und 53, die länglich-oval und sehr regelm ässig gearbeitet sind.
Von besonderer Bedeutung sind die Fragmente 46 -5 1 von m indestens sechs fein gem agerten Kugelbechern mit m arkanter Schulter (Abb. 24). Sie weisen oberhalb des Schulterknicks eine Reihe von E instichen auf. Bei m indestens zwei Fragm enten sind die Eindrücke m it den Gelenkenden von Kleintieren, z.B. Vogel- oder K leinsäugerknochen, eingepresst worden. Eine dieser Scherben ist so gut erhalten, dass sich unterhalb des W andknicks au f der W andung Reste einer Ritzverzierung erkennen lassen. Bei zwei weiteren Fragm enten wurde die Einstichreihe m it einem spitzen Instrum ent eingetieft.
D ie drei Pfeilspitzen 17 bis 19 aus dem unteren Bereich der Fundschicht dürften ins Neolithikum gehören (Abb. 53). Nr. 20 ist aus Bergkristall. Die zeitliche Stellung zahlreicher Silexabschläge, Absplisse, Klingen und Lamellen sowie Kern fragmente und Silextrüm m er ist kaum zu beurteilen; sie können bronzezeitlich, neolithisch oder älter sein (Abb. 54).
W ichtige Anhaltspunkte für die Datierung geben die so genannten D ickenbännli-Bohrer 22 bis 40, welche zur Herstellung von Röhrenperlen aus Kalkstein dienten (Abb. 55), und das Fragment des Silexbeiles 21. Beilklingen
dieser A rt sind bisher in der Region nur wenige bekannt geworden, so bei Erm atingen-Ägersten69 und im nahen K onstanz-Rauenegg, woher auch die Scherbe eines Rössener K ugelbechers70 stammt.
Die fünf Steinbeile resp. Beilfragmente 41 bis 45 von unterschiedlicher Form können ebenfalls zur Datierung beigezogen werden. Spitznackige Beile werden im Bodenseeraum ins frühe Jungneolithikum , in die frühe Pfyner Kultur oder älter datiert.71 Folgende Fundvergesellschaftung ist charakteristisch für das frühe Jungneolithikum an der Wende vom 5. zum 4. Jahrtausend v.Chr.72: Dickenbännli-67 L euzinger 1998, 43.68 G rotti 1993 ,221 .69 K eller-T am uzzer u. R einerth 1925, 71, A bb. 15; W illiger u. H asenfratz
1985, 158.70 Schlichtherle 1990a, Taf. 60, 1349, 1351.71 W iniger u. H asenfratz 1985, 170, 191, 232.72 Schlichtherle 1990a, 13 6 -1 4 9 .
Fund
schi
cht
Stre
ufun
de
Tota
l
Rückenmesser 5 0 5Kerbrest 3 1 4Pfeilspitzen 4 0 4
Silex-Beil 1 0 1Dickenbännlibohrer 21 0 21Stichel 1 0 1Stichellamellen 1 0 1
Lamellen 10 0 10retouchierter Abspliss 1 0 1Klinge 5 1 6Abschläge 45 2 47
Absplisse 116 1 117Kernfragmente 8 1 9ausgesplitterte Stücke 3 0 3Trümmer 81 0 81
Total Anzahl Silices 305 6 311
Abb. 54: T ägerw ilen: A R A -S trasse . Typologische V erteilung der m esolith i- schen und neolith ischen S ilex-G eräte.
60 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Bohrer, spitznackige Steinbeile und Silexbeile, feingearbeitete Keramik mit Ösen sowie Kugelbecher. Entlang des Bodenseeufers und des Rheins gehören diese Funde zum frühesten Beleg einer bäuerlichen Besiedlung überhaupt. Durch Einzelfunde wird auch eine Nutzung des Hinterlandes offenkundig. So fand man beispielsweise in der hoch gelegenen Höhle bei M ett-Oberschlatt, W ildensbucher Hochwacht, Pfeilspitzen zusam m en mit Dickenbännli- B ohrern.73
Ü berreste aus dem frühesten Abschnitt des Jungneolithikum s sind im Bodenseeraum oft m it M aterial aus anderen Besiedlungsphasen verm ischt, so auch im Töbeli und in Tägerwilen-ARA. In Steckborn-Turgi fand sich ein Kugelbecherfragm ent der Zeit vor 4200 v. Chr. im Bereich des Siedlungsareals der frühen Pfyner Kultur um 3900 v.Chr.74 Das Gleiche gilt für Hornstaad-H örnle, wo ältere Kugelbecher und Silexbeile im Fundbestand der frühen Pfyner Kultur nachgewiesen sind.75 Kugelbecher sind charakteristisch im ausgehenden 5. Jahrtausend v.Chr., im Epirössen76 und der Egolzwiler Kultur. Sie treten ausserdem in der A ichbühler Kultur a u f .77 Die M ehrheit der Funde am Bodenseeufer, v.a. das Becherfragm ent aus Steckborn-Turgi und die Funde aus Tägerwilen-ARA, stehen den Bechern von Schellenberg-Borscht und den W auwiler Kugelbechern form al nahe, sind jedoch eher schärfer profiliert. M it ihrer sehr prägnanten Schulter sowie der eher flachen unteren Wandung lassen sie sich dafür gut mit den Funden aus Steckborn-Turgi und aus den deutschen Stationen Aichbühl, H ornstaad-H örnle I, G aienhofen-Hem m enhofen-im Bohl und Unteruhldingen vergleichen.78 Daneben kommen am südlichen Bodenseeufer auch flauer profilierte Kugelbecher in Rössener Tradition vor, so beispielsweise in der kaum zwei Kilometer entfernten Fundstelle Konstanz-Rauenegg.79 Feingearbeitete und einfach durchlochte Ösen finden sich in der N ordostschweiz und in Süddeutschland sowohl in der frühen Pfyner Kultur in H ornstaad80, im Epirössen in W ilchingen81 wie auch in der Lutzengütle-Kultur, so in H erblingen-G rüthalde.82 Das Verbreitungsgebiet der scharf profilierten Kugelbecher lässt sich somit au f den Raum Klettgau, Schaffhausen, Bodensee, Federsee und Rheintal einengen.83
Für den unteren Bereich der Fundschicht m it den vorwiegend neolithischen und mesolithischen Funden ergaben 14C-M essungen ein frühbronzezeitliches Datum.
Abb. 56: T ägerw ilen: A R A -S trasse . Fragm ente v erz ie rte r G efasse der späten F rühbronzezeit / frühen M itte lb ronzeze it (M 1:1).
Keramik der jüngeren Frühbronzezeit und älteren M ittelbronzezeit
Der grösste Teil der Keramik stammt aus den oberen Abstichen der Fundschicht. Er um fasst 2316 kleinfragm entierte Scherben mit einem Gesam tgewicht von 5 kg. Die auswertbare Keramik setzt sich aus 56 Randscherben, 87 verzierten W andscherben und 17 Bodenscherben zusammen. Von diesen 160 Gefässindividuen lassen sich 24,8% der Feinkeramik und 74,3% der G robkeram ik zuordnen; 0,9% bleiben unbestimm t.
Die Scherben datieren in die jüngere Frühbronzezeit und ältere M ittelbronzezeit. Bronzeobjekte konnten nicht gefunden werden. U nter der Feinkeramik sind K nickwandschalen vorhanden, die z.T. m it Henkel oder m it Grifflappen versehen sind, 73 -7 6 . Die Ränder 54, 55 und 59 der Feinkeramik sind ausladend und gerundet. An Verzierungselem enten finden sich Rauten-M otive aus Schrägstrichdreiecken, z.B . 77 (Abb. 56), das gekerbte W inkelband 83, gepunktete Dreiecke, 78, flächendeckende Punkt-M otive, 82, sowie Rillen kom biniert mit einer Einstichreihe, 81.
Abb. 55: T ägerw ilen: A R A -S trasse . B ohrer aus Silex zu r F ierstellung von Perlen aus K alkstein (M 2,5:1 ). F rühes Jungneolith ikum .
JbS G U F 82, 1999, 247.W iniger u. H asenfratz 1985, 56, Taf. 13.13.Sch lich therle 1990a, 98.Stöckli 1995.31 .Schlichtherle 1990c, 141; S chröter u. Schröter, 1974, 169, 170, A bb. 5.2, 5.4.Schlichtherle 1990c, 141, Abb. 9; Schlichtherle 1990a, Taf. 9.76, Taf. 58.1268; G leser 1995, Taf. 6 3 .2 -6 ; W iniger u. H asenfratz , 1985, Taf. 13.13.Schlichtherle 1990a, Taf. 60. 1349.D ieckm ann 1990, Abb. 17.3, 6, 7.S töckli 1995, zu W ilchingen (SH ) Abb. 13.5, zu Schellenberg-B orscht (FL) Abb. 13.S töckli 1995, Abb. 13.34; zu E schen-L utzengütle FL, D rack, 1969, 69, 70, Abb. 6.6.Schlichtherle 1990b, 2 1 7 -2 1 8 , Abb. 8.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 61
Grobkeram ische Vorratsgefässe haben M ündungsdurch- m esser von über 4 0 -5 0 cm. Die unterhalb des Randes horizontal verlaufende Fingertupfenleiste dient zur Zierde und zur Verstärkung der verhältnism ässig dünnen W andung (Abb. 56).84 Oft war auch der Hals- und Schulterbereich mit F ingertupfenleisten verziert. Diese können auch vertikal verlaufen oder verzweigt sein. Im Schulterbereich sind die Fingertupfenleisten oft mit ziem lich grob gefertigten Grifflappen kombiniert. Auch glatte Leisten sind vorhanden.
Die Ränder grobkeram ischer G elasse mit M ündungsdurchm essern zwischen 15 und 30 cm sind vorwiegend ausladend oder steil orientiert, in wenigen Exemplaren auch einziehend ausgeprägt. Neben gerundeten kommen gekantete Ränder vor.85 Horizontal abgestrichene Ränder sind zwar vorhanden, jedoch im Gegensatz zu den charakteristischen Rändern der späten M ittelbronzezeit nicht verdickt, z. B. Nr. 91. Zu den Randform en und Verzierungen siehe Abb. 95 im Kapitel zu Hochstross.
H äufig sind Fingertupfenverzierungen au f der Randlippe, 9 9 -102 ; auch flächendeckende Fingertupfen au f der G elasswandung treten auf, z.B. 114. Schlickauftrag ist bei der Grobkeramik zum eist unterhalb der Schulter vorhanden, der Halsbereich ist oft fein verstrichen, z.B. 84. Weiter finden sich die Randscherben 103 und 104 von grobkeram ischen Kalottenschalen.
D ie D atierung der Funde der jüngeren Frühbronze-/ älteren M ittelbronzezeit
Die Keram ikformen und Verzierungen, insbesondere der «reichverzierte» Stil mit Rhomben, W inkelbändern und Ritzen, lassen sich gut m it dem M aterial aus der jüngeren Frühbronzezeit der Ostschweiz und Süddeutschlands vergleichen,86 deren Dendrodaten in die Zeit zwischen der Mitte des 17. und Mitte des 16. Jhs. v.Chr. fallen .87
Die 14C-Daten Nr. 1 und 2, Abb. 224 und 225 im Anhang, fallen indes jünger aus. Sie liegen mit ihren Extremwerten im frühen 16. Jh. und im 15. Jh. v.Chr., d.h. im älteren Abschnitt der M ittelbronzezeit.
Tägermoos
Oberes Tägermoos und Ruet (Funde: KNr. 129-133; Abb. 169, S. 138-139)
In den 1930er-Jahren fand Alfons Beck in der Flur Ruet nahe dem M ThB-Bahnhof Tägerwilen (Abb. 47, 4) den Silex-Bohrer 129, der m it den frühjungneolithischen D ickenbännli-Spitzen aus der nahe gelegenen Fundstelle A RA-Strasse (Abb. 47, 1) verglichen werden kann.88 Die Fundstelle liegt im flach ansteigenden Gelände au f einer Höhe von gut 4 1 0 -4 1 5 m. ü. M.
A uf einem Acker (Abb. 47, 2) unterhalb der Fundstelle Ruet lasen wir 1997 weiteres prähistorisches M aterial auf: die frühjungneolithische Röhrenperle 132 aus Kalk, mehrere Silices, darunter die Pfeilspitze 130 und der retuschierte Abschlag 131. Die 1998 au f Grund dieser Funde abgetieften
Sondierschnitte waren bis au f einen fundleer. Lediglich in Schnitt 10 konnten Rgste eines bronzezeitlichen Horizontes nachgewiesen und wenig Keramik, darunter das Stück 133 mit Fingertupfenleiste, geborgen werden.
Aus der nahen Flur O kenfiner besitzen wir eine alte Fundmeldung über ein Bronzeringlein und einen angeblich bronzezeitlichen Spinnwirtel, der verschollen ist. Das Ringlein könnte gut aus der Bronzezeit stam m en.89
Funde am Rand des Tägermooses An der Vierten Strasse und Noppelsgut
Im Verlaufe unserer Arbeiten lernten wir das Ehepaar Göpfrich aus Konstanz kennen, das bei der Suche nach mittelalterlichen und neuzeitlichen Schätzen im Vorfeld der Stadt Konstanz zwei neolithische Fundstellen entdeckte. Ein Steinbeil (Abb. 58) und Silexabschläge stammen vom N oppelsgut am Rand des Tägerm ooses (Abb. 57, 3). In ver-
84 F ingertupfenleiste horizontal: 9 3 -9 5 ; am Hals: 1 0 5 -1 2 5 ; vertikal/ verzw eigt: 105 -107 ; kom bin iert m it G rifflappen: 108; g latte Leisten: 12 6 -1 2 7 .
85 ausladend/steil: 8 4 - 9 0 ; einziehend: N rn. 91, 92; gerundet: 58, 5 6 - 6 4 ; 8 4 - 8 6 ; gekan tet 8 7 -9 0 .
86 E gg-O bere Güll (D ), A rbon-B leiche 2 und B odm ann-Schachen (D) Schicht C.
87 K öninger 1995, 72; H ochuli, K öninger u. R u o ff 1994, 275.88 Beck 1961, 28. F ü r H inw eise zu den E n tdeckungen seines Vaters danken
w ir H errn Volcker M artin-B eck89 JbSG U 27, 1935, 34; TB 74, 1937, 71; JbSG U 34, 1943 ,42 .
Obere dritte Strasse
'Ut
Oknr i— ;O b f !• C H ü
Abb. 57: T ägerw ilen . Situationsplan 1 :10000. 1 H ochstross; 2H ochstross, F undort B ronzenadel; 8 N oppelsgut; 4O bere D ritte Strasse, F undort B ronzenadel; 5A n der Z w eiten Strasse, F undort B ronzepfeilsp itze.
62 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Abb. 58: T ägerw ilen: N oppelsgu t und A n der V ierten Strasse: Steinbeile (M 1:2), Jungneolith ikum . Sam m lung G öpfrich , K onstanz.
gleichbarer topographischer Lage stiessen sie an der Vierten Strasse (Abb. 47, 3) au f Silices und ein Steinbeil (Abb. 58). Dank dieser Informationen fanden wir am gleichen O rt einen flachen Netzsenker.
W ie Tägerwilen ARA-Strasse und Töbeli zeigen die beiden Fundstellen im N oppelsgut und an der Vierten Strasse eine intensive Nutzung des Geländes und auch Siedlungstätigkeit am Rand des Tägerm ooses im Neolithikum. Die Datierung dieser beiden Fundstellen ist schwierig, da Keramik fehlt. Das Steinbeil vom N oppelsgut verfügt über einen gepickten Nacken und ovalen Querschnitt. Im Bodenseegebiet sind diese Beilformen für die Pfyner Kultur typisch. Dem gegenüber lässt sich das Beil von der Vierten Strasse nicht näher als ins Jungneolithikum datieren.
An der Zweiten Strasse
Im April 1998 meldete Herbert Böhler, Landwirt in Tägerwilen, er habe au f seinem A cker (Abb. 57, 5) eine bronzene Pfeilspitze gefunden, aber keine Begleitfunde beobachtet. Die gestielte Pfeilspitze, deren M ittelrippe eine knopfartig verdickte Basis aufweist, findet Vergleichsstücke in der Spätbronzezeit (Abb. 97, S. 87).90
Aus der M itte des Tägerm ooses waren uns bislang keine prähistorischen Funde bekannt. Die bronzene Pfeilspitze deutet darauf hin, dass in prähistorischer Zeit das heute trocken liegende ehem alige Sum pfgebiet begangen und dort gejagt worden ist.
Tägerwilen: Gottlieberwise
Dörfer der Jungsteinzeit am Untersee (Funde: KN r. 134-148; Abb. 170-172, S. 140-145)
Seit langem werden im Uferstreifen westlich von Tägerw ilen Funde aus der Jungsteinzeit gem acht. 1943 fand der M etzger Jakob Schwarz beim Eingraben eines Kadavers das Fragment einer Lochaxt.91 Der Fundort liegt au f ca. 400 m Höhe im Uferstreifen, der an dieser Stelle etwa 600 M eter breit ist. U nm ittelbar südlich des Fundplatzes beginnt das Gelände zu einer Terrasse anzusteigen.
Das Fundstück gelangte seinerzeit ins Heim at-M useum Rosenegg in Kreuzlingen, ist aber heute verschollen. Glücklicherweise verfügen w ir über eine alte Fundzeichnung
90 B ernatzky-G oetze 1987, 97, Taf. 152 .12-14 .91 JbSG U 36, 194 5 ,4 7 ; T hurgau ische B eiträge 1948, 51/52.
Gottlieben
,0.5km
A bb. 59: T ägerw ilen . S ituationsplan 1:10000. 1 U nderi und Oberi G ottlieberw ise; 2Oberi G ottlieberw ise; Steinbeilfund J. Schw arz 1943; ’ W inkel; 4Tri- boltingen-H ofw isen .
Nationalstrasse A7 - Katalog aus gewählter Fundstellen 63
A bb. 60: T ägerw ilen: O beri G ottlieberw ise. L ochax t und Steinbeil. N eo lith ikum . Sam m lung Ch. M athis, Ö sterreich .
von Karl Keller-Tarnuzzer. Die Lochaxt weist einen rechteckigen Querschnitt au f und ist von schlanker, länglicher Form. Steinbeile ähnlicher M achart finden sich in der Bodenseeregion in spätneolithischen Horgener Schichten.92
500 M eter östlich des Fundortes fand Alfons Beck um ca. 1940 Silexabschläge au f einem A cker der Flur Winkel (Abb. 59, 3). Er war der Ansicht, dass diese Funde m esolithisch sein könnten. Dies ist bis heute nicht auszusch- liessen93, sie könnten aber auch neolithisch sein.
Von weiteren Funden in der Gottlieberw ise haben w ir erst ab den 1980er-Jahren Kenntnis. Damals fanden Robert König und Christian M athis v ier Steinbeile, eine Lochaxt und m ehrere Silexgeräte (Abb. 60).94 Im Som m er 1999 entdeckte Robert König m ehrere Dutzend Steinbeile in den Fluren Underi und Oberi Gottlieberw ise (Abb. 59, 1; Abb. 22). Die Fundobjekte zeigen Beschädigungen und Rostspuren von m odernen Ackergeräten.
Bei Triboltingen las Familie Plüer zw ischen den 60er- und 90er-Jahren bei der Bewirtschaftung ihres Ackers in der Flur Hofwisen fünf Steinbeile au f (Abb. 59, 4). Die Fundstelle liegt am Fuss einer Terrassenkante im flachen U ferstreifen au f einer Höhe von 400 m. ü. M. An derselben Stelle fanden w ir 1997 Silexabschläge und H itzesteine.95
Rasch fortschreitende Zerstörung von archäologischen Fundstellen im Uferstreifen
Der Fundbereich Gottlieberw ise liegt im flachen U ferstreifen au f einer Höhe von ca. 397 m und umfasst min
destens 10000 n r . Das Areal war übersät mit Dutzenden, wenn nicht H underten von Hitzesteinen; Keram ik fand sich nicht. Es wurde erst 1947 drainiert und wird seither beackert. Zuvor befanden sich hier ufernahe Rietwiesen. Wie an mehreren Stellen au f dem Acker gut sichtbar war, greift der Pflug heute bereits hinunter au f die Seekreide. Erhaltene Kulturschichten sind kaum noch zu erwarten. N icht ausgeschlossen ist jedoch die Erhaltung von Pfahlspitzen unterhalb der Drainagen.
Die ufernahen Ä cker entlang dem Untersee w urden beim Jahrhunderthochw asser 1999 überschwemmt. Beim A ustrocknen der Böden nach dem Ablaufen des Wassers schrum pfte der w assergesättigte Humus. Dadurch ergibt sich für die Ackerbearbeitung zwangsläufig, dass tiefer gepflügt werden muss. Um dem Hum usschwund nach Hochwassern zu begegnen, wurden die betroffenen ufernahen Parzellen bereits vor Jahren aufgeschüttet und dam it für die archäologische Forschung zerstört. Die Fundstelle, die von Robert König lokalisiert werden konnte, liegt a u f dem letzten noch nicht aufgeschütteten Acker.
Zur D atierung der Funde von der GottlieberwiseDie Sammlungen König und M athis bestehen gesam thaft
aus 78 prähistorischen Artefakten. Neben 42 Steinbeilen und
92 W iniger u. H asenfratz 1985, Taf. 62.1; 70.8." B eck 1961 ,28 .94 JbSG U F 81. 1998 ,264 ." JbS G U F 81, 1998 ,260 .
64 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Steinbeilfragm enten sowie 31 Silices findet sich eine Lochaxt, ein Steinbeilrohling sowie ein Klopf- und ein Läuferstein. Laufend findet Herr König weitere Objekte.
Die Mehrzahl der Steinbeile verfügt über einen walzenförm igen Querschnitt, wobei au f der O berfläche Spuren der Pickung sichtbar sind. Sägespuren au f einzelnen Stücken verraten die Sägetechnik. Es dürfte sich vorwiegend um Steinbeile der Pfyner und Horgener Kultur handeln (z.B . Nr. 146).
U nter den 31 Silices fällt die Klinge des langen Dolches 148 auf. Die Form erinnert an Grand-Pressigny-Dolche, Importe aus dem Pariser Becken in schnurkeram ischer Zeit. A uf eine schnurkeram ische Siedlungsphase könnte auch das spitznackige kleine Steinbeil 147 hinweisen, wobei diese Form allerdings auch im frühen Jungneolithikum häufig ist. Weiter findet sich die spitzenartig retuschierte Klinge 135 m it verjüngter Basis. A bgesehen von der Pfeilspitze 134 fin den sich Kratzer und Schaber. Die meisten der retuschierten Abschläge gehören zur Kategorie W erkzeuge. Zahlreiche nicht m odifizierte A bschläge tragen G ebrauchsretuschen oder sekundäre Beschädigungen. Die retuschierten Klingen 138 und 139 dürften als Einsätze von Erntem essern interpretiert werden. Auch ein Bohrer gehört zum Inventar.
Zusam m enfassend geht aus den Lesefunden hervor, dass im ufernahen Gelände Hinweise a u f eine Besiedlung zur Zeit der Pfyner, der Horgener und der schnurkeram ischen Kultur gegeben sind. Das besprochene Fundmaterial ist w ichtig für das Verständnis der jungsteinzeitlichen Befunde im Bereich der Autobahngrabungen.
Kreuzlingen: Töbeli
5000 Jahre Siedlungsgeschehen am Tägermoos
Entdeckung und Lage
Kreuzlingen-Töbeli liegt am Rande des Tägerm ooses au f verlandetem Seeboden im Bereich der 400-m-Kote, also au f der gleichen Höhe wie zahlreiche andere prähistorische Stationen entlang von Boden- und Untersee (Abb. 61, 62).
Die Fundstelle wurde im August 1997 entdeckt. Unsere G rabung von Novem ber bis Mitte Dezem ber 1999 und baubegleitende Beobachtungen erlauben es, die Ausdehnung der fundfuhrenden Schichten au f ca. 1000 m 2 zu beziffern. W ährend die nördliche Grenze der Fundstelle gut bestimm t werden kann, bleibt die Ausdehnung in südlicher Richtung unbekannt, da hier keine Bodeneingriffe gem acht wurden.
Der Ablauf der Grabung
Für die G rabung wählten wir ein lokales Koordinatennetz und öffneten drei Grabungsfelder. Die Deckschichten w urden bis dicht über der Kulturschicht mit dem Bagger entfernt. Beim anschliessenden Handabtrag sam m elten w ir das Fundmaterial getrennt nach m 2 und nach A bstichen au f (Abb. 63).
Snufitfch
Abb. 61: K reuzlingen: Töbeli. S ituation 1:10000.
Silices, M etallobjekte und spezielle Kleinfunde wurden dreidimensional eingem essen. Die Fundschicht 300, die M aterial m ehrerer Zeitstellungen enthielt, liess sich erst beim Zeichnen des Profils in 310, 320 und 330 unterteilen. Fundführend sind die Schichten 310 und 320 (Abb. 65).
T Dokumentierte Baugrubenprofle
1----- ̂ Grabungsfelder
Ausdehnung der erhaltenen . C Fundschichten (geschätzt)
\ \ ^7^1 Ausdehnung der ErdarbeitenJ N (Bauprojekt) ________
279600
7 0 3
Abb. 62: K reuzlingen: Töbeli. S ituation 1:1000.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 65
Abb. 63: K reuzlingen: Töbeli. G rabungsm itarbe iter 1997.
Geoarchäologische Beobachtungen96
Bei der Unterführung Töbeli sind drei PVC-Rohre eingetieft worden, die zusamm en eine Sedim entsäule von knapp 1,8 m erfassen (Abb. 64). Das Profil reicht von einer graubeigen Zone an der Basis, unterhalb von einigen dunklen, torfreichen Lagen, bis zur G rabungsoberkante bei 401,60 m ü.M.
Ein kurzer Profilbeschrieb, Resultate der optischen Untersuchungen und Angaben zu den Sedim entationsphasen und den Ablagerungsm ilieus sind in Abb. 66 zusam m engefasst. Die Tabelle Abb. 67 enthält Angaben zur Chemie.
Die schlecht konservierte archäologische Schicht 310, Abb. 68 oben, ist durch intrasedim entäre Bewegungen, d.h. Quellungs- und Schrum pfungsphänom ene, überprägt. Eine Beteiligung von aufgelöstem Hüttenlehm kann vermutet werden, ist aber nicht sicher nachweisbar. Infolge des kalkfreien Sedim entes haben sich nur verbrannte Knochen erhalten. A llfällige organische sowie phosphathaltige Bestandteile oder Gefügeveränderungen, die au f m enschliche Begehung hinweisen könnten, haben sich nicht erhalten.
Schicht 320, Abb. 68 Mitte, ist ein durch Staunässe überprägter Verwitterungshorizont der Schicht 400 (pseudo- vergleyte Braunerde). Staunässe führte zu leichten, intrasedim entären Quellungs- und Schrum pfungsphänom enen.
Abb. 64: K reuzlingen: Töbeli. E ntnahm e der Proben fü r d ie geoarchäo- logischen U ntersuchungen.
Staubige Porenfüllungen weisen au f vegetationsfreie, denu- dierte Oberflächen in den darüber liegenden Schichten hin und markieren m enschliche Aktivitäten.
Schicht 400, Abb. 68 unten, ist eine leicht organische Hochflutablagerung. Das Auesedim ent ist im oberen Teil geringfügig durch jüngere Bodenbildungsprozesse verw ittert und durch Staunässephänom ene leicht überprägt. Sie ist das
96 D ie Z usam m enstellung basiert a u f einem M anuskrip t von Philippe R entzel und M arcel Joos. D er volle Text b eschreib t e ingehend die R esu lta te der optischen, chem ischen und g ranu lom etrischen U ntersuchungen und enthält K ornsum m enkurven , K onzentrationsdreiecke und m ikroskopische A ufnahm en. E r kann beim A m t fü r A rchäologie eingesehen werden.
Schichten
Abb. 65: K reuzlingen: Töbeli. S üdprofil P rofil 1. M 1:50.
Dat
ieru
ng
66 Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
§2
.s oo -O >
illo >
uoiieiueim pasaasuoj)e)uaui!pasLUM8|anv
COID
I I
o 2
è x
Abb
. 66
: K
reuz
linge
n: T
öbcl
i. Z
usam
men
fass
ung
der
Res
ulta
te
geoa
rchä
olog
isch
er
Unt
ersu
chun
gen.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 67
Probe Prozentualer Anteil Farbeinheiten pH
z Kar
bona
t (%
)
Dol
omit
(%)
Glü
hver
l. (%
)
Ph
osp
ha
tco
lori
-me
tris
ch
Hu
mu
sco
lori
-me
tris
ch
pH
- W
ert
37 0.0 0.0 5.5 1.2 0.2 7.336 0.0 0.0 5.5 1.2 0.2 7.335 0.0 0.0 5.5 1.3 0.2 7.334 0.0 0.0 6.0 1.5 0.2 7.333 0.0 0.0 5.0 1.5 0.4 7.432 0.0 0.0 5.0 1.5 0.5 7.531 0.0 0.0 5.0 1.4 0.5 7.530 0.0 0.0 5.5 1.5 0.6 7.629 0.0 0.0 5.5 1.9 0.6 7.628 0.0 0.0 5.5 2.3 0.7 7.628 0.0 0.0 5.5 2.3 0.7 7.627 7.0 5.0 5.0 2.1 0.0 7.626 19.0 10.0 4.0 2.2 0.0 7.725 28.0 11.0 4.0 2.5 0.0 7.624 32.0 12.0 3.5 2.6 0.0 7.623 33.0 12.0 3.5 2.9 0.0 7.622 33.0 12.0 3.5 3.2 0.0 7.521 32.0 10.0 4.0 2.9 0.0 7.520 31.0 11.0 3.5 2.2 0.0 7.619 37.0 15.0 3.0 2.7 0.0 7.518 31.0 12.0 3.5 2.9 0.0 7.517 25.0 11.0 4.0 2.6 0.0 7.316 23.0 10.0 5.0 2.5 1.5 7.415 15.0 9.0 4.5 2.2 0.0 7.314 17.0 12.0 4.5 2.4 0.0 7.213 15.0 11.0 5.0 2.2 0.0 7.312 5.0 3.0 6.0 2.0 0.0 7.111 4.0 2.0 6.5 1.9 0.0 7.110 3.0 1.0 7.0 1.7 0.0 7.19 4.0 2.0 9.5 1.6 1.1 7.38 11.0 6.0 8.0 2.2 0.5 7.27 3.0 1.0 21.0 2.1 4.2 7.06 32.0 8.0 7.0 2.9 1.3 7.55 26.0 13.0 6.0 2.7 0.1 7.54 16.0 7.0 21.5 2.5 2.3 7.33 52.0 9.0 4.0 2.8 0.1 7.62 50.0 8.0 5.0 2.2 0.1 7.61 56.0 4.0 4.0 1.3 0.1 7.8
A bb. 67: K reuzlingen: Töbeli. K arbonat- und D olom itante ile , G lühverlust, Phosphat-, H um us- und pH -W erte.
Ausgangsgestein für die darüber liegende Bodenbildung in Schichten 330 bis 310.
Die Befunde
D ie StratigraphieIm Töbeli dokum entierten wir eine Schichtabfolge bis au f
über zwei M eter Tiefe. Die Schichten reichen von der frühen N acheiszeit bis in die Bronzezeit. An der Basis findet sich ein eiszeitlicher Beckenton, Schicht 600, der von Seekreide, unterbrochen von organischen Bändern, überlagert wird, Schicht 500. Über der Seekreide folgt ein ockerfarbener Auelehm, Schicht 400, der in einen dunklen Lehm übergeht, in dem Reste der prähistorischen Kulturschicht erhalten sind, Schichten 310-320 . Wie die sedim entologischen U ntersuchungen zeigen, führte die Staunässe zu einem Schrum pfen und Quellen der Schichten mit archäologischen Funden. Ehem alige Gehhorizonte und Strukturen konnten sich unter diesen Bedingungen nicht erhalten.
Die FundverteilungIm oberen Bereich ist die Kulturschicht 310 mit zahl
reichen hitzeversehrten Steinen, verw itterten Keram ikfragm enten und wenigen Silices durchsetzt. Es finden sich
vorwiegend frühbronzezeitliche, aber kaum neolithische Objekte. Im unteren Bereich sind verm ehrt neolithische Silices und Keram ik der jüngeren Frühbronzezeit/älteren M ittelbronzezeit sowie zahlreiche Hitzesteine zu vermerken.
Abb. 68: K reuzlingen: Töbeli. M ikroskopische D ünnschliffe, B ildbreiten: 4 .4 m m. Fotos Ph. Rentzel.O ben: Schicht 310: In der unteren B ildhälfte dunkelb raunes, von R issen durchsetz tes und in A uflösung begriffenes K eram ikfragm ent. H olzkohle ist durch w iederholte Q uellungs- und Schrum pfungsvorgänge der ton igen , m it E isen- und M anganausfällungen (rech te obere B ildecke) durchsetz ten M atrix überpräg t w orden. Parallele Polarisationsfilter.M itte: Schicht 320. V erw itterter, kalk fre ier A uelehm , hydrom orph überprägt. D ie S taunässeanzeiger äussern sich in Form brauner, oxydierter Z onen, ne tzstre ifig ausgerichteter, ge lber T onm atrix sowie geringer Porositä t m it vertikalen R issen. G ekreuzte Polarisationsfilter.U nten: Schicht 400. Feinsandiger A uelehm m it inkohlten o rganischen R esten. Parallele Polarisationsfilter.
68 Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Unterhalb der Kulturschicht folgt der fundfuhrende H orizont 320 mit vorwiegend neolithischen und mesolithi- schen Silices, aber nur wenigen, kaum datierbaren Keram ikfragmenten. Hitzesteine kommen hauptsächlich in Bereichen vor, wo sich auch Keramik erhalten hat.
Die Keramik wirkt zerfressen, geplatzt und aufgelöst. Es blieben vorwiegend die härtesten Scherben erhalten, weiche oder «norm al» harte wurden aufgelöst. Aus diesem Grund hat die Verteilung der Keramik in der G rabungsfläche kaum noch A ussagekraft (Abb. 69). D ie Hitzesteine in der Kulturschicht 310 zeigen jedoch, dass diese nicht oder nur geringfügig um gelagert worden ist. Die wenigen Steine im neolithischen/m esolithischen Fundhorizont 320 legen indessen nahe, dass w ir uns hier nicht im Zentrum einer Siedlung befinden, diese aber in unm ittelbarer Nachbarschaft gesucht werden muss.
Die Funde(KNr. 149-289; Abb. 173-177, S. 146-155)
Das Keram ikmaterial um fasst 2391 klein fragm entierte Scherben. U nter diesen ergeben 76 Randscherben, 87 W andscherben und 7 Bodenscherben 170 Gefässindividuen, die sich zu 74,7% der G robkeram ik und 21,2% der Feinkeramik zuordnen lassen; 4,1% bleiben unbestimmt.
Die 156 Silices stam m en vorwiegend aus dem unteren Bereich der frühbronzezeitlichen Kulturschicht 310 und aus dem fundführenden H orizont 320 (Abb. 65, 71).
Das Fundinventar um spannt mindestens drei Epochen: M esolithikum , frühes Jungneolithikum sowie jüngere Frühbronzezeit/ältere M ittelbronzezeit. Die Streufunde 286 bis 289 zeugen von einer Nutzung des Geländes in röm ischer Zeit und im Mittelalter.
Vertikale Streuung des Fundmaterials in der Kulturschicht
m 2 S ilice s K eram ik H itze ste in e
K ultu rsch ich t 31 0 o b e re r B ere ich FBZ 87 19 4 .2 5 3 kg 61 kg
K ultu rsch ich t 31 0 u n te re r B ere ich F B Z /N e o l . 4 4 39 1.801 kg 33 kg
F u n d h o rizo n t 3 2 0 N eol. / M esol. 26 8 3 0 .4 0 9 kg 2 kg
Verteilung der Hitzesteine
Feld 10 Feld 11
"FiEEPh i _ 1
Feld 12
Störung
Verteilung der Keramik
Feld 10 Feld 11 Feld 12
Pro
fils
teg
|
Störung
G ram m / m2 < 5 ( Q <10( Q ioo -sooQ 500-1 o o o d 'N
IOOO-2OOOQ 2000-4000d 4000-7000d >7000Q \
Abb. 69: K reuzlingen: Töbeli. V ertikale und ho rizon tale S treuung des F undm aterials.
Abb. 70: K reuzlingen: Töbeli. W inzige M ikrolithen dienten als G eschossspitzen. R echts e in K erb test (M 2:1). Spätes M esolith ikum .
M ikrolithen aus dem M esolithikumNeben den zwei trapezförm igen mikrolithischen Ge
schosseinsätzen 149 und 150, die typisch für das späte M esolithikum sind97, belegen die Kerbreste 151 und 152 die Produktion von M ikrolithen (Abb. 70). Zum Fundbestand gehört der kleine, kaum daum ennagelgrosse K ratzer 153.98 Auffallend sind kleine, nicht retuschierte regelmässige Lam ellen (nicht abgebildet, vgl. Tabelle Abb. 71 ). Sie treten hauptsächlich im m esolithisch/neolithischen Horizont 320 au f.99 Ihr Vorkommen im jüngeren neolithisch/frühbronze- zeitlichen Horizont 310 spricht eher für eine vertikale Verlagerung von Fundmaterial als für eine bronzezeitliche Produktion von kleinen Lamellen.
Das tiefer liegende Verlandungssediment Schicht 400 ist 14C-datiert und gibt m it 6205±70yB P einen Terminus post quem für den m esolithisch/neolithischen Fundhorizont.
Letzte Zeugnisse der neolithischen BauernIm Silexinventar lässt sich eine Anzahl von Geräten
identifizieren, die ins N eolithikum gehören. Neben einigen Stichellamellen und wenig aussagekräftigen retuschierten Abschlägen stammen die Pfeilspitzen 154, 155, 157 und 158 aus dem neolithischen Fundhorizont, 156 aus der frühbronzezeitlichen Kulturschicht. Im Einzelfall ist kaum zu
Schicht 200
310,
KS
oben
, FB
Z
310,
KS
unte
n,
FB
Z/N
eol
320,
unt
er
KS,
N
eol/
Mes
ol
Str
eufu
nde
Tot
alP feilsp itzen 1 2 2 1 6
D ick en b än n lib o h rer 3 7 1 11
M ikrolithen 1 1 2
K erb rest 1 1 2
K ratzer 1 1
S tichellam ellen 1 1 2
Lam ellen 1 2 1 2 6
re to u c h ie rte A b sc h lä g e 1 1 2
Klinge 1 1
A b sc h lä g e 5 9 14 2 30
A b sp lisse 3 16 39 4 62
K ern frag m en te 2 1 2 5
T rüm m er 5 4 14 2 25
F e u e r-S c h la g s te in 1 1
Total A nzahl S ilices 2 19 38 84 13 156
Abb. 71: K reuzlingen: Töbeli. Typologische V erteilung der S ilex-G eräte in den archäologischen H orizonten.
97 G rotti 1993 ,221 .98 K ratzer aus m eso lith ischen S tationen im Seebachtal, L euzinger 1998,43 .99 Schlichtherle 1990a, 109.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 69
Abb. 72: K reuzlingen: Töbeli. P feilsp itzen , N eolith ikum , frühe P fyner Kultur.
Abb. 73: K reuzlingen: Töbeli. W inzige B ohrer d ien ten zu r H erstellung von S chm uckperlen . N eo lith ikum , frühe P fyner Kultur.
entscheiden, ob es sich um neolithische oder frühbronzezeitliche Pfeilspitzen handelt (Abb. 72). Die Verwendung von Silex zur Herstellung von Geräten ist bis weit in die Bronzezeit anzunehm en.100
Die D ickenbännli-Bohrer 160 bis 170 sind hingegen typische Geräte aus dem ausgehenden 5. und frühen 4. Jahrtausend (Abb. 73). Sie w urden zur Herstellung von Röhrenperlen aus Kalkstein verw endet.101 Ihr Vorkommen auch in der Kulturschicht der frühen Bronzezeit zeigt, dass vertikale Verlagerungen in den Fundschichten stattgefunden haben .102
Abb. 74: K reuzlingen: Töbeli. B ernste inperle , D urchm esser 4,5 m m . F rühbronzezeit.
Abb. 75: K reuzlingen: Töbeli. F ragm ente e iner M ahlplatte und eines L äufers. S ekundär a ls H itzeste ine verw endet.
Neolithische Keram ik ist im entsprechenden Fundhorizont nur in wenigen Fragmenten erhalten geblieben. Im Fundmaterial wird die frühbronzezeitliche Keramik leichter als die neolithische erkannt. W ährend die kleinfragm entierte Randscherbe 180 nur wenig A ussagekraft hat, findet die feinkeram ische Rundöse 179 ihre Parallelen bei flaschenförm i- gen G elassen der frühen Pfyner Kultur, wie sie in Hornstaad- Hörnle um 3900 v.Chr. Vorkommen.103
Jüngere Frühbronzezeit/ältere M ittelbronzezeitA usser dem Schaft der Bronzenadel 181 w urden keine
Bronzeobjekte gefunden. Die Bernsteinperle 182 (Abb.74), möglicherweise aus dem Ostseeraum importiert, deutet au f weit reichende Beziehungen hin, die bereits in der frühen Bronzezeit bestanden.104 Die Hauptm asse des Fundm aterials besteht aus Hitzesteinen, worunter sich stark zerplatzte Fragmente von sekundär verwendeten M ahlplatten, Läufern und Klopfsteinen befinden (Abb. 75).
I0" Brogli 1980, 88; H ochuli u. M aise 1998, 273.101 Schlichtherle 1990a, 108.102 A u f dem U erschausen-H orn tre ten in den spätb ronzezeitlichen Fund
schichten D ickenbännli-B ohrer auf, die aus nahe gelegenen S tationen der P fyner K ultur e ingesch lepp t sein könnten , vgl. N agy 1997, Taf. 167. 1560-1569 .
103 Sch lich therle 1990a, Taf. 5 .18, 1 9 ,2 4 ; 148, A nm . 438.104 K rause 1997a, 43.
70 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Abb. 76: K reuzlingen: Töbeli. R eich verz ie rtes G efäss m it verw itte rte r und abgep latz te r O berfläche. Jüngere F rühbronzezeit.
Knochen haben sich, bis au f wenige stark zersetzte Reste, in der Kulturschicht nicht erhalten. Abgesehen von den Silices besteht das restliche Fundmaterial aus Keramik.
Gefässform en Hessen sich nur unsicher bestimm en. Sicher belegt sind die Knickwandschale 183 sowie die feinkeramischen Schalen oder Töpfe 184 bis 188 m it ausladenden Randformen. Weitere ausladende Ränder könnten zu grobkeram ischen G elassen mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Randpartie gehören. Unter der Feinkeramik befindet sich das Fragm ent 200 eines steilwandigen, «Pyxis»- förm igen G elasses m it Standring, das reich m it Rhomben, Kreuzen und Kerbbändern verziert ist (Abb. 76). M ehrere W andscherben tragen stark erodierte Ritzverzierungen. Vorhanden sind zudem Scherben, die eine flächendeckende Punktverzierung tragen, 194 bis 197. Es könnte sich um Einpressungen mit einem N adelkopf handeln.
Die zum Teil geschlickte G robkeram ik 212 bis 284 setzt sich vorwiegend aus Töpfen zusamm en, doch sind auch Kalottenschalen vorhanden, z.B . 286 und 287. Die Ränder der Grobkeram ik sind zum eist gerundet und ausladend oder steil orientiert. Neben gekanteten Formen, z.B. 223 bis 229, kom m en Ränder vor, die horizontal abgestrichen sind, 228 und 230. Verdickte Ränder m ittelbronzezeitlicher M achart kommen nicht vor. Die W anddicken entsprechen den M ittelwerten, wie sie für die jüngere Frühbronzezeit und ältere M ittelbronzezeit105 bekannt sind (vgl. Abb. 93, 95).
Bei der Grobkeram ik waren Fingertupfen au f den Randlippen sowie unterhalb des Randes beliebt. Fingertupfenleisten finden sich sowohl unterhalb des Randes wie auch auf der Schulter der G elasse 249 bis 265, sie können auch verzweigt sein, z.B . 252. Gut vertreten sind getupfte Reihen und flächendeckende Fingernagelkerben und Fingertupfen wie 273 bis 284. Letztere wurden teilweise so eingekniffen, dass am Rande der Fingertupfen ein w arzenartiger W ulst entstand, 279 und 280. Bem erkenswert sind die grobkeram ische W andscherbe 285 mit einem doppelreihigen Einstich-M otiv sowie die W andscherbe 257 m it einer getupften Leiste und Fingernagel Verzierung. Die ovalen Grifflappen sind verhältnism ässig grob gefertigt und erscheinen oft au f G elassen mit den typischen, oben beschriebenen Leisten, 266 bis 272. Henkel kommen sowohl bei der Grob- als auch bei der Feinkeramik vor, 272, 198 und 199. Zu den Verzierungen vgl. Abb. 94.
14C-Datierungen, vgl. Abb. 224 im AnhangDie 14C-Datierungen 3 -5 der tie flieg en d en Sedimente
w iderspiegeln die Verlandung des Tägerm ooses ab dem späten M esolithikum. Aus dem schlecht erhaltenen neolithi- schen/m esolithischen Fundhorizont konnte nur ein schnurkeram isches Datum gewonnen werden. Dieses belegt die N utzung des Areals im Endneolithikum , das datierbare Fundmaterial aus dem entsprechenden Horizont ist jedoch älter.
D ie 14C-Proben 6 und 9 aus der frühbronzezeitlichen Kulturschicht fallen schwerpunktm ässig ins 17. Jh. v.Chr., wie dies die Keramik mit Verzierungen im «A rboner Stil» erwarten Hess.106
Der reiche Zierstil des «Pyxis»-torm igen G elasses 200 (Abb. 76) findet sich ähnlich, wenn auch nicht identisch in Arbon-Bleiche 2 .107 Zu den flächendeckenden, runden Punktverzierungen 194 bis 197 gibt es ebenfalls einige Parallelen in A rbon108 und aus dem N ussbaum ersee109. Sie dürften bereits in die frühe M ittelbronzezeit weisen. Ähnliche, vielleicht mit einem N adelkopf eingepresste, flächendeckende Punktverzierungen tauchen in Erlenbach- O bstgartenstrasse au f .110 In zwei Fundstellen der frühen m ittleren Bronzezeit, der Siedlung Forschner und Urdorf- Herweg, sind die Verzierungen m it einem Hölzchen eingestochen.111 In die Zeit um 1500 v.Chr. weist auch die Scherbe 191 mit Resten von flächigen R itzlin ien .112 Zur ausführlicheren D iskussion des Fundm aterials im Übergang der jüngeren Frühbronzezeit zur älteren M ittelbronzezeit sei au f den Beitrag zu H ochstross verwiesen.
Ein bem erkenswert frühes frühbronzezeitliches Datum lieferte die 14C-Probe 8: 2140 bis 1950 v.Chr. Da es sich um Holzkohle handelt, darf die Datierung lediglich als grosszügiger Terminus post quem gewertet werden. Wie der Vergleich zu Bodm an-Schachen I, Schichten A und B, zeigt, ist im frühen A bschnitt der Frühbronzezeit eine spärlich verzierte Keramik zu erw arten .113 Es ist daher nicht aus- zuschliessen, dass sich im Fundmaterial vom Töbeli eine ältere Siedlungsphase verbirgt, die m angels charakteristischer Formen und Z ierelem ente nicht m ehr als solche zu erkennen ist. A bgesehen davon könnte das frühe Datum von Probe 8 auch A usdruck einer der Siedlungstätigkeit vorangegangenen Rodung oder landwirtschaftlichen N utzung se in .114
105 H ochuli 1994, 134, Abb. 91.106 K öninger 1995, 72; H ochuli, K öninger u. R uoff 1994, 274.107 H ochuli 1994, 229, Taf. 13.124.108 H ochuli 1994, 226, Taf. 10.85; Taf. 30.356.109 H asenfratz u. Schnyder 1998, 160, 166, A bb. 160.51. D ie Funde aus dem
N ussbaum ersee lassen sich m it V orsicht in d ie M itte des 16. Jhs. v.Chr. datieren.
110 F ischer 1997, 168; Taf. 70.761, 762.111 S iedlung Forschner: K eefer 1990, Abb. 5.1; U rdorf-H erw eg (ZH ): B auer
et al. 1992, Taf. 3.84.112 V gl. Funde aus der S iedlung Forschner, K eefer 1990, A bb. 5.8, zw ischen
1 5 1 0 -1 4 8 0 v.Chr. und aus U rdorf-H erw eg (Z H ), B auer e t al. 1992, Taf. 3 .9 0 -9 1 .
113 K öninger 1995, 72; H ochuli, K öninger u. R u o ff 1994, 2 7 4 -2 7 6 .114 A ufarbeitung des P robenm ateria ls im R ad iokarbon labor des G eo
g raph ischen Institutes der U niversität Zürich. D atierung m itte ls der A M S-Technik, accelerato r m ass spectrom etry, a u f dem Tandem - B esch leun iger des Institu ts fü r Teilchenphysik der ETH. K alibrierung durch B ettina H edinger.
Nationalstrasse A 7 - Katalog, ausgewühlter Fundstellen 71
Fundstellen au f M oränenterrassen
Tägerwilen: Hochstross
Dörfer oder Gehöfte der Bronze- und Eisenzeit
Entdeckung und Lage
Im Areal Hochstross wurden angeblich im 19. Jh. n.Chr. keltische M ünzen en tdeckt115, deshalb schenkten wir dem Gelände erhöhte Aufm erksam keit. Bereits bei den ersten Kontrollgängen au f dem Acker fanden sich röm ische K eramikfragmente. Ein Luftbild zeigt im Boden verborgene Strukturen, die sich bei den Sondierungen allerdings als neuzeitliche Drainagen entpuppen sollten. Kein einziger prähistorischer Fund a u f der A ckeroberfläche w ies au f die im Boden verborgene bronzezeitliche Fundstelle hin. Diese wurde erst bei den Sondierungen 1997 entdeckt.
Sie liegt au f einer M oränenterrasse südlich des Täger- m ooses (Abb. 57, 1). Das Gelände steigt über eine Distanz von 150 M etern von 401 m ü.M . im Tägerm oos bis au f 420 m ü.M. au f der Terrassenebene an.
Der nördliche Teil der Fundstelle befindet sich am Hang- fuss au f 407 m ü.M . Er ist überlagert von stellenweise bis zu einem M eter m ächtigen Sedimenten, Erosionsm aterial, das vom Hang abgeschwem m t wurde. Diese Ablagerungen schützten Kulturschichten und Baustrukturen.
Eine zweite Fundzone wurde im hangw ärtigen südlichen Bereich angeschnitten. Diese liegt in einer Senke hinter einem schwach ausgeprägten, hangparallel verlaufenden M oränenrücken (Abb. 77).
Ablauf der Grabungen und Befunde
Die G rabungen w urden zwischen Februar und September 1998 mit einem Team von 3 bis 15 Personen durchgeführt, welches gleichzeitig m ehrere baubegleitende U ntersuchungen au f den Autobahn- und M ThB-Baustellen zu betreuen hatte. Trotz U nterbrächen konnten gegen 450 m 2 ausgegraben werden (Abb. 78, 79).
Über das Grabungsareal wurde ein M essnetz gelegt, welches erlaubte, in jedem potentiell zu untersuchenden Sektor ein zuvor definiertes Feld zu öffnen. Der Abtrag der neuzeitlichen Deckschichten erfolgte mit dem Bagger. Die Fundschichten wurden von Hand abgetragen und das Fundmaterial in allen Abstichen nach m 2 und nach Strukturen getrennt eingesam m elt. In den Kolluvien erlaubten die diffusen Übergänge eine G rabung nach Schichten n ich t.116 Statt dessen erfolgte der Abtrag in Abstichen.
Die Stratigraphie, Abb. 80, 81Die Oberfläche der eiszeitlichen M oräne, Schicht 400,
verw itterte im Laufe der Zeit stark. Sie ist durchzogen von Furchen, Mulden und Rinnen. Diese w urden später durch die
A uflagerung von Sanden m it geringem Lehmanteil ausgeebnet, Schichten 320, 325 und 330. In dieser Bodenbildung fällt Schicht 325 auf, die sehr dunkel erscheint und viele Holzkohlen enthält. Diese Rodungszeiger ergaben eine 14C-Datierung für das Endneolithikum und weisen a u f eine Nutzung durch Ackerbau hin. Der Fund des jungsteinzeitlichen Erntem essers 290 von der Oberkante der Schicht 325 passt gut in dieses Bild (Abb. 88).
Die erste Besiedlung in der jüngeren Frähbronzezeit hinterliess Kulturschicht 315, ein im Profil deutlich sichtbarer Horizont, bestehend aus einem dunkelbraun-grauen Sand mit geringem Lehmanteil. Sie ist stark durchsetzt mit hitzeversehrten und zerplatzten Steinen, verkohlten organischen Resten und zahlreichen Keram ikfragm enten. Knochen fanden sich in der entkalkten Schicht spärlich und nur im untersten Bereich. Der Horizont 310 kann durch das Fundmaterial und 140-Datierungen a u f den Zeitraum zwischen jüngerer Frühbronzezeit und älterer M ittelbronzezeit eingeengt werden. Er ist im nordöstlichen Bereich der Siedlung mit 20 bis 30 cm am m ächtigsten ausgeprägt, was au f eine sackartig nach Osten absinkende Mulde hindeutet. Hangaufwärts nim m t die Kulturschicht 315 an M ächtigkeit ab, sie wurde durch die prähistorische Erosion keilförm ig gekappt.
Überlagert wurde die Kulturschicht vom 20 bis 80 cm mächtigen Kolluvium 310, welches aus einem leicht lehmhaltigen, ockerfarbenen Sand m it geringem Kiesanteil besteht und zahlreiche um gelagerte Funde der späten Frühbronzezeit und der entwickelten M ittelbronzezeit enthält. Wie ein sehr frühes 140-Datum , Endneolithikum /frühe Frähbronzezeit, zeigt, ist auch mit um gelagerten älteren Funden zu rechnen.
Im unteren Bereich des Kolluviums 310 konnten m ittelbronzezeitliche Kulturschichtreste erfasst werden. Im oberen östlichen Bereich des Kolluviums sind spätbronzezeitliche/hallstattzeitliche Strukturen eingetieft, deren zugehörige Kulturschichten erodiert sind. Im westlichen Bereich des Fundareals waren, von Oberkante der Schicht 310 ausgehend, eingetiefte latènezeitliche Strukturen zu beobachten.
Abgeschlossen wird die Schichtabfolge durch ein sehr helles Kolluvium, Schicht 200, das ein stark fortgeschrittenes Erosionsstadium der höher gelegenen Hangpartien zeigt. In diesem Horizont finden sich vereinzelte römische und eisenzeitliche Funde. Darüber folgt der mittelalterlich und neuzeitlich gebildete Humus.
Geologisch-bodenkundliche Beobachtungen117Im Rahmen der archäologischen Ausgrabungen bestand
115 K eller u. R einerth 1925, 214.116 Z ur Situation in K olluvien: D ieckm ann 1995a, 42.117 D ie Z usam m enstellung basiert a u f e inem M anuskrip t von Philippe
Rentzel. D er volle Text beschreib t e ingehend d ie F ragestellung, die U ntersuchungsm ethoden , den allgem einen S c h ic h tau ftau und die m ikrom orpholog ischen U ntersuchungen. E r kann beim A m t für A rchäologie e ingesehen werden.
72 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Gegrabene Grabungsfelder und Sondierschlitze
\Ausdehnung der erhaltenen FundschichteMgeschätzt)
>5^3 Ausdehnung der Erdarbeiten (Bauprojekt) z
F
279300
279200
100m 150m
Abb. 77: T ägerw ilen: H ochstross. Lage der Sondierschnitte und G rabungsfelder 1:1000.
der W unsch nach einer geologisch-bodenkundlichen Beur- Grund wurde eine repräsentative Auswahl an Bodenprobenteilung der Schichtabfolge. Dabei standen insbesondere geborgen, um folgende Fragen zu beantworten:Fragen zur Entstehung und zur Art der m enschlichen - Wie sind die dunkeln, unm ittelbar über der M oräneÜberprägung der Sedim ente im Vordergrund. Aus diesem liegenden Schichten 330, 325 und 320 zu deuten?
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 73
Abb. 78: T ägerw ilen: H ochstross. Das G rabungsteam an der A rbeit.
- Was lässt sich zur Bildungsgeschichte der Schicht 315 der jüngeren Frühbronzezeit/älteren M ittelbronzezeit sagen? Handelt es sich um Befunde in situ?
- Gibt es Hinweise au f einen Hiatus zw ischen der Schicht 315 der jüngeren Frühbronzezeit/älteren M ittelbronzezeit und der darüber liegenden Schicht 310 der jüngeren M ittelbronzezeit und Spätbronzezeit?
- Wie haben w ir uns die Entstehung dieser mittel- bis spätbronzezeitlichen Schicht 310 vorzustellen?
Die Beobachtungen von Philippe Rentzel sind in der Abb. 81 zusam m engefasst. Er zieht folgende Schlüsse:
Der unterste Abschnitt der Schichtenfolge besteht aus M oränenablagerungen, die sich pedologisch in drei übereinander liegende und genetisch zusam m engehörige Bodenhorizonte gliedern lassen. Über der frischen M oräne finden sich Reste einer Parabraunerde m it gelblichem Tonanreicherungshorizont (Bt-Horizont), überlagert von einem grauen, sandigen Oberbodenhorizont (Al-Horizont). Diese Bodenbildung aus M oränensubstrat mit verm utlich späteiszeitlicher Flugsanddecke ist A usdruck einer seit dem Spätglazial andauernden Verwitterung unter geschlossener Vegetationsdecke, ln der Fundstelle Hochstross wird dieser ökologische G leichgewichtszustand erstm als im Spätneolithikum em pfindlich gestört, was sich sedimentologisch in der Bildung eines holzkohlehaltigen Kolluviums aus Oberbodenm aterial äussert. Feldbeobachtungen und Ergebnisse der m ikrom orphologischen Analysen sprechen am ehesten für Brandrodungen. Die archäologischen
Hinterlassenschaften aus dieser Schicht sind spärlich und schlecht konserviert, was im Zusam m enhang m it geringer Sedim entüberdeckung und Verwitterung im Anschluss an die spätneolithische Begehung gedeutet werden kann.
Deutliche Spuren hat die knapp tausend Jahre später erfolgte Besiedlung während der jüngeren Frühbronzezeit/ älteren M ittelbronzezeit zwischen Mitte des 17. und dem 16. Jh. v.Chr. hinterlassen. Für den unteren Bereich der Siedlungsschicht liegen - nebst den archäologischen Indizien - eindeutige A nzeiger für in-situ-Befunde mit erhaltenen Gehniveaus vor. Auch aus dem zentralen A bschnitt m it den m ittelbronzezeitlich datierten Funden stammen mikro-
Abb. 79: T ägerw ilen: H ochstross. Ü bersich t über das G rabungsgelände. Im H in terg rund w ird das T rassee der A utobahn abhum usiert.
74 Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
m orphologische Hinweise a u f erhaltene Gehhorizonte. Aus den 14C-Daten lässt sich ablesen, dass die Schichtbildungsdauer eine Zeitspanne von rund 200 Jahren um fassen dürfte.Nach dem Ende der m ittelbronzezeitlichen Siedlungsphase
r _ Humus
scheint ein Sedim entationsstillstand erfolgt zu sein, der sich — in den Profilen in Form einer oberflächlichen Verwitterung lm und H um ifizierung manifestiert. Danach setzt eine Phase ,10 intensiver Kolluvialbildung ein, die um 830 + /- 70 BC cal. — abgeschlossen war. M öglicherweise ist dieses Kolluvium j j t A usdruck einer weiter hangaufwärts zu suchenden, spät- «° bronzezeitlichen Siedlungsstelle.
729 007.75 279-346.00
4 0 7 .0 0 m ü. M.
Spuren eines Grossbaues aus der jüngeren Frühbronzezeit/ älteren M ittelbronzezeit
Im G ebiet der Nordostschweiz beschränkt sich unser W issen über frühbronzezeitliche Hausformen weitgehend au f die Befunde in den Seeufersiedlungen. Über die Bauform en in den Landsiedlungen ist aus diesem Zeitraum sehr wenig bekannt. Ebenso spärlich sind unsere Kenntnisse zu den Siedlungen der mittleren Bronzezeit.
In Süddeutschland und Ö sterreich haben Untersuchungen in den letzten Jahren etwas Licht in die Bautechniken der früh- und m ittelbronzezeitlichen Siedler gebracht. Hierbei wurden ausserordentlich grosse Langbauten entdeckt, die au f Gehöfte m it wenigen G ebäuden hindeuten .118 N ördlich des Bodensees findet sich dieser Bautypus im Hegau, kaum 40 km von Tägerwilen en tfern t.11'' Die Häuser erreichen Längen zwischen 13 und 21 m sowie Breiten von 5 bis 7,5 m. D arunter finden sich Gebäude m it kom binierten Schwell- balken-ZPfostenkonstruktionen, aber auch Bauten, die m öglicherweise über ein W almdach verfügten. Letztere Bauweise benötigte lediglich zwei Firstpfosten, die um ein oder zwei Joche bis zu fünf M eter von der stirnseitigen Wand zurückversetzt waren. Diese K onstruktionsm erkm ale sind zum Verständnis der Befunde in Hochstross von grosser Bedeutung und lassen sich mit einem von uns angeschnittenen Hausgrundriss vergleichen.
Bei den G rabungen 1997/98 wurde die nordwestliche Ecke eines Gebäudes erfasst. Der angeschnittene Hausgrundriss weist eine Breite von m indestens 6,5 bis 7 m und eine Länge von m indestens 6 m auf. Diese Dimensionen deuten au f einen Grossbau hin (Abb. 82, 83, 85, 162 im Anhang S. 125). Ein Vergleich mit der Orientierung der Gebäude in M ühlhausen-Ehingen spricht dafür, dass die Nordwestwand die Giebelseite des Gebäudes bildet. Im Innern finden sich mehrere Pfostengruben, die eine U nterteilung andeuten. Die Pfosten der nordwestlichen Wand wurden in Gruben m it Durchm essern bis zu 1 m gesetzt und mit Steinen verkeilt. Zu einem grossen Teil handelt es sich hierbei um Hitzesteine (Abb. 83).
Die Gruben Pos. 7, 8 und 11 (Abb. 85) zeigten Pfostennegative mit einer Pfostenstärke zwischen 30 und 40 cm. Die Pfosten der südwestlichen Wand dieses Gebäudes wurden mit wenigen Steinen im Boden verkeilt. Die scheinbar geringeren Durchm esser und Tiefen der Pfostengruben in diesem Bereich lassen sich au f die stärkere Erosion der ursprünglichen Geländeoberfläche im hangwärtigen G ebäudeteil zurückfuhren. Innerhalb des Gebäudes fanden sich die
407
729 007,75 279 360.00
407. m ü.
Abb. 80: T ägerw ilen: H ochstross. Schnitt durch das S iedlungsgelände Süd-N ord. D ie K ulturschicht 315 ist hangseitig erodiert.
untersten erhaltenen Reste einer Feuerstelle oder einer Werk- grübe (Abb. 85).
Die Datierung des Gebäudes erfolgt über stratigraphische Beobachtungen. Die Baustrukturen liegen unterhalb der kolluvial abgelagerten Schicht 310. Sie gehören somit zur Siedlungsphase zwischen der späten Frühbronzezeit und der frühen M ittelbronzezeit, wie auch Funde aus den Pfostengruben nahe legen. Die Erosion der Gehhorizonte und die darauf folgende Ablagerung der Schicht 310 dürfte in einem kurzen Zeitraum stattgefunden haben.
Im untersuchten Siedlungsgelände finden sich weitere Pfostengruben der frühen Phase. Eine Reihe von Pfosten
" 8 K rause 1997b, 63.M ühlhausen (D )-E hingen: D ieckm ann 1995b. 75: D ieckm ann et al. 1997 ,67 .
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 75
Schicht Sedimentologie Pedologie, Mikromorphologie
100 Moderner HumushorizontDunkelbrauner, krümeliger, sandiger Lehm.
— o — 0 ^ - < Ah-Horizont
200 eisenzeitliche bis mittelalterliche Funde Gelbbrauner, sandiger Lehm. M-Horizont (Kolluvium)
310 an der Basis MBZ-, oben SBZ FundeHellbrauner, sandiger Lehm, kieshaltig, mit Holzkohlen. m M-Horizont (Kolluvium), teils mit
erhaltenen Gehniveaus.
315 FBZ-SchichtGrau-brauner, sandiger Lehm mit Holzkohlen. EtmM-Horizont (Kolluvium), mit erhaltenen
Gehniveaus. Archäologische Schicht, humifiziert und verwittert.
320 Holzkohleschicht mit spät-neolithischen 325 Funden.
Holzkohle-haltiger, grauer Sand, mit etwas Kies. mff M-Horizont (Kolluvium)
330 Grauer SandFlugsande, mit Moränensubstrat vermischt. • O . O '
• O •
Ai-Horizont
400 MoräneVerwitterte Moräne. Gelblicher bis oranger sandiger Lehm mit Kies und Blöcken. l i i r T
Bt-Horizont
400 MoräneUnverwitterte Moräne. Kies mit Blöcken und siltig, sandiger Matrix. Ungeschichtet, kalkhaltig.
ü— — C-Horizont, teils Kalkausfällungen
(Cca-Horizont).
Legende Sedimentologie Legende Mikromorphologie
_—Ton v O Blöcke
Silt Artefakte & & &Sand # d Holzkohle V ii'i'iKies
organisches Material
Humus
Tonauswaschung
Tonanreicherung
Kalkausfällungen
Gehniveau
Umlagerung, Kolluvialbildung
Schicht Mikromorphologische Merkmale Interpretation Datierung
310 unten Kalkfreier, sandiger Lehm mit verwittertem Feinkies. Seltene Brocken aus der Moränenoberkante (Material aus Bt-Horizont, Schicht 400). Matrix mit viel Mikroholzkohle. Kanal- und Kammerstruktur, Porosität um 20 %. Deutlich ausgeprägte staubige Einschwemmungen. Hydromorphe Merkmale als Eisen- und Manganausfällungen. Seltene Makroreste und wenige verbrannte Komponenten. Stark gerollte Keramikfragmente. Im oberen Abschnitt erscheinen stellenweise holzkohlereiche, sandig-lehmige Krusten und Bereiche mit verdichtetem Gefüge (massive Mikrostruktur). Daneben auch geschichtete Dekantationsniveaus.
Kolluvium mit Hinweisen auf Begehung. Hydro- morph überprägt.
Späte BZ
Mittlere BZ
315 oben Kalkfreier, sandiger Lehm mit relativ viel, stark verwittertem Feinkies. Sehr staubige Matrix mit Holzkohlen. Keramik und Holzkohlen gegen oben abnehmend und allgemein stärker fragmentiert als im darunterliegenden Teil der Schicht 315. Hydromorphe Anzeiger in Form von Eisenausfällun- gen in der Matrix. Deutlich ausgebildete staubige Einschwemmungen in den Porenräumen, Porosität 15-20%, Kanäle und Kammern. Stark bioturbiert.
Archäologische Schicht, oberflächlich verwittert.
Mittlere BZ
315 unten Kalkfreier, sandiger Lehm mit wenig Feinkies. Matrix mit viel Mikroholzkohle. Kanal- und Kammerstruktur, Porosität um 15 %, gegen oben zunehmend. Stark ausgeprägte staubige Einschwemmungen in den Porenräumen. Mechanisch beanspruchte Holzkohlen und Keramikfragmente sowie brandgerötete Sand- und Feinkiespartikel. Seltene verbrannte Knochensplitter, wenige verkohlte Makroreste. Leichte Fundkonzentration im Zentrum der Schicht, dort auch feingeschichtete Krusten mit massiver Mikrostruktur sowie Ansammlungen von Sand und mikroholzkohlehaltigem Silt als Hinweis auf trampling. Allgemein horizontale Ausrichtung der Bestandteile. Gegen oben zeichnen sich vereinzelte Eisenausfällungen ab (Hydromorphie).
Archäologische Schicht mit partiell erhaltenen trampling-Anzeigern. Substrat: Kolluvium aus dem Oberbodenhorizont der Parabraunerde.
Frühe BZ
320, 325 Sandiger Lehm mit vereinzelten, verwitterten Kieskomponenten alpiner Herkunft. Kalkfrei. Matrix leicht organisch und mit markantem Anteil an Mikroholzkohle. Einige gerundete Holzkohlen und seltene, stark verrundete Keramiksplitter. Deutliche staubige Einschwemmungen. Kanäle und Kammern, Porosität um 15.
Holzkohlereicher Oberbodenhorizont (Al-Hori- zont) aus Moräne. Rodungsanzeiger.
SpäteJungsteinzeit
Abb. 81: T ägerw ilen: H ochstross. Z usam m enfassung der geo log isch-bodenkundlichen B eobachtungen nach Philippe Rentzel.
76 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
O
OO
%Abb. 82: T ägerw ilen: H ochstross. R ekonstruk tionsvorsch lag e ines g rossen G ebäudes der jün g eren Frühbronzezeit / ä lteren M itte lb ronzezeit au fg rund der nachgew iesenen P fostenstellungen.
könnte zu einer W andflucht oder einem Dorfzaun gehören. Es lassen sich jedoch keine w eiteren Gebäude erkennen (Abb. 85). Interessanterweise finden sich im Bereich der gut erhaltenen Kulturschicht 315 nur vereinzelte Pfostengruben.
Die beiden Fundkonzentrationen im nördlichen Bereich des Siedlungsgeländes könnten als Abfalldeponien gedeutet werden (Abb. 85, 86, 162 im Anhang S. 125). Die überaus zahlreichen zerplatzten und brandgeröteten Hitzesteine und Keram ikfragm ente im nordwestlichen Bereich lassen die Struktur eines «Haufens» erkennen, ein Indiz dafür, dass die Kulturschicht hier kaum um gelagert und gut einsedim entiert wurde (Abb. 84). Die Fundkonzentration im nordöstlichen Teil des Fundareals ist dank einer leichten Senkung des bronzezeitlichen Geländereliefs erhalten geblieben. Die Fundm engen erreichen maximal 2 -3 ,5 kg K eram ik/m 2 und 4 -4 5 kg H itzesteine/m 2.
Die Kulturschicht ist im Süden schlechter erhalten und im Bereich des lokalisierbaren Hausstandortes erodiert. A uf Grund der Fundverteilung in der Kulturschicht können keine Gebäudestandorte ausgem acht werden (Abb. 85, 86).
Reste von Bauten der M ittel- und SpätbronzezeitOben in Schicht 310 (Kolluvium) findet sich eine Anzahl
von Pfostengruben, die m ehrheitlich nicht näher datiert werden können. A ufgrund stratigraphischer Überlegungen sind sie der entwickelten M ittelbronzezeit oder der Spätbronzezeit zuzurechnen. Der Siedlungsphase in der entwickelten M ittelbronzezeit, die durch spärliche Kulturschichtreste im nördlichen Bereich des Fundareals belegt wird, lassen sich keine Baustrukturen sicher zuweisen. Auch für die Spätbronzezeit sind als Strukturen einzig die zwei Pfostengruben Pos. 18 und Pos. 48 sowie die grosse Grube
Abb. 84: T ägerw ilen: H ochstross. K ulturschicht m it h itzeversehrten Steinen und K eram ikscherben. Jüngere Frühbronzezeit, ältere M ittelbronzezeit.
Pos. 39 auszum achen, die sich aufgrund des Fundmaterials und einer Dendroprobe datieren lassen. Die spätbronzezeitliche Kulturschicht wurde gänzlich erodiert. In den Gruben findet sich nur wenig zugehöriges Fundm aterial. Spätbronzezeitliches, verm utlich verlagertes M aterial kam im N ordwesten des Fundareals, zufälligerweise im Bereich einer latènezeitlichen Grube, zum Vorschein (Abb. 86).
Baureste aus der LatènezeitFundmaterial der Latènezeit findet sich vorwiegend im
Westen, über das ganze Areal verteilt sind jedoch Pfosten- Abb. 83: T ägerw ilen: H ochstross. M ächtige P fostengruben m arkieren die gruben und Gruben, die vom obersten Rand der KolluvienW andflucht eines g rossen früh- oder m itte lbronzezeitlichen G ebäudes. her eingetieft wurden und zum indest teilweise in die Eisen-
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 77
Hochstross: Prähistorische Strukturen
3 7 0 -
Pos. 73 '
3 6 5 -
3 6 0 -
355 —
350 —Pos.
P os. 18-
)P o s . 7Pos. 11
i P ^ P o s . 3345 —
P os. 4 8 r
Ros. 39 r
Hochstross: Verteilung der Keramik
1
406.75
407.00
407.25
350 —
407.50
Gew icht gr./m2
0<50
50-100
100-250
250-500
500-1000
1000-2000
2000-3500
Feingrabung
G robgrabung und Profilstege
Abb. 85: T ägerw ilen: H ochstross. P rähistorische S trukturen und V erteilung der K eram ik.
78 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Hochstross: Verteilung der Hitzesteine
370 _
3 6 5 -
3 6 0 -
*■
1 V
Gewicht (gr.)/m2
<100
100-500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-7000
7000-20000
20000-45000
Feingrabung
G robgrabung und Profilstege
407.25
407.50
345 —
Hochstross: Aussagekräftige Merkmale
370 _
*
jüngere Frühbronzezeit/ ältere MittelbronzezeitDreiecke gepunktet Winkelband Rhomben Halbmondstempel aufgesetzte Warzen Fingertupfen m it Warzen
jüngere MittelbronzezeitRand horizontal abgestrichen Randform verdickt gerundet Randinnenseite verdickt
SpätbronzezeitKonische Schalen Schràgrandgefasse Kalottenschalen Bronzenadel
LatènezeitWS m it Latène-Charakter Napfe. Schalen □
0
350 —
2 7 9 3 4 0 -
Abb. 86: Tägerw ilen: H ochstross. V erteilung der H itzeste ine und aussagekräftige M erkm ale.
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 79
Abb. 87: T ägerw ilen: H ochstross. S te insetzung in der Sohle e iner G rube m it R esten eines verbrannten K onstruktionsholzes. Latènezeit.
zeit datieren (Abb. 85). Die höher liegenden Grubenteile und deren zugehörige Benutzungshorizonte sind erodiert. Die gekappten Strukturen werden von der Schicht 200 überlagert, einem sehr hellen, kolluvial abgelagerten Sediment. Aus m ehreren dieser hoch liegenden Strukturen wurden eisenzeitliche Scherben geborgen. Die Grube Pos. 99 im Westen des Fundareals war m it verbranntem Fachwerk-Lehm und verbrannten Keramikfragmenten gefüllt. Auch wenn dieser Befund zur Hälfte von einer m odernen Drainage gestört wird, dürfte es sich um eine A bfallgrube handeln. Angrenzend deuten m ehrere Pfostengruben auf eine west-östlich verlaufende Wand.
Eine VorratsgrubeIm Nordw esten des Areals trafen w ir au f die auffällige
Steinsetzung Pos.73 (Abb. 85, Abb. 87) m it zwei M etern Durchmesser. Grosse Blöcke von 30 bis 50 cm Länge kleiden die sich leicht senkende Sohle einer Grube aus, die m indestens 40 bis 50 cm in die Schicht 310 eingetieft wurde. A u f der Steinsetzung liegend fanden sich die verkohlten Reste eines Brettes oder Balkens. Eine 14C-Datierung ergab ein frühlatènezeitl iches Alter. Die Funktion der Grube lässt sich mangels Fundmaterial nur schwer erkennen. Es gab keine Hinweise au f Keramik- oder M etallverarbeitung. Brandrötung au f der Grubensohle oder an den W änden sowie H itzespuren an den Steinen wurden ebenfalls nicht beobachtet. Eine Interpretation des Befundes als G rubenhaus scheint uns unwahrscheinlich, da innerhalb und ausserhalb der S truktur keine Pfostenstellungen auszum achen waren. Es ist denkbar, dass die Steine, die in dieser Grösse im M oränenmaterial nur mit erheblichem Aufwand zu finden sind, als Unterlage für einen Holzboden mit einer treppenartigen Abstufung in der Grubensohle dienten. Bedingt durch den starken Hangwasserdruck im Gelände macht eine derartige Baum assnahm e beispielsweise zum Trockenhalten einer Vorratsgrube oder eines Kellers durchaus Sinn.
sich 639 Randscherben (738 Einzelscherben), 1042 verzierte W andscherben (1499 Einzelscherben) und 135 Bodenscherben ( 162 E inzelscherben). aus denen sich 1816 Gefässindivi- duen errechnen lassen. Dazu kommen 15 Bronzeobjekte, 47 Silices und 2 Bernsteinperlen.
Geräte aus SilexDer Anteil der 47 Silices ist gem essen an der G esam t
fläche verhältnism ässig bescheiden. Die meisten Silices sind kleinste Abschläge, Absplisse und Trümmer; der Bestand an Geräten ist sehr gering. In der Übergangszone der Kulturschicht 315 zur darunter liegenden Schicht 325, aus der ein endneolithisches/älter frühbronzezeitliches 14C-Datum gewonnen werden konnte, w urde die M esserklinge 290 mit Sichelglanz sowie ein Silextrüm m er gefunden (Abb. 88). Die Objekte könnten, zusam m en m it den Ergebnissen der Sedim entanalyse der Schicht 325, au f eine vorbronzezeitliche Nutzung des Areals hindeuten.
Aus der gut erhaltenen Kulturschicht 315 der späten Frühbronzezeit/ frühen M ittelbronzezeit stammen lediglich die Silexpfeilspitze 291 sowie zwei Abschläge. Infolge Fehlens von Abfallprodukten in den Schichten lässt sich nicht belegen, dass diese wenigen Objekte in der Bronzezeit hergestellt und genutzt worden sind; sie könnten durchaus auch jungsteinzeitlich sein.
Die m eisten einer Schicht zuweisbaren Silices, näm lich 39 Objekte, stam m en aus Kolluvium 310 und nur gerade drei (!) aus der Kulturschicht 315.
Im Kolluvium Schicht 310, das zwischen der Mittel- und Spätbronzezeit abgelagert wurde, fanden sich vier Pfeilspitzen (Abb. 89), wovon drei aus Silex (293-294 und 296) und eine aus Bergkristall (295) sind. Wie ein endneolithisch/älter frühbronzezeitliches 140-D atum aus Schicht 310 zeigt, enthält das Sediment um gelagertes älteres Bodenm aterial, das durchaus jungsteinzeitliche Funde enthalten kann. Somit sind diese Pfeilspitzen und die übrigen Silices eher als neo- lithisch denn als bronzezeitlich anzusprechen.120
120 N agy, 1999, 7 7 -8 1 , n im m t a u f dem U erschhausen-H orn eine spätb ronzezeitliche S ilexverarbeitung an, w as m it S icht a u f das schnurkeram ische G rubenhaus am gle ichen O rt H asenfratz u. S chnyder 1998, 157, sowie D ickenbännli-B ohrer des frühen Jungneo lith ikum s, N agy 1999, Taf. 1 6 7 .1 6 0 -1 6 7 , m it V orsicht zu in terp retieren ist.
Die Funde(KNr. 2 9 0 -6 0 5 ; Abb. 178-195, S. 156-191)
In Hochstross wurden 121 kg stark fragm entierte Keramik Abb. 88: Tägerw ilen: H ochstross. S ilexm esser m it Sichelg lanz, der beim
bzw. 15 839 Scherben geborgen. Als auswertbar erwiesen Schneiden von G etre idehalm en entsteht (M 1:1). N eolith ikum .
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 81
Abb. 90: T ägerw ilen: H ochstross. V erzierte B ronzenadel, Länge 26 cm . Frühe Spätbronzezeit.
Die Objekte aus BronzeTypologisch und chronologisch auswertbare B ronzeobjek
te wurden aus der Kulturschicht leider keine geborgen, wohl aber aus dem oberen Bereich der Kolluvien. Die Spitze des Dolches 305 m it Rillen lässt sich zeitlich nicht enger als früh- oder m ittelbronzezeitlich einordnen. Der Typ der Nadel 299 mit doppelkonischem K opf und Strichverzierung findet sich bevorzugt in der mittleren Spätbronzezeit, also im 10. Jahrhundert v.Chr. Schwierig datierbar ist der kleine Bronzemeissei 301 m it verstärktem M ittelteil. Der M eissei verfügt über eine Schneide und eine Spitze, die ursprünglich in einen H olzgriff eingelassen war. Für diesen M eissei finden sich Parallelen in früh- wie auch spätbronzezeitlichem Zusam m enhang.121
Nicht näher als in die Bronzezeit datierbar sind die kleine Ahle 302 sowie die K lingenfragm ente 307 und 309, die aus der Kulturschicht und aus den Kolluvien geborgen wurden. Des Weiteren belegen m ehrere Halbfabrikate die Verarbeitung von Bronze: das Drahtstück 314, der an einem Ende flach ausgehäm m erte vierkantige Stab 304, die Reste der Bleche 308 und 311 sowie der geschm olzene M etallklum pen 312.
Als Lesefunde w urden von der Ackeroberfläche bronzezeitliche Fragmente von Messer- und Sichelklingen sowie ein Bronzeringlein geborgen.
Ein ausserordentlicher Glücksfall war der Fund der grossen Trom petenkopfnadel 298. Die frühspätbronzezeitliche Nadel, welche eine Zierzone am N adelschaft aufweist, kann der Form «Yonne» zugewiesen werden (Abb. 90).122 Sie wurde ohne Begleitfunde beim A bhum usieren des Terrains ca. 100 M eter nördlich der Siedlungsstelle Hochstross gefunden (Abb. 57, 2). Ihre Lage in einem prähistorischen Bodenhorizont mit Nässezeigern lässt z.B. an eine gezielte Deponierung im W asser denken. Das hier flache Terrain gehörte in der Bronzezeit noch zum Sum pfgebiet des Tägerm ooses.
Interessanterweise wurde in der kaum 100 M eter entfernten Fundstelle T ägerw ilen -O bere Dritte Strasse eine weitere Bronzenadel ohne Begleitfunde entdeckt (Abb. 91). D iese Nadel ist vom selben Typ wie das in den Kolluvien auf H ochstross gefundene spätbronzezeitliche Exem plar 299. Tägerw ilen-O bere Dritte Strasse liegt ebenfalls am Rand des Tägerm ooses, doch bereits oberhalb des ehem aligen Feuchtbereiches (Abb. 5 7 ,4 ) .123
Die röm ische A ugenfibel 300 aus dem obersten Bereich der Kolluvien lässt sich ins 1. Jh. n.Chr. datieren (Abb. 32).124
Keramik der jüngeren Frühbronzezeit und älteren M ittelbronzezeit
Infolge der starken Fragm entierung lassen sich nur wenige Gefässform en ausmachen. U nter der Feinkeramik fallen die
i Abb. 89: Tägerw ilen: H ochstross. Pfeilspitzen. N eolith ikum oder B ronzezeit.
Abb. 91: T ägerw ilen: O bere D ritte Strasse. B ronzenadel m it verziertem H als, Länge 10,5 cm . L esefund. Spätbronzezeit.
zum Teil verzierten K nickw andschalen125 sowie «Pyxis»- ähnliche T öpfe126 auf, welche über eine steile W andung und oftmals über vertikal orientierte Verzierungsbänder und Henkel verfügen.
Fein- und grobkeram ische K alottenschalen kom m en in verzierten und unverzierten Varianten v o r127; das Exem plar 353 mit beidseitig verdicktem Rand könnte zu einem Schlitz- gefäss gehören. N eben dem verzierten K rug 442 finden sich grobkeram ische Näpfe, z.B . 346, Töpfe mit eher kleinem M ündungsdurchm esser, 354, und sehr grosse Töpfe, wohl Vorratsgefässe, 396 und 397. Etliche Gelasse tragen Henkel, die wand- oder randständig angebracht w urden .128 Reste von Siebgefässen sind ebenfalls vorhanden.129
Die Ränder der Keramik sind vorwiegend gerundet, seltener gekantet. Im unteren und oberen Bereich der Kulturschicht finden sich in wenigen Exem plaren auch horizontal abgestrichene, nicht verdickte sowie verdickte, jedoch gerundete Ränder.130
Die Feinkeramik fällt durch ihren Verzierungsreichtum auf. Ausser dem ausgesparten oder gekerbten W inkelband- M otiv finden sich Kerbbänder und einige wenige gepunktete Dreiecke, Rhomben, Gitter-M otive und Leisten mit doppelten H albm ondstem peln131 sowie auch zwei Gelasse mit vertikalen R ippen '32.
121 H afner 1995, 164; B ernatzky-G oetze 1987, 87.122 B eck 1980, vgl. Taf. 3 1 .6 -1 0 . Z u r D atierung d ieser N adelfo rm in die
m ittlere Phase der frühen Spätbronzezeit ders. 1980, 113.JbS G U F 82, 1999 ,267 .
124 R iha 1979, vgl. T a f.7 .1 9 3 -2 0 9 . Z u r D atierung Taf. 78.125 3 4 7 -3 4 9 ; 4 3 7 -4 4 1 .126 3 1 9 -3 2 0 ; aus den K olluvien: 551.
3 1 5 -3 1 8 ; 3 5 1 -3 5 3 ; 4 9 5 -4 9 6 .128 4 2 1 .4 2 9 ; 354. m 4 9 7 -4 9 8 .1,0 G erundet: 3 4 3 -3 4 9 ; 3 5 4 -3 6 3 ; gekantet: 364/365 und 368/369; ab
gestrichen / n icht verdickt: 371 und 491; gerundet / verdickt: 3 6 1 -3 6 3 , 383 und 484 - 485.
131 W inkelband: 320, 322, 431 , 432 , 438, 4 5 8 -4 6 1 , 4 6 4 -4 6 8 ; K erbband: 315, 316, 327, 3 3 3 -3 3 5 , 435, 440, 461; D reieck: 339, 340, 429, 430, 445; R hom bus: 326, 443; G itter: 317, 437; Leisten 404, 521, 522, 553.
132 V ertikale R ippen: 328 ,431 ; siehe auch Abb. 92 und vgl. ähnliches G efäss in A rbon-B leiche 2, H ochuli 1994, Taf. 29.333.
82 Nationalstrasse A l - Katalog ausgewählter Fundstellen
A bb. 92: T ägerw ilen: H ochstross. Fragm ente von G efässen m it R ippen und re icher R itzverzierung, flächigen V erzierungen, verzw eigten F ingertupfenleisten und G rifflappen, F ingertupfen m it herausgekn iffenen W arzen und aufgesetz ten W arzen. Jüngere F rühbronzezeit und ältere M ittelbronzezeit.
Bei der Grobkeram ik sind Fingertupfenleisten sehr häufig. Sie wurden unterhalb des Randes oder au f der Schulter angebracht, oftm als sind sie mit Grifflappen oder Henkeln kom biniert133. Es finden sich auch verzweigte und mehrfache Leisten, selten auch glatte E xem plare.134
Die Ränder der Grobkeram ik sind oftmals mit einfachen und doppelten Fingertupfen versehen, oder sie sind mit dem Fingernagel oder einem Instrum ent eingekerbt.135 Der vom Instrument an der Eindruckstelle verdrängte Ton vermittelt oft die Illusion, die Ränder seien leicht verdickt.
Flächig angebrachte Fingertupfen zieren häufig die W ände der Grobkeramik. Gelegentlich verfügen diese über einen
W ulst136, der m it dem Fingernagel warzenartig hochgezogen und durch seitliches Zusam m enpressen oft zusätzlich hervorgehoben w urde137. Flächig aufgesetzte Warzen wurden auf feinkeram ischen G elassen angebracht.138
Die Feinkeramik ist in der Regel fein- oder m ittelkörnig gem agert139 und die Oberfläche sorgfältig überarbeitet, wobei die Spuren der G lättung zum eist nicht m ehr mit Sicherheit erkannt werden können. Präzisierende Beobachtungen sind im Fundkatalog als solche vermerkt.
Die Grobkeram ik ist meist m ittel- oder grobkörnig gem agert. Sehr feine oder sehr grobe M agerung ist selten. Die Randpartien sind oft sorgfältig überarbeitet. Oberhalb der Fingertupfenleiste au f der Schulter ist der Hals- und Randbereich zum eist fein verstrichen oder geglättet, unterhalb der Schulter ist die W andung in der Regel grob verstrichen oder geschlickt (z.B. 514). Die Gefassfragm ente sind im Bereich der Kulturschicht meist dunkel-ockerfarben, bräunlich oder grau, aber auch rötliche und rötlich-braune Farbtöne kommen vor.
Die Feinkeramik ist zum eist dunkelgrau-bräunlich gefärbt. In den über der K ulturschicht liegenden Kolluvien sind alle Farbtönungen vorhanden, doch sind helle rötliche und ockerfarbene Tönungen häufiger als dunkle und bräunliche Färbungen. D iese Farbunterschiede sind au f die Erosion des Fundm aterials in den Kolluvien und die Feuchtigkeitsunterschiede in den Fundschichten zurückzuführen. Die Kolluvien sind trockener als die durch das Hangwasser verhältnism ässig stark durchfeuchtete K ulturschicht.140
D atierung des Fundm aterials aus der KulturschichtIm untersten Bereich der Schicht 315 wurden durch die
sedim entologischen U ntersuchungen Reste von Gehniveaus festgestellt. Die 14C-Proben 12 und 13 datieren den Horizont in die M itte des 17. Jhs. v.Chr. und somit den Beginn der bronzezeitlichen Besiedlung au f Hochstross in die späte Frühbronzezeit.
Die Proben 14 und 15 aus dem mittleren Bereich der Kulturschicht fallen ins 15. Jh. v.Chr.; ihre Eckwerte liegen aber noch im 16. Jh. v.Chr.
Die Proben 16 und 17 datieren aus dem 14. und 13. Jh. v.Chr., wobei die älteren Eckwerte von Probe 16 noch deutlich das 15. Jh. v.Chr. bestreichen. Nach der m ikrom orphologischen Untersuchung und aufgrund unserer Feldbeobachtungen scheint die Kulturschicht weitgehend in situ erhalten. Es stellt sich die Frage, ob die Keramik m it den 14C-Datie- rungen aus der Kulturschicht in Verbindung gebracht werden darf. Zur Klärung obiger Fragestellung wurde die Keramik
133 U nterhalb Rand: 385, 386, 3 8 9 -3 9 5 , 5 0 6 -5 1 1 ; G rifflappen/H enkel z .B .; 399, 400.
134 L eiste verzw eigt/m ehrfach: 397, 398, 402, 515, 516, 525, siehe auch Abb. 92; g la tte Leiste: 513.
135 E infache F ingertupfen: 3 7 8 -3 8 0 ; doppelte: 384, 499; F ingem agel- kerben: 377; m it Instrum ent eingepresst: 376.
136 407 und 408, 5 3 1 ,5 3 5 .137 4 0 5 ,4 1 1 , 436 , 532 und A bb. 92 links.138 409, 413, 443 und A bb. 92 oben und rechts.139 K om grösse: Feinkörnig - 0 ,5 m m , m itte lköm ig - 2 m m , g robkörn ig -
5 m m , sehr g robe M agerung > 0,5 m m.140 Z u V erfärbungen von K eram ik in A rbon-B leiche 3 vgl. L euzinger 2000,
26.
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 83
der Kulturschicht getrennt nach oberem und unterem Bereich ausgewertet. Die Auswertung lässt indes keine signifikanten U nterschiede in der Entw icklung von unten nach oben erkennen, und zwar weder bei den Randform en noch bei den Verzierungen. Auch anhand der wenigen erhaltenen durchgehenden Profite lässt sich keine Entw icklung von Gefass- form en sicher ausmachen. Die W anddicken entsprechen den W erten, wie sie für die jüngere Frühbronzezeit und ältere M ittelbronzezeit bekannt sind (Abb. 9 3 ) .141
Die Entwicklung der Keramik von der Frühbronzezeit zur M ittelbronzezeit ist im süddeutschen und schweizerischen Raum noch schlecht bekannt.142 Als Eckpunkte für die jü n gere Frühbronzezeit im Bodenseeraum gelten die Fundkomplexe aus A rbon-Bleiche 2 und den beiden deutschen Stationen Bodm an-Schachen I und Egg-Obere Gült. Sie enthalten reich verziertes M aterial. N ach Dendrodaten beginnt dieser Verzierungsstil um 1650 v.Chr. und endet offensichtlich vor 1500 v .C hr.143 Alle Verzierungselemente sind auch in Hochstross vertreten. Hierzu gehören die Motive Winkelband, Kerbleiste, Rhomben, gepunktete Dreiecke, Gefasse mit Rippen sowie Leisten m it doppelten Halbm ondstem peln (Abb. 94) und charakteristische G efassform en wie Knickwandschalen, verzierte K nickwandkrüge - au f Hochstross in mindestens einem Exem plar belegt - und «Pyxis»- ähnliche Gelasse.
Flächendeckende Fingertupfen und Fingernagelverzierungen sind in A rbon-Bleiche 2, im Nussbaum ersee und Bodm an-Schachen I vorhanden, jedoch nicht häu fig .144 Dagegen sind diese Elemente, zudem auch flächig angebrachte W arzen, in Hochstross gut vertreten. M öglicherweise handelt es sich dabei um eine regionale Eigenheit,
a 11.7
H 8.3
S3 7.0
B 5.0
t a
Abb. 93: K reuzlingen/T ägerw ilen: E n tw ick lung der W anddicken von der jün g eren F rühbronzezeit b is in d ie m ittlere Spätbronzezeit, g rün = M inim alw ert, rot = M ittelw ert, b lau = M axim alw ert
zumal diese Verzierungen auch im Töbeli häufig auftreten. A llerdings könnte diese Verzierungsweise auch chronologisch gedeutet werden. Flächige Fingertupfen, zum Teil mit warzenartig herausgekniffenen W ülsten finden sich näm lich in der Siedlung Forschner145, wo Fundmaterial der älteren M ittelbronzezeit m it D endrodaten zw ischen 1510 und 1480 v.Chr. verknüpft w ird 146. Zwar fehlt dort der reiche ritz verzierte Stil, doch gibt es vertikale R itzlinien-B ündell47, ein Verzierungselement, das in A rbon-Bleiche 2 noch nicht enthalten ist. In H ochstross sind vereinzelte Scherben mit Resten von flächigen Ritzlinien vorhanden, z.B . 332. Für die flächig aufgesetzten Warzen finden sich weder in Arbon- Bleiche 2 noch in den nur auszugsweise publizierten Fundm aterialien von Bodm an-Schachen I und den frühbronzezeitlichen Siedlungen am Zürichsee Vergleichsstücke. Sie sind jedoch in Toos-W aldi148 sowie in U rdorf-H erw eg149 vertreten. Im Gegensatz zu Hochstross beobachtet man in Urdorf-Herweg zahlreiche flächige Ritzlinien. Zudem finden sich flächig m it einem Kam m eingestochene M otive und verdickte, horizontal abgestrichene Ränder.150 Letztere beiden Elemente fehlen in Schicht 315 in H ochstross (Abb. 95) und unter den Funden aus Bad Buchau Siedlung Forschner.151 Gefasse mit flächig aufgesetzten Warzen tauchen in G rabhügeln der m ittleren Bronzezeit au f der Schwäbischen Alb auf.
Zum G elass 444 m it aufgesetzten Warzen existiert eine gute Parallele im Inventar eines G rabhügels aus Gross- engstingen-Haid, sowohl was die Verzierungstechnik als auch das G efässprofil anbelangt152. Letzteres ist m it einer Stachelscheibe, einer Lochhals- sowie einer anderen Nadel m it geschwollenem Hals vergesellschaftet: diese Bronzen
141 H ochuli 1994, 134. B estä tigung in den zeitg leichen Fundste llen U nterführung A R A -S trasse und K reuzlingen-T öbeli.
142 H ochuli 1998, 57; F ischer 1997, 16; H afner 1995, 173.143 H ochuli, K öninger u. R u o ff 1994. 276; H ochuli 1994, 128; K öninger
1995.144 H ochuli, K öninger u. R uoff 1994, 276; V ergleichsstücke in A rbon-
B leiche 2: H ochuli 1994, flächige F ingertupfen und F ingernagelkerben: Taf. 34.411; Taf. 67 .553; Taf. 68 .565; Taf. 7 9 .2 7 4 -7 2 7 ; flächige F ingertupfen m it herausgekniffenen W arzen: Taf. 14.151; V ergleichsstücke im N ussbaum ersee: H asenfratz u. Schnyder 1998, Abb. 160. 52, 53.1998, 160. Das reich verzierte Fundm aterial im N ussbaum ersee lässt sich m it Vorsicht m it D endrodaten aus der M itte des 16. Jhs. v.Chr. verknüpfen. K eefer 1990, Taf. 4 - 6 .
146 K eefer 1990 ,41 .147 K eefer 1990, Abb. 5 .7 -8 ; Abb. 7.2.148 S itterd ing 1974/75, Abb. 12.12.
B auer e t al. 1992, Taf. 3.83.150 D ie Funde von U rdorf-H erw eg w erden früh m itte lb ronzezeitlich datiert,
B auer et al. 1992, 15. V ergleiche zum B ronzebeil aus U rd o rf finden sich in m itte lb ronzezeitlichen Fundkom plexen von Bz B bis Bz C I , F ischer 1997 ,43 .
151 Die bei K eefer 1984. 49, angeführten «verdickten R andbildungen» stam m en von ausladenden R ändern m it gekan teten R andlippen. D iese Form en finden sich auch in A rbon-B leiche 2 und in T ägerw ilen- H ochstross und sind nicht als spezifisch m itte lb ronzezeitlich zu be trach ten. Die horizontal abgestrichenen R änder sind zw ar bereits in der ä lteren M itte lb ronzezeit häufig , H ochuli 1990, 81, d ie verd ick t horizontal abgestrichenen R änder scheinen in d er frühen S iedlung Forschner jedoch noch zu fehlen.
152 P irling et al. 1980, 25 und Taf. Ì5 .0 6 . D ie K eram ik aus den G rabhügeln a u f der Schw äbischen A lb kann nu r unsicher gesch lossenen G rabinven- taren zugeordnet werden. F lächig aufgesetz te W arzen finden sich auch in m itte lb ronzezeitlichen G rabhügeln bei H ossingen (D ), dies. 1980, Taf. 24B, und bei T roch telfingen (D ), dies. 1980, Taf. 51 A6, B.
jüng
ere
Früh
bron
zeze
it/äl
tere
M
ittel
bron
zeze
it (c
a. 1
650
v. C
hr.-1
450
v. C
hr.)
84 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
>o
O>
|£<00
2XI
1 s
lc
iMZJByW I im u a j d n y a 8 u i j aS iq cB ]
8 8 ä 2im• #
•
- - = s •a°o •
•
•
■1=5wi #
• 5
'# 4# m # — • —
7 7 7[• s• • # -
'P i‘, •■Mt •
>C £ •# • •
# # e" •3 ***-• e # •
i == e • #- r •
3 Al///// e # Os• • • • 2
4 • r r • R#» w # •♦s • S #- #- • e2
i(ZXZX2># • • • e"m•" • • • •'S i # • 5 r • 2'W • e SOr • 2es/) #- • S* r•
• #3 • • •'» /f • # * r
• = 00• 00•• e2 •
"XX • •
51 nmi •
5S •
II5 £
lsllSä
fll«IsSai?ä
■3 1ilH li
U CO
1;! ca »
s1j1
2-D
1
I§
1
%
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 85
h äu fig > 40 Stk.
_ gu t vertre ten• 6 -40 Stk.
• w en ige 2-5 Stk.
• vo rh an d en 1 Stk.
geru
ndet
geka
ntet
hori
zont
alab
gest
rich
en
verd
ickt
hor.
abge
str.
verd
ickt
Tri
chte
rran
d
Inne
nfaz
ette
meh
rere
Faz
ette
n
Kal
otte
nsch
alen
Scha
le
Abs
atz
Scha
le
Ran
dlip
pe
geru
ndet
Scha
le
verd
ickt
In
nenf
azet
te
IIII
IIII S
chrä
gran
d,au
slad
end
Schr
ägra
nd
stei
l
Schr
ägra
nd
flau
Ï Ï T31
F fT\
% % T fiK reuzlingen -T öbeli F B Z spät/M B Z früh •
19• 3• 2•
T ägerw ilen -A R A FB Z spät/M B Z früh
20• 8• 1 1
T ägerw i len- H ochstross U K K S F B Z /M B Z früh •
27# 1 4•
T ägerw ilen -H o ch stro ss O K K S F B Z /M B Z früh € 39• 4• 4•T ägerw .-H ochstr. K ol- luv ium F B Z , M BZ , SBZ
^ ^ 2 8 26e 3• 2* 5• 2• 4# 4•T ägerw ilen -im R ibi, M B Z
13e 6• 3• 1 2• 1
K reuzlingen -R ib i- B runegg , M B Z spät w
17• 1 10•
11e 4•
9e 2•
K reu z lin g en -B em rain , M B Z spät, SB Z
39•
3•
1 3•
3•
7# 1(?) 3•
13e 4•
21•
1
T ägerw ilen -im R ibi, SBZ7
•1 3
•16
•1 7• 4• 1 10• • 18• #
2• 6#Abb. 95: K reuzlingen/T ägerw ilen: E n tw icklung der R andform en von der jün g eren F rühbronzezeit bis in d ie m ittlere Spätbronzezeit.
treten erst ab Bz C I, d .h . in der mittleren M ittelbronzezeit, au f .153
Auch zum bauchigen, mit gepunkteten Dreiecken und einem gepunkteten Band verzierten Gefass 429 aus der Schicht 315 in Hochstross findet sich ein Vergleichsstück in den m ittelbronzezeitlichen Grabhügelinventaren der Schwäbischen Alb, so ein in Verzierung und Proportionen sehr ähnliches Exem plar aus G rossengstingen-H aid154. Das betreffende Stück lässt sich heute nicht m ehr einem bestim m ten Grabinventar zuordnen, doch kennen w ir aus den G rabhügeln auch Elemente der älteren M ittelbronzezeit wie Lyra- und Lochhalsnadeln mit vierkantigem Schaft. Unser G efass ist bauchiger und gedrungener als Vergleichsfunde aus A rbon-Bleiche 2, lehnt sich also eher an Formen aus der Siedlung Forschner und der m ittelbronzezeitlichen Grab- inventare an, die tendenziell bauchiger und gedrungener gestaltet sind als die älteren Formen in A rbon-Bleiche 2 .155
Zusam m enfassend kann zur Kulturschicht 315 von Hochstross festgehalten werden, dass der grösste Teil der Keramik aufgrund der G elassform en und Verzierungen dem aus Arbon-Bleiche 2, Bodm ann-Schachen I, Schicht C und Egg-Obere Güll bekannten reich verzierten Stil entspricht und daher mit den 14C-Datierungen vom untersten Bereich der Kulturschicht zu verknüpfen ist. Dem gegenüber finden sich vereinzelte Gefässform en und einige Verzierungselem ente wie flächige Fingertupfen und flächig aufgesetzte Warzen sowie flächige Strichverzierungen, die in die ältere M ittelbronzezeit weisen. Der Fundkomplex aus Hochstross kann zeitlich zwischen A rbon-Bleiche 2, Mitte des 17. Jhs. v.Chr., und der Siedlung Forschner am Ende des 15. Jhs.
v.Chr. eingeordnet werden. Er ist insgesam t etwas älter als die jüngsten Elemente im Fundkomplex der Fundstelle Urdorf-Herweg im Kanton Zürich.
Die m ittelbronzezeitlichen 14C-Daten aus der M itte der Kulturschicht streuen stark und erlauben nur eine grobe zeitliche Einstufung der jüngeren Funde aus Hochstross in die ältere M ittelbronzezeit. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass die jüngsten Daten, die m it ihren Eckwerten bis ins 14. Jh. v.Chr. reichen, mit einer Kontam ination durch organisches Material erklärt werden müssen; sie dürften im Zusam m enhang mit der in den darüber liegenden Kolluvien festgestellten Siedlungsphase der jüngeren M ittelbronzezeit zu sehen sein. Die Frage nach der Laufzeit des reich verzierten frühbronzezeitlichen Keram ikstils lässt sich m it dem vorliegenden Fundkomplex nicht schlüssig beantworten.
D ie Keramik aus den Kolluvien Scherben aus der jüngeren M ittelbronzezeit
Die Kolluvien (Schicht 310) enthalten zum grössten Teil um gelagertes Fundm aterial, das aus den im hangwärtigen Teil der Siedlung erodierten Kulturschichten stammt. Das Fundspektrum um fasst überwiegend die oben beschriebenen M erkmale, darunter auch reich verzierte Scherben,
153 F ischer 1997 ,31 .154 P irling et al. 1980, Taf. 16.1 1. D er T richterrand des G efässes bei P irling
ist ergänzt und nicht gesichert. D ie w enigen G efässe m it R itzverzierungen a u f der Schulter, darun ter S tücke m it steil orien tiertem Rand, datieren in die ältere Stufe der M itte lbronzezeit, dies. 1980, 2 5 -2 8 . G epunktete D reiecke finden sich auch im Fundm aterial von U rdorf-H erw eg (Z H ) in d er ä lteren M itte lbronzezeit, B auer et al. 1992, Taf. 2 .6 8 -7 0 .
155 H ochuli 1 9 9 4 ,Taf. 22.263, 265; K eefer 1990, z.B . Abb. 5.4.
86 Nutionalstrasse AT - Katalog ausgewühlter Fundstellen
vgl. Tabelle Abb. 94. Im Fundkatalog wird nur ein Teil dieses um gelagerten M aterials w iedergegeben.156
Im unteren Bereich der Kolluvien wurden partiell Reste eines m ittelbronzezeitlichen Benutzungshorizontes festgestellt. U m gelagerte Funde aus dieser Zeit finden sich auch bis in den oberen Bereich der Schicht 310. Im Folgenden werden die in den Kolluvien neu auftretenden Elemente der entwickelten M ittelbronzezeit beschrieben: verdickte Ränder, die teilweise durch ihre sehr grobe M achart auffallen, unregelm ässig gefertigte Ränder von G elassen mit geschlickter Oberfläche, horizontal abgestrichene, verdickte Ränder oder solche, die nach innen verdickt s ind .157
Das G elass 559 ist geschlickt und verfügt über sehr grob eingepresste Fingertupfen au f dem Rand, an dem zusätzlich ein Grifflappen mit Delle angebracht wurde. Von m ittelbronzezeitlichen Gefassen dürften auch folgende Beispiele stammen: die Scherbe 571 mit unregelm ässig verteilten flächigen Kerben, 572 m it geritztem Motiv, Exemplare mit Resten von flächigen Ritzlinien wie z. B. 557 sowie die Schulterpartie des Knickwandgefässes 570.
Die Wanddicken der Randscherben mit m ittelbronzezeitlichen M erkmalen liegen m it 8,5 mm M ittelwert erwartungs- gem äss deutlich höher als jene der übrigen Scherben in der Kulturschicht 315. Sie entsprechen somit den Werten der jü n geren M ittelbronzezeit (Abb. 9 3 ).158
Funde der Spätbronzezeit und älteren EisenzeitDie spätbronzezeitlichen Scherben aus dem östlichen
Grabungsabschnitt stam m en aus dem oberen Bereich der Kolluvien respektive Schicht 310 und aus den spätbronzezeitlichen Gruben, Pos. 18, 48 und 39. Weiter westlich fand sich Keramik dieser Zeit auch tiefer liegend in den Kolluvien.
Aus der frühen Spätbronzezeit stammen zwei Scherben mit lang gezogenen Dreiecken, Rhom ben und Zickzack- M otiv.159 Dazu gesellt sich die ca. 100 m ausserhalb des Siedlungsareals Hochstross geborgene Trom petenkopfnadel 298.
In die Stufe Ha B 1 datiert die Bronzenadel 299, deren Hals verziert, deren bikonischer K opf aber unverziert ist. Sie ist zeitgleich mit der spätbronzezeitlichen Keramik, z.B. den konischen Schalen mit schwach ausladendem , facettierten R and160 und Schrägrandgeiassen '6'. Die Schale 594 trägt Reste einer eingestochenen Verzierung au f dem Rand.
Die Funde aus der frühen und m ittleren Spätbronzezeit sind möglicherweise von der nahen Fundstelle Tägerwilen- Ribi angeschwemmt worden. Man kann ihnen keine sicheren Baustrukturen zuweisen. Hingegen finden sich Reste von Gruben und Pfostengruben aus der Spätphase der Spätbronzezeit am Übergang zur älteren Eisenzeit.
Das Dendrodatum von einem verkohlten Pfostenstum pf weist ohne Splint und W aldkante ein Endjahr um 870 v.Chr. auf. Es ist mit einer S iedlungstätigkeit im späten 9. Jh. v.Chr., wenn nicht bereits am Übergang zur Hallstattzeit, zu rechnen. Die Kalottenschalen mit Innenfacette 575 und 598 dürften zu dieser späten Phase gehö ren162, ebenso m ehrere graphitierte und bem alte W andscherben. Eindeutig hallstattzeitlich ist die Randscherbe 596 eines G elasses, das im Halsum bruch über eine Leiste mit beidseitig alternierend eingepressten Kerben verfügt, was der Verzierung ein zopf- oder fischgrätähnliches
Aussehen verleiht. Im M aterial der Siedlung W äldi-Hohen- ra in 163 sind einige Keram ikfragm ente mit gleichem Dekor auszumachen. Ein sehr ähnliches Stück stam m t schliesslich aus der späten Hallstattzeit (Ha D) aus der Siedlung vom U etliberg164, ansonsten scheint dieses eigentüm liche Verzierungsm otiv in der Nordostschweiz nur schwach vertreten zu sein, dies im Gegensatz zu Baden-W ürttem berg165, Südbayern '66 und dem Salzburger R aum '67.
Funde der jüngeren EisenzeitAus der G rube Pos. 99 konnten neben knapp 9 Kilogramm
verbranntem Fachwerklehm, der teilweise noch die Negative von Rundhölzern aufweist, die Rand-, Wand- und Bodenscherben 599-603 geborgen werden, die eine Nutzung des Areals in der Frühlatènezeit nahe legen. Alle Scherbenfragm ente zeigen eine teilweise starke sekundäre Brandeinwirkung, die Oberflächen sind kaum m ehr erhalten. Einzig au f der Wandung der scheibengedrehten, feinkeram ischen Schüssel 599 lässt sich noch wenig G lättung nach- weisen. Das unverzierte Schüsselfragm ent mit scharfem W andumbruch weist einen bem erkenswert kugelig gerundeten Rand auf, der au f eine lokale Töpfertradition schliessen lässt. A uf der Randpartie lassen sich feine, regelmässig parallel verlaufende Drehrillen ausm achen, die von der Arbeit des Töpfers au f einer Drehscheibe herrühren. Formal ähnliche Stücke finden sich im frühlatènezeitlichen Material vom U etliberg168 oder vom G oldberg169 in Süddeutschland. In beiden Stationen sind die Ränder allerdings nicht so rund ausgestaltet. Zu grobkeram ischen Gefassen gehören die beiden N apfränder 600 und 601. Der poröse Charakter der Scherben weist au f organische M agerung hin, die durch H itzeeinwirkung herausgelöst wurde. Von Hand aufgebaute Näpfe dieser Art sind in latènezeitlichem Kontext sehr häufig anzutreffen. So finden sich gute Vergleichsstücke im frühlatènezeitlichen M aterial von G elterk inden '7", S issach '7' oder Alle, Noir B o is '72. Das grobkeram ische, poröse Bodenfragm ent 603 dürfte zu einem dieser beiden G elasse gehören. E inzigartig ist die grobkeram ische Randscherbe 602 m it zip-
5 4 7 -5 5 5 ,5 6 1 -5 6 6 .157 V erdickte Ränder: 558, 568, 587 und Abb. 95; R änder und geschlickte
O berfläche: 560, 567; horizontal abgestrichene R änder: 585, 586; innen verd ick ter Rand: 559, 569.
158 H ochuli 1994, 134. Die W erte entsprechen jen en von K reuzlingen- R ibi-B runegg.
159 Für das lang gezogene Z ickzack-M otiv 590 vgl. F ischer 1997, Taf. 54.325; zu den lang gezogenen D reiecken m it R hom ben 589 vgl. F ischer 1997, Taf. 45 .167.
160 574, 5 9 4 -5 9 6 .5 7 3 ,5 9 2 ,5 9 3 .
162 N agy 1999, 13.163 H ochuli 1990, Taf. 50 .946; Taf. 51.947, 948.164 B auer e t al. 1991, 142, Abb. 177.519 und Taf. 41.519.165 B aitinger 1999, Taf. 70.16, das Stück stam m t aus e inem B randgrab vom
Ü bergang von Ha C zu Ha D. Vgl. auch Taf. 79.E 3; Biel 1987, Taf. 104.76.
166 Z.B. K ossack 1959, T a f 144.10.167 S tö llner 1999. z .B . Taf. 4 2 .A 14.168 B auer et al. 1991, T a f 6 7 .9 2 8 -9 3 0 .169 Parzinger et al. 1998, Taf. 40 .457, 463.170 M artin e t, al. 1973, 179. Abb. 6.171 Tauber 1987, 107, Abb. 4.17.172 M asserey u. Joye 1997, 147, Abb. 18.8.
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 87
felartiger Randausprägung und horizontal abgestrichenem und getupftem Rand. Fingertupfenverzierte Ränder - aber ohne solche «Zipfel» - sind bereits ab der Späthallstattzeit gut belegt. Ein paar wenige Gefässe der Hallstattzeit aus Baden-W ürttem berg 173 und B ayern174 sind ein schwacher A nhaltspunkt dafür, dass m it solch speziell gestalteten Rändern bereits in der älteren Eisenzeit zu rechnen ist. Die Gefässe sehen form al zwar anders aus, sie besitzen jedoch eine recht eigenwillige Randpartie.
Trotzdem dürfte unser Stück von Hochstross ein Novum darstellen, denn bislang scheinen keine publizierten Vergleichsstücke aus frühlatènezeitlichen Fundzusam m enhängen in der Schweiz und benachbarten Gebieten vorzuliegen. Das Fragm ent ist gröber gem agert als die Napfränder, ansonsten steht es den beiden Stücken von der M achart her sehr nahe. Der «Zipfel» hebt sich knapp 1 cm von der um liegenden Randpartie ab, er dürfte aufgesetzt worden sein. Wie die übrige Randpartie ist er relativ flach und leicht überschlagen. Eine schwach ausgebildete Delle au f dem «Zipfel» bildet die Fortsetzung der Fingertupfenverzierung, die bereits au f der restlichen Randpartie zu beobachten war. Eine Funktion des «Zipfels» als A usguss175 ist aus rein praktischen Gründen auszuschliessen.
Aus dem alpinen Raum sind schneppen- oder zipfelartig ausgeprägte Ränder und Ausgüsse aus dem Um feld der Laugen-M elaun- oder der Fritzens-Sanzeno-Kultur für die ältere und jüngere Eisenzeit durchaus beleg t.176 Allerdings handelt es sich bei diesen Henkelkrügen und Kannen um völlig andere Gefässform en, die sich mit unserem Stück nur schlecht vergleichen lassen. Es ist nicht auszuschliessen, dass dieser einzigartige Fund aus Hochstross eine alpine Keramiktradition wiedergibt, die über das Rheintal ans westliche Bodenseeufer gelangte.
D er Inhalt von Grube Pos. 99 w ird hier als geschlossenes Fundensemble angesprochen, da keine M ehrphasigkeit der Grubenfüllung feststellbar war. Der Charakter der Funde ist sehr einheitlich, alle Stücke weisen sekundäre Brandspuren auf. Der Grubeninhalt kann über den typologischen Vergleich in die Frühlatènezeit (574. Jahrhundert v.Chr.) datiert werden, auch wenn die oben beschriebenen Näpfe durchaus bereits in der Späthallstattzeit belegt sind. Der D atierungsvorschlag in die Stufe Fatene A oder B wird durch die Drehscheibenkeram ik gestützt, eine feinere Zuweisung ist jedoch mangels M etallfunden wenig sinnvoll. Die Datierung wird indirekt auch durch die 14C-Probe 18 bestätigt. Das kalibrierte Datum, 530 B C -3 9 0 BC, umfasst eine relativ lange Zeitspanne und lässt eine präzisere Zuordnung der Funde nicht z u .177
In den gleichen Zeitabschnitt gehört auch die Steinsetzung, aus der leider keine datierbaren Funde stammen. Die stratigraphische Lage dieses Befundes sowie die 14C- Datierung 19 von einem verkohlten Balken oder Brett aus der Steinsetzung legen jedoch eine Datierung in die Frühlatènezeit nahe.
Von einer relativ kontinuierlichen Nutzung des Areals bis in die Spâtlatènezeit zeugen einzelne Keram ikfragm ente aus den obersten um gelagerten Schichten ohne Befundzusam m enhang sowie drei M ünzfunde. Neben den von Hand aufgebauten Näpfen 578-580 finden sich weitere scheiben
Abb. 96: T ägerw ilen: H ochstross. Latènezeitliche M ünzen: Potin-M ünze, M otiv nicht erkennbar; keltische M ünze, sog. R eiterquinar. Vorderseite: D arstellung e ines nach rechts gew andten K opfes, 2. Jh. v. C hr (M 2:1).
gedrehte Keram ikstücke, z. B. 604, darunter auch eine Wandscherbe m it Resten von Gefassbem alung und ein feinkeram isches, stark verw ittertes Randfragm ent einer Schale.
Bem erkenswert sind die beiden neuen M ünzfunde (Abb. 96) von der Hochstross aus der M ittel- und Spâtlatènezeit. Dabei handelt es sich um eine äusserst schlecht erhaltene Potinmünze und einen Reiterquinar. Die beiden keltischen M ünzen passen zu einer G oldm ünze178, die im letzten Jahrhundert in der U m gebung gefunden wurde und heute leider verschollen ist.
173 Van den B oom 1989, Taf. 81.949, 950. D ie beiden G efässe von der H euneburg s tam m en aus unstra tifiz ie rtem Z usam m enhang , d ie en tsche idende R andpartie ist nur zu r H älfte erhalten.
174 T horbrügge 1979, Taf. 169.8.175 A usgüsse an e isenzeitlichen N äpfen sind z. B. bekann t aus dem A real
Poser in L iechtenstein. E insicht in das unpubliz ierte Fundm aterial verdanke ich M atth ias G urtner.
176 Von U slar 1997, 159 ff., Abb. 5 und Abb. 8.11.177 Z u r Problem atik von 14C-A nalysen e isenze itlicher Proben vgl. Brogli u.
S chib ier 1999, 104 und A bb. 32, und R uckstuhl 1989, 72, Tab. 2.178 K eller u. R einerth 1925, 214.
Abb. 97: T ägerw ilen: T ägerm oos-A n der Zw eiten Strasse. P feilsp itze aus B ronze (M 1:1). O berflächenfund. Sam m lung Böhler, T ägerw ilen.
88 Nationalstrasse A l - Katalog ausgewählter Fundstellen
Römische FundeBei Begehungen fanden w ir einige Terra-Sigiliata-
Scherben. Es überrascht deshalb nicht, dass römisches Material auch in den oberen Kolluvienschichten 200 und OK 310 vorkommt. Bauliche Strukturen fehlen. Neben einigen W andscherben w urden die Randscherbe 584 einer so genannten rätischen Reibschüssel m it Kragenrand des späteren 2. Jhs. n .C hr.179 sowie die A ugenfibel 300 des 1. Jhs. n.Chr. (Abb. 32)180 geborgen. Die Funde deuten im weitesten Sinn au f eine landwirtschaftliche Nutzung des Geländes in röm ischer Zeit hin.
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg
Siedlungsspuren aus der mittleren Bronzezeit
Entdeckung und Lage
W ährend der G rabungen au f der Flur Hochstross wurden auch die Baustellen in der näheren Um gebung abgesucht. Dabei entdeckten wir im Februar 1998 im Kreuzlinger N eubauquartier Ribi-Brunegg eine Siedlungsstelle der mittleren Bronzezeit. Die Fundstelle liegt nur knapp 300 M eter von der uns bereits dam als bekannten Fundstelle Ribi entfernt au f einer flachen M oränenterrasse. Im Herbst 1998 kam Ribi- Girsbergtunnel dazu (Abb. 98).
Abb. 99: K reuzlingen: R ibi-B runegg. N o tg rabung a u f dem Trassee des Z eppelinrings. D ie K ulturschicht liegt unm itte lbar unterhalb des neuze itlichen Pflughorizontes.
4 2 8 .7 0m ü . M .
0 I m
Abb. 100: K reuzlingen: R ibi-B runegg, nö rd licher B ereich Zeppelinring . N ordp ro fil von Feld 1. M 1:50.
Die Befunde
Wie sich rasch herausstellte, waren die prähistorischen Schichten bereits früher wie auch im Zuge der 1998 laufenden Abhum usierung zu einem grossen Teil zerstört worden. Gut erhalten war lediglich eine Kulturschicht im Trassee der Erschliessungsstrasse Zeppelinring, die sich über eine Länge von ca. 80 M etern und eine Breite von 1-2 M etern erstreckt;
Abb. 98: K reuzlingen/T ägerw ilen . S ituation 1 :10000 . 'R ib i ;2R ibi-B runegg; 1 R ib i-G irsb e rg tu n n e l;2 R ibi-S trasse.
davon konnte die Hälfte bei w interlicher W itterung, Schnee und Regen untersucht werden (Abb. 99).
Kulturschichtreste wurden im Juni 1998 auch weiter südlich festgestellt (Abb. 104). Wir schätzen, dass sich die Fundstelle Ribi-Brunegg über mindestens 10000 m 2 erstreckt. Grössere zusam m enhängende Kulturschichten dürften im südlichen Bereich bislang erhalten geblieben sein (Abb. 102).
Befunde im nördlichen Bereich des ZeppelinringsDirekt unter der Pflugsohle fand sich das Schichtpaket 200
mit der für Landsiedlungen ausserordentlich gut erhaltenen Kulturschicht 210 (Abb. 100) und der darunter folgenden Schicht 220, einem dunklen, olivgrauen Lehm m it viel Holzkohle, d. h. Rodungszeigern. Der Lehm lag a u f der verw itterten Moräne, Schicht 300.
Die A uftrennung des Schichtpaketes 200 in die Schichten 210 und 220 gelang erst bei der Dokumentation der Profile. Fundführend war ausschliesslich die 10-15 cm mächtige Kulturschicht 210, dicht durchsetzt mit hitzeversehrten Steinen und Keram ikscherben (Abb. 101). Im stark entkalkten Boden blieben nur wenige Knochen erhalten.
Sichere Strukturen wie Pfosten- oder W erkgruben zeichneten sich nicht ab. Dagegen fielen markante Fund-
179 Schucany et al. 1999 ,74 .180 R iha 1979, Typ 2.3 vgl. Taf. 7 .1 9 3 -2 0 9 . Z ur D atierung Taf. 78.
Abb. 101: K reuzlingen: R ibi-B runegg. D ie K ulturschicht m it h itzeversehr- > ten S teinen und K eram ikscherben.
90 Nationalstrasse A l - Katalog ausgewählter Fundstellen
<278850 t ~-~-j
T ~ Dokumentierte Baugrubenprofle
1----- 1 Grabungsfeld
Ausdehnung der erhaltenen Fundschichten (geschätzt)
/S'^ 3 Ausdehnung der Erdarbeiten s
Sj (Bauprojekt)'
.278800
1024
Abb. 102: K reuzlingen: R ibi-B runegg. S ituation 1:1000.
konzentrationen auf: An zwei Stellen fanden sich bis zu 11 kg Hitzesteine und bis zu 3 kg Keramik pro m 2, während es im Zw ischengelände weniger als 1 kg Steine und wenige hundert Gramm Keramik pro m 2 waren (Abb. 103). Eine dritte Fundkonzentration enthielt nur Keramik.
Die Befunde im südlichen Bereich des ZeppelinringsIm Süden der Fundstelle beschränkten wir uns au f die
Dokum entation der Profile entlang der Kanalisationsgräben (Abb. 104). Da dieser A bschnitt direkt am Hangfuss liegt, sind die Schichtabfolgen mächtig: A uf die M oräne folgte wiederum ein dunkelgrauer Lehm mit Holzkohle, sprich Rodungszeigern (Abb. 105, Schicht 400). Darüber fand sich als Rest einer Kulturschicht (Schicht 300) ein dunkel- grau-brauner, sandiger Lehm, der bereits als Kolluvium anzusprechen ist. Überlagert war diese von etwas hellerem, ockerfarbenem , praktisch fundleerem angeschwemmtem Hanglehm von ca. 1 M eter M ächtigkeit, Schicht 200.
Die Funde(KNr. 606-801; Abb. 196-201, S. 192-203)
Die Hauptm asse der Funde stellt die Keramik. U nter den 7010 Scherben m it einem Gesam tgewicht von 44,2 kg Hessen sich 184 Rand-, 106 verzierte Wand- und 42 Bodenscherben G elassindividuen zuteilen. Auffällig ist der m it 79,2% sehr hohe Anteil an Grobkeram ik gegenüber 19,5% Feinkeramik und 1,3% unbestim m baren Scherben. Als Besonderheit ist ein W ebgewicht zu erwähnen.
Die Oberflächen der grobkeram ischen Gefässe sind einfach verstrichen, geschlickt oder aufgerauht181, der Ton in der Regel grob gem agert, mit Körnern von 5 -7 mm, in Einzelfällen sogar bis zu 10 m m Durchm esser (Abb. 106 oben)182. Dem gegenüber sind die feinkeram ischen Gefässe höchstens
181 geschlickt: z. B. 658; m it Spate lstrichen aufgerauht: 777, 778.182 K orngrösse: Feinkörnig - 0 ,5 m m , m itte lkörn ig - 2 m m , grobkörn ig
- 5 m m , seh r g robe M agerung > 0 ,5 mm.
Nationalstrasse AT - Katalog ausgewählter Fundstellen 91
Verteilung der Hitzesteine
Verteilung der Keramik
§Gramm/m2 < 5 0 Q < 1 0 ( 0 1 0 0 - 5 0 0 0 500-10 0 0 g 1 0 0 0 - 2 0 0 0 g 2 0 0 0 - 4 0 0 0 ^ 4 0 0 0 - 7 0 0 0 0 > 7 0 0 0 f l u n z u w e i s b a r Q
A bb. 103: K reuzlingen: R ibi-B runegg. Feld 1. H itzeste ine und K eram ik, V erteilung nach G ew icht.
mëm
Abb. 104: K reuzlingen: R ibi-B runegg, Z eppelinring . Im Profil des K analisationsgrabens dunk ler H orizon t m it zah lre ichen H olzkoh len (R odungszeigern), darüber K ultu rsch ich treste und m äch tige Schw em m schichten .
728 994.11 278 732,21
4 3 0 .0 0
m ü . M .
0
Abb. 105: K reuzlingen: R ibi-B runegg, Z eppelin ring . S üdprofil. M 1:50.
Abb. 106: K reuzlingen: R ibi-B runegg. V erzierungselem ente: F ingertupfenleiste; runde A bdrücke e ines N adelkopfes a u f K nickw andschale; flächendeckende E instiche (M 1:1). M ittelbronzezeit.
m it Körnern der Grösse bis 1 mm gem agert. Ihre Oberflächen sind sorgfältig überarbeitet und geglättet.
Die beiden Silices, der Abschlag 607 und die Pfeilspitze 606, sind nicht unbedingt bronzezeitlich. Die Pfeilspitze stammt aus dem untersten Bereich der Kulturschicht und könnte ein Hinweis au f eine N utzung des Areals in neolithi- scher oder frühbronzezeitlicher Zeit sein.
Trotz des hohen Fragm entierungsgrads der Keram ik lassen sich folgende G efässform en183 ausmachen: Schüsseln,
183 Schüsseln: z .B . 636, 638; K nickw andschalen: z .B . 653, 654; K alo ttenschalen: 7 8 8 -7 9 4 ; Töpfe: z .B . 658; verm utlich F lasche: 656.
92 Katalog ausgewählter Fundstellen
Knickwandschalen, Kalottenschalen, Töpfe und vermutlich Flaschen. A nzuführen ist zudem das W ebgewicht 800.
U nter den Verzierungsformen der Feinkeram ik gibt es verschachtelte Dreiecke, ein im jüngeren A bschnitt der M ittelbronzezeit beliebtes M otiv.184 Daneben finden sich Knickwandschalen m it Einstichreihen au f dem W andknick, z.B . 654, und andere m it flächendeckenden Kerben und Nadelkopfeindrücken, z.B . 653. Obwohl diese Verzierung kerbschnittartig anm utet, handelt es sich um eingepresste Kerben. Echter Kerbschnitt ist nicht vorhanden.
Fragmente von Töpfen oder Flaschen tragen Bänder, die mit flächendeckenden Einstichen gefüllt sind, z. B. 655-657 . Aus dem mittleren A bschnitt der M ittelbronzezeit finden sich vergleichbare Gelasse in der H ügelgräberkultur au f der Schwäbischen A lb .185 Die Einstiche au f den G elassen wurden verm utlich m it N adelspitzen angebracht. Die Scherbe 649 trägt als Verzierung die Reste eines W inkelband- Motives, ein von der frühen Bronzezeit bis in die frühe Spätbronzezeit bekanntes V erzierungselem ent.186
Bei grobkeram ischen G elassen sind die W andungen und vor allem die Randlippen oft sehr unregelm ässig ausgearbeitet. Sie verfügen über eine mittlere W anddicke von 8,8 mm, ähnlich jener der verhältnism ässig dickwandigen G elasse der jüngeren M ittelbronzezeit von Hochstross und anderswo, siehe Abb. 93.187
Wie in der Frühbronzezeit finden sich unter den Verzierungen der G robkeram ik Fingertupfenleisten unterhalb des Randes, der aber im Gegensatz dazu in m ittelbronzezeitlicher A rt stark verdickt ist; häufig sind Fingertupfen au f der Randlippe, ebenso Fingertupfenleisten sowie Leisten, welche glatt, verzweigt oder gekerbt sein können. Flächendeckende Fingertupfen treten in eher geringer Anzahl a u f .'88 U nter den Henkeln und Grifflappen finden sich sowohl wand- als auch randständige E xem plare.189
A bb. 107: K reuzlingen : R ib i-B ru n eg g . D o lch k lin g e aus B ronze. M itte lbronzeze it.
Abb. 108: K reuzlingen: R ibi-B runegg. K o p f e iner R ollennadel aus B ronze. M ittelbronzezeit.
U nter den Rändern erkennen wir verdickte Formen, die z.T. zusätzlich horizontal abgestrichen sind, sowie Trichterränder.'90 M it Vorbehalt können vereinzelte Randscherben zur G ruppe m it innen verdickten Rändern gestellt werden, die in der späten M ittelbronzezeit und besonders in der frühen Spätbronzezeit häufig vorkom m t.'9' Zur Entwicklung der Randform en und Verzierungselem ente im Raum Kreuz- lingen/Tägerw ilen siehe Abb. 94 und 95 im Kapitel Hochstross.
In die frühe Spätbronzezeit dürfte das Fragment des Zylinderhaisgefasses 723 m it schräger Randfacette gehören, sowie die Ränder 724-727.
U nter der Feinkeramik fällt das Fragment der Schale 636 mit X -förm igem Henkel und verschachtelten Dreiecken auf. Ob X-förm ige Henkel, z.B . 637 und 638, bereits in späten Fundkomplexen der M ittelbronzezeit oder erst ab der frühen Spätbronzezeit Bz D nachzuweisen sind, wird noch disku tie rt.192 G elasse m it um rieften Buckeln, die als Elem ente der frühen Spätbronzezeit angesehen werden, sind im Fundm aterial nicht en thalten .193
D atierung der FundeIn Ribi-Brunegg fanden sich für Landsiedlungen ver
hältnism ässig viele Bronzeobjekte. Der fast vollständig erhaltene, ungegliederte, zweinietige Bronzedolch 608 mit N ackenfortsatz und zwei seitlichen Rillen stam m t wie die Hauptm asse der Keram ik aus der jüngeren M ittelbronzezeit (Abb. 107). Er steht den Dolchen der Variante Aschenhausen- W erder n ah e .'94 Zweinietige Dolche m it betonter M ittelrippe werden in die Stufe Bz C2, also in die Spätphase der M ittelbronzezeit, datiert.195
6 3 6 ,6 3 8 ,6 4 0 . H ochuli 1990, 79.185 P irling et al. 1980, 26, Taf. 22 .G 16, Fundort H arthausen bei Feldhausen,
H ügel 1 und 2. D ie G rabfunde stam m en aus A ltg rabungen . D ie D atierung der G efässfo rm en und V erzierungsm otive ist nur m it Vorsicht m öglich (ders. 1980, 27).
186 F ischer 1997, z .B . Taf. 49 .196, N eftenbach G rab 26.187 H ochuli 1994, 134, Abb. 91.188 B eispiele fü r F ingertupfen unterhalb des R andes: 752; F ingertupfen a u f
R andlippe: 7 2 8 -7 5 1 ; F ingertupfenleisten : 7 5 2 -7 6 6 ; g la tte Leisten: 769; verzw eigte: 768; Leisten m it K erben: 771; flächendeckende F ingertupfen: 772, 7 7 4 -7 7 6 .6 3 6 ,7 7 9 , 7 8 0 ,7 8 2 ,7 8 5 .
190 Verdickt: 660, 685, 690, 7 0 4 -7 1 6 ; horizontal abgestrichen: 704, 705, 7 0 8 -7 1 2 , 714, 715, 748, 749; T richterränder: 7 1 8 -7 2 2 ; innen verdickte R änder: 6 8 0 ,6 8 4 ,6 9 0 ,7 0 2 .
191 H ochuli 1990 ,79 .192 O sterw alder 1971, 45; H ochuli 1990, 79; F ischer 1997, 18.
F ischer 1997, 52.194 W üstem ann 1995, 119, ähn liches Exem plar z .B . Taf. 47.399.
F ischer 1997, 30.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 93
Die ausgezeichnet erhaltene Rollennadel 609 (Abb. 108), eine während der ganzen Bronzezeit vorkom m ende Form, eignet sich zur zeitlichen Eingrenzung des Fundkomplexes ebenso wenig wie die stark fragm entierten Nadeln und Sichel 610-612 . Zum kleinen, vierkantigen Nagel 613 hingegen finden sich Vergleichsstücke unter den Beigaben einer Bz D- zeitlichen Bestattung in Bern-Kirchenfeld (B E ).196
Die Hauptm asse des Fundm aterials gehört in die jüngere M ittelbronzezeit, wobei vereinzelt auch Elemente der frühen Spätbronzezeit auftreten, w ie z. B. X-Henkel, Zylinderhals- gefäss und Schrägränder. Die M ittelbronzezeit wird in die Jahre zwischen 1550-1350 v.C hr.197 gesetzt, die späte Bronzezeit beginnt dem nach noch im 14. Jh. v.Chr. Unser Versuch, die Laufzeit von Ribi-Brunegg mit der Datierung einiger Holzkohleproben genauer einzugrenzen, scheiterte am grossen Streubereich der !4C-Daten. Immerhin liegen die Werte im Zeitraum zwischen der jüngeren M ittelbronzezeit und der frühen Spätbronzezeit Bz D/Ha A, am deutlichsten jene der Probe 21. Die Proben 22 und 23 weisen eher in den Bereich der frühen Spätbronzezeit. Die Daten der drei Proben entsprechen jenen, die für die Bz D-zeitlichen G räber von Neftenbach und für die Bz D-zeitliche Siedlung von Rekingen-Bierkeller gem essen worden s ind .198 Es ist denkbar, dass in einer Kulturschicht m it mehreren stratigraphisch nicht trennbaren Siedlungsphasen organisches M aterial der jüngsten Phase besser vertreten ist.
Von Interesse ist in diesem Zusam m enhang die rund 200 M eter westlich liegende Fundstelle Ribi-Girsbergtunnel. Im Fundm aterial letzterer sind spät datierende Elemente wie lang gezogene Dreiecke vorhanden, für die eine Datierung in Bz D ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann.
Tägerwilen: Ribi-Girsbergtunnel
Entdeckung und Lage
Im A utobahnabschnitt Ribi-Girsbergtunnel waren aus Rücksicht au f landwirtschaftliche Kulturen 1997 keine system atischen Sondierungen möglich; erst im Septem ber 1998 war das Terrain frei für baubegleitende Abklärungen. An zwei Stellen wurden prähistorische Fundschichten festgestellt (Abb. 109, 111), deren Freilegung im M ärz 1999 begann. Mittels Sondierschnitten, die bereits au f ein grossflächiges G rabungsnetz abgestim m t waren, versuchten wir, die Ausdehnung der beiden Fundzonen abzuklären.
Die Befunde
Die Fundschichten waren eher schlecht erhalten. Die meisten Funde stammen aus den Kolluvien und sind als umgelagert zu betrachten. Lediglich in den Feldern 193 und 223 im Bereich Süd wurden Reste einer in situ liegenden Kulturschicht angetroffen, die von einem bis zu 1,2 m mächtigen Hanglehm (Kolluvium) geschützt war (Abb. 110). Da keine baulichen Strukturen festgestellt werden konnten, verzich
teten wir au f eine grössere Flächengrabung und legten das Schwergewicht au f die Untersuchung der fundführenden Horizonte in den Kolluvien.
Die Funde(KNr. 802 - 835; Abb. 202, S. 204-205)
D ie Funde aus der mittleren und späten Bronzezeit im südlichen Bereich
Die Funde w urden stichprobenweise ausgewertet, wobei das Material aus dem südlichen Areal sich gut mit jenem der benachbarten Fundstelle Ribi-Brunegg vergleichen lässt.
Es finden sich Trichterrandgefässe, feinkeram ische Gefässe mit Resten von Ritz- und Einstichverzierung, darunter lang gezogene Dreiecke und flächendeckende Strich- Motive sowie auffallend viele glatte Leisten, sowohl bei der Grob- als auch bei der Feinkeramik. Fingertupfenleisten sind nur wenige vorhanden. Auffallend ist die Scherbe 809 mit kerbschnittähnlich eingepressten Dreiecken. U nter den Rändern gibt es einfach gerundete Exemplare sowie deutlich verdickte Formen, die z.T. horizontal abgestrichen sind und hier häufiger auftreten als im R ibi-B runegg.199 Einige Ränder sind au f der Innenseite verdickt. Die beschriebenen Elem ente sprechen für eine späte Datierung innerhalb der m ittleren Bronzezeit. Insbesondere die innen verdickten Randform en und die lang gezogenen Dreiecke deuten die Nähe zur frühen Spätbronzezeit an, wenn nicht sogar zur Stufe Bz D.200
Die Fragmente der Kalottenschalen 825 und 826 sowie die flächendeckend mit Fingertupfen verzierte W andscherbe 827 lassen sich nicht näher als mittel- oder spätbronzezeitlich einordnen. Wenige Funde aus dem oberen Bereich der Kolluvien kann man hingegen der Spätbronzezeit zuweisen, z. B. 828-830.
Es scheint, dass im Übergang von der jüngeren M ittelbronzezeit zur frühen Spätbronzezeit ein Areal von m indestens 500 mal 200 M eter A usdehnung zwischen dem N eubauquartier R ibi-Brunegg und dem A utobahntrassee für den Bau verstreuter Gehöfte genutzt wurde, die sich in rascher Folge ablösten. Ein geschlossenes D orf ist eher unwahrscheinlich.
Die Funde im nördlichen BereichAus dem nördlichen Areal liegen, abgesehen von
vereinzelten m ittelbronzezeitlichen Scherben, vorwiegend spätbronzezeitliche vor: Fragmente von reich verzierten konischen Schalen, z. B. 832, die Schulterbecher 833 und 834 mit Kamm strich respektive Riefenverzierung und Schräg- randgefasse wie z. B. 835.
Die Funde lassen sich gut an das Material des benachbarten Ribi anschliessen; sie datieren grob in die spätbronzezeitliche Stufe Ha B l respektive Ha B2 früh nach SPM III.
196 F ischer 1997, Taf. 3 4 .1 2 -1 5 , Taf. 35.27a.197 H ochuli 1998 ,56 .198 N eftenbach: F ischer 1997, 36, Abb. 8 -1 1 , Rekingen: SPM III, 1998,386.199 G erundete: 8 0 3 ,8 1 2 , 813, 815; verdickte: 814, 8 1 6 -8 2 4 ; innen verdickt:
8 2 1 -8 2 4 .200 Fiocinili 1990. 7 9 -8 2 ; zu den lang gezogenen D reiecken 804 und 805
vgl. N eftenbach, G rab 19, F ischer 1997, Taf. 44 .146, 147.
94 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
■s 31.2 G egrabene Qrabungsfelder I— J und Sondlerschlltze
Ausdehnung der erhaltenen Fundschichten (geschätzt)
^ 3 Ausdehnung der Erdarbeiten ■y (Bauprojekt)
/ c i b i
100m 150m
Abb. 109: K reuzlingen/T ägerw ilen-R ibi-G irsbergtunnel. S ituation 1:1000.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 95
728 798.60 278 830.00
728 798.60 278 838.00
Schichten
Humus
427.50
m U . M .
Abb. 110: K reuzlingen /T ägerw ilen-R ib i-G irsberg tunnel. P rofil O st, Feld 193 /223 .
Abb. 111: K reuzlingen /T ägerw ilen-R ib i-G irsberg tunnel. D as G rabungsgelände vor dem T unnelportal, B lick R ichtung N ord. D ie Fundste lle liegt a u f e iner M oränen terrasse in N achbarschaft zu w eiteren bronzezeitlichen Fundstellen.
Tägerwilen: Ribi
Letzte Reste von Dörfern der mittleren und späten Bronzezeit
Entdeckung und Lage
Die Fundstelle liegt in 423 m Höhe au f der für prähistorische Siedlungen günstigen flachen M oränenterrasse, die sich zwischen Kreuzlingen und Tägerwilen erstreckt (Abb. 98,1 ). Trotz O berflächenprospektion waren keinerlei archäologische Funde bekannt, bis w ir im Septem ber 1997 au f dem Trassee im Abstand von 20 bis 25 M etern Sondierschnitte anlegten. Bereits zu Beginn der Arbeiten zeigten vereinzelte Scherben, dass mit prähistorischen Fundstellen zu rechnen war. Allerdings fanden sich auch Hinweise, dass Erosion und jahrhundertelange Landwirtschaft alte Bodenbildungen und
archäologische Strukturen in M itleidenschaft gezogen hatten und sich Reste von Fundschichten nur in natürlichen Senken und Gruben hatten erhalten können.
Unsere G rabungen im Som m er 1998 konzentrierten sich au f zwei Fundbereiche, parallel dazu wurden bis im Sommer 1999 säm tliche Erdarbeiten im Areal überwacht.
Über das gesam te Areal legten w ir ein nach dem Landesnetz ausgerichtetes G rabungsnetz m it definierten Feldern (Abb. 112, 114).
Im südlichen A bschnitt w urden die Felder 93-96 und 113-116 geöffnet; zudem wurden eine Grube und Kulturschichtreste, die bereits bei den Sondierungen angeschnitten worden waren, sowie zwei weitere G ruben untersucht.
Im Norden der Fundstelle, d.h. in den Sondierschnitten 32 und 33, stellten wir eine erhöhte Scherbendichte fest, nicht aber eigentliche Fundkonzentrationen oder Strukturen. Wir beschränkten uns deshalb in diesem A bschnitt au f eine baubegleitende Überwachung. Nach der Entdeckung einer w eiteren Scherbenkonzentration legten wir die Grabungsfelder 3 1 2 ,3 1 3 ,3 3 2 und 333 an.
Die Befunde
Befunde im südlichen Abschnitt
Die flache M oränenterrasse ist von der modernen Landwirtschaft geprägt (Abb. 113). Der Pflug erreicht in diesem Terrain meist die Moräne. Ihre im Laufe der Zeit eingeebnete Oberfläche war ursprünglich durchzogen von Furchen, Erosionsrinnen und natürlichen Senkungen. Lediglich in solchen Sedim entfallen sind alte Bodenbildungen und Kulturschichtreste erhalten geblieben. Es konnten drei Gruben dokum entiert werden (Abb. 115).
Die G ruben Pos. 2 und Pos. 3 sind au f natürliche Weise entstanden. Es könnte sich um grosse W urzelgruben oder die Reste von Erosionsrinnen handeln, in denen sich zuunterst ein dunkelgrau-brauner, mit Holzkohlepartikeln durchsetzter, aber fundleerer Lehm fand (Abb. 116, Schicht 220). Er
96 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
S 31.2 Gegrabene Grabungsfelder und Sondierschlitze
Ausdehnung der erhaltenen Fundschichten (geschätzt)
CfkAusdehnung der Erdarbeiten
N (Bauprojekt)
%272 i
2/9100%
%
279050
I m Rxbx
150m
Abb. 112: Tägerw ilen: R ibi. S ituation 1:1000.
war überlagert von einer gut erhaltenen spätbronzezeitlichen Die G rube Pos. 4, in deren Füllung sich bronzezeitliche Kulturschicht 210. Diese enthielt bis zu drei kg Keramik pro und m ittelalterliche Scherben fanden, könnte vom Menschenm 2 sowie vereinzelte Hitzesteine (Abb. 117). A usserhalb der geschaffen worden sein.Gruben fanden sich nur partiell kleine Kulturschichtreste.Strukturen von Gebäuden aus der Bronzezeit fehlten.
Abb. 113: T ägerw ilen: R ibi. B lick R ichtung O sten. D ie b ronzeze itliche Abb. 114: T ägerw ilen: R ibi. D ie le tz ten R este eines D orfes aus der B ronze-S iedlungsstelle liegt a u f e iner flachen M oränenterrasse. zeit w erden dokum entiert.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 97
N
80 -------
ÖG>
O 9 .— _
oCD
728 832.00 279 070.00
0_ __ Im
Abb. 115: Tägerw ilen: Ribi. S üdlicher B ereich, Felder 114 und 194. S trukturen der bronzezeitlichen K ulturschichtreste nach 1. A bstich. M 1:100.
Befunde im nördlichen Abschnitt Ganze G efässpartien lagen hier noch in situ. Im westlichenFelder 312, 313, 332, 333 A bschnitt fand sich vorwiegend mittel-, im östlichen Teil -
In einer ausgedehnten, flachen M ulde waren 10 bis 15 cm wo auch ein verziegelter Lehm fleck (m öglicherweise dermächtige Kulturschichtreste der m ittleren und der späten untere Teil einer Feuerstelle FS 1) freigelegt werden k o n n te -Bronzezeit unterhalb der m odernen Pflugsohle erhalten. hauptsächlich spätbronzezeitliche Keramik.
839
98 Nationalstrasse AT - Katalog ausgewählter Fundstellen
Abb. 116: T ägerw ilen: Ribi. Süd licher B ereich. Foto: G rube 3. N atürliche Senke m it K ulturschichtresten . Profil: G rube 2 in Feld 114 /94 , unten Schicht 220 m it R odungszeigern , oben d ie spätb ronzezeitliche K ulturschicht 210.
o o
0 Im
Zur Ausdehnung der mittelbronzezeitlichen und spätbronzezeitlichen Siedlungsareale
Aussagen zur Grösse des prähistorischen Siedlungsareals sind wegen der fleckenartigen Erhaltung der Kulturschichtreste schwierig.
Die Fundbereiche Süd und Nord liegen ca. 50 M eter auseinander. Das spätbronzezeitliche Siedlungsareal mag m indestens 2000-3000 m- mit über einem Dutzend G ebäuden um fasst haben.201 Siedlungen in der Spätbronzezeit waren nicht selten bis zu 20000 m 2 gross.
Ü ber die Konstruktionsweise der Häuser lassen sich keine Aussagen machen. Das Fehlen von Pfostengruben könnte au f Block- und Schwellenbau hinweisen, die kaum Spuren im Boden hinterlassen.202
Die H orizontalverteilung der Keramik zeigt folgendes Bild: Im Süden liegen vorwiegend charakteristische spätbronzezeitliche Objekte wie Schrägrandtöpfe, Schulterbecher und konische Schalen (Abb. 117) und nur wenige Funde der m ittleren Bronzezeit. Im Westen des nördlichen Abschnitts fand sich fast ausschliesslich m ittelbronzezeitliches, im Osten dagegen spätbronzezeitliches M aterial.
Eine gut erhaltene Kulturschicht der m ittleren Bronzezeit war lediglich im nördlichen A bschnitt vorhanden. Ob die wenigen m ittelbronzezeitlichen Funde im Süden spärliche Reste einer Kulturschicht sind oder in der Spätbronzezeit um gelagert wurden, war nicht zu entscheiden. Eine Ü berlappung des mittel- und spätbronzezeitlichen Siedlungsareals ist nicht belegt. Es bleibt offen, ob es sich um eine grössere, geschlossene Siedlung handelt oder um kleine, gehöftähnliche Einheiten.203
Die Funde(KNr. 836-1096; Abb. 203-212 , S. 206-225)
Keramik der M ittelbronzezeitIm m ittelbronzezeitlichen Fundmaterial finden sich
feinkeramische Gelasse mit steilen Trichterrändern sowie Gelasse mit Ritz- und Einstichverzierungen.204 Auffällig ist die sehr grobe M achart der oftmals geschlickten G robkeramik. Die R andprofile waren äusserst unregelm ässig gearbeitet und es wurde sehr grobes M agerungsm ittel, Körner bis zu 10 mm, verwendet. Es fallen charakteristisch verdickte Ränder auf, die zum Teil horizontal abgestrichen sind .205 Diese M erkmale, die sich auch im kaum 400 m entfernten Ribi-Brunegg finden, zeigen, dass in beiden A realen in der jüngeren M ittelbronzezeit gesiedelt w urde.206
Das Gebiet wurde offenbar bereits vor der bronzezeitlichen Besiedlung gerodet und genutzt. Unterhalb der Kulturschicht folgte näm lich ein dunkler Horizont mit H olzkohlen, also eine alte Bodenbildung mit Rodungszeigern. Zuunterst in der Kulturschicht lag die Pfeilspitze 1057 aus Silex, die gut mit einer früheren Nutzung des Geländes in Verbindung gebracht werden könnte. Ansonsten sind die Silexfunde sehr spärlich: aus der spätbronzezeitlichen
201 Prim as 1990, 76; Seifert 1996, 164.202 Z ur V erbreitung von B autechniken in T rockenboden-S iedlungen: A rno ld
1990, 155; D ieckm ann 1998, 387; in Ufer- und M oorsiedlungen: Seifert 1996, 168.
203 D ie G rabungen im Traisental (A ) erbrachten den N achw eis von locker gereih ten E inzelgehöften , N eugebauer u. B les 1998, 396. Ä hnliche S iedlungsm odelle sind auch für den süddeutschen und schw eizerischen R aum denkbar.
204 Trichterrand: 1033, 1081; R itz-ZEinstichverzierung: 1037, 1038.205 Verdickt: 1029. 1030, 1044, 1046; horizontal abgestrichen: 1049, 1053.206 H ochuli 1990 ,79 .
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 99
j natürliche Senkung]
Feuerstelle
•12
G ew ich t d e r K eram ik (gr./m 2)
<50
100-500
500-1000
1000-2000
2000-3000 IB ereich mit H andabtrag
Grube 2
I Grube 3
Grube 4
A btrag m it B agger
J natürliche Senkung"
| Feuerstelle
125
Grube 2
Grube 3
Grube 4
M erkm ale M itte lbronzezeit
T öpfe m it F ingertupfen le iste un te rha lb d e s R a n d es
T öpfe m it F ingertupfen au f d e r Randlippe
T öpfe m it horizontal a b g estric h en e m R and
M erkm ale S p ä tb ro n ze ze it
Sch räg rand töp fe
konische S c h a len mit faze ttie rtem Rand
S c h u lte rbecher
□A
O
□A
O
Abb. 117: Tägerw ilen: R ibi. N örd licher und süd licher B ereich. K eram ik, V erteilung nach G ew icht und M erkm alen.
Kulturschicht stammt ein Abschlag, von der Ackeroberfläche der Silexkern 1079.
D ie spätbronzezeitlichen FundeDie Hauptm asse des spätbronzezeitlichen Fundm aterials
besteht aus Keramik, unter welcher die Fragmente des M ondhorns 1078 (Abb. 118) sowie des Spinnwirtels 863 auffallen.
Im spätbronzezeitlichen Keram ikbestand sind mit 43% von 231 identifizierbaren G elassen die konischen Schalen die häufigste Form. In der Spätbronzezeit wurden konische Schalen, die etwa unseren Tellern entsprechen, in sehr grosser Zahl hergestellt. N eben unverzierten, einfacheren Stücken liegen auch verzierte Exem plare vor, die einen gewissen repräsentativen Charakter hatten (Abb. 119). Mit 40% sind so genannte Schrägrandtöpfe (Abb. 121 ) und mit 7% Schulterbecher207 vertreten. Die restlichen typisch spätbronzezeitlichen Formen wie Kalottenschalen, Schüsseln,
Trichterrand- und Zylinderhalsgefasse um fassen zusamm en 10% .**
Im südlichen Bereich stellten wir eine Entwicklung im Fundm aterial fest. In den unteren Abstichen der Grube 2 finden sich Verzierungselemente und G efassform en, die ihre Parallelen in Ha A 2/B1, z.B . in der Seeufersiedlung G reifensee-Böschen, haben.209 Gut vertreten sind Schulterbecher, z.T. mit schrägen Riefen au f der Schulter210, von denen in den oberen Abstichen nur ein Einzelstück 897 vorkom m t211. Aus nicht näher stratifizierbaren Kulturschichtresten stammt das Fragment 1026 eines Schulterbechers m it Kammstrich. Auch Schalen m it einer kleinen Stufe unterhalb der Randfacette an der Innenwand, z. B. 944,
™ Z .B . 8 5 0 -8 5 2 .™ G ross 1 9 8 7 ,151 , A bb. 157.209 Bzw. Ha B 1/B 2 früh nach SPM III2,0 9 3 2 -9 3 5 ,9 3 7 ,9 3 8 .211 E berschw eiler e t al. 1987, 87.
100 Nationalstras.se A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Abb. 119: T ägerw ilen: Ribi. S üdlicher B ereich. Fragm ent e iner verzierten Schale aus der späten Bronzezeit.
Abb. 118: T ägerw ilen: R ibi. Spätb ronzezeitliches M ondhorn . R ekonstruktionszeichnung zum Fragm ent 1077, Foto e iner R eplik von der Insel W erd angefertig t von E. B erdelis, im B esitz von C. B artlett.
treten nur in den unteren Abstichen au f212, sind aber in der Grube 3 ebenfalls vorhanden, z.B . 838, 840. Die Verzierungen der Schalen aus den unteren Abstichen sind mit Zickzack-M otiven bzw. Schrägstrichdreiecken au f dem Rand eher einfach gehalten, 941-944. Dem gegenüber finden sich in den oberen Abstichen Schalen mit dem bekannten, reichen, für Ha B l bzw. Ha B2 früh nach SPM III charakteristischen Zierstil: m ehrfache Verzierungsbänder, Riefen kom biniert mit Einstichreihen, Zickzack-M otiv und Schräg
strichdreiecke au f der Innenseite der W andung.213 Gleiches gilt für die Fragmente der Schüsseln 893-895 und 897. In den unteren Abstichen fand sich nur das Fragment 936 als einziger Vertreter dieses Typs.214 Dieses sowie die Kalottenschalen 982-987 zeigen, dass die Trennung des Fundm aterials nach Abstichen lediglich Entwicklungstendenzen aufzeigt.215
In den oberen Abstichen tauchte ausser einem Fragment eines Trichterrandgeiasses auch die Vasenkopfnadel 926 au f (Abb. 120). Beide Fundstücke weisen au f den späten Abschnitt Ha B3 der Spätbronzezeit hin.
Das Fragment 928 eines Trichterrandes aus dem unteren Bereich der Grube 2 hingegen dürfte aufgrund seiner M achart von einem m ittelbronzezeitlichen G elass stammen.
Bei der Grobkeram ik lassen sich die chronologischen M erkmale nur schwer fassen. Die Schrägrandtöpfe sind in den unteren Abstichen der Grube 2 überwiegend markant profiliert und die Randlippen mit Fingertupfen und Kerben verziert.216 In den oberen A bstichen sind Kerben au f den
212 K am m strichverzierung ist in der frühen Seeufersied lung G reifensee- Böschen häufig , verliert aber bereits in Z ug-Sum pf, ältere Schicht, an B edeutung. E benso verhält es sich bei den Schalen m it k le iner Stufe an der Innenw and unterhalb der R andfassette. E berschw eiler et al. 1987, 8 7 -8 8 ; S e ife rt u. W underli 1997, 3 5 ,4 3 .
2" 8 6 8 ,8 8 7 -8 9 0 .214 D er reich verzierte Stil ist im Fundm ateria l in G reifensee-B öschen noch
n icht en thalten , E berschw eiler et al. 1987, 88.215 K alottenschalen sind im Inventar der frühen S eeufersiedlung G reifensee-
B öschen noch n icht en thalten , sind aber in Z u g -S u m p f gut vertreten. E berschw eiler 1987, 88; S e ife rt u. W underli 1997, 22.
2,6 F ingertupfen: 9 8 9 -9 9 8 , 1020; K erben: 9 9 9 -1 0 0 5 .
Abb. 120: T ägerw ilen: Ribi. Süd licher B ereich. B ronzenadel m it V asenkopf und to rd iertem Schaft (M 1:1). Späte Spätbronzezeit um 900 v. Chr.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 101
Abb. 121: T ägerw ilen: R ibi. S üd licher B ereich. Scherben eines m it K erben verzierten S chrägrandtopfes. Koch- oder V orratsgefäss. Späte B ronzezeit.
Randlippen etwas häufiger.217 Im M ittelland und in der Westschweiz verflauen grobkeram ische G efassränder in der Spätbronzezeit; das kärgliche M aterial von Ribi erlaubte nicht, diese Tendenz auch hier zu belegen.218 Das Fragm ent 923 mit verflautem Rand, schrägen Dellen au f der Randlippe und einer Fingertupfenleiste im Randum bruch ist ein Unikat und dürfte dem spätesten Abschnitt der Spätbronzezeit oder sogar schon der E isenzeit angehören.219
Zusam m enfassend zum spätbronzezeitlichen Inventar aus Ribi sei festgehalten: Die unteren Abstiche der G rube 2 enthalten vorwiegend frühe Elemente, die jenen aus der frühen Seeufersiedlung G reifensee-Böschen (ZH) entsprechen, die in die Zeit zwischen 1048-1042 v.Chr. datiert sind .220 In den oberen Abstichen ist der reiche Zierstil gut vertreten, vergleichbar m it der älteren Schicht in Z ug-Sum pf (ZG) aus der Zeit zw ischen 1056-944 v.Chr.221 Spärlicher oder schwieriger zu erkennen sind in den oberen Abstichen Funde aus der späten Spätbronzezeit, w orauf aber die Vasenkopfnadel 926 weist. Dam it ist nahe liegend, in Ribi eine Besiedlung oder zum indest eine Nutzung des Areals noch im 9. Jh. v. Chr. anzunehm en, was ungefähr der zeitlichen Stellung der Siedlung au f dem Uerschhauser H orn222 oder der späten Besiedlungsphase im benachbarten Hochstross entspricht.
Aus der Bronzezeit dürfte das Bronzeringlein 1094 stam men. Der Typ der römischen, kräftig profilierten Fibel 1095 aus dem Pflughorizont war vom späten 1. Jh. bis ins frühe 3. Jh. n.Chr. gebräuchlich223. Die Fibel und die röm ischen und mittelalterlichen Scherben224 aus den verpflügten und durch Gruben gestörten bronzezeitlichen Kulturschichtresten zeigen, dass im Ribi schon seit Jahrhunderten Landwirtschaft betrieben wurde.
Tägerwilen: Spuelacker
Lage und Befunde
In unm ittelbarer Nachbarschaft zur bereits seit 1997 bekannten bronze- und eisenzeitlichen Fundstelle an der M üller-Thurgau-Strasse begannen im Februar 1999 die
Abb. 122: T ägerw ilen: Spuelacker. S ituation 1 :10000 . 1 Spuelacker; 2T rafostation; 3 M üller-T hurgau-Strasse.
Erdarbeiten zur Überbauung Spuelacker (Abb. 122, 1). Die Dokumentation der prähistorischen Befunde erfolgte baubegleitend. Schneefall, Regen und die rasch fortschreitenden Bauarbeiten erlaubten lediglich einen stichprobeweisen Einblick. Funde kam en nahezu im ganzen Areal der Baustelle zutage.
Die Fundstelle liegt au f einer flach von Nord nach Süd abfallenden M oränenterrasse in ca. 414 m Höhe. Das G elände weist ein Gefalle von ca. 1% auf. Die heutige, durch Erosion und Sedim entation verflachte G estalt des Terrains lässt die ursprünglich unebene M oränenoberfläche nur
217 9 1 0 - 9 1 2 ,9 1 7 ,9 1 8 ,9 1 9 , 920.218 G ross 1986, 48; Seifert u. W underli 1997, 35.219 Ein verg le ichbares G efäss finde t sich als E inzelstück in der jüngeren ,
spätbronzezeitlichen Schicht in Z ug-Sum pf. Seifert u. W underli 1997, Taf. 151.2469. C harak teristisch sind d iese G elasse in hallstattzeitlichen Fundkom plexen, B auer 1993, Taf. 2 .3 0 -3 2 .
220 R uoff 1998 ,6 .221 Seifert u. W underli 1997 .9 .222 G olln isch-M oos 1999, 129.223 R iha 1979, Typ 3.1, Taf. 1 1 .271 -277 . Z u r D atierung siehe Taf. 78.224 Röm isch: 1092, m itte la lterlich 866, 867, 1093.
m r - ■
A bb. 123: T ägerw ilen: Spuelacker. D okum entation der le tz ten R este eines frühbronzezeitlichen D orfes. Freilegen der K ulturschicht m it H itzesteinen und Keramik.
102 Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
SchichtenSchichten
HumusAushub
0 Im
Abb. 124: T ägerw ilen: Spuelacker. N örd licher B ereich . S üdprofil M 1:50.
0 Im
Abb. 125: T ägerw ilen: Spuelacker. S üdlicher B ereich. N ordprofil M 1:50.
erahnen. Über der M oräne (Abb. 125, Schicht 9) folgt eine alte Bodenbildung, Schicht 8, ein dunkelgrauer Lehm mit sehr viel Holzkohle im oberen Bereich, was au f frühere Rodungen in der späten Jungsteinzeit hin weist, vgl. 14C- Datierung 24. Darüber liegende Sande (Abb. 125, Schichten 5 -8 ) stam m en von einer Bachschüttung. Sie sind überlagert von einem ockerfarbenen, sandigen Lehm, Schicht 4, Abb. 125, einer partiell gut erhaltenen und dicht mit hitzever- sehrten Steinen und Keramik durchsetzten Kulturschicht der frühen M ittelbronzezeit. Über der Kulturschicht folgt ein graubrauner, sandiger Hanglehm, Schicht 2. Im oberen Bereich enthält dieser römische Scherben. Hangaufwärts ist die Kulturschicht weitgehend erodiert und lediglich als spärlicher Fundhorizont m it früh- und spätbronzezeitlichem Material erhalten, Schicht 3, Abb. 126.
Die Funde(KNr. 1097-1121; Abb. 213, S. 226-227)
Das Fundmaterial setzt sich aus Hitzesteinen, Keramik und wenigen Silices zusamm en. Von den vielen stark verwitterten und aufgeweichten Scherben konnten nur wenige geborgen werden. Gefässform en lassen sich schwer erkennen. Aus der Kulturschicht und den hangaufwärts liegenden Kulturschichtresten stammen die Fragmente 1100 und 1114 von Knickwandschalen, die mit Halteknubbe bzw. mit Henkel versehen sind. Wenige grobkeram ische Randscherben mit gerundeten Rändern dürften zu Töpfen oder zu Schüsseln gehören. D ie feinkeram ische Randscherbe 1097 stammt von einem engm ündigen Gefäss. H äufig anzutreffen sind Fingernagelkerben225, die flächig oder als Kerbreihe au f die Wandungen von grobkeram ischen G elassen eingepresst wurden, unter anderem au f der Knickwandschale 1114. Aus der Kulturschicht kommen auch die W andscherbe 1103 mit Fingertupfenleiste, die Fragmente 1101, 1102 und 1115 mit flächig und grob aufgebrachten Ritzlinien und die kleine Silexklinge 1112.
Das eben skizzierte Material lässt sich grob der jüngeren Frühbronzezeit/älteren M ittelbronzezeit zuordnen. Einzig hangaufwärts fanden sich neben älteren einige charakteristische spätbronzezeitliche Scherben, darunter die Rand
stücke 1118 einer Schüssel m it Schrägrand und der konischen Schalen 1116 und 1117. In den oberen Horizonten, Schicht 2, traten wenige röm ische Funde zutage, darunter das Fragment 1119 einer Reibschale.
Interessant sind die hochm ittelalterlichen Scherben 1120 und 1121 aus dem nördlichen Bereich der Spuelacker- Baustelle. Sie stam m en von handgewulsteten und überdrehten Töpfen aus dem ÎÎ ./Î2 . Jh. n.Chr., einer Zeit, aus der wir kaum Funde und Befunde besitzen.
Tägerwilen: Trafostation
Lage und Befunde
Bei der Begehung der Baugrube für die neue Trafostation an der Spuelackerstrasse in Tägerwilen (Abb. 122, 2) stellten wir in einer Tiefe von 50 cm eine Kulturschicht fest (Abb. 127).226 Die Fundstelle au f der flachen G eländeterrasse zwischen Tägerwilen und Kreuzlingen liegt au f einer Höhe von 418 m ü.M ., unm ittelbar an einen heute unterirdisch geführten Bach grenzend.
Die bis zu 20 cm m ächtige Kulturschicht enthielt Konzentrationen von hitzeversehrten Steinen und viel Keramik aus der Spätbronzezeit. Sie w ar deutlich ausgeprägt und dürfte sich über die Baugrube hinaus noch nach Norden fortsetzen; im Bereich des benachbarten neuen M ThB-Trassees haben wir sie jedoch nicht m ehr angetroffen.
Die Dokumentation beschränkte sich au f die Aufnahm e der Profile. Deutlich zeigte sich, dass das Gelände bereits vor der Besiedlung in der späten Bronzezeit durch den M enschen genutzt wurde. Unter der Kulturschicht (Abb. 128, Schicht 3) fand sich näm lich ein angeschwem m ter Hanglehm, der au f offene, der Erosion ausgesetzte Flächen, z.B. Äcker, hin-
225 1 104-1 109.™ J b S G U F S l, 1998 ,276 .
Abb. 126: T ägerw ilen: Spuelacker. S üd licher B ereich. D unkle Schicht m it ► zah lre ichen H olzkohlen: R odungszeiger der späten Jungsteinzeit.
104 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Abb. 127: Tägerw ilen: T rafostation. D okum entationsarbeiten in der B augrube der neuen Trafostation.
deutet. So zeigten sich in 1 m Tiefe zwei Phasen von Rodungsaktivität in Form von dunkelgrauen Bändern mit viel Holzkohle (Schichten 5 und 7). Die Rodungen setzten bereits im frühen Jungneolithikum ein, vgl. 140-D atum 25.
Die Funde( KNr. 1122-1139; Abb. 214, S. 228-229)
Aus der Kulturschicht konnte nur ein kleines, dafür aber interessantes Fundinventar geborgen werden. H äufig sind grobkeram ische Schrägrandgefässe, die oftm als mit Fingernagelkerben und Fingertupfen au f der Randlippe und dem Randum bruch verziert sind, z.B. 1129-1139. Das Gefassfragm ent 1138 weist zudem m ehrreihige Nadelkopfeindrücke auf. U nter den feinkeram ischen Schalen befinden sich m ehrere zusam m engehörende Fragmente der m it Z ickzack- und Kam m strich-G irlanden verzierten Schale 1123 sow ie des Schulterbechers 1127. Das Fundensemble, zu dem auch die kleine Silexklinge 1122 gehört, lässt sich gut mit je nem aus G reifensee-Böschen im Kanton Zürich vergleichen, das in die Mitte des 11. Jhs. v.Chr. datiert w ird.227
Tägerwilen: M üller-Thurgau-Strasse
Eisenzeitliche Siedlungsfunde
Lage und Befunde
Im O ktober 1997 wurden an der M üller-Thurgau-Strasse (Abb. 122, 3) in ca. 30 cm Tiefe Reste einer prähistorischen Kulturschicht angeschnitten.228 Diese zeigte sich als ein ca. 15 cm m ächtiger H orizont von grauem, leicht lehm igem Sand, locker durchsetzt mit hitzeversehrten Steinen und Keram ikfragm enten. Eine Datierung der schlecht erhaltenen Keramik, darunter ein Henkelfragm ent, ist schwierig, doch dürfte sie als bronzezeitlich anzusprechen sein.
Die Fundstelle liegt au f einer flachen G eländeterrasse au f einer Höhe von 413 m ü.M ., angrenzend an einen heute unterirdisch geführten Bach. W estlich, recht nahe davon, liegt das Areal Spuelacker, dessen früh- und spätbronzezeitlichen Befunde w ir 1999 aufnahmen.
Im Mai 1998 legten w ir östlich der M üller-Thurgau- Strasse au f einer Fläche von ca. 20 m 2 Reste einer prähistorischen Kulturschicht frei (Abb. 129) 229, die neben wenigen Hitzesteinen auch prähistorische und m ittelalterliche Keram ikfragm ente enthielt. Bauliche Strukturen wurden leider nicht festgestellt.
A ufgrund der Verteilung der Funde ist eine Vermischung der Kulturschichtreste durch den Pflug anzunehm en. Die schlechte Erhaltung darf allerdings nicht über die erhebliche Bedeutung dieser Fundstelle hinwegtäuschen. Die Keram ikfragmente bezeugen näm lich erstm als in der U m gebung von Tägerwilen Siedlungsaktivitäten in der jüngeren Eisenzeit. Solche konkreten Hinweise fehlten bis anhin, obwohl au f Castell und Hochstross aufgefundene keltische M ünzen Siedlungen der Latènezeit verm uten Hessen.230
227 JbSG U F 70, 1987, 8 7 -8 9 .™ JbS G U F 81, 1998 ,276 .™ JbS G U F 82, 1999 ,276 .™ B rem 1997, 7 3 -7 6 ; JbS G U F 81, 1998 ,284 .
4 1 9 .0 0 m ü. M.
* C-14 Probe 1
0 Im
Abb. 128 T ägerw ilen: T rafostation . Profil.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 105
Abb. 129: Tägerw ilen: M üller-T hurgau-S trasse . F reilegen der Fundschicht.
Die Funde(KNr. 1140-1145; Abb. 214, S. 228-229)
Wie w ichtig routinem ässige Baustellenbegehungen sein können, zeigte die Durchsicht des Fundmaterials. Neben mehreren fein- und grobkeram ischen Scherben darf die Bergung des Randfragm entes 1140 einer feinkeram ischen Schale als kleine Sensation gelten (Abb. 130). Das Fragm ent besitzt ein S-förm ig geschweiftes Profil und weist zwei unter dem Rand um laufende Riefen als Verzierungselem ente auf. Die Keramik ist hart gebrannt und fein gem agert. Auffällig ist der hohe Anteil von G lim m er als M agerungszusatz. Das Stück ist au f der Aussenseite stark verwittert, doch sprechen die partiell noch erhaltene schwarze Oberfläche und Vergleichsfunde aus anderen Fundstellen dafür, dass das Gefäss ehem als gut geglättet war.
Das Stück gehört zur G ruppe früher Drehscheibenware, die gegen Ende des 6. Jahrhunderts nördlich der A lpen auftritt. Die schnell rotierende Töpferscheibe kam dam als in unserem Gebiet in Gebrauch. A usgangspunkte der Verbreitung dieser neuen Technik waren verm utlich grössere befestigte Siedlungen, z.B. die Heuneburg an der oberen Donau, Châtillon-sur-G lâne bei Fribourg und vermutlich auch der Uetliberg bei Zürich. D iese pflegten enge Kontakte und intensiven Güteraustausch mit dem Süden, wo die Töpferscheibe bereits seit längerem bekannt war.
Drehscheibenkeram ik findet sich aber auch in kleineren Siedlungen in Höhenlage, z. B. au f der Baarburg bei Baar und au f Alttoggenburg, oder in offenen Landsiedlungen wie z. B.
Abb. 130: Tägerw ilen: M üller-T hurgau-Strasse. Frühe D rehscheibenw are der Spâthallstatt-/F rühlatènezeit (M 1:1).
Gelterkinden, M örikcn und Berikon oder O telfingen.231 Gute Vergleichsstücke zum Fragm ent aus Tägerwilen finden sich au f dem U etliberg.232 Die nahe gelegene Fundstelle M ühlen- zelgle bei Singen lieferte ebenfalls geriefte Drehscheibenkeram ik der Späthallstatt- bzw. Frühlatènezeit; Gefass- profilierung und Randpartie sind dort allerdings etwas anders gestaltet.233
W ährend sich unser Stück m ühelos in die Gruppe der S-förm ig geschweiften und riefenverzierten Schalen und Schüsseln einbinden lässt und in den Übergang von der Späthall statt- zur Frühlatènezeit fällt234, ist die Datierung der übrigen Keramik etwas schwieriger. Das Randfragm ent 1144 eines grobkeram ischen Gefässes zeigt durchaus eisenzeitliche Tradition, eine genauere Zuweisung ist allerdings nicht möglich. Gleiches gilt für das stark in M itleidenschaft gezogene verzierte W andfragment 1142 mit m öglicher Kreisstem pelverzierung.235 Die beiden Ränder 1141 und 1143 lassen sich ebenfalls nicht genau eingrenzen, wobei der stark glim m erhaltige Ton von 1141 für eine Datierung innerhalb der Späthallstatt- oder Frühlatènezeit spricht. Dagegen dürfte die W andscherbe 1145 mit Henkelansatz in die Bronzezeit zu datieren sein.
W ährend die Rand- und W andfragmente keine genauere Datierung zulassen, m arkiert der früheste Nachweis von Drehscheibenware au f Thurgauer Boden erstm als den Übergang von der älteren zur jüngeren Eisenzeit am Anfang des 5. Jahrhunderts v.Chr.
Tägerwilen: Girsberg-Gugger
Prähistorische und römische Funde beim Schlösschen Girsberg
Lage und Befunde
Einen ersten Hinweis au f eine prähistorische Fundstelle nördlich des Schlösschens Girsberg gab der Kratzer 1146 aus Silex, der 1997 nördlich der M ThB-Strecke aufgelesen wurde.
Nahe der Fundstelle des Silexkratzers stiessen wir 1999 südlich des bestehenden M ThB-Trassees in zwei M eter Tiefe au f einen Horizont mit prähistorischen Scherben (Abb. 131, 1).
Die Fundstelle liegt au f einer flach ansteigenden M oränenterrasse nordwestlich des Schlösschens (Abb. 132). An der Basis der Schichtabfolge liegt über der verw itterten M oräne eine alte holozäne Bodenbildung aus dunkelgraubraunem, fast schwarzem Lehm, der durchsetzt ist mit
231 Z ur frühen gerieften D rehscheibenkeram ik vgl. H opert 1996, 1 8 -2 7 .232 B auer e t al. l9 9 1 ,T a f. 63.895 u n d T af. 6 4 .8 9 7 -8 9 9 .233 H opert 1995, 54, Abb. 10.234 B auer et al. 1991, 1 6 4 -1 7 1 , da tie rt d ie S -fö rm ig geschw eiften Schalen
und Schüsseln an den B eginn der Latènezeit.235 Solche V erzierungsm otive w eisen d ie ha lls tattzeitliche G rabkeram ik
vom G eissberg bei K reuzlingen auf, L üscher 1993, z .B . Taf. 62.563; 6 4 .5 6 8 ,5 6 9 .
106 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
fünjcelmos 403
0.5km!0km
Abb. 131 :T ägerw ilen . S ituation 1 :10000 . 1 G irsberg-G ugger, prähistorische Fundstelle; 2G irsberg , röm ische Funde; ’O bere Binder.
zahlreichen Holzkohleflocken. Unm ittelbar oberhalb dieser prähistorischen Rodungszeiger fand sich ein H orizont von 2 0 -3 0 cm M ächtigkeit mit prähistorischen Scherben und vereinzelten hitzeversehrten Steinen. Die Fundschicht war von zwei M eter m ächtigen, sandigen und lehmigen Ablagerungen überdeckt und geschützt. Sie Hess sich in den Profilen über eine Länge von ca. 2 0 -3 0 M etern verfolgen.
Die Funde(KNr. 1146-1149; Abb. 215, S. 230-231)
Die wenigen Fundstücke - K eram ikscherben von prähistorischer M achart sowie ein Silexabschlag - lassen sich nicht
näher datieren, dürften aber aus der Jungsteinzeit oder der Bronzezeit stammen.
Weitere bronze- oder eisenzeitliche Scherben fanden sich in Tägerw ilen-Obere Binder (Abb. 131,3).
U nm ittelbar südlich der prähistorischen Fundstelle G irsberg-G ugger wurden beim Hum usabtrag einige röm ische Scherben geborgen (Abb. 131, 2). Bauliche Strukturen w urden dabei keine festgestellt. Die Randscherbe 1147 sowie der Tellerboden 1148 stammen aus dem 1. Jh. n.Chr. Zur Ergänzung sei die röm ische eiserne Axt 1149 angeführt, die angeblich aus der Um gebung des Schlösschens stam m t.236 Die Fundum stände sind leider nicht bekannt. Das Stück gelangte 1908 nach Zürich ins Landesm useum und soll aus einer Sam m lung Burkhardt stam m en.237 Heierli erwähnt zudem eine röm ische Fibel, die angeblich bei Emmishofen gefunden w urde.238
A bb. 132: Tägerw ilen: G irsberg-G ugger. T rassee der M itte lthurgaubahn. In der B öschung dunkle Schicht m it viel H olzkohle, die von p rähistorischen R odungen stam m t, darüber H orizont m it präh isto rischen Funden.
Fundstellen am Seerücken
Kreuzlingen: Schlossbühl
Lage und Forschungsgeschichte
Eberhard G ra f Zeppelin und Joseph von SitryIm Wald, an der Kante des steil abfallenden Bernrain-
Tobels, findet sich das eindrückliche Erd werk Schlossbühl (Abb. 133, 1). Ein bis zu 5 m hoher Hauptwall riegelt ein kleines Plateau von ca. 100 m 2 vom natürlichen G eländesporn ab. Vor dem Hauptwall liegen zwei 6 -1 0 m breite Gräben, getrennt durch einen Vorwall von bis zu 1,5 m Höhe (Abb. 134).
Die heute sichtbare Anlage ist m ittelalterlich, birgt aber auch urgeschichtliche Funde. Leider kennen wir keine historische Quelle zu diesem Bauwerk. Wie Jakob Heierli in seinem 1896 erschienenen Artikel «Die archäologische Karte des Kts. Thurgau» berichtet, wurde die Burgstelle von Dr. Eberhard G raf Z eppelin239, dem Bruder des Luftschifferfin
ders, entdeckt und als Refugium, beziehungsweise als Fluchtburg, interpretiert.240 Die Herren von Sury und Heierli hielten die Anlage anfänglich für die Reste eines eisenzeitlichen Refugiums. Aufgrund ihrer kleinen A usdehnung vertrat Heierli jedoch später die M einung, es handle sich um die Reste eines röm ischen W achtturm es.241 Über die Forschungen G raf Zeppelins, in dessen Familienbesitz sich das kaum ein Kilom eter entfernte Schlösschen Girsberg befand, wissen w ir leider nur wenig. Von ihm selbst sind keine A ufzeichnungen überliefert. Von Joseph von Sury, der verm utlich zw ischen 1909 und 1911 au f Schlossbühl selbst den Spaten an-
236 G aitzsch 1980, Taf. 5.23.237 Im E ingangsbuch des SLM Z unter der Inven tarnum m er 33057.
E insender: A. H auri, Seengen (A G ), und A lphons M eyer, Zürich.238 N o tizbüch lein H eierli V III, 10, o .J. (SLM Zürich).239 Eberhard G ra f Z eppelin , Dr. b .c ., von T übingen, 184 2 -1 9 0 6 , Präsident
des V ereins für G eschichte des B odensees 1892 -1 9 0 5 , lebte a u f dem G ut Ebersberg in Em m ishofen.
240 H eierli 1896, 130.241 H eierli 1896, 111; JbSG U 5, 1912 ,238 .
Mzfiofiaü(?HJse/47 - Æafa/pg awggewôA/fer Fun^fe/km107
Abb. 133: K reuzlingen. Situation 1 :10000. 'S c h lo ss b ü h l;2B ernrain ; 'W ildenw is-Saubach ; 'Junkho lz ; ‘Schreckenm oos. ‘ B ernrain , K upferbeil.
277900
Schlossbüel277800
500-
•5OO"
500-
50 m
: Schlossbühl. Lage der Sondierschnitte 1 9 72 /73 und des 1996 dokum entierten Profils.Profils.dokum entiertenAbb. 134: K reuzlingen:
108 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
setzte, erfahren wir aber, dass G raf Zeppelin eiserne Gegenstände gefunden habe.242
Über die Ergebnisse der G rabungen von Surys, der von Willy M üller aus Em m ishofen unterstützt wurde, sind wir verhältnism ässig gut unterrichtet. M it m indestens zwei G rabungsschnitten untersuchten sie den Hauptwall und den vorgelagerten Graben (Abb. 136). Der dam als aufgenom mene topographische Plan sowie die Schichtprofile lassen sich mit den Ergebnissen im Rahmen der A7-U ntersuchun- gen gut in Einklang bringen, was für Dokum entationen aus der Frühzeit der Archäologie keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist.
A uf der Rückseite des Hauptwalles verbreiterte von Sury die Grabungsfläche Zeppelins und tiefte sie bis au f den natürlich gewachsenen Boden ab. Im oberen Bereich der Schichtabfolge stiess er, w ie zuvor G raf Zeppelin, au f m ittelalterliche Funde, vorwiegend Ziegel und Keramik. Im unteren Bereich, direkt über der M olasse, verzeichnete er prähistorische Keramik: «...unverkennbar aus der Pfahlbautenzeit...». Gemäss von Surys Bericht handelte es sich um die ungestörte Schichtabfolge einer prähistorischen und mittelalterlichen Kulturschicht, was w ir bestätigen können. Von den angeblich angetroffenen Gips- und M örtelbrocken, die von M auern stammen sollen, fand man bei den späteren U ntersuchungen keine Spuren. Vermutlich handelte es sich lediglich um Kalkablagerungen im M olassefelsen.243
Erste prähistorische Landsiedlung im ThurgauDie grosse Bedeutung der G rabung von Sury wird deut
lich, wenn m an den Kom m entar zur Fundstelle in der Urgeschichte des Thurgaus von Keller und Reinerth aus dem Jahre 1925 liest. Damals beruhte das W issen um die Urgeschichte noch ganz au f den fundreichen Ufersiedlungen am Bodensee sowie au f Grab- und Einzelfunden. Im Thurgau war noch keine einzige prähistorische Landsiedlung bekannt244. Die beiden Autoren bezweifelten von Surys Deutung der Reste als Besiedlungsspuren aus der «Pfahlbautenzeit». Sie interpretierten zudem diese Bezeichnung in von Surys Bericht als «Jungsteinzeit». Von Steinzeit hat dieser in seinen Veröffentlichungen jedoch nie gesprochen, auch Steinwerkzeuge hat er nie erwähnt. Bei den jüngeren U ntersuchungen, so viel sei hier vorweggenom men, wurden ebenfalls keine neolithischen A rtefakte angetroffen.245
Karl Keller-Tarnuzzer wollte au f Schlossbühl weitere Grabungen durchführen, konnte das Vorhaben jedoch nie um setzen.246
Von Surys Leistung für die U rgeschichtsschreibung besteht also darin, dass er als Erster die Spuren einer prähistorischen Landsiedlung im Thurgau richtig als solche interpretierte.
242 JbSG U 5, 1912 ,238 .243 W inkler, K urzbericht über die A usgrabungen a u f dem Schlossbühl bei
K reuzlingen. U npubliz ierter G rabungsberich t o. J.244 W äld i-H ohenrain w ar zw ar bereits bekannt, d ie B efunde aber als G räber
gedeutet, K eller u. R einerth 1925, 210.245 Beck 1935a; 1935b.246 B rie f an A lfons B eck vom 16. Januar 1936. Schlossbühl w ird in diesem
B rie f als B ernrain bezeichnet.
Abb. 135: E berhard G ra f Z eppelin , 1842-1906.
N '/m p w ^
A bb. 80. R efug ium S ch lo ssb ü h l bei E m m ishofen
A ufgenom m en im H erb s t 1912 von D r. Jo s . v. S u ry u n d W illy M üller. 1 : 100.
Refugium Schlossbtihl bei Emmishofen.
Abb. 136: K reuzlingen: Schlossbühl. P lan und Profil der G rabung von Sury 1912. H in ter dem H auptw all ist d ie «A lte G rabung» von G ra f Z eppelin e in gezeichnet.
Nationalstnisse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 109
D ie Aufsam m lungen von Alfons BeckDie Funde von Surys wurden leider nicht veröffentlicht
und sind heute ebenso wie jene von G raf Zeppelin verschollen. Anfangs der 1930er-.lahre suchte der dam alige Hauptlehrer und Stadtarchäologe von Konstanz, Alfons Beck, den Schlossbühl wiederholt nach Funden ab und barg aus dem A ushub der G rabung von Sury weitere prähistorische Scherben. In der Folge entdeckte er auch jenseits des Tobels die Fundstelle Bernrain. Der g rosste Teil seiner Sammlung wird in Frauenfeld aufbewahrt. Zum kleinfragm entierten Fundm aterial, worin nach ihm reichhaltige Profile und O rnam ente fehlen, schreibt Beck, eine Datierung der Scherben in die Bronzezeit könne allein über die M achart und Qualität erfolgen.247
W ir entdeckten unter den Funden Becks 25 auswertbare Randfragmente, Bodenscherben und verzierte W andscherben. Diese Stücke, 1150-1167, sind kleinfragm entiert und schlecht erhalten. Es bleibt offen, ob sie Alfons Beck nicht beachtet hat oder ob die Fundkomplexe heute mit Objekten aus Bernrain verm ischt sind. Becks Sohn, Volcker-Martin Beck, hat seinen Vater in den 30er-Jahren begleitet. Er hat uns 1999 versichert, dass seinerzeit auch auswertbare Randscherben au f Schlossbühl geborgen worden seien. W ir nehm en an, dass die Funde tatsächlich aus dem Grabungsaushub von Surys stammen und somit die wichtigsten Belege für die bronzezeitliche Besiedlung au f Schlossbühl bilden.
Die Grabung von 1972/73
Das Trassee der A7 liegt heute 100 M eter weiter westlich als in den 1960er-Jahren geplant war. Das ursprüngliche Projekt führte nahe an der Burgstelle Schlossbühl vorbei, und es bestand die Gefahr, dass durch den Tagbau des Girsberg- tunnels das Erdwerk zerstört werden könnte. Dies veranlasste die dam alige Kantonsarchäologin M adeleine Sitterding, den Kreuzlinger Lehrer Titus W inkler mit der archäologischen Untersuchung zu beauftragen.
In zwei Etappen, 1972 und 1973, wurden unter der Leitung von Albin Hasenfratz und Edgar Kopieczek zehn Schnitte au f dem Burghügel und in den beiden vorgelagerten Gräben abgetieft, mit weiteren auch ein Graben untersucht, der rund 200 M eter westlich vom Schlossbühl das Plateau abriegelt.
Die neue Linienführung der A7 bewahrte den Schlossbühl vor der Zerstörung, sodass man au f weitere Grabungen verzichten konnte. 1981 kartierten Jakob Obrecht und M atthias Schnyder das Erdwerk (Abb. 134).
Der Nationalstrassenbau bedingte die Verlegung von Waldwegen. Dabei wurde 1996 der östliche A bschnitt des an den Steilhang anschliessenden Walles zerstört und die beiden vorgelagerten Gräben mit Aushubm aterial zugeschüttet. Das Amt für Archäologie, das über dieses Bauprojekt nicht inform iert worden war, erfuhr von Roland Henke, einem lokalhistorisch engagierten Kreuzlinger, von den Schäden. Die Wall- und G rabenprofile konnten noch dokum entiert, die zugeschütteten Gräben wieder geöffnet und die Wegböschung durch den angeschnittenen Wall mit Natursteinen gefestigt werden (Abb. 137, 138).
Reste einer prähistorischen KulturschichtDie prähistorische Kulturschicht wurde 1972/73 und 1996
w ieder angeschnitten. Sie war noch unter dem Wall, nicht aber au f dem Plateau erhalten (Abb. 137, Schichten 5/6) und enthielt zahlreiche Hitzesteine, Holzkohle, brandgeröteten Lehm sowie Keram ikfragm ente. Gegen den Graben hin brach sie unvermittelt ab. Es lässt sich kein Zusam m enhang hersteilen zwischen der Kulturschicht, die in die Bronzezeit zu datieren ist, und dem Bau der W all-Graben-Anlage, welche eindeutig jünger ist.
Die Kulturschicht Hess sich auch in Schnitt 13 feststellen, wo ihre Reste (Abb. 139, Schicht 8) von einer hallstattzeitlichen Schicht und der heute sichtbaren Hügelschüttung überlagert und geschützt sind.
D f e A W e (%7W 2 7 6 -2 /7 , S. 222-235)Unter den Funden von 1972/73 und 1996 ist nur die Rand
scherbe 1165 auswertbar. Zu diesem Fragment einer grobkeram ischen Kalottenschale gibt es Parallelen im m ittelbronzezeitlichen W äldi-H ohenrain.248 Falls die Funde der Sammlung Beck tatsächlich aus dem Aushub der Grabung von Sury stammen, so belegen sie neben einer Besiedlung in der M ittelbronzezeit auch eine Siedlungsphase der Spätbronzezeit. Flinweise au f die M ittelbronzezeit geben verdickte, gerundete Randform en m it Fingertupfen au f der Randlippe, 1154-1156. Die Spätbronzezeit ist durch Scherben mit nach innen schräg abgestrichenen Rändern vertreten, die von grobkeram ischen G elassen stammen, 1159-1161.
Ein Grabhügel aus der Hallstattzeit?
1972 stiessen die A usgräber in einer Schicht mit ver- ziegeltem Lehm unterhalb der W allschüttung au f ein stark fragm entiertes, verbranntes Gefäss (Abb. 139, Schicht 4). Es war überlagert von einer hügelähnlichen Schüttung, Schicht 5. Die Interpretation des Befundes bot Schwierigkeiten. Er spricht für einen hallstattzeitlichen Grabhügel unter der jüngeren, m ittelalterlichen W allanlage. Das Kegelhalsgefäss 1166 erinnert stark an hallstattzeitliche Grabkeramik.
Die kaum zwei K ilom eter entfernten Grabhügel in Kreuz- lingen-Geissberg-O beres Mösli wurden in einer vergleichbaren Geländesituation au f einem Sporn unm ittelbar am Rande eines Tobels angelegt.
Die mittelalterliche Burg
Das Erdwerk dürfte zwischen dem Frühm ittelalter und dem 11./12. Jh. n.Chr. erbaut worden sein. Das Fragment 1176 eines röm ischen vierkantigen Kruges kann mit der Erbauung der Burganlage nicht in Verbindung gebracht werden. Schriftliche Quellen zum m ittelalterlichen Bauwerk sind leider keine bekannt. Die Fundarm ut ist für frühe Holz- Erde-Burgen geradezu typisch, und das Fundmaterial vom Schlossbühl stammt denn auch aus einem späteren Zeitraum,
247 B eck 1935a; 1955; 1956.248 H ochuli 1990, Taf. 1 ,7 , Taf. 13 ,298 .
110 Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
0 Im
Abb. 137: K reuzlingen: Schlossbühl. Schnitt durch den H aupt- und den Vorwall M 1:50. U ntersuchung 1996.
näm lich aus dem 15./16. Jh. n.Chr. Es gehört somit zu einer späteren Nutzung der Anlage.
W eder die H olzbauten noch der Erdwall erfuhren im Hoch- und Spätm ittelalter einen A usbau aus Stein. Lediglich im Bereich der Schnitte 12 und 17 fanden sich spärliche Reste von trocken gesetzten Steinen, die zu den Fundam enten eines Ständerbaus aus Holz und Lehm gehört haben dürften. Dieses Gebäude, dessen Grösse wir nicht kennen, lag au f dem kleinen, flachen Sporn im Schutz des Hauptwalles. Ob der Wall und der Sporn mit einer Palisade befestigt waren, liess sich durch die Sondierungen nicht schlüssig klären. Einzelne Pfostenstellungen schliessen eine solche jedoch nicht aus.
Im spätm ittelalterlich/frühneuzeitlichen Fundmaterial sind Fragmente von dreibeinigen Kochtöpfen, so genannten Grapen, enthalten, die teilweise Reste von G lasur tragen,1168-1171. Neben diesem K ochgeschirr finden sich Teile
des gläsernen Trinkbechers 1174 sowie einige Eisenfunde, darunter ein M esserfragm ent und Nägel. Die Arm ut an Kleinfunden lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass man die Abfalle von der Burg im Tobel entsorgte. Diese Schutthalde dürfte jedoch der heute noch sehr starken Erosion der Tobelkante zum Opfer gefallen sein.
Von einem gewissen, wenn auch nicht üppigen W ohnkomfort der späten Bewohner der Burg zeugen die Scherben von Fensterglas, z.B . 1175, und den unglasierten Napfkacheln 1172 und 1173. Letztere stam m en von einfachen Kuppelöfen, die sich neben den dam als im städtischen und höfischen Leben üblichen Turmöfen m it reich verzierten Reliefkacheln ziem lich bescheiden ausnehmen. Das spärlich erhaltene Fundmaterial erinnert stark an Inventare, w ie sie in den letzten Jahren bei der Untersuchung von spätm ittelalterlich/frühneuzeitlichen Bauernhäusern bekannt geworden sind.249 Haben in der späten Benutzungszeit lediglich niedere Beam te die Anlage verwaltet? Sassen die Herren längst schon im kom fortableren Konstanz?
Abb. 138: K reuzlingen: Schlossbühl. D ie 1996 neu angelegte Forststrassedurchschneidet den H aupt- und den Vorwall der B urganlage. G ut sich tbar ist Abb. 139: K reuzlingen: Schlossbühl. Schnitt durch den H auptw all M 1:50.d ie vom H auptw all überlagerte präh isto rische K ulturschicht. G rabung 1972.
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Kreuzlingen: Bernrain
Eine Siedlung der mittleren und späten BronzezeitForschungs- und Spionagegeschichten
Eine Zeitungsnotiz w ühlt a u fAm 21. D ezem ber 1935 erschien ein Artikel in der
Konstanzer Zeitung, welcher den kantonalen Konservator, Karl Keller-Tarnuzzer (Abb. 140), zutiefst verärgerte.250 Sein Fachkollege, der Hauptlehrer und Stadtarchäologe Alfons Beck aus Konstanz, veröffentlichte die Entdeckung einer bislang unbekannten bronzezeitlichen Siedlungsstelle am Rand des Bernrain-Tobels (Abb. 141). So erhielt Keller- Tarnuzzer erst im N achhinein Kenntnis von der Entdeckung der «seiner Ansicht nach» ersten bronzezeitlichen Landsiedlung im Thurgau.251 In der Thurgauer Zeitung reagierte er verärgert au f die Tatsache, «dass niem and das thurgauische M useum über diese interessanten Funde benachrichtigt hat».252 Er em pfand es als unerhörten Affront seines Konstanzer Kollegen, diese Entdeckungen au f Kreuzlinger, also Schweizer, Gebiet zu veröffentlichen, ohne ihn zu informieren, und die Funde erst noch nach Konstanz, ins benachbarte Ausland, abzuführen. In seinem Ärger unternahm Keller gar nicht erst den Versuch, m it Beck persönlich Kontakt aufzunehm en, sondern zeigte ihn bei der Kreuzlinger Polizei an, die in der Folge Erm ittlungen anstellte. Der eher beschwichtigend verfasste Polizeirapport gab Keller-Tarnuzzer den Rat, «direkt m it Hrn. Beck F ühlung zu nehm en».155
Damit hätte die Geschichte ihr Ende finden können, doch liest sich der weitere Verlauf des Geschehens wie ein K rim inalrom an der Vorkriegszeit.
Noch am Tag der polizeilichen Befragung schrieb Beck an Keller von seiner Entdeckung auf Bernrain : «Wer hätte gedacht, ... dass ich Ihnen ... eine so schöne Station der Ur-
t i
Abb. 140: Karl K eller-T arnuzzer, K antonaler K onservator, m it seiner Fam ilie im Jahr 1932.
Abb. 141 : A lfons B eck, 1 8 9 0 -1 9 6 8 , S tadtarchäologe in K onstanz zw ischen 1936 und I960.
nenfelderstufe, wie dies Bernrain darstellt, übergeben könnte!». Keller hatte wohl eine Entschuldigung erwartet, so aber m usste ihn der in einem gewissen Entdeckerstolz verfasste B rief Becks befremden. Beck war sich anscheinend keines Unrechts bewusst und sah sich bereits als A ssistent einer grösseren G rabung au f Bernrain, für welche er auch gleich den Termin setzte: «An die 50 Bäum e müssten gefällt werden, eine Aufgabe, die schon diesen Winter in A n g r iff genommen werden sollte, wenn man 1936graben will. [ ...] Mein D ienst an der Schule ist schwer ... Darum, wenn im m er möglich, bitte ich die Grabung a u f unsere f ü n f wöchentlichen Sommerferien zu legen. (Juli-August) ... Als Ihr Stellvertreter kann ich natürlich schon die Grabung einige Tage weiterführen, wenn Sie gerade m al verreisen m üssen.»25“5
Nun erst recht in Rage gekom men, machte Keller in einem geharnischten A ntw ortschreiben seinen Kollegen unm issverständlich au f die gesetzlichen Bestim m ungen und die A nzeigeptlicht archäologischer Funde aufm erksam . Er forderte die Herausgabe von Notizen, Planunterlagen und Funden und m achte seinem Ärger seitenweise Luft: «...dass es eine Taktlosigkeit ist, jahrelang in einem frem den Land zu 24‘' R igert u. W älchli 1996.250 B eck 1935b.251 K eller-T arnuzzer 1937, 71.252 T hurgauer Z eitung 21 .1 2 .1 9 3 5 .253 Polizeirapport vom 29 .1 2 .1 9 3 5 . A rchiv AATG.254 B rie f vom 2 9 .1 2 .1 9 3 5 von A lfons B eck an Karl K eller-T arnuzzer. A rchiv
AATG.
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 113
arbeiten und zudem im Revier eines Bekannten ohne diesem gegenüber auch nur eine kleine A ndeutung zu machen ...!»
D er Vorwurf der SpionageDer Streit weitete sich aus. Der dam alige Berner Professor
für Ur- und Frühgeschichte, Otto Tschum i, mischte sich in die Angelegenheit ein. Er forderte vom N euenburger Professor Paul Vouga, dem dam aligen Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, dass die SGU die Angelegenheit klären solle, notfalls m it Hilfe des Bundes.255 Tschum i form ulierte dabei einen schweren Vorwurf an Alfons Beck: «Da die Fundstelle eine gew isse strategische Bedeutung besitzt, könnte es sich auch um eine fing ierte A usgrabung handeln.»
Die Sache nahm durch den Vorwurf der Spionage eine hochpolitische Dim ension an. In der angeheizten Vorkriegsstim m ung konkretisierten sich ja 1935 die Pläne, einen Festungsgürtel mit Bunkeranlagen um Kreuzlingen zu bauen. Die Fundstelle Bernrain befand sich in unm ittelbarer Nähe. Beck versuchte sich zu rechtfertigen, die Fundstelle sei durch W aldarbeiten gefährdet: «...Erst als ich die Schweizer dort oben dauernd herumbuddeln sah, wollte ich die Sache nicht länger hinausschieben...», und er rät: «schützen Sie zunächst den Platz vor den zerstörenden Eingriffen Ihrer Landsleute».256 Aber die Spirale der Verdächtigungen und Vorwürfe drehte sich weiter: Beck und Keller wechselten gehässige Briefe.257 Nach Otto Tschum i schaltete sich auch Prof. Paul Vouga in die Angelegenheit ein und forderte von Keller um fassende Inform ationen über den Fall.258 Keller em pfand diese Schreiben als Einm ischung und wies darau fh in , dass der Fall von den Thurgauischen Behörden behandelt w erde.259
Die Auseinandersetzung in der PresseDie Sache spitzte sich rasch zu einer A useinandersetzung
zwischen der schweizerischen und der deutschen Presse zu. Am 6. Februar 1936 wurde Beck in der Basler Zeitung vom Freiwilligen N achrichtendienst (Frena) öffentlich angegriffen und der Spionage bezichtigt. D arauf forderte Beck Kel- ler-Tarnuzzer auf, sich von dem Artikel zu distanzieren und die schweizerischen Behörden zu informieren. Keller war die Angelegenheit höchst peinlich, und er nahm in einem Brief an das Justizdepartem ent des Kantons Thurgau und an Beck Stellung gegen die Spionagevorw ürfe.260 Eine R ichtigstellung in der Thurgauer A rbeiterzeitung erschien am 13. Februar zu spät261, die nationalsozialistische Presse Deutschlands kam ihr zuvor. Die Bodensee-Rundschau verteidigte am 11. Februar Alfons Beck gegen die Vorwürfe aus der Schweiz und beschim pfte die Frena und die Schweizer Behörden. Als sich Keller für eine Richtigstellung an dieselbe Zeitung wandte, wurden seine Worte in einen weiteren Artikel m it Titel «Schweizer missbilligen die Frena-Hetze» eingebunden.262
Nach diesem aufgebauschten verbalen Grenzkonflikt glätteten sich die Wogen wieder. Friedrich Garscha, der Direktor des Badischen Landesm useum s in Karlsruhe, entschuldigte sich für das Verhalten Becks.263 Bereits im M ärz 1936 sondierte Keller au f Bernrain. Als Jahre später, 1955, Beck die Ergebnisse zu seinen Untersuchungen au f Schlossbühl und Bernrain erneut publizieren wollte, gaben
sich alle Beteiligten Mühe, die Spielregeln einzuhalten. Keller wurde angefragt, das M anuskript von Beck zu überarbeiten.264 Er lehnte ab : « Wie ich Herrn Beck kenne, schreibt er solche Arbeiten nicht nur pünktlich, sondern auch sehr gut und zuverlässig. Ich will und kann sie ihm nun nicht m ehr w egnehm en... Nüt für unguet!».265 Die O rdnung war wieder hergestellt und Beck konnte seine Forschungsergebnisse in allseitigem Frieden veröffentlichen.266
Die Entdeckung durch Alfons BeckÜber die Entdeckung der Fundstelle Bernrain schreibt
A lfons Beck mit Begeisterung:«...Ich kam a u f den Gedanken, den M olassefelsen am Fuss
des Hügels a u f der anderen Seite des Tobels zu untersuchen. Der leuchtende Fels lockte, als ich um 1932 gerade m it einer Schulklasse eine Wanderung durch den Tobel unternahm. ... Ich gab der Schulklasse Auftrag, den H ügel zu stürmen, wo er nicht gerade senkrecht abfiel. M it Begeisterung stürmten die Buben hinauf, m ir standen die Haare zu Berge. . ..D a lagen tatsächlich die ersten Scherben, das selbe M aterial wie bei frühen Stücken des gegenüberliegenden Schlossbühls. A u f der Plattform zeigte ich die Funde meinen Schülern, und nun ging es an ein erneutes Suchen am Berghang. Aberm als einige dieser prähistorischen Scherben! Einige Buben suchten nun auch a u f der Plattform; sie griffen in Wurzelwerk, das am Böschungsrand in der Luft hing; ... da wiesen sie m ir triumphierend neue Scherbenfünde, dicht unter der Oberfläche, die Siedlung war entdeckt! Welch freudiges Gefühl mich damals bewegte, kann ich heute nur noch nachempfinden ... ».267
Sondierungen Keller-Tarnuzzers
Kaum hatte sich der Rauch um die Spionagegeschichte aufgelöst, sondierte Keller-Tarnuzzer au f Bernrain (Abb. 142).26*
255 B rie f vom 2 0 .0 1 .1 9 3 6 von O tto Tschum i an Paul Vouga. A rchiv AATG.256 B rie f vom 2 9 .0 1 .1 9 3 6 von A lfons B eck an Karl K eller-Tarnuzzer. A rchiv
AATG.257 Ebd.. und B rie f vom 3 1 .0 1 .1 9 3 6 von Karl K eller-T arnuzzer an A lfons
Beck. A rchiv AATG. B rie f vom 0 5 .0 2 .1 9 3 6 von A lfons Beck an Karl K eller-Tarnuzzer.
258 B rie f vom 2 1 .0 1 .1 9 3 6 von Paul Vouga an Karl K eller-Tarnuzzer. Archiv AATG.
259 B rie f vom 2 3 .0 1 .1 9 3 6 von Karl K eller-T arnuzzer an Paul Vouga. Archiv AATG.
260 B rie f vom 12 .02 .1936 an das Justizdepartem ent des Kts. Thurgau: B rie f vom 10 .02 .1936 von Karl K eller-T arnuzzer an A lfons Beck. Archiv AATG.
261 T hurgauer A rbeiterzeitung /T hurgauer V olkszeitung 13 .02 .1936.262 B odensee-R undschau 14 .02 .1936.263 B rie f von 2 7 .0 2 .1 9 3 6 von Friedrich G arscha an Karl K eller-Tarnuzzer.
A rchiv AATG.264 B rie f vom 0 2 .1 1 .1 9 5 5 von E. O berhänsli an Karl Keller-Tarnuzzer.
A rchiv AATG.265 B rie f vom 0 4 .1 1 .1 9 5 5 von K arl K eller-T arnuzzer an E. O berhänsli.
A rchiv AATG.266 B eck 1955, (N achdruck 1991). T hurgauer Z eitung 2 5 .0 2 .1 9 5 6 ;
0 2 .03 .1956 .267 B eck 1935a.268 JbSG U 27. 1935,31 .
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Bronzezeihliche Siedlung B ernrain Sondierung vom 11. M ärz 1936
G em ein d e K reu zu n g en
Profil a - a 1:50
SihJoN on 1:500
# • / / / / £ e r> * tr s* r //fr , rm t f*,ioen O C- i S<xKf/trir rffen otun fi» toc
<& ßraoascftiüir
Abb. 142: K reuzlingen: B ernrain. Ü bersich t über d ie S ondierungen vom 11. M ärz 1937 durch Sem inaristen des Sem inars K reuzlingen, aufgenom m en von Frau K noll-H eitz. D ie m eisten Funde lagen en tlang der H angkante und im erod ierten Steilhang. D ie Skizze ist verk le inert w iedergegeben.
Am 11. März 1936 versuchten 25 Seminaristen mittels dreier Sondierschnitte und m ehrerer Dutzend kleinerer Sondierlöcher, die Ausdehnung der Siedlungsstelle zu erfassen und zusam m en mit Franziska Knoll-Heitz, damals Assistentin von Keller-Tarnuzzer, einzumessen. Die bronzezeitlichen Funde lagen entsprechend den Angaben Becks unm ittelbar unter dem Humus in einem schmalen Streifen entlang der Hangkante und im abfallenden Steilhang.
Grabungen bedingt durch den Autobahnbau
Bedingt durch die Trasseeführung der A7 m ussten zahlreiche W aldstrassen ausgebaut oder neu angelegt werden. So auch in Bernrain. Nach Begehungen im O ktober 1996 erfolgten im F eb ru ar-M ärz 1997 Sondierungen.269 Der örtliche Leiter A lbert W idmann legte e lf Schnitte östlich des bekannten Fundbereiches, einen weiteren nahe der Hangkante (Abb. 143, 144).
Die Schnitte bestätigten die Annahme, dass die Fundschichten weitgehend der Erosion durch das angrenzende Bachtobel zum Opfer gefallen sind. U nm ittelbar unter einer dünnen H um usschicht finden sich Kolluvien m it spärlichen Funden, darunter folgt die verw itterte M oräne. Sicher in die Bronzezeit zu datierende Kulturschichten oder bauliche Strukturen konnten nicht verzeichnet werden.
Die Funde(KNr. 1181-1276; Abb. 218-220 , S. 236-241 )
Scherben im M useum sdepot - letzte Informationen zu einer erodierten Fundstelle
Die Sammlung Beck umfasst rund 10 kg Keramik, bzw. gut 1500 Scherben, was für O berflächenfunde eine stattliche M enge bedeutet. Auswertbar sind 171 Rand-, Wand- und Bodenscherben.
Viel geringer sind die Fundmengen der letzten Jahre: Vz kg Scherben m it sieben auswertbaren Fragmenten. Ein Teil fand Roland Henke, Kreuzlingen.
Aus den Sondierungen von Karl Keller-Tarnuzzer sind heute gerade noch zwei Scherben greifbar, der Rest des Fundm aterials ist verschollen.
Was sich heute noch an Keramik im Bernraintobel finden lässt, sind einzelne, sehr klein fragm entierte und fast bis zur Unkenntlichkeit verw itterte Scherben. In den 193Oer-Jahren waren die Scherben noch grösser und zahlreicher, doch ihre Oberflächen wiesen auch schon starke Verwitterung auf. Die Erosion der Hangkante hatte die Fundstelle offensichtlich bereits dam als weitgehend zerstört.
Ohne die ehem als heftig um strittenen Aufsam m lungen von Alfons Beck besässen w ir heute keine oder nur geringe Kenntnisse über diese interessante Fundstelle.
a» J b S G U F S l, 1998 ,272 .
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 115
2 Gegrabene Grabungsfelder und Sondierschlitze
Ausdehnung dichte Fundstreuung
Ausdehnung dünne Fundstreuung
Ausdehnung der Erdarbeiten / / (Bauprojekt) / / />
77800
A bb. 143: K reuzlingen: B ernrain . S ituation 1:1000.
D ie Keramik der M ittelbronzezeitA lfons Beck hat die wesentlichen Zeitstellungen des
Fundmaterials, v.a. Spätbronzezeit und wenige Elemente der älteren Eisenzeit, erkannt und beschrieben. Zu seiner Zeit waren noch kaum Fundkomplexe mit Siedlungskeramik der mittleren Bronzezeit bekannt, sodass Beck die entsprechenden Elemente nicht ausm achen konnte.270 Heute kann das M aterial anhand von Vergleichen m it W äldi-Ho- henrain und den erst 1997 und 1998 ausgegrabenen Fundstellen Ribi-Brunegg, Ribi und W ildenwis-Saubach eindeutig in die jüngere M ittelbronzezeit gestuft werden. Das Bernrain-Plateau war dem zufolge bereits um 1400 v. Chr. besiedelt.
In dem zeitlich verm ischten Fundkomplex zeigen sich die m ittelbronzezeitlichen M erkmale fast ausschliesslich anhand der verdickten Ränder der Grobkeram ik m it ihren gerundeten oder gekanteten Randlippen. Oftmals finden sich Fingertupfen au f der Randlippe. Die Oberflächen dieser Ge- fassfragm ente sind in der Regel sehr grob gearbeitet und weisen eine auffallend grobe M agerung auf.
Daneben finden sich Ränder, die au f der Innenseite verdickt sind, wie dies für die späte M ittelbronzezeit und die frühe Spätbronzezeit charakteristisch ist, 1216-1218. Eine sichere Abgrenzung dieser Randform en zu den spätbronzezeitlichen Schrägrändern ist nicht möglich.
Bei den plastischen Verzierungen sind glatte Leisten vorhanden, Fingertupfenleisten und -reihen, die eine Zuweisung
in die Bronzezeit erm öglichen; genauer lässt sich das M aterial jedoch nicht einstufen.
Ebenso schwierig gestaltet sich die Beurteilung der Feinkeramik. An dem stark erodierten Fundmaterial sind Ritz- und Einstichverzierungen nur schwach erkennbar, und die wenigen klein fragm entierten Scherben lassen sich oft nicht näher in der Bronzezeit einordnen. Lediglich die mit flächendeckenden Einstichen versehene W andscherbe 1182 könnte in die mittlere Bronzezeit oder allenfalls in die H allstattzeit datiert werden. N icht näher einzuordnen sind die Fragmente der Kalottenschalen 1204-1207 .271 Zur Entw icklung der Randform en und Verzierungen sowie der Wanddicken der Früh-, M ittel- und Spätbronzezeit in der Region K reuzlingen/Tägerw ilen siehe die Abbildungen 87 -89 im Kapitel zu Hochstross.
Die F unde der SpätbronzezeitDie spätbronzezeitliche Keramik ist klein fragmentiert.
Konische Schalen, zum eist mit m arkanten Randfacetten, sind die häufigste G elassform und kommen etwa doppelt so oft vor wie spätbronzezeitliche Schrägrandtöpfe. Von 28 Scherben weisen lediglich fünf Exemplare Verzierungen auf. Die Verzierungsarmut dürfte jedoch au f die Verwitterung der Scherben zurückzuführen sein.
270 H ochuli 1990, 11; O sterw alder 1971, 12.271 H ochuli 1990, m ittlere B ronzezeit: Taf. 5. 98, 211 1319, H allstattzeit:
Taf. 46.856.
116 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
A bb. 144: K reuzlingen: B ernrain . S ondierungen im Früh jahr 1997.
Frühe Elem ente der Spätbronzezeit sind das Randfragm ent 1234 m it einer abgesetzten Stufe sowie die Scherbe 1232 mit mehrfachen Zickzack-Ornam enten au f der Randfacette und au f der Innenseite der Wandung. Hierfür finden sich gute Vergleichsstücke in der in die Zeit um 1047-1042 v. Chr. dend- rodatierten Seeufersiedlung Greifensee-Böschen (ZH ).272 Für die Schalen 1230 und 1231 mit Einstichreihen au f der Randfacette ist eine Parallele in Zug-Sumpf, ältere Schicht zu nennen. Sie lassen sich somit in die Zeit zw ischen 1056 und 944 v.Chr. einengen.273 Dass der Bernrain auch in der Spätphase der Spätbronzezeit besiedelt war, zeigt das Fragment 1254 einer Breitrandschale. Vergleichsstücke zu dieser G elassform kennen w ir aus der Siedlung Uerschhausen-Horn, die im späten 9. Jh. v.Chr. angelegt w urde.274 Eine W andscherbe weist einen Graphitüberzug auf, wie er am Übergang von der Spätbronzezeit zur älteren Eisenzeit aufkam.
Die Fragmente von Schrägrandgelassen in der G robkeram ik sind typisch für die ganze Spätbronzezeit. Oftmals sind die Randlippen mit Kerben oder Fingertupfen verziert, wobei die Tupfen auch au f dem Randum bruch einiger G elasse zu finden sind, z.B. 1260-1266. Die unverzierten Schrägränder könnten zu Zylinderhalsgelassen gehören, z.B . 1259, 1267 und 1268.
Das einzige Bronzeobjekt vom Bernrain wurde 1996 bei einer Prospektion durch das Amt im Bereich der Fundstelle entdeckt. Es handelt sich um das Fragment 1276 einer Bin- ninger-Nadel aus der frühen Spätbronzezeit (Abb. 145).275
Zur Spätphase der Besiedlung a u f BernrainFür die späte Besiedlungszeit gibt es nur wenige Belege,
darunter w iederum einige bei der Grobkeram ik. Zwei flau profilierte Randscherben, 1269 und 1270, mit gewellter Randlippe, eine davon m it dreieckigen Kerben au f dem Randum bruch, dürften in die frühe Hallstattzeit gehören.276 Weitere Hinweise zur Hallstattzeit finden sich in der Wand-
272 Eberschw eilev e t al. 1987, Taf. 6.1, 9.273 Seifert 1997, 8; Se ife rt u. W underli 1997, Taf. 14.170.™ N agy 1997, Taf. 3 5 ,3 7 8 ; G olln isch 1997a, 66.275 JbSG U F 80, 1997 ,224 .™ B au er 1993, Taf. 2 ,2 9 ,3 1 .
Abb. 145: K reuzlingen: B ernrain . K o p f e iner B ronzenadel, der in e inem zw eiten A rbeitsschritt in Ü berfangguss-T echnik a u f den N adelschaft gesetz t w urde. D ie G ussbraue ist im Z en trum der B ruchste lle gut zu sehen (M 4:1). Spätbronzezeit.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 117
Abb. 146: K reuzlingen: B ernrain . F undzeichnungen von A lfons Beck, p ub liz ie rt 1936. D ie Scherbe m it dem G itter-M otiv ist e in w ich tiger B eleg für d ie ha lls tattzeitliche B esiedlung. D as S tück ist heute verschollen.
scherbe m it Resten eines geritzten Gitter-M otives (siehe Abb. 146) und in der Scherbe 1274 m it Kreis-M otiven. Diese Motive zieren auch G elasse aus der kaum zwei Kilom eter entfernten G rabhügelgruppe Kreuzlingen - Oberes M ö sli- Geissberg, die in Ha C, 8. Jh. v.Chr., datieren.277
Kreuzlingen: Anschluss Süd
Befunde und Funde im Bett des Saubachs (KNr. 1277-1292; Abb. 221, S. 242-243)
Im September 1997 wurde das Bett des Saubachs verlegt. Dabei entdeckten Bauarbeiter der Firma Geiges AG, Warth, eine bis zu 30 cm mächtige bronzezeitliche Kulturschicht und meldeten diese den Archäologen, die au f dem benachbarten A utobahntrassee Sondierungen durchführten.
Die Fundstelle befindet sich in einer leichten G eländesenke am Fuss eines M oränenrückens au f 520 m ü.M . (Abb. 133, 3). Die Kulturschicht liess sich au f der Sohle des Bachbettes über eine Distanz von 10 M etern verfolgen.
Abb. 147: K reuzlingen: Saubach. M itte lb ronzezeitliche K ulturschicht im B achbett.
Unsere Untersuchungen beschränkten sich au f die Sohle des Bachbettes (Abb. 147).
Über der M oräne (Abb. 148, Schicht 5) folgt ein dunkler Lehm, Schichten 8 und 9, der im oberen Bereich Kulturschichtreste enthält, die im Spätm ittelalter oder in der frühen N euzeit vom Pflug angekratzt worden sind. Diese sind von ockerfarbenem H anglehm überdeckt, Schichten 2 -4 . Bei den Pflugspuren fanden sich m ehrere tie f in den schweren Boden eingetretene Hufeisen.
Das Fundmaterial besteht aus Hitzesteinen und Keramik. Bronzeobjekte und Knochen wurden keine gefunden. Fein-
z " L ü s c h e r l9 9 3 .T a f . 64, 568.
Abb. 148: K reuzlingen:Saubach. O stp rofil M 1:50. 0 - lm
118 Nationalstrasse AT - Katalog ausgewählter Fundstellen
keram ische Gelasse m it m arkanten Schultern verfügen in zwei Fällen über den Ansatz eines Henkels oder Grifflappens. Das Gefass 1277 weist eine Fingertupfenleiste a u f der Schulter au f und unterhalb davon flächendeckende, vertikale Strichbündel. Die feinkeram ischen und m ehrheitlich auch grobkeram ischen Randform en sind leicht gerundet und ausladend. Unter der Grobkeram ik finden sich die Fragm ente des Topfes 1289 m it F ingertupfen au f dem verdickten Rand und einem randständigen Grifflappen. Der untere Teil der W andung ist geschlickt. Die Randscherbe 1286 eines anderen Topfes besitzt einen deutlich horizontal abgestrichenen Rand. Neben Fragm enten von Fingertupfenleisten finden sich glatte Leisten sowie flächendeckend aufgebrachte Fingernagelkerben. Die verdickten und horizontal abgestrichenen Ränder sowie die flächendeckenden Ritzlinien datieren den Fundkomplex in die jüngere M ittelbronzezeit. Er lässt sich gut m it dem Material der anderen Fundstellen um Kreuzlingen vergleichen.
Befunde und Funde im Junkholz(KNr. 1293-1314; Abb. 222, S. 244-245)
Rodungshorizonte und ErosionssedimenteA uf den M oränenrücken im Junkholz (Abb. 133,4), neben
der Fundstelle W ildenwis-Saubach, beobachteten w ir Reste von prähistorischen Fundhorizonten und alten Bodenbildungen m it Rodungszeigern. Südlich der Fundstelle W ildenwis-Saubach wurden prähistorische und röm ische Scherben des 1 .-3 . Jhs. n.Chr. angetroffen, östlich davon eine natürliche Rinne mit eingeschwem m ten Kulturschichtresten (Abb. 149).
Das Fundmaterial aus dem unteren Bereich der Kolluvien ist bronzezeitlich; ausgenom m en die Pfeilspitze 1293 aus Silex, die eher in die Jungsteinzeit datieren dürfte. A uf der Keramik finden sich Reste von Fingertupfenleisten und flächendeckende Fingernagelkerben. W andscherben mit flächendeckenden Strichbündeln und das Fragment 1300 mit lang gezogenen Dreiecken deuten an, dass das Fundmaterial ebenfalls in die späte M ittelbronzezeit oder bereits in die
509.73 m ü. M.
s8
Im
P o s . 1
1 "
Abb. 149: K reuzlingen: Junkholz. In e iner G eländesenkung der stark e rod ierten M oräne R este e iner K ulturschicht und R este a lter B odenbildung, dunkle Schicht. D ie bronzezeitlichen Funde stam m en aus der hellen Schicht über der dunklen B odenbildung. B lick gegen W esten.
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
Abb. 150: K reuzlingen: Schreckenm oos. G rab? N ordprofil M 1:50.
frühe Spätbronzezeit gehört. Das Fragm ent der Ahle 1294 ist der einzige Bronzefund.
Im oberen Bereich der Kolluvien tauchten im Junkholz vereinzelte röm ische Scherben auf, 1313-1314. Diese lockere Fundstreuung, die bislang ohne Bezug zu baulichen Strukturen steht, dürfte im weitesten Sinne als Zeuge der römischen Landnutzung und Landwirtschaft verstanden werden.
Befunde und Funde im Schreckenmoos Funde: KNr. 1315-1318; Abb. 223, S. 246-247)
Ein römisches Grab?Bei Sondierungen im ehem aligen W aldstreifen beim
Schreckenm oos au f 510 m ü. M. w urde im O ktober 1997 eine ovale Grube in 90 cm Tiefe mit den A usm assen 70 mal 50 cm festgestellt (Abb. 133, 5; 143). Die erhaltene Tiefe beträgt 20 cm. Die Füllung der G rube bestand aus Brandschutt mit Holzkohle und Hitzesteinen. Ausserdem wurden Reste des sekundär verbrannten Tellers 1315 aus röm ischer Zeit gefunden, der sich ins 1 .-3 . Jh. n.Chr. einordnen lässt.278 Die Fundsituation erinnert an ein Brandschüttungsgrab, wobei keine kalzinierten Knochen festgestellt werden konnten.
Zeugen prähistorischer RodungenZeuge der vorröm ischen Nutzung des Terrains im
Schreckenmoos ist, wie im Junkholz, ein dunkler Horizont m it zahlreichen Holzkohlepartikeln (Abb. 150, Schicht 9). Darüber folgt ein ockerfarbener Hanglehm, in dem sich ein feines Kieselband, Schicht 8, mit prähistorischen Scherben abzeichnet. Eine innen verdickte Randscherbe lässt sich in die späte M ittelbronzezeit datieren.
A uf dem nördlich angrenzenden Acker fand sich zudem das Bronzeringlein 1318.
278 Schucany u. M artin -K ilchner 1999.
Nationalstrasse A l - Katalog ausgewählter Fundstellen 1 19
Jüngere Fundstellen am Tägerm oos
Gottlieben
Okmi iO.Skm
Abb. 151: G ottlieben . S ituation 1:10 000. 1 R h ein w eg ;2 m utm asslicher Fundort der L a n z en sp itz e ;2 Fundort des Schnurbechers.
Zurück in der Ebene des Tägermooses
Gottlieben: Rheinweg
Latènezeitliche SpurenM ünzfunde des 19. Jahrhunderts belegen eine Begehung
des Gebietes um Tägerwilen in spätkeltischer Z eit.271’ Bereits 1947 sind latènezeitliche Funde gem acht w orden.280 1999 kam am Rheinweg in Gottlieben eine weitere Fundstelle zum Vorschein (Abb. 151, 1). Sie liegt kaum 20 m vom Rheinufer entfernt au f einer Höhe von 398 m ü.M .
StratigraphieAn der Sohle der Baugrube findet sich eine graue, sandige
Seeablagerung (Abb. 152, Schicht 600). D arüber folgt Seekreide, Schicht 500, die partiell durch feine organische Schichten gebändert wird. Unm ittelbar über der Seekreide
liegen die Reste der eisenzeitlichen Kulturschicht 400. Diese zeigen sich als ockergrauer, sandiger Lehm, durchsetzt mit Holzkohle und Keram ikfragm enten. Über Schicht 400 liegt die ockerfarbene Lehm schicht 300, die ebenfalls etwas Keramik enthält.
Die eisenzeitlichen Fundef/OVn /j/C -H JP . /(M,. & 246-247)
Die Scherben aus G ottlieben sind kleinfragm entiert und teilweise stark verwittert. Das Fundmaterial ist zeitlich und von seiner M achart her ziem lich homogen.
Neben zahlreichen unverzierten, glim m erhaltigen Wandscherben findet sich im Material aus der Kulturschicht das Fragm ent 1320 eines feinkeram ischen Napfes m it einziehendem Rand. Feine Rillen au f der Innenseite weisen au f eine Bearbeitung mittels Drehscheibe hin. Die Oberfläche ist relativ porös.
Wichtig für die zeitliche Einordnung sind mehrere Randscherben des handgem achten grobkeram ischen Topfes 1319 mit einziehendem , leicht verdicktem Rand und um laufender Eindrucksverzierung im Halsbereich.
A uf seinem Rand und direkt darunter ist an einigen Stellen ein glänzender, schwarzer Überzug zu beobachten. Diese «Eichung», Anstrich m it Birkenpech, ist ein weit verbreitetes und schon länger bekanntes Phänomen, das regelm ässig au f spâtlatènezeitlicher Grobkeram ik erscheint28' und meist nur die Rand-Hals-Partie der Gefässe bedeckt. Sie wurde wohl als D ichtungsm ittel für die Keram ik verwendet.
M ehrere m it Eindrücken verzierte, grobkeram ische W andscherben und ein m it Fingertupfen verziertes Bodenstück dürften aufgrund ihrer M achart zu einem weiteren grobkeram ischen Gefäss gehören, 1321 und 1322.
Auch kam m strichverzierte Ware findet sich im Fundmaterial von Gottlieben. Beim Kamm strich werden mit einem m ehrzinkigen Gerät parallele Rillen in den weichen
2,9 Brem 1997, A nm . 17.a» JbS G U 39, 194 8 ,9 6 ; Thurg. B eiträge 1948 ,80 .
W ieland 1996, 155.
397.00 m ü . M .
'.ih h ~*~t7j
Schichten
Humus
0 Im
Abb. 152: G ottlieben: Rheinweg. S üdprofil M 1:50.
120 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Ton gezogen. Die drei W andscherben 1323-1325 und das Bodenstück 1322 sind so verziert.
Einzigartig ist das mit unregelm ässigen Grübchen verzierte W andfragment des feinkeram ischen Gefässes 1327. Es besitzt relativ eckige Einstiche, die ebenfalls von einem m ehrzinkigen Gerät stammen.
Zeitstellung der FundeDie wenigen aussagekräftigen Funde lassen sich ins
2. bzw. 1. Jh. v.Chr. datieren. Das Keram ikspektrum kann typologisch gut mit Inventuren benachbarter Fundstellen der Spâtlatènezeit aus Baden-W ürttem berg verglichen werden, z.B . Konstanz Brückengasse 5 -7 , welche aufgrund gut bestim m barer M etallfunde aus dieser Zeit stammen.
Die N eufunde vom Rheinweg belegen erstm als eine spätkeltische Siedlung in Gottlieben. Dafür spricht im Übrigen auch die geographische Lage der Fundstelle. Nur unweit von dieser kann seit jeher der Rhein leicht überquert werden, was für Siedler in keltischer Zeit von grosser B edeutung war.
Nahe der Fundstelle am Rheinweg wurde in den Achtzigerjahren ein Becher der Schnurkeram ik gefunden282, der au f eine neolithische Siedlung weisen könnte (Abb. 151, 3; Abb. 23).
Im H eim atm useum Rosenegg in Kreuzlingen wird die eisenzeitliche Lanzenspitze 1329 aufbewahrt, welche der Taglöhner Emil Egloff aus Tägerw ilen 1947 in der Nähe der Fundstelle am Rheinweg fand. Die stark korrodierte Spitze m it gut ausgebildetem M ittelgrat und Tülle ist knapp 19 cm lang und wiegt 80 g. Die noch erhaltene Flügelbreite misst 2,6 cm. M öglicherweise stammt diese Waffe aus einem Grab, gehören doch latènezeitliche Spitzen dieses Typs nicht selten zu den Beigaben in M ännergräbern. Im Gegensatz zu den Schwertern sind Lanzenspitzen ohne Begleitfunde zeitlich nicht näher einzuordnen.
Abb. 153: A ntonin ian des A urelianus, unbest. M ünzstä tte , 2 7 0 -2 7 5 n .C hr. Rs unleserlich . 1999 .019 .5 .1 : A es des C onstan tin 1, Trier, 316 n .C hr. Typ: Soli Invicto C orniti, T/F, T/R 1999 .019 .6 .1 : A es des C onstan tins II, unbest. M ünzstä tte , 3 5 0 -3 6 0 n .C hr. Typ: Fel Tem p R eparatio (R eitersturz) 1999.019.7 .1 .
Tägerwilen: Ziegelhof
Römische Funde vom Rheinufer (Abb. 30, 21)Am Ufer der kleinen Bucht am Rhein beim Z iegelhof
entdeckte Herbert Böhler, Tägerwilen, in den letzten Jahren w iederholt röm ische Funde, darunter eine Bernsteinperle und drei röm ische M ünzen: ein Antoninian des Aurelianus und je ein Aes des Constantin I und des Constantius II. Diese drei Münzen datieren in die 2. Hälfte des 3. und ins 4. Jh.; eine vierte, ein Aes des 1. Jhs. n. Chr., stammt verm utlich von derg le ichen Fundstelle (Abb. 153).
Die geschützte Lage der Bucht könnte au f eine zweite, bis anhin unbekannte Schiffanlegestelle nahe des römischen Konstanz hindeuten. Bekannt ist eine andere, östlich der Stadt gelegene, welche im 3. Jh. n.Chr. für die römische Bodenseeschifffahrt von grosser W ichtigkeit war.283
Hier nicht abgebildet, der Vollständigkeit halber aber zu erwähnen sind prähistorische Abschläge aus Silex, die beim Z iegelhof in U fernähe aufgelesen wurden.
Tägerwilen: Grabfunde
Rüllensträsschen/Bahnlinie SBBln der Zeit des Eisenbahnbaus von Schaffhausen nach
Konstanz in den 1870er-Jahren wurden in Erm atingen und Tägerwilen frühm ittelalterliche Gräber entdeckt.
W ährend die Lage des 1874 beim Bahnhof Erm atingen untersuchten G räberfeldes284 gut bekannt ist, sind die Fundmeldungen aus Tägerwilen verschwom m en und lückenhaft. In der L iteratur erfahren w ir von diesen Funden erstmals durch Jakob Heierli, der den Fundort in der «archäologischen Karte des Kts. Thurgau» grob einzeichnete und ohne Angabe des Fundjahres schrieb: «Beim Eisenbahnbau stiess man a u f Alamannengräber. Funde: 4 Spathen, 4 Skramasaxe, das Stück eines eisernen Gürtelbeschlages m it B ronzeknopf Eisenbeschläge .,.» .285
Leider sind heute nicht m ehr alle Objekte erhalten. Im Depot des Amtes für Archäologie lagern fünf Skramasaxe
282 W iniger u. H asenfratz 1985, 172, Abb. 30.283 M aurer 1996, 16.284 Ca. 60 G räber m it re ichen S chm uck- und W affenbeigaben. K eller u.
R einerth , 1925, 268.™ H eierli 1896, 156.
Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 121
und eine Spatha, die 1875 beim Bau der Eisenbahnlinie gefunden worden sein sollen (Abb. 34). Durch einen Briefwechsel im Jahre 1924 zwischen Lehrer Schönholzer aus Tägerwilen und dem kantonalen Konservator Karl Kcller- Tarnuzzer erfahren w ir von dessen Bemühungen, Jahrzehnte nach der Entdeckung den genauen Fundort der G räber zu eruieren. N ach Schönholzer wurden die Gräber 1875 ca. 100-150 M eter «unterhalb» des Bahnüberganges vom Rüllensträsschen gefunden.
Als 1998 die Seetalstrasse hier neu gebaut wurde, gelang es uns trotz intensiver Überwachung der Arbeiten nicht, die alten Fundm eldungen zu ergänzen oder zu bestätigen. Nur die von Herbert Böhler au f seinem nahe gelegenen Acker aufgelesene B ernsteinperle286 m ag einen Hinweis au f die G rabfunde von 1875 geben (Abb. 154).
Nach der Zusam m ensetzung und Art der W affenbeigaben zu schliessen sind G räber am Rüllensträsschen innerhalb kurzer Zeit angelegt worden. Neben einem Langschwert oder Spatha fanden sich fünf einschneidige Schwerter, so genannte leichte Breitsaxe, eine Leitform des frühen 7. Jahrhunderts287, also der Zeit um 612 n.Chr., als Konstanz mit der Wahl von Johannes Bischofssitz w urde288.
Leberen-SchanzAus dem Briefwechsel von 1924 zwischen Lehrer Schön
holzer und Karl Keller-Tarnuzzer erfahren w ir erstm als von einem zweiten Gräberfeld. Über den Fundort w issen w ir wenig, die G rabbeigaben sind verschollen. Lehrer Schönholzer schrieb:
«Auch a u f der sog. Schanz einer kleinen Bodenerhebung am O steingang des Dorfes, direkt an der Landstrasse, sollen in den 70er-Jahren (Anm. Redaktion: 19. Jh.) solche Gräberfunde m it alten Waffen gem acht worden sein...».
Jahre später besichtigte Karl Keller-Tarnuzzer mit dem ortsansässigen lokalhistorisch interessierten Otto Egloff- Kym aus Tägerwilen die Schanz. Von ihm erfuhr Keller, dass 1898 beim Bau der W asserleitung längs des oberen Randes der Landstrasse Eisenobjekte gefunden worden seien, nur wenige M eter von den Grabfunden der 1870er-Jahre entfernt. Sein Vater habe im m er behauptet, dass hier ein Friedhof gelegen habe.289
Die angrenzenden Parzellen tragen die Flurnamen K irchacker und Le(e)bere. K irchacker erinnert an G ottesacker und vom Flurnam en Lebere oder Leberen wissen wir, dass er sich häufig im Bereich von frühm ittelalterlichen
, 0.03 0 01
- 0.76
0 30 cm
-----------------Schnittgrenze
Y///A Steine
I----
Haus Koch
V A Haus Herzog
l u
O-,
/
Abb. 154: T ägerw ilen: O bere D ritte Strasse. B ernste inperle , frühm itte la lterlich? S am m lung H. B öhler, T ägerw ilen .
A bb. 155: Tägerw ilen: Rüsel. G rab m it zw ei B estattungen. A nlässlich e iner zw eiten G rablegung w urden die Skelettreste e iner ä lteren zusam m engeschoben. F rühm ittelalter. D etail M 1:20; Ü bersich t M 1:300.
Gräberfeldern findet, so beispielsweise in Güttingen, W ängi- Obertuttwil und anderswo.290
Obwohl wir die Bauarbeiten am Trassee der M ittelthurgaubahn intensiv überwachten, fanden wir keine neuen Hinweise au f Grablegungen.
™ Jb S G U F 8 2 , 1999 ,318 . a? M arti 2000, 116.288 M aurer 1996a, 23.™ JbSG U 28, 1936, 80. A kten AATG.290 D rack 1977.
122 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
RüselstrasseAm 14. M ärz 1973 entdeckte ein Bauarbeiter an der
Rüselstrasse 4 in Tägerwilen Reste eines m enschlichen Skelettes. Der herbeigerufene Erkennungsdienst der Kantonspolizei Thurgau nahm den Tatbestand auf. Weder ihre Untersuchungen noch die Abklärungen beim Zivilstandsam t Tägerwilen ergaben Hinweise au f eine vermisste Person. So gelangten die Funde an das Thurgauische M useum, welches Titus Winkler, K reuzlingen, m it der U ntersuchung der Fundstelle beauftragte. Dieser legte die Reste von drei Körperbestattungen frei.
Grab 1 enthielt die sterblichen Überreste einer m it ca. 40 Jahren verstorbenen Person, verm utlich einer Frau.291 In Grab 2 lagen zwei Bestattete. Das Skelett eines M annes von 55 oder m ehr Jahren war bei der späteren Grablegung eines ca. 50- bis 60-jährigen M annes beiseite geschoben worden. Als einzige Beigabe fand sich das Fragment einer eisernen M esserklinge. Die Art der Grablegung mit Steineinbauten spricht für eine frühm ittelalterliche Datierung (Abb. 155).
Hinterland von Konstanz
Tägerwilen: Konstanzerstrasse
Ein Strassenkoffer aus dem Spätm ittelalter und der frühen Neuzeit
Am 1.9.1998 m eldete Urban Keller, IPG Keller AG, dass sich im Profil eines Leitungsgrabens an der Konstanzerstrasse ein alter Strassenkoffer abzeichne (Abb. 156,158). Unter grossem Zeitdruck dokum entierten w ir während der laufenden Bauarbeiten den Befund.
D er Strassenkoffer liess sich im Profil über eine Länge von 180 M etern verfolgen. Er verläuft ohne R ichtungsabweichung unterhalb der heutigen Strasse. Zwei quer zur Strasse abgetiefte Leitungsgräben erm öglichten es, den Querschnitt aufzunehm en, allerdings nicht über die gesamte Breite.
U nm ittelbar unter dem aktuellen Strassenkoffer fanden sich Reste eines älteren Koffers aus Kies mit Korngrössen bis 5 cm (Abb. 157, Schicht 2). M arm oriert glasierte Keram ikfragmente erm öglichten die Datierung ins 18. Jh. n.Chr. Die Kiesschicht w ar m it Tannenzweigen unterlegt. Tannenzweige wurden bis vor wenigen Jahrzehnten verwendet, um in nassem Gelände den B augrund zu stabilisieren.
0.5km:0km|
Abb. 156: T ägerw ilen: K onstanzerstrasse. S ituation 1:10000.
Unter Schicht 2 fand sich eine bis zu 30 cm mächtige, dunkelgraue Lehm schicht, Schicht 3, die abgesehen von wenigen Ziegelfragm enten nahezu fundleer war. Der wahrscheinlich von einer Überschwem m ung stammende Lehm deckt w iederum einen älteren Strassenkoffer zu. Dieser besteht aus der 10 bis 20 cm mächtigen Schicht 4 von Grobkies m it einer Korngrösse von 5 bis 15 cm. Feinere Fraktionen fehlen; der Koffer m acht einen stark ausgewaschenen Eindruck. Im Profil Hessen sich Karrenspuren erkennen.
Wir konnten die Oberfläche dieser alten Strasse partiell freilegen. Die Steine wirkten stellenweise wie poliert, was au f eine lange und starke Benutzung hinweist. M it Hilfe des M etalldetektors gelang es, m ehrere Kilogram m kleine Eisenreste zu bergen: Fragmente von Hufeisen, Huf- und Schuhnägel sowie Gussabfälle und Reste von Eisenschlacken, die zw ischen den Steinen verkeilt und eingetreten waren. Die Hufeisen verfügen über breite Ruten, wie sie vom Spätm ittelalter bis in die frühe Neuzeit gebräuchlich waren. Hochm ittelalterliche Objekte fanden sich keine.
Die Strasse zwischen Konstanz und G ottlieben/Täger- wilen ist au f Bildquellen ab dem Spätm ittelalter erkennbar, so in der Stumpfschen Chronik von 1548 und au f einem Stich M erians von 1639.
Tägerwilen: Zollbach
Wasser fü r KonstanzIm Februar 1998 verbreiterte man im Tägerm oos den
Zollbach. Dabei stiess man au f die alte, längst nicht m ehr funktionstüchtige W asserleitung nach Konstanz, deren V erlauf wir aus alten Plänen kennen (Abb. 40).
291 B runo K aufm ann, B ericht vom 16. M ai 1980 im A rchiv AATG.
Schichten
AushubLeitungsgraben
, +727-909.20
280-222,00
o Abb. 157: T ägerw ilen: K onstanzerstrasse. L™ Q uerschn itt durch den Strassenkoffer. M 1:50.
Nationalstrasse A 7 - Katalog ausgewählter Fundstellen 123
Abb. 159: Tägerw ilen: T ägerm oos. F reilegungsarbeiten an der Teuchel leitung am Zollbach.
A bb. 158: T ägerw ilen: K onstanzerstrasse. Q uerschn itt durch den Stras- senkoffer. D ie g robe R ollierung des ä lteren K offers lieg t d irekt a u f der Seekreide.
Für die Versorgung von Konstanz w urde oberflächennahes W asser gefasst und dieses über offene oder m it Steinen gefüllte Gräben zur Brunnenstube geleitet, von wo es dann durch ein Eisenrohr in die hölzerne Teuchelleitung eingespeist wurde. Die Gräben und allenfalls auch die Teuchelleitung waren mit Sandsteinplatten abgedeckt und mit Lehm dichtungen versehen «dam it das wasser keinen abgang uberkommen mög» ,292
Archivquellen schildern den Bau der Brunnenstuben recht genau. Vor allem der Plan der «wasserstub by der pfarrers w aid»293 liefert wertvolle Informationen. Der M assstab der Planzeichnung lässt sich au f ca. 1:170 schätzen, wenn ein W erkschuh «sch» = 27,8 cm 294 beträgt.
Von zwei Brunnstuben, Pfarrersweid und Untere Rülle, führten Leitungen über zehn respektive sieben Leitungsabschnitte, «plätze» genannt, zum so genannten Schorplatz. Die «plätze», an denen wahrscheinlich die Richtung änderte, waren mit Pfählen m arkiert, um die Leitung jederzeit wieder finden zu können. Beim Schorplatz wurden die beiden Leitungen zu einer Teuchelleitung zusam m engefasst, die über nur zw ölf «plätze» durchs Tägerm oos zum G eltingertor führte, was au f einen ziemlich geraden Verlauf deutet.
Es ist glücklichen Umständen zu verdanken, dass die Leitung überhaupt lokalisiert werden konnte, da sie zahlreiche neuzeitliche Eingriffe und die laufenden Bauarbeiten
nahe der Böschungskante des Zollbaches längst stark beschädigt hatten.
Die Leitung verläuft von Südwest nach Nordost, ca. 10 m südlich versetzt zur aus den Plänen anzunehm enden Lage. Beim Bau ging man m it grösster Sorgfalt vor, eine Baugrube zeichnet sich im blau-grauen Seeton unm ittelbar unter dem heutigen Humus näm lich nicht ab. Die Leitung besteht aus tannenen Teucheln, die mit querliegenden Kanthölzern unterlegt und m it E isenringen m iteinander verbunden sind. Nach den Verbindungsringen dürfte das von uns dokum entierte
292 B runnenbuch 1536, fol. 4 (zur R ickenbacher Leitung), fol. 136 zur P farrersw eid; H echt 1938.
2,3 B runnenbuch 1536, fol. 136.294 D orbas 1991, 120.
7'rompvterschlössl
A bb. 160: T ägerw ilen: T ägerm oos. Situation 1:10000. 1 W asserleitung; 2L ehm entnahm e- und A bfallgruben.
124 Nationalstrasse A7 - Katalog ausgewählter Fundstellen
Abb. 161: Tägerw ilen: T ägerm oos. B eim A bhum usieren des S trassentras- sees en tdeck te A bfallg ruben . Ä hnliche G ruben dürften in g rosser Zahl im ganzen T ägerm oos zu finden sein.
Teuchelstück aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammen und wäre dem nach als Neuanlage oder Reparatur eines spätm ittelalterlichen Vorgängers anzusprechen.
Tägerwilen: Lehmgruben im Tägermoos
Zur Abfallentsorgung der Stadt Konstanz im Spätm ittelalter und der Frühen Neuzeit (vgl. S. 42-49)
Am Zollweg konnten im Februar 1998 m indestens acht neuzeitliche Gruben dokum entiert werden (Abb. 160, 161).
Vermutlich handelt es sich um ehem alige Lehm entnahm estellen, die ab dem 18./19. Jh. n.Chr. nicht mehr benutzt und in der Folge m it Abfall aufgefüllt worden sind. Die Stadt Konstanz deponierte seit der beginnenden Neuzeit ihren Abfall im Tägerm oos. Zudem befanden sich hier, z.B. im Töbeli bei Kreuzlingen, bis ins 19. Jh. n.Chr. die W asenplätze für Tierkadaver.
Die G ruben enthielten reichhaltiges Fundmaterial (Abb. 38). Teile der G rubeninhalte w urden später bei landwirtschaftlichen Arbeiten aufgepflügt und über weite Flächen verteilt. Daher finden sich im Tägerm oos überall Keramik- und Glasscherben, M ünzen sowie andere Kleinfunde.
Die meisten der an der Oberfläche aufgelesenen Funde datieren ins 19. und 20. Jh. Ä lter sind nur einzelne M ünzen aus dem 16., 17. und 18. Jh. Die G rubenfüllungen stammen grösstenteils aus dem 18., seltener aus dem 17. Jh. M ittelalterliche Funde sind selten.
Zur Bergung der G rubeninhalte stand nur wenig Zeit zur Verfügung. Wir beschränkten uns darauf, eine repräsentative Auswahl an Fundgut zu sammeln. Auch die Befunde w urden kursorisch erhoben. Es handelte sich um einfache, wenig tiefe Gruben. Wegen des hohen G rundwasserspiegels konnten nur die obersten Tonschichten ausgebeutet werden; sie bestanden aus einem eher hellen, kalkreichen sowie einem relativ fetten Ton von m ässiger Qualität, der zum Teil eine feine Bänderung m it seekreideartigen Einschlüssen aufwies. Unterhalb dieser Schicht fand sich der so genannte blaue Ton.
In den Profilen zeichneten sich Einschwem m schichten ab. Die W iederauffullung der Gruben musste dem nach über längere Zeit erfolgt sein.
125
Anhänge
N
r— r%T.
'-m j*
Abb. 162: T ägerw ilen: H ochstross. S ituation 1:200. S te ingerech ter Plan der S trukturen.
Katalog der Funde
Abkürzungen im Katalog
A A bstichLfm L aufm eterBdD m B odendurchm esserM ag. M agerungBdSt B odenstärkeBer BereichBS B odenscherbeF FeldFeinK er Feinkeram ikFragni. Fragm entFS Fundschicht
G rK er G robkeram ikKoll K olluviumkorr. korrodiertKS K ulturschichtLfm L aufm eterM ag. M agerungm ittelk. m itte lkörn igobB er o berer BereichOF1 O berfläche
O K O berkan te/oberkan tRS R andscherbeS SchnittSondS SondierschnittSlg. Sam m lungU K U nterkante / unterkantuntB er un terer BereichW S W andscherbe
020
126 Katalog der Funde
Tägerwilen: Unterführung ARA-Strasse. Abb. 163.
1 R ückenlam ellenfragm ., beim A ufprall zersplittert, w eissl. Silex.1998.025.119.1. F 2, m 2 296.50/499.00. S 200/300. I .A . UK FS.
2 R ückenlam clle. w eissl. Silex.1998.025.120.1. F 2, m 2 298 .00 /499 .50 . S 200/300, I .A . UK FS.
3 R ückenlam clle, g rü n er Silex.1998.025.121.2. F 2, n v 305/500, U K KS. U K FS.
4 R ückenlam clle, weissl. Silex.1998.025.170.1, F 2. m 2 295.50/501.50 , S 200/300. I .A . UK FS.
5 R ückenlam elle, Silex, sekundär hitzeversehrt.1998.025.117.1, F 2. m 2 298.55 /500 .98 . S 200/300. I .A .
6 A bspliss, retuschiert, g rüner Silex.1998.025.167.1, F 2, m 2 298.45 /501 .02 , S 200/300, I .A .
7 K erbrest, ockerfarbener Silex.1997.008.102.1, Streufund.
8 K erbrest, ockerfarbener H ornstein.1999.054.4.1, F 3, m 2 495 .28 /296 .26 , S 200/300, 1. A.
9 K erbrest, Silex, sekundär h itzeversehrt.1999.054.27.1, F 3, n r 495 .38 /296 .77 . S 200/300, I . A.
10 S tichel, ockerfarbener Silex.1999.054.80.1, F 3. m 2 496 .79 /294 .60 , S 200/300, I .A .
11 A usgesplittcrtes Stück, Silex.1999.054.118.12, F 3. m 2 495 /295 , S 200/300, 1. A.
12 Lam elle, R adiolarit.1998 .0 2 5 .1 1 4 .1 ,F 2 , m 2 3 0 6 /5 0 1. l .A U K .
13 Lam elle, verrundet, Radiolarit.1998 .0 2 5 .1 1 2 .1 ,F 2 , m 2 296.31/501.48 , S 200/300, I .A .
14 Lam elle, K ieselkalk.1998.025.115.1, F 2, m 2 298.40/501.60 , S 200/300, I .A .
15 K linge. Silex, hitzeversehrt.199 8 .0 2 5 .1 1 6 .1 ,F 2 , m 2 298.70/500.60 , S 200/300, I .A .
16 K linge, ge lber H ornstein. A us KS im Profil der B augrube.1999.001.2.3, S treufund, Slg. König.
Katalog der Funde127
Abb. 163: Tägerw ilen: A R A -Strasse. S ilices M 1:1. M esolith ikum 1-13 ; M esolith ikum , N eolith ikum oder B ronzezeit 14 16.
128 Katalog der Funde
Tägerwilen: Unterführung ARA-Strasse. Abb. 164.
17 Pfeilsp itze, Silex, aus K ortexabschlag gefertig t. 40 D ickcnbännli-B ohrer, H albfabrikat, w eisser Silex.1999.054.24.1, F 3. i r r 497.94 /296 .46 , S 200/300, I .A . 1998.025.95.1. F 2. rr r 296.50 /501 .50 , S 200/300, I .A .
18 Pfeilsp itze, R adiolarit.1998 .025 .88 .1 , F 2. n r 296 .48 /501 .28 , S 200 /300, I . A.
19 P feilsp itze m it A ufprallbeschäd igung , ockerfarbener Silex.1999.054.29.1, F 3. i r r 496 .63 /297 .20 , S 200/300, 1. A.
20 P feilsp itzenfragm ., B ergkristall. U K FS.1998.025.90.1, F 2. n r 292.50/501.50 , S 200/300, I .A .
21 B eilfragm ., Typ G lis-W eisw eil, Silex, sekundär hitzeversehrt.1998.025.83.1, F 2. n r 299.05/499.72, S 200/300, I .A .
22 D ickenbännli-B ohrer, ge lber H ornstein , leicht verrundet.1998.025.84.1, F 2. n r 298 .40 /501 .88 , S 200 /300, 1. A.
23 D ickenbännli-B ohrer, Silex, hitzeversehrt.1998.025.85.1, F 2, m 2 295.05 /501 .40 , S 200/300. I .A .
24 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.86.1, F 2, m 2 298.26 /501 .03 , S 200/300, I .A .
25 D ickenbännli-B ohrer, rötl. Silex, leicht verrundet.1998.025.89.1, F 2. m 2 297.38 /499 .52 , S 200 /300 , I .A .
26 D ickenbännli-B ohrer, rötl. Silex, leich t verrundet.1998.025.94.1, F 2, n r 297.50 /499 .50 , S 200/300, I .A .
27 D ickenbännli-B ohrer, Silex, hitzeversehrt.1998.025.91.1, F 2. n r 299.20 /499 .75 , S 200/300. I .A .
28 D ickenbännli-B ohrer, ge lber Silex.1998.025.97.1, F 2. m 2 296 .70/501.32, S 200/300, I .A .
29 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.19 9 8 .0 2 5 .9 8 .1, F 2, m 2 298 .65 /500 .75 , S 200 /300 , 1. A.
30 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.99.1, F 2, m 2 298.50 /500 .50 , S 200/300, I .A .
31 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.100.1, F 2, m 2 296.90 /499 .90 , S 200/300, I .A .
32 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.101.1, F 2, m 2 298.67/500.53 , S 200/300, I .A .
33 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.102.1, F 2, m 2 296.41/500.74 , S 200/300. I .A .
34 D ickenbännli-B ohrer, g rauer Silex.1998 .025 .104.1 , F 2. m 2 298.42 /500 .85 , S 200 /300. I . A.
35 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.106.12, F 2, m 2 296/500, S 200/300, I .A .
36 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.106.11, F 2, m 2 296/500, S 200/300, 1. A.
37 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.177.1, F 2, m 2 299.80/501.95 , S 200/300, I .A .
38 D ickenbännli-B ohrer, ockerfarbener Silex.1999 .054 .118 .11, F 3, m 2 495 /295 , S 200/300, 1. A.
39 D ickenbännli-B ohrer, w eisser Silex.1998.025.108.1, F 2, m 2 298.50/500.50, S 200/300, 1. A
Katalog der Funde
20
— -
0 > 22 Û 23 ö 24 O 25 26
1 '
O 28 C ) 29 ^ 30 £2) 31 Q 32 A
/ l
C D 34 35 C C 36 Û 37 Q 38 0 39
Abb. 164: T ägerw ilen: A R A -Strasse. S ilices M 1:1. N eo lith ikum 17 -40 .
130 Katalog der Funde
Tägerwilen: Unterführung ARA-Strasse. Abb. 165.
41 Steinbeil, G rüngestein , partiell R este der Pickung, Schneide über
schliffen.1999.001.2.1. Streufund, Slg. König.
42 Steinbeil, G rüngestein . N acken gepickt, Schneide geschliffen.1999.001.2.2. S treufund, Slg. König.
43 S teinbeil, G rüngestein , im N ackenbereich geringe R este der P ickung, vo llständig überschliffen .1998.025.279.9, Streufund.
44 S teinbeilfragm ., G rüngestein , im Bereich des N ackens gepickt,
partiell überschliffen .1998.025.123.1, F 2, m 2 S 200/300. I .A .
45 L ochax tffagm ., G rüngestein , vollständig überschliffen , sekundäre V erw endung als Schlagstcin , S chlagspuren an der B ruchstelle .1998 .025 .122 .1 . F 2. m 2 298 .50 /500 .04 , S 200/300, I .A .
Katalog der Funde
A bb. 165: T ägerw ilen: A R A -Strasse. Steinbeile M 1:2. N eo lith ikum 4 1 -4 5 .
132 Kakilog der Funde
Tägerwilen: Unterführung ARA-Strasse. Abb. 166.
46 W S. K ugelbcchcr, FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. fein. OF1 ge glättet. verw ittert. E instichreihe, e ingestochen m it G elenkcnde von K lein tierknochen, R este von R itzverzierung.1998.025.7.1, F 2, m 2 297/501, S 200/300. I .A .
47 W S. K ugelbecher, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert, E instichreihe, e ingestochen m it G elenkenden von K lein tierknochen (V ogelknochen?).1998.025.8.3. F 2. m 2 298/500, S 200/300. I .A .
48 W S, K ugelbecher. FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. m ittelk ., OFIgeglättet, E instichreihe, e ingestochen m it sp itzem Instrum ent.1998 .025 .21. 1, F 2, m : 295/499, S 200/300. I .A .
49 W S, K ugelbecher. FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein, OFI verw ittert,E instichreihe.1998.025.32.5. F 2. m 2 295 /500. S 200/300, 1. A.
50 W S, K ugelbechcrfragm .. FeinKer, ockerfarben , M ag. fein, OFIverw ittert. R este e iner E instichverzierung.1999 .054 .26 .1 , F 3. m 2 495 /296, S 200 /300 , I .A .
51 W S, K ugelbechcrfragm ., FeinKer, ockerfarben, im B ruch grau, M ag.fein, verw ittert, R este e iner E instichverzierung.1999 .054 .81.5. F 3. m 2 495 /294, S 200/300, I . A.
52 W S. Ö senfragm ., FeinKer. ockerfarben. M ag. fein, feinverstricheneOFI. verw ittert.1999.054.40.89. F 3 . m 2 496 /295 , S 200/300. I . A.
53 W S, Ö se, FeinKer. rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., fein verstrichene OFI,sehr regelm ässig und fein gearbeitet.1999.054.25.1, F 3. m 2 495.31 /296 .43 , S 200/300. I .A .
54 RS, Topf, FeinKer, g rau . M ag. m itte lk ., geglättet.1998.025.5.1, F 2. r r f 301/501, S 200/300. I .A .
55 RS, FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. fein, verw ittert1998.025.12.1, F 2. m 2 299/500, S 200/300. 1. A.
56 RS, GrKer, ockerfarben-grau . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1998.025.43.1, F 2, m 2 304/501, S 200/300. I .A .
57 RS, Topf, G rKer. rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert.1998.025.35.2, F 2. rr f 295/501, S 200/300, I .A .
58 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob.1998.025.2.9, F 2, n f 298 /501, S 200 /300 , I .A .
59 RS, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein.1 998 .025 .35 .1, F 2, m 2 295/501, S 200/300, I .A .
60 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, sehr unregelm ässig.1999.054.77.2, Streufund.
61 RS. G rK er, rötl., M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert.1999.054.68.3, F 3. m 2 496 /294 . S 200 /300, I . A.
65 H enkel, G rKer, grau . M ag. m ittelk .. verstrichen, verw ittert.1998 .025 .4 .1 1 .F 2 . n f 2 9 6 /5 0 1, S 200/300. I .A .
66 H cnkelfragm ., G rK er, g rau , M ag. m ittelk .. verstrichen, verw ittert.1998.025.54.1, F 2. n f 300/501. S 200/300. I .A .
67 H enkel, G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen, verw ittert.1999.054.39.11, F 3, n f 496 /295 , S 200 /300 . 1. A.
68 BS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1999.054.71.2, F 3. n f 497 /294 , S 200 /300, I .A .
69 BS, FeinKer. rö tl.-braun, M ag. fein.1998.025.34.2, F 2, n f 2 9 5 /5 0 1, S 200/300, 1. A.
70 BS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert. 1998.025.38.10, F 2. n f 297/500, S 200/300, I .A .
71 BS. G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1998.025.32.6, F 2. n f 295 /500 , S 200 /300. I .A .
72 BS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1998.025.17.2, F 2, n f 303/500, S 200/300, 1. A.
73 W S, K nickw andschale m it G rifflappen, FeinKer, dunkelg rau . Mag. fein.199 8 .0 2 5 .1 8 .1 .F 2 , Streufund.
74 RS, K nickw andschale m it G rifflappen, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, geglättet, verw ittert.1998.025.40.26, F 2, n f 297/501, S 200 /300 , I .A .
75 RS, K nickw andschale m it G rifflappen, rö tl.-braun. M ag. grob.1999.054.12.2, F 3. n f 497 /296 , S 200/300. I .A .
76 RS. K nickw andschale. FeinKer. ockerfarben-grau . M ag. m ittelk .1998.025.4 .1 , F 2, n f 296/501. S 200/300. 1. A.
62 RS, G rKer, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1998 .025.38.1 , F 2. n f 297/500, S 200/300, 1. A.
63 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1998.025.32.4, F 2, n f 295/500, S 200/300, 1. A.
64 RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert.1998.025.32.1, F 2. n f 295/500, S 200/300, 1. A.
Katalog der Funde 133
Abb. 166: T ägerw ilcn. A R A -S trasse . K eram ik M 1:3. N eolith ikum 4 6 -5 3 ; N eolith ikum oder späte F rüh b ro n zeze it/frü h e M itte ib ronzezeit 5 4 -7 2 ; spate
F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 7 3 -7 6 .
134 Katalog der Funde
Tägerwilen: Unterführung ARA-Strasse. Abb. 167.
77 W S. K rug, FeinKer, braun-grau . M ag. m ittelk .. OFI geglättet, Sanduhr-M uster, Rillen.1998.025.9.2, F 2, n r 296/500, S 200/300, 1. A.
78 W S, FeinKer. g rau . M ag. g rob, stark verw ittert, Punktdreiecke.1998.025.43.2, F 2. m : 304 /501 , S 200/300, I .A .
79 W S, FeinKer, g rau . M ag. m ittelk .. R illen und Strichverzierung.1998.025.73.2, F 2. 305 /500 , S 200/300, 1. A.
80 W S, FeinKer, g rau . M ag. m ittelk .. R illen.1998.025.73.1, F 2, m 2 305/500. S 200/300, I .A .
81 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., E instichreihe, R illen.1999.054.71.1, F 3, rr r 497 /294 , S 200/300, I .A .
82 W S, FeinKer, grau, M ag. fein, Punktverzierungen.1998.025.53.1, F 2, m 2 496/295, S 200/300, 1. A.
83 BS, FeinKer, grau. M ag. grob, stark verw ittert, R este von Strichverzierung, W inkelband und Sanduhr-M uster, K erben.1998.025.32.27, F 2, m 2 295/500, S 200/300, I .A .
84 RS, rö tl.-braun. M ag. grob, un terer Teil der W andung geschlickt, A nsatz eines Flenkels oder G rifflappens.1999.054.43.1, F 3, m 2 495 /295 , S 200/300, I .A .
85 RS, GrKer, g rau-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert.1998.025.17.1, F 2, m 2 303/500, S 200/300, I .A .
86 RS, FeinKer, rö tl.-braun, M ag. grob.1998.025.12.2, F 2, m 2 299/500. S 200 /300 , I .A .
87 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1998.025.26.1. F 2, m 2 295/502. 3 .A.
88 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1998.025.39.1. F 2. m 2 294/501, S 200/300, I .A .
89 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1999.054.18.4. F 3, m 2 495 /296 , S 200/300. 1. A.
90 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1999.054.55.7. F 3, m 2 497 /295 , S 200/300, 1. A.
91 RS, GrKer, rötl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1998.025.32.3, F 2. m 2 295/500. S 200/300, I .A .
92 RS, GrKer. g rau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1998.025.39.2. F 2, m 2 294/501. S 200/300. I .A .
93 RS, Topf, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.025.42.1, F 2. m 2 293/500, S 200/300, I .A .
94 RS, Topf, GrKer, sehr hart, rötl.. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfcnlciste unterhalb Rand.1998.025.6.1, F 2, m 2 297/499, S 200/300, I .A .
95 RS, G rK er, g rau . M ag. grob , verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste unterhalb Rand, R anddurchm esser g rö sse r 50 cm.1999 .054 .51.1, F 3. m 2 495 /295, S 200/300, I .A .
96 RS. GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1999 .054 .7 .1, F 3, m 2 496 /296 . S 200/300, I . A.
97 RS, G rK er, rö tl.-braun, verstrichen, verw ittert, F ingertupfcnlcisteunterhalb Rand, im R andbereich grob geglättet.1999.054.41.2, F 3, m 2 497 /295, S 200/300, I .A .
98 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1999.054.77.4, Streufund.
99 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verstrichen, verw ittert,F ingertupfen a u f Rand.1998.025.33.1, F 2, m 2 302/502, S 200/300, I .A .
100 RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1998.025.55.6, F 2, m 2 299 /499. S 200 /300 , 1. A.
101 RS, G rK er, braun-grau , M ag. grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1998.025.3.7, F 2, m 2 301/500, S 200/300, I .A .
102 RS, G rK er, rötl.. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen a u fRand, Fingertupfenreihe.1999.054.51.3, F 3, m 2 495 /295 , S 200 /300 , I .A .
103 RS, konische Schale, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, sehr grob gefertig t.1998.025.3.1, F 2, m 2 301 /500. S 200/300, I .A .
104 RS, K alo ttenschale, G rK er, grau, M ag. sehr g rob, geschlickt.1998.025.277.1, F 2, m 2 294/501, S 200/300, I .A .
Katalog der Funde 135
Abb. 167: T ägerw ilen: A R A -Strasse. K eram ik M 1:3. Späte F rüh b ro n zeze it/frü h e M itte lb ronzezeh 7 7 -1 0 4 .
136 Katalog der Funde
Tägerwilen: Unterführung ARA-Strasse. Abb. 168.
105 W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob, verstrichen, verw ittert, verzw eigte F ingertupfenleiste .1998.025.32.7, F 2. m 2 295/500, S 200/300. I .A .
106 W S, G rK er, grau. M ag. grob, F ingertupfenleiste a u f H alspartie.1999.054.60.1, F 3. in 2 495 /294, S 200/300, I .A .
107 W S, G rK er, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen, verw ittert. G rifflappen m it A nsätzen von m ehreren F ingertupfenleisten .1999 .054 .44 .1, F 3. i r r 496 /295, S 200/300, 1. A.
108 W S. G rK er. rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste , G rifflappen.1999.054.14.1, F 3. m 2 497/296. S 200/300, I .A .
109 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen, verw ittert, geschlickt, G rifflappen.1998.025.35.3, F 2. m 2 295/501. S 200/300. I .A .
110 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert. G rifflappen.1998.025.39.6. F 2. m 2 294/501, S 200/300. I .A .
1 11 W S, G rK er, rö tl.-braun, verstrichen, verw ittert, geschlick t, G rifflappen.1998.025.39.51. F 2, n r 294/501, S 200/300. I .A .
112 W S. GrKer, rötl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert, G rifflappen m it A nsatz e iner Fingertupfenleiste.1998.025.1.5, F 2, S treufund.
113 W S, M iniaturgefass? , G rK er, ockerfarben . M ag. grob, verstrichen, verw ittert, A nsatz e iner F ingertupfenleiste? , abgep latz ter G rifflappen.1999.054.55.3, F 3. n r 497/295, S 200/300. 1. A.
I 14 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verstrichen, verw ittert, Reihen m it F ingernagel-Z w icken.1998.025.1.8, F 2, Streufund.
115 W S, G rKer, rötl., M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste .1998.025.10.3, F 2. n r 296/499, S 200/300. I .A .
116 W S. G rK er, rötl., M ag. grob, verstrichen, verw ittert, schm ale Kerben a u f der Leiste.1999.054.45.1, F 3, n r 496 /295 , S 200/300, I .A .
117 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert, geschlickt, F ingertupfenleiste.1999.054.124.4. Streufund.
118 W S, G rK er, rö tl.-braun verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste .1999.054.59.2, F 3. m 2 495 /294 . S 200 /300 , I . A.
119 W S, GrKer. ockerfarben, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1999.054.20.1, F 3. m 2 496/296, S 200/300. 1. A.
120 W S, GrKer, rötl.. M ag. g rob , F ingertupfenleiste , verstrichen, verw ittert.1998.025.19.9, F 2. m 2 294/500, S 200/300. 1. A.
122 W S. G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste .1998.025.14.1, F 2, m 2 294/499. S 200/300, I .A .
123 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. seh r grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfenleiste .1998.025.66.1, F 2, m 2 295/501. S 200/300, I .A .
124 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1998.025.279.4, Streu fund.
125 W S, G rK er, rö tl.-b raun , M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingernagelkerben.1998.025.8.4. F 2. m 2 298/500. S 200/300, I . A.
126 W S, G rK er, rötl.-grau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert, g latte Leiste.1999.054.46.9, F 3. m 2 496 /295 , S 200/300, 1. A.
127 W S. G rK er, ockerfarben. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, g latte Leiste.1999.054.51.7, F 3, m 2 495 /295 . S 200/300, 1. A.
128 Pfeileisen oder A rm brustbo lzen , 14./15. Jh.1999.001.2.11, Streufund. Slg. König.
121 W S. GrKer. rötl.. M ag. grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfenleiste.1999.054.53.13, F 3. m 2 496 /295, S 200 /300 . I .A .
Katalog der Funde137
105
Abb. 168: T ägerw ilen: A R A -Strasse. M etall M 1:2; K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lb ronzezeit 10 5 -1 2 4 , 126. 127; B ronzezeit? 125;
M itte lalter 128.
138 Katalog der Funde
Tägerwilen: Oberes Tägermoos und Ruet. Abb. 169.
129 Bohrer, Silex.Inv. Nr. 9108, O Flnfund a u f A cker, Slg. Beck.
130 Pfeilsp itze, Silex.1997.008.96.1. O Flnfund a u f Acker.
131 A bschlag , retuschiert.1997.008.96.2, O Flnfund a u f Acker.
132 R öhrenperle, K alkstein.1997.008.096.3, O Flnfund a u f Acker.
133 GrKer, G rifflappen m it A nsatz e iner Fingertupfenleiste .1998.008.027.25.1, SondS 10.
Katalog der Funde
Abb. 169: Tägerw ilen: O b eresT äg erm o o s und Ruet. S ilices und Perle M 1:1; K eram ik M 1:3. N eolith ikum 129; Prähistorisch 1 3 0 -1 3 2 ; B ronzezeit 133.
140 Katalog der Funde
Tägerwilen: Gottlieberwise. Abb. 170.
134 P feilspitze m it leicht e inz iehender Basis, dorsal flächcnrctuschiert, Silex.1999 .053 .1.69, Streu fund. Slg. König.
135 K linge, Spitze?, re tuschiert, Silex.1999 .053 .1.28. Streu fund. Slg. König.
136 A bschlag , re tusch iert, Silex.1999.053.1.71, Streufund, Slg. König.
137 K ratzer an A bschlag , Silex.1999.053.1.37, Streufund, Slg. König.
138 K linge, S icheleinsatz? , re tuschiert, Silex.1999.053.1.30, Streufund, Slg. König.
139 K linge, S tichel?, re tuschiert, Silex.1999.053.1.33, Streufund, Slg. König.
Katalog der Funde 141
Abb. 170: T ägerw ilen: G ottlieberw ise. Silices M 1:1. Jungneo lith ikum 134-139 .
142 Kakilog der Funde
Tägerwilen: Gottlieberwise. Abb. 171.
140 Steinbeil. G rüngestein , stark verw ittert, e rhaltene Fläche üb ersch ü tten , 14 g.1999.053.1.60, Streufund, Slg. König.
141 M esser oder k le ines S teinbeil, G rüngestein , ü b e rschü tten . 7 g. 1999.053.1.63, Streufund. Slg. König.
142 Steinbeil, G rüngestein , a llseitig überschliffen m it Resten der P ickung , zahlre iche R ostspuren , 414 g.1999.053.1.9, Streufund, Slg. König.
143 Steinbeil, G rüngestein , N acken gepickt, R ostspuren , 244 g.1999.053.1.6. Streufund, Slg. König.
Katalog der Funde 143
Abb. 171: Tägerw ilen: G ottlieberw ise. S teinbeile M 1:2. E ndneolith ikum . Schnurkeram ik, 140; Jungneo lith ikum 141 143.
144 Katalog der Funde
Tägerwilen: Gottlieberwise. Abb. 172.
144 Steinbeil, G rüngestein , teilw eise überschliffen , R este der Pickung sichtbar, 282 g.1999.056.1.6, S treu fu n d Slg. König.
145 L ochaxt, G rüngestein , w alzenförm iger b is leicht 4 -kan tiger Q uerschnitt, a llseitig überschliffen , partiell Spuren der P ickung, 224 g.1999.041.1.2, S treu fu n d Slg. Ch. M athis.
146 S teinbeil, G rüngestein . 4 -kan tiger Q uerschn itt, allseitig überschliffen , 208 g.1999.041.1.1. S treu fu n d Slg. Ch. M athis.
147 Steinbeil, G rüngestein , vo lls tänd ig überschliffen , Seiten gepickt, R ostspuren. 50 g.1999.053.1.61, S treu fu n d Slg. König.
148 D olch, pressigny-ähn lichcr Silex, stark verw ittert.1999.053.1.27. S treu fu n d Slg. König.
Katalog der Funde 145
Abb. 172: T ägerw ilen: G ottliebcrw ise. Silices M 1:1; Steinbeile M 1:2. Jungneolith ikum , P fyner K ultur? 144 und 145; Jungneolith ikum . H orgener Kultur, 146 und 147; Endneolith ikum , Schnurkeram ik , 148.
146 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Töbeli. Abb. 173.
149 M ikrolith . gelber Silex, leicht verrundet.1997.052.34.1. S 300, Streufund.
150 M ikrolithfragm .. gclbl. Silex.1 9 9 7 .0 5 2 .1 7 1 .1 .F 1 1 ,m 2 302.70/508.58 , S 300, I .A .
151 K crbrest, w eisser Silex.1997.052.81.1, F 11, m : 302.07/510.30. S 300. I .A .
152 K erbrest, w eissl. Silex.1997.052.402.1. F 11. m 2 301.29/514.24 , S 300. I .A .
153 K ratzer, gelber Silex, leicht verrundet.1997.052.232.1. F 11, m 2 304/514, S 200. I .A .
154 Pfeilspitze, w eisser Silex.1997.052.142.1, F 10, m 2 300.10/502.40 , S 300. I .A .
155 Pfeilsp itze, g rauer P lattensilex m it R esten von Kortex.1997.052.100.1, F 11, m 2 302.87/507.85 , S 300, I .A .
156 Pfeilsp itzenfragm ., e inseitig retuschiert.1997.052.110.1, F 11. m 2 300.00/511.35 . S 300, I .A .
157 P feilsp itzenfragm ., gelber, leicht durchscheinender Silex.1997.052.372.1. F 12, m 2 302.36/514.17 . S 300, I .A .
158 Pfeilspitze, gelber Silex.1997.052.80.1, F 11, m 2 303.60/508.31, S 300, I .A .
159 P feilspitze m it A ufprallbeschäd igung , gelber H ornstein.1997.052.4.9, F 10. m 2 300/504. S 200. I .A .
Katalog der Funde 147
Abb. 173: K reuzlingen: Töbeli. S ilices M 1:1. M esolith ikum 14 9 -1 5 3 ; N eolith ikum oder F rühbronzezeit 159 und 156; N eolith ikum 154 und 155, 157 und 158.
148 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Töbeli. Abb. 174.
160 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex. 182 Perle, B ernstein.1997.052.444.1. F 1 1. m : 302.94/513.40 . S 300, I .A . 1997.052.138.1, F 10, n v 300.14 /506 .37 , S 300, I .A .
161 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997.052.397.1. F 12, m 2 301.20 /515 .29 , S 300. I .A .
162 D ickenbännli-B ohrer, Fragni., c rem efarbener Silex.1997.052.388.1. F 11. m 2 301.91/512.94 , S 300. I .A .
163 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997.052.447.1. F 11. m 2 302/510, S 300, I .A .
164 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997.052.446.1. F 11, m 2 302/510. S 300. I .A .
165 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997.052.369.1. F 12, m 2 301.56/515.18 , S 300. I .A .
166 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997.052.374.1. F 12, m 2 302.37/514.27 , S 300. I .A .
167 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997.052.147.1. F 10, m 2 302 /504 , S 300, I .A .
168 D ickenbännli-B ohrer, Fragni., c rem efarbener Silex.1997.052.153.1. F 11, m 2 301/507. S 300. I .A .
169 D ickenbännli-B ohrer. crem efarbener Silex.1997.052.148.1. F 11, m 2 300.95/508.50 , S 300, I .A .
170 D ickenbännli-B ohrer, crem efarbener Silex.1997 .052 .222 .1 .F 10. m 2 301.21/500.95 , S 300, l.+ l .A .
171 A bspliss, re tuschiert, Silex, sekundär hitzeversehrt.1997.052.445.1. F 11, m 2 302.80/514.29 , S 300, I .A .
172 Lam elle, rosa Silex, h itzeversehrt?1997.052.383.1. F 11, m 2 302.90/513.23 , S 300, I .A .
173 L am elle, S tichel?, re tuschiert, crem efarbener Silex.1997.052.327.1. F 11, m 2 302.35/514.49 , S 300, L A
174 Lam elle, g rauer Silex.1997.052.152.1. F 10. m 2 302.97/504.41 , S 300, I .A .
175 Lam elle, g rauer Silex.1997.052.109.1. F 11, m 2 300.92/511.20 , S 300, I .A .
176 A bschlag m it A bnutzungspuren (vom Feuerschlagen?), w eisser Silex.1997.052.228.1. F 10, m 2 301/505, S 300, l.+ l .A .
177 Lam elle, Ö lquarzit.1997.052.418.1. F 12, m 2 300/519, S 310, Streufund.
178 A bschlag , re tuschiert, c rem efarbener Silex.1997.052.233.1. F 12. m 2 304/520, S 200?, I .A .
179 WS m it Ö se, neolith isch . FeinKer, rö tl.-grau . M ag. fein, verw ittert.1997.052.83.1. F 10, m 2 3 0 1.4 0 /5 0 4 .10, S 300 UK , L A .
180 RS. Topf, neolith isch . GrKcr, rö tl.-braun, M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.165.1. F 10. S 300/400, I .A .
181 N adelfragm .. Bronze.1997.052.32. l . F 10. m 2 302/505, S 300, 1. A.
Katalog der Funde 149
' I
Q 1 6 0 Q 161 1 6 2 ,____ ̂ 1 6 3 q 1 6 4 Û 1 6 5 ^ 1 6 6
1 6 7 Q 1 6 8
- &
> 1 6 9 1 7 0
171 1 7 2 1 7 3 1 7 4
1 7 5 1 7 6 1 7 7 1 7 8
O
rr®1 7 9 1 8 0 181
12) ^0 0 1 8 2
Abb. 174: K reuzlingen: Töbeli. Silices. M etall und B ernstein M 1:1; K eram ik M 1:3; N eolith ikum 160 -1 6 7 . 171 und 172, 179 und 180; evtl. M esolithikum173; N eolith ikum oder Frühbronzezeit 168 170; M esolith ikum , N eolith ikum oder Frühbronzezeit 17 4 -1 7 8 ; F rühbronzezeit 181 und 182.
150 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Töbeli. Abb. 175.
183 RS. K nickw andschale , schw arz-grau , M ag. m ittclk .. geglättet.1997.052.313.3, F 12, m : 301/520, S 300, I .A .
184 RS. Topf, FeinKer. m tl.. M ag. fein, verw ittert.1997.052.126.1, F I I . m : 301/507. S 300. I .A .
185 RS, Topf. FeinKer, g rau , M ag. fein, verw ittert.1997.052.169.1, F 10, m 2 300.23 /503 .70 , S 300, I .A .
186 RS, Topf.’, FeinKer, m tl.-g rau . M ag. fein, verw ittert.1997.052.144.1, F 10. m : 302/501, S 300. I .A .
187 RS. FeinKer. m tl.-b raun . M ag. m ittclk ., verw ittert.1997.052.348.1, F 12. m 2 300/519, S 300, I .A .
188 RS, Topf. FeinK er?, m tl.. M ag. m ittclk.1997.052.139.3, F 10. m 2 300/506. S 300. I .A .
189 RS. K nickw andschale? , FeinKer, m tl.. M ag. m ittclk .. verw ittert.1997.052.111.1, F 10. m 2 301/502, S 300, I .A .
190 RS, K nickw andschale?, FeinKer, m tl.. M ag. m ittelk .. verw ittert.1997 .052.249.1 , F 10, m 2 300/500, S 300, l.+ l .A .
191 W S, FeinKer. m tl.-b raun , verw ittert, R este von R itzverzierung.1997.052.353.2, F 11, m 2 302/514, S 300, I .A .
192 W S, FeinKer, m tl.-b raun . M ag. m itte lk ., verw ittert, Schrägstrichdreiecke.1997.052.46.2, F 10, m 2 300/505, S 300, I .A .
193 W S, Schultergefass m it A nsatz eines H enkels, FeinKer, g rau , M ag. fein, verw ittert.1997.052.22.1, F 11, m 2 303/508, S 300, I .A .
203 BS, FeinK er?, grau . M ag. grob, verw ittert, F ingernagelkerben.1997.052.42.2, F 10, m 2 302/500, S 300. l.+ l .A
204 RS, Topf, FeinKer, m tl.-b raun . M ag. m ittelk ., verw ittert.1997.052.11.1, F 10. m 2 303/503, S 300, I .A .
205 RS, Topf, GrKer, M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.411.1, F 12, m 2 300/520, S 300, I .A .
206 RS, Topf, FeinKer, m tl.. M ag. m ittelk ., verw ittert.1997.008.11.1, K analisa tionsgraben , S 300.
207 RS, Topf?, G rK er?, grau, M ag. m ittelk ., um laufende Rillen. R itzverzierung.1997 .052 .265 .1 ,F l l . m 2 300/512, S 300, 1. A.
208 RS. Topf.’. FeinKer, grau . M ag. m itte lk .. verw ittert.1997.052.1.2, F 10, m 2 305.00 /501 .60 , A btrag bis OK 300, I .A .
209 RS, Topf, FeinKer, m tl., M ag. m ittelk ., verw ittert.1997.052.441.2, Streufund.
210 RS, Topf, FeinKer, grau. M ag. grob, verw ittert.1997.052.199.2, F 11, m 2 301/510, S 300, I .A .
211 RS, Topf. FeinKer. m tl.-b raun . M ag. m ittelk ., verw ittert.1997.052.21.1, F 10, m 2 303/505, S 300, I .A .
2 12 RS, Topf, G rK er, m tl.-b raun , M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.052.90.1, F 10. n f 301/503, S 300, I .A .
213 RS, Topf, G rK er, grau. M ag. fein, verstrichen, verw ittert.1997.052.117.1, F 11. S 300, I .A .
194 W S, FeinKer, m tl., M ag. m itte lk ., verw ittert, S tem peleindrücke (m it N adelkop f ausgeführf?).1997.052.4.2, F 10, m 2 305/506, A btrag bis O K 300, I .A .
195 W S. FeinK er?, braun-grau , M ag. m ittelk ., flächendeckende Stem pel, m it rundem H ölzchen eingepresst.1997.052.199.3, F 11, m 2 301/510, S 300, I .A .
196 W S, FeinK er?, m tl.-braun. M ag. m ittelk ., flächendeckende E indrücke (m it N ad elk o p f ausgeführt?).1997.052.82.18, F 10. m 2 300/502, S 300, 1. A.
197 W S. FeinK er?, m tl.-g rau . M ag. grob, flächendeckende S tem pelverzierung.1997.052.89.8, F 10. m 2 301/501, S 300, I .A .
198 W S, H enkel, FeinKer, m tl.-b raun , M ag. m ittclk ., verw ittert.1997.052.353.7, F 11, m 2 302/514, S 300, I .A .
199 H enkel, FeinKer, grau. M ag. fein, verw ittert.1997.052.421.1, F l l . m 2 301/513, S 300. I .A .
200 BS, B echer («P yxis») m it S tandring , FeinKer, grau . M ag. fein, um laufendes B and m it E instichreihen , R illen, K reuzen und R hom ben.1997.052.349. l . F 12, m 2 302/519, S 300, I .A .
201 BS, m tl.-b raun . M ag. grob. Rest von Standring.1997.052.431.7, F 12, m 2 301/526, S 300, I .A .
202 BS. B echer («Pyxis»), FeinKer, ge lb-grau . M ag. fein, verw ittert. E instichreihe.1997.052.411.16, F 12, m 2 300/520. S 300, I .A .
152 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Töbeli. Abb. 176.
214 RS, Topf. GrKcr. rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert. 1997.008.15.50, K analisa tionsgraben . S 300.
215 RS. T o p f G rK cr. rötl., M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.124.1, F I I . n v 301/509, S 300. I .A .
216 RS. T o p f GrKer, gelb -grau , M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.427.1, F 10, m 2 299/506, S 300, l.+ l .A .
217 RS. T o p f GrKer. g rau . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1997.052.107.1, F 1 1. m 2 303.00 /511 .35 , S 300. I .A .
218 RS, Topf, GrKer. gelb -b raun , M ag. m ittelk ., verstrichen , verw ittert.1997.052.132.1, F 11, m 2 301/508, S 300, I .A .
219 RS. Topf, G rK er, g rau . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1997.052.309.1, F l f m 2 303/513, S 300. I .A .
220 RS. Topf. GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.313.2, F 12. m 2 301/520, S 300. I .A .
221 RS. Topf. G rK er. gelb -grau . M ag. grob , verstrichen, verw ittert.1997.052.29.1. F 10, m 2 303/504, S 300. 1. A.
222 RS. T o p f G rK er, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen , verw ittert.1998.049.3.2, Profil B augrube, S 300.
223 RS. T o p f G rK er, grau. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.1.1. F 10, m 2 305.00 /501 .60 , O K 300, I .A .
224 RS, Topf, G rK er, grau, M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.052.22.2, F 11. m 2 303/508, S 300, I .A .
225 RS, Topf, GrKer.1997.008.15.1. K analisa tionsgraben , S 300.
226 RS, Topf, GrKer. braun-grau . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1997.052.82.2. F 10, m 2 300/502, S 300, I .A .
227 RS. Topf, b raun-grau , M ag. grob.1997.052.45.1, F 10, m 2 300/506, S 300, I .A .
228 RS. Topf, GrKer. grau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.052.139.1, F 10. m 2 300/506, S 300, L A
229 RS, G rK er. rö tl.-braun, M ag. grob, verw ittert.1997.052.226.5, F 10. m 2 302/501. S 300. I .A .
230 RS, Topf. GrKer, grau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.008.12.1, K analisa tionsgraben. S 300.
231 RS, T o p f rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1997.052.120.2, F 10. m 2 303/506, S 300, I .A .
232 RS, Topf. GrKer. rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.052.46.1, F 10, m 2 300/505, S 300, I .A .
237 RS, Topf. GrKer, rö tl.. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert.1997.052.36.1, F 10, m 2 301/506, S 300, I .A .
238 RS, Topf. GrKer, g rau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfen a u f Rand. F ingertupfenleiste a u f Schulter.1997.052.36.4. F 10, m 2 301 /506 , S 300, I .A .
239 RS. Topf. rö tl.-grau . M ag. m ittelk .. F ingertupfen a u f R andum bruch.1997.052.82.1, F 10, m 2 300/502, S 300, I .A .
240 RS, Topf. G rK er. rö tl.-b raun . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert. F ingertupfen unterhalb Rand.1997.052.259.1, F l f m 2 302 /512. S 300, I .A .
241 RS, T o p f G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1997.008.12.25, K analisa tionsgraben . S 300.
242 RS, T o p f G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1997.052.36.5. F 10, m 2 301/506, S 300, I .A .
243 RS, Topf. G rK er, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1997.052.36.9, F 10, m 2 301/506, S 300. I .A .
244 RS, Topf, rö tl.-braun. M ag. grob, F ingertupfen a u f Rand.1997.052.13.1, F 10, m 2 302/503, S 300, I .A .
245 RS. T o p f G rKer, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen a u f R andum bruch.1997.052.215.9. F 10, m 2 300/505, S 300. l.+ l .A .
246 RS, Topf, G rKer, grau . M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.433.1. F 12, m 2 302/520, S 300, I .A .
247 RS. Topf, G rKer. gelb -g rau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1997.052.99.4. F 11. n f 300.00 /511 .35 , S 300. I .A .
248 RS, Topf, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1998.049.5.1. Profil B augrube, S 300.
249 RS, T o p f G rK er, rötl.-braun, M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfcnleiste unterhalb Rand.1997.052.42.1. F 10. m 2 302/500, S 300, l . + l .A .
250 RS, Topf. G rK er, ge lb-grau . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert. F ingertupfcnleiste unterhalb Rand.1997.052.396.3. F l l . m 2 301/512, S 300. I .A .
251 RS, Topf. G rK er, gelb -grau . M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingertupfcnleiste unterhalb Rand, F ingertupfen a u f Rand.1997.052.103.1. F 11. m 2 300/509. S 300, I .A .
233 RS, Topf, hart, rö tl.-braun. M ag. grob.1997.052.11.7, F 10, m 2 303/503, S 300, I .A .
234 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.052.58.2, F 10. m 2 302/508, S 300, I .A .
235 RS. Topf, GrKer, rötl., M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1998.049.1.1, Profil B augrube, S 300.
236 RS. T o p f GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.313.1, F 12. m 2 301/520. S 300. I .A .
Katalog der Funde 153
Abb. 176: K reuzlingen: Töbeli. K eram ik M 1:3. F rühbronzezeit 2 1 4 -2 5 1 .
154 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Töbeli. Abb. 177.
252 W S, G rK er, braun-grau . M ag. sehr grob, verstrichen, verw ittert, doppelte W arzen m it verzw eigten F ingertupfenleisten .1997.008.15.10. K analisa tionsgraben. S 300.
253 W S, G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.203.7, F 11, m 2 301/509, S 300, I .A .
254 W S, G rK er, ge lb-grau , M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.257.1, F 11, m 2 302 /513 , S 300, I .A .
255 W S. G rK er, grau-braun . M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.311.10, F 12, m 2 302/520. S 300. I .A .
256 W S, G rK er, rötl.. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.139.5, F 10, m 2 300/506, S 300. I .A .
257 W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert, F ingernagelverzierung und Fingertupfenleiste .1997.052.126.5, F 11, m 2 301/507, S 300, I .A .
258 W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.423.1, F 11. m 2 301/513, S 300. I .A .
259 W S, GrKer. braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.248.1, F l l . m 2 300/508, S 300. 1. A.
260 W S, FeinK er?, rö tl.-braun. M ag. fein. F ingernagelkerben.1997.052.253.1, F 11, m 2 300/514, S 300, I .A .
261 W S, G rK er, ge lb-grau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert. F ingertupfenleiste.1997.052.11.6. F 10, m 2 303/503. S 300, I .A .
262 W S, GrKer, grau-braun . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.132.16, F l l . m 2 301/508, S 300. I .A .
263 W S, GrKer, hart, M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingcrtupfen- leiste.1997.052.315.2, F l l . m 2 303/514. S 300, I .A .
264 W S, GrKer, rötl.. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.154.20. F 10, m 2 300/507, S 300. I .A .
265 W S, G rK er, ge lb-grau . M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.30.3, F 11, m 2 302/508, S 300, I .A .
266 W S, G rK er. rötl.. M ag. grob, verstrichen, verw ittert. G rifflappen.1998.049.3.1. Profil B augrube. S 300.
267 W S. GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, G ritflappen.1997.052.45.12, F 10, m 2 300/506, S 300. I .A .
268 W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, G rifflappen m it A nsatz e iner Fingertupfenleiste.1997.052.248.2, F l l . m 2 300/508, S 300. I .A .
269 W S, GrKer, rötl.. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, G rifflappen.1997.052.139.2, F 10, m 2 300/506, S 300. I .A .
270 W S. GrKer, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert, G rifflappen.1997.052.170.1, F 10, m 2 300/502, S 300, I .A .
271 W S, GrKer, grau-braun . M ag. g rob , verstrichen, verw ittert. G rifflappen mit Fingertupfenleiste.1997.052.308.3, F 12, m 2 300/520. S 300. I .A .
H enkel, G rK er, rö tl.-b raun . M ag. grob, verstrichen, verw ittert.1997.052.308.2, F 12, m 2 300/520, S 300, 1. A
W S. G rK er. rötl.. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfenleiste.1997.052.422.1. F l l . m 2 301.15 /513 .30 , S 300, I .A .
W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen.1997.052.159.1. F 10. m 2 300/501, S 300. I .A .
W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert, flächendeckende Fingertupfen.1997.052.313.9. F 12. m 2 301/520, S 300, I .A .
W S, GrKer, grau . M ag. m ittelk .. verstrichen, verw ittert, flächendeckende F ingertupfen.1997.052.45.8. F 10. m 2 300/506. S 300, I .A .
W S, GrKer, ge lb-grau . M ag. g rob, verstrichen, verw ittert, F ingertupfen.1997.052.126.7, F l l . m 2 301 /507 , S 300, I .A .
W S. G rK er. braun-grau . M ag. fein, verstrichen, verw ittert, flächendeckende F ingertupfen.1997.052.18.1. F 10, m 2 203/506, S 300, 1. A.
W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert, flächendeckende F ingertupfen.1997.052.97. l . F I I , m 2 302/509, S 300. 1. A.
W S. Topf?, grau, M ag. m ittelk ., flächendeckende F ingertupfen.1997.052.111.9, F 10. m 2 301/502, S 300. I .A .
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, verw ittert, flächendeckende F ingertupfen .1997.052.308.4. F 12, m 2 300/520, S 300, I .A .
W S, GrKer, gelb -g rau . M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert, flächendeckende F ingernagelkerben.1 99 7 .0 5 2 .1 0 1 .1 .F l l . m 2 303/509, S 300, 1. A.
W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert, F ingertupfen.1997.052.347.3, F 12, m 2 303/520, S 300, I .A .
W S. GrKer, g rau . M ag. g rob, verstrichen, verw ittert, flächendeckende Fingernagelkerben.1997.052.85.24, F 10, m 2 300/504, S 300. I .A .
W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert, doppelte E instich reihe.1997.052.375.1. F 12. m 2 301.88/514.79, S 300, I .A .
RS, K alo ttenschale, G rK er, grau. M ag. m itte lk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.140.1. F 10. m 2 300/505, S 300. I .A .
RS. K alo ttenschale, GrKer, gelb lich-grau . M ag. m ittelk ., verstrichen, verw ittert.1997.052.215.4, F 10, m 2 300/505, S 300, l .+ l .A .
RS, Schüssel, röm isch, 1. Jh. n .C hr. (S chucany /M artin -K ilcher 1999, Taf. 70.18), rö tl.-orange, ohne Mag.1997.052.2. l . F 10. m 2 305 .00/503.20 , A btrag bis O K 300, I .A .
RS, G rapen, I4 ./15. Jh. n .C hr., b raun-grau . M ag. fein, R ussspuren am Rand.1997.052.441.1. S treufund.
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
Katalog tier Funde 155
Abb. 177: K reuzlingen: Töbeli. K eram ik M 1:3. F rühbronzezeit 2 5 2 -2 8 7 ; R öm isch 288; Spätm ittela lter 289.
156 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 178.
290 K linge m it e inseitigem Sichelg lanz, ockerfarbener Silex.1998.002.368.1, F 138, m 2 012/348. I .A . KS untBcr.
2 9 1 P feilspitze m it A ufprallbeschäd igung an der Spitze, rö tl.-gelber Silex.1998.002.2182.1, F 168, m 2 010.93 /354 .54 , I .A . KS untBer.
292 K linge, Silex, sekundär h itzeversehrt.1998.002.1358.1, F 167, m 2 001 /353 , I .A . Koll. untBer.
293 Pfeilspitze, w eissl. Silex.1998.002.2181.1, F 168, m 2 015.76 /351 .91 , I .A . Koll untBer.
294 P feilspitze m it A ufprallbeschäd igungen . Silex, sekundär h itzeversehrt.1998.002.2180.1, F 254, m 2 982.18 /369 .15 , I .A . Koll obBer.
295 P feilsp itzenfragm . m it A ufprallbeschäd igungen , Bcrgkristall.1998.002.2120.1, F 224/225, Koll obBer.
296 Pfeilsp itze, g rün l.-schw arzer Silex.1998.002.2130.1, F 168. m 2 010.90/354.76 . 1, A, Koll untBer.
297 K linge, Silex, sekundär h itzeversehrt.1998.002.1454.1, F 167, S treufund aus A ushub.
Katalog der Funde 157
Abb. 178: T ägerw ilen: H ochstross. S ilices M 1:1. N eolith ikum oder B ronzezeit 2 9 0 -2 9 7 .
158 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 179.
298 N adel, B ronze. 35,3 g.1998.002.800.1 , beim A bhum usieren aus altem B odenhorizon t nördlich S iedlungsgelände. Koord. 729019 .08/279426.63 .
299 N adel. B ronze. 6,28 g.1998.002.2139.1, F 107, n r 3 .24/341.17 . S UK 200/O K 300, Koll.
300 Fibel, röm isch, 1. Jh. n. Chr. B ronze, 31.5 g.1998.002.2143.1, F 255, m : 990/368. S 300. I .A . Koll.
301 M eissei. B ronze. 3,5 g.1998.002.799.1, F 169, m 2 13/352, S 300, I .A . Koll.
302 A hle, B ronze, 0 .84 g.1998.002.2141.1, F 138, m 2 8 .60/348.83. S 300. I .A . Koll.
303 K lam m er. B ronze, 4.5 g.1998.002.2142.1, Streufund.
304 Stab, vierkantig , H albfabrikat, B ronze, flach ausgehäm m ert, 2,9 g.1998.002.2144.1, F 166. 995.26 /354 .01 . S 300. I .A . KS.
305 D olchfragm ., B ronze, stark korr., R illen schw ach erkennbar, 3,4 g.1998.002.2138.1, F 168, m 2 11/351, S 300, I .A . KS.
306 R inglein. B ronze. 1,99 g.1998.002.2150.2, Lesefund a u f Acker.
307 M esserk lingenfragm .?, B ronze, 9.1 g.1998.002.2136.1, F 168, m 2 10.59/354.89. S 300. L A , KS.
308 H albfabrikat?. B ronze, 0 ,54 g.1998.002.2145.1, F 168/169, S 300, S treufund aus A ushub KS.
309 K lingenfragm ., B ronze, 1,6 g.1998 .008 .2148 .1 ,F 167. m 2 5 .18/351.31 , S 300, 1. A. Koll.
310 S ichelfragm .. B ronze, 8,5 g.1998.002.2137.1, Lesefund a u f Acker.
311 B lech, B ronze, 1,5 g.1998.002.2149, F 1 6 6 ,5 3 0 0 . L A , Streufund aus A ushub KS.
312 K lum pen. G ussabfall? , B ronze, 30,7 g.1998.002.2146.1, F 166, S 300 O K , beim Baggerabtrag.
313 K lingenfragm .. B ronze, 3,6 g.1998 .002 .2150 .1, Lesefund a u f Acker.
314 Draht, B ronze. 0,35 g.1998.002.2147.1, F 169. m 2 13.85/352.40, S 300. L A , KS.
Katalog der Funde 159
Abb. 179: Tägerw ilen: H ochstross. B ronze M 1:2. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 304, 305, 307, 308, 3 1 1 .3 1 4 ; B ronzezeit 301, 302, 306 309, 310, 312, 313; Spätb ronzezeit 298, 299; R öm isch 300; D atierung unklar 303.
160 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 180.
315 RS. K alo ttcnschale, FeinKcr, grau. M ag. m ittc lk ., Schrägstrichdreiecke, K erbband.1998.002.267.3, n r 016 /353 , I .A . KS untBer.
316 RS. K alo ttenschale, FeinKcr, m tl.. M ag. fein. OFI geglättet. K erbband.1998.002.312.3, F 168, m 2 012/352. I .A . KS untBer.
317 RS, K alottenschale, FeinKer, m tl.. M ag. fein, OFI geglättet, G itter-M otiv.1998.002.269.1, F 168, m 2 01 1/353. I .A . K S untBer.
318 RS, K alottenschale, FeinKer, g rau , M ag. fein.1998.002.314.1, F 168, m 2 012 /353 , I .A . KS untBer.
319 RS, «Pyxis»-ähn liches G elass, FeinKer. m tl.. M ag. fein, A nsatz eines H enkels, Schrägstrichdreiecke.1998.002.369.2, F 168, m 2 011/351. l .A , KS untBer.
320 BS, Becher, FeinKer, grau. M ag. fein, W inkelband und K erbband.1998.002.305.3, F 169, m 2 015 /352 , l .A , KS untBer.
321 W S, FeinKer, m tl.. M ag. m ittelk ., geglättet, R este von R itzverzierung.1998.002.306.13, F 169, m 2 015 /353 , I .A . KS untBer.
322 W S, FeinKer, m tl.. M ag. fein, W inkelband.1998.002.1391.9, F 166, m 2 995/354, l .A , KS untBer.
323 W S, FeinKer, g rau . M ag. m ittelk ., OFI geglättet, Schrägstrich dreiecke.1998.002.592.2, F 169, m 2 015/353. l .A , KS untBer.
324 W S, FeinKer, m tl.. M ag. m ittelk ., Schrägstrichdreiecke, Rillen.1998.002.224.1, F 168, m 2 010/353, l .A , KS untBer.
325 W S, FeinKer. rö tl.-braun, m ineralische und o rganische M ag., OFI geglättet, Schrägstrichdreiecke, Rillen.1998.002.891.10. F 169, m 2 014/351. I .A . KS untBer.
326 W S, FeinKcr, dunkelgrau , M ag. grob, OFI geglättet, Sanduhrm uster, G rifflappen.1998.002.1431.1, F 168, m 2 010/351. I .A . KS untBer.
327 W S, FeinKer, dunkel-grau . M ag. fein, Fischgeräte-M otiv, Kerbband, Schrägstrichdreiecke.1998.002.1121.1, F 168, m 2 007/354, l .A , KS untBer.
328 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., vertikale R ippen, R este von R itzverzierung.1998.002.337.6, F 169, m 2 016/352, l .A , KS untBer.
329 W S, FeinKer. ockerfarben . M ag. m ittelk ., eingestochene R illen sowie E instichreihe.1998.002.1805.1, F 196, m 2 995/356, l .A , KS untBer.
330 W S, FeinKer, grau. M ag. fein. S trichverzierung.1998.002.1808.11. F 196, m 2 995/357, l .A , KS untBer.
331 W S. FeinKer, grau. M ag. m ittelk ., R este von R itzverzierung.1998.002.1463.3, F 166, m 2 994/354, I .A . KS untBer.
332 W S, GrKer, M ag. grob, g rober K am m strich a u f W andung, verbrannt.1998.002.615.8, F 168, m 2 006/353, I .A . KS untBer.
333 W S, FeinKer, grau, M ag. m ittelk .. R illen und K erbreihen.1998.002.256.2, F 169, m 2 016/351. I .A . K S untBer.
334 W S, FeinK er, bräun !.. M ag. m itte lk ., OFI geglättet. K crbrcihc, Reste von R itzverzierung.1998.002.409.5. F 169, m 2 014/354, I .A . KS untBer.
335 W S, Schultergefäss, FeinKer. M ag. m ittelk ., K crbrcihc a u f Schulter, verbrannt.1998.002.371.1, F 168, m 2 010/351. l .A , KS untBer.
336 W S. B echer?, m tl.. M ag. m itte lk ., R este von R itzverzierung, A nsatz e ines H enkels.1998.002.416.3. F 168, m 2 010/352. I .A . KS untBer.
337 W S, FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein. R este von R itzverzierung.1998.002.314.7, F 168. m 2 012/353. l .A , KS untBer.
338 W S, FeinKer, ockerfarben. M ag. m ittelk ., R illen, E instichreihe.1998.002.418.6, F 169, m 2 016/353, I .A . KS untBer.
339 W S, FeinK er?, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., punktgefüllte D reiecke, Riefe.1998.002.314.8, F 168, m 2 012 /353. l .A , KS untBer.
340 W S, FeinKer. M ag. m ittelk ., R este von Punktdreiecken, sekundär verbrannt.1998.002.1460.1, F 166. m 2 994/354, l .A , KS untBer.
341 W S, G rK er?, Reihe von E instichen m it e inem G etreidehalm ?, verbrannt. 1998.002.607.2, F 169, m 2 013 /354, I .A . KS untBer.
342 BS, FeinKer, M ag. fein, R este von R itzverzierung, stark verbrannt.1998.002.418.5, F 169, m 2 016/353, l .A , KS untBer.
Katalog der Funde 161
Abb. 180: Tägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. Keram ik M 1:3 . Späte F rühbronzezeit / frühe M ittc lbronzezeit 3 1 5 -3 4 2 .
162 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 181.
343 RS, FeinKcr. dunkelgrau . M ag. m ittelk ., geglättet.1998.002.1991.1, F 197, n r 000/359. I .A . KS untBcr.
344 RS, G rK cr, ockerfarben . M ag. m ittelk . b is grob.1998.002.222.3, F 169, tn ; 016 /352 , I .A . K.S untBer.
345 RS, FeinKcr. dunkel-g rau . M ag. m ittelk.1998.002.402.3, F 168, m : 012/352. I .A . KS untBer.
346 RS, FeinKcr. dunkelgrau . M ag. m itte lk ., OF1 fein verstrichen, G rifflappen.1998.002.1808.1. F 196, m 2 995/357, I .A . KS untBer.
347 RS. K nickw andschale, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein.1998.002.219.2, F 168, m 2 011 /351, I .A . KS untBer.
348 RS, K nickw andschale. FeinKer, dunkelgrau , M ag. m ittelk .. OF1 fein verstrichen.1998.002.275.18, F 168, m 2 012 /353 , I .A . KS untBer.
349 RS, K nickw andschale , FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, OF1 geglättet.1998.002.374.1. F 168, m 2 010/351. L A , KS untBer.
350 BS, FeinKer, dunkelgrau . M ag. m itte lk ., fein verstrichen, Standring.1998.002.1434.2, F 166, m 2 998/354. L A , KS untBer.
351 RS, N apf, dunkelgrau , M ag. m ittelk .. OF1 fein verstrichen. G rifflappcn.1998.002.314.4, F 168, m 2 012/353. L A , KS untBer.
352 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., innen fein verstrichen, aussen grobe OF1.1998.002.2005.1, F 197, m 2 001/358, KS untBer.
353 RS, K alo ttenschale, G rK er, grau . M ag. grob.1998.002.483. l . F 169, m 2 016/352, L A . KS untBer.
Katalog der Funde 163
352
Abb. 181 : T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M ittelbronzezeit 3 4 3 -3 5 3 .
164 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 182.
354 RS. Schüssel, GrKer, M ag. g rob. OF1 grob verstrichen, H enkel.1998.002.416.1, F 168, n v 010/352. I .A . KS untBer.
355 RS. GrKer. m tl.. M ag. g rob, OF1 fein verstrichen. F ingertupfen.1998.002.1344.1, F 166, m 2 998/353, L A , KS untBer.
356 RS, GrKer, g rau . M ag. m ittelk .1998.002.414.1, F 169, m 2 015/352. I .A . KS untBer.
357 RS. GrKer, ockerfarben . M ag. grob.1998.002.418.100, F 169, m 2 016 /353, L A , KS untBer.
358 RS, G rK er, rö tl.-braun, M ag. grob, fein verstrichen.1998.002.424.1, F 168, m 2 010/351. I .A . KS untBer.
359 RS, GrKer, ockerfarben-grau . M ag. grob.1998.002.407.2, F 168, m 2 011 /352 , L A . KS untBer.
360 RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. m ittelk .1998.002.1069.1, F 168, m 2 011/353, I .A . KS untBer.
361 RS, G rK er, rötl.. M ag. grob.1998.002.833.3, F 169, m 2 015/352, L A . KS untBer.
362 RS. G rK er, grau . M ag. grob.1998.002.833.2, F 169, m 2 015/352. L A , KS untBer.
363 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.1118.7, F 169, m : 015/351, L A , KS untBer.
364 RS, G rKer, braun. M ag. m ittelk.1998.002.484.1, F 168, m 2 010 /354 , I .A . KS untBer.
365 RS. G rKer, grau . M ag. m ittelk.1998.002.314.2, F 168, m 2 012 /353 , I .A . KS untBer.
366 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.407.3, F 168, m 2 011/352. L A . KS untBer.
367 RS, GrKer, dunkelgrau , M ag. grob.1998.002.402.4, F 168, m 2 012/352, L A , KS untBer.
368 RS, GrKer. grau. M ag. grob.1998.002.338.1, F 168, n r 009/354, L A , KS untBer.
369 RS. GrKer, g rau . M ag. grob.1998.002.581.2, F 168, m 2 01 1/354, I .A . KS untBer.
370 RS, G rK er, ockerfarben-grau . M ag. m ittelk ., grob geschaffene R andpartic.1998.002.581.1, F 168, m 2 011 /354 , I .A . KS untBer.
371 RS, GrKer, rötl., M ag. grob, G rifflappen, teilw eise geschlickt.1998.002.631.1, F 167, m 2 999/354, L A , KS untBer.
372 RS, GrKer, grau. M ag. grob.1998.002.240.1, F 168. m 2 009/354, L A . KS untBer.
373 RS, GrKer, g rau . M ag. grob.1998.002.617.1, F 169, m 2 014/354, L A . KS untBer.
374 RS, GrKer, ockerfarben. M ag. m ittelk .1998.002.1069.100, F 168, m 2 011/353, L A , KS untBer.
375 RS, GrKer. ockerfarben. M ag. fein.1998.002.407.1, F 168, m 2 011/352, L A . KS untBer.
Katalog der Funde 165
Abb. 182: T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 3 5 4 -3 7 5 .
166 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 183.
376 RS, G rKcr. b raun-grau . M ag. m itte lk ., Kerben a u f Rand.1998.002.380.1. F 168. n r 007/354. I .A . KS untBer.
377 RS, G rKcr, M ag. grob. F ingernagelkerben a u f Rand, stark verbrannt.1998.002.220.1. F 168, m 2 008/353, I .A . KS untBer.
378 RS. G rK cr. ockerfarben . M ag. grob, F ingertupfen a u f Rand.1998.002.1813.1. F 196, m : 998/356. I .A . KS untBer.
379 RS, G rK er, m tl .-braun, M ag. grob. F ingertupfen a u f Rand.1998.002.346.4. F 169, n r 014/352. I .A . KS untBer.
380 RS, G rK er, grau. M ag. grob, F ingertupfen a u f Rand.1998.002.717.2, F 168. n r 010 /351 . I .A . KS untBer.
381 RS, GrKcr, grau-braun . M ag. g rob . F ingertupfen a u f Rand.1998.002.307.16, F 169. n r 014/353, I .A . KS untBer.
382 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. g rob, F ingertupfen a u f Rand, Fingertupfenreihe.1998.002.606.15, F 168, m 2 012/354, I .A . KS untBer.
383 RS, GrKcr, M ag. sehr grob, F ingertupfen a u f Rand.1998.002.594.1. F 169, m 2 014/352, l .A , KS untBer.
384 RS, GrKer, g rau . M ag. g rob, F ingertupfen a u f Rand.1998.002.602.2. F 168. m 2 012/354. I .A . KS untBer.
385 RS, G rK er, g rau . M ag. m ittelk ., F ingertupfen a u f Rand, F ingertupfenleiste.1998.002.1970.2. F 197, m 2 005/356, I .A . KS untBer.
386 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob. F ingertupfen a u f R an d F ingertupfenleiste.1998.002.418.2. F 169, m 2 016/353, I .A . KS untBer.
387 RS, GrKer, M ag. sehr g rob, oberhalb der F ingertupfenleiste grob verstrichen, unterhalb geschlickt.1998.002.605.1, F 169, m 2 014/353. I .A . KS untBer.
388 RS, GrKer, b räunl.-grau . M ag. grob. F ingertupfenleiste a u f Schulter, OF1 unterhalb der F ingertupfenleiste geschlickt, im H alsbereich fein verstrichen.1998.002.11 12.1, F 169, m 2 013/353, I .A . KS untBer.
389 RS, G rK er, bräun !.. M ag. grob. Fingertupfenleiste .1998.002.418.101, F 169, m 2 016/353, l .A , KS untBer.
390 RS, G rK er, g rau-braun. M ag. sehr g rob, F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.891.2, F 169. m 2 014/351, I .A . KS untBer.
391 RS, G rK er, dunkel-g rau . M ag. grob, F ingertupfen a u f R an d F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.307.27, F 169, m 2 014/353. I .A . KS untBer.
392 RS, GrKer, grau-braun . M ag. g rob , F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.224.4, F 168, m 2 010/353. I . A. KS untBer.
393 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob. F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.245.1, F 168, m 2 007/354, l .A , KS untBer.
394 RS, GrKer, braun. M ag. grob. F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.480.3, F 168, m 2 012/354. l .A , KS untBer.
395 RS, G rK cr, ockerfarben. M ag. grob, F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.1965.2, F 197, m 2 000 /356 , I .A . KS untBer.
Katalog der Funde 167
Abb. 183: T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 3 7 6 -3 9 5 .
168 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 184.
3 % RS. G rK er, bräunl.. M ag. grob. F ingertupfen leiste unterhalb Rand und a u f Schulter. H alsbereich fein verstrichen, un terer Teil der W andung geschlickt.1998.002.1449.1, (FNr. a u f der Tafel:98 .002.382.1!) F 168, m 2 009 /351, I .A . KS untBer.
397 RS, GrKer, grau-braun , M ag. grob . OF1 grob verstrichen, verzw eigte F ingertupfenleiste , G rifflappen.1998.002.364.1. F 168, m 2 012 /353, I .A . KS untBer.
398 RS, GrKer. m tl.. M ag. grob, F ingertupfen leiste sowie F ingertupfen a u f Rand1998.002.1968.2, F 197, tn 2 005/356, I .A . KS untBer.
399 W S, G rK er, grau-braun , M ag. fein. OF1 verstrichen, Fingcrtupfcn- leiste, H enkel.1998.002.1424.2, F 167, m 2 999 /354 , I .A . KS untBer.
400 W S. G rK er. m tl.. M ag. m ittelk .. G rifflappen kom bin iert m it F ingertupfenleiste.1998.002.325.2, F 169. m 2 015 /351 , I .A . KS untBer.
401 W S, GrKer, b räunl., un terhalb der F ingertupfen leiste geschlickt. H alsbereich grob geglättet.1998.002.407.4, F 168, m 2 011/352, I .A . KS untBer.
402 W S. G rK er, m tl.-b raun . M ag. sehr grob. F ingertupfenleisten .1998.002.305.5, F 169, m 2 015/352, L A , KS untBer.
403 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob. OFI oberhalb der F ingertupfenleiste g rob verstrichen, unterhalb geschlickt.1998.002.306.9. F 169, m 2 015/353. I .A . KS untBer.
404 W S, G rKer, rö tl.-braun, M ag. m itte lk ., Leiste m it be idseitigen H albm ondstem peln .1998.002.574.6, F 169. m 2 013/353. I .A . KS untBer.
Katalog der Funde 169
396
398
397
399
402 403
400 401
404
Abb. 184: T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M l :3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lb ronzezeit 3 9 6 -4 0 4 .
170 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 185.
405 W S, G rK er, g rau . M ag. grob. F ingertupfen m it W arzen. 4251998.002.418.7, F 169, m 2 016/353. I .A . KS untBcr.
406 W S. G rK er, ockerfarben . M ag. fein. H alsbereich fein verstrichen, 426flächendeckend aufgesetz te W arzen, kom biniert m it flächendeckenden Fingernagelkerben.1998.002.602.3, F 168. n r 012/354. I . A, KS untBcr. 427
407 W S. G rK er. grau -braun. M ag. grob , flächige F ingertupfenw arzen.1998.002.598.4, F 168, m 2 008/353, I .A . KS untBer. 428
408 W S, G rK er, grau-braun . M ag. g rob , F ingertupfen m it W arzen.1998.002.409.8, F 169, m 2 014/354. I. A, KS untBer.
409 BS, G rK er., m tl.-b raun , o rganische M ag., flächendeckende F ingertupfen.1998.002.1783.3, F 196. m 2 995/356, I .A . KS untBer.
410 W S, G rK er, ockerfarben. M ag. m ittelk .. F ingertupfen m it W arzen.1998.002.409.7, F 169, m 2 014 /354. I .A . KS untBer.
411 W S, G rK er, grau, M ag. m ittelk ., au fgesetz te W arzen.1998.002.1783.2, F 196. m 2 995 /356 , I .A . KS untBer.
412 W S, G rK er, grau, M ag. m itte lk ., flächendeckende W arzen m it F ingertupfen , R este von R itzverzierung.1998.002.1344.32, F 166, m 2 998 /353 , L A , KS untBer.
413 W S, g rau . M ag. grob , aufgesetz te W arzen.1998.002.574.7, F 169, m 2 013/353. I .A . KS untBer.
414 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, Fingertupfen.1998.002.275.15, F 168, m 2 012/353, I .A . KS untBer.
415 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , flächige Fingertupfen.1998.002.402.8, F 168, m 2 012/352. L A , KS untBer.
416 W S, GrKer, dunkelgrau . M ag. m ittelk ., fein eingepresste F ingertupfen.1998.002.346.11, F 169. m 2 014/352, L A , KS untBer.
417 W S, GrKer, dunkelgrau , M ag. m ittelk ., flächendeckende F ingernagelkerben.1998.002.402.10, F 168, m 2 012/352, I .A . KS untBer.
418 W S, GrKer, ockerfarben . M ag. grob, flächige Fingernagelkerben.1998.002.402.9, F 168, m 2 012/352, L A , KS untBer.
419 W S, GrKer, ockerfarben . M ag. grob. G rifflappen.1998.002.415.5, F 169. m 2 014/354. L A , KS untBer.
420 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. sehr grob , G rifflappen.1998.002.1118.6, F 169. m 2 015/351. L A , KS untBer.
421 H enkel, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.609.1. F 169. m 2 009/354, L A , KS untBer.
422 W S. GrKer, ockerfarben-grau . M ag. grob , G rifflappen.1998.002.615.9, F 168, m 2 006/353, L A , K S untBer.
423 W S, G rK er, ockerfarben . M ag. grob, G rifflappen, kom biniert m it F ingertupfenreihe. K erbreihe a u f G rifflappen.1998.002.331.8, F 169. m 2 015/352, L A , KS untBer.
BS, G rK er, bräun!.. M ag. g rob , geschlickt.1998.002.373.1, F 168, n r 12.05/351.95, L A , KS untBer.
BS, G rK er, grau, M ag. grob.1998.002.312.6, F 168, m 2 012 /352 , L A , KS untBer.
BS, G rK er, grau. M ag. grob.1998.002.901.5, F 168, m 2 009/353. L A , KS untBer.
BS, G rK er?, grau, M ag. m ittelk.1998.002.346.20, F 169. m 2 014/352, L A , KS untBer.
424 BS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.597.5, F 168, m 2 011/353. L A , KS untBer.
Katalog der Funde 171
Abb. 185: Tägervvilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 4 0 5 -4 2 8 .
172 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 186.
429 RS. Topf. FeinKer. M ag. m ittelk ., H enkel, gepunktetes Band und gepunktete D reiecke a u f Schulter, sekundär verbrannt.1998.002.376.3, F 168, m 2 012 /352 , I .A . KS untBer.
430 W S. FeinKer. M ag. m ittelk .. Punktdreiecke a u f Schulter, sekundär verbrannt.1998.002.305.6, F 169, m 2 015/352. I .A . KS.
431 W S, FeinKer. dunkelgrau , M ag. fein, vertikale R ippen m it Kerben. W inkclband. Schrägstrichdreiecke.1998.002.345.7. F 169, m 2 015/352, 1. A. KS.
432 W S. FeinKer, grau. M ag. grob. OF1 fein verstrichen, W inkelband. Schrägstrichdreieckc.1998.002.580.2, F 168, m 2 007 /353, I .A . KS.
433 W S, FeinKer. Punktdreicke. R illen, R este von R itzverzierung.1998.002.307.15. F l 69. m 2 0 14/353, 1. A. KS.
434 W S, FeinKer, grau . M ag. m ittelk .. E instichreihe, Rillen.1998.002.1118.2. F 169. m 2 015/351, I .A . KS.
435 W S. FeinKer. grau. M ag. grob. Kerbband. K erbreihen.1998.002.404.1. F 168, m 2 01 1/354. L A , KS.
436 W S, G rK er. ockerfarben . M ag. m itte lk ., F ingertupfen m it W arzen.1998.002.275.10, F 168, m 2 012/353. L A , KS.
437 RS. K nickw andschale. FeinKer. rötl.. M ag. fein, G rifflappen, Gitter-M otiv, Schrägstrichdreiecke.1998.002.1471.9, F 167. m 2 004/354, L A , KS.
438 RS, K nickw andschale, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., W inkelband.1998.002.1420.1. F 166, m 2 998/354. L A , KS.
439 RS, K nickw andschale, dunkelgrau . M ag. m ittelk .. OF1 aussen geglättet, innen fein verstrichen.19 9 8 .0 0 2 .5 9 8 .1. F 168. m 2 008 /353 . 1. A. KS.
440 W S. K nickw andschale, rö tl.-braun. M ag. fein, FeinKer, Rillen, K erbreihe.1998.002.408.4, F 168, m 2 012/353, L A , KS.
441 W S. K nickw andschale. FeinKer. dunkelgrau . M ag. m ittelk .. R illen, E instichreihe.1998.002.414.6, F 169, m 2 015/352. I .A . KS.
Katalog der Funde 173
Abb. 186: Tägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte Frühbronzezeit / frühe M itte lb ronzezeit 4 2 9 -4 4 1 .
174 Katalog der Funde
Tägevwilen: Hochstross. Abb. 187.
442 RS. FeinKer, H enkelkrug , (ein H enkel gesichert), R hom ben-M otivc, Rillen.1998.002.575.1. F 166. n r 993/345, KS obBer.
443 RS. Fein- oder G rK er, grau . M ag. m ittc lk .. H alsbereich geglättet, a u f Schulter M ächendeckend aufgesetz te W arzen.1998.002.311.1. F 169, m : 014 /354, L A , K.S obBer.
444 RS. FeinKer, M ag. m itte lk .. punk tgefü llte D reiecke, R illen, stark verbrannt.1998.002.392.2. F 168, n r 008/352, I .A . KS obBer.
445 RS. FeinKer, ockerfarben . M ag. fein, Z ickzack-M otiv a u f dem Hals.1998.002.710.1, F 168, n r 003/353. I .A . KS obBer.
446 RS. G rK er, ockerfarben . M ag. m ittelk ., OF1 geglättet.1998.002.798.2, F 168, m 2 010/354, L A , KS obBer.
447 RS, GrKer, dunkelgrau , M ag. fein, aussen geglättet.1998.002.1795.2, F 196, n r 996/356. KS obBer.
448 RS, FeinKer, dunkelg rau , M ag. fein.1998.002.307.3, F 169. m 2 014 /353 , I .A . KS obBer.
449 RS. GrKer, ockerfarben . M ag. m ittelk ., OF1 fein verstrichen.1998.002.1778.2, F 196. n r 997 /356 . I .A . KS obBer.
Katalog der Funde 175
443
444
445446
447448 449
Abb. 187: T ägerw ilen: H ochstross Bereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 4 4 2 - 449.
176 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 188.
450 W S. FeinK er, ockerfarben. M ag. m ittclk ., OFI geglättet, Schrägstrichdreiecke.1998.002.1820.1, F 196, n r 996/356, I .A . KS untBer.
451 W S. FeinKer, dunkelgrau , M ag. m itte lk ., geglättet, Schrägstrichdreiecke.1998.002.1466.7, F 166, m : 997/353, I .A . KS obBer.
452 W S, FeinKer, dunkelgrau , M ag. m ittc lk ., geglättet, R illen, E instichreihe.1998.002.417.5, F 168, n r 007 /352 . I .A . KS obBer.
453 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittclk ., Reste von R itzverzierung.1998.002.1476.1, F 167, m : 002/353, L A , KS obBer.
454 W S, FeinKer, ockerfarben . M ag. fein. R este von R itzverzierung.1998.002.891.9. F 169, n r 014/351. L A , KS obBer.
455 W S, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein, OFI geglättet, Rillen.1998.002.307.23. F 169. n r 014/353, L A , KS obBer.
456 W S. FeinKer. dunkelgrau , M ag. fein bis m ittelk ., geglättet, Schrägstrichdreiecke.1998.002.1466.8, F 166, n r 997/353, L A . KS obBer.
457 W S, FeinKer. rö tl.. M ag. m itte lk ., K erbreihe, Schrägstrichdreiecke.1998.002.1435.3, F 167. m : 999 /353, I .A . K S obBer.
458 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. gekerbtes W inkelband m it S chrägstrichdreiecken. Punktband.1998.002.710.4. F 168, n r 003/353. L A , K S obBer.
459 W S, FeinKer, Z ickzack-M otiv. Schrägstrichdreiecke, K erbband, stark verbrannt.1998.002.1115.1, F 168, n r 009/352, L A , KS obBer.
460 W S, FeinKer. M ag. m ittclk .. W inkelband, Schrägstrichdreiecke.1998.002.377.3, F 169. 016/351. I .A . K S obBer.
461 W S. FeinKer, rötl.. M ag. m ittelk ., gekerbtes W inkelband.1998.002.406.4, F 169, n r 016/352, L A . KS obBer.
462 W S, GrKcr. ockerfarben . M ag. grob, R este von Ritz- und E instichverzierung.1998.002.222.9, F 169. 01=016/352, I .A . KS obBer.
463 W S, FeinKer, grau. M ag. fein, R este von S trichverzierung.1998.002.1387.1 I. F 167, m 2 000/353, L A , KS obBer.
464 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., W inkclband, gestaffelte D reiecke. Kerbband. E instichreihe.1998.002.1457.1, F 166. n r 996/353, L A , KS obBer.
465 W S, FeinKer, grau. M ag. m itte lk ., W inkelband.1998.002.390.2, F 168, m 2 012/351, L A , KS obBer.
466 W S, FeinKer, dunkelg rau-rö tl.. M ag. m ittelk ., W inkelband.1998.002.581.4, F 168, n r 011/354, L A , KS obBer.
467 W S, FeinKer, rötl.. M ag. fein. W inkelband.1998.002.717.5, F 168, n r 010/351. L A , KS obBer.
468 W S, FeinKer, grau . M ag. m ittelk ., W inkelband, Schrägstrich dreiecke, Rillen.1998.002.891.4. F 169. m 2 014/351, L A . KS obBer.
469 W S, FeinKer, grau . M ag. m ittelk ., Schrägstrichdreiecke, Rillen. K erbreihe.1998.002.377.4. F 169. n r 016/351. L A . KS obBer.
470 W S, FeinKer. grau . M ag. m ittelk ., OFI fein verstrichen.1998.002.616.7, F 168, m 2 010 /351 , L A . KS obBer.
471 W S, FeinKer, grau . M ag. m itte lk ., R illen und Schrägstrichdreiecke.1998.002.597.3. F 168. n r 011/353. L A , KS obBer.
472 W S, FeinKer, grau . M ag. m itte lk ., R illen, K erbreihe.1998.002.256.1, F 169, m 2 016/351. L A , KS obBer.
473 W S, FeinKer, grau . M ag. fein, E instichreihe, Rillen.1998.002.405.1, F 169, m 2 014/353, L A , KS obBer.
474 W S, FeinKer. rötl.. M ag. fein, E instichreihe, R illen und K erbreihe a u f Schulter.1998.002.403.2, F 169, m 2 016/351. L A . KS obBer.
475 W S, FeinKer, dunkelgrau-braun . M ag. m ittelk ., E instichreihe und Rillen.1998.002.337.1. F 169. m 2 016/352. L A , KS obBer.
476 BS, FeinKer. M ag. m itte lk ., OFI fein verstrichen.1998.002.1819.3, F 196. n r 997 /356 . L A , KS obBer.
477 BS, FeinKer, rötl.. M ag. fein, fein verstrichen, Standring.1998.002.626.5, F 168, n r 009 /354, L A , KS obBer.
Katalog der Funde
Abb. 188: Tägerw ilcn: H ochstross B ereich Ost. Keram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lb ronzezeit 4 5 0 -4 7 7 .
178 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 189.
478 RS. GrKcr, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.879.2. F 169, m 2 014/352, I .A . K S obB cr.
479 RS. GrKer, rö tl.-g rau . M ag. m ittclk.1998.002.410.1. F 168, m 2 011/352. I .A . K S obB cr.
480 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.1387.1. F 167. n r 000/353. I .A . K S obB cr.
481 RS, ockerfarben . M ag. m ittclk.1998.002.1502.1. F 167, n v 003 /352 , I .A . K S obB cr.
482 RS, G rK er, ockerfarben , M ag. grob.1998.002.1957.3, F 197. m : 000/357. I .A . K S obB cr.
483 RS. G rK er, rötl.. M ag. grob.1998.002.2004.1. F 197, m 2 001 /358 , I .A . K S obB cr.
484 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.1827.1. F 196, n r 999/358. KS obBcr.
485 RS, GrKer, ockerfarben . M ag. grob.1998.002.974.1. F 169, m 2 013 /354 , I .A . KS obBer.
486 RS, GrKer. grau-braun . M ag. m ittclk .. fein verstrichen.1998.002.408.1. F 168. n f 012/353. I .A . KS obBer.
487 RS. G rK er. rötl.. M ag. m ittelk .1998.002.2000.100. F 197, n r 003/356, I .A , KS obBer.
488 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.395.1. F 168, m 2 007/354, I .A . KS obBer.
489 W S, GrKer. grau, M ag. grob.1998.002.342.1. F 168, m 2 012/354, I .A . KS obBcr.
490 RS, G rK er, grau. M ag. grob.1998.002.719.1. F 168. m 2 9 .7/354. I .A , KS obBcr.
491 RS, G rK er, grau. M ag. grob.1998.002.879.3, F 169, m 2 014/352. I .A . KS obBer.
492 RS, G rK er, rötl.. M ag. m ittelk .1998.002.1777.5. F 196. m 2 995/356, I .A . K S obB cr.
493 RS, G rK er, grau. M ag. m ittelk.1998.002.1115.2. F 168. m 2 009/352, I .A . K S obB cr.
494 RS, G rK er, K alo ttenschale, grau. M ag. grob.1998.002.1 II 1.2, F 169. m 2 013/351, I .A . KS obBer.
495 RS, K alottenschale. GrKer, dunkelgrau , M ag. m ittelk .. F ingertupfenleiste, F ingertupfen a u f Rand.1998.002.1339.1. F 167. m 2 999/353, I .A , K S obB cr.
496 RS, K alo ttenschale, G rK er, ockerfarben , M ag. grob.1998.002.1449.1 (Fnr. a u f der Tafel 98 .002 .1378 .7!), F 167, m 2 000/353, I .A . KS obBcr.
Katalog der Funde 179
Abb. 189: T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 4 7 8 -4 9 6 .
180 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 190.
497 RS. R este eines S iebgefasses, GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittclk . 516 RS, GrKer, g rau . M ag. grob, verzw eigte Fingertupfenleiste .1998.002.1401.2, F 166, tn : 994/353, KS obBer. 1998.002.1234.1, F 166, m 2 993/353, I . A. KS obBer.
498 RS. Siebgefass?. G rK er. M ag. m ittclk .. OFI fein verstrichen,D urchlochung im R andbereich.1998.002.836.1, F 168, m 2 010 /352. L A , KS obBer.
499 RS, G rK er, g rau , M ag. grob. F ingertupfen leiste unterhalb Rand.F ingertupfen a u f Rand.1998.002.1466.10. F 166. m 2 997/353. I .A . KS obBer.
500 RS. G rK er. M ag. g rob . F ingertupfen a u f R and und a u f Schulter, stark verbrannt.1998.002.966.4, F 168. n r 008/352, I .A . KS obBer.
501 RS. GrKer. rö tl.-braun. M ag. g rob , F ingertupfen a u f Rand.1998.002.380.3, F 168. n r 007/354, I .A . KS obBer.
502 RS. GrKer, F ingertupfen a u f Rand.1998.002.598.2, F 168, n r 008/353, L A , KS obBer.
503 RS. GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob. F ingertupfen a u f Rand, im H als- bcrcich fein verstrichen, unterhalb der F ingertupfenleiste geschlickt.1998.002.434.1. F 168. n f 011/351. L A , K S obBer.
504 RS, GrKer, ockerfarben . M ag. g rob , F ingernagelkerben a u f Rand.1998.002.1774.10, F 196, m : 997/356, L A , KS obBer.
505 RS. G rK er, rö tl., M ag. m ittelk .. F ingernagelkerben a u f Rand.1998.002.1891.1, F 197, m : 001/358. L A , KS obBer.
506 RS, GrKer. bräun!., M ag. m itte lk .. F ingertupfen leiste unterhalb Rand.1998.002.880.1, F 168, m 2 008/351, L A , KS obBer.
507 RS, GrKer, grau . M ag. g rob , F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.1109.1, F 168, m 2 009 /352 , I .A . KS obBer.
508 RS. G rK er. grau. M ag. g rob . F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.832.3. F 168, m 2 007 /352 . I .A . KS obBer.
509 RS, G rKer, rö tl.-braun, M ag. grob. F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.696.1. F 169, m 2 013/352. I .A . KS obBer.
510 RS, G rKer. grau . M ag. sehr g rob . H alsbereich fein verstrichen. F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.002.380.2, F 168, m 2 007/354. L A , KS obBer.
511 RS, G rKer. rötl.. M ag. grob, Fingertupfenleiste .1998.002.1787.1, F 196. m 2 996/356, L A , KS obBer.
512 RS. G rKer, grau . M ag. g rob . OFI verstrichen, F ingertupfenleiste.1998.002.633.100. F l 66, n r 993/354, L A . KS obBer.
513 W S, G rK er, ockerfarben. M ag. grob, g latte Leiste, un terer W and- bercich geschlickt.1998.002.1497.7, F 167, m 2 002/350. I .A . KS obBer.
514 RS, GrKer. M ag. grob, F ingertupfenleiste , H alsbereich fein verstrichen, untB er W andung geschlickt.1998.002.1337.1. F 166, m 2 995/354, L A , KS obBer.
515 W S. G rKer, M ag. g rob , m ehrfache F ingertupfenleisten , stark verbrannt.1998.002.1960.1, F 197, n r 999/357. L A , KS obBer.
Katalog der Funde 181
Abb. 190: T ägerw ilen: H ochstross B ereich O st. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 4 9 7 -5 1 6 .
182 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 191.
517 W S. G rK cr. b räunl., OFI verstrichen, F ingertupfenleiste , G rifflappen.1998.002.1482.1, F 167, m 2 003 /353 , I .A . KS obBer.
518 W S, G rK cr. m tl.. M ag. fein , G rifflappen, F ingertupfenleiste .1998.002.1477.1. F 167, m 2 003/353, I .A . KS obBer.
519 W S. G rK cr. bräunl.. M ag. grob. F ingertupfen leiste , G rifflappen, H alsbereich fein verstrichen, un tB er W andung geschlickt.1998.002.1390.4, F 166. m 2 992/352, I .A . KS obBer.
520 W S. G rK cr, m tl.. M ag. sehr grob, oberhalb der F ingertupfenleiste fein verstrichen, unterhalb geschlickt.1998.002.390.5, F 168. n r 012/351. I .A . KS obBer.
538 W S, G rK er, m tl.-b raun . M ag. grob. F ingertupfenreihe, im Hals- bcreich fein verstrichen, un tB er W andung geschlickt.1998.002.1109.5, F 168. m : 009/352, L A , KS obBer.
539 W S, GrKer, bräunl.. M ag. grob, g rober K am m strich.1998.002.413.2, F 169. m : 013/353. L A , Koll untBer.
540 W S, GrKer. grau . M ag. m itte lk ., G rifflappen m it D elle, kom biniert m it F ingertupfenleiste .1998.002.703.2, F 168, m 2 01 1/354, L A , KS obBer.
541 W S, rö tl.-braun, M ag. m itte lk ., G rifflappen m it D elle.1998.002.635.1, F 168, m 2 009/354, I .A . KS obBer.
542 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., G rifflappen mit Delle.1998.002.345.12, F 169, m 2 015 /352, I .A . KS obBer.
543 BS. G rK cr, m tl.. M ag. grob, flächendeckende F ingertupfen.1998.002.1991.2, F 197, m 2 000/359, L A , KS obBer.
544 BS. rötl.-braun. M ag. m itte lk ., flächige Fingertupfen.1998.002.1777.2, F 196, m 2 995/356, I .A . KS obBer.
545 BS, GrKcr. ockerfarbcn-rö tl.. M ag. g rob , geschlickt.1998.002.1378.100. F 167, m 2 000 /353 , I .A . KS obBer.
546 BS, G rK cr. bräunl.. M ag. grob, geschlickt.1998.002.410.3, F 168. m 2 011 /352 , I .A . KS obBer.
525 W S. G rK er. M ag. grob. H enkel, verzw eigte Fingertupfenleiste .1998.002.1444.2, F 167. m 2 000/354. L A , KS obBer.
526 W S, G rK er. ockerfarben . M ag. grob. H enkel.1998.002.1373.3, F 166, m 2 994/354, L A . KS obBer.
527 W S. GrKer, rö tl.-b raun , M ag. grob, geschlickt, Henkel.1998.002.897.1. F 168. m 2 010/352. L A , KS obBer.
528 W S, GrKer. ockerfarben . M ag. g rob , H enkel.1998.002.634.3, F 166. m 2 994/353. L A , KS obBer.
529 RS. G rK er, ockerfarben. M ag. grob, Henkel.1998.002.1492.2. F 167. m 2 005 /351, L A . KS obBer.
530 W S, G rK er. m tl.. M ag. grob. H enkel, flächige F ingertupfen.1998.002.612.3, F 166. m 2 993/354. I .A . KS obBer.
521 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. Leiste m it doppelten H albm ondstem peln .1998.002.1422.1, F 167, m 2 999/350, I .A . KS obBer.
522 W S. GrKer, m tl.. M ag. m itte lk ., Leiste m it beidseitigen Eindrücken.1998.002.621.1, F 169. m 2 013/35 1. I .A . KS obBer.
523 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, G rifflappen. H alsbereich fein verstrichen, un tB er geschlickt.1998.002.410.2, F 168. m 2 011/352. I .A . KS obBer.
524 W S. G rK er. bräunl.. M ag. grob. H enkel, kom bin iert m it F ingertupfenleiste.1998.002.390.100, F 168, m 2 012 /351 , L A . KS obBer.
531 W S, G rK er. grau. M ag. grob. F ingertupfen m it W arzen.1998.002.390.3, F 168, m 2 012/351, L A , KS obBer.
532 W S, G rK er. m tl.. M ag. m ittelk .. F ingertupfen m it W arzen.1998.002.243.4. F 169. m 2 016/352. L A , KS obBer.
533 W S, G rK er, b raun-grau . M ag. grob, flächendeckende Fingertupfen. 1998.002.344.49. F 169. m 2 013 /352, L A , KS obBer.
534 W S, G rK er, M ag. g rob , ockerfarben , flächendeckende Fingertupfen.1998.002.306.19. F 169. m 2 015 /353, I .A . KS obBer.
535 W S, GrKer, grau, o rganische und m ineralische M ag., flächendeckende F ingertupfen m it W arzen.1998.002.635.2, F 168, m 2 009/354, L A , KS obBer.
536 W S, G rK er, m tl.-g rau . M ag. grob, F ingernagelkerben.1998.002.377.7, F 169, m 2 016/351. I .A . KS obBer.
537 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob , F ingertupfenreihe.1998.002.403.5. F 169, m 2 016/351. L A . KS obBer.
Katalog der Funde 1*3
Abb. 191: T ägerw ilen: H ochstross Bereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 5 1 7 -5 4 6 .
184 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 192.
547 RS. GrKer. ockerfarben . M ag. fein. Kerben a u f Rand.1998.002.1456.1, F 167. n v 003/352. I .A . Koll untBer.
548 RS. G rK er, grau, M ag. grob.1998.002.1853.5, F 197. m : 005/359. I .A . Koll untBer.
549 RS. G rK er, m tl .. M ag. g rob , F ingertupfen a u f Rand.1998.002.1817.2. F 196. m 2 996/358, I .A . Koll untBer.
550 RS. G rK er, randständ iger H enkel, rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1998.002.1943.1, F 197. m 2 001/357, I .A . Koll untBer.
5 5 1 W S. Becher, ockerfarben , M ag. m ittelk ., verw ittert. Rhom ben und Schrägstrichdreiecke.1998.002.1912.1. F 196. m 2 996/359, L A , Koll untBer.
552 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verw ittert, g latte Leiste, R itzlinien unterhalb der Leiste.1998.002.1931.1. F 197. m 2 005/358, I .A . Koll untBer.
553 W S. G rK er. rö tl.-b raun . M ag. m ittelk .. verw ittert. L eiste mit be id seitigen H albm ondeinstichen.1998.002.1856.2, F 197, m 2 005 /356 , L A , Koll untBer.
554 W S, G rK er, grau. M ag. grob. G rifflappen, flächige F ingertupfen .1998.002.1374.1, F 176, m 2 002 /354 , L A . Koll untBer.
555 BS, G rK er, grau. M ag. grob, flächige W arzen m it F ingertupfen.1998.002.1119.1, F 166. m 2 994/352, I .A . Koll untBer.
556 RS, G rK er, K alottenschale, grob verstrichen.1998.002.1863.1, F 197. m 2 999/359, I .A . Koll untBer.
557 W S, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob. R este von flächiger S trichverzierung.1998.002.1890.2, F 197. m 2 003/357. L A , Koll untBer.
558 RS, GrKer, ockerfarben . M ag. grob , sehr g rob gefertigt.1998.002.1383.1, F 167, m 2 000/354. L A . Koll untBer.
559 RS, Topf, G rK er, ockerfarben. M ag. g rob , sehr unregelm ässig gefertig t, F ingertupfen a u f Rand, G rifflappen m it Delle.1998.002.1852.1, F 197, m 2 004/359, L A . Koll untBer.
560 RS, GrKer. geschlickt, sehr unregelm ässig gearbeitet.1998.002.1481.1, F 197, m 2 000 /356.66 , L A , Koll untBer.
Katalog der Funde 185
Abb. 192: T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lb ronzezeit 5 4 7 -5 5 5 , entw ickelte M itte lbronzezeit 5 5 6 -5 6 0 .
186 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 193.
561 RS. GrKcr. ockerfarben . M ag. g rob , F ingertupfen a u f Rand.1998.002.2044.1. F 198. m : 006/358, I .A . Koll obBcr.
562 W S. FcinKcr, g rau . M ag. fein, K erbreihe.1998.002.61.3, F 138, m 2 007 /349 , I .A . Roll obBcr.
563 W S. G rKer. ockerfarben, flächendeckende F ingertupfen m it W arzen.1998.002.1778.3, F 196. m : 997/356. I .A . Koll obBer.
564 W S, G rK cr. rö tl.-b raun , flächendeckende F ingertupfen m it W arzen, im H alsbereich fein verstrichen.1998.002.1892.3, F 196. m 2 998 /356 , 1. A, Koll obBcr.
565 W S. FeinKer. Schrägstrichdreiecke, Rillen.1998.002.2079.1, F 197, m 2 002 /356 , I .A . Koll obBcr.
566 W S, FeinKer, M ag. m itte lk ., Punktreihe, verbrannt.1998.002.1372.5. F 167. n r 004/352, 1. A, Koll obBcr.
567 RS. G rK cr, ockerfarben . M ag. grob , geschlickt, sehr unregelm ässig gearbeitet.1998.002.1845.3, F 197, m 2 000/358, 1. A, Koll obBer.
568 RS, G rK er, rötl.. M ag. grob , unregelm ässig gearbeitet.1998.002.1892.1. F 196, m 2 998/356, I .A . Koll obBer.
569 RS, GrKcr. rötl.-braun. M ag. g rob , unregelm ässig gearbeitet.1998.002.1845.2, F 197, m 2 000/358, I .A . Koll obBer.
570 W S, G rK er, b raun-grau . M ag. grob, unregelm ässig gearbeitet, K nick- w andgefäss, glatte L eiste a u f Schulter.1998.002.1868.4, F 197, m 2 001 /358 , 1. A. Koll obBcr.
571 W S, G rK er. ockerfarben-rö tl.. M ag. m ittelk ., flächige F ingernagelkerben.1998 .002 .282 .1. F 138, m 2 006/346. I . A, Koll obBer.
572 W S, FeinKer, grau. R este von Ritz- und E instichverzierung.1998.002.1845.1, F 197, m 2 000/358, I .A . Koll obBer.
573 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob, g rob gearbeitet.1998.002.1886.1, F 197, m 2 001/357, I .A . Koll obBer.
574 RS, Schale, FeinKer. ockerfarben. M ag. fein, Innenseite geglättet, aussen verstrichen.1998.002.1469.1, F 254, m 2 978/367, 1. A. Koll obBcr.
575 RS. GrKer, rötl., M ag. m ittelk ., OF1 fein verstrichen.1998.002.246.1. F 166 I .A . Koll obBer.
576 RS, G rK er, grau. M ag. fein, F ischgräten-M otiv a u f R andum bruch.1998.002.1547.1. F 254. m 2 978/366, Koll obBer.
577 S p innw irte lfragm .. rötl.-braun.1998.002.1985.12, F 197, m 2 999/356, I .A . Koll obBer.
582 RS. G rK cr, beige-grau . M ag. grob m it G lim m erzusatz .1998.002.1337.35, F 166, m 2 995/354, L A , Koll obBer.
583 RS, rö tl.-ockerfarben , M ag. fein.1998.002.1355.1, F 167, m 2 003/350, L A , Koll obBer.
584 RS. R eibschale, Terra sigillata, röm isch , I . Jh. n .C hr., hello ranger Ton, R este von rötl. Ü berzug, stark verw ittert und verrundet.1998.002.134.1. F 108, m 2 010/344, Koll obBcr. über Pos. 36.
578 RS, N apf, FeinKer, rö tl.-ockerfarben , B ruch grau. M ag. fein m it G lim m erzusatz.1998.002.1366.1, F 167, m 2 999/351, L A , Koll obBer.
579 RS, N apf, grau braun. M ag. fein m it G lim m erzusatz.1998.002.1347.23, F 166, m 2 994/350, I .A . Koll obBer.
580 RS, N apf, beige, M ag. fein m it G lim m erzusatz , stark verw ittert.1998.002.1414.3, F 136, m 2 993/349, Koll obBer.
581 RS, FeinK er m it D rehrillen , beige. M ag. fein m it C ilim m erzusatz.1998.002.1418.2, F 167, m 2 000 /351, L A . Koll obBer.
Katalog der Funde 187
Abb. 193: T ägerw ilen: H ochstross B ereich Ost. K eram ik M 1:3. Späte F rühbronzezeit / frühe M itte lb ronzezeit 5 6 1 -5 6 6 : en tw ickelte M ittc lbronzezeit 5 6 7 -5 7 2 : Spätb ronzezeit 5 7 3 -5 7 6 : B ronzezeit 577; L atènezeit 5 7 8 -5 8 3 ; R öm isch 584.
188 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 194.
585 RS, G rK er, ockerfarben , M ag. grob.1998.002.1723.2, F 223, n r 976/364, I . A, Koll untBer.
586 RS, G rK er, rö tl.-b raun . M ag. grob.1998.002.1698.1, F 224. m 2 981/362. I .A . Koll untBer.
587 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob.1998.002.1653.1, F 224, n v 980/364, I .A . Koll untBer.
588 RS. G rK er, dunkelgrau-braun . M ag. grob.1998.002.1695.1, F 224. m 2 979/363. I . A. Koll untBer.
589 W S, FeinKer, rö tl.-ockerfarben . M ag. m ittclk ., R este von langen, gestaffelten D reiecken und lang gezogenen R hom ben, A ussenseite mit R ussresten.1998.002.1655.2, F 224. m 2 980/363, L A , Koll untBer.
590 W S. G rK er?. dunkelgrau-braun . M ag. fein. Reste von lang gezogenen R hom ben oder D reiecken.1998.002.1644.2, F 224. m 2 983/363. I . A. Koll untBer.
591 RS, S chrägrandgelass. GrKer, rötl.. M ag. m ittelk ., Kerben a u f Rand.1998.002.1607.1, F 254. m 2 979/366, Koll untBer.
592 RS. Schrägrandgefäss, G rK er, braun, M ag. m ittelk.1998.002.1551.2, F 254, m 2 978/367, L A , Koll untBer.
593 RS, Schale, FeinKer. ockerfarben . M ag. fein.1998.002.1560.1, F 254. m 2 979 /367, I . A. Koll untBer.
594 RS, Schale, FeinKer, rötl.. M ag. m ittelk .. E instichreihen a u f Rand.1998.002.1582.1, F 254, m 2 978/367. L A , Koll untBer.
595 RS, Schale. FeinKer. rötl.. M ag. m ittelk.1998.002.1584.1, F 254. m 2 980/366, I . A, Koll untBer.
596 RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. hom ogen m ittelk .. OF1 fein verstrichen, Leiste m it fischgra t-ähn lich e ingepressten K erben.1998.002.1605.1, F 254, m 2 981/366, I .A . Koll untBer.
597 RS. GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, G rifflappen, H alsbereich geglättet, unterhalb der F ingertupfenleiste geschlickt.1998.002.191.1, F 107, m 2 005/342, G rube Pos. 46.
598 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. fein.1998.002.215.1, F 107, m 2 001/343, G rube Pos. 48.
Katalog der Funde 189
596
598
597
Abb. 194: T ägerw ilen: H ochstross B ereich West. K eram ik M 1:3. E ntw ickelte M itte lbronzezeit 5 8 5 -5 8 8 : Spätbronzezeit 5 8 9 -5 9 5 : H allstattzeit 596; späteFrühbronzezeit / frühe M itte lbronzezeit 597; Spätbronzezeit 598.
190 Katalog der Funde
Tägerwilen: Hochstross. Abb. 195.
599 RS. Schüssel. FeinKcr, innen beige, aussen g raubeige, M ag. fein m it G lim m erzusatz , geglättet, scharfer W andum bruch, scheibengedreht, sekundär verbrannt.1998.002.1410.16. F 166, m 2 993/349, G rube Pos. 99.
600 RS. N apf, aussen grau-orange, innen orange. M ag. m ittclk . bis grob m it G lim m erzusatz , sekundär verbrannt.1998.002.1410.15, F 166, m 2 993 /349, G rube Pos. 99.
601 RS. N apf, ockerfarben . M ag. m it G lim m erzusatz , sekundär verbrannt.1998.002.1410.7, F 166. m 2 993/349, G rube Pos. 99.
602 RS. N a p f oder Becken, rö tl.-b raun bis dunkelgrau . M ag. grob m it G lim m erzusatz , o rganische M agerungsbestand teile?, R andzipfel, OF1 porös, Rand horizontal abgestrichen und m it Fingertupfen verziert, sekundär verbrannt.1998.002.1410.17, F 166, m 2 993 /349, G rube Pos. 99.
603 BS. ockerfarben-rö tk . M ag. m ittelk . b is grob m it G lim m erzusatz , organische M ag.?, OF1 porös, sekundär verbrannt.1998.002.1410.2. F 166. n v 993/349, G rube Pos. 99.
604 W S. FeinKer, aussen b raun-schw arz, innen braun. M ag. mit Scham ott- oder o rganischem Z usatz, m ineralische M ag. g rob . W ulst. 1997.008.46.26, SondS 23.
605 RS, G rapen, grau-schw arz. M ag. m ittelk .1997.008.46.4, SondS 23.
Katalog der Funde 191
Abb. 195: Tägerw ilen: H ochstross. Keram ik M 1:3. L atènezeit 5 9 9 -6 0 4 ; M itte lalter 605.
192 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg. Abb. 196.
606 P feilspitze m it A ufprallbeschäd igung , Silex, hitzeversehrt.1998.013.74.1. F I . m : 301/595. S 200. I .A .
607 A bschlag, re tusch iert, gelber H ornstein.1998.013.4.188. Profil 2. L fm 105, S 300.
608 D olch, ungeg liedert zw einietig . m it N ackenfortsatz und zwei seitlichen R illen. B ronze, m it schöner Patina, 32.8 g.1998.013.248.1. F 1. m 2 300.60/581.85 . S 200, I . + I .A .
609 R ollennadel, B ronze, m it schöner Patina, 11.4 g.1998 .013.247.1 . F 1, m 2 3 0 1.45/501.00, S 200, 1. A.
610 N adelschaftfragm ., B ronze, stark k o rr , 0 ,9 g.1998.013.256.1. F 1, m 2 301.10/572.98, S 200. I .A .
6 1 1 N adelschaftfragm .?. B ronze, m it schöner Patina, 0 ,9 g.1998.013.257.1. F 1. m 2 299/571. OK S 200.
612 S ichelfragm ., B ronze, m it schöner Patina, 5,5 g.1998.013.258.1. F l . m 2 301.85 /591 .70 . S 200. I .A .
613 N agel, B ronze, 3.4 g.1998.013.255.1. F l . m 2 300/568. O K S 200.
614 G eschm olzener K lum pen, B ronze, 13,5 g.1998.013.259.1. F 1, m 2 302.10/586.05. S 200, L A
Katalog der Funde 193
Abb. 196: K reuzlingen: R ibi-B runegg. S ilices M 1:1 ; B ronze M 1:2. N eolith ikum oder B ronzezeit 606 und 607; jü n g ere M itte lbronzezeit 6 0 8 -6 1 4 .
194 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg. Abb. 197.
6 15 RS. K lcingefdss. Tasse?, FeinKer, M ag. m ittclk .. OFI geglättet.1998.013.86.9, F I, m ; 301/583, S 200, I .A .
616 RS, FeinKer, rötl.. M ag. fein.1998.013.132.1. F 1, m 2 301/581, S 200, I .A .
6 17 RS, FeinKer, ockerfarben-grau . M ag. fein.1998.013.36.5. F I, m 2 301/591, S 200, I .A .
618 RS, FeinKer. K nickw andschale , rötl.. M ag. m ittclk.1998.013.156.8, F 1, m 2 301/592, S 200, I .A .
619 RS. FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. m ittelk.1998.013.49.1. F l, m 2 301/570, S 200, I .A .
620 RS. FeinKer, grau. M ag. fein.1998.013.156.1. F 1, m 2 301 /592 , S 200, I .A .
621 RS. FeinKer. grau. M ag. fein.1998.013.80.24, F 1, m 2 301/592, S 200, I .A .
622 RS, FeinKer, grau. M ag. grob.199 8 .0 1 3 .1 1 7 .1 .F I, m 2 300/593, S 200. I .A .
623 RS, FeinKer, g rau . M ag. grob.1998.013.117.2. F 1, m 2 300/593, S 200, I .A .
624 RS, FeinKer, rö tl.-braun, ohne M ag.1998.013.106.1. F 1, n v 300/575, S 200, I .A .
625 RS, FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. fein.1998.013.16.2. F 1, m 2 300/598, S 200, I .A .
626 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1998.013.128.2. F I . m 2 301/579, S 200, I .A .
627 W S, FeinKer, K leingelass, grau. M ag. fein.1998.013.16.1. F 1, m 2 300/598, S 200. I .A .
628 W S, FeinKer, rötl.. M ag. fein, Rillen.1998.013.36.1. F 1, m 2 301/591, S 200, I .A .
629 W S. FeinKer. grau, M ag. m ittelk ., Rillen.1998.013.89.1. F 1, m 2 300/575, oberhalb S 200, l .+ l .A .
630 RS. FeinKer, grau. M ag. fein. R illen.1998.013.151.5. F 1. m 2 301/593, S 200, I .A .
631 W S. K nickw andschale, rö tl., M ag. fein.1998.013.128.7. F 1, m 2 301/579, S 200, I .A .
632 W S, FeinKer. rötl.-braun. M ag. m itte lk ., R illen a u f Schulter.1998.013.106.5. F 1. m 2 300/575, S 200. I .A .
637 W S, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., H enkelfragm .1998.013.161.1. F 1, m 2 301/581. S 200, I .A .
638 W S, Schüssel, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., X -form igcr H enkelansatz, gestaffelte Dreiecke.1998.013.125.1, F I, m 2 301/588, S 200, I .A .
639 W S, FeinKer, grau , M ag. m ittelk ., E instichreihe, gestaffelte Dreiecke.1998.013.32.1. F l . m 2 300/576, S 200.
640 W S, FeinKer, rötl.. M ag. fein. R este von gestaffelten Dreiecken.1998.013.106.6, F l . m 2 300/575, S 200. I .A .
641 W S. FeinKer, g rau . M ag. fein. R este von R itzverzierung.1998.013.87.4. F l . m 2 301/585, S 200. I .A .
642 W S, FeinKer, g rau . M ag. fein. H enkelansatz, R este von R itzverzierung..1998.0! 3 .87.3. F l . m 2 301/585, S 200. I .A .
643 W S. FeinKer. M ag. fein, R este von gestaffelten D reiecken?1998.013.43.3. F l . m 2 300/589, S 200. I .A .
644 W S, FeinKer. g rau . M ag. m ittelk .. R este von S trichverzierung.1998.013.82.7. F l . m 2 301/577. S 200.
645 W S. FeinKer, g rau . M ag. fein, R este von R itzverzierung, D reiecke?1998.013.119.8. F 1, m 2 300/589. S 200. I .A .
646 W S, FeinKer, M ag. fein, R este von R itzverzierung, Z ickzack-M otiv. 1998 .013.108.2 , F I . m 2 299/564. S 200. I . A.
647 W S, FeinKer. g rau . M ag. m itte lk ., R este von R itzverzierung.1998 .013 .112.5, Streufund aus A ushub.
648 W S, FeinKer, rötl.. M ag. fein, E instichreihen und R este von gestaffelten Dreiecken.1998.013.156.7, F 1. m 2 301/592, S 200, I .A .
649 W S, FeinKer, rötl.. M ag. fein, W inkelband.1998.013.123.5, F l . m 2 300/596, S 200, I .A .
650 W S, FeinKer, grau, M ag. fein, R este von Strichverzierung.1998.013.42.1, F l . m 2 3 0 1 /5 9 0 ,5 200, I .A .
651 W S, FeinKer, grau. M ag. fein. R este von R itzverzierung.1998.013.96.8, F l . m 2 301/572, S 200, I .A .
652 W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, R este von R itzverzierung.1998.013.133.4, F l . m 2 301/575. S 200, L A
633 W S, FeinKer, g rau . M ag. fein, Rillen.1998.013.165.1. F l . m 2 301/576. S 200. I .A .
634 W S, FeinKer, g rau . M ag. fein. Rillen.1998.013.133.1. F l . m 2 301/575, S 200, I .A .
635 W S, FeinKer, g rau . M ag. fein, R illen.1998.013.96.2, F 1, m 2 301/572, S 200, I .A .
636 RS, Schüssel, FeinKer, ockerfarben , M ag. fein, H enkel, Rillen, gestaffelte D reiecke.1998.013.156.3. F l . m 2 301/592, S 200, I .A .
Katalog der Funde 195
Abb. 197: K reuzlingen: R ibi-B runegg. K eram ik M 1:3. Jüngere M itte lbronzezeit 6 1 5 -6 5 2 .
1% Katalog der Funde
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg. Abb. 198.
653 W S, K nickw andschale , FcinKcr, m tl.. M ag. fein, flächendeckende K erben und E indrücke m it N adelkopf?1998.013.104.5, F 1, m 2 301/575, S 200, I .A .
654 W S, K nickw andschale , GrKer. g rau . M ag. m ittelk .. verstrichen, E instichreihe , S chulterfragm .?, O rien tie rung schw ierig , auch In terpretation als B oden nicht ausgeschlossen .1998.013.127.2. F 1. m 2 300/596, S 200, I .A .
655 W S, FeinKer, grau , M ag. fein. OF1 geglättet, H enkel, flächendeckende E instichm otive (D reiecke?, vertikale und horizontale Bänder).1998.013.96.1, F 1, m 2 301/572, S 200, I .A .
656 W S, FeinKer, m tl.. M ag. fein, flächendeckende E instichm otive in v ertikalen B ändern.1998.013.119.6. F 1, m 2 300/589, S 200, I .A .
657 W S. FeinKer. m tl.. M ag. fein, flächendeckende, m it spitzem Instrum ent (N adel?) e ingestochene Einstiche.1998.013.104.6. F I . m 2 301/575, S 200. I .A .
658 RS, Topf. G rKer. m tl.-b raun , M ag. sehr g rob , verstrichen, geschlickt.1998.013.118.6, F I . m 2 301/583, S 200. I .A .
659 RS, G rKer, m tl.-b raun . M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.51.1, F 1, m 2 301/570. S 200, I .A .
660 RS, G rK er. m tl.. M ag. g rob, verstrichen.1998.013.164.3. F 1, m 2 301/597, S 200, I .A .
661 RS, GrKer, m tl.-b raun . M ag. grob, verstrichen.1 998 .0 1 3 .1 5 2 .1 ,F 1. m 2 301/584, S 200. I .A .
662 RS. GrKer, g rau . M ag. g rob, verstrichen.1998.013.22.2, F 1. m 2 301/577. S 200, I .A .
663 RS, G rK er, m tl.-b raun . M ag. g rob, verstrichen.1998.013.95.84. F 1. m 2 300/576. S 200. I .A .
664 RS, GrKer. rö tl.-braun, sehr grob, verstrichen.1998.013.121.1, F l . m 2 3 0 0 /5 9 1 ,S 200.
665 RS, GrKer. rötl.-braun. M ag. seh r grob , verstrichen.1998.013.107.2, F I . m 2 301/572, S 200, I .A .
666 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen.1998.013.87.2, F 1, m 2 301/585, S 200, I .A .
667 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen.1998.013.253.1. Profil 2. Lfm 104. S 300.
668 RS, GrKer, grau, o rganische M ag., verstrichen.1998.013.145.2, F l . m 2 301/585, S 200. I .A .
669 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.76.1. F l . m 2 301/576, S 200.
670 RS, GrKer. g rau . M ag. m itte lk ., verstrichen.1998.013.86.1. F 1, m 2 301/583, S 200. I .A .
671 RS, GrKer, ockerfarben-grau , M ag. sehr grob , verstrichen.1998.013.47.1. F 1, m 2 300/594, S 200, I .A .
673 RS, G rK er, grau, M ag. m itte lk ., verstrichen.1998.013.106.7, F I . m 2 300/575, S 200, I .A .
674 RS, Topf, G rK er, ockerfarben-grau , M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.113.131.1. Feld l . m 2 301/583. S 200. I .A .
675 RS, FeinKer, grau. M ag. fein.1998.013.83.1. F l . m 2 300/577, S 200, I .A .
676 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.013.84.3, F 1, m 2 300/580, S 200, I .A .
677 RS, G rK er. rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen.1998.013.139.3, F I . m 2 301/575, S 200, I .A .
678 RS, GrKer. grau. M ag. m itte lk ., verstrichen.1998.013.104.1. F l . m 2 301/575, S 200, I .A .
679 RS, Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. g rob, verstrichen.1998.013.148.9, F 1, m 2 301/582, S 200, I .A .
672 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen. 1998.013.95.103, F 1, m 2 300/576, S 200, I .A .
Katalog der Funde 197
l i n te VH 1 1 v a
Abb. 198: K reuzlingen: R ibi-B runegg. Keram ik M 1:3. Jüngere M itte lbronzezeit 6 5 3 -6 7 9 .
198 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg. Abb. 199.
680 RS, G rK cr, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.93.1. F 1, tn 2 299/566, S 200. I .A .
681 RS, G rK cr. rö tl.-braun, M ag. g rob, verstrichen.1998.013.84.1. F 1. m 2 300/580. S 200. I .A .
682 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.86.6, F 1, m 2 301/583, S 200, I .A .
683 RS, GrKer. rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen. 1998.013.99.37. F 1. m 2 301/574, S 200, I .A .
684 RS, GrKcr. rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen.1998.013.40.2. F 1. m 2 300/587, S 200. I .A .
685 RS. GrKcr. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.158.3, S treufund aus A ushub.
686 RS, Topf. G rK er, rö tl.-braun, M ag. seh r grob, verstrichen.1998.013.85.1. F 1. m 2 301/573, S 200. I .A .
687 RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.156.4, F 1. m 2 301/592. S 200. I .A .
688 RS, G rK er, grau, M ag. sehr grob, verstrichen.1998.013.155.1. F 1, m 2 301/596, S 200, I .A .
689 RS, T o p f G rK er. rö tl.-b raun , M ag. m itte lk ., verstrichen.1998.013.85.9. F l . m 2 301/573. S 200, I .A .
690 RS. GrKer. rö tl.-braun. sehr grob , verstrichen.1998.013.155.3, F 1, in 2 301/596, S 200, I .A .
691 RS, GrKer, grau , M ag. g rob, verstrichen.1998.013.35.1. F 1, m 2 301/570, S 200, I .A .
692 RS. G rK er. rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.134.4, F 1, m 2 301/574. S 200. I .A .
693 RS, G rK er. grau . M ag. g rob , verstrichen.1998.013.34.1. F l . m 2 301 /571 , S 200, I .A .
694 RS, G rKer, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.013.147.1. F l . m 2 301/572, S 200, I .A .
695 RS, G rKer. rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verstrichen.1998.013.158.2. S treufund aus A ushub.
696 RS, G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.158.4, S treufund aus Aushub.
697 RS, G rKer. grau, M ag. grob, verstrichen.1998.013.117.4, F l . m 2 300/593. S 200. I .A .
698 RS, G rKer. grau, M ag. grob, verstrichen.1998 .0 1 3 .1 3 0 .1 ,F l . m 2 301/585, S 200, I .A .
699 RS, G rKer. rötl.-braun, M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.164.3. F 1. m 2 301/597. S 200. I .A .
703 RS. G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen.1998.013.157.1. F 1, m 2 301/582, S 200, I .A .
704 RS, G rK er, braun-grau . M ag. grob, verstrichen.1998.013.128.1. F l . m 2 301/579. S 200. I .A .
705 RS, G rK cr, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen.1998.013.152.2. F 1. m 2 301/584, S 200. I .A .
706 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen.1998.013.86.3, F 1, m 2 301/583, S 200. I .A .
707 RS. G rK er, grau, M ag. grob, verstrichen.1998.013.164.4. F I . m 2 301/597, S 200. I .A .
708 RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen.1998.013.155.4. F l . m 2 301/596, S 200, I .A .
709 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.84.9, F 1. m 2 300/580, S 200. I .A .
710 RS, G rK er, g rau , M ag. sehr grob, verstrichen, geschlickt.1998.013.82.1, F l . m 2 301/577, S 200.
711 RS, G rK er, rötl.. M ag. sehr grob, verstrichen.1998.013.13.12, F 1. m 2 300/597, S 200, I .A .
712 RS. G rK er, rö tl.-braun, sehr grob, verstrichen.1998.013.73.1, F 1, m 2 301/591. S 200. I .A .
713 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob , verstrichen.1998.013.99.2, F l . m 2 301 /574, S 200, I .A .
714 RS, G rK cr, rö tl.-b raun . M ag. grob, verstrichen.1998.013.9.2, F l . m 2 300/593. S 200. I .A .
715 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.9.1, F 1, m 2 300/593, S 200, I .A .
716 RS, GrKer, g rau . M ag. sehr grob, verstrichen. 1998.013.104.56, F l . m 2 301/575, S 200. I .A .
717 RS, Topf, rö tl.-braun, M ag. grob.1998.013.254.1. Profil 2. S 300.
718 RS. GrKcr, rö tl.-b raun . M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.013.85.8. F l . m 2 301/573, S 200. I .A .
719 RS, Schale. FeinKer, grau . M ag. fein.1998.013.127.1, F l . m 2 300 /596. S 200. I .A .
720 RS, Topf, GrKcr, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.013.91.1. F l . m 2 301/574. S 200. I .A .
721 RS, Topf, GrKer. grau. M ag. sehr grob, verstrichen.1998.013.134.7, F 1, m 2 301/574, S 200, I .A .
722 RS, G rK cr, rö tl.-b raun . M ag. sehr grob, verstrichen.1998.013.1 1 1 .1 ,F l . m 2 300 /575. S 200.
700 RS, G rKer, rötl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.19.2. F l . m 2 300 /588 , S 200, I .A .
701 RS, G rKer, rötl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.106.2, F l . m 2 300 /575. S 200. I .A .
702 RS, G rKer, grau. M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.13.1. F l . m 2 300 /597 . S 200. I .A .
Katalog der Funde 199
Abb. 199: K reuzlingen: R ibi-B runegg. K eram ik M 1:3. Jüngere M itte lbronzezeit 6 8 0 -7 2 2 .
200 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Ribi-Brunegg. Abb. 200.
723 RS, Z y linderhalsgefäss? , G rK er, ockerfarben-grau . M ag. grob, verstrichen.1998.013.244.2, P rofil 2, S 300.
724 RS. FeinKer. grau. M ag. fein.1998.013.95.4, F 1, m 2 300/576, S 200, I .A .
725 RS. G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.013.155.5, F 1. m 2 301/596, S 200, I .A .
726 RS, G rK er, rö tl.-braun, M ag. grob , verstrichen.1998.013.19.1. F I, m 2 300/588. S 200, I .A .
727 RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen.1998.013.156.2, F 1. m 2 301/592, S 200, I .A .
728 RS, G rKer, grau. M ag. g rob , verstrichen. F ingertupfen a u f Rand.1998.013.46.1, F 1, m 2 300/594, S 200, I .A .
729 R S .T opf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittclk ., verstrichen, F ingertupfen au f Rand.1998.013.252.1. Profil 2, S 300.
730 RS, G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen. Fingertupfen a u f Rand.1998.013.16.3, F 1, m 2 300/598, S 200, I .A .
731 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen, Fingertupfen a u f Rand.1998.013.155.2, F I . m 2 301/596, S 200, I .A .
732 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.157.4, F 1, m 2 301/582, S 200, I .A .
733 RS, GrKer. rö tl.. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.134.6, F 1. m 2 301/574. S 200, I .A .
734 RS, GrKer, rö tl.-b raun , M ag. sehr grob, verstrichen, geschlickt.1998.013.130.2. F 1, m 2 301/585. S 200, I .A .
735 RS, G rK er, m tl.. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.250.1. Streufund.
736 RS, G rK er, g rau . M ag. g rob , verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.123.1. F 1. m 2 300/596, S 200, I .A .
737 RS, rötl.. M ag. sehr grob. F ingertupfen a u f Rand.1998.013.15.3, F 1, m 2 300/598, S 200, I .A .
738 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, geschlickt, F ingertupfen randl., verstrichen.1998.013.42.2, F 1. m 2 301/590, S 200, I .A .
739 RS, GrKer, rötl.-braun. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen au f Rand.1998.013.45.1, F 1. m 2 301/593, S 200, I .A .
740 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.85.7. F 1, m 2 301/573, S 200, I .A .
741 RS. GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen. F ingertupfen au f Rand.1998.013.49.2, F F m 2 301/570, S 200. I .A .
742 RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen. F ingertupfen a u f Rand.1998.013.148.18, F 1, m 2 301/582, S 200, I .A .
743 RS, GrKer, rötl.-braun. M ag. m ittclk .. verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.43.1, F 1. m 2 300/589. S 200. I .A .
744 RS. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittclk ., verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.158.1, S treufund aus A ushub.
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.134.5, F 1. m 2 301/574, S 200, I .A .
RS, G rK er. ockerfarben-grau . M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.19.7, F I, m 2 300/588, S 200, I .A .
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen. F ingertupfen a u f Rand.1998.013.123.2, F 1, m 2 300/596, S 200, I .A .
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen. F ingertupfen a u f Rand.1998.013.37.5. F 1, m 2 300/589, S 200, I .A .
RS, GrKer, grau . M ag. sehr g rob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.013.145.1. F 1, m2 301/585, S 200, I .A .
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.249.1. P rofil 2, S 300.
RS, G rK er. grau, M ag. grob, verstrichen, Fingertupfen a u f Rand.1998.013.105.1. F I . m 2 301/580, S 200, I .A .
RS, G rK er, M ag. sehr grob, rötl., verstrichen, gem essener R anddurchm esser ca. 4 0 -5 0 cm.1998.013.16.4, m 2 300/598, S 200. I .A .
W S, G rK er, grau. M ag. sehr grob, verstrichen, Fingertupfenleiste.1998 .0 1 3 .1 6 0 .1 .F 1, m 2 301/594, S 200, I .A .
W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen.1998.013.113.2 .F 1, m 2 301/594, S 200. I .A .
W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. m ittclk ., verstrichen. F ingertupfenleiste .1998.013.55.3, F 1. m 2 299/567, S 200, I .A .
W S, G rK er, bräunt.. M ag. grob. F ingertupfenleiste , verstrichen.1998 .013 .111.4, S treufund aus A ushub.
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, F ingertupfenleiste.1998.013.104.7, F 1, m 2 301/575, S 200. I .A .
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob , verstrichen, F ingertupfenleiste.1998.013.19.9, F 1. m 2 300/588, S 200, I .A .
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.F ingertupfenleiste .1998.013.19.4, F l . m 2 300 /588, S 200. I .A .
W S, G rK er, rö tl.-b raun , M ag. g rob, verstrichen.F ingertupfenleiste.1998.013.159.1. F l . m 2 301/597. S 200, I .A .
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob, verstrichen,F ingertupfenleiste .1998.013.130.5, F l . m 2 301/585, S 200. I .A .
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, F ingertupfenleiste.1998.013.150.2. F l . m 2 301 /585 , S 200, I .A .
W S, G rK er, rötl.. M ag. g rob , verstrichen.F ingertupfenleiste .1998.013.145.10, F l . m 2 301/585. S 200, I .A .
W S, G rK er, grau, M ag. g rob, verstrichen,F ingertupfenleiste .1998.013.148.25, F 1, m 2 301/582, S 200, I .A .
W S, G rK er, ockerfarben-grau . M ag. grob, verstrichen.1998.013.105.3. F I. m 2 301/580, S 200. I .A
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
Kakilog der Funde 201
Abb. 200: K reuzlingcn: R ibi-B runegg. K eram ik M 1:3. Jüngere M itte lb ronzezeit 7 2 3 -7 6 5 .
202 Katalog der Funde
Kreuzungen : Ribi-Brunegg. Abb. 201.
766 W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verstrichen, F ingertupfenleiste.1998.013.4.1, Profil 2. L fm 105, S 300.
767 W S. FeinK cr?. rö tl.-braun, o rganische M ag.. gekerbte Leiste. 1998.013.4.108, Profil 2. Lfm 105, S 300.
768 W S. G rK er. rö tl.-braun, M ag. sehr g rob , verstrichen, verzw eigte Leisten.1998.013.162.1, F I . n r 301/596. S 200. L A .
769 W S. GrKer. hart. M ag. grob , verstrichen, glatte Leiste.1998.013.156.5, F I . m 2 301/592, S 200, L A .
770 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, G rifflappen und F ingertupfenleiste .1998.013.123.3, F 1, m 2 300/596, S 200, I .A .
771 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen. Leiste und E instichreihe.1998.013.148.7, F 1. m 2 301/582. S 200, I .A .
772 W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen, flächendeckende F ingertupfen.1998.013.46.36, F I. m 2 300/594. S 200. L A .
773 W S. G rK er. rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen. Fingertupfenreihe.1998.013.85.35, F 1, m 2 301/573, S 200. L A .
774 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, flächendeckende F ingertupfen.1998.013.108.1, F 1. m 2 299/564. S 200. L A .
775 W S, G rK er, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen, flächendeckende Fingernagelkerben.1998.013.86.7, F 1. m 2 301/583, S 200, I .A .
776 W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, flächendeckende F ingertupfen.1998.013.148.8, F I. m 2 301/582. S 200, I .A .
777 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verstrichen, Spatelrauhung.1998.013.95.10, F 1. m 2 300/576, S 200, I .A .
778 W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, Spatelrauhung.1998.013.106.3, F I . m 2 300/575, S 200, I .A .
779 RS, GrKer. rötl.-braun, M ag. grob, verstrichen, Henkel.1998.013.148.1, F 1. m 2 301/582, S 200, L A .
780 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verstrichen, A nsatz eines H enkels.1998.013.79.1, F 1, m 2 301/581. S 200.
781 W S, G rK er, rö tl.-b raun , M ag. sehr grob, verstrichen, G rifflappen.1998.013.85.19. F 1. m 2 301/573, S 200. I .A .
785 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. seh r grob, verstrichen. Rest von randständ igem H enkel oder G rifflappen.1998.013.84.2, F 1, m 2 300/580, S 200, L A .
786 W S. G rK er. rö tl.-b raun . M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.013.127.4, F 1, m 2 300/596, S 200. I .A .
787 W S. G rK er. ockerfarben-grau . M ag. g rob , verstrichen, G rifflappen.1998.013.19.5. F 1. m 2 300/588, S 200. I .A .
788 RS, K alottenschale. FeinKcr. g rau . M ag. m ittelk .. aussen geglättet, innen verw ittert.1998.013.21.1. F 1, m 2 301/388, S 200, I .A .
789 RS. K alottenschale. G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.013.252.2, Profil 2, S 300.
790 RS, FcinK er?. K alottenschale, M ag. g rob , OF1 verw ittert.1998.013.39.1. F I. m 2 300/588. S 200. L A .
791 RS. K alo ttenschale. G rK er. rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.013.95.36, F l . m 2 300/576, S 200, I .A .
792 RS, K alottenschale. G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen. 1998.013.119.33, F 1. m 2 300/589, S 200. L A .
793 RS, K alottenschale, G rK er, rö tl.-braun. M ag. fein, verstrichen.1998.013.104.13, F 1, m 2 301/575. S 200. I .A .
794 RS. K alottenschale, rö tl.-braun, M ag. grob.1998.013.104.42, F 1. m 2 301/575, S 200. L A .
795 BS, FeinKer. ockerfarben-grau , M ag. fein.1998.013.148.4. F l . m 2 301/582, S 200. L A .
796 BS, G rK er. ockerfarben-grau , M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.013.127.3, F 1. m 2 300/596, S 200. I .A .
797 BS, FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. fein.1998.013.95.1, F 1, m 2 300 /576, S 200, I .A .
798 BS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen.1998.013.95.20, F I. m 2 300/576, S 200, L A .
799 BS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.013.95.37. F 1, m 2 300/576, S 200. I .A .
800 W ebgew ichtfragm ., M ag. grob.1998.013.102.1, F l . m 2 300/577, S 200.
801 RS, FeinKer, röm isch . 1. Jh. n .C hr. (S chucany-M artin -K ilchner 1999, Taf. 65.24), rötl.. ohne M ag.. a u f D rehscheibe gefertig t. OF1 aussen geglättet.1998.013.149.3, F 1. m 2 301/586, S 200, L A
782 H enkelfragm ., g rau . M ag. fein.1998.013.113.1. F 1. m 2 301/594, S 200, L A .
783 W S, ockerfarben-grau . M ag. grob. A nsatz eines Henkels.1998.013.42.8, F l . m 2 301/590. S 200, L A .
784 W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, G rifflappen.1998.013.51.9, F l . m 2 301/570, S 200, I .A .
Katalog der Funde 203
Abb. 201 : K reuzlingen: R ibi-B runegg. K eram ik M 1:3. Jüngere M ittelbronzezeit 7 6 6 -8 0 0 . Röm isch 801
204 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi-Girsbergtunnel. Abb. 202.
802 RS. T rich tcrrandgefäss, FeinKer, m tl. bis dunkelgrau , M ag. fein, geglättet.1999.009.39.1. Ber. Süd. F 223. m 2 799/36, S 300, I .A .
803 RS, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein.1999.009.42.2. Ber. Süd, F 253. m 2 798/41, S 300. 1. A.
804 W S. FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein. OF1 verw ittert, R este von lang gezogenen D reiecken.1999.009.20.3. Ber. Süd. F 223. m 2 799/36, S 300. I .A .
805 W S, FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein, OF1 geglättet, R este von lang gezogenen Dreiecken.1999.009.15.4. Ber. Süd. F 193. m 2 799/32. S 300.
806 W S. FeinKer. dunkelgrau . M ag. m ittclk .. R este von lang gezogenen D reiecken.1999.009.2.3. Ber. Süd, F 193, m 2 799/34, S 300, I .A .
807 W S. FeinKer. g rau . M ag. fein , R este von flächendeckender R itzverzierung.1999.009.62.1, Ber. Süd, F 253, m 2 800/41, S 300, I .A .
808 W S, FeinKer, grau-braun . M ag. fein, OF1 verw ittert, A nsatz eines H enkels oder G rifflappens, R este von R itzverzierung.1999.009.31.3. Ber. Süd. F 193. m 2 799/33, S 300. I .A .
809 W S, FeinKer, ockerfarben . M ag. m ittclk .. kerbschnittähnlich eingepresstc Dreiecke.1999.009.20.2, Ber. Süd, F 223, in 2 799/36, S 300. I .A .
810 W S, FeinKer, ockerfarben . M ag. m ittelk ., verw ittert, g latte Leiste au f Schulter. R este von R itzverzierung.1999.009.15.6, Ber. Süd, F 193, m 2 799/32, S 300.
811 W S, FeinKer, m tl., M ag. m ittelk ., OF1 verw ittert, g latte L eiste au f Schulter.1999.009.15.5. Ber. Süd, F 193, m 2 799/32, S 300.
812 RS. G rK er, m tl., M ag. m ittelk.1999.009.2.1, Ber. Süd, F 193. m 2 799/34. S 300. I .A .
813 RS, G rK er, m tl.-b raun . M ag. g rob , OF1 verstrichen.1999.009.15.1, Ber. Süd, F 193, m 2 799/32, S 300. I .A .
814 RS, GrKer. m tl.-b raun . M ag. sehr grob , F ingertupfen a u f Randlippe.1999.009.31.1, Ber. Süd, F 193, m 2 799/33, S 300, L A .
815 RS. GrKer. rötl.-braun. M ag. grob. F ingertupfen a u f R andlippe.1999.009.22.1, Ber. Süd. F 223. m 2 799/35. S 300, I .A .
816 RS, GrKer, g rau . M ag. sehr grob.1999.009.14.1, Ber. Süd, F 252. m 2 793/41. S 300. I .A .
821 RS, G rK er, m tl., M ag. m ittclk . b is grob.1999 .009.34 .1 . Ber. Süd. F 253. m 2 799/40, S 300, I .A .
822 RS, G rK er. grau-braun , M ag. grob.1999.009.25.2, Ber. Süd, F 253, m 2 797/41, S 300, I .A .
823 RS, G rK er. rö tl.-b raun . M ag. grob. OF1 geschlickt.1999.009.75.1. Ber. Süd. F 253, m 2 801/40, S 300, 1. A.
824 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. g rob, sehr unregelm ässig gearbeitet.1999.009.63.1. Ber. Süd, F 253, S 300, 1. A
825 RS, K alottenschale, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, OF1 grob verstrichen.1999.009.33.1. Ber. Süd, F 253, n r 799/41, S 300, I .A .
826 RS, K alo ttenschale. F e in -o d er G rK er. grau. M ag. m itte lk ., verw ittert.1999.009.39.2. Ber. Süd. F 223. m 2 799/36, S 300. I .A .
827 W S. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. flächendeckende Fingertupfen.1999.009.31.5, Ber. Süd, F 193, m 2 799/33. S 300. I .A .
828 W S, FeinKer, dunkelgrau . M ag. m ittelk ., verw ittert, R iefe und R este von K am m strich.1999.009.1.2. Ber. Süd. F 193. m 2 799/31, S 300. I .A .
829 RS, Schrägrandgefäss, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob.1999.009.31.2. Ber. Süd, F 193. m 2 799/33, S 300, I .A .
830 RS, Schrägrand- oder Z y lindcrhalsgefäss, G rK er, rö tl.-braun. Mag. sehr grob.1999.009.27.1. Ber. Süd, F 193. m 2 799/33, S 300. I .A .
831 RS, GrKer. grau. M ag. grob . A nsatz eines Henkels.1999.009.16.1. Ber. Nord, F 705. m 2 812/15, S 300. I .A .
832 RS, Schale, FeinKer, grau . M ag. grob, verw ittert, Z ickzack-M otiv au f Rand, R iefenbänder a u f Innenseite der W andung.1998.003. 85.1, Ber. N ord, SondS 3.
833 RS, Schulterbecher, FeinKer, bräun!.. M ag. m ittclk .. OF1 geglättet, R este von K am m strich.1998.003.204.1. Ber. Nord. SondS 1.
834 W S. Schulterbecher?, FeinKer. m tl.. M ag. fein, verw ittert.1999.009.91.1. Ber. Nord. F 705. m 2 807/15, S 300.
835 RS, S chrägrandgefäss, G rKer, rö tl.-braun. M ag. fein, K erben a u f Rand.1998.003.197.1. Ber. Nord. SondS 1.
817 RS, G rK er, g rau . M ag. grob , OF1 geschlickt.1999.009.79.1, Ber. S ü d F 253. m 2 8 0 0 /4 1. S 300, 1. A.
818 RS, GrKer, grau, M ag. grob, OF1 geschlickt.1999.009.34.2, Ber. S ü d F 253. m 2 799/40, S 300, I .A .
8 19 RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. sehr g rob , sehr unregelm ässig gearbeitet.1999.009.15.2, Ber. S ü d F 193, m 2 799/32, S 300. I .A .
820 RS, GrKer. rötl.-braun. M ag. sehr grob.1999.009.75.2. Ber. S ü d F 253. m 2 801/40, S 300, I .A .
Katalog der Funde 205
Abb. 202: K reuzlingen/T ägerw ilen . R ibi-G irsbergtunnel. K eram ik M 1:3. Jüngere M itte lbronzezeit 8 0 2 -8 2 4 ; Jüngere M itte lbronzezeit oder Spätbronzezeit8 2 5 -8 2 7 ; Spätbronzezeit 8 2 8 -8 3 0 ; M itte lbronzezeit 831; Spätbronzezeit 8 3 2 -8 3 5 .
206 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 203.
836 RS. Schale, rö tl.-braun. M ag. fein, innen geglättet, verw ittert, Z ickzack-B änder.1998.003.28.1. F 94. Pos. 3. n r 833/71, S 200. I .A .
837 RS. Schale. FeinKer, d tm kelgrau. M ag. fein.1998.003.27.2. F 94. Pos. 3, n r 833/72, S 200, I .A .
838 RS. Schale. FeinKer, hart. M ag. m ittelk .. innen geglättet, aussenverstrichen. Z ickzack-M otiv.1998.003.58.1, F 94, Pos. 3, m 2 833/71, S 200, I .A .
839 RS. Schale, FeinKer, ockerfarben, M ag. fein.1998.003.32.1, F 94, Pos. 3, n r 834/73, S 200, I .A .
840 RS, Schale, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., fein verstrichen.1998.003.32.2. F 94, Pos. 3, n r 834/73. S 200, 1. A.
841 RS, Schale, grau. M ag. m ittelk .1998.003 .32 .3 . F 94 . Pos. 3. n r 834/73. S 200 . 1. A.
842 RS, Schale, FeinKer, grau . M ag. m ittelk .1998.003.45.2, F 94 . Pos. 3. n r 833/72 . S 200 . I .A .
843 RS, Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein.19 9 8 .0 0 3 .3 8 .1, F 94 . Pos. 3. n r 835/73. S 200 . 1. A.
844 W S, Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein, Z ickzack-M otive. 1998.003.33.30. F 114. Pos. 3. n r 835/75, S 200. I .A .
845 W S, Schale, FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein, aussen grob verstrichen, innen geglättet.1998.003.27.1, F 94. Pos. 3, n r 833/72, S 200, I .A .
846 W S, Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen. R iefen.1998.003.49.1, F 94, Pos. 3, n r 833/72, S 200, I .A .
847 W S, Schale, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, innen geglättet, aussen grob. R iefen. E instichreihe.1998.003.51.7. F 94, Pos. 3, m 2 8 3 3 /7 1. S 200, 1. A.
848 W S. Schale, grau. M ag. fein. R iefen.1998.003.32.18. F 94. Pos. 3. n r 834/73, S 200, I . A.
849 RS, Topf, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, OFI geglättet.1998.003.40.1, F 94, Pos. 3, n r 833/72, S 200. I .A .
850 W S, Schulterbecher, FeinKer, grau, M ag. fein.1998 .003.51.8 . F 94. Pos. 3, n r 833/71 . S 200 . I . A.
851 W S, Schulterbecher, g rau . M ag. fein. Riefen.1998.003.51.9. F 94, Pos. 3, n r 833/71, S 200, I .A .
852 W S. FeinKer. Schulterbecher?, dunkelgrau . M ag. fein. R iefen.1998.003.32 .17 , F 94, Pos. 3. n r 834/73, S 200, 1. A.
853 BS, FeinKer, rö tl.-braun, M ag. fein.1998.003.51.13, F 94, Pos. 3. n r 833/71. S 200, I .A .
854 RS, GrKer, rötl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen. F ingertupfen a u f Rand.1998.003.23.39. F 94 , Pos. 3, n t2 834/72, S 200, I . A.
RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen. F ingertupfen a u f Rand.1998.003.30.1, F 94. Pos. 3. n r 833/72 , S 200, I .A .
RS. Topf, GrKer. rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., R and innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.49.2, F 94. Pos. 3. n r 833/72. S 200, 1. A.
RS. Topf. GrKer, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen. Kerben a u f Rand.1998.003.56.2. F 94. Pos. 3, n r 832/72 , S 200. I .A .
RS. Topf, G rK er, ockergrau . M ag. g rob , verstrichen, K erben a u f Rand.1998.003.40.3. F 94. Pos. 3. n r 833/72 . S 200. 1. A.
RS. Topf. rö tl.b raun . M ag. grob , K erben a u f Rand. F ingertupfen au f R andum bruch.1998.003.40.2. F 94, Pos. 3. n r 833/72, S 200, 1. A.
BS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. seh r g rob, verstrichen.1998.003.56.3, F 94 , Pos. 3, m 2 832/72, S 200, I . A.
RS, D eckel, GrKer, rö tl.-braun, verstrichen, F ingertupfenleiste .1998.003.44.1, F 94, Pos. 3. n r 835/71, S 200. I .A .
Spinnw irte l, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.003.51.43. F 94. Pos. 3. m 2 833/71. S 200 . I . A.
RS, Schale, FeinKer. grau. M ag. fein, V erzierung m it E instichreihe. Riefe.1998 .003 .41 .12, F 94 , Pos. 4. n r 835/70, S 200.
RS, G rK er, ockerfarben . M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.003.41.1, F 94. Pos. 4. m 2 835/70. S 200.
RS, Topf, 14. Jh. n .C hr., sehr hart, rötl.. M ag. fein.1998.003.60.1, F 94, Pos. 4. n r 835/70. S 200. 1. A.
RS, Schüssel, 15. Jh., sehr hart, ohne M ag.. Innenseite grün glasiert ohne Engobe.1998.003.60.2, F 94. Pos. 4. n r 835/70, S 200. 1. A.
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
855 RS, GrKer, rö tl.-b raun , verstrichen.1998.003.44.2, F 94, Pos. 3, n r 835/71, S 200, I .A .
Kiitcilog der Funde 207
Abb. 203: Tägerw ilen: Ribi. K eram ik M 1:3. Spätb ronzezeit 8 3 6 -8 6 5 : M itte lalter 866 und 867.
208 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 204.
868 RS. Schale, FcinKer, sehr hart, dunkelgrau . R iefen, E instichreihe, 888Z ickzack-M otive, Schrägstrichdreiecke.1997.008.58.3. SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 5 -7 6 . S 200. I .A .
889869 RS. Schale, FcinKer. dunkel-g rau . M ag. fein, Z ickzack-M otiv.
1998.003.1.8. F 94. Pos. 2. n r 835/74, S 200.890
870 RS, Schale, FcinKer. rö tl.-braun. M ag. fein, beidseitig geglättet, Z ickzack-M otiv.1998 .003 .2 .1. F 94 . Pos. 2. n r 836/74, S 200. 8 9 1
871 RS. Schale. FcinKer, grau. M ag. fein.1998.003.2.4. F 94. Pos. 2. n r 836/74. S 200. 892
872 RS, Schale, FcinKer, grau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.1.101. F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200.
873 RS, Schale, FeinKer. dunkelg rau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1997.008.58.2, SondS 30. Pos. 2, Lfm 7 5 -7 6 , S 200, L A .
874 RS. Schale, FcinKer, dunkelgrau . M ag. fein, beidseitig geglättet.1997.008.56.3, SondS 30, Pos 2. Lfm 7 6 -7 9 , S 200 O K , I .A .
875 RS, Schale, FcinKer, rö tl.-b raun , M ag. fein, be idse itig geglättet.1998.003.25.10. F 94 . Pos. 2. n r 836/73 . S 200. I .A .
876 RS, Schale. FcinKer. dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.1.5, F 94, Pos. 2. m 2 835/74, S 200.
877 RS. Schale, FeinKer, ockerfarben , ohne Mag.19 9 8 .0 0 3 .1.3, F 94. Pos. 2 .n f 835/74. S 200.
878 RS, Schale. FeinKer. ohne M ag.1998.003.1.100, F 94, Pos. 2. n r 835/74 , S 200.
879 RS. Schale. FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein, beidseitig geglättet.1998.003.2.5, F 94 . Pos. 2. n f 836/74. S 200.
880 RS, Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein , beidseitig geglättet.1998.003.2.6. F 94 . Pos. 2. m 2 836/74. S 200.
8 8 1 RS, Schale, FeinKer, hart, rö tl.-b raun , aussen verstrichen, innen geglättet.1997.008.58.1, SondS 30. Pos. 2, Lfm 7 5 -7 6 , S 200. I .A .
882 RS, Schale, FcinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1997.008.56.2, SondS 30, Pos. 2. Lfm 7 6 -7 9 , S 200 OK. I .A .
883 RS, Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein, aussen verstrichen, innen geglättet.1997.008.57.1. SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 , S 200 OK. 1. A.
884 RS, Schale, FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.2.2. F 94 . Pos. 2. n r 836/74. S 200.
885 RS, Schale, dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.109.4, F 114. Pos. 2, n r 835/75, S 200. I .A .
886 RS, Schale, FeinKer. dunkelgrau . M ag. m ittelk.1997.008.57.5, SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 , S 200 O K . I .A .
W S, Schale, FeinKer, dunkelg rau . M ag. fein , E instichreihe, R iefen.1998.003.1.15, F 94. Pos. 2, n r 835/74, S 200.
W S. Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein, E instichreihen .1998.003.24.46. F 94, Pos. 2. n r 835/74. S 200, 1. A.
BS. Schale, FeinKer, ockerfarben. M ag. fein. R iefen.1998.003.1.12. F 94, Pos. 2. n r 835/74, S 200.
RS. K alottenschale, FeinKer, ockerfarben .1998.003.1.14, F 94, Pos. 2, m 2 835/74, S 200.
RS, Tasse?, G rK er, dunkelgrau , M ag. grob, verstrichen.1997.008.58.9. SondS 30. Pos. 2, Lfm 7 5 -7 6 . S 200. L A
887 BS, Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. m ittelk ., E instichreihen , Z ickzack-M otiv, R iefen.1998.003.25.17, F 94, Pos. 2, n r 836/73, S 200, 1. A.
210 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 205.
893 RS. Schüssel, FeinKcr, b raun-grau . M ag. m ittelk ., H enkel. R iefen, E instichreihen.1998.003.131.1. F 1 14. Pos. 2, m 2 834/77, S 200, I .A .
894 W S, Schüssel, FcinKer, g rau . M ag. m itte lk ., R iefen. E instichreihen.1997.008.56.6. SondS 30. Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 . S 200 O K , I .A .
895 W S. Schüssel, FcinKer, dunkelgrau , M ag. fein, R iefen, Z ickzack- Motiv.1998.003.25.24. F 94. Pos. 2. m 2 836/73, S 200. 1. A.
896 W S, Schulterbecher, FcinKer, grau. M ag. fein. R iefen.1998.003.108.21, F 114, Pos. 2, m 2 835/76, S 200, I .A .
897 W S, FcinKer, dunkelgrau . M ag. fein. R iefen.1998.003.2.25, F 94. Pos. 2, m 2 836/74. S 200.
898 RS, Topf, FcinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, geglättet.1997.008.57.8, SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 , S 200 O K , I .A .
899 W S, rö tl.-braun, M ag. fein. Leiste.1997.008.57.9, SondS 30, Pos. 2. Lfm 7 6 -7 9 , S 200 OK. I . A.
900 BS, FcinKer. ockerfarben . M ag. m ittelk.1998.003.1.7, F 94. Pos. 2, m 2 835/74, S 200.
901 BS, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .1997.008.57.65, SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 , S 200 O K , I .A .
902 RS, G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen.1997.008.56.7, SondS 30. Pos. 2. Lfm 7 6 -7 9 , S 200 OK , L A .
903 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.003.108.10, F 114. Pos. 2, m 2 835/76, S 200, L A .
904 RS, Topf, G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.003.25.11. F 94, Pos. 2. m 2 836/73, S 200, L A .
905 RS, Z y linderhalsgefdss? , G rK er, rö tl.-braun, verstrichen, OF1 fein verstrichen.1997.008.57.2, SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 , S 200 O K . I .A .
906 RS. GrKer. rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen.1998.003.108.100, F 114. Pos. 2, m 2 835/76, S 200, L A .
907 RS, Topf, G rK er, ockerfarben. M ag. grob, verstrichen.1998.003.1.4, F 94. Pos. 2, m 2 835/74, S 200.
908 RS, GrKer. dunkelgrau . M ag. m itte lk ., verstrichen.1998.003.25.3, F 94, Pos. 2, m 2 836/73, S 200, I .A .
909 RS, Topf, G rK er. b raun-grau . M ag. grob, verstrichen.1998.003.19.1, F 94, Pos. 2. m 2 835/75, S 200, L A .
910 RS. Topf, GrKer, rö tl.-braun, M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen im R andum bruch, Kerben a u f Rand.1998.003.108.17, F 114, Pos. 2, m 2 835/76, S 200, L A
212 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 206.
9 1 1 RS. Topf. G rK er, ockerfarben. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen a u f R andum bruch, K erben a u f Rand.1998.003.25.13, F 94, Pos. 2, i r r 836/73, S 200, I .A .
912 RS, Topf, G rK er, ockerfarben. M ag. fein, verstrichen, Kerben a u f Rand und a u f R andum bruch.1998.003.25.4. F 94. Pos. 2, m 2 836/73, S 200, 1. A.
913 RS, Topf. G rK er, rö tl.-braun, verstrichen, E instichreihe a u f R andum bruch.1998.003.25.7. F 94. Pos. 2, m 2 836/73, S 200, I .A .
914 RS, Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen. Kerben a u f Rand und K erben in F ischgräten-M otiv a u f R andum bruch.1998.003.23.1. F 94. Pos. 2, m 2 834/72. S 200. I .A .
915 RS. Topf, G rK er. ockerfarben , M ag. g rob , verstrichen. K erben a u f Rand und R andum bruch.1998.003.25.5. F 94 . Pos. 2. m 2 836/73, S 200. I .A .
916 RS, Topf. G rK er, ockerfarben, sehr g rob, verstrichen, Kerben au f Rand.1997.008.57.4. SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 6 -7 9 . S 200 O K . 1. A.
917 RS, Topf, G rK er, ockerfarben. M ag. grob, verstrichen, K erben au f Randum bruch.1998.003.2.10. F 94. Pos. 2, m 2 836/74, S 200, I .A .
918 RS, Topf, G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1997.008.58.5, SondS 30, Pos. 2. Lfm 7 5 -7 6 , S 200, I .A .
919 RS, Topf, G rKer, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, K erben a u f R and und R andum bruch.1997.008.58.4, SondS 30, Pos. 2, Lfm 7 5 -7 6 , S 200, 1. A.
920 RS, Topf. G rK er, ockerfarben. M ag. grob, verstrichen, K erben a u f Rand und R andum bruch, N adelkopfeindrücke?1998.003.56.1. F 94 . Pos. 2. m 2 832/72. S 200. I .A .
921 RS, Topf, G rK er, ockerfarben . M ag. g rob, verstrichen. F ingertupfen randlich.1998.003.108.14, F 114, Pos. 2. m 2 835/76, S 200. I .A .
922 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen. F ingertupfen au f Rand.1998.003.1.60, F 94, Pos. 2, m 2 835/74. S 200. L A .
923 RS, Topf, GrKer, rö tl.-b raun , M ag. grob, verstrichen, K erben a u f Rand. F ingcrtupfcnleiste a u f R andum bruch.1998.003.7.3, F 94, Pos. 2. m 2 834/74, S 200, I .A .
924 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, R este von flächendeckenden Kerben.1998.003.56.16, F 94, Pos. 2, m 2 832/72, S 200, I .A .
925 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, H enkelansatz.1997.008.57.72, SondS 30. Pos. 2. Lfm 7 6 -7 9 , S 200 O K , 1. A.
926 V asenkopfnadel m it to rd iertem Schaft. B ronze. 9,35 g.1998.003.196.1. F 114. Pos. 2, m 2 835.24/78 .47, S 200. L A
Katalog der Funde 213
Abb. 206: T ägerw ilen: Ribi. B ronze M 1:2. Keram ik M 1:3. Spätbronzezeit 9 1 1 - 922 und 9 2 4 -9 2 6 ; Spätbronzezeit / H allstattzeit 923.
214 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 207.
927 RS. FcinKcr. M ag. fein.1998.003.109.2, F 114. Pos. 2, n r 835/75 , S 200. I .A .
928 RS. T rich tcrrandgcfäss. g rau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.109.7, F 114. Pos. 2, n r 835/76 .47 , S 200. I .A .
929 RS. FeinKcr. ockerfarben-braun , ohne M ag.1998.003.108.6, F 114. Pos. 2. n r 835/76. S 200. I .A .
930 RS, FeinKer, dunkelgrau . M ag. g rob , aussen geglättet.1998.003.108.3, F 114, Pos. 2, m 2 835/76, S 200, I .A .
931 RS, Schulterbecher, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.108.1, F 114. Pos. 2. n r 835/76, S 200, I .A .
932 W S. Schulterbecher, rö tl.-braun, M ag. fein, altern ierende Schrägstrichgruppen a u f Schulter.1998.003.13.19, F 94. Pos. 2, n r 835/74, S 200, 1. A.
933 W S. Schulterbecher, dunkelgrau , M ag. fein, horizon tale und schräg verlaufende R iefen.1998.003.29.15, F 114. Pos. 2, m 2 836/75, S 200, I .A .
934 W S, Schulterbecher, schw arz. M ag. fein, R iefen.1998.003.33.61. F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
935 W S. Schulterbecher, FeinKer, grau. M ag. fein, aussen geglättet, horizontal und schräg verlaufende R iefen.1998.003.50.5, F 94. Pos. 2. n r 836/74. S 200. I .A .
936 W S, Schüssel, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, E instichreihen , R iefen. 1998.003.24.27, F 94, Pos. 2, n r 835/74 , S 200, I .A .
937 W S, FeinKer, dunkelg rau , ohne M ag., R iefen.1998.003.12.37. F 94 . Pos. 2, n r 835/73 . S 200. I .A .
938 W S, FeinKer, ockerfarben . M ag. fein.1998.003.116.41. F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
939 W S. FeinKer. grau, M ag. fein, R iefen.19 9 8 .0 0 3 .2 2 .13. F 94. Pos. 2. m 2 836/73. S 200. I . A.
940 H enkel, FeinKer, g rau . M ag. fein.1998.003.33.9. F 114. Pos. 2, n r 835/75. S 200. I .A .
941 RS, Schale. FeinKer, ockerfarben . M ag. m ittelk ., innen geglättet, aussen verstrichen, Schrägstrichdreiecke a u f Rand.1998.003.24.2. F 94, Pos. 2. n r 835/74. S 200, 1. A.
942 RS, Schale, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., Zickzack-M otiv.1998.003.109.12, F 114, Pos. 2, m 2 835/75, S 200, I .A .
943 RS, Schale, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, Z ickzack-M otiv a u f Rand.1998.003.109.6, F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
944 RS, Schale. FeinKer, hart, ockerfarben . M ag. fein, Z ickzack-M otiv a u f Rand.1998.003.24.73, F 94, Pos. 2, n r 835/74 , S 200, 1. A.
945 RS, Schale, GrKer, rötl.-braun. M ag. fein, verstrichen, sehr unregelm ässiger Rand.1998.003.108.4, F 114, Pos. 2, n r 835/76, S 200, I .A .
946 RS, Schale, FeinKer, grau, M ag. m ittelk ., F ingerdellen a u f A ussenseite , innen geglättet.1998.003.17.4, F 94, Pos. 2, m 2 836/74, S 200, I .A .
947 RS, Schale. FeinKer, dunkelgrau , ohne M ag.1998.003.13.1, F 94. Pos. 2. m 2 835/74, S 200, I . A.
948 RS, Schale. FeinKer, grau. M ag. fein.1998 .003 .50 .1, F 94, Pos. 2. n r 836/74, S 200. 1. A.
949 RS, Schale, FeinKer. ockerfarben-grau . M ag. fein.1998.003.12.4, F 94, Pos. 2, m 2 835/73, S 200, I . A.
RS, Schale, FeinKer, grau. M ag. fein.1998.003.17.100, F 94, Pos. 2, n r 836/74. S 200, I .A .
RS, Schale, FeinKer, ockerfarben. M ag. m ittelk .1998.003.24.12, F 94. Pos. 2. n r 835/74, S 200. I .A .
RS, Schale, FeinKer, grau. M ag. m ittelk.1998.003.116.9, F I 14. Pos. 2. n r 835/75, S 200, I .A .
RS, Schale. FeinK er dunkelgrau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.109.10, F 114, Pos. 2, n r 835/75 , S 200. 1. A.
RS. FeinKer, grau. M ag. m ittelk ., aussen verstrichen, innen geglättet.1998.003.13.3, F 94 . Pos. 2, m 2 835/74. S 200 , I .A .
RS, Schale, FeinKer, ockerfarben-grau , M ag. fein.1998.003.24 .23 , F 94. Pos. 2. m 2 835/74. S 200. I . A.
RS, Schale, FeinKer, ockerfarben. M ag. fein.1998.003.18.8, F 94 . Pos. 2. m 2 836/74, S 200. I .A .
RS. Schale, FeinKer. g rau . M ag. grob.1998.003.136.4. F 114, Pos. 2, m 2 836/75. S 200, I .A .
RS. Schale, FeinKer, grau. M ag. m ittelk ., innen geglättet, aussen verstrichen. A nsatz e ines G rifflappens?1998.003.24.3, F 94 . Pos. 2. m 2 835/74. S 200 . 1. A.
RS. Schale, FeinKer, ockerfarben. M ag. fein.1998.003.120.1, F 114. Pos. 2, n r 835/76, S 200, I .A .
RS. Schale, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein, beidseitig geglättet.1998.003.17.101, F 94, Pos. 2, m 2 836/74. S 200, I .A .
RS, Schale, FeinKer, ockerfarben. M ag. fein, beidseitig geglättet.1998 .003 .12.5. F 94 . Pos. 2. m 2 835/73. S 200. I . A.
RS. Schale. FeinKer, dunkelgrau , ohne M ag.1998.003.14.3, F 94 . Pos. 2. m 2 835/74. S 200. I . A.
RS, Schale, FeinKer, grau. M ag fein.1998.003.17.3, F 94. Pos. 2. n r 836/74. S 200, 1. A.
RS, Schale, FeinKer, ockerfarben , M ag. fein.1998.003.24.5. F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200, I .A .
RS, Schale. FeinKer, ockerfarben. M ag. m ittelk.1998.003.24.6. F 94 . Pos. 2. n t2 835/74. S 200. I .A .
RS, Schale, FeinKer, g rau . M ag. fein.1998.003.50.4, F 94, Pos. 2. n r 836/74, S 200. 1. A.
RS. Schale, FeinKer, dunkelg rau . M ag. fein.1998.003.24.56, F 94. Pos. 2, m 2 835/74, S 200, I .A .
RS, Schale, dunkelg rau , M ag. grob, aussen grob verstrichen, innen geglättet.1998.003.109.38, F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
RS, Schale, FeinKer. dunkelgrau . M ag. m ittelk ., beidseitig geglättet.1998.003.24.100. F 94. Pos. 2, n r 835/74, S 200. I .A .
RS, Schale. FeinKer. g rau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.24.22, F 94. Pos. 2, m 2 835/74, S 200, I .A .
RS, Schale, FeinKer, dunkelg rau . M ag. grob.1998.003.109.9, F 114. Pos. 2, m 2 835/75, S 200, I .A .
RS, Schale, FeinKer. g rau . M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.136.100. F 114, Pos. 2, n r 836/75, S 200. 1. A
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
Katalog der Funde 215
Abb. 207: T ägerw ilen: Ribi. K eram ik M 1:3. M itte lb ronzezeit 927 und 928; Spätbronzezeit 9 2 9 -9 7 2 .
216 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 208.
973 RS. Schale. FeinKcr. dunkelgrau , M ag. fein.1998.003.33.100, F 114. Pos. 2, n v 835/75 , S 200. I .A .
974 RS, Schale, FeinKer, dunkelgrau .1998.003.24.14, F 94. Pos. 2. m 2 835/74. S 200, I .A .
975 RS, Schale, FeinKer, grau. M ag. fein.1998.003.13.102. F 94. Pos. 2. n r 835/74, S 200, I .A .
976 RS. Schale. FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein.1998.003.24.1, F 94, Pos. 2, m 2 835/74, S 200. I .A .
977 RS, Schale. FeinKer, ockerfarben , M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.33.1, F 114, Pos. 2, m 2 835/75, S 200, I .A .
978 RS, Schale, FeinKer. dunkelg rau , M ag. fein.1998.003.108.12. F 114. Pos. 2. n r 835/76, S 200. I .A .
979 RS. Schale, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.13.100, F 94. Pos. 2, n v 835/74. S 200, I .A .
980 RS, Schale, FeinKer, g rau . M ag. fein.1998.003.116.10, F 1 14. Pos. 2, n r 835/75, S 200. I .A .
981 W S. Schale, FeinKer, hart. M ag. fein. R iefen.1998.003.24.63, F 94, Pos. 2. n r 835/74. S 200, I .A .
982 RS. Schale, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein, beidseitig geglättet.1998.003.109.5, F 114, Pos. 2, n r 835/75. S 200, I .A .
983 RS, Schale, FeinKer, ockerfarben . M ag. fein, beidseitig grob geglättet.1998.003.24.20, F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200. I .A .
984 RS. K alottenschale, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein.1998.003.14.2, F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200, 1. A.
985 RS. K alo ttenschale, FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.109.1. F 1 14, Pos. 2, n r 835/75, S 200. I .A .
986 RS. K alo ttenschale, rö tl.-braun. M ag. fein.1998.003.13.101, F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200. I .A .
987 RS, K alo ttenschale. FeinKer, grau. M ag. fein.1998.003.12.2, F 94, Pos. 2. n r 835/73 , S 200 . I .A .
988 RS. Tasse?, FeinKer, grau. M ag. fein.1998.003.50.3, F 94. Pos. 2. m 2 836/74, S 200. I .A .
989 RS, Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, doppelte Reihe m it F ingertupfen a u f R andum bruch.1998.003.116.5. F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
990 RS, Topf, G rK er, grob, rö tl.-braun, verstrichen, Fingertupfen a u f Rand.1998.003.109.15. F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200. I .A .
991 RS, Topf. G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.003.109.18, F 114, Pos. 2. n r 835/75. S 200. I .A .
992 RS, Topf, GrKer. rötl.-braun, M ag. m ittelk ., verstrichen, K erben au f Rand.1998.003.109.27, F 114. Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
993 RS. Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen. Fingertupfen a u f R and und a u f R andum bruch.1998.003.33.7, F 114. Pos. 2, m 2 835/75. S 200. I .A .
994 RS, Topf, GrKer, ockerfarben. M ag. grob, verstrichen, Fingertupfen randlich.1998.003.116.7, F 1 14, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I .A .
995 RS, Topf. G rK er, rö tl.-braun. M ag. fein, verstrichen, Kerben au f Rand.1998.003.138.1. F 114. Pos. 2, n r 835/74 , S 200. 1. A.
996 RS, Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, Kerben au f Rand, F ingertupfen a u f R andum bruch.1998.003.18.4, F 94, Pos. 2, n r 836/74, S 200, I .A .
997 RS, Topf. GrKer, ockerfarben. M ag. g rob , verstrichen. Fingertupfen randlich.1998.003.10.1. 94/114, Pos. 2. m 2 835/75, S 200, I .A .
RS. Topf, G rK er. grau . M ag. g rob , verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.003.108.15, F 1 14, Pos. 2, n r 835/76, S 200, 1. A.
RS. Topf, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen, K erben a u f Rand.1998.003.120.5, F I 14, Pos. 2. n r 835/76, S 200, I .A .
RS, Topf, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob , verstrichen, K erben a u f Rand.1998 .003 .18.3, F 94. Pos. 2, m 2 836/74, S 200, I . A.
RS, Topf, G rK er. ockerfarben . M ag. grob, verstrichen. K erben au f Rand.1998.003.109.17, F 114. Pos. 2. n r 835/75, S 200. I .A .
RS, Topf, G rK er, rö tl.-braun. Mag. grob, verstrichen, K erben a u f Rand.1998.003.14.1, F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200, I .A .
RS, Topf, G rK er. hart. M ag. grob, verstrichen , K erben a u f Rand.1998.003.109.200, F 114, Pos. 2, n r 835/75 . S 200, I .A .
RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen. K erben a u f Rand.1998.003.136.2, F 114. Pos. 2, n r 836/75, S 200, I .A .
RS. Topf, GrKer. ockerfarben . M ag. m ittelk ., verstrichen, Kerben au f Rand. F ingertupfen a u f R andum bruch.1998.003.109.20, F 114, Pos. 2. m 2 835/75. S 200, I .A .
RS, T öpfchen m it Flenkel, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, Kerben a u f R andum bruch, N adelkopfeindrücke.1998.003.24.8, F 94 . Pos. 2, m 2 835/74. S 200. I .A .
RS. G rK er. ockerfarben . M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.003.109.24, F 114, Pos. 2, n r 835/75, S 200, I . A.
RS. Topf, rö tl.-braun. M ag. grob.1998.003.109.25, F 114. Pos. 2, m 2 835/75, S 200, I .A .
RS. Topf, G rK er, hart, rö tl.-braun, verstrichen.1998.003.19.2, F 94 . Pos. 2. m 2 835/75, S 200. I .A .
RS, Topf, G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.003.12.3, F 94 , Pos. 2, m 2 835/73. S 200. I .A .
RS, Topf, G rK er, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.003.50.20. F 94, Pos. 2. n f 836/74 , S 200, I .A .
RS. Topf. G rK er, grau . M ag. g rob , verstrichen.1998.003.13.4, F 94, Pos. 2, n r 835/74, S 200, I .A .
RS, T rich terrandgefäss, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.003.108.13. F 114. Pos. 2. n r 835/76, S 200, I .A .
RS, T rich terrandgefäss, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen.1998.003.108.8, F 114. Pos. 2 ,m 2 835/76. S 200. I .A .
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob, verstrichen.1998.003.24.4, F 94, Pos. 2, m 2 835/74. S 200, 1. A.
RS, Topf. GrKer, bräunl.. M ag. grob, verstrichen.1998.003.109.21, F 114. Pos. 2, m 2 835/75, S 200, I .A .
W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. g rob, verstrichen, gekerbte Leiste. 1998.003.17.12, F 94, Pos. 2. n r 836/74, S 200, I .A .
H enkel, GrKer, ockerfarben . M ag. grob, verstrichen.1998.003.116.2, F 114, Pos. 2, m 2 835/75, S 200, I .A .
W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob, verstrichen, flächendeckende Fingertupfen.1998.003.24.28. F 94, Pos. 2, n f 835/74, S 200, 1. A.
W S. Schrägrandgetass?, GrKer. rötl.. M ag. g rob , verstrichen, F ingertupfen a u f R andum bruch.1998.003.24.29, F 94. Pos. 2, m 2 835/74, S 200, I. A
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1 0 1 0
1011
1 0 1 2
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
218 Katalog der Fände
Tägerwilen: Ribi. Abb. 209.
1021 RS. Schale, FeinKer, ockerfarben , M ag. fein.1997.008.55.1. SondS 30. Lfm 7 2 -7 6 , S 200. I .A .
1022 RS, Schale. FeinKer. rö tl.-b raun , M ag. m ittclk.1997.008.55.6. SondS 30, Lfm 7 2 -7 6 . S 200, I .A .
1023 RS. Schale, FeinKer. ockerfarben-grau . M ag. fein.1998.003.42.1. F 94. m 2 833/73. S 200, 1. A.
1024 RS. Schale. FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein, geglättet.1998.003.133.1. F 114. n r 836/75, S 200.
1025 RS, Schale. FeinKer. rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1998.003.121.1. F 1 1 4 ,m 2 836/76. S 200. I .A .
1026 W S. Schulterbecher, rö tl.-braun, M ag. fein, geglättet, K am m strich, R iefen. 1997.008.70.1. SondS 32, Lfm 1 8 -2 8 . a lter B odenhorizont.
1027 RS. Topf, G rK er, rö tl.-braun, M ag. seh r grob, verstrichen.1998.003.174.1. F 1 14. m 2 834/76, S 200, I .A .
1028 RS, Topf, G rK er. rö tl.-grau . M ag. seh r grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1997.008.59.5. SondS 30, Lfm 6 8 -7 2 . S 200.
1029 RS, Topf, GrKer. ockerfarben. M ag. m ittelk ., verstrichen1997.008.55.5. SondS 30, Lfm 7 2 -7 6 . S 200, I . A.
1030 RS, Topf, G rK er, rö tl.-b raun , M ag. grob, verstrichen, K erben au f R and und R andum bruch.1998.003.134.1. F 114, m 2 833/76. S 200. I .A .
1031 BS, G rKer, rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1997.008.65.1. SondS 31, L fm 57, a lter B odenhorizont.
1032 BS, G rKer. rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1997.008.63.1. SondS 30, Lfm 57, a lter B odenhorizont.
Katalog der Funde 219
/ 1028
Abb. 209: Tägerw ilen: Ribi. K eram ik M 1:3. M itte lbronzezeit 1030 und 1031; Spätb ronzezeit 1 021 - 1029, 1032.
220 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 210.1053 RS, G rK cr, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.
1033 RS, T rich terrandgefass, ockerfarben . M ag. fein. 1998.003.150.2, F 332. m - 824/130, S 200. 1. A.1998.003.87.1, F 312. m 2 821/129, S 200, 1.+ I .A .
1054 RS. G rK cr. dunkelgrau , M ag. g rob , verstrichen.1034 RS, Topf. G rK er. ockerfarben . M ag. fein, fein verstrichen. 1998.003.140.2, F 332. m 2 824/130. S 200. I .A .
1998.003.140.1, F 332, n r 824/130, S 200. I .A .1055 RS, Topf, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, K erben a u f
1035 RS. T rich terrandgefass? . FeinKcr. ockerfarben . M ag. fein. Rand.1998.003.151.100, F 332, m 2 823/130, S 200. I .A . 1998.003.164.1. F 332. m 2 821/130, S 200, I .A .
1036 W S, T rich terrandgefass? , FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein, geglättet. 1056 RS. Topf, GrKer, ockerfarben . M ag. grob, aussen grob verstrichen,1998.003.148.3. F 332, m : 822/130. S 200. I. A. R andinnenseite fein verstrichen, K erben a u f Rand.
1998.003.73.2, F 312, m 2 821/128, S 200, 1.+ L A1037 RS. Schultergefass, FeinKer. b räunt., M ag. fein, aussen geglättet.
E instich- und K erbreihen.1998.003.144.3, F 332, m 2 823/130, S 200, 1. A.
1038 W S, FeinKer, dunkelgrau . M ag. fein. Rillen.1998.003.72.2, F 312, m 2 822/127, S 200, 1.+ I .A .
1039 RS, Schale, FeinKer, seh r hart. M ag. fein, beidseitig geglättet.1998.003.82.2. F 312. m 2 823/128. S 200. I .A .
1040 RS. Schale. FeinKer. dunkelgrau . M ag. fein, beidseitig geglättet.1998.003.87.2, F 312, m 2 821/129. S 200. 1.+ I .A .
1041 RS, Schale, FeinKer, hart, dunkelgrau , beidseitig geglättet.1998.003.151.2. F 332, m 2 823/130, S 200, I .A .
1042 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verstrichen.1998.003.84.3, F 312, m 2 822/128, S 200. 1.+ I .A .
1043 RS. Becher. G rK er. dunkelgrau . M ag. g rob, verstrichen, grob gefertigt.1998.003.156.1, F 332. m 2 821/130, S 200. I .A .
1044 RS, Topf, GrKer. bräunt.. M ag. sehr grob. z.T. mit R undkieseln bis 1 cm D urchm esser gem agert, verstrichen, geschlickt, sehr unregelm ässiges P rofil, F ingertupfen a u f Rand.1998.003.139.1. F 332, m 2 823/130, S 200. I .A .
1045 RS, Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen unterhalb Rand.1998.003.74.1. F 312, m 2 824/129, S 200. I .A .
1046 RS. Topf, G rK er, b räunt., M ag. g rob , verstrichen. F ingertupfenleiste unterhalb Rand.1998.003.145.1. F 332. m 2 823/134, S 200. I .A .
1047 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1998.003.69.2, F 312, m 2 823/129, S 200, I .A .
1048 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, F ingertupfen au f Rand.1998.003.151.4. F 332, m 2 823/130. S 200. I . A.
1049 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, verstrichen, F ingertupfen au f Rand.1998.003.150.1. F 332. m 2 824/130, S 200, I .A .
1050 RS. GrKer, rötl.. M ag. grob, verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.003.73.1. F 312. m 2 821/128. S 200. 1.+ I .A .
1051 RS, GrKer, grau. M ag. grob, verstrichen.1998.003.82.3. F 312. m 2 823/128, S 200. I .A .
1052 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verstrichen.1998.003.74.2. F 312. m 2 824/129. S 200. I .A .
Katalog der Funde 221
.1033 1034 1035 1036
/
J / L
\ 1037
1038
1040 x 1041
1039
1042
1043
,0'p
1044
1045 1046
1047 1048
gm1049 1050 1051 1052 1053 1054
1055 1056
Abb. 210: T ägerw ilen: Ribi. K eram ik M 1:3. M itte lbronzezeit 1 0 3 3 - 1054; Spätbronzezeit 1055 und 1056.
222 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 211.
1057 P feilspitze m it A ufprallschäden, rö tl.-g rauer P lattensilex , 1078 BS, G rK cr. rö tl.-braun, M ag. sehr grob, verstrichen,durchschim m ernd, K ortexreste. 1998.003.91.5, Felder 312. 313, 333. 334. S 200, I . A.1998.003.177.1. F 312. n r 825.20/128.10, UK S 220, OK S 230. 1. A.
1058 RS, Schale. FeinKcr, dunkelgrau . M ag. fein.1998.003.91.9, Felder 312, 313, 333, 334. S 200, I .A .
1059 RS, Schale, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein.1998.003.91.2. Felder 312, 313, 333. 334, S 200, I .A .
1060 RS, Schale, FeinKcr, aussen verstrichen, innen geglättet.1998.003.100.1. F 313, n f 826/126, S 200, I .A .
1061 RS, Schale, FeinKer, ockerfarben . M ag. fein.1998.003.102.1. F 3 1 3 , n r 826/127, S 200, 1. A.
1062 RS, Schale, FeinKcr, dunkelgrau , M ag. fein, innen geglättet, aussen verstrichen.1998.003.96.1. F 313. n r 825/126, S 200. I .A .
1063 RS, FeinKcr, ockerfarben . M ag. fein.1998.003.91.100. Felder 3 1 2 .3 1 3 ,3 3 3 , 334. S 200, 1. A.
1064 RS. FeinKer, ockerfarben . M ag. fein.1998 .003 .95 .2 . F 3 13. n r 826/126, S 200. I . A.
1065 RS. Topf, FeinKer, dunkelgrau , M ag. grob, aussen geglättet.1998.003.90.1, F 313, n r 825/129, S 200 UK, I .A .
1066 W S, FeinKer, ro th -braun . M ag. m ittelk ., R iefen.1998.003.91.35, Felder 3 1 2 ,3 1 3 , 333, 334. S 200, 1. A.
1067 W S, FeinKer, ockerfarben . M ag. fein, R iefen. Z ickzack-M otiv.1998 .003 .91.6, Felder 3 12 ,3 1 3 , 333. 334, S 200, I . A.
1068 W S, Schulterbecher?, FeinKer, ockerfarben , M ag. fein, R iefen.1998.003.91.24, Felder 3 1 2 ,3 1 3 , 333, 334, S 200, I . A.
1069 RS, Topf, GrKer, rö tl.-braun. M ag. g rob , verstrichen, F ingertupfen a u f Rand.1998.003.96.2, F 3 13. n r 825/126, S 200, I .A .
1070 W S, FeinKer. Schulterbecher?, dunkelgrau . M ag. fein, K erbreihe,R ille, Riefe.1998.003.91.7, Felder 312, 313, 333, 334, S 200, I .A .
1071 RS, Topf, G rK er, braun. M ag. grob, verstrichen. F ingertupfen au f Rand.1998.003.91.8, Felder 312, 313, 333, 334, S 200, I .A .
1072 RS, G rK er, ockerfarben , M ag. fein, verstrichen.1998.003.91.4, Felder 3 1 2 ,3 1 3 ,3 3 3 ,3 3 4 ,5 200, 1. A.
1073 RS, GrKer, grau, M ag. grob, verstrichen.1998.003.92.1, F 313, m 2 825/129, S 200. I .A .
1074 W S, G rKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, geschlickt.1998.003.154.6, F 333, m 2 825/130. S 200, I. A.^
1075 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen, G rifflappen.1998.003.98.4. F 333. m 2 825/128. S 200. 1. A.
1076 BS, GrKer. rö tl.-braun, ohne M ag., verstrichen.1998.003.91.11, Felder 312, 313, 333, 334, S 200, I .A .
1077 M ondhorn , Fussfragm .1998.003.91.1. Felder 312, 313, 333, 334, S 200, 1. A
Katalog der Funde 223
Abb. 211 : T ägerw ilcn: Ribi. S ilices M 1:1. K eram ik M 1:3. N eo lith ikum oder B ronzezeit 1057: Spätbronzezeit 1 058 -1078 .
224 Katalog der Funde
Tägerwilen: Ribi. Abb. 212.
1079 Silex, Kern, ge lber H ornstein, unregelm ässig abgebau ter Kern.1997.008.66.5, Streufund.
1080 RS, G rK er, grau, M ag. grob, verstrichen.1998.003.119.33, Felder 115/116, n r 835/76, S 200. I .A .
1081 RS. Topf. G rK er. ockerfarben , M ag. m itte lk ., Ofl fein verstrichen.1998.003.26.7, F 95, B aggerabtrag .
1082 W S, Schulterbecher, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., Rillen.1998.003.26.4, F 95, beim B aggerabtrag .
1083 RS, Schulterbecher, ockerfarben , M ag. fein.1998.003.26.2, F 95. beim B aggerabtrag.
1084 RS, Schale, FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein. Z ickzack-B and a u f Rand.1998.003.113.1. F 114. n r 836/73, S 200.
1085 RS, Schale. FeinKer, ockerfarben-grau . M ag. fein, verw ittert.1998.003.171.2, F 114, n r 834/77, S 200.
1086 RS. Schale, FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein.1998.003.126.1. F 114. n r 834/78. S 200.
1087 RS, K alo ttenschale, G rK er?, grau, M ag. m ittelk , verstrichen.1998.003.171.1. F 114, in 2 834/77, S 200.
1088 RS. G rK er, rö tl., M ag. g rob , verstrichen. F ingertupfen a u f Rand. Streufund.
1089 RS. Topf. GrKer. rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verstrichen, K erben a u f Rand und a u f R andum bruch.1998 .003 .34 .1. F 94, m 2 835/72, S 200, I . A.
1090 R S .T opf. rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., F ingertupfen a u f Rand.1998.003.107.5, F 114. n r 835/77. S 200. I .A .
1091 W S. GrKer, eisenzeitlich oder röm isch, g rau . M ag. m ittelk ., verstrichen, g rober K am m strich.1998.003.110.13, F 114. n r 833/79, S 200, I .A .
1092 RS, Topf, röm isch?, ockerfarben , scheibengedreht.1998.003.48.1. S treufund.
1093 RS, N apfkachel, 15. Jh ., rötl.1998.003.137.1. F 114. m 2 832/77, S 200, I .A .
1094 R inglein, B ronze. 2,13 g.1998.003.187.1. S treufund.
1095 Fibelfragm ., B ronze, röm isch, spätes 1 - frühes 3. Jh. n .C hr., 4 .94 g.1998.003.195.1. Streufund.
1096 A nhänger, B ronze, röm isch?, 3,21 g.1997.008.75.1 l .S o n d S 32.
Katalog der Funde 225
1080
1082
1081
1083
10791084 1085 1086 1087 1088
"7
1089
1090 1091 1092
1093
1094 O,
\ e a ! 1095 1096
Abb. 212: T ägerw ilen: Ribi. Silices M 1:1; B ronze M 1:2; K eram ik M 1:3. N eolith ikum oder B ronzezeit 1079: M itte lbronzezeit 1080, 1081; Spätbronzezeit 1 0 8 2 -1 0 9 0 , 1094; R öm isch 1091.1092, 1095, 1096; M ittelalter 1093.
226 Katalog der Funde
Tägerwilen: Spuelacker. Abb. 213.
1097 RS, Fein Rer. ockerfarben , M ag. fein bis m ittelk.1999.006.6.2, Ber. Nord. Profil I . S 4 .
1098 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob.1999.006.6.2, Ber. Nord. Profil 1, S 4.
1099 RS, GrKer, ockerfarben . M ag. grob.1999 .006 .1.2, Ber. N ord, Profil 1, S 4.
1100 W S, FeinKcr, K nickw andschale, b räun!.-ockerfarben. M ag. m ittelk ., G rifflappen.1999.006.6.3, Ber. Nord, Profil I , S 4.
1101 W S. GrKer, grau-braun . M ag. grob. R este von flächendeckenden Ritzlinien.1999.006.1.7. Ber. Nord, Profil 1 .S 4 .
1102 W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. Reste von flächendeckenden R itzlinicn.1999.006.1.1. Ber. Nord, Profil 1 .S 4 .
1103 W S, G rK er, rö tl.-braun, M ag. m ittelk .. R est e iner Fingertupfenleiste .1999.006.1.3, Ber. Nord. Profil 1, S 4 .
1104 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. R eihe m it F ingernagelkerben.1999.006.1.5. Ber. Nord. Profil I . S 4 .
1105 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, flächendeckende F ingernagelkerben.1999.006.1.4, Ber. Nord. Profil 1, S 4.
1106 W S, GrKer, ockerfarben . M ag. m itte lk ., flächendeckende F ingernagelkerben.1999.006.6.6, Ber. Nord, Profil 1, S 4.
1107 W S. GrKer. braun-grau , M ag. grob, flächendeckende F ingernagelkerben.1999.006.6.5, Ber. Nord. Profil I .S 4 .
1108 W S, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. flächendeckendc Fingernagelkerben.1999.006.1.6, Ber. Nord. Profil 1, S 4.
1109 W S. G rKer, ockerfarben . M ag. m ittelk ., flächendeckende F ingernagclkcrben.1999.006.6.7, Ber. Nord, Profil 1, S 4.
1110 BS. GrKer. rötl, M ag. grob., geschlickt.1999.006.6.4, Ber. Nord. Profil 1, S 4.
1111 BS. GrKer, g rau . M ag. m ittelk.1999.006.6.20. Ber. Nord, Profil 1. S 4.
1112 K linge, c rem efarbener Silex.1999.006.1.100. Ber. Nord, Profil 1, S 4.
1113 RS, FeinKer, rö tl.-braun, M ag. m ittelk.1999.006.9.3, Ber. Süd. Profil 2, S 3.
1114 W S, GrKer. K nickw andschale, dunkelgrau . M ag. grob. H enkelansatz, flächendeckende F ingernagelkerben.1999.006.7.1. Ber. Süd. Profil 2, S 3.
1115 W S. GrKer, rö tl.-b raun , M ag. grob. R este von flächendeckenden R itzlinien.1999.006.4.2. Ber. Süd. Profil 2. S 3.
1116 RS, Schale. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verrundet.1999.006.4.10. Ber. Süd, Profil 2. S 3.
1117 RS, FeinKer, g rau . M ag. m ittelk.1999.006.5.15, Ber. Süd. Profil 2, S 3.
1118 RS, Topf. G rK er. rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1999.006.10.1. Ber. Süd, Profil 2. S 3 .
1119 BS. R eibschale, rot, Innenseite m it Q uarzkörnern .1999.006.9.1. Ber. Nord, Profil I. S 2 oben.
1120 RS, Topf, dunkelgrau , D rchrillcn.1999.006.100.1. S treufunde Ber. Nord.
1121 RS, Topf, dunkclgrau , von H and aufgebaut und au fT öpfersche ibe überdreht.1999.006.3.1. S treufund Ber. Nord.
Abb. 213: Tägerw ilen: Spuelacker. S ilices M 1:1. Keram ik M 1:3. Frühe M itte lbronzezeit 1097-1115; Spätbronzezeit 1116-1118; R öm isch 1119: M ittclal- ter 1120 und 1121.
228 Katalog der Funde
Tägerwilen: Trafostation. Abb. 214.
1122 K linge, g rau e r Silex, hitzeverschrt.1997.053.49.46. S 3 .
1123 RS, Schale, m tl.-b raun . OF1 verw ittert. Z ickzack-M otiv a u f R and und a u f W andung, R este eines G irlandcn-M otives in K am m strichtechnik.19 9 7 .0 5 3 .5 0 .1 ,5 3.
1124 RS, Schale. FeinKer, m tl.. M ag. fein.1997.053.52.200, S treufund Aushub.
1125 RS, Schale, FeinKer, m tl.-b raun . M ag. fein, verw ittert.1997.053.50.6, S 3 .
I 126 W S, FeinKer, ohne M ag., verw ittert. R este eines Z ickzack-M otives.1997.053.50.16, S 3.
1 127 W S, Schulterbecher, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein, um laufende R iefen, R este von R itzverzierung.1997.053.49.4. S 3 .
1128 BS. FeinKer. rö tl.-b raun . M ag m ittelk ., verw ittert.1997.053.50.12. S 3 .
1 129 RS, S chrägrandtopf. G rK er, rö tl.-b raun . M ag. seh r g rob, verstrichen, Kerben a u f Randlippe.19 9 7 .0 5 3 .5 0 .8 0 .S 3 .
1130 RS, S ch räg rand top f oder Z y linderhalsgefass, G rKer. ockerfarben . M ag. grob, verstrichen.1997.053.53.1, S 3 .
1131 RS. S chrägrandtopf. G rK er, rötl.. M ag. sehr grob, verstrichen, F ingertupfen a u f R andlippe.1997.053.52.23. S 3 .
1132 RS, S chrägrandtopf. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verstrichen, F ingertupfen a u f Randlippe.1997.053.53.2, S treufund A ushub.
1133 RS, S chrägrandtopf, GrKer. b räunt.. M ag. fein, verstrichen. F ingertupfen a u f Randlippe.1997.053.50.8. S 3 .
1134 RS, S chrägrandtopf. GrKer, ockerfarben . M ag. sehr grob, verstrichen. F ingertupfen a u f R andlippe. Kerben im R andum bruch.1997.053.50.10. S 3 .
1135 RS, S chrägrandtopf. G rK er, M ag. m itte lk ., verstrichen, mit N adelschaft eingepresste K erben a u f R andlippe?1997.053.50.3, S 3 .
1136 RS, S ch räg rand top f oder Z y linderhalsgefass, sehr grosses G elass, D urchm esser 50 cm oder grösser.1997.053.50.247, S 3 .
1137 W S, S chrägrandtopf, GrKer, ockerfarben . M ag. grob, au f R andum bruch m it N adelkop f eingepresste V erzierung.1997.053.49.44. S 3 .
1138 W S, S chrägrandtopf, GrKer, rö tl.-braun, M ag. m itte lk ., a u f R andum bruch m it N adelkop f eingepresste V erzierung. 1997.053.50.107, S 3 .
1139 W S. R andum bruch eines Schrägrandgefässes, G rKer, rötl.-braun. M ag. m ittelk.1997.053.51.1, S 3 .
Tägerwilen: Müller-Thurgau-Strasse.
1140 RS. Schale, dunkelg rau b is schw arz. M ag. fein m it G lim m erzusatz , A ussenseite teilw. stark verw ittert, scheibengedreh t, S-förm ig pro filie rt, m it zwei um laufenden R iefen verziert.1998.039.1.1, G rabungsfläche 1, aus gelbem Lehm , I. A btrag.
1141 RS, FeinKer, dunkelbraun, im B ruch g rauer Kern, M ag. fein m it G lim m erzusatz , verw ittert, R and verdickt, M ündungsdurchm esser und R andstärke unbestim m bar, O rien tie rung unsicher.1998.039.3.1. Streufund.
1142 W S, FeinKer, rötl. bis g rau . M ag. fein m it G lim m erzusatz , stark verw ittert, K reisstem pelm otiv?1998.039.1.15, G rabungsfläche I . aus gelbem Lehm , 1. A btrag.
1143 RS, G rK er, A ussenseite fleckig, rötl. b is dunkelgrau . M ag. m ittelk. m it G lim m erzusatz , stark verw ittert, Rand leicht verdickt. R andstärke 5,9 m m , O rien tierung unsicher.1998.039.1.8, G rabungsfläche I . aus gelbem Lehm . I . A btrag.
I 144 W S, G rKer, dunkelg rau bis braun. M ag. m ittelk .. A nsatz eines Henkels.1997.054.13, aus KS w estl. M üller-T hurgaustr.. 1. A.
1145 RS, G rK er, rötl., M ag. grob m it G lim m erzusatz , verw ittert, Rand leicht ausbiegend, M ündungsdurchm esser unbestim m bar. R andstärke 9,8 m m .1998.039.1.3, F 1, aus gelbem Lehm , 1. A.
Katalog der Funde 229
1122
1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 2 5 1____ ) i l W
1 1 2 6 1 1 2 7
1128
I - NN
1 1 2 9
1 1 3 0
1 1 3 4
1 131 1132
1 1 3 5 1 1 3 6
1133
1 1 3 7 1 1 3 8 1 1 3 9
1141 1 1 4 2 1 1 4 3
1 1 4 0
1 1 4 4 1 1 4 5
Abb. 214 T ägerw ilen: T rafostation . S ilices M 1:1: K eram ik M 1:3. Spätbronzezeit 11 2 2 -1 1 3 9 ; T ägerw ilen: M üller-T hurgau-Strasse. K eram ik M 1:3; späteH allstattzeit / frühe L atènezeit 1140 -1143 , 1145; B ronzezeit? 1144.
230 Katalog der Funde
Tägerwilen: Girsberg-Gugger. Abb. 215.
I 146 K ratzer, Silex.1997.008.28.1, O Flnfund a u f Acker.
1147 RS. Teller. Terra sigillata, Drag. 18 oder Schüssel Drag. 37. hclltonig, südgallisch.1999.032.1.1, UK neuze itlicher Pflughorizont.
1148 BS. Teller, Terra sigillata. H altern 1 oder R ödgen 1. helltonig, südgallisch.1999.032.1.2, UK neuzeitlicher Pflughorizont.
1149 A xtklinge m it S chäftungsloch , Eisen, röm isch.SL M Z Inv. Nr. 33057. A ltfund, Fundum stände unbekannt.
Katalog der Funde 231
1147
Abb. 215: T ägerw ilen: G irsberg-G ugger. S ilices M 1:1; K eram ik M 1:3. P rähistorisch 1146; Röm isch 1147-1149.
232 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Schlossbühl. Abb. 216.
1150 RS, FeinKcr, g rau , M ag. m ittclk ., verw ittert, g rosses G cfàss.1934.1.3.3.1, Slg. Beck.
I 151 RS, Schale, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verw ittert.1934.1.2.2.101, Slg. Beck.
1152 RS, Schale, FeinKer, ockerfarben . M ag. fein, verw ittert.1934.1.2.2.100. Slg. Beck.
1153 W S, FeinKer. rötl.. M ag. fein, verw ittert, Rillen.1934.1.2.2.24, Slg. Beck.
1154 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1934.1.2.2.22, Slg. Beck.
1155 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. g rob, verw ittert.1934.1.2.2.20, Slg. Beck.
1156 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1934.1.2.2.25, Slg. Beek.
1 157 RS. GrKer, rö tl.-braun. M ag. g rob, verw ittert.1934.1.2.2.9, Slg. Beck.
1158 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert.1934.1.2.2.10. Slg. Beck.
1159 RS. G rK er. rö tl.-braun. M ag. g rob , verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1934.1.2.2.21. Slg. Beck.
1 160 RS, G rK er, M ag. m itte lk ., verw ittert1934.1.2.2.17, Slg. Beck.
1161 RS, G rKer, rö tl.-braun, M ag. grob, verw ittert.1934.1.2.2.12. Slg. Beck.
1162 RS, K alo ttenschale, G rK er, grau. M ag. m itte lk ., verw ittert.19 7 3 .0 1 .1 4 A 3 .1 .Schnitt 14, S 3 .
1163 W S. GrKer, rö tl.-braun, M ag. g rob , verw ittert, K erben.1934.1.2.2.26, Slg. Beck.
I 164 W S, GrKer. rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, flächige Fingertupfen. !9 3 4 .l . 2 .2 .27. Slg. Beck.
I 165 RS. G rK er, dunkelgrau , M ag. m ittelk ., verw ittert.19 7 2 .0 1.12FG 1 -4 .1 , Schnitt 12, S I 4.
1166 BS. W S. K egelhalsgefäss?, M ag. m ittelk .. OF1 fein verstrichen, rote B em alung im Fialsbereich.1972 .01.13E4a.2, Schnitt 13, S 4 a .
1167 BS, G rKer, rötl., M ag. m ittelk ., verw ittert.1972 .01.13E 4a. 1. Schnitt 13, S 4 a .
Katalog der Funde 233
11501151 1152 1153
1154 1155 1156 1157 1158
1159 1160 1161 \ 1162
1163 1164
1165
1166 1167
Abb. 216: K reuzlingen: Schlossbühl. Keram ik M 1:3. M itte lbronzezeit? 1 1 5 4 -1 1 5 9 ; M ittel- oder Spätbronzezeit? 1150, 1151, 1153, 1163, 1164; Spätbronzezeit? 1152, 1160 und 1161; M ittc lbronzezeit 1165; M ittel- oder Spätbronzezeit 1162; H allstattzeit 1166, 1167.
234 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Schlossbühl. Abb. 217.
1168 RS, G rapen. 15. Jh. n. Chr. m tl., g rüne G lasur ohne Engobe.19 7 2 .0 1.12G 4.1, Schnitt 12, S 4.
1 169 RS. G rapen. 15./16. Jh. n. Chr. grau, unglasiert.1973 .01 .17H 2.1, Schnitt 17, S 2.
1 170 RS, G rapen, 15. Jh. n. Chr. m tl., R este von g rüner G lasur ohne Engobe a u f A ussenseite.1973.01.17 1.1, Schn itt 17, S 1.
1171 BS, G rapen, 15./16. Jh. n. Chr, m tl., unglasiert.1972 .01.12H 2.1, Schnitt 12, S 2.
1172 RS, N apfkachel, 15 ./I6 . Jh. n. Chr, m tl.. unglasiert. 1973.01.17F2 2.1, Schnitt 17, S 2.
1173 RS, N apfkachel. 15./16. Jh. n. Chr. m tl.. unglasiert.1972 .01 .1 2 F G -1 -4 .3 , Schnitt 12, S 1 -4.
1174 RS. G lasbecher, grün.1972 .01 .12F 1.1, Schnitt 12, S 1.
1175 Fenstcrg lasfragm ., stark korr.1934.1.7.7.1, Slg. Beck.
1176 K rugfragm ., v ierkantig , röm isch.1972.01.17F 2.1, Schnitt 17. S 1.
1177 M esserfragm ., E isen , 11,7 g.1972 .01 .14H-K 13.100. Schnitt 14. S 3 .
1178 N agel, Eisen.1972 .01 .12G 4 .100, Schnitt 12, S 4.
1179 K lam m erfragm .. Eisen 1972.01.12G 4 .101, Schnitt 12, S 4.
1180 N agel, Eisen.1973 .01.17C3 2.100, Schnitt 17, S 2.
'«A
l
Katalog der Funde 235
1168 1169
1 1 7 0
1 1 7 2
1 171 1 1 7 4
1 1 7 3
[Ä
1 1 7 5 1 1 7 6
Abb. 217: K reuzlingen: Schlossbühl. E isen M 1:2; K eram ik, G las M 1:3. S pätm ittela lter / frühe N euzeit 1168 1175 und 1177-1180: R öm isch 1176.
236 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Bernrain. Abb. 218.
1181 RS. FeinKer. ockerfarben . M ag. fein, verw ittert, R este von geritztem 1203 RS. G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, geschlickt. Motiv. 1932.1.1.9, Slg. Beck. 1932.1936.1.245.9. Slg. Beck. 1936.
1182 W S. FeinKer, ockerfarben , M ag. fein, verw ittert, flächendeckende Einstiche m it sp itzem Instrum ent.1936.1.245.7, Slg. Beck.
1183 RS, G rK er, ockerfarben , M ag. grob, verw ittert.1932.1.10.5, Slg. B eck, 18.05.1932.
I 184 RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. grob, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1936.1.247.16. Slg. Beck. 1936.
1185 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1936.1.247.13, Slg. Beck, 1936.
1186 RS. G rK er. rötl.. M ag. g rob, verw ittert.1932.1.1.16, Slg. Beck. 1932.
1187 RS. GrKer. hart, rö tl.-braun, verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1999.018.9.6, Slg. Beck.
1188 RS, GrKer, rö tl.-braun, M ag. m ittelk .. verw ittert.1932.1.3.1, Slg. Beck. 31.07.1932.
1189 RS, G rK er, hart, dunkelgrau . M ag. m ittelk ., verw ittert.1932.1.1.6, Slg. Beck, 1932.
1190 RS. G rKer. rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verw ittert.1932.1.10.9, Slg. B eck, 18.05.1932.
1191 RS, G rKer. rötl.. M ag. grob, verw ittert.1936 .1.274.1, G rabung K K T 11.03.1936.
1192 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert.1936.1.247.12, Slg. Beck, 1936.
1193 RS, GrKer. rö tl.-braun, M ag. grob, verw ittert.1932.1.12.48. Slg. Beck, 1932.
1194 RS, G rK er, rö tl.-b raun . M ag. sehr grob, verw ittert.1932.1.10.2, Slg. B eck, 18.05.1932.
1195 RS, G rK er, ockerfarben . M ag. m itte lk ., verw ittert.1934.1.1.3, Slg. B eck. 1934.
1196 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verw ittert.1932.1.10.1, Slg. Beck. 18.05.1932.
1197 RS, GrKer. ockerfarben. M ag. m ittelk ., verw ittert.1934.1.1.1, Slg. B eck. 1934.
1198 RS, GrKer. g rau . M ag. grob, verw ittert.
1999.018.9.8, Slg. Beck.
I 199 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. m itte lk .. verw ittert.1932.1.4.8, Slg. B eck. 1932.
1200 RS. G rK er, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verw ittert.1934.1.1.2, Slg. B eck. 1934.
1201 RS, GrKer. rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verw ittert.1936 .1 .247 .11, Slg. Beck. 1936.
1202 RS, G rK er, grau. M ag. grob, verw ittert.1932.1.9.4. Slg. Beck. 1932.
Katalog der Funde 237
1181 1182
1183 1184 1185
1186 1187
- - ' T \
1188
1189
1190
119311921191 1195 1196 1197 1198 11991194
1200 1201 1202 - 1203
A bb. 218: K reuzlingen: Bernrain. K eram ik M 1:3. M itte lbronzezeit 1181-1203 .
238 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Bernrain. Abb. 219.
1204 RS. Schale, FeinKer. grau . M ag. fein, verw ittert.1932.1.1.41, Slg. B eck, 1932.
1205 RS, Schale, FeinKer. ro th -braun . M ag. fein, verw ittert.1934.1.4.6, Slg. B eck. 25.05 .1934.
1206 RS, FeinKer, grau-braun . M ag. fein, verw ittert.1932.1.1.7, Slg. B eck. 1932.
1207 RS, Schale. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert.1932.1.1.37, Slg. B eck. 1932.
1208 RS. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verw ittert.1932.1.1.2. Slg. Beck. 1932.
1209 RS, G rK er, grau. M ag. grob.1932.1.6.12, Slg. B eck. 29.6.1932.
1210 RS. FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert.1932.1.3.2. Slg. B eck, 31.07.1932.
1211 RS, Schale oder T rich terrandgefäss, ockerfarben. M ag. m ittelk .. grob verstrichen, unregelm ässiger Rand.1932.1.1.100. Slg. Beck.
1212 RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. verw ittert.1999.018.9.2. Slg. Beck.
1213 RS. M ag. m ittelk .. innen geglättet, aussen verstrichen, T richterrand?1932.1.3.9, Slg. Beck, 31.07.1932.
1214 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert.1932.1.6.4, Slg. Beck, 29.6.1932.
1215 RS. GrKer, grau b is rö tl.-braun, verw ittert.1936.1.247.14, Slg. Beck, 1936.
1216 RS, GrKer, grau, M ag. m ittelk ., verw ittert.1936.1.247.19, Slg. Beck, 1936.
1217 RS, GrKer, grau-braun . M ag. m ittelk .. verw ittert.1932.1.9.3, Slg. B eck. 1932.
1218 RS, G rK er, grau. M ag. sehr grob, verw ittert.1932.1.10.10, Slg. Beck, 18.05.1932.
1219 W S, G rK er. rö tl.-braun. M ag. sehr g rob , verw ittert. F ingertupfenleiste.1932.1.10.12, Slg. Beck, 18.05.1932.
1220 W S, GrKer, rö tl.-braun, M ag. sehr g rob , verw ittert, F ingertupfenleiste.1932.1.9.8, Slg. Beck, 1932.
1221 W S, GrKer, rötl., M ag. grob, verw ittert. F ingcrtupfenleiste.1932.1.1.14. Slg. Beck, 1932.
1222 W S, G rK e. rö tl.. M ag. grob, verw ittert, F ingertupfenleiste. 1932.1.6.53. Slg. Beck, 29.6.1932.
1223 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert.1936.1.245.2. Slg. Beck, 1936.
1224 W S, GrKer, hart, rötl., verw ittert, F ingcrtupfenleiste .1932.1.1.17, Slg. Beck. 1932.
1225 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, F ingcrtupfenleiste .1936.1.245.3. Slg. Beck. 1936.
1226 W S, G rK er. ockerfarben . M ag. sehr grob.1936.1.245.4, Slg. B eck, 1936.
1227 W S, GrKer. grau . M ag. grob, verw ittert, g latte Leiste.1999.018.6.1, Slg. Beck.
1228 W S, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, g latte Leiste.1932.1.10.13, Slg. Beck. 18.05.1932.
1229 W S, rö tl.-braun. M ag. grob.1932.1.12.1. Slg. Beck. 1932.
Katalog der Funde 239
1204 1205
\
1206 1207
1209 1210 1211
1208
1212 1213 1214
1215
1216
1219 1220
1224
1227
1217
1221
1225
1228
1218
1222
1226
1229
1223
Abb. 219: K reuzlIngen: B ernrain. Keram ik M 1:3. M ittel- oder Spätb ronzezeit 1 204 -1229 .
240 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Bernrain. Abb. 220.
1230 RS, Schale, FeinKer, m tl.. M ag. fein, verw ittert. E instichreihe a u f Rand.1932.1.6.1. Slg. Beck, 29.6.1932.
1231 RS. FeinKer. hart, dunkelgrau , verw ittert, E instichreihen a u f Rand.1936.1.247.3, Slg. B eck. 1936.
1232 RS. FeinKer, grau-braun . M ag. fein, verw ittert, Z ickzack-M otiv a u f Rand.1936.1.247.2, Slg. Beck. 1936.
1233 RS. Schale, FeinKer, m tl.-b raun , verw ittert. M ag. fein, Z ickzack- M otiv a u f Rand.1936.1.247.100, Slg. Beck. 1936.
1234 W S, Schale, ockerfarben . M ag. fein, abgesetz te Stufe.1932.1.13.100. Slg. Beck, O ktober 1932.
1235 RS, Schale. FeinKer. m tl.-b raun . M ag. fein, verw ittert.1936.1.247.6, Slg. Beck, 1936.
1236 RS, Schale. FeinKer, ockerfarben . M ag. fein, verw ittert.1999.018.7.6, Slg. Beck.
1237 RS, Schale, FeinKer. rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert, innen geglättet, aussen verstrichen.1934.1.4.1. Slg. Beck.
1238 RS, FeinKer. ockerfarben , M ag. fein, verw ittert.1932.1.6.5. Slg. B eck. 2 9 .6 .1932.
1239 RS, Schale. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. m ittclk , verw ittert.1932.1.10.4, Slg. B eck, 18.05.1932.
1240 RS, Schale, FeinKer, grau. M ag. fein, beidseitig geglättet.1999.018.9.1. Slg. Beck.
1241 RS, Schale, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. grob , verw ittert.1996.51.1.1. O F lnfund 1996.
1242 RS, Schale. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert, aussen verstrichen, innen geglättet.1999.018.6.2, Slg. Beck.
1243 RS, Schale. FeinKer. rö tl.-braun. M ag. m ittelk ., verw ittert.1932.1.4.10, Slg. Beck, 1932.
1244 RS, Schale, FeinKer, dunkelgrau , M ag. fein.1932.1.1.15, Slg. Beck, 1932.
1245 RS, Schale, FeinKer, rö tl.-braun, M ag. fein, verw ittert.1932.1.3.20, Slg. Beck. 31.07.1932.
1246 RS, Schale, FeinKer. ockerfarben. M ag. fein, verw ittert.1936.1.247.5, Slg. Beck, 1936.
1247 RS, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert.1932.1.6.6, Slg. Beck, 29 .6.1932.
1248 RS, Schale, FeinKer, grau. M ag. fein, verw ittert.1932.1.6.2, Slg. B eck, 29 .6.1932.
1249 RS, Schale, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert.1934.1.4.4. Slg. B eck, 25.05.1934.
1250 RS, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert.1997.003.1.1. O Flnfund P rospektion 1997.
1251 RS, Schale, GrKer, m tl., M ag. grob, verw ittert.1932.1.6.19, Slg. B eck. 29 .6.1932.
1252 RS. FeinKer, Schale, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert.1934.1.4.3, Slg. Beck, 25.05.1934.
1253 RS, Schale oder T rich terrandgefäss, FeinKer, rö tl.-braun, verw ittert.1932.1.13.13. Slg. Beck. O ktober 1932.
1254 RS, FeinKer, hart, bräun!.. M ag. fein, verw ittert.1932.1.6.9. Slg. Beck, 29.6.1932.
RS, Schale. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert.1932.1.1.3, Slg. B eck. 1932.
RS, FeinKer, g rau . M ag. fein, verw ittert.1932.1.6.15, Slg. B eck, 29 .6.1932.
RS. Schüssel. FeinKer, rö tl.-braun. M ag. seh r grob, verw ittert.1936.1.247.1, Slg. B eck, 1936.
RS, FeinKer, ockerfarben , M ag. fein, verw ittert.1936.1.247.8, Slg. Beck, 1936.
RS, GrKer, ockerfarben . M ag. m itte lk ., verw ittert.1932.1.10.3, Slg. Beck. 18.05.1932.
RS, GrKer, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1936.1.247.15, Slg. Beck. 1936.
RS, Topf, GrKer, ockerfarben , M ag. m itte lk ., verw ittert. Kerben a u f R andum bruch.1936.1.247.9, Slg. Beck, 1936.
RS, G rK er, ockerfarben . M ag. g rob , verw ittert. F ingertupfen.1936.1.247.17, Slg. Beck. 1936.
RS, Topf, G rK er. rö tl.-braun, M ag. g rob, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1999.018.8.2, Slg. Beck.
RS. G rK er. grau . M ag. g rob , verw ittert, Kerben a u f Rand.1932.1.6.8, Slg. B eck, 29 .6.1932.
RS, G rK er, m tl.. M ag. grob, verw ittert, F ingertupfen a u f Rand.1932.1.100. Slg. Beck. 1932.
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. m itte lk ., verw ittert. F ingertupfen a u f Rand.1932.1.3.22, Slg. B eck, 31.07.1932.
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert.1932.1.9.2. Slg. B eck, 1932.
RS, G rK er, grob, ockerfarben , verw ittert.1932.1.1.8. Slg. Beck. 1932.
RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. grob, verw ittert, D ellen a u f Rand. K erben a u f R andum bruch.1936.1.247.7, Slg. B eck. 1936
RS. G rK er, rö tl.-braun, M ag. m ittelk ., verw ittert, D ellen a u f Rand.1999.018.9.10, Slg. Beck.
W S, G rK er, ockerfarben . M ag. grob, verw ittert, D ellen a u f Schulter.1936.1.245.1. Slg. Beck, 1936.
W S, FeinKer, rö tl.-braun. M ag. fein, verw ittert, g latte Leiste.1932.1.4.2. Slg. Beck, 1932.
W S. FeinKer, rötl.-braun. M ag. fein, verw ittert, g latte Leiste.1936.1.245.6, Slg. B eck, 1936.
W S, FeinKer, rö tl.-braun, M ag. fein, verw ittert, K reism otive.1936.1.245.5, Slg. B eck, 1936.
W S, FeinKer, ockerfarben, M ag. fein, verw ittert, K erbreihe.1932.2.19, Slg. Beck, 1932.
N adelkopf, Fragm . e iner B inninger-N adel, Bronze.1996.999.1.1, O Flnfund 1996.
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
Katalog der Funde 241
1230 1231 1232
' " ^ A\ . V
).JJ1233 1234
1235
1236 1237
1239 x 1240 1242 .1243 1244 1245 1246 12471241
1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256
1258
, 1257
j1260
1259
1261
12621263 1264 1265
1266 1267 ' 1268 1269 1270
1271 1272 1273 1274 1275
1248
- Q 0
l/ 1276
Abb. 220: K reuzlingen: B ernrain. B ronze M 1:2; K eram ik M 1:3. Spätbronzezeit 1 2 3 0 -1 2 6 8 , 1276; Spätbronzezeit oder H allstattzeit 126 9 -1 2 7 5 .
242 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Anschluss Süd Saubach. Abb. 221.
1277 W S. Fein- oder (irfCer, dunkelg rau . M ag. m ittelk ., verw ittert. A nsatz eines H enkels. F ingertupfen-L eiste a u f Schulter, S trichbündel.1997 .008 .86 .1, SondS B achbett, S 410.
1278 W S, Schu ltergelass, FeinKcr, dunkelgrau . M ag. m ittelk ., verw ittert.1997.008.87.6, SondS B achbett. S 410.
1279 W S. Schu ltergelass. FeinKcr, m tl.-b raun . M ag. fein, verw ittert.1997.008.89.1, SondS B achbett. S 410.
1280 RS, FeinKcr, rö tl.-braun. M ag. m ittelk .. OFI geglättet.1997.008.82.1, SondS B achbett, S 410.
1281 W S. Rest e iner Leiste. Fein- oder GrKer, rö tl.-braun. M ag. m ittelk.1997.008.94.9, SondS B achbett, S 410.
1282 BS, FeinKer, rö tl., M ag. fein , verw ittert.1997.008.93.1, SondS B achbett. S 410.
1283 RS, G rK er. rö tl.-braun. M ag. grob. OFI verstrichen.1997.008.87.2, SondS B achbett. S 410.
1284 RS, G rK er, grau, M ag. m ittelk ., OFI verstrichen.1997.008.84.3, SondS B achbett, S 410.
1285 RS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. sehr grob, OFI verstrichen.1997.008.94.5, SondS B achbett, S 410.
1286 RS, GrKer, g rau . M ag. sehr grob, OFI verstrichen.1997.008.83.1, SondS B achbett, S 410.
1287 RS, G rK er, rö tl., M ag. g rob . OFI verstrichen.1997.008.99.1, SondS B achbett. S 410.
1288 W S, GrKer, rö tl.. M ag. m ittelk ., OFI verw ittert, abgep latz te Leiste.1997.008.87.1, SondS B achbett, S 410.
1289 RS. BS, W S, Topf, G rKer, ockerfarben , M ag. grob, Proportionen des G efässes n icht gesichert, F ingertupfen a u f Rand, randständ iger G rifflappen. untB er W andung geschlickt.1997.008.82.2, SondS B achbett, S 410.
1290 BS, G rK er, rö tl.-braun. M ag. g rob, flächendeckende F ingernagelkerben.1997.008.82.2, SondS B achbett, S 410.
1291 BS, GrKer. bräunl.. M ag. m ittelk ., flächendeckende Fingernagelkerben.1997.008.84.1, SondS B achbett, S 410.
1292 BS, GrKer. grau. M ag. grob. 1 9 9 7 .0 0 8 .8 6 .1 3 ,5 .4 1 0
Katalog der Funde 243
1 2 7 7
d1 2 8 0 1281 1 2 8 2
1 2 8 4 1 2 8 5 1 2 8 6 1 2 8 7 / / 1 2 8 8
1 2 8 9
_£JJ 1 2 9 0 1291 1 2 9 2
Abb. 2 2 1 : K rcuzlingen: W ildenw is-Saubach. Keram ik M 1:3. Späte M ittelbronzezeit 1277-1292 .
1 2 7 8
1 2 7 9
1 2 8 3
244 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Anschluss Süd Junkholz. Abb. 222.
1293 P feilsp itzenfragm ., rosafarbener Silex.1997.008.138.1, SondS 52. S 2/3.
1294 A hlcnfragm ., v ierkan tiger Q uerschnitt, B ronze. 3,5 g.1997.008.132.1, SondS 53, S 3 .
1295 RS, GrKer. ockerfarben. M ag. g rob , verstrichen.1997.008.141.1, SondS 52, S 2/3.
1313 RS, Teller. FeinKer, röm isch, 1 -3 . Jh. n.Chr., rö tl.-braun. M ag. m ittc lk .. verw ittert, scheibcngcdrehf?1997.008. 135.3, SondS 53. S 2/3.
1314 W S ,T erra s igillata, Drag. 37 oder Drag. 29. 1 .-2 . Jh. n .C h r..T o n orange, OF1 abgep latz t, M otiv: laufendes T ier (H ase?), darüber Rest eines floralen M otives.1997.008.178.1. SondS 39, S 2.
1296 RS, GrKer. ockerfarben . M ag. sehr grob, verstrichen.1997.008.135.1. SondS 53. S 2/3.
1297 RS, G rK er, braun. M ag. sehr grob, verstrichen. 1997.008.119.1 SondS 53. S 2/3.
1298 RS. G rKer. rö tl.-braun. M ag. grob, verstrichen.1997.008.131.1. SondS 53, S 2/3.
1299 RS, G rKer. rötl., M ag. grob, verstrichen.1997.008.127.2, SondS 53. S 2/3.
1300 W S. dunkelgrau . M ag. grob. OF1 verw ittert. R este von lang gezogenen Dreiecken.1 997 .008 .12 9 .1. SondS 53. S 2/3.
1301 W S, G rKer, braun, verstrichen, R este von flächendeckenden R itzlinien.1997.008.119.10. SondS 53. S 2/3.
1302 W S, G rK er, grau-braun . M ag. grob, verw ittert, flächendeckende Ritzlinien.1997.008.135.20, SondS 53. S 2/3.
1303 W S, grau. M ag. m ittelk ., verw ittert, R este von flächendeckenden Ritzlinien.1997.008.119.3, SondS 53, S 2/3.
1304 W S. GrKer, rö tl.-braun, verstrichen. F ingertupfen aufW andum bruch .1997 .008 .119.8, SondS 53, S 2/3.
1305 W S, G rK er, dunkelgrau . M ag. grob, flächendeckende F ingertupfen.1997 .008 .128.5. SondS 53. S 2/3.
1306 W S, G rob- oder FeinKer, dunkelgrau . M ag. m ittelk .. verw ittert, A nsatz eines H enkels.1997.008.119.2, SondS 53, S 2/3.
1307 W S, G rK er. dunkelgrau . M ag. m ittelk .. abgeplatz te F ingertupfenleiste .1 997 .008 .124.1, SondS 53, S 2/3.
1308 W S, GrKer. Fragm . eines H enkels, FeinKer. dunkelgrau bis schw arz. M ag. m ittelk.1997.008.119.2. SondS 53, S 2/3.
1309 W S, FeinK er?, ockerfarben . M ag. grob. OF1 fein verstrichen.1997.008.153.1. SondS 55. S 2/3.
1310 BS. GrKer. grau. M ag. grob.1997.008.171.1. SondS 36, S 2.
1311 BS, FeinKer, dunkelgrau , M ag. m itte lk ., OF1 geglättet.19 9 7 .0 0 8 .126.5 , SondS 53. S 2/3.
1312 BS, FeinKer, dunkelgrau . M ag. m ittelk .. OF1 verw ittert.1997.008.119.21. SondS 53, S 2/3.
Kultilog der Funde 245
1295
1296
1 2 9 7
1 2 9 8 1 2 9 9
1 3 0 0 1301 1 3 0 2 1 3 0 3 1304 1 3 0 5
1306 1 3 0 7 1 3 0 81 3 0 9
"CO'1 3 1 0 1311 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4
Abb. 222: K reuzlingen: Junkholz. S ilices M 1:1; B ronze M 1:2; K eram ik M 1:3. N eolith ikum oder B ronzezeit 1293; M itte lbronzezeit 1294 1312; R öm isch1313 und 1314.
246 Katalog der Funde
Kreuzlingen: Anschluss Süd Schreckenmoos. Abb. 223.
1315 RS, Teller, FeinKer, röm isch 1 .-3 . Jh. n. Chr., scheibengedreht, sekundär stark verbrannt, stark zerscherb t, erhalten ca. '/< des G elasses, keine M ag. im Ton.1997.008.103.1, SondS 59/60, G rube/G rab?
1316 RS, GrKcr. grau. M ag. sehr grob, OF1 verstrichen. A nsatz eines randständ igen H enkels oder G rifflappens.1997.008.108.1, SondS 60, S 400.
1317 RS, GrKcr. dunkelg rau , M ag. g rob. R este eines Henkels.1997.008.105.1, SondS 60, S 400.
1318 R inglein. B ronze, verm utlich Bronzezeit. Lese fund a u f Acker.G öttlichen , Rheinw eg. Abb. 216.
1319 RS. Topf, grau-schw arz, M ag. g rob m it G lim m erzusatz , teilw. verw ittert, unregelm ässig verd ickt, ha lbm ondförm ige E indrücke im H alsbereich , M ündungsdurchm esser ca. 20 cm , R andstärke 8,5 m m ,R este von B irkenpech (Eichung).1999.016.7.1, S 400, Lfm 4 .0 -5 .4 0 .
1320 RS. N apf, grau-schw arz, verw ittert. R and leicht einziehend, M ündungsdurchm esser unbestim m t. R andstärke 9,6 m m . M ag. fein bis m ittclk . m it G lim m erzusatz , o rganische Z usch läge teilw eise herausgew ittert, innen feine D rehrillen , (N ach-'.')bearbcitung a u f der D rehscheibe.1999.016.3.1, Südprofil, S 400, Lfm 2.25.
1321 BS, G rKcr, grau-schw arz, M ag. g rob mit S cham ott und G lim m erzusatz , verw ittert, fingertupfenverziert. B dD m unbestim m t,BdSt unbestim m t.1999 .016 .1.3, S üdprofil, S 400. Lfm 5 .4 0 -6 .0 .
1322 W S, GrKer. grau- b is b raun-schw arz. M ag. g rob m it G lim m erzusatz, verw ittert, unregelm ässige E indrucksverzierung.1999.016.8.3, W estprofil, S 300, Lfm 0 .5 0 -1 .9 0 .
1323 W S, grau bis grau-schw arz. M ag. m ittelk . bis g rob m it G lim m erzusatz , verw ittert, kam m strichverziert.1999.016.8.4, W estprofil, S 300, Lfm 0 .5 0 - 1.90.
1324 W S, aussen beige, innen grau-schw arz, im B ruch grau. M ag. m ittelk. bis g rob m it G lim m erzusatz , verw ittert, kam m strichverziert, innen feine D rehrillen.1999.016.8 . I S 300. Lfm 0 .50 1.90.
1325 W S. m tl.-b raun . M ag. m ittelk . m it G lim m erzusatz , verw ittert, kam m strichverziert.1999.016.9.1, aus A ushub.
1326 BS, hell- bis dunkelbraun, im B ruch grau . M ag. m ittelk . m it G lim m erzusatz , verw ittert. R este von K am m strich , BdD m unbestim m t, B dSt 12.5 m m.1999.016.13.1, W estprofil. S 400. Lfm 2.
1327 W S. rö tl.-braun, im B ruch g rau , M ag. fein m it G lim m erzusatz , verw ittert, m it unregelm ässigen G rübchen verziert.1999.016.8.2, W estprofil, S 300. Lfm 0 .5 0 -1 .9 0 .
1328 W S, rö tl.-b raun . M ag. fein m it G lim m erzusatz , im B ruch grau, stark verw ittert, einstich- oder g rübchenverziert.1999.016.13.2, W estprofil, S 400. Lfm 2.
1329 L anzensp itze m it M itte lgrat und Tülle, E isen, stark korr., erhaltene F lügelbreite 2,6 cm , 80 g.1999.018.1. A ltfund, H eim atm useum R osenegg. K reuzlingen.Inv. Nr. 4243.
Katalog der Funde 247
Abb. 223: K reuzlingen: Schreckenm oos. B ronze M 1:2; K eram ik M 1:3. R öm isch 1315; späte M itte lbronzezeit 1316, 1317; B ronzezeit 1318. G ottlieben, Rheinweg. Eisen M 1:2; K eram ik M 1:3. Spâtlatènezeit 131 9 -1 3 2 8 ; Latènezeit 1329.
248
Literaturverzeichnis
L »p u b liz ierte Q uellenB odenseeufer-K arte 1751: S tadtarchiv K onstanz: Plan Z 11 a /4 4 . (A nonym e
B odenseeuferkarte m it E inzeichnung von Strassen usw.)B runnenbuch 1582: B runnen- und Teuchelbuch 1445-1620 . S tadtarchiv
K onstanz, A VIII 6: fol. 1 ff. [neue Pagin ierung. Wo nötig , w erden die einzelnen E inträge pro B latt m it e iner eigenen N um m er zitiert.].
H afenprojekt 1947: S ituationsplan über d ie G em arkung T ägerm oos bei K rcuzlingen und T ägerw ilen . K anton T hurgau. 1947. Staatsarchiv T hurgau: T ägerm oos, Schachtel 2. [D er Plan träg t die B em erkung: «m it R hein h afen -P roject» . E ingetragen ist die stark vereinfachte S ituation aus dem G rundbuchplan . D arüber ein riesiges P ro jek t eines R heinhafens m it m ehreren B ecken.]
Inventar H isto rischer Verkehrsw ege der Schw eiz (IV S) D okum entation Thurgau. B earbeitet von T hom as Specken Bern 2000.
Plan über das T ägerm oos, 1892. S taatsarchiv T hurgau: T ägerm oos, Schachtel 3.
R im m elc. A ndreas, B runnenplan 1784: G rundriss der kaiser!, königl. V. Ö. S tadt K onstanz sam t V erzeichnis der drei B runnenw asser w ie selbe ihren L au f in H eucheln durch die S tadt haben, auch w elche B runnen hievon gespeist w erden. M = ca. 1 :4000. S tadtarchiv K onstanz: Plan Z l l a / 1.
Sauter. Johann-B aptist. Plan oder G rundriss über die L andstrass durch das Thurgoaw. A nno 1777. S taatsarchiv T hurgau: Plan 1823.
G edruckte Q uellenTU B : T hurgau isches U rkundenbuch. Hg. vom T hurgauischen H istorischen
Verein. 7 B ände. Frauenfeld 1924 -1 9 6 7 .
L iteraturverzeichnisA rnold, B éat (1990) C orta illod-E st et les villages du lac de N euchâtel au
Bronze final. S tructure de L habita t et pro to-urbanism e. A rchéologie neuchâtelo ise 6. Saint-B iaise.
B aitinger, H olger (1999) Die H allstattzeit im N ordosten Bd-W ttb.s. M aterialhefte zu r A rchäologie in B d-W ttb. 46. Stuttgart.
Bär, Paul (1995a) G rossbrand im Em m ishofen . Die Z iegelei N oppel geht in F lam m en auf. In: D elphin-K reis ( H rsg.) G eschichte und G eschichten aus K onstanz und von den Schw eizer N achbarn . K onstanzer Beiträge zu r G eschichte und G egenw art, N eue Folge 4. K onstanz, 136-137 .
Bär, Paul (1995b) Wo der K onstanzer G algen stand. D er Z ieg e lh o f im Tägerm oos. In: D elphin-K reis (H rsg .) G eschichte und G eschichten aus K onstanz und von den Schw eizer N achbarn . K onstanzer B eiträge zur G eschichte und G egenw art, N eue Folge 4. K onstanz, 144-145 .
Bauer, Irm gard (1993) Ein ha lls tattze itlicher Fundkom plex aus der Z uger A ltstadt. JbSG U F 76, 9 3 -1 1 2 .
Bauer, Irm gard e t al. (1991) U etliberg, U to-K ulm . A usgrabungen 1980-1989. ZD A M 9. Zürich.
Bauer, Irm gard et al. ( 1992) B ronzezeitliche L andsiedlungen und Gräber. ZD A M 2. Zürich und Egg.
B eck, A delheid (1980) B eiträge zu r frühen und älteren U rnenfe lderku ltu r im nordw estlichen A lpenvorland. PBF XX , 2. M ünchen.
B eck, A lfons (1935a) Zwei H öhensiedlungen der Spätb ronzezeit bei K onstanz. In: A lem annisches Volk. K ultur- und H eim atbeilage der B odensee-R undschau, 3. Jahrgang, Nr. 51. 21 .12 .1935: 2 0 1 -2 0 4 ; Nr. 5 2 .2 8 .1 2 .1 9 3 5 ,2 0 5 -2 0 6 .
Beck, A lfons (1935b) E ntdeckung zw eier spätb ronzeze itlicher S iedlungen bei B ernrain. In: K onstanzer Zeitung, Jahrgang 13(63), Nr. 296, 2 1 .12 .1935 .
Beck, A lfons (1939) W ohnplätze der M ittleren S teinzeit in der K onstanzer B ucht. M annus 31, 100-108 .
Beck, A lfons ( 1955) R efugium B ernrain und Schlossbühl. In: V ereinigung H eim atm useum K rcuzlingen (H rsg.). B eiträge zur O rtsgeschichte von K rcuzlingen 9. N achdruck in: S tadtrat K rcuzlingen, Hrsg. ( 1991 ) K rcuzlinger M osaik. B erichte und B ilder aus V ergangenheit und G egenw art. Ein Q uellenbuch der G renzstad t K rcuzlingen bis ca. 1960. K rcuzlingen. 3 3 4 -3 3 8 .
Beck. A lfons ( 1956) U r-K reuzlingen. In: T hurgaucr Z eitung, Teil 1 : 2 5 .2 .1956 , Jahrgang 158, Nr. 48, Bl. 3: Teil 2: 02 .03 .1956 , Jahrgang 158, Nr. 53, BL 3.
Beck, A lfons ( 1961) Z um M esolith ikum des Thurgaus. In: Kcller-Tarnuzzer. Karl. Q uellen zu r U rgeschichte des Thurgaus. 11. Fortsetzung. T hurgauische B eiträge zu r vaterländ ischen G esch ich te 98, 2 6 -2 9 .
B ernatzky-G oetze , M onika (1987) M örigen. D ie spätbronzezeitlichen Funde. A ntiqua 16. Basel.
B iel, Jörg (1987) V orgeschichtliche H öhensiedlungen in S üdw ürttem berg- H ohenzollern . Forschungen und B erichte zu r Vor- und Frühgeschichte in Bd-W ttb. 24. Stuttgart.
B illam boz, A ndré und G olln isch . H artm ut (1996/97) Die D endrodatierung der S iedlungsphasen von U erschhausen-H orn (C H , T hurgau) in der Spätbronzezeit und frühen Eisenzeit. P lattform 5/6, 102-103 .
B irkeland, Peter (1998) Soils and G eom orphology. O xford.B rcm , H ansjörg ( 1997) Spärliche Spuren. Funde der Latènezeit aus dem
Thurgau. AS 20, 7 3 -7 6 .Brogli W erner (1980) Die b ronzezeitliche Fundstelle « U f W igg» bei
Z ein igen AG. JbSG U F 63, 7 7 -9 2 .Brogli. W erner und Schibier, Jörg (1999) Z w ö lf G ruben aus der
S pâthalls tatt-/F rüh latènezeit in M öhlin. JbSG U F 82, 7 9 -1 1 2 .B ullock. Peter, Fedoroff, N icolas, Jongerius, A., S toops, G eorges and
Tursina, T. (1985) H andbook for soil thin section descrip tion . W olverham pton.
B urkardt, M artin (1991) K onstanz im 18. Jahrhundert. In: Burkhardt, M artin . D obras. W olfgang und Z im m erm ann , W olfgang. K onstanz in der frühen N euzeit. G eschichte der S tadt K onstanz 3. K onstanz. 3 1 3 -4 4 8 .
Courty. M arie-A gnès, G oldberg , Paul and M acphail, R ichard ( 1994) A ncient People-L ifesty les and C ultural Patterns. In: In ternational Society o f Soil Science (H rsg .) T ransaction o f the 15th W orld C ongress o f Soil Science, M exico, Vol. 6a, 2 5 0 -2 6 9 . M exico.
Courty, M arie-A gnès, G oldberg , Paul und M acphail, R ichard ( 1989) Soils and m icrom orpho logy in archaeology. C am bridge.
C rotti. P ierre (1993) Das Spätpaläoh th ikum und M esolith ikum in der Schw eiz: die letzten Jäger. In: SPM 1, 2 0 3 -2 2 1 .
D ella C asa, Philippe ( 1998) Relief, B oden. K lim a -Z u sam m e n h än g e zw ischen L andschaften und S ied lungsm uster am Beispiel der T äler nördlich und südlich des San B ernardino . In: H änsel. B ernhard (H rsg .) M ensch und U m w elt in der B ronzezeit Europas. A bsch lusstagung der K am pagne des Europarates: Die B ronzezeit: Das Erste G oldene Z eita lte r Europas, an der Freien U niversität B erlin , 1 7 .- 19. M ärz 1997. B erlin , 3 6 7 -3 7 2 .
D ieckm ann, Bodo ( 1990) N eue Forschungsergebnisse zur Jungste inzeit im H egau und in H ornstaad am B odensee. In: H öneisen , M. (H rsg .) Die ersten B auern 2. Zürich. 157-169.
D ieckm ann. B odo (1995a) A rchäologische B eobachtungen zur B odenerosion im H egau. In: Biel. J. (H rsg .) A nthropogene L andschaftsveränderungen im prähistorischen Südw estdeutschland. A rchäologische Inform ationen aus Bd-W ttb. 30. S tu ttgart, 2 8 -4 3 .
D ieckm ann, B odo (1995b) M itte lb ronzezeitliche und frühm itte la lterliche S iedlungsbefunde aus M ühlhausen-E hingen. K reis K onstanz. A rchäologische A usgrabungen in B d-W ttb., 7 5 -8 0 .
D ieckm ann. B odo (1998) S iedlungen und U m w elt der B ronzezeit am Federsee und im w estlichen B odenseegebiet. In: H änsel. B ernhard (H rsg.) M ensch und U m w elt in der B ronzezeit Europas. A bsch lusstagung der K am pagne des Europarates: D ie B ronzezeit: Das Erste G oldene Z eita lte r Europas, an der Freien U niversität B erlin , 1 7 .- 19. M ärz 1997. Berlin. 3 7 3 -3 9 4 .
D ieckm ann, B odo et al. (1997) H ornstaad-H örnle , eine der ältesten jungste inze itlichen U fersiedlungen am B odensee. In: Schlichtherle. H elm ut (H rsg.) P fahlbauten rund um die A lpen. A rchäologie in D eutschland, Sonderheft. S tu ttgart, 1 5 -2 1 .
D orbas, W olfgang ( 1991 ) K onstanz zu rZ e it der R eform ation . In: Burkhardt, M artin , D obras. W olfgang und Z im m erm ann , W olfgang. K onstanz in der frühen N euzeit. G eschichte der S tadt K onstanz 3. K onstanz, 3 1 3 -4 4 8 .
Literaturverzeichnis 249
Druck. W alter (1969) Die frühen K ulturen m itte leuropäischer H erkunft. In: Druck. W alter et al. (H rsg .) Die jü n g ere Steinzeit. Ur- und frühgeschichtliche A rchäologie der Schw eiz 2. B asel, 6 7 - 8 2 .
Druck. W alter (1977) Z ur B edeutung und zum archäologischen Leitw ert des F lu rnam ens «Leberen». In: S tüber, Karl und Zürcher, A ndreas (H rsg .) Festschrift W alter Druck, zu seinem 60. G eburtstag . Stäfa. 143 -150 .
Eberschw eiler, Beat et ul. ( 1987) G reifensee-B öschen ZH: Ein spätb ronzezeitliches Dorf. Ein Vorbericht. JbSG U F 70, 7 7 -1 0 0 .
Fischer. C alistu (1997) Innovation und Tradition in der M ittel- und Spätbronzezeit. M onographien der K antonsarchäologie Zürich 28. Zürich und Egg.
Fischer, Franz (1990) Die B esiedlung S üdw estdeutschlands am Ende der L atènezeit. In: Nuber, H ans U. et al. (H rsg .) A rchäo log ie und G eschichte des ersten Jahrtausends in Südw estdeutschland. A rchäologie und G eschichte . F reiburger Forschungen zum ersten Jah rtau send in S üdw estdeutschland 1. S igm aringen, 2 9 -4 2 .
G aitzsch , W olfgang (1980) E iserne röm ische W erkzeuge. Studien zur röm ischen W erkzeugkunde in Italien und den nörd lichen Provinzen des Im perium R om anum . B A R. in ternational series 78. O xford.
G è, Thierry, Courty, M arie-A gnes, M atthew s, W endy and W attez, Julia (1993) Sed im entary form ation p rocesses o f occupation surfaces. In: G oldberg . Paul. N ash, 0 . and Petraglia. M. (eds.) Form ation P rocesses in A rchaeological C ontext. M onographs in W orld A rchaeology 17. M adison, W isconsin. 149 163.
G iger. Peter. K önig, Erich und Surber, M argrit (1999) T ägerw ilcn. Ein T hurgauer D o rf im W andel der Zeit. T ägerw ilen.
G leser. R alf ( 1995) Die E p i-R össener G ruppen in Südw estdeutschland. U ntersuchungen zur C hronologie , stilistischen E ntw ick lung und kulturellen E inordnung. Saarbrücker B eiträge zur A ltertum skunde 61. Bonn.
G olln isch . H artm ut (1997a) Leben am See in der spätbronzezeitlichen S ied lung U erschhausen-H orn . A S 2 0 , - 6 6 - 6 8 .
G olln isch , H artm u t (1997b) D ie späte B ronze- und frühe E isenzeit im K anton Thurgau. AS 20, 6 9 -7 2 .
G olln isch-M oos, H artm ut (1999) U erschhausen-H orn , Haus- und S iedlungsstruk tu ren der spätestb ronzezeitlichen S iedlung. Forschungen im Seebachtal 3. A iTG 7. Frauenfeld.
G ross, Eduard (1986) V inelz-L ändti, G rabung 1979. Die neo lith ischen und spätb ronzezeitlichen U fersiedlungen. Bern.
G ross, Eduard (1987) Die spätb ronzezeitliche K eram ik. In: G ross et al. Zürich «M ozartstrasse» . N eolith ische und bronzezeitliche U fersiedlungen 1. ZD A M 4. Z ürich , 15 0 -1 5 5 .
G uélat, M ichel, M oulin. B ernard et R entzel, Philippe (1998) Des sols enfouis dans les séquences de versant du Valais (Suisse). C arac té risa tion. durée des phases de pédogenèse e t sign ifica tion pour la ch ronologie régionale de l’H olocène. B ulletin d 'é tu d es préh isto riques et a rchéologiques alp ines. A ctes du V I11 C olloque In ternational su r les A lpes dans l 'A n tiqu ité , Sion, 2 6 -2 8 septem bre 1997. A osta 1998, 3 9 -5 2 .
H aas, Jean N icolas und H adorn , Philippe (1998) Die Vegetations- und K ulturlandschaftsgeschichte des Seebachtals von der M ittelsteinzeit bis zum Frühm itte la lter anhand von Pollenanalysen. In: A iTG 4. Frauenfeld, 2 2 1 -2 5 5 .
H afner, A lbert (1995) D ie Frühe B ronzezeit in der W estschweiz. Funde und B efunde aus S iedlungen, G räbern und H orten der en tw ickelten Frühbronzezeit. U fersied lungen am B ielersee 5. Bern.
H asenfratz. A lbin (1997) Z ur neolith ischen Forschung im Thurgau. A S 20. 4 6 -5 0 .
H asenfratz, A lbin und Schnyder, M atth ias ( 1998) Das S e e b ac h ta l-E in e archäologische und paläoökologische B estandesaufnahm e. Forschungen im Seebachtal 1. A iTG 4. Frauenfeld.
H echt. Konrad ( 1938) Vom G algenbrunnen zum Seepum pw erk. K onstanzer W asserversorung einst und je tz t. In: D eutsche B odenseezeitung, Nr. 293, 2 -3 .
H echt. Konrad (1939) Z ur G eschichte der B runnen a u f der K onstanzer M arktstätte . In: M ein H eim atland 26, 1. K onstanz, 2 2 -2 8 .
H echt. K onrad ( 1939) Z ur G eschichte der K onstanzer W asserversorgung, ln: A lem annisches Volk. Kultur- und H eim at-B eilage der «B odensee- R undschau», 7. Jahrgang. Teil 1: Nr. 1, Sa. 7. Jan. 1939. 1 -3 , Teil 2: Nr. 2, Sa. 14. Jan. 1939, 5 - 7 . Teil 3: Nr. 3, Sa. 21. Jan. 1 9 3 9 .9 -1 1 .
H eierli. Jakob ( 1896) D ie archäo log ische K arte des Kts. Thurgau, nebst E rläu terungen und Fundregister. T hurgau ische B eiträge zur vaterländ ischen G esch ich te 36, 105 160.
H erzog. R uedi und Stricker. H annes ( 1993) G renzschu tz am B odensee und die G eschichte der G renzbrigade 7. Frauenfeld.
H ochuli, S tefan (1990) W äld i-H ohenrain TG. Eine m itte lb ronzezeitliche- und ha lls tattzeitliche Fundstelle . A ntiqua 21. Basel.
H ochuli. S tefan (1994) A rbon-B leiche. Die neo lith ischen und b ronzeze itlichen S eeufersiedlungen. A iTG 2. Frauenfeld.
H ochuli. Stefan (1997) Im Banne des M etalls: die frühe und m ittlere B ronzezeit im Thurgau. AS 20. 6 2 -6 5 .
H ochuli. S tefan (1998) C hronolog ie M itte lbronzezeit, Z en tral- und O stschw eiz. In: SPM 111, 5 6 -6 2 .
H ochuli, S tefan und M aise. C hristian ( 1998) G eräte und Schm uck aus Stein. In: SPM Hl, 2 6 9 -2 7 3 .
H ochuli, S tefan , K öninger, Joachim und Ruoff, U lrich ( 1994) D er abso lu tchronologische R ahm en der F rühbronzezeit in der O stschw eiz und in Südw estdeutschland. A rchäo log isches K orrespondenzblatt 24. 2 6 9 -2 8 2 .
Höfler, E dgar und llli. M artin ( 1992) V ersorgung und Entsorgung der m itte la lterlichen Stadt. V ersorgung und Entsorgung im Spiegel der Schriftquellen . In: Flüeler. M arianne und Flücler. N iklaus (H rsg .) S tadtluft, H irsebrei und B ettelm önch. Die S tadt um 1300. A usste llungskatalog Z ürich /S tu ttgart. S tu ttgart, 3 5 1 -3 6 4 .
H operi, Sabine (1995) Die späthallstatt-Z frühlatenezeitliche S iedlung im G ew ann «M ühlenzelg le» in Singen am H ohentw iel. K reis Konstanz. In: F ürstensitze-H öhenburgen-T alsiedlungen. B em erkungen zum frühkeltischen Siedlungsw esen in B d-W ttb. A rchäologische Info rm ationen aus Bd-W ttb. 28. 4 7 - 5 6 . L andesdenkm alam t Bd-W ttb.
H opert, Sabine (1996) Frühe scheibengedreh te K eram ik aus Südw estdeutschland und der Schw eiz. A S 19. 1 8 -2 7 .
Junkes, M arina (1991) D ie spätm itte lalterliche G esch irrkeram ik der G rabung K onstanz F ischm arkt. U npubliz ierte D issertation. U niversität Kiel.
Junkes, M arina ( 1992) K eram ikgesch irr aus K onstanz. In: Flüeler, M arianne und Flüeler, N iklaus (H rsg .) S tadtluft, H irsebrei und B ettelm önch. Die S tadt um 1300. A usste llungskatalog Z ürich /S tu ttgart. S tuttgart, 3 4 0 -3 4 5 .
K eefer. Erw in (1984) Die b ronzezeitliche «S iedlung Forschner» bei Bad Buchau. Kr. B iberach. 1. V orbericht. B erichte zu U fer- und M oorsiedlungen Südw estdeutschlands 1. M aterialhefte zu r Vor- und Frühgeschichte in Bd-W ttb. 4, 3 7 -5 2 .
K eefer, E rw in (1990) D ie «S iedlung Forschner» am Federsee und ihre m itte lb ronzezeitlichen Funde. B erR G K 71, 3 8 -5 1 .
K eller-T arnuzzer. Karl (1937) B ronzezeit, K reuzlingen. T hurgauische B eiträge zu r v a terländischen G eschichte 74, 7 0 -7 1 .
K eller-Tarnuzzer. Karl und R cinerth . H ans (1925) U rgeschichte des Thurgaus. Frauenfeld.
Köninger, Joachim (1995) Eine stark befestig te P fahlbausiedlung der jün g eren F rühbronzezeit in der O beren Güll bei K onstanz-E gg. K reis Konstanz. A rchäologische A usgrabungen in Bd-W ttb.. 6 5 -7 3 .
K ossack, G eorg (1959) Südbayern w ährend der H allstattzeit. R öm isch- G erm anische Forschungen 24. Berlin.
K rause, R üdiger (1988) G rabfunde von Singen am H ohentw iel I. D ie end- neolith ischen und frühbronzezeitlichen G rabfunde a u f der N ord stad tterrasse von Singen am H ohentw iel. Stuttgart.
K rause. R üdiger (1997a) K om m unikation. H andel und D eponierung in der B ronzezeit. Die B ronzezeit in Südw estdeutschland. In: G oldene Jah rhunderte, 4 1 -5 1 .
K rause, R üdiger (1997b) G rossbau ten der F rühbronzezeit aus B opfingen. D ie B ronzezeit in Südw estdeutschland, ln: G oldene Jahrhunderte,6 3 -6 6 .
K ühne, K arsten (1979) Das K rim inalverfahren und der Strafvollzug in der Stadt Konstanz. K onstanzer G eschichts- und R echtsquellen 24. K onstanz.
Leutenegger. A lbert (1932) Das T ägerm oos. T hurgauische B eiträge zur vaterländischen G eschichte 69. 1-117.
Leuzinger, Urs (1997) S teinzeitliche W ildbeutergruppen im G ebiet des heutigen K antons Thurgau. AS 20. 4 - 4 5 .
250 Literaturverzeichnis
Leuzinger, Urs (1998) Die m eso lith ischen Stationen im Seebachtal. In: A iTG 4. Frauenfeld 2 8 -5 2 .
Leuzinger, Urs (2000) Die jungste inze itliche S eeufersied lung A rbon- B leiche 3. B efunde. A iTG 9. Frauenfeld.
Lüschcr, G eneviève (1993) U nterlunkhofen und d ie ha lls tattzeitliche G rab keram ik in der Schw eiz. A ntiqua 24. Basel.
M arti, Reto (2000) Z w ischen R öm erzeit und M ittelalter. Forschungen zur frühm itte la lterlichen S ied lungsgesch ich te der N ordostschw eiz (4 .-1 0 . Jahrhundert). A rchäo log ie und M useum 41. Liestal.
M artin . M ax et al. (1973), Eine früh latènezeitliche S iedlung bei G elterk in- dcn. B aselb ic tcr H eim atbuch 12. L iestal, 1 7 0 -2 1 3 .
M asserey, C atherine und Joye, C atherine ( 1997) D eux m aisons celtes à A lle, N oir Bois (JU ). AS 20, 139 -148 .
M aurer. H elm ut (1989) K onstanz im M ittclalter. I. Von den A nfängen bis zum Konzil. In: G eschichte der Stadt K onstanz. 9 -2 9 5 .
M aurer. H elm ut (1996a) K onstanz im M itte lalter I. Von den A nfängen bis zum Konzil. G esch ich te der S tadt K onstanz 1. 2. übcrarb. A uflage. Konstanz.
M aurer. H elm ut (1996b) K onstanz im M ittc lalter II. Vom Konzil bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. G eschichte der S tadt K onstanz 2. 2. überarb. A uflage. Konstanz.
M eisel. Peter (1957) Die V erfassung und V erw altung der Stadt K onstanz im 16. Jahrhundert. K onstanzer G esch ich ts- und R echtsquellen 8. Konstanz.
M enotti, Francesco (1998/99) D ie A ufgabe der frühbronzezeitlichen U ferrandsied lung von B odm ann-Schachen. P lattform 7/8. 5 8 -6 6 .
M SC C MunseH Soil C olor C harts, B altim ore 1954.N agy, G isela (1997) U erschhausen-H orn . K eram ik und K leinfunde der
spätestb ronzezeitlichen S iedlung. Tafeln. Forschungen im Seebachtal 2. A iTG 6. Frauenfeld.
N agy, G isela (1999) U erschhausen-H orn . K eram ik und K leinfunde der spätestb ronzezeitlichen S iedlung. Text. Forschungen im Seebachtal 2. A iTG 6. Frauenfeld.
N eugebauer, Johannes-W olfgang und B lesi. C hristoph (1998) Das T raisental in N iederösterreich . Die S ied lungsersch liessung einer T allandschaft im A lpenvorland in der B ronzezeit. In: Hänsel, B ernhard (H rsg .) M ensch und U m w elt in der B ronzezeit Europas. A bsch lusstagung der K am pagne des Europarates: Die B ronzezeit: D as Erste G oldene Z eita lte r Europas, an der Freien U niversität B erlin , 17 .-19 . M ärz 1997. B erlin . 3 9 5 -4 1 8 .
N ielsen, Ebbe H. (1997) Fällanden Z H -U sserrie t. Zum Ü bergangsbereich Spätm eso lith ikum -F rühneo lith ikum in der Schw eiz. JbSG U F 80. 5 7 -8 4 .
O elze, Patrik (1996). D as K onstanzer H afnerhandw erk im 15. und 16. Jahrhundert im Spiegel der schriftlichen Q uellen, ln: A rchäologisches L andesm useum B d-W ttb. (H rsg .) G laube, Kunst und Spiel. A L M anach 1. S tu ttgart, 2 5 -5 8 .
O exlc. Jud ith (1985) Eine K onstanzer T öpferw erksta tt im 17. Jh. [Töpferei Vogler], ln: L andesdenkm alam t B d-W ttb. (H rsg .) D er K eltenfurst von H ochdorf. M ethoden und Ergebnisse der Landesarchäologie. K atalog zur A usste llung S tu ttgart 1985. S tu ttgart, 4 7 3 -4 8 3 . Fundkatalog 4 9 5 -5 0 7 .
O exle, Judith (1992a) K onstanz [S tadtportrait], In: Flüeler, M arianne und Flüeler, N iklaus (H rsg .) S tadtluft, H irsebrei und B ettelm önch. Die Stadt um 1300. A usste llungskatalog Z ürich /S tu ttgart. S tuttgart, 5 3 -6 7 .
O exle. Jud ith (1992b) V ersorgung und Entsorgung der m itte la terlichen Stadt. V ersorgung und E ntsorgung nach dem archäologischen B efund. In: Flüeler. M arianne und Flüeler, N iklaus (H rsg .) Stadtluft, H irsebrei und B ettelm önch. D ie S tadt um 1300. A usste llungskatalog Z ürich /S tu ttgart. S tuttgart. 3 6 4 -3 7 4 .
O exle, Judith u. C ordie-H ackenberg , R osm arie (1984) Spâtla tènezeitliche S iedlungsfunde aus K onstanz. B rückengasse 5 -7 . A rchäologische A usgrabungen in B d-W ttb., 7 6 -7 8 .
O stendorp , W olfgang und Froböse, C hristiane (1994) Ein b ronzezeitlicher S trand bei Ludw igshafen (K reis K onstanz, Ü berlinger See). P lattform 3, 3 7 -4 5 .
O sterw alder, C hristin (1971) D ie m ittlere B ronzezeit im schw eizerischen M ittelland und Jura. M onographien zu r Ur- und F rühgeschichte der Schw eiz 19. Basel.
Parzinger. H erm ann et al. (1998) D er G oldberg. Die m etallzeitliche B esiedlung. R öm isch-G erm anische Forschungen 57. M ainz.
P irling, R enate et al. (1980) D ie m ittlere B ronzezeit a u f d er Schw äbischen Alb. PBF X X , 3. M ünchen.
Prim as. M argarita (1990) Die B ronzezeit im Spiegel ihrer S iedlungen. In: H öneisen , M arkus (H rsg .) Die ersten B auern I. Z ürich , 7 3 -8 0 .
Prim as, M argarita ( 1998) D er b ronzezeitliche L andausbau in den A lpen. In: H änsel, B ernhard (H rsg .) M ensch und U m w elt in der B ronzezeit Europas. A bsch lusstagung der K am pagne des E uroparates: Die B ronzezeit: Das Erste G oldene Z eita lter Europas, an der Freien U niversität Berlin. 1 7 .-19 . M ärz 1997. B erlin. 3 5 5 -3 6 5 .
R entzel, Philippe (1996) Q uartä rgeo log isch-bodenkundliche V erhältnisse. In: Leuzinger-P iccand, C atherine. E insiedeln SZ -L angrüti: eine spätm agdalen ienzeitlichc und m eso lith ische Frcilandstation in den V oralpen. G rabungsberich t und Sam m lungsstud ie. JbSG U F 79, 7 -2 6 .
R entzel. Philippe (1997) G eo log isch-bodenkundliche U ntersuchungen in der G rabung Süd. In: Spycher. H ans Peter und Schucany, C aty (H rsg.) Die A usgrabungen im Kino Elite im R ahm en der b isherigen U ntersuchungen der S o lo thurner A ltstadt. A ntiqua 29, 2 3 -3 2 .
R igert, Erw in und W älchli, D avid (1996) Das «H ebandchuus» in Kaisten. B auarchäologische U ntersuchung an e inem B auernhaus des frühen 17. Jah rhunderts m it e inem V orgängerbau aus dem Spätm ittelalter. B lätter für H eim atkunde und H eim atschutz 70, 2 9 -1 1 2 .
Riha, Em ilie (1979) Die röm ischen Fibeln aus A ugst und K aiseraugst.F orschungen in A ugst 3. A ugst.
R öber. Ralph (1996) Studien zu r O fenkeram ik der T öpferei Vogler (ca. 1650 -1683). Fundberichte aus Bd-W ttb. 21, 5 7 9 -6 1 8 .
R uckstuhl. B eatrice (1989) H allstattzeitliche S ied lungsgruben aus N eunkirch-Tobeläcker. JbSG U F 72, 5 9 -9 8 .
R uoff, U lrich (1998) G reifensee-B öschen . Kt. Zürich. Die U nterw asser- R ettungsgrabung. H elvetia A rchaeologica 29, 2 -4 4 .
R ychener. Jürg (1995) D ie S ituation der O stschw eiz. In: 60 B C -1 5 AD. D 'O rgéto rix à Tibère. Préactes co lloque A RS, Porrentruy 2/3 novem bre 1995, 8 2 -8 8 .
Schilling C hron ik 1513: Die L uzerner C hronik des D iebold Schilling. K om m entarband zum Faksim ile. Hg. v. A lfred A. Schm id. Luzern 1981.
Schindler. M artin P. (1998) K irchberg SG -G ähw il, A lttoggenburg/ St. Iddaburg und O berbüren SG -G lattbrugg: zwei prähistorische Fundstellen im unteren St. G alle r Thurtal. JbSG U F 81, 7 -2 2 .
Schlichtherlc. H elm ut (1985) P rähistorische U fersiedlungen am Bodensee. Eine E in füh rung in natu rräum liche G egebenheiten und archäo log ische Q uellen , ln: L andesdenkm alam t B d-W ttb. (H rsg.) B erichte zu Ufer- und M oorsiedlungen S üdw estdeutschlands 2. M aterialhefte zu r Vor- und F rühgeschichte in B d-W ttb. 7. S tuttgart. 9 - 4 2 .
Schlichtherlc. H elm ut ( 1990a) S iedlungsarchäologie im A lpenvorland 1. Die Sondagen 1973-1 9 7 8 in den U fersicdlungen H ornstaad-H örnle: B efunde und Funde zum frühen Jungneo lith ikum am w estlichen B odensee. Forschungen und B erichte zur Vor- und F rühgeschichte in Bd-W ttb. 36. Stuttgart.
Schlichtherlc . H elm ut (1990b) A spekte der s iedlungsarchäologischen Erforschung von N eolith ikum und B ronzezeit im südw estlichen A lpenvorland. B erR G K 71, 2 0 8 -2 4 2 .
Schlichtherlc, H elm ut (1990c) Jungste inzeitliche K ulturgruppen zw ischen B odensee und Federsee. In: H öneisen. M. et al. (H rsg .) D ie ersten B auern 2. Zürich, 135-156 .
Schlichtherlc , H elm ut (1994a) Exotische Feuersteingeräte am Bodensee.P lattform 3, 4 6 -5 3 .
Schlichtherlc , H elm ut (1994b) Eine M ineralbodensied lung der M itte lb ronzezeit in B odm an, G de. B odm an-L udw igshafcn , K reis K onstanz. A rchäologische A usgrabungen in B d-W ttb., 6 1 -6 5 .
Schröter, R udolfine und Schröter, Peter (1974) Zu ein igen Frem delem enten im späten M ittel- und beginnenden Jungneo lith ikum Südw estdeutschlands. F undberich te aus Bd-W ttb. 1. 157 -1 7 9 .
Schucany, Caty, M artin-K ilcher, S tefanie, Berger, Ludw ig und Paunier, D aniel (1999) Hrsg. R öm ische K eram ik in der Schw eiz. A ntiqua 31. Basel.
Seifert, M athias (1996) D er archäologische B efund von Z ug-Sum pf. Zug- S u m p f 1, 1-197.
Literaturverzeichnis / Ortsverzeichnis 251
S eifert. M athias ( 1997) Die spätb ronzezeitlichen U fersied lungen von Zug- S u m p f 2/1. Die Funde der G rabungen 1 9 5 2 -5 4 . Text. Zug.
S eifert. M athias u. W underli. M arlies (1997) Die spätb ronzezeitlichen U fersied lungen von Z u g -S u m p f 2/2. Die Funde der G rabungen 1 9 5 2 -5 4 . K atalog und Tafeln. Zug.
Sitterd ing , M adeleine (1974/75) Die b ronzezeitlichc H öhensied lung von W aldi bei Toos. JbSG U F 58, 1 9 -3 9 .
SPM I (1993): S töckli. W erner E. et al. (H rsg .) SPM 1. die Schw eiz vom Paläolith ikum bis zum frühen M ittelalter. Paläolith ikum und M esolithikum . Basel.
SPM 11 (1995) Stöckli. W erner E. et al. (H rsg.). d ie Schw eiz vom P aläolith ikum bis zum frühen M ittelalter. N eolith ikum . Basel.
SPM III (1998): H ochuli. Stefan et al. (H rsg .) SPM III. d ie Schw eiz vom Paläolith ikum bis zum frühen M ittelaltcr. B ronzezeit. B asel, 5 6 -6 2 .
S tehrenberger, T hom as (2000) Die L atènezeit im T hurgau. U nveröffentlichte L izentia tsarbeit am Sem inar für Ur- und F rühgeschichte der U niversität Zürich.
S töckli, W erner, E. (1995) G eschichte des N eolith ikum s in der Schw eiz. In: SPM II, 1 9 -4 9 .
Stöllner, T hom as (1999) Die H allstattzeit und der B eginn der Frühlatènezeit im Inn-Salzach-R aum . A rchäologie in Salzburg 3/II. Salzburg.
S toops, G eorges (1990) M ultilingual transla tion o f the te rm ino logy used in the «H andbook for soil thin section descrip tion». In: D ouglas, Lowell (ed.) Soil m icrom orphology: a basic and applied science. Proceedings o f the V UIth In ternational W orking M eeting o f Soil M icrom orphology, San A ntonio , Texas - July 1988. A m sterdam , 7 0 5 -7 1 6 .
Suter, E lisabeth ( 1981 ) W asser und B runnen im alten Zürich. Z u r G eschichte der W asserversorgung der Stadt vom M itte lalter bis ins 19. Jahrhundert. Zürich.
Tauber. Jürg (1987) Eine «B randgrube» der Frühlatènezeit in Sissach BL. Ein A rbeitsbericht. AS 10, 102 -111 .
Taute, W olfgang ( 1977) Z u r Problem atik von M eso lith ikum und Frühneolith ikum am B odensee. In: B odm an - Dorf, K aiserpfalz, Adel. B odenseebiblio thek 13, 1 1 -3 2 .
T heune-G rosskopf, B arbara ( 1997) D er lange Weg zum K irc h h o f - W andel der germ anischen B esta ttungstradition . In: A rchäologisches L andesm useum Bd-W ttb. (H rsg .) Die A lam annen. A usste llungskatalog S tu ttgart/Z ürich /A ugsburg . S tu ttgart. 4 7 1 -4 8 0 .
T horbrügge, W alter ( 1979) Die H allstattzeit in der O berpfalz . M aterialhefte zur bayerischen V orgeschichte 39. K allm ünz.
Von Uslar, Rafael (1996) Zu R ätern und Kelten in den m ittleren A lpen.B erR G K 77, 156 -213 .
Van den Boom . H elga (1989) K eram ische S ondergruppen der H cuneburg. H euncburgstudien VII. R öm isch-G erm anische Forschungen 47. M ainz.
Vogt. R ichard (1990) Pedologische U ntersuchungen im U m feld der neolith ischen U fersiedlung H ornstaad-H örn le . B erRG K 71, 136 144.
W ieland, G ünther ( 1996) Die Spätla tenezeit in W ürttem berg . Forschungen zur jün g eren L atèneku ltu r zw ischen Schw arzw ald und N örd linger Ries. Forschungen und B erichte zu r Vor- und F rühgeschichte in Bd-W ttb. 63. Stuttgart.
W iniger, Jo se f und H asenfratz, A lbin (1985) U fersiedlungen am Bodensee. A rchäo log ische U ntersuchungen im K anton Thurgau 1981-1983 . A ntiqua 10. Basel.
W inkler, Titus (o. J.) K urzbericht über d ie A usgrabungen a u f dem Schlossbühl bei K reuzlingen. U npubliz ierter G rabungsbericht. A m t für A rchäologie des Kt. Thurgau.
Wood, W. R aym ond and Johnson, D onald Lee (1978) A survey o f d istu rbance p rocesses in archaeological site form ation . In: Schiffer, M ichael. B. (ed.) A dvances in archaeological m ethod and theory I. N ew York. 3 1 5 -3 8 1 .
W üstem ann , H arry ( 1995) D ie D olche und S tabdolchc in O stdeutschland. PB F V I, 8. Stuttgart.
Ortsverzeichnis
A ad o rf (TG ) E rlenbach (ZH ) K reuzlingen (TG ) Tasgetium (röm isch E schenz TG )Aichbiihl (0 ) E rm atingen (TG ) M ett-O berschlatt (TG ) Traisental (A)A lle-N oir Bois (JU ) Eschenz (TG ) M öriken (AG) T riboltingen (TG )A lttoggenburg (SG) Frauenfeld (TG ) M ühlhausen-E hingen ( 0 ) T roch telfingen ( 0 )A rbon (TG ) G aienhofen-H em m enhofen ( 0 ) N eftenbach (ZH) U etliberg (Z H )B aarburg (ZG ) G elterk indcn (BE) O te lfingen (ZH ) U erschhausen (T G )Bad B uchau (D) G oldberg (D) O ttenberg (T G ) U nteruhld ingen (D)B erikon (AG) G öttlichen (TG ) P fyn (TG ) U rdorf-H crw eg (ZH )B erlingen (TG ) G reifensee (ZH ) R ekingen (AG) W einfeldcn (TG )B ern-K irchenfeld (B E) G rossengstingen-H aid (D) Schaffhausen (SH) W ild lingen (SH )B odm an-Schachen (D ) H egau ( 0 ) Schellenberg-B orsch t (FL) Z ug (Z G )B opfingen (D) H erblingen (SH ) Seengen (AG)B üsingen (D) H euneburg (0 ) S ingen-M ühlenzelg le (D)C hâtillon-sur-G lâne (FR) H ornstaad-H örnle ( 0 ) S issach (BL)D iessenhofen (TG ) H ossingen (0 ) St. M argrethen (SG)E g g (D ) H üttw ilen-U erschhausen (TG ) S tein am R hein (SH)E m m ishofen (TG ) K onstanz (0 ) T ägerw ilen (TG )
252
Zusam m enfassung
A7 - Ausfahrt Archäologie
Das erste generelle Projekt für das letzte Teilstück der Nationalstrasse A7 vom Höhenzug des Seerückens zur Landesgrenze bei Konstanz wurde vom Bundesrat Mitte August 1972 genehmigt. Die A usführung der letzten vier K ilometer verzögerte sich aus verschiedenen Gründen. Nach diversen Projektänderungen war im Som m er 1997 Baubeginn.
Die um fangreichen Erdbewegungen au f dem Trassee der A7 und die dam it zusam m enhängende Verlegung von Strassen, Waldwegen und der Bahnlinie erforderten archäologische Abklärungen. Die Aufwendungen für die Ausgrabung und Bergung historischer Funde im Gebiet künftiger Nationalstrassen gehören nach einem Bundesbeschluss von 1961 zu den Erstellungskosten.
Mit der Ausführung der Untersuchungen wurde der Archäologe Erwin Rigert beauftragt. Er befasste sich eingehend mit der Besiedlungsgeschichte des G ebietes vom Bodensee über das Tägerm oos, einer rund 1 km 2 grossen verlandeten Bucht im Vorland von Konstanz, bis au f die M oränenterrassen zwischen 400 und 500 m ü. M.
Bereits bekannt waren Einzelfunde vom M esolithikum bis zum M ittelalter, einige frühm ittelalterliche G räberfelder und die Befestigungen der Stadt Konstanz, jedoch keine prähistorischen Siedlungsstrukturen. Eine Ausnahm e ist der Schlossbühl oberhalb von K reuzlingen, wo bronzezeitliche Schichten von m ittelalterlichen W ällen und Gräben überlagert sind.
Wie aufgrund früherer S ilexfunde anzunehm en war, kam en Lagerplätze des M esolithikum s zum Vorschein. Eine Ü berraschung war die Entdeckung der bislang ältesten jungsteinzeitlichen Landsiedlung im Kanton. Sie gehört zur so genannten H ornstaadergruppe und ist rund 6000 Jahre alt.
Neben Fundstellen des späteren Neolithikum s waren zwei Stationen der frühen und der mittleren sowie m ehrere der späten Bronzezeit vertreten, lediglich aber drei Siedlungsplätze der späten Eisenzeit. Interessanterweise fand man einige Einzelstücke röm ischer und frühm ittelalterlicher Zeitstellung, aber keine zugehörigen Siedlungen. Neuzeitlich sind die Ton- und A bfallgruben der Stadt Konstanz und Reste der W asserleitungen im Tägerm oos.
Die Besiedlungsgeschichte aufgrund der Sondierungen und G rabungen ergibt folgendes Bild:
Im M esolithikum um fasste der Untersee auch das Gebiet des heutigen Tägerm ooses. An seinem Ufer im Bereich der 400-m -H öhenkote lagerten zwischen 8000 und 5000 Jahren v. Chr. Jäger- und Sam m lergruppen. Ab etwa 4500 v. Chr. verlandeten Teile des Sees, und es bildete sich das Tägerm oos. An seinem südlichen Rand entstanden im Neolithikum Dörfer, und man begann, die angrenzenden Hangterrassen zu roden. In der Frühbronzezeit und der frühen M ittelbronzezeit wurde an ähnlichen Lagen gesiedelt wie in der Jungsteinzeit. Erst ab etwa 1450 v. Chr., d. h. ab der späten M ittelbronzezeit, bewohnte man auch die Höhen. In der Spätbronzezeit war das Tägerm oos trockener und besser begehbar, was ab etwa 1200 v. Chr. den Bau von Siedlungen am Rhein und Untersee erlaubte.
Die rund drei Jahre intensiver archäologischer Arbeit au f dem kurzen A utobahnabschnitt im Raum T ägerw ilen-K reuz- lingen haben zu vielen neuen Erkenntnissen geführt, g leichzeitig aber auch nachdenklich gestimm t. Wenn au f einem eng begrenzten Raum so viel entdeckt wird, müssten sich auch anderswo die Fundstellen dicht folgen. Leider fehlen im Norm alfall die Mittel für ähnlich intensive Untersuchungen, und vieles wird unbeobachtet unwiederbringlich zerstört.
253
Résumé
A7 - prochaine sortie: archéologie
Au mois d ’août 1972, le Conseil fédéral donnait son feu vert au projet initial de construction de l'u ltim e tronçon de la route nationale A l , entre le Seerücken, im portante moraine du glacier du Rhin, et la frontière allem ande à Constance. Pour divers motifs, la réalisation du projet fut ajournée à plusieurs reprises, et l’ouvrage ne put débuter qu ’en été 1997.
Les importants travaux d ’excavation prévus com prenaient le déplacem ent de routes, de chem ins forestiers et de lignes ferroviaires, impliquant des interventions archéologiques préventives. Rappelons que, selon un arrêté fédéral datant de 1961, le financem ent des fouilles archéologiques sur les zones touchées par la construction des routes nationales doit s ’inscrire dans les coûts de construction.
Erwin Rigert, archéologue, fut mandaté par le Service archéologique pour assurer le suivi des travaux autoroutiers. On opta pour une technique extensive visant à la com préhension globale de l’histoire du peuplem ent dans la région du lac de Constance, y com pris celle du Tägerm oos, une baie asséchée couvrant environ 1 km 2, en am ont de Constance, et celle des hauteurs environnantes, qui culm inent entre 400 et 500 m.
Dans la région, on recensait déjà plusieurs trouvailles isolées allant du M ésolithique au Moyen Age, quelques nécropoles m édiévales, et les fortifications de la ville de Constance. M is à part le site de Schlossbühl, un habitat fortifié en am ont de K reuztingen qui servit de refuge à l’âge du Bronze et au Moyen Age, on n ’avait jam ais découvert d ’habitats préhistoriques. Les recherches entreprises dans le cadre de la construction de l’autoroute perm irent d ’identifier quelques cam pem ents mésolithiques. Par contre, on ne s ’attendait guère à la découverte d ’un site terrestre néolithique, le plus ancien de cette période sur territoire cantonal. Il se rattache au groupe de Hornstaad et rem onte à environ 6000 ans.
Outre des villages du Néolithique final, on a découvert deux stations du Bronze ancien et du Bronze moyen, ainsi que
plusieurs sites du Bronze final, mais trois habitats du second âge du Fer seulem ent. 11 est intéressant de noter que, si l’on a découvert des trouvailles isolées datant de l’époque romaine et du Haut Moyen Age, aucune trace d ’habitat susceptible de s ’y rattacher n ’a pu être mise au jour. Les glaisières et les fos- ses-dépotoirs de la ville de Constance sont d ’époque m oderne, ainsi que les restes d ’une conduite d ’eau repérée dans le Tägerm oos.
Grâce à ces fouilles et sondages, nous som m es désorm ais en m esure de proposer une histoire du peuplement:
Au M ésolithique, le lac de Constance était nettem ent plus large; il recouvrait une surface correspondant à la superficie actuelle du Tägerm oos et atteignait approxim ativem ent la cote de 400 m. Entre 8000 et 5000 av. J.-C ., les rives de ce lac étaient parcourues par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Au Néolithique, dès 4500 av. J - C. environ, on assiste au com blement du lac et à la form ation du Tägerm oos. Sur ses bords s ’édifièrent des villages, et l’on com m ença à défricher les hauteurs. Au Bronze ancien et au Bronze moyen, le peuplem ent ne subit pas de m odifications importantes. Ce n ’est que vers 1450 av. J.-C., c ’est-à-dire dès la fin du Bronze moyen, que les hauteurs sont égalem ent habitées. Au Bronze ancien, le Tägerm oos était asséché et donc plus facile d ’accès, ce qui perm it la construction de villages sur le Rhin et le Lac inférieur.
Les quelques trois années de travaux archéologiques m enés de manière intensive sur le court tracé autoroutier dans la zone T ägerw ilen-K reuzlingen ont apporté de nombreux élém ents nouveaux, en nous rendant toutefois songeurs: si, sur une zone aussi restreinte, on découvre autant de vestiges, la densité des sites doit être très im portante ailleurs aussi. M alheureusem ent, en règle générale, les moyens financiers font défaut pour assurer un suivi archéologique, et d 'innom brables témoins du passé sont alors détruits à jam ais.
Catherine Leuzinger-Piccand
254
Riassunto
A7 - Uscita per l’archeologia
Il primo progetto generale per la costruzione dell’ultimo tratto dell'autostrada A7 tra la cim a del Seerücken e il confine nazionale presso Costanza venne accordato dal consiglio federale verso metà agosto dell'anno 1972. Lo svolgimento dei lavori degli ultimi quattro chilom etri è stato rim andato per varie ragioni. Dopo diversi cam biam enti del progetto i lavori sono stati avviati nell’estate 1997.1 lavori lungo il tracciato dell'autostrada A7 com portarono spostamenti di strade, vie e ferrovia, i quali richiesero accertamenti archeologici. Gli impieghi necessari per gli scavi e la raccolta dei reperti storici nelle aree di strade nazionali future, sono stati classificati secondo una legge del 1961 come costi di costruzione.Per lo svolgimento delle indagini fu incaricato l’archeologo Erwin Rigert. L 'archeologo si occupò della storia di agglom erazione, in maniera approfondita, della zona tra il Lago di Costanza, il Tägerm oos, una baia ormai interrata con una superficie piana di circa 1 km- presso Costanza, fino alle zone più alte com prese tra i 400 e i 500 m s.l.m.Già conosciuti erano singoli ritrovamenti dal periodo m esolitico fino al periodo medioevale, qualche necropoli del presto medioevo e le fortificazioni della città di Costanza. Strutture di agglom erazione invece, non erano conosciute. U n’eccezione è lo Schlossbühl sopra Kreuzlingen, dove sono stati ritrovati strati dell’età del bronzo ricoperti da mura e fossati medioevali.Com e ritrovamenti precedenti lasciarono presupporre, sono venute alla luce delle aree di accam pam ento del Mesolitico. Una grande sorpresa fu la scoperta della più antica agglom erazione neolitica del cantone. Questa agglom erazione appartiene al gruppo dell’H ornstaad ed è stata costruita circa 6000 anni fa.Accanto a dei luoghi di ritrovamento del tardo neolitico, sono stati scoperti due posti dell’antica e della media età del bronzo, così come più scoperte della tarda età del bronzo. I Ritro
vamenti databili nella tarda età del ferro am m ontano purtroppo soltanto al numero di due.Sono stati trovati diversi oggetti singoli datati nel periodo rom ano e quello medioevale, però, curiosam ente, senza luogo di appartenenza diretto nella zona. Di epoca m oderna invece sono le discariche della città di Costanza e i resti della canalizzazione del Tägerm oos.La storia di agglom erazione può essere ricostruita con l’aiuto di sondaggi e di scavi e risulta in m aniera seguente: nel periodo mesolitico il lago Untersee com prendeva anche la zona dell’attuale Tägerm oos; ai suoi margini all'altezza di 400 m, si svilupparono, nel periodo tra il 8000 e il 5000 a. C., diversi accam pam enti di gruppi di cacciatori; circa 4500 anni fa certe zone del lago si interrarono e così si sviluppò il Tägermoos. Lungo il m argine m eridionale nacquero durante il Neolitico dei paesi e si com inciò a disboscare i pendìi circostanti. Durante l’antica e la m edia età del bronzo furono costruite altre agglom erazioni nella stessa zona dell’età della pietra.Soltanto dal 1450 a. C. in poi, cioè a partire dalla tarda età del bronzo, furono costruite abitazioni anche sulle alture. Durante la tarda età del bronzo, dal 1200 a.C . in poi, il Tägerm oos diventò più asciutto ed accessibile, perm ettendo così la costruzione di agglomerazioni lungo il Reno ed il lago Untersee. I tre anni di lavoro archeologico intensivo lungo il breve tratto di autostrada traTägerw ilen e Kreuzlingen, hanno dato alla luce molte nuove conoscenze, e, allo stesso tempo, sono stati fonte di riflessioni. Dato che sono stati fatti tanti ritrovam enti in un ’area così com patta, si dovrebbe trovare altrettanto materiale nelle zone direttam ente adiacenti. N ella m aggior parte dei casi m ancano i mezzi per effettuare ricerche così com plesse com e questa e tante cose vengono purtroppo distrutte involontariam ente senza neanche accorgersene.
Daniele Fabro
255
Tabellen
Lf-Nr. Ort 14C-Nr. Labor-Nr. y BP BC 1 s W in % BC 2 s W in % Schicht Befund
1 ARA-Str. ARA 3 UZ-4212
ETH-195473195 ± 5 5 15 2 5 - 1420 68.20% 1620 - 1390
1340 - 132094.30%
1.10%200 Kulturschicht
BZ
2 ARA-Str. ARA 5 UZ-4213 ETH-19548
3150 ± 5 5 15 2 0 - 1400 68.20% 1530 - 1300 1590 - 1560
94.30%1.10%
200 KulturschichtBZ
3 Töbeli A_KT 1 UZ-4221ETH-19556
6205 ± 70
4 Töbeli B_KT 2 UZ-4222ETH-19557
7 3 5 0 ± 70
5 Töbeli C_KT 3 UZ-4223ETH-19558
8705 ± 75
6 Töbeli D_KRT 1 UZ-4097ETH-18187
3340 ± 60 17 0 0 - 1590
15 7 0 - 1520 1740 - 1720
69.00%
24.00%7.00%
1 7 8 0 - 1510
18 7 0 -1 8 4 098.00%
2.00%
UK 310 / OK 320
UK Kulturschicht FBZ
7 Töbeli EJKRT2 UZ-4098ETH-18188
3910 ± 60 2500 - 2320 2560 - 2540
97.00%3.00%
2580 - 2200 100.00% 320 Bodenbildung
8 Töbeli FJK R T3 UZ-4099ETH-18189
3650 ± 55 2140 - 1950 100.00% 2 2 0 0 - 1880 100.00% 310 Kulturschicht
9 Töbeli G _KR T4 UZ-4100ETH-18190
3360 ± 55 1740 - 1610 1560 - 1540
93.00%
7.00%
1780 - 1520
1 8 7 0 - 1840
97.00%
3.00%
310 Kulturschicht
10 Hochstross TH 42 UZ-4218
ETH-19553
3995 ± 60 2610 - 2460 68.26% 2750 - 2300 2900 - 2800
87.00%8.40%
325 alte Bodenbildung
11 Hochstross TH 39 UZ-4216ETH-19551
3565 ± 95 2040 - 1860 1850 - 1770 2 1 1 0 -2 0 9 0
48.10% 17.50%
2.50%
2200 - 1650 95.44% 310, oberer
BereichKolluvium
12 Hochstross TH 34 UZ-4330 ETH-21604
3330 ± 60 1672 - 1535 68.26% 1738 - 1462 95.44% 315 UK, Bereich Gehhorizont
UK Kulturschicht FBZ/MBZ
13 Hochstross TH 36 UZ-4331ETH-21605
3305 ± 65 1657 - 1507 68.26% 1731 - 1440 95.44% 315 UK, Bereich Gehhorizont
UK Kulturschicht FBZ/MBZ
14 Hochstross TH 40 UZ-4217
ETH-195523195 ± 7 5 153 0 - 1400
1600 - 156058.50%
9.70%1680 - 1310 95.44% 315, unterer
BereichKulturschicht
FBZ/MBZ
15 Hochstross TH 35 UZ-4215 ETH-19550
3 1 7 0 ± 60 152 0 - 1410 68.26% 154 0 - 1310 16 1 0 - 1550
88.40%7.00%
315 M itte KulturschichtFBZ/MBZ
16 Hochstross TH 33 UZ-4329ETH-21603
3135 ± 7 5 1475 - 1290 68.26% 1564 - 1172 95.44% 315 M itte KulturschichtFBZ/MBZ
17 Hochstross TH 25 UZ-4214ETH-19549
3 0 4 5 ± 55 1400 - 1260 68.26% 1440 - 1120 95.44% 315 Mitte KulturschichtFBZ/MBZ
18 Hochstross TH 106 UZ-4220ETH-19555
2375 ± 55 530 - 390 760 - 720
59.10%9.10%
6 1 0 -3 7 0 770 - 620
70.60%24.80%
eingetieft in 310 Grube Latènezeit
19 Hochstross TH 46 UZ-4219 ETH-19554
2 3 3 5 ± 55 530 - 360 65.80% 550 - 200 800 - 600
83.00%12.40%
eingetieft in 310 SteinsetzungLatènezeit
20 Hochstross TH 5 2234
(Dendroprobe)1012 - 870 eingetieft in 310 Pfostengrube SBZ
und Waldkante
21 Ribi-Brunegg KRBR 1 UZ-4224
ETH-195593095 ± 60 144 0 - 1300
12 8 0 - 126065.30%
2.90%152 0 - 1210 95.40% 210 Kulturschicht
BZ
22 Ribi-Brunegg KRBR2 UZ-4225 ETH-19560
3000 ± 55 1320 - 1200 13 9 0 - 1340 119 0 - 1160
46.00%13.40%
8.80%
1410 - 1060 95.40% 210 KulturschichtBZ
23 Ribi-Brunegg KRBR 3 UZ-4226ETH-19561
2985 ± 55 132 0 - 1130 13 7 0 - 1350
63.70%4.50%
1400 - 1050 95.40% 210 KulturschichtBZ
24 Spulacker TS 1 UZ-4328ETH-21602
4 0 2 0 ± 65 2649 - 2467 68.26% 2847 - 2346 95.44% 8 Bodenbildung
25 Spulacker Trafo 1 UZ-4327 ETH-21601
5005 ± 60 3905 - 3727 68.26% 3944 - 3673 95.44% 7 Bodenbildung
Abb. 224: 14C-Daten a ller Stationen