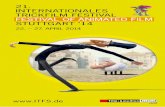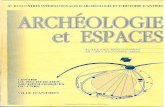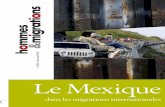Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten, in: V. Gaggadis Robin - M. Redde (eds.),...
-
Upload
independentresearcher -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten, in: V. Gaggadis Robin - M. Redde (eds.),...
actes du xe colloque international sur l’art provincial romain, p. 783 à p. 792
Cristina-Georgeta Alexandrescu
Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten
Abstract : The study of the depictions of musical instruments and musicians on Roman funerary |
monuments made possible several observations concerning the used schemata for cornicines, the
organology of the instrument and the identification of the represented musical instruments. For the
depiction of cornu and military cornicines on gravestones in Aquincum as well as in Mainz and near
Bonn, the artists aimed to carve very realistic representations. The results of this concern for realism
have been quite confusing for the scholars willing to find correspondences between the names of
musical instruments (known from the written sources) and the existing iconographical evidence.
Eine Untersuchung der Abbildungen von Musikern und Musikinstrumenten auf römischen Grabdenkmälern hinsichtlich ihrer Realitätstreue stellte zunächst fest, dass das Thema sowohl auf direkt mit den Musikern in Verbindung stehenden Denkmälern (Grabdenkmäler der Musiker) als auch auf anderen Monumenten vorkommt. Die spezielle Erforschung der römischen Blasmusiker hat auch die Feststellung erbracht, dass manche Grabdenkmäler, auf denen deren Musikinstrumente abgebildet sind, regionale Züge oder werkstattbedingte Details erkennen lassen.
Literarisch und epigraphisch sind die Namen von vier Blasmusikinstrumenten überliefert 1. Nach näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass nur drei davon beim Militär Verwendung fanden. Die Forschung des 20. Jahrhunderts hat sich anfangs aber bemüht, eine Übereinstimmung der durch verschiedene Quellen überlieferten Informationen zu finden 2. Zudem hatte man sich die Identifizierung und Benennung der dargestellten Musikinstrumente und Musiker zum Ziel gesetzt. Die gefundenen Lösungen und ggf. Vorschläge waren dennoch nicht zufriedenstellend. Besonders unsicher schienen die Unterschiede zwischen cornu und bucina, bucina und tuba oder tuba und lituus 3.
Ausgangspunkt der einen oder anderen Hypothese waren die Grabdenkmäler der Musiker, in der Annahme, dass die Abbildungen der Musikinstrumente und ggf. die dazugehörige Inschrift hier am ehesten der Wahrheit entsprächen.
1. Alexandrescu 2004.2. Behn 1912 und die davon ausgehende Literatur.3. siehe z.B. die Diskussion bei Speidel 1976 sowie die Gegenargumente bei Meucci 1987, S. 259-272. Vgl. auch Alexandrescu 2006, S. 207-220 ; Tamboer, van Vilsteren 2006, S. 221-236.
Cr.-G. Alexandrescu • Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten
784
Hinsichtlich der gewählten Thematik lassen sich grundsätzlich mehrere Kategorien unterscheiden, die den auch sonst überlieferten Einsatzbereichen der Blasmusiker entsprechen : Kriegsgeschehen, offizielle Zeremonien, Gladiatorenkämpfe und athletische Spiele sowie Begräbniszeremonien 4.
Während die cornicines auf fast allen Darstellungen der genannten Sujets vorkommen, sind die tubicines bei diesem historischen oder realistischen Themenspektrum nur bedingt zu finden, vor allem in zeremoniellem und feierlichem Umfeld.
In diesem Rahmen werden die cornu-Darstellungen näher betrachtet, besonders die Abbildungen des Instrumentes auf Grabdenkmälern aus Aquincum, aus Gallien, aus Italien und aus Germanien.
Eine Systematik der Haltungen der Musiker berücksichtigt erstens die Handhabung des Instruments, zweitens dessen Ausrichtung, und drittens die Tätigkeit des Bläsers, d.h. ob das Instrument gespielt wird.
Das cornu wird, abhängig von seiner Größe, von seinem Bläser entweder auf die Schulter gelegt oder aber – bei der kleinen Variante – vor dem Körper gehalten. Wenn es gespielt wird, hält eine Hand die Griffstange, während die andere das Mundstück an die Lippen presst. Eine besonders selten dargestellte Haltung ist die, bei welcher der Bläser mit einer Hand das Instrument so hält, dass die Griffstange in seinem Nacken liegt, während er das von rechts kommende Mundstück mit der anderen Hand an die Lippen presst (z.B. auf dem sog. Großen Sarkophag Ludovisi).
Wenn es nicht gespielt wird, kann das auf der Schulter getragene Instrument mit einer Hand entweder an der Griffstange oder am unteren Bereich des Rohres festgehalten werden. Das cornu wird auf Darstellungen sowohl auf die rechte als auch auf die linke Schulter gestützt, gelegentlich kann der cornicen die lange Querleiste diagonal über der Brust tragen 5.
Darstellungen der Blasmusiker auf ihren Grabdenkmälern
Es sind bis jetzt zehn Grabmäler von tubicines mit Darstellung des Instruments bekannt, sechs davon zeigen auch die Blasmusiker selbst. Auffallend ist die Vorliebe für die Darstellung von Instrumententeilen, hauptsächlich den Schalltrichter und den Mundstückhalter. Für cornicines sind sechzehn Beispiele erhalten. Die Soldaten ließen sich auf elf Denkmälern auch selbst darstellen, während weitere fünf Grabstelen nur das Bild des cornu tragen. Chronologisch betrachtet überwiegen für die tubicines die Denkmäler des 1. und 2. Jhs. n. Chr., während die cornicines am häufigsten im 2. und 3. Jh. n. Chr. vorkommen 6.
Die Blasmusiker verwendeten für ihr Bild auf den Grabdenkmälern die Form der Ganzkörperdarstellung und das Brustbild oder ließen sich als Reiter darstellen.
4. Als willkürlich ausgewählte Beispiele seien hier die folgenden genannt : Kriegsgeschehen – der Schlachtsarkophag Ludovisi – Aurigemma 1954, S. 88, Nr. 229, Taf. 36 ; offizielle Zeremonien – die antoninischen Platten auf dem Constantinsbogen – Scott Ryberg 1967 ; Gladiatorenkämpfe und athletischen Spiele – das Mosaik aus der villa in Zliten, Aurigemma 1926, S. 149 f. ; Begräbniszeremonien – der Relief von Amiternum, Franchi 1963-1964, S. 23 ff.5. z.B. Trajanssäule Sz. CIX (= Florescu 1969, Taf. 93).6. Die erhaltenen Denkmäler verteilen sich folgendermaßen : Italia 2 Beispiele, Rom 2, Sardinia 1, Germaniae 4, Galliae 6, Pannoniae 6, während aus Moesia superior, Thracia, Africa, Syria, Achaia und aus dem Regnum Bosporanum jeweils ein Beispiel bekannt ist.
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
785
In manchen Fällen ist allein die Darstellung des Musikinstrumentes auf dem Grabstein der Hinweis auf die Tätigkeit des Verstorbenen als Blasmusiker. Methodisch gesehen sind die Beobachtungen, die ich demnächst vorstellen möchte, Ergebnisse einer weit angelegten Erfoschung der Abbildungen von diesen Musikern und deren Instrumenten, sowie des Vergleichs mit der schriftlichen Überlieferung. Die epigraphische und papyrologische Überlieferung der Blasmusiker im römischen Heer ist recht spärlich 7. Zudem ist anzumerken, dass, obwohl insgesamt mehr tubicines als cornicines bekannt sind (auch bei den Grabinschriften beträgt das Verhältnis 31 zu 22), dennoch mehr cornicines bekannt sind, die auf ihren Grabmälern das Instrument darstellen ließen. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes bzw. der fehlenden Angaben in der Inschrift bleibt bei manchen Blasmusikern unklar, ob sie beim Militär tätig waren oder als zivile Musiker einzuordnen sind.
Die Grabstele des Aur. Bitus, cornicen der leg. II Adiutrix (Abb. 1), wurde in Aquincum gefunden, wo auch der von ihm errichtete Sarkophag seines Sohnes erhalten ist 8. Auf beiden Denkmälern ist der Hornist in Vollfigur dargestellt. Auf seiner Grabstele hält der cornicen das Instrument auf der linken Schulter. Auf dem kleinen Sarkophagkasten des Aurelius Vitalinus wird das Instrument – ähnlich wie auf Grabsteinen, die nur cornu
abbilden – nur schematisch angegeben (Abb. 2), allem Anschein nach mit dem Schalltrichter nach oben (Abb. 3). Interessant sind hier zwei Einzelheiten. Der Verstorbene hält in seiner Rechten einen Gegenstand, der zuerst, wie üblicherweise auf den Darstellungen des späten 2. und 3. Jhs. n. Chr., als rotulus zu deuten wäre. Der neben ihm stehende Sohn hält auch in der Hand eine Schriftrolle, die aber, anders als bei seinem Vater, eine gleichmäßige Form aufweist. Der Gegenstand in der Hand des Bitus hat dagegen einen pilzförmigen oberen Abschluss und könnte das abmontierte Mundstück seines cornu sein. Das zweite bedeutende Detail ist die Darstellungsweise des Instruments, die ohne Vergleich unter den anderen Ganzkörperdarstellungen der cornicines ist. Die meisten anderen cornicines sind entweder in Vorderansicht mit Standbein und Spielbein zu sehen, ein Schema, das der ganzen Gestalt des Musikers eine gewisse Beweglichkeit verleiht. Oder aber, wenn die Musiker in einer starren Vorderansicht widergegeben sind, werden zumindest ihre Instrumente von der Seite oder in Dreiviertelansicht dargestellt. Anders aber bei Bitus : Der cornicen ist in einer unbeweglichen Pose frontal dargestellt und sein
7. Die reichste epigraphische Überlieferung ist die der bucinatores. Deren Darstellungen hingegen sind sehr selten identifizierbar – s. demnächst ausführlicher Alexandrescu 2004.8. Grabstele : Budapest, Aquincum Muzeum Inv. 64.10.7, CIL III 15159 ; Ubl 1969, Nr. 25 ; Németh 1999, Nr. 13. Kindersarkophag : Budapest, Aquincum Muzeum Inv. 64.10.31, CIL III 15160 ; Ubl 1969, Nr. 26 ; www.ubi-erat-lupa.org , Nr. 2986 (beste Abbildung).
Abb Ο . 1. Grabstele des Aur. Bitus, Aquincum, Detail (Verfasserin).
Cr.-G. Alexandrescu • Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten
786
Abb Ο . 2. Sarkophag des Aur. Vitalinus, Aquincum (www.ubi-erat-lupa.org, Nr. 2986).
Abb Ο . 3. Sarkophag des Aur. Vitalinus, Aquincum, Detail (Verfasserin).
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
787
Instrument folgt genau dieser Orientierung der gesamten Gestalt. Die Wiedergabe des cornicen ist sehr realistisch durchgeführt. Man betrachte nur die fast akribische Darstellung der Details, wie die Verzierung der Querleiste oder die linke Hand, die am unteren Bereich des Rohres das Instrument stützt. Sie spricht für eine Haltung, bei welcher der Musiker das Instrument nur trägt und nicht spielt.
Der zweite überlieferte cornicen aus Aquincum, dessen Grabstele erhalten ist, Aelius Quintus Probatus 9, ist im Brustbild dargestellt (Abb. 4), mit einer Schriftrolle in der Linken, auf die er mit dem Zeigefinger der Rechten hinzuweisen scheint. Über seiner rechten Schulter ist das Instrument zu sehen, das aber – würde die Inschrift nicht seinen Posten nennen – nicht direkt als cornu zu erkennen wäre. Die Darstellung sollte auch für Quintus den Eindruck des getragenen Instruments widergeben, was aber für die Brustbildvorlage offensichtlich nicht vorgesehen war.
Durch Vergleichsbeispiele aus Aquincum und aufgrund epigraphischer Hinweise ist die Grabstele des Quintus in die zweite Hälfte des 2. Jhs. datiert worden 10. Das bedeutet für die Darstellungsweise des cornu, dass die Vorlage der Werkstatt schon zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stand und speziell für die Darstellungsform der verstorbenen Soldaten in Vorderansicht, wie sie auch auf dem späteren Grabstein des Bitus verwendet wurde, entworfen worden war.
Zudem erklärt die Stele des Quintus, warum eher tubicines die Form des Brustbildes als Alternative zur Ganzkörperdarstellung wählten : Um eine tuba zu erkennen, war es offensichtlich für den antiken Betrachter nicht nötig, das ganze Instrument zu sehen, sondern es genügten der Schalltrichter und der Mundstückhalter 11. Die Grabstelen aus dem 1. Jh. n.Chr. verwenden diese Darstellungsform, während
9. Budapest, Aquincum Muz. Inv. 63.10.137, Ubl 1969 Nr. 86 ; Németh 1999, Nr. 45 mit Abb.10. www.ubi-erat-lupa.org/Nr. 2836 (hadrianisch) ; Ubl 1969, Nr. 86 und S. 467 (Septimius Severus) ; vgl. auch Jaeger 2007, S. 27-36, bes. S. 30ff.11. z.B. die Mainzer Grabstele des Sibbaeus, tubicen in cohors I Ituraeorum : Boppert 1992, Nr. 20 mit Taf. 19.
Abb Ο . 4. Grabstele des Aelius Quintus, Aquincum (Verfasserin).
Cr.-G. Alexandrescu • Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten
788
später (besonders im 3. Jh.) die Ganzkörperdarstellung des Musikers und die Abbildung der ganzen tuba bevorzugt werden.
Ubl sah in der cornu-Darstellung auf den beiden cornicines-Stelen eine besondere Form des Instrumentes, die durch eine zusätzliche Verdrehung des Rohres gekennzeichnet ist 12. In Anbetracht der sonstigen Darstellungen der größeren Variante des Instrumentes scheint es sich aber um eine gewollt realitätsnahe Abbildung zu handeln. Versucht man die große Variante des cornu auf der Schulter zu tragen, ergibt sich diese sog. Drehung einfach durch die Länge des Rohres. Aus der Vorderansicht bzw. deren Darstellung kann dann der Eindruck einer solchen Sonderform entstehen.
Unter den Berufsdarstellungen auf Grabdenkmälern aus den gallischen Provinzen lässt sich auch eine Reihe von Musikerdenkmälern auflisten 13. Als Vollfigur sind zwei cornicines auf einer Stele in Bordeaux und einer Platte von einem Grabbau in Dijon, beide aus der zweiten Hälfte des 2. Jhs. n.Chr., dargestellt 14. Hinsichtlich der Größe des dargestellten Instrumentes findet diese Platte eine Parallele auf dem Grabstein des C. Sulpicius Nertus in Bordeaux.
Der Prätorianer M. Antonius Ianuarius ist das einzige Beispiel unter den Grabdenkmälen von Musikern für eine Darstellung im Profil 15. Es kann angenommen werden, dass für diese Figur einfach eine Vorlage mit historischer Thematik verwendet wurde. Auffallend ist die Größe des dargestellten Instrumentes, das offensichtlich erkennbar sein sollte. Ianuarius hat die Linke an der Querleiste und mit der rechten Hand scheint er das Mundstück an die Lippen zu pressen.
Bei den anderen bis jetzt bekannten Darstellungen von cornicines auf Grabmälern tragen bzw. halten diese einfach ihr Instrument, manchmal sogar mit abmontiertem Mundstück. Das beste Beispiel hierfür, besonders für die Position der Hände am Instrument, ist die schon genannte Darstellung des Aur. Bitus. Auf seiner heute in Mantua aufbewahrten Stele hält Coponius Felicio das verhältnismäßig kleine Instrument an der Querleiste mit der linken Hand und in der Rechten das abmontierte Mundstück 16. Ähnlich scheint, soweit die einzige Abbildung des Steins es erkennen lässt, auch die Darstellung des Seemanns T. Flavius Maximus zu sein, nur hält er in seiner Rechten ein Täfelchenbündel (?) 17.
Darstellungen des cornu ohne Blasmusiker
Allgemein betrachtet sind cornua, bzw. cornicines, die am häufigsten dargestellten Musikinstrumente bzw. Musiker. Die Darstellungen zeigen außer der gebogenen Form ein weiteres charakteristisches Element : die Griffstange oder die Querleiste. Man kann ein vielfältiges Spektrum der Länge und Tragweise des Instrumentes feststellen. Es wurden immer ganze Instrumente dargestellt.
12. Ubl 1969, S. 466ff. mit Abb. 467, 468 und 471. 13. Ein Übersicht bietet Pinette 1993. 14. Bordeaux : CIL XIII 860 ; Braemer 1959, Nr. 94. 15. Rom, Vatican, Galleria Lapidaria, Inv. 7006, Wand XXXI,3, CIL VI 2627 ; Amelung 1903, Bd. 1, Nr. 137o mit Taf. 28.16. Mantua, Palazzo Ducale - CIL V 1027 ; Levi 1931, Nr. 169, Taf. 89 b.17. Conze 1911-1922, S. 104 Nr. 2130 mit der Skizze von Conze.
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
789
Wenn das Instrument auf den Grabmälern der Blasmusiker allein, ohne seinen Bläser dargestellt wird, ist es ganz und von der Seite zu sehen. Der Unterschied besteht nur in der Positionierung des Schalltrichters nach oben oder nach unten. Kennzeichnend ist die Querleiste, die einfach oder mit Verzierung, sogar mit den Querleistenstützen dargestellt wird.
Die allein dargestellten cornua erinnern an die Musikinstrumente, die in etruskischen Grabkammern die Wände links und rechts vom Eingang verzieren, sei es als Malerei, sei es als bemalte Reliefs 18. Dort stehen die Musikinstrumente aber nicht als Kennzeichen für den von einem der Bestatteten ausgeübten Beruf, sondern für seine hohe soziale Position, die ihm die Begleitung durch die Musiker (sog. cornicines und liticines) erlaubte. Gelegentlich sind solche Musikinstrumente auch als Grabbeigaben gefunden worden.
Die römischen Grabstelen belegen also eine Übernahme der Form des Instrumentes von den Etrusker sowie die Darstellungs- und vielleicht die Aufbewahrungsweise. Das Instrument wird also gezeigt als ob das cornu, wenn nicht getragen, an der Wand aufgehängt war. In der Darstellungsform mit dem Schalltrichter nach oben ist eine Wiedergabe des von dem Blasmusiker über die Schulter getragenen Instruments zu erkennen, während der nach unten gerichtete Schalltrichter eine leichtere Handhabung beim Halten in der Hand bieten würde.
Realitätsbezug – Verifizierung
Betrachtet man die cornua, die zusammen mit ihren Bläsern auf deren Grabmälern vorkommen, lassen sich grundsätzlich zwei Formen unterscheiden, die anfangs schon genannt wurden : die kleine mit einem kurzen Rohr und die große mit einem umfangreichen Rohr. Auf Darstellungen verstorbener Blasmusiker ist die zusätzliche kleine Stütze, die ansonsten bei der großen Variante gelegentlich vorkommt, bis jetzt nicht belegt 19.
Die cornua auf den übrigen Darstellungsträgern weisen meistens die gleichen Formen auf wie die auf den Grabmälern der Blasmusiker. Abhängig von der Art des Denkmals und von der Darstellungsweise, Tragweise und Haltung des Bläsers können die Instrumente unterschiedlich dargestellt sein. Die Grundform aber ist die gleiche. Die Querleiste kann besondere Verzierung tragen ; meist werden aber nur die einfachen Rillen angegeben, die das Rutschen dieser hölzernen Stange verhindern sollten 20.
Die Identifizierung der abgebildeten Musikinstrumente
In der Literatur wurden zwei weitere Grabsteine aufgrund der dargestellten Musikinstrumente den bucinatores zugewiesen : das des Andes, Reiter in der ala Claudia (Abb. 5), in Mainz-Zahlbach und eine fragmentarisch erhaltene Stele in Remagen (Abb. 6) 21. Bei genauerer Betrachtung aber sind mindestens die Enden der unteren Querleistenstütze zu sehen, die als eindeutiger Hinweis für die Identifizierung der dargestellten Instrumente als
18. z.B. Steingräber 1985, S.317, Nr. 69, Abb. 163.19. z.B. Trajanssäule, Sz. LXI (= Florescu 1969,Taf. 45) ; Relief von einem Grabbau in Isernia, Antiquario Comunale – Diebner 1979, Is 19.20. vgl. die genannten Stelen in Aquincum sowie die Stele des Flavius Attius in Györ, Lapidarium : Szőnyi 2003, Nr. 13.21. Grabstele des Andes : Mainz, Mittelrheinisches Landesmuseum Inv. S.608 ; CIL XIII 7023 ; Boppert 1992, Nr. 35 Taf. 33 ; Behn 1912, S. 43 mit Abb. 12. - Grabstelenfragment aus Remagen : Bonn, Rheinisches Landesmuseum Inv. Nr. 15319 ; Bauchhenß 1976, Nr.42, Taf. 40 ; Behn 1912, S. 79.
Cr.-G. Alexandrescu • Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten
790
cornua gelten können. Das Instrument auf dem Fragment aus Remagen kann eine zusätzliche Stütze haben, die im Mundstückbereich befestigt war. Zudem weisen beide Instrumente Mundstücke auf. Die Inschriften bieten keine Anhaltspunkte, da Andes auf seiner Stele nur als eques der Ala Claudia bezeichnet wird, während für die Stele aus Remagen die Inschrift nicht erhalten ist. Das “Unvermögen“ der Bildhauer dieser beiden Grabsteine führte dazu, dass man hier die einzigen Darstellungen der ansonsten bildlich kaum überlieferten bucina zu sehen glaubte. Daraus ist die Theorie entstanden, die bucina sei eine Art Zugposaune gewesen 22.
Beide Grabsteine finden in der Stele des cornicen Aurelius Disas aus der ala I Flavia Britannica in Apamea eine besondere Ergänzung 23. Dort wird der Verstorbene als Reiter dargestellt, trägt sein Instrument auf der rechten Schulter und wird in der Inschrift als cornicen bezeichnet. Damit ist auch epigraphisch belegt, dass cornicines in den alae tätig waren. Die beiden Steine in Apamea datieren in das 3. Jh. n. Chr. und spannen damit den Bogen der Überlieferung vom 1. Jh. – die Entstehungszeit der Grabstelen, die nur Darstellungen der Instrumente tragen – bis ins 3. Jh. n. Chr. Die Annahme von H. Ubl, der sich gegen die These von A. von Domaszewski zum Fehlen der cornicines in den Reitereinheiten äußerte 24, wird somit untermauert.
22. Behn 1912, S. 43 ; für eine Zusammenstellung der Deutungen s. Boppert 1992, S. 143f. 23. Apamea Museum, AE 1993, 1595 ; Balty, Rengen 1993, S. 12 Taf. 26. – siehe auch Balty, Rengen 1993, S. 11 Taf. 25.24. Ubl 1969, S. 472 ; Domaszewski 1885, S. 9.
Abb Ο . 5. Grabstele des Andes, Mainz, Detail (nach Speidel 1976,
Abb. 14).
Abb Ο . 6. Grabstelenfragment aus Remagen, Detail (nach Bauchhenß
1978, Taf. 40).
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
791
Ergebnisse
Ohne weitere Rückschlüsse aus der spärlichen Beweislage ziehen zu können, soll hier die häufigere Verwendung der Ganzkörpervariante für die Darstellung der cornicines festgestellt werden. Die Ausnahmebeispiele, wo cornicines als Brustbild oder als Reiter dargestellt sind, vermitteln eher den Eindruck, dass für die Darstellung des cornu in diesen Bildschemata des Verstorbenen keine gelungene Lösung gefunden wurde. Die meisten dieser Denkmäler datieren in das 2. Jh. n. Chr. und später. “Personalisierte” Schemata sind in Pannonien und Germanien für das 1. und für das späte 2. Jh. n.Chr. festgestellt worden.
Man darf wohl sagen, dass sich im Falle des cornu ein klares Bild feststellen lässt. Die Annahme, dass es sich wegen der Zerstückelung der dargestellten tuba-Teile um ein zerlegbares Instrument handelte, kann auch für das cornu gelten und wird durch die Funde von Musikinstrumenten zumindest theoretisch bestätigt.
Was die Form des Instrumentes im Lauf der Jahrhunderte betrifft, ist es sogar möglich, eine Entwicklung zu zeichnen, die von den ältesten Formen bei den Etruskern über die Änderungen und die Einführung der Querleiste bis zu den großen Instrumenten der römischen Kaiserzeit mit einer Querleiste, manchmal sogar mit einer zusätzlichen Stützleiste reicht. Diese bei der Untersuchung der Darstellungen festgehaltenen “Phasen” lassen sich anhand der erhaltenen Instrumente nachvollziehen. Es sind auf gleichzeitigen Darstellungen, manchmal auf denselben Denkmälern (z.B. auf der Trajans-Säule), mehrere ‚Formen‘ wiederzufinden. Zudem ist es nicht möglich, eine im Heer bevorzugte Form festzustellen. Vielmehr scheinen der zur Verfügung stehende Platz und die Komposition der Szene eine Rolle bei der Auswahl gespielt zu haben. Wie es in der Realität aussah, ob z.B. die in der Arena geblasenen Instrumente reicher verziert oder größer waren, muss offen bleiben.
BiBlioGRAphie
Alexandrescu 2004 : Alexandrescu (C.-G.), Blasmusiker und Standartenträger im römischen Heer, ungedruckte Dissertation, Köln (in Druckvorbereitung).
Alexandrescu 2006 : Alexandrescu (C.-G.), “Zur Frage der Datierung der Trompete von Zsámbek (Ungarn)”, in E. Hickmann, A.A.Both, R. Eichmann (Hrsg.), Studien zur Musikarchäologie 5, (Orient Archäologie, 20), Rahden, Westf., p. 207-220.
Amelung 1903 : Amelung (W.), Die Sculpturen des Vaticanischen Museums, Berlin.
Aurigemma 1926 : Aurigemma (S.), I mosaici di Zliten, Roma-Milano.
Aurigemma 1954 : Aurigemma (S.), Le terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma.
Balty, van Rengen 1993 : Balty (J. Ch.), Rengen (W. van), Apamée de Syrie. Quartiers d’ hiver de la IIe légion Parthique. Monuments funéraires de la nécropole militaire, Bruxelles.
Bauchhenß 1978 : Bauchhenß (G.), Militärische Denkmäler, (Corpus Signorum Imperii Romani, Deutschland III.1), Mainz.
Behn 1912 : Behn (F.), “Die Musik im römischen Heere”, Mainzer Zeitschrift, 7, p. 36-47.
Boppert 1992 : Boppert (W.), Militärische Grabdenkmäler aus Mainz und Umgebung, (Corpus Signorum Imperii Romani, Deutschland II.5), Mainz.
Braemer 1959 : Braemer (Fr.), Les Stèles funéraires à personnages de Bordeaux, Ier-IIIe siècles. Contribution à l’ histoire de l’ Art provincial sous l’ Empire romain, Paris.
Cr.-G. Alexandrescu • Grabdenkmäler mit Darstellungen von Blasmusikinstrumenten
792
Conze 1911-1922 : Conze (A.) (Hrsg.), Die attischen Grabreliefs, Bd. 4, Berlin-Leipzig.
Diebner 1979 : Diebner (S.), Aesernia – Venafrum. Untersuchun-gen zu den römischen Steindenkmälern zweier Landstädte Mittelitaliens, Roma.
Domaszewski 1885 : Domaszewski (A. von), Die Fahnen im römischen Heer (Abhandl. Arch.-Epigr. Seminar Univ. Wien, 5), Wien.
Florescu 1969 : Florescu (F. Bobu), Die Trajanssäule, Bonn-Bukarest.
Franchi 1963-1964 : Franchi (L.), “Rilievo con pompa funebre e rilievo con gladiatori al museo dell’ Aquila”, Studi Miscellanei, 10, p. 23-32.
Jaeger 2007 : Jaeger (B.), “Römische Grabdenkmäler mit Porträtdarstellungen aus Aquincum (Budapest)”, in E. Walde (Hrsg.), Die Selbstdarstellung der römischen Gesellschaft in den Provinzen im Spiegel der Steindenkmäler. IX. Internationales Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, 2005, Innsbruck, p. 27-36.
Levi 1931 : Levi (A.), Sculture greche e romane del Palazzo Ducale di Mantova, Roma.
Meucci 1987 : Meucci (R.), “Lo strumento del bucinator A.Surus e il cod. Pal. Lat. 909 di Vegezio”, Bonner Jahrbücher, 187, p. 259-272.
Németh 1999 : Németh (M.), Vezetö az Aquincumi Múzeum kötárában, Budapest.
Pinette 1993 : Pinette (M.) (coord.), Le Carnyx et la Lyre. Archéologie musicale en Gaule celtique et Romaine, Besançon.
Scott Ryberg 1967 : Scott Ryberg (I.), Panel Reliefs of Marcus Aurelius, New York.
Speidel 1976 : Speidel (M. P.), “Eagle-bearer and trumpeters. The eagle-standard and trumpets of the Roman legion illustrated by three tombstones recently found at Byzantion”, Bonner Jahrbücher, 176, p. 123-163.
Steingräber 1985 : Steingräber (S.) (Hrsg.), Etruskische Wandmalerei, Stuttgart-Zürich.
Szönyi 2003 : Szőnyi (E.), Führer zum römischen Lapidarium des Museums in Györ, Györ.
Tamboer, Vilsteren 2006 : Tamboer (A.), Vilsteren (V. van), “Celtic bugle, roman lituus, or Medieval Ban Horn? An Evaluation of Cast Bronze Horns with an Upturned Bell”, in E. Hickmann, A.A.Both, R. Eichmann (Hrsg.), Studien zur Musikarchäologie V, (Orient Archäologie, 20), Rahden, Westf., p. 221-236.
Ubl 1969 : Ubl (H.), Waffen und Uniform des römischen Heeres der Prinzipatsepoche nach den Grabreliefs Noricums und Pannoniens, ungedruckte Dissertation, Wien.