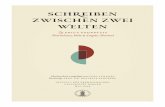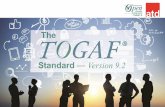Goethes Welten - Weltlichkeit und Weltliteratur in den Wahlverwandtschaften
Transcript of Goethes Welten - Weltlichkeit und Weltliteratur in den Wahlverwandtschaften
DOGILMUNHAK
Koreanische Zeitschrift für Germanistik
제128집 54권 4호 2013년 12월
편집 원
이혜자(위원장, 군산대) 남유선(간사, 원광대)
김륜옥(성신여대) 송경안(전남대)
송 전(한남대) 안진태(강릉원주대)
양우탁(전북대) 양태종(동아대)
왕치현(인하대) 이민행(연세대)
이영석(경상대) 임홍배(서울대)
정경량(목원대) 탁선미(한양대)
한국독어독문학회
Koreanische Gesellschaft für Germanistik
이 학술지는 2012년도 정부재원(교육과학기술부)으로
한국연구재단의 지원을 받아 출 되었음.
Inhalt
D OGILM U N HA K B and 128 Jahrgang 54 Heft 4 D ezember 2013
Teil I B e iträg e z um 2 0 . S o rak-S y m po s ium 2 0 1 3
<Plenarvorträge>
Monika SCHMITZ-EMANS (Bochum Uni)
Landkarte und Atlas in literarischen Texten - Zur Darstellung von Räumen
bei Christoph Ransmayr (Atlas eines ängstlichen Mannes) und Judith
Schalansky (Atlas der abgelegenen Inseln) ·················································· 9
Monika SCHMITZ-EMANS (Bochum Uni)
Kulturvergleich und Kulturtransfer in Malerromanen der
Gegenwartsliteratur ······················································································ 29
Chieh CHIEN (Taiwan National-Uni)
Die Welt der Sprache bei Herta Müller ···················································· 51
Shinji MIYATA (Tokyo Uni)
Zur Figur des Fremden in der Chrono-Topographie Lichtenbergs ············ 77
TAK Sun-Mi (Hanyang Uni)
Das-fremde-Ich und der-vertraute-Andere - Zur kritischen Betrachtung
einer literarischen Phantasie in der globalisierten Welt, am Beispiel von
Hermann Hesses Siddhartha ······································································· 91
<Beiträge>
Anthony Curtis ADLER (Yonsei Uni)
Goethes Welten - Weltlichkeit und Weltliteratur in den
Wahlverwandtschaften ················································································ 115
AHN Mi-Hyun (Mokpo National-Uni)
Globale Stadt, lokales Leben - Eine Studie über Taxi von Karen
Duve ·········································································································· 139
CHANG Je-Hyung (Seoul National-Uni)
Das Nationale des deutschen Barock und dessen Dekonstruktion in
Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels ························· 159
CHEON Hyun Soon (Ewha Frauen-Uni)
Die zukünftige Hybridkultur von Mensch und Roboter - Eine vergleichende
Untersuchung zu Fritz Langs und Rintaros Metropolis ··························· 181
Reinmar EMANS (Bochum/Hamburg Uni)
In Grenzen global - oder doch darüber hinaus? Internationales Leben an
den Welfenhöfen und den Residenzstädten im 17. und 18. Jahrhundert ···· 197
HAM Su-Ok (Chung-Ang Uni)
Transgenerationelle Traumatisierung durch den Kolonialismus
- Anna Kims Anatomie einer Nacht ························································ 219
KIM Ihmku (Seoul National-Uni)
Der koreanische Independent Film Zwei Striche im Schwangerschaftstest
(2011) - Ein Deutungsversuch im global-epochengeschichtlichen
Kontext ······································································································ 235
KIM Yeon-Soo (Ewha Frauen-Uni)
Herders Übersetzungslehre im Zeitalter der Globalisierung ····················· 253
LEE Kishik (Korea Uni)
Anatomie einer Nacht von Anna Kim - eine ostasiatische
Tuschmalerei Grönlands in schwarz-weiß ················································ 277
LEE Youngnam (Dongduk Frauen-Uni)
Heimat und Identität der koreanischen Diaspora in Deutschland ············ 293
W. Günther ROHR (Chung-Ang Uni)
Globalisierung aus historischer Sicht - Johann und Peter Simon
blicken nach Fernost ················································································· 309
Christoph SEIFENER (Korea Uni)
Heimatdarstellungen bei Andreas Maier und Peter Kurzeck
- Antworten auf die Globalisierung ·························································· 327
SHIN Hyun Sook (Seoul Frauen-Uni)
Fassbinders Welt am Draht, Komödie oder baldige Realität ·················· 347
Teil II Sonderbeiträge
Erik-Joachim JUNGK (Sogang Uni)
Die frühe Reiseliteratur Ernst Jüngers ······················································ 373
LEE Joon-Suh (Ewha Frauen-Uni)
Das Fortschreiben als “Dialog mit den Toten” - Thomas Freyers Im
Rücken die Stadt als Korrektur von Heiner Müllers Die Korrektur ······· 399
LEE Seong Joo (Sungkyunkwan Uni)
Dante auf dem Zauberberg ······································································· 421
PAK Schoro (Hanshin Uni)
“Im Fremden ungewollt zuhaus”, oder die Psychologie der Vertriebenen
- Zu Reinhard Jirgls Roman Die Unvollendeten ····································· 445
Tagungsbericht / Das 20. Sorak-Symposium 2013 ······································465
학회소식 신간도서 안내 ·········································································· 468
한국독어독문학회 연구윤리 규정 ································································· 474
한국독어독문학회 편집 원회 규정 ····························································· 477
�독일문학� 편집 규정 ·················································································· 479
�독일문학� 논문 투고 안내 ········································································· 482
�독일문학� 논문 작성 양식 ········································································· 484
115
Goethes Welten
- Weltlichkeit und Weltliteratur in den Wahlverwandtschaften
Anthony Curtis ADLER (Yonsei Uni)
I. Schönes Leben
Der Begriff Weltliteratur wird vor allem im Sinn einer nicht mehr nationalistisch
begrenzten, sondern sich global ausbreitenden Literatur verstanden. Doch die
Weltliteratur hat bei Goethe vielleicht auch eine ganz andere, nicht ganz
offensichtliche, gleichsam unterirdische, unterweltliche Bedeutung: sie bezieht sich
nicht nur auf die weltweite Ausbreitung und Vermarktung der Literatur, sondern
auf die intensive Auseinandersetzung mit dem Weltbegriff selbst. Nach dieser Ansicht
hätte Goethe nicht nur den Begriff Weltliteratur vorgeschlagen, sondern den Faden
der Weltbildung durch die Literatur explizit und radikal wieder aufgenommen.
Im folgenden wird diese Behauptung durch eine Auslegung des Romans Die
Wahlverwandtschaften bekräftigt. Seit seiner Veröffentlichung in 1809 wurden Die
Wahlverwandtschaften als eins von Goethes geheimnisvollsten und am schwersten
zu verstehenden Werken betrachtet, ein Werk, das eine grosse Kontroverse und
manchmal grossen Unmut unter seinen Lesern erregt. Und nach Benjamins berühmtem
Aufsatz hat es auch einen schwindelerregenden Wirbel von Auslegungen nach sich
gezogen.1) Doch wird es sehr selten mit Bezug auf das Problem der Weltliteratur
gelesen. In den Wahlverwandtschaften ist die Welt eine eher periphere Angelegenheit
— sie untersteht einer bestimmten, ausdrücklichen Vergegenständlichung, indem
sie als etwas genannt wird, was draußen liegt, eine fast abstrakte gesellschaftliche
1) Zur Rezeptionsgeschichte des Romans, siehe Astrida Orle Tantillo, Goethe’s “Elective Affinities” and the Critics. Rochester N.Y. 2001.
116 독일문학∣제128집
Macht. Es bleibt anscheinend möglich, keine Beziehung zur Welt zu haben, oder
wenigstens nur eine ablehnende. Der eigentliche Schauplatz des Romans, Eduards
Landgut, ist genau nicht die Welt, sondern eine kleine Gesellschaft von Freunden
und Freundinnen, Hausangestellten, und gelegentlichen Besuchern. Die Anwesenheit
der Welt in den Wahlverwandtschaften ist ganz unheimlich: die Welt, der die
Charaktere auch noch irgendwie angehören, erscheint ihnen gegenüber als etwas,
was aus dem Kreis ihres Lebens ausgeschlossen werden könnte — noch ein
unwillkommener, fragwürdiger Besucher. Vor allem kommt das bei dem Waisenkind
Ottilien, Charlottes Nichte, vor, deren Ankunft die schicksalhaften Begebenheiten
des Romans in Gang setzt. Von Anfang an hat Ottilie anscheinend nichts mit
der Welt zu tun. Wenn die Welt überhaupt in Beziehung mit ihr genannt wird,
nimmt sie eine entfremdete Exteriorität an: “Und wie sie in dem Umgang mit
Eduard die Welt vergass, so schien ihr in der Gegenwart des Grafen die Welt
erst recht wünschenswert zu sein.”2) Die Umheimlichkeit der Welt wird noch am
klarsten und mächtigsten in einem Eintrag aus ihrem Tagebuch ausgedrückt: “Man
weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich
nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst.”3) Durch die Kunst, die zugleich ein
Ausweichen vor der Welt und eine Beziehung zu der Welt erlaubt, erscheint uns
die Welt in der Fülle ihrer Unheimlichkeit. Daher herrscht eine Stimmung der
Angst. Das Wort Welt in den Wahlverwandtschaften bezieht sich prinzipiell, wenn
auch nicht immer, auf die größere Welt von Individuen, die einem hohen
gesellschaftlichen Stand angehören, oder auch (wie bei Künstlern, Gelehrten,
Beamten) den Hohen irgendwie anhängen, und die miteinander vor allem dadurch
verbunden sind, dass sie ihre Zugehörigkeit zur Welt irgendwie gegenseitig
anerkennen. “Everyone who is anyone”: wie man auf Englisch sagt. In diesem
Sinne ist die Welt auch ein Bereich der öffentlichen Erscheinung in einer noch
feudalen Standesgesellschaft. Nur innerhalb der Welt kann man als Mensch in
vollstem Sinne erscheinen, zum Vorschein kommen. Dieser Sinn von Welt wird
2) Johann Wolfgang Goethe, Hamburger Ausgabe. München 1988, Bd. 6, S. 413. 3) Ebd., Bd. 6, S. 398.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 117
am auffälligsten durch die Nebeneinanderstellung von Ottilien und Charlottes Tochter
Luciane, die beide dieselbe Pension besuchen und von Anfang an, in Berichten
der Vorsteherin und ihres Gehülfen, als ein auffallender Kontrast von Veranlagungen,
Charakter, und menschlichem Sein dargestellt werden. Und von Anfang an wird
die Gegensätzlichkeit in Hinsicht auf die Welt begriffen. Als Charlotte mit ihrem
Gatten Eduard die Möglichkeit, dass Ottilie bei ihnen wohnen könnte, zur Sprache
bringt, erklärt sie:
Wenn Luciane, meine Tochter, die für die Welt geboren ist, sich dort für die Welt
bildet, wenn sie Sprachen, Geschichtliches und was sonst von Kenntnissen ihr
mitgeteilt wird, so wie ihre Noten und Variationen vom Blatte weg spielt; wenn
bei einer lebhaften Natur und bei einem glücklichen Gedächtnis sie, man möchte
wohl sagen, alles vergisst und im Augenblicke sich an alles erinnert; wenn sie
durch Freiheit des Betragens, Anmut im Tanze, schickliche Bequemlichkeit des
Gesprächs sich vor allen auszeichnet und durch ein angeborenes herrschendes
Wesen sich zur Königin des kleinen Kreises macht…so ist dagegen, was sie
schliesslich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung,
dass ein übrigens so schön heranwachsendes Mädchen sich nicht entwickeln, keine
Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle.4)
Während die Vorsteherin Luciane bis zur Vergötterung lobt, findet Ottilie ihren
Fürsprecher in dem Gehülfen, der, in einem beigelegten Bericht, schreibt: “aber
es gibt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten, kernhaften sind und die
sich früher oder später zu einem schönen Leben entwickeln.”5)
Was heißt Welt? Was ist die Welt in ihrem Wesen? Durch diesen Kontrast
zwischen Einer, die für die Welt geboren ist, und einer Anderen, die für etwas
ganz anderes gemacht wurde, vernehmen wir eine Antwort. Die Welt ist von ihrer
Erschlossenheit, ihrer Öffentlichkeit her charakterisiert. Die Welt ist da, wo Sachen
und Menschen erscheinen, zum Vorschein kommen können, und zwar, wo alles
erscheinen muß: wo Fähigkeiten, Vermögen als Fertigkeiten erscheinen müssen.
4) Ebd., Bd. 6, S. 251. 5) Ebd., Bd. 6, S. 264.
118 독일문학∣제128집
Das Wort Fertigkeit in der oben zitierten Passage ist besonders bedeutungsvoll.
Man könnte es als entelecheia übersetzen — das heißt: eine Anlage, die sich realisiert
hat, nicht, indem sie wirklich ausgeübt wurde, sondern in dem Sinne, dass sie
sich zu einer inneren Vollkommenheit entwickelt hat und deswegen sich durch
konkrete Auswirkungen, konkrete Taten darstellen darf. Diese Erschlossenheit
charakterisiert die Welt, indem die Welt prinzipiell als das Miteinandersein von
Menschen, die sich gegenseitig als “bedeutende Menschen” anerkennen, verstanden
wird. Genau diese äußerliche, öffentliche Anerkennung der inneren, “geistigen”
Eigenschaften und Anlagen fordert, dass sich diese Anlagen in einer Fülle
verwirklichen, wodurch sie öffentlich offenbar werden dürfen.
Ottiliens Schönheit weist auf eine ganz andere Weise hin, dadurch etwas offenbar
werden könnte. Eine Fertigkeit zeigt sich nur, indem sich ihre Potentialität erschöpft.
Ein Vermögen kann nur eine Fertigkeit werden, wenn es sich so und in dem
Grad verwirklicht, dass es einen Mangel an zukünftiger Möglichkeit — eine
Abgeschlossenheit und fast tödliche Vollkommenheit — aufweist. Otteliens
Schönheit ist dagegen Zeichen, Symbol, für eine Potentialität — vor allem in
Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft (ihr romanhaftes Geschick) — die nicht
nur unverwirklicht bleibt, sondern notwendigerweise, nach einer kulturellen Logik
der weiblichen Bescheidenheit und Verhaltenheit, verborgen bleiben muß. Es ist
nicht Kants desinteressierte Schönheit der rein ästhetischen Erfahrung, sondern
die höchst “interessierte” Schönheit der heiratsfähigen Jungfrau, die Heideggers
Auslegung des Kunstwerkes als Streit zwischen Unverborgenheit und Verborgenheit,
Welt und Erde antizipiert. Daher verweist Ottilie in den Augen ihrer männlichen
Bewunderer auf die heilige Jungfrau, die sie in dem tableaux vivant darstellt. Die
Schönheit, die Ottilie verkörpert, heißt schönes Leben. Die Bedeutung dieses
Syntagmas wird klar, als sie auf dem Landgut Eduards und Charlottes ankommt
und sich ihre in der Pension gänzlich verborgenen Anlagen als höchst wertvoll
zu zeigen beginnen: “Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenig Winke,
wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sei. Ottilie hat schnell die ganze Ordnung
eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden [...] Alles geschah pünktlich. Sie
wusste anzuordnen, ohne dass sie zu befehlen schien, und wo jemand säumte,
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 119
verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.”6) Innerhalb der textuellen Logik der
Wahlverwandtschaften ist Ottiliens außergewöhnlicher, fast unheimlicher Sinn für
häusliche ökonomische Ordnung gleichsam eine virtuose Domestizität, von einem
Stück mit ihrem Mangel an Fertigkeiten, ihrem Unweltlichsein, und ihrer Unfähigkeit,
sich unter ihren Schulgenossinnen auszuzeichnen und zu glänzen oder überhaupt
als irgend jemand zu erscheinen. Der Grund davon liegt darin, dass das Geschäft
des Haushalts, die häusliche Ordnung, die Ottilie mit wenigen Winken vollkommen
begreift und durchschaut, genau das Gegenteil von Welt ist: sei die Welt der Bereich
von plötzlichen, augenblicklichen, dramatischen Erscheinungen und Auftritten —
der Ort wo Sachen und Menschen als das erscheinen, was sie sind —, ist die
häusliche Ordnung dagegen die verborgene, immer-weiter-laufende Sorge für Sachen
und Menschen. Sie ist das schöne Leben, das, in Dunkel versunken, hinter und
unter der Welt liegt, und doch die Welt von unter her unterstützt und aufrechthält.7)
Es ist, nach der von Arendt, Agamben (und auch Heidegger) erwähnten aus der
griechischen Sprache stammenden Unterscheidung, zoē und nicht bios: kein
besonders, qualifiziertes, menschliches Leben (Aristoteles spricht von bios politikos
und bios theoretikos), keine Art des Lebens, sondern das allgemeine Leben, an
dem alle Lebewesen teilhaben. Ottilie stellt das Paradigma der im 18ten Jahrhundert
neu aufkeimenden biopolitischen Subjektivität dar. Ohne dass sie zu befehlen scheint,
ordnet sie alles an; ohne dass sie auf dem Unterschied besteht, ersetzt sie selbst
die fehlende Arbeit ihrer Untergebenen. Ottilie weiß genau, wie man kann alles
anordnen und verrichten, ohne den Anschein der Herrschaft zu geben. Ihre
anordnende Tätigkeit wird gleichsam eins mit der Ordnung des metabolischen,
“biologischen,” natürlichen Lebens. Ordnung ist nicht mehr hierarchisch, sondern
rhythmisch, fließend, musikalisch und choreographisch: hier auch ahnt man die
zukünftige Entwicklung des Kapitalismus. Ottiliens Dienstfertigkeit, Verhaltenheit,
6) Ebd., Bd. 6, S. 282.7) Zur Thema der Ökonomie in den Wahlverwandtschaften, vgl. Joseph Vogl, “Nomos der Ökonomie:
Steuerungen in Goethes ‘Wahlverwandtschaften.’” MLN 114:3 (1999), S. 503-527; Joseph Vogl, “Goethes ökonomischer Mensch.” In: Erzählen und Wissen: Paradigmen und Aporien ihrer Inszenierung in Goethes “Wahlverwandtschaften,” hrsg. v. Gabriele Brandstetter. Freiburg im Breisgau 2003, S. 241-257.
120 독일문학∣제128집
und Empfänglichkeit sind nicht nur Aspekte einer stereotypischen “weiblichen”
Passivität, sondern Beherrschung des Lebens. Durch ein “angebornes herrschendes
Wesen” hat Luciane sich zur Königin des kleinen Kreises gemacht. Ottilie dagegen
war “indessen,” d.h. ohne das jemand es gemerkt, “schon völlig Herrin des
Haushaltes.”8) Hier vollzieht sich die vollkommene Trennung zwischen prunkvoll
erscheinendem Königtum und regierender, anordnender Gewalt.
II. Affenbilder
Ottiliens Begabung für die häuslichen Angelegenheiten, ihre virtuose Handhabung
der Hauswirtschaft ist innigst verbunden mit ihrer Beziehung zur Zeitlichkeit, ihrer
Weise des In-der-Zeit-Seins. Bei ihrem glücklichen Gedächtnis kann Luciane alles
vergessen und im Augenblick sich an alles erinnern, als ob sie vom Moment zum
Moment lebte, ohne dass sie, von einem unwillkürlichen und eher empfänglichen
Gedächtnis gezwungen, die hinter der Oberfläche liegenden Verbindungen zwischen
den Dingen, sowie ihren verborgenen Sinn, vernimmt oder eben nur ahnt. Ottilie
dagegen existiert nicht nur in der Gegenwart, sondern, bei ihren heimsuchenden
Erinnerungen und dunklen Vorahnungen, auch und vor allem in der Zukunft und
der Vergangenheit. Sobald Luciane die strukturierte Umgebung der Pension verläßt,
in der Fertigkeiten ständig zur Schau gestellt werden müssen, ohne Sinn für den
weiteren Zusammenhang und ihre innewohnenden Beziehungen zu einander, wird
ihr angeborenes herrschendes Wesen zum Unwesen. Luciane hat überhaupt keinen
Sinn für den kairos: die kritische Stunde und Jahreszeit.9) Für die Arbeit eines
Gärtners, die, mehr als jede andere “eine[n] ruhige[n] Blick, eine stille Konsequenz,
in jeder Jahreszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu tun” benötigt, besitzt
Ottilie eine besondere Verwandtschaft. Dagegen hat Luciane, in der ungeregelten
8) Ebd., Bd. 6, S. 296.9) Joseph Vogl bemerkt, dass die Zeit des Erzählens des Romans auch immer die “richtige Zeit”
verfehlt. [“Nomos der Ökonomie: Steuerungen in Goethes ‘Wahlverwandtschaften.’” MLN 114:3 (1999), S. 503-527, hier S. 508]
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 121
Wildheit ihrer bizarren Launen und unzeitigen Forderungen, eine zerstörende
Wirkung auf den Garten.10)
Die Welt, wie schon bemerkt, ist die öffentliche Sphäre der Anerkennung: die
Sphäre, in der Menschen und Dinge, als genau die Seienden, die sie sind, erscheinen
können. Genau das hat alles zu tun mit der Zeitlichkeit der Welt, wie sie in Lucianes
fast unmenschlich glücklichem, unheimgesuchtem und ahnungslosem Gedächtnis
dargestellt wird. Solcherart weltliche Erkenntnis ist nur möglich, wenn Seiende
aus dem Zusammenhang der Bedeutungsganzheit der Welt (im Sinne Heideggers),
der Geschichte und ihrer weiterlaufenden Bildung herausgerissen sind. Damit etwas
als etwas erscheinen kann (als Vorhandenes, könnten wir sagen), muß es in einer
bestimmten Fertigkeit erscheinen, als fertiggemacht. Und auch als Nachahmung
eines anderen Dinges. Die Fertigkeit ist selbst immer die Nachahmung einer
vorherseienden Form. Nur als Nachahmung kann die Fertigkeit offenbar werden.
Das Wesen der Welt, in diesem Sinne, ist ihre Nachbildlichkeit; alles, was erscheint,
ist schon Nachbildung eines anderen. Lucianes eigenste Begabungen — Begabungen,
die der ganzen Welt gefallen müssen — sind im Wesen vollkommen imitativ.11)
Charakteristisch in diesem Sinne ist ihr Umgang mit Kleidung. Sie hat keinen
Sinn für die Angemessenheit ihrer Kleidung in Hinsicht auf ihre Tätigkeiten und
das Wetter.12) Der Gebrauchswert von Kleidung als Schutz des Körpers fällt ihr
nicht einmal ein. Für sie existiert Kleidung nur um der Verkleidung willen; sie
kleidet sich anscheinend nur, um sich als anderer Menschentyp (Bäuerin, Fischerin,
Fee, Blumenmädchen, auch alte Frau) zu verkleiden. Doch vielleicht das schlagendste
Zeichen für Lucianes mimetische Natur ist ihre Neigung zu Affen. Als ihre Mutter
ihr ein Bilderbuch zeigt, in dem Affen abgebildet sind, nachdem Luciane bedauert,
dass sie ihren Affen nicht mitgebracht hat, findet sie ungemeines Vergnügen darin,
in jedem Affen die Ähnlichkeit mit einem ihr bekannten Menschen zu entdecken.
Ihr Vergnügen ist genau das, was Aristoteles in seiner Poetik behauptet, nämlich
dass der Mensch von Natur aus mimetisch ist. Es ist das Vergnügen des
10) Johann Wolfgang Goethe, Hamburger Ausgabe. München 1988, Bd. 6, S. 423-424.11) Ebd., Bd. 6, S. 395.12) Ebd., Bd. 6, S. 377.
122 독일문학∣제128집
Wiedererkennens, das wir empfinden, wenn wir in einer Abbildung die Ähnlichkeit
mit einem Ding bemerken, das uns vorher schon begegnet ist. Doch das, was
Luciane in den Affenbildern sieht, ist keine eigentliche Ähnlichkeit mit Menschen,
sondern nur eine Nachäffung — das Werk eines Künstlers, der, die Menschen
durch Affen abbildend, nur beweist, dass er selber das Menschliche nicht sehen
kann, und in den Menschen nur ein Nachäffendes, Affenartiges, kennt.13) Was
nachgeahmt und nachgeäfft wird, ist etwas, was nur als Nachahmung existiert:
die Weltlichkeit der Welt.
Das bringt uns zu dem entscheidenden Punkt. Die Welt der Wahlverwandtschaften
muß hinsichtlich einer theologischen Charakteristik verstanden werden. Es ist ein
Geschöpfsein ohne Ursprung und Urbild; eine von ihrem Schöpfer verlassene,
entfremdete Schöpfung. Doch diese Welt ist nicht der Ort, wo die Begebenheiten
des Romans stattfinden, sondern parodierender Anhang. Luciane kommt an, die
Welt mit sich nachschleppend, und geht wieder weg; sie zieht von einem Landgut
zum anderen, bis sie sich endlich dem Zentrum der Welt, der Residenz des Fürsten,
nähert, nur um sich abzuwenden. Ihr Erscheinen, einem Kometen gleich, bekundet
eine Zäsur in dem Roman, und doch hat es fast keine Wirkung auf den eigentlichen
Gang der Ereignisse. So nehmen die Wahlverwandtschaften die Welt auf, um sie
zu depotenzieren, dass sie in ihrer Leere erscheint. In einem Gestus, den Kafka
erahnte und mit der größten Folgerichtigkeit ausführte, entdeckt der Roman die
Impotenz einer jeden Fertigkeit — die Nichtigkeit von allem, was eine bestimmte,
fertige Form angenommen hat. Doch zugleich, und darauf kommt es bei dieser
ganzen Lektüre an, weist sie auch auf eine andere Welt hin, die natürliche Welt.
Ottiliens schönes Leben, wie schon bemerkt, stellt die innersten Zügen dieser
natürlichen Welt dar. Vor allem aber wird sie mit dem Leben auf dem Landgut
und dem Landgut selber identifiziert. Dieses Leben besteht vor allem darin, dass
13) Vgl. Brigitte Peucker, “The Material Image in Goethe’s ‘Wahlverwandtschaften.’” Germanic Review 74: 3 (1999), S. 195-213; Elizabeth Boa, “Aping and Parroting — Imitative Performance in Goethe’s Die Wahlverwandtschaften.” In: Performance and Performativity in German Cultural Studies, hrsg. v. Carolin Duttlinger/ Lucia Ruprecht/ Andrew Webber. Bern 2003, S. 21-40, hier S. 19; Dorothea von Mücke, “The Power of Images in Goethe’s Elective Affinities.” Studies in Eighteenth Century Culture 40 (2011), S. 63-81.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 123
man an dem Garten arbeitet und das bloß natürliche Leben bildet, das natürliches
Wachstum nach menschlichen Zwecken heranbildend. So erscheint Eduard schon
im ersten Satz des Romans in seiner Baumschule, wo er “frisch erhaltene Pfropfreiser
auf junge Stämme bringt.”14) Wenn Luciane und ihre Welt ein vom Ursprung
entferntes, entwurzeltes Geschöpf ist, so spielt Eduard, als er die Zeit in seinem
eigenen Paradies zubringt und den Stämmen und Wurzeln neues Wachstum
zurückbringt, die Rolle des Schöpfergottes: “Sein Geschäft war eben vollendet;
er legte die Gerätschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit
mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Fleisse
des Herrn ergetzte.”15) Doch hier ist der Herr nicht eigentlich Herr. Der Gärtner,
der sich “an dem teilnehmenden Fleiße des Herrn” ergetzt, scheint über dem Herrn
zu stehen, den er beobachtet. Daher der kritische Punkt, um den sich die Tragödie
des Romans dreht: eine Tragödie, die vielleicht weniger mit sexuellen Sitten und
der Ehe zu tun hat als mit der Unmöglichkeit, die natürliche Welt als eine bewohnbare,
völlig menschliche Welt in Anspruch zu nehmen. Obwohl Eduard als Eigentümer
der Herr des Landguts ist, vermag er nicht, sich dieses unnatürliche, bloß gesetzliche
Eigentum (ein Eigentum, das von gegenseitiger Anerkennung abhängt) als ein
natürliches Eigentum anzueignen. Die natürliche Welt widersteht dem menschlichen
Aneignen. Vom ersten Anfang an wird seine eigentliche Herrschaft von denen
in Frage gestellt, die eigentlich nichts haben.
Das erklärt die seltsame Rolle von Eduards Freund, dem Hauptmann, der, sobald
er ankommt, das Projekt unternimmt, das Landgut zu vermessen und eine
topographische Karte zu erstellen. Diese Karte verspricht, nichts wenigeres zu leisten,
als zwischen natürlichem und gesetzlichem Eigentum zu vermitteln, indem sie
eine formale Darstellung der natürlichen Eigenschaften von Eduards Land liefert,
die in einem einzigen, alles überschauenden Blick aufgenommen werden kann.
Als die Karte nach und nach entsteht, sieht Eduard “seine Besitzungen auf das
deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte
14) Johann Wolfgang Goethe, Hamburger Ausgabe. München 1988, Bd. 6, S. 242.15) Ebd., Bd. 6, S. 242.
124 독일문학∣제128집
sie jetzt erst kennenzulernen, sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören.”16) In
genau dem Moment, als seine Besitzungen zum ersten Mal ihm zu gehören scheinen
und er völlig Herr wird, wird seine Herrschaft in Frage gestellt. Seine Besitzungen
wachsen als eine neue Schöpfung hervor, doch der Schöpfer dieser Schöpfung
ist nicht er, sondern der Hauptmann. Eduard ist auf einen bloßen Gehülfen reduziert:
Der Hauptmann “unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei
dem Geschäft behülflich sein sollten.”17) Die bedrohende Gefahr der Enteignung
reicht bis in Eduards intimstes Eigentum hinein, sein eigenes Selbst. Ungeduldig
und missmutig, als seine Frau ihm beim Lesen in das Buch sieht, verweist er
es ihr: “Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich
etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen
Sinnes, meines eigenen Herzens [...] Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir
immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.”18) Das gedruckte, geschriebene
Zeichen, in seiner vorstellenden, repräsentierenden Funktion, schadet dem
ursprünglichen Eigentum des Selbst. Doch ohne diese ursprüngliche Enteignung
des Eigentlichen wäre die gesellschaftliche Anerkennung des Eigentums, und seine
Verwandlung von Natürlichem in das Rechtliche, unmöglich. Das deutet auf eine
noch radikalere Weise auf die Rolle der Nachahmung in der unnatürlichen,
gesellschaftlichen, auf Konventionen begründeten Welt hin, die Luciane auf
exemplarische Weise bewohnt. Konstitutiv für diese Welt ist das Tilgen der
Singularität des natürlichen Ereignisses durch die Wiederholbarkeit des
geschriebenen Zeichens.
Ottilie weist auf einen Ausweg aus dieser Aporie hin. Genau deswegen hat
sie so eine große Bedeutung für Eduard. Dieses ist der Grund einer Liebe, der
vielleicht nur oberflächlich geheimnisvoll bleibt. Ottiliens Schönheit, meinten wir
schon, ist schönes Leben: es ist Leben als verborgene Potentialität, durch die negative
Struktur der Signifikation offenbar gemacht. Auf gerade diese Weise, d.h. als die
Verkörperung dieser parodoxen Struktur der Signifikation, verpricht sie den Abgrund
16) Ebd., Bd. 6, S. 261.17) Ebd., Bd. 6, S. 261.18) Ebd., Bd. 6, S. 269.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 125
zwischen natürlichem und rechtlichem Eigentum zu überbrücken. Ottilie wird die
eigentümlichen Potenzen der Natur explizit und offenbar werden lassen. Diese
Versprechung kommt an den Tag durch ein Ereignis, das, indem es Eduard Ottiliens
Liebe offenbart, einen Wendepunkt in den Roman markiert. Ottile schreibt eine
zweite Kopie eines Kontrakts ab. Es geht bei dem Original, das in Eduards Hand
geschrieben ist, um den teilweisen Verkauf von Eduards Landgut, um neue Projekte,
die mit dem Landgut unternommen werden, zu finanzieren. Während die ersten
Seiten “mit der größten Sorgfalt” in Ottiliens zarter, weiblicher Hand abgeschrieben
werden, scheinen sich die Züge ihrer Handschrift nach und nach zu verändern.
Sie werden leichter und freier, “[u]nd wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten
mit den Augen überlief. ‘Um Gottes willen!’ rief er aus, ‘was ist das? Das ist
meine Hand!’” Hätte das schriftliche Zeichen ihn vorher mit der Enteignung seines
eigensten Selbst bedroht, ist jetzt sein Selbst ihm selber zurückgebracht und auf
unheimliche Weise heimgekehrt. Die entfremdende Macht der Schrift wird das
Mittel der Nachahmung von genau dem Ding, das unter allen Dingen in der Welt
am eigensten ihm gehört: seine Hand, seine Schrift und Unterschrift. Hier gibt
es eine doppelte Enteignung, indem die Hand, die gesetzlich autorisiert ist, das
Dokument zu verfassen, das sein Eigentum enteignen wird, die Hand einer anderen
wird. Dadurch wird Eduard seines eigenen natürlichen Wesens, der Spur der
Eigentümlichkeit, die von dem Gesetz um seiner verallgemeinernden Ordnung willen
genötigt wird, enteignet. Auf diese Weise werden Gesetz und Natur eins. Oder
wenigstens fast eins. Liebe bleibt nur die Versprechung einer bestimmten Einheit
und Erfüllung. Deshalb bleibt die Liebe zwischen Eduard und Ottilien, die auf
eine emphatische Weise das verspricht, was alle Liebe verspricht — nämlich die
Versöhnung von Natur und Geist, Natur und Gesetz —, ohne durch die Ehe geheiligt
zu werden, nur die natürliche und noch nicht die gesetzliche Versöhnung zwischen
Natur und Gesetz.
Was es Ottilie ermöglicht, diese auch nur partielle Versöhnung zu leisten, wird
in der oben zitierten Szene angedeutet. Als Eduard den abgeschriebenen Kontrakt
mit seinen Augen überläuft, hat er eine besondere Erfahrung, die man avant la
lettre grammophonisch nennen könnte: die sich verändernde Qualität der
126 독일문학∣제128집
Bewegungen ihrer Hand, eine Änderung, die während des Abschreibens stattfindet,
wird ihm gleichsam zurückgespielt. Ein Zeitbild entsteht. Ottiliens Wesen hat also
eine besonders nahe Beziehung zur Zeit und zum Werden. Das ist vielleicht alles,
was wir über ihre Schönheit wissen, die sonst so abstrakt bleibt. Während Lucianes
Schönheit am strahlendsten erscheint, als sie still steht — sonst wird sie fast unanmutig
—, ist Ottiliens Schönheit, um mit Schiller zu sprechen, eine bewegende Schönheit.
Es ist eine Schönheit, die eben innigst und untrennbar mit Ottiliens außerordentlichem
rhythmischem Sinn und Timing verflochten ist. Genau das erlaubt es ihr, Potentialität
zu verwirklichen, zu potenzieren, ohne sie auf eine Fertigkeit zu reduzieren. So
allein vermag sie das Werden selbst in seinem Werden darzustellen. Als sie ihren
Flöte spielenden Gatten musikalisch begleitet, der selber, ohne Geduld oder Ausdauer
zur richtigen Ausbildung eines musikalischen Talents, häufiger in einem falschen
Tempo spielte, wußte Charlotte zwar, indem sie “die doppelte Pflicht eines guten
Kapellmeisters und einer klugen Hausfrau versah, das Maß des Ganzen zu erhalten,
wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Takt bleiben sollten.”19) Ottilie
dagegen passt sich nicht nur oberflächlich Eduards idiosynkratischer Spielart an:
“[s]ie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, dass daraus wieder eine
Art von lebendigen Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäss bewegte,
aber doch Höchst angenehm und gefällig lautete.”20) Nach der Logik des Textes
gehört es zum innersten Wesen der Frau, den mangelnden Zeitsinn des Mannes
zu ergänzen, zu kompensieren, zu supplementieren. In diesem Sinne ist Luciane
fast gar keine Frau, Charlotte eine gute Frau, und Ottilie fast göttlich, indem sie
den Zeitmangel des Mannes nicht nur kompensiert, sondern verklärt, ohne seine
Eigenartigkeit zu verdecken. Der Mann kommt in der Welt vor, indem er sich
in seiner Eigentümlichkeit, seiner Exzentrizität, seiner Überspanntheit und sogar
seinen Ausschweifungen zeigen läßt. Vielleicht ist die Welt im Grund nichts anderes
als die Gesamtheit dieser exzentrischen Bahnen. Die Rechtzeitigkeit und
Zeitgerechtheit der Frau fügt diese männlichen Ausschweifungen wieder in eine
19) Ebd., Bd. 6, S. 257.20) Ebd., Bd. 6, S. 297.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 127
fließende, graziöse Ordnung ein. Daher hat Ottiliens Rechtzeitigkeit fast messianische
Dimensionen. Bei den Männern, bei der männlichen Herrschaft, ist die Zeit immer
aus den Fugen geraten. Der Staat selbst bezieht sich auf die fließende Zeit der
Natur als Ausnahme. Die Frau dagegen hält und heilt die Zeit. Nur innerhalb
der Zeit, nur mit der Zeit, könnte die Natur, und auch die menschliche Natur,
allmählich den Menschen zu gehören anfangen, um eine Welt zu werden, in der
das Leben möglich wäre. Diese Verwandlung ist der Sinn der Geschichte, ist Bildung,
die nicht nur als Selbstbildung zu verstehen ist, sondern als die Erschließung und
Offenbarung, die Veröffentlichung von Potentialität als Potentialität. In diesem
Sinn darf Goethe behaupten, dass sich eine Weltliteratur bilde. Es geht hier nicht
um eine historische Teleologie, wie bei Schiller und Hegel, sondern um eine
Rückführung in die Verfügung der Zeit.
III. Das Unnachahmliche nachzuahmen
Während der erste Teil der Wahlverwandtschaften eher einen räumlichen Charakter
hat, insofern die topographische Karte als vereinendes Motiv dient, wird im zweiten
Teil die Dimension der Zeit vorherrschend. Das tableaux vivant bietet den Übergang,
indem es die Überlegenheit der bewegenden, unendlichen, romantischen Schönheit
Ottiliens über die statische, klassische Schönheit Lucianes entscheidend beweist.21)
Doch die Zeitlichkeit, die jetzt herrscht, ist tragisch.22) Der Tod streift den ersten
Teil des Romans nur leicht: der Knabe, wegen Eduards Nachlässigkeit fast ertrunken,
wird wieder zum Leben erweckt. Verwüstend behauptet der Tod im zweiten Buch
seine Rechte: zuerst an Charlottes Kind Otto, dessen Ertrinkung sich unheimlich
21) Vgl. Norbert Puszkar, “Frauen und Bilder — Luciane und Ottilie.” Neophilologus 73: 3 (1989), S. 397-410.
22) Zur innigsten Beziehung zwischen tableaux vivant und Zeitlichkeit siehe Claudia Öhlschläger, “‘Kunstgriffe’ oder Poesis der Mortifikation: Zur Aporie des ‘erfüllten’ Augenblicks in Goethes “Wahlverwandtschaften”.” In: Erzählen und Wissen: Paradigmen und Aporien ihrer Inszenierung in Goethes “Wahlverwandtschaften,” hrsg. v. Gabriele Brandstetter. Freiburg im Breisgau 2003, S. 187-203.
128 독일문학∣제128집
ahnen ließ, dann an Ottilien und Eduard. Zeit und Geschichte, so scheint es, dürfen
nur existieren, insofern sich die Endlichkeit brutal in die natürliche und
gesellschaftliche Ordnung einschneidet. Tod, die menschliche Endlichkeit, entsteht
aus dem Zusammenstoß von der Raümlichkeit der Männer und der Zeitlichkeit
der Frauen. Oder: es sind Tod und Endlichkeit als äußerste Grenze menschlicher
Möglichkeit, die zwischen dem schönen Leben der Natur und der weltlichen Ordnung
der Erkennbarkeit und Sichtbarkeit vermitteln. Geschichte in diesem Sinne ist das
notwendige Versagen von dem, was sie zu versprechen scheint: das Erschaffen
einer neuen, natürlichen, doch auch menschlichen Welt, in der es möglich wäre,
als Potentialität und nicht als Fertigkeit zu erscheinen. Pontentialität vermag nur
zu erscheinen mit Bezug auf den Tod als äußerste Möglichkeit — d.h. radikale
Unmöglichkeit.
Das Schicksalhafte an Ottiliens Existenz, ihrer tragischen Versprechung, wird
offenbar durch eine merkwürdige Inversion, und Perversion, der Ordnung der Dinge:
ihr Kind — das Kind, das ihr ähnelt — ist nicht nur vor dem Vollzug ihrer Liebe
zu Eduard geboren, sondern, anstatt dass seine Geburt eine höhere Vereinigung
der Liebhaber darstellt, wird der Vollzug der Liebe antizipiert, und gleichsam
proleptisch ausgeschloßen, durch den unnatürlichen Tod des Kindes. Zudem steht
dieses Kind in naher Verbindung mit einer anderen Welt, einer natürlichen Welt
innewohnender Bedeutsamkeit. Die Welt wird zweimal in Verbindung mit dem
Kind erwähnt, und jedes Mal hat sie nichts mehr mit dem Element der
gesellschaftlichen Anerkennung zu tun. Durch das Kind erhält Charlotte “einen
neuen Bezug auf die Welt und auf den Besitz.”23) Noch erleuchtender ist das
folgende Gespräch zwischen Eduard und Ottilien, die das Kind, unmittelbar vor
seinem Tod, besorgt:
„ist dies nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.‟
„Nicht doch!‟ versetzte Ottilie; „alle Welt sagt, es gleiche mir.‟ — „Wäre es
möglich?‟ versetzte Eduard, und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen
auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe
23) Johann Wolfgang Goethe, Hamburger Ausgabe. Bd. 6, S. 427.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 129
sah die Welt schon so verständig an; er schien die beiden zu kennen, die vor ihm
standen. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder, er kniete zweimal vor Ottilien.
„Du bists!‟ rief er aus, „Deine Augen sinds. Ach! aber laß mich einen Schleier
werfen über jene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasein gab.24)
Hier stoßen die zwei Bedeutungen von Welt zusammen. Die von Ottilien genannte
Welt ist die gesellschaftliche Welt — die Welt, die aus der Kraft, Ähnlichkeiten
und nur immer Ähnlichkeiten zu erkennen, besteht. Hier könnte man “alle Welt”
mit “man” ersetzen: die Welt ist einfach das Man. Doch in dem Augenblick, als
das Kind seine Augen aufschlägt, wird eine andere Welt erblickt: eine Welt, die
auf den ersten Blick nichts mit der Gesellschaft und ihrer unendlich sich
reflektierenden Anerkennung zu tun hat. Die Ähnlichkeit zu Ottilien, von aller
Welt erkannt, beruht in den Augen, doch nicht dem bloßen Aussehen nach, sondern
insofern sie selber in eine andere Welt hineinzublicken scheinen. Diese andere
Welt ist die Welt der Dinge, die in ihrer Potentialität gekannt werden. Daher wird
es möglich, die Welt mit einem tiefen, freundlichen Verständnis anzusehen: d.h.
mit einer Empfänglichkeit, die die Dinge nicht nur als abgeschlossen und abgefertigt,
als Fertigkeiten vernimmt, als ob sie dem und dem schon Bestehenden ähnlich
wären. Das Kind sieht eine Welt an, die wesentlich mit der Potentialität seines
Sehvermögens verwandt ist. Doch gerade als Eduard durch die eine Welt in die
andere hineinschaut, drückt er seinen Wunsch aus, einen Schleier über die Stunde,
die dem Kind Leben bescherte, zu werfen. Es ist als ob er die innewohnende
Verkehrung der geschichtlichen Zeit nicht akzeptieren könnte. Er kann nicht
akzeptieren, dass diese neue wahrhafte Welt nur aus der falschen Ordnung der
Bilder geboren werden könnte.
Das Paradoxe an Ottiliens Dasein und an der Geschichte selber, läuft auf dieses
hinaus: Bildung, die Versprechung der Geschichte — die Kultivierung und Formung
der Natur in eine völlig menschliche, auf Dauer bedachte, wohlgeordnete Welt
— wäre nur möglich durch den Einbruch einer radikalen Unterbrechung des
Zeitverlaufs. Geschichte ist niemals nur ein natürlicher Prozess. Ottilie sagt genau
24) Ebd., Bd. 6, S. 455.
130 독일문학∣제128집
das, als sie in ihr Tagebuch schreibt: “Alles Vollkommene in seiner Art muß
über seine Art hinausgehen, es muß etwas anderes, Unvergleichbares werden.”25)
Die Vollkommenheit der Art ist immer eine Art Unart, Entartung. Teleologie,
wenn man von so etwas noch sprechen kann, ist niemals nur die langsame Erfüllung
der Art, sondern ihre Überwindung: “Entweder das Gegenwärtige hält uns mit
Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig
Verlorene [...] Selbst in großen und reichen Familien [...] pflegt es so zu gehen,
dass man des Großvaters mehr als des Vaters gedenkt.”26) Der Gehülfe wird zu
diesen Gedanken geführt, als er beobachtet, daß die schöne Reihe von Lindenbäumen,
die von Eduards Vater gepflanzt wurden, genau in der Zeit, “da sie erst anerkannt
und genossen werden sollten,” von niemandem mehr beachtet wurde. Anerkannt
und genossen wird ist eigentlich nur das, was noch nicht reif oder doch schon
überreif ist. Die Blütezeit sei gleichsam eine Unzeit. Wäre der Übergang von der
natürlichen Welt in die gesellschaftliche Welt noch möglich, dürfte es weder die
leere Zeit dieser Welt noch die lückenlose Zeit jener sein, sondern eine Zeit, die,
indem sie Generationen überspringt, das plötzliche Erscheinen des scheinbar
Verlorenen ermöglicht.
Auf gerade diese Weise führt die Geschichte selber, trotz der Versprechung
der Offenbarung der reinen Potentialität, die Kraft der Nachahmung wieder ein.
Es geht nicht mehr um die unendliche Regression der Nachahmung, die die
Affenartigkeit der gesellschaftlichen Welt charakterisiert. Eher geht es um die
Tatsache, dass das Neue, obgleich in seiner Neuheit und unendlichen Potentialität
erkannt und trotz des stets ablaufenden Prozesses der naürlichen Bildung, doch
unvermeidlich wieder eine Wiederholung eines vergangenen Augenblicks werden
wird. Potentialität erscheint im Moment der Diskontinuität, des Bruchs, doch die
Unterbrechungen des Flusses der natürlichen Zeit können selbst nur durch die
Erscheinung eines Stückes aus einer vergessenen Vergangenheit erkannt werden.
Die Tragödie der Geschichte ist ihre Unfähigkeit, auch im Moment der radikalsten
25) Ebd., Bd. 6, S. 427.26) Ebd., Bd. 6, S. 417.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 131
Umwälzungen, der Parodie ganz zu entgehen.
Dieses illuminiert die eigentümliche Verbindung zwischen Ottilien und der
Muttergottes. Während Luciane allem ähnelt, oder sie wenigstens zu ähneln und
nachzuahmen versucht, ähnelt Ottilie nur dieser Einen, die die Macht des
Symbolischen symbolisiert, als ein Vermögen der Empfänglichkeit, durch die die
Erde vom Göttlichen befruchtet und fähig wird, das Göttliche in endlicher Form
zu gebären. Diese Empfänglichkeit ist vor allem die Macht des Genies. Doch Ottilie,
indem sie die absolute Empfänglichkeit symbolisiert, wird selber in ihrer Schönheit
geistig von Männern empfangen, die, mit Bezug auf sie, doppelt passiv werden.
Diese Konstellation von Motiven, welche Ottilie, das Empfänglichkeitsvermögen,
die Muttergottes, die Schönheit, und die Diskontinuität der Geschichte kettenhaft
verbindet, wird unmittelbar sichtbar an der Decke der alten Kapelle, welche der
Architekt, eher Dilettant als Genius, um sie als “ein Denkmal voriger Zeiten und
ihres Geschmacks” wiederherzustellen, nach seiner Sammlung “von verschiedenen
Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern
dahin sich nähernden Dingen” dekoriert. Diese Dinge, “die Einbildungskraft gegen
die ältere Zeit hinrichtend,” begeistern den Architekten zu etwas, was der Meinung
des Gehülfen nach als ein barbarischer Anachronismus gilt.27) Er restauriert den
katholischen Charakter der für den protestantischen Gottesdienste eingerichteten
Kapelle. So stark ist die Wirkung der neu dekorierten Kapelle, dass “man sich
beinahe selbst fragen mußte, ob man denn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob
es nicht ein Traum sei, dass man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten,
Lebenweisen und Überzeugungen verweile.”28) Die vereinigende Charakteristik
dieser Figuren ist eine radikale Unterwürfigkeit und Hingabe an das Göttliche:
“Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Ehrwürdigen über uns, stille
Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Gebärden
ausgedrückt… Nach einer solchen Region blicken wohl die meisten wie nach einem
verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradies hin. Nur
27) Ebd., Bd. 6, S. 366-367.28) Ebd., Bd. 6, S. 367.
132 독일문학∣제128집
vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihresgleichen zu fühlen.”29) Es geht
hier nicht nur um eine bestimmte Art von Persönlichkeit, nicht um einen
psychologischen Typ, sondern um die existentielle Charakteristik einer Welt, die
auf eine ganz andere Weise als unsere eigene zusammengehalten wurde: eben
nicht durch den ruhelosen affenartigen Nachahmungszwang, den Luciane
exemplifiziert, sondern durch eine reine Empfänglichkeit, Geduld, und Hingabe
an das Jenseitige und Größere. Ottilie allein scheint diesem anderen Modus der
annähernden Ähnlichkeit zu ähneln. Doch als der Architekt, von Ottilien geholfen,
seine eigenen Nachmachungen der Bilder auf der Decke der Kapelle nachmacht,
werden die Gesichter, die er allein malen durfte, Otteliens eigenem Gesicht nach
und nach immer ähnlicher. Nicht nur, dass er von ihrem Bild stark affiziert wird,
sondern ihre eigene Empfänglichkeit macht ihn auch einer reinen, gleichsam
makellosen Empfängnis ihres Bildes fähig: “Die Nähe des schönen Kindes mußte
wohl in die Seele des jungen Mannes [...] einen so lebhaften Eindruck machen,
dass ihm nach und nach auf dem Wege vom Auge zur Hand nichts verlorenging,
ja dass beide zuletzt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letzten
Gesichtchen glückte vollkommen, so dass es schien, als wenn Ottilie selbst aus
den himmlischen Räumen heruntersähe.”30) Sich in Ottiliens Nähe befindend, in
ihr Auge hineinsehend, wird das Auge des Architekten gleichstimmig mit seiner
Hand, und in dieser Gleichstimmigkeit fähig, Ottilie in das Firmament zu stellen,
so dass ihr Auge, wie aus der Höhe der Vergangenheit, jetzt auf ihn heruntersieht.
Das Ereignis der Geschichte, in dem die Vergangenheit plötzlich und unerwartet
in die Gegenwart hineinblitzt, ist vielleicht nichts anderes als dieses Eräugnis,
in dem sich das Auge dem Auge zeigt, oder, wie man sagt, eräugt.
Hier scheint Ottiliens Genius harmlos genug, doch in den letzten Kapiteln nimmt
er einen schicksalhaften, dämonischen Aspekt an. Nachdem Charlottes Sohn
ertrunken ist, gelobt sie Schweigen und hungert bis zum Tode. Das Wesen ihres
Genius ist Martyrium, oder eher, wie die Scheinseligsprechung bei ihrer Beerdigung
29) Ebd., Bd. 6, S. 367-368.30) Ebd., Bd. 6, S. 372.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 133
andeutet, eine Parodie des Martyriums. Der Genius wird zur Parodie des Genius.
Doch auch diese Parodie ist unnachahmbar. Keiner weiß das besser als Eduard,
der versucht, Ottiliens Weg zu folgen. Sein Versuch, auf ihre Art zu sterben, scheitert
selber unmittelbar vor seinem Tod: er will wieder essen, und spricht nach langem
Schweigen mit seinem letzten Wort das vernichtende Urteil über seine Existenz
aus.
[...] was bin ich unglücklich, dass mein ganzes Bestreben nur immer eine
Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir
Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen bin ich genötigt, diese Pein zu
übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach; aber meine Natur hält
mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das
Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem,
auch zum Martyrium.31)
IV. Zum Schluss
Von Welt und Weltlichkeit haben wir viel gesagt — von Weltliteratur nichts.
Es wäre vielleicht genug, darauf aufmerksam zu machen, dass Goethes Begriff
von Welt nicht ohne Konsequenzen für sein Verständnis von Weltliteratur sein
kann, auch wenn diese Beziehung thematisch nicht weiter entwickelt wird. Es
hat aber auch nicht nur zu tun mit der Auslegung Goethes, sondern mit unserem
Umgang mit dem Begriff Weltliteratur. Die Welt, die in der Literatur aufs Spiel
gesetzt wird, steht in engster Verbindung mit einer verwickelten theologischen
Problematik, die in der heutigen Diskussion zur Weltliteratur meistens vollkommen
übersehen wird. Sehr schematisch ausgedrückt: der Roman, als Hauptorgan der
Weltliteratur, intendiert eine Fülle der Welt, eine Fülle, Selbstständigkeit und
Schließung der Bedeutungen (der Erschlossenheit, könnte man nach Heidegger
sagen), die die Geschaffenheit der Welt bestreitet, insofern die Schöpfung nur
31) Ebd., Bd. 6, S. 489-490.
134 독일문학∣제128집
ihre Bedeutung außerhalb ihrer selbst in einem Schöpfergott finden kann. Doch
er kann auch nicht den Begriff der Welt als ens creatum ganz aufgeben, weil
die Möglichkeit der Bedeutung, die Möglichkeit eines Sinnes der Welt und des
Lebens, noch von der Logik der Schöpfung abhängt. Bedeutung und Sinn darf,
nach dieser Logik, nur das haben, was von einem Schöpfer oder Künstler zu einem
möglichen Zweck gemacht wurde. Daher intendiert der Roman eine
Kompromisformation, die man die natürliche Welt heißen könnte. Die natürliche
Welt ist zugleich weltlich und naturhaft: innewohnendes, von selbst entstehendes
Wachstum und bedeutungsvolle Geschöpflichkeit. Ottiliens Tragödie besteht vor
allem darin, dass die Kompromisformation, die der Roman bezweckt, scheitern
muss. Das neue, schöne Leben kann sich nicht aus dem Kreis der Nachahmungen
retten: das Ursprünglichste muss selbst Parodie, und zwar Selbst-Parodie werden.
Literaturverzeichnis
Boa, Elizabeth: “Aping and Parroting — Imitative Performance in Goethe’s Die
Wahlverwandtschaften.” In: Performance and Performativity in German Cultural
Studies, hrsg. v. Carolin Duttlinger/ Lucia Ruprecht/ Andrew Webber. Bern 2003,
S. 21-40.
Goethe, Johann Wolfgang: Hamburger Ausgabe, München 1988, Bd. 6.
von Mücke, Dorothea: “The Power of Images in Goethe’s Elective Affinities.” Studies
in Eighteenth Century Culture 40 (2011), S. 63-81.
Öhlschläger, Claudia: “‘Kunstgriffe’ oder Poesis der Mortifikation: Zur Aporie des
‘erfüllten’ Augenblicks in Goethes ‘Wahlverwandtschaften.’” In: Erzählen und
Wissen: Paradigmen und Aporien ihrer Inszenierung in Goethes
“Wahlverwandtschaften,” hrsg. v. Gabriele Brandstetter. Freiburg im Breisgau
2003, S. 187-203.
Peucker, Brigitte: “The Material Image in Goethe’s ‘Wahlverwandtschaften.’” Germanic
Review 74: 3 (1999). S. 195-213.
Puszkar, Norbert: “Frauen und Bilder: Luciane und Ottilie.” Neophilologus 73: 3
(1989), S. 397-410.
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 135
Tantillo, Astrida Orle: Goethe’s “Elective Affinities” and the Critics. Rochester N.Y.
2001.
Vogl, Joseph: “Goethes ökonomischer Mensch.” In: Erzählen und Wissen: Paradigmen
und Aporien ihrer Inszenierung in Goethes “Wahlverwandtschaften,” hrsg. v.
Gabriele Brandstetter. Freiburg im Breisgau 2003, S. 241-257.
Vogl, Joseph: “Nomos der Ökonomie: Steuerungen in Goethes Wahlverwandtschaften.”
MLN 114:3 (1999), S. 503-527.
136 독일문학∣제128집
국문 요약
괴테의 세계
- �친화력�에 나타난 세계성과 세계문학
앤소니 커티스 아들러 (연세 )
재 세계 문학 학계에서 큰 요성을 지니고 있는 괴테의 세계문학의 컨셉트
는 내 보다는 외 으로 해석 되고 있다 - 이는 문학 산업의 로벌화를 의미한
다. 이 논문에서 나는 �친화력�을 읽고 괴테에게 있어 문학은 세계의 컨셉트 자
체를 다시 생각하고 다시 바라보는 것이라고 주장하려 한다. 괴테에게 있어 소설
은 단지 세상을 묘사하는 것이 아닌 객 으로 존재하지만 일시 이고 공간
배경의 인간의 존재를 체한다. 더 자세히 나는 �친화력�의 상반되는 등장인물
들인 오틸리에과 루치아네를 통해 두 개의 다른 세계 을 보여 다: 한 면에서는
세계가 쇠퇴하는 건 인 체제에 응하는 외 인 존재와 인식이지만 한 면에
서는 세계가 삶 자체의 경제 인 체제라는 것을 보여 다. 소설에서는 이 둘의
충을 찾으려 하지만 두 번째 트의 비극 인 개는 두 상반되는 세계 을
섭렵하지 못한 인 실패를 보여 다. 이 비극 인 개는 결론 으로 모방
의 문제로 연결 될 수 있는데, 이 작품은 에두아르트의 공간을 떠나는 루치아네
를 포함하지 않으면서 “모방성”의 퇴출을 보여주고자 하지만 독창성으로 보여지
는 오틸리에의 본성은 성모 마리아를 모방함으로써 더 험하고 악마 인 모방
을 보여 다. 그녀의 순교는 패러디의 방식을 띄고 있으며 에두아르트는 비극을
뛰어넘는 고통의 운명을 겪어야 한다. 모방 할 수 없는 것을 모방하는 창피한
실패를 하는 것이 그의 과제가 된다.
주제어: 괴테, 세계문학, 세계개념, 세계성, 친화력
Schlüsselbegriffe: Goethe, Weltliteratur, Weltbegriff, Weltlichkeit,
Wahlverwandtschaften
Goethes Welten|Anthony Curtis ADLER 137
필자 E-Mail: [email protected]
투고일: 2013. 10. 20 | 심사일: 2013. 11. 5 | 심사완료일: 2013. 11. 25