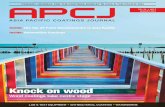Genug Holz für Stadt und Fluss? Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen. (Enough wood for...
Transcript of Genug Holz für Stadt und Fluss? Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen. (Enough wood for...
Genug Holz für Stadt und Fluss? Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen
Projektbericht September 2013
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt Universität für Bodenkultur Wien
Finanziert vom Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die ÖAW und unterstützt durch Nationalpark Donau-Auen GesmbH & Österreichischen Bundesforste AG
Enough wood for city and river? Vienna’s wood resources in dynamic Danube floodplains
Project report (English summary see chapter 8)
Zitiervorschlag:
Hohensinner, S., Drescher, A., Eckmüllner, O., Egger, G., Gierlinger, S., Hager, H., Haidvogl, G. & Jungwirth, M. (2013): Genug Holz für Stadt und Fluss? Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen. Projektbericht, Institut für Hydrobiologie & Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien, 66 S. mit 12 Kartenbeilagen.
Bildnachweis Titelblatt:
links: Vogelschauplan der Stadt Wien und Umgebung von Nordwesten, Folbert van Alten-Allen, Kupferstich aufgenommen vor 1683 (hrsg. 1686), WStLA Kartographische Sammlung, Sign. 1856; verändert von S. Hohensinner
rechts: von der Donau frisch erodiertes Ufer nach dem Uferrückbau am Thurnhaufen flussauf von Hainburg, C. Baumgartner, Nationalpark Donau-Auen GesmbH, 2009
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ........................................................................................................... 1
2 Wissenschaftliche Fragestellungen ...................................................................... 2
3 Projektgebiet & Untersuchungszeitraum ............................................................ 3
4 Methodik ............................................................................................................. 5
4.1 Projektdesign ..................................................................................................................... 5
4.2 Flussmorphologische Rekonstruktion ................................................................................ 7
4.3 Historische Land-/Waldnutzung ..................................................................................... 10
4.4 Vegetationsökologische Rekonstruktion .......................................................................... 13
4.5 Forstwirtschaftliche Modellierung .................................................................................... 16
4.6 Historischer Holzverbrauch ............................................................................................. 19
4.7 Synthese der Projektergebnisse ........................................................................................ 21
5 Ergebnisse ........................................................................................................ 22
5.1 Flussmorphologische Rekonstruktion .............................................................................. 22
5.1.1 Abiotische Standortbedingungen ............................................................................. 22
5.1.2 Flussdynamik ........................................................................................................... 27
5.2 Historische Land-/Waldnutzung ..................................................................................... 29
5.3 Vegetationsökologische Rekonstruktion .......................................................................... 32
5.4 Forstwirtschaftliche Modellierung .................................................................................... 36
5.5 Historischer Holzverbrauch ............................................................................................. 39
5.6 Synthese der Projektergebnisse ........................................................................................ 41
6 Praktische Relevanz .......................................................................................... 48
6.1 Ökologisch-naturschutzfachlich ...................................................................................... 48
6.2 Forstwirtschaftlich-volkswirtschaftlich ............................................................................. 52
7 Zusammenfassung ............................................................................................ 56
8 English summary .............................................................................................. 59
9 Literaturverzeichnis .......................................................................................... 62
10 Kartenanhang .................................................................................................... 66
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 1
1 Einleitung
Was wissen wir heute über die natürliche Produktivität von Auwäldern an großen Flüssen
vor der Regulierung und über deren ehemalige Funktion als Quelle für Rohstoffe und
erneuerbare Energie? Können wir aus einer Rekonstruktion der historisch verfügbaren
Holzressourcen Rückschlüsse für ein ökologisches und nachhaltiges Ressourcen-
management ziehen? Die Ausarbeitung von Grundlagendaten zur Beantwortung dieser
Fragen war das generelle Ziel des Forschungsprojektes.
Die Augebiete der Donau stehen schon seit Jahrhunderten im Spannungsfeld
unterschiedlicher Nutzungsinteressen. Neben Fischerei- und Jagdnutzung waren Auwälder
auch wegen ihrer Holzressourcen für größere Städte von besonderer wirtschaftlicher
Bedeutung. Einerseits weil es sich dabei um hochproduktive forstliche Standorte handelt,
andererseits weil der Holztransport über den Wasserweg leichter zu bewerkstelligen war.
Da die vorindustrielle Gesellschaft in Österreich bis ins 19. Jahrhundert auf solarbasierte
Energiequellen angewiesen war, stellte lokal und regional verfügbares Brennholz einen
zentralen wirtschaftlichen Faktor dar. Fossile Energiequellen haben heute zwar Biomasse
größtenteils als Energieträger abgelöst, Holz gewinnt jedoch als erneuerbare und
nachhaltige sowie lokal verfügbare Ressource zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung.
Der Wert der vielen Ressourcen und Funktionen von Aulandschaften für eine ökologisch-
wirtschaftlich nachhaltig orientierte Gesellschaft wurde in jüngster Zeit auch im
Millennium Ecosystem Assessment betont (Millennium Report Wetlands, 2005). Dabei
befinden sich Wälder generell und Auwälder im Besonderen in einem neuen Spannungsfeld
– jenem zwischen forstlicher Ertragsmaximierung und ökologisch-naturschutzfachlich
ausgerichteter Waldnutzung.
Die Art der wissenschaftlichen Fragestellungen erfordert einen interdisziplinären Zugang,
wobei auch das Wissen von institutionalisierten und privaten Akteuren des Donauraums in
die Analysen einbezogen wurde. Neben flussmorphologisch-gewässerökologischen,
vegetationsökologischen und forstwirtschaftlichen Schwerpunkten weist das Projekt auch
einen umwelthistorischen Zugang auf, indem gesellschaftlich-wirtschaftliche Aspekte
miteingebunden werden. Als transdisziplinäre Projektpartner haben folgende Institutionen
und Personen zum Gelingen des Projekts beigetragen: Nationalpark Donau-Auen
GesmbH, MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, DI Gottfried
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 2
Haubenberger (ehemals Forstverwaltung Lobau, MA 49), MA 8 – Wiener Stadt- und
Landesarchiv, Wiener Stadtarchäologie, via donau – Österreichische Wasserstraßen
GesmbH, Österreichische Bundesforste AG, Forstverwaltung Metternich-Sándor
Grafenegg, Univ.Doz. DI Dr. Norbert Weigl (Forstmeister, Forsthistoriker).
2 Wissenschaftliche Fragestellungen
Basierend auf den beiden eingangs genannten Fragenkreisen ergeben sich in Hinblick auf
die Donau-Flusslandschaft vor der systematischen Regulierung mehrere interessante
wissenschaftliche Fragestellungen:
1. Wie groß waren die jährlichen Erosions- und Anlandungsraten im Fluss-Auensystem
der Wiener Donau vor der Regulierung?
2. Welche Vegetationsgesellschaften waren typisch für das Wiener Augebiet und welche
Sukzessions-/Altersstadien wiesen diese auf?
3. Mit welchem Holzertrag konnte bei den damaligen Standortbedingungen
(Standortalter, hydrologische Bedingungen, ...) gerechnet werden und wie groß sind
die Unterschiede zum Ertrag in den heutigen regulierten/stabilen Auen?
4. Wieviel Holz wurde von der Donau jährlich durch Erosion mobilisiert? (Totholz)
5. Wie groß war der jährliche Verbrauch an (Brenn-)Holz in Wien im Vergleich zu den
Holzressourcen der Auwälder und welcher Anteil an erforderlicher Biomasse konnte
durch lokale Ressourcen gedeckt werden?
6. Welche Erkenntnisse sind aus den historischen Analysen für ein ökologisch
verträgliches Management und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Donau-
Augebieten unter den aktuell geänderten naturräumlichen Bedingungen und
sozioökonomischen Verhältnissen ableitbar?
Zu einigen dieser Fragen gibt es nach bisherigem Stand der Wissenschaft nur offene
Hypothesen (Fragen 3, 4, 5), während bezüglich der anderen Fragen zumindest Kenntnisse
auf genereller Ebene vorliegen.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 3
3 Projektgebiet & Untersuchungszeitraum
Die Modellierungen wurden für den Donau-Abschnitt zwischen dem Kuchelauer Hafen
bei Klosterneuburg (in der Wiener Pforte) und dem Alberner Hafen vorgenommen
(Strom-km 1937 – 1919, siehe Abbildung 1). Die seitliche Ausdehnung des Projektgebietes
entspricht dem gesamten postglazialen Augebiet, welches im Holozän ungefähr in den
letzten 11.500 Jahren von der Donau geprägt wurde („Zone der rezenten Mäander“). Die
Gesamtfläche beträgt 96,4 km² und die Länge der Talachse 16,4 km (Mittelachse des
Donau-Alluviums).
Für die Auswertung der Ergebnisse wurde zusätzlich ein engeres Untersuchungsgebiet
herangezogen, welches sich von Nußdorf bis ungefähr Kaiserebersdorf erstreckt, in der
lateralen Ausdehnung aber unverändert bleibt (Strom-km 1933,5 – 1921,5). Die zusätzliche
Abgrenzung ergibt sich aus zweierlei Gründen: (1) da die flussauf/flussab gelegene
Begrenzung des gesamten Projektgebietes aufgrund der verwendeten historischen
Grundlagen schräg zur Fluss-/Talachse schneidet (anstatt senkrecht), sodass das Augebiet
nicht vollständig erfasst werden kann; und (2) weil es sich beim Abschnitt Kuchelau –
Nußdorf um einen flussmorphologisch anders gearteten Donau-Abschnitt handelt (Wiener
Pforte). Das engere Untersuchungsgebiet weist eine Fläche von 77,1 km² und eine Länge
der Talachse von 11,8 km auf.
Die Modellierungen wurden für den Zustand der Donau-Flusslandschaft um 1825
vorgenommen, da für diesen Zeitpunkt die ersten detaillierten Vermessungen der Donau-
Auen vorliegen und zeitgleich der Franziszeische Kataster (Urmappe) als wesentliche
Grundlage erstellt wurde. Die Donau-Landschaft war um 1825 vom flussmorphologischen
Standpunkt aus betrachtet nicht mehr ganz natürlich. Vor allem beim Hubertusdamm
flussauf Jedlesee, am Donaukanal und teilweise am Fahnenstangenwasser bei der
Leopoldstadt gab es bereits stärkere menschliche Eingriffe (Hochwasserschutzdämme und
Ufersicherungen). In Summe waren aber die örtlichen Eingriffe mit 11 %
Regulierungsintensität (= Anteil der gesicherten Hauptstromufer) noch gering (Schuller, in
prep.). Dies trifft jedoch nicht auf die Landbedeckung im Augebiet zu, da die Wiener Auen
um 1825 nur mehr zu rund einem Drittel mit Wald bedeckt waren. Zudem wurden die
Wälder bereits seit Jahrhunderten intensiv genutzt.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 4
Abbildung 1: Abgrenzungen des Projektgebiets und des engeren Untersuchungsgebietes
(Hintergrund: Flächenmehrzweckkarte, MA 41)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 5
4 Methodik
4.1 Projektdesign
Die interdisziplinär zu beantwortenden Fragestellungen spiegeln sich in der mehrstufig
aufeinander abgestimmten Struktur des Projekts wider (Abbildung 2). Die Rekonstruktion
der flussmorphologischen Verhältnisse der Donau-Auen um 1825 stellt gemeinsam mit der
Analyse der damaligen Landnutzungen die Basis des Projekts dar. Beide Arbeitspakete
wurden an der Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Hydrobiologie &
Gewässermanagement, von Severin Hohensinner beziehungsweise von Gertrud Haidvogl
bearbeitet. Darauf aufbauend wurden von Anton Drescher (Karl-Franzens-Universität
Graz) und Gregory Egger (eb&p Umweltbüro GmbH Klagenfurt) die damaligen
Vegetationsgesellschaften des Auwaldes rekonstruiert. Diese Ergebnisse dienten wiederum
als Ausgangsbasis für die forstwirtschaftliche Modellierung der Holzproduktivität der
Auwaldstandorte. Diese Arbeiten wurden von Otto Eckmüllner, Bojana Veselinovic
(Institut für Waldwachstumsforschung, BOKU) und Herbert Hager (Dept. für Wald- und
Bodenwissenschaften, BOKU) vorgenommen. Die Ermittlung des jährlichen
Holzverbrauches der Stadt Wien um 1825 wurde von Sylvia Gierlinger am Institut für
Soziale Ökologie, IFF, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, durchgeführt.
Abbildung 2: Projektstruktur und Arbeitspakete
Die Modellierungen und vergleichende Analysen wurden für zwei Szenarien
vorgenommen. Im ersten Szenario wurde hypothetisch angenommen, dass das gesamte
Augebiet um 1825 in einem „natürlichen“ Zustand, also vom Menschen unbeeinflusst war.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 6
Dabei wurden großflächig wirksame menschliche Eingriffe, wie zum Beispiel die
Auswirkungen von Landnutzungsänderungen im Einzugsgebiet flussauf, nicht
berücksichtigt. Das Ziel hierbei war es, das natürliche Potenzial der Donau-Auen für
Holzressourcen zu ermitteln (Abbildung 3).
Abbildung 3: Schematische Darstellung der historischen Analysen unter der Annahme, dass das gesamte Augebiet natürliche Auenvegetation aufwies (Szenario 1)
Im ersten Schritt wurde das natürliche Holzpotenzial der Auen („Holzvorrat“) sowie die
mittleren jährlichen Zuwachsraten berechnet. Im zweiten Schritt wurde ermittelt, wieviel
davon wieder von der Donau durch Erosion mobilisiert und so dem Gewässersystem
zugeführt wurde. Der dritte Schritt umfasste die Gegenüberstellung des jährlichen
Holzverbrauches von Wien mit dem jährlichen Zuwachs. Dadurch soll geklärt werden,
inwiefern der Holzbedarf durch den jährlichen Zuwachs im Augebiet gedeckt werden
konnte.
Das zweite Szenario berücksichtigte hingegen, dass große Teile des Augebietes gar keine
Waldbestände mehr aufwiesen, sondern landwirtschaftlich genutzt wurden oder als
Siedlungsraum dienten. Ebenso wurde berücksichtigt, dass die verbliebenen Wälder von
den Menschen in unterschiedlicher Form genutzt wurden. Die Modellierungen und
Bilanzierung der Ergebnisse erfolgte analog zum natürlichen Szenario (Abbildung 4).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 7
Zusätzlich wurde aber auch noch untersucht, wieviel Holz damals tatsächlich aus dem
Augebiet entnommen wurde und ob die entnommene Menge zusammen mit dem
erodierten Totholz größer oder kleiner als die jährlichen Zuwachsraten waren.
Abbildung 4: Schematische Darstellung der historischen Analysen unter der Berücksichtigung der tatsächlichen Land-/Waldnutzung (Szenario 2)
4.2 Flussmorphologische Rekonstruktion
Die Rekonstruktion der flussmorphologischen Situation und der hydromorphologischen
Standortsverhältnisse für die Auenvegetation um 1825 beruht auf zahlreichen Daten, die
bereits in früheren Forschungsprojekten erarbeitet wurden. Der wichtigste
Standortparameter – das morphologische Standortalter – wurde durch sukzessive
Verschneidung von 7 bereits rekonstruierten Zeitschnitten (1529, 1570, 1632, 1663, 1726,
1780 und 1817) mittels GIS ermittelt. Diese Zeitschnitte wurden im Rahmen des FWF-
Projekts „ENVIEDAN – Umweltgeschichte der Wiener Donau 1500-1890“ (Leitung:
Verena Winiwarter, Projekt-Nr. P22265-G18) 2012 erstellt (siehe Lager, 2012;
Hohensinner et al., 2013a, 2013b). Da der Zeitabstand zwischen 1780 und 1817 für die
Modellierungen zu lang war, wurde im Zuge des vorliegenden Projekts zusätzlich die
Situation um 1805 rekonstruiert; ebenso auch die Situation um 1825 auf welche sich die
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 8
Modellierungen beziehen (Schuller, in prep.; siehe Kartenbeilage 1). Somit konnte das
Standortalter aller Landflächen für das Jahr 1825 basierend auf insgesamt 9 Zeitschnitten
beginnend im Jahr 1529 berechnet werden.
Da für das Augebiet um 1825 keine genaue Vermessung der Höhenverhältnisse vorliegt,
wurde eine vertikale Gliederung des Fluss-Auensystems anhand von 6 morphologischen
Geländezonen vorgenommen (Kartenbeilage 2). Als Grundlagen dafür wurden
bestehende Studien von anderen Donau-Abschnitten (Hohensinner, 2008; Hohensinner et
al., 2011), ein digitales Höhenmodell der Wiener Donau-Auen 1849 (Herrnegger, 2007;
Hohensinner et al., 2008) und zahlreiche neu recherchierte historische Grundlagen
herangezogen. Jede dieser morphologischen Geländezonen zeichnet sich durch eine
charakteristische Höhenlage relativ zum Null-Wasserspiegel (ca. mittleres jährliches
Niederwasser, MJNW) und zum sommerlichen Mittelwasserstand (SMW) aus. Die
Gewässerflächen beim Null-Wasserstand und unbewachsene Schotter-/Sandflächen bilden
als unterste Höhenzonen zusammen das "aktive Gerinne". Die unterste Zone mit
mehrjähriger Gehölzvegetation, welche zwischen sommerlichem Mittelwasser und ca. 1-
jährlichem Hochwasser überflutet wurde, entspricht den sogenannten "Vegetated areas
below bankfull" (VABB). Dabei handelt es sich um tief liegende Uferzonen, kleinere
Inseln, verlandete Altarme und bewachsene Gräben. Zusätzlich wurde hierbei
unterschieden, ob die VABB-Flächen durch An-/Auflandung entstanden sind oder durch
Verlandungsprozesse in ehemaligen Altarmen. Die fünfte Geländezone entspricht den
höher liegenden Vegetationsflächen, dem Hauptniveau des Augeländes ("Elevated
floodplain areas – mittel"), welche zumeist erst bei Wasserständen über einem 1-jährlichen
Hochwasser überflutet wurden. Die höchste Geländezone wurde durch die "Elevated
floodplain areas – hoch" gebildet. Diese wurden erst bei ca. 5-jährlichem Hochwasser
überschwemmt.
Für jede der 6 Geländezonen wurden die abiotischen Standortfaktoren für die
Auenvegetation definiert (siehe Tabelle 2 in Kapitel 5.1.1). Die Flurabstände bei MJNW
und bei SMW basieren primär auf einem Geländemodell, welches für das Projektgebiet für
das Jahr 1849 erstellt wurde. Da sich die Wasserspiegellagen zwischen 1825 und 1849
verändert haben, wurden die täglichen Pegelwerte an der Großen Wiener Taborbrücke
zwischen 1829 und 1849 analysiert (Pegeldaten von der via donau). Dementsprechend ist
anzunehmen, dass der Null-Wasserspiegel (MJNW) im Jahr 1825 um ca. 0,4 m höher war
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 9
als 1849 und der Mittelwasserspiegel um 0,2 m. Die Spiegellage beim mittleren jährlichen
Hochwasser (MJHW) blieb offensichtlich gleich.
Abbildung 5: Geländemodell der Wiener Donau-Landschaft im Jahr 1849 (Herrnegger, 2007)
Ebenso musste berücksichtigt werden, dass es vor allem auf den jüngeren Flächen des
Augebietes zwischen 1825 und 1849 hochwasserbedingt zu Auflandungen kam, wodurch
sich die Flurabstände und Überflutungshäufigkeiten veränderten. Da es keinerlei Daten
über langfristige Auflandungsraten in Form von Feinsedimenten (Schluff) gibt, wurden
diese neu rekonstruiert. Als Basis dienten dazu die im Geo-Atlas der Stadt Wien
ausgewiesenen Schluffmächtigkeiten, welche mit dem Standortalter verschnitten wurden
(Hoffmann et al., 2007). Das Standortalter ergibt sich hierbei aus dem Zeitraum, in dem
der betreffende Bereich des Augebietes von Hochwässern beeinflusst wurde (d. h. in vielen
Bereichen maximal bis zur Fertigstellung der großen Donauregulierung 1875).
Erwartungsgemäß erfolgte die Ablagerung von Schluff auf jungen Standorten anfangs sehr
rasch und verringerte sich je älter und höher das Augelände wurde (Abbildung 6).
Die für 1849 berechneten Flurabstände wurden anschließend anhand der ermittelten
Wasserspiegellagenänderungen und berechneten Ablagerungsraten von Feinsedimenten für
1825 adaptiert (d. h. die Flurabstände wurden verringert). Neben den Flurabständen und
Feinsedimentauflagen wurden ebenfalls die Überstauungshöhen und mittlere Dauer der
Überstauung bei 1-jährlichem Hochwasser (HW1) und 5-jährlichem Hochwasser (HW5)
rekonstruiert.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 10
Abbildung 6: Rekonstruierte Ablagerungsraten von Feinsedimenten (Schluff) für die Wiener
Donau-Auen in Abhängigkeit der Zeitdauer (rot: Rückrechnung für das Jahr 1825)
Dies erfolgte unter Zuhilfenahme zusätzlicher historischer Informationen wiederum mit
Hilfe des adaptierten Geländemodells 1849 (in diesem Fall wurden für 1825 an jüngeren
Austandorten geringfügig größere Überstauungshöhen als 1849 angenommen).
Sämtliche rekonstruieren Standortfaktoren sind je Standortalter und Geländezone in
Tabelle 2 in Kapitel 5.1.1 ersichtlich. Die Berechnung der jährlichen Erosions- und
Anlandungsraten in den Zeiträumen 1805 – 1817 und 1817 – 1825 erfolgte ebenfalls durch
Verschneidung der betreffenden Zeitschnitte mittels ArcGIS. Auf Basis der ausgewiesenen
erodierten Austandorte konnte in weiterer Folge die Menge des von der Donau
mobilisierten Totholzes ermittelt werden.
4.3 Historische Land-/Waldnutzung
Die Wiener Donau-Auen werden seit Jahrhunderten intensiv genutzt. Außerhalb der
Donau-Hauptarme (flussmorphologisch aktive Zone der Neuzeit) wurden große Flächen
um die Siedlungskerne alter Gemeinden wie z.B. Kagran, Aspern oder Hirschstetten bereits
sehr früh gerodet. Diese Bereiche standen somit als Waldflächen nicht mehr zur
Verfügung. Aber auch für die durchaus noch großflächig verbliebenen Auwäldern ist eine
menschlich bedingte Änderung der Baumbestände und damit der Produktivität
anzunehmen.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 11
Mehrere potenzielle Faktoren kommen für diese Veränderungen in Frage: Zunächst die
forstliche Bewirtschaftung und Holzentnahme selbst, durch die vermutlich gewisse
Baumarten gefördert wurden, andererseits aber auch eine Beeinflussung des Waldbestandes
durch Viehweide in den Auwäldern oder durch Wildhege, die vor allem in den
habsburgischen Jagdgebieten (Teile des Praters, Lobau) intensiv war.
Die Untersuchung der historischen Land- und Waldnutzung im Wiener Augebiet diente
dazu, den tatsächlichen, vom Menschen beeinflussten Zustand der Donau-Auwälder für
die Zeit um 1825 zu dokumentieren. Dieser Zeitpunkt liegt sowohl vor dem Beginn der
großen Donauregulierung als auch vor dem intensiven Bevölkerungsanstieg in der Stadt
Wien. Konkret wurden drei Fragen behandelt:
1. Welche konkurrierenden Landnutzungen existierten im unregulierten Augebiet, die
einer Maximierung des Holzertrages entgegenstanden?
2. Welche Möglichkeiten und Formen der Holznutzung gab es in den Donau-Auen
vor der Regulierung?
3. Wurden die Auwaldstandorte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts quantitativ
gesehen nachhaltig genutzt? Wurde mehr oder weniger Holz entnommen als
jährlich zugewachsen ist?
Als Datengrundlage wurden verschiedene Teile des franziszeischen Katasters verwendet.
Der franziszeische Kataster ist eine umfassende kartographische und statistische Aufnahme
aller Katastralgemeinden der Habsburger Monarchie. Er diente als Besteuerungsgrundlage,
wobei Steuern vor allem auf land- und forstwirtschaftliche Erträge erhoben wurden.
Abgesehen von den unmittelbar für die Steuerermittlung nötigen Grundlagen bieten die
Schriftoperate umfassende Daten zur Bevölkerung sowie zur Land- und Forstwirtschaft
generell. Für die Analysen wurden die Mappenblätter, die Parzellenprotokolle und das
Waldschätzungsoperat aller im Untersuchungsgebiet liegenden Katastralgemeinden
verwendet.
Die Mappenblätter weisen einen Maßstab von 1 : 2.880 auf und zeigen parzellenscharf
abgegrenzt den jeweiligen Landnutzungstyp. In den Parzellenprotokollen finden sich die
genauen Ertragsklassen. Die Waldschätzungsoperate beinhalten für jede Katastralgemeinde
eine Beschreibung der Ertragsklasse für jeden Landnutzungstyp. Es gibt hier
Informationen zum Flächenausmaß, zur gesamten Anzahl an Parzellen einer
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 12
Nutzungsklasse, zu den dominierenden Baumarten, zur forstwirtschaftlichen Verwendung
des Holzes und dessen Absatz, zu den Umtriebsperioden, zum Waldzustand, zu
Bodenbeschaffenheit und Lage sowie zum Naturalertrag und Zuwachs pro Jahr. Der
Naturalertrag ist dabei eine Schätzung des gesamten Ertrags nach Erreichen der
Umtriebszeit. Der jährliche Zuwachs wurde als gesamter Naturalertrag geteilt durch die
Umtriebszeit ermittelt. Die Mappenblätter wurden im Bereich der Donau-Auen im
Zeitraum um 1825 produziert (gesamt Wien: 1817 – 1829). Die zugehörigen
Parzellenprotokolle stammen allerdings erst aus den Jahren 1833 oder 1834 und die
Schätzungsoperate überwiegend aus dem Jahr 1829.
Die Mappenblätter des Katasters wurden parzellenscharf mittels ArcGIS vektorisiert von
der Stadtarchäologie der Stadt Wien zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Prater
Hauptallee/Lusthaus standen für einen kleinen Bereich von ca. 0,8 km² keine Daten zur
Landnutzung zur Verfügung. Zur Erhebung der tatsächlichen Waldflächen wurde eine
Bilanzierung der im GIS ausgewiesenen Landnutzungstypen vorgenommen. Die
ursprünglich ermittelten 30 Kategorien wurden dafür in die Hauptkategorien Äcker,
Grünland und Obst-/Gemüsegärten, Siedlungen und höherwertig genutzt Flächen,
Gewässer und Wälder zusammengefasst. Einige sehr kleinräumige Nutzungen wurden in
der Sammelkategorie „Sonstige“ erfasst. Zur Weiterbearbeitung der Fragen bezüglich
Produktivität, Bewirtschaftung und Zustand der Wälder wurden im Anschluss die
Waldparzellen exportiert. Danach wurden jeder Parzelle die Katastralgemeinde, die
Parzellennummer laut Parzellenprotokoll und die entsprechende Ertragsklasse zugewiesen.
Die Informationen aus dem Waldschätzungsoperat wurden systematisch in Excel erfasst.
Parameter wie dominierende Baumarten oder Bodenart wurden in weiterer Folge auch in
das GIS-Shapefile als Attribute übertragen.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass bei der Unterscheidung der Waldnutzungstypen
„Auwald“ und „Niederwald“ keine plausible Differenzierung gefunden werden konnte. Die
Beschreibungen in den Schätzungsoperaten deuten darauf hin, dass heute gängige
Definitionen nicht zutreffen. Es scheint vielmehr so, dass die Festlegung der
Nutzungsklassen gemeindeweise von den Schätzungstruppen vorgenommen wurde. Dies
trifft auch auf die Unterscheidung der einzelnen Ertrags- oder Bonitätsklassen zu. Sie
wurden auf Gemeindeebene vorgenommen und waren nicht einheitlich standardisiert. Die
beste Ertragsklasse in einer Gemeinde wurde als Klasse 1 aufgenommen. Die einzelnen
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 13
Kategorien sind daher nicht überregional vergleichbar. Zudem ist die Ausweisung dieser
Klassen sehr großflächig und erlaubt ebenso wie die Angaben zum Boden keine
detaillierten Rückschlüsse auf kleinräumige Standortverhältnisse.
Gesamte Ertragsschätzungen im Augebiet sind nicht für einen bestimmten Zeitpunkt
möglich. Wie bereits einleitend angeführt, stellte der sogenannte Naturalertrag, der in
weiterer Folge für die Besteuerung herangezogen wurde, eine theoretische Schätzung der
Holzernte nach Erreichen der vollen Umtriebszeit dar. Daher wurde hier vor allem der
jährliche Zuwachs ausgewertet. Dieser ist für jede Katastralgemeinde und hier wiederum
pro Landnutzungstyp und Nutzungsklasse vermerkt. Nicht immer wird der Naturalertrag
für einzelne Baumarten angeführt. Mitunter werden zum Beispiel alle „Weichhölzer“ oder
überhaupt alle vorkommenden Arten zusammengefasst. Insgesamt stand für Weiden,
Pappeln, Ulmen und Erlen eine größere Anzahl an Einzelwerten zum jährlichen Zuwachs
zur Verfügung. Die Zuwächse wurden bereits im Kataster anhand der Umtriebszeit
ermittelt (Zuwachs = Naturalertrag durch Umtriebszeit). Die Angaben erfolgten in Klafter
30-zöllige Scheiter pro NÖ Joch. Unter der Annahme, dass ein Klafter 1,896 m beträgt und
ein Joch eine Fläche von 0,5755 ha aufweist, entspricht ein Klafter 30-zöllige Scheiter 2,84
m³ oder rm/Joch beziehungsweise 4,94 m³ oder rm/ha.
4.4 Vegetationsökologische Rekonstruktion
Zentrale Aufgabe der vegetationsökologischen Analysen war die Charakterisierung der
ökologischen Verhältnisse und der Artenzusammensetzung der potenziell natürlichen
Auentypen sowie deren Zuordnung zu Pflanzengesellschaften. Ebenso die Zuordnung der
historischen Auentypen zu Sukzessionsphasen und die Einschätzung deren
Sukzessionsgeschwindigkeit. Diese Einstufungen erfolgten durch Verknüpfung des
rekonstruierten Standortsalters mit den bestimmenden Standortsmerkmalen. Basierend auf
diesen Expertenregeln wurde mittels GIS eine flächendeckende Karte der Auentypen der
historischen Donau-Auen bei Wien generiert. Diese diente in weiterer Folge als Grundlage
für die Ermittlung der historischen Holzvorräte.
Als Sukzessionsphasen werden generell mehr oder weniger gut abgrenzbare Abschnitte in
der Bestandes- und Sedimententwicklung bezeichnet. Im vorliegenden Fall beziehen sich
diese auf die ungestörte Vegetationsentwicklung von Primärstandorten im Augebiet, die
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 14
nach flussmorphologischen Veränderungen entstanden sind. Die Abfolge läuft allgemein
von vegetationsfreiem Sediment (initial phase) nach dem „Heraustreten“ von vorerst
nackten Sediment über die sommerliche Mittelwasserlinie (= UVG oder Untere
Vegetationsgrenze) über Pionierphasen (pioneer phase), Folgestadien (shrub phase – early
successional woodland phase – established forest phase) bis zu Endstadien der
Auwaldentwicklung (mature phase) auf flussfernen und über mehrere Jahrhunderte
durchgehend als „Land“ ausgewiesenen Flächen (Naiman et al., 2005; Egger et al., 2013).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine von größeren Hochwässern ungestörte Entwicklung
über mehrere Jahrhunderte hinweg unter den dynamischen Verhältnissen eines montanen
Auentyps – wie bei Wien um 1825 – nur auf kleinsten Flächen möglich war.
Im ersten Schritt wurden einzelne historische Bestandsformen in Abhängigkeit vom
Ausgangssubstrat bzw. der Lage der Standorte in der Au den drei Sukzessionsserien
Auflandungs-, Anlandungs- und Verlandungsserie zugeordnet. Grundlage dafür waren
unter anderem die Auwaldtypen bzw. Standortseinheiten nach Wendelberger (1960) und
Jelem & Mader (1964a, 1964b, 1965). Daraus wurden die sogenannten „Auentypen“
(Standortstypen der Au) abgeleitet. Nicht alle für den historischen Zustand 1825 relevanten
Bestandsformen und Standorte können auf Basis der vorliegenden hydromorphologischen
Rekonstruktionen in der Modellierung abgebildet werden. Dazu folgende Anmerkungen:
• Der Sonderstandort „Grobkörnige Aufschüttung“ (an der Donau bei Wien
„Heißlände“ genannt) wurde nicht berücksichtigt; einerseits aufgrund der nur äußerst
unzureichend bekannten Zusammensetzung und Verbreitung für den
Untersuchungszeitraum, anderseits weil er sich auf Basis der zur Verfügung
stehenden Standortsdaten von der „typischen“ Auflandungsserie nicht differenzieren
lässt.
• Die Standorte der Auflandung und Anlandung ließen sich anhand der ausgewerteten
Geländedaten ebenfalls nicht unterscheiden. Sie wurden daher unter „Auentypen der
Auf- und Anlandungsserie“ zusammengefasst, wodurch zwangsweise eine
Vereinfachung des Modells in Kauf genommen werden musste.
• Die Namensgebung folgte weitestgehend Wendelberger (1960) bzw. den
Kartenlegenden der „Forstlichen Standortskarten Prater-Lobau“ (Jelem, 1974; Jelem
& Mader, 1964a, 1964b, 1965). Kleinere Abweichungen sind dadurch bedingt, dass
die Standortseinheiten in regulierten und forstlich bewirtschafteten Auen der Donau
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 15
gefasst wurden und die Baumartenkombination nur bedingt jener der historischen
Bestände entspricht.
• Die höher gelegenen Standorte (EFA mittel und EFA hoch; 1,0 – 2,5 m bzw. 2,5 –
5,0 m über sommerlichen MW) werden mit dem Präfix „Hohe ...au“ versehen. Die
Unterscheidung in „frisch“ und „trocken“ ist auf Basis der Höhe über MW ohne
weitere differenzierte Angaben zum Bodenaufbau nicht sinnvoll.
• Vor allem zwischen den Typen der „Pappelauen“ und den Hartholzauen sind längere
Übergangsphasen weit verbreitet, die in diesem Rahmen nicht näher unterschieden
und kartographisch dargestellt werden können. Trotz des gleichen Standortsalters (>
200 Jahre) lassen das tiefer liegende Gelände (VAAB „vegetated area below
bankfull“) und damit die größeren Überstauungshöhen bei HQ5 eine Unterscheidung
der Übergangsphase Hohe Pappelau/Hohe Eichen-Ulmenau von der höher
liegenden Hohen Eichen-Ulmenau sinnvoll erscheinen.
Ein weiterer Aspekt ist das seit fast 200 Jahren stark veränderte Verhältnis der
strukturbestimmenden Holzarten vor allem auf Weichholzstandorten und das massive
Eindringen von Neophyten. Unter den Holzarten sind dies vor allem invasive Arten wie
Eschenblättriger Ahorn (Acer negundo), Bastardindigo (Amorpha fruticosa) und die im vorigen
Jahrhundert großflächig gepflanzten Hybrid-Pappeln (Populus x candensis) in den
Weichholzauen, sowie Robinie (Robinia pseudacacia), Götterbaum (Ailanthus altissima),
Schwarznuss (Juglans nigra) in den Hartholzauen. Vor allem die Bedeutung von Grau-Erle
und Schwarz-Pappel hat sich in der Aulandschaft des Wiener Beckens stark zu Gunsten
von Weiß- und Grau-Pappel sowie Edel-Esche verändert (Schratt-Ehrendorfer, 2011;
Adler et al., 2003). In den heutigen Donau-Auen im Wiener Becken ebenso fast
verschwunden ist die Schwarz-Pappel, die auf grobkörnige, gut durchlüftete Böden
angewiesen ist. Auf den Hartholz-Standorten breitete sich nach der Stabilisierung großer
Teile der Au neben den oben genannten neophytischen Holzarten nicht nur die Edel-
Esche (Fraxinus excelsior), sondern auch der Berg-Ahorn (Acer pseudplatanus) großflächig aus.
Die im Zuge des Projekts ausgewiesenen historischen Auentypen der Wiener Donau-Auen
sind Rekonstruktionen und entsprechen im Wesentlichen der potenziell natürlichen
Auenvegetation der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Zeit vor den umfassenden
Donauregulierungen. Zur Rekonstruktion wurden neben Neilreich’s Flora von Wien mit
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 16
Nachträgen (Neilreich, 1846, 1870) auch dessen Flora von Niederösterreich mit
Nachträgen (Neilreich, 1859, 1866, 1869) sowie ergänzend die Beck’sche Flora von
Niederösterreich (Beck von Managetta, 1890, 1893) herangezogen.
Als wesentlichster Parameter für die Einstufung des Auentyps diente das Standortsalter
(siehe Kapitel 5.1.1). Der zweitwichtigste Faktor war die Berücksichtigung der jeweiligen
Geländezone. Da für den Zustand der Wiener Donau-Landschaft um 1825 keine genauen
historischen Vermessungen vorliegen, wurde eine vertikale Gliederung des Fluss-
Auensystems anhand von 6 morphologischen Geländezonen unterschiedlicher Höhenlage
vorgenommen (siehe Kapitel 4.2). Die resultierende Einstufung der Auentypen ist eine
Experteneinschätzung auf Basis unterschiedlichster historischer Quellen und
hydromorphologischer Rekonstruktionen. Exakte Untersuchungen bzw. Daten basierend
auf einem Langzeit-Monitoring fehlen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Leitarten der
einzelnen Sukzessionsphasen häufig bereits in der Phase davor und auch danach
vorkommen und es in der Natur sämtliche Übergänge gab.
Nähere Informationen zur vegetationsökologischen Rekonstruktion und zu den neu
definierten Auentypen sind dem Detailbericht Drescher & Egger (2013) zu entnehmen.
4.5 Forstwirtschaftliche Modellierung
Die Modellierung des Holzbestandes (Holzvorrat) und der jährlichen Zuwächse gestaltete
sich generell schwierig, da heute kaum mehr morphologisch dynamischen Donau-
Abschnitte existieren. Durch die Regulierung wurden die Auwälder an der österreichischen
Donau fast zur Gänze stabilisiert und im 20. Jahrhundert im Zuge der
Kraftwerkserrichtungen großteils abgedämmt. Wenige Abschnitte (zum Teil in
Stauwurzelbereichen, der Wachau und östlich von Wien) sind zumindest noch durch eine
hydrologische Dynamik, wie Schwankungen des Grundwasserspiegels und häufigere
Überflutungen) gekennzeichnet. Lediglich im Nationalpark Donau-Auen existieren noch
kleinere, morphologisch dynamische Standorte, die den ehemaligen Verhältnissen der
Wiener Donau um 1825 nahe kommen. Für die Modellierungen wurde daher auf
Vergleichsdaten von Auwäldern flussauf und flussab von Wien zurückgegriffen.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 17
Unterhalb Wiens handelt es sich dabei um Daten der Naturrauminventur im Nationalpark
Donau-Auen, die nach 1998/99 in den Jahren 2008/09 nochmals erhoben wurden. Diese
Datensätze sind sehr detailliert und daher gut zur Modellierung geeignet. Für dieses Gebiet
liegen sowohl eine flächendeckende Standortskartierung aus den 1950ern als auch eine
luftbildgestützte Biotopkartierung neueren Datums vor. Die Daten oberhalb von Wien
stammen aus betrieblichen Forstinventuren und konnten daher nur anonymisiert zu
Vergleichszwecken herangezogen werden. Insgesamt standen somit rund 2.700
Stichproben unterschiedlicher Qualität zur Verfügung.
Abbildung 7: Lage der für die Holzmodellierung verwendeten Sample Sites
Abbildung 7 zeigt jene Gebiete, aus denen Stichprobendaten zur Verfügung standen. Die
blauen Bereiche stehen bis heute unter intensiver forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung und
die orange-roten Flächen weisen schon längere Zeit (ca. 20 Jahre) lediglich extensive oder
gar keine Bewirtschaftung mehr auf. Der zentrale Bereich des Nationalparks unterlag in
den letzten 10 Jahren nur noch sporadischer Bewirtschaftung, wurde aber davor intensiv
bewirtschaftet.
Aufwändig war es, zu den historischen abiotischen Standorttypen (Kapitel 5.1.1, Tabelle 2)
und rekonstruierten Auentypen von Drescher & Egger (Kapitel 5.3, Tabelle 6) möglichst
vergleichbare aktuelle Sample Sites zu ermitteln. Dazu musste ein „Übersetzungsschlüssel“
Wien St. Pölten
Krems
Tullner Becken
NP Donau-Auen
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 18
zwischen der Standortseinteilung der Naturrauminventur und den von Drescher & Egger
speziell für das Projekt entwickelten Auentypen ausgearbeitet werden. Tabelle 1 zeigt das
Ergebnis dieser vergleichenden Analyse.
Tabelle 1: Gegenüberstellung der Auentypen nach Drescher & Egger (links), den Standortseinheiten nach Margl (1972) und Jelem (1974) (mitte)
und den für die Holzmodellierung zugrunde gelegten Standortseinheiten (rechts)
Auentypen Standortseinheiten Standortseinheiten Drescher & Egger Margl (1972), Jelem (1974) Eckmüllner
Purpurweidenau Purpur-Mandelweidenau Purpurweidenau Tiefe Weidenau Feuchte/Nasse Weidenau Feuchte/Nasse Weidenau Hohe Weidenau Frische Weidenau Frische Weidenau Tiefe Pappelau Feuchte Weißpappelau Feuchte Pappelau
Hohe Pappelau Schwarzpappelau, Frische Pappelau
Schwarzpappelau, Frische Pappelau, Trockene Pappelau
Tiefe Pappel-Feldulmenau Feuchte Feldulmenau Feuchte Harte Au
Hohe Eichen-Ulmenau Frische Eschen-Feldulmenau, Trockene Eichen-Feldulmenau
Frische Harte Au, Trockene Harte Au
Der nächste Schritt umfasste die Auswertung der forstlichen Stichproben nach 10jährigen
Altersstufen. Da diese Altersstufen flächenmäßig sehr ungleich verteilt waren, wurden für
die weitere Bearbeitung standardisierte Flächen berechnet, wodurch man normalisierte
Betriebsklassen erhält. Aus diesen Betriebsklassen wurden sodann je Auentyp der
Normalvorrat an Holz, der Normalzuwachs und andere forstliche Kennwerte berechnet.
Dabei wurden jeweils 15 Jahre bis zur Etablierung des jeweiligen Bestandtyps angenommen
und die Umtriebszeiten wurden der natürlichen Mortalität der relevanten Hauptbaumarten
angepasst. Unter Zuhilfenahme der Daten aus den forstbetrieblichen Inventuren wurden
eine vorratsreiche Variante (natürlich ohne Nutzung für Szenario 1) und eine vorratsarme
(bewirtschaftete) Variante berechnet (für Szenario 2). Da es sich bei der
Naturrauminventur im Nationalpark Donau-Auen um eine permanente Stichprobe handelt
bei der auch Totholz erhoben wurde, konnten auch der Totholzvorrat und dessen
Zuwachs (eigentlich zeitliche Veränderung) ausgewertet werden. Für sämtliche Kennwerte
wurden Mittelwerte basierend auf 95%-Konfidenzintervallen berechnet
(Irrtumswahrscheinlichkeit 5 %). Diese Mittelwerte wurden in weiterer Folge für
Ausarbeitung der Endergebnisse herangezogen (siehe Kapitel 5.6).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 19
4.6 Historischer Holzverbrauch
Für die Ermittlung des Holzverbrauchs der Stadt Wien um 1825 war es notwendig zu
wissen, für welche Zwecke Holz benötigt wurde und welche Bedeutung das Holz
langfristig als natürliche Ressource für eine urbane Gesellschaft hatte. In der
vorindustriellen Zeit war Brennholz der wichtigste Energieträger. Es wurde nicht nur für
die Raumheizung, sondern auch für viele Produktionsprozesse verwendet, wie z.B.
Ziegelherstellung, Metallbearbeitung, Porzellanproduktion, aber auch für Brauereien,
Bäckereien, Zuckerfabriken u.a.m. Neben der energetischen Nutzung war Holz auch ein
wichtiges Material für die Errichtung von Gebäuden und Infrastruktur, für den Bau von
Kutschen, Wagen und Schiffe, Möbel, Webstühle, Fässer und viele andere Objekte des
täglichen Lebens (Wessely, 1868; Chaloupek et al., 1991). In quantitativer Hinsicht war aber
Holz als energetische Ressource wesentlich wichtiger.
Historische Steueraufzeichnungen stellen die wichtigste Grundlage für die Ermittlung des
Wiener Holzverbrauchs dar. Eine Steuer war zu entrichten, sobald das Holz in die Stadt
gebracht wurde (Hauer, 2010). Diese Abgabe – ab 1830 als "Verzehrungssteuer"
bezeichnet – musste für die meisten Produkte bezahlt werden, die in die Stadt geliefert
wurden. Jenes Holz, das nur durch die Stadt transportiert wurde um es andernorts zu
verkaufen, wurde nicht in Steuerunterlagen angeführt. Die Zollgrenze der Stadt Wien,
welche zwischen 1760 und 1891 gleich geblieben ist, entsprach dem damaligen Linienwall
(heutiger Gürtel). Dazu kam noch die Leopoldstadt, wo bei der Donaubrücke die Steuer zu
entrichten war. Ebenso wurde Holz, das über den Donaukanal herangebracht wurde,
besteuert. Es ist jedoch nicht klar, ob das in der Stadt gewonnene Holz (in den Donau-
Auen in der Leopoldstadt) besteuert wurde oder nicht (Hauer, 2010).
Als historische Quellen dienten primär statistische Berichte und historisch-topografische
Beschreibungen (N.N., 1866; Handels- u. Gewerbekammer in Wien, 1867; Wessely, 1868,
1882). Die Literaturrecherche ergab, dass vielfältige Informationen über die Versorgung
und den Verbrauch von Holz in quantitativer und qualitativer Hinsicht verfügbar sind.
Damit war es möglich, den Verbrauch an Brennholz für den Zeitraum zwischen 1760 und
1891 genau zu rekonstruieren. Informationen bezüglich anderer Verwendungen des Holzes
sind nicht so einfach verfügbar. So musste die Menge des jährlich benötigten Bauholzes
basierend auf mehreren historischen Quellen im Detail recherchiert werden.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 20
Drei Werke stellten die Hauptgrundlage für die Quantifizierung des Holzverbrauchs in
Wien dar: Sandgruber (1987) für den Zeitraum 1760 – 1829, Hauer (2010) zwischen 1830
und 1890, sowie Krausmann (2013) für die Zeit von 1800 bis 2006. Sandgruber (1987) gibt
nicht nur Aufschluss über den Energieverbrauch in Wien vom späten 18. bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts, sondern liefert auch zusätzliche Informationen zur Verwendung von
Brennholz, Holzkohle und Kohle. Johann (2005) bietet einen Überblick über den
Holzverbrauch von Wien vom 17. bis zum 19. Jahrhundert; ebenso Informationen darüber,
woher das Holz kam, wie es nach Wien transportiert wurde, wie der Verkauf des Holzes in
der Stadt Wien organisiert und wofür es verwendet wurde.
In den Aufzeichnungen zur Verzehrungssteuer wurden „Bauholz in Bäumen“ und „kleines
Bauholz“ wie Balken, Pfosten, Pflöcke, Brunnenröhren und Rinnen erst ab 1830 und 1832
(gemessen in Laufmeter) angeführt und ab 1833 bis 1843 als Stückzahl von Baumstämmen.
Kleinholzprodukte wie Bretter, Schindeln und Laden wurden in den Jahren 1830 bis 1843
ebenso stückweise verzeichnet. Die Umrechnung dieser Mengenangaben in Raummeter
bzw. Festmeter erfolgte auf Basis von Größenangaben für verschiedene Holzarten
publiziert von Wessely (1868), Rottleuthner (1985) und Ast & Winner (2011). Die
berechneten Mengen an Bauholz wurden danach anhand des Pro-Kopf-Verbrauches
Anfang der 1830er für den Untersuchungszeitraum um 1825 extrapoliert, das heißt,
geringfügig reduziert.
All die genannten Grundlagen beziehen sich nur auf Wien innerhalb der Steuergrenze
(Linienwall/Gürtel). Es gibt aber kaum Angaben über den Holzverbrauch in den Wiener
Vororten außerhalb der Linienwalls. Eine Möglichkeit, die in den Vororten verbrauchte
Holzmenge zu ermitteln, ist die Extrapolation basierend auf dem Pro-Kopf-Verbrauch und
der Bevölkerungszahl. Dazu wurden Bevölkerungsdaten den beiden Publikationen Weigl
(2000) und MSW Magistrat der Stadt Wien (1883-1913) entnommen. Demnach lebten im
Jahr 1825 innerhalb der Steuergrenze rund 278.000 Menschen (im Mittel 283.000 zwischen
1820 und 1830), während die Wiener Vororte entsprechend den frühest verfügbaren
Bevölkerungsdaten von 1830 ca. 62.000 Personen umfassten (bezogen auf
Zivilbevölkerung ohne Militär). Eine solche Extrapolation des Holverbrauchs kann aber
nur ein Näherungswert sein. Der Holzverbrauch hängt nämlich von mehreren Faktoren ab,
unter anderem von der Struktur der gewerblichen Wirtschaft und Industrie. Unklarheit
herrscht dabei, wieviele intensiv Holz verbrauchende Produktionsstätten, wie z.B.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 21
Ziegelwerke, es außerhalb des Linienwalls im Vergleich zu innerhalb des Walls gab. Im Jahr
1757 wurde die Schließung aller Ziegelwerke in der Gegend der heutigen Bezirke IV, V und
VI durch kaiserliches Dekret verordnet. Als Folge davon wurden die Ziegelwerke
außerhalb des Linienwalls verlegt (Rohatsch, 2005). Dies ist ein Faktor, der zu einem
höheren Pro-Kopf-Verbrauch an Holz außerhalb des Linienwalls beigetragen hat.
Da sich das gegenständliche Projekt auf die Stadt Wien innerhalb der heutigen Grenzen
bezieht, wurde der Holzverbrauch außerhalb des Gürtels auf Basis der gut belegbaren
Daten innerhalb des Gürtels hochgerechnet. Dabei wurden die oben genannten
Überlegungen mitberücksichtigt. Um die historisch gut abgesicherten Werte von den
hochgerechneten Werten zu unterscheiden, wurden diese bei den Ergebnissen bezüglich
des gesamten Holzverbrauchs der Stadt Wien um 1825 gesondert ausgewiesen (Abbildung
14).
4.7 Synthese der Projektergebnisse
Der letzte Arbeitsschritt umfasste die vergleichende Analyse der sektoralen Ergebnisse der
einzelnen Fachdisziplinen entsprechend der beiden in Kapitel 4.1 dargestellten Szenarien
(Abbildung 3 und Abbildung 4). Dabei wurden dem um 1825 im Augebiet vorhandenen
Holzvorrat die jährlichen Zuwachsraten, jährlich erodierte/mobilisierte Holzvorräte und
der damalige jährliche Holzverbrauch von Wien gegenübergestellt. Es wurde ermittelt,
inwiefern ein quantitativer Ausgleich zwischen Zuwachs und Verlust bzw. Bedarf an Holz
gegeben war. Beim anthropogen modifizierten Szenario wurde zusätzlich noch die
alljährlich aus dem Augebiet entnommene Holzmenge berücksichtigt.
Sowohl die sektoralen Ergebnisse als auch die Zusammenschau der Ergebnisse (Szenarien)
dienten als Grundlage für die abschließende Diskussion aus ökologisch-
naturschutzfachlicher und bzw. forstbetriebswirtschaftlicher Sicht.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 22
5 Ergebnisse
In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse des Projekts zunächst entsprechend den
einzelnen Rekonstruktions- bzw. Modellierungsschritten je Fachdisziplin präsentiert. Die
Zusammenschau der Ergebnisse erfolgt danach in Kapitel 5.6.
5.1 Flussmorphologische Rekonstruktion
5.1.1 Abiotische Standortbedingungen
Auf Basis der rekonstruierten Zeitschnitte seit 1529 konnten neun verschiedene
Standortalter zwischen einem Jahr und mehr als 300 Jahre ausgewiesen werden. Da jedes
Standortalter in vier verschiedenen Geländezonen auftreten kann, ergaben sich in Summe
36 unterschiedliche terrestrische Standorttypen, die jeweils unterschiedliche
hydromorphologische Charakteristika aufweisen (Tabelle 2). Wie in Kartenbeilage 3
ersichtlich, befanden sich die jüngeren Austandorte (1 – 45 Jahre) sowie die Standorte
mittleren Alters (45 – 160 Jahre) direkt im bzw. sehr nah beim dynamischen Flusskorridor.
Die mit mehr als 300 Jahre ältesten Bereiche befanden sich großteils nördlich der Donau,
auf der Simmeringer Haide, in der Leopoldstadt und im Prater. Wie alt diese Bereiche
genau sind, kann aufgrund der historischen Quellen nicht festgelegt werden. Betrachtet
man die Verteilung des Standortalters im Augebiet, so ist zu erkennen, dass um 1825 ca. 25
% der Flächen jünger als 50 Jahre alt waren (Abbildung 8).
Knapp 50 % des Augeländes waren zwischen einem und rund 300 Jahre alt (=
Medianalter), wobei das gewichtete Mittel knapp über 300 Jahre lag. Das mittlere Alter wird
stark vom Alter der ältesten Geländeteile beeinflusst, welches jedoch nicht genauer
ermittelt werden konnte. Die Simmeringer Haide und die Bereiche weit nördlich der
Donau (Leopoldau, Kagran, Hirschstetten) sind vermutlich älter als der Prater (die zeitliche
Stellung der Leopoldstadt ist unklar). Als Näherungswert wurde daher für die älteste
Altersklasse ein mittleres Alter von 500 Jahren im Jahr 1825 angenommen, wobei große
Teile davon vermutlich einiges älter waren, einige auch jünger. Durch diese Unsicherheit
wurde die Modellierung der Vegetationsgesellschaften und des Holzvorrates nicht tangiert,
da bei über 300 Jahren dieselbe Vegetation bzw. Produktivität angenommen wurde.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 23
Tabelle 2: Übersicht über die rekonstruierten Standorttypen und -faktoren für die Wiener Donau-Auen um 1825
Stan
dort
-m
ittl.
Fein
sed.
-mor
phol
.Fl
urab
stan
dFl
urab
stan
dFl
urab
stan
dm
ittle
re Ü
ber-
mitt
lere
Dau
erm
ittle
re Ü
ber-
mitt
lere
Dau
erTy
pLa
nd w
ar zu
-m
in. A
lter
max
. Alte
rm
ittl.
Alte
rAl
ters
klas
sen
aufla
ge1
Gelä
nde-
bei M
JNW
2be
i SM
W3
bei S
MW
3st
auun
gshö
heHW
1st
auun
gshö
heHW
5Co
dele
tzt W
asse
r in:
neue
s Lan
d:ne
ues L
and:
neue
s Lan
d:(J
ahre
ger
unde
t)(m
ger
unde
t)zo
nen
(m)
(m)
Mitt
el (m
)be
i HW
1 (m
)(c
a. T
age/
Jahr
)be
i HW
5 (m
)(c
a. T
age/
5 Ja
hre)
>300
tief
A7
VABB
-A4
1,7
- 3,2
*0
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
>300
tief
V7
VABB
-V4
1,3
- 3,2
*0
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
>300
mitt
elEF
A52,
7 - 4
,21,
0 - 2
,52,
00
- 0,5
0 - 4
0,3
- 1,8
5 - 8
>300
hoc
hEF
A ho
ch6
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
250-
300
tief A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
250-
300
tief V
VABB
-V1,
3 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
250-
300
mitt
elEF
A2,
7 - 4
,21,
0 - 2
,51,
90
- 0,5
0 - 4
0,3
- 1,8
5 - 8
250-
300
hoch
EFA
hoch
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
200-
250
tief A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
200-
250
tief V
VABB
-V1,
3 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
200-
250
mitt
elEF
A2,
7 - 4
,21,
0 - 2
,51,
80
- 0,5
0 - 4
0,3
- 1,8
5 - 8
200-
250
hoch
EFA
hoch
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
160-
200
tief A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
160-
200
tief V
VABB
-V1,
3 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
160-
200
mitt
elEF
A2,
7 - 4
,21,
0 - 2
,51,
70
- 0,5
0 - 4
0,3
- 1,8
5 - 8
160-
200
hoch
EFA
hoch
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
100-
160
tief A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
100-
160
tief V
VABB
-V1,
3 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
100-
160
mitt
elEF
A2,
7 - 4
,21,
0 - 2
,51,
60
- 0,5
0 - 4
0,3
- 1,8
5 - 8
100-
160
hoch
EFA
hoch
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
45-1
00 ti
ef A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
45-1
00 ti
ef V
VABB
-V1,
3 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
45-1
00 m
ittel
EFA
2,7
- 4,2
1,0
- 2,5
1,4
0 - 0
,50
- 40,
3 - 1
,85
- 845
-100
hoc
hEF
A ho
ch4,
2 - 6
,72,
5 - 5
,0-
00
0 - 0
,50
- 520
-45
tief A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
20-4
5 tie
f VVA
BB-V
1,3
- 3,2
0 - 1
,5-
0 - 1
,54
- 81,
3 - 3
,25
- 820
-45
mitt
elEF
A2,
7 - 4
,21,
0 - 2
,51,
30
- 0,5
0 -4
0,3
- 1,8
5 - 8
20-4
5 ho
chEF
A ho
ch4,
2 - 6
,72,
5 - 5
,0-
00
0 - 0
,50
- 58-
20 ti
ef A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
8-20
tief
VVA
BB-V
1,3
- 3,2
0 - 1
,5-
0 - 1
,54
- 81,
3 - 3
,25
- 88-
20 m
ittel
EFA
2,7
- 4,2
1,0
- 2,5
1,3
0 - 0
,50
- 40,
3 - 1
,85
- 88-
20 h
och
EFA
hoch
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
1-8
tief A
VABB
-A1,
7 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
1-8
tief V
VABB
-V1,
3 - 3
,20
- 1,5
-0
- 1,5
4 - 8
1,3
- 3,2
5 - 8
1-8
mitt
elEF
A2,
7 - 4
,21,
0 - 2
,51,
20
- 0,5
0 - 4
0,3
- 1,8
5 - 8
1-8
hoch
EFA
hoch
4,2
- 6,7
2,5
- 5,0
-0
00
- 0,5
0 - 5
Scho
tter
11
11
0,0
Scho
tter
0 - 1
,70
01,
5 - 3
,24
- 82,
8 - 4
,55
- 8W
asse
r0
00
00,
0W
asse
r-
--
--
--
1 abh
ängi
g vo
m S
tand
orta
lter;
2 MJN
W =
mitt
lere
s jä
hrlic
hes
Nied
erw
asse
r; 3 S
MW
= s
omm
erlic
hes
Mitt
elw
asse
r = M
ittel
was
ser +
30/
40 c
m (=
mitt
lere
Veg
etat
ions
gren
ze)
4 VAB
B =
vege
tate
d ar
ea b
elow
ban
kful
l (tie
flieg
ende
Flä
chen
mit
meh
rjähr
iger
Veg
etat
ion,
Ufe
rzon
en, j
unge
Wei
denf
läch
en, k
lein
e In
seln
, Grä
ben
und
Senk
en im
Aug
ebie
t)5 E
FA =
ele
vate
d flo
odpl
ain
area
s (h
öher
lieg
ende
Flä
chen
des
Aug
ebie
tes,
Hau
ptni
veau
des
Aug
elän
des)
6 EFA
hoc
h =
beso
nder
s ho
he B
erei
che
des
Auge
biet
es, z
umei
st ä
ltest
e Be
reic
he w
ie a
uf S
imm
erin
ger H
aide
und
Leo
pold
stad
t, er
st ü
ber H
W5 ü
berfl
utet
; 7 A =
An-
/Auf
land
ungs
typ,
V =
Ver
land
ungs
typ
* un
ters
chie
dlic
he F
lura
bstä
nde:
Veg
etat
ions
gren
ze b
eim
dyn
amis
cher
en V
ABB-
Anla
ndun
gsty
p be
i SM
W (1
,7 m
ü. N
ull)
und
beim
sta
gnie
rend
en V
erla
ndun
gsty
p be
i MW
(1,3
m ü
. Nul
l)
0,6
- 1,6
0 - 0
,6
2,6
- 2,8
2,4
- 2,6
2,3
- 2,4
2,1
- 2,3
1,9
- 2,1
1,6
- 1,9
45 20
11
- 84,
58
2,8
- 2,9
296
255
193
250
- 300
200
- 250
178
160
- 200
> 27
6
276
9910
0 - 1
60
1817
131
7245
45 -
100
162
99
2020
- 45
33
1805
88
- 20
14
1825
Stan
dort
alte
r bez
ogen
auf
182
5
älte
r
1529
1570
1632
1663
> 25
5>
300
162
1726
1780
> 29
6
255
193
224
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 24
Abbildung 8: Verteilung des Standortalters im engeren Untersuchungsgebiet im Jahr 1825 (grün: gesamtes Augebiet, blau: zwischen 1817 und 1825 erodierte Flächen; die markierten
Datenpunkte stellen die Mittelwerte der zugrunde liegenden Altersklassen dar)
Die Verteilung der Flurabstände beim mittleren jährlichen Niederwasserstand
(MJNW) hängt eng mit der jeweiligen Geländezone zusammen (siehe Tabelle 2 und
Kartenbeilage 4). Tief liegende Vegetationsflächen (VABB) wiesen generell Flurabstände
zwischen 1,3 m und 3,2 m auf. Bei den dynamischeren An- und Auflandungsbereichen
(VABB-A) lag die Grenze der mehrjährigen Vegetation aufgrund der häufigeren
Spiegelschwankungen und Störungen mit 1,7 m über Null (MJNW) etwas höher als in den
Verlandungsbereichen mit 1,3 m über Null (VABB-V). Dementsprechend variieren diese
beiden Geländezonen geringfügig bezüglich der Flurabstandsklassen. Die Flurabstände der
Hauptniveauflächen des Augebietes (EFA mittel) betrugen bei MJNW um 1825 zumeist
zwischen 2,7 m und 4,2 m. Die höchsten Flächen des Augebietes (EFA hoch) wiesen
typischerweise Flurabstände von 4,2 m bis 6,7 m auf. Die näherungsweise Verteilung der
Flurabstände ist Abbildung 9 zu entnehmen (basierend auf Klassenmittelwerten). Bei
MJNW fielen 27 % der Standorte in die beiden untersten Klassen mit Flurabständen bis 2,7
m und ca. 50 % der Flächen waren durch Flurabstände kleiner als 3 m gekennzeichnet (=
Medianwert; gewichtetes Mittel = 3,4 m).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 25
Abbildung 9: Verteilung der Flurabstände beim mittleren jährlichen Niederwasser (MJNW) und beim
sommerlichen Mittelwasser (SMW) im engeren Untersuchungsgebiet um 1825 (die markierten Datenpunkte stellen die Mittelwerte der zugrunde liegenden Flurabstandsklassen dar)
Für den sommerlichen Mittelwasserstand (SMW) ergibt sich ein analoges Bild. Da bei
SMW der Wasserspiegel im Mittel um 1,7 m höher lag als bei MJNW, verringerten sich
dementsprechend die Flurabstände. Bei SMW wurden bereits einige Bereiche der
Verlandungszonen (VABB-V) überstaut, weshalb sich die unterste Flurabstandsklasse nach
oben verschiebt (Abbildung 9).
Für die Entwicklung der Auenvegetation ist nicht nur die Anbindung an Grundwasser von
Relevanz, sondern auch die Höhe und Dauer der Überstauung bei häufig
wiederkehrenden Hochwässern. Im Zuge des Projekts wurden daher die entsprechenden
Kennwerte für 1-jährliche Hochwässer und 5-jährliche Hochwässer rekonstruiert. Das
1-jährliche Hochwasser (HW1) ist an der unregulierten österreichischen Donau ungefähr
mit dem bordvollen Wasserstand gleichzusetzen – jener Wasserführung bei der die
Böschungsoberkanten im Mittel gerade noch nicht überflutet wurde (Hohensinner et al.,
2011, 2013a). Bei HW1 wurden generell nur die tiefer liegenden Vegetationsflächen im
Augebiet (VABB-A, VABB-B) überflutet. Die höher liegenden Flächen (EFA mittel) waren
davon nur teilweise oder gar nicht (EFA hoch) betroffen. Die Überstauungshöhe in den
tief liegenden Bereichen lag generell zwischen 0 und 1,5 m, wobei die Dauer der
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 26
Überstauung im Mittel vermutlich 4 bis 8 Tage betrug. Höher liegenden Bereiche (EFA
mittel) waren bei HW1 großteils nicht oder nur geringfügig überflutet (max. 0,5 m ?).
Bei HW5 wurden hingegen auch die höheren Bereiche des Augebietes überflutet. Die
höchsten Bereiche (EFA hoch) wurden großteils aber noch nicht vom Hochwasser erreicht
(siehe Kartenbeilage 5). Während die tiefer liegenden Vegetationsflächen (VABB) mit 1,3 –
3,2 m vergleichsweise große Überflutungshöhen aufwiesen, waren diese bei den höher
liegenden Hauptniveauflächen des Augebietes (EFA mittel) mit 0,3 – 1,8 m wesentlich
geringer. Die Dauer der Überstauung betrug bei den VABB vermutlich 5 – 8 Tage je
Hochwasserereignis; bei den EFA war sie im Mittel mit maximal 5 Tagen etwas kürzer.
Die rekonstruierten Feinsedimentauflagen (Schluffüberdeckung) deuten darauf hin,
dass die Überlagerung des Schotter-/Sandhorizontes zu Beginn des Ablagerungszeitraumes
sehr rasch vor sich ging (siehe Spalte „mittlere Feinsedimentauflage“ in Tabelle 2). So
lagerten sich bei einem einzigen Hochwasser stellenweise bereits einige Dezimeter Schluff
ab. Vor allem die auf offenen Schotterflächen neu aufwachsenden Gehölze (Weiden und
Tamarisken) beschleunigten die Ablagerung von Schluff indem sie die Fließgeschwindigkeit
lokal signifikant reduzierten. Während in den ersten 20 Jahren jährliche Ablagerungsraten
von rund 10 cm erreicht wurden, verringerten sich diese über längere Zeiträume hinweg
erheblich (siehe Abbildung 6 in Kapitel 4.2). Über 100 Jahre alte Standorte zeigten nur
mehr sehr geringe Auflandungen durch Feinsedimente. Durch die anfänglichen
Schluffablagerungen erhöhte sich sehr rasch das Niveau des Augeländes. Mit
zunehmendem Ablagerungsniveau wurde das ältere Augelände immer seltener von
Hochwässern erreicht, wodurch die Ablagerung nur mehr bei besonderen
Katastrophenhochwässern erfolgen konnte.
Jüngere, bis zu 20 Jahre alte Standorte wurden im Mittel von bis zu 1,6 m mächtige
Schluffhorizonten überlagert (Kartenbeilage 6). Standorte mit einem Alter von 20 bis 100
Jahre wiesen in Mittel Schlufflagen von 1,6 m bis 2,1 m auf und die noch älteren Standorte
(> 100 Jahre) kamen auf bis zu 3 m Mächtigkeit. Es versteht sich von selbst, dass es sich
hierbei um generalisierte Mittelwerte handelt. Lokal, wie z.B. in Gräben oder bei
besonderen Strömungsverhältnissen, konnten in kürzeren Zeiträumen auch 4 m mächtige
Feinsedimentauflagen entstehen.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 27
5.1.2 Flussdynamik
Abbildung 10 auf der nächsten Seite stellt die Umlagerungsvorgänge bezogen auf die
Landfläche im engeren Untersuchungsgebiet dar. Daraus ist ersichtlich, wieviel Prozent des
Augeländes (VABB und EFA) im jeweiligen Zeitraum jährlich erodiert oder neu angelandet
wurden. So wurden im Zeitraum vor Beginn der verstärkten Regulierung (1663 – 1825)
jährlich im Mittel 0,42 % des Augeländes vom Fluss abgetragen. Die Anlandungen
machten mit 0,42 % des Augeländes durchschnittlich ebenso viel aus. Dies bedeutet, dass
langfristig alljährlich auf rund 25 ha neue Lebensräume für die Pioniervegetation
entstanden sind. Der anthropogen bedingte Rückgang der Erosion nach 1825 ist klar
ersichtlich. Möglicherweise ist die leicht verminderte Erosion zwischen 1817 und 1825
teilweise menschlich verursacht, das heißt, auf lokale Regulierungsmaßnahmen
zurückzuführen (z.B. am Donaukanal). Daher wurden für die Berechnung des durch
Erosion mobilisierten Holzvorrates nicht nur die Erosionsraten von 1817 – 1825
herangezogen, sondern auch die höheren Werte zwischen 1805 und 1817. Die jährlichen
Erosionsraten sind für verschiedene Zeiträume und für unterschiedliche räumliche Bezüge
in Tabelle 3 zusammengefasst. Demnach wurden jährlich zwischen 24 und 34 ha an
Landflächen erodiert. Dies entspricht rund 2,1 – 2,9 ha pro km Tallänge (heute ca. je km
reguliertem Donaulauf). Oder anders ausgedrückt: je km² Landfläche (Augelände) wurden
damals zwischen 0,40 und 0,56 ha an potenziellen Waldflächen erodiert.
Tabelle 3: Jährliche Erosionsraten im engeren Untersuchungsgebiet 1780 – 1849 (ha)
Erosionsraten Landflächen pro Jahr 1780‐ 1805‐ 1817‐ 1825‐
1805 1817 1825 1849
Fläche erodiert gesamt (ha) 25,8 33,8 24,2 20,2
pro km Talachsenlänge (ha) 2,19 2,87 2,06 1,72
pro km² Fluss‐/Auenzone (ha) 0,34 0,44 0,31 0,26
pro km² Augelände (ha) 0,43 0,56 0,40 0,33
pro km² Waldfläche (ha)* ‐ ‐ 1,04 ‐
Erosionsraten Verhältnis zu 1817 – 1825 1,07 1,40 1,00 0,84
* bezogen auf tatsächlich vorhandene Waldflächen 1817 – 1825
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 28
Abbildung 10: Jährliche Umlagerungsraten bezogen auf die Landfläche im engeren Untersuchungsgebiet; grün: Anlandungen blau: Erosion punktierte horizontale Linien 1663–1780: tatsächliche Messwerte, die auf Basis der detaillierten Analysen 1780–1825 korrigiert wurden Verhältniswerte: Verhältnis zwischen Anlandung und Erosion (basierend auf Lager 2012, ergänzt von Schuller, in prep.)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 29
Bei der separaten Analyse der tatsächliche Wald-/Landnutzung um 1825 (Szenario 2)
wurde zudem unterschieden, ob es sich bei der betreffenden erodierten Fläche um einen
Waldbestand oder um eine anderweitig genutzte Landfläche gehandelt hat (vgl.
Kartenbeilage 7).
Die Auswertungen der erodierten Auenstandorte lieferten auch Hinweise zu deren
Altersverteilung im Vergleich zur Altersstruktur des gesamten Augebietes. Wie in
Abbildung 8 zu sehen, waren 70 % der zwischen 1817 und 1825 erodierten Flächen jünger
als 50 Jahre und somit wesentlich jünger als das gesamte Augebiet. Das Medianalter (50 %)
der erodierten Standorte betrug um 1825 nur 20 Jahre und das gewichtete Mittel nur 85
Jahre. Daraus geht hervor, dass die Flussdynamik Anfang des 19. Jahrhunderts primär im
jüngeren Alluvium der Donau angesiedelt war, während ältere Standorte nur wenig davon
betroffen waren.
5.2 Historische Land-/Waldnutzung
Innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes waren lediglich rund 30 % der Fläche
Auwald. Fast 50 % der Fläche wurde landwirtschaftlich genutzt, wobei sich die Äcker vor
allem am nördlich gelegenen linken Donauufer im Anschluss an alte und neuere Siedlungen
wie Floridsdorf, Kagran, Hirschstetten, Stadlau oder Aspern befanden. Über ein Viertel der
Flächen waren Wiesen, Weiden, Obst- oder Gemüsegärten und in einem geringen Ausmaß
auch Weingärten, die an den Rändern des Projektgebietes nahe des heutigen 19. Bezirkes
lagen. Gebäude und Flächen höherwertiger Nutzung (z.B. Militäranlagen, Friedhöfe, Parks)
machten ca. 3 % aus (Tabelle 4).
Tabelle 4: Landnutzungen und Flächenverteilung im engeren Untersuchungsgebiet 1825 – 1830
Landnutzungstyp ha %
Äcker 1.593 21,1 Wiesen, Weiden, Weingärten, Obst- Gemüsegärten
2.014 26,7
Gebäude, höherwertige Nutzungen 237 3,1
Gewässer 1.413 18,7
Sonstige 35 0,5
Wälder (inkl. potenzielle Waldstandorte) 2.249 29,8
Gesamt 7.541 100,0
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 30
Landflächen nahmen um 1825 im engeren Untersuchungsgebiet rund 6.129 ha ein. Davon
waren tatsächlich noch 2.046 ha oder rund 33 % an Waldflächen übrig (ohne
Berücksichtigung von Sedimentflächen als potenzielle Waldstandorte; siehe Kartenbeilage
1). Die Kontrolle anhand der Parzellenprotokolle führte zu einigen Änderungen in der
Klassifizierung und Abgrenzung der Parzellen, sodass die tatsächlich ausgewerteten
Auwaldflächen im engeren Untersuchungsgebiet schließlich 2.310 ha betrugen anstatt der
2.249 ha im Kataster ausgewiesenen Waldflächen. In diesen Werten sind auch angrenzende
Sedimentflächen an den Gewässerufern als potenzielle Waldstandorte inkludiert, wodurch
sich eine etwas größere Fläche als die oben genannten 2.046 ha ergab. Die angrenzenden
Sedimentflächen wurden in die Berechnung und Überprüfung anhand der
Parzellenprotokolle inkludiert, da aufgrund des Zeitabstands zwischen Vermessung der
Mappenblätter und Endausfertigung der Parzellenprotokolle mehrere Jahre lagen, in denen
entweder bereits Waldstandorte entstanden sind oder durch die Dynamik der Donau
wieder erodiert wurden. Es sie hier darauf hingewiesen, dass solche Ereignisse tatsächlich
mehrfach stattfanden, da das große Donauhochwasser von 1830 zwischen den beiden
Aufnahmeperioden lag.
Als Waldnutzungsklassen wurden „Auwälder“ und „Niederwälder“ ausgewiesen. Einige
Flächen waren als gemischte Nutzung in Form von Hutweiden mit vereinzeltem
Waldbestand angeführt. Grundsätzlich ist anzumerken, dass bei der Unterscheidung der
Waldnutzungstypen „Auwald“ und „Niederwald“ keine plausible Differenzierung gefunden
werden konnte (Anmerkungen dazu siehe Kapitel Methodik 4.3).
Als dominierende Baumarten wurden Weiden (auch als Felbern angeführt), Pappeln,
Espen (auch Aspe oder Zitterpappel), Erlen, Eschen, Ulmen und Ahorn angegeben.
Teilweise wurden einzelne Arten unterschieden, wie Schwarz- oder Silber-Pappel oder
Weiß-Erle. Diese Angaben sind aber nicht überall vorhanden, sodass die Auswertungen auf
der Ebene von Gattungen durchgeführt werden musste. Neben den dominierenden
Baumarten finden sich zusätzlich Weiß-Buchen, Eichen aber auch Apfel- und Birnbäume
unter den Gehölzen der Auwälder. Wurden zwei oder mehrere dominierende Baumarten
genannt, so zeigen diese gemeinsamen Vorkommen oft keinen Zusammenhang mit
natürlichen Auwald-Gesellschaften. Das ist zum Beispiel in Leopoldstadt der Fall, wo im
Bereich nördlich des heutigen Pratersterns und sogar auf nahe gelegenen Inseln Pappeln
und Ulmen als vorherrschend angeführt wurden. Möglicherweise handelte es sich hierbei
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 31
um die Flatter-Ulme. Im heutigen Prater werden Ulmen als einzig dominierende Baumart
angeführt. Eventuell verblieben in diesem bereits um 1825 für Erholungszwecken
genutzten Gebiet einzelne Ulmen als Überhälter, während andere Gehölze entfernt oder
reduziert wurden.
Die Umtriebszeiten lagen in den einzelnen Gemeinden und Nutzungsklassen für Pappeln
und Weiden zwischen 30 und 40 Jahren, bei Erlen und Ahorn zwischen 20 und 24 Jahren
und bei den Ulmen bei 30 bis 80 Jahren.
Verschiedene Kennwerte des jährlichen Holzzuwachses sind in Tabelle 5 angeführt. Die
Mittelwerte lagen für Pappeln z.B. bei 13 rm/ha (9,1 fm), bei Weiden und Ulmen bei ca.
7,5 rm/ha (5,3 fm). Es liegen allerdings große Schwankungsbreiten vor, die sich
wahrscheinlich durch den unterschiedlichen Zustand der Wälder ergaben (siehe unten). Die
Maximalwerte für Pappeln lagen z.B. bei 17,5 rm/ha (12,3 fm) und bei Erlen bei 18,7
rm/ha (13,1 fm). Insgesamt scheinen zumindest die Mittelwerte relativ niedrig (vgl.
modellierte Zuwachsraten in Kapitel 5.4), die Relation zwischen den einzelnen Arten ist
allerdings aus forstwirtschaftlicher Sicht plausibel.
Tabelle 5: Jährliche Zuwachsraten für Hauptbaumarten basierend auf dem Kataster (Festmeter)
Pappel Weide Ulme Erle Ahorn Weichholz Hartholz alle Minimum 6,7 1,7 3,5 3,5 4,6 3,1 6,5 3,3 Median 8,6 4,5 5,6 4,6 4,6 6,5 6,5 5,0 Mittelwert 9,1 5,5 5,3 6,3 4,6 5,7 6,5 6,0 Maximum 12,3 10,1 6,9 13,1 4,6 6,5 6,5 10,1 Anzahl Werte 6 5 7 9 1 4 1 8
Ermittelt man nun den jährlichen Gesamtzuwachs aller Auwaldflächen auf Basis des
jährlichen Zuwachses/ha für die angeführten Baumarten in einer Nutzungsklasse und der
Fläche einer Nutzungsklasse in einer Gemeinde, so ergeben sich für das engere
Untersuchungsgebiet 17.270 rm. Dies entspricht bei einem Umrechnungsfaktor von 0,7
insgesamt rund 12.090 fm. Da davon auszugehen ist, dass nur größere Stämme nach
Erreichen der Umtriebszeit berücksichtigt wurden, kann dieser Wert als Vorratsfestmeter
Derbholz (VfmD = Holz mit Durchmesser > 7 cm) angesehen werden. Für einen
Vergleich mit den modellierten Werten ist zudem noch zu berücksichtigen, dass der hier
berechnete Wert einen sogenannten „Haubarkeitsdurchschnittszuwachs“ darstellt, der je
nach Durchforstung und Waldzustand um 25 – 50 % unter dem durchschnittlichen
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 32
Gesamtzuwachs lag. Tatsächlich ist daher von 15.110 – 18.140 VfmD/Jahr
durchschnittlichem Gesamtzuwachs auszugehen. Rechnet man noch einen Anteil von 15
% an stärkerem Astholz (5 – 7 cm Durchmesser) dazu, ergibt sich ein Haubarkeits-
durchschnittszuwachs von 13.900 fm und ein durchschnittlicher Gesamtzuwachs
zwischen 17.380 – 20.860 fm pro Jahr.
In Hinblick auf den Waldzustand wird für einige Nutzungsklassen angeführt, dass die
Wälder stark ausgelichtet waren und zudem Jagd- bzw. Wildschäden zu verzeichnen waren.
Letzteres traf vor allem auf die Auwälder der 1. Klassen in der Katastralgemeinde Aspern
zu, weiters auf jene der 1. und 3. Klasse in der Leopoldstadt.
Bei einem angenommenen Gesamtjahresverbrauch der Stadt Wien von ca. 900.000 fm um
1825 deckte der Zuwachs der Auwälder somit nur 1,9 – 2,3 % des Bedarfes ab. Es ist aber
auf Basis der verfügbaren historischen Quellen nicht zu eruieren, welche Holzmengen für
die Stadt Wien tatsächlich aus den noch verbliebenen Donau-Auwäldern entnommen
wurden. Bei den Nutzungen ist angeführt, dass im Augebiet hauptsächlich Brennholz
gewonnen wurde. Darüber hinaus wurde Holz aber auch für den Wasserbau (Faschinen)
verwendet. Einzelne Ulmen wurden gewerblich genutzt. Holz wurde schließlich aber auch
an Wagner verkauft oder für die Herstellung von „Korken“ für Holzfässer verwendet.
5.3 Vegetationsökologische Rekonstruktion
Im Folgenden wird auf Basis der für das Untersuchungsgebiet flächendeckend
vorliegenden Informationen zu den Standortbedingungen (Kapitel 5.1.1) eine Zuordnung
zu den jeweiligen Auentypen der Wiener Donau-Auen um 1825 vorgenommen (Tabelle 6).
Neben der Verlandungsserie müssen die Sukzessionsphasen der An- und Auflandungsserie
zusammengefasst behandelt werden, da eine getrennte Darstellung auf Basis der
vorliegenden Standortsinformationen nicht möglich ist.
Die nähere Beschreibung der Auentypen anhand der Leitarten der Baum- und
Strauchschicht sowie die Gegenüberstellung mit den Pflanzengesellschaften der An-
/Auflandungsserie nach Willner & Grabherr (2007) ist in Tabelle 7 ersichtlich. Analog dazu
charakterisiert Tabelle 8 die Auentypen der Verlandungsserie.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 33
Tabelle 6: Primäre Standortfaktoren und Festlegung der Auentypen der Wiener Donau-Auen vor Beginn der Regulierung für die An-/Auflandungsserie und die Verlandungsserie
Standort- typ Code
Land war zuletzt
Wasser in:
Altersklasse (Jahre
gerundet)
Gelände- zone
Flurabstand bei SMW
(m)
An-/Auflandung Auentyp
Verlandung Auentyp
>300 tief
älter > 300
VABB 0 - 1,5 Hohe Pappelau/ Hohe Eichen-Ulmenau Tiefe Pappel-Feldulmenau
>300 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Hohe Eichen-Ulmenau
>300 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Eichen-Ulmenau
250-300 tief
1529 250 - 300
VABB 0 - 1,5 Hohe Pappelau/ Hohe Eichen-Ulmenau Tiefe Pappel-Feldulmenau
250-300 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Hohe Eichen-Ulmenau
250-300 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Eichen-Ulmenau
200-250 tief
1570 200 - 250
VABB 0 - 1,5 Hohe Pappelau/ Hohe Eichen-Ulmenau Tiefe Pappel-Feldulmenau
200-250 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Hohe Eichen-Ulmenau
200-250 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Eichen-Ulmenau
160-200 tief
1632 160 - 200
VABB 0 - 1,5 Hohe Pappelau Tiefe Pappelau
160-200 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Hohe Pappelau
160-200 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Pappelau
100-160 tief
1663 100 - 160
VABB 0 - 1,5 Hohe Pappelau Tiefe Pappelau
100-160 mittel EFA 1,0 - 2,5 Hohe Pappelau
100-160 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Pappelau
45-100 tief
1726 45 - 100
VABB 0 - 1,5 Hohe Weidenau Tiefe Weidenau
45-100 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Hohe Weidenau
45-100 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Weidenau
20-45 tief
1780 20 - 45
VABB 0 - 1,5 Hohe Weidenau Röhricht
20-45 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Hohe Weidenau
20-45 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Hohe Weidenau
8-20 tief
1805 8 - 20
VABB 0 - 1,5 Purpurweidenau Röhricht
8-20 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Purpurweidenau
8-20 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Purpurweidenau
1-8 tief
1817 1 - 8
VABB 0 - 1,5 Straußgras-Pionierrasen Röhricht
1-8 mittel EFA mittel 1,0 - 2,5 Purpurweidenau
1-8 hoch EFA hoch 2,5 - 5,0 Purpurweidenau
-
1825 0
(Wasser + Schotter)
- - < MJNW = Gewässer < MJNW = Gewässer
- - - > MJNW = vegetationslose
- - - Schotter-/Sandbänke
Abkürzungen/Legende: MJNW = mittleres jährliches Niederwasser, SMW = sommerliches Mittelwasser = MW + 30/40 cm (= mittlere Vegetationsgrenze) VABB = vegetated area below bankfull (tief liegende Flächen mit mehrjähriger Vegetation, Uferzonen, junge Weidenflächen, kleine Inseln, Gräben und Senken im Augebiet) EFA mittel = elevated floodplain areas (höher liegende Flächen des Augebietes, Hauptniveau des Augeländes) EFA hoch = besonders hohe Bereiche des Augebietes, zumeist älteste Bereiche wie auf Simmeringer Haide und Leopoldstadt, erst über HW5 überflutet
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 34
Tabelle 7: Auentypen der Wiener Donau-Auen vor Regulierung, Pflanzengesellschaften der An- und Auflandungsserie und Leitarten der Baum- und Strauchschicht (Pflanzennamen nach Fischer et al., 2008).
Auentypen der Wiener Donau-Auen (Drescher & Egger)
Pflanzengesellschaft (nach Willner & Grabherr 2007)
Leitarten (LA) der Baum-und Strauchschicht (fett = dominant; Strauchschicht nur wenn
Diff.-Art)
Typische und Trockene Hainbuchenau
Fraxino-Ulmetum caricetosum albae
Ulmus minor (histor.), Acer campestre, Populus alba, Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, (Pyrus pyraster, Juglans regia, Cornus
mas, Berberis vulgaris)
Hohe Eichen-Ulmenau Fraxino-Ulmetum typicum Populus nigra, Acer campestre, Ulmus laevis, (Alnus incana, Fraxinus excelsior)
Hohe Pappelau Fraxino-Populetum typicum Populus nigra, Alnus incana, Populus alba, Ulmus laevis, Salix alba, (S. purpurea, )
Hohe Weidenau Salicetum albae cornetosum Salix alba, (S. purpurea, Populus nigra, Ulmus laevis, Cornus sanguinea)
Purpurweidenau Salicetum purpureae Salix purpurea, Salix eleagnos, Myricaria germanica (histor.)
Straußgras-Pionierrasen "Straußgrasstadium", Echio-
Melilotetum?, Bidention-Gesellschaften
Agrostis alba, Phalaris arundinacea, Deschampsia cespitosa, Daucus carota, Melilotus albus, Hieracium pilosella Myricaria germanica (histor.) u.a. (alle über
Kies bzw. Grobsand); Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, P. mitis, Bidens tripartita, Chenopodium glaucum, u.a. (über schluffig-feinsandigem Sediment)
(für die nähere Beschreibung der Auentypen siehe Detailbericht Drescher & Egger 2013)
Tabelle 8: Auentypen der Wiener Donau-Auen vor Regulierung, Pflanzengesellschaften der Verlandungsserie und Leitarten der Baum- und Strauchschicht (Pflanzennamen nach Fischer et al., 2008).
Auentypen der Wiener Donau-Auen (Drescher & Egger)
Pflanzengesellschaft (nach Willner & Grabherr 2007)
Leitarten (LA) der Baum-und Strauchschicht (fett = dominant; Strauchschicht nur wenn
Diff.-Art)
Feuchte Hainbuchenau Fraxino-Ulmetum phalaridetosum (prov.)
Ulmus minor (histor.), Acer campestre, Populus alba, Quercus robur, Fraxinus excelsior, (Carpinus
betulus),
Tiefe Pappel-Feldulmenau Fraxino-Populetum typicum Populus alba, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Viburnum opulus
Tiefe Pappelau Fraxino-Populetum phalaridetosum prov. Populus alba (Salix alba × fragilis, S. fragilis)
Tiefe Weidenau Salicetum albae phalaridetosum Salix alba
"Lückiger Weidenbusch" ?? Salix alba, Populus alba
Röhricht Phragmitetum vulgaris,
Scirpetum lacustris, Glycerietum aquaticae
Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Glyceria aquatica
Bültenseggenbestand Caricetum elatae Carex elata
Schwimmblattgesellschaften Nymphaetum albo-luteae Nuphar lutea
(für die nähere Beschreibung der Auentypen siehe Detailbericht Drescher & Egger 2013)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 35
Die Auswertungen lassen den Schluss zu, dass die Hainbuchenauen als Endgesellschaft
(mature phase) im Untersuchungsgebiet wahrscheinlich – mit Ausnahme kleinflächiger
Relikte – kaum vorgekommen sind (Tabelle 8). Es ist davon auszugehen, dass diese sehr
reifen Standorte bereits damals durchwegs gerodet waren und landwirtschaftlich genutzt
wurden und damit in den Karten nicht mehr als Auwald ausgewiesen wurden.
Kartenbeilage 8 zeigt die daraus resultierende flächige Verteilung der potenziell natürlichen
Auentypen im Projektgebiet um 1825. Klar ersichtlich ist, dass der Flusskorridor aufgrund
der hohen Umlagerungsdynamik primär durch Weichholz-Gesellschaften geprägt war.
Aber selbst die älteren Standorte (> 200 Jahre) wiesen aufgrund des relativ geringen
Flurabstandes und der häufigen Überflutungen großflächig Übergangsformen von Weicher
Au zur Harten Au auf (Hohe Pappelau/Hohe Eichen-Ulmenau). Richtige Harte Auwälder
(Hohe Eichen-Ulmenau) konnten sich nur auf den höchsten und zugleich ältesten
Standorten des Augebietes entwickeln. Konkret betrifft dies nur die Roßau, die
Leopoldstadt, Teile der Simmeringer Haide und im Bereich Jedlesee-Floridsdorf-
Leopoldau. Die Auenvegetation wurde auf 87 % der Landflächen primär durch An- bzw.
Auflandungsprozesse geprägt und lediglich auf 13 % durch Verlandungsprozesse.
Insgesamt nahm die Weiche Au rund 34 % der Fläche ein, wovon der Großteil von der
Hohen Weidenau und Hohen Pappelau geprägt wurde (Abbildung 11).
Abbildung 11: Flächenbilanz der potenziell natürlichen Auentypen bei Wien um 1825
(bezogen auf das gesamte Projektgebiet Kahlenbergerdorf bis Albern)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 36
Die Übergangstypen von Weicher Au zur Harten Au (Hohe Pappelau/Hohe Eichen-
Ulmenau und Tiefe Pappel-Feldulmenau) nahmen mit 48 % noch größere Flächen ein,
während die Harte Au (Hohe Eichen-Ulmenau) nur knapp 11 % des Augebietes erreichte.
Die restlichen Flächen (6 %) entfielen auf Straußgras-Pionierrasen in An- und
Auflandungsbereichen sowie Röhricht in Verlandungsbereichen. Der hohe Anteil des
Übergangstyps und der Harten Au mit insgesamt 59 % ist vor allem auf die großflächigen,
stabileren Bereiche des Augebietes in der Leopldstadt, Prater, nördlich der Donau und auf
der Simmeringer Haide zurückzuführen.
5.4 Forstwirtschaftliche Modellierung
Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der forstlichen Modellierungen. Je Bestandstyp wurde der
Holzvorrat des Auwaldes sowohl für eine vorratsreiche Variante (natürlich ohne
Waldnutzung) als auch eine vorratsarme (bewirtschaftete) Variante berechnet.
Tabelle 9: Modellierte Holzmengen je Bestandstyp – Mittelwerte (von/bis = untere/obere Grenze der 95 %-Konfidenzintervalle bei 5 % Irrtumswahrscheinlichkeit)
modellierter Kennwert
Purp
urw
eide
nau
Tief
e W
eide
nau
Hoh
e W
eide
nau
Tief
e Pa
ppel
au
Hoh
e Pa
ppel
au
Tief
e Pa
ppel
-Fe
ldul
men
au
Hoh
e Ei
chen
-U
lmen
au
Typi
sche
/troc
kene
H
ainb
uche
nau
Holzvorrat vorratsreiche Variante (VfmD/ha) 104 124 262 287 280 258 220 242
von 48 68 212 262 260 239 200 186 bis 159 180 312 312 299 277 241 299 Holzvorrat vorratsarme Variante (VfmD/ha) 80 92 227 238 218 188 170 185
von 36 47 184 215 201 171 151 143 bis 123 137 269 261 234 205 188 227 Zuwachs Holzvorrat (VfmD/ha/Jahr) 12,6 14,7 16,1 13,1 12,1 11,4 8,8 10,1
von 8,7 12,6 12,9 12,0 11,2 10,4 8,2 7,5 bis 16,5 16,9 19,3 14,1 12,9 12,4 9,4 12,7 Totholzvorrat (VfmD/ha) 13 76 60 39 29 24 24 38
von 1 46 38 31 23 17 18 12 bis 24 107 83 46 34 31 29 63 Zuwachs Totholzvorrat (VfmD/ha/Jahr) 0,5 5,4 3,1 1,5 1,2 0,8 1,0 2,4
von 0,1 2,4 0,9 0,7 0,6 0,1 0,5 0,3 bis 1,6 8,4 5,2 2,3 1,7 1,6 1,5 4,4
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 37
Die erste Variante dient der Untersuchung der potenziell natürlichen Holzressourcen
(Szenario 1), die zweite Variante für die Analyse des damals bereits menschlich genutzten
Wiener Auwaldes (Szenario 2). Weiters wurden die jährlichen Zuwächse an Holz und der
Vorrat an Totholz im Waldbestand sowie dessen jährlicher Zuwachs modelliert. Die
Ergebnisse sind als Vorratsfestmeter Derbholz (VfmD) je Hektar Auwald angegeben
(sämtliches Holz mit einem Durchmesser größer als 7 cm) und stellen Mittelwerte
basierend auf 95%-Konfidenzintervallen dar (Irrtumswahrscheinlichkeit 5 %). Diese
Mittelwerte wurden in weiterer Folge für Ausarbeitung der Endergebnisse herangezogen
(siehe Kapitel 5.6).
Für die letztendliche Zuordnung der modellierten Kennwerte zu den Standortstypen bzw.
Auentypen der Wiener Donau-Auen um 1825 wurden zusätzlich das Standortalter und
andere Faktoren, wie der potenzielle Überschirmungsgrad je Bestandsalter, berücksichtigt.
Diese zusätzliche Differenzierung war erforderlich, da ein Auentyp in mehreren
Standortaltersklassen auftreten kann.
Tabelle 10: Modellierte Holzmengen je Standorttyp und Auentyp bei Wien um 1825
Standort- Typ Code
Auentyp (Drescher & Egger)
Hol
zvor
rat
vorr
atsr
eich
e Va
r. (V
fmD
/ha)
Hol
zvor
rat
vorr
atsa
rme
Var.
(Vfm
D/h
a)
Zuw
achs
H
olzv
orra
t (V
fmD
/ha/
Jahr
)
Toth
olzv
orra
t (V
fmD
/ha)
Zuw
achs
To
thol
zvor
rat
(Vfm
D/h
a/Ja
hr)
>300 tief A Hohe Pappelau/H. Eichen-Ulmenau 220 170 8,8 24 1,0 >300 tief V Tiefe Pappel-Feldulmenau 258 188 11,4 24 0,8 >300 mittel Hohe Pappelau/H. Eichen-Ulmenau 220 170 8,8 24 1,0 >300 hoch Hohe Eichen-Ulmenau 242 185 10,1 38 2,4
250-300 tief A Hohe Pappelau/H. Eichen-Ulmenau 214 165 8,6 23 1,0 250-300 tief V Tiefe Pappel-Feldulmenau 250 182 11,1 23 0,8 250-300 mittel Hohe Pappelau/H. Eichen-Ulmenau 214 165 8,6 23 1,0 250-300 hoch Hohe Eichen-Ulmenau 235 180 9,8 36 2,3
200-250 tief A Hohe Pappelau/H. Eichen-Ulmenau 207 160 8,3 22 1,0 200-250 tief V Tiefe Pappel-Feldulmenau 243 177 10,7 22 0,8 200-250 mittel Hohe Pappelau/H. Eichen-Ulmenau 207 160 8,3 22 1,0 200-250 hoch Hohe Eichen-Ulmenau 228 174 9,5 35 2,2
160-200 tief A Hohe Pappelau 280 218 12,1 29 1,2 160-200 tief V Tiefe Pappelau 287 238 13,1 39 1,5 160-200 mittel Hohe Pappelau 280 218 12,1 29 1,2 160-200 hoch Hohe Pappelau 280 218 12,1 29 1,2
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 38
Tabelle 10 (Fortsetzung): Modellierte Holzmengen je Standorttyp und Auentyp bei Wien um 1825
Standort- Typ Code
Auentyp (Drescher & Egger)
Hol
zvor
rat
vorr
atsr
eich
e Va
r. (V
fmD
/ha)
Hol
zvor
rat
vorr
atsa
rme
Var.
(Vfm
D/h
a)
Zuw
achs
H
olzv
orra
t (V
fmD
/ha/
Jahr
)
Toth
olzv
orra
t (V
fmD
/ha)
Zuw
achs
To
thol
zvor
rat
(Vfm
D/h
a/Ja
hr)
100-160 tief A Hohe Pappelau 224 174 9,7 23 0,9 100-160 tief V Tiefe Pappelau 229 190 10,5 31 1,2 100-160 mittel Hohe Pappelau 224 174 9,7 23 0,9 100-160 hoch Hohe Pappelau 224 174 9,7 23 0,9
45-100 tief A Hohe Weidenau 262 227 16,1 60 3,1 45-100 tief V Tiefe Weidenau 124 92 14,7 76 5,4 45-100 mittel Hohe Weidenau 262 227 16,1 60 3,1 45-100 hoch Hohe Weidenau 262 227 16,1 60 3,1
20-45 tief A Hohe Weidenau 157 136 9,7 36 1,8 20-45 tief V Röhricht 0 0 0,0 0 0,0 20-45 mittel Hohe Weidenau 157 136 9,7 36 1,8 20-45 hoch Hohe Weidenau 157 136 9,7 36 1,8
8-20 tief A Purpurweidenau 104 80 12,6 13 0,5 8-20 tief V Röhricht 0 0 0,0 0 0,0 8-20 mittel Purpurweidenau 104 80 12,6 13 0,5 8-20 hoch Purpurweidenau 104 80 12,6 13 0,5
1-8 tief A Straußgras-Pionierrasen 0 0 0,0 0 0,0 1-8 tief V Röhricht 0 0 0,0 0 0,0 1-8 mittel Purpurweidenau 31 24 4 4 0,1 1-8 hoch Purpurweidenau 31 24 3,8 4 0,1
Schotter vegetationslose Sand-/Schotterbänke 0 0 0,0 0 0,0 Wasser Gewässer 0 0 0,0 0 0,0
Für die Ermittlung der potenziell natürlichen Holzressourcen der Wiener Donau-Auen
(Szenario 1) wurden der Holzvorrat der vorratsreichen Variante und der Totholzvorrat
summiert. Die flächige Umlegung der Modellierungsergebnisse erfolgte über die im GIS-
Projekt vorliegenden Standorttypen (siehe Kartenbeilage 9). Beim Zuwachs des jährlichen
Holzvorrates wurde für das Szenario 1 ebenfalls der Zuwachs an Totholz mitgerechnet
(Kartenbeilage 10). Unter Berücksichtigung der damaligen menschlichen Nutzungen
(Szenario 2) wurde das Totholz hingegen weder beim Holzvorrat (vorratsarme Variante)
noch beim Zuwachs hinzugezählt, da anzunehmen ist, dass dieses großteils aus dem
Bestand entfernt wurde (Kartenbeilagen 11 und 12). Die in den angeführten
Kartenbeilagen dargestellten Holzmengen beinhalten kein Astholz (Durchmesser 5 – 7 cm;
vgl. Kapitel 5.6).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 39
5.5 Historischer Holzverbrauch
Der Verbrauch an Brennholz der Stadt Wien innerhalb des Linienwalls (Gürtel inklusive
Leopoldstadt) stieg von rund 477.000 Raummeter (rm) im Jahr 1760 auf rund 1 Mio. rm in
den 1780ern (Abbildung 12). Bis 1850 schwankte die jährliche Menge an verbrauchtem
Brennholz stark, der generelle Trend ist aber gleich geblieben. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts sank der Holzverbrauch stetig und erreichte um 1890 ein Niveau von 347.000
Raummeter. Dabei ist zu bedenken, dass sich im selben Zeitraum die Bevölkerungszahl
ständig vergrößerte, wodurch ein rücklaufender Pro-Kopf-Verbrauch zu verzeichnen war.
Der Höhepunkt des Pro-Kopf-Verbrauchs wurde im Jahre 1796 mit jährlich 5,25 rm
erreicht. Von da an sank der Verbrauch pro Kopf beständig bis auf 0,43 rm um 1890.
Abbildung 12: Verbrauch von Brennholz der Stadt Wien innerhalb des Linienwalls 1760 – 1890
(basierend auf Sandgruber 1987 und Hauer 2010)
Der Pro-Kopf-Rückgang an Brennholz in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
kann vermutlich durch Verbesserungen der Heiztechnik und steigende Holzpreise erklärt
werden (Sandgruber, 1987). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Biomasse
(Holz) durch fossile Brennstoffe (Kohle) als Primärenergieträger ersetzt (Krausmann,
2013). Um 1890 verlor Holz als Primärenergieträger in den Städten völlig an Bedeutung.
Der Verbrauch an Bauholz schwankte in den Jahren von 1833 bis 1843 zwischen 166.000
rm und 256.000 rm pro Jahr. In diesem Zeitraum betrug der Anteil des Bauholzes am
gesamten Holzverbrauch im Mittel 18,5 %. Es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil
nicht über den gesamten Zeitraum von 1760 bis 1890 gleich geblieben ist. Die Entwicklung
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 40
des Bauholz-Verbrauchs folgte anderen Gesetzmäßigkeiten als der Verbrauch von
Brennholz. Im Zuge des industriellen Wandels wurde Holz im Bausektor wahrscheinlich
zunehmend durch andere Materialien ersetzt. Andererseits erhöhte sich aber die
Bautätigkeit im Rahmen der Stadterweiterung. Diese Entwicklung könnte die Substitution
von Holz durch andere Materialien überwogen haben.
Abbildung 13: Gesamter Holzverbrauch der Stadt Wien innerhalb des Linienwalls 1833 – 1843
Zwischen 1833 und 1843 schwankte der gesamte Holzverbrauch von Wien innerhalb des
Linienwalls (inkl. Leopoldstadt) zwischen 940.000 rm und 1,2 Mio. rm; im Mittel lag er bei
1,1 Mio. rm (Abbildung 13).
Für die vergleichende Untersuchung im Rahmen des gegenständlichen Projektes wurden
die in Raummeter ermittelten Holzmengen in Festmeter umgerechnet (1 rm = 0,7 fm). Da
nicht alle Daten zum Holzverbrauch für ein bestimmtes Jahr vorliegen und um
jahresbedingte Schwankungen auszuschließen, wurden sämtliche Werte für den Zeitraum
1820 – 1830 gemittelt. Abbildung 14 zeigt die abschließende Bilanz des gesamten Wiener
Holzverbrauchs bezogen auf das Stadtgebiet in den heutigen Grenzen. Die auf soliden
historischen Quellen basierenden Daten für den Holzverbrauch innerhalb des Linienwalls
sind blau dargestellt. Die anderen Holzmengen wurden darauf aufbauend anhand der
Bevölkerungszahl für die Wiener Vorstädte extrapoliert (siehe Kapitel 4.6).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 41
Abbildung 14: Bilanz des gesamten Wiener Holzverbrauchs im heutigen Wiener Stadtgebiet um 1825 (* hochgerechnet basierend auf Bevölkerungszahl, ** zusätzlicher Bedarf für Ziegelöfen und andere
Brennholz verbrauchende Betriebe)
Innerhalb des Linienwalls wurden um 1825 alljährlich rund 613.000 fm Brennholz und
84.000 fm Bauholz benötigt, in Summe somit rund 700.000 Fm pro Jahr. Die Vorstädte
benötigten weitere 126.000 fm Brennholz und 18.000 fm Bauholz. Dazu kam noch ein
zusätzlicher Brennholzbedarf für die Ziegelöfen und andere Brennholz verbrauchende
Betriebe im Ausmaß von ungefähr 32.000 fm. Zuletzt sind noch Kleinholzprodukte wie
Bretter, Schindel und Laden mit 26.000 fm hinzuzurechnen. Somit ergibt sich ein
Gesamtverbrauch an Holz von 899.000 Festmeter bzw. 1,28 Mio. Raummeter pro Jahr.
5.6 Synthese der Projektergebnisse
Unter der Annahme, dass die Wiener Donau-Auen um 1825 einen vom Menschen
weitgehend unbeeinflussten Auwald aufwiesen (Szenario 1), ergibt sich für das engere
Untersuchungsgebiet (Nußdorf bis ungefähr Kaiserebersdorf) ein Holzvorrat von
insgesamt 1,41 Mio. Vorratsfestmeter Derbholz (VfmD = sämtliches Holz mit einem
Durchmesser größer als 7 cm). Dabei ist auch das Totholz im Waldbestand inkludiert
(Kartenbeilage 9). Zählt man dazu noch das stärkere Astholz (mit 5 – 7 cm Durchmesser)
im Ausmaß von 15 % des Derbholzes dazu, so ergeben sich rund 1,63 Mio. Festmeter. Der
jährliche Holzzuwachs erreichte rund 76.100 fm (bzw. 66.200 VfmD, Kartenbeilage 10).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 42
Hingegen kam die jährlich von der Donau erodierte/mobilisierte Holzmenge lediglich auf
5.200 – 7.300 fm (4.500 – 6.300 VfmD). Demnach war der jährliche Zuwachs mehr als 10-
mal so groß wie die erodierte Holzmenge.
Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Landnutzung im Augebiet um 1825 (nur rund ein
Drittel des Augeländes im engeren Untersuchungsgebiet waren bewaldet) und unter der
Annahme, dass die Wälder damals mehr oder weniger nachhaltig genutzt wurden, ergibt
der gesamte Holzvorrat mit 278.700 fm (242.300 VfmD) wesentlich geringere Werte
(Szenario 2, Kartenbeilage 11). Hierbei wird davon ausgegangen, dass es aufgrund der
damaligen Holznutzung kein oder nur sehr wenig Totholz im Wald gab. Dementsprechend
war der Zuwachs an Holz mit rund 20.000 fm (17.400 VfmD) pro Jahr ebenso bedeutend
kleiner als im natürlichen Szenario (Kartenbeilage 12). Da viele Uferbereiche
landwirtschaftlich genutzt wurden, reduzieren sich auch die jährlichen Raten an
mobilisiertem Holz um ca. 50 % auf 2.800 – 3.900 fm (2.400 – 3.400 VfmD). Auch in
diesem Szenario ist der Zuwachs an Holz bedeutend größer als die vom Fluss jährlich
erodierte Menge. Tabelle 11 zeigt die Ergebnisse im Detail mit unterschiedlichen
räumlichen Bezügen für weiterführende Studien.
Tabelle 11: Gegenüberstellung von Holzvorrat, -zuwachs u. -mobilisierung im engeren Untersuchungsgebiet für das natürliche Szenario 1 und das anthropogen geprägte Szenario 2; oben: Holzmengen gesamt;
mitte oben: je km Talachsenlänge; mitte unten: je km² Fluss-/Auenzone; unten: je ha Augebiet/-gelände (angegebene Werte in Festmeter = Vorratsfestmeter Derbholz mit >7 cm Durchmesser + 15 % Astholz
mit 5-7 cm Durchmesser)
Holzvorrat gesamt natürlich1 anthropogen2
Holzvorrat gesamt (fm) 1.627.028 278.684
Holzzuwachs gesamt (fm pro Jahr) 76.141 20.033
Holzvorrat mobilisiert 1817-1825 (fm pro Jahr) 5.221 2.780
Holzvorrat mobilisiert 1805-1817 (fm pro Jahr)3 7.293 3.883 1 inklusiv Totholz; 2 exklusiv Totholz
3 extrapoliert basierend auf 1817 - 1825 und Erosionsraten
Holzvorrat pro km Talachse natürlich1 anthropogen2 Holzvorrat gesamt (fm) 138.235 23.678 Holzzuwachs gesamt (fm pro Jahr) 6.469 1.702 Holzvorrat mobilisiert 1817-1825 (fm pro Jahr) 444 236 Holzvorrat mobilisiert 1805-1817 (fm pro Jahr)3 620 330
Länge der Talachse: 11,77 km
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 43
Holzvorrat pro km² Fluss-/Auenzone natürlich1 anthropogen2 Holzvorrat gesamt (fm) 21.112 3.616 Holzzuwachs gesamt (fm pro Jahr) 988 260 Holzvorrat mobilisiert 1817-1825 (fm pro Jahr) 68 36 Holzvorrat mobilisiert 1805-1817 (fm pro Jahr)3 95 50
Fläche: 77,07 km²
Holzvorrat pro ha Augebiet natürlich1 anthropogen2 Holzvorrat gesamt (fm) 269 46 Holzzuwachs gesamt (fm pro Jahr) 12,6 3,3 Holzvorrat mobilisiert 1817-1825 (fm pro Jahr) 0,9 0,5 Holzvorrat mobilisiert 1805-1817 (fm pro Jahr)3 1,2 0,6
Fläche: 6.055 ha
Da die standardisierte Darstellung der Ergebnisse in Festmeter je Hektar Augebiet für
Vergleichszwecke am gebräuchlichsten ist, werden diese hier gesondert erwähnt
(Abbildung 15 unten und Tabelle 11 oben). Als Augebiet sind hier die Landflächen ohne
Wasser- und Schotterflächen (= Augelände) zu verstehen.
Abbildung 15: Gegenüberstellung von Holzvorrat, -zuwachs u. -mobilisierung pro ha Augebiet (Augelände)
im engeren Untersuchungsgebiet für das natürliche Szenario 1 und das anthropogen geprägte Szenario 2 (Werte in Festmeter = Vorratsfestmeter Derbholz mit >7 cm Durchmesser + 15 % Astholz mit 5-7 cm)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 44
So betrug der gesamte Holzvorrat im natürlichen Szenario rund 269 Festmeter pro Hektar
Augebiet (VfmD inkl. 15 % Astholz), während er tatsächlich weniger als ein Fünftel (46
fm/ha) ausgemacht haben dürfte. Der jährliche Zuwachs an Holz erreichte natürlicher
Weise fast 13 fm/ha, tatsächlich aber nur 3,3 fm/ha. Die von der Donau mobilisierten
Holzmengen schwankten zwischen 0,9 und 1,2 fm je Hektar Augebiet und Jahr. Wenn man
die damaligen menschlichen Nutzungen berücksichtigt, reduzieren sich diese Werte um ca.
50 % auf lediglich 0,5 bis 0,6 fm je Hektar und Jahr.
Die oben genannten Werte werden in der folgenden Synthese der Ergebnisse (Abbildung
16) noch einmal übersichtlich dargestellt und dem damaligen jährlichen Holzverbrauch der
Stadt Wien (in den heutigen Grenzen) gegenüber gestellt. Die angegebene Menge des
erodierten Totholzes (6.400 fm/Jahr) entspricht dem zwanzigjährigen Mittel im Zeitraum
1805 bis 1825. Auf den ersten Blick erscheint es mit jährlich 1,1 fm/ha Augebiet (= 0,4 %
des gesamten Holzvorrates) relativ wenig. Besser vorstellbar ist die Umrechnung in Bäume
je Kilometer Flusslauf. Dementsprechend wären dies 60 – 90 rund 200 Jahre alte und 20 –
25 m lange Weiden oder Pappeln, die je Kilometer Donaulauf erodiert wurden.
Abbildung 16: Synthese der historischen Analysen unter der Annahme, dass das gesamte Augebiet um 1825 eine natürliche Auenvegetation aufgewiesen hat (Szenario 1; Prozentwerte beziehen sich auf den gesamten
Holzvorrat im Augebiet, fm = VfmD + 15% Astholz)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 45
Aus der Abbildung geht auch hervor, dass der Wiener Holzverbrauch selbst im natürlichen
Szenario um ein Vielfaches größer war als der jährliche Zuwachs im Augebiet. So betrug
der jährliche Bedarf an Holz rund 900.000 fm, was 55 % des gesamten natürlichen
Holzvorrates entspricht. Mit anderen Worten: wären die Wiener Donau-Auen zur Gänze
mit natürlichem Auwald bestockt gewesen und hätte man sämtliche Bäume gefällt, so hätte
das Holz nur für knapp zwei Jahre gereicht. Zur Deckung des jährlichen Wiener
Holzbedarfes hätte man den Holzzuwachs eines 12-mal so langen Donau-Abschnittes mit
139 km Länge (= 40 % der österreichischen Donau) benötigt.
Im zweiten Szenario, wenn man die damaligen Formen der Land- und Waldnutzung
berücksichtigt, fällt diese Diskrepanz zwischen Holzvorrat und Zuwachs einerseits und
Holzverbrauch andererseits noch viel stärker aus (Abbildung 17). Von den rund 279.000
fm an Holzvorrat im Augebiet wurden zwischen 1805 und 1825 im Mittel jährlich 3.450 fm
erodiert und wieder dem Gewässersystem zugeführt. Dies entspricht ca. 1,2 % des
damaligen Holzvorrates oder anders ausgedrückt, 30 – 50 rund 200 Jahre alte und 20 – 25
m lange Weiden oder Pappeln je Kilometer Donaulauf.
Abbildung 17: Synthese der historischen Analysen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Land- und Waldnutzungen um 1825 (Szenario 2; Prozentwerte beziehen sich auf den gesamten Holzvorrat im Augebiet,
fm = VfmD + 15% Astholz)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 46
Der Zuwachs an Holz war zwar mit ca. 20.000 fm (7,2 %) wesentlich höher, es wurden
aber auch vermutlich große Mengen an Holz geerntet. Auf Basis der
Waldschätzungsoperate und Parzellenprotokolle zum Kataster ist anzunehmen, dass
ungefähr 17.400 – 20.900 fm pro Jahr an Holzzuwachs für diverse Nutzungen zur
Verfügung standen (vgl. Kapitel 5.2). Dadurch ergibt sich eine leicht negative Bilanz: es
wurden vermutlich alljährlich im Mittel ca. 3.000 fm Holz mehr geerntet bzw. vom Fluss
erodiert als nachgewachsen ist. Es ist jedoch historisch nicht belegbar, wie viel Holz
tatsächlich aus den Donau-Auen entfernt wurde.
Der jährliche Holzbedarf der Stadt Wien in den heutigen Grenzen machte um 1825 mehr
als das Dreifache des gesamten Holzvorrates im Augebiet aus. Die Donau-Auen spielten
demnach für die Holzversorgung der Stadt nur eine sehr geringe Rolle. Der weitaus größte
Teil (879.000 fm/Jahr) musste aus dem flussauf gelegenen Einzugsgebiet der Donau am
Wasserweg nach Wien transportiert werden (Gierlinger et al., 2013). Unter der Annahme
gleichartiger Nutzungsformen der österreichischen Donau-Auen, wäre ein 45-mal so langer
Donau-Abschnitt (= 528 km oder 153 % der österreichischen Donau) erforderlich
gewesen, um die benötigte Holzmenge aus den Auen gewinnen zu können. Es ist
anzunehmen, dass die Donau-Auen abseits der Stadt Wien durchschnittlich stärker
bewaldet waren als so nahe bei der Stadt, wodurch ein etwas kürzerer Abschnitt zur
Deckung des Holzbedarfes gereicht hätte. Tatsächlich wurde das benötigte Holz aus dem
alpinen Raum oder dem Alpenvorland nach Wien transportiert.
Die für Wien um 1825 ermittelten Werte ermöglichen eine Hochrechnung der
Holzressourcen aller österreichischen Donau-Auen. Dazu sei hypothetisch
angenommen, dass die Standortbedingungen und Vegetationsgesellschaften entlang der
österreichischen Donau ähnlich waren und sich vergleichbare Holzressourcen entwickeln
konnten. Insgesamt nehmen die morphologischen Donau-Auen, das heißt das postglaziale
Alluvium, in Österreich eine Fläche von 655 km² ein. Im natürlichen Zustand konnten
größere Hochwässer, wie z.B. HW100, darüber hinausgehende Flächen überfluten (z.B. im
Marchfeld oder die Niederterrasse im östlichen Machland). Heute sind weite Teile der
morphologischen Au hingegen abgedämmt.
Unter Annahme einer natürlichen Auenvegetation (Szenario 1) ergibt die Hochrechnung
für die gesamte österreichische Donau einen Holzvorrat von rund 13,8 Mio. Festmeter
(VfmD inkl. 15 % Astholz). Der jährliche Zuwachs betrug demnach ca. 650.000 fm und die
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 47
Mobilisierung von Totholz durch Ufererosion schwankte zwischen 44.000 fm und 62.000
fm pro Jahr.
Abbildung 18: Holzvorrat, -zuwachs und -mobilisierung hochgerechnet für sämtliche österreichische
Donau-Auen – Vergleich natürliches Szenario (blau) und anthropogen geprägtes Szenario (rot) (Werte in Festmeter = Vorratsfestmeter Derbholz >7 cm Durchmesser + 15 % Astholz 5-7 cm)
Legt man der Hochrechnung hingegen die gleichen Land- und Waldnutzungen zugrunde
wie im Wiener Abschnitt, so ergibt der Holzvorrat lediglich rund 2,4 Mio. Festmeter. Der
Zuwachs an Holz würde sich auf 170.000 fm pro Jahr reduzieren und die Mobilisierung
von Totholz auf 24.000 – 33.000 fm pro Jahr. Da anzunehmen ist, dass die Donau-Auen
abseits der Stadt Wien im Schnitt stärker bewaldet waren als direkt bei Wien, sind diese
Werte als Untergrenze anzusehen. In Wien war rund ein Drittel des Augebietes bewaldet.
Wenn man für die ländlichen Augebiete hypothetisch annimmt, dass zwei Drittel der
Fläche bewaldet waren, dann wären die oben genannten Werte für den Holzvorrat und den
jährlichen Zuwachs auf 4,8 Mio. fm bzw. 340.000 fm zu verdoppeln. Die durch Erosion
mobilisierten Holzmengen können nicht in gleicher Weise hochgerechnet werden.
Basierend auf näheren Analysen der Wiener Donau-Auen wäre der Faktor hierbei ungefähr
mit 1,4 anzusetzen. Dadurch ergibt sich für die gesamte österreichische Donau eine
Schwankungsbreite an jährlich mobilisiertem Totholz von 34.000 – 47.000 fm.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 48
6 Praktische Relevanz
Entlang der österreichischen Donau haben sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund der
spezifischen historischen Entwicklung aber auch aufgrund unterschiedlicher prioritärer
Nutzungsansprüche regional sehr verschiedene Zielsetzungen bezüglich des Auen-
Managements herausgebildet. Während im Nationalpark Donau-Auen der Schwerpunkt bei
einer anthropogen möglichst wenig beeinflussten, naturnahen und dynamischen
Entwicklung des Auwaldes liegt, stehen andernorts mehrheitlich forstliche
Nutzungsinteressen im Vordergrund.
An Fließgewässern befinden sich daher aktuell gesellschaftliche (forstwirtschaftliche
Produktion erneuerbarer Ressourcen), ökologische (Förderung dynamischer
flussmorphologischer Prozesse entsprechend der EU WRRL) und naturschutzfachliche
(Förderung von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen entsprechend der FFH-Richtlinie)
Ziele in einem schwer lösbaren Spannungsfeld (Muhar et al., 2011). Zum Teil auch medial
ausgetragene Diskussionen spiegeln das derzeitige Ringen um praktikable
Kompromisslösungen wider. Für die Erarbeitung einer gut fundierten Kompromisslösung
fehlt derzeit aber – da es an der Donau in Mitteleuropa keine anthropogen
unbeeinträchtigten Auwälder mehr gibt – nach wie vor entsprechendes Wissen zu den
potenziell verfügbaren Ressourcen von naturnahen, flusstypischen Auenlandschaften.
Welche praktischen Erkenntnisse sind nun aus den Untersuchungen der historischen
Wiener Donau-Auen unter den aktuell geänderten naturräumlichen Bedingungen und
sozioökonomischen Verhältnissen ableitbar?
6.1 Ökologisch-naturschutzfachlich
Weiche Auwaldgesellschaften sind europaweit besonders bedroht, da diese durch
langfristige Verlandungs- und Auflandungsprozesse seit den Regulierungen im 19.
Jahrhundert in Hartholzstandorte umgewandelt oder anderweitig genutzt wurden (Tockner
& Stanford, 2002). Neue dynamische Pionierhabitate und Standorte für die Gesellschaften
der Weichen Au entstehen heute hingegen nur mehr lokal im Zuge ökologisch orientierter
Rückbaumaßnahmen. Ein Großteil der niederösterreichischen Donau-Auwälder wurde
daher als Schutzgebiet entsprechend der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Natura 2000,
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 49
92/43/EWG) ausgewiesen (Abbildung 19). In Oberösterreich ist neben den bestehenden
Schutzgebieten „Oberes Donau- und Aschachtal“ und „Traun-Donau-Auen“ ein weiteres
FFH-Gebiet („Machland Nord“) in Umsetzung begriffen. Zudem wurden weite Teile der
Auwälder östlich von Wien im „Nationalpark Donau-Auen“ entsprechend international
anerkannter Kriterien unter besonderen Schutz gestellt.
Abbildung 19: FFH-Schutzgüter (Weichholz- u. Hartholz-Auwälder) innerhalb der bei HQ100
überschwemmten Flächen im Tullner Becken, Wien und im Nationalpark Donau-Auen (Orthofoto: ESRI Basemap)
In Bezug auf die Auwälder sind an der Donau zwei FFH-Schutzgüter (Lebensraumtypen)
relevant: „91E0* Restbestände von Erlen- u. Eschenwäldern an Fließgewässern“
(Weichholz-Auwälder) und „91F0 Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder“ (Hartholz-
Auwälder). Erstere stellen gemäß der FFH-Richtlinie ein sogenanntes prioritäres Schutzgut
dar, für welches der jeweilige Mitgliedsstaat eine besondere Verantwortung bezüglich
dessen Erhaltung bzw. Förderung trägt. Konkret wird seitens der EU die Bewahrung des
„günstigen Erhaltungszustandes“ dieser Schutzgüter eingefordert, wodurch der
Mitgliedsstaat aufgerufen ist, einer allfälligen Verschlechterung entgegenzuwirken
(Ellmauer & Essl, 2005). Langfristig wirken sich jedoch derzeit die aktuellen
Rahmenbedingungen an der österreichischen Donau nachteilig auf diese Schutzgüter aus:
Bei jedem größeren Hochwasser werden große Mengen an Feinsedimenten (Schluff) in den
Augebieten abgelagert, wodurch der generelle Trend in Richtung trockenere
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 50
Auwaldstandorte geht (z.B. rund 3,6 Mio. m³ Ablagerung an Feinsedimenten bei einem
100-jährlichen Hochwasser alleine im oö./nö. Machland; Hochwasserschutzverband
Donau-Machland, 2005).
Zudem sind an der Donau die Vorgaben der EU Wasserrahmenrichtlinie (WRRL
2000/60/EG), die auf die Erreichung eines guten Gewässerzustandes bzw. guten
ökologischen Potenzials bis zum Jahr 2015 abzielen, zu berücksichtigen. Damit verbunden
ist ein Verschlechterungsverbot aquatischer Ökosysteme und der damit direkt assoziierten
Landökosysteme (Auen) bzw. ein Verbesserungsgebot sofern das vorgeschriebene
Qualitätsziel nicht erreicht wird. Als objektiver Bewertungsmaßstab ist der nicht oder nur
sehr gering menschlich beeinträchtigte Zustand des Gewässers im Sinne eines
typspezifischen Referenzzustandes heranzuziehen. Obwohl in der FFH-Richtlinie nicht
explizit angesprochen, so erfordern beide Richtlinien die (teilweise) Wiederherstellung
flusstypischer hydrologischer und morphologischer Prozesse. Nur so können die
verbliebenen Schutzgüter langfristig erhalten und gefördert bzw. die angestrebten
Qualitätsziele, erreicht werden.
In den unregulierten Wiener Donau-Auen wurde der zentrale Flusskorridor auf ca. 2,5 – 3
km Breite fast durchwegs von Weichen Auwaldgesellschaften geprägt (rund ein Drittel des
gesamten postglazialen Alluviums). Die vergleichende Analyse des Standortalters im
Augebiet und der Entwicklung der Auenvegetation unterstreichen die Notwendigkeit
dynamischer flussmorphologischer Prozesse für die ständige Verjüngung der
Auenstandorte und deren Sukzessionsstadien (vgl. dazu auch Hohensinner et al., 2011).
Dementsprechend wäre die Zielrichtung für ein ökologisch orientiertes Auenmanagement
klar: Dynamisierung von aktuell stabilisierten/abgedämmten Donau-Auen, wie es auch Ziel
des „Flussbaulichen Gesamtprojektes Donau östlich von Wien“ (FGP) im Nationalpark
Donau-Auen ist.
Die vorliegende Studie bietet auch neue Erkenntnisse zur Bedeutung von mobilisiertem
Totholz an derart dynamischen Flüssen. Totholz, das erodiert, weitertransportiert und
vom Fluss wieder abgelagert wurde, trug wesentlich zur flussmorphologischen Dynamik
und damit zur Verjüngung terrestrischer Habitate bei (Nanson & Knighton, 1996; Hering
et al., 2000; Gurnell et al., 2005). Bildlich dargestellt, waren dies an der Wiener Donau je
Kilometer Donaulauf 60 – 90 rund 200 Jahre alte Weiden oder Pappeln, die eine Länge von
je 20 – 25 m aufwiesen.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 51
Abbildung 20: Totholzeintrag beim frisch erodierten Donau-Ufer am Thurnhaufen nahe Hainburg
(C. Baumgartner, Nationalpark Donau-Auen GesmbH, 2009)
Dabei ist keineswegs gesagt, dass all das erodierte Holz weitertransportiert wurde. Vor
allem an kleineren Nebenarmen sind vermutlich größere Mengen an Holz im Gerinne
liegen geblieben. Bevor dieses nun entweder bei Hochwässern ausgeschwemmt oder von
Sedimenten überlagert wurde, erfüllte es als Habitat und Nahrungsquelle für holzliebende
Organismen eine bedeutende Rolle. Jüngere Studien belegen diese wichtige Funktion von
Totholz in Fließgewässer-Ökosystemen (Kail et al., 2007; Seidel & Mutz, 2012).
Aktuelle Vergleichsdaten sind für die österreichische Donau kaum verfügbar. Im Zuge des
Monitorings zum „Flussbaulichen Gesamtprojekt Donau östlich von Wien“ (FGP) soll im
Nationalpark Donau-Auen auch die Quantität und Qualität des Tot- bzw. Treibholzes
dokumentiert werden. Einer Kartierung aus dem Jahr 2002 zufolge wurden bei den Orther
Inseln (linksufrig bei Strom-km 1901,2 – 1900,3) ca. 56,3 fm an Treibholz vorgefunden
(Julius, 2002). Wenn man die Schotterflächen mitrechnet, entspricht dies rund 10 – 11
fm/ha. Dieser Wert ist jedoch nicht vergleichbar mit den in der vorliegenden Studie
ermittelten Mengen an jährlich mobilisiertem (erodiertem) Totholz, da wir über dessen
Entstehungszeit nichts wissen. Am ehesten sind die an den Orther Inseln gemessenen
Treibholzmengen mit dem für 1825 modellierten Totholzvorrat je Hektar Waldfläche
vergleichbar. Dieser betrug damals im anthropogen unbeeinträchtigten Zustand (Szenario
1) 27 fm/ha, wozu noch rund 1 fm/ha an erodiertem Holz dazugerechnet werden kann. In
Summe wäre dies mit ca. 28 fm/ha beinahe die dreifache Menge als 2002 bei den Orther
Inseln festgestellt wurde. Die Frage dabei ist, ob beim aktuellen Wert abgestorbene, noch
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 52
im Waldbestand in situ verbliebene Bäume mitgerechnet wurden, was beim historischen
Referenzwert der Fall ist. Dadurch würde sich die Differenz etwas verringern.
6.2 Forstwirtschaftlich-volkswirtschaftlich
Die Ergebnisse der Holzmodellierung zeigen, dass die Produktivität der dynamischen
Weichholz-Auwälder vor der Regulierung vergleichsweise hoch war. Durch die wiederholte
Umlagerung des Aubodens (je Standort im Abstand von wenigen Jahren bis zu mehreren
Jahrhunderten) war ein dynamischer Wechsel von starker Durchfeuchtung bis in den
Oberboden und Absinken des Grundwasserstandes bis in den Schotterkörper
gewährleistet. Abhängig von diesen bodenhydrologischen Verhältnissen und dem lokal
unterschiedlichen Wasserhaltevermögen der Feinsedimentdecke ist generell anzunehmen,
dass das Zuwachspotenzial der historischen Auwaldbestände höher war als in den heutigen
regulierten bzw. abgedämmten Donau-Auen (Hager & Eberl, 1989; Sterba & Kissling,
1989; Haubenberger & Weidinger, 1990). Der potenziell natürliche Holzvorrat der Wiener
Auwälder betrug um 1825 im Mittel 234 VfmD je Hektar Waldfläche (ohne Astholz;
Abbildung 21).
Abbildung 21: Vergleich der modellierten Holzvorräte für die historischen Wiener Donau-Auen mit jenen in
aktuell unterschiedlich bewirtschafteten Auwäldern – Mittelwerte (Pfeile: Schwankungsbreite)
Der Holzvorrat reduziert sich um annähernd 50 %, wenn man die damaligen Formen der
Waldnutzung mitberücksichtigt (im Mittel 127 VfmD/ha). Dieser Wert liegt im Bereich
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 53
heute forstwirtschaftlich genutzter Auwälder an der regulierten Donau, wie im Tullner
Becken bei der Einmündung der Traisen (Mittel: 134 VfmD/ha, Schwankungsbreite: 108 –
203 VfmD/ha). Der Unterschied zu den natürlichen Auwäldern ist auch dadurch
begründet, dass die bewirtschafteten Wälder meist keine vollständige Bestockung aufweisen
(Auslichtung). Jedoch ist in Bezug auf die Produktivität der Auwälder an potenziellen
Weichholzstandorten auch zu berücksichtigen, dass um 1825 ertragsstarke
Hybridpappelsorten noch nicht für die Holzproduktion zur Verfügung standen. Nach der
Donauregulierung im 19. Jahrhundert war neben einer erhöhten Stabilität der
Waldstandorte gegen Erosion auch ein Verlust an Dynamik im Wasserhaushalt des
Standorts, wie auch das teilweise „Austrocknen“ von Standortseinheiten bzw. die
Veränderung in Richtung Hartholzstandorte, zu beobachten. Dies führte zu einem Abfall
der jährlichen Wuchsleistung an den betreffenden Standorten und in Folge zu längeren
Produktionszeiträumen (Umtriebszeiten) (Hager & Eberl, 1989; Sterba & Kissling, 1989).
Trotz dieser anthropogen verursachten Einschränkungen konnte aber die Produktivität
durch den Einsatz von Hochleistungs-Hybridpappeln in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts stark gesteigert werden. So erreichen die Hybridpappel-Bestände je nach
Nutzungsdauer und -intensität Holzvorräte von 200 VfmD/ha bis zu mehr als 400
VfmD/ha und damit wesentlich mehr als die natürlichen Auwaldbestände (Abbildung 21).
Abbildung 22: Vergleich der modellierten jährlichen Holzzuwächse für die historischen Wiener Donau-Auen
mit jenen in aktuell unterschiedlich bewirtschafteten Auwäldern – Mittelwerte (Pfeil: Schwankungsbreite)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 54
Interessant ist hierbei auch der jährliche Holzzuwachs. Dieser erreichte in den menschlich
unbeeinflussten Auwäldern rund 11 VfmD/ha, wobei die Schwankungsbreite je nach
Sukzessionsphase und Bodenstandort mit 4 – 20 VfmD/ha/Jahr ziemlich groß war
(Abbildung 22). Der Zuwachs in den von Menschen genutzten Wäldern betrug mit
durchschnittlich 9,1 VfmD/ha etwas weniger und wies damit eine vergleichbare
Produktivität wie heutige Auwälder im Tullner Becken auf. Hybridpappel-Bestände, die im
Nationalpark Donau-Auen seit 10 Jahren nicht mehr genutzt wurden, erreichen mit jährlich
16 VfmD/ha wesentlich größere Zuwächse.
Wenn auch mit Hybridpappel-Beständen größere Zuwachsleistungen erzielt werden
können, so entspricht dies nicht den Zielen eines ökologisch und naturschutzfachlich
ausgerichteten Auwaldmanagements. Hingegen erscheint generell eine Dynamisierung
flussnaher Bereiche von derzeit stabilen/abgedämmten Augebieten dazu geeignet, im Sinne
einer ökologisch verträglichen Bewirtschaftung auf morphologisch verjüngten
Austandorten langfristig höhere Holzerträgen zu erzielen. Eine allzu intensive
Dynamisierung von Augebieten würde jedoch zumindest kurzfristig zu
betriebswirtschaftlichen Einbußen führen. Einerseits durch den Erosionsverlust an
bewirtschaftbaren Waldflächen, andererseits auch durch die erschwerte Erreichbarkeit bei
der Holzbringung (erodierte oder überschwemmte Forstwege). Diesen negativen
Auswirkungen steht andererseits die Aufwertung von Fischereirevieren und damit erhöhte
Pachterträge gegenüber.
Fossile Energiequellen haben heute zwar Biomasse größtenteils als Energieträger abgelöst,
Holz gewinnt jedoch als erneuerbare und nachhaltige sowie lokal verfügbare Ressource
zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Aus umweltpolitischer Sicht ist daher die
Förderung lokaler Holzressourcen als CO2-neutrale Energiequelle durchaus sinnvoll.
Volkswirtschaftlich gesehen ebenfalls, da die Wertschöpfung lokal/regional erfolgt, indem
fossile Energieträger durch Bioressourcen substituiert werden. Jedoch ist es unter den
heutigen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Forstbetriebe zumeist nicht
sinnvoll, Brennholz aus Rundholz zu produzieren (Auskunft seitens der im Projekt
„Wiener Holz“ involvierten Forstverwaltungen). Ebenso ist beim derzeitigen Preisgefüge
die Produktion von Holzpellets aus Rundholz nicht wirtschaftlich. Lukrativer ist indessen
die Produktion von Nutzholz für verschiedenste andere Verwendungen (Bauholz, Möbel,
Furniere, etc.).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 55
Ein weiterer Hemmschuh für ambitionierte Dynamisierungsprojekte in Augebieten sind die
langwierigen (oft jahrelangen) und dadurch sehr kostspieligen Behördenverfahren, die
selbst für ökologisch ausgerichtete Rückbaumaßnahmen an Fließgewässern vorgeschrieben
sind. Jüngste Erfahrungen haben gezeigt, dass daher solche Projekte ohne große
institutionalisierte und finanziell unabhängige Projektpartner kaum durchzuführen sind.
Die in Kapitel 6 aufgezeigten Entwicklungsmöglichkeiten österreichischer Donau-
Auwälder sind vor dem Hintergrund ökologisch-naturschutzfachlicher Anforderungen und
den Zielen eines nachhaltigen Managements erneuerbarer Ressourcen zu sehen. Die
divergierenden Interessen zwischen „Nützen“ und „Schützen“ und der Bedarf der
Abstimmung sind am Beispiel der Donau-Auwälder und deren Holzressourcen klar
erkennbar. Umweltpolitisches und volkswirtschaftliches Ziel sollte es daher sein,
praktikable und wissenschaftlich fundierte Lösungswege zu erarbeiten, welche die
ökologisch-naturschutzfachlichen Ziele und die legitimen Ansprüchen der betroffenen
Waldeigentümer gleichermaßen berücksichtigen. So könnten im öffentlichen Interesse
rückgebaute (dynamisierte) donaunahe Aubereiche langfristig zur ökologischen Aufwertung
der FFH-Schutzgüter (i. B. prioritäres Schutzgut „Weichholz-Auwälder“), Verbesserung
des ökologischen Zustandes entsprechend der EU Wasserrahmenrichtlinie und zur
nachhaltigen Nutzung naturnaher Auwälder für die Gewinnung von Bioressourcen
beitragen. Für die Umsetzung derartiger Maßnahmen und das langfristige Management der
neu geschaffenen Flusslandschaftsräume sind jedoch adäquate öffentliche Förderungen
und vereinfachte Behördenverfahren eine notwendige Voraussetzung.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 56
7 Zusammenfassung
Das Projekt „Wiener Holz“ erbrachte zahlreiche neue Erkenntnisse für ein besseres
Verständnis der weitgehend unregulierten Wiener Donau-Auen aus flussmorphologischer,
gewässer-/vegetationsökologischer, forstwirtschaftlicher und umwelthistorischer Sicht.
Damit können die eingangs in Kapitel 2 angeführten wissenschaftlichen Fragestellungen
weitgehend beantwortet werden (die angegebenen Werte beziehen sich auf das engere
Untersuchungsgebiet zwischen Nußdorf und Kaiserebersdorf; Frage Nr. 2 auf das gesamte
Projektgebiet).
1. Wie groß waren die jährlichen Erosions- und Anlandungsraten im Fluss-Auensystem der Wiener
Donau vor der Regulierung?
Die von der Donau alljährlich zwischen 1805 und 1825 erodierten Landflächen
schwankten zwischen 24 und 34 ha. Dies entspricht rund 2,1 – 2,9 ha je km Tallänge
(heute ca. je km reguliertem Donaulauf) oder 0,4 – 0,6 % der damaligen Landflächen
(= potenziellen Auwaldflächen; vgl. Kartenbeilage 7). Andererseits entstanden durch
Anlandungs- und Verlandungsprozesse neue Landflächen im ungefähr selben Ausmaß
(34 – 37 ha/Jahr).
2. Welche Vegetationsgesellschaften waren typisch für das Wiener Augebiet und welche Sukzessions-/
Altersstadien wiesen diese auf?
Aufgrund der hohen Umlagerungsdynamik der Donau war der zentrale Flusskorridor
primär durch Weichholz-Gesellschaften geprägt (insgesamt 34 % der potenziellen
Auwaldflächen). Es handelte sich dabei um die jüngeren und bis zu 200 Jahre alten
Sukzessionsstadien, wie Purpurweidenau, Tiefe/Hohe Weidenau und Tiefe/Hohe
Pappelau. Aber selbst die älteren Standorte (> 200 Jahre) wiesen aufgrund des relativ
geringen Flurabstandes und der häufigen Überflutungen großflächig Übergangsformen
von Weicher Au zur Harten Au auf (48 % Hohe Pappelau/Hohe Eichen-Ulmenau).
Richtige Harte Auwälder (Hohe Eichen-Ulmenau) konnten sich nur auf den höchsten
und zugleich ältesten Standorten des Augebietes entwickeln. 90 % davon befanden
sich auf mehr als 300 Jahre alten Standorten (Leopoldstadt, Roßau, Jedlesee-
Floridsdorf-Leopoldau, Simmeringer Haide).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 57
3. Mit welchem Holzertrag konnte bei den damaligen Standortbedingungen (Standortalter, hydrologische
Bedingungen, ...) gerechnet werden und wie groß sind die Unterschiede zum Ertrag in den heutigen
regulierten/stabilen Auen?
Um 1825 betrug der gesamte potenziell natürliche Holzvorrat im Wiener Augebiet
rund 1,6 Mio. Festmeter (sämtliches Holz stärker als 5 cm) bzw. im Mittel 269 fm/ha
Auwald. Der natürliche Holzzuwachs betrug gesamt rund 76.000 fm pro Jahr bzw.
12,6 fm/ha. Damit war der Holzvorrat der damaligen dynamischen Donau-Auwälder
im Mittel um 40 % größer als in den heutigen regulierten und abgedämmten Auen.
Der jährliche Zuwachs war ebenfalls um rund 25 % höher als in heutigen Auwäldern.
Intensiv bewirtschaftete Auwälder (Hybridpappel-Kulturen) erreichen jedoch
wesentlich größere Werte. Berücksichtigt man die um 1825 vorherrschenden Land-
und Waldnutzungen, so reduziert sich der Holzvorrat von 1,6 Mio. fm auf rund
280.000 fm. Ebenso der jährliche Holzzuwachs von 76.000 fm auf 20.000 fm bzw.
10,5 fm je ha tatsächlich vorhandener Waldfläche. Diese Werte sind vergleichbar mit
jenen heutiger Donau-Auwälder.
4. Wieviel Holz wurde von der Donau jährlich durch Erosion mobilisiert? (Totholz)
Ohne menschliche Eingriffe in den Auwald wären theoretisch alljährlich im Mittel
6.400 fm an Holz durch Erosion mobilisiert worden. Dies entspricht 60 – 90 rund 200
Jahre alte und 20 – 25 m lange Weiden oder Pappeln, die je Kilometer Donaulauf
erodiert wurden. Es ist aber nicht feststellbar, wieviel davon von der Donau weiter
flussab transportiert wurde oder einfach im Gerinne vor Ort liegen geblieben und
wieder von Sedimenten überlagert wurde. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Auwaldbestände um 1825 ist von einem ca. 50 % geringeren Wert (im Mittel 3.450
fm/Jahr) auszugehen. Für die Hochrechnung des theoretisch anfallenden Totholzes
auf alle österreichischen Donau-Auen siehe Ende des Kapitels 5.6.
5. Wie groß war der jährliche Verbrauch an (Brenn-)Holz in Wien im Vergleich zu den
Holzressourcen der Auwälder und welcher Anteil an erforderlicher Biomasse konnte durch lokale
Ressourcen gedeckt werden?
Wien’s Bedarf an Holz war zu Beginn des 19. Jahrhunderts enorm. Durchschnittlich
wurden um 1825 alljährlich rund 900.000 fm Holz benötigt, wobei Brennholz als
Primärenergieträger rund 86 % ausmachte. Der Rest wurde zum Bauen oder für
diverse Holzprodukte benötigt. Der gesamte natürliche Holzvorrat der Wiener
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 58
Auwälder hätte für nicht einmal 2 Jahre gereicht; der natürliche jährliche Holzzuwachs
hätte nur 8,5 % des Bedarfes abgedeckt. Umso größer wird die Differenz, wenn man
die tatsächlich um 1825 vorhandenen Auwälder betrachtet. Diese vermochten lediglich
ungefähr 2 % des Wiener Holzverbrauchs abzudecken. Um Wien vollständig mit Holz
aus Auwäldern zu versorgen, hätte man den jährlichen Holzzuwachs eines 12-mal so
langen Donau-Abschnittes gebraucht, was 40 % der österreichischen Donau
entspricht. Unter der Annahme einer gleichen Nutzungsintensität der österreichischen
Donau-Auen wie bei Wien, hätte man einen 45-mal so langen Abschnitt gebraucht (=
1,5-mal die Länge der österreichischen Donau).
6. Welche Erkenntnisse sind aus den historischen Analysen für ein ökologisch verträgliches Management
und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Donau-Augebieten unter den aktuell geänderten
naturräumlichen Bedingungen und sozioökonomischen Verhältnissen ableitbar?
Die divergierenden Interessen zwischen „Nützen“ und „Schützen“ und der Bedarf der
Abstimmung sind am Beispiel der Donau-Auwälder und deren Holzressourcen klar
erkennbar. Umweltpolitisches und volkswirtschaftliches Ziel sollte es daher sein,
praktikable und wissenschaftlich fundierte Lösungswege zu erarbeiten, welche die
ökologisch-naturschutzfachlichen Ziele und die legitimen Ansprüchen der betroffenen
Waldeigentümer gleichermaßen berücksichtigen. So könnten im öffentlichen Interesse
rückgebaute (dynamisierte) donaunahe Aubereiche langfristig zur ökologischen
Aufwertung der FFH-Schutzgüter (i. B. prioritäres Schutzgut „Weichholz-Auwälder“),
Verbesserung des ökologischen Zustandes entsprechend der EU
Wasserrahmenrichtlinie und zur nachhaltigen Nutzung naturnaher Auwälder für die
Gewinnung von Bioressourcen beitragen. Für die Umsetzung derartiger Maßnahmen
und das langfristige Management der neu geschaffenen Flusslandschaftsräume sind
jedoch adäquate öffentliche Förderungen und vereinfachte Behördenverfahren eine
notwendige Voraussetzung.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 59
8 English summary
The project "Vienna’s Wood" brought many new insights towards a better understanding
of the largely unregulated Viennese Danube floodplains in river morphological,
aquatic/vegetation ecological, forestal and environmental historical perspective. The results
allow answering the research questions initially listed in chapter 2 (the values given here
refer to the closer study area between Nußdorf and Kaiserebersdorf; question No. 2 to the
entire project area).
1. What annual erosion and aggradation rates were typical for the river-floodplain system of the Viennese
Danube prior to regulation?
Between 1805 and 1825 the annually eroded floodplain terrain fluctuated between 24
and 34 hectares, representing approximately 2.1 to 2.9 ha per km valley length (today
approximately per km regulated river length). This corresponds to 0.4 – 0.6 % of the
floodplain terrain (= potential riparian forest areas; see attached map no. 7). On the
other hand, aggradation and terrestrialization processes generated new floodplain areas
in about the same extent (34 – 37 ha/year).
2. Which riparian vegetation communities were typical for the Viennese floodplain and which
successional/age stages did they show?
Due to the high fluvial dynamics the central corridor of the Danube River was
primarily characterized by softwood communities (in total 34 % of the potential
floodplain areas). These were younger and up to 200 years old successional stages, as
Purple Willows, Deep/High Willow communities and Deep/High Poplar
communities. Most of the older sites (> 200 years) featured transitional forms between
hardwood and softwood forests due to the relatively small depth of the groundwater
table and frequent floodings (48 % High Poplar/High Oak-Elm communities). Real
hardwood forests (High Oak-Elm communities) could only develop on the highest
and oldest sites of the floodplain. 90 % of them were located on more than 300 years
old locations (Leopoldstadt, Roßau, Jedlesee-Floridsdorf-Leopoldau, Simmeringer
Haide).
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 60
3. Which timber yield could theoretically be expected based on the historical site conditions (site age,
hydrological conditions, ...) and how large are the differences in yield compared to today's
regulated/stable floodplains?
Around 1825, the entire potential natural stock of wood in the Viennese floodplain
amounted approximately to 1.6 million solid cubic meters (all wood more than 5 cm
thick) or on average to 269 scm/ha of riparian forest. The natural growth of wood
yielded a total of c. 76,000 scm per year or 12.6 scm/ha. Thus, the stock of wood in
the dynamic Danube floodplain forests was 40 % greater than in today's regulated and
dammed floodplains. The annual growth of wood was also by about 25 % higher than
in today's riparian forests. However, intensively managed forests (hybrid
poplar/cottonwood cultivations) reach much larger values. Considering the prevailing
land and forest uses around 1825, this reduces the wood stock from 1.6 solid cubic
meters to around 280,000 scm. Similarly, the annual growth of wood reduces from
76,000 scm to 20,000 scm or 10.5 scm per ha forest area, respectively. These values are
comparable to those of today's Danube floodplain forests.
4. How much wood was annually mobilized due to the erosion by the Danube River? (dead wood)
Without any human interventions in the floodplain forest on average theoretically
every year 6,400 scm of wood were mobilized by erosion. This corresponds to 60 – 90
about 200 years old and 20 – 25 m long willows or poplars that were eroded per
kilometer river length. However, it is not possible to determine how much of the
eroded wood was transported by the Danube further downstream or remained in
nearby channels and was gradually buried under sediments. Taking into account the
really existing floodplain forests around 1825 a 50 % lower value (c. 3,450 scm/year)
can be assumed. For the extrapolation of the theoretically resulting dead wood for the
entire Austrian Danube floodplains see end of chapter 5.6.
5. How big was the annual consumption of (fuel)wood in Vienna in comparison to the timber resources
in the riparian forests and which proportion of required biomass could be met by local resources?
At the beginning of the 19th century Vienna’s demand for wood was enormous. On
average approximately 900,000 solid cubic meters of wood were needed each year
around 1825, of which fuelwood as primary energy source accounted for
approximately 86 %. The rest was needed for constructions or for various wood
products. The total wood stock of the natural Viennese floodplain forests would have
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 61
reached for less than 2 years, and the natural annual growth of wood would have
covered only 8.5 % of the demand. The greater is the difference, if you look at the
actual existing riparian forests around 1825. They could only cover approximately 2 %
of the Viennese wood consumption. In order to fully supply Vienna with wood from
riparian forests, the annual increment of wood growth of a 12 times longer Danube
section would have been needed, which corresponds to 40 % of the Austrian Danube.
Assuming an equal intensity of wood harvesting in the Austrian Danube floodplains as
in Vienna, a 45 times long river section would have been needed (= 1.5 times the
length of the Austrian Danube).
6. Which conclusions can be drawn from the historical analysis for an ecologically favorable and
sustainable management of Danube floodplains under the current changed natural and socio-economic
conditions?
The diverging interests between "using" and "protecting" and the need for
reconcilement are clearly demonstrated by the example of the Danube floodplain
forests and their timber resources. Environmental and economic policy should
therefore aim to develop practical and scientifically based solutions, which take both
the ecological and nature conservation objectives and the legitimate claims of the
concerned forest owners into account. Thus, in the public interest restored
(dynamized) floodplain areas along the Danube River could contribute to the
ecological enhancement of FFH-protected goods (i.e. priority protection good
according to EU Habitats Directive "softwood floodplain forests"), the improvement
of the ecological status according to the EU Water Framework Directive and to the
sustainable use of semi-natural floodplain forests for the extraction of bioresources.
However, adequate public funding and simplified administrative procedures are
necessary prerequisites for the implementation of such measures and the long-term
management of the newly created river landscapes.
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 62
9 Literaturverzeichnis
Adler, W., Mrkvicka, A.C, Becker, B., Schratt-Ehrendorfer, L., Fischer, M.A., Holzner, W., Leputsch, S., Müllner, A.N. & Vitek, E. (2003): Die Flora Wiens gestern und heute. Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen in der Stadt Wien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrtausendwende. Naturhistorisches Museum, Wien
Ast, H. & Winner, G. (2011): Nutschindeln. Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion – Spaltprodukte. http://holzverwendung.boku.ac.at/refbase/files/ast/2011/274_Ast2011.pdf (05.09.2013)
Beck von Managetta, G. (1890, 1893): Flora von Nieder-Österreich. Handbuch zur Bestimmung sämmtlicher in diesem Kronlande und den angrenzenden Gebieten wildwachsenden, häufig gebauten und verwildert vorkommenden Samenpflanzen und Führer zu weiteren botanischen Forschungen für Botaniker, Pflanzenfreunde und Anfänger. 2 Bände – C, Gerold’s Sohn, Wien
Chaloupek, G., Eigner, P. & Wagner, M. (1991): Wien – Wirtschaftsgeschichte 1740 bis 1938. Teil I: Industrie. J & V, Wien
Drescher, A. & Egger, G. (2013): Wiener Holz – Vegetation. Bericht für das Projekt „Genug Holz für Stadt und Fluss? Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen“ i. A. des Instituts für Hydrobiologie & Gewässermanagement, BOKU Wien, Karl-Franzens-Universität Graz und eb & p Umweltbüro GmbH Klagenfurt
Egger, G., Politti, E., Garófano-Gómez, V., Blamauer, B., Ferreira, M.T., Rivaes, R., Benjankar, R., & Habersack, H. (2013): Embodying interactions of riparian vegetation and fluvial processes into a dynamic floodplain model: concepts and applications. In: Maddock, I., Harby, A., Kemp, P. & Wood, P. (Hrsg.), Ecohydraulics: an integrated approach. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK
Ellmauer T. & Essl, F. (2005): Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter. Band 3: Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Studie im Auftrag der neun österreichischen Bundesländer, des BMLFUW und der Umweltbundesamt GmbH, Wien
Fischer, M., Adler, W. & Oswald, K. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Auflage, Land Oberösterreich und OÖ Landesmuseum, Linz
Gierlinger, S., Haidvogl, G., Gingrich, S. & Krausmann, F. (2013): Feeding and cleaning the city: the role of the urban waterscape in provision and disposal in Vienna during the industrial transformation. Water History, 5 (2), 219-239
Gurnell, A., Tockner, K., Edwards, P. & Petts, G. (2005): Effects of deposited wood on biocomplexity of river corridors. Frontiers in Ecology and the Environment, 3, 377-382
Hager, H. & Eberl, W. (1989): Forstökologische Untersuchungen. unveröffentlichte Studie i. A. der MA 49 – Forstamt u. Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. University of Natural Resources & Life Sciences Vienna (BOKU)
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 63
Handels- u. Gewerbekammer in Wien (1867): Statistik der Volkswirtschaft in Nieder-Oesterreich 1855-1866. Leopold Sommer, Wien, 157-261
Haubenberger, G. & Weidinger, H. (1990): Gedämmte Au – geflutete Au. Vergleichende Grundlagenforschung zur forstökologischen Beurteilung abgedämmter und gefluteter Auwaldstandorte östlich von Wien. MA 49 – Forstamt u. Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Hauer, F. (2010): Die Verzehrungssteuer 1829 – 1913 als Grundlage einer umwelthistorischen Untersuchung des Metabolismus der Stadt Wien. Social Ecology Working Paper, 129, 1-289
Hering, D., Kail, J., Eckert, S., Gerhard, M., Meyer, E.I., Mutz, M., Reich, M. & Weiss, I. (2000): Coarse woody debris quantity and distribution in Central European streams. International Review of Hydrobiology, 85, 5-23
Herrnegger, M. (2007): Historische Hydromorphologie und Geländetopographie der Wiener Donau-Auen. Diplomarbeit am Institut für Hydrobiologie & Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien
Hochwasserschutzverband Donau-Machland (2005): Donau Hochwasserschutz Machland. Umweltverträglichkeitserklärung, Einreichdetailprojekt 2003, Vorhaben – Betriebsphase, Mappe 9: Hydrotechnik, unveröffentlichter Bericht
Hofmann, T., Pfleiderer, S. & Stürmer, F. (2007): Digitaler angewandter Geo-Atlas der Stadt Wien. in: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Bd. 147, Heft 1 u. 2, 263-273, Geologische Bundesanstalt Wien
Hohensinner, S. (2008): Rekonstruktion ursprünglicher Lebensraum-verhältnisse der Fluss-Auen-Biozönose der Donau im Machland auf Basis der morphologischen Entwicklung von 1715 – 1991. Doktorarbeit am Institut für Hydrobiologie & Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien
Hohensinner, S., Herrnegger, M., Blaschke, A.P., Habereder, C., Haidvogl, G., Hein, T., Jungwirth, M. & Weiß, M. (2008): Type-specific reference conditions of fluvial landscapes: A search in the past by 3D-reconstruction. Catena, 75, 200-215
Hohensinner, S., Jungwirth, M., Muhar, S. & Schmutz, S. (2011): Spatio-temporal habitat dynamics in a changing Danube River landscape 1812 – 2006. River Research and Applications, 27, 939-955
Hohensinner, S., Sonnlechner, C., Schmid, M. & Winiwarter, V. (2013a): Two steps back, one step forward: reconstructing the dynamic Danube riverscape under human influence. Water History, 5 (2), 121-143
Hohensinner, S., Lager, B., Sonnlechner, C., Haidvogl, G., Gierlinger, S., Schmid, M., Krausmann, F. & Winiwarter, V. (2013b): Changes in water and land: the reconstructed Viennese riverscape 1500 to the present. Water History, 5 (2), 145-172
Jelem, H. & Mader, K. (1964a): Forstliche Standortskarte Lobau. Forstliche Bundesversuchsanstalt, Institut für Standort, Wien
Jelem, H. & Mader, K. (1964b): Forstliche Standortskarte Prater. Forstliche Bundesversuchsanstalt, Institut für Standort, Wien
Jelem, H. & Mader, K. (1965): Forstliche Standortskarte Lobau-Mühlleiten. Forstliche Bundesversuchsanstalt, Institut für Standort, Wien
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 64
Jelem, H. (1974): Die Auwälder der Donau in Österreich. Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt, 109 A, 109 B
Johann, E. (2005): Das Holz-Zeitalter: Die städtische Holzversorgung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. In: Brunner, K. & Schneider, P. (Hrsg.), Umwelt Stadt. Geschichte des Natur- und Lebensraumes Wien. Böhlau, Wien, 170-179
Julius, E. (2002): Die Bedeutung von Treibholz für große Flüsse am Beispiel der Orther Inseln im Nationalpark Donau-Auen. Bakkalaureatsarbeit an der Fachhochschule Eberswalde, Deutschland
Kail, J., Hering, D., Muhar, S., Preis, S. & Gerhard, M. (2007): The use of large wood in stream restoration: experiences from 50 projects in Germany and Austria. Journal of Applied Ecology, 44, 1145-1155
Krausmann, F. (2013): A City and Its Hinterland: Vienna’s Energy Metabolism 1800 – 2006. In: Singh, S.J., Haberl, H., Chertow, M., Mirtl, M. & Schmid, M. (Hrsg.), Long Term Socio-ecological Research. Studies in Society: Nature Interactions Accross Spatial and Temporal Scales. Springer, Wien – New York
Lager, B. (2012): Historische morphologische Veränderungen der Donau-Flusslandschaft bei Wien 1529 – 2010. Masterarbeit am Institut für Hydrobiologie & Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien
Margl, H. (1972): Die Ökologie der Donauauen und ihre naturnahen Waldgesellschaften. Naturgeschichte Wiens, 2, 675-707
Millennium Report Wetlands (2005): Ecosystems and human well-being: wetlands and water. Millennium Ecosystem Assessment, World Resources Institute, Washington, DC.
MSW Magistrat der Stadt Wien (1883-1913): Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien.
Muhar, S., Pohl, G., Stelzhammer, M., Jungwirth, M., Hornich, R. & Hohensinner, S. (2011): Integratives Flussgebietsmanagement: Abstimmung wasserwirtschaftlicher, gewässerökologischer und naturschutzfachlicher Anforderungen auf Basis verschiedener EU-Richtlinien (Beispiel Steirische Enns). ÖWAW, 9-10, 167-173
Naiman, R.J., Décamps, H. & McClain, M.E. (2005): Riparia – Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities. Elsevier Academic Press, San Diego
Nanson, G.C. & Knighton, A.D. (1996): Anabranching rivers: their cause, character and classification. Earth Surface Processes and Landforms, 21, 217-239
Neilreich, A. (1846): Flora von Wien. Eine Aufzählung der in den Umgebungen Wiens wild wachsenden oder im Grossen gebauten Gefässpflanzen, nebst einer pflanzengeografischen Uebersicht. Fr. Beck, Wien
Neilreich, A. (1859): Flora von Nieder-Oesterreich. Eine Aufzählung und Beschreibung der im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns wild wachsenden oder in Grossem gebauten Gefässpflanzen, nebst einer pflanzengeografischen Schilderung dieses Landes – C. Gerold’s Sohn, Wien
Neilreich, A. (1866): Nachträge zur Flora von Niederösterreich. Braumüller, Wien
Neilreich, A. (1869): Zweiter Nachtrag zur Flora von Nieder-Oesterreich. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 19, 245-298
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 65
Neilreich, A. (1870): Die Veränderung der Wiener Flora während der letzten zwanzig Jahre. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 20, 603-620
N.N. (1866): Wien und das Brennholz. Österreichische Monatsschrift für Forstwesen, XVI, 439-465
Rohatsch, A. (2005): Aus Stein gebaut. Natursteinbau und Baurohstoffe in Wien. In: Brunner, K. & Schneider, P. (Hrsg.), Umwelt Stadt. Geschichte des Natur- und Lebensraumes Wien. Böhlau, Wien, 180-186
Rottleuthner, W. (1985): Alte und lokale nichtmetrische Gewichte und Maße und ihre Größen nach metrischem System. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 104-109
Sandgruber, R. (1987): Die Energieversorgung Wiens im 18. und 19. Jahrhundert. In: Kusternig, A. (Hrsg.), Bergbau in Niederösterreich. NÖ Institut für Landeskunde, Wien, 459-491
Schratt-Ehrendorfer, L. (2011): Donau und Auenlandschaft. Ein Lebensraum voller Gegensätze. In: Berger, R. & Ehrendorfer, F. (Hrsg.), Ökosystem Wien. Wiener Umweltstudien, Band 2, Böhlau Verlag, Wien, 328-391
Schuller, V. (in prep.): Rekonstruktion flussmorphologischer Standortsbedingungen für die Auenvegetation an der Wiener Donau um 1825. Masterarbeit am Institut für Hydrobiologie & Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien
Seidel, M. & Mutz, M. (2012): Hydromorphologische Entwicklung von Tieflandbächen durch Holzeinsatz – Vergleich von Einbauvarianten im Ruhlander Schwarzwasser. Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, 56 (3), 126-134
Sterba, H. & Kissling, K.B. (1989): Grundlagen für Auwaldstandorte aus forstökologischer und ertragskundlicher Sicht. unveröffentlichte Studie i. A. der MA 49 – Forstamt u. Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. University of Natural Resources & Life Sciences Vienna (BOKU)
Tockner, K. & Stanford, J.A. (2002): Riverine flood plains: present state and future trends. Environmental Conservation, 29 (3), 308-330
Weigl, A. (2000): Demographischer Wandel und Modernisierung in Wien. Pichler Verlag, Wien
Wendelberger, E. (1960): Die Auwaldtypen der Donau in Niederösterreich. Cbl. Ges. Forstwesen, 72 (2), 65-92
Wessely, J. (1868): Statistik Niederösterreichs – Forst, Torf, Jagd. Österreichische Monatsschrift für Forstwesen, XVIII, 503-634
Wessely, J. (1882): Österreichs Donauländer (Ober- und Niederösterreich mit Wien). 2. Teil: Special-Gemälde der Donauländer und der Weltstadt Wien. Carl Fromme, Wien, 117-152
Willner, W. & Grabherr, G. (2007): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen, Bd. 1 Textband, Elsevier, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
Wiens Holzressourcen in dynamischen Donau-Auen 66
10 Kartenanhang
Folgende im Bericht angeführte Kartenbeilagen sind für die Wiener Donau-Auen um 1825
dem Bericht beigefügt:
1. Flussmorphologische Situation & Waldflächen
(River morphological situation & forest areas)
2. Morphologische Geländezonen des Augebietes
(Morphological terrain zones of the floodplain)
3. Standortalter der Landflächen
(Site age of the floodplain terrain)
4. Flurabstände bei mittlerem jährlichen Niederwasser (MJNW)
(Depths of the groundwater table at mean annual low water)
5. Überstauung bei 5-jährlichem Hochwasser
(Height of the inundation at a 5-years flood)
6. Feinsedimentauflage im Augebiet
(Fine sediment aggradation in the floodplain)
7. Erosion von Landflächen 1817 – 1825
(Erosion of floodplain terrain 1817 – 1825)
8. Potenziell natürliche Auentypen
(Potential natural riparian vegetation)
9. Potenziell natürlicher Holzvorrat
(Potential natural stock of wood)
10. Potenziell natürlicher Holzzuwachs
(Potential natural growth of wood)
11. Holzvorrat bei Nutzung des Waldes
(Human modified stock of wood)
12. Holzzuwachs bei Nutzung des Waldes
(Human modified growth of wood)