G. Hentschel & M. Grochowski (eds.), Funktionswörter im Polnischen. Oldenburg 1998 (= Studia...
-
Upload
uni-oldenburg -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of G. Hentschel & M. Grochowski (eds.), Funktionswörter im Polnischen. Oldenburg 1998 (= Studia...
Studin Slnvica Oldenburgensia 1
hrsg.von Rainer Grübel und Gerd Hentschel
Maciej Grochowski - Gerd Hentschel
Funktionswörterim Polnischen
Eformationssystem
1998
Bibliotheks- und In der Universität Oldenburg
lnhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber der Reihe..........
Vorwort der Herausgeber des Bandes........
Adam BednarekIilobec - Versuch einer semantischen Analyse 1
lreneusz BobrowskiAre relative connectors necessary in the classilicationof Polish lexemes? t9
Andrzej BoguslawskiThe semantic primitives'someone','something'and the Russian contradistinction-uudydo vs. -?o.......... 33
Adam DobaczewskiOn some contextual asyntagmatic lexemes
Maria GehrmannZur Semantik der je§li-Konstruktionen 77
Maciej GrochowskiOkolo als Vertreter der Klasse der adnumerativen Operatoren............. 99
Björn HansenDie polnischen Modalauxiliare: Semantik, Formund Struktur der Kategorie................. 119
Gerd HentschelSekundäre Präpositionen, primäre Präpositionen,Kasus: przy pomocy, za pomocq, z pomocq undihre funktionalen Aquivalente............. 155
Krystyna KallasOn Polish syntactic constructions with theconjunction nii,'that' 195
tx
55
Verlag/Druck/Vertrieb:
Bibliotheks- und Informationssystemd11^Carl von Ossietzky Unir.rritai Oldenburg(BIS) - VerlagPostfach 25 41,26015 OldenburgTel.: 0441/798 2261, Telefax: Oi+tnSS qOqOe-mail: [email protected]_oldenburg.de
rsBN 3_8142_0629_0
VI
Zuzanna TopolifiskaPolish 2e - all-pcwerful introducer of new clauses
Ewa WalusiakLexical exponents of intratextual hierarchy
219
239
Vorwort der Herausgeber der Reihe
Die Studia Slavica Oldenburgensla sind primär als Publikationsforum derOldenburger Slavistik gedacht. Zwei Aspekte stehen dabei im Vorder-grund: Zum einen sollen sie der Dokumentation der Zusammenarbeitder Oldenburger Slavistik mit Partnern im In- und Ausland dienen, nichtzuletzt der Zusammenarbeit mit den Oldenburger Partneruniversitäten inslavischsprachigen Ländern. Insofern freut es uns, daß der hier vorliegen-de Band I zur polonistischen Sprachwissenschaft aus der langjährigenKooperation mit der Polonistik der Universität Thom hervorgegangen ist.Zum anderen sollen die Studia dem wissenschaftlichen Nachwuchs Ge-legenheit bieten, seine Arbeit einem breiten Publikum vorstellen zu kön-nen. Schon Band II, der bereits im Druck ist, wird eine Reihe von Auf-sätzen bieten, die aus Vorträgen junger deutscher und ausländischerslavistischer Sprachwissenschaftler (darunter Oldenburger und Thorner)resultieren, die sich im Herbst L997 in Konstanz zu einem Symposiumgetroffen haben. Band III schließlich, der ebenso noch in diesem Jahr er-wartet werden darf, besteht in einer monographischen Studie eines jun-gen Oldenburger Literaturwissenschaftlers zu den russischen Heldenependes 18. Jahrhunderts.
Mögen die Studia Slavica Oldenburgensic die Entwicklung der Slavistikan der eigenen Universität und an der Partneruniversität ltirdern undeinen bescheidenen Beitrag zum slavistischen Diskurs im Allgemeinenleisten.
Rainer Grübel Gerd Hentschel
Vorwort der Herausgeber des Bandes
Die vorliegende Sammlung von Aufsätzen zu Funktionswörtern im Polni-schen ist eines der Ergebnisse der Zusammenarbeit polnischer und deut-scher Sprachwissenschaftler im Rahmen des Kooperationsabkommenszwisohen der Nikolar.ls Kopernikus Universität Thom und der Carl vonOssietzky Universität Oldenburg. Nicht alle der hier versammelten Auto-ren sind Vertreter dieser beiden Universitäten. Die gemeinsamen wissen-schaftlichen Interessen der Thorner und Oldenburger Polonisten und Sla-visten gebieten, auch Kollegen von außerhalb der Grenzen Thoms undOldenburgs, ja auch Polens und Deutschlands in die Zusammenarbeiteinzubeziehen. Einladungen zur Mitarbeit an diesem Band sind noch aneine Reihe anderer ausgewiesener Sprachwissenschaftler ergangen, die je-doch aufgrund verschiedener anderer Verpflichtungen in der zur Verfü-gung stehenden Zeit keinen Beitrag einsenden konnten.
Die Problematik der Funktionswörter gehört seit einigen Jahrzehntenzu den zentralen Forschungsgebieten vieler Sprachwissenschaftler, diesich mit Syntax, Semantik, Pragmatik, Lexikographie oder Texttheoriebefassen. Davon zeugt nicht ailetzt die vor über zehn Jahren erschienenePartikel-Bibliographie. Internationale Sprachenforschung zu Partikeln und In-terjektionen (bearbeitet von Harald Weydt und Klaas-Hinrich Ehlers,Frankfurt/M., 1987). In ihr sind ca. 1300 Arbeiten registriert, die sog.Hilfsausdrücke (Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln, Interjektionenund ähnliche) betreffen, Arbeiten vor allem in englischer, deutscher undfranzösischer Sprache.
Lawinenartig angewachsen, insbesondere im letzten Jahrzehnt, istauch die Zahl der Publikationen über Funktionswörter im Polnischen.Neben zahlreichen Aufsätzen in Zeitschriften und Sammelbänden ent-standen auch verschiedene Monographien. Allein im letzten Jahr erschie-nen die Arbeiten von Jadwiga Wajszczuk, System znaczei w obszarze spöj-niköw polskich. Wprowadzenie do opisu (Warschau 1997) und von MaciejGrochowski, Wyrai enia funkcyj ne. S tudium leksykografi czne (Krakau 1 997).In der Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft des Instituts für PoFnische Philologie der Universität Thorn wird ein fortlaufendes bibliogra-phisches Register von Arbeiten zu Funktionswörtern geführt, das pol-nische Publikationen berücksichtigt. Ztm gegenwärtigen Zeitpunkt, ob.wohl es bei weitem nicht als vollständig angesehen werden kann, umfaßt
es ca. 1000 Positionen. Ständig werden neue Arbeiten vorgelegt, auchvon "neuen" Autoren - sprachwissenschaftlern der jüngsten Generation.
Die umfang- und ertragreiche Literatur zu den polnischen Funktions-wörtern liegt weitestgehend in polnischer sprache vor und ist aus diesemGrund unzugänglich für zahlreiche sprachwissenschaftler, die dieserSprache nicht mächtig sind. (Die oben erwähnte partikel-Bibliographieverzeichnet nur drei Arbeiten zu den polnischen Funktionswörtern.) Ausdiesem Grund schien es uns angebracht, einen Band zu polnischenFunktionswörtern in englischer und deutscher Sprache vorzulegen.
Die vorliegenCen Aufsätze aus den Bereichen der Syntax, der Seman-tik und der Textlinguistik gehen von unterschiedlichen methodologischenKonzeptionen aus und setzen sich in der Regel mit bestimmten Funk-tionswörtern aus teils verschiedenen wortarten (Konjunktionen, präposi-tionen, Pronomen, adnumerale Operatoren, Modalverben u. a.) ausein-ander. Daher wurde davon abgesehen, eine thematische Gruppierung dereinzelnen Beiträge zu versuchen. Sie sind in alphabetischer Reihenfolgeder Nachnamen der Autoren angeordnet, und in dieser Reihenfolge sollauch ein Ausblick auf die Aufsätze gegeben werden:
Der Band wird von Adam Bednarek (Thorn) eröffnet, der eine se-mantische Analyse der Präposition wobec vorlegt. Ausgehend von einerdetaillierten und kritischen Prüfung von Einträgen zu wobec in einschlä-gigen Wörterbüchern zur polnischen Gegenwartssprache wird das pro-blem von Monosemie und Polysemie diskutiert. Es rvird die Unmöglich-keit der Reduktion der als Ausgangspunkt angenommenen Mehrdeutig-keit dargelegt, um anschließend vier Kontexttypen mit Verwendungendes untersuchten Ausdrucks herauszuarbeiten, denen jeweils eine De{i-nition zugeordnet wird.
Ireneusz Bobrowski (Krakau) diskutiert die syntaktischen Krite-rien der Klassifikation von Lexemen durch Roman Laskowski aus demJahre 1984. Es wird eine Begründung für die Hypothese gegeben, daß re-lativische Konnektoren keine besondere Klasse bilden, die bei einer Klas-si{ikation von wortarten berücksichtigt werden müßte. Gegenstand derAnalyse des Autors (im theoretischen Rahmen der generativen Transfor-mationsgrammatik) sind Sätze mit sog. Relativpronomen, insbesonderesolche, die eine abhängige Frage einleiten. Bobrowski schlägt vor, auf dieAnnahme einer besonderen Wortart der relativischen Konnektoren zuverzichten und die betreffenden Entitäten - analog zu den sog. Fragepro-
xl
nomen - vier unterschiedlichen Wortarten zuzurechnen, nämlich denSubstantiven, Adjektiven, Numeralien und Adverbien.
Der Beitrag von Andrzej Boguslawski (Warschau), mit dem einBlick in eine andere slavische Sprache erlaubt sei, liefert eine detailliertegrammatische und semantische Interpretation einer paarigen Reihe 'ronPronomen, die eine Spezifik des Russischen darstellen: Pronomen mitden Elementen -uudydo und -ro. Dies geschieht vor einem breiten Hinter-grund von Erwägungen, welche die Aspekte der Existenz, des Wissensund der Wahrheit betreffen, insbesondere hinsichtlich der gegenseitigenErsetzbarkeit der beiden Glieder in affirmativen und negierten Aussage-sätzen sowie in Entscheidungsfragen. Boguslawskis Interpretation bringteine Besiätigung der Hypothese, daß die russischen Pronomen KTo-Tound ,tro-'ro als Aquivalente der englischen someanetnd something lexika-lische Exponenten eines Paares "semantischer Primitive" sind. Somitliefert der Beitrag empirische Evidenz zugunsten der alten These AnnaWierzbickas (aus dem Jahre 7972), daß die oppositiven kognitiven Bedeu-tungen, die im Paar 'someone', 'something' enthalten sind, zum Grund-bestand eines universalen semantischen Systems gehören.
Der Beitrag von Adam Doba czew ski (Allenstein) enthält einesyntaktische und semantische Charakteristik asyntagmatischer, "satzoppo-sitiver" Kontextwörter eines Typs, der in der polnischen sprachwissen-schaftlichen Terminologie als "dopowiedzenie" bezeichnet wird. Sie funk-tionieren als selbständige Aussagen und implizieren linksseitig eine an-dere Aussage. Zt den zentralen Fragen, die in diesem Aufsatz bespro-chen werden, gehört die intratextuelle Referenz der Elemente der unter-suchten Klasse. Hier wird der metatextuelle Status dieser Elemente deut-lich. Im zweiten Teil des Aufsatzes werden semantische Explikationenvon sieben derartigen Lexemen vorgeschlagen, die eine Bestätigung derlinksseitigen Aussage zum Ausdruck bringen oczlnvi§cie, pewnie, jasne, nochyba, a jakie, jak najbardziej.
Maria Gehrmann (Oldenburg/Berlin) gibt einen Überblick übersemantische Relationen, die in syntaktischen Konstruktionen mit derKonjnnktion je§li,'wenn' zum Ausdruck kommen. Vor dem Hintergrundeiner allgemeinen Typologie von Relationen, die auf der Grundlage einerAnalyse komplexerer polnischer Sätze entwickelt wird, erfolgt eine Dis-kussion von Interpretationstypen, die mit jeJliKonstruktionen kompatibelsind. Gegenstand der syntaktischen und semantischen Analyse sindSätze, die folgende Relationen ausdrücken: konditionale, epistemische
xll
(mit thematischer und wertender Interpretation), kausal-formale, kontra-stierend-konzessive. Die ersten beiden Relationstypen werden als typischfür Konstruktionen mit jesli herausgearbeitet, die beiden anderen alsperipher; letztere können nur unter bestimmten Bedingungen realisiertwerden.
Maciej Grochowski (Thorn) schlägt in seinem Beitrag die An-nahme einer (zu den unflektierten gehörenden) wortart der adnumerati-ven operatoren vor, welche syntaktisch nur in verbindung mit Numeraliabzw. von Numeralia abgeleiteten Ausdrücken auftreten. Im Rahmeneiner allgemeinen syntaktischen charakterisierung derartiger Elementewird der Kontrast zwischen zwei Lexemen diskutiert: zwischen der prä-position okolo und dem adnumerativen operator okolo. Trotz gleicherAusdrucksform und gleicher Bedeutung sind sie nicht als eine Einheit,sondern als zwei verschiedene, grammatisch homonyme Einheiten zuqualifizieren. Der zweite Teil des Aufsatzes enthält den vorschlag einerExplikation des Ausdrucks okolo mit Hilfe relativ simpler semantischerEinheiten. Dabei wird von einer Analyse des Begriffs der Approximationausgegangon, der durch dic semantisch homogene Klasse der adnumera-tivcn Opcrat«rrcn implizicrl wirtl.
lliirrrr ll rr , s c n (ll.nrhurg) charaktorisicrt die Kategorie der Modali-tiil in llirrsit:lrt aul'ilrrc lirrnrale (morphologische wie auch syntaktische)trrrtl scrnunlischc struktur im Rahmen eines prototypischen Ansatzes.Nac:h (o1 vorstellung der Metasprache der semantischen Beschreibung,wclche die Theorie der elementaren Einheiten Anna wierzbickas aus-nutzt, sowie nach einer untersuchung der polnischen Modalverben hin-sichtlich ihrer Zugehörigkeit zu zentralen oder peripheren untermengendieser Klasse zeichnet der verfasser ein lexikographisches Bild von sechszentralen (mieö, moina, möc, musieö, naleiy, powinien) und fünf peripherenRepräsentanten (chcieö, potrafiö, trzeba, wolno, wypada) und schlägt seman_tische Explikationen für sie vor. Die heterogene und partiell nur unscharfabzugrenzende Klasse der Exponenten der Modalität nimmt aus dersicht Hansens im sprachsystem eine intermediäre position im Grenzbe-reich von Lexikon und Grammatik ein, eine position zwischen Funk-tionswörtern und "vollexikalischen" Einheiten.
Gerd Hentschel (oldenburg) diskutiert drei präpositionale Fü-gungen przy pomocy, za pomocq, z pomocq, ,mit Hilfe' in ihren Relationenzu den ihnen bei belebten Ergänzungen funktional nahe stehenden pri-mären Präpositionen (insbesondere z plus Instrumental, ,mit,) und zu
xIl
den "reinen Kasusformen" (hier dem Instrumental) bei unbelebten Er-gänzungen. Hinsichtlich des kategorialen Status der drei Fügungen wirdihr unterschiedliches syntaktisches Verhalten im Kontext personalerErgänzungen einerseits und unbelebter Ergänzungen andererseits unter-sucht. Die Fügungen przy pomoq), za pomocq, z pomocq verhalten sich mitpersonalen Ergänzungen wie eigenständige" präpositional markierte No-minalgruppen, bei unbelebten Ergänzungen dagegen als Ganzes wie se-
kundäre Präpositionen. Im Hinblick auf die Semantik korreliert damii,claß das Verhältnis z'r,vischen den drei Fügungen einerseits und der Frä-position z plus Instrumental anrJererseits bei personalen Ergänzungenoppositiv ist, bei unbelebten hingegen, also das Verhältnis der sekundä-ren Präpclsitionen zum "reinen" Instrumental, variativ. Im ietztgenanntenFall korrelieren semantisch und / oder konstruktionell unmarkierteKontexte mit einer Präferenz für den reinen Kasus, markierte Kontextemit einer Präferenz für die sekundären Präpositionen.
Gegenstand des Beitrags von Krystyna K a I I a s (Thorn) ist die Be-schrcibung der Struktur verschiedener syntaktischer Konstruktionen mitder kornparativen Konjunktion nii, welche nach formalen Kriterien zuunterscheiden sind. Die Verfasserin ermittelt die Distribution und diellierarchie von vier Bestandteilen dieser Konstruktionen, nämlich derKornparativform, der Konjunktion selbst und der zwei verglichenenKomponenten. Auf der Basis einer Analyse der super- oder subordinati-ven Relationen zwischen diesen Bestandteilen stellt Krystyna Kallas fest,daß die Konjunktion nii als konstitutiver Bestandteil der Konstruktionobligatorisch ihre drei anderen Bestandteile konnotiert. Die Komparativ-form konnotiert die Konjunktion nii dagegen nur fakultativ, wobei erste-re die letztgenannte gleichzeitig akkommodiert. Die hier vorgeschlageneAnalyse bewegt sich im Rahmen des syntaktischen Ansatzes, der in Po-len durch Zygmunt Saloni und Marek Swidziriski, d. h. durch die Auto-ren des Bandes Sktadnia wspölczesnego jgzyka polskiego (Warschau 1985,1987) vertreten wird.
Der Beitrag von Zuzatna Topoliriska (Skopje) liefert eine Bestä-tigung der These, daß der syntaktische Operator 2e im Polnischen eineuniversale Fähigkeit hat, abhängige Sätze unterschiedlicher Typen einzu-führen. Vor dem Hintergrund einer Übersicht der grammatischen Funk-tionen von ie bespricht die Verfasserin zwei Serien extensionaler konnek-tiver Ausdrücke mit diesem Operator, die folgende Schemata realisieren:(1) Präposition + Demonstrativpronomen in kataphorischer Funktion + /e
xlv
als operator, der die Position für den abhängigen satz eröffnet: der Typ... przez to, ie ...; ... dzigki temu, 2e ...; (2) Partikel (Satzadverb) + ie mitderselben Funktion wie in (1): der Typ ... chyba ie ...; ... Ulko ie ... Diehier an polnischen Beispielen vorgeschlagenen Arten der Formalisierungkonjunktionaler Diskursprädikate (unter Beteiligung von /e) sind, wiezuzanna Topoliriska belegt, auch charakteristisch für viele andere slavi-sche und nicht-slavische Sprachen, besonders für die romanischen.
Abgeschlossen wird der Band durch einen Beitrag von Ewa W a I u -s i a k (Thorn). Sie bietet vorschläge an zur Explikation lexikalischer Ein-heiten, die drei Gruppen von Exponenten der intratextuellen verknüp-fung und der Hierarchisierung von Inhalten von Textfragmenten reprä-sentieren: przy,'bel'; nie tylko..., lecz tak2e..., 'nicht nur..., sondern auch...'; nie ..., tylko..., 'nicht ..., nur ...'. Es werden zwei Typen der Hierar-chisierung (von Elementen der außersprachlichen welt und von Elemen-ten der Aussage) im Text unterschieden sowie drei Arten der Verknüp-fung (anaphorische Verknüpfung; Verknüpfung durch Ausdruckswie-derhclung; Anknüpfung an ein Element der semantischen Struktur). Aufdieser Basis werden Mechanismen der Hinzufügung von Information, derBestätigung tind der Negation (des Verwerfens) besprochen, um auf dieseweise semantische Komponenten der hierarchisierenden Exponenten zuunterscheiden, welche teils den einzelnen Gruppen gemein, teils für dieeinzelnen Einheiten spezihsch sind.
Wir haben die Hoffnung, daß durch die hier vorgelegte Sammlungvon Aufsätzen, die aus der Zusammenarbeit zwischen der Thorner undder Oldenburger Polonistik hervorgegangen ist, die Problematik der ge-genwärtig (schwerpunktmäßig in Thorn) durchgeführten Untersuchungenzum Gegenstand des Interesses eines größeren Kreises von Sprachwis-senschaftlern wird.
***+**
l)ic llerausgeber des Bandes bedanken sich bei Frau Nicole Störmer fürtlir: Anfertigung eines reprofähigen Typoskripts, bei Robert Mclaughlinliir die abschließende Beratung zur sprachlichen Gestaltung der Beiträgeirr cnglischer Sprache sowie bei Hauke Bartels und Thomas Menzel fürvcrschicdenste Hilfeleistungen.
Maciej {-jroohowski Gerd Hentschel
Adam Bednarek, Thorn
Wobec - Versuch einer semantischen Analyse
l. Gegenstand dieses Artikels ist die semantische Analyse von wobec.
2. Informationen zum Begriff wobec wtrden den folgenden Wörterbü-chern entnommen: MSJPSkor, MSJPSob, SJPD, SJPSz, SS, SWJP, PSJP
sowie der den polyprädikativen Ausdrücken gewidmeten Monographie(iRocHowsKrs (1984).
Die Mehrzahl der betrachteten Arbeiten liefert Informationen überrlie Zugehörigkeit des untersuchten Begriffes zur Klasse der "'Wortar-tcn"l :
1. MSJPSkoT - (S. 904)1.1 "als Präposition" - drei Bedeutungen;
"als Adverb in: Wszem w. a. wszem w. i kaidemu z osobnd -eine Bedeutung;
2. MSJPSob - (S. 1031)2.1 "als Präposition" - vier Bedeutungen;2.2 "als Adverb in: Wszem w. albo wszem w. i kaidemu z osobnd -
eine Bedeutung;
3. SJPD - (S. 1194lIX)
Wortarten werden in diesen Arbeiten traditionell behandelt. Demzufolge werdenentweder fünf unterschieden: Präposition, Adverb, Konjunktion, Partikel und In-terjektion, oder vier: Präposition, Adverb, Konjunktion, Partikel (vgl. SINIEL-NIKoFF L964, Ll9-139). Eine Ausnahme bildet SWJP, wo dreizehn Wortartenunterschieden werden: Substantiv, Pronomen, Adjektiv, Zahlwort, Verb, Adverb,Modulator, Präposition, Kojunktion, Relator, Interjektion, Apposition, metatextu-eller Operator (vgl. SWJP, XD.Am Rande der Überlegungen zur kategoriellen Zugehörigkeit von wobec soll dieparadoxe Situation vermerkt werden, auf die man bei der Analyse von MSJPSob,MSJPSkoT und PSJP stößt. In allen diesen Werken werden für Interjektionen alsBeispiele die Ausdrücke Bgc!rund Hop! angefihrt Als Lemmata aber kommen siedort gar nicht vor. Von den insgesamt 71 im SJPSz als Interjektion qualifiziertenEinheiten bekommen im Wörterbucheintrag in MSIPSob nur 15 diese Bewertung(dazu zwei Wortgruppen "w funkcji wykrzyknika" und zwei Ausdrücke "w funk-cji wykrzyknienia").
3.1 "als Präposition mit Substantiv (oder anderem Ausdruck mitsubstantivischer Funktion) im Genitiv; in diesen Verbindun-gen bedeutet wobec ..."
4. SJPSz - (S. 739)4.1 "als Präposition mit Substantiv (oder anderem Ausdruck mit
substantivischer Funktion) im Genitiv";
5. SS - keine Information
6. PSJP - (S. i134)6.1 "als Präposition" - vier Bedeutungen;6.2 "als Adverb in'. wszem w. albo wszem w. i kaidemu z osobna,, -
eine Bedeutung;
7. SWJP - (S. 1239)1 .l wobec - "Adverb mit Genitiv" - fünf Bedeutungen;7.2 wobec powyiszego - "Konjunktion." - eine Bedeutung;7.3 vrobec tego -- "Konjunktion." - eine Bedeutung;1.4 wobec tego,2e - "Konjunktion." - eine Bedeutung;
In allen betrachteten Wörterbüchern ist wobec als Präposition polysem.In MSJPSkoT gibt es drei Bedeutungen, im MSJPSob und PSJp - je vier,im SWJP - gar fünf Bedeutungen. Die Situation wird noch etwas kom-plizierter, wenn wir die Frage nach der Zahl der Bedeutungen des unter-suchten Ausdrucks im SJPD und SJPSz stellen. Diese Schwierigkeitenentstehen aus der Verschwommenheit des Terminus "Bedeutungsnu-ance" in der Einleitung zu SJPD (vgl. S. XXXV). Wollte man die dorti-gen Ausführungen wörtlich verstehen, so müßte man annehmen, daß dieübergeordnete Definition von wobec in diesem Wörterbuchwie folgt lautet:"Präposition mit Substantiv (oder anderem Ausdruck mitdessen Funktion) im Genitiv; in diesen Verbindungen bedeutet wobec...". Dagegen finden sich unter den drei folgenden lateinischen Buchsta-ben a), b), c) drei Bedeutungsvarianten des untersuchten Schlagwortes.Eine ähnliche Situation tritt in SJPSz2 auf, wo jedoch vier "Bedeutungs-nuancen" angegeben sind. Der Einfachheit halber legen wir fest, daß eine"Bedeutungsnuance" hier als selbständige Bedeutung gilt, weil es schwer-
2 In der Einleitung zu SJPSz fehlt jedwede Information zu Konventionen der Ver-wendung lateinischer Buchstaben als Exponenten von,,Bedeutungsnuancen,,.Kurz gesagt, dieses Wörterbuch sieht keine Konvention vor, derartige Unterschei-dungen zu treffen.
3
liillt, gemeinsame Bedeutungskomponenten der von den einzelnen Auto-ron vorgeschlagenen Definitionen (die auf die lateinischen Buchstabenlblgen) explizit anzugeben.
Offensichtlich ist es für die weiteren Ausführungen von besondererIledeutung, welcher Art die in den Wörterbüchern aufgeführten Defini-tionen sind. Konkret geht es hier um die Feststellung, ob es sich um ge-genständliche (grob gesagt: synonymische oder periphrastische) Definitio-nen oder aber um metasprachliche handelt. Im ersteren Fall entsteht dieweitere Frage, ob die Definitionen analytischen Charakter haben (das De-liniens ist eine Folge von Elementen, die semantisch einfacher sind alsdas Definiendum) oder eine nicht analytische (Dehniens und Dehnien-dum haben den gieichen Grad an semantischer Komplexität)3.
Das Bedeutungsspektrum stellt sich in den einzelnen Wörterbüchernlolgendermaßen dara:
1. MSJPSkoT - (S. 904)1.1 "w (czyjej) obecno§ci, przy (kimf ,'in fiemandes) Gegenwart,
vor (emandem)'1.2 "w stosunku do kogo",'gegenüber jemandem'1.3 "z powodu, z racji (czego), dla (czegof,'wegen (etwas), für (et-
was)'
2. SJPD - (S. 1194/IX)2.1 "w obecno§cf, 'in Gegenwart'2.2 "w stosunku do czego§ lub kogo§, ze wzglgdu na co§ lub na ko-
go.f', 'gegenüber einer Sache / jemandem, in Hinblick auf et-was oder jemanden'"w poröwnaniu z czym",'im Vergleich mit / zu etwas'
SJPSz - (S. 739)"oznaczajqcy: w (czyjej§) obecno§ci, przy ftim§)','in (iemandes)Gegenwart, vor (iemandem)'"oznaczaj4cy: w stosunku do kogo§ lub czego§', 'gegenüber zu
2.3
J.
3.1
3.2
J
4
jemandem oder einer Sache'3.3 "oznaczaj4cy: w poröwnaniu z czym§', 'im Vergleich zu etwas'
Siehe dazu z. B. GRocHowsru (1988; 1993).
Dieses Bedeutungssystem umfaßt nur wobec als Präposition.
3.4 "oznaczaj}cy: z powodu, z racii czego§, dla czego§, ze wzglgdu nu
co,f', 'wegen etwas, für etwas, mit Rücksicht auf etwits, itnHinblick auf etwas'
4. MSJPSob - (S. i031)4.1 "w (czyjej) obecno§ci, przy kiml','in (emandes) Gegonwirrt'
vor fiemandem)'4.2 "w stosunku do kogo",'gegenüber jemandem'
4.3 " z powodu, z racji (czego), dla (czego),'wegen etwas, für'4.4 "w poröwnaniu z czym", 'im Vergleich mit / zu etwas'
s. PSJP - (5.1134)5.1 "w (czyjej§) obecno§ci, przy (kim§)','in (iemandes) Gegonwart,
vor (iemandem)'5.2 "w stosunku do kogo§','gegenüber jemandem'
5.3 "z powodu, z racji (czegoi), dla (czego§)', 'wegen etwas, für'5.4 "w poröwnaniu z czym§', 'im Vergleich mit / zu etwas'
6. SS
6.1 wobec synonym zu w poröwnaniu, 'im Vr:rgloich' s. v. ina<:zci
(201);6.2 wobec synonym zu przez (und dementsprechend auch zu:
wskutek, na skutek, z powodu, za przyczynq, z racji, ze wzglgdu,
przez wzglqd, w wyniku, w nastgpstwie, w konsekwencji, 'infolge,
aufgrund') s. v. poniewai (656);
6.3 wobec synonym zu je§li idzie o, wzglgdem, odno§nie do, co do, w
zwiqzku z s. v. pöino (688);
7. SWJP - (S. 1239)
7.1 "wskazuje na osoby obecne przy danej czynno§ci; w obecno§ci,
prd','Hinweis auf anwesende Person; in Anwesenheit von,
bei';7.2 "wskazuje na przymusowq, zwykle niepomy6ln4, okoliczno§Ö,'
w obliczu", 'Hinweis auf zwangsläufige, gewöhnlich ungünsti-ge Umstände; angesichts';
7.3 "wskazuje na adresata czynno§ci, stanu uczuciowego lubsklonno§ci; w stosunku do, wzglgdem", 'Hinweis auf Adressat,
Gefühlszustand oder Neigung; im Verhältnis zu, bezüglich';7 .4 "wskazuje na ptzyczyrq; z powodu, wskutell','Hinweis auf Ur-
sache; wegen, infolge';
5
7 .5 "wskazuje na przedmiot pordwnania; w poröwnaniu z, w zesta-wieniu l', 'Hinweis auf Vergleichsobjekt; im Vergleich mit,angesichts'.
Aus obiger Zusammenstellung wird klar, daß die Mehrzahl der Defini-tionen nicht analytische gegenständliche Synonymdefinitionen sind. Aus-nahmen sind nur das SJPSz und das SWJP. Die Definitionen im erstendieser Wörterbücher haben gewissermaßen metatextliche Einführungen,denen eine nichtanalytische Synonymdefinition foigt. Lediglich in SWJPhat das Deltniens jeweils deutlich zweiteiligen Aufbau - der erste, analy-tische Teil ist von metatextlicher Art, der zweite dagegen ist synony-misch.
Die in allen sieben Wörterbüchern der polnischen Sprache vorgefun-denen Synonymdefinitionen stellt die folgende Tabelle zusammen:
SWJP MSJPSkor.
SJPD SJPSz MSJPSob
PSJP ss
1 w obecno§ci,
orn (l .'1..\
1.1 2.1,. 3.1. 4,L, 5.1 fehlt
2. w obliczu (7.2.) fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehltJ. w stosunku do,
wzsledem (7.3.\t.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.3.(?)
4. z powodu,
wskutek (7.4.)1.3. fehlt 3.4. 4.3. 5.3. 6.2.
5. w porownanlu z,
w zestawieniu z(7.s.)
fehlt 2.3 -r.J- 4.4. 5.4. 6.1
6. Ifehlt] fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt je§liidzie o,
odno§nie
do, co do
Es ist also nur e i n e Bedeutung - und zwar diejenige mit den beidenSynonymen w stosunku do, wzglgdem repräsentierte - in allen sieben Wör-terbüchern verzeichnet. Darüber hinaus erscheinen in sechs der unter-suchten Wörterbücher Bedeutungen, die durch folgende Ausdrücke wie-dergegeben werden können - erstens: w obecno§ci, przy, zweitens; z poyto-du, wskutek, drittens: w poröwnaniu z, w zestawieniu z, Die durch w obliczusowie durch je§li idzie o, odno§nie do, co do repräsentierten Bedeutungen
(r
haben insofern isolierten Charakter, als sie sich nur einmal finden. DasBeispielmaterial aus SWJP zeigt, daß wobec in den folgenden fünf Kon-texten vorkommt:
1) jemand tut etwas / verhält sich zu jemandem (in dessen An-wesenheit) auf bestimmte Weise; z. B. Udawal wobec go§ci
osobg troskliwq. 'Er spielte den Gästen gegenüber den Besorg-
ten'.
2) jemandl ist / wird konfrontiert mit etwas2 (etwas2 stcllt eincndurch jemandl "unerwünschten" Zustand dar); 't. B. Znalazlsig wobec nowych trudno§ci, wobec now.ych zagroiui.'Er sah sichneuen Schrvierigkeiten, Gefahren gegcnübor.'
3) jemandq ist irgendwie / hat etwas bezilglioh (hinsichtlich) je-
mand2; z. B. Byl bezwzglgdn.y wobcc slabszych, lojalny wobec
wladzy. 'Er war rücksiclrlstos gcgenüber Schwächeren, lokalgegenüber dcr ()brigkciL' l{a zobowigzania wobec rodzicöw.'Erhat \zerpflichtungcn gegen seine Eltern.' Stosowal te same kry-teria wobec wszystkich.'Er an alle die gleichen Maßstäbe.'
4) etwasl entsteht aus (infolge) etwas2; z. B. Nie zostal przyjgty na
studia wobec braku wolnych miejsc.'Er wurde wegen fehlenderStudienpiätze nicht immatrikuliert.' Wobec poniesionych strat
zaklad zbankrutowal. 'Der Betrieb ging wegen erlittener Ver-luste bankrott.'
5) etwasl ist irgendwie bezüglich (im Vergleich zu) etwas2; z. B.'fYymagania nauczyciela matematyki sq du2e wobec wymagai je-go zastgpcy.'Die Ansprüche des Mathematiklehrers an seinenVertreter sind hoch.'
In SJPSz irnden sich im Beispielmaterial von 126 Artikelns 135 lkon-textuelle) Sätze6 mit wobel .
Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen dem analysier-
ten Ausdruck und den Deltniensreihen in den Synonymdehnitionens
5
6
1
Die Lemmata der Wörterbuchartikel werden im Anhang I aufgelistet.
Eine Liste der Verwendungskontexte befindet sich im Anhang 2.
Dies betrifft nur das "propositionale" wobec.
7
kann man mit Sicherheit feststellen, daß keines der definierenden Ele-mente hyperonym zu allen durch die Autoren der Wörterbücher hervor-gehobenen Bedeutungen der untersuchten Reihe ist. Vgl. z. B:
(1) Wojna jest zbrodni4 wobec czlowieka.'Der Krieg ist ein Verbrechen gegen den Menschen.'
aber:
(2) *Wojna jest zbrodni4 w obecno§ci czlowieka.'Der Krieg ist ein Verbrechen in Anwesenheit des / einesMenschen.'
(3) Byl wyniosty wobec podwladnych.'Er war arrogant zu Untergebenen.'
aber:*Byl wyniosly w obliczu podwladnych.'Er war arrogant vor Untergebenen.'
Bezsilny wobec losu.'Machtlos dem Schicksal gegenüber.'
aber:
(6) *Bezsilny w stosunku do losu.'Machtlos im Verhältnis zum Schicksal.'
(7) WiemoSö wobec krdla.'Die Treue zum König.'
aber:
(8) *Wierno§ö z powodu krdla.'Die Treue wegen des Königs.'
(Satz 8) ist zwar nicht direkt irreführend, hat aber eine andere Bedeutungals der zugrunde liegende Satz 7); vgl. das nicht widersprüchliche:
(9) On jest wierny wobec kröla, ale nie z powodu kr6la.'Er ist dem König treu, aber nicht des Königs wegen.'
(10) Minimalistyczna postawa wobec 2ycia.'minimalistische Lebenseinstellung'
Ich nehme an, daß in sogenannten synonymischen Definitionen zwischen Defi-niendum und Dehniens in Wirklichkeit eine ein- oder zweiseitige hyponymischeRelation besteht.
(4)
(s)
8
aber:
(11) *Minimalistyczna postawa w poröwnaniu z 2yciem.'minimalistische Einstellung im Vergleich zum Leben'
Dies heißt natürlich nicht, daß wobec notwendigerweise mehrdeutig ist.
Allgemein gesagt läßt sich feststellen, daß in den polnischcn lexikogra-phischen Ausarbeitungen eine deutliche Tendenz zu zahlrcichcron Be-
deutungen sichtbar wird (vgl. die Analyse der Wörtorbuclrlrtikcl), dage-
gen lassen sich im Bereich der lexikalischen Scmantik rcduktivc Noigtrrt-gen nachweisen. GRocHowsKI (1984) untorschcirlct in SWI) z.wci l(cla-tionen F + wobec Ng :
3.4.2.10. die Relation F + woäec Ng ([)
Kontext: To jabtko jest g,orzkic wohcc smuku tamtcgtt 'Dieser Apfel ist bittcrim Vergleich zu jenem.'
Andere Exponenten:p + w poröwnaliu z N1 '. Choruba Adama byla i;lnha w poröwnaniu z powuin.v'rtt
stanem zdrowia Pfuttra.'Ätl;tnts Krankheit war gar nichts im Vcrglcich ztr
Peters Zustand.'
F + w zestawieniu z N1 : lego gra byla imponujgca w zeslawicniu i rc(ttillrtttMarii.'Sein Spiel war imposant im Vergleich zu Marias Rezititl.' .1.4.,1 ll.die Relation F + woäec Ng (II)Kontext: Przeprosila siostrg wabec §wiadköw.'Sie bat die Schwcsttr vot Zt'tt
Ben um Entschuldigung.'
Andere Exponenten:
F + w obecno§ciN": Wrgczono mu nagrodg w obecno§ci ntinislru.'lit crlrrt'lldie Auszeichnung in Anwesenheit des Ministers.'
F + przyNlss'. Udawala osobg toskliwq przy go§ciach.'Sic spiclle rlrc llc.sorgte vor den Gästen.'
Präpositionen als Exponenten dieser Relation beschränken die Klirssc rlt'r
mit ihnen gemeinsam auftretenden Substantive auf Personurthczt:lt'lrrrurrgen. Vgl. den Gegensatz: wobecl - wobec II. Nominalphrascn ttril tlct l'tttposition wobec in noch anderen Verwendungsweisen werdcrt tlttttlt tltt:;
Grundprädikat impliziert: Jan jest nieufny wobec iony. Maria .1rst htTtltntwobec wladzy. In solchen Sätzen ist die Präposition wobec (im Ulrlrrrst lrrcrl
zu wobec I, II) durch wzglgdem ersetzbar. GRocuowsrt (1984,264\.
Grochowskis These von der Existenz der oben angeführten zwci l{t'lrr-tionen muß als gleichbedeutend mit der These von der zumindosl zwt:l-
fachen Bedeutung des von mir untersuchten Elementes angeschcn wcr-
den. Der Ordnung halber merken wir an, daß Grochowski auch cirrtr
9
Konjunktion mit der Relation p WOBEC TEGO, ZE q anftihrt (sieheGnocaowsrt 1984, 2gl)e .
3. Das Problem der (präpositionalen) Mehrdeutigkeit von wobec läßt sichnicht lösen, ohne zuvor das Objekt unserer Untersuchungen klar anzu-geben. Es ist offensichtlich, daß die realen semantischen Eigenschaften(oder ihr Fehlen) nicht isolierten sprachlichen Figuren zugeschriebenwerden können, sondern Elementen, die in der Fachliteratur als lexikali-sche Einheitenlo geführt werden. Man muß gleich feststellen, daß es fürsolche mit wobec nicht immer leicht zu entscheiden ist, ob nun wobecnurTeil einer Einheit ist oder aber ein Element, welches eine selbständige le-xikalische Einheit konstituiert. Anders gesagt, es gibt Beispiele für Sätze,in denen wobec mit Sicherheit Teil einer Einheit ist, aber es linden sichauch Beispiele, in denen wobec als einziger lexikalischer Exponent derEinheit vorkommt (außer Exponenten haben wir es im allgemeinen auchmit Bestandteilen in Form grammatikalisch und / oder semantisch erklär-ter Valenzen zu tun). Die erstgenannte Situation tritt meines Erachtensin Satz (12) aul während sich die zweite in Satz (13) findet;vgl.:
(12) Stacja radiometryczna [...] podaje polo2enie kierunkowe ka2-dego samolotu wobec ziemi. (SJPD IX, 1194)'Die radiometrische Station gibt die Position jedes Flugzeugsgegenüber dem Boden an.'
(13) Przeprosila siostrg wobec §wiadk6w. (GRocHowsKr 1984,264)'Sie bat die Schwester vor Zeugen um Entschuldigung.'
Es gibt aber auch sehr zahlreiche Kontexte, die sich nicht klar und in-tuitiv einer der beiden Klassen zuordnen lassen. Das bedeutet natürlichnicht, daß dergleichen Kontexte nicht Realisierungen der ersten oderzweiten Art wären. Ganz im Gegenteil - sie müssen entweder zur einenoder aber zur anderen gehören. Ich schließe die Existenz von Zwischen-klassen aus. Beispiele derartiger Kontexte sind die Sätze:
(14) Jan jest agresywny wobec Marii.'Jan ist zu Maria aggressiv.'
9 Derartiger Gebrauch ist nicht Gegenstand meiner Untersuchungen.
10 Zum Begriffder lexikalischen Einheit siehe u. a. BoGUSr.AwsKr (1976; 1988).
r0
(15) Piotr jest uprzejmy wobec studentek.'Peter ist zu Studentinnen höflich.'
(16) Marek zachowuje sig nieladnie wobec kobiet.'Marek benimmt sich Frauen gegenüber schlecht.,
(17) Andrzej jest lojalny wobec szefa.'Andrzej ist zum Chef loyal.'
Man kann sie, meiner Ansicht nach, zumindest auf zweicrlei Weise inter-pretieren: Erstens indem man annimml, wobcc sei der einzige lexikalischeExponent einer Einheit der Form z. B. jaki§ wobec kogo§,'irgendwie zujemandem'. Für eine solche Lösung scheincn sich die Autoren von SWJpauszusprechen. Zweitens indem man wobec als Teil einer Einheit vomTyp kto$ jest agresywny wobec kogo§, 'jemand, ist aggressiv gegenüber je-mandemr', kto$ jest uprzejmy wobec kago§, iemand, ist höflich zu jeman-demr' etc. beschreibt (vgl. die Interpretation des Satzes Kozacy kubaiscypozostali laialni wobec Jelcyna, 'die Kubankosaken blieben gegenüberJelcyn loyal' in Bera (Ms.)). Ich meine, daß beide hier vorgeschlageneInterpretationsversuche nicht allzu glücklich sind. Vielmehr glaube ich,daß man auf allgemeine Art und Weise die Klasse der Adjektive (bzw"die der Adverbien) charakterisieren kann, deren Elemente vor dem unter-suchten Ausdruck auftreten können. Im Ergebnis erhalten wir zumindestzwei neue Einheiten - kto4 jest jaki§ wobec kogo§r, 'jemand, ist irgend-wie zu jemandemr,. kto§, zachowuje sig jako§ wobec kogo§r, 'jemand, be-nimmt sich irgendwie zu jemandemr' anstelle der ...zig oder gar Hunder-te, die sich aus der zweiten Lösung ergeben würden.
Die Einheit kto§, iest iaki§ wobec kogoJ2 scheint von nicht allzu großersemantischer Kompliziertheit zu sein. Sie teilt nur etwas über das Ver-halten einer entsprechenden, im gegebenen Kontext nicht näher präzi-sierten Relation zwischen jemand, und jemand, mit. Diese Abhängigkeitläßt sich folgendermaßen def-rnieren:
kto§, Jesl jaki§ wobec kogo§r: gdy my§lE o tym, jaki jest kto§,, to topowoduje, 2e zaczynam my§leö o niml i kim§r; 'wenn ich darandenke, wie jemand, ist, dann beginne ich deshalb an ihn, und je-mand, zu denken'
vel.
Ian jest agresywny (uprzejmy, lojalny) wobec Marii. 'Jan ist aggressiv(höflich, loyal) Maria gegenüber': gdy my§lp o agresywno6ci (uprzej-
il
mo§ci, lojalno§ci) Jana, to to powoduje, 2e zaczynam my§leö o Janiei Marii. 'Wenn ich an Jan's Aggressivität (Höflichkeit, Loyalität)denke, so führt das dazu, daß ich an Jan und Maria denke.'
Hinter dieser Position steht jedoch ein Zirkelschluß. Die Gruppe jaki jestktu§, muß nämlich als spezihsche Abkürzung für die Phrase kto§ jest jaki§wobec kogo§, Jemand ist so und so zu jemandem' genommen werden.Dies ist klar, weil jenes bycie jakim§ faktisch der Name einer R e I ati o nist. Folglich muß obiger Vorschlag leicht modifiziert werden. Ich schlagevor:
kto§, Jest jaki( wobec kogoSr: gdy my§19 o kim§,, to jest co6
fiakby) w nim, co powoduje, 2e zaczynam my§leö o nim, ikim§,'wenn ich an jemanden, denke, so ist (es, als ob) etwas inihm was bewirkt, da ich an ihn, und jemanden, denke'
Satz (15) z. B. ist potentiell mehrdeutig. In Abhängigkeit davon, zu wel-cher Einheit das Segment wobec gerechnet wird, erhalten wir entwedereinen vollen Satz (in dem alle durch Prädikate geöffnete Valenzen be-setzt sind), oder aber einen elliptischen; vgl. die mögliche Weiterung:
(18) Piotr jest uprzejmy wobec studentek w stosunku do swojegoasystenta.'Peter ist höflich zu Studentinnen im Vergleich zu seinemAssistenten.'
Also:
(19) Piotr jest uprzejmy dla asystenta w obecnoSci studentek.'Peter ist zu seinem Assistenten vor Studentinnen höflich.'
Vgl. auch:
(20) Jan jest uprzejmy wobec sekretarki tylko wobec studentek,natomiast wobec palacza jest wobec sekretarki agresywny iniegrzeczny.'Peter ist zur Sekretärin nur vor Studentinnen höflich, vordem Heizer jedoch ist er zur Sekretärin aggressiv und un-freundlich.'
Die Bedeutung der Einheit wobec kogo§ kann nicht auf die oben charak-terisierte Bedeutung reduziert werden. In Wörterbüchern der polnischenSprache ist sie durch Synonyme als w obecno§ci, przy erklärt. Eine solche
l2
Bedeutung führt auch Grochowski an und illustriert sie an folgenden Bei-spielen:
(21) Przeprosila siostrg wobec swiadk6w.'Sie entschuldigte sich vor Zeugen bei ihrer Schwester.,
(22) Wrgczono mu nagrodg w obecnosci ministra.'Er erhielt die Auszeichnung in Anwesenheit des Ministers.,
(23) Udawala osobg troskliwq przy gosciach.'Sie spielte die Besorgte vor den Gästen.,
was besagt wobec kogo§ im satz (21) und die ihm entsprechenden Grup-pen w obecno§ci kogo§, przy kims in (22) und (23)? Ganz allgemein gesagt,stellen diese sätze das vorkommen gewisser sachverhalte fest, die durchHauptprädikate ausgedrückt werden. Darüber hinaus wird festgestellt,daß diese sachverhalte in jemandes Anwesenheit eintraten. Anders aus-gedrückt - jemand war dort, wo es zu F kam (wir nehmen mit Gro-chowski F + wobec Ng als schema für dergleichen sätze an). Erschöpftsich damit die Bedeutung des betrachteten Elementes? Die untersu-chungen von Bera scheinen eine solche These zu bestätigen - siehe "Mit-tels der Präpositionalphrase wobec deutet der sprecher auf ein g e m e i n-sames Vorkommen: [...j der Akt der Entschuldigung und dieAnwesenheit von Zeugen. Mit der Benutzung von wobec bestimmt derSprecher jeweils die verhältnisse zwischen dem, was durch das Hauptprä-dikat ausgedrückt und dem, was durch das beigefügte prädikat ausge-drückt wird." (Brne Ms.). Schöpft aber nun dieses gemeinsameVorkommen die Bedeutung von wobec aus? Nach meiner überzeu-gung - nein. Mehr noch - es geht hier gar nicht um ein rein physikali-sches gemeinsames Vorkommen an einem bestimmten Ort. Vgl. dasinakzeptable:
(24) *Przeprosila go§ci wobec 6wiadk6w i nie wiedziala, 2e jesttak2e kto§ jeszcze opröcz niej i gosci.'Sie bat die Gäste vor Zeugen um Entschuldigung und wußtegar nicht, daß außer ihr und den Gästen noch jemand dawar.'
Anders gesagt - das durch wobec konnotierte Element kann nicht etwasgegenüber dem in F beschriebenen Zustand Externes repräsentieren.wenn jemend in Anwesenheit von zeugen um Entschuldigung bittet ("Ie-ieli kto§ przeprosil kogo§ wobec §wiadköw, 'wenn jemand einen anderen vor
l3
Zeugen um Entschuldigung gebeten hat'), dann können diese Zeugennicht nur versteckte Beobachter dieses Vorgangs sein. Wenngleich alsodas durch wobec konnotierte Element auf keine Weise (etwa indirekt)durch das Hauptprädikat des Satzes konnotiert ist, so repräsentiert esdennoch jemanden, dessen Existenz einer Person bewußt ist, über die imSatz gesprochen wird (bei normaler Betonung und natüriichem Satzbau).Folglich meine ich, daß'zur gleichen Zeit an einem ge-meinsamen Ort sein' gar nicht hauptsächliches konstituierendesElement der untersuchten Einheit ist. Ein passenderer Kandidat für dieseRolle scheint die nichtdefinierbare Einheit byö czg§ciq czegoS,'Teil vonetwas sein' zu sein. Ich schlage vor:
stalo si9 F wobec N, 'F passierte bei N':czg{ci1 tego, o czym mdwig möwi4c F byl N'ein Teil von dem, worüber ich spreche, wenn ich F sage, war N'
Natürlich erschöpft obiger Yorschlag nicht die Bedeutung des untersuch-ten Elementes, wir haben es hier mit einer partiellen Definition zu tun.Das Wesen der Rolle von N in F besteht in der spezifischen Passivitätvon N. Ich verstehe das so, daß N Teil des Sachverhalts F ist, ich miraber diesen Sachverhalt ohne N nicht vorstellen kann. Ich schlage letzt-endlich vor:
stalo sig F wobec N, 'F passierte bei N':czg§ciy tego, o czym m6wig möwi4c F byl N, a gdyby nie bylo N, tote2 möglbym powiedzieö F'ein Teil von dem, worüber ich spreche, wenn ich F sage, war N,und wenn N nicht gwesen wäre, so hätte ich auch F sagen können'
Der nächste Kontext, in dem ein Element der Form woäec Ng auf-taucht, wird im von GRocHowsKI (1984) angeführten Satz deutlich:
(25) To jablko jest gorzkie wobec smaku tamtego.'Dieser Apfel schmeckt bitter im Vergleich zu jenem.'
Andere Exponenten dieser Relation sind w poröwnaniu z N1, w zestawieniuz N1, 'im Vergleich zu Ni, gegenüber N1' (vgl. GnocuowsKl 1984,264).Zusammenhänge dieser Art lassen sich auf keine der bisher betrachtetenRelationen zurückführen. Allgemein gesagt vergleicht in derartigen Sät-zen der Sprecher zwei Sachverhalte. Es handelt sich aber nicht um daseinfache, direkte Yergleichen, mit dem wir es etwa im folgenden Satz zutun haben:
14
(26) To jablko jest bardziej kwa§ne od tamtego.'Dieser Apfel ist sauerer als jener.'
Metaphorisch gesprochen, ist der in Sätzen des untersuchten Types mit-tels F kommunizierte Sachverhalt gewissermaßen auf den zweiten ,,pro-
jiziert", dessen lexikalischer Exponent N ist (Ausgangsschema - F + wo-äec Ng). Das Element Ng repräsentiert das, was dem Sprecher erlaubt, Fzu sagen. Wir schreiben das Ausgangsschema ausführlicher - S jest p wo-Dec Ng. Der unten angeführte Explikationsversuch scheint alle zuvorsignalisierten Intuitionen zu umfassen:
S jest P wobec Ng, 'S ist P gegen Ng': mySl4c o tym, jakie jest Smy§19 o N; to powoduje,2e mogg powiedzieö: S jest P'Wenn ich daran denke, wie S ist, denke ich an N; folglich kann ichsagen:
^S rst P
Konkret:
Choroba Jana jest blaha wobec powaZnego stanu zdrowia Piotra.'Jans Krankheit ist belanglos angesichts Peters Zustandcs.'
My§lac o tym, jaka jest choroba Jana my§lg o powaZnym staniczdrowia Piotra; to powoduje, 2e mogg powiedzieö: Choroba.lana.jcs!blaha.'Wenn ich daran denke, wie Jans Krankheit ist, denko ich an dcnernsten Zustand Peters; folglich kann ich sagen: Petcrs Krankhcit istbelanglos.'
Die letzte Art Kontext mit dem hier untersuchten Element sin«l Sätzeder Art:
(27) Nie zostal Wzyjpty na studia wobec braku wolnych micjsc.'Er wurde nicht immatrikuliert wegen fehlendcr Studicn-plätze.'
(28) Wobec poniesionych strat zaklad zbankrutowal.'Der Betrieb ging wegen erlittener Einbußen bankrott.'
Sätze dieser Art drücken - entgegen der in den entsprechenden Artikelnder Wörterbücher der polnischen Sprache vorzufindenden Ansichten -keine Kausalrelation aus. Wohl kann man sie etwa in Gruppen mit demElement z powodu, wskutek etc. umformen. Wahr ist aber auch, wie schonBERA (Ms.) bemerkt, daß wir im Ergebnis dieser Substitutionen keine zuden Ausgangssätzen bedeutungsgleichen Sätze erhalten. Es scheint also,
l5
daß die Ergebnisse der Autorin hinsichtlich derartiger Kontexte korrektsind1l .
Zweifellos behauptet der Sprecher solcher Sätze nicht, oder sogarabgeschwächt - er sagt nicht einmal, daß N die Ursache für F ist (S istP). Es offenbart sich vielmehr ein Motivationszusammenhang zwischenden durch den Sprecher geäußerten Urteilen. Die Hauptmitteilung ist inder Zeichenfolge enthalten, welche die grundlegende Prädikat-Argument-Struktur realisiert. In den Sätzen (27), (28) sind das die Gruppen niezostal przyjgty na studia; zaklad zbankrutowal. Es gibt eine an Sicherheitgrenzende Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Ursache dieser Sachverhaltedas Fehlen freier Studienplätze bzw. die erlittenen Einbußen waren.Jedoch ist in den Sätzen nicht die Rede davon, daß ein solcher Zusam-menhang besteht. Vielmehr gibt es einen Zusammenhang zwischen dendurch den Sprecher ausgedrückten Urteilen. Ich schlage vor:
S jest P wobec Ng, 'S ist P gegenüber Ng': to, 2e m6wig S jest Ppowoduje, 2e chc7 powiedzied N.'Die Tatsache, daß ich ,S lsr P sage, führt dazu, daß ich N sagenwill.'
4. Im Verlauf der semantischen Analyse habe ich vier Arten von Kontex-ten mit dem untersuchten Element ausgezeichnet. Jedem Typ habe icheine analytische Synonymdehnition zugeschrieben. Ohne abschliessendüber deren Adäquatheit urteilen zu wollen, hoffe ich doch, daß sie viel-leicht zumindest weiteren, erschöpfenderen Beschreibungen des hier un-tersuchten wobec die Richtung weisen.
11 BERA schlägt folgende Explikation für alle eigenständigen Verwendungen vonwobecyor:
"möwi4c, 2e F wobec N, möwig : to, o czym mdwig, m6wi4c F' jest takie, ienie mogg nie powiedzied jednocze§nie o tym, 2e N"' (BERA Ms.)'das, was ich sage, wenn ich F' sage, ist derart, daß ich gar nicht umhin kann,gleichzeitig N' zu sagen'
Ich meine, diese Explikation stellt einen interessanten Versuch dar, die Bedeu-tung mancher, jedoch nicht aller, Kontexte des hier untersuchten Ausdrucks zuerfassen. Dabei stimme ich der These von der Eindeutigkeit des untersuchtenAusdrucks nicht zu.
l6
Anhang Iwörterbucheinträge mit Beispielen f'd,r wobec im sJpsz: dgrcsywny, altemawa, dseku-racja, bezradno§ö, bezradny, bezsilnosö, bezsilny, biernosö, bierny, blamowaö iig, btomaa,blainiö sig, charakteryzowaö sig, chtebodawca, czynny, dqö, iterikatny, demaikowaö sig,despotyczny, dlug, dystansowaö sig, el<sponent, elegancki, glupio, grzeczny, igraszka, indyfe_rentny, kapitulowaö, kara, konspirowaö sig, lojarnosö, manifesrowaö, mentor, minimari-slyczny, monadyczny, nadskakiwaö, nastawienie, negawn), niechgtnie, nieelegancki, nielo-jalnie, nielojalnoiö, nielojalny, nieludzko, nieladnie, nieröwnosö, niesolidarny, niespra-wiedliwy, nieszczery, nie§mialy, nietolerancyjny, nieuczciwie, niewiernosö, niezaradnosö, nie-iyczliwo§ö, niiszo§ö, obojgtnie, obojgtnosö, odpowiedzialnosö, odpowiedzialny, oporny, pew-no§ö, pietyzm, ploszczyö sig, poblailiwy, posluszeistwo, postdwa, postawiö sig, przewiniö,przewinienie, przykty, przymus, realnosö, represja, rezenya, röwny, skapirutiwaö, skom_promitowaö, sluialczo§ö, sluiabtwo, spoköj, stawiaö sig, stosowaö, subordynacja, surowy, sz-czery, szwny, terytorialny, tolerancja, tolerancyjny, uchybienie, ucßk, uczyniö, ugodowo,uleglo§ö, uniiono§ö, uniiony, upokorzyö, uprzejmosö, uprzejmy, usluiny, ustqpiö, ustgpli_wo§ö, ustgpliwy, uwlaczaiqcy, wdzigcznosö, wierkoduszny, wiernosö, winny, woicc, wrogosö,*yniosly, wyrozumialy, zaborczo, zachowaö sig, zachowanie, zagranica, zaklopotanie, za-manifestowaö, zastrzeienie, zblednqö, zbtainiö sig, zdrada, zobojgtnieö, zobowiqzanie,zuchwalo§ö.
Anhang 2
verwendungskontexte von wobec im sJPSz: Byö agresywnym wobec kogo§; stanqö przedalternatywq, wobec altemawy; Asekuracja wobec kogo§; poczucie bezradnosii wobecbrutalno§ci, przemocy; Byli bezradni wobec przemocy; Bezsilnosö czlowieka wobec prawprzyrody; Bezsilny wobec losu, czyjego§ uporu, przemocy wroga; Biernosö wobec przeciwnoscilosu; Zajmowaö biernq postawg wobec iycia; Blamowaö sig wobec kogo§; Stosowaö blokadgwobec jakiego§ paistwa; Blainiö sig dla jakiegos powodu, wobec kogo§; charakteryzowaösig wobec otoczenia sttym zachowaniem; obowiqzki pracowniköw wobec chlebodawcöw;czynna postawa wobec iycia; Dqö sip wobec dawnych kolegöw, przed dawnymi kolegami;Byli nierwykle delikatni wobec (w stosunku ilo) ludzi starych; Demaskowaö sig przed kim,wobec kogo oderwaniem sig, zachowaniem; Byö, staö sig despotycznym (wobec kogo§, wstosunku do koeo§); Mieö dlug wdzigcznosci wobec kogo§; Dystansowaö sig wobec kogo§,wobec jakiej§ sprawy; El<sponenci dwöch postaw wobec iycia; Byt elegancki wobec kobiet;Glupio jest komu§ wobec kogo§, z jakiegos powodu; Grzeczny dla kogo§, wobec kogo§; co§wydaje sig dziecinnq igraszkq wobec czego§ ; Ludzie indyferentni wobec postgpu naukowego;wobec takich argumentöw musial kapitulowaö; stosowaö, zastosowaö wobec kogos karg(cielesnq, §mierci); Konspirowaö sig wobec otoczenia; Lojatnosö wobec paistwa; Mini.festo-waö swq niechgö, sympatig do kogo§, wobec kogo!; przybieraö wobec kogos ton mentora;Minimalistyczna postawa wobec iycia; Posrawa monadyczna wobec swiata; Byl nadska-kuiqcy wobec przelo2onych; Nastawienie do kogo§, czego§, wobec kogo§, czegoi, w stosunkudo kogo§, czego§; NegatTwna postawa wobec czego§; Byt niechgtnie usposobionym wobeckogo§; Byö nieeleganckim wobec kogo§; Postgpowaö nielojalnie wobec kogo§; Nielojatnosöwobec kolegöw, w stosunku do kolegöw; Byl nietojalny wobec przyjaciela; zachowaö sig
t7
nieludzko wobec kogo§; Zachowywal sig nieladnie wobec kobiet; Nieröwno§ö wobec prawa;Byö niesolidarnym w stosunku do kogo§, wobec kogo§; Byö niesprawiedliwym wobec kogo§,dla kogo§; Byö nieszczerym wobec kogo§, w stosunku do kogo§, z kim§; Byö nie§mialymwobec kogo§; Byö nietolerancyjnym dla kogo§, wobec czyich§ poglqdö,n; Postgpowaö nieucz-ciwie wobec kogo§; Niewierno§ö wobec idealöw; Niezaradno§ö wobec trudno§ci iyciowych;Nieiyczliwo§ö wobec kogo§; Uznaö swojq niiszo§ö wobec kogo§, w jakiej§ dziedzinie; Ma-gnes zachowuje sie obojgtnie wobec drutu cynkowego; Obojgtno§ö dla kogoi, dla czego§,
wobec, wzglgdem kogo§, czego§; Odpowiedzialno§ö przed zwierzchnikiem, spoleczeistwem(wabec zwierzchnika, spoleczeisfiya); Odpowiedzialny wobec rodziny; Oporny wobec czyich§iqdai; Wobec niej tracil calq pewnoiö; Mieö, iywiö pietyzm dla kogo§ lub wobec kogo§;Flaszczyö sig wobec kago§; Na stara§ö stal sig bardziej poblailiwy wobec innych;Posluszeistwo rodzicom a dla rodzicöw, wobec rodzicöw; Aktywna, bierna, asekuranckapostawa wobec iycia, wobec rzeczTwßto§ci, wobec losu; Przyjqö, mieö jakg§ postawg wobecczego§, kogo§; Postawiö sig wobec czyich§ iqdai, wobec kogo§; Przewiniö wobec rodzicöw;Przewinienie wobec rodzicöw; Byö prrykrym dla kogoi, w stosunku do kogo§, wobec kogo§;Stosowaö wobec kago§ przymus; Stangla wobec realno§ci iycia; Stosowaö represjg wobeckogo§, przeciw komu§; Zachowywaö sig z rezerwq wobec kogo§; Wszyscy obywatele sq röwniwobec prawa; Skapitulowaö wobec nadmiaru tudnoici; Skompromitowaö kolegg wobecznajomych; Sluialczo§ö wobec zwierzchnika; Sluiclstwo wobec kogo§; Spoköj wobec nie-powodzei, klgsk; Stawiaö sig wobec nauczycieli, wobec opiekunöw; Nie stosowaö wobeckogo§ przymusu Stosowaö wobec kogo§ bojkot towarzyski; Subordynacja wobecprzeloionych; Surowy dla dzieci, wobec dzieci; Byö z kim§, wobec kogo§ szczerym; Bylsztywny wobec nieznajomych; Roszczenia, iqdania terytorialne Qeilnych paistw wobecdrueich); Tolerancja wobec uczniövt, mlodszych kolegöw; Byö tolerancyjnym wobec cudzychpoglqdöw, wobec czyich§ dziwactw; Uchybienie wobec starszego czlowieka; Stosowaö uciskwobec ludno§ci okupowanego paistwa; Przykre uczucia uczynily jq nieufnq wobec ludzi;Byö ugodowo usposobionym wobec czego§; Uleglofiö dzieci wobec rodzicöw, w stosunku dorodzicöw; Uni2ono§ö wobec rodzicöw; Byö uniionym wobec przeloionych; Upokorzyö kogo§przed znajomymi, wobec znajomych Upokorzyö sig wobec rodzicöw; Uprzejmo§ö dla kobiet,wobec kobiet; Uprzejmy dla koleianek, wobec podwladnych; Byö usluinym wobec kobiet;Nie ustgpowal wobec gröib; Ustgpliwo§ö wobec kogo§, czegoi; (lstgpliwy wobec kogo§,czego§; Zachowal sig wobec nas w sposöb uwlaczajqcy; Czuö wdzigcznoSö wobec kogo§; Byöwielkodusznym wobec wrogöw; Wiemo§ö krölowi, wobec kröla; Czuö sig winnym wobeckogo§; Przeprosiö kogo§ wobec §wiadköw; Przemöwiö wobec tlumu; Mieö obowiqzki wobecdziecka; Wojna jest zbrodniq wobec czlowieka; Byl okrutny wobec slabszych; Upal w pokojubyl niczym wobec spiekoty panujqcej na z€wnqtu; Moje zmarwienie jest niewielkie wobectwoich zmattwiert; Nie mögl kupiö samochodu wobec braku oszczgdno§ci; Ilobec groibynapastnika musial sig cofngö; Nie ukrywaö swojej wrogo§ci wobec kogo§; Byl wynioslywobec podwladnych; Nauczycielka wyrozumiala wobec (dla) uczniöw; Zachowywaö sigwobec kogo§ zaborczo; Zachowaö sig biernie wobec wypadköw; Zachowanie cörki wobecrodzicöw; Reprezentowaö Polskg wobec zagraniq; Odczuwaö wobec kogo§ zaklopotanie;Zamanifestowaö swojq niechgö, sympatig do kogo§, wobec kogo§; Mieö zastrzeienia co doczego§, wobec kogo§, w stosunku do kogo§; Czyje§ zmartwienia, klopoty zbladly wobecnieszczg§ö innlch; Zblainiö sig wobec kogo§; Dopu§ciö sig zdrady wobec kogo§, czego§;Zobojgtnieö wobec ludzkiej niedoli; Zobowiqzania wzglgdem rodziny, wobec sprzymierz-ertcöw, w stosunku do przyjaciöl; Zuchwalo§ö dziecka wobec matki;
l8
Literatur
BERA, M. Ms; Wobec - przyimek wielo- czy jednoznaczny?
BocUSLAwsKt, A. 1976 O zasadach rejestracji jednostek jgzyka. ln: Po-radnik Jgzykowy, z. 8
BocusrewsKt, A. 1988: Jgzykw slowniku. WroclawGnocsowsrl, M. 1984: Skladnia wyraLei polipredykatywnych. (Zarys
problematykl). ln: Z. Topolirlska (red.): Gramatyka wspölczesnego jgzy-ka polskiego. Skladnia. Warszawa, 273-300
GRocHowsKI, M. 1988: Podstawowe zasady dehniowania wyraZen wslowniku jednojgzycznym. In: W. Luba§ (red.): Woköl slownika wspöl-czesnego jgzyka polskiego. Wroclaw, 45-62
GRocHowsKI, M. 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyra2ei jg-zykowych. Warszawa
MSJPSkoT 1969: Maly Slownik Jgzyka Polskiego. (red. S. Skorupka, H. Au-derska, Z. l,empicka) Warszawa
MSJPSob 1994: Maly slownik jgzyka polskiego. (red. E. Sobol) WarszawaPSJP 1996: Podrgczny slownik jgzyka polskiego. (opr. E. Sobol) WarszawaSINIELNIKoFT', R. 1964: Czg§ci mowy. In: W. Doroszewski, B. Wieczor-
kiewicz (red.): Gramatyka opisowa jgzyka polskiego z öwiczeniami. TomI. Warszawa, 119-139
SJPD 1958-1969: Slownik jezyka polskiego. (red. W. Doroszewski) War-szawa
SJPSz 1978-198t: Slownik jgzyka polskiego. (red. M. Szymczak) War-szawa
SS 1993: Slownik synontmöw. (Andrzej D4bröwka, Ewa Geller, RyszardTurczyn) W'arszawa
SWJP 1996: Slownik wspölczesnego jezyka polskiego. (red. B. Dunaj) War-szawa
Ireneusz Bobrowski, Cracow
Are relative connectors necessaryin the classification of Polish lexemes?
The tree diagram which presents the functional classihcation of Polishiexems proposed by Laskowski (see GRzEcoRCzyK^own and others,1984,32), especially its branch with a relative connector (i. e. the indica-tor of syntactic relations), on its top might cause at least one diff,rcultproblem for any reader who wants to examine it. Connectors are a cate-gory of the highest order. They can be indicators of syntactic subordina-tion. A second group of connectors are coordinating conjunctions whilethe ltrst can be indicators of syntactic subordination of noun phrases(prepositions) or clauses. If the relative connector is an indicator of sub-ordination of a clause, but it is not a part of it, it belongs to the class ofsubordinating conjuctions. But if the relative connector is the indicator ofsubordination of a clause and simultaneously one of the components atthis clause then it belongs to the category of relative connectors. In thehrst part of my paper, I will discuss the problem mentioned at the begin-ning of this paragraph. A question which arises after closer study refersto whether there is a correlation between, for example, interrogative pro-nouns and relative connectors or not. As it is well known, there is noplace for pronouns in Laskowski's classification of Polish words. The tra-ditional interrogative pronouns kto and co used in sentences:
(1) Kto widzi Jana?
who see Jan'Who sees John?'
(2) Co sprowadza tutaj Jana?what bring here Jan'What brings Jan here?'
(3) Kogo Jan nie widzi?who66; Jan5r6.; not see
'Who does Jan not see?'
20
(4) Czego Jan nie widzi?what Jan not see
'What does Jan not see?'
are contextual realizations of the nouns KTO and CO. Adjectival, nu-meral and adverbial relative pronouns receive a similar treatment. Insentences like
(5) Jakim Jan jest czlowiekiem?what kind Jan is a man'What kind of man is Jan?'
Ktörych ksi42ek Jan nie przeczytal?
which books Jan not read'Which kind of books did Jan not read?'
Ilu Jan ma przyjaciil?how many Jan has friends'How many friends has Jan got?'
(8) Jak Jan mieszka?how Jan lives'How does Jan live?'
the forms jakim, ktörych, ilu, jak are realizations of the adjectives JAKI,KTÖRY, the numeral ILE and the adverb JAK. Consequcntly the initialquestion can be expressed in the following way:
(9) Are relative connectors distributionally complementary withnouns such äs KTO, CO, adjectives such as JAKI, KTORY,numerals such as ILE and adverbs such as JAK?
To anticipate the further exposition of the case, I can add the follow-ing auxiliary question:
(10) Does the attribute "relative" have its reason with reference tothe class of words which is marked by the tree diagramdiscussed at the beginning?
If we reformulate the analyzed tree diagram as below
21
(1 1)
constituent of thesubordinate clause
indicator ofsyntactic subordination
of clause
indicators ofsyntactic connections
of noun phrase
outside thesubordinate clause
syntagmatic lexeme
A
(6)
(7)
CONNECTOR SUBORDINATECONJUNCTION
we can give the afhrmative answer to the question asked above. W'e canaccept that in the sentences:
(12) Ten, kto nie czyta, nie wie.this one who not read not know'This one who does not read does not know.'
(13) Chlopak, kt6ry przyszedl, siedzi.the boy that came sits.'The boy that came is sitting.'
(14) Jan jest taki, jak wczoraj byl Jerzy.Jan is like which yesterday was Jerzy'Jan is like Jerzy was yesterday.'
(15) Chlopak6w przyszlo tylu, ilu zostalo zaproszonych.boys came as many how many were invited'As many boys came as [boys] were invited.'
22 23
(25) *Jan wie, pigciu chlopakdw przyszlo.Jan knows five boys came
(26) *Jan wie, komfortowo Maria mieszka,Jan know comfortable Maria lives
The contextual words dziewczyna, wysoki, dobry, pigciu, komfortowo are di-stributional equivalents of kto, ktöry, jaki, ilu, jak. Therefore it can be ex-pected that since the sentences (17-21) are acceptable, the sequences(22-26) should be acceptable as well. But this is not the case. To makethese sentences acceptable we have to add the conjuction ie, 'that'.Given the facts that, firstly, sentences (17-21) are acceptable without theconjunction 2e arrd, secondly, that they are unacceptable sequences withthe conjuction 2e:
(27) *Jan wie, äekto przyszedl.
(28) *Jan wie, 2ektöry chlopak przyszedl.
(29) *Jan wie, 2e jaki panuje tt zwyczaj.
(30) *Jan wie, 2e ilu chlopakdw przyszlo.
(31) *Jan wie, 2e jak Marysia mieszka.
and, thirdly, that the conjunction ie ts an indicator of syntactic subordi-nation, then the contextual words kro, ktöry, jaki, ilu, jak are not "realiza-tions" of the noun KTO, the adjectives KTÖRY, JAKI, numeral ILE andthe adverb JAK.
The contextual words mentioned above conform to the definition ofconnectors, as can be easily inferred from the tree diagram placed above.They are indicators of syntactical relations. The difference between thetree (11) and the tree in Gnzr,coRczYKowA and others (1984) consistsin a different terminology. I use the term connector at the lowest level. Ihave not described the more general class by a single term. This generalclass is named "connector" by Roman Laskowski, but at the lowest levelof the tree he uses the term "relative connector". On the basis of theformer argument it follows that the attribute "relative" has been used un-properly.
The attribute "relative" clearly refers to traditional syntax. Three waysof linking main and subordinate clauses were accepted there: 1. conjunc-tional, 2. relative 3. interrogative-relative. The class of relative connectorscan be applied only to the sentences (12-16), i. e. to that type of connec-
(16) Jan §pi tak, jak sobie poslal.
Jan sleeps in that way how for himself made bed'Jan sleeps as well as he made his bed.'
and in the sentences:
(17) Jan wie, kto przyszedl.Jan knows who come'Jan knows who came.'
(18) Jan wie, ktdry chlopak przyszedl.Jan knows which boy came'Jan knows which boy came.'
(i9) Jan wie, jaki panuje tu zwyczaj.Jan knows which rules here custom'Jan knows what custom rules here.'
(20) Jan wie, ilu chlopaköw przyszlo.Jan knows how many boys came'Jan knows how many boys came.'
(21) Jan wie, jak Maria mieszka.Jan knows how Maria lives'Jan knows how Maria lives.'
the relative pronouns are indicators of syntactic subordination of clausesas well as part of these clauses.
There is no need to-,,defend" the thesis that the forms kl4 ktöry, jaki,ilu, jak in the sentences (12-16) are indicators of syntactic subordination.This point of view is generally accepted by linguists. However, the state-ment that the forms kto, ktöry, jaki, ilu, jak are indicators of syntactic sub.ordination in the sentences (17-21) as well, seems to be controversial.Let us consider the following unacceptable sequences and compare themwith sentences (17-21):
(22) *Jan wie, dziewczyna przyszla.Jan knows a girl came
(23) *Jan wie, wysoki chlopak przyszedl.Jan knows a tall boy came
(24) *Jan wie, dobry panuje tu zwyczaj.Jan knows good rules here custom
24
tion, which in traditional grammar was considered as relative. Thus, thisclass does not include sentences (17 -2Dt . It was perhaps understood inthe same way by Lesrowsru. However, the definition of the class, whichcan be inferred from the tree diagram placed in his part of the "Morpho-logy", forces us to look for connectors in so-called interrogative-relativesentcnces. Therelore it would be more appropriate to use lhe term "con-nector" instead of "relative connector".
GRocgowsrl (1986, 33ff) used the more adequate ,,relator" in hisclassification. He aims at words which are not used separately, whichhave junctive function, which do not govern case and which are in thesyntactic position of one of the components of linked clauses. Thereforehis relators can be identified both in sentences (12-16) and in sentences(17 -21) by the qualities which are mentioned in the de{lnition. Howeverthe term "relator" can be associated with relativization, i. e. the operationwhich inserts relative clauses. Thus, in the rest of my paper I will use theterm "connector" without the determining attribute "relative".
To be precise, I have to add that in Grochowski's classification onlyuninflected lexemes are considered. This does not imply that it is impos-sibie to separate relators among inflected lexemes. However, in accor-dance with principles of classification based on inflexion, we should con-sider three additional classes of relators: (1) inflected by case and unin-flected by gender (KTO2), (2) inflected by case, gender and number(KTÖRYr), (3) inflected by case and gender but uninflected by number(ILE2). They all are syntactically different from nouns, adjectives andnumerals that have an identical representation on the expression plane(marked with a following 1, e. g. KTO1).
But the point is whether we should distinguish so many homonymicpairs. Moreover I do not examine this problem in the same way as someother linguists, who reject detailed distributive research which leads todistinguish many classes of lexems. I acknowledge the superiority of thecriterion of completeness of grammatical description above the criterionof descriptional economy. In other words, economy is useless if the de-
scription is not complete.However, under certain methodological assumptions - as it seems -
we may do without some lexems called connectors (relators), and the
The same point was made by Wr6bel and Grochowski during the discussion ofan earlier version of the present article.
25
grammar will not become less complete. The affirmative answer to ques-
tions (9) and (10) leads us to such a solution. We may assume that con-nectors are complementary to, for example, interrogative pronouns whichbelong to the class of nouns, adjectives, numerals and adverbs. If a lex-eme with identical phonological representation appears in a single clauseor in the main clause of a complex clause, it is the realization of a noun,an adjective, a numeral or an adverb. But if it appears in the subordinateclause, it will be the realization of a lexeme called connector or the reali-zation of one of four relators (also see Gnocgowsrr 1986, 46-47).
It is accepted in traditional structuralistic phonological descriptionthat phones which are in complementary distribution are the realizationsof the same phoneme (at least if they are similar in terms of sound fea-tures). It seems sound to take such phonological principles in grammati-cal description into consideration as well.
In my syntactic description of Polish, which owes much to the trans-formational approach (see BonnowSKI 1995), I assume that the sentence
(32) Chlopak wie, 2e dziewczyna czyta ksiqikg.a boy knows that a girl reads a book'A boy knows that a girl is reading a book.'
has the underlying structure:
(33) s'
,4'.com6 's
I ,4.eNPVPL..
chlopäk Y S'
Iwie Comp St,\
i" NP VPI ,ndziewczyna V Ntt
czyta ksiq Lkg
26
which is motivated by the following phrase structure rules:(34) S'-+ Comp S
Comp -+ e
Comp -+ SppS-+NPVPVP -+VNpVP-+VS,
where e symbolizes an empty clement, and the symbol spp a subordinateconjunction.
Accepting this subset, we should notice that subordinate conjunctionsdo not appear beyond the subordinate clauses S', but only beyond S.This second symbol indicates a category dominated by S,. It is in accor-dance with the <iistributional facts because in the pair of sentences
(35) Janek wie wszystko.Janek knows everything'Janek knows everything.'
(36) Janek wie, 2e Jurek idzie.Janek knows that Jurek idzie'Janek knows that Jurek is going.,
the sequence Jurek idzie is not a distributional equivalent of .wszystko,butthe sequence ie Jurek idzie is. It has to be noticec tha.t ihe subclass ofrules in (34) allows us to build the following tree:
(37) S',
,4'.Comp S
I ,4..IeNPVPI ,4.
chlopak V S'
| ,.A..wie Comp SIAeNPVP
| , .Idziewczyna V NPI1
czyta co
This is the tree of the underlying structure of the sentence
(38) Chlopak wie, co dziewczyna czyta.the boy knows what the girl reads'The boy knows what the girl is reading.'
in which c'o was moved up to the hrst symbol Comp, which does notcontain any lexical elements. With this solution we can do without theintroduction of connectors from subordinate questions.
But still there are many detailed problems which I tried to solve inmy paper (BoBRowsKI 1988). Among other things I discussed the deriva-tional history of the sentence:
(39) Co Janek chce, 2eby Jurek przeczytal?
what Janek wants conj Jurek has read'What does John want Jurek to read?'
It derives from the following underlying structure:
27
2928
przeczytal co
There is no doubt that this tree may be constructed using the rules in(34). The element co can appear under the nearest symbol Comp because
it is occupied by Zeby. So it should be moved upwards and hnally appears
under an empty symbol Comp.Similarly we should analyse sentences with nouns different from co,
with adjectives such as jaki, ktöry, witb adverbs such as jak and withnumbers such as i/e. But the problem is whether we could also eliminateconnectors from relative clauses such as
(41) Chlopak, ktörego znam, idzie.a boy who(m) I know goes
'A boy who I know is going.'
(42) Chlopak, kt6ry idzie, zna mnie.a boy who goes he knows me'A boy who is going knows me.'
in the same way. The answer to this question is also affirmative. In ourgrammar the structure of sentence (41) would have the following form:
(43)
Comp
Ie
Comp
Ie NP VP
| ,A-ja V NP
,J- "r,rlpuru
This structure undergoes a transformation which moves the elementchlopaka under the first empty symbol Comp from below, and then itundergoes relativization, changing the second appearance of the nounwhich has the same reference as ktörego.
It should also be noticed that this solution is not only of theoreticalvalue. It it well known that some transformational assumptions allow usto reduce some categories which are very useful in structural descrip-tions. However, the structuralists' argument against these assumptionswas the fact that there was no full description of Polish within the trans-formational framework. Now, the argument seems to be rather weaker asthere is such a description (see BonRowsKI 1995). Needless to say, thepresent solution is also applied in the description and it seems to workthere very well.
Finally, let us consider a problem of, probably, secondary importance.But it is certainly an interesting one. In Polish there are sentences suchas:
(44) Chlopak, co siedzi, jest moim przyjacielem.a boy that sits is my friend'A boy who is sitting is my friend.'
(40) S'
,4..pS,/\
Com
Ie NP VP
NP
L..Jairek V S'ln
chce Comp S
| ,z:-.-Zeby NP VP
I ,n
S'chlopakJ'V
I
idzieS
Jurek NP
I
V
I
30
(45) Chlopak, co go widzg, jest moim przyjacielem.a boy that him,I see is my friend'A boy that I see (him) is my friend.'
In my opinion (44) and (45) are acceptable. Although the status of thefollowing sentence is rather problematic:
(46) ?Chlopak, co on siedzi, jest moim przyjacielem.a boy that he sits is my friend
However, the sequence
(47) *Chlopak, co widzg, jest moim przyjacielem.a boy that I see is my friend
is undoubtedly deviant.But only if we accept sequence (47) as a correct one and regard sen-
tences (45) and (46) as unacceptable, may we say that the situation isvery similar to what we can observe in English, where the pronoun #lal ispossible in colloquial speech instead of which or who(m).
However, Polish co is not an equivalent of English that, not only be-
cause (47) is not acceptable in the Polish language. The second reason isthat a possible pronoun can appear in a similar sentence, not before co
but always after it:
(48) Chlopak, co z nim idg, §piewa.
a boy that with (him) I go sings'A boy that I am going with (him) is singing.'
(49) Chlopak, oo o nim m6wig, §piewa.
a boy that about him I speak sings'A boy that I am speaking about (him) is singing.'
It is proper to pay attention to linguistic material discussed in Les-KowsKI (1991), who analyses the language of Polish emigrant childrenliving in Sweden.
Our grammar offers at least three solutions of the problem of thiskind of sentence. According to the first one, we could take co as a subor-
dinate coniunction as does Lasrowsrl (1991). Additionally, we shouldassume that if Comp dominates Spp co, then the moving transformationis blocked, because it is a condition for relative transformation. So in thiscase an ordinary pronominalization takes place. But if the pronominali-zalion causes a noun to be replaced by on, ona or ono in the nominativecase, this nominative case should be erased. In this solution Polish co
3l
would be an equivalent to English that, however it is not an equivalent tothe element that replacing which, but to the conjunction fiaf.
The least satisfactory solution is the second one, according to whichthe relativization changes the second appearance of the noun to ktöry, -a,-e or to co + on / ona / ono.
The third solution is not satisfactory either. It says that a posttrans-
formational structure containing ktöry, -a, -e is an underlying structurefor a transformation which substitutes an element co + on instead ofktöry.
These two solutions are hard to accept. According to changes pro-posed in these solutions we do not obtain sentences (48) and (49), butthe sequences
(50) *Chlopak, z co nim idg, §piewa.
a boy with that him I go sings
(51) *Chlopak, o co nim möwig, §piewa.
a boy about that him I speak sings
which are dehnitely not acceptable utterances in Polish.
Literature
Bognowsru, I. 1988: Gramatyka generayno-transformaqjna (TG) a ugöl-niona gramatyka struktur frazovtych (GPSG). Wroclaw
Bosnowsru, I. 1995: Gramatyka opisowa jgzyka polskiego, v. l: Strukturawyj§ciowa. Kielce.
Gnocgowsrt, M. 1986: Polskie partykuly. WroclawGRzEcoRczyKowA, R.; R. Lasrowsru; H. Wnösrt, (eds.) 1984: Gra-
matyka wspölczesnego jgzyka polskiego. Morfologia. WarszawaLASKowSKI, R. 1991: Status gramatyczny wskaZnika syntaktycznego
zespolenia w zdaniach wzglgdnych z co. ln: M. Grochowski, D. Weiss(eds.): Words are Physicians for an Ailing Mind. Sagners SlavistischeSammlung, Band 17. München, 277-277
A n dr z ej B o gusl aw ski, Il'ars aw
The semantic primitives'someone','something' and theRussian contradistinction -Hildy4b vs. -ro
For my friend Yictor Chrakowkij
I am strongly convinced that one of the pivotstones of the universal se-mantic system, i. e. of the system of "semantic primitives", is the pair ofnon-accommodative (non-inflectional) units of language endowed withindependent, mutually opposed cognitive meanings, units represented inEnglish by someone (or somebody) and something. The idea of accordingbasic and universal status to these meaning units has been developed byWIERZBICKA (1972) (in her "Semantic Primitives"); and they have re-tained this position in all her later outlines of the semantic system(which otherwise vary to a considerable extent).
One obvious requirement which has to be applied to candidates to thestatus of non-arbitrary semantic primitives of natural languages (as opposed to elements of freely invented calculi) is their universality. Anideal conhrmation of their truly universal character would of course be astrict one-to-one translation relation of appropriate expressions in all lan-guages. It goes without saying, however, that such a relation is hard tohnd even for two arbitrary ethnic languages, let alone for a larger numberof them or for all of them.
But we can relax the universality constraint by allowing for certaindepartures from the ideal I have just mentioned. First of all, we losenothing of importance if we consider inflectional sets of expressions(making up individual "lexemes") as wholes rather than looking at indi-vidual forms; it is a trivial phenomenon that the distributlon of membersof inflectional sets varies from language to language. Second, we maydiscard cases of pragmatic limitations of the "one-to-one" principle, e. g.,limitations which are caused by some language-specific conventions suchas those providing for avoidance of the use of certain expressions inspecified types of situation (cf., e. g., some well known "humility" con-straints on the use of the first person pronoun).
However, in the case of 'someone', 'something' there are more seriousempirical obstacles to the acceptance of the universality claim. One such
34
possible countercase is the Lithuanian pronoun system with its uniquepronoun kas or kaäkas which is applicable to both persons and things;only a certain bias of kas, as opposed to kaikas, towards indicating per-sons seems to give some substance to the claim that Lithuanian is notdeprived, after all, of the distinction 'someone' : 'something'; but I shallnot go into the details of the Lithuanian situation here. There are alsoother troublesome cases, as when the prima facie counterparts of ,some-one', 'something' in a given language are n o t used, but are replaced byexpressions whose (cognitive) meanings differ rather unequivocallyfrom those of 'someone', 'something'. This puts even the more liberalvariety of the universality claim (as applied to 'someone', 'something,) injeopardy.
one case in point is that of the Russian pronouns in -uufiyil whichare used instead ofwhat could be expected, i. e. instead ofthe pro-nouns in -ro which undoubtedly supply the primary translation equiva-lents of the English someone, something (as well as other ,,indefinite pro-nouns"): the former pronouns are, in all likeliness, n o t synonymouswith the latter. (Notice that there is a further factor which destroys a one-to-one relationship between KTo-To, qro-To and someone / somebody,something. I mean the Russian Kro-ro, ttro-To; but there is little doubtthat uercro, Heuro a r e synonymous with HeKTo, He4ro in their cognitivemeanings and differ from the latter merely stylistically, as claimed,among others, by MaLovrczur (1971), §pr,rarm (1973); a powerfulargument in favour of their relation to rcro-ro, uro-ro resembling that ofsomebody : someone is their being deprived of indirect cases, somethingwhich even makes thbm members of the same lexemes, with just one setof indirect case forms, on the pattern, say, of the Nominative pluralNorwedzy / Nonuegowie in Polish; such a clue is absent from English withrespect to somebody, someone.)
In what follows I am going to present an interpretation of the Russianphenomenon of having the t w o full inflectional sets of pronouns: with-ro and with -uudydt I think my interpretation will make it possible tosustain the position of the pronouns KTo-To, qro-To as valid counterpartsof the English someone, something and thus to get round the threat of thecollapse of the rather promising prospects for revealing particularly im-portant members of the basic structures of language, viz. ,sb,, ,sth,, as Ishall henceforth call the putative semantic primitives in question.
35
As is well known, the ordinary logical interpretation of 'sb', 'sth' is interms of existential quantihcation (cf. GBecH (1951, 130): "[...] in spiteof their grammatical difference, the indehnite pronoun ,something' doesthe same job as the verb ,exists' (ens et aliquid convertuntur); ,somethingis a red rose' means just the same as ,a red rose exists'."). Thus, a sen-tence like
(1) Somebody is ill.is claimed to be a way of expressing something a more exact rendering ofwhich (for the given instance) is
(2) There exists / is somebody who is ill.where there exisls (or: is) somebody who is in fact treated as forming anindivisible whole corresponding to symbols like V_(x) or 3 x_(x) in, say,
(3) VI (x)x
This interpretation disregards the fact that'sb','sth'are truly ref eren-tial expresions which can mark different individuals at differ-e n t places where the pronouns occur; this is clearly not the case withexistential sentences. Thus, when PaLEr (1988,262) claims that
(4) Karel blahopiäl Marii a nökdo nökomu.
is illicit in that it just repeats, in the phrase nökdo nökomu, the existentialstatement already entailed by the initial phrase Karel blahopiäl Marii, heignores the fact that the usual reading of (4) would involve a separatereference for nökdo nökomu; he also ignores the obvious difference be-tween (4) which is most easily interpretable as meaningful (as ascribingthe expression of good wishes to someone else addressing yet anotherperson, over and above Karel and Marie), on the one hand, and, on theother hand,
(5) Karel blahopiäl Marii a existuje nökdo, kdo blahopiälnökomu.
which indeed makes little sense.Therefore (as well as by virtue of further cues which I shall not go
into here) 'sb' and 'sth' must be kept apart from the concept of existence.Still, the lack of compelling arguments which would substantiate a
kind of ambiguity of 'sb', 'sth' in their "basic occurrences" (as exempli-fied by (1), (4)), on the one hand, and in concatenations with 'exists', on
36
the other, makes it reasonable to think of 'sb,, ,sth, as identical in a 1lthese occurrences.
Moreovor, it is hard to deny that the following implications seem tohold good (in the sequel, I shatl confine myself, for simplicity,s sake, to'sb', but the same observations do apply to 'sth' as well):
(6) sb F -+ there exists sb who F
(1) there exists sb who F + sb F
Now, I adopt, at the same time, an interpretation of ,exists, whichleads to the following substitution for 'there exists sb who F, (seeBocusrawsKr (1994) for more details):
(8) sb knows about 'sb who F'that sb knows sth about sb who FThe parallel substitution for'sb F' is
(9) sb knows about sb that Fwhich can also be rendered as
(10) sb knows about sbl that sbi F
Furthermore, it is clear that 'sb' in(11) sb F
can be ascribed an indefinite number of qualities; i. e., (11) is an ante-cedent in an indehnite number of material implications; and the samething applies, of course, to 'sb who F' in
(12) there exists sb who F
In other words,'sb' just referred to is also bearer of G, H, 1,... (withoutany last member of the series, and with the only constraint on the seriesthat its members cannot be mutually contradictory).
Notice, however, that there is something quite peculiar about the im-plications in (6), (7): they do not admit of a regular contraposition. Trueenough, the following entailment (corresponding to contraposition asapplied to (6)) must be accepted without question:
(13) sb who F does not exist -+ sb does notFI.e.,
(14) sb who F does not exist
is incompatible with(11) sb F
37
But the reverse does not hold good:
(15) sb does notF
is compatible withboth(14) sb who F does not exist
and
(12) there exrsrs sb who F
I. e., we cannot accept the entailment corresponding to (7):
(16) * sb does notF -+ sb who F does not exist
Thus, the following situation emerges:a. even though sä F is not identical with there exists sb who F, it has theforce of the latter because it entails the latter; accordingly, the RussianKTo-Toin rcro-ro,Fis paralleledby rcro-roin qtr4ecreyer rcro-ro, rcro F;
b. there are two possibilities ofa denial related to sb F: besides sö
does not ,F which does not entail sä who F does not exist, we have sb who Fdoes not exrst which entails sb does not F; sb who F does not exlsf has itsmore customary variants no one who F exists, no one F, there does not existanyone who F, with slight differences in the thematic-rhematic arrange-ment, perhaps along the following lines: the first two variants correspondto
(17) 'sb who F' is such thatsb knows sth contradictory to 'sb knows about sb that F'
whereas the last variant corresponds to
(18) 'sb knows sth contradictory to 'sb knows about sb that F" issuch that'sb who F'is such that sb knows sth contradictory to'sb knows about sb that F'
Such possibilities of differentiation as are indicated, for English, in b. areproper to all languages, and they extend to expressions with multiplevalency, thus yielding a still greater variation. For example, we have inGerman: jemand F nicht vs. niemand d furthermore, jemand G jemanden
nicht ys. niemand G jemanden (iemanden G niemand) vs. jemand G nie-manden (niemanden G jemand); in Russian: KTo-ro ne F ys. uurro ue F;besides: rcTo-To ue G xoeo-ro vs. HUKTI y-e G uurcoeo (nurcoeo ue G uurto)ys. KTo-To ue G uurcoeo vs. HuKTo ue G xoeo-ro; in Lower Lusatian:nöchten nö-G nökogo (with the stressed negated verb: 'someone not G
38
someone') vs. nichten nö-G nikogo (with the stressed nichten, nikogo whoseroot vowel is hardly distinguishable from that in the written nöchten,nökogo:'no one G no one'); etc.
Means used to achieve this differentiation vary widely, cf., e. g., the"ascetic" German, on the one hand, and Russian, on the other, whichmakes use of "redoubled negation" with strong redundancy manifestingitself in the employment of both the negative particle ne and, the negativeprefix ni- . But the system of distinct areas to be covered(each in its own way) is the same everywhere.
Problems arise when it comes to yes / roquestions. Here, one has toenvisage four different imaginable answers for any possible occurrence of'sb': 1. the possible positive answer with'sb,, 2. the possible answerwith the negation of F' applying to 'sb', 3. the possible positiveexistential answer, 4. the possible answer with the negation ofthe very ex iste n c e of 'sb who P.
It is rather natural to adopt, in the capacity of a representation of theentire set of the envisaged possible propositions-answers for a given yes /naquestion, the positive ref erential, rather than existential, formula-tion, i. e., a formulation with 'sb'. This is because that kind of formula-tion is semantically and superficially simpler than the other kinds of for-mulation (including the negative referential and the existential ones)while at the same time being quite innocuous: the positive existentialproposition (see 3. above) is preserved as a possibility due to the bidirec-tional implications presented in (6), (7).
However, a certain difficulty is nonetheless involved in the option justmentioned. The point is that the positive referential formulation mayclash with some answers one can expect. The pronoun'sb, in a posi-tive answer preserves all its properties; in particular, it can be en-riched with further predicates in a limitless way; on the other hand, apossible negative answer at least may engender the loss of thatproperty: this is the case of negation which affects not just the predicate4 but also the very exi ste nce of 'sb who P.
This naturally gives rise to a certain propensity to have a neutralform of the common basis of the relevant possible propositions, a basis tobe presented in a yes,/ naquestion; such a neutral form may appear to befairly useful in its f ailing to suggest any particular answer, out ofthe four admissible ones.
39
The setting up of that kind of neutral form is by no means a neces-sity. Ies / noquestions might always be shaped by using forms like:
(19) Is somebody ill?
This style of inquiry is proper to Polish or Czech, at least in their basicvarieties (see KrlZrovÄ (1971) for an excellent comprehensive analysisof Slavonic indehnite pronouns), cf.:
(20) Czy kto6 jest chory?
(21) Je nökdo nemocen?
But there is another avenue open: it is the use of the polar altemativewhere externally both the negation of f'and the negation of existence of'sb who P seem to materialise (of course, they do not in fact materialisebecause the relevant form is used in a question), cf.:
(22) Is nobody ill?
or Czech
(23) Nikdo neni nemocen?
Here, should the answer consist in the denial of the overt formulation ofthe question, we end up with a positive answer, e. g.:
(1) Somebody is ill,or Czech
(24) Nökdo je nemocen.
since 'it is not true that nobody is ill' entails 'there is somebody who isill'which, in its turn, entails 'somebody is ill'.
Finally, there is a third option. This is a compromise solution. Boththe positive variant with 'sb' and the polar negative variant with nobody(no one) are withdrawn. Instead, some other related form is looked forand found. For example, in some varieties of Polish or Czech both kto§resp. nökdo arrd niktresp. nikdo are replaced with the otherwise interroga-tive forms kto resp. kdo, cf .:
(25) Czy kto jest chory? / Jest kto chory?
(26) Je kdo nemocen?
This extraneous form overrides, so to speak, the four initial possibilities:the positive referential form (with kto§, nökdo), the negative referentialform (with kto§, nökdo and negated verb), the positive existential form(with, say, czy jest kto§ taki, ie __), and the negative existential form (with
40
nikt, nikdo). In English, the compromise solution assumes the shape ofanyone (and other similar words beginnirg in any-), cf .:
(27) Is anyone ill?
The Russian answer to the dilemma sketched out above has been theinstallment of a very special form, viz. the afhx -uudyda attached to theinterrogative pronouns, cf.:
(28) Kro-Hu6y[r 6onen?
None of the forms under consideration in yes / no-questions militatesagainst the idea of the basic character of 'sb', 'sth'. The very nature of aquestion suggests that its utterer need not indicate a speci{ic person
or thing referred to as'sb'resp. 'sth'. His ordinary objective is f indingthe truth among the abstract possibilities: 'sb F', 'sb not-F', 'there existssb who F', 'no one F'; in other words, he tries to elicit a choice of one ofthe things which may occupy the place "__" in 'sb knows that __' where'sb' (with some F) is deeply embedded in "__". All of this allows him totake recourse to one of the possible a n s w e r forms (as shown above) orelse to submit something which is neutral, but points in the direction ofall those possibilities.
Notice that there is yet another option open to him, viz. applying a
yes / noquestion form directly to the concept which is crucial in the en-
tire enterprise, i. e., to the concept of truth. Thus, the inquirer may ask:
(29) Is it true that sb P(30) Is it true that sb not-P
(31) Is it true that there exists sb who .F?
(32) Is it true that there does not exist sb who F? / Is it true thatno one r?
In these cases, 'sb' remains, for the most part, in its place without any
changes whatsoever. It is only when the question is formulated in termsof the negative existential claim that other words than someone, §omething
(etc.) show up:
(33) Is it true that there does not exist anyone who P(34) Is it true that no one who Fexists?
But even here wordings with 'sb', 'sth' are admissible.And the same thing is valid for Russian, cf.:
4l
(35) Bepuo rII,I, rrro xro-ro r?
(36) Bepno Jrr{, qro rro-ro ne-.P
(37) Bepuo Jrrr, qro cyxlecrByer Kro-ro, rro r?(38) Bepno Jrr{, qro He cyqecrByer KTo-To, rro F? / Bepuo rru,
rITo HrrKTo ue Fl / BepHo JrI{, rITo He cyulecrByer Hr{KTo, Korr? / Bepuo JrI{, qro He cyulecrByer KTo 6m ro Hu 6rrno, xron
Here, too, the basic form xro-ro obviously prevails.The answers to these questions are as straightforward:lto (3s)l
(39) [a, cJreÄoBareJrbxo KTo-To F / \a, cJre[oBarerrbuo cy-ulecrByer KTo-To, xro F.
with the possible enlargement:
(40) ,[a, cnegonarerrbHo KTo-ro fl u npurou nce F.
(41) Her, cnegonareJrbHo rro-ro ne .F.
with the possible enlargement:
(42) Her, clegorareJrbHo KTo-To ne F,u [prrroM nr,rxro ne .F.
lto (36)l
(43) [,a, clegonareJrbHo KTo-To ue ,F / [a, cnegoBarerrbuo cy-IrlecrByer KTo-To, xro ne F.
with the possible enlargement:
(44) [a, ctegouareJrbHo Kro-ro ne -( u npr{roM llurro ue F.
(45) Her, cneÄonareJrbHo rro-ro f'.with the possible enlargement:
(46)
lto (37)l
(47)
Her, cregonareJrbHo KTo-To ,( r.r nprarou nce F.
,[a, cnegorareJlblro cyulecrByer KTo-To, xro fl, cJlegoBareJrb-uo xro-ro F.
(48) Her, cnegorareJrbHo HuKTo ne d cleloBareJrbHo KTo-To rreF.
42
lto (38)l
(49) [a, clegonareJrr,Ho HrrKTo ue d, cnegonareJrbHo xro-ro ue F.
(50) Her, cnegorareJrr,Ho cyrUecrByer Kro-ro, xro .fl crregoBa_TeJrbHo xro-ro .E
Let us now revert to the problem of the divergence of how the Rus-sian rcro-ro, qro-To are used from the pattern we come across, say, inPolish or even in English (where the counterparts of the polish kto§, co§,i. e. someone, something, are very regularly replaced with anyone, anythingin questions). The divergence lies in rro-r4 4ro-To being sometimes re-placed, as it were, by xro-uudydt, vro-uu6ydo in declarative sen_t e n c e s , including purely positive ones (a similar substitution in favcurof the English anyone, anything never affects sonrcane, somethingif there isno negation present in a given declarative sentence); moreover, there isno relevant contextual complementary distribution of a reguiar kind tobe stated; correlated with this is a very common and strong feelingamong both native speakers and the investigators that the uufydrformsare anything but synonymous with the ro-forms (unlike the Englishsomeone and somebody, anyone and anybody, no one and nobody which maybe claimed to be cognitively synonymous, despite any differencesthere are between them). Thus, a hypothesis is likely to arise that theputative semantic primitives KTo-To, 4To-To appear to have a much nar-rower domain of application than the Polish kto§, cos or the Englishsomeone, something, a phenomenon which may result simply from theirembodying quite different (even if somehow related) meanings than theirprima facie Polish or English counterparts. This would, in turn, under-mine the idea of the status of semantic primitives (i. e. universal con-cepts) as proper to any single pronoun in the group (including other ap-parent counterparts of the expressions now under consideration to befound in any of the remaining languages).
Before we come up with an interpretation of the dilemma and an at-tempt at solving it, let us illustrate the appearance of the nufydo-formswith a sample of occurrences. First, I shall adduce some examples citedin Kuz'MrNe (1989):
(51) Tl';t uro-uu6ydo He ro roBoprrrub.
(52) Her, ryr uro-uudydo He raK. (M. 3ouleuro)
43
(53) HerpyÄno y6eIlnrncs, [...], uro caMo rpol.r3norueune [...]ssyra [ö] He rrpeAcraB;nfler qeeo-Hu6ydt ne\ocrylHoro Arr.trys6exa. (E. A. tlonuranon)
(54) Hepegro 6rrsaer neo6xogurvro. qro6rr rcro-nudydo qro-ro
cÄeJriu [nx uac [...]
(55) [a rax u 6yÄet flpoÄoJDr(arbcfl, IroKa Kro-To aeeo-nudydt necÄeJraeT.
(56) A sgpyr rcro-uu6ydt Ha pr,IHKe craHer roproBarb qeM-ro
ne[OSnOnenUr,rU?
(57) Bce BpeMr xoreJr cKasarb eMy trro-To oyexb [pprrrmoe, qro-xudydo paccKa3arb BeceJreHbKoe.
(58) JIrcÄu 6o.src, oro nprr3Harr. floerouy 3a trro-ro uerrrr;llorc.tr... Jluur 6st sa qro-Hudydtyxnarurncx.
(59) Kax sro rax, uro6u KTo-To oKa3aJlcfl clrJrbnee ero? 9to6rrou rcouy-nudydo ycrynun?
(60) [...] xor4a xouy-uuiyda qro-ro HaÄo,.fl rroH.f,reH u xopour. (8.Jlnxouocon)
(61) Yro, [o-rauteMy, Jryrrlue ... c]IÄerb Ha cIIeHe Ir [oKa3blBarbHo)KKy ... yut*r cuÄerb LI qro-To AeJIarb, xorr 6rr vro-uudydoHe3Harrurerbuoe. (K. C. Craslrcnancruü)
(62) florou BcKpbrJrocb r.r raKoe, rrro cB-f,3aHo co crr{JIeM: ecJlr{
uro-nufyda raKoe cepbe3l{oe, Topr(ecrBeHlroe - eKaHbe; ecJILrrro-To 6uronoe, ne6pexuoe - rrKaHbe. (C. C. Brrcorcruü)
Another sample comes from Peouörve (1985):
(63) Bepoxtno, ee [prrBe3 rro-uudydo rr3 poAcrBeHHrrKoB.
(64) Bosruoxruo, ero rro-uudydo rralpyrru.
(65) KaxÄrrü AeHb Kro-Hudydaut Hac xo4rrJr K HeMy s 6onrHuqy.
(66) Harepuo, on ueu-uudydo 6oteu.
(67) Euy n uepnrrri pa3 [purrrJrr{ Bonpocbr o Bo3Mo)r(Hocrrr AJr.rr
ero x(enbr nro6r.rrr rcoeo-nudyda. (Tolcrou)
(68) On uoxrer uro-uudyöa sa6rrrr.
44
(69) [...] ror s. yt AyMar, tro rcro-uuiydo xo4lrn r uerrly. ([o-croeBcKr.rri)
(70) Ec:nu rcro-uuiyda.re6n o6rngea, rpocrrr eMy.
(71) fiol>ruro 6r,rrr,, ee rpeÄyrpe,qr.rJr rco-uu1ydagpyrou.
(72) Ha ,4nop BbexaJr eKr.rrax r4 KTo-To cnpaurr{BaJr O6nouora. -Kro-uudydo lI3 uporrrJloto4Hlrx 3HaKoMbIx BcloMHIrJr MorrraMeHr{Hbr. (Iouvapor)
(73) Tax u sarurcr, KaK 6ygro copox nyg c6pacrrnaer rcro-uuiydac reJrerrr. (Ioronn)
We may add that a number of Paduöeva's examples where she claims-uu6yda is downright unacceptable or deviant (as shown by her asteriskrather than, say, a question mark) do in fact admit the uufyduform: suf-fice it to consider examples like (51)-(52) or paduöeva's own quotationslike (63), (65), (66), (69), (11) where -uudydu is present under contextualcircumstances which cannot be opposed in any reasonable way to thosein the occurrences dismissed by her. Here are some relevant illustrationsof this kind of misjudgement (I omit the asterisks):
(74) Panrrue oHa rryBcrBosara ce6fl nyx<Hori rcouy-rutiydo.
(7 5) Mue «axerc fl, .tro KTo-Hu6ydt xogur [o trepgaKy.
(76) -fl Hacrazsaro, qro ee rcro-uu1ydt o6u4en.
I now proceed to offer an account of the nature of the uu6ygr-pro-nouns and its impact-on the initial question of the possible semanticprimitives among pronouns.
My starting point is as follows: I join all those investigators whostrongly emphasise the extremely regular appearance of the uufydo-formsin questions, especially in yes / noquestions, as sui generis winning com-petitors of the ro-forms. In accordance with what I said earlier on, I as-sume that they originate in interrogative sentences as forms which allowthe speakers to avoid the suggestion of a positive or negative answer withspecific reference (which is inherent in basic occurrences of the ro-forms, as well as other pronouns, such as the Polish kto§, co§, in simpledeclarative sentences) or the polar negative-existential suggestion whichinstalls itself as soon as negative-existential pronouns are resorted to (or,flor that matter, 'all'-pronouns as well since they, too, embody a negative-
45
existential claim, only with the relevant predicate negated; thus, what Ihave in mind here are pronouns like nobody, nikto, and, secondarily,everybody, kaädyi. But what stands in the middle between the indicatedpoles thus envisaged is of course the concept of positive existence. It has,of course, its own exponents, viz. forms like there is sb who_- sb who__exists, there exists sb who_- qt4ecr6yer KTo-To, rcro__ which may be ren-dered in questions, according to the relevant grammatical patterns, as lsthere sb who__or is there anyone who _- does sb who__exist or does anyonewho_- exist, does there exist sb who __ or does there exist anyone who-cyryecrtyer fiu KTo-To, rcro__ (and, as a later outgrowth: qt4ecrsyer nurcro-uudyda, rcro_). Still, these forms are obviously quite rare in speechbecause of their very special cognitive purpose; and they are, correspond-ingly, fairly cumbersome whereas the problem to be solved for questionsapplies to a I I of them, foremostly to ordinary (usually, very short!) ques-
tions related to simple matters with specihc reference (i. e., to questionscorresponding to possible answers which represent singular state-ments). This makes it imperative to find simpler means of formulatingquestions; speakers may waive their ambitions to present their questionsin a neutral, "suggestionless" shape and fall back on the basic linguisticstratum, i. e. on forms like the Polish kto§, co§; and this is indeed thesolution Polish has adopted; however, if some other simple forms areavailable, they may be welcome. As it happens, the Russian uuiydupro-nouns are just such forms (notice that in allegro speech tudyda is pro-nounced as a one-syllable segment, viz. [gt'], i. e. a segment fully equalto ro; of course, the difference between one syllable and two is also neg-ligible). In a certain variety of Polish, the external shapes of interrogativepronouns began to play the same röle (something which is not unknownin substandard Russian, either; for a discussion of this phenomenon, see
KUz'MINA (1989,209-210); thus, we have sentences like(11) Czy kto przyszedl?
And the interrogative pronouns even expand into the area of imperativesentences, cf.:
(78) Przynie§ co!
future tense sentences, cf.:
{79) Przyniosg co.
or declarative sentences with negation applied to verba sentiendi, cf.i
46
(80) Nie s4dzg, by kto przyni6sl co.
But they do not embrace positive declarative sentences, even with expres-sions of a degree of certainty lower than that of knowledge, cf.:
(81) *My§lg, 2e kto przynidsl co.
(to be cautious' we may say sentences like (g1) are not entirely ex-cluded), let aione non-hypothetical decrarative sentences, i. e. sentencesimplying the speaker's relevant knowledge, cf.:
(82) *Kto przyniösl co.
This matches English (with its anyone, anything) quite exactly, apart frompositive imperative and future tense sentences, cf.:
(83) I don't think anyone has brought anything.
(84) *I think that anyone has brought anything.
(85) *Anyone has brought anything.
(86) *Bring anyrhing!
(87) *I'll bring anything.(the latter four sentences, including (g6)-(87), representing exclusivelyuniversal quantification).
It is here that Russian asserts itself as a hiehly original language: itadmits not only of sentences like
(88) flpnruel nlr rro-Hr.r6ylr?
(89) flpuuecr.r.rro-uu6ygr!
(90) .[I npuuecy v.ro-uu6ygr.
(91) -fl ne gyrrlaro, vro6rr xro-Hu6ygt rrpuHec vro_ur.r6ygr.but also of sentences like
(92) .fl Ayuarc, .{ro rro-uu6yÄb rprlHec uro-ua6ygr.and even
(93) Kro-uu6y4r rprrHec vro-un6ygt.But what is the ultimate basis of this Russian peculiarity? I think theanswer emerges from our discussion of the röle of the nu1ydo-forms inquestions as tentatively neutral between the poles of suggesting reference,on the one hand, and of suggesting negation of existence, on the other,
41
the neutrality boiling down to the concept of positive existence. Theuudydrforms necessarily acquire the property of being strongly corre-lated with that very concept. To put it bluntly, a question like (88) mustbe understood as equivalent to a possible, but fairly unwieldy formula-tion
(94) Cyulecrsyer Jrr{ KTo-ro, xro upuuren?
Now, this correlation can be, and in fact is, preserved in imperative, fu-ture tense, hypothetical and, ultimately, non-hypothetical declarative sen-tences.
In other words, it will be my claim that the best way of accounting forthe particularity of declarative sentences with the uudydo-forms is by tak-ing them to be variants of existentially quantihed ones, alongside, that is,sentences based on expressions llke cyqecrayer KTo-To, rcro__. lt is mostimportant, at this point, to take account of the fact that (declarative)concatenations like
(95) *cyulecrryerxro-nu6ygr,xro__
are clearly deviant; this strongly corroborates the claim to the effect thatthe schemata rro-uudydu .F and cyu4ecr6yer Kro-To, no F are indeed mu-tual variants, the odd declaratives with cyryenoyer rcro-nufydo, rcro F giv-ing an irresistible impression of an unwanted pleonasm. True enough,int e rro g ative forms like
(96) cyulecrByer nu xro-uu6ygb, Kro__
are current, but this is an effect of a nearly automatic replacement of thercro-forms by the uudyda-forms in interrogative expressions; such a re-placement may be extended to imperative, volitive, future tense and hy-pothetical contexts of 'existence' as forming part of the relevant (impera-tive etc.) utterance, but the results do not seem to be fully acceptable(and the degree of their acceptability diminishes according to the scalejust indicated):
(97) ?nycrr cyulecrByer rro-uu6ygr, xro--(98) ?oH xover,'Ito6rr cyulecrBoBaJl r<ro-nr,t6ygr, xro--(99) '6yger cyulecrBoBarr rro-nu6ygb, Kro--
(100) ?s AyMaro, rrro cyulecrByer xro-uu6ygb, Kro_-
(101) ??ou AyMaer, qro cyulecrByer xro-uu6ygb, Kro__;
4tt
as for negative sentences, the obvious option is to use HrKTo or,with thedifference pointed out in (1g) as opposed to (rr), *o-nu6o or'rcro 6or rouu 6ouo, also in sentences like
(L02) x He AyMaro, qro cyurecrByer Krolrrrr6o / rro 6r,r ,ro Hu6rtlo, xro__
Thus, I am inclined to treat the following examples cited by Kuz,MINa(1989, 211) as marginal:
(103) BepoxrHo, B AHue 6ruo uro_uufiydo oco6eunoe, noroMy trroEercu rorqac 3aMerrrJra oro (JI. Toncrol.r)
(104) cyÄu rro BceMy, 3Äecb He Moxer 6rrrr 4ry:nasHori cucreurra AoJIxHo 6twn olssareJrbuo Haruque ueeo_nu1ydo
Tperbero, qro cryxur Heo6xoglrutrM rrocpe.qurrKoM MexÄyoTIMLI yxe He TeKcTaMH, a HMeHHO CTIcTeMaMII (A. A.PeQopuarcrr.u.r)
It must be added that (103)-(104) do not, after all, make straightforwardexistential statements, but rather characterise, respectiv-ely, Annaand language (cf .: Auua orrtuttalacb veu-uuiyda oco1runorul.
It is quite instructive to note that pADUaEva (19g5,215f1) discusses-uu6yda (together with -nu6o) in a special section the titre of which is"existential pronouns" ("exsucreuqrraJrbHr,re MecrorMeHrr.a,,). Thus, myclaim is in full harmony with the prominent scholar,s general appraisal ofthe force of the uufyda'pronouns. However, her statement 1pa»uerva1985,210) to the effect that they have a "non-referential status,,may bemisleading: whenever positive existence is asserted by means of a uufiydupronoun (as is the case, e. g., in her own exampre (12)) there is a validentailment of a singurar, and thus referentiar, proposition. And it is in-correct to characterise the most important groups of occurrences of -xa-6ydo signalling doubts concerning the very existence of a bearer of therelevant property (PADUöEVA 19g5, 215): clearly, there need not be anysuch doubts when a question is asked or when a conditional is used orwhen a degree of certainty is indicated or when a possibility is asserted(as in Peouöeva's example quoted here as (63)). In short, there is nospecial bias of -uudydu towards the concept of .n o n -existence,. But nei_ther does avowed 'non-existence' exclude the possibility of an utterancewith a uu6ydupronoun; thus, peouör,va,s asterisks on her examples
49
(105) Mne upr{crrrrJrocb, qro Kro-Hu6yÄr .ryxoü nocenranc-f, sAOMe.
(106) Ott roo6paxraer, r{ro ero xro-xr.r6yÄr noHflJr.
cannot claim any absolute validity. On the other hand, a suspension ofthe speaker's judgement concerning 'existence' or 'non-existence', oftenconnected with verbs of saying, is not the real source of their almost ex-clusively going with ?Gpronouns either; a simple explanation of this phe-nomenon lies in the fact that what is said more often than not includes,not claims of existence of such-and-such, but reference to particular per-sons by means of, say, KTo-To or proper names (the latter normally beingdirectly substitutable precisely by rro-ro) etc., whereas the use of a
uudydvpronoun in reported speech would imply that that very pronounhas been used; cf. Paduöeva's examples:
(107) *On cKa3ilr, qro xro-uu6ygb 83.trr ero rrralKy.
(108) *B reJrerpaMMe 6rrno cxagano, rrro KTo-Hr.r6ylr npuexan.
In the same way, we would rather say:
(109) Oua rorrrJra y6r.rrr xoro-ro.
if what "she" could say truthfully about her intention was
(110) g uoüAy y6rro roro-ro.but
(111) Oua norrrJra y6urr roro-uu6ygr.if what "she" could say truthfully about her intention was
(ll2) fl uoüAy y6r,ro xoro-nu6ygn.
thus making it clear that her objective was the'existence of someonekilled by her', whether of someone individualised in some way or not; thebare absence of the possible, and basic in reference to identihed persons,KTo-ro strongly suggests, of course, that "she" had no particular individ-ual in mind.
I am now coming to a decisive point in my reasoning. Let us recallthe all-important and undeniable implications stated in (6)-(7). Their ob.vious corollary is that what we must expect, given the plausibility of theexistential impact of the uu6ydo-forms, is a fair amount of interex-changeability of the ro and the nudyda-forms, even if the relevant sen-tences are declarative. Indeed, the extent of that interchangeability
50
should be much greater than in the case of pairs rike rcro-ro F - qtryecr-eyer KTo-To, rcro .rtr (although members of such pairs do display some abil_ity to replace each other, too): the reason is that the two kinds of formexhibit the important feature of technicar commensurability (they areapproximately equal as regards their "cost,,, something which is obviouslynot the case with members of the last-mentioned pairs).
Now, when we turn to textual material, we may easily observe thatthe expectations do in fact materialise: cases where -ro unä -nu6ydo showup side by side under similar circumstances are quite frequent. A num-ber of relevant illustrations can be found in the examples cited above.Here are some further examples (from Kuz,utNa 1qg9, Ztt_ZtZ" tOllwhere -ro is used in spite of the presence of contextual ,"riino i'.tmake existential statements quite reasonabre and where -uu6yäa wourdindeed be most natural:
(113) t...] fl rrutny oro []rcbMo He AJr.E roro, vro6r,r pasxaro6r.rrr,rcoeo-ro [...)
(114) Ecnu rcro.To rr npr{Beger fiprrMep, To He rrHaqe, KaK e[r{Hrirr-nrrri.
(115) Korra npoBo^r..ub c Ke.M-ro xorr, 6r,r rarori ue6onruroücpoK, KaK,qBe HeÄeJrr.t, HeMrrHyeMo y3Hae[Ib nouyr.rura [...]
(116) Kax ,,pu,rrHo [...] sapenerr, ecJrrl npocJryrrraJr ttro_To yt,Te_pecHoe. (B. Eenos)
(117) t...] Hr'rKro HprKor^a He [JraKarr rr3-3a Hee, pasne rolrro Ca-ureyKa B Tex cJryr{a.flx, Kor1a olaa qro_To eMy 3anpeqa.na. (8.Torapena)
(1 18) KnagoBuluqa rar o6pa:oraJracb, KaK 6yAro uo.rsprsmuricxBpaq MoI .lTo_TO I,3MeHI{T}, B OTqy)KAeHHOM oTHOtueHI{r{ Kueü ruogepa. (E. ErryrueHro)
(119) fl, soo6ue He rroMHro, qro6br ora xeHrrlrrH a Ha Koeo-To cep-Artlacb t...1 (H. IInruHa)
(120) oHa rraHrrrrecKr{ 6o.a.uacr B Kor't-To rroBToprrrbc.f,. (r. ce-ueuon)
(l2l) V erle rorAa 6rr.nu gpyux, 6lusrue Apysb,r, 6es roropux lrHe MbIcJItIJIacL xI{3Hb. Kro_ro 3BoHI{JI, KoJr4y_,ro rbl Bcer4a
51
6rrn uyx<en, c KeM-To naAo 6rrno rlofoBoprl{b, qro-ro o6-cygr.rrb. (H. Illlrenes)
There is yet another clue which is worth mentioning as a piece of evi-dence in favour of the existential interpretation of the uudyda-forms: A1-though existential generalisation admits of further existential generali-sations being embedded in it (something which corresponds to iterationof quantifters, cf. lx ly ...), it is quite clear that single generalisationswidely prevail; thus, a sentence like
(122) There exists someone who made something magnificent inthe domain of sculpture within one hour.
or
(123) CyulecrByer KTo-To, KTo co3gaJr qro-To BeJlrrKoJrelHoe B
o6racru cKyJrbrrrypbr B Ter{eHr{e qaca.
is incomparably more probable than a sentence like(124) There exists someone such that there exists something mag-
nificent in the domain of sculpture such that he made it with-in one hour.
or
(125) CyqecrByer Kro-ro raKoü, qro cytqecrByer qro-ro BeJrr{Ko-
JrerrHoe s o6ractu cKyJIbrITypbI TaKoe, qro oH co34aJr 9To B
TEIIEHI.IE qACA.
Now, if we turn to sentences with uudydvpronouns, we may notice thatthey systematically follow this pattern; i. e., -uudydo marks the wider exis-tential scope within which an ordinary ,epronoun occurs, cf. our previ-ous examples (54)-(56), (60) (where, by the way, a uufydvpronoun pre-cedes, for the most part, a lapronoun, also in the linear order, thus ex-actly matching the pattern of cyuqecreyer as appearing in the initial posi-tion and of a rapronoun as being placed in the complement of rcro-ro,KTö or uTo-TO ,rro which accompany cyu4ecreyer).
Let us revert to the crucial implications (6)-(7). It is they that make itpossible to use, in English, a sentence like
(126) I'11 fire someone.
even though what the speaker has in mind is an existential generalisa-tion, rather than a singular statement with specihc reference. Pragmati-
52
cally, (726) is much better than a theoretically possible, but more com_plicated and, as a matter of fact, awkward, existential sentence(727) There is someone I,ll fire. / There IS someone I,ll fire.
The matter is different for Russian. Although an expression like (127) isavailable here, too, cf.:
(128) Ecrr KTo-To, Koro , BbrKr{Hy. / E c r b Kro_To, Koro _tr
BbrKrrHy. / Kro_ro, Koto _f, Br,rKr{Hy, cyulecrByer.and although, owing to implication (6), an intended existential generari-sation can much more naturally materiarise in a shape similar lo (126),viz. as
(129) fl BbrKr{Hy Koro-ro.(129) tends to be understood fairly unequivocaily as invorving a specirrcreference and as intended in that vein by the speaker. This is because aRussian has two technicaily comparable means at his dispos ar: rcoeo-roand rcoeo-uu6yd4 the latter embodying an existential generalisation with-out any extra cost. Moreover, the sheer fact that (129) d o e s n o tcorlprise xoeo-uu,yda creates a very strong pressure towards under-standing it as referentially specific and towards dismissing any guessabout the speaker's confining himself to an existential claim; su"h u pr"r-sure is absent from the Engrish (126), and, for that matter, from the pol-ish
(130) Wyrzucg kogo§.
(if rve disregard the possibility of using kogo instead, a possibility limitedto very special varieties-of polish). The indicated pressure secures, at thesame time, by way of a kind of back_lash, the existential sense of sen_tences with uu6yda-forms. As for the deep nature of the pressure, it mustbe linked with an extremely generar pragmatic mechanism of inierpreta-tion a sketchy description of which has been offered by Grice (1975) un-der the label of "generalised conversationar implicature,,; its substanceboils down to a kind of tacit withdrawal of the content of an expressionwhich has not been used, although could well be used (in our case, ofthe purely existential claim correlated with -nuiydtwhich is not used, butgives way to -ro).
53
I think our discussion provides a sufficient substantiation of the fol-lowing claim: The Russian language-specihc "designation gaps" proper toKTo-To, ttro-To (as compared with, say, English somebody, something orPolish kros, co$ which are connected with the presence of the specialRussian convention of usage involving rcro-uu6yda, aro-uu6ydo are se-
rnantically and pragmatically well motivated. They do not undermine,after all, the hypothesis of the status of tcro-ro, qra-ro as real representa-tives of the putative semantic primes 'somebody', 'something': the nar-rower domain of use of rcro-ro, qro-ro need not be interpreted as engen-dering their röle of bearers of a different meaning.
Literature
BoGUSLAwSKI, A. 1994 Duality and knowledge. The root and the fruit.Theorie des Lexicons 61. Wuppertal
GEACH, P. 1951: On what there is. Proceedings of the Aristotelian Society.
Supplementary Volume 25
GRICE, H. P. 1975: Logic of conversation. In: P. Cole; J. L. Morgan(eds.): Syntax and Semantia. Vol. 3.: Speech,4cts. New York
KniZ«ovÄ, H. l97t: Syst6m neuröitfch zäjmen v souöasnfch slo-vanskych jazycich. ln: Slavia XXXX, 3
KuZ'MINA, S. M. 1989: Semantika i stilistika neopredelennych mesto-imenij. In: D. N. §melev (red.): Grammatiöeskie issledovanija. Funk-cional'no- stilistiöeskij aspekt. Moskwa
MALovICKU, L. Q. 1971: Voprosy istorii predmetno{iönych mestoimenij.ln: Uöenye zapiski LGPI im. A. I. Gercena. T. 517
PeDUÖEve, E. 'ü/. 1985: Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s dejstvitel'nost'ju(Referencial'nye aspekty semantiki mestoimenij). Moskva
PeLEK, B. 1988 Referenöni vlstavba textu. Praha§BlrazuN, M. A. 1978: O semantike i upotreblenii neopredelennych
mestoimenij v russkom jazyke. lrt: Semantika nominacii i semantikaustnoj reöi. Tartu
WiBRzstcKA, A. t972: Semantic Primitives. Frankfurt a. Main
Adam Dobaczewski, Olsztyn
On some contextual asyntagmatic lexemes
0. Asyntagmatic lexemes are lexemes that do not enter into syntactic re-lations with other elements of text, and function as separate syntacticunits (sentence equivalents) (cf. LASKowSKI 1984). They constitute a he-terogeneous syntactic class which is often called interjections (it the broadsense of the term)l . The newer classihcations of Polish lexemes- Laskowski's functional-syntactic and Groehowski's formal-syntactic-distinguish classes of contextual asynlagmatic lexemes (cf. Lasrowsrl1984), in other words, classes of lexemes occurring separatelv, constitut-ing utterances dependent on verbal context (cf. Gnocuowsru 1986;1993), which are named "dopowiedzenia" ('Aussagesatzäquivalente')2.As opposed to the other asyntagmatic lexemes (non-contextual ones),contextual asyntagmatic iexemes (henceforth: CAL) imply a text, i. e.
they obligatorily enter a composition of larger textual units (containing atleast two utterances)3 . To say it more precisely, they imply (leftwards) a
sentence q. The Polish tak, nie, owszem, French oui, non, sr, German 72,nein, doch and English yes, no may, among others, be examples of unitsbelonging to the CALclass.
In this paper tr will present the tentative preliminary characterizationof this class of Polish lexemes, with particular respect to those propertiesof CALs which are a consequence of the way they function in text and oftheir intratextual reference. In the second part of the article I will presenta detailed semantic interpretation of several chosen units of Polish qualiIted as CAL which convey the relation of confirmation, in modern Polish
Cf. e. g. the project of syntactic classihcation of Polish uninflectional lexemesproposed.by SALoNI (1974).GRocHowsKI's project of classification concems only uninflectional lexemes.Although, the criteria of division and, consequently, dehnitional features of theclass named "dopowiedzenia" are different in the classifications of the twoauthors, one may nevertheless assume that the class distinguished by Gno-cHowsKI (1986; 1993) is identical to that distinguished by LASKowsKr (1984).Non-contextual asyntagmatic lexemes (interjections) do not imply a text, theycan make a complete text by themselves (cf. LASKowSKI 1984), in other words,they constitute utterances independent of any verbal context (cf. GRocHowSKI1986,1993).
5(r
dictionaries (cf. SJPD, SJPSZ, SppD) called ,.strong,, or ,,categorical,,confirmation (cf. SJpD 1,940; III,309; SJpSz I, 2B7,Stg). SyntaJtic andsemantic features of such Polish rexem es as: oczyviscie, naturalnie, pewnie,jasne, no chyba, a jakie, iak najbardziej will be the subject of the Jesoription.
1.1 Exploiting the terminological apparatus of a syntax (the distributionalor functional one) dealing with relations between sentence components,one cannot give an account of differentiation of syntactic propertiesamongst the asyntagmatic lexemes, which do not enter, ex definitione,into any syntactic rerations with other elements of text. Thus, strictry un-derstood, syntactic characterization of those lexemes may, in fact, be lim-ited to determining whether a given lexeme is (or is not) asyntagmatic.Any formal (non-semantic) division of asyntagmatic lexemes can only bemade on the basis of observations concerning the cooccurrence of theselexemes with other elements of texta and their linear position amongthese elements. one can speak of the syntactic classification cri-teria of asyntagmatic lexemes and interpret the syntactic featuresof particuiar elements of the class they constitute only if the entities men-tioned above (which can be defined tentatively by the name of *textualco-occurrence") have been included in the range (denotation) of the termsyntax. Thus, I suggest understanding the dehnitional feature of cALnamed "contextuality" as the obligatory textual co-occurrence of cALand sentence 4 in the rinear arrangement: q - cAL. As opposed to thecALclass, non-contextual asyntagmatic lexemes (interjections) rack thisfeature, that is to say, they do not have to co-occur with any sentence q(in the linear arrangement q - interjection).
For purposes of syntactic description of particular cALs, one maytake into account the folrowing properties of these lexemes: 1) types ofthe leftward contexts of their occurrence (i. e. types of q); 2) possibility /impossibility of secondary occurrence of cAL in the linear position of anargument of the relation typical of sentences / clauses, i. e.: a) taking thesyntactic place opened by conjunction ie (cf. e. g. quotations in so-calred
57
indirect speech) or other conjunctions (e. g. wigc, to, je2eli, zatem, albo,
lub etc.); b) their co-occurrence with expressions predestined to enter intoa relation (or to co-occur) with the sentence, cf. e. g. chosen particles andso-called "modifiers of declarative sentences"t (". g. chyba, na pewno, no,
alei).The primary context of occurrence of CALclass elements is a dia-
logue. Description of types of leftward context of given CAL consists inestablishing what conditions must be fulfilled by sentence q in order thatone could answer the utterance realized by this sentence by means of thesentence equivalent constituted by CAL. The most generally accepted
division of sentences into declarative, interrogative and imperative sen-
tences (however, it will certainly not appear to be sufficient)6 can be thestarting point of categorization of sentences 4 (as the possible contexts ofgiven CAL).
1.2 Referring to the opposition (generally accepted in linguistics): sen'tence - utteronce,' I use the tetm sentence (also sentence equivalent) (p, e, r,s) to denote the entity interpreted syntactically and semantically (i. e. thestructure which is realized on the basis of grammatical rules and which is
- on the strength of the cognitive conventions8 - a conveyer of certaincontents) and the term utterance (@ to denote the sentence(s) / sentenceequivalent(s) used by the speaker § and aimed at the addressee ,4. in a
certain situation, i. e. the entity interpreted pragmatically.Dialogue - the primary context of CAL occurrence - is a sequence of
at least two utterances such that the second is a reaction to the ltrst. Theminimal dialogue ur:it (MD() is such a dialogue that is the sequence oftwo (and only two) utterances used by two different speakers. I will call
The class distinguished by GRocHowsKI (1986).This division is not based on clear homogeneous criteria and it is often appliedto sentences (syntactic entities) and to utterances (entities interpreted pragmati-cally) as well. I treat it only as the starting point of the tentative general semanticcharacterizations of sentences q - the leftward contexts of given CAL occurrence.Cf. e. g. STRAwSoN (1950), BACHTIN (1979). The opposition sentence - utterance
consists in treating the sentence as a unit of the langue-plane and the utterance as
a unit ofthe parole-plare, cf. LYoNS (1971), cf. also PADUöEvA (1985).On the concept of the cognitive and non-cognitive linguistic conventions see:
BocusLAwsKr (1979).
5
6
4 The syntactic classifications of interjections proposed by GRocHowsKr (19g9;1993) are made up mainly on the basis of the co-occurrence criteria. Neverthe_less, two subclasses ol interjections are an exception: onomatopoeias and, yolitiveinterjecrions, because they may be regarded as arguments of pure syntactic rela-tions. In this respect, one cannot consider these lexemes to be asyntagmatic (cr.cRocHowsKr 1992,157).
5tt
the first of the utterances "action-utterance,, (A() and the second one"reaction-utterance" (RU)g .
Describing semantic features of the CAl-class elements, one ought totake into consideration that they constitute sentence equivalents used asa part of dialogue. Thus, it is cAL constituting sentence equivalent r(realizing a Äu in an MDU, i. e. in the context of the ALI realized bysentence q) that should be the subject of semantic analysis. It must bepointed out that the AU - making the context - determines the object ofreference of cAL. In this connection, only these elements of contentsconveyed by a given CAL which are independent of the context (i. e.which are identical in the context of the given type) can be regarded asthe semantic components of this CAL.
The statement of the intratextual reference of cAL can be a basis ofadvancing the hypothesis about the metatextual character of these lexe-mes"' : something is said by means of them about the content (the part ofcontent) of sentence 4 making the context (realizing ,4I4. Thus, it is thesentence p - equal to q ar to its part - that is the object of CAL refer-ence. This can be confirmed by such pairs of MDUs - contexts of CALuse - in which: a) CAL is referred to the same sentence (p) by differentsentences q, cf.:
(1) Czy lan jutro przyjedzie?'Will John arrive tomorrow?'
Tak / Owszem / Oczywi§cie.'Yes / Oh yes / Of course (he will).'
(2) Jan jutro przyjedzie.'John will arrive tomorrow.'
Tak / Owszem / Oczywi§cie.'Yes / Oh yes / Of course (he will).'
b) CAL is referred to different sentences (p) by the same q, cf.:
(3) S4dzg, 2e Jan jutro przyjedzie.'John will arrive tomorrow, I suppose.'
I adopt the terms action-utterance ("wypowied2-akcja,,) and reaction-utterance("wypowied2-reakcja") from CHoJAK (1992).This hypothesis obviously concerns only these elements of the cAl-class whichare meaningful. However, I do not preclude a priori the existence of semanticallyempty CALs, which can perform exclusively pragmatic functions.
10
59
(3a) Tak / Owszem / Oczywi§cie - przyjedzie.'Yes, he will.'
(3b) Tak / Owszem / Oczywi§cie - sqdzis4 ale nie wiesz tego napewno.'Oh yes, you do (suppose), but you don't know it for certain.'
In this connection, one may claim that in the semantic structure of CAL,the predicate 'say about:' is contained. It is the sentence p in suppositio
materialis (but interpreted semantically) that is the denotation (one ofarguments) of this predicate. The identihcation of the object of CALreference is the condition of the unambiguous comprehension of thatsentence equivalent which is constituted by this CAL; thus, more thanone interpretation of a given CAL (even in the context of the same q - cf.the example (3) above) does not have to entail the thesis that this CALhas more than one meaning (that it is equivocal).
It is not possible to describe the relation (opposition) q - p as a con-stant (inter)dependence determined by the semantic structure of q, em-ploying such concepts as illocution or modalityll . Quite the contrary, atleast in certain contexts, distinguishing the sentence p as the object ofCAL reference depends, to some extent, on the decision of the ,RU-
speaker. An attempt to describe this opposition, referring to the thematic-rhematic structure of 4, appears to be ineffective, too: in the case of 4 oftype (3), p may be interpreted as identical to the rhematic part (rhematicdicturn) of 4, but when q is an interrogative sentence, p is identical to thethematic part (thematic dictum) of qt2 .
The opposition q - p canbe described only from the viewpoint of RU-speaker / AU-addressee. The elements of 4 content which may be left be-yond p are represented by predicates often called "modal" or "illocution-ary" (I will denote them with letter 1)13 implying the personal argument,
11 One could tentatively characterize p as propositional content of q (cf. SEARLE
1965), especially when 4 is an interrogative sentence (cf. example (1)), providedthat such dismemberment of any sentences/utterances in the content planewould be accepted. However, such an interpretation is not possible with refer-ence to the utterance quoted in (3).
12 Cf. the analysis of interrogative sentences proposed by BocUSLAwSKI (1977).13 In sentences reporting an utterance, the exponent lcan be represented by the so-
called illocutionary verbs. Nonetheless, one ought to remember that the illocu-tionary verbs, in the sentences reporting utterances, can give an account of the
60
equal to the ,4U-speaker, and the sentential argument p. Thus, I is theexponent of relation between the sentence q and the speaker (and - incase of need - the addressee) of the AU. Treating 1 as a facultative ele-ment (possible 1:0)ta, one may interpret each q, from the viewpoint of,RU-speaker / AU-addressee, as a sentence in which p - one of the argu-ments of the relation expressed by / - is embedded, i. e.: q : I(d. Tnegeneral schema of the structure of cAL occurrence context, that is tosay, the schema of MDU in which the sentence equivalent r constitutedby CAL realizes RU may be as follows:
(4) AU - q:'I(p)'RU - r.'saying about ,,p,,, I say: x,
(AU - action-utterance; R[l - reaction-utterance; q - sentence realizingAU; r - sentence equivalent constituted by CAL, realizing ÄU; p _ sen-tence (clause) embedded in q, being the denotation (one of arguments) ofthe predicate 'say about:' (which is present in the semantic structure ofcAL); 1 - exponent of the reration between sentence p and. A(J-speaker(and, in case of need, A[.i-addressee), communicated on the strength ofthe cognitive linguistic conventions; x - other semantic components ofCAL).
The reduction of MDU - as the context of cAl.-class element occur-rence - to one schema (4) will allow us, to my mind, to formulate seman-tic explications of all meaningful cALs, as well as to avoid multiplying"contextual" meanings of given cAL, which could be a consequence ofdifferentiation of contexts (and possible objects of reference) of thisCAL.
2.1 The chosen units of Polish - cALclass elements, whose semanticfeatures are the subject of description in the present paper (see § 0.),have not been, as far as I know, systematically analysed so farls . The
contents which are not communicated in this utterance (reported) on thestrength of cognitive conventions.one obtains the situation like this when: a) there is no predicate .I in the struc-ture of q (and, automaticaly, q : p): b) there is predicate 1 in the structure of qbut it is not, in consequence of referring CAL to 4, left beyond p; then q : p :.I(s) where s is the sign ol sentence (clause) embedded in p = q, ueing ttre urgu-ment of the predicate /.The only attempt known to me to interpret an expression which may be treatedas a cAl-class element is wierzbicka's proposal of explication of Russian aga,cf.: 'I think you would want to say that you and I say the same (about it). yäu
14
t5
6l
definitions of these expressions contained in modern Polish dictionaries(cf. the respective entries in: SJPD, SJPSz, SPPD) are not of the kindthat could be accepted. Most of them are logically incorrect (so-called
circulus vitiosus), therefore one cannot treat them as a comfortable startingpoint of the analysis of the units under examination. For example, theexpression oczywi§cie, which is defined, among others, by means of theexpressions naturalnie, rozumie sig (see: SJPD V, 631; SJPSz ll, 441;SPPD, 431), is contained in the definitions of the expressions naturalnieand rozumie sig (see: SJPD IV, 1223, YlI, 1311; SJPSz lI, 299,III: 126).
The expressions oczywi§cie and / or naturalnie are also contained, amongothers, in the dehnitions of the following expressions: (no)pewnie,
(no)pewno (see: SJPD, YL,269-270; SJPSz ll,64l; SPPD, 500), no chyba
(see: SJPSz 1,287), jasne (see: SJPD III, 342; SJPSz I, 826). On the otherhand, the expressions a jakie, jak najbardziej and no chyba are character-ized by means of unclear metalinguistic definitions, cf.: a jakie -"wyra2enie ekspresywne wzmacniaj4ce, potwierdzaj4ce, niekiedy ironicz-ne" (expressive, strengthening, confirming expression, sometimes ironic)(SJPD III, 319; SJPSz I, 820); jak najbardziej - "kategoryczna formatwierdzqcej odpowiedzi" (categorical form of affirming answer) (SJPD III,309; SJPSz I, 819); no chyba - "wyra2enie u2ywane jako mocne po-
twierdzenie tre§ci pytania" (expression used as strong confirmation ofquestion content) (SJPD 1,940; SJPSz I, 287).
Undertaking an attempt to interpret the meaning of oczywi§cie,
WrBnzgIcKA (1969) ascribed to it the following explication formula:"sqdzg,2e rozumiesz, 2e nie mo2e by6 inaczej" ('I think you understandthat it cannot be otherwise') (WIERZBICKA 1969, 54). Although Wierz-bicka's proposal concerns oczywi§cie 2 (in the function of a declarativesentence component, i. e. the autosyntagmatic lexeme)'u homonymouswith the CALclass element under consideration, it can nevertheless be
- as opposed to the dictionary dehnitions mentioned above - a comfort-able starting point of the analysis of at least a few units considered inthis article.
can say it now.' (WIERZBICKI 1991). On the semantic features of Polish tak andowszeml wrote in DoBACzEwSKI (1995).
16 I. e. particle - according to GRoCHowSKI's (1986) classification or modalizer -according to LASKowSKI's (1984) classification.
62
2-2 It seems to be undeniable that the units examined here communicatesimilar contents. All of them are used to realize affirming answers to yes /raquestions or to "confirm" content of declarative sentences. In all thesentence equivalents quoted in (6), (8) (constituted by CALclass ele-ments) in the context of the sentences (5), (7) it is said abo\t,,p,, ="Janpowinien przeprosiö Anng za swe zachowanie" ,'Johrr should apologize toAnna for his behaviour', that John should apologize to Anna for hisbehaviour, cf.:
(5) Czy Jan powinien przeprosiö Anng za swe zachowanie?'Should John apologize to Anna for his behaviour?'
(6) - Oczy'wi§cie. - Naturalnie. - Jasne. - Pewnie. - No chyba. -A jak2e. - Jak najbardziej.
(7) Jan powinien przeprosiö Anng za swe zachowanie.'John should apologize to Anna for his behaviour.'
(8) - Oczywi§cie. - Naturalnie. - Jasne. - Pewnie. - No chyba. -A jakZe. - Jak najbardziej.
Quite an adequate reaction to the answers quoted in (6), (8) could be thiscomment:
(9) Wbrew temu, co powiedzial nadawca WR w (6), (8), wcalenie jest tak, 2e Jan powinien przeprosiö Anng za swe zachow-anie.'Contrary to what ÄU-speaker said, it is not the case thatJohn should'apologize to Anna for his behaviour.'
The following sentences (10)-(12) (realizing RU to AU quoted in (5),(7)) are undeniably self-contradictory, cf.:
(10) *Oczywi§cie, ale wcale nie jest tak, 2e Jan powinien przepro-siö Anng za swe zachowanie.'Of course loczywi§ciel, but it is not the case that John shouldapologize to Anna for his behaviour.'
(11) *Pewnie, ale Jan wcale nie powinien jej przepraszaö.'Certainly lltewniel, but John shouldn't apologize to her atall.'
63
(12) *Jak najbardziej, ale nie s4dz9, 2e Jan powinien przeprosiöAnng (za swe zachowanie).'Oh yes, indeed ljak najbardziej, btrt I don't think that Johnshould apologize to Anna (for his behaviour).'
Moreover, all the answers adduced above (6), (8) can be regarded as
containing some additional content components which cause the answerslike these to be described as "strong", "categorical" etc., although cer-tainly not all the lexemes constituting the answers (6), (8) are synony-mous. RUs realized by a jakie and jak najbardziej seem to communicatefundamentally different contents (from the others). Synonymy of theother lexemes is not indisputable either. In order to establish which ofthese lexemes are synonymous and which differ (from each other) inmeaning, one ought to undertake detailed semantic studies of them andattempt to make up semantic explications of particular lexemes.
2.3.1 The broadest range of inter-equivalent substitution appears to be aproperty of the following lexemes: oczywi§cie, naturalnie, jasne and pew-nie17 . They can constitute sentence equivalents realizing RU in the con-text of AU realized by interrogative sentences (so-called yes / noques-tions, cf. (5)-(6)), declarative sentences (cf. (7)-(8)), as well as imperativesentences, cf. e. g.:
(13) Przynie§ bagaie.'Bring the luggage.'- Oczywi§cie. - Naturalnie. - Pewnie. - Jasne.
Obviously, pragmatic differences occur amongst these lexemes. Oczywi§ciecan be regarded as pragmatically neutral, the others - as pragmaticallycharacterizedi naturalnie is more formal than oczryi§cie; pewnie and jasne
are more informal and colloquial - their use is limited to informal com-municative situations.
Assuming that lexemes ocz)»ti§cie and naturalnie may actually be in-terpreted as synonymsl8, I maintain that the differences between oczywi§-
All these lexemes - CAl.-class elements - have their homonymous counterpartsin other classes of lexemes: oczywi§cie2, ndturalnie2, pewnie2 are pfilicles, natu-ralniq is an adverb, whereas 7'csne is homonym of the neuter form of the adjective7asny. Nevertheless, lor clarity of the description, I omit the numeral markers atthe lexemes belonging to the CAL<lass.Provided that two asyntagmatic lexemes oczlwi§cie have been distinguished:oczywi§cie1 by means of which it is said about "p" that p and oczywi§cie2 by means
77
.l 8
( r'l
cie, pewnie a',d jasne cannot be reduced onry to the pragmatic opposi-tions. I will endeavour to present some arguments for the thesis thatthese lexemes communicate somewhat different contents; however, I amaware that the interpretations of their meanings proposed by me, as theyare supported mainly by my own linguistic intuition, may be very contro-versial.
The essential difference between oczywiscie and pewnie seems to be asfollows: the contents communicated by oczywiscie convey the impressionthat they are more objective, whereas pewnie appears to comprise subjec-tive elements and some components of imperative or persuasive nature. Ithink that the explication of oczywiscie proposed by wrERzBrcKA (1969)contains the inadequate component in the form of the deontical predi-cate 'it cannot be otherwise' (= 'it must be so'?). Referring this predicateto a state of affairs ("be otherwise") ought to be, in my opinion, regardedas invalid, cf. the not self-contradictory sentences (15)-(16) in the contextof AU (14):
(14) Czy Jan 2eni sig zMari4?'Is John marrying Anna?,
(15) - Oczywiscie, choö moLe / moglo byö inaczej (wcale niemusi / musial sig z ni4 Leniö).'Yes, of course [oczywi§ciel, but it can / could be otherwise(he does / did not have to marry her).,
- Pewnie, choö r6wnie dobrze moie / m6gl sig z ni1 nie Le_niö.
of which it is not said that p. It appears that oczwisciez can be used without ex-plicit verbal context (but, on the other hand, it does not seem to refer immedi-ately to states of affairs), therefore it may be regarded as a non-contextual asyn-tagmatic lexeme. cf. the following examples of use of oczl.wiscie2 without vertarcontext (i) and with verbal context (ii), in which it is not said that p:
(i) - Oczywi§cie! - krzykngla mamusia, gdy wszedlszy do pokoju ujrzala napodlodze strzgpy pozostawionych na stole dokumentöw, wsroo ttoryctrbaraszkowalo zachwycone niemowlg.
(ii) - wojtek znowu zgubil pieniEdze. - oczpviscie. Jemu nic daö do rgkinie mo2na!
what is the subject of semantic analysis here is the rexeme oczywisciel(undeniably belonging to the cAl-class) and this lexeme is considered to ie syn-onymous with naturalnie.
(16)
65
'Certainly lpewniel, however he may / might as well not marryher.'
Thus, the component 'it cannot' proposed by Wierzbicka ought to be re-
ferred to a judgment about a state of affairs rather than to the state ofaffairs itself (the latter causes this explication to sound too "fata-listical")le, cf.: 'I think you understand that one cannot think (of p) thatnot p'. This formula is quite adequate, to my mind, for the contents com-municated by paonie because it links the subjective elements mentionedabove ('I think you understand') with some persuasive elements ('onecannot'). Furthermore, the elements 'you' and 'I' can show the informal,colloquial character of pcwnie.
Regarding the interpretation of oczywi§cie, I rather incline to explicatethe contents implied by this lexeme by means of other concepts -concepts that would give an account of "epistemic objectivism" of those
contents. The premise for the hypothesis about such a character of themeaning of this lexeme is the interpretation of a number of occurencesof the lexemes oczywi§cie and pewnie. The answers constituted by oczy-wi§cie (IBJ, QD, Q4) do not have - as opposed to those constituted bypewnie (19), (22), (25) - a subjective and persuasive character. Quite thecontrary: the assumption of the adequacy of p (constituted by the speakerwhen using oczywi§cie) seems to result from objective premises whichcould be paraphrased by means of such concepts as "forecast" or even"knowledge", cf.:
(17) I ona möwi ci tak o wszystkim, bez ienady?'And does she tell you about everything, without shame?'
(18) - Oczwi§cie.
(1e)
(20)
(21)
(22)
Po2ycz mi sto zlotych do pierwszego.
'Lend me 100 zl. until the first (of next month).'
19 Wierzbicka's proposal will have been exploited in the explication formula of a
.iakie (see § 2.3.3).
(23) To Ziemia krgci sig wok6l Slorica?'Is it the Earth that goes round the Sun?,
(24) - OczYwi§cie.
(25) - Pewnie.
The speaker of the R t/ (18), (21), (24), saying (about ,,p,,) that p, says alsothat one can / could expect, foresee or even know that p. The hypothesisabout the semantic difference between oczywi:icie and, pewnie can be alsoconfirmed on the basis of interpretations of the contexts of the type (26)where sentence q is explicitly expressive (WTERZBICKA (1969) calls theutterances iike these "expression of volition"), whereas the RU realizedby oczywi§cie - as opposed to that realized. by pewnie - is rather impossi-ble, cf.:
(26) Niechby Jan ju| wr6cill'Wish John would come back already!,
(27) - Pewnie.
(28) -*?Ocz,'wiscie"20
when p is referred to the present or future state of affairs, the contentscommunicated by oczywiicie could be paraphrased by means of the se-quence: 'one can / could foresee that p, (cf. (29)). On the other hand,when p is referred to the past state of affairs, such an interpretationwould be inadequate, cf. (30):
(29) Przyjdziesz jutro na zebranie?'Will you come to the meeting tomorrow?,
- Oczywi§cie.
(30) Czy Kopernik ju2 umarl?'Is Copernicus dead?'- Oczywi§cie.
For paraphrasing the contents communicated by oczywiscie in (30) theconcept of "knowledge" seems to be more adequate than the concept of"forecast" - the ÄU-speaker in (30) says something like this: ,.It isknown". Regardless of whether p is referred to future states of affairs(i. e. such as can be foreseen) or to past states of affairs (i. e. such as can
20 The answer oczlwi§cie in (28) could be accepted only under the condition that itwas interpreted as constituted by the lexeme oczywiscie2 (cf. footnote 1g).
67
be just known), the interpretation of the contents communicated by oczy'
wi§ciemay be as follows: the speaker of the.RUrealized by oczywi§ciesays
about "p" that p; he also says that p is such that, knowing about the other
things (ry...r), one can know that p21 .
The lexeme jasne - similarly to oczywi§cie - implies that adequacy of p
results from objective premises but, on the other hand, some persuasive-
ness and directness are characteristic of it (in this respect jasne is similarto pewnie).Interpretation of the contents communicatedby jasne may be
nearly identical to that of oczywi§cie. However, the component 'one can /could know' ought to be, in my opinion, replaced with 'you can / could
know' (in order to report the persuasiveness and directness mentionedabove).
The explication formulae of meanings of the lexemes oczywi§cie
(: naturalnie), pewnie and jasne - realizing ,RU in the context of AU real-
ized by s: I(p) - can be as follows:
(31) Oczywi§cie / Naturalnie.:'Saying about "p", I say: p. That p issuch that (knowing that 11...r) one can / could know that p.'
(32) Pewnie.:'Saying about "p", I say: p. I think you understandthat one cannot (could not) think (of p) that not p.'
(33) Jasne.: 'Saying about "p", I say: p. That p is such that(knowing that 11...r) you can / could know that p.'
Here are the explications of chosen examples of uses of these lexemes (inbrackets - the identihcation of p, the object of reference of the sentence
equivalent constituted by CAL):
(34) Czy Janprzyjedzie na konferencjg?'Will John arrive at the conference?'(p: Jan przyjedzie na konferencjg.'John will arrive at the conference.')
(35) - Oczwi§cie..''Saying about "Jan przyjedzie na konferencjg", Isay: John will arrive at the conference. That John will arriveat the conference is such that (knowing the other things) one
21, Cf. the explication of Polish verb przewidywai, 'foresee', proposed by Gno-cHowsKI (1980,84): "Xprzewiduje,2e stanie sig A= Xniewre,czy stanie sig l;X wie, ie B i X wie, Le B-+A i to powoduje, 2e X s4dzi, 2e stanie sig 1." ('X fore-sees that I will happen : Xdoes not know if ,4 will happen; .{knows that B andXknows that B-+A, and this causes Xto believe/think that I will happen').
(r ll
can / could know that John will / would arrive at the confer-ence.'
(36) - Pewnie.: .Saying about ,,Jan przyjedzie na konferencjg,,, Isay: John will arrive at the conference. I think you under_stand that one cannot (could not) think that John will(would) not arrive at the conference.,
(37) - Jasne.: 'saying about,,Jan przyjed.zie na konferencig,,, I say:John will arrive at the conference. That John will arrive at theconference is such that (knowing the other things) you can /could know that John will / would arrive at the conference.,
(38) Nie pal przy Jasiu, bo on chory.'Don't smoke in Jack,s presence because he,s ill.,@ = fy (AU-addressee): nie paliö przy Jasiu. ,yot (AU_ad-dressee): not to smoke in Jack,s presence.,)
(39) - Oczywi§cie.: 'saying about ,,Ja: nie paliö przy Jasiu,,, I say: Iwill not smoke in Jack,s presence. That I will not smoke inJack's presence is such that (knowing the other things) onecan / could know that I will / would not smoke in Jack,s pres-ence.'
(40) - Pewnie.: 'saying about ,,Ja: nie paliö przy Jasiu,', I say: Iwill not smoke in Jack,s presence. I think you understandthat one cannot (could not) think that I will (would) smokein Jack's prrlsence.'
(41) - Jasne.: 'saying about ,,Ja: nie paliö przy Jasiu,,, I say: I willnot smoke in Jack's presence. That I will not smoke in Jack,spresence is such that (knowing the other things) you can /could know that I will / would not smoke in Jack,s presence.,
The explications adduced above can be justified by using the method ofinquiring about contradiction, cf. the following sentences which (used asRU to AU (34), (38)) are self-contradictory:
(42) *Oczy,wi5cie, ale wcale nie möwig, Le mo2na (bylo) wiedzieö,2e Jan przyjedzie na konferencjg.'Naturally [oczywiscie], but I don,t say that one üan (could)know that John will (would) arrive at the conference.'
69
(43) *Pewnie, ale wcale nie m6wi9, 2e nie moZna (bylo) s1dziö, 2e
Jan nie przyjedzie na konferencjg.'Of course lpewnie), but I don't say that one cannot (could
not) think that John will (would) not arrive at the confer-
ence.'
(44) *Jasne, ale wcale nie m6wig, 2e moilesz / mogle§ wiedzieö, 2e
Jan przyiedzie na konferencjg.'Of course fjasne], but I don't say that you can (could) knowthat John will (would) arrive at the conference.'
(45) *Oczywi§cie, ale wcale nie möwig, 2e moLta (bylo) wiedzieÖ,
äe nie b9d9 palil przy Jasiu.'Naturally loczywi§ciel, but I don't say that one can (could)
know that I will (would) not smoke in Jack's presence.'
(46) *Pewnie, ale wcale nie m6wig, Le nie mozna (bylo) s4dziö,2e
bedp palil przy Jasiu.'Of course lpewniel, but I don't say that one cannot (couldnot) think that I witl (would) smoke in Jack's presence.'
G7) *Jasne, ale wcale nie m6wig, 2e moLesz / mogle§ wiedzieö, 2e
üa) nie bpde palil przy Jasiu.
'Of course liasnef, but I don't say that you can (could) knowthat I will (would) not smoke in Jack's presence''
2.3.2 The lexeme no chyba - as opposed to the lexemes examined
above - cannot be used as an A[/ to the AU realized by an imperative
sentence (regardless of whether these ,4Us would be interpreted as re-
quests, orders or commands), cf. e. g.:
(48) Przynie§ bagaie.'Bring the luggage.'
- *No chyba.
Thus, use of this lexeme is restricted only to the contexts in which the
AU is realized by a declarative sentence or an interrogative sentence Qtes /raquestion).
In the case of no chyba, the assumption of the truthfulness of p rather
does not follow upon the objective premises (in this respect it is similarto pewnie). Moreover, the answer no chyba is not possible in the context
^t
ol' questions revealing the speaker's ignorance concerning',fundamental,,or "obvious" matters, cf.:
(49) Czy pies jest zwierzgciem?'Is a dog an animal?'- *No chyba.
(50) Czy Kopernik ju2 umarl?'Is Copernicus dead?'- *No chyba.
Thus, use of this lexeme seems to be possible only when the .RU-speakerhas some reason to think not exactly that the lu-speaker does not knowif p (as in the examples (49)-(50)) but rather that the ,4u-speaker candoubt if p; and this is why the RU-speaker wants to persuade him (AtJ-speaker / ÄU-addressee) to think that p, cf .:
(51) Mo2esz i§ö?'Can you walk?'- No chyba - odpowiedzial ruszajqc upartym, szybkimkrokiem, przechodz4cym chwilami w bieg. (SJPD)'You bet - he answered, moving on with an obstinate, faststep, sometimes turning into a run.,
(52) Piotr powinien Anng przeprosi6.'Peter should apologize to Anna.,- No chyba.
The imperativeness and persuasiveness of utterances realized by no chybacan be reported by means of the additional component: 'I do not wantyou to think that not p'. In this connection, I propose to explicate thecontents of sentence equivalents constituted by no chyba (realizing Äuinthe context of AU realized by q : I(p)) bv means of the following for-mula:
(53) No chyba.'.'saying about ,,p,,, I say: p. I think you understandthat one cannot (could not) think (of p) that not p. I do notwant you to think that not p.,
The self-contradictory sentences (54)-(57) (used in the context of AUsquoted in (51)-(52)) can be justification of the adequacy of the explica-tion formula (53), cf.:
7l
(54) *No chyba, ale wcale nie möwig, 2e nie moZna (bylo) s4dziö,2e nie mogg i§ö.
'Of course [no chyba], but I don't say that one can't (couldn't)think that I can't (couldn't) walk.'
(55) *No chyba, ale wcale nie möwig, 2e nie chcg, by§ s4dzil, 2e
nie mogg i§ö.
'Of course lno chybal, but I don't say that I don't want you tothink that I can't walk.'
(56) *No chyba, ale wcale nie möwig, 2e nie mo2na (bylo) sqdziö,2e Piotr nie powinien Anny przepraszaö.
'Of course lno chybal, but I don't say that one can't (couldn't)think that it's not the case that Peter should apologize toAnna.'
(51) *No chyba, ale wcale nie m6wi9, 2e nie chca, by§ s4dzil, 2e
Piotr nie powinien Anny przepraszaö.'Of course lno chybal, but I don't say that I don't want you tothink that Peter shouldn't apologize to Anna.'
2.3.3 Communicating an explicit reserve concerning the contents of p is aparticular feature of utterances realized by a jakid2 . Llke no chyba, ttrislexeme cannot occur in the context of an AU realized by an imperativesentence. Moreover, the possibility of its parenthetical use is characteris-tic of a jakie, cf.:
(58) Wszystko przygotowalam juZ do podrö2y, a jakile. (SJPSz)
'I have already prepared everything for the journey, indeed.'
(59) Wszystko przygotowalam juZ - a jakLe - do podr62y.
(60) Wszystko przygotowalam - a jak2e - ju2 do podröZy.
(61) Wszystko - a jakle - przygotowalam ju2 do podrö2y.
I maintain that the contents conveyed by a jakie in all contexts (com-prising also its parenthetical use) can be explicated by means of the se-
quence: 'it cannot (could not) be otherwise'23 . The RU-speaker's attitudeof reserve (communicated on the strength of the cognitive conventions, I
22 The dictionary definitions describe this lexeme as "sometimes ironic", cf.definitions quoted above (in § 2.1).
23 Ci. Wierzbicka's proposal of explication of oczwi§cie adduced in § 2.1.
the
72
suppose) can be reported by means of the component 'I think you under-stand that, thinking of p, I want to say something else,, as well as - con-trary to the other CALs analysed here - by means of lack of the compo-nent 'I say: p'. The explication formula of the sentence equivalent consti-tuted by a jakie realizing a RU (in the context of an ALI realized by q- declarative or interrogative sentence) or used parenthetically could belike this:
(62) A jak2e.'. 'Saying about "p", I say: It cannot (could not) bethat not p. I think you understanci that I (thinking of p) wantto say something else.'
The adequacy of this formula can be checked against the explications ofthe following sentence equivalents constituted by a jakie (64), (66) (real-izing RU in the contexts of AU (63), (65)), cf.:
(63) Czy zaproslla§ szefa na przyjgcie?'Did you invite the boss to the party?'
(64) - A jakie.: 'Saying about "Zaprosilam szefa na przyjgcie,,, Isay: It could not be otherwise (that I would not invite him). Ithink you understand that I (thinking of that I invited theboss to the party) want to say something else.,
(65) Lewica wygrala wybory.'The Left won the election.'
(66) - A jakie.'.'Saying about "Lewica wygrala wybory,,, I say: Itcould not be otherwise (that the Left would not win the elec-tion). I think you understand that I (thinking of that the Leftwon the election) want to say something else.,
2.3.4 The last lexeme analysed here - jak najbardziej - has the narrowestrange of use. It can constitute a RU only in the context of an AU realizedby declarative sentences and yes ,/ naquestions. The initial article insPPD concerning this lexeme contains the directive that jak najbardziejcan be used only when it can be replaced with the adverb bardzda .
However, the examples below (67)-(68) reveal that the connection be-tween the appropriateness of jak najbardziej and the possibility of re-placing it with the adverb bardzo is very doubtful, cf. e. g.:
t3
(67) Czy wolno nam tak post4piö?
'Are we allowed to behave like this?'
- Jak najbardziej. - *Bardzo.
(68) Czy jest zimno?'Is it cold?'- *Jak najbardziej. - Bardzo.
The use of jak najbardziej in the function of a RU is possible only whenthe deontical predicate (with unrestricted reference) or the mental predi-cate (epistemic, volitive one - referred to RU-speaker) is contained in thestructure ofp, cf. e. g.:
(69) Piotr powinien Anng przeprosiö.
'Peter should apologize to Anna.'- Jak najbardziej.
(70) Chcesz herbaty?'Do you want some tea?'- Jak najbardziej.
(71) Jeste§ pewien,2e Jan przyjdzie?'Are you sure that John will come?'
- Jak najbardziej.
Interpreting p as M(s) (where M denotes the deontical or mental predicatewhose sentential argument is s), I propose to explicate the sentenceequivalents constituted by jak najbardziej by means of the following for-mula:
(72) Jaknajbardziej.:'Saying about "p" (: M(s)), I say: M(s). I say:M more than you think.'
These are examples of explications of the sentence equivalents consti-tuted by jak najbardziej adduced above (70)-(71), cf.:
(70a) Jak najbardziej.:'Saying about "Chca herbaty", I say: I wantsome tea. I say: I want it more than you think.'
(7la) Jak najbardziej.'. 'Saying about "Jestem pewien, 2e Jan ptzy-jdzie",I say: I am sure that John will come. I say: I am sureof that more than you think.'
24 See SPPD,223.
74
3. The semantic analyses of chosen Polish lexemes belonging to the CAL-class presented here are not, obviously, exhaustive; the semantic explica-tion formulae are only preliminary and tentative proposals. As it waspointed out earlier, they are the result of introductory observation basedon my own linguistic competence; some of hypotheses presented herewere not justihed to a satisfying degree. The need of further detailedstudies of the CAl-class elements is, in my opinion, undeniable.
Literature
Bacgrru, M. M. L9l9: Estetika slotesnogo tvoröestva. MoskvaBocusr,awsKI, A. 1977:On the semantic structuie of interrogative sen-
tences. ln Salzburger Beitröge zur Linguistik 3, Tübingen, 61-70Bocusrewsrl, A. i979: Performatives or metatextual comments? On the
cognitive and non-cognitive linguistic conventions. In: KwartalnikNeofilologiczny 26, 3; 3Al -326
CHoler, J. 1992: Odpowiedzieö - na ca? ln Studia gramatyczneX,43-54DoseczEws«t, A. 1995: Cechy semantyczne ieksemdw dopowiedzenio-
wych tak i owszem. In: M. Grochowski (ed.), Wyraienia funkcyjne wsystemie i w tek§cie. Materialy konfuencji naukowej. Toruri, 1-51-158
GRocttowsrt, M. 1980: Pojpcie celu. Studia semantyczne. WroclawGRocgowsfl, M., 1986: Polskie partykuty. Skladnia, semantyka, lek»k-
ografia. WroclawGRocHowsKI, M. 1989: Wprowadzenie do analizy syntaktycznej
wykrzyknikdw. ln Polonica 13, 85-99GRoCHowsKI, M. 1992: Status semantyczny wykrzyknikdw wla§ciwych.
ln: Prace Filologiczne 37,155-163GRocnowsrt, M. 1993: Syntaktische und semantische Eigenschaften
willensäußernder Interjektionen der polnischen Gegenwartssprache.In: G. Hentschel, R. Laskowski (eds.): Studies in Polish Morphologyand Syntax. München, 293-31,3
LesrowsKt, R. 1984: Podstawowe pojgcia morfologii. In: R. Grzegorczy-kowa, R. Laskowski, H. Wröbel (eds.): Gramatyka wspölczesnego jgzykapolskiego. Morfologia. Warszawa, 9-57
LYoNS, J. l97l: Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge.Peouörve, E. V. 1985: Yyskazyvanie i ego sootnesennost' k dejstvitel'nost'ju.
(Referencial'nye aspekry semantiki mestoimenij). Moskva
75
SALoNI, Z. 1974: Klasyfikacja Eramatyczna leksem6w polskich. lnl. lgzykPolski 53, l-2; 3-13,93-101
SEARLE, J. R. 1965: What is a Speech Act? In: M. Black (ed.): Philosophy
in Ameica. London, 211-239SJPD; W. Doroszewski (ed.): Slownik jezyka polskiego.
szawa 1958-1969SJPSz: M. Szymczak (ed.): Slownik jgzyka polskiego.
szawa 1978-1981SPPD: W. Doroszewski, H. Kurkowska (eds.): Slownik poprawnej
polszczy zny. Warszawa l, 97 3
SrRAwsoN, P. F. i95G: On Referring.ln: Mind 59,320-344\\TIERZBICKA, A. L969: Dociekania semantyczne. WroclawWIERZBICKA, A. 199tr: Interjections across cultures. In: A. Wierzbicka:
Cross-Cultural Pragmatia. The Semantics of Human Interaction. Berlin -New York, 285-339
Vols. I-XI, War-
Vols. I-III, War-
M ari a G ehrmann, O ldenb urg/ Berlin
Zur Semantik der je§li-Konstruktionen
l.l Ziel dieser Studie ist es, die komplexen Satzstrukturen (weiter auchVerbindungen bzw. Konstruktionen genannt), die mit Hilfe des Konnek-tors je§li gebildet werden, bezüglich ihrer semantischen Natur zu unter-suchen. Als "Konnektor" wird hier eine funktionale sprachliche Einheitverstanden, die keine oder aber eine sehr stark reduzierte lexikalische Be-
deutung aufweist und die die Art der semantischen Relation zwischenTeilen der syntaktisch komplexen Struktur anzeigt.
Die Untersuchung setzt an bei der Analyse der Relationen der seman-
tischen Inhalte der Verbindungsteile (weiter auch Teilsätze genannt) undformuliert sodann eine metasprachliche Interpretation der Konstruktio-nen. Als theoretische Fundierung dienen Ausarbeitungen zum EurotypProjekt "Adverbiale Subordinatoren in den Sprachen Europas", sowiegrundlegende Forschungen zur Untersuchung der Funktionswörter derentsprechenden FG am ehemaligen ZISW1 .
Die Analyse basiert auf Texten der modernen Gegenwartssprache; als
Belege wurden Beispielsätze aus einer Datensammlung von ca. 150 Kon-struktionen, die den publizistischen (aus aktuellen Nummem der Wo-chenzeitschrlft Polityka, weiter (P)), den literarischen (aus dem RomanPrzybysz z Narbony von Julian Stryjkowski, weiter (S)) sowie den um-gangssprachlichen Stil (aus einigen Briefen) repräsentieren. Außer denjeJliKonstruktionen werden auch Konstruktionen mit anderen Konnek-toren in die Untersuchung einbezogen, soweit sie mit jenen in irgend-einer Art korrespondieren.
Die je§llKonstruktionen werden syntaktisch als zusammengesetztesubordinative Sätze mit der Struktur je§li p, q bzw. ihrer Konversion 4je§li p realisiert. Als Korrelat kann in den Konstruktionen to, tu, wöwczas
vorkommen. Das häuhgste Korrelat ist lo (in 65% aller Konstruktionen),es ist jedoch fakultativ, d. h. es trägt zur jeweiligen semantischen Inter-pretation nicht bei, und man kann es, da es in den publizistischen undumgangssprachlichen häufiger als in den literarischen Texen begegnet,
als stilabhängig bezeichnen.
Siehe die Ausarbeitungen in KoRTMÄNN (1990) sowie LaNc (1977)
18
1.2 Die Konnektoren je§li und jeieli werden hier als Synonyme betrachtet(demnach wird weiter nur je§li verwendet), denn weder lassen sich Diver-genzen im Gebrauch der beiden Konnektoren feststellen, noch differen-zieren lexikographische Werke deren Gebrauch. Der Slownik jgzyka pols-
kiego (hrg. von W. DonosznwsKl) führt sie zwar als getrennte Lemmataauf, gibt jedoch in beiden Fällen die wortgleiche Dehnition an; das GrotJ-
wörterbuch Poln. - Dl. verweist unter je:ili attf jeieli.Etymologisch unterscheiden sich die beiden Konnektoren ebenfalls
nicht; je§li entstand als syntaktische Form aus der 3. Pers. Sg. Präs. vonbyö, d. h. jest + Fragepartikel /i (schon im 14. Jh. nur in der Funktioneiner interrogativen Struktur czy jest), jeieli - jesl + Verstärkungspartikelie + li.
Interessant in diesem Kontext ist die veraltete russische Form 6yde inder Bedeutung von 'wenn' und auch die dialektale russische Form ecro
6or, ebenfalls in dieser Bedeutung.In der Gruppe der modernen slavischen Sprachen wird der Konnektor
außer im Polnischen auch im Russischen (ecnu) und im Tschechischen(jestli), dialektal auch im Slovakischen, Ukrainischen und Belorussischenrealisiert, wohingegen die südslavischen Sprachen einen auf diese Artgebildeten Konnektor nicht aufweisen.
1.3 Der Konnektor;eill ist polyfunktional; seine Polyfunktionalität wirdin folgendem sichtbar:
- je§li signalisiert mehrere semantische Relationen;
- je§li signalisiert Verbindungen, deren Interpretation und somit seman-
tischer Typus nicht nur durch die Relationen zwischen den semanti-schen Inhalten der Teilverbindungen bestimmt werden, sondern sie
resultieren auch aus den Relationen zwischen semantischen Inhaltender Teilverbindungen einerseits und dem kommunikativen Wert derAußerungen andererseits.
Für die Analyse ergeben sich drei Gruppen von je.f/iKonstruktionen, die
nacheinander besprochen werden:
die Gruppe der jeJliKonstruktionen mit(weiter COND genannt),die Gruppe der jeJliKonstruktionen mit(weiter EPIST genannt) unddie Gruppe der jeJä:Konstruktionen mitzessiver oder kontrastiver Interpretation
konditionaler Interpretation
epistemischer Interpretation
konsekutiver, kausaler, kon(weiter entsprechend: KON
79
SEK, CAUS, KONZES und KONTR), die im Grenzbereich zwischenden beiden erstgenannten Gruppen anzusiedeln sind.
2.1 Als COND werden Konstruktionen verstanden, deren Teilsätze in sol-cher Relation zueinander stehen, daß die Existenz von p die Voraussetz-ung für die Existenz von q ist2 . Eine so breit angelegte Definition er-scheint brauchbar, weil dadurch die Zugehörigkeit der nicht zukunfts-bezogenen Konstruktionen zur Gruppe von COND außer Zweifel steht,was in manchen Abhandlungen nicht akzeptiert wird3.
Innerhalb der COND-Konstruktionen werden meist nach dem seman-tischen Kriterium Realität - Potentialität des in p ausgedrückten Sachver-haltes drei Gruppen unterschieden: reale, hypothetische und nicht-realeKonstruktionena . Je§ltKonstruktionen realisieren die zwei ersten Grup-pen der COND-Semantik.
Somit ist zunächst festzustellen, daß die jedliKonstruktionen zwardurchaus COND-Konstruktionen sind. Da sie aber nicht das ganzeCOND-Feld abdecken, können sie nicht als die COND-Konstruktionenschlechthin betrachtet werden; und die Funktion des Konnektors jeJli alseine konditionale Konjunktion par excellence, wie sie in den traditionel-len Abhandlungen angesehen wird, kann de facto nur mit Eingeschrän-kungen geltens.
Auch zwei weitere Spielarten der COND-Semantik, die man auch alsperiphere Art betrachten könnte, die nicht von je.(/iKonstruktionen aus-gedrückt werden:
die exklusive, bei der die in p ausgedrückte Voraussetzung für den inq genannten Sachverhalt genügende oder ausreichende Gründe sind;als Konnektor in den Konstruktionen dieses Typs kommt byle (by),
ieby verstärkt durch tylko vor, z. B.:
2 Diese Dehnition wurde den Grundzügen der Deutschen Grammatik (1981, 794)entnommen.
3 So werden z. B. in GRoCHo"vsKI (1984, 285) als grammatische Bedingungbezeichnet: Futurlormen in p und s; in q - V perfektiv.
Vgl. u. a. K0RTMANN (1990); ZtrxzEwsKA (1993); ENGEL (1988, 290). DieseMeinung wird z. B. von GAIIE (1980, 126) nicht geteilt.
Vgl. DoRoszEwsrr (1964,237); JoDr.owsKr (1977, 191); SzoBER (7962,378).
(l) Kilka razy ucieka, a raz nawet umy§lnie rani sig, byle tylkowyrwaö sig spod wladzy tyrana. (P)
'Einige Male versucht er zv fliehen, einmal fügt er sich sogarselbst eine Verletzung zu, nur um sich von der Tyrannei zubefreien.'
- und die negative, bei der die Existenz des in q augedrückten Sachver-haltes von der Nicht-Erfüllung der in p ausgedrückten Voraussetzungabhängt, die aber nicht negativ gebildet ist; als Konnektor kommthier chyba 2evor. Die Unmöglichkeit der Substitution mit je§liist abernur im Falle der potentialen lexikalischen und nicht der inkorporier-ten Negation wirksam; vgl. z. B. folgende chyboKonstruktion, die einenegierte jeJlr-Konstruktion als Synonym haben kann:
(2) Dostanie nowy paszport, chyba 2e ma stary.'Er bekommt einen neuen Paß, es sei denn, er hat noch denalten (außer (daß) er hat noch den alten.)'
(2a) +Dostanie nowy paszport, je§ii ma stary.
(2b) Dostanie nowy paszport, je§li nie ma starego.
Vgl. weiter Beispiel (2) mit einer folgenden chyba-Konstruktion, die eineinkorporierte Negation enthält; die jeJliKonstruktion ist mit ihr syn-onym:
(2c) Stare dowody osobiste s4 wa2ne do Smierci wla§ciciela. Chybai2 ten wcze§niej go zgubi - wdwczas otrzyma nowy. (P)
'Die alten Personalausweise behalten ihre Gültigkeit bis zumTode ihres Besitzers. Außer er verliert ihn vorher- dann bekommt er einen neuen.'
(2d) Je§li ten (/ kto§) wcze§niej zgubi paszport, w6wczas otrzymanowy.'Wenn er (/ jemand) vorher den Paß verliert, dann bekommt(er) einen neuen.'
Die nicht-reale COND-Semantik, in der Bezug genommen wird auf eineimaginäre Situation, die sich nicht hätte ereignen können, wird im Polni-schen durch Konstruktionen mit konjunktivisch markierten (durch diePartikel äy) COND-Konnektoren gdyby, jakby, ieby atsgedrückt. DieseKonstruktionen haben im Deutschen "normale" wenr.Konstruktionen als
81
Aquivalente, wodurch die Translationsproblematik erschwert wird, vgl.z. B.:
(3) Gdyby kilka lat temu kto§ mi powiedzial, 2e dla technikdw ra-
diowo-telewizyjnych zabraknie pracy, uznalbym go za idiotg.(P)
'Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, daß dieArbeit für Rundfunk- und Fernsehtechniker knapp werdenkönnte, hätte ich ihn für einen Idioten gehalten.'
2.2 Tnnerhalb der COND-Semantik drücken jeJliKonstruktionen diereale und hypothetische Relation aus. Die Häultgkeit dieser Konstruktio-nen (nach der Statistik des untersuchten Materials 36% aller je§irrKon-
struktionen) entspricht in etwa der der Konstruktionen mit EPIST-Se-
mantik. Das bedeutet, daß der Konnektor je§li auch frequentiell gesehen
kein herausragendes Element der COND-Konstruktionen ist, wodurchauch seine Transparenz unterstrichen wird.
Die reale COND-Relation zwischen den Inhalten der Konstruktions-teile bezieht sich auf reale Fakten in der Gegenwart oder Vergangenheit.Die Mehrzahl der je§li,Konstruktionen dieses Typs realisiert diese Seman-tik in Übereinstimmung mit den ihr entsprechenden grammatischenFormen: Futurformen (imp. / pf.) der Prädikation in p und perfektiveVerbform irr q, z. B.:
(4) Je§li utrzyma sig kurs na demokracjg, szanse wolnomularstwawzrosnq, je§li pöjdziemy w strong dyktatury, czy, nie daj Bo2e,totalitaryzmu - nastanq dla nas cigikie czasy. (P)
'Wenn der demokratische Kurs eingehalten wird, vergrössemsich die Chancen der Freimaurerei, wenn wir (aber) die Rich-tung der Diktatur oder, was Gott verhüte, des Totalitarismuseinschlagen - kommen schwere Zeilen auf uns zu.'
Es bleibt aber ein beachtlicher Rest von 7eJliKonstruktionen, derenTeile im Verhältnis der realen Setzung (p setzt q voraus) zueinanderstehen, in denen die grammatische Struktur der Teilsätze aber keineMarkierung bezüglich der Temporalität auflveist, d. h. die temporalenVerhältnisse unterliegen lediglich den Bedingungen der Setzung; somitkönnen beide Teilsätze im Futur oder im Präteritum stehen, wie in denfolgenden Beispielen:
82
Czlonkowie brygady wileriskiej, ktdrzy w rozmowie z redak-
torami "Respubliki" mieli powiedzieö, Le je§li nie oni bgdq
rzqdziö Wilnem, to bgdq to robiö Czeczency, zdolali nawet
nakloniö jednego z dziennikarzy Eazety do napisania uka-
zuj4cego ich w pozytywnym §wietle artykulu "Wilnem
rz4dzimy my". (P)
'Den Mitgliedern der Wilna-Brigade, die in einem Gespräch
mit den Redakteuren der "Respublika" gesagt haben sollen,
daß, wenn nicht sie die Machthaber von Wilna vrürden, wür-
den es die Tschetschenen, ist es sogar gelungen, einen der
Journalisten dieses Blattes dazu zu bewegen, einen sie im po-
sitiven Licht darstellenden Artikel "Wir beherrschen Wilna"
zu schreiben.'
Gdy kucharz przynosil kanapki dzieciom, ojcowie odsuwali
dzieci od talerza, jedli sami, i ewentualnie, je§li co§ zostawalo,
dawali to dzieciom i kobietom. (P)
'Wenn der Koch den Kindern belegte Brote gebracht hatte,
schoben die Väter ihre Kinder beiseite, aßen selbst, und
(dann) eventuell, wenn etwas übrig geblieben war, gaben sie
den Kindern und Frauen davon.'
Die Temporalität bildet nicht die einzige grammatische Restriktion,
denen die COND je.(/iKonstruktionen unterliegen; auch die morphologi-
sche Kategorie des Modus schränkt den Gebrauch bestimmter Formen in
den Teilsätzen ein, wenn sie den semantischen Prinzipien der setzung
nichtadäquatsind,wieimfolgendenBeispiel,indemdieFormdesln.dikativs in p keine voraussetzung für den Imperativ in q im Rahmen der
realen COND-Semantik ist:
(7) *Je§li bgdzie padal deszcz, wel patasoll
'Wenn es regnen wird, nimm den Regenschirm!'
Vgl. (7) mit den entsprechenden nicht abweichenden Formen der hypo-
thetischen COND-Semantik:
(1a) Je§li mialby padaö deszcz, weZ parasol!
'FürdenFall,daßesregnensollte,nimmdenRegenschirm!'
was die syntaktische struktur der coND jeJli-Konstruktionen angeht,
so bestehen die verbindungsteile aus wohlgeformten Sätzen ohne Eliipse
oder Reduktion. Das Korrelat to fehlt in dieser Gruppe auffallend oft,
83
was als Zeichen ausreichender Sicherung der semantischen Interpretationdurch die Inhalte der Verbindungsteile angesehen werden darf. Dazukommt noch die Tatsache, daß die Reihenfolge in den meisten Fällendem Prinzip der Sukzessivität folgt: je§li p, (to) q (82% der COND jeJliKonstruktionen im untersuchten Material). Somit läßt sich feststellen,daß die jeJliKonstruktionen dieses Typs eine hohe semantische als auchgrammatische Stabilität aufweisen.
2-3 Die hypothetische COND-Semantik bezieht sich auf eine Situation,die geschehen sein könnte. Wie oben schon bemerkt wurde, wird diese
Semantik vorwiegend dtrch gdybyKonstruktionen ausgedrückt; in derUmgangssprache nicht selten substitutiv durch jakbyKonsttuktionen.
"Ie.f/iKonstruktionen dieses Typs sind den gdybnKonstruktionen seman-
tisch gleich; jene unterscheiden sich von diesen durch geringere Fre-quenz und dadurch, daß die Konjunktivpartikel äy beweglich ist, wäh-
rend sie mit dem Konnektor gdy eine lexikalische Einheit bildet. Dieskann bedeuten, daß je§li in dieser Funktion einen geringeren Grad derEtablierung aufweist, vgl. die Stellung der Partikel äy in (8) mit der devi-
anten gdybyKonstruktion in (8a) und der einzig korrekten in (8b):
(8) Znaczy to, ie je§li Niemcy zatrzymaliby tg grupg, to zgodnie zobowiqzuj4cym prawem niemieckim skonfiskowano by imwszystkie marki, zostawiaj4c 20 na podr62. (P)
'Es bedeutet, daß, wenn die Deutschen diese Gruppe ange-
halten hätten, sie - dem deutschen Recht entsprechend - das
ganze Geld bis auf 20 DM Reisegeld konhsziert hätten.'
(8a) *... gdy Niemcy zatrzyrnallby ...
(8b) ... Cdyby Niemcy zatrzymali ...
Der Konnektor gdyby weist in den COND-hypothetischen Konstruktioneneinen höheren Grad von Spezialisierung auf als ie§liby.
Das Vorkommen des Konnektors gdy rtmfaßt - was das untersuchteMaterial belegt - hauptsächlich zwei semantische Bereiche: EPIST undTEMP. In den realen COND-Konstruktionen ist gdy aber ebenfalls belegt,
obwohl es nicht immer zu diesem Typ gerechnet wird6 ; hier ein Beispielaus demselben Artikel:
(s)
(6)
Dies wird weder in GRocHowsKI (1984) noch in ZAKRZEWSKA (1993) erwähnt.
84
(9)Je§lilohnjestambitny,topotrafisobieporadziöz|iczbamiwymiernymi . Gdy Johnjest ambitny i chce pdZniej studiowaÖ,
to musi zaliczyö cztery kursy matematyki' (P)
'Wenn John ehrgeizig ist, packt er die rationalen Zahlen'
Wenn John ehrgeizig ist und später studieren will, dann muß
er vier Semester Mathematik absolvieren''
Eine klare unterscheidung der coND- und der TEMP-Semantik ist bei
den gdyKonstruktionen schwer zu vollziehen; in den meisten Fällen sind
die beiden Interpretationen gleichberechtigt wie im folgenden Beispiel:
(10) Gdy padnie Grenada, twardy ich miecz spadnie na was' (S)
'WennGranadafällt,senktsichihrhartesSchwertaufeuchherab.'
Um das Bild der hypothetischen COND-Konstruktionen zu vervoll
kommnen, sollen hier auch die koordinativen Konstruktionen mit dem
Konnektor inaczei erwähnt werden, die ein Pendant zu entsprechenden
negativen ie§liby / gdybyKonstruktionen darstellen; vgl' z' B' (11) mit
(1 1a):
(11) Zaden minister 2ydowski nie stawial dobra swego narodu nad
dobrem swego kröla. Inaczej nie bylby ministrem' (S).NochkeinjüdischerMinisterhatdasWohlseinesVolkes
überdasWohlseinesKönigsgestellt.Andernfallswäreernicht Minister.'
(11a) Zaden minister 2ydowski, je§li stawialby / gdyby stawial do-
bro swego narodu nad dobrem swego kröla, nie bylby mi-
nistrem.'Kein jüdischer Minister wäre Minister, wenn er das Wohl
seines Volkes über das Wohl seines Königs gestellt hätte''
2.4 Konstruktionen, die die Außerungsebene betreffen, werden hier (wie
auch in den meisten AusarbeitunSen zum Thema) als dem epistemi-s chen Typ zugehörig betrachtetT'
In den verbindungen dieses Typs gibt es keine Restriktionen bezüg-
lich der Temporalität in der Struktur der verbindungsteile. Das ist ein-
leuchtend, denn die Interpretation der ganzen Konstruktion ergibt sich
nicht aus dem semantischen wert der durch die verbindungsteile ausge-
85
drückten Sachverhalte, sondern aus der Einstellung des Sprechers zudem Inhalt desjenigen des Verbindungsteils, für den das Redemomentrelevant ist.
Ein solcher Ebenenwechsel ist nicht nur den .1eJli-Verbindungen ei-gen. Solche mit anderen Konnektoren können ebenfalls dieses Merkmalaufweisen, vgl. z. B. eine adversative ale'aber' - bzw. eine kausale gdy2
'denn'-Konstruktion:
(12) Jan przyszedl za p6äno na obiad, ale to nic (zlego). Ktö? z
nas nie spöZnia sig czasami.'Jan kam zu spät zum Mittagessen, aber das ist nicht so
schlimm. Wer von uns verspätet sich nicht manchmal.'
(12a) Dobrze sig stalo, 2e Jan przyszedl za pöLno na obiad, gdyZZosia spiinlla sig z zupq.'Es ergab sich gut, daß Jan zu spät zum Mittagessen kam,denn Sophie verspätete sich mit der Suppe.'
Im Bereich der 7e.f/iKonstrukionen mit der EPlST-Interpretation las-sen sich mehrere Untertypen aufzeichnen:
Der topische (informative) EPIST-Typ, bei dem der kommunika-tive Wert von p in der Signalisierung einer Information bzw. eines Be-richtes zum semantischen Inhalt von 4 besteht. Im untersuchten Materialmachen diese Konstruktionen 5% aller 7eJlr-Konstruktionen aus. DieMehrzahl der Verbindungen wird mit der fast lexikalisierten (die Katego-rie der Temporalität wird noch realisiert) Wendung je§li chodzi / idzie ogebildet, z. B.
(13) Je6li chodzi o relacje z innymi wyznaniami chrze§cijariskimi- tu papie2 uwa2a, 2e katolicyzm najwigcej wspölnego ma zprawoslawiem.''Wenn es um die Beziehungen zu anderen christlichen Kon-fessionen geht - so meint der Papst, daß der Katholizismusam meisten mit der Orthodoxie gemeinsam hat.'
In der Funktion von p sind in diesem Typ von je.(/ri-Konstruktionen per-formative Ausdrücke typisch wie'. je§li möwig, ie ...,'wenn ich sage, daß',je§li pytasz, czy...,'werrrr du fragst, ob'.
Als Aquivalente aus dem COND-Bereich kommen die üblichen Kon-nektoren o ile, jak und co sig tyczy als Aquivalent des ganzen Ausdruckesje§li chodzi / idzievor.
So z. B. bei GÄrrp (1980, 152) oder RupoLpu (1981, 152)'
86
Der evaluative (einschätzende) EPIST-Typ. Der kommunikative
wert der jeJlr:Konstruktion besteht im Ausdruck der spra'chlichen Ein-
schätzung eines in p ausgedrückten Sachverhaltes durch den sprecher.
Die Frequenz von Konstruktionen dieses Typs ist sehr hoch; sie nehmen
in dem analysierten Material mit 2l% den zweiten Platz unter allen je§li
Konstruktionen ein, gleich nach den Konstruktionen mit coND-Seman-
tik.Innerhalb dieser Gruppe von Konstruktionen lassen sich weitere dif-
ferenzierteUntergruppendarstellen,wasvorallembezüglichderDistri-bution der Aquivalenzkonnektoren von Bedeutung ist'
Als Kriterium für die unterscheidung dient die Feststellung, ob die
geäußerte Einschätzung die Meinung des Sprechers über den Sach-
verhalt enthält oder aber eine implizite logische Konklusion aus
dem Sachverhalt darstellt,vgl. z. B' Beispiel (14), in dem 4 die Meinung
des Journalisten ausgedrückt wird, der man zustimmen kann oder nicht,
mit (15):
(14) Je§li ju2 szukaö w ustawie jakich§ podtekst6w polityczno-raso-
wych, to ustawa o AIDS odzwierciedla po§rednio rosyjskie
tendencje izolacjonistYczne'.WennmanschonindemGesetznachgewissenpolitisch-ras.
sistischenUnterschwelligkeitensuchenwill'dannwiderspie-geltdasAIDS-GesetzindirektrussischeTendenzenzurlsola-tion.'
(15) Je§li rubet padl w resultacie spisku, to po co bylo karad Dubi-
lina?.WennderRubelaufgrundeinerVerschwörunggefallenist,
wozu hat man dann Dubilin bestraft?)'
In (15) stellt q eine Schlußfolgerung dar, die zwar als Meinung eines
Journalisten fungiert, durch jeden von uns aber als eigene Konklusion
vollzogen werden könnte.
Für die jeiliKonstruktionen des EPIST-Typs ist kennzeichnend, daß
die verbindungteile aus syntaktisch nicht vollständigen Satzstrukturen
bestehen. Die durch q ausgedrückte Meinung bzw' Konklusion hat oft
die Form einer rhetorischen Frage Qe§ti nie chce, to co zrobiö?, .wenn er
nichtwill,wasdanntun?'),einerelliptischenWenduryQe§liniechcialprzyj§ö, to i dobrze, 'wenn er nicht kommen wollte, auch gut') oder eines
Expressivum s Qe§li nie zechce, to nie daj Boie!, ,wenn er nicht willig ist'
87
dann bewahre Gott '); die durch p ausgedrückte Prämisse kann durcheine pronominale Substitution oder durch ein anderes referentielles Ele-ment eine Verflechtung mit dem vorangegangenen Textabschnitt reali-sieren, z. B.:
(16) Je§li fakty nie s4 najwaLniejsze, to co jesf! (P)
'Wenn nicht Fakten am wichtigsten sind, was ist es dann?'
(17) Je§li tak, to im dlu2ej sytuacja pozostanie niejasna, tymtrudniej bgdzie j4 ostatecznie wyja§niö. (P)
''Wenn es so ist, dann wird es immer schwieriger, eine Situa-tion aufzuklären, je länger sie unklar bleibt.'
Dies ist allerdings nicht allein den je.(/iKonstruktionen eigen; es bil-det eher eine generelle Erscheinung in den komplexen Strukturen mitder EPIST-Semantik, vgt. z. B. ähnliche adversative a/eKonstruktionen in(18):
(18) Got6w jestem uwierzyd we wszystko, co dotyczy spotkania, z
wyjatkiem tego,2e Zbigniew H. wstal. Ale to dygresja. (P)
'Ich bin bereit, allem Glauben zu schenken, was diese Begeg-
nung betrifft, ausgenommen, daß Zbigniew H. aufgestandenist. Aber das ist eine Abschweifung.'
mit der Interpretation:
'die im ersten Teil der Aussage gemachte Außerung gehörtnicht zum Hauptthema, was hätte angenommen werden kön-nen.'
Was die Distribution der Aquivalenzkonnektoren betrifft, so könnenals Substitute zu je§li in den Konstruktionen der ersten Gruppe, d. h. denevaluativen der Meinung-Konstruktionen die Konnektoren o ile und jakvorkommen, aber nicht skoro, z. B.
(19) Wiadomo, 2e jak chlopi juZ co§ robiq, to malowniczo i z pew-
nym rozmachem. (P)
'Es ist bekannt, daß die Bauern, wenn sie schon etwas unter-nehmen, es dann malerisch und mit einem gewissenSchwung tun.'
Der Konnektor skoro fundiert in den Konstruktionen der zweitenGruppc mit der sehr schmalen, aber spezifischen und Ieicht lesbarenFunktion der Signalisierung einer Schlußfolgerung in der Art, daß dersemantische Inhalt von q eine Schlußfolgerung aus p ist. Der Konnektor
88
skoro ist dwch je§li ersetzbar, die synonymität ist jedoch nicht vollstän-
dig, die skoraKonstruktionen drücken die Schlußfolgerungssemantik
deutlicher aus, vgl. z. B.:
(20) Z tym dolarem widocznie nie wszystko jest w porz4dku, skoro
eksport katastrofalnie spada. (P)
'Mit dem Dollar ist offenbar nicht alles in Ordnung, wenn
der Export katastrophal zurück geht''
mit der reinen Schlußfolgerungsinterpretation von 17:
'der Export fällt, also ist etwas nicht in Ordnung'
und einer eindeutigen CAUS-Beziehung des Grundes'
Außer der obigen Funktion signalisiert skoro auch noch die KoN-
SEK-Semantik, die allerdings von der evaluativen nicht weit entfernt ist,
z. B.'.
(2t) Skoro wybrali§my "Partnerstwo dla Pokoju", to teraz
niezbgdny staje sig nacisk na przylgcie paristw wyszehrad-
zkich do NATO. (P)
'Da wir die "Partnerschaft für den Frieden" gewählt haben,
wird jetzt ein Drängen auf Aufnahme der "Wyszegtader"
Staaten in die NATO unvermeidlich''
mit der InterPretation:
'die Aufnahme muß / müßte als Konsequenz auf die Wahl
folgen.'
Syntaktisch weisen die skoroKonstruktionen keine von der typischen
Form abweichende strukturellen Merkmale auf; sie sind hypotaktisch, die
Reihenfolge der Verbindungsteile ist zur Hälfte skoro p, to q wd q' skoro
p, was nicht verwundert, da die Interpretation der Konstruktion, auch
wenn sie die EPlST-Einstellung des Sprechers beinhaltet, hauptsächlich
aus den semantischen Inhalten der verbindungsteile resultiert, die die
Grundlage für logische Schlußfolgerungen liefern'
Der stilistisch als umgangssprachlich markierte Konnektor jak kam im
untersuchten Material in den Konstruktionen dieser Gruppe gelegentlich
und seiner stilistischen Funktion entsprechend vor; der Konnektor o l/e
scheint hier nicht verwendbar zu sein.
zu der Gruppe der EPlST-Konstruktionen gehören auch FäIle, in de-
rren sich die Einstetlung des sprechers als Zweifel am wahrheitswert des
sachverhaltes zeigt. sprachlich kommt diese Einstellung durch rhetori-
89
sche Fragen bzw. modale Formen in p zum Ausdruck, vgl. dazu die inihrer Bedeutung polysemischen Formen von mieö im folgenden Beispiel(die erste bedeutet 'angeblich, wenn es wirklich so ist'):
(22) Je§li Jelzin ma imperialne zamiary, to nie ma lepszego mo-mentu, Zeby uderzyö na Polskg, ni? teraz, kiedy ministerzdymisjonowany. (P).Wenn Jelzin (tatsächlich) imperialistische Ambitionen habensollte, so wird es keinen besseren Moment geben, Polen an-
zugreifen, als jetzt, da der Minister demissioniert ist.'
Diese Semantik kann auch durch Korrelate verstärkt werden, vgl.:
(23) Ie§li naprawdg kochasz, to Bög ci pomo2e. (S)
'Wenn du wirklich liebst, wird dir Gott helfen.'
3. Im Grenzbereich der beiden Hauptgruppen von jeJlr-Konstruktionenmit semantischer und kommunikativer Interpretation stehen Konstruk-tionen mit Konsekutiv- und Kontrastinterpretation.
3.1 KONSEK je,f/iKonstruktionen bilden eine inverse Struktur zu denCAUS-Verbindungen. Die Anzahl dieser Konstruktionen ist nicht allzugroß, sie treten aber auch nicht als stilistisch markierte Elemente auf.
Diese jeiliKonstruktionen sind inverse CAUS- und nicht COND-Stn-lkturen, die ähnlich wie die additiven oder kontrastiven parallelenKonstruktionen eine Umstellung der Verbindungsteile zulassen: A i / a B= B i / a A; hier je§li p, to q : je§li q, to p.Davon zeugen außer ihrer Ursa-che - Folge - Interpretation auch grammatische Merkmale wie die tem-poralen Verhältnisse der Prädikation in p und q, vgl. z. B. folgendeKONSEK jeJliKonstruktion:
(24) Je§li panowie {...) odmöwill w Krakowie grania "Emigrant6w"Mro2ka, to czujq slg obra2eni. (P)
'Wenn die Herren (...) das Aufführen von Mro2ek's "Emi-granten" abgelehnt haben, dann fühlen sie sich beleidigt.'
mit der kausalen Struktur: p - Folge, q - Ursache, Grund und der Inter-pretation: 'Ablehnung der Handlung hatte als Ursache das Gefühl vonMißmut'.
Vgl. eine CAUS-Konstruktion:
(24a) Poniewa2 panowie czujq sig obraZeni, odmöwili grania.
90
'Weil die Herren sich beleidigt fühlen, haben sie das Spiel
abgelehnt.'
Diese Konstruktion weist die kausale Struktur: p - Ursache, q - Folge
und die Interpretation: 'Das Gefühl von Mißmut ist die ursache für die
Ablehnung der Handlung' auf.
Sowohl die Struktur des Kausalverhältnisses, die semantische Inter-
pretations als auch die temporalen Formen (Präsens in dem Teilsatz, der
die ursache ausdrückt; Präteritum in dem Teilsatz, der die Folge aus-
drückt, also keine temporale Aufeinanderfoige) sind h (24) und (24a)
gleich.Vgl. weiter eine wlgcKonstruktion des Typs KONSEK:
(24b) Panowie czuli sig obra2eni, wigc odmöwili grania'
'Die Herren fühlten sich beleidigt, also lehnten sie die Auf-
führung ab.'
mit Folge-Zuordnung und temporaler sukzessivität, und eine coND 7eJlr-
Konstruktion:
(24c) Ieleli panowie czuli sig obra2eni, odwolywali koncerty'
(24d) Jeleli panowie poczuli sig obra2eni, odwolali koncert'
mit der konditionalen Struktur: p - Bedingung, Voraussetzu\g, q - Wir-
kung und der semantischen Interpretation 'die Ablehnung der Handlung
war bedingt durch das Empfinden von Mißmut' und der Notwendigkeit
nicht nur temporaler, sondern auch aspektualer Übereinstimmung'
Diese obligatorisch-e Übereinstimmung der temporalen Formen (Suk-
zessivität) bei den coND-Konstruktionen und deren Mangel bei den
cAUS-Konstruktionen erklärt sich per definitionem: In den cAUS-Rela-
tionen geht es um den kausalen Rahmen einer Handlung, in den coND-Relationen um Existenzvoraussetzungen (konditionale setzung q durch
p).
Die KONSEK je.(/iKonstruktionen könnten allerdings als "normale",
d. h nicht inverse coND-Konstruktionen mit epistemischer semantik der
Schlußfolgerung interpretiert werden, vgl z. B':
(24e) Je§li panowie odmdwili w Krakowie grania "Emigrantöw"
Mro2ka, to (znaczy,2e) czujE sig obra2eni' (P)
9l
'Wenn die Herren das Aufführen von Mrozeks "Emigranten"ab gelehnt haben, dann (heißt das), sie fühlen sich beleidigt.'
mit der Struktur p - Prämissa, e - Schlußfolgerung und der semanti-schen Interpretation:
'Der Sprecher schlußfolgert aus der Aussage über die Ableh-nung der Handlung, daß sie aufgrund des Gefühls von Miß-mut bei den Herren zustande kam, als eine der möglichenErklärungen'.
Somit stehen diese "7e,f/iKonstruktionen im Grenzbereich zwischenden semantischen und kommunikativen Verbindungentypen.
3.2 Je§li-Konstruktionen mit der KONTR-Semantik bilden ebenfalls eineGrenzgruppe, da sie sowohl den semantischen als auch den kommunika-tiven Typ der Konstruktionen realisieren. Frequentiv entsprechen dieseKonstruktionen denen des KONSEK-Typs, ihr Anteil irn untersuchtenMaterial beträgt 9% aller Vorkommen.
Im Bereich der semantisch motivierten Verbindungen können je§li-
Konstruktionen alle Typen der Adversativität realisieren, von der simul-tanen Gegenüberstellung bis zur Konzessivitäte.Erster Typ: Die Gegenüberstellung.
Der Kontrast resultiert aus dem Gegensatz zwischen den semanti-schen Inhalten der Verbindungstelle; je§li ist ersetzbar durch adversativeKonnektoren: a, ale, lecz, podczas gdy, za§, natomias4 rymczasem. Als Sub-stitut aus dem kausalen Bereich ist nur o l/e möglich; gdy zeigt diesbezüg-lich eine interessante Entwicklung. Beispiele:
(25) Je§li V/atykan jest przede wszystkim rzeczywisto§ci4 doczesn4i geograftczn4, to Stolica Apostolska ma wymiar prawny, a
dla katoliköw glöwnie duchowy, w pewnym sensie nawetnadprzyrodzony. (P)
'Wenn der Vatikan eine vor allem weltliche und geographi-
sche Wirklichkeit darstellt, so hat der Heilige Stuhl einerechtliche und für die Katholiken vor allem eine geistliche,im gewissen Sinne sogar eine überirdische Dimension.'
(26) Je§li Berlusconi stanowi przyklad na poparcie tezy, 2e wielcybiznesmeni nie sprawdzajq si9 w roli polityköw, Jan Ga-
Von der möglichen EPIST-Interpretation wird hier abgesehen' 9 Zu den adversativen Typen des Polnischen s. GEHRMANN (1988).
92
wrofski jest zaprzeczeniem przyjgtego w Polsce pogl4du, 2e
dziennikarze nie powinni zabieraö sig za poiitykg' (P)
'Wenn Berlusconi ein Beispiel für die These darstellt, daß
sich große Geschäftsleute als Politiker nicht behaupten kön-
nen, so ist Jan Gawroäski ein Gegenbeispiel für die bei uns
populäre Ansicht, daß Journalisten keine Politik betreiben
sollten.'
Die verbindungsteile der o. a. Konstruktionen zeigen in ihrer struk-
turierung das für diesen Konstruktionstyp kennzeichnende Merkmal: Sie
sind parallel strukturiert und können somit umgestellt, reduziert und ihre
Elemente pronominalisiert werden, der Konnektor kann weggelassen
werden oder nimmt die Position zwischen den verbindungsteilen ein
(Koordination).im Falle von je§liKonstruktionen haben wir mit der Reaiisierung nur
einiger der Eiemente zu tun. Der Konnektar je§li behält auch hier, in den
Konstruktionen eines solchen semantischen Typs, dem eine koordinative
Struktur eigen ist, die Merkmale der subordinativen syntaktischen struk-
tur bei - im unterschied zu dem in einem anderen semantischen Be-
reich (Temporalität) als subordinativ geltenden, in den adversativen Kon-
struktionen aber koordinativ auftretenden Konnektor podczas gdy, vgl.
(26a) und (26b) mit (26c):
(26a)Podczasgdy/je§tiBer|usconistanowiprzykladnapoparcietezy, 2e wielcy biznesmeni nie sprawdzaj4 sig w roli polity-
köw, JaS Gawroriski jest zaprzeczeniem przyjgtego w Polsce
pogl4du, 2e dziennikarze nie powinni zabietaö sig za politykg'
(26b) Podczas gdy / je§li Ja§ Gwawro6ski jest zaptzeczeniem przy-
jgtego w Polsce pogl4du, 2e dziennikarze nie powinni za-
bierad sig za politykg, Berlusconi stanowi przyklad na popar-
cie tezy,2e wielcy bisnesmeni nie sprawdzaj4 sig w roli polityköw.
(26c) Berlusconi stanowi przyklad na poparcie tezy, 2e wielcy
biznesmeni nie sprawdzaj4 sig w roli polityköw, podczas gdy /\e§ti Ja§ Gawrofski jest zaptzeczeniem przyjgtego w Polsce
poglqdu, 2e dziennikarze nie powinni zabietaö sig za politykg'
Das Beispiel zeigt, daß der Konnektor je§ti in dieser Funktion syntaktisch
noch nicht ganz etabliert ist'
93
Was den Konnektor gdy betrlfft, so ist eine interessante Erscheinungder Kontamination der beiden Konnektoren podczas gdy wd gdy in derFunktion der Signalisierung adversativer Semantik zu beobachten, vgl.z. B.'.
(27) Demokracja nie jest jednak w stanie :ukryö, Le Radio Bre-meriskie, czy ORB, albo Rozglo§nia Saary to twory malutkie,gdy osadzony w Nadrenii Pölnocnej - Westfalii, landzie naj-ludniejszym, V/DR to gigant. (P)
'Die Demokratie ist jedoch außerstande zu leugnen, daß Ra-dio Bremen, ORB, oder der Saarländische Rundfunk sehrkieine Schöpfungen sind, während der in Nordrhein - Westfa-len, dem volkreichsten Bundesland, angesiedelte WDR einGigant ist.'
Zweiter Typ: Der Kontrast resultiert aus der unterschiedlichen Einschät-zung der Inhalte von Verbindungsteilen nach dem Kriterium: positiv -negativ, vorteilhaft - nachteilig u. ä.
Als adversative Aquivalente kommen hier ale, choö, als konditionale o
ile vor, z. B.:
(28) Taka krytyka jest potrzebna, nawet je§li okaie sig niesku-teczna. (P)
'Solche Kritik ist nölig, auch wenn sie sich als nicht wirksamerweisen sollte.'
,IeiliKonstruktionen dieses Typs greifen in die anderen des KONZES-Typs über, indem sie die KONZES-Semantik ausdrücken können und derKonnektor jeili durch ein Korrelat wie nawet im o. a. Beispiel bzw. durchein anderes aus dem konzessiven Bereich verstärkt wird, die zwar nichtobligatorisch für die Signalisierung der KONTR-Semantik sind, dochsehr wohlformend wirken. Atrntictr verhält es sich mit der Reduktionderselben Elemente im zweiten Teilsatz, die trotz der strukturellen Paral-lelität nicht realisiert wird, vgl. z.B. (28a) mit (28b):
(28a) Taka krytyka jest nieskuteczna, ale / choö potrzebna.
(28b) Je§li taka krytyka jest nieskuteczna, to jest ona fiednak /mimo to / mimo wszystko) potrzebna.
Dritter (KONZES-)Typ: Der Kontrast resultiert aus dem Widersprucheiner potentiellen Konklusion, die aus dem Inhalt des ersten Verbin-dungsteils gezogen werden könnte. Die adversativen Aquivalente sind
94
hier'. ale, chociai, mimo 2e, mimo to, Substitute aus dem COND-Bereich: o
ile, skoro, gdy, zw verstärkung der semantischen Interpretation sehr oft
das Korrelat'. nawet Beispiele:
(29) Je§li nawet dochodzi do konfliktdw migdzy administracjq
las6w panstwowych a niektörymi kolami lowieckimi, to nie
dotyczq one calego §rodowiska. (P)
'Wenn es schon zu Konflikten zwischen der Verwaltung der
staatlichen Wälder und den Jagdverbänden kommt, betreffen
sie nicht das ganze Milieu.'
(30) Nawet gdy zostan4 ujgci, czgsto niczego nie mo2na im udo-
wodni6. (P)
'Auch wenn sie gefaßt werden, kann man ihnen oft nichts
vorwerfen.'
Die Sicherung der semantischen Interpretation als KoNZES ist hier
durch die semantischen Inhalte der verbindungsteile gewährleistet. so-
mit hat das Korrelat nawet tatsäahlich eine verstärkende Funktion, ist
aber fakultativ; vgl. die KONZES-Interpretation von (29) ohne Berück-
sichtigung yon nawet 'es ist nicht so, trotz der naheliegenden vermutung,
daß die Konflikte einen breiten Charakter haben, sind sie lokal' mit einer
ählichen COND-Konstruktion
(29a) Je§li dojdzie do konfliktdw migdzy administracj4 las6w parist-
wowych a kolami lowieckimi, to dotknq one cale 6rodowisko'
(P)'Wenn es zu Konflikten zwischen der Verwaltung der staatli-
chen Wälder und den Jagdverbänden kommen wird, so wer-
den sie das ganze Milieu treffen.'
mit der Interpretation 'die Konflikte werden einen Grund darstellen für
ein schlechtes Klima im Milieu'. Es steht außer Zweifel, daß derartige
Konstruktionen auch als EPIST betrachtet werden können und daß die
Grenze zwischen den beiden Interpretationstypen fließend ist'
Evaluativer EPIST-Typ: Der Kontrast entsteht dadurch, daß eine aus
dem Inhalt des ersten Verbindungsteils im kommunikativen Sinne gezo-
gene Schlußfolgerung abgewiesen wird. wie in anderen EPIST-Konstruk-
tionen sind hier neben syntaktisch wohlgeformten strukturen als Teil-
sätze auch elliptische strukturen, rhetorische Fragen u. dgl. typisch, vgl.
z. B.:
95
(31) Je§li konflikt na osi Wschdd - Zach1d zostal rozwiqzany, tonie oznacza, 2e §wiatu latwiej bgdzie rozwi4zaö inny, ten naosi Pölnoc - Poludnie. (P)'Wenn (schon) der Ost-West-Konflikt gelöst wurde, bedeutetdas nicht, daß es der Welt leichter werden wird, einen ande-ren zu lösen: den Nord-Süd-Konflikt.'
(32) Je2eli uderzenie jednocze6nie we wszystkich przeciwnikdw,jak i po tencjalnych sojusznikdw nie jest aktem ostatecznejglupoty, to co nim moie jeszcze byö?! (P)
'Wenn der Angriff gleichzeitig sowohl gegen alle Gegner als
auch gegen die potentiellen Verbündeten kein Beweis für dieDummheit ist, was könnte es denn dann noch sein?!'
Die o. a. Beispiele zeigen, daß innerhalb der EPIST KONTR-Konstruk-tionen, ähnlich wie im Falle der semantischen Konstruktionen dieses
Typs mehrere Untertypen zu verzeichnen sind. So repräsentiert die ersteder Konstruktionen den KONZES-Typ, während die zweite den KONTR-Typ der Gegenüberstellung belegt.
Wie schon oben bei der Betrachtung der KONSEK-Konstruktion läßtsich auch hier feststellen, daß eine klare Grenze zwischen einer semanti-schen und einer kommunikativen Interpretation schwer (wenn über-haupt) zu ziehen ist. Die je.d/iKonstruktionen können sie beide ausdrük-ken, und oft entscheiden erst der sprachliche Kontext oder die sachbezo-gene Erfahrung des Betrachters über den Typ der Interpretation.
4. Zusammenfassend ist folgendes zu sagen: Auch wenn die 7eJliKon-struktionen verschiedene semantische Relationen ausdrücken können,gehören sie hauptsächlich der Gruppe der CAUS-Konstruktionen an, weilunter Beibehaltung der Strukturierung und der semantischen Interpreta-tion der Konstruktion der Austausch der Konnektoren aus der CAUS-Gruppe möglich ist. Was sich dabei ändert, ist lediglich die Art des
Grund-Folge-Bezugs.Im Falle des Austausches mit dem Konnektor aus einem anderen
semantischen Bereich entstehen entweder deviante oder von der ur-sprünglichen Bedeutung weit entfernte Formen, und eine korrekte Inter-pretation solcher Konstruktionen kann erst durch die Veränderung in derKonstruktionsstruktur, beispielsweise durch Einführung einer Negation(bei der Anderung einer COND jeJlriKonstruktionen in eine KONSEK-Konstruktion) hergestellt werden kann.
96
Der Konnektor ie§li ist in seiner konjunktionalen Bedeutung transpa-
rent. In dieser Eigenschaft gleicht er der adversativen koordinativen Kon-junktion ale. Das bedeutet, daß ie§li Strukturen verbinden kann, dereninterpretatorische Stabilität sehr stark ist. Sie ist manchmal so stark, daß
eine entsprechende Interpretation erst über mehrere Stufen erschließbar
ist, die gar keinen Ausdruck in der Konstruktion selbst fitnden; vgl. fol-gendes Beispiel:
(33) Je6li spojrzed na politycznA mapg kraju po referendum,dynie bardzo wqskie paski na wybtzeiach oznaczone sE
rem zwolenniköw referendum. (P)
'Wenn man sich die Karte des Landes nach dem Referendumbetrachtet, so sind es nur sehr schmale Streifen auf der Kü-ste, die mit der Farbe der Befürworter des Referendums mar-
kiert wurden.'
dessen Interpretation Komponenten enthält, die nicht ausgedrückt sind:'es ist leicht zu erkennen', 'die Anzahl der Befürworter war sehr gering',
und eine entsprechende a/eKonstruktion:
(34) Na skrzyZowaniu panowal du2y tlok, ale
dobrze miasto.'Die Kreuzung war verstopft, aber unser
Stadt gut.'
mit den nicht ausgedrückten Komponenten:
'wir sind weiter gefahren', 'wir benutzten andere Straßen'
usw.
Die leiliKonstruktionen kommen in Terten der geschriebenen Spra-
che nur selten als einzelne Konstruktionen vor. Die Verflechtung mitanderen Konstruktionen bzw. Strukturen geht dabei in beide Richtun-gen:
In einem Falle bildet eine jeiliKonstruktion den Verbindungsteil inübergeordneten Konstruktion eines anderen Typs, etwa in einer adversa-
tiven asyndetischen Konstruktion wie in (4) oder in einer konjunktiona-len sukzessiven Konstruktion wie in (6), oder aber sie ist referierende
Ergänzung wie in (5) und (8).
In anderem Falle besteht ein Verbindungsteil (oder auch beide) einerjeJliKonstruktion aus einer Konstruktion anderen Typs, etwa einem
Relativsatz wie in (3), einer referierenden Ergänzung wie in (13) und
97
(L9), einer KoNsEK-Konstruktion wie in (9), oder einer zugleich finalen,komparativen und temporalen Konstruktionen wie in (22).
Literatur
CzARNECKI, T.1977. Der Konjunktiv im Deutschen und Polnischen. Versuch
e i n er Ko nfront a ti o n. W r o clawDoRosZEwsKI, W. 1964: Gramatyka opisowa jgzyka polskiego z öwicze-
niami.WarszawaENGEL, U. 1988: Deutsche Grammatik. Heidelberg.GATJE, H. 1980: Bemerkungen zur Semantik des Konditionalgefüges. In:
Folia Linguistica. Acta societatis linguisticae Europeae. La Hague,123- 168
GEHRMaNN, M. 1988: Adversative Konjunktionen des Polnischen imVergleich zum Deutschen. In: Linguistische Studien 183. Berlin, 107-190
Gnocnowsrl, M. 1984: Skladnia wyraäei polipredykatywnych. Zarysproblematyki. ln: Gramatyka wspölczesnego jgzyka polskiego. Skladnia.'Warszawa, 213-299
Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin 1981
JoDLowsKI, S. 1971: Podstany polskiej skladni. WarszawaKoRTMANN, B. 1990: Adverbial subordination in the languages of Eu-
rope. In: EUROTYP Project desuiption. BerlinLeNG, E. 1977: Semantik der koordinativen Verknüpfung. ln: Studia
Grammatica XIV. BerlinRUDoLPH, E. 1981: Zur Problematik der Konnektive des kausalen Berei-
ches. In: J. Fritsche (Hrg.): Konnektivausdrücke, Konnektiyeinheiten.Grund elemente der semantischen Struktur yon Texten. Hamburg, L46-244
SzoBER, S. 1962: Gramatyka jgzyka polskiego. WarszawaZAKRZEwSKA, E. 1993: Interclausal adverbial relations and their expo-
nents in Polish. In: K. Hengeveld (Hrg.): The internal Structure ofadverbial clauses. (: EUROTYP Working PapersY.5),1-1,18
to je-
kolo-
nasz kierowca znal
Fahrer kannte die
Maciej Grochowski, Thorn
Okolo als Vertreter der Klasseder adnumerativen Operatorenl
1. Eine weitgefaßte formale Klassifizierung der Lexeme, d. h. eine, dieauch ihre Funktionsmerkmale berücksichtigt, bildet einen wichtigen Be-
standteil der Konzeption einer Grammatik der natürlichen Sprache.
Wenn man annimmt, daß die grammatische Information ein notwendigesElement des Wörterbuchartikels jedes Lexems ist, dann muß man auchannehmen, daß in den lexikographischen Untersuchungen eine vorherbestimmte formale Lexemklassifikation verif,tziert wird. Wenn also das
Lexem X infolge der Beschreibung seiner grammatischen Merkmale sichkeiner der unterschiedenen Klassen zuordnen läßt, bedeutet das, daß dieangenommene Klassihkation inadäquat ist.
Die Frage, durch welchen Grad der Allgemeinheit sich die grammati-schen Klassifikationskriterien auszeichnen sollten, und im Zusammen-hang damit, wieviele Klassen zu unterscheiden wären, kann lediglicharbiträr entschieden werden. Für eine grammatische Sprachbeschreibungist ein Vervielfachen von Klassen nicht zweckmäßig. Das betrifft insbe-sondere geschlossene Klassen, d. h. solche, deren Elemente durch Auf-zählen charakterisiert werden können. In der lexikographischen For-schung hingegen sind Zahl und Größe der Klassen grammatischer
Lexeme kein wesentliches Problem. Es ist vor allem eine Frage der Ord-nung und Organisation, weil alle grammatischen Merkmale des Lexems,auch die individuellen, in seinem Wörterbuchartikel berücksichtigt wer-den sollten.
Die syntaktische Klassiltkation der polnischen unflektierbaren Lexe-me, die ich vor mehr als zehn Jahren vorgeschlagen habe (GRocHowsKI1984, 1986), ist ohne Zwelfel inadäquat sowohl hinsichtlich der gramma-tischen als auch hinsichtlich der lexikographischen Bedürfnisse. Ohneauf Einzelheiten einzugehen, kann ich unumwunden feststellen, daß die-se Klassifikation für eine grammatische Beschreibung allzusehr ausgc
Diese Arbeit wurde im Rahmen des Forschungsprojektes Nr. 1 P104 009 05 inder ZeIt vom 2.11.1993 bis 31.10.1996 ausgeführt, finanziert vom Komitet BadariNaukowych (Komitee für Wissenschaftliche Forschungen).
100
baut und für die Lexikographie nur schwer in der Praxis der Beschrei-
bung einzelner Lexeme anwendbar ist. Denn viele Einheiten lassen sich
nicht einfach einer und nur einer der unterschiedenen grammatischen
Klassen zuordnen. An dieser Stelle kann ich keine neue Klassifikationanbieten. Ich nehme an, daß dies erst in einigen Jahren nach Beendigung
der gegenwärtig geführten empirischen Forschungen der Funktionsaus-
drücke möglich sein wird.Henryk Wrdbel in seinen polemischen Artikeln (WRÖBEL 1991, 1995)
forderte die Einführung zahlreicher Anderungen in meinem syntakti-
schen Klassiltkationsentwurf der polnischen unflektierbaren Lexeme. Er
wies u. a. auf ein gewisses gemeinsames Merkmal einiger adnominaler
Operatoren hin, und zwar darauf, daß sie syntaktische Beziehungen mitden Numeralien bilden @nÖner 199t,779;1995, 15). In Anlehnung an
diese Beobachtung schlage ich hier vor, eine Klasse der adnumerativen
Operatoren anzunehmen. Die grammatischen Merkmale der Elemente
dieser Klasse sollten im wörterbuch auf homogene weise beschrieben
werden. Eine Antwort auf die Frage, ob in einer grammatischen Klas-
sif,rkation von Lexemen die Annahme einer wenig umfangreichen Klasse
adnumerativer Operatoren zweckmäßig ist, wäre aber verfrüht. Und um-
somehr unternehme ich hier keinen Versuch, das Verhältnis der adnu-
merativen Operatoren zu den adnominalen zu bestimmen.
2. Ich nehme an, daß die Klasse der adnumerativen Operatoren mit Hilfeeiner Menge von sechs Merkmalen abgegrenzt werden kann, einer
Menge, welche für die dieser Klasse zugehörigen Elemente charakteri-
stisch ist. Diese Operaioren sind Lexeme mit folgenden Eigenschaften:
(a) Sie sind nicht flektierbar, (b) sie werden nicht allein gebraucht (in
opposition zu den Interjektionen und anderen Ausdrücken in Funktion
der Satzäquivalente), (c) sie spielen keine Fügefunktion (in Opposition zu
den Konjunktionen und Präpositionen), (d) sie regieren keine Kasus (in
opposition zu den Präpositionen), (e) sie bilden keine syntaktische Rela-
tion mit dem Verb (in Opposition zu den Adverbien und Partikeln), (f)
sie bilden syntaktische Relationen mit den Numeralien und Ausdrücken,
die von Numeralien abgeleitet sind.
Mindestens acht polnische Lexeme zeigen die genannten sechs Merk-
male. Es sind folgende Ausdrücke: bez mala, 'fast / knapp'; blisko,'fast';niespelna,'knapp'; okolo, 'etwa'; plus minus,'ungefähr'; ponad, 'über'; z,
'etwa'; z görq,'über'. Vgl. folgende typische Beispielsätze, in denen die
Eigenschaften der adnumerativen Operatoren zum Vorschein kommen:
101
(1) Tym samym samochodem przejechal 1uZ bez mala pigd ty-sigcy kilometröw.'Mit demselben Auto hat er schon fast fünf Tausend Kilome-ter zurückgelegt'.
(2) Pocztg otworzono po blisko trzy miesi4ce trwajqcym remon-cie.'Die Post wurde nach einer fast drei Monate dauernden Re-
novierung geöffnet.'
(3) Do domu Piotra trzeba i§6 st4d niespelna dziesigö minut.'Zum Haus von Peter muß man von hier noch knapp zehnMinuten geheu.'
(4) Po okolo dwdch tygodniach dostaniesz t9 ksi42k9.'Nach etwa zwei Wochen bekommst du dieses Buch.'
(5) Na szefa musisz poczekaö jeszcze plus minus p6l godziny.
'Auf den Chef mußt du noch ungefiihr eine halbe Stundewarten.'
(6) Szybko§ciomierz wskazywal ponad dwie§cie kilometr6w nagodzing.'Der Tachometer zeigte über zweihundert Kilometer in derStunde an.'
(7) Wszystkich napoj6w zam6wili z g6rq trzy litry.'Allein an Getränken haben sie über drei Liter bestellt.'
(8) Kup z pigö kilogramdw kartofli.'Kauf etwa fünf Kilo Kartoffeln.'
Um Mißverständnisse zu vermeiden, ist festzustellen, daß es homo.nyme Lexeme zu vier der genannten Operatoren gibt, d. h. Lexeme mitidentischer Gestalt, die sich durch unterschiedliche Mengen syntakti-scher Eigenschaften auszeichnen. Zur Klasse der Präpositionen gehörenAusdrücke blisko, okolo, ponad, z. Der Ausdruck blisko vertritt auch dieKlasse der Adverbien; vgl. z. B.
(9) Przewröcil sig bardzo blisko mety.'Er stürzte gar^z in der Nähe des Zieles.'
(10) Z domu do szkoly bylo blisko.'Von zu Hause war es nicht weit zur Schule.'
t02
(11) Wyslal okolo trzydziestu kartek z Lyczeniami §wi4tecznymi.'Er verschickte etwa dreißig Weihnachtskarten.'
(72) Halasowali na boisku ponad ludzk4 wytrzymalo§ö.'Das Geschrei auf dem Sportplatz war lauter, als man es
hätte aushalten können''
(13) Poszedl z psem na spacer.
'Er ging mit dem Hund sPazieren.'
Homonyme Lexeme werden hier ausschließlich aufgrund grammatischer
Kriterien unterschieden. Die Bedeutungen solcher homogenen Lexeme
können identisch oder unterschiedlich sein. Jede der Einheiten bedarf
einer gesonderten semantischen Analyse. In einer meiner früheren Arbei'ten habe ich die These über die gleichen Bedeutungen der Präposition
ponadwd des Operators ponad (GRocHowsKI 1995) dargelegt. Die Aqui-
valenz der Bedeutungen der Präposition okolo und des operators okolo
ergibt sich aus dem weiteren Teil der hier dargestellten Überlegungen
(vgl. § 7).Die Zuordnung der homonymen Lexeme zu einer von zwei (oder
von mehreren) grammatischen Klassen ist durch den Kontext determi-
niert. Die Kontexte der Homonyme schließen einander aus, wie z' B' die
Kontexte des Operators blisko und der Präposition blisko oder des Opera-
tors ponad und der Präposition ponad. Die Gebrauchsbedingungen jedes
Lexems sind in der Regel in einem höheren Grade begrenzt, als es allein
aus der Zugehörigkeit des Lexems zu einer grammatischen Klasse her-
vorgeht. Die Einschränkungen haben oft einen individuellen charakter,
sie betreffen sowohl den syntaktischen als auch semantisch{exikalischen
Kontext. Auch die Gebrauchsbedingungen der einzelnen adnumerativen
operatoren sind nicht identisch. vermutlich unterliegt der operator okolo
größeren Einschränkungen als ponad oder bez mala, ä/lsko und niespelnl .
Bei der Beschreibung der Eigenschaften von okolo gehe ich verglei-
chend auf die Gebrauchsbedingungen des operators ponadein, welche in
einer anderen Arbeit genauer dargestellt wurden (vgl. GROCHOWSKI
199s).
2 Die Verbindungsfähigkeit der drei letzteren Ausdrücke hat SZUMINSKA (1996)
charakterisiert.
103
3. Der adnumerative Operator ponadkant hinzugefügt werden:(a) einem Numerale, unabhängig davon, ob das Numerale ein Bestandteileiner Nominalphrase mit oder ohne Präposition ist; in den präpositionalmarkierten Nominalphrasen nimmt der Operator eine lineare Stellungzwischen der Präposition und den anderen Bestandteilen der Phrase ein,vgl. z. B.
(14) W tym instytucie jest zatrudnionych ponad czterdziestu pra-
cownik6w.'In diesem Institut sind über vierzig Mitarbeiter beschäftigt.'
(15) Poci4g byl op6Zniony o ponad pi9ö godzin.'Der Zug hatte über fünf Stunden Verspätung.'
(b) einem zusammengesetzten Adjektiv, das von einer numeral-substanti-vischen Gruppe abgeleitet ist, und auch einem Adverb, das von einemNumerale abgeleitet ist, vgl. z. B.
(16) Na ucztg weseln4 zabito ponad stukilogramowego wieprza.'Für den Hochzeitsschmaus wurde ein über ein hundert Ki-logramm schweres Schwein geschlachtet.'
(I7) Spoiycie alkoholu wzroslo ponad czterokrotnie.'Der Alkoholverbrauch ist mehr als um das Vierfache gestie-gen.'
(c) einem Substantiv, das den Namen - sowohl einer konventionellen als
auch nicht konventionellen - Maßeinheit darstellt; vgl. z. B.
(18) Ze zbiornika wylano ponad litr wody.'Aus dem Behälter wurde über ein Liter Wasser ausgeschüt-tet.'
(19) Wypil ponad szklankg wina.'Er hat über ein Glas Wein getrunken.'
Die Sätze des Typs (16) sind transformierbar in Sätze, in denen ponad
einen expliziten Bezug auf ein Numerale hat; vgl.
(20) Na ucztg weselnq zabito wieprza waiqcego ponad sto kilo-gram6w.'Für den Hochzeitsschmaus wurde ein über hundert Kilowiegendes Schwein geschlachtet.'
104
In den Sätzen des Typs (18), (19) bezieht sich ponad auf die grammati-
sche Form des Numerales jeden3, das - da redundant - vor dem Sub-
stantiv nicht verwendet werden muß (vgl. ToPoLINsKA 1981, 153). Die
Tatsache, daß nur dieses Numerale in derartigen Sätzen vor dem Sub-
stantiv stehen kann, ergibt sich daraus, daß die Substantivform in diesen
Sätzen den Wert singularis besitzt. Die Anderung dieses Wertes hat es
zur Folge, daß vor dem Substantiv ein Numerale mit einem höheren
Wert als jedenverwendet werden muß (vgl. WnÖsBr 1991, 179). Die Ver-
letzung dieses Prinzips verursacht, daß ein ungrammatischer Satz ent-
steht. Vgl. z. B. (18), (19) mit (21) bis (26):
(21) Ze zbiornlka wylano ponad jeden litr wody.'Aus dem Behälter wurde über ein Liter Wasser ausgeschüt-
tet.'
(22) Ze zbiomlka wylano ponad dwa litry (pipÖ litr6w) wody.
'Aus dem Behälter wurden zwei (fün0 Liter Wasser ausge-
schüttet.'
(23) *Ze zbiornlka wylano ponad litry (litröw) wody.
(24) Wypil ponad jedn4 szklankp wina.'Er hat über ein Glas Wein getrunken.'
(25) Wypil ponad dwie szklanki (pip6 szklanek) wina.
'Er hat über zwei (fünl) Glas Wein getrunken.'
(26) *Wypil ponad szklanki (szklanek) wina.
In den Wörterbüchem der polnischen Gegenwartssprache wird ponad
ausschließlich als Präposition beschrieben, auch in solchen sätzen, wie
die Beispiele (14) bis (20). Von der Inadäquatheit solch einer grammati-
schen Qualilrzierung dieses Lexems zeugen folgende Argumente. Ponad
regiert keinen Kasus: Die grammatische Form des Bestandteils, der in
den angegebenen Sätzen nach ponad gebraucht wird, ergibt sich aus den
syntaktischen Relationen, die zwischen anderen Satzkomponenten außer
ponad bestehen. Ponad bildet keine Relation mit dem substantiv. Es übt
in den angegebenen Sätzen keine verbindende Funktion aus. Im Gegen-
3 In solchen Kontexten hat es Flexionsmerkmale eines Adjektivs - vgl. GRUSZ-
czYNSKl & S^LoNI (1978, 20); LASKoWSKI (1984, 285).
105
satz zut Präposition kann es aus diesen Sätzen entfernt werden, ohne daß
ihre grammatische Korrektheit verletzt wird.
4.1 Die Bestimmung von Gebrauchsbedingungen des adnumerativenOperators okolo erfordert zuerst eine syntaktische Charakterisierung derPräposition okolo. Der Bereich der Verbindungsfähigkeit dieser Präposi-tion auf seiner rechten Seite mit untergeordneten Ausdrücken (im Genitiv) ist in der polnischen Gegenwartssprache wesentlich begrenzt. Hierfindet man:(a) Numeralien und numeral-substantivische Gruppen; z. B.
(27) Go§ci przyszlo okolo czterdziestu.'Gäste sind etwa vierzig gekommen.'
(28) Majatek zajmowal okolo trzystu hektaröw powierzchni lwspy.'Das Landgut umfaßte etwa drei hundert Hektar von der Ge-samtfläche der Insel.'
(b) Adjektive (traditionell Ordinalzahlen genannt), die in substantivischerFunktion gebraucht werden; meist um einen Zeitpunkt zu bestimmen,z. B.
(29) Koriczg pracg okolo siedemnastej.'Ich arbeite bis etwa 17 Uhr.'
(30) Zebranie odbgdzie sig okolo dwudziestego.'Die Versammlung hndet um den 20. statt.'
(c) Substantive, die Mengen und Zahlen bezeichnen; z. B.
(31) Wypil okolo polowy butelki.'Er hat etwa eine halbe Flasche getrunken.'
(32) Wlej tam okolo dwiartki §mietany.'Gieß etwa ein Viertel Liter Sahne darein.'
(33) Zginglo wtedy okolo setki osöb.'Damals sind etwa hundert Menschen ums Leben gekom-
men.'
(34) Pytal o ciebie mg2czyzna okolo pipddziesiqtki.'Ein Mann um die Fünfzig fragte nach dir.'
(d) Substantive, die eine konventionelle oder unkonventionelle Maßein-heit bezeichnen (sie sind transformierbar in Gruppen mit dem Numeralejeden;vsl. auch oben (18) und (21), (19) und (24)); z. B.
106
(35) Ta paczka wa2y okolo (iednego) kilograma.'Dieses Paket wiegt etwa ein Kilogramm.'
(36) W lod6wce bylo jeszcze okolo fiednej) kostki masla.
'Im Kühlschrank gab es etwa noch ein Stück Butter.'
(e) wenige Substantive, die Zeitpunkte bezeichnen (2. B. poludnie,'Mit-tag'; pölnoc, 'Mitternacht'), sowie Substantive, die sekundär in der Funk-
tion temporaler Ausdrücke gebraucht werden (2. B. §wigto, 'Festtag';
obiad,'Mittag'); z.B.(37) Okolo pölnocy uslyszeli potg2nv huk.
'Gegen Mitternacht hörten sie einen gewaltigen Knall.'
(38) Wpadng do ciebie okolo 6wi4t Bo2ego Narodzenia.
'Ich schaue bei dir gegen Weihnachten vorbei.'
(39) Zakoiczymy budowg tej autostrady okolo roku 2000.
'Wir beenden den Bau dieser Autobahn um das Jahr 2000.'
Die verbindungen der Präposition okolo mit Substantiven anderer Klas-
sen, z. B. mit Bezeichnung des Ortes, vgl.
(40) Siedzieli okolo stolu.'Sie saßen um den Tisch.'
werden in den Wörterbüchern als veraltet eingestuft - siehe z. B. SJPD,
SJPSz., SPP.
4.2 Yor dreißig Jahren, als Witold Doroszewski die Empfehlungen zur
Sprachkorrektheit beirir Gebrauch des Ausdrucks okoto (DoRoszgwsrI
1962, 95) formulierte, setzte er voraus, okolo sei ausschließIich eine Prä-
position. Im Zusammenhang damit empfaht er, die Verbindungen von
okolo mit anderen Präpositionen zu meiden, und diesen Ausdruck durch
solche Folgen wie mniej wigcej,'ungefähr' und w przybliieniu, 'annähernd'
zu ersetzen. Einige Jahre später, obwohl er weder auf seine Prämisse
noch auf die daraus resultierende Empfehlung verzichtet hatte, wurde er
auf die verbreitung von okolo in der Funktion des Adverbs aufmerksam
(vgl. DoRoszEwsKI 1968, 71). Trotzdem wurden die Verbindungen von
okolo mit Präpositionen, die einen anderen Kasus als Genitiv forderrr, im
Wörterbuch SPP vom Jahre 1973 (hrsg. v. W. Doroszewski und H' Kur-
kowska) als inkorrekt bezeichnet. Die Korrektheit dieser verbindungen
wurde in Frage gestellt:
107
(41) SpöZnil sig o okolo dwie godziny.'Er verspätete sich um etwa zwei Stunden.'
(42) Przez okolo dziesigd lat.'Während etwa zehn Jahre.'
Auf die fehlende Übereinstimmung der in SPPa dargestellten Mei-nung mit dem gegenwärtigen Sprachgebrauch wurde von MiroslawBafko und Maria Krajewska (BaNro & KRAJEwSKA 1994, 222) hinge-wiesen, die zwischen der Präposition und der Partikel okolo (mehr dazttunten) unterschieden. Schon im fünften Band des SJPD wurden zweihomonyme Stichwörter (Lexeme) in Gestalt von okolo unterschieden: Lokolo - Fräposition und II. okolo - Adverbs . Ein Zitat, das den adverbia-len Gebrauch von okolo belegen sollte, ist jedoch nicht zutreffend. ImSatz
(43) Droga w dwie strony wynosi okolo p6l kilometra.'Der Weg hin und zurück beträgt ein halbes Kilometer.'
ist okolo eine Präposition. Der Verfasser des Stichwortartikels ließ sichvermutlich durch die Unflektierbarkeit des Numerales pö|,'halb' inefüh-ren. Die Substitution dieses Wortes durch ein flektierbares Numeralebeweist aber, daß es im Genitiv gebraucht werden muß, also in einerKasusform, die durch okolo regiert wird. Abgesehen von dem zitiertenBeispiei und auch von der grammatischen Qualifizierung des nichtpräpo-sitionalen Gebrauchs von okolo muß man feststellen, daß die Idee selbst,zwei Homonyme mit der Gestalt von okolo zu unterscheiden, richtig ist.Es zeugen davon zahlreiche Beispiele des Gebrauchs von okolo, der an-ders ist als der präpositionale, und zwar solche, in denen das bespro-chene Lexem die Eigenschaften eines adnumerativen Operators hat. Aufsolche Beispiele verwiesen BocusrawsKl6 (1973, 30), GRUSZCzvNsKI &SeroNr (1978, 380, BeNro & KRAJEWSKA (1994,222D.
4 Die gleichen Feststellungen sind nota bene in achtzehn Auflagen des SPP abge-druckt worden, bis zum Jahr 1995 einschließlich.
5 Im SJPSz wurde okoJo ausschließlich der Klasse der Präpositionen zugeordnet.
6 BoGUSr,Awsru (1973, 30) hat aul normative Schwierigkeiten beim Generierenvon syntaktischen Konstruktionen (insbesondere präpositionalen Konstruktio-nen) mit adnumerativen Ausdrücken hingewiesen, z.B. mial kolo dwustu zlotych
- zostal z kolo dwustu zlotymi (?) 'er hatte etwa zwei hundert Zloty - er ist mit et-wa zwei hundert Zloty zurückgeblieben', mial ze stu iolnierzy - zostal z ... (?)'erhatte etwa ein hundert Soldaten - er ist mit ... zurückgeblieben'. Die Beispiele
108
5.1 Die Gebrauchskontexte des Operators okolo und der Präposition okolo
schließen grundsätzlich einander aus (vgl. § 5.2.), obwohl die seman-tische Struktur der beiden Ausdrücke äquivalent ist (vgl. § 7.). Der adnu-merative Operator okolo kann hinzugefügt werden:(a) einem Numerale, das in einer nicht präpositional markierten Nominal-phrase auftritt, welche durch ein Substantiv im Dativ oder Instrumental(okolo besetzt dann die lineare Stelle vor dem Numerale) konstituiert wird;z.B.
(44) Przyglqdal sig okolo dwudziestu uczestniczkom konkursu.'Er betrachtete etwa zwanzig Teilnehmerinnen des Wettbe-werbs.'
(45) Interesowala sig okolo trzydziestoma dyscyplinami sporto-wymi.'Sie interessierte sich für etwa dreißig Sportdisziplinen.'
(b) einem Numerale, das in einer präpositional markierten Nominalphra-se auftritt; okolo besetzt dann die lineare Stelle zwischen der Präpositionund dem Numerale (Kontexte, die eine Präposition mit Genitiv als Ka-susforderung enthalten, bedürfen einer Einzelanalyse - mehr dazuunten); z. B.
(46) Dopiero po okolo trzech miesi4cach mo2esz zaobserwowaÖjakie6 zmiany.'Erst nach etwa drei Monaten kannst du irgendwelche Ande-rungen bemerken.'
(47) Mo2na tam doj§Ö w okolo dwadzie§cia minut.'Man kann dahin in etwa zwanzig Minuten gelangen.'
(48) Opowiedzial o okolo dziesigciu ksi4Zkach.'Er erzählte über etwa zwanzig Bücher.'
(49) Prezydent rozmawial z okolo pigÖdziesigcioma 2olnierzami.'Der Präsident sprach mit etwa fünfzig Soldaten.'
(50) Na okolo stu mieszkafc6w wypadalo jedno l62ko.'Auf etwa hundert Einwohner kam ein Bett.'
und die ihnen beigefügten Fragezeichen stammen aus der Arbeit von Bogu-
slawski.
109
(-51) Wydarzenie mialo miejsce przed okolo rokiem.'Das Ereignis spielte sich vor etwa einem Jahr ab.'
(c) einem Adjektiv, das traditionell als Ordnungszahl bzw. Wiederho-Iungszahlwort interpretiert wird; z. B.
(52) Przed okolo dwudziestym okr42eniem poczul silny b6l.'Vor der etwa zwanzigsten Umrundung verspürte er einenstarken Schmerz.'
(53) Przed kamerami wyst4pil okolo dziesigciokrotny zwycigzcawy§cigu.'Vor den Kameras trat der etwa zehnmalige Sieger des Ren-nens auf.'
(d) einem zusammengesetzten Adjektiv, das von einer numeral-substanti-vischen Gruppe abgeleitet ist - sowohl in den präpositionaien als auchnichtpräpositionalen Phrasen; z. B.
(54) Przygl4dal sig okolo stulitrowemu pojemnikowi.'Er betrachtete einen etwa hundert Liter fassenden Behälter.'
(55) Byl wykoriczony po okolo czterogodzinnej nasiad6wce.'Er war hx und fertig nach einer etwa vierstündigen Mam-mutsitzung.'
(e) einem von einem Numerale abgeleiteten Adverb; z. B.
(56) Ceny papieru wzrosly okolo trzykrotnie.'Die Preise für Papier sind etwa um das Dreifache gestiegen.'
(I) einem Substantiv, das eine Zahl bezeichnet; mit analogen Einschrän-kungen wie im Punkt (a) und (b); z. B.
(57) Kierowal okolo pigödziesiqtk4 urzgdnikdw.'Er leitete etwa fünfzig Beamte.'
(58) Wypili po okolo setce w6dki.'Sie haben etwa hundert Gramm Wodka getrunken.'
(g) einem Substantiv, das (sowohl konventionelle als auch unkonventio-nelle) Maßeinheiten bezeichnet - mit analogen Einschränkungen, wie inden Punkten (a) und (b); z. B.
(59) Przyszedl do nich z okolo litrem piwa.
'Er kam zu ihnen mit etwa einem Liter Bier.'
110
(60) Przez okolo miesi4c nie mogli uzgodniÖ stanowiska w tej
sprawie.'Etwa einen Monat lang konnten sie sich in der Sache nicht
einigen.'
(61) Rozdal dzieciom po okolo tabliczce czekolady'
'Er verteilte je etwa eine Tafel Schokolade an die Kinder"
5.2 Das Lexem okolo, das vor dem Numerale in einer nicht präpositional
markierten Nominalphrase auftritt, die durcli ein substantiv in der syn-
taktischen Position des Nominativs und Akkusativs konstituiert ist, ge-
hört zur Klasse der Präpositionen und fordert den GenitivT ' Z' B'
(62) Okolo stu kobiet podpisalo ten protest'
'Etwa hundert Frauen haben diesen Protest unterzeichnet''
(63) Nauka trwala okolo sze§ciu miesigcy'
'Der Unterricht dauerte etwa sechs Monate''
Vel. (62) und (63) mit:
(64) Sto kobiet podpisalo ten protest'
'Hundert Frauen haben diesen Protest unterzeichnet''
(65) Nauka trwala sze§Ö miesigcY.
'Der Unterricht dauerte sechs Monate''
Ebenfalls als Präposition muß okolo vor einem substantiv in der
Form einer Bezeichnung für eine Zahl- oder Maßeinheit betrachtet wer-
den, wenn dieses substantiv die Position des Nominativs und Akkusativs
in nichtpräpositionalen Phrasen besetzen würde; z' B'
(66) Okolo setki görnikdw demonstrowalo przed parlamentem'
'Etwa hundert Bergleute protestierten vor dem Parlament''
(61) Okolo litra benzyny wycieklo z kanistra'
'Etwa ein Liter Benzin ist aus dem Kanister ausgelaufen''
(68) Kori wYPil okolo wiadra wodY.
'Das Pferd hat etwa einen Eimer Wasser ausgetrunken''
Vel. (66) bis (68) mit:
Auf dieses Merkmal des Lexems okolo haben BANKO & KRAJEWSKA (1994' 222)
hingewiesen, obwohl sie das besprochene Problem etwas anders aufgefaßt haben.
111
(69) Setka g6rnik6w demonstrowala przed parlamentem.'Hundert Bergleute protestierten vor dem Parlament.'
(70) Litr benzyny wyciekl z kanistra.'Ein Liter Benzin ist aus dem Kanister ausgelaufen.'
(71) Kof wypil wiadro wody.'Das Pferd hat einen Eimer Wasser ausgetrunken.'
Der grammatische Stellenwert des Lexems okolo in Nominalphrasen(sowohl in einer nichtpräpositionalen als auch in einer präpositionalen -mit einer den Genitiv fordernden Präposition), die durch ein Substantivin der syntaktischen Position des Genitivs konstituiert werden, kann aufzweierlei Weise interpretiert werden, indem der untersuchte Ausdruckentweder als Präposition oder als adnumerativer Operator eingestuft wird.Vgl. z. B.
(72) Spodziewal sig okolo dwudziestu pacjentdw.'Er erwartete etwa zwanzig Patienten.'
(73) Nie wstawal od okolo dwdch miesigcy.'Seit etwa zwei Monaten blieb er im Bett.'
Das Lexem okolo kann aus semantischen Gründen weder als Präposi-tion noch als adnumerativer Operator verbunden werden (a) mit den sog.uneigentlichen Numeralien vom Typus trochg,'etwas'; nieco,'ein wenig';duio, 'viel'; malo, 'wenig'; sporo,'ziemlich viel' und des Typs parg, 'einpaar'; kilka, 'einige'; wiele\ , 'viel' sowie auch (b) mit den Numeralien oäa,obydwa,'beide'.
6.1 Die adnumerativen Operatoren bilden eine semantisch homogeneLexemklasse. Die Hinzufügung eines beliebigen Lexems dieser Klasse zueinem Numerale (oder einem vom Numerale abgeleiteten Ausdruck)führt dazu, daß die vom Numerale ausgedrückte (vermeintlich exakte)quantitative Charakteristik eines Objekts (sie umfaßt sensu stricto Zahl,Maß und Menge) als nicht übereinstimmend mit der wirklichen Größedes Objekts (vom Sprecher) dargestellt wird. Der Inhalt, der allein mitHilfe eines in solch einem Kontext gebrauchten Numerales einem Objektzugeordnet wird, bildet lediglich eine Vergleichsbasis, die für eine rela-tive Charakteristik der tatsächlichen quantitativen Parameter des Obiekts
Mehr zu diesem Problem in GrocuowsKl (1996).
112
angenommen wirde. Die quantitativen Werte, die tatsächlich dem Objekt
zukommen, unterscheiden sich hinsichtlich des Grades von dem, was das
Numerale kommuniziert. Die relevanten (obwohl nicht die einzigen) se-
mantischen Komponenten der adnumerativen Operatoren sind Einheiten
'weniger als ,Y - fiü;r bez mala, blisko, niespelna und 'mehr als ,Y - fürponad, z görq (wo X ein Numerale oder dessen Ableitung ist).
Lexeme des Typs okolo, plus minus, z umfassen sowohl den Bereich
'weniger' als auch den Bereich 'mehr'. Sie sind vermutlich, gegen allen
Anschein, semantisch am kompliziertesten, weil sie u. a. beide genann-
ten Komponenten enthaltenl0. Der Sprechende, der solche Lexeme auf
das Numerale bezieht, schließt es weder aus, daß das Objekt den durch
das Numerale ausgedrückten Wert hat, noch wird die Übereinstimmungdieses werts mit dem wirklichen bestätigt; anders gesagt, er distanziert
sich bewußt - aus verschiedenen Gründen (mehr dazu unten) - von
einer genauen quantitativen charakteristik. Die adnumerativen operato-
ren (insbesondere des Typs okolo und des Typs ä/isko) kann man also als
Exponenten der Approximation anerkennen.
6.2 Die Approximation als eine bestimmte Weise, die Welt durch den
Sprechenden zu erfassen, beruht auf der Beschreibung der wirklichen
Größen mit Hilfe von Ausdrücken, die sich auf andere Größen beziehen,
ähnliche Größen, die man sich leichter als die ersteren vorstellen kann.
Eine derartige Beschreibung bildet eine mittelbare Charakteristik der
gegebenen Größe: Der Sprechende schreibt das Metaprädikat mit dem
Inhalt 'annähernd' einem anderen Prädikat zu. Also, der Sender, wenn er
über r4 spricht, sagt "annähernd X', weil er glaubt, daß ,4 in einem gerin-
gen Maße anders als X ist und daß es am einfachsten über ,4 zu sprechen
ist, indem man "X" gebraucht.
Auf eine ähnliche Art und weise kann man beliebige sachverhalte
analysieren. Die Approximation wird aber wohl am stärksten mit einer
breit verstandenen quantitativen Kategorie assoziiert. Es scheint, daß zur
approximativen quantitativen charakteristik der objekte vor allem zwei
vgl. die These von sAptR (1972) über den graduellen Status der sog. quantitati
ven Urteile.
Die Urteile über die quantitative Ungleichheit des Typs 'x ist mehr als y' ('y ist
weniger als x') gehören nach BoGUSI-ÄwsKI (1966, 55) zur Bedeutung u. a. von
okolo.
113
Kategorien der Exponenten dienen: die uneigentlichen Numeralienll(des Typs trochg, nieco, duio, malo, sporo urld des Typs parg, kilka, wiele)
und die adnumerativen Operatoren. Eine Reihe von typischen Exponen-ten der Approximation, die eine Relation mit dem Numerale eingehenkönnen (genauer mit dem eigentlichen Numerale), haben einen wesent-lich weiteren Bezugsbereich als die im vorliegenden Artikel ausgesonder-ten adnumerativen Operatoren. Dieses Merkmal ist vor allem für Lexememit der Komponente 'weniger als X (sie sind mit blisko verwandt) cha-rakteristisch, wie prawie, niemal und auch für sinnverwandte Wörter(Synonyme?) von okolo, wie mniej wigcej, w przybliieniu, z grubsza,'bei-nahe, fast, ungenau'. Die genannten Lexeme bilden auch Relationen mitVerben, Adjektiven und Substantiven; vgl. z. B.
(74) Buty ju2 mniej wigcej (prawie) wyschly.'Die Schuhe sind fast trocken.'
(75) Ta serweta jest mniej wigcej (prawie) czysta.'Diese Serviette ist fast sauber.' '
(76) Ten domek to w przybli2eniu (z grubsza) sze§cian.
'Dieses Häuschen ist beinahe ein Würfel.'
(77) Tymczasem datg wyjazdu moLna okre§liö w przybliäenht (zgrubsza).
'Das Abreisedatum kann man mittlerweile ungefähr bestim-men.'
Im Vergleich mit den typischen Repräsentanten der adnumerativen Ope-ratoren könnte man sie "fakultativ adnumerativ" nennen. Anders gesagt,
ist die Beziehung mit dem Numerale kein relevantes syntaktisches Merk-mal solcher Lexeme. Sie müßten also einer anderen grammatischen Klas-se zugeordnet werden. Auch die semantische Explikation dieser Lexemebedarf einer Analyse ihres Gebrauchs in verschiedenen, nicht nur nume-ralen, Kontexten.
7. Der Gebrauch von okolo ist sinnvoll und dadurch auch zulässig, wenndie approximative Charakteristik einer gegebenen Quantität eine Art vonGeneralisierung in bezug auf die wirkliche Größe bilden kann und wenn
11 Diesen Terminus wendet ToPoLINSKA (1984, 369) auf eine Elementenmenge an,die der hier angenomme[en zu entsprechen scheint. Die uneigentlichen Nume-ralien als Exponenten der Approximation bespreche ich in GnocuowsKl (1996).
l0
114
solch eine Generalisierung den Kommunikationspartnem helfen kann,
sich die wirkliche Größe vorzustellen. Die Akzeptanz des Gebrauchs von
okolohängt nicht vom quantitativen Exponenten ab, auf den dieses Meta-prädikat bezogen wird, sondern von der Art des Phänomens, das einerquantitativen Charakteristik unterliegt. Im Einklang mit der gestellten
Hypothese ist der Satz:
(78) Sprzedawal meble z okolo trzyprocentow4 bonifikatq.'Er verkaufte Möbel mit einem dreiprozentigen Preisnachlaß.'
zu akzeptieren, und der Satz:
(79) ?Pojechal do tapicera z okolo trzema fotelami.'Er ist mit etwa drei Sesseln zum Polsterer gefahren.'
nicht zu akzeptieren. Die Information über den dreiprozentigen Preis-
nachlaß kann man als generalisierend und zugleich approximativ verste-
hen, die Information über drei Sessel kann nur a.ls konkret und exakt
verstanden werden.Die Möglichkeit, Phänomene unter dem Gesichtspunkt zu klassifizie-
ren, ob die quantitativen Parameter eine approximative Charakteristik
zulassen, müßte man von vorn herein als unrealistisch ausschließen.
Auch die Motivierung, warum der Sender in einem gegebenen Satz den
Ausdruck okolo gebraucht hat, kann vielfältig und schwer zu bestimmen
sein. Möglicherweise weiß der Sender nicht, wie der exakte quantitative
Wert eines Objekts ist, er kann aber auch diesen Wert aus verschiedenen
Gründen nicht nennen wollen, z. B. wenn er meint, daß die Informationdarüber für das Außgrungsziel nicht wesentlich ist. Es scheint also, daß
nur die oben genannte, sehr allgemeine Motivation für die Verwendung
von okolo, die in beliebigen Außerungen mit okolowiedetzufinden ist, als
semantischer Bestandteil dieses Ausdrucks anerkannt werden kann'
Diese Komponente könnte folgende semantische Repräsentation haben:
A jest okolo X-a / -öw.: 'Wenn ich sage, wieviel ,4 ist, dann sage ich"X", weil es am einfachsten zu sagen ist,wenn man "X" sagt.'
Ein wichtiger Bestandteil der Bedeutung von okolo ist auch das Ver-
hättnis der Meinung des Senders über die Größe von ,4 zur wirklichenGröße von A. Es scheint, daß der Sender, indem er sich von einer ge-
nauen charakteristik der Größe von .4 distanziert, ihre drei quantitativen
Schätzungen zuläßt: 'Aist X', 'r{ ist nicht viel weniger als X,'A ist nichtviel mehr als ,Y. Vgl. den widersprüchlichen Satz:
115
(80) *Möwiqc, ie w tej sali jest okolo stu osöb, nie möwig, ie liczbaosöb w tej sali moie wynosiö sto, niewiele mniej niZ sto lub nie-wiele wigcej ni2 sto.'Wenn ich sage, daß es in diesem Saal etwa hundert Men-schen gibt, sage ich nicht, daß die Zahl der Menschen in die-sem Saai ein hundert beträgt, nicht viel weniger als ein hun-dert oder nicht viel mehr als ein hundert.'
Hier folgt ein Vorschlag einer semantischen Explikation des Aus-drucks okolor2:
A jest okolo X-a / -öw.:'Wenn ich sage, wieviel ,4 ist, dann sage
ich "X", weil es am einfachsten zu sagen ist, wenn man 'X"sagt;
,4. kann X sein, es kann nicht viel weniger als X sein, es kannnicht viel mehr als -f,sein.'
Dieses Schema läßt sich in der Explikation sowohl der Präpositionokolo als auch des adnumerativen Operators okolo anwenden, Vgl. z. B.
(81) Okolo stu kobiet podpisalo ten protest.
'Etwa hundert Frauen haben diesen Protest unterzeichnet.'
'Wenn ich sage, wieviele Frauen diesen Protest unterzeichnethaben, sage ich: "hundert", weil es am einfachsten zu sagen(über diese Zahl zu sagen) ist, wenn man sagt: "hundert";
Die Frauen, die den Protest unterzeichnet haben, könnenhundert an der Zahl sein, es können nicht viel weniger alshundert sein, es können nicht viel mehr als hundert sein.'
72 Es scheint, daß die hier schematisch dargestellte Beschreibung von okolo mit derAuffassung von WInnzntcKA (1991, 358) übereinstimmt. Sie hat folgende Expli-kationsformel für das englische around vorgeschlagen:
.aroundit could be thßit could be a little more than thisit could be a little less than thi.s
it couldn't be much more than thisit couldn't be much lex than thisI say this (number), not another (number),
because it ß easy to think of this (number)".
Diskutabel ist die Frage, ob die vierte und fünfte Komponente dieser Explikationgegenüber der zweiten und der dritten nicht redundant sind.
116
(S2) Ewa interesowala sig okolo trzydziestoma dyscyplinami sporto'
wymi.
'Ewa interessierte sich für etwa dreißig Sportdisziplinen''
'Wenn ich sage, für wieviele Sportdisziplinen sich Ewa inter-
essierte, sage ich "für dreißig", weil es am ieichtesten zu
sagen (über die Zahl der Disziplinen zu sagen) ist, wenn man
sagt: für dreißig;
An Sportdisziplinen, für die sich Ewa interessierte, können es
dreißig sein, es können nicht viel weniger als dreißig sein, es
können nicht viel mehr als dreißig sein.'
Die allgemeinste schlußfolgerung, die sich aus den hier dargestellten
Überlegungen ergibt, lautet, wie folgt: Zwei homonyme Lexeme mit der
Gestalt von okolo, die Präposition und der adnumerative operator, sind
gleichbedeutend.
Literature
BaNro, M., KRarr,wsKA, M. 1994: Stownik wyrazöw klopotliwych' Wars'
zawaBoGUSLAws«r, A. 1966: Semantyczne pojgcie liczebnika i jego morfulogia w
j gzy ku ro syj skim. WroclawBocusLAwsKI, A. 1973: Nazwy pospolite
niektdre wla§ciwo§ci ich form liczbowychjpzyku poiskim. ln Z. Topoliriska; M.
ilo:iö, miara. Wroclaw, 7-35
DoRoszEwsKI, W. 1962: O kulturg slowa. Poradnik igzykowy' Bd' I' War-
szawaDoRoszEwsKI, W. 1968: O kulturP slowa. Poradnik jgzykowy' Bd' II'
WarszawaGRocHowsKr, M. 1984: Frojekt klasyfikacji syntaktycznej polskich lek-
semöw nieodmiennych. In: Polonica 10,73-97
Gnocuowsrt, M. 1986: Polskie partykuly. skladnia, semantyka, leksyko-
grafia. WroclawGROCgOwSrl, M. 1995: Cechy gramatyczte i semantyczne wyra2enia
"ponad". ln: Acta (Jniversitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska 46,
41-51
tt7
GRocHowsKI, M. 1996: O wykladnikach aproksymacji: liczebniki nie-wla§ciwe a operatory przyliczebnikowe. In: H. Wrdbel (Hrg.): Wybrane
problemy gramaüczne i leksykologiczne jgzyköw slowiaiskich. Krak6wGnuszczvNsKl, W., SALoNI, Z. 1978:. Skladnia grup liczebnikowych we
wspölczesnym jgzyku polskim. ln: Studia gramatyczne 2, L7 -42LASKowsKI, R. 1984: Liczebnik. In: R. Grzegorczykowa; R. Laskowski;
H. Wröbel (Hre.): Gramatyka wspölczesnego igzyka polskiego. Morfolo-gia. Warszawa, 283-293
SAPIR, E. 1972: Gradacja: studium z semantyki. In: A. Wierzbicka(Hrg.): Semantyka i slownik. Wroclaw, 9-37
SJPD: ,Slorrynik jgzyka polskiego P,4N. Hrsg. W. Doroszewski, I-XI, War-szawa 1958-1969
SJPSz.: Slownik jezyka polskiego PWN. Hrsg. M. Szymczak, I-III, War-szavta 19921
SPP: Slownik poprawnej poßzczyzny. Hrsg. W. Doroszewski, H. Kurkow-ska, Warszaw a lg7 31 ,199518
SzuuINsre, B. 1996: l-qczliwo§ö skladniowa i semantyczno-leksykalnawyraiert "bez mala", "blisko", "niespelna". ln Poradnik Jgzykowy
Topoltt'tsra, Z. l98l: Remarks on the Slavic Noun Phrase. WroclawTopornsra, Z. t984: Skladnia grupy imiennej. ln: Z. Topolitiska (Hrg.):
Gramatyka wspölczesnego jgzyka polskiego. Skladnia. Warszawa, 301-389
WlBRzsrcKA, A. 1991: Cross-Cultural Pragmatia. The Semantia of HumanInteraction. Berlin
WRönEL, H. 1991: Polskie grupy imienne z czlonem niefleksyjnym. In:M. Grochowski (Hre.): Problemy opisu gramatycznego jgzyköw slowiari-skich. Warszawa, 177 -t82
WRöBEL, H. 1995: Problemy dyskusyjne w syntaktycznej klasyfikacjipolskich leksem6w. lnl' Studia grama1)czrre 11, 7-18
przedmiotöw konkretnYch ii polqczeri z liczebnikami w
Grochowski (Hrg.): Liczba,
r
Björn Hansen, Hamburg
Die polnischen Modalauxiliare: Semantik, Form undStruktur der Kategorie
0. Fragestellung
In diesem Artikel soll es um die zentralen Ausdrucksmittel des Polnischen für die Bedeutungen 'können', 'müssen' und 'wollen' gehen. ImMittelpunkt stehen die Lexeme möc, musieö, chcieö und, die mit ihnenverwandten Einheiten. Es wird untersucht, welche der möglichen Aus-drucksmittel als die zentralen angesehen werden können und welcheeinen nur peripheren Status einnehmen. Dafür werden sowohl die se-
mantische als auch die formale Seite der betreffenden sprachlichen Mit-tel berücksichtigt und miteinander in Beziehung gesetzt. So sind nebender Semantik auch spezihsche morphologische und syntaktische Eigen-schaften festzustellen. Bei den Modalauxiliaren handelt es sich um eineKlasse von Ausdrücken, die sich im Grenzbereich zwischen Lexikon undgramnaatischer Kategorie bewegen, also zwischen lexikalischem undgrammatischem Status oszillieren. Die im vorliegenden Beitrag vorge-schlagene Herangehensweise trägt gerade dieser Eigenart Rechnung. Eswird zunächst die Semantik beleuchtet und eine Beschreibungssprachezu ihrer Erfassung entwickelt. Nach einer Analyse der für Auxiliare typi-schen Eigenschaften werden die betreffenden Elemente in lexikographi-schen Kurzportraits beschriebenl .
l. Zw Forschung
Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit kein Raum ist für eine ausführ-liche Erörterung der Forschungslage zlur Modalität, beschränke ich michauf einige wesentliche Punkte aus der Literatur zu den polnischen
Die Arbeit knüpft an HANSEN (im Druck a/b) anseitdem geändert.
Einige Sichtweisen haben sich
rt20
Modalauxiliaren2 . Im Gegensatz zur Germanistik ist es in der polonisti-schen Grammatikographie nicht üblich, von einer eigenen Klasse derModalauxiliare bzw. -verben zu sprechen. Dies ist dadurch bedingt, daßdiese kein den germanischen präteritopräsentien vergleichbares Formpa-radigma aufweisen und sich auch in der syntax nicht von Ausdrückenmit inhnitivischem Aktanten unterscheiden, wie dies in den germani-schen Sprachen der Fall ist (deutsch Inhnitiv ohne zu). Dennoch findenwir in den neueren Grammatiken gewisse Hinweise auf die uns interes-sierende Klasse von Ausdrücken. so behandelt die AG skladnia (19g4)zentrale Ausdrücke der Modalität unter der Rubrik .,prädikat-Argument-
struktur mit einem Prädikat höherer ordnung", in der neben musieö,'müssen' auch solche eindeutig nichtmodalen Lexeme wie postanowiö,'beschließen' aufgeführt werden. somit bilden die modalen Ausdrückekeine eigene Klasse, sondern fallen in große, offene Klassen mit einergemeinsamen prädikatenlogischen Funktion. Erwähnenswert ist die Be-handlung in der Grammatik Lesrcowsrr (1919), in der unter der Be-zeichnung "Modalverben" bzw. "Modalwörter,, eine Klasse von ,,seman_
tisch unvollständigen Elementen" aufgeführt wird. Neben den eindeutigmodalen Elementen zählt der Autor auch andere verben mit infinitivi-schem Aktanten hinzu wie z. B. przeszkotlziö,,stören'.
Da das funktional-semantische Feld der Modalität als solches in gro-ßem Maße die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen hat,haben sich recht viele Autoren zu den Elementen geäußert, die ich hierals Modalauxiliare bezeichne. Die wichtigsten einschlägigen Arbeiten zuden lexikalischen Ausdrucksmitteln der Modalität bzw. den Modalauxi-liaren des Polnischen sind Rvrpr. (1982), Karlrv (1976 ff.) wsrss (19s7)und Lrcana (1997)- Außerdem wären noch KAKTETEK (1973, L976) und,Zesnocrl (1978) zu erwähnen. In den Untersuchungen werden folgendeTermini verwandt:r modale Hilfsverben (Karvv 1976), schließt prädikativewie trzebaein;o Modalauxiliare (Kerurrn« 1976);e eigentliche Modalverben (Rvrrl 1982, Lrcena 1997);o Modale - nach dem engl. "modals,, (ZABRocKI 197g).Der größte Teil der untersuchungen geht von modalen Bedeutungen ausund ordnet diesen die entsprechenden Ausdrucksmittel des polnischen
2 Zur polonistischen Forschung s. SAppoK (1994); RyrEL (19g2);(1976); LIGAR^ (1997) und HANSEN (im Druck a).
121
zu. Der Ausgangspunkt kann durch eine sprachunabhängige Definitionder Bedeutungen gesetzt werden, wie im Falle der Arbeit RvrBL (1982),
die von der in LvoNS (1977) vorgeschlagenen Unterteilung der modalenBedeutungen in alethische, deontische und epistemische ausgeht. Andere
Autoren behandeln diesen Bereich im Rahmen unilateraler kontrastiverUntersuchungen; d. h. als Tertium comparationis zwischen den vergli-
chenen Sprachen Sr und 52 dient das Modalauxiliarsystem von 51;
deutsch --> polnisch: KAruv (1976), WEIss (1987); englisch -+ polnisch:
KAKTETEK (7976), Frsmr et alii (1978), ZasRocKI (i978). Kakietekvergleicht die den englischen Modalverben eigenen Formeigenschaftenmit denen der polnischen Aquivalente. Hierbei handelt es sich m. E. umeine wenig ergiebige Fragestellung, da die morpho-syntaktischen Merk-male von Modalauxiliaren oder wie in diesem Falle von Modalverben inhohem Maße idiosynkratisch sind. Wie in Hansen (im Druck a) anhanddes Deutschen und Dänischen gezeigt wurde, unterscheiden sich diegermanischen Modalverbsysteme in ihren formalen Eigenschaften Eanzerheblich voneinander. Selbst eng verwandte Sprachen wie das Dänischeund Schwedische differieren. Aufgrund des im wesentlichen von dengermanischen Sprachen bestimmten Blickwinkel, steht bei vielen For-
schern bei der Postulierung von Klassen gerade die Wortart Verb imMittelpunkt der Untersuchung (KezurrEK 1976, RYTEL 1982: "wla6ciweczasowniki modalne"). Die bislang umfassendste Inventarisierung sämt-
licher modaler Ausdrucksmittel bietet die bilateral tschechisch-polnischkontrastierende Arbeit RYTEL (1982). Die neue darauf aufbauende Mo-nographie LIGARA (1997) stellt in zweierlei Hinsicht ein Novum dar.
Zum einen liegt die Untersuchungsrichtung polnisch --> französisch vor,
und zum anderen wird eine erste umfassende semantische Beschreibungzentraler Modalauxiliare geliefert.
Wie in den Ausführungen zu den grammatikographischen Standard-werken angedeutet wurde, herrscht in der Forschung eine ausgespro-
chene Uneinigkeit darüber, welche Ausdrucksmittel des Polnischen zueiner eigenen Klasse von modalen Lexemen zusammengefaßt werden
sollten. In der weiter unten folgenden Tabelle habe ich zusammengetra-gen, welche sprachlichen Elemente von den einzelnen Autoren genannt
werden, wenn sie den uns interessierenden Bereich behandeln. Die Hete-
BoNIECKA
rl.r-r
rogonität ergibt sich natürlich auch ganz wesentlich durchschen Fragestellungen der Autoren3 .
Lexem EJP Kak. Libyö zmuszonym,' gezwungen
sein'bylo + lnfinitiv, 'es war zu,chcieö,'wollen'godzi sig,'es gehört sich'daö sig, 'sich lassen'mieö,'sollen'moina,'man kann'möc,'können'musieö,'müssen'naleiy,'man muß'niepodobna,'man kann nicht,nie potrzebowai, 'nicht brau
chen'nie sposöb,'man kann nicht'powinien, 'sollte'przystoi,'es ziernt sich'raczyö, 'geruhen'trzeba,'man muß / soll'winien.'er soll'wolno,'man dar?wypada,'es ziernt sich / man
muß'
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so läßt sich jedoch eine Art Zen-trum der Klasse ausmachen, wie sie vcn den rneisten Autoren gesehenwird (vgl. Anzahl der Kreuze in der Tabeile): musieö, möc, powinien, ntieö.weniger klar ist der status derjenigen Lexeme, die von nur wenigenAutoren genannt werden, z. B. chcieö oder wolno. In den Abschnitten 3und 4 wird der Frage nachgegangen, inwiefern wir von einer Klasse aus-
t23
gehen können und welche Merkmale es sind, die uns z. B. möc intuitivals typisches Modalauxiliar erscheinen lassen.
2. Semantik der Modalauxiliare
Die Modalauxiliare bilden die zentralen Ausdrucksmittel für denjenigen
Bereich innerhalb des funktional-semantischen Feldes der Modalität, den
ich als Handlungsmodalität bezeichnen möchte' Diese verstehe
ich als
(D nichtpropositionale Bedeutungsbestandteile des Satzes,
(IIa) die sich auf latente Vorlaufsstadien einer Handlung oder
(IIb) die subjektive Bewertung der Wahrscheinlichkeit der Hand-
lungsrealisierung beziehen.
Wie der Disjunktor 'oder' in der Deltnition anzeigt, haben wir es mitzwei miteinander zusammenhängenden Grundtypen von Bedeutungen zu
tun, nämlich den agensorientierten (IIa) und epistemischen (IIb)4 . Bei-
derr Typen gemeinsam ist eine Qualifikation der Geltung einer Situation'Agensorientierte Bedeutungselemente speziltzieren eine Situation, indemsie ni.chtwahrnehmbare Zustände bzw. Dispositionen fokussieren, diedem Handlungsträger zugeschrieben werden. Ein solches latentes Sta-
dium findet sich zum Beispiel in Piotr musi powtörzyö egzamin,'Piotr mußdie Prüfung wiederholen'. Der Zustand des Müssens ist nicht wahr-nehmbar und als Disposition des Handlungsträgers der Situation 'Piotrwiederholt die Prüfung' vorgelagerts. Im Polnischen läßt sich diese Be-
deutung paraphrasieren durch den Satz Piotr jest zmuszony powtörzyö
egzamin,'Piotr ist gezwungen, die Prüfung zu wiederholen'. Die episte-
mischen Bedeutungen enthalten als deiktische Komponente die Spre-
cherbewertung der Realität der versprachlichten Situation. In einem Satz
wie Piotr musi mieö co najmniej 30 lat,'Piotr muß mindestens 30 Jahre altsein' drückt musieö aus, daß bestimmte Indizien den Sprecher dazu ver-
anlassen, anzunehmen, daß Piotr mindestens 30 Jahre alt ist (in etwa
synonym: Piotr napewno ma co najmniej 30 lat,'Piotr ist ganz sicher min-
Die Einteilung und die Termini, nicht jedoch die Dehnition, folgen BYBEE et alii(1994)'agent-oriented' vs.'epistemic modality'.
Eine ähnliche handlungsorientierte Auffassung vertritt WUNDERLICH (i981, 46):"Vorfeld von Handlungsausführungen".
die spezifi-
Die Abkürzungen stehen flür Encykropedia wiedzy o jgzyku porskim, wErss (19g7);Rrrrl (1982); KA,rNy (1976); K^KIErEK (1976) und Ltc^RA (1997).
t24
destens 30 Jahre alt'). Der sprecher kann die versprachlichte situationunmarkiert lassen, so daß sie ars real existent verstanden wird.
Gemäß der Definition der Handlungsmodalität als Bedeutungsbe-standteile des satzes, die sich auf nicht-wahrnehmbare vorlaufsstadieneiner Handlung bzw. die subjektive Bewertung der wahrscheinlichkeitder Handlungsrealisierung beziehen, ist der Kreis der Bedeutungen ein-gegrenzt. wir können z. B. die verben mit prädikativem Aktanten aus-schließen, die wahrnehmbare Zustände oder Handlungen bezeichnen.Dies gilt für verben wie pröbowai, 'versuchen,: so kann man sinnlichwahrnehmen, wenn jemand versucht, eine Tür zu öffnen, aber kaum, daßer die Tür öffnen kann oder muß. Gleichermaßen können wir eineGrenze ziehen zu eindeutigen Fällen der expliziten Ausformulierung derepistemischen Bewertung wie in przypuszczam, ie p,'rch nehme an, daßp', da die Bewertung hier als Bestandteil der proposition angesehen wer-den muß. Ahnliches gilt für deontische verben des Typs rozkazaö,'befehlen', in deren Explikationskern neben den handlungsmodaren pri-mitiva propositionale Elemente enthalten sind wie ,sagen,und ein weite-rer Aktant bzw. Partizipant: piotr musi wyjsö, 'piotr muß hinausgehen, vs.Piotr rozkazuje Tomkowi wyjsö,'piotr befiehlt Tomek zu gehen,. trn ande-ren Fällen ist die Grenze fließend; z. B. mieö prawo, ,das Recht haben,oder byö doaoolonym, 'erlaubt sein'.
Die Handlungsmodalität eröffnet einen recht weiten semantischenRaum, der für die angestrebte Beschreibung der Modarauxiliare systema-tisch erfaßt werden soll. Dafür wird eine Explikationssprache entwickelt,die im wesentlichen d,em lexikographischen zweck der Abgrenzung dereinzelnen Bedeutungen und der Erfassung der lexikalischen Beziehungender synonymie, Polysemie und varianz dient. Der Bestand des Lexikonsdieser Explikationssprache ist nicht a priori festgelegt, sondern wird imLaufe der empirischen Arbeit bestimmt und verändert sich dadurchständig (GRocHowsKI 1980, 8: "stopniowe konstruowanie metajgzyka,,).Es wird angestrebt, daß die an der umgangssprache orientierten Explika-tionen die semantische Brücke zwischen den Lexemen einer vokabelzum vorschein bringen6 . Es soll vermieden werden, daß die jeweiligeExplikation Lexeme enthält, die sehr viel komplexer sind als die zu be-schreibenden modalen Bedeutungen. Dieser von wIEnzBrcKA (19g7)
6 "A vocable is the set of all lexical units such that (i) their signifiers are identicaland (ii) the signifieds of any two units are linked [...] The semantic link betweentwo lexical units is a semantic bridge.,, (MEL,öuK 19gg, 169)
125
erhobene vorwurf bezieht sich auf solche in der Modalitätsforschung
sehr verbreiteten Termini wie Notwendigkeit, Pflicht, zwang, Erlaubnis oder
deontische Quetle; denn sie enthalten offensichtlich die Bedeutungen der
Modalverben können wd müssen und darüber hinaus noch weitere se-
mantische KomponentenT. Nach der oben dargelegten Definition der
Handlungsmodalität läßt sich der Kreis ihrer Exponenten eingrenzen auf
diejenigen Elemente, die in dem Kernprädikat ihrer Explikation ein mo-
dales Primitivum und eine variable für die Handlung p aufweisen. Primi-
tiva sind innerhalb der Explikationssprache unzerlegbare Komponenten.
Ich gehe von vier Primitiva aus: WILL, KANN, MUSS und ES IST BES-
SER, WENNa. Letzt"rer stellt die abgeschwächte Form von MUSS dar;
vgl.'. musieö,'müssen' vs. powinien, 'sollte'. Bei den Primitiva der Me-
tasprache haben wir es nicht mit den entsprechenden Lexemen einer
realen sprache, sondern mit Abstraktionen zu tun. Die Primitiva bilden
jeweils nur den prädikativen Kern der Explikationen; d. h. in die Expli-
kation von musieö gehen neben MUSS noch weitere Komponenten ein.
Den vier genannten semantischen Primitiva wird Eigenständigkeit zuge-
standen, d. h. trotz vorhandener wechselbeziehungen wird keines auf die
jeweils anderen zurückgeführt. Wollten wir MUSS auf KANN reduzie-
ren, so übersähen wir, daß die Konstruktion des Typs nie mo2e nie p im
Polnischen recht peripher ist. Das Umgekehrte, nämlich die Reduzierung
von KANN auf MUSS, erscheint gänzlich ausgeschlossen wie *nie musi
nie zeigt. Gegen die Konzeption wmnzslcres (1987), die KANN durch
WILL expliziert im Sinne r/X wants to do it X will do i/, spricht die Tatsa-
che, daß vielen Entitäten KANN oder MUSS zugesprochen werden kann,
die über keinen eigenen willen verfügen. Zwischen den Primitiva KANNund MUSS besteht die seit Aristoteles bekannte Beziehung der gegensei-
tigen Dehnierbarkeit, die sich in der negationsbedingten Teilsynonymie
bestimmter Auxiliare ausdrückt; d. h. der eine operator läßt sich mit
Hilfe der Negation durch den anderen defltnieren:
Es wurde im wesentlichen auf die Konzeptionen der (ex-)Moskauer und der
polnischen schule zurückgegriffen. Zu wichtigen Prinzipien der lexikographi-
schen Praxis und der Erstellung von Explikationen s. APRESIÄN (1972; 1974;
1994); GRocHowsKI (1980); MEL'ÖUK (1988); wIERzBIcKA (1972; 1996)' ImGegensatz zu wierzbicka erhebe ich für meine Explikationen nicht den
Anspruch auf kognitive Realität. sie sind als das Produkt lexikographischer
Praxis anzusehen. Der gesamte Aufbau der Explikationssprache muß an anderer
Stelle erläutert werden.
Die Explikationen werden in GROSSBUCHSTABEN angegeben.
L)(r
(1a) Piotr mo2e nie przyjsö. - piotr nie musi przyjsö.X KANN NICHT-P: X MUSS_NICHT p. (0 _ p: _ [ p)
(ib) Piotr nie mo2e nie przyjsö. - piotr musi nie przyjsö.X KANN-NICHT P : X MUSS NICHT-P. (_ 0 p = [ _ p)e
wie bereits erwähnt wurde, treten die genannten primitiva mit weiterensemantischen Komponenten auf: den Modalitätsebenen. Diese machendie in der Forschung oft als polysemie oder manchmal gar als Homony-mie behandelte Funktionsbreite der Modalauxiliare aus. Es handelt sichum drei Basisebenen, denen in der Metasprache durch folgende phrasenRechnung getragen wird:o dynamisch: Modalität der objektiven Beziehung zwischen Fartizipant
und Handlung;a. bedingt durch innere Anlagen: ,AUFGRUND VON ETWAS IN_NERHALB VON X';b. bedingt durch objektive äußere Bedingungen: .AUFGRUND VONETWAS ATJSSERHALB VON X';
o deontisch: Modalität der verpflichtung und Erlaubnis; 'AUFGRUNDDESSEN, WAS JEMAND WILL';
o epistemisch: Modalität des Wissens und Glaubens; ,DER SPRE-CHER MUSS / KANN ANNEHMEN, DASS X P'.
Im Gegensatz zu der von Knarzsr (lg7i, 197g) entwickelten Theorieder relativen Modalität, die die Modalitätsebenen - bei ihr ,Redehinter-gründe' genannt - aus der Bedeutung in den Kontext bzw. das 'wissenvon Hörer und sprecher verlagert, gehe ich im Rahmen der vorliegendenArbeit von unterschiedlichen Bedeutungsbestandteilen aus. sie könnenzu varianten einer Bedeutung oder zu porysemie führenl,. Die An-nahme von Bedeutungsalternationen ergibt sich nicht zrtletzt aus derkonkreten lexikographischen Aufgabe, die Bedeutung nicht nur der zen-tralen Auxiliare wie möc oder musieö, sondern auch der peripheren zubeschreiben. so verfügt das Polnische über Modalauxiliare, die jeweilsnur eine der Ebenen versprachlichen; ausschließlich deontisch verwend-bar ist z. B. wolno, 'man darf.
In der logischen Notation stehen 0 für KANN, I für uuss und - für die Negation.
Zur Definition von Polysemie und varianz verwende ich das Kriterium derkompatiblen Kookkurrenz (AIRESJAN 1974,1,86; MEL,öI,K 19g8, 1g3).
127
In dem semantischen Raum der Handlungsmodalität, der durch die
dargestellten Primitiva und Modalitätsebenen konstituiert wird, können
wir Fokalbedeutungen festmachen; d. h. übereinzelsprachlich häufiglexikalisierte Bedeutungen. Diese können wir der typologischen For-
schung und einer auf ersten Arbeitshypothesen gestützten Grobanalyse
der Bedeutungen der polnischen Exponenten der Handlungsmodalitätentnehmen. Ein Großteil der von mir angenommenen Fokalbedeutungen
findet sich in der 76 Sprachen umfassenden typologischen Untersuchung
BYBEE et alii (1994). Es folgen die Fokalbedeutungen, ihre Explikationenin der hier entwickelten Explikationssprache und jeweils ein expliziterpolnischer Exponent.o Fähiskeit: 'X KANN P AUFGRUND VON ETWAS INNERHALB
VON X.' Dies sind im Handlungsträger angelegte Eigenschaften, die
die Durchführung der Handlung ermöglichen (dynamisch); byö zdol-nym,'fdhig sein'.
o Möglichkeit: 'X KANN P AUFGRUND VON ETWAS AUSSER-
HALB VON X.' In diesem Falle sind es nicht innere Eigenschaftendes Handlungsträgers, die eine Handlung ermöglichen, sondern äu-
ßere Bedingungen (dynamisch); mieö mo2liwo§ö,'die Möglichkeit ha-
ben'.r Erlaubnis: 'X KANN P AUFGRUND DESSEN, WAS JEMAND
WILL.' Eine Handlung kann durch den Willen anderer Leute bzw.
bestimmter Kollektive ermöglicht werden (deontisch); wolno, 'marrdarP,
o mittlere Wahrscheinlichkeit: 'DER SPRECHER KANN ANNEH-MEN, DASS X P.' Es liegt eine epistemische Bedeutung vor. DieWahrscheinlichkeit ließe sich mit 50% angeben; moie,'vielleicht'.
o Notwendigkeit: 'X MUSS P AUFGRUND VON ETWAS INNER-HALB ODER AUSSERHALB VON X.' Die Kräfte, die den Hand-lungsträger zur Handlung zwingen, liegen hier in dinglichen Bege-
benheiten (dynamisch); byö zmuszonyrz,'gezwungen sein'.Verpflichtung: 'X MUSS P AUFGRUND DESSEN, WAS JEMANDWILL.' Der Handlungsträger wird von Geboten, Konventionen, Ge-
setzen oder dergleichen zur Handlung bewegt (deontisch); nieiobowiqzek,'die Pflicht haben'.Hohe Wahrscheinlichkeit: 'DER SPRECHER MUSS ANNEHMEN,DASS X P.' Diese epistemische Bedeutung drückt einen sehr viel hö-
heren Grad an Überzeugung des Sprechers arts; zapewne, 'sicherlich'.10
rl2lr
o Schwache Verpflichtung: 'ES IST BESSER, WENN X p., Im Unter-schied zur Verpflichtung bleibt hier die Entscheidung, die Handlungauszuführen, beim Handlungsausführenden (deontisch); byö zalecano,'empfohlen sein'.
r 'W'ollen: 'X WILL P.'; chcieö, 'wollen'.o Absicht: 'X WILL P UND IST BEREIT ZU P.'Hierbei handelt es
sich um ein späteres Stadium der Herausbildung eines Handlungs-planesrr ; zamierzaö,'beabsichtigen'.
Die bei den meisten der aufgeführten Fokalbedeutungen mögliche ne-gierte Form ist hier nicht eigens aufgeführt. Wie die Lexeme nie potrze-bowaö, 'nicht brauchen' oder niepodobna, 'man kann nicht' zeigen, verfügtdas Polnische über negativ polarisierte Auxiliare. In den Lexemen, diedie Fokalbedeutungen repräsentieren, können sich zusätzliche semanti-sche Komponten finden; z. B. der polnische Ausdruck für 'Fähigkeit',umieö, enthält die Komponente 'AUFGRUND VON WISSEN ODERüBUNc'.
3. Die Klasse der Modalauxiliare
Nachdem im vorigen Kapitel die Handlungsmodalität beschrieben unddie Grundkomponenten zu ihrer lexikographischen Erfassung entwickeltworden sind, soll nun der Frage nachgegangen werden, welche Mittet imPolnischen für die beschriebenen Bedeutungen verwendet werden. Ge-hen wir streng onomasiologisch vor und ordnen den genannten Bedeu-tungen mögliche Realisierungen zu, so stoßen wir auf eine große Anzahlsehr heterogener Ausdrucksmittel. Neben den extrem häufigen Modal-verben wie möc,'können' und musieö,'müssen' treten u. a. folgende Mit-tel aul Prädikativa des Typs trzeba,'man muß / soll', Konstruktionen wieco§ jest do zalatwienia, 'etwas ist zu erledigen', byö w stanie,'in der Lagesein', Wortbildungsafhxe wie in niewyplacalny, 'zahlungsunfähig'. Es stelltsich die Frage, wie der Stellenwert eines Lexems wie potrafiö,'können' imVergleich zv möc angesehen werden soll. Können wir eine Ordnung indie aufgeführte große Anzahl von möglichen Modalauxiliaren bringen?Im folgenden möchte ich die These entwickeln, daß sich im Polnischenein Auxiliarisierungsprozeß nachweisen läßt, den einige Elemente bereits
129
recht weit und andere nur teilweise durchlaufen haben. Dafür muß zu-
nächst der Begriff des Modalauxiliars geklärt werden.
Im Gegensalz zrt den bisherigen Untersuchungen, die im wesentli-
chen durch den germanisch-polnischen Sprachvergleich beeinflußt waren,
möchte ich meiner Analyse des Polnischen einen übereinzelsprachlichenAuxiliarbegriff zugrundelegen. Dafür können lvir zunächst auf Hr,wB(1993) zurückgreifen, der eine typoiogisch ausgerichtete Minimaldefi-nition vorschlägt. Danach ist ein Auxiliar generell eine sprachliche Ein-
heit, die sich auf einem Kontinuum zwischen einem Vollverb einerseits
und einem grammatischen Marker für Tempus, Aspekt und Modalität an-
dererseits bewegt (a. a .O., 70). Da Heine die breite Perspektive der Cha-
rakterisierung aller Typen von Auxiliaren einnimmt, möchte ich auf eine
Besonderheit der Modalauxiliare hinweisen. So ist die vollständige Gram-
matikalisierung, die mit einem Übergang einer selbständigen Form in ein
Affix einhergeht, zumindest in den Sprachen Europas eher selten. Vgl.folgende Sätze aus KtNc (1996):
(2) Türkisch: Ben Tokyo'ya gideäflirim.
(3) Baskisch: Tokiora joan maiteke.'Ich kann nach Tokyo fahren.'
Die Modalauxiliare der slavischen, germanischen und romanischen Spra-
chen sind von einem vergleichbaren Affixstatus sehr weit entfernt. Typo-logische Daten weisen darauf hin, daß die Exponenten der Handlungs-modalität zu einer gewissen formalen Autonomie neigen. Wie oben inbezug auf die germanischen Modalverben erwähnt wurde, sind die for-malen Eigenschaften von Modalauxiliaren in allen Sprachen selbst bei
enger Verwandtschaft recht verschieden. Ich möchte bei der Formulie-rung der Kriterien zur Bestimmung des Status des Modalauxiliars einenWeg einschlagen, der Übergangsphänomene erlaubt und formale wiesemantische Merkmale gleichermaßen berücksichtigt. Wir haben es ganz
offensichtlich mit einer stark ausgefransten ("frtzzy") Klasse von Aus-drücken zu tun, die in sich Stufungen aufweist. Anhand eines Merkmal-bündels möchte ich Schwellen auf dem Auxiliarkontinuum festsetzen.
Im folgenden werden vier Eigenschaften erläutert, die in ihrer Gesamt-
heit den Prototypen des polnischen Modalauxiliarskonstituieren.
1l Zur Explikation der volitiven Ausdrücke des Polnischen s" GRoCHowSKT (1980)
Iilt
l. I Modrrllrrxiliare sind polyfunktional.
Wio am Beispiel ndc, 'können' :und, potrafii, ,können, gezeigt werdenkann, unterscheiden sich die einzelnen auf die Handlungsmodalität spe-zialisierten vokabeln im Grad der Expansion auf die verschiedenen Fo-kalbedeutungen. Einige Elemente können gleich zwei oder mehr dieserBedeutungen versprachlichen, während andere auf nur eine beschränktsind. So tritt möc irt den Bedeutungen ,Fähigkeit,, .Möglichkeit','Erlaubnis' und 'mittlere Wahrscheinlichkeit', potraJiö hingegen nur inder Bedeutung_'Fähigkeit' auf.. Fähigkeit:
(4) Ju2 cale trzy dni ci9 nie widzialam i nie moglam wytrzymaö,musialam koniecznie z tob4 sig spotkaö.'Ich habe dich schon drei Tage nicht gesehen, ich konnte esnicht mehr aushalten, ich mußte mich unbedingt mit dir tref-fen.'
Möglichkeit:
(5) Ale je§li pani zal4da, mogg / ?potrafig sig postaraö o wekslegwarancyjne, a w Europie ode§lg natychmiast pod wskazanyadres.'Aber wenn Sie wünschen, kann ich mich um einen Garan-tieschein kümmern, und in Europa schicke ich ihn sofort andie angegebene Adresse.'
Erlaubnis:
(6) Skazani na najwy2szy wymiar kary mog4 / *potrafi4 w stanieUtah wybierad sposdb, w jaki chc4 umrze6.'Die zur Höchststrafe Verurteilten können im BundesstaatUtah auswählen, auf welche Art sie sterben wollen.,
o mittlere Wahrscheinlichkeit:
(7) Moiemy / *potrafimy lada chwila zostaö bez dachu, a typieni4dze wyrzucasz.'Wir können jeden Moment ohne ein Dach über dem Kopfdastehen, und du schmeißt das Geld zum Fenster hinaus.,
Diese Polyfunktionalität in Form von Bedeutungsalternationen (polyse-mie bzw. varianz) kann als das zentrale Merkmal der Modalauxiliare
131
angesehen werdenl2 . Neben der Expansion auf mehrere handlungsmo-
dale Bedeutungen wie bei möc gibt es noch andere Alternationen. Einige
Elemente der auf Handlungsmodalität spezialisierten Ausdrucksmittel ex-
pandieren nicht nur innerhalb der Handlungsmodalität, sondern erstrek-
ken sich in benachbarte funktional-semantische Felder. So kann z' B. der
Ausdruck für 'schwache Verpflichtung' mieö,'sollen' auch verwendet wer-
den, wenn der Sprecher die Quelle seines Wissens angibt, wie in
(S) §wiadkowie mieli te2 widzieö, jak jeden z pilotdw katapulto-wal sig, ale zgin4l, poniewa2 nie otworzyl mu sig spadochron.'Zeugen sollen gesehen haben, wie sich einer der Piloten her-
auskatapultiert habe, aber umgekommen sei, da der Fall-schirm sich nicht geöffnet habe.'
Der Sprecher markiert hier, daß er von der Situation 'Zeugen habengesehen, wie p'vom Hörensagen weiß. In diesem Falle liegt eine Bedeu-
tung aus dem an die epistemische Modalität angrenzenden funktional-semantischen Feld der Evidentialität vor. Die semantische Expansion aufdie epistemischen Fokalbedeutungen oder in die Evidentialität ist oft mitformalen Veränderungen verbunden; z. B. btldet möc in der Bedeutung
'Möglichkeit' einen Teil eines zusammengesetzten Prädikats, während es
in der Bedeutung 'mittlere Wahrscheinlichkeit'wie eine Partikel fungie-
ren kann:
(9) Tomek mo2e pojechad do Polski.'Tomek kann nach Polen fahren.'(Möglichkeit oder Verpflichtung)
(10) Uczy sig dobrze, mo2e nawet dostanie stypendium.'Er lernt gut, vielleicht bekommt er sogar ein Stipendium.'(mittlere Wahrscheinlichkeit)
Entgegen der üblichen Herangehensweise werden im Rahmen der vorlie-genden Arbeit auch die partikelhaften Lexeme zu den Auxiliaren ge-
zählt. Während recht viele Lexeme aus den Bereichen Fähigkeit, Mög-lichkeit, Notwendigkeit und Verpflichtung epistemische oder evidentiale
12 Hinweise auf die zentrale Rolle der Bedeutungsaltemationen hnden wir u. a. beiPLANK (1987); GoossENS (1987) und LIGARA (799'l). Lreara ist in dieser Hin-sicht jedoch nicht konsequent; einerseits sieht sie die von ihr postulierte Poly-semie als feste Eigenschaft der Modalauxiliare an, andererseits zählt sie auchEinheiten mit einer einzigen Fokalbedeutung hinzu: daö sig, 'sich lassen' undwolno,'man darl (a. a. O.,73).
f-
132
Bedeutungen aufweisen, ist dies bei volitiven Lexemen selten. wie dasenglische will und das serbokroatische hteti zeigen, entwickeln sich Aus-drücke des wollens eher in den temporalen Bereich: Das yerb chcieöbesitzt vor allem in der umgangssprache die noch recht schwach ent-wickelte aspektuell-temporale Bedeutung'Eintritt einer erwarteten Hand-lung'.
(11) Otworzyl usta, ale slowa nie chcialy mu przejsö przez gardlo.'Er öffnete den Mund, aber die Worte wollten ihm nichtdurch die Kehle kommen.'
Zusammenfassend können wir festhalten, daß Modalauxiliare typischer-weise neben einer handlungsmodalen mindestens eine weitere hand-lungsmodale oder mindestens eine Fokalbedeutung aus einem anderenfunktional-semantischen Feld wie z. B. Temporalität oder Evidentialitätaufweisen. Bei der Polyfunktionalität im hier dargelegten sinne handeltes sich um das stärkste Kriterium, das auch zur übereinzelsprachlichenIdentifikation von Modalauxiliaren ausreicht (s. HaNsru im Druck b).
3.2 Modalauxiliare sind nicht lexikalisch.
Unter dieser Eigenschaft ist eine Kombination semantischer und forma-ler Merkmale zu verstehen. Im Gegensatz zum rein handlungsmodalenmusieö, 'müssen'weist z. B. die Vokabel trzeba,,man muß / soll'die in-zwischen nur noch seltene lexikalische Bedeutung 'benötigen' auf (Trzebami pienigdzy. 'Ich brauche Geld.'). In diesem Falle hat trzeba einen volle-xikalischen status, was sich sowohl in der Explikation der Bedeutung alsauch in der Valenzstruktur niederschlägt. Anders als die typischen Mo-dalauxiliare, die ja nur eine Leerstelle für den Infinitiv aufweisen, sele-giert dieses Lexem von trzeba ein Genitiv- und ein Dativobjekt. Daß die-ser Gebrauch heute als etwas veraltet empfunden wird, deutet auf dasAussterben dieses Lexems hin.
3.3 Modalauxiliare bilden einen Verbalkomplex.
Dieses Merkmal hängt mit der unter 3.2. behandelten polysemie und denlexikalischen Eigenschaften eng zusammen. Typische Modalauxiliareselegieren obligatorisch und ausschließlich den Infinitiv. sie eröffnen da,rüber hinaus also keine eigenen valenzstellen. Dies gilt für alle Lexeme
133
einer Vokabel. Wenn ein Auxiliar keine eigenen Valenzstellen eröffnet,
dann kann es auch keinen Einfluß auf die Besetzung dieser Stellen aus-
üben; d. h. die Selektionsrestriktionen sind allein vom inhnitivischenVerb bestimmt. Wie die folgenden Sätze zeigen,weist möc im Gegensatz
zu potraJiö in der Tat keine Beschränkungen auf13 .
(12) Ta ksi42ka mo2e si9 tkazaö na wiosng. vs. *Ta ksi4Zka potrafi
sig ukazaö na wiosng.'Das Buch kann zum Frühling erscheinen.'
Einen weiteren Fall, in dem das modale Element keinen Verbalkomplexbildet, ltnden wir bei der handlungsmodalen Vokabel wypada,'man muß
/ es ziemt sich' vor, die außer einem Infinitiv auch einen Nebensatz
selegieren kann.
(13) Mo2e wypadaloby wr6ciö i poLeer.aö iq?'Vielleicht sollte man umkehren und sich von ihr verabschie-
den?'
(14) Nie wypada, 2eby gospodarz opuszczal swych go§ci'
'Es gehört sich nicht, daß ein Gastgeber seine Gäste allein1äß1.',
Das Merkmal Verbalkomplex bedingt ganz wesentlich den Zwittercha-rakter der stark auxiliarisierten Modalausdrücke. An der Oberfläche äh-
neln sie vollwertigen Lexemen, funktional verhalten sie sich jedoch wie
Funktionswörter, die mit dem infiniten Verb eine analytische Form bil-den.
3.4 Modalauxiliare sind defektiv.
Der Prozeß der Auxiliarisierung, also die diachrone Bewegung auf dem
Kontinuum in Richtung auf Modalitätsmarker, ist mit der Dekategoriali-
sierung der betroffenen Einheit verbunden (HoPPER 1991, HeNr 1991);
d. h. den Einheiten fehlen Eigenschaften der Wortart, der sie angehören'Als typisches Beispiel wäre trzeba zu nennen, das aufgrund des Verlustes
sämtlicher substantivischer Eigenschaften heutzutage kaum noch als Sub-
stantiv erkennbar ist. Da das Merkmal Defektivität negativ als Verlustvon Merkmalen definiert ist, verwundert es nicht, daß Modalauxiliare
13 In HelrsrN (im Druck a) wurde den Selektionsrestriktionen noch nicht diese
Rolle zugeschrieben.
r134
normalerweise nicht über ein spezihsches einheitliches Formenparadig-ma verfügen. Der Fall der germanischen Präteritopräsentien, der in die-sem Zusammenhang immer genannt wird, stellt nach der neuen, nochunveröffentlichten typologischen Untersuchung von über 80 Sprachenvon KINc (1996) eine große Ausnahme unter den Sprachen der Welt dar.Der in jeder Sprache individuell verlaufende Prozeß der Dekategorialisie-rung äußert sich im Polnischen in zwei Merkmalen, die kombiniert fastausschließlich bei Modalauxiliaren vorkommen. Sie treten zusätzlich zuder oben genannten obligatorischen und alleinigen Infinitivselektion auf:o bei der Wortart Verb:
1. es fehlt der Aspektpartner und2. es fehlt der Imperativ;
r bei der Wortart Prädikativ:nur alleinige und obligatorische Infinitivselektion.
Wie in HaNsr,N (im Druck a) gezeigt wurde, läßt sich aufgrund der reinformalen Merkmale Infinitivselektion (2.3.) und Defektivität (2.4.) einegeschlossene Klasse von Vokabeln feststellen, die eine starke Tendenzzur handlungsmodalen Motivierung aufweist. Diese Formklasse, für diein HeNsr,N (im Druck a) der Terminus 'modale Verbbegleiter' vorge-schlagen wurde, enthält folgende Mitglieder:
jgö, 'beginnen'; mieö,'sollen'; moina, 'man kann'; möc, 'können';musieö, 'müssen'; naleiy, 'man muß'; potrafiö, 'können'; powinien,
'sollte'; raczyö,'geruhen'; wolno,'man dar? ; zdolaö,'schaffen' ; zwyk-nqö,'es gewohnt sein'
Aus der Tatsache, claß fast alle nichtmodalen Elemente dieser Form-klasse - jqö, raczyö, zwyknqö - stark veraltet sind, erkennen wir die Kon-stituierung einer Formklasse, in die die zentralen Modalauxiliare fallen.Insofern beginnen die polnischen Modalauxiliare eine relativ einheitlichesemantisch-formale Klasse zu konstituieren, die jedoch recht unscharfeGrenzen aufweist.
Fassen wir den hier entwickelten Begriff eines typischen Modalauxili-ars des Polnischen zusammen. Demnach handelt es sich um eine miteinem Hauptverb auftretende, jedoch von diesem unabhängige Oberflä-cheneinheit, deren wesentliche übereinzelsprachliche Eigenschaft diePolyfunktionalität ist. Darüber hinaus sind Modalauxiliare nichtlexika-lisch, bilden einen Verbalkomplex und sind defektiv. Sind alle vier Merk-male vorhanden, liegt ein prototypisches Modalauxiliar vor. Elemente,die nur drei der genannten Kriterien erfüllen, bilden den angrenzenden
135
Bereich der peripheren Auxiliare. Je mehr Merkmale fehlen, desto weiterentfernt man sich vom Prototypen.
4. Kurzportraits der polnischen Modalauxiliare
Im folgenden sollen in konziser Weise die prototypischen und einigeperiphere Modalauxiliare beschrieben werden. Im Gegensatz zu allen bis-
herigen Analysen der Bedeutungen von Modalauxiliaren wird jeweils diegesamte Vokabel erfaßt; d. h. auch nichtmodale Bedeutungen werden ex-
pliziert. Nicht berücksichtigt werden Phraseologismen und Gebrauchs-
bedingungen pragmatischer Art. Zur Notation: Varianten einer Bedeu-
tung werden mii Buchstaben (moina a/b), einzelne Bedeutungen mit ara-
bischen Zlffen (mieö l/2) und Homonyme mit römischen Zrffern (mieö
I/II) markiert. Darüber hinaus wird eine Notation für die Valenzstrukturverwendet, wie sie in HeNsr,N (im Druck a) eingeführt worden ist:
[...] obligatorisch zu besetzende Valenz;
[Z] blockierte Valenz;
(...) fakultativ zu besetzende Valenz;
[NNor,r] Valenz mit Angaben über Rektion;
[VIrr *] der Aktant bildet mit dem Lexem einen Verbalkomplex.
Ich gehe davon aus, daß die Valenzstruktur des Hauptverbs in einemVerbalkomplex durch ein Modalauxiliar gebrochen werden kann. Diese
durch ein Modalauxiliar ausgelösten Veränderungen werden durch dieSchreibung '[X > Y]' dargestellt. X steht für die im Lexikon festgeschrie-
bene Besetzung der Leerstelle des inhnitivischen Verbs und Y für dieje-nige im Verbalkomplex. Einige Beispiele zur lllustration:
otwieraö [NNom] - (Naut) - lNett]musieölY6yf
naleiyP6l* [NNo- > O1 ...1
Die Selektionsrestriktionen werden in die Explikation integriert, obwohlsie m. E. nicht zur eigentlichen Bedeutung, sondern zur Kombinatorikzählen (vgl. ArnrsrAN 1972, 5L). Dieses Verfahren wurde aus rein prak-
tischen Gründen der Übersichtlichkeit der lexikographischen Portraitsgewählt; daher: BESEELTES X.
136
Eine Darstellung der polnischen Modalauxiliare setzt als erstenschritt eine empirische untersuchung des Lexikons voraus; denn es wirdeine systematische Erfassung angestrebt. Beginnen wir mit den prototy-pischen Vertretern dieser Kategorie.
4.1 Prototypische Modalauxiliare
Die untersuchung hat eine kleine Gruppe von prototypischen Modalau-xiliaren hervorgebracht. Es handelt sich um folgende fünf vokabeln:
mieö, 'soller.'; moina,'man kann,; möc, ,körrnen,; musieö,,müssen';naleiy, 'man muß'; powinien, 'sollte'
4.1.1 MIEÖ,'sollen'Struktur: X ma p [Vnr *]mieö l/l schwache Verpflichtung: 'ES IST BESSER, WENN X p AUF-
GRUND DESSEN, DASS JEMAND SAGT ODER GESAGT HAT,DASS JEMAND WILL, DASS X P.''4
(15) Nigdy za§ nie zapomng radosci, jakiej doznalem uslyszawszy,2e mam jechaö do Zamo§cia.'Ich werde nie die Freude vergessen, die mich überkam, alsich erfuhr, daß ich nach Zamosö fahren soll.,
mieö l/2 Hören-Sagen: 'JEMAND HAT DEM SPRECHER GESAGT,DASS X P.'
(8) Swiadkowie mieli te2 widzie6, jak jeden z pilot6w katapul-towal sig, ale zgin4l, poniewa2 nie otworzyl rnu sig spado-chron.'Zeugen sollen gesehen haben, wie sich einer der piloten her-auskatapultiert habe, aber umgekommen sei, da der FalFschirm sich nicht geöffnet habe.'
14 Der zweite Teil der Explikation stammt aus WEISS (ms.). Zur recht komplexenSemantik dieses Modalauxiliars s. WErss (ms.), SzyuausKt (1990); OLSZEWSKA_MTcHALCzyK (1980) und TopoLTNSKA (1968).
mieöl/3 konditional
(16) Gdyby posiedzienie mialo trwaö dluZej, musialbym zadzwo-
niö do 2ony.'lYenn die Sitzung länger dauern sollte, müßte ich meine
Frau anrufen.' (Beispiel aus Wtlss ms.)
Mieö erfiüllt das Kriterium der Polyfunktionalität in recht hohem Maße.
Über die handlungsmodale Bedeutung 'schwache Verpflichtung' hinaus
ist es wie das deutsche Pendant sollen it die benachbarten Felder Evi-
dentialität und Konditionalität expandiert. Der erste Teil der Explikationvon mieö I/1 markiert dieses Lexem als einen Ausdruck für die Fokalbe-
deutung 'schwache Verpflichtung'. Der folgende Teil zielt auf die Spezi-
fik der Situation ab, in die "zwei einzelne Aussagen eingehen: in der
einen aktuellen berichtet der Sprecher dem Hörer den Inhait einer ande-
ren Aussage, die den Referenten des grammatischen Subjekts enthält"(WEIss ms., 2). Bei unterschiedlicher referentieller Besetzung der Kom-ponente JEMAND ergeben sich solche Lesarten wie z' B.
o fatalistisch:
(17) Mial jeszcze wiele przecierpieö, zanim wyzdrowial.'Er sollte noch sehr viel erleiden, bevor er gesund wurde.'
o Aufforderung:
(18) Aniu, ty maszteraz posprz4taö pok6j!
'Anna, du sollst jetzt das Zimmet aufräumen!' (Beispiele aus
Wrtss ms.)
Von dem Modalauxiliar mieö I sind als Homonyme das possessive mieö
II 'haben'mit der Struktur [NNo- ] - [Na11 ] und das possessiv-resulta-
tive mieö III wie in mam napisane zu unterscheiden.
r37
/
138
4.1.2 MOZNA,'man kann'
Struktur: mo2na p [Vnr * [NNo- > Al ... 1
moina a. Möglichkeit'MAN KANN P AUFGRUND VON ETWAS AUS-SERHALB.'
(19) Nie powinienem tego m6wiö, ale je§li uzyska pani zgodg szefaoddzialu, to bgdzie mo2na sprawdzid pani konto przez telex.'Ich sollte es nicht sagen, aber wenn Sie vom Abteilungsleiterdie Erlaubnis bekommen, kann man Ihr Konto per Telexüberprüfen.'
moina b. Erlaubnis 'MAN KANN P AUFGRUND DESSEN, WAS JE-
MAND WILL.'(20) Tu drzemie stara ksig2na; tu dwie hrabiny informuj4 sig u
pralata, czy molna dziecko ochrzciö wodq r6Lan4?'Hier schlummert die alte Fürstin, und zwei Grähnnen in-formieren sich beim Prälat, ob man ein Kind mit Rosenwas-ser taufen dürfe.'
Wie an der Notierung der beiden Alternanten mit a) und b) zu erkennenist, liegen hier nicht zwei Bedeutungen, sondern Varianten einer Bedeu-tung vor. Das Prädikativum moina ist ein Teilsynonym von möc. Im Ver-gleich zu diesem ist es jedoch weniger polyfunktional, da es einige Be-
deutungen mit dem Primitivum KANN ausschließt. Dies gilt für denAusdruck der Fähigkeit und der mittleren Wahrscheinlichkeit. Moinakommt ausschließlich in Konstruktionen vor, in denen der erste Aktantdes inlinitivischen Verbs wegfällt (*mo2na mi sprawdziQ und bildet folg-lich eine funktionale Opposition zu dem persönlich konstruierenden möc.
4.1.3 Moe,'können'Struktur: X mo2e p [Vlnr *]
möc la Fähiekeit 'X KANN P AUFGRUND VON ETWAS INNER-HALB VON X.'
(4) Ju2 cale trzy dni cig nie widzialam i nie moglam wytrzymaö,musialam koniecznie z tob4 sig spotkaö.'Ich habe dich schon drei Tage nicht gesehen, ich konnte es
nicht mehr aushalten, ich mußte mich unbedingt mit dir tref-fen.'
t39
möc lb Möelichkeit: 'X KANN P AUFGRUND VON ETWAS AUS-SERHALB VON X.'
(5) Ale je§li pani zaL4da, mogg sig postaraö o weksle gwarancyj-
ne, a w Europie ode6lg natychmiast pod wskazany adres.
'Aber wenn Sie wünschen, kann ich mich um einen Garan-tieschein kümmern, und in Europa schicke ich ihn sofort an
die angegebene Adresse.'
möc lc Erlaubnis: 'X KANN P AUFGRUND DESSEN, WAS JEMANDWILL.'
(21) Skazani na najwLszy wymiar kary mog4 w stanie Utah wy-
bieraö spos6b, w jaki chc4 umrzeö.'Die zur Höchststrafe Verurteilten können im Bundesstaat
Utah auswählen, auf welche Art sie sterben wollen.'
möc 2 [Vr.,r *] / [S] mittlere Wahrscheinlichkeit: 'DER SPRECHERKANN ANNEHMEN, DASS X P.'
(7) Mo2emy lada chwila zostaö bez dachu, a ty pieni4dze W'rzucagz.'Wir können jeden Moment ohne ein Dach über dem Kopfdastehen, und du wirfst das Geld zum Fenster hinaus.'
(22) A moie moZesz mi powiedzieö przynajmniej, dlaczego przy-
l)rtszczasz,2e bgdg mial ochotg prosiö go o to?
'Aber vielleicht kannst du mir jedenfalls sagen, warum duglaubst, daß ichr Lust hätte, ihn darum zu bitten?'
Das Modalauxiliar möc ist das bei weitem häufigste und zeigt damit zu-
sammenhängend eine sehr ausgeprägte Polyfunktionalität. Bei den ersten
drei Alternationen ist nach dem Prinzip der kompatiblen Kookkurrenzvon Varianz auszugehen; denn es läßt sich häufig nicht sagen, ob nureine oder gleichzeitig mehrere der genannten Bedeutungskomponentenaktiviert sind. Als eine eigenständige Bedeutung wurde die epistemischeangesehen, da hier ein ganzer Satz mit einem finiten Verb stehen kann.In dieser Bedeutung geht der Übergang zu einer Modalpartikel vor sich.Solche Entwicklungen scheinen gerade für in hohem Maße auxiliarisierteElemente typisch zu sein, da periphere Modalauxiliare so etwas nichtzulassenl5 . Im Hinbtick auf die Negation erlaubt möc alle logisch mögli-
15 Ahnliche Phänomene finden wir auch in anderen slavischen Sprachen: Im Ser-
bokroatischen sind die Auxiliare moöi, 'können' und valjati, 'sollte' mit dem
1
l,l0
r:hon Kombinationen: nie mo2e, moie nie und nie moie nie. Letzeres stelltcinen stark kontextabhängigen Ausdruck der Notwendigkeit dar (- 0 - p:Ip).
4.1.4 MUSIEÖ,'müssen'
Struktur: X musi p [Vtrr *]
musieö 1a Notwendigkeit: 'X MUSS P AUFGRUND VON ETWAS IN-NERHALB ODER AUSSERHALB VON X.'
(4) Ju2 cale trzy dni cig nie widzialam i nie moglam wytrzymaö,musialam koniecznie z tob4 sig spotkaö.'Ich habe dich schon drei Tage nicht gesehen, ich konnte es
nicht mehr aushalten, ich mußte mich unbedingt mit dir tref-fen.'
(23) Matka mi zachorowala i musialem szukaö doktora.'Meine Mutter wurde krank, und ich mußte einen Arzt su-chen.'
musieö 1b Verpflichtung: 'X MUSS P AUFGRUND DESSEN, WAS JE-MAND WILL.'
(24) Jest gorqco i lle sig czujesz, ale bgdziesz musial umyö miwö2, synu. I jeszcze zmienisz mi olej w silniku.'Es ist heiß, und du fühlst dich schlecht, aber du wirst mirden Wagen waschen müssen, Junge. Außerdem wechselst dumir das Öl im Motor.'
musieö 2 [Vrnr *] hohe Wahrscheinlichkeit: 'DER SPRECHER MUSSANNEHMEN, DASS X P.':
(25) Czytalem cienkim glosikiem, chrzqkajqc i pokaszlujqc. Mu-sialo to wypa§ö Zalo§nie.'Ich las mit dünner Stimme, mich räuspernd und hüstelnd.Das muß ziemlich jämmerlich gewirkt haben.'
Wie bei der Vokabel möc liegt auch hier zwischen den agensorientiertenAlternanten Yarianz vor. Wir treffen auf eine ähnlich stark entwickeltePolyfunktionalität. In der Negation verhält sich das Modalauxiliar musieöikonisch; d. h. der Negator hat dasjenige Element in seinem Skopus, vor
Funktionswort da zu epistemischen Partikeln zusammengeschmolzen'. moidaund valjda. Im Tschechischen: tieba,'wahrscheinlich'.
747
dem es steht: nie musiist also immer zu verstehen als - 0 p (anders: po-winien). Unter bestimmten Bedingungen, vor allem bei musieö 2 ist auch
die interne Negation möglich:
(26) List musial nie doj§6.'Der Brief muß nicht angekommen sein.' ([J - p) (Beispiel
aus GRzEcoRCzYKowA 1973)
Die doppelte Negation ist falsch: *nie musi nie (- U - p)'
4.1.5 NALEZY,'man muß'
Struktur: nale|y p lVrnr* [NNo-> A]...1naleiy la Verpflichtung: 'MAN MUSS P AUFGRUND DESSEN, WASJEMAND WILL.'
(27) Kobieta wytworna wla§nie z powodu tej wytworno§ci zaslu-
guje na nasz4 wdzigczno§ö. Nale2y calowaÖ rqbek jej sukni,dlonie, czasem stopy... Ale usta?'Eine vornehme Frau verdient gerade aufgrund ihrer Vor-nehmheit unsere Dankbarkeit. Man muß den Saum ihres
Kleides küssen, die Hände, manchmal die Füße... aber denMund?'
naleiy lb Notwendigkeit: 'MAN MUSS P AUFGRUND VON ETWASINNERHALB ODER AUSSERHALB.'
(28) Nale2y w tym miejscu podkre§liö, 2e powy|sze uwagi dotycz4gldwnie jpzyka potocznego, albowiem w innych odmianachstylowych polszczyzty zrö2nicowanie form 'mgskich' i 'Len'skich' przedstawia si9 nieco inaczej.'Es muß betont werden, daß die bisherigen Ausführungenhauptsächlich die Umgangssprache betreffen; denn in ande-
ren Varietäten des Polnischen stellt sich die Unterscheidungvon'männlich' und'weiblich' etwas anders dar.'
Zwischen naleiy la und Ib herrscht Varianz einer Bedeutung, da diebetreffenden Komponenten gleichzeitig auftreten können, wie man be-
sonders an (27) sehen kann. Die Valenzstruktur ist durch die Blockie-rung der Stelle des ersten Aktanten des infinitivischen Verbs gekenn-
zeichnet. Dadurch tritt es zu dem semantisch teilsynonymen musieö ineine funktionale Opposition, wie sie auch bei moinavld möcyorliegt. ImGegensatz zu den anderen prototypischen Auxiliaren weist vor allemnaleiy la eine buchsprachliche Färbung auf (Ltcane (1997): "styl pod-
1
rt42
niosly, uroczysty"). Naleiy II mit der Struktur [N1rom] _ [N66+6sn] undder Bedeutung 'gehören' muß als Homonym angesehen werden. Diedeontische Bedeutung Ia taucht in dem verwandten Lexem naleiyry'schicklich' auf.
4.1.6 POWINIEN,'sollte'Struktur: X powinien p [Vlnr n]
powinien 1 schwache Verpflichtung: ,ES IST BESSER, WENN X pAUFGRUND DESSEN, WAS DER SPRECHER UND JEMAND WOLLEN.'
(29) U mnie zarabiaj1,ja im dajg zarobek, oni mnie powinni calo_wa6 po nogach, bo jak bym im nie dal roboty, to co?'Sie verdienen bei mir ihr Geld, ich gebe ihnen den Lohn, siesollten mir dafür die Füße küssen; denn wenn ich ihnenkeine Arbeit gäbe, was wäre dann?,
powinien 2 hohe Wahrscheinlichkeit: ,DER SPRECHER MUSS AN_NEHMEN, DASS X P.'
(30) Wyszedl o jedenastej, bawi ju2 blisko siedem godzin... powi_nien by ju2 do tego czasu powröciö.'Er ist um elf gegangen, er spielt schon fast sieben Stunden,er müßte bis jetzt schon zurücksein.,
Als Ausdruck der Fokalbedeutung'schwache verpflichtung, unterschei-det sich powinien I von mieö I/1 in der Modalitätsebene. während mieöI/1 generell die Artikulation des willens einer nicht näher festgelegtenPerson oder Institution versprachlicht, ist bei powinien 1 immer der Spre-cher involviert; d. h. er steht hinter der verpflichtung (vgl. v/rtss 19g7).Daher taucht in dem Explikationsteil für die Modalitätsebene nebenJEMAND auch DER SPRECHER auf. Das epistemische powinien 2 istnoch recht schwach entwickelt; denn es kann nur mit einer relativ klei-nen Anzahl von verben auftreten. Dies bedarf weiterer untersuchungen.In formaler Hinsicht fällt die vokabel dadurch auf, daß sie in der Fle-xion sowohl verbale als auch adjektivische Eigenschaften aufweist. wiein dem Kurzportrait von musieö angedeutet wurde, zeigt powinien einspezifisches Negationsverhalten. Auch wenn der Negator vorangestelltwird - nie powinien -, liegt innere Negation vor, d. h. nicht das Modalele-ment wird negiert, sondern die Handlung (in logischer Notation
[ - p). Daher kann man ein negiertes powinien im Deutschen durcheinen Ausdruck mit dem Primitivum KANN übersetzen:
(31) O tych sprawach opr6cz nas dwojga, nikt wiedzieö nie powi-nien.'Außer uns beiden darf keiner etwas von diesen Dingen wis-sgn.'
Das Polnische zeigt die Struktur I r p und das Deutsche das logischeAquivalent - 0 p.
durch
4.2 Periphere Modalauxiliare
Unter diese Bezeichnung fallen alle diejenigen Elemente, denen minde-stens eines der oben genannten Merkmale fehlt. Iü/ie oben erwähnt han-delt es sich bei der Polyfunktionalität um das wichtigste Merkmal derModalauxiliare. Insofern behnden sich die polyfunktionalen Vokabelnchcieö, trzeba lnd wypada in direkter Nachbarschaft zum Prototypen despolnischen Modalauxiliars. Von den weiteren Elementen seien nochpotrafiö,'können' und wolno,'man darf portraitiert.
4.2.1 CHCIEC,'wollen'Struktur: X chce p / leby p / Y-achcieö | Wollen [NNo- ] [Vr"f ] oder [Nrqo- ) lLe I Zeby + 51.BESEELTES X WILL P, ODER DASS JEMAND ANDERES P.'
(32) Przecie| to ty chcesz robiö ten film, Anderson.'Aber du bist es doch, der den Film machen will, Anderson!'
(33) Gdzie s4 moje listy (...) Oddaj mi je, nie chcg, 2eby sig po-niewiera§ i wpadly w czyje§ rgce.'Wo sind meine Briefe (...) Gib sie mir, ich will nicht, daß sieherumliegen und in fremde Hände geraten.'
chcieö 2 [Nno.r, ][Nc"n ] 'BESEELTES X WILL Y HABEN'.(34) Czy po to chciala§ tej rozmowy ze mnq,Zeby poinformowaö
mnie, 2e spgdzasz noce z lotnikami?'Wolltest du dieses Gespräch, um mir mitzuteilen, daß du dieNächte mit den Piloten verbringst?'
chcieö 3 [Nuo* ][Vnr] 'WIE MAN ERWARTET, WIRD X GLEICH P.'
f744
(11) Otworzyl usta, ale slowa nie chcialy mu przej§ö przez gardlo.'Er öffnete den Mund, aber die Worte wollten ihm nichtdurch die Kehle kommen.'
chcieö I und 2 zeigen in ihrer Explikation das Primitivum WILL. Durchdie aspektuell-temporale Bedeutung chcieö 3 zeigt sich die Vokabel alspolyfunktional in dem oben definierten Sinne. Dementgegen finden sichauch Eigenschaften, die Vollexemen zukommen. Hier ist zum einen dieSelektion eines Objektsatzes mit ieby zu nennen. Zum anderen ist das
Kriterium Verbalkomplex durch die Selektionsrestriktion BESEELT nichterfüllt. Ferner hat das Lexem chcieö 2 einen vollexikalischen Status. Mitder Expansion in das temporal-aspektuelle Feld geht die Selektionsre-striktion BESEELT verloren, so daß auch Gegenstände oder abstrakte
Entitäten (slowa nie chcialy) als erster Aktant erlaubt sind. Daß diese
Bedeutung nicht an die Personil-tzierung von Gegenständen gebunden ist,erkennt man an solchen Beispielen wie Chcialem upa§ö,'lch bin beinahegestürzt'. Andere Ausdrücke, die in ihrer Explikation WILL enthalten,expandieren nicht in dieser Art und Weise (*slowa nie zamierzaly mu
przej§ö...). Das Modalauxiliar chcieö ist nicht in dem Maße defektiv wie
z. B. musieö, denn es hat einen perfektiven Aspektpartner. Die Vokabelzechcieö verhält sich jedoch in mancher Hinsicht anders. So tritt sie häu-
fig in ausgesucht höflichen Aufforderungen aui(35) Jak pani na imig? - Anna! - Czy zechce pani möwi6 do mnie
po prostu Kamil?'Wie heißen Sie? - Anna! - Möchten Sie nicht einfach Kamilzu mir sagen?'
4.2.2 POTRAFIÖ,'können'
Struktur: X potrah p [NNom ] lVrnr ]
1. Fähiekeit: 'BESEELTES X KANN P AUFGRUND VON ETVTAS INx.'
(36) Armia z calq pewno6ci4 potrafi strzec bezpieczefstwa naro-
dowego i jest wystarczaj4ca silna, aby sig broniö.'Die Armee ist zweifellos in der Lage, die nationale Sicher-
heit zu wahren und verfügt über ausreichende Kräfte, umsich zu verteidigen.'
2. bewertete Fähigkeit: 'BESEELTES X KANN P AUFGRUND VONETWAS IN X, WOBEI X NORMALERWEISE NICHT.P.'
745
(37) Ten pies potrafi tanczyö.'Der Hund kann sogar tanzen.'
(38) Potrafil 2eni6 sig i rozwodziö sze§ö razy.
'Er hat es fertig gebracht, sich sechsmal zu verheiraten und
scheiden zu lassen.' (Beispiel aus tr-ezINsrl 1996)
Wie aus der Explikation hervorgeht, haben wir es mit einem Teilsyno-nym von möc zu tun. Beide Lexeme von potartö bewegen sich innerhalbder einen Fokalbedeutung Fähigkeit, Obwohl es obligatorisch und alleinig den Infinitiv selegiert, hat potrafiö für den ersten Aktanten die Se-
lektionsrestriktionen BESEELT. Im Gegensatz zu den anderen verbalen
Auxiliaren ist potraliö biaspektuell. Die Bedeutung von potrafiö 2 ist sehr
speziltsch und bezieht sich auf Handlungen, die gemessen an dem Welt-wissen über den normalen Gang der Ereignisse auffallen; denn "norma-lerweise" kann ein Hund nicht tanzen bzw. läßt man sich nicht sechsmal
scheiden.
4.2.3 TRZEBA
trzeba 1a [Vrnr*] / lLeby S I 'MAN / X MUSS P ODER ES IST BESSER,
WENN MAN / X P AUFGRUND VON ETWAS AUSSERHALB.'
(39) Wyrok zapadl, trzeba sig pogodziö z faktami.'Das Urteil ist gefällt, man muß sich mit den Fakten arran-gieren.'
trzebalb [Vrnr*] / lLeby S ] 'MAN i X MUSS P ODER ES IST BESSER,
WENN MAN / X P AUFGRUND DESSEN, WAS JEMAND WILL.'
(40) Nie spodziewalem sig, 2e zrobig aL tak1 przyjemno§Ö temupoczciwemu Wokulskiemu. Tak, trzeba zawsze podaö rgkg
nowym ludziom.'Ich habe nicht erwartet, daß ich diesem treuherzigen Wo-kulski eine so große Freude machen würde. Ja, man mußneuen Leuten immer die Hand reichen.'
trzeba 2 X-owi Y-a (Noot ) - [Nc".,] 'ES IST BESSER FÜR MENSCHLI-CHES X, WENN X Y HAT.'
(41) Trzeba mi pienigdzy.'Ich brauche Geld.'
Intuitiv ist trzeba teilweise mit musieö wd nale2y synonym. Nach Rvrnl(1982) und Lrcana (1991) unterscheidet sich trzeba jedoch in einem
1
r146
geringeren Grad der Verpflichtung; andererseits ist dieser Grad m. E.stärker als bei powinien und mieö. Dieses Oszillieren in der Stärke wird inder Explikation auf folgende Weise modelliert: Das Hauptprädikat ent-hält sowohl MUSS als auch ES IST BESSER, WENN und zwischen bei-den steht der Disjunktor ODER. Wie (39) und (40) bereits erkennenlassen, sind die Varianten 1a und lb nur sehr schwer voneinander zutrennen. Die Komponente 'ES IST BESSER, WENN'liefert hier die se-mantische Brücke zu der Bedeutung 'benötigen', die gewöhnlich alsnichtmodal angesehen und aus den Untersuchungen ausgeklammertwird. Nach der hier vorgeschlagenen Analyse entsteht die handlungsmo-dale Bedeutung durch die Besetzung einer ursprünglich substantivischenLeerstelle mit p: trzeba pienigdzy -> trzeba i§ö.
4.2.4 WOLNO,'man darfStruktur: X-owi wolno p (NO.J [Vrnr ]wolno I Erlaubnis: 'MAN / BESEELTES X KANN P AUFGRUND DES-SEN, WAS JEMAND WILL.'
(42) Nie wolno potgpiaö czlowieka za jego wrodzone kalectwo.'Man darf einen Menschen nicht wegen seiner angeborenenGebrechen verdammen.'
Die Explikation weist wolno als einen nichtpolyfunktionalen Ausdruck fürdie Erlaubnis aus. Im Gegensatz zu dem Prädikativum moina ist hier dieSetzung des Handlungsträgers im Dativ möglich. Die Besetzung dieserValenz hängt nicht nur von dem infinitivischen Verb ab; so hnden wirHinweise darauf, daß X der Restriktion BESEELT unterliegt; vgl. mit derdeontischen Variante von möc und dem deutschen Übersetzungsäquiva-lent dürfen:
(43) Rowery nie mog4 staö na korytarzu. vs. *Rowerom nie wolnostaö na korytarzu.'Fahrräder dürfen nicht im Flur stehen.'
aber:
(43a) Psom nie wolno przebywaö na korytarzu.'Hunde dürfen sich nicht im Flur aufhalten.'
Wie die oben angeführte Notation der Valenzstruktur angibt, sind nichtalle Kriterien für den Status eines Verbalkomplexes gegeben. lleben demModalauxiliar wolno I gibt es noch wolno II, 'frei' vfid wolno III, 'lang-sam', mit einer anderen Wortartenzugehörigkeit und einer nichtmodalen
147
Bedeutung. Unter den Modalauxiliaren befindet sich wolno I an der Peri-
pherie, da zusätzlich zur Selektionsrestriktion nur eine handlungsmodaleFokalbedeutung vorliegt. Außerdem ist der Zusammenhang zu wolno llenger als beispielsweise zwischen nale2y l,'man muß' und naleiy II, 'ge-
hören'.
4.2.5 WYPADA,'es ziemt sich / man muß'
wypada X-owi p / Leby p
wypada I/1 (Npa) [V61 ] oder lLe / ileby + Sl schwache Verpflichtung:.ES IST BESSER WENN X / MAN P AUFGRUND DESSEN, WASDER SPRECHER UND DIE I.EUTE FÜR GUT HALTEN.'
(14) Nie wypada opuszczaö go§ci. Nie wypada, 2eby gospodarzo-
puszczal go§ci.
'Es gehört sich für einen Gastgeber nicht, seine Gäste alleinezu lassen.'
wypada I/2 (Npa) [V1,,i ] 'MAN MUSS P AUFGRUND VON ETWASAUSSERHALB ODER INNERHAI,B.'
(44) Teorie spoleczne ks. S4ciegiennego zaliczyö wypada do socja-
lizmu utopijnego.'Die Gesellschaftstheorien des Priesters S4ciegienny mußman dem utopischen Sozialismus zurechnen.'
Die Explikation von wypada I/1 steht für eine Art 'Benimmregel' imSinne der deutschen Aquivalente es gehört sich (nicht) oder es ziemt sich
fuichA. In den Explikationsteil für die Modalitätsebene wurde statt demin anderen deontischen Bedeutungen verwendeten JEMAND die Kom-ponente DIE LEUTE eingesetzt. Wypada kann in Hinsicht auf Polyfunk-tionalität durchaus als Modalauxiliar klassiltziert werden; denn neben
der genannten Bedeutung kann es die dynamische Bedeutung Notwen-digkeit ausdrücken. Beide Bedeutungen ltnden ihren Reflex in unter-schiedlichen Valenzmustern. So läßt wypada I/2 keinen iebySatz zu. Indieser Polyfunktionalität unterscheidet sich die Vokabel von anderenVerben der 'Benimmregel' wie z. B. das seltene nie uchodzi. An den Bei-spielen erkennt man die recht starke stilistische Färbung des Auxiliars; es
gilt als leicht veraltet bzw. buchsprachlich. Vor allem im Wissenschafts-
stil erfüllt es wie auch naleiy die Funktion, den Handlungsträger auszu-
blenden: statt muszg zaliczyö kann man sagenwypada zaliczyö.
r148
4.2.6 Weitere Elemente
Über die dargestellten peripheren Modalauxiliare hinaus gibt es nochweitere Elemente, die sich im Umkreis des Kerns bewegen. Es handeltsich um Vokabeln, die nur eine handlungsmodale Fokalbedeutung ab-decken und auch in den anderen Parametern der Auxiliarisierung nochnicht sehr weit entwickelt sind. Aufgrund des begrenzten Umfangs desvorliegenden Aufsatzes werden sie nur kurz vorgestellt. Zu nennen wärenzunächst die buchsprachlich markierten Ausdrücke für eine negierteMöglichkeit nie sposöb wd niepodobna; beide sind auf die dynamischeEbene beschränkt und können einen Nebensatz mit ieby selegieren.
(45) Posilki traktowalem jak konieczn4 stratg czasu, kt6rej niepo-dobna wyeliminowaö.'Die Mahlzeiten habe ich immer als eine notwendige Zeitver-schwendung angesehen, die man nicht abschaffen kann.'
(46) Wiadomo, 2e [ci ludzie] znali kolo, kt6rego znaczenia dlatransportu nie da sig przeceniö. Nie spos6b jednak m6wi6 oci4glo§ci rozwoju od czasdw kultury luZyckiej.'Es ist bekannt, daß [diese Leute] das Rad kannten, dessenBedeutung für den Transport nicht zu hoch bewertet werdenkann. Man kann jedoch nicht von einer Entwicklungskontinuität seit der Lausitzer Kultur sprechen.'
In ähnlicher Weise stilistisch markiert sind eine R.eihe von unpersönli-chen Ausdrücken mit dem Primitivum ES IST BESSER, WENN. Es han-delt sich um die Ausdrücke der 'Benimmregeln' nie uchodzi, przystoi wdgodzi sig. Sie können durchweg als veraltet angesehen werden und spielenim modernen Polnisch nur eine untergeordnete Rolle.
(47) Niewinnej pannie w tych czasach nie uchodzi jechaö wedwöjkg z narzeczofiym.'Für ein unverheirates Fräulein ziemt es sich in solchen Zei-ten nicht, zu zweit mit dem Verlobten zu fahren.'
Als weiteres Element, das der Auxiliarisierung unterliegt, ist nie potrze-bowaö nt nennen. Dieses wie das deutsche brauchen auf negierte undeinige andere nichtfaktivische Kontexte beschränkte Element ist eineNeuerung des Polnischen, die sich erst langsam durchsetzt. Es handeltsich um den Ausdruck einer Unmöglichkeit; d. h. um einen Exponentender dynamischen Modalität.
t49
(48) No a co my§lisz, 2e szpieg nie potrzebuje spaö?
'Na was, denkst du, daß ein Spion nicht zu schlafenbraucht?'
Ein mit der Vokabel potrafiö verwandter Ausdruck der Fähigkeit liegt indem Verb umieö,'können' vor, das jedoch im Gegensatz zu ersterem einAkkusativobjekt regieren karrn (Umiem swoiq rolg, 'lch kann meineRolle'). Es geht um eine Fähigkeit, die auf bestimmten kognitiven Fä-
higkeiten basiert.In formaler Hinsicht teilweise auxiliarisiert ist das Yerb zamierzaö,
'beabsichtigen'. Zum einen selegiert es obligatorisch den Infinitiv undzum anderen weist es in zamierzyö einen Aspektpartner auf, der nur nochsehr beschränkt funktionstüchtig ist. Im Gegensatz zu chcieö kann es kei-
nen Nebensatz mit ieby selegieren. Nicht auxiliarisiert ist es dagegen insemantischer Hinsicht.
(49) Polski MSZ nie zamierza na razie protestowaÖ przeciwko wy-
daniu tej ksi42ki.'Das polnische Außenministerium beabsichtigt vorläufignicht, gegen die Veröffentlichung dieses Buch zu protestie-
ren.'
Zt guter Letzt sei das auf die dynamische Ebene beschränkte Yerb daö
sig erwähnt, das z. T. in ähnlicher Weise wie moina funktioniert; s. Bei-
spiel (46).
5. Fazit
Wie die bisherige polonistische Forschung gezeigt hat, besteht bei derBeschreibung der polnischen Modalauxiliare das Problem, wie der Um-fang der Klasse zu bestimmen ist. In der vorliegenden Arbeit wird eine
Herangehensweise entwickelt, die es erlaubt, einerseits eine Klasse vonModalauxiliaren zu etablieren und andererseits deren fließenden Über-gang zu vollexikalischen Einheiten zu erfassen. Wir erhalten eine starkausgefranste Kategorie, deren Zentrum durch ein Bündel semantischerund formaler Merkmale bestimmt ist. In einer bildlichen Darstellungkönnte dieser Sachverhalt folgendermaßen dargestellt werden: in derMitte befinden sich die prototypischen Vertreter, denen sich in unter-schiedlichem Abstand weitere periphere Auxiliare oder Semiauxiliare
150
nähern. Recht nah am Kem ist z. B.
ein prototypisches Auxiliar übergeht.
da6 sig nie sposöbniepodobna
potrafiö
bowaö :
przystoi
uchodzi
godzi si9
Die einzelnen Elemente befinden sich in verschiedenen Stadien der ineinem synchronen Schnitt aufgezeigten Auxiliarisierung. Da sich Modal-auxiliare auf einem Kontinuum zwischen Funktionswörtern und vollexi-kalischen Einheiten befinden, müssen bei der Erlässung der Semantikder betreffenden Einheiten m. E. auch die angrenzenden lexikalischenBedeutungen berücksichtigt werden. Diese sind in der Forschung bislangdurchweg ausgeklammert worden. Es ist davon auszugehen, daß dielexikalischen Bedeutungen wie z. B. 'benötigen' bei trzeba in der hand-lungsmodalen Semantik einen gewissen Reflex finden. Deshalb wurdenin den Portraits der einzelnen Auxiliare die Vokabeln jeweils ir ihrer Ge-
samtheit erfaßt. In dieser Perspektive wurde ein neuer explikationsba-sierter Beschreibungsapparat vorgestellt, der neben den abstrakten hand-
151
lungsmodalen auch angrenzende vollexikalische Bedeutungen berück-sichtigt. Die Explikationen setzen sich im Sinne der Konzeption Wierzbickas aus möglichst einfachen, allgemeinverständlichen Ausdrücken zu-
sammen. Eine solche explikationsbasierte Beschreibung hat zum einenden Vorzug, daß sie die Beziehungen zwischen Lexemen bzw. derensemantische Brücken offenzulegen vermag. Zum anderen erlaubt sie dieDifferenzierung recht nah beieinanderliegender Bedeutungen.
Literatur
Morfologia 1984: Gramatyka wspölczesnego igzyka polskiego. MorJb-logia. Warszawa
Skladnia 1984: Gramatyka wspölczesnego jgzyka polskiego. Skladnia.
WarszawaAPRESJAN, Ju. D. 1972: Definiowanie znaczert leksykalnych jako zagad-
nienie semantyki teoretycznej. In: A. Wierzbicka (red.) Semantyka islownik. Wroclaw, 39-59
APRESJAN, Ju. D. 1974: Leksiöeskaja Semantika. MoskvaAPRESJAN, Ju. D. 1994: O jazyke tolkovanij i semantiöeskich primitivach.
lr'. Imestija. RAN Serija Literatury i Jazyka 4, 27 -40BARTNICKA, B. 1982: Funkcje semantyczno-skladniowe bezokalicznika we
wspölczesnej Polszczyinie. WroclawBsNsSovÄ, E. l97t Syntax slovesnd modality. Klasifikace s6mantickfch
jednotek slovesnd modality. In: L Panevovä & E. Bene§ovä & P. Sgall(red.): Öas a modalita v öe§tinö. Praha, 97-143
BIERwISCH, M. 1990: Verb cluster formation as a morphological process.
In: G. Booij & J. Van Marle (eds.): Yearbook of Morphologt 3,773-199
BoNIECKA, B. 1976:. O pojgciu modalno§ci. hr: Jgzyk polski 56/2,99-110Bnzrzme, M. 1983: Prdba normatywnej oceny konstrukcji 'potrzebowaö
z bezokolicznikiem'. [n: Jgzyk polski LXIII, 284-300BvBEE, J. & PERKINS, R. & PAGLIUCA, W.: 1994 The evolution of gram-
mar. Tense, aspect, and madality in the languages of the world. ChicagoEncyklopedia wiedzy o jgzyku polskim. Wroclaw 1978
FISIAK, J. & LIpINSKA-Gnzr,coRsK, M. & ZesRocrI, T. (red.) 1978: AnIntroductory English - Polish Contrastive Grammar. Warszawa
die Vokabel trzeba, die langsam in
AG
AG
Ir52
GoossBNs, L. 7987: The auxiliarization of the English modals: Afunctional grammar view. In: M. Harris & P. Ramat (eds.): Historicaldevelopment of auxiliaries. Amsterdam/Phil., 1 1 1 - 143
GRocHowsKI, M. 1980: Pojgcie celu. Studia semdntyczne. WroclawGRzEGoRczYKowA, R. 1967: O konstrukcjach z bezokolicznikiem przy-
czasownikowym w jgzyku polskim. ln: Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Jgzykoznawczego 25, 123 -L32GRZEGoRCZYKowA, R. 1973: Czasowniki modalne jako wykladniki
röZnych postaw nadawcy. ln Otäzlgt Slovanskö Syntaxe III. Brno, 201-205
HANSEN, B. im Druck a: Die modalen Verbbegleiter des Polnischen unddie germanischen Modalverben zwischen Form- und Funktions-klasse. In: J. Schulze & E. Werner (Hrsg.): Linguistische Beiträge zurSlavistik aus Deutschland und Österreich. V. Jungslavistlnnen-Treffen.München
HANSEN, B. im Druck b: Modal'nye vspomagatel'nye slova v slavjanskichjazykach. In: N. A. Kozinceva & A. K. Ogloblin (red.): Tipologiia.
Grammatika. Semantika. (FS V. S. Chrakovskij) Sankt PeterburgHUNE, B" 1993: Auxiliaries. Cognitive forces and grammaticalization. New
YorkHoPPER, P. J. 1991: On some principles of Grammaticalization. In:
Traugott, E. & Heine, B. (eds.): Approaches to Grammaticalizationl-ll.Amsterdam/Phil., 17-35
JEDRZEJKo, E. 1987: Semantyka i skladnia polskich czasowniköw deon-
tycznych. WroclawKAKIETEK, P.1973 'Must' and its equivalents in Polish. ln'. Papers and
Studies in Contrastive Linguistia 1,77 -87KAKIETEK, P. 1976 Formal characteristics of the modal auxiliaries in
English and Polish. ln'. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 4,
205-216K,tTi.Iy, A. 1916: Zur kontrastiven Analyse der deutschen Modalverben.
ln'. Studia Germanica Posnaniensia 5, 91 -103K-A,TI.IY, A. t979: Die Exponenten der Modalität im Deutschen und Pol-
nischen. ln'. Studia Germanica Posnaniensia 7 , 6'l '7 5
KATI.[Y, A. 1980: Die Modalverben und Modaladverben im Deutschen und
Polnischen. Rzesz6wKArNv, A. 1987: Bibliographie zur Modalität. Modalausdrücke im Deußchen
und Polnischen. (KLAGE 14) Köln
153
KtNc, A. 1996: Root Modals in European Languages: A preliminary Typo-
log1t. Paper ALT workshop AntwerpenKRATZER, A. 1917 What'must'and'can'must and can mean. ln: Lan-
guage and Philosophy 1,337 -355KRatzER, A. 1978: Semantik der Rede. Kontexttheorie - Modalwörter -
Konditionalsälze. KönigsteinLASKowsKI, R. 1979: Polnische Grammatik. WarschauLIGARA, B. 1997: Polskie czasowniki modalne i ich francuskie elaoiwalenty
tlumaczeniowe. KraköwI-aztNsru, M. 1996: Bezokolicznik czasownika dokonanego jako czlon
wymagany w zdaniu. ln'. Poradnik Jgzykowy t996/1,27-29MEL'öuK, I. A. 1988: Semantic description of lexical units in an explana-
tory combinatorical dictionary: basic principles and heuristic criteria.7n'. International Journal of Lexicography l/3,165-188
OlszEwsKA-Micgerczyr, H. 1982: O u2yciu poseswenym czasownika'mieö'. In: H. Wröbel (red.): Studia i szkice o wspölczesnej polszczyinie.
Katowice, 94-108PISARKowA, K. 1972: Frdba okre§lenia posilkowo§ci predykatu w jgzyku
polskim. ln'. Konferencja Naukowa, System morfologiczny i syntaküczny
wspölczesnego j gzyka polskiego. Zaw oja, 91 -117PLANK, F. 1981: i\4odalitätsausdruck zwischen Autonomie und Auxiliari-
tät. In: I. Rosengren (Hrsg.): Sprache und Pragmatik. Lunder Sympo-
sium1980. Lund,57-71REHÄöpr, L. 1966 Sömantika a syntax; Infinitivu v souöasnöm polsköm
spisowäm jazyce. PrahaRYTEL, D. 1982: Leksykalne §rodki v,ryraiania modalno§ci w ipzyku czeskim i
polskim. WroclawSAPPoK, Ch. 1994: Modalität im Polnischen. In: H. Jachnow et alii
(Hrsg.): Modalitöt und Modus in den slavischen Spracher. Wiesbaden,298-323
Suoczn§sra, M. 199-l: The acquisition of Polish Modal Verbs. In: N.Dittmar & A. Reich (eds.): Modality in Language Acqußition. Berlin,14s-l7l
STEELE, S. 1978: The category AUX. In: Greenberg, J. (ed.): Universals ofHuman Language III. Stanford, 9-46
SzYueNsrI, M. 1990: Konstrukcje typu 'mie6' + infinitivus w jgzykupolskim, macedofskim i serbo-chorwackim. ln: Jgzykowe Studia Bal-kanistyczne II, 153-168
t54
TopouNsre, Z. L968: Miejsce konstrukcji z czasownikiem 'mieö' w pols-
kim systemie werbalnym. ln'. Slavia Orientalis XVIII, 427-431WEISs, D. 1987: Polsko-niemieckie paralele w zakresie czasownikdw
modalnych (na tle innych jpzykdw slowiariskich). In: G. Hentschel &G. Ineichen & A. Pohl (Hrsg.): Sprach- und Kulturkontakte im Pol-nischen (Festschrift für A. de Vincenz). München, 131-156
WEISS, D. 1993: Infinitif et datif en Polonais moderne - un couple mal-heureux? In: S. Karolak & T. Muryn (eds.): Complötude et incomplö-
tude dans les langues romanes et slaves. Kraköw, 443-487WEIss, D.: Semantyka konstrukcji 'mieö + bezokolicznik'. Pröba rozstrzy-
gnigcia polisemii. Ms. ZürichWIERZBICKA, A. 1971: Kocha, lubi, szanuie. Medytacje semantyczne. War'
szawa
WIERzBICKA, A. 1972: Semantic primitives. Frankfurt/M.WIERzBICKA, A. 1987: The semantics of modality. In: Folia Linguistica
2t/t,25-43WIERZBICK-{, A. 1996: Semantic Primitives. Primes and Universals. OxfordWoJTASIEwICZ, A. 1975: Sformalizowana semantyczna interpretacja cza-
sownik6w. ln'. Studia Semiotyczne Yl, 43-94WUNDERLICn, D. 1981: Modalverben im Diskurs und im System. In: I.
Rosengren (Hrsg.): Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1980.
Lund, 11-53ZABRocKI, T. 1978: Status syntaktyczny czasownikdw modalnych w
jpzyku angielskim i polskim. lnl. Biuletyn Polskiego Towarzysfiva lgzyko'znawczego 36,43-57
Gerd Hentschel, Oldenburg
Sekundäre Präpositionen, primäre Präpositionen, Kasus:przy pomocy, za pomocfu, z pomoc4 und ihre
funktionalen Aquivalente*
1. Einführung und Zielsetzung: Die polnischen Graphemsequenzen przypomocy und za pamacq (zl z pomocq s. u.) und ihre lautlichen Korrelatein der gesprochenen Sprache werden in der Regel im ganzen als Präposi-tionen klassifizieri. Dies geschieht, obwohl sie auch als gegliederte Fol-gen aus einer Präposition przy bzw. za und einer Flexionsform des Sub-
stantivs pamoc,'Hiife' gedeutet werden könnten. (Man spricht daher mit-unter auch von "präpositionalen Fügungen".) Der simple Grund, sie denPräpositionen zuzuschlagen, besteht darin, daß sie wie verschie<iene an-
dere solcher Sequenzen (2. B. na rzecz, na temat, w ciqgu, w stosunku, ze
strony, ...) in vielen Kontexten durch "unzerlegbare" Präpositionen ersetzt
werden können bzw. diese ersetzen können (vgl. auch KNmcnqINowe1963):
(1) Woino§ci nie moZna symulowaö. Nie moZna zagraö "Pie§niWolno§ci" przy pomocy instrumentu6.n przemocy. (Lec)'Freiheit kann man nicht simulieren. Das "Lied der Freiheit"kann man nicht mit Hilfe des Instruments der Gewalt spie-
1en.'
An die Stelle von przy pomocy plus Genitiv kann hier z. B. die "unzer-legbare" Präposition no plus Lokativ (instrumencie) treten, ohne daß dar-aus ein (nennenswerter, s. u.) Sinnunterschied resultieren würde. Einähnliches Substitutionsverhältnis besteht in anderen Kontexten zwischensekundären Präpositionen und "reinen" Kasus. Ygl. (2), wo an die Stellevon przy pomoq plus Nominalgruppe im Genitiv, NGc"n, der "reine" In-strumental, d. h. eine NG1n" melodami treten kann, wiederum ohne Sinn-unterschied:
Für eine kritische Lektüre früherer Versionen dieser Abhandlung bin ich M.Grochowski, Th. Menzel, A. Sander, Lj. Sariö und H. Bartels zu Dank verpflich-tet. Verbliebene Unzulänglichkeiten und Irrtümer liegen natürlich in meiner Ver-antwortung.
156
(2) Teraz - na razie przy pomocy metod6"n do6ö powolnych -bgdzie molna sporz4dziö mapg ludzkiego genomu, ludzkiejdziedziczno§ci, [...] (Tygodnik Powszechny)
'Jetzt - vorerst mit Hilfe relativ langsamer Methoden - kannman eine Landkarte des menschlichen Genoms, der mensch-
lichen Vererbung anfertigen.'
Angesichts der allgemein bekannten funktionalen Überlappung zwischen"reinen Kasus" und (primären) Präpositionen spricht auch dies für den
präpositionalen Charakter von przy pomocy und ähnlichen Sequenzen.
Kasus und Präpositionen werden in funktional orientierten Gramma-
tiken oft als "Relatoren" bezeichnet (2. B. PINKSTER 1988, 57). Motiviertist dies dadurch, daß beide bestimmte "Relationen" zwischen verschie-
denen NG in einem Satz (bzw. zwischen den mit ihnen korrelierendenReferenten) ausdrückenl . Dabei kann die jeweilige Relation zwischen
zwei gegebenen NG durch die Präposition und dem mit ihr einhergehen-
den Kasus allein zum Ausdruck gebracht werden, z. B. kolega z Torunia,
'ein Kollege aus Thorn' (also als Markierung des Attributs irn Rahmen
einer umfassenderen NG), oder - stark vereinfacht gesagt - im Zusam-
menspiel mit dem Prädikat, z. B. Piotr przyszedl z kolegq,'Piotr kam miteinem Kollegen' (a1so auf dem Satzniveau bei einem "Satzglied"). Rela-
tionen zwischen NG können natürlich auch durch andere, "eindeutig"lexikalische Elemente ausgedrückt werden, z. B. durch relationale Sub-
stantive wie pomoc,'Hilfe' oder droga, 'Weg' oder, wie gesagt, durch Ver-
ben in Funktion des Prädikats. Diese sind es dann auch, die den "R-oh-
stoff" für sekundäre Präpositionen wie eben puy pomocy, drogqbzw. engl-
during, dt. wöhrend, russ. blagodar"ta bilden.LgslrleNu (1986) reiht die sekundären Präpositionen in eine Skala
der Grammatikalisierung des Ausdrucks solcher Relationen ein (er
spricht hier von "case relations" i. w. S.):
Diese metasprachliche Verwendung des Ausdrucks "Relatol" darf also nicht miteiner solchen verwechselt werden, wie sie in der polnisch-polonistischen Diskus-
sion der Wortarten gegeben ist, vgl. WRÖBEL (1996).
151
relationales Substantiv mit Kasus- oderpräpositionaler Markierung
Sekundäre Adposition.fJIPrimäre AdpositionJJJagglutinatives KasussuflixJ,JT
(E) fusionales Kasussufltx
Diese Skala ist streng genommen ein Kontinuum. Sie könnte noch ver-
feinert werden dadurch, daß für die "Übergangsräume" jeweils eine Zahlvon Merkmaien (syntaktischer, semantischer, morphologischer Art) an-
genommen werden, um mit ihrer Hilfe zu parametrisieren, ob ein gege-
bener Ausdruck eher der tieferen oder der höheren Stufe zuzurechnenist. Auf den graduellen Übergang von einer "echten" NG zur sekundärenPräposition - also von (A) zu (B) - hat auf dem Hintergrund der Prager
Unterscheidung von zentralen und peripheren Ausdrucksmitteln (DANES
1966) schon BrupS (1974) verwiesen und Merkmale zur Parametrisie-rung dieses Übergangs vorgeschlagen2 . lZwischen (A) und (B) nimmt er
noch eine Klasse von "Halbpositionen" an.) PLANK (o. J.) versucht eine
Abstufung des kategorialen Raums zwischen (primären) Präpositionenund "agglutiniativem" sowie "fusionalem" Kasus, also des Bereichs von(C) über (D) bis (E)3.
Das Ziel dieses Beitrages ist, die Verwendung der drei im Titel ge-
nannten Sequenzen przy pomocy, za pomocq und z pomocq im modemen
Einen neueren Vorschlag zur Differenzierung von NG und sekundären Präposi-tionen hat BI^DUN-GRABAREK (1991) vorgelegt, allerdings ohne ein Konzept derAbstufung dieses Übergangs.
R,c.uu (2. B. 1993) versucht (abgesehen von Präpositionen in festen Wendungen)im Rahmen des generativen Ansatzes eine Unterscheidung von lexikalischen und"Kasuspräpositionen", wobei letztere jedoch in etwa den Stellenwert eines "lexi-cal case" (man beachte die terminologische Problematik zwischen "1 e x i c a Ipreposition" und "i e x i c a 1 case") im selben Ansatz hat. D. h., es handelt sichum lexikalisch-idiosynkratische Kasus- bzw. Präpositionszuweisungen durch Prä-
dikate an eines ihrer Argumente (also nicht um "structural case"). Aber auchhier werden somit zwei "Grammatikalisierungsgra«ie" von Präpositionen aner-
kannt.
(A)
(B)
(c)
(D)
158
Polnischen zu untersuchen. Die angesprochenen Kriterien, mit denenihre Einstufung im Kontinuum der Lehmannschen Grammmatikalisie-rungsskala vorgenommen werden kann, sind dabei insofern relevant, als
- wie sich zeigen wird - einzelne Verwendungen, d. h. einzelne Typen(Kontexte) der Verwendung dieser Sequenzen unterschiedlich zu bewer-ten sind. D. h., die diskutierten Sequenzen schwanken in einzelnen Kon-texten zwischen den Polen "primäre Präposition Qtrzy, z, za) plus autose-mantisches Substantiv", also (A) auf der Lehmannschen Skala, und se-
kundäre Präposition, (B)4.Weiterhin - und das ist das Hauptinteresse unserer Betrachtungen -
soll versucht werden, die FälIe, in denen diese potentiellen (sekundären)Präpositionen mit primären Präpositionen bzw. mit einem "reinen" Ka-sus konkurrieren, vor dem Hintergrund anderer Instanzen der variablenMarkierung von Nominalgruppen zu betrachten. Man denke an solchePhänomene wie die Variation zwischen Nominativ und Instrumentalbeim Prädikatsnomen (substantivischen Prädikat) im Russischen (HeNr-scHEL 1992) oder im Polnischen des 16./17. Jahrhunderts (HENTSCHEL
1993, 1994) oder auch an die Variation zwischen dem Dativ des Rezi-pienten und seiner präpositionalen Markierung bei Verben des Beschaf-
fens wie kupowaö / kupiö oder zalatwiaö / zalatwiö komu§ co§bzw. co§ dla
kogo§,'jemandem / für jemanden etwas kaufen / besorgen'. Sowohl bei
diesen Variationsphänomenen als auch bei denjenigen mit przy pomoq,
za pomocq und z pomoc4 sind zumindest in vielen Kontexten keine Sinn-unterschiede mit den Markierungskontrasten verbunden (vgl. auch dieBeispielsätze (1) und (2)).
2. Allgemeine Betrachtungen: In der polnischen Lexikographie werdenvon den drei zu untersuchenden Elementen in (i. w. S.) präpositionaler
Funktion nur przy pomocy und za pomocq berücksichtigt. SJP-DoR, SJP-
Szytvt und SPP notieren s. v. pomoc die "Phraseologismen" przy pomocy
kogo und za pomocq czego. Demgemäß müßte die Ergänzung (das interneArgument) von przy pomocy eine personale (ggf. auch animale, s. u.) NGsein, das von za pomocq eine unbelebte (bzw. impersonale) NG. (Spp fügtfijr za pomocq hinzu, es sei vorzuziehen, an seiner Stelle den reinen In-strumental zu verwenden, was - wie noch deutlich werden soll - in vie-
4 Dies könnte im Rahmen einer nicht holistischen, merkmalorientierten Wortar-tenkonzeption, ggf. bei Annahme prototypischer Zentren, eingehender beschrie-ben werden, was jedoch weiteren Untersuchungen vorbehalten bleibt.
159
len Kontexten völlig ausgeschlossen ist.) Im Swrp aus dem Jaht 1996werden beide in jeweils besonderen Einträgen als Präpositionen klassifi-ziert, wobei fij,r za pomocq ebenfalls von einer Restriktion auf unbelebte
NG ausgegangen wird. Fidrt przy pomocy hingegen wird festgestellt, es trete
sowohl mit personalen als auch - jedoch seltener - mit unbelebten NGauf. Ein z pomocq hingegen wird von keinem dieser Wörterbücher in prä-
positionaler Funktion beschrieben. Es wird lediglich in Kontexten vonVerben (insbesondere der Bewegung, i. w. S.) wie przyi§ö / po§pieszyö /zglosiö sig z pomocq,'zu Hilfe kommen, eilen' bzw. 'sich zu Hilfe melden'erwähnt. Wenn hier rechts (oder auch links) Yor, z pomocq eine NG imobliquen Kasus auftritt (was selten der Fall ist), so steht sie im Dativ undmuß als Argument einer komplexen prädikativen Einheit aufgefaßt wer-
den, die aus dem jeweiligen Verb und z pomocq besteht:
(3) Oczywi§cie byla to tylko mniejszo§ö, ktörej przeciwstawiÖ
trzeba niezliczonych Polak6w, usiluj4cych przyi§ö z pomocq
ludno§cip"s Zydowskiej [...] (Tyeodnik Powszechny)
'Natürlich war dies nur eine Minderheit, der man die unge-
zählten Polen gegenüberstellen muß, die sich bemühten, derjüdischen Bevölkerung zu Hilfe zu kommen.'
Verwendungen wie diese - allerdings in der Regel ohne die NGeul - über-wiegen die präpositionalen Verwendungen (also z pomocq plus NG6") an
der Zahls .
Zur Verwendung von przy pomoq), za pomocq und z pomoc4 ist allge-
mein folgendes festzustellen6: Wie die beiden ersten kann auch z pomocq
prinzipiell, d. h. zumindest in bestimmten Kontexten (s. u.), als sekun-
In einem Textkorpus von knapp 2 Millionen laufender Wortformen wurden 42
Vorkommen yon z pomocq ermittelt, davon 15 (potentiell, s. u.) präpositionale
rnd 27 Verwendungen in phraseologischer Verbindung mit den Verben der ge-
nannten Art.Diese Beobachtungen beziehen sich auf eine Analyse des oben genannten Kor-pus. Nur die Hälfte seines Umfangs, immerhin knapp 1 Million Wortformen,kann als repräsentative Materialgrundlage aus fiktionalen, joumalistischen undpopulärwissenschaftlichen Textfragmenten angesehen werden, in welcher eineeinzelne Quelle ggf. keine Verzemrng der quantitativen Verhältnisse bewirkenkann. Die andere Hälfte besteht weitgehend aus wissenschaftlichen Texten, imeinzelnen größeren Umfangs. Bei den quantitativen Feststellungen werden also
nur sehr deutliche Diskrepanzen berücksichtigt, und ansonsten wird gebührendvorsichtig formuliert.
160
däre Präpositionen angesehen werden. Im Vergleich zu den beiden ande-ren ist z pomocq allerdings relativ selten'. Alle drei können sowohl im-personale als auch personale Ergänzungen binden. Im Kontext von zapomocq sind personale Ergänzungen allerdings nur sehr schwach belegtund werden von gebildeten Informanten meist nicht akzeptiert; vgl. aber(5)8. Bel z pomocqund przy pomoqt haben unbelebte Ergänzungen jeweilsein mehr Qtrzy pomoqt) oder weniger (z pomocq) deutliches übergewicht.Es ist also keineswegs so, daß - wie die bisherige Forschung annimmt -przy pomocy nur oder häuhger mit personaler Ergänzung auftritte:
(4) Nie dowierzaj1c naturze, a raczej chc4c jakby wspomdc na-turg, postanowili zapewniö sobie ten stan lagodnosci przypomoq narkotykuuns"l najbardziej odpowiedniego dla tegostylu Zycia. (Hartwig)'Da man der Natur nicht vertraute, sondern ihr eher helfenwollte, beschloß man, sich diesen Zustand der Sanftheit mitHilfe des für diesen Lebensstil geeignetsten Rauschmittels zusichern.'
(5) [...] Fouch precyzyjnie kontrolowal Erg za pomocq swego agen-tan"., Duchateliera, znajduj4cego sig w sztabie "Georgesa".(Lysiak)'Fouch kontrollierte das Spiel präzise mit Hilfe seines Agen-ten Duchatelier, der sich im Stab von "Georges" befand.'
(6a) Prymitywiej4ca z roku na rok muzyka mlodzie2owa wlewa sigju2 nawet na lekcje z pomocq lomocz4cych walkmanöw,6"1.(Tygodnik Powszechny)
Den genannten 15 präpositionalen Verwendungen von z pomocq stehen ca. 150yon ptzy pomocy und 250 voi za pomocq gegenüber. Von diesen 250 stammen je-doch auffällig viele (mehr als 100) aus einer umfassenden Quelle (sprachwissen-schaftliche Literatur), so daß der quantitative Unterschied zwischen przy pomocyund za pomocq hier zu vemachlässigen ist.
Verschiedene polnische Informanten, die auf Grund der (nach bisheriger Lehr-meinung) ausgeschlossenen VerwendunEyon za pomocq bei einer NGr"o mit sol-chen Beispielen konfrontiert wurden, sprachen dieser Kombination eine Nuanceder Vergegenständlichung bzw. Entpersonifizierung zu.
Fijr przy pomocy wird angesichts seiner Beschreibungsgeschichte auf ein Beispielmit personaler Ergänzung verzichtet, fijrr za pomocq auf eins mit unbelebter. Für zpomocq wird jeweils ein Beispiel angegeben.
161
'Die von Jahr zu Jahr primitiver werdende Jugendmusik er-
gießt sich selbst in den Unterricht mit Hilfe dröhnenderWalkmen.'
(6b) 1.3 sierpnia wieczorem, znudzony pröLnq paplanin4 obec-
nych, przewröcil sig z pomocq pokojowego*r" na drugi bok, do
§ciany, po jakim6 czasie wydal ostatnie tchnienie. (Herling-Grudziriski)'Am 13. August abends, gelangweilt vom leeren Geschwätzder Anwesenden, drehte er sich mit Hilfe des Kammerdie-ners auf die andere Seite, zur Wand, und gab nach einigerZeit den Geist auf.'
Prinzipiell scheinen przy pomoq, za pomocq wd z pomocq in präpositio-
naler Verwendung synonym zu sein. Es sei dabei unterstrichen, daß wirvorerst in einem weiteren Sinne von "präpositionaler" Verwendung spre-
chen, im Einklang mit der Klassihkation von zumindest przy pomocy undza pomocq im Swrp. Im weiteren Verlauf der Darstellung werden wirfeststellen, daß sie nur in bestimmten Kontexten als (sekundäre) Präposi-tion anzuerkennen sind. Hier geht es vorerst nur um die Klärung derDistribution.
Abgesehen vom erwähnten selteneren Auftreten yon za pomocq mitbelebten Ergänzungen erlauben die untersuchten Materialien nur nochdie Feststellung, daß z pomocq offenbar am wenigsten charakteristisch fürden journalistischen und wissenschaftlichen Stil ist (die meisten Belegestammen aus der schönen Literatur), während przy pomoq) und nochdeutlicher zd pomocq besonders dort verbreitet sind. Im folgenden wirddavon abgesehen, zwischen den drei Elementen zu differenzierenl0.
Differenziert werden müssen dagegen ihre Verwendungen mit perso-
nalen Ergänzungen von solchen mit unbelebten. In 4. wird dargelegtwerden, daß der Status der drei Sequenzen unterschiedlich ist in Abhän-gigkeit davon, ob sie eine personale oder unbelebte Ergänzung binden.
10 Ebenso wird davon abgesehen, ihr Verhältnis zu anderen sekundären Präpositio-nen wie dzigki'd,ank' oder drogq'auf dem Wege' zu klären, die jeweils zumindestin gewissen Kontexten synonym verwendet werden können: Co kilka jednakmiesigcy przyjeidia do Warszawy dla zalatwienia "interesöw", zdoblwajqc pieniqdze napodröi drogq [przy pomoq] iebraniny. (Konwicki), 'Alle paar Monate kommt ernach Warschau zur Erledigung von "Geschäften", wobei er das Geld für dieReise durch [wörtlich: auf dem Wege von/mit Hilfe von] Bettelei auftreibt.' DieseFragen müssen späteren Untersuchungen überlassen werden.
162
Zu beachten ist dabei, daß es hier nicht um die "grammatische" Persona-lität geht (die sog. Beseeltheitskategorie), die wie die Belebtheit als Ge-nusphänomen in bestimmten slavischen Sprachen zu beobachten ist (vgl.LAsKowsKI 1988). Es geht um die Personalität (und Unbelebtheit) alssemantisches Merkmal, und als personale Substantive bzw. NG werdenim folgenden nicht nur Personenbezeichnungen (sowie ihre pronomina-len Vertreter) behandelt, sondern auch Bezeichnungen von Gruppen,Institutionen und Organisationen, die von Menschen gebildet werden,wie z. B. ambasada,'Botschaft', rzqd,'Piegierung', koiciö\,'Kirche' (* Ge-bäude), pulk,'P.egiment' u. ä. Im impersonalen Bereich sind es nur dieunbelebten Substantive, die als Ergänzungen der (potentiellen) sekundä-ren Präpositionen kommentiert werden. Über animale Substantive kön-nen auf der Basis des zur Verfügung stehenden Materials keine Aussagengemacht werdenll.
3. Kasus- bzw. Markierungsvariation: Wenn für e i n e gegebene NG imSatz (Satztyp) von einer Kasusvariation oder von einer Markierungsvaria-tion gesprochen werden kann, dann muß diese NG trotz der möglichenunterschiedlichen Markierungen noch als Einheit, d. h. struktureli undsemantisch in einem gewissen Sinne als "ein und dieselbe" NG angese-hen werden können. D. h., mit dieser Markierungsvariation darf wederein Unterschied in der syntaktischen Funktion (Subjekt, Objekt, Kcmple-ment, Adverbiale, Attribut) einhergehen, noch ein Unterschied in der se-
mantischen "Grobstruktur" von Sätzen, die in verschiedensten Beschrei-bungsansätzen mit semantischen Rollen (semantischen Funktionen, the-matischen Rollen etc.) wie Agens, Patiens, Rezipient, Instrument u. dgl.modelliert wird. Es wäre z. B. irreführend, wenn man für das Agens imRussischen von einer Kasusvariation sprechen würde, mit der Begrün-dung, daß es im Aktivsatz (in der Regel) im Nominativ auftritt und imPassivsatz (wenn überhaupt) im Instrumental. Genauso abwegig wäre es,von einer Variation zwischen Akkusativ und Präpositiv (Lokativ) zu spre-chen in Kurylowiczs bekanntem russ. Beispiel on prygaei na stolouu I nastolep,^r. Während beim Akkusativ von einer semantischen Funktion
11 Wahrscheinlich ist eine "Zwischenstellung" der animalen Substantive in demSinne, daß sich auf Grund des anthropozentrischen Zuschnitts verschiedenerStrukturen natürlicher Sprachen Bezeichnungen von "nahen" Tieren (2. B. Haus-tiere, die Namen tragen) wie personale Substantive verhalten, wohingegen solchefür "feme" Tiere den unbelebten ähneln.
163
Richtung gesprochen werden kann, geht es beim Präpositiv um die RolleOrtr2. Identität bezüglich syntaktischer und semantischer Funktion istalso die minimale Voraussetzung, um für eine NG von einer Markie-rungsvariation zu sprechen.
In semantischer Hinsicht wird der Begriff Kasusvariation (implizit) inder Regel noch enger gefaßt. Tritt z. B. beim direkten Objekt, beim Pa-tiens, der Akkusativ oder der sog" partitive Genitiv auf, so korreliert da-mit in den siavischen Sprachen durchgehend ein Sinnunterschied, der ineiner Artikelsprache wie dem Deutschen eben durch Artikel und gegebe-
nenfalls lexikalische Quantihkatoren wie e/was ausgedrückt wird, vgl.russ. Yypil öqjupu,tc"n / öaj6yy, 'Er trank etwas Tee. / Er trank den Tee aus'.Weder würde hier von einer Kasusvariation gesprochen noch in einemFall wie dt. Die Kinder spielen vor / hinter dem Haus von einer präpositio-nalen Variation.
Von Variation wird vielmehr dort gesprochen, wo mit dem Markie-rungsunterschied kein evid enter Sinnunterschied korreliert und/oderwo es zumindest bestimmte Kontexte gibt, in denen ein Sinnunterschiednicht oder kaum auszumachen ist. Ein Standardfall ist die Variation zwi-schen dem Nominativ und dem Instrumental beim substantivischenPrädikatsnomen im R.ussischen der Gegenwart. Ilier ist die wissenschaft-liche Meinung uneinheitlich: Während manche behaupten, mit dem Mar-kierungsgegensatz korreliere ein Sinnunterschied (grob: der Nominativkorreliere mit der konstanten Gültigkeit der durch das prädikative Sub-stantiv ausgedrückten Eigenschaft, der Instrumental mit der vorüberge-henden), bestreiten das andere (vgl. HENTSCuEL i. Dr.).
Wenn in diesem Beitrag die Verwendung der drei genannten (poten-tiellen) sekundären Präpositionen beleuchtet werden soll, so ist zunächstzu prüfen, ob und gebenenfalls in welchen Kontexten ein Sinnunter-schied zwischen ihrer Verwendung und der Ver"wendung konkurrierenderAusdrucksmittel, also der Verwendung bestimmter primärer Präpositio-nen und des "reinen" Kasus besteht.
Die Außerungen hierzu in der einschlägigen Literatur sind wider-sprüchlich, selbst bei einzelnen Autoren. Einerseits wird immer wiederhervorgehoben, die Motivation (Funktion, Aufgabe) für neue, sekundäre,
12 Damit korreliert ein unterschiedlicher Grad der Bindung an das prädikativeZentrum, dem z. B. im funktionalen Ansatz von DIK (1989) durch die Unter-scheidung von Prädikatssatellit (Richtung) und Prädikationssateltit (Ort) Rech-nung getragen wird.
t64
abgeleitete Präpositionen läge in einer Differenzierung und/oder Präzisie-
rung des Ausdrucks, in der Bereitstellung von semantisch bzw. kommu-nikativ differenzierteren, präziseren Präpositionen (2.B. BurrLER,KURKoWSKA, SATKIEWICZ I97I,354; BNNES I974, 44; BIADUN-GRABA-
REK 1991, 321). Das hieße, die sekundären Präpositionen wären seman-
tisch spezifischer als konkurrierende primäre Präpositionen bzw. Kasus.
Andererseits sind aber folgende Dinge zu beachten: Erstens wird vielfach
festgestellt, das Aufkommen sekundärer Präpositionen reihe sich ein indie allgemeine Entwicklungstendenz inrioeuropäischer Sprachen zum
Analytismus (BsNp§ 1914,44; KNncININowA 1963, 156). Da nun analy-
tische Sprachen allgemein wohl nicht als präziser im Ausdruck im Ver-gleich zu flektierenden angesehen werden können, mag ein erster Zweifelam "Präzisionspostulat" aufkommen. Weiterhin geht nach verbreiteter
Meinung mit der Entwicklung der sekundären Präpositionen, d. h. mitder Grammatikalisierung zunächst nicht präpositionaler Einheiten eine
Desemantisierung, ein Verlust an semantischer Spezifizierung einher(LEHMANN 1988; BurrlER, KuRKowsKA, SATKIEWIECZ 1971, 325f). Wiepaßt das rnit ihrem angeblich durch eine Tendenz zur semantischen
Differenzierung bedingten Aufkommen zusammen? Ist die "synchrone"
Verwendung und "diachrone" Ausweitung sekundärer Präpositionen
tatsächlich durch das Streben nach Präzision im Ausdruck motiviert?Und, wenn ja, inwieweit? Oder ergeben sich sekundäre Präpositionen auf-
grund semantischer Degeneration (Präzisionsverlust) innerhalb eines
durch eine "unsichtbare Hand" (im Sinne KeLLEns 1990) gesteuerten
Prozesses der Entwicklung zum Analytismus? Ist dies ein echter oder ein
Scheinwiderspruch? Und, gesetzt, letzteres sei der Fall, woraus kann ein
solcher resultieren?
4. Semantische Differenzierung oder Präzisierun! vs. Desemantisierung:
Als Alternativen (Varianten) zu den zu untersuchenden Präpositionen
steht in bestimmten Kontexten mit personalen Ergänzungen die komita-tive bzw. soziative primäre Präposition z plus NG1n. zur Verfügung:
(7) Ojciec Stroopa, Oberwachtmeiser Konrad Stroop, obslugiwal
kiedy§ ten sam teren przy pomocy tylko pigciu urzgdniköw.
(I-ysiak) loder: tylko z pigcioma urzgdnikaml
'stroops Vater [...] bediente einst dasselbe Gebiet mit (Hilfevon) nur fünf Beamten.'
165
Hier kann natürlich nicht von einer generellen Synonymie zwischen demkomitativen z und den drei hier diskutierten Sequenzen gesprochen wer-den. Eine Ersetzung von z pomocq durch z in (6b) gäbe dem Satz einenganz anderen Sinn. Aber es gibt eben Sätze wie (7), wo der prinzipiellesemantische Unterschied in den Hintergrund tritt. Dies soll in 4a. einge-hender diskutiert werden.
Im Kontext von unbelebten Ergänzungen liegen die Dinge offenbaranders: Wo immer eine Substitution der Sequenzen za pomocq, przy po-mocy, z pomocq plus NG6"n durch den reinen Instrumentall3 möglich ist,und das ist überaus häuhg der Fall, bleiben Unterschiede im Sinn offen-bar aus:
(8) [...] bylem §wiadkiem usilowari polania klombu 162 za pomocq
zbyt krötkiego szlaucha. (Bratny) foder: zbyt krötkim szlaucheml
'Ich war Zeuge von Bemühungen, das Rosenbeet mit Hilfeeines zu kurzen Schlauchs zu gießen.'
Dazu mehr in 4b.
4a. Das Verhältnis zum komitativen z plus Instrumental bei personalenNG: Wie bereits festgestellt wurde, ergäbe die Substitution der hier dis-kutierten Sequenzen durch das komitative z in Fällen wie (6b) einenganz anderen Sinn. Problematisch ist eine Ersetzung durch z plus In-strumental auch in folgenden Sätzen:
W nocy przy pomoq) szmuglerdw t? samA drog4 wrdcilemszczg§liwie do Jablonny. (Nowak-Jeziorariski)'In der Nacht kehrte ich mit Hilfe der Schmuggler glücklichnach Jablonna zurück.'
13 Dort, wo keine Substitution durch den reinen Instrumental möglich ist, liegenmitunter andere Ersetzungsmöglichkeiten vor: So kann z pomocq plus NGc"n in(6a) durch przez phts NG,qt ersetzt werden, oder (in umgekehrter Richtung) zplus NGc* in Czolo kolumny ostrzelano z karabinu maszyflowego (Rudnicki), 'DieSpitze der Abteilung wurde mit einem Maschinengewehr beschossen', durchz. B. przy pomocy plus NGc;"n. Auch hier ist wohl kaum von einem Sinnunter-schied zu sprechen. Linguisten, die in derartigen Kontexten in przez plus NG,libzw. z plus NGc", eine lokale Semantik sehen, müßten konsequenterweise wohlauch in der Markierung des agentiven Komplements in polnischen Passivsätzendtrch przez eine lokale, "improlative" Bedeutung sehen, ähnlich wie WIERZBIC-KA (1980, 49f0 dem Instrumental des agentiven Komplements im Russischennoch eine echte "instrumentale Bedeutung" zuspricht. Zur Problematik der Ab-grenzung lokaler und instrumentaler Präpositionen s. u.
(e)
166
(10) [...] udalo mu sig przy pomoq przedwojennego kumpla, star-szego du2o od niego kolejarza Romana Makiely, dostad dowydzialu personalnego dyrekcji Warszawa Wschodnia.(Nowak-Jezioraf ski)'Es gelang ihm mit Hilfe eines Kumpels aus der Vorkriegszeit- Roman Makula, der viel älter war als er - in die Personal-abteilung Warschau Ost zu kommen.'
Zwar kann in all diesen Sätzen von einem "Hauptagens" X (in Subjekt-funktion) und einem Koagens Z (die NG rechts von przy pomoq) / z po-mocq) atsgegangen werden" Während jedoch für X die im Prädikat aus-gedrückte Relation explizit asseriert wird ((6b) 'X hat sich auf die andereSeite gedreht', (9) 'X ist zurückgekehrt', (10) 'X ist in die Abteilung ge-
langt'), geschieht dies für Z durch die Verwendung von z pomocq / przypomocy nicht. Es ist offenbar unser Weltwissen von den korrelierendenSzenarien, das inferieren läßt, ob bei Verwendung dieser beiden Sequen-zen für Z dieselbe Relation gilt wie für X. Die bisher zitierten Beispielelassen sich diesbezüglich abstufen: In Satz (7) bedienen sowohl Stroop Xals auch die fünf Beamten Z das Gebiet; in Satz (9) ist es zumindestnicht ausgeschlossen, daß auch die Schmuggler Z gemeinsam mit demIch X nach Jablonna zurückgekehrt sind; in (10) ist es wenig wahrschein-lich, daß der Kumpel der Vorkriegszeit Z mit dem Referenten von X indie Personalabteilung gelangt ist (möglicherweise war Z schon vorherdrin); in (6b) dagegen ist es (nahezu) ausgeschlossen, daß sich der Die-ner Z gemeinsam mit dem Sterbenden X auf dern Lager umdrehte.
Die Verwendung von z hingegen hätte eine Lesart der Assertion der-selben Relation für Z bewirkt. Die (mutmaßlichen) sekundären Präposi-tionen und die primäre Präposition z stehen hier also prinzipiell in Oppo-sition. Verwendungen der erstgenannten dienen somit in diesen Kontex-ten zweifellos der semantischen Differenzierung gegenüber Verwendun-gen der letztgenannten, wobei diese Differenzen in Sätzen wie (7) jedoch
minimal sind (s. u.). D. h. aber auch, daß von einer semantischen Ent-leerung von z pomocq, przy pomocy hier keine Rede sein kann.
Dies wird auch durch folgende Beobachtung unterstützt - vgl. folgen-des in Anlehnung an (10) konstruiertes Minimalpaar:
(11) Dostal sig do wydzialu personalnego przy pomocy przedwo-jennego kumpla.'In die Personalabteilung kam er mit Hilfe eines Kumpels aus
der Vorkriegszeit.'
167
(12) Dostal si9 do wydziala personalnego za po§rednictwem przed-
wojennego kumpla.'In die Personalabteilung kam er durch Vermittlung einesKumpels aus der Vorkriegszeit.'
Wenn (12) wahr ist, dann ist notwendigerweise auch (11) wahr, abernicht umgekehrt: 'Wenn der eine den anderen vermittelt hat, so hat erdiesem auch geholfen. Seine Hilfe hätte aber auch in etwas anderem als
in der Vermittlung bestehen können, z. B. in Ratschlägen, wie man indiese Abteilung gelangt. Es geht also um eine einseitige Implikation: zapo§rednictwem ist nicht inkompatibel zu przy pomoq, sondern hyponym.(Ob das in allen Kontexten so ist, sei dahingestellt.) D. h., (11) schließtzwar den in (12) ausgedrückten Sachverhalt nicht aus, asseriert ihn abernicht. Die Sequenz za po§rednictwem ist also semantisch spezifischer,präziser als przy pomoqt.
Daß die Sequenzen mit pomoc bei personalen Ergänzungen nicht se-
mantisch leer sind, zeigt sich auch in passivischen Kontexten, wo ineinigen Fällen die Möglichkeit der Substitution durch die primäre Präpo-sition przez zu beachten ist:
(13) Przy pomoqt wywiadu angielskiego2 [Oy] wprowadzony zostalw kontakt z rezydentem wywiadu japo6skiego ...
(Nowak-Jezioraiski)'Mit Hilfe des englischen Geheimdienstes wurde er in Kon-takt mit dem Vertreter des japanischen Geheimdienstes ge-
bracht.'
(14) [...] proponowal realizacjg swego projektu w kolejnych eta-pach: - Wielkie polowy delfindw przez specjalnie do tegoprzystosowan4 flotg. - Umieszczenie zwierzqt w odpowied-nich basenach portowych I...1. - Forsowna tresura przy po-mocy wykw alihkowanych instruktordw2 martnarki. (tr-ysiak)
'Er schlug die Durchführung seines Projekts in aufeinander-folgenden Etappen vor: - Umfangreiche Fänge von Delphinen durch eine speziell dafür eingerichtete Flotte. - Unter-bringung der Tiere in entsprechenden Hafenbecken. - Inten-sive Dressur mit Hilfe von qualihzierten Instruktoren der Ma-rine.'
In (13) liegt eine kanonische Passivkonstruktion vor, in (14) ein Nomi-nalsatz mit dem Prädikat in der Form einer Nominalisierung, also eine
168
Konstruktion, die bekanntlich viele strukturelle Gemeinsamkeiten mitdem Passivsatzhat, wie z. B. die nominale Markierung des korrespondie-renden Agens durch przez plus Akkusativ. Wird in (13) und (14) przy po-moqt durch przez ersetztla, so wird Z explizit als alleiniges Agens prä-sentiert. Die Verwendung von przy pomocy in diesem passivischen Kon-text läßt offen, ob Z alleiniges Agens ist oder "Koagens" zu einem nichtexplizit erwähnten "primären" Agens. So könnte z. B. (I4) erweitert wer-den durch ein solches "primäres" Agens, das dann mit przez markiertwäre:
(15) Forsowna tresura przez tasze1o wspdlpracownika przy pomocywykwalifikowanych instruktoröw marynarki.'Intensive Dressur durch unseren Mitarbeiter bei Unterstüt-zung durch qualifizierte Instruktoren der Marine.'
Sätze wie (15), mit przez und przy pomoq), zeigen den prinzipiellen Ge-gensatz somit deutlich.
Zurück zu aktivischen Sätzen und zur Möglichkeit der Ersetzung vonprzy pomocy, z pomocq, (za pomocq) plus Genitiv durch z plus Instrumentalbei personalen Ergänzungen. Sätze wie (7), in denen eine solche Erset-zung ohne evidenten Sinnunterschied möglich ist, sind nicht selten, wieauch folgende Belege zeigen:
(16) [...] panx nasz doszedl do wladzy dzigki spiskowi, kiedy wroku 1916 z pomocq ambasady zachodnich l@*f dokonal za-machu stanu [...] (Kapu§ciriski)'Unser Herr kam dank einer Verschwörung an die Macht, alser im Jahre 1916 mit Hilfe westlicher Botschafter einenStaatsstreich durchführte.'
(I7) I jak to drugiego marca 1942 roku [O*] zorganizowal przypomocy dwdch harcerzyy wywieszenie ogromnego, polskiegosztandaru [...] (Nowak-Jeziorariski)'Und irgendwie organisierte er am 2. März 1942 mit Hilfezweier Pfadfinder die Hissung einer riesigen polnischen Stan-darte.'
14 In Fällen von (13) wäre dann eine initiale Position des agentiven KomplementsQtrzez wywiad angielski) eher ungewöhnlich. D. h., dann wäre eine andere lineareOrdnung naheliegend: I4 kontakt z rezydentem wyuiadu japoiskiego zostal wpro-wadzony przez wywiad angiebki.
169
(18) Ale przy mojejy pomocy, jakbym cig trzymal mocno pod rgkg,czy nie daloby sig jako§ i5ö? (Morton)'Aber mit meiner Hilfe, wenn ich dich fest an der Handhalte, würdest Du dann irgendwie gehen können?'
(19) Przy pomocy komisjiy kulturalnych [Or] koordynujq dzialal-no§ö kulturalno-o§wiatowa [...] (Boborowska)'Mit Hilfe der Kulturkommissionen koordinieren sie die KUFtur- und Bildungsaktivitäten.'
In allen vier Sätzen kann die Konstruktion 'mit Hilfe von Y' ersetzt wer-den durch die Konstruktion 'mit Y'. In drei Sätzen - auf Grund derunpersönlichen Konstruktion nicht in (18) - könnte auch die Konstruk-tion 'X und Y' verwendet werden. In keinem dieser Fälle würde sichdurch diese Substitution ein Sinnunterschied ergeben, wie es in denSätzen (6b) oder (10) der Fall wäre. Eine Art nuancenhafter Unterschiedzwischen den drei Konstruktionen besteht wohl in Konstellationen wie(7) bzw. (16) bis (19) in einem (aus der Sicht des Senders) unterschiedlichen Grad der Involvierung des Partizipanten Y: 'X mit Hilfe von Y' < 'Xmit Y' ( 'X und Y'1s . Dies sind jedoch Kontexte, in denen der prinzi-pielle semantische Unterschied neutralisiert ist. Diese Neutralisation istdabei abhängig von der lexikalischen Semantik des Kontextes (insbeson-
dere des jeweiligen Prädikats und Ergänzung, um deren Markierung es
geht) und von pragmatischen Sinnkomponenten wie dem Weltwissen- vgl. z. B. die Disskusion im Anschluß an die Beispiele (9) und (10).
Der prinzipielle semantische (i. e. S.) Unterschied zwischen den dreiim Zentrum der Diskussion stehenden Sequenzen und z plus Instrumen-tal besteht bei personalen NG darin, daß z prinzipiell das Moment derKomitativität enthält, die Sequenzen mit einer Form von pomoc dagegendas der Hilfe oder Unterstützung. D. h., die lexikalische Semantik desSubstantivs pomoc, das Bestandteil der drei zu untersuchenden Sequen-zen ist, ist hier noch vollständig relevant! Selbst in den neutralisierendenKontexten geht sie nicht verloren, sondern sie ist nur mit der Komitativi-tät von z kompatibel.
Wenn aber die lexikalische Semantik pomoc in den drei Sequenzen(zumindest bei personalen NG) noch voll zum Tragen kommt und somit
15 Zur Frage der unterschiedlichen Involvierung von Partizipanten bei komitativenKonstruktionen vgl. Sroz (1997).
t70
nicht von einer Desemantisierung gesprochen werden kann, so stellt sichdie Frage, ob wir hier, im Kontext personaler NG, überhaupt von einer(sekundären) Präposition sprechen sollten. Dies haben wir zwar bis hier-her getan, aber - wie gesagt - zunächst der Beschreibung in der neuerenLexikographie folgend. Wäre es nicht konsequenter, pomoc in diesempersonalen Kontext als selbständiges Satzglied (Adverbiale, freie Ergän-zung) anzusehen, das durch die primären Präpositionen przy, z, za mar-kiert werden kann und obligatorisch durch ein nominales Attribut imGenitiv bzw. durch ein diesem äquivalentes Possessivpronomen (s. u.) er-gänzt werden muß16 ? Daftir sprechen auch andere Fakten.
Erstens: Oft wird festgestellt, daß Sequenzen wie die hier diskutiertennicht im Ganzen als sekundäre Präpositionen gedeutet werden karn,wenn zwischen die primäre Präposition und das substantivische Element,aus welchen die Sequenz zusammengesetzt ist, ein Attribut tretenkannrT . Dies ist aber durchgehend möglich, wenn, wie gesagt, die betref-fende NG personal ist; vgl. Erweiterungenwie: przy troskliwej pomoqrodziny,'mit fürsorglicher Hilfe der Familie'; przy ostroinej pomocy
wywiadu angielskiego,'mit vorsichtiger Hilfe des englischen Geheimdien-stes', ze skrytq pomocq ambasad zachodnich, 'mit verdeckter Hilfe westli-cher Botschaften'. Wie üblich kommt die adjektivische Attribuierung ei-
ner semantischen Spezifizierung der Bedeutung des Substantivs gleichl8 .
Zweitens: Eine semantische Spezifizierung des substantivischen Be-
standteils von przy pomocy, za pomocq, z pomocq wiederum im Kontexteiner personalen NG) kann auch durch konjunktionelle Koordinationeines weiteren Substantivs erreicht werden:
16 Zur Obligatorik dieser Ergänzung s. u.
l7 Sicherlich müssen hier kongruierende attributive Elemente ausgenommen wer-den, die nichts anderes sind als Repräsentationen der jeweiligen Ergänzungen.Eine NG in der Form von Personalpronomen z. B. kann im Polnischen prinzipi-ell nicht im Genitiv dem lexikalischen Kopf nachgestellt werden; vgl. dom ojca,
'das Haus des Vaters', aber nicht'dom mnie, wörtlich: 'das Haus von mir', son-
dem möj dom,und insofem auch przy pomocy ojca, aber nichl*przy pomocy mnie,
sondem przy m o j e j pomocy.
18 Die Obligatorik einer NG im Genitiv als Ergänzung zu Fügungen wie den hierdiskutierten wird oft als Indiz für den präpositionalen Status angesehen. DiesesArgument ist nicht stichhaltig, wenn es sich wie in unserem Fall um Fügungenmit einem substantivischen Bestandteil verbalen Ursprungs handelt (ein substan-tiviertes Verb), und die Ergänzung nichts anderes ist als der Ausdruck des erstenArguments des zugrundeliegenden Verbs.
171,
(20) Instytucje z prehistorii PRL, takie jak KRN, PKWN i p62-
niejsze rzqdy,byly opraw4 lub oslon4 komunistycznego przej-
mowania wladzy, ktöre [...] nastgpowalo przy pomocy i wspöl-
dzialaniu Armii Czerwonej. (Tygodnik Powszechny)'Die Institutionen aus der Vorgeschichte der PRL, solche wiedie KRN und der PKWN und die späteren Regierungen, wa-
ren der Rahmen oder die Tarnung der kommunistischenMachtergreifung, welche mit Hilfe und Kooperation der Ro-
ten Armee erfolgte.'
Die primäre Präposition przy regiert hier also nicht nur den Kasus vonpomoc, sondern auch den "ton wspöldzialanie - jeweils den Lokativ. Diebeiden Substantive sind durch die Konjunktion i verbunden, sie verhal-ten sich also völlig wie "normale" NG, was noch dadurch verdeutlichtwird, daß sie beide attribuiert werden können: przy stalei pamoq i aky-nym wspöklzialaniu,'mit steter Hilfe und aktiver Kooperation'.
Zwischenfazit: Im Kontext einer personellen NG oder, besser gesagt,
bei Bezugnahme auf einen personalen Referenten (i. w. S.: Referent als
Token oder Type), der substantivisch Qtrzy pomocy ojca) oder pronomi-
nal-adjektivisch (przy mojej pomocy) ausgedrückt werden kann, habenwir es im Faile von przy pomoq), z pomocq und za pamocq nicht mit einersekundären Präposition, also nicht mit einer synsemantischen Einheit,sondern mit einer Kombination aus (natürlich autosemantischem) Sub'stantiv und substantivischem bzw. pronominalem Attribut zu tun. Inso-fern kann auch nicht von einer Markierungsvariation zwischen den Kon-struktionen mit primärer Präposition plus pomoc einerseits und denen mitder primären, komitativen Präposition z andererseits gesprochen werden.Dort, wo eine gegenseitige Ersetzung ohne nennenswerten Sinnunter-schied möglich ist, handelt es sich um punktuelle Paraphrasemöglichkei-ten, die auf einer vom Kontext abhängenden Kompabilität zwischen demMerkmal der Unterstützung aus pomoc und der Komitativität aus z ba-
siert.
4b. Das Verhältnis zum reinen Instrumental bei unbelebten NG: Andersstellen sich die Dinge in der Verwendung der Sequenzen za pomocq, przypomoq), z pomocq im Kontext unbelebter NG dar.(i): V/ie im Kontext von personalen NG (gegenüber z plus Instrumental)können przy pomocy, za pomocq, z pomocq im Kontext von unbelebten NGzwar längst nicht immer die hier relevante Altemative, den "reinen"
172
Instrumental ersetzen bzw. durch ihn ersetzt werden. Im Gegensatz zuKontexten mit personalen NG ist dies bei unbelebten jedoch nie dadurchblockiert, daß zwischen den drei zu untersuchenden Sequenzen einerseitsund dem "Konkurrenten", also hier dem reinen Instrumental, anderer-seits bzw. zwischen Sätzen mit der einen oder anderen Markierung einSinnunterschied vorliegen würde. Dort, wo eine Ersetzung möglich ist,zeigen sich die drei Sequenzen einerseits und der reine Instrumentalandererseits sozusagen prinzipiell als fakultative Varianten, was jedochkontextabhängige Präferenzen für das eine oder das andere nicht aus-schließt.
Die untersuchten drei Sequenzen und der reine Instrumental sind(dort, wo sie sich prinzipiell gegenseitig ersetzen können) also bei unbe-lebten NG semantisch bzw. "grammato-semantisch" äquivalent. Zu be-achten ist dabei, daß es hier nicht um den Instrumental im allgemeinengeht, sondern um eine der verschiedenen Funktionen des Instrumentals,die jedoch die zentrale, die namensgebende ist: um den sog. Instrumen-tal des Instrumentsl' . Di.r ist ein Terminus aus der traditionellen, vor-strukturalistischen Sprachbeschreibung. Auch wir wollen diesen Termi-nus verwenden, allerdings in einem etwas weiteren Sinne, als es die tradi-tionelle Grammatik oder auch WTERZBICKA (i980) in ihrer Untersu-chung zum Instrumental im Russischen tut. Der Terminus Instrumentbezieht sich in der vorliegenden Untersuchung auf die semantischeRolle, welche der NG in Sätzen zuzuschreiben ist, welche einen (spezifi-schen, unspezifischen oder generischen) Referenten auscirückt, der situa-tiv-ontologisch als Mittel für eine Handlung (i. w. S.) fungiert. Weiterhinliegen ein Agensx und typischerweise ein Patiensy vor. Die semantischeRolle Instrument2 muß dabei nicht durch den Instrumenta! signalisiertwerden. Es wurden bereits einige solcher Fälle angesprochen: Wrögyostrzeliwal miastoy z armatz,'Der Feind beschoß die Stadt mit (wörtlich:aus) Kanonen' - z plus Genitiv anstelle des Instrumentals; Dziewczynaygrala (partyturev) na wiolonczeliy, 'Das Mädchen spielte die Partitur aufeinem Violoncello' oder Kolega pisal tekst na komputerze,'Der Kollegeschrieb den Text auf dem Computer' - na plus Lokativ. Mitunter wirdhier in Frage gestellt, ob derartigen präpositional markierten NG die se-mantische Rolle Instrument zugeschrieben werden kann. Diese Zweifel
19 Zur Rolle der Polysemie (Polyfunktionalität) destion siehe Abschnitt 5.
173
scheinen berechtigt angesichts von Sätzen wie Z tych armat wrög ostrze-
liwal miasto pociskami dymnymi,'Mittels dieser / Aus diesen Kanonen be-
schoß der Feind die Stadt mit Rauchgranaten'. Es liegt nahe, der NG1n"
pociskami dymnymi die semantische Rolle Instrument zuzuerkennen.Wenn man dann aber dem seit FILLMoRE (1968) weithin akzeptiertenGrundsatz folgt, daß jede semantische Rolle (Fillmore: Tiefenkasus) nureinmal im Satz vorliegt, dann verbietet sich die Annahme der semanti-schen Rolle Instrument fiür z tych armat. Ftjr z tych armat könnte an eine
lokale semantische Rolle "Richtung - her" gedacht werden, was aber
dieselben Probleme aufwirft: Z tej söry wrög dwukrotnie ostrzelal miaslo zarmat,'Yon diesem Berg aus beschoß der Feind die Stadt zweimal mitKanonen'. Aus denselben Gründen wäre es problematisch, fi.J.r na kom-puterze,'auf / mit dem Computer' eine semantische Rolle Ort anzuneh-men: W' instytucie przepisal telcst na komputerze,'Im Institut schrieb er denText mit dem Computer ab'. Es scheint angemessen zu sein, von einemKontinuum zwischen lokaler und instrumentaler Konzeptualisierung vonan einem Sachverhalt beteiligten (i. w. S.) Objekten auszugehen2o . B"i-'Schießen' wäre der Ort, von dem aus geschossen wird, das lokale Ex-trem, die Geschosse, die ins Ziel treffen sollen, das instrumentale. DieWaffen, die zum Schießen verwendet werden, nähmen eine Positiondazwischen ein. Diese können dann entweder mit einem typisch lokalenMarker - im Polnischen Präpositionen - oder mit einem typisch instru-mentalen Marker - im Polnischen der Instrumental - markiert werden.Bemerkenswert ist, daß im Deutschen die komitativ-instrumentale Mar-kierung durch 'mit' für "Schußapparate" dann ausgeschlossen ist, wenndie Geschosse auch ausgedrückt werden: ... mit Rauchgranaten ... mittels /aus Kanonen, s. o. Wenn Gewehre oder Kanonen beim Schießen, Instru-mente bei der Musikerzeugung, Computer bei der Erstellung von Textennun weder als typischer Ort noch als typische Instrumente konzeptuali-siert werden, so besteht dennoch kein Zweifel, daß sie den letzteren nä-
her stehen. Dies belegen unter anderem die Seiektionseinschränkungenfür Prädikate wie verwenden oder benutzen: Er benutzte seinen Füller /seinen Ccmputer / *sein Zimmer, um den Brief zu schreiben oder Sie ver-wendeten Splittergranaten / groJJkalibrige Kanonen /?lden gegenüberliegenden
Berg zum BeschuJS der Stadt. (Man beachte, daß im Polnischen genau dort
20 Zur Vorstellung von Kontinua in Zusammenhang mit semantischen bzw. Kasus-rollen vsl. auch StoLz (1993,46ff-).
Instrumentals für die Distribu-
t74
die Verwendung von za pomocq, przy pomocy, z pomocq ausgeschlossenoder sehr zweifelhaft ist, wo in diesen deutschen Sätzen ein * oder ?
steht. Typizitätsgrade der Instrumentalität werden uns noch in Abschnitt5. beschäftigen.) Es scheint uns daher sinnvoll, die semantische RolleInstrument als (abstraktere) Metarolle anzusehen, an deren stelle ge-gebenenfalls zwei (konkretere) instrumentale Rollen treten: eine typischeund eine weniger typische2l .
In der semantischen Rolle Instrument treten nicht nur konkret-unbe-lebte Substantive auf, sondern auch Abstrakta: Sporzqdzili mapgy nowqmetodqT (vgl. Beispielsatz (1)), 'sie fertigten die Karte mit / nach einerneuen Metho de an'22. Auch hier gehen wir von einer semantischen Rolledes Instruments aus und sprechen bei verwendung des Instrumentalsvom "Instrumental des Instruments". (Wenn wir diesen Terminus eherim Sinne WIERZBIcKAs (i980 1f0, die sich hier auf typische (s. o.), kon-krete Instrumente beschränkt, verwenden, setzen wir das Kürzel (i. e. S.)hinzu.)
Prinzipiell sind also sowohl die Sequenzen przy pomocy, za pomocq, zpomocq als auch der reine Instrumental zur Markierung einer unbelebtenNG in der semantischen Rolle Instrument geeignet. Im Gegensatz zuKontexten mit personalen NG ist dabei nicht festzustellen, daß bei ver-wendung der drei potentiellen sekundären Präpositionen ein anderersinn als beim Instrumental erreicht wird, der auf die ursprüngliche lexi-kalische Semantik des Substantivs pomoc zurückgeführt werden kann.D.h., pomoc ist hier (mindestens) genauso weit desemantisiert bzw. ase-
Eine ähnliche Konstellation liegt bei den semantischen Rollen Benefizient undRezipient vor, die nur dann unterschieden werden müssen, wenn sie in einemKontext verschiedenen NG zugeschrieben werden können: Ich habe ihr ein Buchfür ihren Vater gegeben. Ist das nicht der Fall, so genügt die Annahme einer Meta-rolle, wie auch immer diese genannt wird lch habe ihr / fi)r sie eine Wohnung ge-sucht.
Mitunter kann es besonders - aber nicht nur - bei Abstrakta zu Abgrenzungs-schwierigkeiten gegenüber der semantischen Rolle der Art unri Weise kommen(vgl. WIERZBICKA (1980, 88) zum "Instrumental of manner,'). Würde anstellevon noh)y,'neu' in diesem, in Anlehnung an satz (2) konstruierten Beispiel einEpitheton wie do§ö powolny, 'ziemlich langsam' stehen, läge die Annahme derRolle Art und Weise nicht fem. Wie dem auch sei, auch dann kann przy pomocyetc. verwendet werden, wie gerade Satz (2) zeigt. Hier kann dieses Abgrenzungs-problem, das sich in ähnlicher Form prinzipiell für eine Reihe solcher semanti-schen Rollen stellt, also vernachlässigt werden.
175
mantisch wie der Instrumental (des Instruments). Dies steht im Einklangdamit, daß unbelebte NG nur sehr beschränkt als erste Argumente derkorrespondierenden Verben pomagaö / pomöc auftreten können. Möglichist dies im medizinischen Bereich für Medikamente u. ä.: Przy zazigbieniu
pomoie aspirina / gorqca kqpiel, 'Bei Erkältung hilft Aspirin / ein heißes
Bad' sowie Abstrakta" die das Handeln "echter Agens" zur Lösung von
Problernen ausdrücken, vgl. W takich przypadkach pomoie wylqcznie sta-nowcze postgpowaniq 'In solchen Fällen hilft nur entschlossenes Handeln'.Hier liegt eine metonymische Extension ('eine positive Wirkung haben')der prototypischen Kernbedeutung von 'helfen'vor, die mit einem perso-
nalen, "die Hilfeleistung kontrollierenden" Agens verbunden ist. Alserstes Argument der Verben in dieser metonymisch extendierten Bedeu-
tung ist nur ein Substantiv einer kleinen Klasse von Substantiven mög-
lich.Noch beschränkter sind die Möglichkeiten der Verwendung unbeleb-
ter NG als Genitivattribut zu pomoc. -
Pomo, aspiriny / gorqcej kqpieli przy
zazigbieniu polega na tym, 2e ..., 'Die Hilfe von Aspirin / eines heißen Ba-
des bei Erkältung basiert darauf, daß ...'. Die Desemantisierung zeigtsich auch darin, daß die Sequenzen aus primärer Präposition und pomoc
wie der Instrumental des Instruments neutral gegenüber dem Merkmalder Intentionalität der Handlung sind (vgl. WIERZBICKA L980,27):
(27) Wysadzil w powietrze siebie i Apolla przy pomocy "pig§ci pan-
cernej" wyrroluj4c przez pomylkg jej wybuch.23 lJgtkiewicz)'Er jagte sich und Apoll mit einer Panzerfaust in die Luft, als
er durch einen Fehler ihre Explosion auslöste.'
Im Gegensatz dant liegt bei personalen NG im Kontext der drei unter-suchten Sequenzen immer Intentionalität vor. Die Desemantisierung vonpomoc in przy pomocy, za pomocq, z pomocq im Kontext unbelebter NG istdeuilich. Dies alles weist darauf hin, daß hier die Entwicklung zur se-
kundären Präposition fortgeschritten ist.(ii) Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, daß bei Verwendung der dreizu untersuchenden Sequenzen mit unbelebten NG ausgeschlossen ist,daß ein adjektivisches Attribut z\ pomoc eingefügt wird, welches einesemantische Spezifizierung yon pomoc bervirken würde. Bei personalen
23 Da dieses Beispiel aus einer Übersetzung (von Bö11) stammt, wurden Informan-ten mit ähnlich konstruierten polnischen Beispielen konfrontiert, die nicht aufAblehnung stießen.
21
22
176
NG ist dies, wie gezeigt wurde, offenbar prinzipiell möglich, genauso wiees dort stets möglich ist, von solchen Sätzen eine Paraphrase mit denVerben pomagaö / pomöc und dem korrespondierenden Adverb zu bilden- vgl. folgende Sätze:
(22a) Przewodniczqcy ogromniemu pomagal w karierze.'Der Vorsitzende half ihm ernorm in seiner Karriere.'
(22b) Robil karierg przy ogromnej pomocy przewodnicz4cego.'Er machte Karriere bei vehementer Unterstützung durch denVorsitzenden.'
Unbelebte NG sind als erste Argumente zu diesen Verben, wie gesagt,nur sehr beschränkt möglich. Aber selbst da, wo dies der Fall ist, kanndas Adverb in diesem Kontext nicht in der Form des Adjektivs zwischenden (etymologisch) präpositionalen Bestandteil und den (etymologisch)substantivischen Bestandteil treten:
(22c) Nowa luneta ogromnie mi pomagala w tym czasie syste-matycznie obserwowaö zwyczaje towarzyskie goryli.'Das neue Fernrohr half mir in dieser Zeit gewaltig, die sozia-len Gepflogenheiten der Gorillas systematisch zu beobach-ten.'
(22d) W tym czasie systematycznie obserwowalem zwyczaje towa-rzyskie goryli przy (*ogromnej) pomocy nowej lunety.'In dieser Zeit beobachtete ich systematisch die sozialen Ge-pflogenheiten der Gorillas mit (*gewaltiger/starker/großer)Hilfe des neuen Fernrohrs.'
(iii) Satz (20) hat gezeigt, daß im Kontext von personalen NG an dasSubstantiv pomoc nach der primären Präposition przy ein weiteres Sub-stantiv treten kann, das dann denselben Kasus annimmt. Auch dies istim Kontext von unbelebten NG ausgeschlossen, z. B.:
(23) Istota tej propozycji sprowadzala sig do rozdzielenia maj4tkunarodowego pomigdzy oby,rrateli przy pomocyl*i u2yciul2a spe-cjalnych bonöw pryw aty zacy jnych. (Tygo dnik Powszechny)'Der Kern dieses Vorschlags war die Verteilung des nationa-len Vermögens unter den Bürgern mit Hilfe [*und Verwen-dungl spezieller Privatisierungsgutscheine.'
177
Fazit: Während im Kontext von personalen NG zwischen przy pomocy zpomocq und za pomocq einerseits und dem einschlägigen Konkurrenten zplus Instrumental (sowie im Kontext des Passivs a:uch przez plus Akku-sativ) andererseits von einer prinzipiell semantischen Opposition auszu-gehen ist (bei der Möglichkeit ihrer kontextbedingten Neutralisation), istdies im Kontext von unbelebten NG nicht der Fall. Hier sind die dreiuntersuchten Sequenzen desemantisiert bis auf die Funktion des Aus-drucks der semantischen Rolle des Instruments. Sie sind in dieser Hin-sicht "grammato-semantisch" äquivalent zu ihrer Alternative, dem reinenInstrumental des Instruments. (Dies heißt aber nicht, daß sie in allenKontexten gegenseitig ersetzbar sind, s. u.) Im Kontext von unbelebtenErgänzungen sprechen also mehrere Argumente dagegen, pomoc in dendrei diskutierten Sequenzen als autosemantisches Substantiv zu sehen:der hohe Grad der Desemantisierung, die Unmöglichkeit der Verbindungmit qualifizierenden adjektivischen Attributen und die Unmöglichkeitder koordinierenden Verbindung mit anderen Substantiven. Konsequen-terweise könnte gefolgert werden, daß pomoc hier keinen Satzgliedstatushat, sondem Teil einer bzw. dreier etymologisch komplexer Präpositio-nen przy pomoq, z pomocq, za pomocg ist, dessen etymologische Selbstän-digkeit noch transparent ist. Dem widerspricht jedoch offenbar folgendes:Ahnlich wie bei personalen Ergänzungen kann der Referent derselbendurch ein attributivisches Possessivpronomen (hier natürlich nur einanaphorisches, d. h. der dritten Person) ausgedrückt werden:
(24) Formantem jest sufiks (-ysz). Za jego pomocq tworzy sig wjgzyku rosyjskim derywaty odrzeczownikowe (Szczer-bowski)'Das Formans ist das Suffrx <-ysz>. Mit seiner Hilfe werdenim Russischen desubstantivische Derivate gebildet.'
(25) ... slowo (kurwa) moile wyralaö wszystko ... Czgsto .qcraila-
my przy jego pomoq zachwyt i podziw. (Mro2ek)'... das Wort <kurwa) kann alles ausdrücken ... Oft drückenwir mit seiner Hilfe Begeisterung und Bewunderung aus.'
Erstens stellen die diskutierten Sequenzen hier kein ideales morphologi-sches Wort dar (das Possessivpronomen tritt zwischen die beiden etymo-logischen Bestandteile), wie es sonst für Präpositionen üblich ist. Zwei-tens müßte, wenn nicht in pomoc ein Satzglied gesehen werden soll, ebendiesem anaphorischen Possessivpronomen der Status eines Satzgliedes24 Natürlich kann hier ui))ciu stehen, dann aber ohne pornoq.
178
zugesprochen werden. Abgesehen von elliptischen Konstruktionen (IhrenWagen hat er verkauft, seinen Aylur"n zu Schrott Sefahren) ist dies aber unüb-lich, und hier kann von einer Ellipse natürlich keine Rede sein. Die Se-quenz jego pomocy ist hier ebenso als NG aus attributivem Pronomen undSubstantiv zu sehen, wie in den Fällen, wo jego sich auf einen belebtenReferenten bezieht. (Daß in jego hier keine Form des anaphorischenPersonalpronomens zu sehen ist, zeigt sich natürlich auch im Fehlen des"n-Vorschlags", der sonst für Formen der Personalpronomen im Kontextvon Präpositionen obligatorisch ist.)
Wenn dies aber das einzige Moment ist, das die drei hier diskutiertenSequenzen im Kontext von unbelebten NG noch von "echten" (primä-ren) Präpositionen unterscheidet, so können sie doch als sekundäre Prä-positionen bezeichnet werden. Wäre ihr morphologisches und syntaktisches Verhalten vollends mit dem echter / primärer Präpositionen iden-tisch, so gäbe es synchron keinen Grund, sie als sekundäre zu bezeich-nen.
Die drei diskutierten Sequenzen werden somit im Kontext personalerNG einerseits und unbelebter NG andererseits unterschiedlich klassilrziert: Im erstgenannten ist pomoc eine übliche präpositional markierteNominalgruppe mit Satzgliedstatus, die NG im Genitiv das Attribut. (Ei-ne alternative Konstruktion ist die adjektivisch-attributivische mit Posses-
sivpronomen przy mojej pomoq) u. dgl.) Im letztgenannten, bei unbeleb-ten NG, haben die drei Sequenzen deutlich präpositionalen Charakter.Der etymologisch-substantivische Bestandteil pomoc hat die einschlägigensemantischen und syntaktischen Eigenschaften eines autosemantischenSubstantivs weitgehend eingebüßt. Liegt die Ergänzung in der Formeiner vollen Nominalphrase vor, so kann ihr der Status eines (präpositio-nal markierten) Satzglieds (und nicht der eines Attributs) zugeschriebenwerden. Einzig die in diesen Kontexten sehr seltenen Fälle wie in (24)und (25) laufen dieser Beschreibung zuwider, wodurch dokumentiertwird, daß der Übergang zur "echten", primären Präposition noch nichtabgeschlossen ist.
Daraus folgt weiterhin, daß wir es bei unbelebten NG in der Konkur-renz zwischen den drei Sequenzen und dem reinen Instrumental sehrwohl mit einer Instanz der Markierungsvariation zu tun haben. Der Restdieser Untersuchung wird eben dieser Variation gewidmet sein.
5. Konstanten der Markierungsvariation von Nominalgruppen: Am Bei-spiel von zwei Phänomenen der Kasusvariation im Russischen - Genitiv
179
oder Akkusativ der Negation beim direkten Objekt, Instrumental oderNominativ beim prädikativen Substantiv und Adjektiv - haben wir dreiPrinzipien der Distribution variierender Kasus herausgearbeitet (HENT-scHEL i. Dr.): (I) das Salienzprinzip, (II) das Isomorphismusprinzip, (III)das Prinzip zur Vermeidung "lokaler" Ambiguitäten. (Die beiden letztensind Untertypen einer Tendenz zur syntaktosemantischen Transparenz.)
(I) Das Salienzprinzip: Ausdrucksmittel wie Kasus und Präpositionenlassen sich in eine Hierarchie einordnen. Diese Hierarchie ist ähnlich wiein der Kasusklassifikation bei Kunvlowrcz (1949) und MEL'öuK (1986)syntagmatisch-syntaktisch bedingt. Sie orientiert sich an der Wahrschein-lichkeit, mehr oder weniger zentrale NG von Sätzen zu markieren. DieseZentralität wiederum kann gemessen werden an bekannten Hierarchiender semantischen Rollen Ägens > Patiens > Rezipient ) Instrument ... >
Ort > Zeit etc. bzw. syntaktischen Rollen Subjekt > direktes Objekt >
indirektes Objekt > Komplement (mit den bekannten Interdependenzenzwischen ihnen). So kann der Nominativ z. B. in dem Sinne als saliente-ster Kasus angesehen werden, daß er mit dem zentralsten (salientesten)semantischen und syntaktischen Rollen (Agens / Subjekt) korreliert, derInstrumental im selben Sinne als weniger salient (Korrelation mit In-strument / Komplement). Folgende Hierarchie der Ausdrucksmittel Ka-sus und Präposition (bzw. allgemeiner Adposition) läßt sich aufstellen:
(a) zentrale grammatische Kasus: z. B. Nominativ, Akkusatils(b) periphere grammatische Kasus: Genitiv, Dativ, Instrumental(c) sofern vorhanden, strikt semantische (adverbiale Kasus):
X-essive, X-lative, Komitativ u. ä.
(d) Präpositionen: (d1) primäre(d2) sekundäre
Innerhalb dieser Klassen sind weitere hierarchischen Abstufungen wahr-scheinlich - z. B. in (b) Genitiv ) andere. Unter den Präpositionen kön-nen primäre hierarchisch höher als sekundäre eingestuft werden, ohnedaß damit gesagt werden soll, daß zwei strikt diskrete Klassen vorliegen.Diese Hierarchie von (a) zu (d) korreliert weiterhin mit dem Grad ansemantischer Spezifizität, die in (a) am schwächsten, in (d2) am höchstenist. Prinzipiell ist diese Hierarchie, wie gesagt, syntagmatisch motiviert.
25 Wir beschränken uns hier auf Kasus vonchen.
sog. Nominativ- bzw. Akkusativspra-
180
Kommt es nun bei einer gegebenen NG in einem gegebenen syntag_matisch-syntaktischen Zusammenhang an einer bestimmten strukturellen(nicht linearen) Position zu einer variablen Markierung, so besagt dassog. salienzprinzip, daß auch hier wieder salienzkriterien bzw. -hierar-chien die Distribution der jeweiligen konkurrierenden Markierungenbestimmen, zwar nicht deterministisch, aber probabilistisch. Nur sind diedann relevanten Hierarchien nicht syntagmatischer Art (wie Agens >Patiens )... bzw. subjekt > direktes objekt...), sondern paradigmatisch.Für die erwähnten Kasusvariationen im Russischen sind insbesonderedie bekannten skalen der "Belebtheit", also personal ) animal > konkret-unbelebt > abstrakt sowie der Definitheit, also dehnit > indefinit, und derspezifität (Referentialität), spezifisch > unspezifisch (referentiell > nicht-referentiell) relevant. so steigt z. B. im Kontext der Negation die wahr-scheinlichkeit der verwendung des salienteren Akkusativs, ie höher diebetreffende NG des direkten objekts auf diesen skalen einzustufen ist.Der weniger saliente Genitiv (der Negation) korreliert statistisch mitniedrigen Werten der betreffenden NG auf diesen Skalen.
(II) unter Isomorphismus versteht man gemeinhin eine eineindeu-tige Relation zwischen "Elementen" der Ausdrucks- und Inhaitsebene(ein Ausdruck - ein Inhalt). Diese maximal transparente Konstellationwird bekanntlich durch verschiedene Asymmetrien gestört, die man inder Lexik als Polysemie bzw. Homonymie (ein Ausdruck - n Inhaite)und synonymie (n Ausdrücke - ein Inhalt) bezeichnet. wie sind nun diedrei sekundären Präpositionen einerseits und der reine Instrumentalandererseits an der Meßlatte des Isomorphismus, der maximalen Trans-parcnz zwischen Ausdrucks- und Inhaltsmittel zu bewerten? Beide"verfehlen" dieses Ideal schon aufgrund ihrer prinzipiellen (grammato-semantischen) Synonymie: Beide können, wie gesagt, prinzipiell die se-mantische Funktion Instrument signalisieren. Keine der beiden Markie-rungsvarianten ist also ein eineindeutiges signal. während jedoch diedrei diskutierten sekundären Präpositionen eindeutig diese semantischeRolle zum Ausdruck bringen (sie sind monosem oder, besser, monofunk-tional), ist der reine Instrumental mehrdeutig (polysem bzw. polyfunktio-nal). D. h., in der Perzeption (parsing) eines reinen Instrumentals kanner als Instrumental des Instruments erst durch eine Analyse der lexika-lischen semantik der jeweiligen NG und, in der Regel, des prädikats er-kannt werden. Die sekundären Präpositionen sind also, gemessen amIdeal des Isomorphismus, die transparenteren signale. (sie sind jedoch
181
nicht semantisch präziser als ihr "direkter" Konkurrent, der Instrumentaldes Instruments, was heißen soll, daß dort, wo sie vertauscht werdenkönnen, eine Präzisierung des Sinns erreicht wird.) Das in HEI.{TSCHEL(i. Dr.) formulierte Isomorphismusprinzip in der variablen Markierungvon NG besagt nun, daß die Verwendung einer transparenteren Mar-kierung umso wahrscheinlicher ist, je komplexer der strukturelle Kontextausfällt, in welchem die jeweilige NG eingebettet ist. Dies geschieht, um(antizipatorisch) den Aufwand der Dekodierung einer sprachlichenNachricht gering zu halten. Es geht also um Dekodierungsökonomie.
(III) Die Tendenz zur Vermeidung "lokaler" Ambiguitäten: Auchdiese Prinzip ist, wie gesagt, motiviert durch die Transparenz der Signali-sierung von Inhaltsstrukturen, durch Dekodierungsökonomie. Und den-noch ist es vom Isomorphismusprinzip prinzipiell unabhängig, denn eskann mit diesem in Konflikt geraten, vgl. HENTSCHEL (i. Dr.).
Gibt es Hinweise darauf, daß derartige Prinzipien auch eine Rolle fürdie Distribution der hier diskutierten sekundären Präpositionen gegen-über ihren Konkurrenten bzw. Alternativen spielen? Ohne hier eine ähn-lich detaillierte quantitativ-statistische Analyse wie in HeNTsCHEL (i. Dr.)vorlegen zu können, meinen wir, dies mit verschiedenen Beobachtungenbestätigen zu können.
(zu I) Vergleichen wir das quantitative Verhältnis zwischen Konkretaund Abstrakta für die Markierung durch eine der drei sekundären präpo-sitionen und für den "reinen" Instrumental, so sind die Abstrakta bei denerstgenannten deuilich stärker vertreten. Dies mag nun ein Nebeneffektder Materialgrundlage sein. Zwei der drei sekundären präpositionen- und zwar die beiden häuhgsten, przy pomoq, za pomocq - treten bevor-zugt in joumalistischen und wissenschaftlichen Texten auf, Daß Ab-strakta zumindest in letztgenannen wesentlich häufiger sind als in hktio-nalen, dürfte auf der Hand liegen.
Hineinspielen mögen jedoch auch folgende Zusammenhänge: Etwa100 zufällig ausgewählte sätze aus dem zugrundeliegenden Textkorpusmit einer der drei sekundären Präpositionen wurden muttersprachlichenInformanten26 vorgelegt mit der Aufgabe, die Substitution durch den"reinen" Instrumental als möglich, unsicher oder unmöglich zu bewer-ten. Dabei kristallisierte sich heraus, daß sowohl im Kontext von Konkre-ta als auch von Abstrakta - zunächst grob gesagt - typische Instrumenta-
26 Zwischen lünfund acht an der Zahl.
t82
lität die substitutionsmöglichkeit der drei sekundären präpositionendurch den reinen Instrumental fürdert, untypische dagegen ihr entgegen-wirkt. Der Grad der typischen Instrumentalität ist dabei primär eineFunktion der lexikalischen Bedeutung des Prädikats der NG mit der se-mantischen Rolle Instrument (s. u.). Hinzu kommt, in gewissen Kon-texten zumindest, die lexikalische Bedeutung des Patiens sowie gegebe-nenfalls der weitere szenarische Kontext. Typische instrumentale Kon-stellationen für Konkreta (26) und Abstrakta (27)27 sind z. B.:
(26a) [zostali oni] aresztowani i wywiezieni za to, 2e nie chcieli bu-dowaö urzqdzen "walu wschodniego,, nawet przy pomocyrydla. (Machejek)'Sie wurden verhaftet und verschleppt, weil sie selbst mitHilfe eines Spatens keine Anlagen des "Ostwalls,' bauen woll-ten.'
(26b) t...1 bylem §wiadkiem usilowai polania klombu röL za po-mocq zbyt krötkiego szlaucha. (Bratny)'Ich war Zeuge von Bemühungen, den Rosenstock mit Hilfeeines zu kurzen Schlauchs zu gießen.'
(26c) Surcouf zd4Lyl ich jednak wybiö za pomoc4 granatöw. (Lysiak)'Surcouf schaffte es jedoch, sie mit Hilfe von Granaten zuvertreiben.'
(27a) Czy on rzeczywi§cie sqdzi, 2e muszg go zwalczaö za pomocAtakich metodl (Tyrmand)'Denkt er denn wirklich, ich müsse ihn mit solchen Metho-den bekämpfen?'
(27b) Prototyp warto§ciowania jako aktu mowy mo2na przedstawiöprzy pomocy poniZszego schematu.. [...] (polonica XVIID
27 Die Aulteilung von "unbelebten substantiven" in nur zwei Klassen der Konkretaund Abstrakta ist nicht unproblematisch. Eine stärkere Differenzierung, wie siez. B. MusT^JoKI & HErNo (1991) im Zusammenhang mit der Variation zwi-schen Akkusativ und Genitiv beim direkten objekt in negierten russischen sät-zen verwenden, wäre vorzuziehen. Für die Zwecke der Darstellung ist die Zwe!teilung jedoch ausreichend, wobei Konkreta solche Substantive (bzw. Verwen-dungen von substantiven) sind, deren konkrete Referenten zur bestimmten Zeitan einem bestimmten Ort sein können. Insofem sind auch ,schema,und ,Wort,
in (27b / 27 c) als Abstrakta gewertet.
183
'Den Prototyp der Bewertung als Sprechakt kann man mitHilfe des untenstehenden Schemas illustrieren:'
(27c) [...] slowo (kurwa) moZe wyraLaö wszystko, zalelnie od into-nacji. Czgsto wyraiamy przy jego pomocy zachwyt i podziw.(Mro2ek)'Das Wort (kurwa) [wörtlich 'Nutte', äquivalent eher dem dt.Scheirßel kann alles ausdrücken, abhängig von der Betonung.Oft drücken wir mit seiner Hilfe Begeisterung und Bewunde-rung aus.'
Untypische instrumentale Konstellationen liegen dagegen in folgendenZitaten vor - Konkreta in (30), Abstrakta in (31):
(28a) To nic, 2e glupcy lqczq möj wzlot z talentem, kt6rego nie po-
siadam, lecz ktdrego uczg sig za pomoc4 startych do 2ywegociala paznokci. (Tyrmand)'Dummköpfe führen meinen Aufstieg auf Talent zurück. Dasbesitze ich jedoch nicht, sondem ich bringe es mir mit Hilfevon bis aufs Fleisch abgeriebenen Fingemägeln bei.'
(28b) Nie dostrzegalem nic niestosownego w piciu w6dki [...] z su-
tenerami |yiqcymi z lansowania zgvalconych uprzednio zapomocq alkoholu dziewczqt, [...] (Tyrmand)'Ich sah nichts Ungebührliches darin, Wodka mit Zuhälternzu trinken, die ihren Lebensunterhalt dadurch verdienten,zuvor mit Hilfe von Alkohol vergewaltigte Mädchen auf denStrich zu schicken.'
(28c) Istota tej propozycji sprowadzala sig do rozdzielenia maj4tkunarodowego pomigdzy obywateli przy pomocy specjalnychbonöw prywatyzacyjnych. (Tyeodnik Powszechny)'Der Kern dieses Vorschlags war die Verteilung des nationa-len Vermögens unter den Bürgern mit Hilfe spezieller Privati-sierungsgutscheine.'
Q9{ Zyli§my w dobrobycie, gdy wraz z MultiflorE otrzymali§myprzy pomocy krzyiowai wiele nieznanych odmian kwiatdw oröZnych magicznych zapachach. (Brzechwa)'Wir lebten im Wohlstand, nachdem wir zusammen mit derMultiflora mit Hilfe von Kreuzungen viele unbekannte Gat-
184
tungen von Blumen mit verschiedenen magischen Gerüchenentwickelt hatten.'
(29b) l,acina zna jednak dwa typy zdai podrzgdnych wsp6lczesnejpolszczyLnie nieznanych, ktörych nie da sig opisaö przy po-mocy akomodacji wzglgdem spöjnika, z tej prostej przyczytry,2e spdjnika one nie zawieraj4. (Polonica XVIII)'Das Latein kennt zwei Typen untergeordneter Sätze, die demmodernen Polnisch unbekannt sind. Diese lassen sich nichtmit Hilfe der Akkomodation gegenüber einer Konjunktionbeschreiben, aus dem einfachen Grund, daß sie keine Kon-junktion enthalten.'
(29c) Jest faktem, 2e "Rudy Karol" za pomoc4 charakteryzacji potra-fi wcielaö sig w najprzedziwniejsze postacie z mistrzostwemniezr6wnanym. (tr ysiak)
'Es ist eine Tatsache, daß "Rudy Karol" durch die Charakteri-sierung mit unvergleichlicher Meisterschaft die wunderlich-sten Gestalten annehmen konnte.'
Während in den Beispielen in (26) und (27) der Instrumental als Ersatzfür die Konstruktion mit der sekundären Präposition bereitwillig akzeytiert wurde, stieß er in (28) und (29) überwiegend auf Ablehnung.
Natürlich stellt sich die Frage, was Typizität überhaupt ist, bzw. wieman sie messen kann. Wenn man etwa wie PutNRu (1975) bei seinen"stereotypen" von konventionellen mentalen Bildärn ausgeht, dann las-
sen sich schon psycholinguistische Tests wie Messung der Reaktionszeitauf Stimuli, Zuordnungsaufgaben u. dgl. vorstellen. Dies kann hier nichtdiskutiert werden, zumal es für einzelne Prädikate (bzw. einzelnen Klas-sen von Prädikaten) in einer detaillierten semantischen Analyse unter Be-
rücksichtigung des Kontextes differenziert verfolgt werden müßte. DaßTypizitätseffekte bei der Markierung eine Rolle spielen, mögen folgendekonstruierte syntaktische Minimalpaare verdeutlichen, die Informantenzur Beurteilung vorgelegt wurden:
185
(30/31) Jadl zupg ...
'Er aß die Suppe ...
(3 1a)
(31b)
(32a)
(32b)
lyLkq.mit einem Löffel.'
'przy po..ro"y lyLki.mit Hilfe eines Löffels.'
... ?pokrywk4 po sloiku.
... mit einem Deckel eines Konservenglases.'
...przy pomocy pokrywki po sloiku.
... mit Hilfe eines Deckels eines Konservenglases'
(32/33) Udowodnila wing oskarZonego ...
'Sie bewies die Schuld des Angeklagten ...
... nowymi zeznaniami §wiadk6w.
... mit neuen Zeugenaussagen.'
...przy pomocy nowych zeznan Swiadköw.
... mit Hilfe neuer Zeugenaussagen.'
(33a) ... i.go kodem genetycznym.... mit seinem genetischen Code.'
(33b) ...przy pomocy jego kodu genetycznego.
... mit Hilfe seines genetischen Codes.'
Für Konkreta (30/31) wird der Instrumental in der typischen Konstella-tion des Essens der Suppe mit einem Löffel (30a) vorbehaltlos akzeptiert.Hier (in einem Kontext, der sich darüber hinaus durch einen minimalenGrad an Komplexität auszeichnet), wird die Konstruktion mit der sekun-dären Präposition dagegen (30b) als merkwürdig bewertet. In der untypi-schen Konstellation (3lalb), wo der Deckel eines Konservenglases denLöffel ersetzt, ist dies genau umgekehrt: Der Instrumental wird ais
merkwürdig empfunden, die Markierung durch die sekundäre Präpositionals normal. Bei Abstrakta ist dies genauso in der untypischen Konstella-tion (33alb). Ein genetischer Code eines Menschen ist zwar ein mögli-ches Beweisstück wie jedes andere Ding oder Phänomen auch, aber keintypisches. Eine Zeugenaussage ist dagegen ein Beweisstück per se. Wennbei Abstrakta im Gegensatz zl Konkreta in der typischen Konstellation
186
(32) nicht nur der Instrumental (32a), sondern auch die sekundäre prä-position (32b) als adäquat bewertet wird, so zeugt das nur davon, daßAbstrakta allgemein eher mit sekundären präpositionen markiert werdenals Konkreta.
(zu II) Eines der einschlägigen Kriterien der im Isomorphismusprin-zip angesprochenen syntaktisch-strukturellen Komplexität ist die wort-stellung bzw. satzgliedstellung. In Hr,NrscuEL (i. Dr.) haben wir gezeigt,daß - ceteris paribus - die Häufigkeit der verwendung des "transparen-teren" Kasus in markierten Satzgliedfolgen (die unmarkierte ist sorvohlfür sätze mit direktem objekt als auch ftir solche mit substantivischemPrädikat die sequenz s - v - X) signihkant zunimmt (vgl. auch HrNr-scHEL 1992).
Das erste, was in diesem Zusammenhang bei der Analyse der sekun-dären Präpositionen mit dem substantivischen Bestandtell pomoc auffällt,sind die überaus zahlreichen Beispiele, in denen sie in parenthetisch-medialer (34) oder "rechts-isolierter" Position (35) verwendet werden. (Inca. 200 Belegen mit den drei zu untersuchenden sequenzen traten mehrals zehn Prozent in solchen Kontexten auf, bei i00 zufällig ausgewähltenBelegen mit dem Instrumental des Instruments kein einziger.) vgl. ne-ben Satz (2):
(34a) W tym roku udalo sig memu bratu etrzy pomocy povrainegodaru) zalatwiö pozwolenie na wyw6z calej kotekcji do polski.(Tygodnik Powszechny)'In diesem Jahr gelang es meinem Bruder (durch ein be_trächtliches Präsent), die Erlaubnis für die Ausführung dergesamten Kollektion nach Polen zu erhalten.,
(34b) W tym wla§nie celu, przy pomocy odpowiednich zabiegöw i za_strzyköw, wyhodowali sobie trzeci4 szybkobie2n4 nogg.
(Brzechwa)'Genau mit diesem Ziel, mit Hilfe entsprechender Anweisun_gen und Injektionen, züchteten sie sich ein drittes ,.Schnell_
laufbein" an.'
(35a) Jak jednak wybrn4ö z owego ambitnego *wieku Kafk1,,? Zapo mocq I ab iryntu. (Herling-Grudziriski)'Wie sollte man aber jenem ehrgeizigen ,,Jahrhundert
Kaf_kas" entrinnen? Mit Hilfe eines Labvrinths.,
187
(35b) Musi pani strz4sn4ö z siebie Eorycz pora2ki - rzekl Hojda z
ujmuj4cym u§miechen. - Najlepiej za pomocq najprostszychrado§ci. (Tyrmand)'Sie müssen die Enttäuschung über die Niederlage von sichabschütteln - sagte Hojda mit einnehmendem Lächeln. - Ambesten mit Hilfe einfachster Freuden.'
Es ist dabei keineswegs so, daß der Instrumental anstelle der sekundärenPräposition völlig ausgeschlossen ist. In (34a/b) wurde er von den mei-sten Informanten akzeptiert, in (35alb) meist nicht, was aber eher mitdem oben besprochenen, hier geringeren Typizitätsgrad zu tun hat. Inparenthetischer bzw. isolierter Stellung wird die sekundäre Präposition"lediglich" sehr stark bevorzugt.
Eine weitere Beobachtung, die partietl mit der gerade beschriebenenzusammenhängt, betrifft die lineare Position einer NG mit der semanti-schen Rolle Instrument in Sätzen ohne parenthetische Elemente. Soferneine Markierung des Instruments durch den Instrumental erfolgt, sinddie rni1 Abstand häufigsten Muster offenbar NGN.* - V - (NGAkJ -NG1n. oder NGN.- - V - NG6" - NGap. Eine Stellung der NG1n" vor derVerbform oder gar vor eine NGno. ist sehr selten und nur möglich, wenndie N§,n, thematisch ist und besonders hervorgehoben werden soll. Diesliegt weitgehend daran, daß NG mit der Rolle Instrument typischerweiseindelrnit und rhematisch sind (vgl. GrvöN L984,422).In den Sätzen mitsekundärer Präposition ist nun auffällig, daß sie überaus häufig vor derVerbform oder gar vor dem Subjekt (bzw. dem ersten Argument in einemobliquen Kasus) stehen. In einer Menge von ca. 100 Beispielen (nurSätze mit f-rniten Prädikaten, ohne parenthetische bzw. rechtsisolierteVerwendungen) stand die durch eine der drei sekundären Präpositionenmarkierte NG in einem Fünftel der Beispiele vor der Verbform, dannmeist sogar vor dem Prädikat und sämtlichen Argumenten. Dabei mußdie NG keineswegs (i. e. S.) thematisch (alte Information) sein, wie fol-Eendes Beispiel zeigt:
(36) Odkrylem go [swöj nos], kiedy, korzystaj4c z nieobecno§cistarszych w domu, przy pomocy dwöch luster staralem si9stwierdziö i oceniö szanse mojej urody. (Mro2ek)'Ich entdeckte sie [meine Nase], als ich - die Abwesenheitder Alteren im Hause ausnutzend - mit Hilfe von zwei Spie-geln die Chancen meiner Reize festzustellen und zu bewertensuchte.'
188
In dieser linearen Position erinnern durch die drei sekundären Präpositionen markierte NG an freie Angaben (Adverbiale) des Orts oder derZeit, die relativ häufig in initialer Position auftreten, obwohl sie zweifel-Ios neue Information einbringen. Im Prager Ansatz der funktionalenSatzperspektive spricht man hier vom "situative setting of the action"und nennt diese NG situative thematische Elemente (vgl. z. B. FInses1964, 271). Auch eine ganze Reihe der parenthetischen Verwendungenzeigt Ahnlichkeiten mit Beispielen wie (36): Nach einer ersten, initialenfreien Angabe (des Orts oder der Zeit) folgt diejenige, welche mit einerder drei sekundären Präpositionen markiert ist, und zwar entweder beiexpliziter Kennzeichnung der Parenthese durch Kommata, Gedanken-striche oder Klammern oder auch ohne diese. Werden solche Sätze (hör-bar) gelesen, so zeigt sich ihr parenthetischer Charakter deutlich im Into-nationsverlauf, der sie vom vorangehenden und folgenden Kontext ab-
hebt.Aber auch wenn die instrumentale NG thematisch (i. e. S.) ist, also
lexikalisch oder pronominal Vorerwähntes aufnimmt, scheint die Markie-rung durch sekundäre Präpositionen derjenigen durch den reinen In-strumental vorgezogen zu werden. Dies zeigte sich in unserer Informan-tenbefragung beispielsweise für Satz (37a) und noch deutlicher für (37b),wo die instrumentale NG aus einem Pronomen besteht. (In Hundertenvon Pronominalformen des Instrumentals nim und niq konnte keine ein-zige ermittelt werden, die in initialer Position eine NG mit der semanti-schen Rolle Instrument ausdrückt.)
(37 a) Za pomocq przedstawionej wyiej grammatyki moLna eksplicyt-nie opisad pewne fakty jgzykowe [...] (Bobrowski)'Mit Hilfe der oben vorgestellten Grammatik kann man ex-plizit gewisse sprachliche Fakten beschreiben.'
(37b) Formantem jest sufiks <-ysz>. Za jego pomocq lworzy si9 w j9-
zyku rosyjskim deryT raty odrzeczownikowe. (Bobrowski)'Das Formans ist das Suffix <-ysz>. Mit seiner Hilfe werdenim Russischen desubstantivische Derivate gebildet.'
Markiertere lineare Positionen, d. h. eine parenthetische oder isolierte so-
wie eine dem Prädikat und den Argumenten vorangestellte Position, sindalso präferierte Verwendungsbereiche der diskutierten sekundären Präpo-sitionen. Was ihre Verwendung in markierten linearen (darunter paren-
thetisch-dislozierten) Konstellationen fördert, ist ihre Monosemie, d. h.
189
ihre im Vergleich zum polysemen reinen Instrumental bessere Positiongegenüber dem Isomorphismusprinzip.
(zu III) In einigen der ermittelten Belege der Verwendungen sekundä-
rer Präpositionen zur Markierung der semantischen Rolle Instrumenttreten in unmittelbarer Nachbarschaft andere NG im Instrumental auf.
Befragte Informanten negierten vielfach die Möelichkeit, hier die sekun-dären Präpositionen durch den reinen Instrumental zu ersetzen bzw.bezeichneten dies als fragwürdig oder zumindest unschön:
(38a) Zanudzilabym sig z tobq - ziewngla Teresa, wci4gaj4c halkiza pomocq szybkiego krgcenia taliq. (Tyrmand)'Mir würde mit dir langweilig werden - gähnte Teresa, wobeisie durch eine schnelle Drehung in der Taille die Unterröckeatzog.'
(38b) Klinika nie rozporzqdzala jeszcze skomplikowanymi aparatami,za pomoc4 ktörych moZno bylo wylqczyö chore serce z krwio-biegu. (Po§wiatowska)
'Die Klinik besaß noch keine komplizierten Apparate, mit de-
ren Hilfe man ein krankes Herz aus dem Blutkreislauf her-ausnehrnen konnte.'
Insbesondere in (38a) wurde ein zweiter Instrumental szybkim krgceniem
in Frage gestellt, in (38b) ein relativischer Anschluß mit ktörymi lediglichals unschön klassihziert. In anderen Kontexten ist in ähnlicher lexikali-scher Umgebung der Instrumental jedoch keineswegs ausgeschlossenbzw. auch nur störend:
(39a) Wci4gngla halkg szybkim ruchem.
'Sie zog den Unterrock mit einer schnellen Bewegung an.'28
(39b) Tymi aparatami mo2na wylqczyö chore serce z krwiobiegu.'Mit diesen Geräten kann man ein krankes Herz aus demBlutkreislauf nehmen.'
28 Hier, aber auch in (38a), erhebt sich die Frage, ob der betreffenden NG über-haupt die semantische Rolle Instrument zugeschrieben werden kann, ober ob es
nicht angebrachter wäre, von einer semantischen Rolle Art-und-Weise zu spre-chen. (Damit sei nicht gesagt, daß diese beiden Rollen scharf abzugrenzenwären.) Die Verwendung der drei hier diskutierten Sequenzen in diesem Bereichbleibt zu untersuchen.
190
In engerem Sinne kann in diesen Beispielen nicht von der Vermeidungvon Ambiguitäten gesprochen werden. Dennoch zeugen sie von einerTendenz, die doppelte Verwendung desselben Markers im gegebenen
Kontext zu vermeiden, besonders wenn die zwei betroffenen NG mit un-terschiedlichem syntakto-semantischen Status in unmittelbarer linearerNachbarschaft auftreten.
6. Schluß: Ziel dieses Beitrages war es, die Verwendung der drei Sequen-
zefl przy pomocy, za pomocq, z pomocq im modernen Polnischen zu unter-suchen. Als erstes Ergebnis konnte festgestellt werden, daß diese Se-
quenzen in Verbindung mit personalen NG nicht als Präpositionen bzw.
sekundäre Präpositionen beschrieben werden können. Die Komponentepomoc in diesen drei Sequenzen bei personalen NG funktioniert syntak-
tisch-strukturell wie ein "normales" Substantiv als lexikalischer Kopfeiner NG: Es kann kongruierende adjektivische Attribute binden Qtrzydzielnej pomocy,'mit tatkräftiger Hilfe', oder es kann mit einer koordinie-renden Konjunktion ein weiteres, kasuskongruentes Substantiv ange-
schlossen werden Qtrzy pomocy i wspöldzialaniu,'mit Hilfe und Koopera-tion'). Durch derartige Erweiterungen wird pomoc semantisch spezifiziert,was gleichzeitig heißt, daß es im Kontext personaler Ergänzungen nichtzu einer Desemantisierung von pomoc, 'I{ilfe' kommt. Pomoc ist hier als
autosemantisches Substantiv und nicht als (etymologisch-substantivi-
scher) Bestandteil eines synsemantischen, präpositionalen Markers zu be-
werten. Dieses Substantiv pomoc bzw. die gesamte NG hat Satzgliedsta-
tus und wird selbst durch die primären Präpositionet przy, z (sowie selten
za) und die jeweils korrelierenden Kasus markiert. Die gebundene Ergän-
zung ist als Attribut zu beschreiben: als kongruierendes, adjektivisch-pro-nominales Qtrzy mo je j pomocy,'mit meiner Hilfe') oder als substanti-visches im Genitiv Qtrzy pomocy m a t k i ,'mit Hilfe der Mutter').
In einigen spezifischen Kontexten kann anstelle der drei Sequenzen
die primäre Präposition z (in passivischen Kontexten przez) verwendetwerden, ohne evidenten Sinnunterschied. Dies sind jedoch kontextab-
hängige Neutralisationen, denn im Regelfall besteht zwischen den dreihier diskutierten Sequenzen und diesen Präpositionen eine semantische
Opposition, die auf der lexikalischen Bedeutung von pomoc,'Hilfe' (also
des lexikalischen Kopfs der jeweiligen Nominalgruppe) basiert.
Anders verhält es sich mit den drei Sequenzen irn Kontext :rnbelebter
NG. Eine prinzipielle semantische Opposition zur Aiternative des reinen
Instrumentals läßt sich nicht ermitteln. Auch verliert pomoc hier die
191
Fähigkeit, kongruierende adjektivische Attribute zu binden und mit an-
deren Substantiven durch Konjunktionen verbunden zu werden. EineKonstruktion wie 1? przy pomocy i uiyciu mlotka, 'mit Hilfe und [unter]Verwendung eines Hammers', wäre eine normverletzende Tautologie. Diedrei Sequenzen nehmen hier also deutlich präpositionalen Charakter an.Besteht ihre Ergänzung in einer vollen Nominalphrase, z. B. przy pomocy
mlotka,'mit Hilfe eines Hammers', so bidrßt pomoc seinen Status als Sub-stantiv und Satzglied vollständig ein. Satzgliedstatus hat vielmehr die Er-gänzung^ Einzig bei der hier seltenen Realisierung der Ergänzung durchein anaphorisches Possessivpronomen in attributivischer Position za jego
pomocy, 'mit seineru6"l Hilfe' bewahrt pomoc letzte Reste substantivischerStruktureigenschaften. Dies ist das Moment, welches die drei Sequenzen
im Kontext unbelebter Ergänzungen von echten / primären Präposi-tionen unterscheidet. Zurecht können sie hier als sekundäre Präpositionbeschrieben werden.
Die Distribution der drei Sequenzen in Konkurrenz zum funktionalprinzipiell äquivalenten Instrumental des Instruments ist dabei nichtzufällig. Grob gesagt korrelieren die sekundären Präpositionen mit se-
mantisch und / oder syntaktisch markierten Kontexten, der reine Instru-mental mit unmarkierten: (a) Abstrakta werden häufiger / eher durch diedrei sekundären Präpositionen markiert als Konkreta. (b) Untypische "In-strumentalitä|" korreliert statistisch mit der Verwendung der sekundärenPräpositionen, typische mit der Verwendung des reinen Instrumentals.(c) Markierte, d. h. parenthetische, rechtsdislozierte oder untypischeinitiale Positionen des "Instruments" korrelieren mit der Verwendungsekundärer Präpositionen, unmarkierte lineare Konstellationen mit derdes reinen Instrumentals. (d) Sekundäre Präpositionen werden vorgezo-gen, wenn ein anderer reiner Instrumental in unmittelbarer Nähe auftritt.
Natürlich ist die Verwendung sekundärer Präpositionen bzw. präposi-
tionaler Fügungen (i. w. S.) in einem gewissen Sinne auch vom Stil ab-
hängig. Insbesondere zeigt sich eine Abhängigkeit von funktional-stilisti-schen Faktoren. Außerordentlich häufig sind sie in wissenschaftlichenoder fachsprachlichen und, partiell zumindest, in journalistischen Tex-ten. Dies ist aber nichts anderes als ein Teilaspekt der allgemeinen Ten-denz dieser Textsorten zum sog. Nominalstil. Nominalgruppen im Satz,insbesondere solche, die vom "Kasusrahmen" des (verbalen) Prädikatsnicht gefordert werden, also freie Angaben, können als kondensierte Pro-
t92
positionen aufgefaßt werden2e . Dies ist für Phänomene der hier disku-tierten Art von Relst.e (1991) thematisiert worden. Sekundäre Präpositio-nen (2. B. za pomocq, z pomocq, przy pomocy bei unbelebten Ergänzungen)und auch präpositionale Fügungen, die noch nicht so stark "präpositiona-lisiert" sind (also z. B. auch dieselben Sequenzen im Kontext personaler
Ergänzungen), stellen eine der Strategien der Integration einer Proposi-
tion B in eine Proposition A dar. Für die hier diskutierten Sequenzen mitdem deverbalen pomoc sind dabei die Kontexte mit personaler Ergänzunggrundlegend: 'X machte Z';'Y half X' -> 'X machte Z mit Hilfe von Y'.Metaphorisch abgeleitet sind dagegen Verwendungen von pomoc mit un-belebten Ergänzungen: 'X machte Z'; 'X behalf sich dabei mit Y' -+ 'Xmachte Z rnit Hilfe von Y'. Konstruktionen mit sekundären Präpositio-nen bzw. präpositionalen Fügungen sind dabei graduell gesehen "integra-tiver" als z. B. die syntaktische Subordination von B in A durch einen
Nebensatz: 'X machte Z,wobei ihm Y half / wobei er sich mit Y behalf'.Dies erklärt auch die Seltenheit von sekundären Präpositionen in der All-tagssprache und ihre Häufigkeit in journalistischen und wissenschaftlichen Texten. In den letztgenannten geht es in der Regel um Vermittlungvon komplexen Sachverhalten auf knappem Raum, wobei häufig mehrals das sonst übliche "eine Stück an neuer Information" pro Satz über-mittelt wird.
Literatur
BsNrS, E. 1914: Präpositionswertige Präpositionalfügungen. In: Deutsche
Sprache der Gegenwart 34,32-52BtapuN-GneBAREK, H. 1991: Zur Bestimmung und Abgrenzung der
präpositionsartigen Präpositionalphrasen. In: E. Feldbusch, R. Poga-
rell, C. Weiß (Hg.): Neue Fragen der Linguistik. Akten des 25. Linguisti-schen Kolloquiums Paderborn 1990. Bd. l, 321-327
BurtLER, D., KunrowsKA, H., SATKIEwICZ, H. 1971: Kultura jgzyka
polskiego. Zagadnienia poprawno§ci gramatycznej. Warszawa
DANES, F. 1966: The relation of centre and periphery as a language uni-
versal. ln: Travaux linguistiques de Prague 2,9-21
29 Vgl. in diesem Zusammenhang die sog
(1e88).
t93
DIK, S. C. 1989: The theory of functional grammar. Part I: The structureof the clause. Dordrecht [: Functional Grammar Series 9]
FIlruonE, Ch. J. 1968: The case for case. In: E. Bach, R. T. Harms(eds.): Universals in linguistic theory. New York, 1-88
FIRBAS, J.7964: On defining the theme in functional sentence analysis.ln'. Travaux Linguistiques de Prague l, 267 -280
GIvöN, T. 1984: Syntax. A functional-lypological introduction. Vol. I. Am-sterdam
HENTSCHEL, G. t992: Zum Einfluß der Konstituentenfolge auf die Ka-suswahl im Russischer lrr: Lingua 87,231-255
HENrscHBr, G. 1993: Zur Kasusvariation des prädikativen Substantivs.Syntaktischer Wandel im Polnischen des 17. und 18. Jahrhunderts.In: G. Hentschel; R. Laskowski (eds.), 1993
HENTSCHEL, G. 1994: Rozszerzenie u2ywalno5ci narzgdnika orzeczniko-wego w polszczyLnie XVI i XVII w.ln: PolonicaXYl,lSl-192
HENTSCHEL, G. (i. Dr.): Konstanten der Kasusvariation. Zu,.n Wech-sel zwi-schen Nominativ und Instrumental sowie r,vischen Akkusativ und Genitivim Russischen.
HENTScHEL, G., LRsrowsKI, R. 1993: Studies in Polish inflectional mor-phology and syntax. Synchronic and diachronic problems. München
KELLER, R. 1990: Sprachwandel. TübingenKNIAGININowA, M. 1963: Struktury opisowe - znamienna cecha stylu
dziennikarskiego. In: Jgzyk Polski XLIII 3, 148-L57KuRYLowICz, L 1949: Le problöme du classement des cas. In: Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Jgzykoznawczego 9, 20 -43LASKowSKI, R. 1988: The systemic prerequisites of the development of
the declensional patterns of the Siavic languages (the category of gen-
der). In: Scando-Slavica 34, lLl-125LEHMANN, Ch. 1986: Grammaticalization and iinguistic typology. In:
General Linguistics 26/1, 3-22Msl'öur, I. 1986: Toward a definition of case, in: R. D. Brecht, J. S.
Levine, (ed.) Case in Slavic. Columbus, Ohio, 35-85MusTanozu, A. & H. HEINo l99l: Case selection for the direct object in
Russian negative clauses. Helsinki [: Slavica Helsingiensia 9]
PINKSTER, H. 1988: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen
"Textuelle Kasustheorie" von SteprtNov
t94
PLANK, F. o. J.: From cases to adpositions. In: N. Pantaleo (ed.)'. Aspects
of English diachronic Linguistics. Papers red at the Second National Con'
ference of History of English, Naples 28-29 April 1989. O. O. [: Biblio-teca della Ricerca. Cultura Straniera 481, 19-61
PurNalr, H. 1975: The meaning of "meaning". In: ders.: Mind, language
and reality. Philosophical papers, vol. IL Cambridge, 215-271RAIBLE, W. 1991: Junktion. Eine Dimension der Sprache und ihre Realisie-
rungsformen zwischen Aggregation und Integration. HeidelbergSlp-Don 1958-1969: Slownik jgzyka polskiego. (red.W. Doroszewski)
WarszawaSJr-SZYM 1978-1981: Slownik jgzyka poßkiego. (red. M. Szymczak)
WarszawaSpp 1973: Slownik poprawnej polszczyzny. (red. W. Doroszewski & H. Kur-
kowska) WarszawaSTEPANoV, Ju. S. 1988: Tekstovaja teorija russkich padeZej v opisatel'-
nom i sravnitel'no-istoriöeskom iazykoznanli. In: Ju. N. Karaulov(ed.): Rusrstlka segodnja. Moskva, 31-57
SToLZ, Th. 1993: Über Komitalive. Essen [= Arbeitspapier Nr. 24 des Fb
Sprach- und Literaturwissenschaften der GH Essenl
SroLZ, Th. 1997: Two comitatives or more? On the degree of involve-ment of participants. In: A. Gather & H. Werner (Hg.): Semiotische
Prozesse und natürliche Sprache. Festschrift fi)r Udo L. Fie4e zum 60. Ge-
burtstag. Stuttgart, 515-530
Swrp 1996: Slownik wspölczesnego iezyka polskiego. (red. B' Dunaj) War-
SZAWA
WIERZBICKA, A. 1980: The case for surface case. Ann ArborWnösrl, H. 1996 Nowa propozycja klasyhkacji syntaktycznej polskich
leksemöw. ln: Studia z leksykologii i gramatyki jpzyköw slowiaiskich'
Kraköw, 53-60
Krystyna Kallas, Torui
On Polish syntactic constructionswith the conjunctiorl ni*,'than'
1. Introduction
Constructions with the connectorl ni| are usually treated as a subclass ofcomparative constructions. In the present article I shall not be concernedwith any semantic issues (see Kerles 1996b), even though I will use theterms 'subjects of comparison' and 'comparative construction'. This isbecause comparative constructions, when dehned semantically, representa variety of syntactic patterns. Specifically, these constructions employsyntactically heterogeneous connectors, i. e. prepositions and conjunc-tions, as well as lexical markers of comparison. Most importantly, not allof these types of constructions include the comparative form, which re-sults in considerable differences in their syntactic structure. The aim ofthis paper is to describe the syntactic structure of those comparativeconstructions that do contain the connector ril. This connector typicallyco-occurs with the comparative form.
The connector ni2};,as two functions (cf. SzurRvCzyNsKA 1980,106-108). It can work either as a nominative-governing preposition, as in (1):
Zaanektowano kraing wigksz4 ni2 Wielka Brytania.'A country larger than GB was annexed.'
or as a conjunction, as in (2):
(2) Ufal dyplomacji bardziej niZ artylerii. (Herbert t993,124)'He believed in diplomacy more than in artillery.'
I have provided arguments for this distinction as well as an analysis ofthe prepositional constructions in my article "On constructions with the
The term "connector" was introduced by L^sKowsKI (1984, 31) to denote the"indicators of the syntactic relation holding between the components of an utter-ance". It comprises four functional classes of lexemes: coordinating conjunc-tions, prepositions, subordinating conjunctions and relative pronouns.
(1)
t96
preposition nii" (1995b). Accordingly, the present work deals exclusivelywith the constructions involving a conjunction2.
In a typical comparative construction, such as dyplomacji bardziejni| artylerii, there are four components3 :
the first subject of comparisot (dyplomacji'diplomacy') - symbol X,- the comparative form (bardziej'more') - symbol comp,
- the conjunction nii (or one of its variants, e. g. aniiel),- the second subject of comparison (artylerii - 'artillery') - symbol Y.
In my analysis I also take into account the head of the constructionin question. This can be the predicator, i. e. a finite verb form (e. g. ufal'[he] believed') in structuralist terminology (vf). The sequence of symbols"vf X comp ni| Y" represents sentence (2) above. It should be addedthat the first and the second subject of comparison are not distinguish-able on the basis of their linear order. Accordingly, the second memberis defined as the one introduced by the conjunction ni/: the sequenceconsisting of the comparative form and the second subject of comparison(the one introduced by nii) can precede the first subject, as in (2a):
(2a) Bardziej niZ artylerii ufal dyplomacjia
I shall not deal here with the types of constructions exemplified by the followingsentences: Poezja lepiej nii proza oddaje ulotno§ö chwili,'Poetry shows how quicklymoments pass better than prose', or Wyspa mniejsza nii Polska wladala Indiami'An island smaller than Poland ruled over India'. Such constructions include as
the first subject of comparison a grammatical subject, i. e. a Nominative nominalphrase that enters the mutual agreement relation with the finite verb form (see.
SALoNI & SwtozlNsxl 1985, 116-119 and 162-166). The status ofthe connector(is it a conjunction or a preposition?) requires further examination.
I take constructions comprising three components, e. g. Drzwi byly szersze ni2wyisze,'The door was wider than higher' to be non-typical as well: they involvetwo compärative forms which simultaneously constitute the subjects of compari-son. Some constructions with a form of the lexeme rnny,'different/other' also in-volve three components only, e. g. PRL to byla Polska, tyle ie inna nii obecna,
'Polish People's Republic was [also] a Poland, only a different one than the pres-
ent one'(GSwhr 7977,8). Here the form inna is an equivalent of the compara'tive form, and at the same time is the first subject of comparison. Yet anothertype of non-typical constructions are those constituted by a form of the Verbwoleö,'prefer', e. g. Woli kawg nii herbatg,'[s/hel prefers coffee to tea', where thecomparative form does not appear. Such sentences are the topic of my article"Unique syntactic properties of the Verb woleö" (1995a).
t97
There are also more complex constructions involving the conjunctionnii, for example:
(3) Holendrom przypadl udzial wigkszy ni2 Anglikom. (Dziew
1989, 203)'The Dutch got a bigger share than the English.'
In (3) the comparative form wiglcszy is subordinate to the r,our, udzial,
which is not a subject of comparison. The structure of the connstructionsof this type will also be discussed in this article.
The syntactic description of the constructions in question can be
based on several factors. First, one can perform a distributional analysis,
describing the grammatical properties of the head; this yields the divisionof the constructions into adverbal (especially: those headed by a hniteform, cf. sentence (2) above), adinfinitival and adparticipial:
(4) ... londyriski zlodziej m6gl wybraö ruczei nalychmiastow4§mierö ni2 powolne konanie za Oceanem. (Dziew 1981, 288)
'a London thief would choose immediate death rather thanslow agony over the Ocean.'
(5) Pracujqc czg§ciej noc4 ni2 w dzie6, Jan nabawil sig klopotöwz zasypianiem.'Working at night rnore often than during the day, Jan devel-
oped sleeping problems.'
There are also adnominal constructions, e. g. (6):
(6) Ma ono [szczg§cie] cechy raczej rado§ci ni2 zadowolenia.(Tatar 1990, 84)'It [happiness] has features ofjoy rather than satisfaction.'
and adjectival ones, e. g. (7):
(1) Brak zwi4zk6w osobistych..., bardziej na6wczas widoczny ni?dzisiaj, zainspirowal... (Tuchman 1992, 212-213)'Lack of personal ties .... more conspicuous at that time thantoday, inspired...'
In this article I shall only be concerned with the constructions thatare headed by a finite form; this position, subordinate to the head, can
4 The order of constituents in the constructions with the connector rlz as well as
the position of this connector are discussed in my article "On structural condi-tions of word order..." (1996a).
198
be filled either by all the components of a given comparative construc-tion, or only some of them.
Second, one could categorize the subjects of comparison into gram-matical classes, which would yield the following types: nominal, preposi-tional-nominal, numeral, prepositional-numeral, infinitival, participial-adverbial, adjectival, prepositional-adjectival, adverbial, and so on.
Third, one could provide a typology of phrases that are syntactic reali-sations of the subjects of comparison. Following the theory of SeroNI &§wl»ztNs«I (1985,209-215). I consider the following types of phrases:nominal and prepositional-nominal, infinitival, adjectivai and preposi-tional-adjectival, adverbial, and modifyings . In this article some referencewill be made to the second and third of the factors mentioned above.However, it is not my aim to provide a systematic or exhaustivedescription of the constructions involving the conjunction ni2, regardingeither homogeneity or heterogeneity of subjects of comparison, eventhough the issue deserves further investigation.
Fourth, one could categorize the comparative forms themselves. Theycan be adverbial, as in (8):
(8) Czp§ciej bywal w Warszawie ni2 w Krakowie.'He would go to Warsaw more often than to Cracow.'
or adjectival, as in (9):
(9) ZywnoSö w Polsce jest dro2sza niZ w Londynie.'Food is more expensive in Poland than in London.'
This difference is rather significant, because the syntactic position ofthese two comparative forms is different (although in sentences (8) and(9) both forms are headed by a finite form). I shall return to this pointlater on. Let me only add at this stage that the so-called 'analytical' com-parative forms, e. g. bardziej interesujqcy / interesujqco, 'more interesting /interestingly', mniej bolesny / bole§nie, 'less painful / painfully' are treatedhere as syntactic constructions; as a result, only adverbial forms exempli-fied by bardziej / mniej, 'more / less' are comparative forms. This ap-
5 In this article, I shall not discuss the constructions whose second subject ofcomparison is a clause, e. g. Postrzega siebie inaczej, nii jg ukazano.'She perceives
herself differently from the way she was presented'(see K,tLLas 1997), or a finiteform, e. g. W ostrym sloicu owoce raczej wyschly nii dojrzaly. 'In the heat of thesun the fruit became dry rather than ripe'. I exclude clauses from the presentdiscussion; such constructions should be dealt with separately.
199
proach considerably affects the classihcation of comparative construc-tions; I shall return to this issue in sect. 4 below.
I also consider wigcej, 'more' afld mniej, 'less' to be comparativeforms6 . Furthermore, I treat as equivalents of the comparative form vari-ous forms of the following lexemes: inny,'other / different'), inaczej, ('dif-ferently'), odwrotnie,'conversely', przeciwnie,'on the contrary', odmiennie,
'in a different way', as well as some uses of bodaj and raczej,'rather'? . Allof these display significant grammatical differences. Unfortunately, a clo-ser examination of this issue is beyond the scope of this article8 .
Our main task here is structuring the constructions in question. Thisinvolves establishing the distribution and hierarchy of the four compo-nents of the comparative construction mentioned above. The central role,I believe, is played by the comparative form itself; accordingly, one needsto determine the component to which this comparative form is subordi-nate, as well as the relationship between the comparative form and thesubjects of comparison. In particular, I want to describe the phenomenonof interphrasal relations between the comparative form and the subjectsof comparison (as in sentence (3)), as well as the phenomenon of hierar-chical distance between related constituents.
I will first characterise the sentences where the components of thecomparative construction are at the same syntactic level (sect. 2). Subse-quently, I will discuss sentences where the comparative form occupies a
different hierarchical position than the subjects of comparison (sect. 3
The lexemes wigcej and mniej have two functions: numeral or adverb. The nu-meral form (heading the Noun) appears in the following structure: ... z posiadania
imperium wynika wigcej klopotöw ni2 korzy§ci,'... having an empire brings moretrouble tnan profits' (Dziew 1989, 355); note that wigcej shortld be considered a
different type of lexeme than du2o or wiele, because numerals do not have the in-flectional form of degree. An example of the adverb form (having no relation tothe noun) is'. ... zostalo po tym imperium ... znacznie wigcej nii po upadku innychimperiöw w hßtorii,'... much more remained after the fall of this empire than afterthe fall of others in history' @ziew 1989, 463). Some peculiar properties ofthese uses will surface in the course of the present analysis, but they will not bedescribed in any detail here. I exclude uses such as: wigcej nii ladna,'more thanpretty', or tnvdlo to dluiej nii rok, 'this lasted longer than a year', i. e. those inwhich the first subject of comparison is missing.
A different way of segmenting the text can be found in GRocHowsKI (1988),where a two-component conjunction is singled out, namely: raczej ..., nii.Cf. the list of constituents that are obligatorily implied by nü, compiled byLoJASrEwrcz (1992, 702).
200
and 4). These will include the sentences where the comparative form isin the relation of subordination either with both subjects of comparison(as their head) or only with the first subject, as its modifier (sect. 3), as
well as sentences (e. g. sentence (3) above) whose comparative form issubordinate to a constituent which is not a subject of comparison (sect.
4). I shall also devote some attention to the government relation holdingbetween the comparative form and the conjunction, and to the issue ofsyntactic implication within the comparative construction (sect. 5).
The structural analysis presented below belongs to the descriptive tra-
dition exemplified in the volume Syntax of Modern Poäslt by SeLo-
NI & SwIDZINSKI (1985). Their work is the source of my conceptualapparatus (to some extent) and my descriptive notation. However, theirsystem is not sufhcient for the present purposes. Saloni & Swidziriskirepresent the structure of constructions in the form of immediateconstituent trees (IC trees), which do not reflect head - complementrelations among constituents. Instead, I shall use dependency graphs as
the main tool for representing these relations. (Such graphs are not a
kind of 'trees').eMy use of graphs of dependency is only tentative at this stage. Never-
theless, the present approach seems to well illustrate the intuitions con-
cerning the dependencies that hold among components of the compara-
tive construction.
2. Equivalence of qomponents of the comparative construction
As it was already mentioned in the Introduction, only constructionsheaded by a finite form will be analyzed here. In this section I shall lookat the comparative constructions whose components are at the same levelof the syntactic hierarchy and thus have a common head, i. e. the finiteform.
9 The differences between these two types of structuring are discusseci by WEINS-
BERc (1983, 766-167). On dependency syntax see MeL'Öur (1988; 1974). See
also SaLoNI & SwtoztNsxt (1985,22-24:44-76).
2.1 Distributional hierarchy of components
2.1.1 Let us begin with relatively simple constructions, exemplilted by
sentence (2), which can be represented by the following dependencygraph:
(2b) ry",
0",:o'
dyplomacji bardziej nii artylerii'diplomacy -- more -- than artillery'
This interpretation is based on the assumption that the head is directlyrelated to each of the two components, but not to the conjunction ni2.
The conjunction links the comparative form and the second subject ofcomparison, whereas the comparative form is linked to the first subject ofcomparison.
The basis for the above structuring is the test of reductionlt. In a"-cordance with my own intuition, I distinguish the following phrases here:
ufal dyplomacji, ufal artylerii, as well as "incomplete" phrases (their exis-
tence can be accounted for in terms of syntactic implication; this will be
discussed in sect. 5.2), namely: ufal bardziej, ufal bardziej dyplomacii, ufatbardziej ni| artylerii. On the other hand, nil artylerii is an exocentric, irre-ducible phrase (this is why its components are not separated with a lineon the graph of dependency above). The comparative construction as a
whole constitutes an expanded phrase: bardziej dyplomacji nii artylerii.
Furthermore, one can draw some negative conclusions from this type ofgraph. In particular, there are no phrases of the form: *X nii(*dyplomacji ni2),*X niL Y (*dyplomacji ni2 artylerifl, or *vf X ni|Y (*ufal dyplomacji nii artylerifl, because the conjunction nil does notenter the direct relation with either the Iirst subject or the finite form.This is a signiltcant difference between this particular conjunction andother co-ordinating conjunctions.
Another kind of structuring of the comparative constructions can be found inSANNtKov (1989,32-41;1979), still another kind in SAWINA (1990).
Cf. SALoNT & SwroztNsrr (7985,238-244).
207
.. --lrIX _ comp _ nlz Y-'
10
11
I202
The structure of the sentence in question can also be represented
means of an IC tree:
(2c)
ufal dyplomacji bardziej ni? artylerii
2.1.2 The comparative constructions in the following sentences also
display syntactic equivalence of their components:
(9) Zywno§ö w Polsce jest droZsza ni2 w Londynie.
'Food is more expensive in Poland than in London.'
(11) W Kalifornii jest wigcej szpitali ni2 we Francji.'There are more hospitals in California than in France.'
This can be demonstrated by means of the following dependency graphs:
(9a) jest
w Polsce --droLsza -- nii w Londynie
(1 1a)
w K. -- wipcej -- niZ we F.
Jszpitali
The structure of (11a) is determined by the fact that there does exist the
phrase jest wigcej, but not *iest szpitali. One needs to point out that an IC
tree is not as satisfactory in the present case, as it does not highlight the
relation of the comparative form and the conjunction:
203
(11b)
Specifically, (11b) predicts the existence of the string "*X ni2 Y", a pos-
sibility that has been ruled out by the analysis in terms of the depend-ency graph. The peculiarity of this construction is that the comparativeform wigcej is the head of the noun szqtitali, which, however, is not a
subject of cornparison. It is equally important for our purposes that thephrase *wigcej szpitali ni2 we Francji does not exist. We shail return to thisissue below.
2.2 Types of phrases headed by the finite form
We turn now to the syntactic requirements of the head finite form, as itis its subcategorization properties that determine a particular sentencepattern.
2.2.1 1shall begin by discussing the comparative constructions which as a
whole occupy the position of a phrase of a speciltc type, such as a Nounphrase, for instance in the dative, as in sentence (2), and also a preposi-
tional-nominal or inltnitival phrase, as in the following sentences:
(12) Polegala raczej ta popieraniu panuj4cych wladcöw ni2 na za-
stgpowaniu ich innymi. (Dziew 1981, 371)'She would tend to support the rulers who were currently inpower rather than replacing them with others.'
(13) Du2a iowa rodzina jest bardziej obiektem ideologicznychmarzei niZ historyczn4 prawd4.
'A large, multi-generational family is an ideological dreamrather than historic truth.'
(14) Rosjanie raczej staraj4 sie z Rosji wyjecha6 niZ tu wr6ciö.'Russians attempt to leave Russia rather than come back.'
by
wigcej szpitali
204
Employing traditional terminology, one can say that such comparativeconstructions function as objects (sentences (2), (12), and (14)) or predi-cative nouns (13).
Comparative construction can be also realised by adjectival phrases
and prepositional-adjectival phrases:
(15) Odstgpstwo od polityki, ..., jest bardziej chwalebne niZharibi4ce. (Tuchman 1992, 27 5)'Staying away from politics is more laudable than ignomi-nous.'
(16) Hastingsa uwaiano raczej za makiawelicznego ni| za tgpego.'Hastings was considered Macchiavelian rather than thick.'
as well as adverbial complement phrases (syntactically required phrases),
(17) Dzi§ zdarza sig to czg§ciej ni2 kiedy§.'Today it is more common than it used to be.'
and adjunct (i. e, modifying) phrases, e. g.:
(18) Dzi§ spal lepiej ni2 wczoraj.'Today he slept better than yesterday.'
(19) Chptniej pracowai w dzieri ni2 w nocy.'He preferred working during the day to working at night.'
2.2.2 | will now turn to the constructions in which the function of thesubjects of comparison is different from the function of the comparativeform. Let me begin with examples where predicative adjectives and pre-
dicative adverbs are combined with adjuncts (again, a traditional term).Below are a few possible combinations of the two different types ofphrases:
- the subjects of comparison as an adjunct phrase and the comparativeform as a predicative adjectival phrase, e. g.:
(9) Zywno§ö w Polsce jest droZsza ni2 w Londynie.'Food is more expensive in Poland than in London.'
* the subjects of comparison as a predicative adjectival phrase and thecomparative form as an adjunct phrase, e. g.:
(20) Czg§ciej bywal chory nü zdrowy.'He was sick more often than healthy.'
205
- the subjects of comparison as an predicative adverbial phrase and thecomparative form as an adjunct phrase, e. g.:
(21) Lepiej czul sig dzisiaj ni| wczoraj.'He felt better today than yesterday.'
CzgSciej bywal w Krakowie niZ w Warszawie.'He would go to Cracow more frequently than to Warsaw.'
This diversity stems from the syntactic difference between the compara-tive form of the adjective and adverb, respectively, and especially fromdifferent selectional properties of the hnite form.
A peculiar situation ensues when the comparative form wigcej / mniejis the head noun that is not a subject of comparison, as in:
(11) w- Kalifornii jest wigcej szpitali niZ we Francji.'There are more hospitals in California than in France.'
In (11) the comparative form constitutes the subject noun phrase innominative: wigcej szpitali, whereas the subjects of comparison, beinginside the verb phrase, function as adverbial complement phrases: wKalifornii, we Francji. Let us consider one more example:
(22) Wskutek powodzi Holandia stracila wigcej ludzi niZ w czasiewojen.'Holand lost more people because of floods than in wars.'
In this sentence the comparative form wigcej is a component of the accu-sative noun phrase (i. e. the object), whereas the subjects of comparisonare an adjunct phrase. There is a direct link between wigcej and the com-ponent of the adjectival or adverbial phrase: wigcej nii we Francji, wigcejnii w czasie wojen. I suggest that this phenomenon be called the "inter-phrasal interaction" of the comparative form or "interphrasal relations". Ishall return to this point in sect. 4 and 5.
(8)
206207
3. Non-equivalence of components I: the subordination relationbetween the comparative form and the subjects ofcomparison.
3.1 The comparative form as the head of the subjects of comparison.
Only the comparative form is headed by the finite form.
3.1.1 The heads "X and ni2 Y" are primarily those comparative formswhich are case governors or prepositional-case governors, as exempliliedbelow:
(23) Postawy ideologiczne plasowaly nas bliiej chlopskiego konser-watyzmu niZ socjalizmu.'Ideological attitudes placed us closer to peasant conservatismthan socialism.'
{24) ... byl bliiszy czlowiekowi jaskiniowemu ni2 temu, ktöry ...'... [he] was closer to primitive man than to the one who ...'
(25) Panuje tam wiecznie cisza, podobniejsza do milczeniaZy'wiolu ni2 do milczenia ludzkiego. (ResP 1/1989, 88)'Eternal silence reigns there, more like the silence of the ele-ments than human silence.'
The comparative forms wigcej / mniej, as numerals, are also case gover-nors and thus heads of nominal subjects of comparison, as in:
(26) Oeiefi... d,awalwigcej dymu ni2 ciepla. (Herbert L993,157)'The hre gave more smoke than warmth.'
(27) Bylo wigcej rado§ci ni2 placzu.'There was more joy than tears.'
The relevant graphs of dependency are given below:
'conservatism than socialism' 'smoke than warmth'
The above structures are also determined by the reduction test (phrasesllke *plasowaly konserwatyzmu, ot * dawal dymu are nonexistent).
A parallel treatment can be given to some constructions whose sub-jects of comparison are not govemed by the comparative form, as in:
(29) Bliiej mu st4d ni2 sk4dkolwiek indziej'.'It is closer for him from here than from any'lvhere else.'
* The components that are neither implied nor govemed often allow two interpreta-tions: complement of an adverb (e. g. bliiej stqd, 'closer from here') or complement ofa finite verb (e. g. bylo stqd,'was from here'). Similarly, the sentence: Dzi§ szkolnitwojest bardziej rozpowszechnione nii dawniej. 'Nowadays education is more widespreadthan in the past' can be structured in two ways: the modifiers dzi§, dawniej can betreated as complements of the Adjective or the finite Verb:
dawniej
3.1.2 Special attention should be given to more complex constructions,e.g.:
(30) Dzielo nosi wigcej podobieristw do Czechowa ni2 do Tolstoja.'The work bears more similarities to Czekhov than to Tolstoj.'
In this case the structure can be interpreted in two ways:
(23a) plasowaly, 'laced' (26a) dawal,'gave'
IIbli2ej,
(28) vf
Icomp/t\
XniiY
'closer' wigcej, ('more')
jest
Irozpowszechnione
"zt--"dzi§ _ bardziej ___niL dawniej
jest
^dzi§ rozpowszechnione nü
l-lI--bardziej
209208
(30a) nosi
Iwigcej
(30b) nosi
I
+wigcej
(31a) nosiI
.+ .wl9ceJ
"----T-*podo.bieristw ni| [podobie6stw]
(31b) noslII
wl9ceJ
podobieristw ni2 [podobieristw]lldo Czechowa do Tolstoja do Czechowa ni2 do Tolstoja
Ido utwordw
ICzechowa
I[do utwor6w]
ITolstoja Czechowa niZ Tolstoja
The structure in (30a) involves no copying of any component (those thatare copied are given in square brackets). In other words, in sentence (30)
the component do Tolstoja is treated as a contextual equivalent of thecomponent podobieistw do Tolstoja. In authentic texts, some componentsdo in fact get copied (cf. e. g. (41) below), but this often results in theirbeing stylistycally marked. In traditional terminology this interpretationwould be called "elliptical". In the other interpretation, i. e. the graph(30b), the comparative form wigcej is separated from the conjunction niz
by one node, i. e. the constituett podobiefistwo. This in turn involves "per-colation" of case government of the head wigcej over the constituentpodobiertstwo; this will be discussed further in sect.5. The second inter-pretation can be said to assume structural distance between syntacticallyrelated constituents (i. e. between "comp" and "ni2"). This structuraldistance can also amount to two nodes, as in:
(31) Nosi wigcej podobieristw do utworöw Czechowa ni2 Tolstoja.'It bears more similarities to the works of Chekhov than toTolstoj's.'
The two possible interpretations are illustrated with the following de-
pendency graphs:
It is also worthwhile to consider sentences comprising the comparativeform and two inhnitival constituents, e. g.:
(32) Latwiej [jest] stluc ni2 skleiö.'[It is] easier to break than to lix.'
A more complex sentence of this type, e. g.:
(33) Trudniej liestl nauczyö tego mg2a ni| äong.'[It is] more difficult to teach this husband than the wife.'
can have two interpretations, parallel to those already discussed, as
shown on the relevant graphs:
210
(33a) Ljestl
Ifrudniei./T\"
nauczyö ni| [nauczyö]llfngza zong
Here the structural distance can also amount to two nodes, e. g.:
(34) Latwiej [est] skarciö dziecko wlasne ni| cudze.'[It is] easier to coerce one's own child than somebody else's.'
3.2 The comparative form as a subordinate (complement) to the firstsubject
The comparative form can.be headed by the first subject of comparison,which in turn can be realised by nominal, adjectival, or adverbial forms,e.g.:
(35) Jan ma wigksze dochody niZ wydatki.'Jan has more income than expenses.'
(36) dramatyczny los tradycjonalisty Lechonia 'budzi dzi§wzruszenie nie mniejsze niL podziw ... (Polityka-Kultura 28, 1)'... today, dramatic fate of the traditionalist Lechori evokesaffection no smaller than admiration ...'
(37) ta bardziej natchniona ni? zrozumiala tyrada ... podnosiRuysdaela ... (Herbert 1993,17)'this tirade, more inspired than comprehensible,.... risesRuysdael ...'
(38) Ale rdwnie2 odwagg, moile bardziej intelektualnq niL cywllnq,wykazal Prus "Faraonem". (TP 2326, 6)
'Prus revealed his courage, perhaps more intellectual thancivic, in his "Faraon".'
(39) Rzecz wyglqda bardziej malowniczo nii grolnie. (ResP 2/66,65)'It looks more picturesque than threatening.'
I suggest the following structure for this type of constructions:
(35a) (37a) tyrada
211
(33b)
rngza zon9
dochody niZ wydatki
T,/wigksze
natchniona riL zroztmialaT/bardziei
In accordance with principles of distribution, the comparative form ofthe adjective is subordinate to the noun, while the comparative form ofthe adverb is subordinate to the adjective and adverb (e. g. bardziejmalowniczo, 'more picturesque'). In the examples above, the comparativeform is located one level below the subjects of comparison. However, itcan also be located two levels below, as in (40):
(40) Murzyn nie m6gl popelniö zbrodni wigkszej ni| poduie§ö rekg
na bial4 kobietg. Golityka 1940,28)'A black man could not commit a more serious crime than toharm a white woman.'
4. Nonequivalence of components II: the comparative form asthe subordinate of a component which is not a subject ofcomparison.
Apart from the hnite form, the nominal form can also be the head of theadjectival comparative form (cf. (3), and (41)-(43) below), while the ad-jectival form can be the head ofthe adverbial comparative form ((44) and(45) below). Notably, none of these two types of head is a subject ofcomparison. In the syntactic hierarchy, subjects of comparison are lo-cated one level higher than the comparative form. Let us begin our over-view from the following examples:
(3) Holendrom przypadl udzial wigkszy ni2 Anglikom.
(41) ... w naturze szczg§cia byla wigksza trwalo§ö nil w naturzenieszczg6cia. (Tatar 1,990, 120)'... there was more pefinanence in the nature of happinessthan in the nature of unhappiness'
Holendromudzial ni| Anglikom
Vwigkszy
2t2
This type of structure can be illustrated by means of a dependency graph(3a) or an IC tree (3b):
(3b)
213
constitute an accusative noun phrase in (44), and an adjunct (modifier)in (45):
(44) Ich biale sztandary uczynily ich bardziej widocznymi ni2wszystkich pozostalych. (Dziew 1989, 403)'Their white banners made them more visible than all theothers.'
(45) ... ogromna transformacja w Rosji jest tysiqc razy trudniejszai du2o bardziej bolesna ni2 np. w Czechach. (TP 2346,4)'... the enormous transformation in Russia is a thousandtimes more difltcult and much more painful than, say, in theCzech Republic.'
(45) deserves special attention, as it contains a co-ordinate phrase consist-ing of both the so-called "synthetic" and "analytical" comparative forms:jest trudniejsza i bardziej bolesna, 'is more difficult and more painful',which changes the location of other components in the sentential hierar-chy:
(45a) jest
w R-trudniejsza<iLw Cz. w R. bolesna ni| w Cz.
Vbardziej
In contrast, in the sentence (45a), where there is only one 'synthetic'comparative form, the components of the comparative construction areall at the same level in the hierarchy, and as such they have already beendiscussed in sect. 2.1.2 above (e. g. (9a)). On the other hand, the so-called 'analyticai' comparative form involves a difference of levels, be-cause the subjects of comparison are direct complements of the liniteverb form, while the comparative form bardziej is subordinate (a com-plement) to the adjectival form bolesna. This is also the case in examples(15), (37a) and (44), as well as (39), which contains the so-called 'ana-lytical adverbial' comparative forms: wyglqda bardziej malowniczo nii groi-nie, 'it looks more picturesque than terrifying'. The phenomenon under
The IC tree in (3b) raises the same kind of doubts as the one in (11b)
above. Most importantly, it does not highlight the link between the com-parative form and the conjunction nii. What is more, the followingphrases do not exist, contrary to what is predicted by the representationin (3b): *Holendrom wigkszy ni2 Anglikom, *Holendrom wigkszy udzial niiAnglikom. The comparative form constitutes a part of the subject phrase(it is an attribute), whereas the subjects of comparison belong to thepredicate phrase, or to put it more precisely, they function as objects. Inthe terminology of structuralist syntax, the comparative form is a compo-
nent of the nominative noun phrase, while the subjects of comparisonform a dative noun phrase, or prepositional-nominal phrase (41). Ac-cordingly, the phenomenon of interphrasal relations also occurs here.
In the following two examples, the comparative form is a componentof the object, i. e. the Accusative Noun phrase (42) or the prepositional -nominal phrase (43), while the subjects of comparison constitute an ad-junct (a constituent that is not required by the finite verb head):
(42) To slowo ,,natychmiast" mialo w tamtych czasach nieco inneznaczenie ni2 obecnie. (Dziew 1981,213)'The word 'immediately' now has a slightly different meaningthan it used to.'
(43) Protestantyzm spotkal sig tam z lepszym traktowaniem niLgdzie indziej.'Protestantism was better received there than anywhere eise.'
In the last two examples in this section, the adverbial comparative formis a component of the adjectival phrase, while the subjects of comparison
wigkszy udzial przypadl
(45b) jest
2t4
discussion rsveals the surface-syntactic nature of the distinctions analysed
in this article.
5. Syntactic implications and government relations
5.1 Special attention should be devoted to the nonstandard government
relation that involves the comparative form and the conjunction ni2.
SALoNI & SwIoztNsKI (1985, 103-104) introduce the notion of 'lexicalgovernment', concerning prepositions in particular. Some verbs, as wellas other types of lexemes, select a particular preposition, e. g. dowiedzial
sig od Marii '[he] learnt it from Mary', not*do Marii. Simllarly, the com-
parative forms select a preposition governing nominative case, i. e. nii, as
illustrated below:
Acc Acc, Sg, F Ni2 Nom Nom!----------.-----..--.-----l----Tl---.----l-T
(la) Zaanektowano kraing wigkszq nii lYielka Brytania
I consider nontypical that the comparative form lexically governs
('selects') the conjunction niil2 (The broken line denotes a no-govem-
ment relation):
2t5
Acc frc".,"''-llr-r +(26b)
r-allr... dawal wi'gcej
Niz
f"-" Ilr- I fi"r-llr-- I
(35b) Ma dochody wigksze ni2 wydatki
The same type of conjunction government is found with the fotms wigcej
and mniej, as well as other forms that are equivalents of the comparative
form, and also various forms of the lexeme woleö,'prefer', e. g.:
t' The phenomenon of lexical government of a conjunction was not predicted by
S^LoNI & §wloztNsrl (1985), who postulated purely syntactic govemment of a
given sentence type; for example, the Verb powiedzieö, 'say' govems the phrase
headed by ie: ie Piotr przyjdzie,'that Peter will come'. Although the latter was
treated by the two authors as a distinct type of govemment, one can nevertheless
detect a certain analogy here, as one could distinguish a conjunction govem-
ment, for instance (notably, verb forms govem subordinating conjunctions).
v(46a) Wolal kawg herbatg (46b) Wolal pi6
It is equally interesting that the comparative form can transfer its con-junction government properties vertically, over structural distance; that is,govemment can 'percolate' across a constituent (or two)13 . This type ofconstituent is a complement (subordinate) of the comparative form andsimultaneously the head of the subjects of comparison, which is illus-trated by the relevant nodes on the dependency graphs in (30b), (31b)and (33b) above. The phenomenon of "transfer" of the conjunction gov-ernment by the comparative form can also take place long distance, i. e.horizontally: this is a case of interphrasal government (see ex. (3b) insect. 4). The influence of the comparative form on the selection of theconjunction nii,when the latter is distal in the structural sense, (vertical-ly or horizontally) demonstrates the "strength" of the former.
5.2 The syntactic implication relation hotding between the comparativeform and the subjects of comparison on the one hand, and the head onthe other, i. e. the implication of various types of phrases by the finiteform, has already been discussed. In this subsection I wish to focus myattention on various implication relations within the four-component co-
" I offer this particular interpretation by analogy to the phenomenon of .trans-ferring" of the influence of negative forms by non-negative ones, as in: Jan nielubi je§ö sera,'Ian doesn't like eating cheese', where the genetive govemment ofthe negative form nie /aäl is transferred by the inhnitival form jesö. This phe-nomenon was noticed by SALoNI & Swl»zlNsxr (1985, 142).
Acc
I ,q." Acc, Pl, M3 Niz -ll1-l-l-.Vv
Gen
216
ordinate comparative construction. The comparative form is obligatorilyrequired by the conjunction nii, and the conjunction nii in turn is also
required (albeit only optionally) by the comparative form. In other words,this is an instance of mutual implication. On the other hand, the con-junction nii obligatorily requires two subjects of comparison, which can
be illustrated in the tollowing way:
fr-l Iml(2c) Ufal Orr,olu"jt Outdr,.j 1i2 artylerii.
6. The role of the link between the comparative form and theconjunction,afl
The constitutive element of the construction in question is certainly theconjunction nii, as it obligatorily syntactically implies the other threecomponents. The fact that the comparative form is so implied by theconjunction nii is a unique property of the latter (and also of the preposi-
tion nii).In contrast, the comparative form syntactically implies nii onlyoptionally. Simultaneously, it is the comparative form that governs (i. e.
selects from the given set of conjunctions or prepositions) riz. The rela-
tion "comp niZ" has considerable strength, as it survives over structuraldistance, both vertically and horizontally. The comparative form deter-
mines the special characteristics of the comparative construction: it is
this form that distinguishes the construction with the conjunction nilfrom co-ordinate constructions, as well as the constructions with thepreposition ni| from the typical prepositional constructions.
Due to limitations of space, it is impossible to provide a systematic
overview of similarities and differences between the constructions withthe conjunction ni2 and the typical co-ordinate and prepositional con-
structions. The issue awaits further investigation.
Sources of cited sentences
Dziew: Dziewanowski K.1981 Brzemig bialego czlowieka. Warszawa
1989 Brzemig bialego czlowieka. Tom II. Warszawa
M.J. i A. Michejdowie. Katowice 1992
Literature
GRoCHowsKI, M. 1988: Cechy skladniowe i semantyczne wyra2eniaraczej. ln: Woköl jgzyka. Rozprawy i studia po§wigcone pamigci Prof. M.Szymczaka. Wroclaw, 167 -11 I
KALLAS, K. 1995a: Indywidualne cechy skladniowe czasownika'woleö'. ÄctaUNC XLVI, Toruri, 53-64
Kelres, K. 1995b: O konstrukcjach z przyimkiem nii- ln M. Gro-chowski (red.): Wyra2enia funkcyjne w systemie i w tek§cie. Toruri, 99-110
KALLAS, K. 1996a: Strukturalne uwarunkowania szyku w wybranychkonstrukcjach z konektorem niL. In: K. Kallas (red.): Polonistyka To-ruiska Uniwesytetowi w 50. RocznicA Utyvorrcenia UMK. Jgzykoznawstwo.Toruri, 145-155
KALLAS, K. 1996b: Rola czynnik6w semantycznych w strukturze polskichkonstrukcji por6wnawczych (z konektorem nii). ln:. Biuletyn PolskiegoTow arzy stw a J g zy ko zn aw c z e go LlI,'Warszawa, 1 3 5 - 1 4 5
KALLAS, K. 1997: Skladnia zdari poröwnawozych. Uwagi o zdaniachzespolonych spöjnikiem nii. ln: Polonica XVIII, Krak6w, 11-27
LASKowSKI, R. 1984: Funkcjonalna klasyfikacja leksem6w: czg§ci mowy.ln: Gramatyka wspölczesnego jgzyka polskiego. Morfologia.'Warszawa,26-37
I-oJAsIEwICZ, A. 1992: Wasno§ci skladniowe polskich spöjniköw. 'Warszawa
MEL'öuK, l. 1974: Opyt teoii lingvistiöeskich modelej 'Smysl <==> Telcsf.
MoskvaMEL'öUK, I. 1988: Dependency Syntax: Theory and Practice. New York
217
Herbert -- Herbert, Z.1993 Martwa natura z wgdzidlem.Tatar = Tatarkiewicz,W.1990 O szczg§ciu. WarszawaTuchman: Tuchman B.1990 Szabrtstuo wladzy. Przeklad
GSwiqt : Gazeta SwiqtecznaPolityka (i dodatek Kultura)ResP : Res PublicaTP -- Tygodnik Powszechny
Wroclaw
278
SALoNI Z.; §woztNsrr, M. 1985: Sktadnia wspölczesnego igzyka polskiego.'Warszawa
SANNIKov, Y.Z. 1979:. Soöinitel'nye i sravnitel'nye konstrukcii: ich bli-zost', ich sintaksiöeskoe predstavlenye. Öast pervaja. In'. Wiener Sla-wistischer Almanach 4, 473 -431
SANNIKov, Y. Z. 1989: Russkie soöinitel'nye konstrukcü. Semantika. Prag-matika. Sintaksis. Moskva
SAwINA, E. N. 1990: Sravnitel'nye i soöinitel'nye konstrukcii v russkomjazyke: ich schodstva i razllöija. In: Z. Saloni (red.): Metody formalnew opisie jgzyköw slowiartskicft. Bialystok, 221-230
SzUPRYCZYI§sKA, M. 1980: Opis skladniowy polskiego przymiotnika. TorufWEINSBERG, A. 1983: Jgzykoznawstwo ogölne. Warszawa
Zuzanna Topohrtska, Skopje
Polish 2e - all-powerful introducer of new clauses
I shall discuss here formal markers opening syntactic positions for finiteclauses. Let me first present some comments conceming my terminology.A finite clause is for me a syntactic construction with a hnite verbal formas its head. If introduced by a specialized formal marker, it is ipso factogramatically dependent. At the semantic level a hnite clause is ex defi-nitione a formalization 1= a formal surface realization) of a predicate-ar-gument structure with a predicate formalized as a finite verbal expres-sion. I shall present evidence proving, in my opinion, that in Polish (andalso in many other Siavic, Romance, and Balkan languages) there existspecial markers for introducing finite clauses of different status in thetext.
Before preseniing my Polish examples, I would like to state the threebasically different syntactic (and semantic) contexts (and functions) invrhich the dependent finite clauses appear in the text. They can serve:(1) as a noun phrase complementation (: as noun phrase modihers),
e. g. \he student) that I met yesterday, the connective introducing a
clause of this type has no lexical meaning; it blocks the position ofone of the argument expressions of the corresponding predicate; if itis a declinable proform, its categorial characteristics are those of theblocked argument expression, if not (i. e. if we are faced with the so
called relativum generale), the said characteristics can be signaled byan anaphoric; e. g. Standard Polish (czlowiek,) ktörego [masc sg acc]spotkalam... vs. Polish dialectal (czlowiek) co [relativum generale] go
[masc sg accf spotkalam ...,'the man I met ...';as a verb complementation (= as intensional clauses : as argumentalexpressions implied by verbal predicates), e.E. Q am glad) that youcame; the connective introducing a clause of this type has no lexicalmeaning; in some languages it anticipates certain modal characteris-tics of the clause;as extensional clauses in compounds (= as argumental expressionsimplied by conjunctive predicates), cf. (1 was still sleeping) when hecalled, and the like. The connective introducing a clause of this typerepresents a discoursive predicate at the semantic level; it expresses
(2)
(3)
220
associative (conjunctive, temporal, causative) relations between theevents that the speaker chooses as a projection of the course of histhought when generating a text. From this point of view extensionalconjunctions belong to the same functional class of lexemes as theso-called paratactic conjunctions.
Let us pass now to the examination of the material. I shall start witha short review of the grammatical functions of Polish ie.'fhen I shall tryto reconstruct the main line of functional derivation connecting all these
functions. Finally, I shall present evidence for similar functional entitiesexisting in other languages.
From the etymological point of view it is not clear whether we have
one or two Zeelements in Polish. To my thinking we have two such ele-
ments: a postpositive particle ie coming from IE *ge or xg'e (cf. KoreÖwv1973, 335) and a conjunction coming from the combination of the 01d
Slavonic anaphoric pronoun )o masc. and / or *je neut. with the saidparticle. Today the most frequent variants of these two elements are
homonymous and from the synchronic point of view it would sornetimes
be impossible to say which one appears in a particular function. This isnot the case, however, from the diachronic perspective. The old particle,*ler, depending on the phonological context, appears in two variants - -
2e arrd -i - and behaves as a bound enclitic in a limited number of lexe-
mes such as takie'also', jui 'already', tei'aiso', gdy2'because', and some
others. The conjunction, which is a functional (syntactic) derivative ofthe Old Polish relative pronoun (cf. below), appears in several variants inOld Polish texts: ii(e), e2(e) and ze (cf. PtsanKowA 1984, 231). It behaves
as a free proclitic. Nevertheless, since the above etymological hypothesisis not generally accepted, the following classification of different uses ofthe Zeconnective in Polish is founded exclusively on functional criteria.
l. ie - connective introducing relative clauses
We do not have such a connective in modern Polish. Nevertheless, we
have to account here for its appearance in Old Polish, since it presents
the first step in transforming an enclitic postpositive particle into a pro-
clitic conjunction.It is a well known fact (cf. Blusn 1967) that the relative pronouns in
Slavic (and also in other IE languages) are derived from demonstrativa
and / or from interrogatfua. h Polish the two lines of derivation are
221
chronologically ordered. Old Polish shows the type *jo-(no-)ie, *ja-Ze,
\e-äe ..., known also in other West Slavic languages and in Old ChurchSlavonic, where the presence of the enclitic -äe marks the differencebetween the anaphoric )o and the respective relative form. Cf. OP (..uiytk) jei to je§ö bgdziecie..., '(fruits) that you shall eat ...', (czlowiek ...),
.jenie by byl trgdowat...,'(a man...) that would be leprous ...', (raj...),wniem2e postawil czlowieka ..., '(paradise ...) where (lit. in which ...) heplaced the man', etc.
Besides those with *jt(no-)Ze Old Polish also shows relative clausesintroduced with the interrogative co. In modern standard Polish relativeclauses are introduced with the interrogative ktöry.
On consecutive compounds with connective sequences of the type taki(...), 2e ..., tak (...), ie ..., tyle (...), ;e... see below in the section on exten-sional clauses.
By the wa1,, in colloquial use today one can find constructions of thetype ... czlowiek, ie lepszego nie znajdziesz, lit. 'a man that you can notfind better than him', ciasteczka, ie palce lizaö, idiom.'best cookies in theworld!', etc. They are derived from explicit comparative constructions ofthe pattem taki, ie ... and expressively marked - they signal the best pos-
sible quality. Today it is only in constructions of this type that one findsle in clauses serving as noun phrase complements.
2. 2e - connective introducing intensional clauses
The main connective function of 2e in modern Standard Polish is tointroduce intensional clauses. "Intensional" ie aheady appears in theoldest Polish texts. It is, in my opinion, ie2, i. e. a marker of noun phrasecomplementation, which took over the function of verb complementationas well. The convincing proofs are its variants: i2e, e2e, aie (cf. Pt-SARKowA 1984, 207), best interpreted as different gender forms of the+ja-Ze combination. Today we are faced with only two variants: the basicone 2e, and the secondary, bookish one, ii.
Note that jeie was one of basic complementizers in Old Church Sla-vonic.
From the beginning of its career as an intensional connective, Polish2e has not been sensitive to the opposition: factive vs. non-factive and /or evidential vs. non-evidential. Thus, beside Jestem przekonany, 2e ...,'lam covinced that...'we have Niewierzg, ie...,'I do not believe that...',
222
and beside lYiem, 2e..., 'I know that ...' we have Obiecujg, 2e ...,'l prom-
ise that...', and so on. Nevertheless, there exists one interesting opposi-tion in the use oI ie. after verba voluntaris on the one hand and its use
after other predicates on the other. This is the relationship between ie as
an intensional connective and by as a conditional (potential?, optative?)marker. Stated most simply:
- There exists /e as a free proclitic morpheme introducing intensionalclauses independent of the categorial (temporal, modal, aspectual ...)
characteristics of their constitutive verbal expressions; among others itintroduces clauses with ihe by marker, as in'. Powiedzialam, ie chgtnie
bym tam poszla /... 2e bym tam poszla chgtnie,'I said that I would go
there with pleasure'(the difference in linearization expresses a subtledifference of the communicative hierarchy of the message), or:
Slyszalam, ie on by sig tego podjql / ... 2e on podiqlby sig tego,'I heard
that he would take on the job' (the two linear variants are homony-mous).
- By contrast, there exists /e as a bound proclitic morpheme in perma-
nent combination with by - the combination which, according to Pol-
ish grammatical tradition, is interpreted as a ltnal conjunction ieby.
Zeby is isofunctional with aby, aieby, and even with by in its special,
connective function. Beside the free-or-bound character of 2e there isa deeper functional difference between the two types of intensional/eclauses. The iebyclauses alternate in a clear-cut pattern with infini-tive clauses; an infinitive clause appears when the ltrst (subject) ar-
guments of the m4in and of the intensional clause are coreferential,e. g. Chcg, ieby on tam poszedl,'I want him to go there' vs. Chca tam
pöj§ö, 'l want to go there'. Finally, it should be mentioned that ieby(/ aby / öy) also introduces extensional final clauses.
Polish grammarians usually classify verbal constructions with the free
morpheme äy as expressing the potential mood, while verbal expressions
constituting the ieby / aby...-clatses are evaluated as expressing the in-dicative mood. I know only one study (PuzvNINA 1971), however, whose
author overtly argues in favor of this solution. This interpretation is, or so
it seems to me, a consequence of identifying grammatical categories withtheir morphological exponents. In my opinion both uses of äy should be
interpreted as exponents of the same modal category (cf. also GorAs1964a and b). - If this is so, it would mean automatically that both uses
of ie are also variants of the same connective, in other words, that all
223
types of finite intensional (and not only intensional) clauses can be in-troduced with the aid of ie.
There is one more interesting problem connected with intensional ie.As mentioned above, intensional leclauses are viewed from a semanticperspective as argumental expressions implied by the correspondingpredicative expression. However, the primary syntactic form for an argu-mental expression is a noun phrase. In Slavic we still have a reminder ofthis fact in the form of a "syntactic nominalization" formula (cf. To-PoLINSKA 1977). Let us quote some Polish examples:
(1a) Jurek przyje2dia jutro. Powiedzialam jej o tym.'George comes tomorrow. I told her that.'
(1b) Powiedzialam jej o tym, 2e Jurek przyjeädäa jutro.'I told her that George comes tomorrow.'
(1c) Powiedzialam jej, 2e Jurek przyjeLdLa jutro.: (1b): 'I told her that George comes tomorrow.'
(2a) Jurek przyje2d2a jutro. Cieszg sig z tego.'George is coming tomorrow. I am happy about it.'
(2b) ,Cieszg sig z tego, 2e Jurek przyjeLdLa jutro.'I am happy about the fact that George is coming tomorrow,'
(2c) Cieszg sig, 2e Jurek przyjeLdLa jutro.= (2b): 'I am happy about the fact that George is coming to-morrow,'
(3a) Wigcej tego nie zrobig. Przysiggam.'I will never do it again it. I swear.'
(3b) *Przysiggam to,2e wigcej tego nie zrobig.
(3c) Przysiggam, 2e wigcej tego nie zrobig.'I swear that I will never do it again.'
(4a) Ona powinna wyjechaö. Poradzilam jej to.'She should take a trip. I advised her so.'
(4b) *Poradzilam jej to, 2eby wyjechala.
(4c) Poradzilam jej,Lebywyjechala.'I advised her to take a trip.'
224
(5a) Mogloby sig zdarzyö,2e minister mnie nie przyjmie, wigc po
prostu nie p6jdp tam i w ten spos6b tego unikng.'Maybe the minister will not receive me. So I simply will notgo there and that way I will avoid it.'
(5b) Po prmtu nie pöjdg tam i w ten sposdb unikng tego, 2e mini-ster mnie nie przyjmie.'I simply will not go there and that way I will avoid the pos-
sibility that the minister will not receive me.'
(5c) *Po prostu nie pöjdp tam i w ten spos6b unikng, 2e ministermnie nie przyjmie.
(6a) I co zrobisz? Zrobig to, 2e wyjadg. (in colloquial use only)'And what will you do? I shall go away', lit. '... I will do that:I shall go awaY.'
(6b) *I co zrobisz? Zrobig,2e wyjadg.
As can be seen from the examples, the dominant connective formulaintroducing an intensional clause is ... ro, ie ... where the kataphoric /o
blocks the position for a nominal argument, and ie opens a position for apropositional argument. Mutatis mutandis the above formula parallels
the primary patterns of relativization: ... to, co ..., '... that which ...';... ten, kto...,'...he who...', etc. whose only function is that of introduc-ing clausal constructions into positions reserved for noun phrases, cf. To,
co mi sig podoba, jest zawsze najdroisze,'That (the thing) which pleases me
is always the most expensive', Ten, kto rozumie innych, iest zwykle toleran-qjny, 'He who understands others, is usually a tolerant man', etc. It is
hard to say whether we are faced with a structural parallel alohe, or
whether there is also a genetic link between the two lines of syntactic
derivation. As stated above, the Old Polish formulas ... to, co ... and -.. ten,
kto... were paralelled with *... to, jeie... and *... ten, joie..., hence the
reinterpretation of the relative into an intensional connective is more
than probable. The zone of use of English lhat, of French 4ue, etc. offers
a suggestive parallel.In the oldest Polish texts, which are religious texts and legal records,
intensional clauses, almost without exception, appear aftet verba dicendi,
and, once more almost without exception, are introduced with .'. tako,
2e ... or (less frequent) with ... to, ie... Our exarnples illustrating the
modern use of the formula ... to, ie(by)... show that the demonstrative
22s
element is almost universal and optional in almost all contexts. The twoways exceptions (as in examples (3)-(4) and / or (5)-(6)) depend on thelexical meaning of the governing verbs (cf. thorough analysis in ZenoN1980, ZroöRSKA-BRooKs 1982); ZanoN (1980, 13) differentiates be-
tween iey - "pure" complementizer - and ie2 - used in the quotationmode and introducing "a rhematic dictum", as in our examples (3a) and
@ü. Zez excludes cataphoric fo.
Insofar as 0y is concemed, I treat it - according to the interpretationpresented above - as an exponent of the verbal mood. Its distribution iscontrolled by the governing verb.
3. ie - connective introducing extensional clauses
As mentioned above, I take extentional clauses to be "second arguments"of discursive predicates formalized as corresponding conjunctions. By"second arguments" I mean arguments that are of secondary importancefrom the point of view of the communicative hierarchy of the message; Iassume that the diathetic hierarchy of the arguments is always coded inthe predicate. To illustrate this let us examine some English examples.
The conversive predicates 'buy' and 'sell', as in sentences Bill buys the car
from Peter and Peter sells the car to Bill, differ only in the diathetic hierar-chy of their arguments. Similarly, in compound sentences such as I didnot come because it was raining and It was raining, therefore I did not come
the discursive predicates because and therefore differ in the diathetic hier-archy of their arguments formalized respectively as main clause and
extensional clause. The term "discursive predicates" alludes to the factthat paratactic and extensional conjunctions (as well as verbs such as
coexist, follow, precede, imply, cause; nouns such as conjunction, alternative,
simultaneity, succesion, cause, condition; and adjectives such as parallel,
adverse, precedent) reflect the course of the speaker's thought when gener-
ating a text (: when taking part in a discourse). In other words, paratac-
tic and extensional conjunctions have lexical meaning, i. e. they functionas predicates at the semantic level, as opposed to relative and intensionalconnectives, which do not. The difference between paratactic conjunctivepredicates on the one hand and extensional conjunctive predicates on theother lies in the fact the former are not diathetically ordered, while thelatter imply a deflrnite hierarchy of their arguments. Paratactic predicates
are symmetrical, while extensional are not. Let us consider once more a
226
parallel with verbal predicates. The predicate 'dance (with somebody)' issymmetrical, since Bill dances with,4nn implies Ann dances with Bill. ltthe same way, the conjunctive predicate 'and' is symmetrical, since Bil/ ls
reading and Ann is working in the kitchen implies Ann is working in thekitchen and Bill is reading. On the other hand, predicates like 'read' or'since' are not symmetrical, since they impose a unique, definite hierar-chy of arguments (and usually also a unique, definite linearization oftheir surface exponents). Taking into consideration the above general
assumptions, let us now analyze Polish expressions introducing exten-sional clauses.
'We shall concentrate on expressions containing the formula ... to,
ie(by) ... There are two types: those where the formula is added to a
preposition and those where it is added to a particle. (For a dehnition ofparticles as a lexical class cf. GRocHowsKI 1986).
Among the Polish examples cited above illustrating the intensionalformula ... to,2e(by)..., there are some where the kataphoric demonstra-tive form is dominated by a preposition. The preposition in turn is gov-
erned by the verb of the main clause, e. g. powiedzieö (komu§ o tym, ie ...),
'tell (somebody that ...)', prosiö (kogo§ o to, ieby...)'ask (somebody to dosomething)', upieraö sig (przy tym, ie ... / ieby ...), 'b" stubborn aboutsomething', etc. As can be seen from these examples, prepositionalpredicates in intensional compound sentences modify verbal predicates
in the same way as they do in simple sentences. In extensional com-pound sentences we are faced with a different situation. Here are someexamples:
(7a) Nie przyszlam dlatego, 2e nie mialam ochoty przyj§ö.
'I did not come since I did not want to.'
(7b) Nie mialam ochoty przyj§ö. Dlatego nie przyszlam.'I did not want to come. That is why I did not.'
(8a) SpöZnilam sig przez to, 2e zepsul mi sig samochdd.
'I was late because the car broke down.'
(8b) Zepsul mi sig samochid. Przez to sig spoZnilam.'The car broke down. That is why I was late.'
227
(9a) Zdq?ylam na samolot dzigki temu, 2e Jurek odwidzl mnie nalotnisko.'I caught the plane thanks to George's driving me to the air-port.'
(9b) Jurek odwi6zl mnie na lotnisko. Dzigki temu zd4Lylam nasamolot.'George drove me to the airport. It enabled me to catch theplane.'
(10a) Wobec tego, 2e Jurek nie przyszedl, musimy skröciö zebranie.'Faced with the fact that George has not come, we have toshorten the meeting.'
(10b) Jurek nie przyszedl. Wobec tego musimy skr6ciö zebranie.'George has not come. Hence we have to shorten the meet-ing.'
(11a) Opröcz tego,2e sam nie przyszedl, nie zawiadomil innych o
zebraniu.'He not only did not come himself, but did not tell othersabout the meeting.'
(11b) Sam nie przyszedl. Oprdcz tego nie zawiadomil innych o ze-
braniu.'He did not come himself. What is more, he did not tell oth-ers about the meeting.'
(1,2a) Poza tym, Le sam nie przestrzega przepisdw, d.aje zly przykladdzieciom.'He not only does not follow the rules, but sets a bad exam-ple for the children.'
(12b) Sam nie przestrzega przepisdw. Poza tym daje zly przykladdzieciom.'He does not follow the rules himself. \Yhat is more, he sets abad example for the children.'
(13a) Przyszlam tylko po to,Zeby wam to powiedzieö.
'I came solely in order to tell you this.'
228
(13b) Chcialam wam to powiedzieö. Przyszlam tylko po to.'I wanted to tell you this. That is the only reason for my com-ing,' etc.
Expressions like dlatego, ie ..., przez to, ie ..., dzigki temu, ie ..., wobec tego,
2e ..., opröcz tego, ie ..., po to, ieby ... draw attention due to their transpar-ent syntactic (morphological!) structure: prepositions are exponents oftheir lexical predicative meaning, demonstratives serve as kataphora, i. e.
point to the extensional clauses conveying the implied argument content,and the ie(by)-marker opens a position for these dependent argumentclauses. Prepositions as parts of the expressions under discussion are notgoverned by verbs. They are autonomous predicates and heads of con-structions; moreover, the accompanying formula ... to, le ... irnposes se-
lectional restrictions on their second arguments. On the formal plane
they must take the form of clauses, and on the semantic plane öH whenpresent, signals their non-factive character.
As mentioned above, discoursive predicates express relations thathold between the narrated events from the speaker's perspective. Thereare, roughly speaking, three such types of relations: pureiy associative(i. e., when the base of the association is not explicitly present in thesemantic structure of the predicate), temporal (i. e., with temporal suc-
cession as base of the association) and causative. It is not without inter-est that the prepositional discoursive predicates containing the formula... to, ie... express only relations of the ltrst and third types. The restric-tion seems to be connected with the presence of ze, since we do havecolloquial constructioirs such as Po tym jak projekt zostal odrzucony,
zmienili§my tematykg badai,'After the project was rejected, we changedthe object of research'. Nevertheless the fact remains that, if present inthe structure of temporal discoursive predicates, prepositions rather thandemonstratives govern the substantive czas 'time', as well as other sub-
stantives with the component 'time' built into their semantic structure,followed by pronominal adverbs of the type kiedy / gdy,'when', cf. w
czasie, gdy ..., w okresie, kiedy ..., and the like.Concerning the derivational history of sequences of the type: prepos!
tion + /q ie ..., it should be mentioned that parallel sequences without ie(cf. (7b)-(13b)) function normally in the text as anaphorics, i. e. as dis-
cursive predicates whose first argument belongs to the precetling passage
in the text). In this respect, extensional compounds are completely paral-
lel to intensional compounds (cf. (1a)-(7a) above).
229
The second series of extensional connective expressions containingthe formula ... (to), ie ... are those where ... Ad, ie ... is attached to aparticle. (On the syntactic definition of a particle cf. GnocgowsKl 1986,63.) This series is smaller than the preposition series and embracesamong others expressions like mimo (to), ie ..., chyba ie ...(- chyba to, ie...), tylko 2e ...(= tylko to, ie ...), tyle ie ..., jako ie ... - Cf .
('1.4a) Przyszlam mimo (to), 2e powinnam zostad w domu.'I came even though I should have stayed at home.'
(14b) Powinnam byla zostaö w domu. Mimo to przyszlam.'I should have stayed at home. Nevertheless, I came.'
(15a) On mi obiecal t9 ksi42k9, tylko 2e nigdy mi jej nie dal.'He promised to give me the book, but never gave it to me.'
(15b) Niedy mi nie dal tej ksi4Zki. Mimo (to), 2e mi jq obiecal.'He never gave me the book, although he promised to give itto me.'
(16a) On mi obiecal tg ksi42k9, tyle 2e nigdy mi jej nie dal.The same as (15a) but whereas (15a) is a neutral statement,(16a) is an ironical comment.
(16b) Niedy mi nie dal tej ksi42ki. Tyle 2e mi j4 obiecal.'He never gave me the book. He only promised to give it tome.' - also as an ironical comment.
(17a) Nie mogg wyjechaö, chyba 2e kto§ mi po2yczy pienigdzy.'I can not leave, unless somebody lends me some money.'
(17b) Kto§ musi mi poLyczyö pienigdzy. Tylko w takim wypadkumoglabym wyjechaö.'Somebody must lend me some money, Only then can I go
away.'
In contrast to the prepositional series, within the particle series everyconstruction has a unique status and requires separate comment. This isdue to the different origins and different inherited morpho-syntactic idio-syncrasies of particular particles.
(l4a/b) alone shows some similarity to the prepositional series insofaras variants a. and b. are cataphoric and anaphoric, respectively, and alsoin the optional status of ie in the cataphoric construction. The above-
230
mentioned characteristics are both due to the fact that mimo is of prepo-sitional origin.
(15alb) and (16alb) have identical interpretations except for the ex-pressive markedness of the second pair. The second ("extensional")clause in (15a) and (16a) explains why the operation expressed in themain clause was / is / would be unsuccessful. The change of linearizationas in (15b) and (16b) also gives an extensional compound. The discursivepredicate in question is a combination of conjunction and negation andits arguments are not strictly hierarchically ordered. Both tyle and tylkoare of pronominal origin and as such also appear in relative constructionsof the type Ule / tylko..., ile... Tylkocan also be used with the cataphoricro, in intensional constructions like Przeszkadzalo mu tylko to, 2e chwilowonie mial pienigdzy,'Only one thing bothered him: that momentarily hehad no money', i. e. constructions where the immediate constituents are(1) tylko and (2) to, 2e .., where the demonstrative blocks a position thatshould be occupied by a noun phrase.
While in (15a) and (16a) extensional clauses point to some obstacle(restriction) hindering the realization of the action, in (t7a) the exten-sional clause expresses the unique condition that would make the actionpossible. We are once more faced with an implication founded on theinterplay of negation and conjunction. The parallel goes still farther inthat there exists an intensional construction with cataphoric to, cf . Nic nie
moie mnie uratowaö, chyba to, ie kto§ poiyczy mi pienigdzy,'Nothing cansave me, the only possibility would be if somebody lends me somemoney.'
The interesting coistruction with the discursive predicate wla§nie ie...as its head also belongs to the particle series. It appears solely as a re-plica in dialogue and expresses an emotionally marked negation of theforegoing statement of the interlocutor, cf.
(18a) A: Piotr tego nie powiedzial. - B: A wla§nie 2e powiedzial!'A: Peter did not say so. - B: But he said it!'
(18b) A: Piotr sam tak powiedzial. - B: A wla§nie 2e niepowiedzial!
'A: Peter said so himself. - B: But he did not say so!'
Like tylko and chyba, wla§nie enters a combination with cataphoric fo onlyin an intensional construction: Niepokoi mnie wla§nie to, 2e przyszedl takwcze§nie,'What bothers me is just that he came so early.'
231
Taking into account not only the modern Polish standard, but alsothe Polish diasystem as a whole, we can indicate at least two other dis-cursive predicates, implying clausal arguments and containing the ieelement. These are chociai and jeieli. Chociai, meaning 'although', in-cludes a truncated 2e, parallel to \ei(e), \i(e), etc. - Cf. above. Jeielicomes from lesto-äe-li and means 'il.
Finally, one more group of le-clauses should be mentioned: those en-tering the so-called consecutive compounds and having as their heads thediscursive predicates taki ..., ie ...; tak ..., 2e ...; tyle ..., 2e ... They arederived, or so it seems, directly from the corresponding relative formulas:taki, jaki ..., tak, jak ..., tyle, ile... which, in expressing comparisons, have atwofold interpretation: as introducing relative and / or extensionalclauses. Cf.
(19a) Moja dziewczynajest taka, jakqkaLdy chcialby mie6.'My girl is of the kind that everybody would like to have.'
(19b) Moja dziewczynajest taka, 2e wszyscy mi zazdroszcza.'My girl is of such a kind that everybody envies me.'
(20a) Halasowali§my tak, jak tylko dzieci mog4 halasowad.'We were as noisy as only children can be.'
(20b) Halasowali§my tak,2e szyby w oknach popgkaly.
'We were so noisy that the window panes broke.'
(21a) Nakupili§my tyle, ile mogli§my unie6ö.'We bought as much as we could carry.'
(21b) Nakupili§my tyle, 2e nikt nie m6gl tego zje§ö.'We bought so much that nobody could eat it all.'
My last Polish example is the expression jako 2e ... based on an oldinterrogative / relative form. It is perceived as bookish and slightly ar-chaic, and on the semantic plane it is a marginal synonym of dlatego 2e ...
**
As can be seen from our short review ie has a wide range of uses inStandard Polish. It serves as a universal operator accommodating inten-sional clauses, and can be attached to different prepositions, particles,and pronouns, i. e. it serves as a "derivational suflix", forming discursive
l
:
i
i
l
232
predicates of different types. The common denominator for all these uses
is the same syntactic function: opening a position for a dependent clause.Before formulating some general conclusions, I would try to ansrver thequestion of whether there are parallel functional entities in other lan-guages, and if so, how far the parallel goes.
At the time when I was invited to participate in the present volume, Iwas working on some Macedonian and Bulgarian connectives whosefunctional network I thought to be characteristic specifically of BalkanSlavic. The key elements of those connectives are wro in Macedonianand ue in Bulgarian. The strikingly wide range of syntactic and morpho-logical contexts of these two elements is due, in my opinion, to the influ-ence of the Vulgar Latin quo and also, in some respect, to the influenceof the Greek zrori.
The analysis of the functional range of Macedonian wro has been myobjective in several papers (cf. Toror,rNSKA 1988, L990, 1994, etc.). First,ruro attracted my attention in its function of relativum generale, which is aphenomenon characteristic of many Slavic dialects but rather atypical formost Slavic standards. Then, analyzing its function as a component ofnumerous conjunctions (discursive predicates), I realized that it presents
a valid argument in favor of the theory that I support and that connectsthe so-called processes of Balkanization with the need for a transparent,overt correlation between form and meaning in a multilingual environ-ment. Finally, I realized that there are striking similarities in the historyof functional derivation of Macedonian wro and of Bulgarian qe. Themost interesting parallel is the fact that they have both been promoted
from the function of intensional operator to the function of clause ac-
commodating operator in extensional cornpound sentences.
In view of all that has been said above, when invited to take part in a
volume dedicated to Polish connectives, a natural choice of theme for mycontribution was the functional network of Polish 2e. I was well aware
that ie is the best Polish parallel of the two mentioned above Balkanconnectives, but the results of the analysis surpassed my expectations. Iam Polish, I am a linguist, I have known that ie was incorporated intothe Old Polish relative pronoun system, and yet still only in course of theanalysis presented in the first part of this paper did I realize how deep isthe parallel between the Balkan and the Polish situation. Where I hadseen a Balkan feature of Romance origin before, I would now ratherspeak of a much wider tendency in deriving discursive predicates, a ten-
233
dency characteristic of many languages belonging to different branches ofthe Indo-European family. I would like to present now, in short, theargumentation leading to such a conclusion. I shall start from most gen-
eral statements and then pass to those pertaining to the specific Polishsituation as described above.
In all languages with the basic dichotomy Yerbum vs. Nomen there are
two and only two basic syntactic structures founded respectively onverbal or on nominal forms. These are (simple) sentences and nounphrases. They are respectively products of mental processes usuallylabelled "predication" and "nomination".Noun phrases as such are natural components of sentential structures,while sentential structures entering other sentential and / or phrasal
structures as dependent components are known as clauses. Clausescan also enter structures of higher rank where they are grammaticalydependent not on verbal but on conjunctive predicates.
- While verbal predicates (or, more precisely, predicates constitutingsemantic structures of simple sentences, i. e. prcdicatcs that ohligalrl-rily have a f,tnite verbal form among their surfacc r:xpononts ) primar-ily express relations between objects that the speaker perceivcs in tht:outer world and / or his inner (intellectual, emotional, volitional) atti-tudes concerning objects and events of the outer world, conjunctivepredicates (: discursive predicates) project the course of the speaker'sthought, his specific way of linking events perceived in the outerworld. The connection may be of a generallly associative character(without any explicit motivation) or founded on a temporal and / orcausal succession.As a corollary of their semantic and syntactic characteristics, verbalpredicates impose definite semantic and grammatical requirements onthe accompanying, grammaticaly dependent noun phrases. We couldsay that they imply them on the semantic level and accommodatethem on the grammatical level. Surface exponents of the processes ofgrammatical accommodation are the exponents of the grammaticalcategory of case. Mutatß mutandis clauses are also accommodated tothe governing grammatical construction, be it a noun phrase, a verbal,or a discursive predicate.The relative pro-forms constitute the exponents of accommodation ofa clause to a governing noun phrase. As mentioned above, insofar asthese pro-forms are concerned, there is a choice between interroga-
234
tives and demonstratives. Slavic relative pro-forms may, but need not,be differentiated from the basic interrogative and demonstrative formsthrough the agglutination of some postpositive particle, usually also ofpronominal origin, cf. Old Polish and Czech jenie, Macedonianrcojwro, Bulgarian rcoüro, etc. Also, a sentence may be modihed by arelative clause, and a pro-form delegated to fulhll this function ismaximally unmarked insofar as the nominal categories of gender andnumber are concerned, i. e. the singular neuter form, e. g. Polish co,
Macedonian wro, Bulgariar^ Koe, as in Koncert okazal sig sukcesem, co
bylo prawdziwym cudem w tej sytuacji,'The concert was a success whichwas a wonder in this situation.' The use of relative pro-forms as ana-phorics for sentences constitutes, or so it seems, the hrst step towardstheir introducing intensional and / or extensional clauses.
- In a diachronic perspective, the first, simple type of intensional con-struction is the quotation, i. e. the repetition of a statement. Such a
statement may be introduced in two modes: as oratio recta or as oratioobliqua. In the oldest texts, as also in dialect texts, the mixing of thetwo modes is not unusual. The general formula of quotation, modus
obliquus, can be rendered in Standard Polish as X powiedzial (to) ie ...,
in Old Polish (ro) co ... / (to) jeie ... / (to) jako... Exponents of clausalaccommodation are here sequences of (optional) sentence anaphoricsand (obligatory) clausal cataphorics. It seems to be a dominant for-mula, at least in the Slavic linguistic world. Exponents of this type are
void of lexical meaning, they serve only as operators of accommoda-tion. Here belong,, e. g., Russian qro, Polish ie / ii, Czech äe. lnSouth Slavic there are specialized exponents (verbal particles!) ofclauses in the subjunctive mood - they not only function as operatorsof accommodation but also signal the non-factive character of the cor-responding clause. In North Slavic the latter information has a dis-crete exponent - the particle Öy.
Up to now I have outlined the theoretical framework of my discussionand placed the known facts about relative and intensional connectives inthat framework. Now I would like to pass to what is, to the best of myknowledge, a new point in the description of Slavic connectives.
In works on the historical syntax of particular languages, we oftenfind a statement that hypotaxis develops slowly and is characteristicmainly of the written text and / or of the standardized text. That slowdevelopment of hypotaxis is due to underlying pragmatic and semantic
2.r 5
phenomena. The most sophisticated hypotactic constructions uro oxtott-
sional compound sentences and their appearance signals the acquirr:dability to connect events and to speculate about that connection. In otherwords: it signals the speaker's ability to shape argumentative discourse,the skill to use what is called here the discursive predicate.
The two patterns rnost frequent in the derivation of the discursivepredicates in Polish (as illustrated in the above text) are present also inother Slavic and also non-Slavic languages, Let us repeat them here inmore abstract form:
(1) PREPOSITION + DEMONSTRATIVE + OPERATOR OPENINGPOSITION FOR A CLAUSE
and
(2) PARTICLE (SENTENTIAL ADVERB!) + OPERATOR OPENINGPOSITION FOR. A CLAUSE.
Tlie operator in question is identical with (one of) the intensionaloperator(s) characteristic of the corresponding system. The particle isunderstood as an invariable, grarnmaticaly independent predicate thatcan be superposed on any other (verbal and / or nominal) predicate; theEnglish semantic equivaients would be. e. g., 'only', 'alse', 'at least','probably', etc.
While frequent in Slavic, both these patterns are also typical of Ro-mance languages. As mentioned above, I saw in them at ärst the resultof Romance influence in Balkan Slavic. It seems, however, that if we canspeak here of Romance influence at all, it would be transmitted by dif-ferent means, noi only through Balkan Latin but also with Vulgar Latinas a vehicle for early West Slavic literacy. Whether or not influence is in-volved, the two patterns seem logical candidates for the derivation ofdiscursive predicates in languages that have chosen interrogatives (andnot demonstratives) as basic pro-forms in the process of complementationboth of phrasal and of sentential constructions. In other words, there are
inner prerequisites enabling such a derivation in the morphosyntacticsystems of those languages. The specificity of the Polish (and Czech) case
is in the fact that ie, albeit based on an anaphoric (cf. above), lost alltraces of its pronominal origin in the course of the regular phonetic de-
velopment and was reinterpreted as a particle-complementizer.The ltrst pattern, cf. (1), simply broadens the scope of use of preposi-
tional predicates both on the semantic and on the syntactic planes. As
236
verb modifiers they express spatial relations holding between materialobjects, and governing noun phrases accommodate them to the corre-
sponding verbal predicates. As part of our formula (1), they stay formallysuperposed to a noun phrase (: to a sentential anaphoric) but the domi-nating verb is absent and the following phrasal operator makes them intodiscursive predicates expressing (temporal and / or causal) relations be-
tween events projected respectively in the main and in the extensionalclauses. Thus, the formula (1) produces expressions like the Polish przy
tym, ie ..., obok tego, ie ..., poza tym, 2e .... dlatego ze ... (where the spellingsignals a more advanced process of derivation), po to, ieby ... etc., Mace-
donian sa (roa) utro ..., nopadu roct wro ..., oceeH Toa wro ,.., od (roa) wro..., 6es da ..., nped da ... etc., French parce que ..., des eu€ -.-, sans que ...,
avant que..., etc.In our pattern (2) the phrasal operator is attached to particle predi-
cates whose primary function it is to emphasize particular components ofthe message. (Cf., e. g., the case of English only as in Only Peter [='nobody but Peter'l proposes this solution. vs, Peter only proposes [: 'and notimposes ...'l this solution. vs. Peter proposes only rftrs [: 'and not some other...'l solution, etc.). When used this way, the corresponding particles ex-
press discursive predicates and require an overt argument of a non-clausal character. Combined with a phrasal operator they appear as heads
of extensional compounds, i. e. with two overt clausal arguments. Exam-ples: Polish mimo ie ..., tylko ie ..., jako ie ..., Macedonian can4o utro ...,
ryKy wro..., MaKap utro..., French quoique..., bien que..., tandis que...
The two lines of derivation of discursive predicates suggest the same
conclusion: In the grammatical systems of the languages in question
there is an element - we have labelled it here as "clausal operator", i. e.
"clause accommodating" or "clause introducing" operator - that makesprepositional anaphoric expressions and / or sentential particles into two-argument discursive predicates. It is an open derivation, both mecha-
nisms are still productive, hence the status of the said element varies
between that of a bound and a free morpheme. Genetically it is usuallyof pronominal origin, with its primary semantic and morphological char-
acteristics varying from language to language.As mentioned above, dependent clauses appear in the text in three
basic contexts: as noun phrase modilters and / or noun phrase substitutes(i. e. as relative clauses), as argumental expressions accommodated toverbal predicates (i. e. as intensional clauses), and as argumental expres-
237
sions accommodated to conjunctive (discursive) predicates (i. e. as exten-
sional clauses). The relationship between the exponents of accommoda-tion of relative clauses on the one hand and intensional clauses on theother is a separate interesting theme that was only touched here. What Iwanted to demonstrate is that in all the languages under discussion it isthe exponent of accommodation of intensional clauses which has beentaken as the basic formative of extensional discursive predicates.
Literature
BAUER, J. 196?: K vwoji vztäin§ch vöt v slovanskych jazycich. In: §la-vica Sloyaca 2,297f
GoLÄg, Z. 1964a: Conditionalis üpu balkaiskiego w jgzykach poiudniowo-§owiartskich. Wroclaw
GoLAB, Z. 1964b:. The Problem of Verbal Moods in Slavic Languages.ln'. International Journal of Slavic Linguistics and Poetia 8, 1*36
GRocHo$/sKI, M. 1986: Polskie partykuly: Skladnia, semantyka, leksyko-grafia. Wroclaw
KopröNY, F. 1973: Etyntologiclcj, slovnik slownsklch jarykü, Slova grama-tickä a zäjmena, svazek l: Piedloild), Koncovö partikule sestavil Fr. Ko-Peöni'' Ptaha
PISARKowA, K. 1984: Historia skladni jgzyka polskiego. WroclawPUzYNINA, J. 7971: Jeden tryb czy dwa tryby? In: Biuletyn PTJ 29, t3l-
139
ToporiNsra, Z. 1977: Mechanizmy nominalizacji w jgzyku polskim. In:Studia Gramatyczne 1, l7 5-212
Toporntsre, Z. L988: Kryteria wyr62niania funkcji syntaktycznych. In:Woköl jgzyka. Wroclaw, 397 -403
TopouNsx-,r, Z. 1990: Opdrateurs polyfonctionnels et coh6sion discursivede la langue parlde In: Croatica, Slavica, Indoeurapea. Wiener Slawisti-sches Jahrbuch, Ergönzungsband 8, 239 -244
Topotwsra, Z. 1994: Z problematyki macedoriskiej skladni dialektalnej(relatywizacja vs. komplementacja). ln: Problemy suöasnot arealogii.Kyiv, 184-191
Zecönsre-BRooKs, M. 1982: Standardization and the acquisition of thestandard language in Poland. ln: International Joumal of Slavic Lin-guistics and Poetics 25/26,97-98
ZaRoN, Z. 1980: Ze studiöw nai.d skladniq i semantykq czasownika. Wroclaw
Ewa Walusiak, Torurt
Lexical exponents of intratextual hierarchy
It is well known that themes of text organization transcend grammar and
semantics of the sentence. Everybody realizes that a set of correct sen-
tences does not have to make a correct text. Some detailed monographsconceming these problerns have appeared in recent yearst. There have
not, however, been many papers about lexical exponents organizing an
utterance longer than a sentence. The aim of this article is just the ele-
mentary description of these exponents. I will work on the expressionswhich divide the text and distinguish one of the parts2 . These expres-
sions have, of course, metatextual character.
1.1 V/e can speak about the hierarchy3 of two elernents (x and y) whenwe are able to compare these elements. It means that these elementshave (or may have) a colnmon feature ( "f ). We compare things takingtheir size, position, colour into account and we compare states of affairstaking their sequence into account, for example. We cannoi compare a
tree with peeling potatoes because we cannot find a common basis ofcomparison for these elements. We speak about the hierarchy of twocompared elements when they differ from each other. The difference is
in degree of intensity of a feature (x is rnore f than /), see (1); or thepresence of this feature vs. ist absence (xis/and yis notl), see (2).
(1) Ten dom jest wigkszy od tamtego.'This house is bigger than that one.'
(2) Ten dom jest duZy, a tamten nie.'This house is big, and that one isn't.'
The monographs DoSRzyNSKA (1993) and DE BEAUGRANDE & DRESSLER(1990) contain an extensive bibliography conceming the theory oftext.Grochowski's papers (or fragments of papers) concem exponents of the metatex-tual hierarchizing function (GRocHowsKI 1986; 1994; 1995; 1996).
A hierarchy can be broadly perceived as an order of elements according to anyfeature (for example a chronology, a size), or only as an organization with grades
of importance.
r240
There are, of course, enumerable different hierarchical structures inthe extralinguistic world. The speaker can express a perceived hierarchy,
cf. (1), (3), (4).The sentence (1) builds the configuration of two ele-
ments (houses) putting them in order to accord to their size. The sen-
tence (3) builds the conhguration of two events, putting them in order
according to their sequence (place in time) and sentence (4) puts things
in order by taking their interposition into account.
(3) Najpier* zjadl §niadanie, a potem wyszedi do pracy.
'He had eaten his breakfast and then he went to work.'
(4) Pi6ro jest Pod stolem''A pen is under the table.'
The hierarchy of configurations (1), (3), (4) results from the observation
of the reality. It is also possible that the hierarchy results from the
judgements about realitya, cf. (5), (6).
(5) Maria jest zdolniejsza od Jdzefa.
'Mary is cleverer than JosePh.'
(6) Oklamal jq i, co gorsza, zostawil.'He lied to her and, what is even worse' left her.'
The speaker can hierarchize elements by not only appealing to the extra-
linguistic reality, but also appealing to the knowledge of this reality, cf.
(7):
(7) Krzeslo jest PrzY stole.'The chair-is at the table.'
The speaker of this sentence (y przy ('at') x) wants the addressee to get to
know where the chair is. The speaker supposes that the addressee willget to know that if he associates the place where the table is with the
place where the chair is. This sentence is reasonable when the speaker
assumes that the addressee knows where the table is and does not know
where the chair is. There is the opposition (known - unknown) of the
elements connected with the preposition przy (x is known and y is un-
known). The speaker puts elements into a certain order, taking the ad-
4 In fact it is sometimes hard to state when an utterance reflects a hierarchy really
existing in the world, anrl when the speaker hierarchizes something (appreciating
reality), cf. (2). Different persons can perceive reality differently, just as they can
appreciate it differently.
241
dressee's knowledge of these elements into account. We hnd a similardependence relation in sentences (8), (9): the addressee does not associ-
ate the places, he associates time of the happening of events.
(8) Przy obieraniu ziemniakdw nerwowo sig rozgl4dal.'While peeling potatoes he was looking around nervously.'
In all cited examples the hierarchy concems the elements of the extralin-guistic world, not the elements of the sentences.
l-Z lt may seem that the sentence (9) implies the same meaning as thesentence (8):
(9) Obieral ziemniaki, przytym nerwowo sig rozgl4dal.'He was peeling potatoes and was looking around nervouslywhile doing that.'
The expressiot przy opens two syntactic positions: for a noun in the loca-
tive, and for a verb of any form. The addressee knows the state of affairsimplied by a noun. The state of affairs implied by a verb is a new piece
of information; compare the analysis of the sentence (7). In the sentence(9) the pronoun is standing in the position of a noun. This is an ana-
phoric pronoun referring to the earlier fragrnent of the text. '1#'e can writedown the meaning of this pronoun in this way: 'this that I said about'(see WtrnzaICKA (197i) and WarszczuK (1980, 147-148)). So the se-
quence rym implies the same state of affairs as the sequence x (x, przy
Um y). The addressee knows the state of affairs implied by the expression
filling the position for a noun in the locative, but this knowledge is notbased on appealing to the extralinguistic reality, but on the strength ofintratextual dependence. The addressee knows what the speaker is think-ing about while saying tym 'that', because the speaker has said x earlier.The elements that hll two syntactic positions of a sequence przy make thehierarchical structure (the known state of affairs - the unknown state ofaffairs). In the sentence (8) the hierarchy has extralinguistic character,and in the sentence (9) - an intratextual one. Sentence (9) contains themetatextual component. In this sentence the text is the source of theknowledge the speaker assumes the addressee has, and in the sentence(8) - the extralinguistic world is the source of the addressee's knowledge.
If the same sentence had a left-hand context and some informationabout the state of affairs x was in this context, the hierarchy would alsohave an intratextual character. So the text would be the source of theaddressee's knowledge, cf. (10):
242
(10) Na krze§le siedzial stary czlowiek i obieral ziemniaki. Przy
obieraniu ziemniakdw nerwowo sig rozgl4dal.'An old man was sitting on a chair and was peeling potatoes.
While peeling the potatoes he was looking around nervously.'
1.3 We can speak about the metatextual hierarchy when:f irst: an expression opens two syntactic positions for elernents differ-ing from each other in the presence of any feature, e. g. (x - known, y -unknown);second: we have a left-hand context (beyond sequences appearing insyntactic positions implied by this expression) and this context containsinformation about the state of affairs x (or about the element x).
It is possible to speak about the metatextual kind of hierarchy onlywhen the expressions being examined have a context containing threedistinguished elements.
2.1 The hierarchizing function described above can be observed withother units, too; see the foilowing sentencess :
(11) Pod fotelem le2y kolorowa maska. Unoszg j4 i zakladam na
twarz. Pulkownik wzywa mnie. Wychodz4c st4d wezmg, pröcz
maski, dwa bicze leLqce na posadzce.
'The colourful mask is lying under the armchair. I am liftingit and putting it on my face. The colonel is calling on me.
Going out of here I'11 take two whips lying on the parquet
floor beyond the mask.'
(12) Ci, ktlrzy nami rzqdzq od pigciu lat, zamiast leczyö tg cho'robg, poglgblli j4, na dodatek tego staraj4 sig zepchn4Ö do
rowu Ko6ciö1.'These people who have governed us for five years, instead ofcuring this sickness have deepened it, and in addition to thatthey have tried to push the Church down.'
(13) - Ona nie bgdzie miala z takiego mgLa |adnej korzy§ci.
- Jestem pewien, Le ona nie tylko nie bgdzie miala z takiegomgla iladnej korzy§ci, ale na pewno dozna niemalej ujmy.
5 Most of these sentences are inexact quotations from contemporary literature. Ihave made some changes in these sentences, necessary for my considerations. Ido not supply sources of these quotations.
243
'- She won't have any profit of such a husband'I'm sure she will not only not have any proltt of such a hus-
band, but also will suffer damage to her reputation.'
(14) Rezoner to kto§, kto lubi glupio rozprawiaÖ i krytykowal. To
slowo kojarzy sig z ludZmi, co nie do§ö, ie möwiq glupoty, t ojeszcze rozdzielajq je na czworo.'A reasoner is somebody who likes to speak and criticize stu-
pidly. This rvord is associated with people who not only say
stupidities, but also divide them into four parts''
(15) - Fryderyk byl czlowiekiem niezwykle inteligentnym.- Na domiartego byl jeszcze m4dry, a to duZo wigcej.
'- Frederick was an exceptionally intelligent man.
- He was also wise on top of that and that is a lot more.'
(16) - Maria sobie §wietnie z tym poradzi.
- MoZe to zrobiö zaröwno ona, jak i Anna.'- Mary will get through it excellently.- Both she and Ann can do it.'
(17) Niektdre murzyriskie szczepy ucinaly uszy swym wrogom - z
tych uszu robiono diugie laricuchy, suszone jak grzyby. Nieja wymy2lilem por6wnanie do grzyb6w (trochg moZe nazbytbrawurowe), ry/ko Slowacki.'Some Negro tribes cropped their enemies's ears. Longchains, dried like mushrooms, were made from these ears. Ihave not invented the comparison to mushrooms (maybe a
little too bravura), but Slowacki did.'
2.2 ln these examples, the expressions under examination have been
used in the context of three elements. If the context contains only twoelements, we would not talk about the metatextual hierarchy. For exam-ple, in sentence (18) the unit under examination hierarchizes the states
of affairs implied by x and y, not just the expressions x and y. Thespeaker of this sentence assumes that the addressee knows (should know)the state of affairs x - the speaker assumes that the addressee has some
extralinguistic (extratextual) knowledge of x.
Y
,!
I
244
(18) Slowo "rezoner" kojarzy sig z ludZmi, co nie do§Ö, ie möwi4
glupoty, to jeszcze rozdzielai1 je na czworo.
'The word "reasoner" is associated with people who not only
say stupidities, but also divide them into four parts''
The fact that the units being examined probably have a metatextual
function in these contexts, too, creates some problems in the analysis.
This function can be explicated by the following sequence: 'I will say
more'6 . A metatextuality in the context of two elements concems, how-
ever, the mechanism of adding informationT , not a mechanism of textual
hierarchy. The hierarchy in this context concerns the extralinguistic
world.This required context of three elements can be contained in one sen-
tence, cf. (12)E . More often, however, we must take into account an ut-
terance longer than one sentence.
2.3 I have to define what I mean by stating that two (x7 and x2) of three
required elements must communicate the same state of affairs, or speak
about the same object (compare the second condition of metatextual
hierarchy ). Generally we can say that the relation between x7 and x2 is a
relation of intratextual referencee . On the basis of the preliminary analy-
This is the wajszczuk,s suggestion conceming the conjunctions (wirtszczux
1986).
The exponents of the intratextual hierarchy also have a metatextual function
which concems the mechanism of adding the information. Their explications
contain the element, 'I want to say more'; compare all the explications'
wajszczuk refrains from description of intrasentential dependens in her research
on intratextual reference (wAJSzczuK 1981, 82). But the sentence (12) can be
transformed into two sentences, compare: Ci, ktörzy nami rzqdzq od pigciu lat'
zamiast leczyö tg chorobg, poglgbiti iq. Na dodatek tego staraiq sig zepchngö do rowu
Ko§ciöl.,These people who have governed us for five years, instead ofcuring this
sickness have deepened it. In addition to that they have tried to push the
church down.,. The same mechanism of reference is in this sequence of senten-
ces and in the sentence (12). It seems that a separate analysis of the units being
examined is superfluous.
Wajszczuk notes the confusion of this concept (WAJSzczuK 1981, 67)' The
author postulates the limitation of this telm to formal (grammatical) facts' Only
the intersentential conjunctions and anaphoric pronouns would take part in the
mechanism of intratextual reference, but it is not justihed to speak about the
function of intratextual reference in case of lexical coherence. The mechanism of
the reference is the same in sentence (16) and in (22). We can speak about intra-
245
sis of sentences (9)-(17) we can state that there are different types ofreference. We ought to distinguish: a) an anaphoric kind of reference, b)an intratextual reference through the reproduction of expressions, and c)an intratextual reference to an element of a semantic structure of x/10 .
a) an anaphoric kind of reference, cf. sentences (9), (12),
(15), (16)
in sentences (9), (12), (15) a pronoun ,o'that' (in the case compatiblewith a syntactic implication of units under examination) refers to theearlier applied verb or rather to the whole proposition (sentences). Inliterature, this type of an anaphoric reference is called a prosenten-tialization (in contradistinction to pronominalization, see below). Apronoun, however, does not substitute f,or a verbll, cf. the incorrectsentence (19):
(19) *Ci, ktörzy nami rzqdzy od pigciu lat, zamiast leczyö tg cho-robg, poglgbili j4, na dodatek poglgbili, staraj4 sig zepchn4ödo rowu Ko5ci6l.'*These people, who have governed us for five years, insteadof curing this sickness, have deepened it, in addition to deeppened, they have tried to push the Church down.'
The pronoun to'that', referring to a verb, has the syntactic features ofa noun, not of a verb12 . So linguists also speak about a verbal pronomi-
textual reference when an anaphoric pronoun as well as a lexical exponent refersto an earlier sentence (one explication is possible for these two types ol refe-rence, compare the formulas at the end of paper). On the other hand, we mustremark that a sentence with an anaphoric pronoun without any context contai-ning an antecedent is semantically incorrect. An analogous sentence realizing theintratextual reference with a lexical exponent is correct. A distinction between ananaphoric kind of reference and the lexical kind of reference is probably neces-sary. Grzegorczykowa recognizes a lexical kind of intratextual reference as ananaphoric technique (GRZEGoRCzyKowA 1996, 7 3-7 5).
This description of different types of reference does not pretend to be a fulldescription of rules of intratextual reference. It only contains elementary ascer-tainments, without which I would not come to the further analysis (more widelyabout intratextual reference see DE BEAUGRANDE & DRESSLER (1990».This may show that an anaphoric mechanism of reference is not a mechanism ofsubstitution. Wajszczuk postulates a resignation from a substitutive interpreta-tion of anaphora (WAJszczuK 1980).
See WISNIEwSKI (1987; 1990) about a possibility of different interpretations ofthe sequence lo (also as a verb).
10
11
t2
t246
nalization, see ToPoLINSKA (1987)'3 or about a propositional antecedent
Paouönva (1985, 164f1). We can import a meaning communicated by averb used earlier into a sentence with units being examined by gram-
matical transformation, compare (9) with (i0).It is worth wondering which passage of the text can be identihed as
x7. The anaphoric pronoun x2 refers to a verb. I see, however, that x7 has
to contain, beyond this verb, arguments irnplied by the verb, too. Com-pare sequence (i2) with (20), (21):
(20) *M6wi4c, Le ci, ktlrzy nami ruydzq od pigciu lai, zamiast
leczyö t9 chorobg, poelpbili jg, na dodatek tego staraj4 sig
zepchn4Ö do rowu Ko§Öi61, möwi4c: "tego", mam na my6ii
fakt, 2e poelgbili.'*Saying that these people, who have governed us for ltveyears, instead of curing this sickness have deepened it, and
in addition to that they have tried to push the Church down,
saying: "that" I think about the fact that they have deepe-
ned.'
(21) Möwi4c, Le ci, ktörzy r.ami rzqdzq od pigciu lat, zamiast
leczyö tg chorobg, poglgbili j9, na dodatek tego staraj4 sig
zepchn4ö do rowu Ko6ciöI, m6wi4c: "tego", mam na my§li
fakt, 2e ci, ktlrzy nami tzEdzy od pigciu lat, zamiast leczyö tp
chorobg, poglgbili jP .
'saying that these people, who have governed us for fiveyears, instead of curing this sickness have deepened it, and inaddition to that they have tried to push the Church down,
saying: "that" I think about the fact that these people, who
have governed us for ltve years, instead of curing this sickness
have deepened it.'
- in sentence (16) an anaphoric pronoun ona,'she' refers to a noun
Maia, 'Mary' (pronominalizationla). In that case the pronoun can be
replaced by the correspondent noun, cf. (22):
13 Compare as well Palrr (1985).
14 See BiLY (1981).
247
(22) - Maria sobie §wietnie z tym poradzi.
- Mo2e to zrobiö zar6wno Maria, jak i Anna.'- Mary will get through it excellently.- Both Mary and Ann can do it.'
I suggest that the whole sentence with the correspondent expression(noun) be taken as x/ also, in cases when a pronoun refers to an expres-sion other than a verb. Compare sequence (i6) with (23).
(23) *Mdwiqc, Le moie to zrobiö zardwno ona, jak i Anna,m6wi4c: "ona", nie mam na my§li tej Marii, o ktdrej po-
wiedzialeS, 2e §wietnie sobie z tym poradzi.'*Saying that both she and Ann can do it, saying: "she", Idon't think about Mary, about whom you said she will get
through it excellently.'
b) an intratextual referencs through the repro-duction of expressions, cf. (L0), (11), (13).
The sequence x2 is the repeated fragment of x7 only in sentence (13).In sentences (10) and (ll), x2 is the expression which has been used inthe other form in x1. The sequence 12 is syntactically implied by theunits being examined.
Using a described type of reference (like an anaphoric kind of refer-ence) the speaker can refer to different expressions by x2. I suggest thewhole sentence with correspondent expression be taken as x7. In thatcase, too, compare (11) with Q0. The sentence (11) also shows that x2
does not need to follow x7 directly.
(24) *M6wi4c, Le wychodz1c st4d wezmg, pröcz maski, dwa biczelei4ce ta posadzce, möwi4c: "maska", nie mam na my§li tejmaski, o ktörej powiedzialem, 2e lezy pod fotelem i jest kolo-rowa.'*Saying that going out of here I'11 take two whips lying onthe parquet floor beyond the mask, saying: "the mask", Idon't think about this mask, about which I said that it wascolourful and was lying under the armchair.'
c) an intratextual reference to an element of a
semantic structure of x1, cf. (14), (17), (25):
Y248
(25) Przyjechalem bez zwloki, Wa$qc byö uczestnikiem pogrze-
bu. Pröcz mnie, dw6ch grabarzy i ksigdza z przycmentarnegoko§ciola, stal tam tylko jeden czlowiek.'I have come without delay, wanting to attend a funeral. Onlyone man stood over there beyond me, two gravediggers and a
priest from a graveyard church.'
In that case the sequence x2 can be a synonym, a hyperonym, an elementcf connotation, a presupposition of "y",, or it can result from x7 (see
DeNs§ 797 4, 32-35 and Gnzr,coRczyKowÄ 1996, 1 3-7 4).
2.3.1 trt is characteristic for all types of intratcxtual reference that theexpression which the speaker chooses and opposes to the oth.er expres-
sion ( y ) appears in x2. The sequences x2 a-nd y have to contain expres-sions corresponding with each other (from the same grammatical class).
For example, in sentence (11) the expressions maska,'mask' and dwa
bicze,'Iwo whips' are opposed to each other, in (14) - möwiq glupoty,'saystupidities' and rozdzielajq je na czworo, 'divide them into four parts', in(16) - ona, 'she'and Maria, 'Mary', and in (11) - ja, 'I'and Slowacki.
The expression which the speaker wants to oppose to the other one(y) does not need to be a single expression in x2, but it has to follow theunits being examined directly in a position implied for the referring se-
quence, compare the incorrect sentences (26) and (27)1s with the corre-
sponding correct sentences (28), (29):
(26) *Jestem pewien, 2e nie tylko ona nie bgdzie miala z takiegomgLa Zadngj korzy§ci, ale na pewno dozna niemalej ujmy.'*I'm sure, not only will she not have any profit of such a
husband, but also will suffer damage to her reputation.'
(21) *Jestem pewien, 2e ona nie tylko z takiego mg2a nie bgdziemiala 2adnej korzy§ci, ale na pewno dozna niemalej ujmy.'*I'm sure, in case of such a husband she will not only nothave any profit, but also will suffer damage to her reputa-tion.'
249
(28) Jestem pewien, Le nie tylko ona nie bgdzie miala z takiegomgia iadnej korzy§ci, ale r6wnie2 jej dzieci.'I'm sure, not only will she not have any proht of such a hus-band, but neither will her children.'
(29) Jestem pewien, 2e ona nie tylko z takiego mg2a niemiala 2adnej korzy§ci, ale na pewno i z 2adne5omgäa.'I'm sure, in case of such a husband she will not only nothave any profit, but also of any other husband.'
2.3.2 lt is not important for my considerations which specific kind ofintratextual reference there is in a given sentence. It is important that thelexemes under examination open a position for a referring expression.The addressee knows x2 on the basis of an earlier fragment of text ( x7 ).I think an adequate sequence implying this meaning will be: 's4dzg, iewiesz, o czyrn (lub o kim) m6wig, möwiqc x2r6 , bo powie«lzialem x7' ('Ithink that you know what (or who) I say when saying x2 because I saidxi).
2.3"3 I assume this formula although the addressee can say x7, too, cf.(13), (15), (16)t' . An adequate forrnula shculd have the following shape:'sqdzg,2e wiesz, o czym (lub o kim) m6wig, m6wi4c x2, bo powiedziale§xi' ('I think that you know what (or who) I say when saying x2 because
irou said x1'). It probably makes no basic difference to the meaning of thelexemes being examined.
2.3.4 lt is also possible that the expression x2 does not contain an ana-phoric pronoun, but a cataphoric one, see (30).
Compare a sequence suggested by Boguslawski, for example in BocUSLAwsKI(7996,44).
Wajszczuk's suggestion is not compatible with the analysis of these sequencestogether with the sentences, where there is one speaker (WAJSZCZUK 1981, 81).It seems that the mechanism of intratextual reference is the same (in differentsentences with the units being examined).
bgdzieinnego
t6
15 These sentences could be correct with an non-typical stress
t7
v2
i
250
(30) Ten grzebany czlowiek bgdzie odtqd we wladaniu ziemi, nag6rze nie zostalo po nim nic pr öcz tego slowa, kt6re jestdetonatorem wielkich lowdw. To slowo brzmi: spisek.'This man being buried will be in the power of the earth everafter; nothing has been left of him above apart from thisword, which causes the explosion. It is the word conspiracy.'
An adequate formula for this sentence should have the following shape:
's4dzg, 2e bgdziesz wiedzial, o czym (lub o kim) mdwig, mdwi4c x2, bopowiem x7' ('I think that you will know what (or who) I say when sayingx2 because I will say x7'). I will take into account only such uses where x1
is in a text earlier than x2. The mechanisms of anaphoric and cataphoricreference one probably differ in direction oniy. The mechanism of textualhierarchy is the same. The addressee knows what the speaker thinksabout saying x2 on the strength of appearance of x7 in a left- or right-hand contextls.
3" The lexemes under eximanination (in sentences (9)-(17), (25), (30))
differ from the viewpoint of the speaker's attitude to the truth of x2:
3.1 The speaker states that x?, using sequences na dodatek,'in addition';opröcz, pröcz, 'beyond', 'in addition to', 'besides', 'apart from', 'except';
l8 There may be, however, some semantic difference between an anaphoric refe-
rence and a cataphoric one (or even between a regressive reference and a pro-gressive one). The speaker in the progressive reference knows that the addressee
does not know what a referring expression refers to. This meaning can be writtendown as follows: 'I know that you don't know what I'm saying when saying x:;you will know what I'm saying when saying rc2 because I will say xr'. The speakerplays with the addressee. This play consists in the fact that the speaker does notneed to say xr and the addressee will not get to know what the speaker hadthought about. So the addressee depends on the speaker, see the following dialo-gue:
- Wa2ne jest, by jutrzejsza bitwa miala poparcie.
- Wszyscy jq popieraj4. Opröcztych malkontentdw.- Jakich malkontentdw?- Tych, ktdrzy chcq, 2eby6 popelnil samobdjstwo.'- It is important that tomorrow's battle has support.- Everybody supports it. Apart from these malcontents.- What malcontents?- The ones who want you to commit suicide.'
251
przy,'at','near', 'beside', 'over', 'by', 'while'; zaröwno..,, jak i,'both,.,,and', cf. (31)-(34).
(31) *Möwiqc, 2e ci, ktiruy nami rzqdzq od pigciu lat, zamiastleczyö tg chorobg, poglpbili jg i m6wi4c, 2e na dodatek tegostaraj4 sig zepchn4ö do rowu Ko§ci6l, nie m6wi9, 2e chc7,2eby§ s4dzil, Le ci, ktirzy nami rzydzq od pigciu lat, zamiastleczyö tg chorobg, poglpbili jp.
'*Saying that these people, who have governed us for fiveyears, instead of curing this sickness have deepened it, andsaying that in addition to that they have tried to push theChurch down, I don't say that I want you to think that thesepeople, who have govemed us for five years, instead of curingthis sickness have deepened it.'
(32) *Möwi4c, 2e wychodzqc st4d wezmg, pröcz maski, dwa biczeleL4ce na posadzce, nie m6wig, 2e chc1,2eby§ s4dzil, 2e rvy-chodz4c st4d wezmg maskg.'*Saying that going out of here I'll take two whips lying onthe parquet floor beyond the mask, I don't say that I wantyou to think that going out of here I'll take the mask.'
(33) *Mdwi4c, 2e na krze§le siedzial stary czlowiek i obieral ziem-niaki i m6wi4c, Le przy obieraniu ziemniaköw nerwowo sigrozgl4dal, nie mdwig, 2e chcg, Zeby§ s1dzll, 2e (staryczlowiek) obieral ziemniaki.'*Saying that an old man was sitting on a chair and was peel-ing potatoes and saying that while peeling the potatoes hewas looking around nervously, I don't say that I want you tothink that (an old man) was peeling potatoes.'
(34) *Mdwi4c, 2e Maria sobie §wietnie z tym poradzi i m6wi4c, 2e
mo2e to zrobiö zaröwno ona, jak i Anna, nie m6wi9, Le chc1,2eby§ s4dzil, Le moile to zrobiö Maria.'*Saying that Mary will get through it excellently and sayingthat both she and Ann can do it, I don't say that I want youto think that Mary can do it.'
3.2 The speaker also states that x2, using sequences nie do§ö, ie..., tojeszcze and nie tylko..., lecz takie,'not only..., but'. These expressions,however, imply something more. Using these units the speaker does not
?
252
want the addressee to think that x2 can be said and nothing more can be
said, cf. (35), (36):
(35) *M6wi4c, 2e ona nie tylko nie bgdzie miala z takiego mg2aiadnej korzy§ci, ale na pewno dozna niemalej ujmy, niemöwig, Le chc1, 2eby6 s4dzil, ie ona nie bgdzie miala z ta-kiego mg2a 2adnej korzy§ci i nie mdwig, 2e nie chcg, Zeby§
s4dzil, 2e moLna powiedzieö, 2e nie bgdzie miala z takiegomgLa Ladnej kcrzy§ci i nie mo2na powiedzieö wigcej.'*Saying that she will not only not have any profit of such ahusband, but also will suffer damage to her reputation, Idon't say that I want you to think she won't have any profitof such a husband and I don't say that I don't want ,vou tothink that it can be said that she won't have any prolit ofsuch a husband and nothing more can be said.'
(36) *Möwi4c, 2e rczoter to kto§, kto lubi glupio rozprawiaö ikrytykowaö i möwi4c, 2e to slowo kojarzy sig z ludZmi, co nie
do§6, 2e möwi4 glupoty, to jeszcze rozdzielaj4 je na czworo,nie mdwig, 2e chc1,2eby§ s4dzil,2e to slowo kojarzy sig zludZmi, co m6wi4 glupoty i nie m6wig, 2e nie chcg, 2ebyS
s4dzil, Le molna powiedzieö, 2e to slowo kojarzy sig z
ludZmi, co m6wi4 glupoty i nie rno2na o tym slowie po-
wiedzieö wigcej.'*Saying that a reasoner is somebody who likes to speak and
criticize stupidly and saying that this word is associated withpeople who not only say stupidities, but also divide them intofour parts, I don't say that I want you to think that this word
is associated with people who say stupidities and I don't say
that I don't want you to think that it can be said that thisword is associated with people who say stupidities and noth-ing more can be said.'
3.3 The speaker contradicts the statement x2, using sequences nie ...,
tylko,'not..., only' and also nie ..., a,'not ..., and'; nie ..., raczej,'not ...,rather', cf. (37):
253
(37) *M6wi4c, 2e niekt6re murzyfskie szczepy ucinal uszy swymwrogom - z tych uszu robiono dlugie lafcuchy, suszone jakgrzyby i m6wi4c, 2e nie ja wymy§lilem pordwnanie do grzy-
bdw (trochg mo2e nazbyt brawurowe), tylko Slowacki, niem6wi9, 2e nie chcg, Zeby§ s4dzil, 2e ja wymy§lilem por6wna-nie do grzyböw.'*Saying that some Negro tribes cropped their's enemies ears,
that long chains, dried like mushrooms, were made fromthese ears, and saying that I have not invented the compari-son to mushrooms (maybe a little too bravura), but Slowackihas, I don't say that I don't want you to think that I have in-vented the comparison to mushrooms.'
The units under investigation, which serve to set up a hierarchy in thetext, are divided into three groups. Lexemes from the different groups
have different elements of semantic structure. They can conhrm an ear-
lier utterance, or deny it. Such elements of semantic structure as a con-Iirmation or a contradiction are characteristic to dialogic sequences. Theunits under examination appear, however, not only in dialogues (twospeakers), but also in monologues (one speaker).The described mecha-nism is probably one of the ways of "dialogizing" of the monologue(BAcHrrN 1970).
4. The fact that the speaker not only confirms an earlier utterance (or de-
nies it) but also adds new information (using the units being examined)is important for my analysis. This meaning can be written down in thefollowing sequence: 'chcg powiedzieö wigcej ni2 to, co powiedzialem, mö-wiqc, 2e x2' ('I want to say more than I said saying that x2') - for con-firming units and 'chcg powiedzieö wigcej ni2 to, co powiedzialem,mdwi4c, 2e nie x2' ('I want to say more than I said saying that not x2') -for contradicting units.
5. The speaker has to assume that the added information is unknown tothe addressee 's4dzg, 2e nie wiesz, ze y' ('I think that you don't knowthat y'). So a hierarchy built by the units under examination is realizedby the presence and the absence of the same feature (x is known, and y isunknown). But the opposition known - unknown does not imply theopposition important - unimportant. Since y is the new information tothe addressee it could be important information for collocutors: thespeaker says y because he wants the addressee to get to know that y. This
254
is at least the normal case. Let us note, however, that the sequence x/ is
strongly connected with the antecedent text (x2 refers to x1), and y - isnot. This makes it possible to insert in this place a secondary text, whichis not connected with the rest of the utterance. The sequence y can be, totell the truth, new information, but also can be the information which is
lest in the utterance. There is no need to import the element of the shape
'chcg, 2eby§ wiedzial, 2e f ('l want you to know that y') or the element ofthe shape 'chcg, 2eby§ wiedzial. 2e x' ('l want you to know that x') toexplications.
6. According to this analysis, experimental semantic explications may be
suggested. For example, the explication of the sentences with the unitprzy (x1. Przy x2, y) - 'at' (x7. At x2, y) could have the following shape:
's}dzg, 2e wiesz, o czym mdwig, möwi4c: xu, bo powiedzialem: x7;
chcg, 2eby§ sqdzll.2e xi,chcg powiedzieö wigcej ni2 to, co powiedzialem, mdwi4c: x2;
s4dzqc,2e nie wiesz, 2e y, möwig: !('I think that you know what I say when saying: x2 because I said:
Xt',
I want you to think that x2;I want to say more than I said saying: x2;thinking that you don't know that y, I say: y')
Let us check if this formula is adequate:
(10) Na krze§le siedzial stary czlowiek i obieral ziemniaki. Przy
obieraniu 4iemniak6w nerwowo sig rozgl4dal.'An old man was sitting on a chair and was peeling potatoes.
While peeling the potatoes he was looking around nervously.'
'sqdz1,2e wiesz, o czym m6wig, m6wi4c: obieranie ziemniaköw,bo powiedzialem: (stary czlowiek) obieral ziemniaki;chcg, 2eby§ s4dzil, 2e (stary czlowiek) obieral ziemniaki;chca powiedzieö wigcej niZ to, co powiedzialem, möwi4c: bieranie
ziemniak6w;sqdz4c,2e nie wiesz, 2e (stary czlowiek) nerwowo sig rozgl4dal,möwig: nerwowo sig rozglqdal''I think that you know what I say when saying: peeling the potatoes
because I said: (an old man) was peeling potatoes;
I want you to think that (an old man) was peeling potatoes;
I want to say more than I said saying: peeling potatoes;
;,t
I
255
thinking that you don't know that (an old man) was looking'aroundnervously,I say: he was looking around nervously'
I suggest the following explication for the sentences with a unit nie tylko..., lecz takie (xy Nie tylko x2, lecz takie y) - 'not only ..., but' (x1. Notonly x2, buty):
'sqdzg,2e wiesz, o czym m6wi9, möwi4c: x2, bo powiedzialeml. x6chcg, Zeby§ sqdzll,2e x2;nie chcg, Zeby6 s4dzil , Le molna powiedzieö: x2 i nie moZna po-wiedzieö wigcej;chcg powiedzieö wigcej niZ to, co powiedzialem, m6wi4c: x2;sqdz4c,2e nie wiesz, 2e y, m6wig: !('I think that you know what I say when saying: x2 because I said:x1;I want you to think that x2;I don't want you to think that x2 can be said and nothing more canbe said;I want to say more than I said saying: x2;thinking that you don't know that y, I say: y')
Let's check if this formula is adequate:
(38) Demokracji europejskiej co§ sig chyba pomylilo. Nie tylko eu-ropejskiej, lecz amerykariskiej tak2e.'I think the European democracy is wrong. Not only the Eu-ropean one, but also the American one.'
's1dzg, 2e wiesz, o czym m6wi9, m6wi4c: europejskiej, bo po-wiedzialem:demokracji europejskiej co§ sig chyba pomylilo;chcg, 2eby6 sqdzil, äe europejskiej (demokracji co§ sig pomylilo);nie chcg, Zeby§ s4dzil, 2e molna powiedzieö: europejskiej (demokra-cji co§ si9 pomylilo) i nie mo2na powiedzieö wigcej;chcg powiedzieö wigcej ni2 to, co powiedzialem, möwiqc:skiej (demokracji co§ sig pomylilo);s1dz4c, 2e nie wiesz, 2e amerykariskiej (demokracji cos siglo),m6wi9: amerykafiskiej (demokracji coS sig pomylilo)'
europeJ-
pomyli-
256
'I think that you know what I say when saying: the European one
because I said:a European democracy was wrong;I want you to think that the European (democracy was wrong);
I don't want you to think it can be said that the European (demo-
cracy was wrong) and nothing more can be said;
I want to say more than I said saying: the European (democracy was
wrong);thinking that you don't know that the American (democracy was
wrong),I say: the American (democracy was wrong)'
I suggest the following explication for the sentences with a :urrit nie ---,
tylko (x1. Nie x2, tylko y) - 'not ..., only' (x7. Not x2, only y):
'sqdzg,2e wiesz, o czym möwig, möwi4c: xz, bo powiedzialem: x;nie chca, leby§ sqdzll,2e x2;
chca powiedzied wigcej ni2 to, co powiedzialem, möwi4c: nie x2;
sqdzqc,2e nie wiesz, 2e y, m6wig: 1r
('I think that you know what I say when saying: x2 because I said:
xtiI don't want you to think that x2;
I want to say more than I said saying: not x2;
thinking that you don't know that y I say: y')
Let's check if this formula is adequate:
(17) Niektöre murzyüskie szczepy ucinaly uszy swym wrogom - z
tych uszu robiono dlugie laricuchy, suszone jak grzyby. Nie ja
wymy6lilem por6wnanie do grzybdw (trochg mo2e nazbyt
brawurowe), tylko Slowacki.'Some Negro tribes cropped their enemies's ears. Long
chains, dried like mushrooms, were made from these ears. Ihave not invented the comparison to mushrooms (maybe a
little too bravura), but Slowacki has.'
'sqdzg,2e wiesz, o czym möwig, möwi4c: ja wymy§lilem pordwnanie
do grzyb6w, bo powiedzialem: z tych uszu robiono dlugie lafcuchy,suszone jak grzyby;
nie chcg, Zeby§ s4dziö , 2e ja wymy§lilem poröwnanie do grzybdw;
chcg powiedzieÖ wigcej niZ to, co powiedzialem, mdwi4c:
nie ja wymy§lilem poröwnanie do grzybdw;
iIiI
251
sqdzqc, 2e nie wiesz, Le Slowacki (wymySlil pordwnanie do grzy-
b6w), möwig: Slowacki (wymy§lil pordwnanie do grzyb6w)''I think that you know what I say when saying: I have invented thecomparison to mushrooms because I said: long chains, dried likemushrooms, were made from these ears;
I don't want you to think that I have invented the comparison tomushrooms;I want to say more than I said saying: I have not invented the com-parison to mushrooms;thinking that you don't know that Slowacki (has invented the com-parison to mushrooms), I say: Slowacki has'
7. This analysis is only an introductory one. Especially, the suggestedexplications are only a f,rrst attempt to record the meaning characteristicsfor different groups of exponents of intratextual hierarchy. I am sure thatunits of the same groups have different semantic structures. For example,the sequence nie do§ö, ie ..., to jeszcze probably differs from the sequencenie tylko..., lecz takie 'not only..., but'because the first of them hierar-chizes both connected fragments of the text and, implied by these frag-ments, states of affairs ('s4dzg, 2e y jest gorsze od rC ('I think that y isworse than t')).
All three groups of units under examination have two elements of thesemantic structure in common: 'sqdzg, Le wiesz, o czym m6wi9, m6wi4c:x2, bo powiedzialem: x7' ('I think that you know what I say when saying:x2 because I said: x1') and 's4dz4c, 2e nie wiesz, ze y,möwig:. y' ('thinkingthat you don't know that y I say: y'). These two elements are responsiblefor the mechanism of intratextual hierarchizing: the addressee knows oneof the fragments based on the reference to an earlier fragment, and theother fragment is unknown.
All of the lexemes being examined take part in the mechanism of in-tratextual reference (the first element of explications). The remainingsequences of explications are individual for different groups. These ele-ments are responsible for the mechanism of conhrmation or contradic-tion.
All the units take part in the mechanism of adding information (theelement 'chca powiedzieö wigcej' ('I want to say more')).
Let me remark that the metatextuality of the units being examinedconcerns not only their hierarchizing function. Each element of their
258
semantic structure contains a metapleonasm 'm6wig' ('I say'), see WIERZ-
BICKA (1971). The metatextuality concerns also the mechanisms of ad-
ding information or its confirmation and contradiction.The units of the same shape appearing in two-element contexts (the
hierarchy of elements of the extralinguistic world) differ from the expli-
cated units (the hierarchy of fragments of utterance) only by the lirstelement of the formula - there is no sequence 'bo powiedzialem x7' ('be-
cause I said: x1') in this element.
Literature
BAcHTIN, M. 1 970: Problemy poetyki Dostoiewskiego. W arszaw a
B[rY, M. l98l: Intrasentential pronominalization and functional sentence
perspecti:e (in Czech, Russian, English). LllndDE BEAUGRANDE, R.-A.; W. U. DRESSLER 1990: Wstgp do linwistyki
tekstu. WarszawaBocuslAwsrI, A. 1996: Pronominalizacja w zdaniowych uzupelnieniach
predykatöw mentalnych. In: M. Grochowski (red.): Anafora w struk-turze tekstu. Warszawa, 43-48
DANES, F. 7974: Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu. In:M. R. Mayenowa (red.): Tel<st i igzyk. Problemy semanüczna Wroclaw,
23-40DosnzYNsKA, T. 1993: Tekst Pröba üntezy. Warszawa
GRocHowsKl, M. 1986: O metapredykatywnej funkcji niektörych wyra-
2eri partykulowo-przyslöwkowych w strukturze tekstu. In: T. Dobrzy6-
ska (red.): Teoria tekstu. Wroclaw, 139-148Gnocgowsrl, M. 1994: The function of the prepositional phrase and the
lexical meaning of the preposition. A study of sequences containingthe preposition opröcz.ln'. Revue des etudes slaves,537-545
Gnocgowsrl, M. 1995: O mo2liwo§ciach slownikowej charakterystyki
semantycznej przyimkowych jednostek iEzyka. In: M. Grochowski(red.): Wyraienia funkcyine w systemie i tek§cie. Toruri, 89-97
GRocHowsKI, M. 1996: O partykulach jako wykladnikach nawi4zania.
Analiza wyraZenia wrgcz. ln M. Grochowski (red.): Anafora w struk'turze telcstu. Warszawa, 91 -104
GnzEconczYKowA, R. 1996: Polskie leksemy z wbudowan4 informacj4anaforyzacyjn4. In: M. Grochowski (red.): Anafora w strukturze tek-
stu. Warszawa, Tl-77
259
Papuöeva, E. V. 1985: Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s dejs»itel'nost'ju.Moskva
PALEK, B. 1985: Some considerations on pro-verbal forms in Czech, In:Z. Hlavsa, D. Viehweger (ed.): Aspecß of text organization. LinguisticaXI. Praha, 107 -123
TopottNsre, Z. 1987: O "pronominalizacji" wyra2efi werbalnych. In:Prilozi, XII / 2, 1 5 5- I 60
WAJszczuK, J. 1980: Substytucyjna i metatekstowa interpretacja zjawiskaanafory. ln: Juinoslovenski Filolog, XXXVI, 121-151
WAJSzczuK, J. 1981: Pojgcie nawiqzania. Analiza koncepcji ZenonaKlemensiewicza. h: Polonica VIII, 67-83
Warszczur, J. L986: Sp6jnik jako zobowiqzanie. In: T. Dobrzyriska(red.): Teoria tekstu. Zbiör studiöw. Wroclaw, 117-137
WßnzgIcKA, A. 1971: - A. Wierzbicka, Metatekst w tek§cie, In: Ospöjno§ci tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wroclaw, 105 - 123.
WISNIrwsru, M. 1987: Formalnogramatyczny opis leksemöw ro. 1. Slowoto w funkcji rzeczownika lub przymiotnika. In: Acta Universitatis Ni-colai Copernici, Filologia Polska XXIX, L74,27-42
WISNmwsru, M. 1990: Formalnogramatyczty opis leksem6w ,o. 2. Sloworo w funkcji sp6jnika, partykuly, czasownika niewla§ciwego. ln: ActaUniversitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XXXI, 91-119
tt










































































































































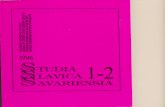







![Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f3e485efe380f30672ea/le-bas-danube-dans-la-seconde-moitie-du-xi-eme-siecle-nouveaux-etats-ou-nouveaux.jpg)




![Oświata polonijna w Szczecinie w świetle dokumentów MSZ Drugiej Rzeczypospolitej [Bildung der polnischen Minderheit in Stettin, im Licht der polnischen Außenministerium Dokumente]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63135753c32ab5e46f0c602b/oswiata-polonijna-w-szczecinie-w-swietle-dokumentow-msz-drugiej-rzeczypospolitej.jpg)
![Giger_Menzel_Wiemer Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia [= Studia Slavica Oldenburgensia 2]. Oldenburg 1998](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225cfc61d7e169b00c98c0/gigermenzelwiemer-lexikologie-und-sprachveraenderung-in-der-slavia-studia-slavica.jpg)






