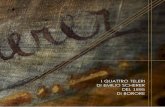Callies, M., Ogiermann, E. \u0026 Szcześniak, K. (2010) “Genusschwankung bei der Integration von...
Transcript of Callies, M., Ogiermann, E. \u0026 Szcześniak, K. (2010) “Genusschwankung bei der Integration von...
Strategien der Integration und Isolation nicht-nativer
. Einheiten und Strukturen
Herausgegeben von Carmen Scherer und Anke Holler
De Gruyter
·~
ISBN 978-3-11-023431-2 e-ISEN 978-3-11-023432-9 ISSN 0344-6727
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.
© 2010 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York
Druck: Hubert & Co, GmbH & Co. KG, Göttingen €9 Gedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Inhaltsverzeichnis
Anke Holler und Carmen Scherer Einleitung ......................................................... .
MartinNeef Die Schreibung nicht-nativer Einheiten in einer Schriftsystemtheorie mit einem mehrschichtigen WOrtschatzmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Horst Haider Munske o.k. [o'ke:] und k.o. [ka'o:]. Zur lautlichen und graphischen Integration von Anglizismen im Deutschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Evan-Gary Cohen Predicting Adaptation Patterns: Multiple Sources ofHebrew Vowels in English Loanwords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Marcus Callies, Eva Ogiermann undKonrad Szczesniak Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern im Deutschen und Polnischen ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Heide Wegener Fremde Wörter- fremde Strukturen. Durch Fremdwörter bedingte strukturelle Veränderungen im Deutschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rüdiger Harnisch Integration und Isolation von suffixverdächtigen Fremdwörtern -das Deutsche in typologischer Perspektive ............. , . . . . . . . . . . . . . I 05 .
LuiseKempf Warum die Unterscheidung fremd-nativ in der deutschen Wortbildung nicht obsolet ist ............ , .......................... 123
Agnes Kolmer Kontaktbedingte Veränderung der Hilfsverbselektion im Cimbro Ergebnisse einer Pilotstudie ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Gisela Zifonun Von Bush administration zu Kohl-Regierung: Englische Einflüsse auf deutsche Nominalkonstruktionen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-
VI
Anke Holler und Carmen Scherer Zur Argumentstruktur entlehhter Verben . : .......................... : 183
Takashi Nakajima Loan W ords Get-by with A Little Help from Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Beatrice Alex und Alexander Onysko Zum Erkennen von Anglizismen im Deutschen: der. Vergleich einer automatisierten und einer manuellen Erhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Anke Holler und Carmen Scherer
Einleitung
Entlehnungen sind eines der linguistischen Themen, die nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch in der interessierten Öffentlichkeit sowie in- Verlagswesen und Lexikographie auf große Resonanz stoßen. Hinsichtlich des Umgangs mit Entlehnungen lassen sich dabei zwei grundlegende Tendenzen erkennen: Einerseits lässt sich eine Fokussierung auf lexikalische Entlehnungen beobachten, andererseits erfahren die entlehnten Wörter sowohl in der Lexikographie ("Fremdwörterbücher") als auch in der Sprachtheorie oft eine Sonderbehandlung. Im ersten Fall wird übersehen, dass es neben lexikalischen Entlehnungen auch Entlehnungen unterhalb und oberhalb der Wortebene gibt Zu nennen sind hier insbesondere die Entlehnung von Phonen oder Phonemen (z.B. [3] in Genie), von Graphen oder Graphemen (z.B. <ph> in Philosophie) sowie die Übernahme von gebundenen Morphemen wie /ier/ in buchstabieren oder /thek/ in Mediathek. Daneben finden sich aber genauso Entlehnungen größerer Einheiten wie syntaktischer Strukturmuster (z.B. in 2009 oder Air Berlinfliegen) oder komplexer semantischer Einheiten (eine CD brennen). Im Falle der Sonderbehandlung von Entlehnungen wird hingegen die Tatsache ausgeblendet, dass zwischen nativen und nicht-nativen Einheiten und Strukturen systematische Beziehungen. bestehen, die es sowohl sprachtheoretisch als auch lexikographisch aufzudecken gilt. Es ist ein maßgebliches Ziel des vorliegenden Sammelbandes, genau diese Zusammenhänge herauszuarbeiten.
Die Literatur im Bereich der Entlehnungsforschung ist breit gefächert und äußerst umfangreich. Selbst fiir eine Einzelsprache, wie z.B. das DeutSche, ist sie kaum vollständig zu überblicken. Dennoch liegen nur wenige systematischtheoretische Beschreibungen nicht-nativer :ßinheiten vor, die zugleich mehrere sprachliche Ebenen berücksichtigen. Nennenswerte Ausnahmen sind die Arbeiten von Munske (1988) und Eisenberg (2001). Die Mehrzahl der VeröffentlichUngen befasst sich eher mit einzelnen Aspekten nicht-nativer Einheiten, etwa mit den Motiven, den Konsequenzen und der Akzeptanz von Fremdwörtern (Zabel (Hg.) 2001, Gardt!Hüppauf (Hgg.) 2004) oder mit Entlehnungen aus bestiminten Sprachen wie dem Französischen (Volland 1986, O'Halloran 2002, Eroms 2006), dem Lateinischen und Griechischen (Munske/Kirkness (Hgg.) 1996, Kirkness 2001), dem Arabischen (Tazi 1998) oder Chinesischen (Sons 1998, Best 2008). Besonders intensiv erforscht ist der Bereich der Anglizismen (Zürn 2001, Glahn 2002, Muhr/Kettemann (Hgg.) 2002, Bechet~ Tsarnos 2005, Onysko 2007). Im Bereich der Grammatik finden sich vor allem Fo!schungsarbeiten, die sich auf einzelne grammatische Teilbereiche beziehen:
Marcus Ca/lies, Eva Ogiermann unß Konrad Szczesniak
Genusschwankung bei der Integration von englischen Lelinwörtem im Deutschen und Polnischen
1. Einleitung
Die Verwendung von Anglizismen in Sprachen, die über die grammatische Kategorie des Genus verfügen, setzt voraus, dass den entlehnten Wörtern ein· Genus zugewiesen wird. Bei der Genuszuweisung greifen Sprecher der entlehnenden Sprache unter anderem auf die Kriterien der eigenen Muttersprache zurück. Hinzu kommen eine Reihe von lehnwortspezifischen Zuweisungsregeln (vgl. hierzu Corbett 1991: 75-:-82). Da Genuszuweisung das Ergebnis . der Interaktion verschiedener Kriterien ist, die meist unbewusst angewendet werden, kann man gerade bei neuereil Anglizismen beobachten, dass sie mit mehreren Genera auftreten können, wie z. B. der/die/das Badge ('Anstecker',
. 'Abzeichen'). Diese Variation in der Genuszuweisung bei der Integration von Lehnwörtern wird mit dem Terminus "Genusschwankung" bezeichnet (im. Englischen "gender variation", "gender vacillation" oder" gender wavering").
Der massive Einfluss des Englischen ermöglicht es, Integrationsprozesse bei Anglizismen in verschiedenen europäischen Sprachen genauer zu betrachten .. Gerade die Untersuchung von Sprachen mit unterschiedlichen Genuszuweisungsregeln kann entscheidende Erkenntnisse über den Prozess der Genuszuweisul1g und das Phänomen der Genusschwankung·liefern (vgl. SchulteBeckhausen 2002: 234). Während im Polnischen die Genuszuweisung fast· ausschließlich auf der Grundlage von morphonologischen Kriterien erfolgt, gibt es im Deutschen eine Reihe. von formalen und semantischen Faktoren, die genusdeterminierend wirken. Das eingangs erwähnte Phänomen der Genusschwankung. bei Anglizismen im Deutschen 1st bislang. nicht umfassend untersuchtworden, für Anglizismen im Polnischen fastüberhaupt nicht erforscht.
Die vorliegende Arbeit untersucht Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern im Deutschen und Polnischt;:n. Es soll der Frage nachgegangen werden, welche Ursachen zu Genusschwankung führen, welche Faktoren sie begünstigen bzw. ihr Auftreten eher unwahrscheinlich machen. Besonders interessant sind hierbei eventuell auftretende Unterschiede zwischen dem Deutschen und Polnischen. Ferner wird untersucht, inwieweit die
· für das Deutsche vorgeschlagenen Erklärungsmuster auf Genusschwankung im Polnischen anwendbar sind und welche Rolle die Genuszuweisungsregeln in · der jeweiligen Nehmersprache für das Ausmaß von Genusschwankung spielen.
66 Marcus Ca/lies, Eva Ogiemzann und Konrad Szczesniak
2. Genuszuweisung im Deutschen und Polnischen
Das Genussystem des Englischen untersch~idet zwischen einem persönlichen und einem unpersönlichen Genus (Corbett 1991: 12), das an genusspezifischen Pronomina markiert wird. Die Genuszuweisung erfolgt anhand von se:r;nantisehen Kriterien, insbesondere anband von natürlichem Geschlecht. Da beim ·unpersönlichen Genus bis auf wenige Ausnahmen keine Genusunterscheidung erfolgt, kann bei Anglizismen das Genus nicht mit entlehnt werden. Bei der Genuszuweisung werden folglich überwiegend die Genuszuweisungsregeln der entlehnenden Sprache herangezogen (Corbett 1991 ~ 74).
2.1. Genuszuweisung im Deutschen
Das Deutsche verfügt über ein komplexes Genusklassifikationssystem. Die Genuszuweisung wird von einer Reihe konkurrierender phonologischer, morphologischer und semantischer Kriterien bestimmt (Corbett 1991: 49). Unter den semantischen Regeln stellt das natürliche Geschlecht sicherlich die robusteste Kategorie dar, während das Leitwortprinzip oder die Zugehörigkeit zu einem semantischen Feld lediglich Tendenzregeln darstellen. Die semantischen Felder weisen Substantiven aufgrund ihrer Zugehörigkeit. zu diesen Feldern ein bestimmtes Genus zu. Nach dieser Regel erhalten z. B. Wochentage (der Montag, der Freitag), alkoholische Getränke (der Wein, der Wodka) oder Gewürze (der Pfeffer, der Kümmel) das männliche und Bäume (aie Kiefer, die Birke), Blumen (die Rose; die Tulpe) und Flüsse (die Mosel, die Donau) das weibliche Geschlecht, während Farben (das Rot,. das Blau), Städtenamen (das katholische Münster) und Sprachen (das Englische, das Polnische) zum Neutrum tendieren. Beim Leitwortprinzip hingegen übernehmen verschiedene Hyponyme das Genus ~<:;s Hyperonyms. Somit ist z. B. nicht nur der Wagen maskulin, sondern auch der Honda, der Mercedes und der Twingo. Illsbesondere bei Markennamen bietet das Leitwortprinzip eine recht zuverlässige Genuszuweisungsregel. Allerdings wird zu Recht darauf hingewiesen, dass Gruppenanalogie und Genuszuweisung nach dem Leitwortprinzip häufig kaum voneinander zu trennen und dass möglicherweise "formale Kriterien mit größerer Reichweite, unabhängig von ·der Semantik, eine bestimmte Genuszuordnung favorisieren" (Scherer 2000: 19).
Im Deutschen kann selbst das natürliche Geschlecht von formalen, d. h. phonologischen und morphologischen, Genuszuweisungskriterien übertroffen werden, insbesondere bei der Bildung des Diminutivs. Die dem Diminutivum zugrunde liegende Konnotation mit etwas Kleinem, Jungem oder Unreifen zieht das·neutrale Geschlecht nach sich (der Mann~ das Männlein). Da es
Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 67
sich bei Diminutiven um Derivata handelt, bestimmt hier aber das Ableitungssuffix das Genus. Ableitungssuffixe ~rmöglichen eine nahezu eindeutige Genuszuweisung und werden sogar als Genusmorpheme angesehen: (Wegener 1995: 74). Pseudosuffixe (der Himmgl die Bu!tflL der Namg.), gleichen zwar formal echten Suffixen, sind jedoch als phonologische Regeln einzustufen (z. B. Chan 2005: 62). Im Gegensatz zu Ableitungssuffixen stellen Pseudosuffixe, mit Ausnahme der Schwa-Regel, eher Tendenzkriterien dar.
Bei einsilbigen Substantiven sirid formale Kriterien noch weniger zuverlässig; Köpckes (1982) Versuch, die Genusverteilung bei Einsilbern durch phonologische Kriterien zu erfassen, wurde stark kritisiert, da elf der aufgestellten 24 Regeln lediglich ein (meist das feminine) Genus ausschließen. Zudem komi:nen die untersuchten Konsonantenkombinationen im An- und Auslaut nur bei einem geringen Teil des deutschen Wortschatzes vor, noch seltener in entlehnten englischen Wörtern, weswegen diese bei der Genuszuweisung von Lehnwörtern eine sehr untergeordnete Rolle spielen (z. B. Scherer 2000: 17f.). Ähnliches gilt für die Schwa-Regel, da in Lehnwörtern ein orthographisch vorhandenes <e> sehr häufig nicht gesprochen wird (Scherer 2000: 17, Onysko 2007: 163), Da jedoch zwei Drittei der von Köpcke analysierten Einsilber das maskuline Genus erhalten, kann man aus seiner Studie zumindest schließen, dass Einsilber tendenziell maskulin sind (Wegener 1995: 78).
Die Tendenz zum Mas~linum istauch für einsilbige Anglizismen charakteristisch (Schulte-Beckhausen 2002: 62). Die Konkurrenz zwischen Maskulinum und Neutrum (Carstensen 1980b: 10, Fischer 2005: 295-299) wird hier noch dadurch verstärkt, dass Lehnwörtern ein höheres Abstraktionsniveau zi.lgeschrieben wird (Talanga 1987: 93, Schulte-Heckhausen 2002: 75-76).
Während fehlende Englischkenntnisse die Assoziation von Anglizismen mit etwas Abstraktem begünstigen, erfolgt die Genuszuweisung bei Sprechern mit guten Englischkenntnissen oft über die Assoziation mit einer bestimmten lexikalischen Entsprechung in der Nehmersprache (z. B. Carstensen 1980a: 55ff., Gregor 1983: 47ff.). Allerdings ist die nächste lexikalische Entsprechung als Erklärungsmodell fiir die Genuszuweisung zu Recht in Frage gestellt worden, vor allem wegen einiger erheblicher operationaler Schwierigkeiten (siehe hierzu Scherer 2000: 18f; und zuletzt Onysko 2007: 166). Der Einfluss dieses Faktors auf Genusschwankung wird weiter unten diskutiert.
Bei mehrsilbigen Anglizismen dürfte der Unterschied zwischen Suffixen und Pseudosuffixen von den meisten Sprechern nicht wahrgenommen werden, so dass sie zu einer weiter gefassten Kategorie des Wortausgangs zusammengefasst werden können (Schulte-Beckhausen 2002: 31). Umso mehr Bedeutung wird allerdings der Suffixanalogie zugeschrieben, bei der das Suffix eines deutschen Wortes oder eines bereits etablierten Anglizismus bei einem noch nicht etablierten Lehnwort genusbestimmend wirkt (Gregor 1983: 59, Scherer 2000: 16). Schließlich wird argumentiert, dass gegenüber dem nativen Wort-
68 Marcus Callies, Eva Ogiermann und Konrad Szczesniak
schatzsemantische Regeln an Bedeutung zunehmen, während formale schwächer werden (Chan 2005: 267).
2.2. Genuszuweisung im Polnischen
Im Vergleich zum Deutschen verfügt das Polnische über eine recht einfache Genuszuweisungssystematik. Semantische Kriterien beschränken sich weitestgehend auf das natürliche Geschlecht (Menzel 2000: 91), wohingegen der ·Großteil der Substantive ihr Genus nach formalen Kriterien erhält. Während im Deutschen das Genus an den das Nomen begleitenden Determinanten angezeigt wird (Wegener 1995: 65), kann es im Polnischen in den meisten Fällen bereits an der Form der Substantive abgelesen werden (Kucala1978: 9). Aüf phonologischer Ebene gibt der Auslaut der Grundform Auskunft über die Genuszugehörigkeit des Wortes (Kreja 1989: 89) .. Aufmorphologischer Ebene kann das Genus mit Hilfe von Synkretismen von Formen in bestimmten paradigmatischen Positionen bestimmt werden (Batlk:o 2002: 149).
Da das Genus des Substantivs anhand von Synkretismen bei der Deklination bestimmt wird und das Polnische über eine Vielzahl an Deklinationsparadigmen verfügt, ist die Frage nach der genauen Anzah1 der Genera im Polnischen strittig. Von einem Großteil polnischer Sprachwissenschaftler werden fünf Genera postuliert (Kucala 1978, Batlk:o 2002), die auf eine Dreiteilung des Maskulinums nach den semantischen Kategorien 'der Belebtheit und Personalität zurückgehen (Subgenera nach Corbett 1991: 163).
Auch bei der Genusbestimmung von Anglizismen im Polnischen werden weniger Kriterien herangezogen als im Deutschen. Während Faktoren wie Suffixanalogie und Homonymie bei sich typologisch nahe stehenden Sprachen genusbestiinmend wirken können, spielen sie bei Anglizismen im Polnischen kaum eine Rolle (Fisiak 1975: 60). Ähnlich wie beim nativen Wortschatz erfolgt die Genuszuweisung haupt~ächlich anhand phonologischer Kriterien. In Arbeiten, die. auf den Einfluss polnischer Genuszuweisungskriterien auf Anglizismen eingehen (Fisiak 1975, Baran 2003, Nettmann-Multanowska 2003), werden daher Vokale und Konsonanten aufgelistet, die charakteristisch für den Wortausgang der drei Genera sind.
Vereinfacht dargestellt sind Wörter, die auf einen Konsonanten auslauten, maskulin (kot 'die Katze') und die, die auf Ia/ oder einen (meist palatalen) Konsonanten auslauten, feminin (droga 'der Weg'; krawffdi 'die Kante'). Die Vokale Iei, 1':>1 und lf.l hingegen bieten einen zuverlässigen Hinweis auf das neutrale Genus (siano 'das Heu'; pole 'das Feld'; prosi(j 'das Ferkel'). Bei Maskulina, die auf Ia! oder lil, Ii! enden, handelt es sich hauptsächlich um Personenbezeichnungen, die anhand von semantischen Kriterien zuordenbar sind V?zykoznawca 'Sprachwissenschaftler'; wozny 'Hausmeister'). Zu Über-
Genusschwankung bei der Integradon von englischen Lehnwortern 69
schneidungen kommt es also vor allem bei Wörtern, die auf palatale Konsonanten auslauten und daher sowohl feminin als auch maskulin sein können. Eine genaue AufschlüsseJung dieser Konsonanten samt Frequenzangaben findet sich bei Kreja (1989: 90).
Der überwiegend konsonantische Auslaut englischer Wörter führt also dazu, ·dass die meisten Anglizismen im Polnischen das maskuline Genus annehmen. So sind in Fisiaks (1975: 61) Korpus 598 von 668 Anglizismen (89,5%) maskulin. Nettinann-Multanowska (2003: 152) berichtet hingegen, dass im Polnisclien 87% und im Deutschen 49% der von ihr untersuchten Anglizismen maskulin sind.
Während es unter den Anglizismen im Polnischen nur sehr wenige Neutra gibt (18, also 3% bei Fisiak 1975: 61), erhalten viele der Feminina ihr Genus, weil sie Personen bezeichnen. Neben natürlichem Geschlecht werden von polnischen Autoren weitere semantische Kriterien genannt, die jedoch mit sehr wenigen Beispielen belegt werden. So erwähnen sowohl Fisiak (1975: 62) als auch Nettmann-Multanöwska (2003: 122) das Wort rugby, das aufgrundseiner Zugehörigkeit zur semantischen Klasse gra ('Spiel') feminin sei. Das Wort whisky wird dagegen angeführt als ein Beispiel einer Assoziation mit dem
. polnischen lexikalischen Äquivalent wodka. Beide Wörter sind durch die Wirkung phonologischer Regeln von Genusschwankung betroffen. Da das Polnische keine phonologische Regel für Wörter bereithält, die auf li:l auslauten, 1 erhalten sie meist das neutrale Genus (Nettmann-Multanowska 2003: 124) und bleiben indeklinabel (Fisiak1975: 62).
Die stark morphonologisch orientierte Geriuszuweisungssystematik des Polnischen führt dazu, dass dem entlehnten Wort ein Suffix hinzugefügt werden kann, um die Integration in eines der Deklinationspardigmen zu ermöglichen. Dieses Suffix kann als ein weiterer Faktor der Genuszuweisung angesehen werden (Ma.rlczak-Wohlfeld 2006: 4). So spiegelt sich das natürliche Geschlecht von· Anglizismen wie stewardessg_ auf morphonologischer Ebene wieder.
Das Ii! hingegen (das Polnische macht keine Unterscheidungen bezüglich Vokallänge) kann Teil eines Suffixes wie z. B. {-yni} sein, das bei Personenbezeichnungen wie sprzedawczyni ('Verkäuferin') vorkommt.
70 Marcus Callies, Eva Ogiermann und Konrad Szcze§niak
3. Das Phänomen der Genusschwankung
3 .1. Forschungsstand
Genusschwankung wird in der Literatur zum Teil unterschiedlich aufgefasst. Im Allgemeinen besteht jedoch Übereinstimmung darüber, dass als "echte" Fälle von Genusschwankung nur solche anzusehen sind, in denen die verschiedenen Genera nicht zur Unterscheidung von Lexemen dienen, also das Auftreten von zwei oder drei Genera für dasselbe Substantiv ohne jegliche Bedeutungsdi:fferenzierung (Onysko 2007: 174, Schulte-Beckhausen 2002: 79f., Talanga 1987: 14). Daher wäre Variation bei der/das Laptop als Genusschwankung anzusehen, Variation bei der Single ('allein stehende Person') vs. die Single ('Schallplatte') dagegen nicht. Die meisten Studien, die sich mit Genuszuweisung von Anglizismen im Deutschen beschäftigen, behandeln Genusschwankung nur am Rande. D~bei wird ihr Ausmaß. vor allem in den neueren Arbeiten als eher gering eingeschätzt, was allerdings zumindest teilweise mit der Datengrundlage zusammenhängt. Viele Arbeiten verwenden fast ausschließlich die großen Standardwörterbücher (Duden, Wahrig, z. B. Chan 2005) und/oder kleinere Textkorpora. Bei den Textkorpora handelt es sich in der Regel um einen bzw. mehrere Jahrgänge einer überregionalen Zeitung bzw. Zeitschrift, typischerweise Der Spiegel (z. B. Yang 1990, Onysko 2007). Nur selten· sind zusätzlich zu Wörterbüchern und Korpora weitere Daten wie z. B. solche aus Informantenbefragungen hinzugezogen worden (Carstensen 1980a, b, Schulte-Beckhausen 2002, Fischer 2005).
Onysko (2007: 169f.) stellt nur ein sehr geringes Maß an Genusschwankung in seinem Spiegel-Korpus fest, das allerdings nicht quantifiziert wird. Chan (2005: 84) betont ebenfalls, dass die Anzahl von Anglizismen mit Genusschwankung nicht groß sei. Unter den 3105 Einträgen fmden sich 191 (6%), die mit mehr als einem Genus ausgewiesen sind, wovon der weitaus größte Anteil zwischen Maskulinum und Neutrum schwankt (141 Einträge, 5%). Scherer (2000: 14, 96) stellt fest, dass Genusschwankung nur selten zu beobachten und in der Regel von kurzer Dauer sei. Ihre Daten zeigen maximal 2% an Variation, wobei Schwankung am häufigsten zwischen Maskulinum und Neutrum auftritt (12 der 16 Fälle von Genusschwankung). Gregor (1983: 49) geht über eine grobe Schätzung nicht hinaus ("Schwankung des Genus in nicht mehr als 20% aller Fälle").
Die Studien von Carstensen (1980a, b), Talanga (1987), SchulteBeckhausen (2002) und Fischer (2005) beschäftigen sich (in Teilen) detaillierter mit Genusschwankung bei Lehn- und Fremdwörtern im Deutschen. Eine der ersten systematischen Studien zur Genusiuweisung bei Anglizismen ist Carstensen (1980a, b), in der er 14 verschiedene deutsche Wörterbücher mit
Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 71
Ergebnissen einer Befragung von 67 deutschen Muttersprachlern vergleicht. Hauptergebnis dieser Arbeit ist, dass die Anzahl der Wörter, die zwei (vor allem Maskulinum und Neutrum) oder gar drei Genera haben können, größer ist als bis dato angenommen~ Carstensen (1980a: 68) stellt zudem fest, dass die Unsicherheit der befragten Sprecher bezüglich einer klaren Genuszuweisung zunimmt, wenn die Bedeutung des entsprechenden englischen Wortes unbekannt ist, was auf eine wichtige Rolle semantischer Kriterien hinweist. Talanga (1987) arbeitet ebenfalls auf der Grundlage von Wörterbüchern und untersucht Lehn- und Fremdwörter aus mehreren Sprachen. Von 344 Einträgen, die in den Wörterbüchern als schwankend verzeichnet sind, stammten 88 (25,6%) aus dem Englischen, fiir die aber leider keine separate Analyse vorgenommen wird.
Schulte-Be<?khausen (2002) hat die methodologisch bislang ausgereifteste Arbeit zu Genusschwankung bei englischen, französischen, italienischen und spanischen Lehnwörtern im Deutschen seit 1945 vorgelegt. Sie untersucht Genusschwankung in einer Vielzahl von Wörterbüchern (auch in diachroner Perspektive) und vergleicht diese mit der Genusschwankung bei 42 ausgewählten Lehnwörtern2 aufder Grundlage einer Befragung von 160 deutschen
. Muttersprachlern sowie anhand von Zeitungskorpora (Frankfurter Allgemeine Zeitung 1994-1998 und Tageszeitung 1986-:-1996). Von den 311 in den Wörterbüchern untersuchten Anglizismen weisen 13% Genu~schwankung au:t; die besonders stark zwischen Maskulinum und Neutrum (220, 70,7%) ist. 32 Wörter schwanken zwischen allen drei Genera (10,3%), 33 (10,6%) zwischen Femininum und Neutrum und 26 (8,4%) zwischen feminin und maskulin (Schulte-Beckhausen 2002: 104). Die Dominanz der Schwankung zwischen Maskulinum und Neutrum .wird zum einen durch die schwache formale Abgrenzung von Maskulina und Neutra im Deutschen erklärt, zum anderen durch die zahlreichen englischen Substantive ohne formale Markierung. Beim Vergleich mit den Korpus- und Fragebogendaten ergaben sich zwar einige Übereinstimmungen mit den Wörterbüchern, allerdings auch eine Reihe von starken Äbweichungen (Schulte-Beckhausen 2002: 207), die hier nicht im Detail dargestellt werden können}
Fischer (2005) befragte 100 deutsche Muttersprachler mit guten Englischkenntnissen niit Hilfe eines Fragebogens mit 33 Anglizismen. Folgende Hauptergebnisse lassen sich erkennen: Intraindividuelle Variation bei der Genuszuweisung nimmt mit steigender fremdsprachlicher Kompetenz der
2 Davon 22 weitgehend etablierte englische Lehnwörter.
3 Eine knappe Darstellung wird zudem dadurch erschwert, dass die Verfasserin die
· Ergebnisse der Korpusanalysen urid Informantenbefragung bedauerlicherweise nicht systematisch zusammenfassend darstellt, sondern alle Ergebnisse in komplexe Tabellen in den Anhang verschiebt.
72 Marcus Callies, Eva Ogiermann und Konrad Szcze8niak
Sprecher bzw. Kenntnis der Wortbedeutung ab. Interindividuelle Variation besteht hauptsächlich zwischen Maskulinum und Neutrum, und zwar unabhängig von der Kenntnis der Wortbedeutung (Fischer 2005: 284f), die geringste Variation ist zwischen maskulin und feminin zu beobachten. Als einen Hauptfaktor der GenusschwankUng nennt Fischer die Verfügbarkeit verschiedener lexikalischer Entsprechungen im Deutschen. Er vermutet zudem, dass der Kontext, in dem die Testwörter präsentiert wurden, die Genuszuweisung· erleichtert (disambiguiert) und somit Schwankung reduziert. Entscheidend ist das Ergebnis, dass Genusschwankung offenbar am häufigsten bei einsilbigen Wörtern ohne formale morphologische Markierung auftritt, besonders wenn die Bedeutung des englischen Wortes unbekannt ist (Beispiele wie Jam oder Plot, Fischer 2005: 287ff.).
Genusschwankung bei Anglizismen im Polnischen hat nicht zuletzt durch die Iiormativistischen Ansätze der polnischen Sprachwissenschaft verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden. Genusschwankung wird vor allem von Fisiak (1975) und Manczak-Wohlfeld (2006) thematisiert und von beiden Autoren als gering eingeschätzt. Nettmann-Multanowskas (2003) kontrastive Untersuchung von Anglizismen in deutschen und polnischen Wörterbüchern ergab lediglich 9 (3%) Fälle von Genusschwankung im Polnischen gegenüber 57 (10%) im Deutschen. Zu ganz anderen Ergebnissen führte jedoch die von Baran (2003) durchgeführte Studie, in der sie in den USA lebende Polen befragte und bei 39 der47 getesteten Wörter Variation bei der Genuszuweisung feststellte. Allerdings handelt es sich bei ihrer Untersuchung eher um das Phänomen des Codecswitching als um die Integration von Lehnwörtern.
In der Literatur werden eine Reihe von Faktoren genannt, die Genuszuwei- _ sung allgemein und Genusschwankung im Besonderen beeinflussen (siehe besonders Carstensen 1980a Un.d Schulte-Beckhausen 2002). Neben morphonologischen und semantischen Genuszuweisungsregeln (siehe Abschnitt 2) sind dies die Verwendungshäufigkeit eines Wortes, dialektale Unterschiede, Sprachebene - z. B. Fach- vs. Standard- vs. Umgangssprache, schriftliche vs. mündliche Sprache - Kompetenz in· der jeweiligen Fremdsprache bzw. Kenntnis der W ortbedeutung, ·sowie bei experimentellen Studien auch der Präsentationskontext Besondere Bedeutung in Bezug auf Genusschwankung wird der Anzahl der verschiedenen lexikalischen Entsprechungen in der Nehmersprache beigemessen, wobei man davon ausgeht,· dass eine Vielzahl an möglichen Identifikationsbasen eine höhere Variation zur Folge hat, wie etwa bei dem Wort Login, das wenigstens drei mögliche deutsche Entsprechungen mit drei verschiedenen Genera hat: die Anmeldung, das Passwort, der Benutzername.
Schließlich wird in den meisten Arbeiten auch ein diachroner Faktor angesprochen, d. h. wie "neu" bzw. etabliert/integriert ein Anglizismus ist. Dabei betrachten die meisten Autoren Genusschwankung als ein vorübergehendes Phänomen. Zwei Hypothesen sind formuliert worden: a) Genusschwankung
Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 73
tritt typischerweise während der ersten Integrationsphase auf und nimmt "mit fortschreitender Integration im Zuge der Konventionalisierung" ab (Gregor 1983: 50, ähnlich Fischer 2005: 136), und b) Genusschwankung tritt ab der zweiten Integrationsphase mit verstärkter Verwendung durch monolinguale Sprecher auf und kann dann als Vorstufe zum Genuswechsel verstanden werden. Schulte-Heckhausen (2002: 164ff.) findet in ihrer diachronen Wörter-· buchanalyse Bestätigung für beide Hypothesen, wobei Genuswechsel bei Anglizismen im Vergleich zu Lehnwörtern aus den romanischen Sprachen deutlich seltener ist: Drei Viertel aller Wörter mit Genusschwankung schwanken in der ersten Integrationsphase, wie z. B. Cover (m./n. -+ n.), nur bei einem Viertel kommt es zu Genuswechsel, wie z. B. Gang (m. -+ m./f. -+ f) oder Slang(n.-+ n./m.-+ m.)
Angesichts des Zusammenwirkens dieser verschiedenen Faktoren wird Genusschwankung im Allgemeinen als Rivalität der Genuszuweisungsregeln verstanden, wobei in Bezug auf Anglizismen besonders morphonologische und semantische Regeln, häufig mehrere lexikalische Entsprechungen sowie - bei fehlender formaler Markierung oder semantischer Motivierung - das sog. "abstrakte Neutrum" konkurrieren (Schulte-Beckhausen 2002: 229).4 Die eindimensionale Erklärung von Genusschwankung über die Anzahl der möglichen deutschen Identifikationsbasen, wie siez: B. von Gregor (1983: 49)vorgeschlagen wird, ist dagegen wenig· überzeugend; ebenso wenig wie Erklärungsmuster, die nicht-linguistische Kriterien wie willkürliche Genuszuweisung oder das Sprachgefühl anführen (Carstensen 1980a: 58). Neuerdings ist auch vorgeschlagen worden, Genusschwankung im Rahmen kognitiv-linguistischer Ansätze als "different conceptualizations reflecting semantic primitives of gender" (Onysko 2007: 174f.) zu erklären.
3.2. Motivation und Arbeitshypothesen
Obwohl die Ergebnisse der oben besprochenen Arbeiten de:Ö. Schluss nahe legen, das Genusschwankung bei der Integration von Anglizismen insgesamt weit weniger ausgeprägt ist als angenommen, gibt es doch einige Gründe, die das Gegenteil vermuten lassen. In der Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen sind fast ausschließlich Wörterbücher als Datengrundlage verwendet worden, was gewisse Schwierigkeiten bezüglich der Interpretation der Ergebnisse mit sich bringt. V ergleichende Studien haben gezeigt, dass das Phäno:.. men der Genusschwankung in Wörterbüchern zum einen unterschiedlich ge-
4 Für eine Reihe verschiedener Konkurrenzbeziehungen, die · aufgrund der hier gebotenen Kürze nicht im Detail dargestellt werden können, verweisen wir a~f die Darstellung in Schulte-Beckhausen (2002), Kapitel 4.1.1.
74 Marcus Ca/lies, Eva Ogiermann und Konrad Szczesniak
handhabt wird (Schulte-Beckhausen 2002: 80f.) und dass sie sich hil).sichtlich ihrer Dokumentation von Genusschwankung zum Teil stark unterscheiden und demnach "nicht besonders zuverlässig" und uneinheitlich sind (Carstensen 1980a: 39, Schulte-Beckhausen 2002: 92ff.). Zudem dokumentieren Wörterbücher nicht notwendigerweise die Sprachverwendung von linguistisch.untrainierten Sprechern,. sondern repräsentieren Expertenwissen - auch was die Motivierung von Genuszuweisung über Regeln angeht (Carstensen 1980a: 39, 43) - und besitzen normativen Charakter. Insofern ist die Einschätzung von Chan (2005), die Das große Wörterbuch der deutschen Sprache von Duden (GWB) in der CD-ROM Ausgabe von 2000 als Datenbasis verwendete, nicht ohne Vorbehalt zu betrachten: "mit den grammatischen Angaben im GWB kann andererseits zuverlässige Information über die Genuszugehörigkeit der englischen Entlehnungen erhoben werden, was Textkorpora in Form von Datenerhebung aus Zeitungen oder Zeitschriften nicht immer gewährleisten können" (Chan 2005: 81).
Demgegenüber bergen kleinere Textkorpora die Gefahr, insbesondere wenn sie lediglich Texte einer einzelnen überregionalen Zeitung bzw. Zeitschrift beinhalten (wie z. B. die Arbeiten von Yang 1990 oder Onysko 2007), dass hier ein hauseigener Schreibstil bzw. redaktionelle Politik gegenüber der Verwendung eines bestimmten Anglizismus und des entsprechenden Genus dokumentiert wird (Onysko 2007: 177, ähnlich Carstensen 1980a: 39), wobei das Auftreten von Genusschwankung möglicherweise unerwünscht ist. Zudem treten bei der Analyse von elektronischen Korpora einige methodologische Probleme auf, die aus:fiihrlicher in Abschnitt 4.1 besprochen werden. Schließlich haben sowohl Wörterbücher als auch Korpora den Nachteil, dass sie intraindividuelle Variation nicht dokumentieren können.
Auf der Grundlage des oben skizzierten Forschungsstandes lassen sich fiir die vorliegende Untersuchung folgende Arbeitshypothesen ableiten:
(i)
(ii)
Genusschwankung ist weniger ausgeprägt bei Anglizismen, die formal fiir ein bestimmtes Genus markiert sind. Dabei kann es sich um morphonologische Merkmale handeln, z. B. Suffixe wie {-er} ~Maskulinum, { -ing} ~ Neutrum im Deutschen, oder um konsonantischen Auslaut im Polnischen ~ Maskulinum. Es können aber auch semantische Kriterien sein, vor allem das natürliche Geschlecht, das eine nahezu eindeutige Genuszuweisung ermöglicht. Genusschwankung wird begünstigt durch das Fehlen eines formalen Genusmarkers. 5 Im Deutschen sind hier vor allem Einsilber betroffen, im
5 Talanga (1987: 104) nennt dies "Genusschwankung par excellence", die auftrete, wenn weder morphonologische noch semantische Regeln anwendbar sind und auch
Genusschwankung bei der Integration VOIJ.englischen Lehnwörtern 75
Polnischen Anglizismen, die auf einen Vokal auslauten, der nicht den polnischen Genuszuweisungsregeln zugeordnet werden kann, nämlich wie die im Englischen häufig auftretenden /i:/ und /u:/.
(iii) Bei Wörtern, die keine (eindeutige) h~xikalische Entsprechung in der Nehmersprache haben (oder deren viele), steigt die Wahrscheinlichkeit .der Genusschwankung.
(iv) Genusschwankung nimmt zu, wenn die Bedeutung des englischen Wortes unbekannt ist.
4. Methodologie und Daten
Die Untersuchung von Fremdwörtern, die sich in der entlehnenden Sprache noch nicht etabliert und somit kein Genus zugewiesen bekommen haben, schließt die Verwendung von Wörterbüchern als Datenquelle aus. Eine zusätzliche Herausforderung stellt der kontrastive Ansatz der Studie dar, der die Heranziehung von zwei vergleichbaren Datensätzen erfordert.
4.1. Korpusstudie
Wie bereits erwähnt basieren die meisten Untersuchungen zur Genuszuweisung und Genusschwankung auf Analysen einschlägiger Wörterbücher bzw. · kleiner Textkorpora. Um die damit verbundenen Beschränkungen aufzuheben, wurde zunächst überprüft, in wieweit zuverlässig und in ausreichendem Maße Daten zur Genusschwankung aus elektronischen Textkorpora des Deutschen bzw. Polnischen erhoben werden können. Dazu wurden zunächst einige neuere Anglizismen _bezüglich ihres Genus in deutschen Textkorpora überprüft. Dies war zum einen das Korpus der Berliner Zeitung, das alle online erschienenen Artikel der Berliner Zeitung zwischen 1994 und 2005 umfasst (252 Millionen Textwörter) und über die DWDS-Abfrageplattform verfiigbar ist.6 Vier ausgewählte Wörter mit eher niedriger Textfrequenz wurden zusätzlich in COSMAS II getestet.7 Die Korpora belegen zwar, dass bei einigen Testwörtern
keine lexikalische Entsprechung .vorhanden ist, was dann zu Schwankung zwischen Maskulin und Neutrum :fiihre.
6 http://www.dwds.de/textbasis (letzter Zugriff am 11.07 .2008). ·
7 W-öff, Archiv der geschriebenen Korpora, alle öffentlichen Korpora, zum Zeitpunkt der Recherche im Februar 2008 ca. 2,2 Milliarden Textwörter. Verfügbar unter https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/(letzter Zugriff am 11.07 .2008).
76 Marcus Callies, Eva Og~ermann und Konrad Szczesniak Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 77
_ 'cf- 'cf- 'cf- o o o 'cf- 'cf- o 'cf- ~ _ 'cf- 'cf- 'cf- 'cf- Genusschwankung zu beobachten ist, so z. B. bei Movie, Update oder Cookie :§ t:: ~ ~ ~ ~- ~ ~ ...r :§ "5 :;:;. ~ ~- l . (siehe Tabelle 1 und 28
). Jedoch zeigt sich deutlich, dass Korpusanalysen auf-~ .2 t- ('<") ...... ~ S:: ..... ""f" N - N .
rg ~ §. rg ~ grund der großen Menge an irrelevanten, nicht eindeutigen bzw. Treffern ohne ~ S "' ~ :J ;:::; S:! .,., ~ ~ S ~ ~ """ ~ Genusmarkierung und der somit verbleibenden niedrigen Fallzahlen nur sehr
'I:' c bedingt und eingeschräilkt geeignet sind (vgl. Schulte-Reckhausen 2002: 206). ~ o ,., o o o ::R ::R o ::R ::R g o o o o Für das Polnische wird dies zusätzlich durch eine nur begrenzte Verfiigbar-.0 o'- o o o o Q.)
~ ~ ..o- ~ ~ :;;- ~ _ keit von Korpora des modernen Polnisch sowie deren Zusammensetzung 5 ] .,., "' "' "' ~ ] (hauptsächlich literarische Texte) erschwert.9 Die Verwendung des Internet als
] P.. ~ ~ \0 § ~ [t P.. Datenbasis, z. B. durch Suchabfragen mit Google, ist ebenfalls nur sehr einge-~ t schräilkt möglich bzw. liefert kaum zielgerichtete Daten. Korpusdaten können N ,., ,., .;.., ,., ,., ,., ,., ,., o ::R 000
• ::R ::R ::R ::R daher primär zur Ergänzung bzw. Verifizierung/Falsifizierung von in experi-V) • o-..... o' o....._ o' o-..... o' o-..... o-..... o > +-> o o o :5--. N. g ~ ~ ~ ~ ~ :::!: :;6- :::;- :· :E ~ ~ ~ ~- oö mentellen Studien gewonnenen Eindrücken bzw .. Hypothesen eingesetzt wer-V) ~ M ..-- ...... Q NN-N -'
g -: ~ :J den. ~ ~ -Mr:-..-..-ooON M ~ NN...::t-'"<1" 1'! - M - 1::f s ('l ('l \0 "' ~ ~ "' ' :;;; ::R ::R ::R ::R ::R ::R ::R o o o ~ 'cf- 'cf- 'cf-1 o I 4.2. Experimentelle Studie § ~& .. ~~~&> .. ~ ~ ~ .. :.-~ '
~ g 0
~ ;:;::; ~ ~ - N - Auch wenn bei der Korpusstudie deutlich wurde, dass viele Anglizismen nur 1ü .:: - - "' - - - ~ ~ :::!: ~ """ selten bzw. in einem Kontext vorkommen, der keine Rückschlüsse auf das c
:;:: :::: Genus des Wortes zulässt, erwies sie sich bei der Auswahl der Testwörter für ~ .
lXl o ::R o o o o o o o o ~ o o 'cf- o den Fragebogen als nützlich. Nachdem sichergestellt wurde, dass die Test-.g !::! ~ . ~- wörter sowohl von deutschen als auch von polnischen Sprechern benutzt wer-~ ~ 8 ] _ den, d.h. in b~id~n Sprachen ausreiche?d bekannt ~d frequent sind, wur~e ~ ~ .!3 unter Berücksichtigung der Genuszuweisungsregeln Im Deutschen und Polm-8 E sehen (siehe Abschnitt 2) eine Auswahl von 26 Testwörtern getroffen. "ä o o 'cf- o o 'cf- 'cf- '$. '$. 'cf- ~ 'cf- ~ '$. '$. Die Auswahl der Testwörter ergab für beide Sprachen eine Aufteilung in ~ "' - "' ,_ oo =o ,....... oo o .-• .-. w· d h b · R 1 d · · ·1· ·· N hm h · t:: ~ oö ö v5 r-f ~ ~ lD .><i .-: N "' ~ örter, enen nac estimmten ege n er JeWei Igen e ersprac e em :0 ~ N M ct.:lt: 00 Vl
~ ~ · ~ ~ s Genus zugewiesen werden kann, und solche, bei denen die Sprecher auf andere ~ 8
""" ~ - - "' ~ c c "' ~ -~ ~ Kriterien ausweichen müssen. Der Fragebogen enthält somit: 5 !~ . +-" ..= &; • w
;§ öh ::R ::R ::R ::R ::R ::R ::R ::R ;o;::.," 'cf- '~ :=: öh 'cf- 'cf- 'cf- 'cf- L Wörter, die ein natürliches Geschlecht haben oder zu einer bestimmten ....... ·- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;> - ·- 0 0 0 0
~ ·~ 8 ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ·~ 8 8 8 8 semantischen Klasse gehören: Bitch, Coach; Alcopop, Shake, Techno, Do-bll [) =:s N [) .
· gl · .o o:s N. .o mam ~ ~ ~ ~ N N ~ ~ ~ ~ V ·- n ~ ~ 0 -
"d) ~ ~ V tn ~ - =: \0 .,g ~ ~ t- l- M N
~ ~ ~fr ! § E-< • "' "' ,_ ,_ "' ~ ~ s:; - ;;:1; § ~ E-< .; "' o "' "' • Erläuterung zu einzelnen Spalten: mask. I neut. = Die Verwendung des unbestimm-"' i'l N
00 -
00 N - - - - -~ 0) N ~ \0 ~ Artik 1 . b fl k:t" F 1 b . z dn . b "d G ka ·;; oo """ .,., ~ 5 oo - - ten e s em zw. e 1erter ormen er au t eme uor ung m e1 e enus te-
~ 1:l ;g gorien. Genus nicht markiert = Fälle, in denen kein Artikel verwendet wurde bzw. gl gl 1=i kontextuell nicht iu erschließen war. bereinigt = Nicht relevante Treffer wie . z.B. ~ ~ \§ Cookie in der Bedeutung 'Keks, Plätzchen', Treffer in Eigennamen von Firmen oder
. . Produkten und in englischsprachigen Textpassagen wurden nicht berücksichtigt. ~ ~ ., ·"' ., ., .!!:! ~ ., .~ .,
9 So zum Beispiel das PELCRA Reference Corpus of Polish (korpus.ia.uni.lodz.pll) - ., ·- ·- :!;! ~ - <:::! :::::: ·- ""' ~ d d . . 1/" d h ?1 1 ) .Oi ·!;() ii'i 5 g ~ ~ ·]. ~ ~0 .i?lJ <» ~ 2 ~ ] o er as IPI PAN Korpus (korpus.p m ex.p p. ang=en&page=we come . '-§· ..s d:; ~ l.l <:q '::; ::5 ~ t;:; \.!:) '-§ '-1 l.l <:q "" . !;.::; ' !;.::;
78 Marcus Callies, Eva Ogiermann und Konrad Szczesniak
· 2. Wörter, die durch ein (Pseudo-)Suffix markiert sind: Browser, Voucher, Casting, Posting Label, Jingle10
3. deverbale Nomen mit Partikel: Download, Update, Take-off, Login 4. Wörter, die nach ihrem Wortausgangnicht eindeutig einem Genus zugewie
sen werden können, z. B. kommt der Auslaut /d3/ im Deutschen und /i:/ und /u:/ im Polnischen nicht vor: Preview, Crew; Movie, Cookie ('Internetprogramm'); Badge, Stage
5. Einsilber: Gate, Safe, Slot, Gig
Die ausgewählten Testwörter wurden. anschließend in Sätze eingebettet, die eine (im Deutschen) bzw. mehrere Lücken (im Polnischen) enthielten, und zwar überall dort, wo mit Hilfe eines Determinanten das Genus des Testwortes angegebenwerden sollte. Die Sätze wurden angeglichen, so dass sie in diesen Sprachen: identische Entsprechungen darstellen. Im Deutschen handelt es sich bei den zu ergänzenden Merkmalen durchgehend um bestimmte Artikel. Da es im Polnischen keine Artikel gibt, das Genus aber an diversen Determinanten wie auch an den Verbendungen markiert wird, enthalten die meisten polnischen Sätze mehrere Lücken. Zusätzlich zur Markierung des Genus (hier waren Mehrfachnennungen möglich) sollten die Informanten auch ankreuzen, ob ihnen die Bedeutung des jeweiligen Wortes bekannt ist, und dann eine ungefähre Entsprechung in ihrer Sprache angeben.
7) Sehr zur Erleichterung seiner Fans dementierte Quentin Tarantino sämtliche Gerüchte, daß nächste Movie seine Karriere beenden werde.
D Ich kenne die Bedeutung des Wortes: Eine ungefähre deutsche Entsprechung ist z. B. das Wort ______ .
D Ich kenne die Bedeutung des Wortes nicht. D Ich bin mir bezüglich der Bedeutung des Wortes unsicher.
Abbildung I: Fragebogenausschnitt fiir das Testwort Movie (deutsche Fassung)
5) Ku tildze fan6w, Tarantino zaprzeczyl pogloskom, jakoby jego nast<(pn __ movie mial __ zakoiiczyc jego kariert(.
D Znam znaczenie tego slowa. Bliskim polskim odpowiednikiem jest slowo
D Nie znam tego slowa. D Nie jestem pewien co do znaczenia tego slowa.
Abbildung 2: Fragebogenausschnitt fiir das Testwort Movie (polnische Fassung)
10 /~V ist anfällig fiir Variation im Deutschen, vgl. Schulte~Beckhausen (2002: 138f.). Auf die Verwendung von Phantomwörtern wurde hier verzichtet, zumal frühere Tests, z. B. von Carstensen (1980a: 62f.), nahelegen, dass ein morphologisches Merkmal, z. B. ein Suffix, die Zuweisung eines bestimmten Genus befördert.
Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 79
Der Fragebogen wurde an zwei deutschen und einer polnischen Universität an 146 deutsche und 100 polnische Muttersprachler verteilt, alle Studentinnen der Anglistik. Von den deutschen Teilnehmerinnen waren 44 männlich und 102 weiblich, im Durchschnitt 21,7 Jahre alt und im 2. oder 3. Semester. Unter den polnischen Informantinnen waren 18 Männer, 80 Frauen (zwei Teilnehmerinnen machten keine Angabe) im Alter von durchschnittlich 20,2 Jahren, ebenfalls im 2. oder 3. Semester. Die Fragebögen wurden anschließend mit Hilfe von SPSS statistisch ausgewertet.
Als Maß fiir die Heterogenität der nominalskalierter Variablen "Genus" wurde ein in den Naturwissenschaften verwendeter Diversitätsindex gewählt, nämlich Simpson's D (Müller-Benedict 2006: 113f).11 Anders als bei der üblicheren Berechnung der V ariationsbreite, bei der lediglich die Anzahl der genannten Genera berücksichtigt wird, gibt der Diversitätsindex Auskunft darüber, ob die Antworten sich auf verschiedene Genera gleichmäßig verteilen oder ob sie eher auf ein Genus "konzentriert" sind. Die Variationsbreite allein ist kein zuverlässiges Maß fiir Genusschwankung: Während sich z. B. bei den Testwörtern Domain und Gate die Antworten der polnischen. Informantinnen zwar auf 5 verschiedene Kategorien verteilen (inkl. Mehrfachnennungen), fallen sie zu 93,8% bzw. 92,5% in nur eine Kategorie. Dies ergibt zwar die Variationsbreite von 5,jedoch einen relativ niedrigen D-Wert (0,15 bzw. 0,18).
5. Ergebnisse und Diskussion
Für Wörter, die bei der Genuszuweisung im. :Qeutschen bzw. Polnischen ein erhebliches Maß an Variation aufweisen, ist das Zusammenfallen der folgenden Merkmale zu beobachten: die Variationsbreite liegt zwischen 3 und 7, D ist grqßer als 0,4, und es tritt in der Regel auch intraindividuelle Variati<~n auf (die betreffenden D-Werte sind in Tabellen 3 und 4 grau unterlegt). In Bezug aufinterindividuelle Variation überrascht die recht große Zahl an Testwörtern, fiir die in beiden Sprachen alle drei Genera angegeben wurden (12 bzw. 13 von
11 Der Diversitätsindex bezieht die Häufigkeiten der Antworten in der jeweiligen Genuskategorie mit ein, . d. h. wie oft bzw. selten ein bestimmtes- Genus m den Antworten repräsentiert ist. Der Wert D ist dabei eine Zahl ZWischen 0 und 1: D ist 1, wenn alle gegebenen Antworten gleichmäßig unter den Genera verteilt sind (also z. B. 50 mal maskulin, 50_ mal feminin und 50 mal neutrum). D ist 0, wenn alle gegeben Antworten in nur eine Kategorie fallen, also konsistent nur ein Genus vorkommt und keine Variation erkennbar ist. Kurz gesagt: je höher der Wert fiir D, desto mehr Variation·findet sich in den Antworten.
80 Marcus Callies, Eva Ogiermann und Konrad Szczesniak
26). Am zweitstärksten ausgeprägt ist Genusschwankung zwischen Maskulinum und Neutrum (9 bzw. 6 von 26 Wörterti). Intraindividuelle Variation ist in beiden Sprachen ebenfalls überwiegend auf Schwankung zwischen Maskulinum und Neutrum zurückzuführen (18 bzw. 15 von 26), im Polnischen ist aber auch mehr Variation zwischen maskulin und feminin zu beobachten (12 vs. nur 6 Fälle im Deutschen).
Die Dominan.Z von Schwankung zwischen Maskulinum und Neutrum könnte zumindest für das Deutsche auf das Wirken des sogenannten "abstrakten Neutrums" (Neutrum als "default") zurückzuführen sein, insbesondere bei erschwerter Motivierung wegen fehlender Markierung und Unkenntnis der Wortbedeutung (vgl. Schulte-Beckhausen 2002: 75ff.; 189). Dies ist auch für das Polnische ein möglicher Erklärungsansatz (Cookie, Badge, Jingle).
In Bezug auf Schwankung bei deverbalen Substantiven ~at schon Carstensen (1980a:: 6lf.) gezeigt, dass Substantive, die aus Verb und Partikel bestehen, entweder Neutra sind oder zwischen maskulinem und neutralem Genus schwanken, weil nur in den ailerwenigsten Fällen eine direkte lexikalische Entsprechung im Deutschen vorhanden ist. Carstensen nennt zwei Grundprinzipien, bei denen es sich im Grunde um konzeptuelle Unterschiede in der Motivierung des Genus handelt: a) Tätigkeit/Handlung als kontinuierlicher Verlauf, die das entsprechende deutsche Verb ausdrückt (imperfektive Lesart), deshalb Neutn,gn wie z. B. bei take off= abheben =das Take-Off; b) punktuelle Handlung (perfektive Lesart), mögliche Motivierung über eine existierende lexikalische Entsprechung wie z. B. take-off = der Start/Abflug c= der Take-Off(vgl. auch Schulte-Beckhausen 2002: 132ff.)
Die vorgelegten Ergebnisse bestätigen im Wesentlichen die eingangs aufgestellten Hypothesen, nämlich dass Genusschwankung weit weniger ausgeprägt ist bei Anglizismen, die in der jeweiligen Nehmersprache für ein bestimmtes Genus markiert sind. Genusschwankung tritt dann sehr häufig und in starkem Maße auf, wenn ein formaler Genusmarker fehlt, der eine eindeutige Genuszuweisung erlauben würde (Fehlen eines morphologfschen oder· semantischen Merkmals im Deutschen, Uneindeutigkeit des Auslauts im Polnischen). Bei Wörtern, die keine (eindeutige) lexikalische Entsprechung in der Nehmersprache haben (oder deren viele) steigt di_e Wahrscheinlichkeit der Genusschwankung (z. B. Login, Jingle). Die Hypothese, dass Genusschwallkupg dann auftrete, wenn die Bedeutung des englischen Wortes unbekannt sei, kann allerdings nicht aufrechterhalten werden, sondern muss modifiziert werden. Fehlende Kenntnis der Wortbedeutung bzw. das Fehlen einer lexikalischen Entsprechung allein ist kein zuverlässiger Indikator für da~ Auftreten von Genusschwankung. So gaben z. B. beim Wort Browser 66,6% der deutschen Informantinnen keine lexikalische Entsprechung an (von den übrigen Testpersonen wurden 18 verschiedene Entsprechungen genannt), und mehr als der Hälfte war die Bedeutung des Wortes nicht (sicher) bekannt. Bei Voucher
Genusschwankungbei der Integration von englischen Lehnwörtern
~ ~ Cl .§
~ ~ ~ ] oa ·;; ..0
I "' "' ~ <Y-i ~ ~ ..<:)
~
81
82
.::::
-5 cn
:E ~ .§
~ '0
~ ~ [i ~ ·a; ..0 gp
! cn cn
~ ~
~ ooCl
~·
Marcus Callies, Eva Ogiermann und KonradSzczesniak Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 83
nannten fast 50% der poinischen Teilnehmerinnen kein Äquivalent, ebenfalls rund 50% war die Bedeutung nicht (sicher) bekannt. Dennoch zeigen beide Wörter überhaupt keine bzw. nur ein sehr geringes Ausmaß an Genusschwankung in der jeweiligen Sprache. Dagegen ist die Bedeutung von Movie beinahe allen Informantinnen bekannt und hat sowohl im Deutschen als auch im Polnischen eine klare lexikalische Entsprechung (der Film bzw.Jilm, mask). Dennoch schwankt. das Genus dieses Wortes in beiden Sprachen erheblich. Es lässt sich daher lediglich festhalten, dass fehlende Kenntnis der WOrtbedeutung bzw. Fehlen einer lexikalischen Entsprechung .Genusschwankung zusätzlich verstärkt, sie aber nicht zwingend verursacht. In solchen Fällen scheidet Genuszuweisung über eine nahe lexikalische Entsprechung aus, z. B. bei Cookie, Badge und Jingle im Deutschen, im Polnischen setzen sich phonologi-sche Regeln durch; so bei Gig und Techno. ·
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass folgende Faktoren (in absteigender Gewichtung) das Auftreten von Genusschwankung am wahrscheinlichsten und am ausgeprägtesten machen: 1) natürliches Geschlecht ist nicht vorhanden; 2) Regeln der Genuszuweisung, die über. formale Genusmarker ablaufen, greifen nicht, 3) es gibt kein (eindeutiges) bzw. kein dominantes lexikalisches Äquivalent, was sich in einer großen Breite der angegebenen Entsprechungen und der hohen Anzahl von Antworten in der Kategorie "keine Entsprechung angegeben" zeigt, und 4) es besteht Unkenntnis bzw. Unsicherheit über die Bedeutung des Wortes.
Genuszuweisung über eine oder mehrere lexikalische Entsprechungen scheint im Polnischen weniger ausgeprägt zu sein als im Deuts.chen. So ist bei einigen Wörtern zu beobachten, dass selbst bei uneindeutigem Auslaut nicht notwendigerweise über das Genus der angegebenen lexikalischen Entspre..: chungen zugewiesen wird. Zum Beispiel waren alle Entsprechungen, die für das Wort Crew angegeben wurden feminin (zaloga, ekipa), aber nur 52 von 100 Informanten wiesen dem Wort feminines Genus zu.
Für das Polni~che ist zudem zu beobachten, dass phonologische Regeln offenbar nicht so dominant sind wie im nativen Wortschatz: uneindeutige Wortausgänge zeigen zwar die meiste Schwankung, aber auch eindeutige konsonantische Auslaute schließen Schwankung nicht aus (Browser, Label). Insofern lässt sich die von Chan (2005: 267) für das Deutsche vertretene These auch für das Polnische belegen: beim Lehnwortschatz nehmen gegenüber dem nativen Wortschatz semantische Regeln an Bedeutung zu, während formale schwächer werden.
Unsere Ergebnisse widersprechen insofern der von Nettmann-Multanowska (2003: 152, 155) vertretenen Auffassung, dass Genusschwankung als Folge des Wettbewerbs der in der jeweiligen· Sprache konkurrierenden Zuweisungsregeln durch die Dominanz phonologischer Regeln im Polnischen seltener und weniger ausgeprägt sei als im Deutschen~ Ebenso widerlegen unsere Befunde
84 Marcus Ca/lies, Eva Ogiermann und Konrad Szczesniak
ihre These, dass nur bei Anglizismen im Deutschen alle drei Genera auftreten können (Nettmann-Multanowska 2003: 153).
6. Schlussbetrachtung und Ausblick
Wie die vorliegende Studie gezeigt hat, wird die Genuszuweisung bei Lehn-. wörternvon einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die zum Teil sprachspezifisch und zum Teil sprachübergreifend sind. Das Ergebnis der Interaktion dieser Faktoren ist wort- und sprecherspezifisch und kann nicht zuverlässig vorhergesagt werden - auch wenn auf der Basis der hier vorgelegten Ergebnisse Tendenzen bezüglich der Dominanz bestimmter Faktoren festgehalten werden können.
Welche Bedeutung hat Genusschwankung für den Integrationsprozess von Anglizismen in einer Sprache? Auch wenn Genusschwankung mit fortschreitender Integration von Lehnwörtern in eine Sprache und deren Aufuahme in Wörterbücher abnimmt, ist Genusschwankung nicht bloß ein vorübergehendes Phänomen, sondern kann unterschiedlich lange andauern. Im Deutschen gibt es beispielsweise eine Reihe von seit Jahrzehnten etablierten Anglizismen, die immer noch Genusschwankung aufweisen. Carsttmsen (1980a) nennt z. B. der/das Quiz, der/das Pub, der/das Essay. Neuere Anglizismen, bei denen sich ausgehend von Genusschwankung eine relativ stabile Variation zu etablieren scheint, sind die/das Mail, der/das Laptop, der/das Event, der/das Movie. Diachrone Veränderungen in der Genusschwankung sind bisher durch sich ändernde Gewichtung genusdeterminierender Faktoren bzw. das Hinzutreten eines weiteren Faktors erklärt worden (Schulte-Beckhausen 2002: 173f.). Weitere Gründe sind aber auch die mögliche unterschiedliche kognitive/konzeptuelle Motivierung anhand einer bestimniten Jdentifikationsbasis/lexika- . lischen Entsprechung in der Nehmersprache bzw. stabile regionale Variation.
Überhaupt spielen regionale Faktoren eine zentrale Rolle bei der Genusschwankung, wobei ihr Einfluss bisher wenig erforscht ist und sich die Frage stellt, inwieweit Genusschwankung von dialektaler Variation getrennt werden kann (vgl. Schulte-Beckhausen 2002: 233). Aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit wird in einer Folgestudie der Einfluss soziolinguistischer Variablen auf die Genusschwankung bei englischen Lehnwörtern im Deutschen untersucht (Callies/Ogiermann/Onysko in Vorb.). Anhand von Daten aus verschiedenen Regionen (unterteilt entlang der Benrather Linie bzw. gemäß den deutschen Dialekten und Sprachgebieten seit 1945) soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern es sich beim Auftreten verschiedener Genera
Genusschwankung bei der Integration von englischen Lehnwörtern 85
bei einem Anglizismus um tatsächliche Genusschwankung oder um regionale Unterschiede bei der Genuszuweisung.handelt.
Ein weiteres zentrales Anliegen ist zudem die Frage der Datenerhebung. Während Wörterbücher eher normativen als tatsächlichen Sprachgebrauch dokumentieren, haben experimentelle Methoden den Nachteil, dass das Testdesign die Ergebnisse möglicherweise beeinflusst. Zum einen konnte die im vorliegenden Testformat angelegte Reflexion über die Bedeutung eines Lehnworts und die Suche nach einer passenden lexikalischen Entsprechung in der
· Nehmersprache eine bewusstere Genuszuweisung eben über eine bestimmte lexikalische Entsprechung bewirkt haben. Wenn man mit Onysko (2007: 174ff.) davon ausgeht, dass Genusschwankung auch durch verschiedene kognitive Motivierung bzw. Konzeptualisierung verursacht werden kann, könnte zudem die kontextuelle Einbettung und Präsentation eines jeden Testworts Genusschwankung eingeschränkt haben. Daher führen wir in unserer Folgestudie einen methodologischen Vergleich durch, der den Einfluss des Aufbaus des Fragebogens auf das AUftreten von Genusschwankung untersuchen soll.
7. Literatur
BaDko, Miroslaw (2002): Wyklady z polskiej fleksji. Warszawa: PWN. Baran, Dominika (2003): "English loanwords in Polish and the question of gender
assignment." In: Penn Warking Papers in Linguistics 8/1, 15-28. Callies, Marcus/Ogiermann, Eva!Onysko, Alexander (in Vorb.): Variation in gender ·
assignment to English loanwords in German. The injluence of methodological design, cognitivefactors and sociolinguistic variables.
Carstensen, Broder (1980a): "Das Genus englischer Fremd- und Lehnwörter im Deutschen." In: Wolfgang Viereck (Hg.): Studien .zum Einfluß der englischen Sprache auf das Deutsche, 37-76. Tübingen: Narr.
- (1980b): ''The gender ofEnglish loan-words in German." In: Studia Anglica Posnaniensia 12, 3-25.
Chan, Sze-Mun (2005): Genusintegration: eine systematische . Untersuchung zur Genuszuweisung englischer Entlehnungen in der deutschen Sprache. München: Iudicium.
Corbett, Greville, G. (1991): Gender. Cambridge: Cambridge UniversityPress. Fischer, Rudolf-Josef (2005): Genuszuordnung. Theorie und Praxis am Beispiel des
Deutschen. Frank:furt/Main: Peter Lang. Fisiak, Jacek (1975): "Some remarks concerning the noun gender assignment ofloan
words." In: Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 33,59-63. Gregor, Bemd (1983): Genuszuordnung: Das Genus englischer Lehnwörter im Deut
schen, Tübingen: Niemeyer.
86 Marcus Callies, Eva Ogiermann.und Konrad Szczesniak
Köpcke, Klaus-Michael (1982): Untersuchungen zum Genussystem der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.
Kreja, Boguslaw (1989): Z moifonologii i moifotaktyki wsp6lczesnejpolszczyzny. Wroclaw: Ossolineum.
Kucala, Marian (1978): Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny. Wroclaw: Ossolineum.
Mailczak-Wohlfeld, Elzbieta (2006): "Rodzaj gramatyczny zapo:Zyczeit angielskich w polszczyZn.ie." Vortrag auf dem LXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Jttzykoz-nawczego, 15-16 September 2006, Szczecin. -
Menzel, Thomas (2000): Flexionsmorphologischer Wandel im Polnischen. Oldenburg: Studia Slavica Oldenburgensia,
Müller-Benedict, Volker ('2006): Grundkurs Statistik in den Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Verlag fiir Sozialwissenschaften.
Nettmann-Multanowskli, Kinga-(2003): English Loanwords in Polish and Germanafter 1945: Orthography and Morphology. Frankfurt/Main: Peter Lang.
Onysko, Alexander (2007): Anglicisms in German. Borrowing, Lexical Productivity, and Written Codeswitching. Berlin: Walter de Gruyter.
Scherer, Carmen (2000): Vom Fremdwort zum Lehnwort: Eine Untersuchung zur morphologischen Anpassung im Gegenwartsdeutschen. Magisterarbeit, Universität Marburg. (germanistik.urii-mainz.de/linguistik/mitarbeiter/scherer/publikationen/pubfremdwort.pdf)
Schulte-Beckhausen, Marion (2002): Genusschwankung bei englischen, französischen, italienisphen und spanischen Lehnwörtern im Deutschen: Eine Untersuchung auf der Grundlage deutscher W6rterbücherseit 1945. Frankfurt!Main: Peter Lang.
Talanga, Tomislav (1987): Das Phänomen der Genusschwankung in der deutschen Gegenwartssprache - untersucht nach Angaben neuerer Wörterbücher der deutschen Standardsprache. Bonn, Univ., Diss.
Wegener, Heide (1995): Die Nominalflexion des Deutschen - verstanden als Lerngegenstand. Tübingen: Niemeyer.
Yang, Wenliang (1990): Anglizismen im Deutschen: am Beispiel des Nachrichten-magazins Der Spiegel. Tübingen: Niemeyer.
Heide Wegener
Fremde Wörter- fremde Strukturen Durch Fremdwörter bedingte strukturelle Veränderungen im Deutschen -
1. Einleitung und Begriffserklärung
Die Fremdwortlinguistik geht heute davon aus, dass der Wortschatz einer Sprache mehrere Schichten aufweist. Munske (1988: 50) spricht von der
· "zweifachen Struktur des Deutschen", wo "die Fremdwörter [ ... ] spezifische Teilsysteme bilden bzw. die indigenen Teilsysteme ergänzen". Eisenberg (2002: 184) sieht einem Kern des Sprachsystems "verschiedene Epizentren gegenüberstehen", die also an der Peripherie stehen. Auch bei Munske stehen die verschiedenen Teilsysteme nebeneinander, sie durchdringen sich nicht. Ausdrücklich weist er auf die Kombinationsrestriktionen in der Lehnwortbildung hin, bei der entlehnte Suffixe i. d~ R. nur an entlehnte Basen treten, so dass es hier "zwei voneinander unabhängig funktionierende produktive Systeme" gebe, zwischen denen "ein gegenseitiges Heiratsverbot" bestehe (1988: 67).
Die vorliegende Arbeit will genau hier ansetzen und Wortformen untersuchen, bei denen deutsche Stämme mit fremden Suffixen kombiniert werden, sei es in der Flexion, sei es in der Wortbildung. Die Arbeit will also nicht nur untersuchen, in welchen peripheren Bereichen fremde Strukturmuster gelten, sondern auch zeigen, dass es von der Peripherie ausgehende Einflüsse auf den nativen Wortschatz gibt. 1 Sie will Ursachen und Konsequenzen solcher Bildungen aufzeigen, der Frage nachgehen, welche Motivation die Sprecher haben, fremde Suffixe zu_ verwenden, obwohl native zur Verfügung stehen, welche Vorteile die neuen F ormtm also aufweisen.
Entlehnung und Übernahme, d. h. produktive Verwendung fremder Suffixe stellt eine viel weitergehende, tatsächlich strukturelle Änderung dar, da Suffixe zu· einer Vielzahl neuer Wörter mit eventuell auch in prosodischer Hinsicht neuer WOrtstruktur führen können. Die Entlehnung eines Flexionssuffixes ist dabei wegen seines obligatorischen Einsatzes in noch höherem Maße als grammatische Veränderung zu werten als die eines W ortbildungssuffixes. Für beides lassen sich im heutigen Deutsch Belege finden.
1 Eisenberg (2002: 183) hält einen Einfluss auf den Kern fiir möglich.


















![Oświata polonijna w Szczecinie w świetle dokumentów MSZ Drugiej Rzeczypospolitej [Bildung der polnischen Minderheit in Stettin, im Licht der polnischen Außenministerium Dokumente]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63135753c32ab5e46f0c602b/oswiata-polonijna-w-szczecinie-w-swietle-dokumentow-msz-drugiej-rzeczypospolitej.jpg)