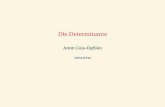Die urnenfelderzeitliche Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil - Prospektionsbericht 2014
Transcript of Die urnenfelderzeitliche Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil - Prospektionsbericht 2014
Bericht über die Rammkernsondierungen RKS 10–19 in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil im südöstlichen Niederösterreich
Mag. Dr. Peter TREBSCHE
Landessammlungen Niederösterreich
Bereich Ur- und Frühgeschichte
Schlossgasse 1
2151 Asparn an der Zaya
Asparn an der Zaya, 4. 11. 2014
2
03 Bericht Teil B – Gesamtdarstellung der Maßnahme
PRIGGLITZ-GASTEIL BOHRUNG 2014
Maßnahmennummer: 23134.14.02
Maßnahmenbezeichnung: Prigglitz-Gasteil Bohrung
Bundesland: Niederösterreich
Verwaltungsbezirk: Neunkirchen
Katastralgemeinde: Prigglitz
Flurname/Adresse: Gasteil Nr. 7 (Gruberhof)
Grundstücks-Nummern: 1393/1, 1394, 1395, 1397/1, 1398/1 und 1399/2 (EZ 45)
Anlass für die Maßnahme: Forschungsprojekt
Durchführungszeitraum: 14.7.2014 bis 14.8.2014
Fundverbleib: Landessammlungen Niederösterreich, Asparn an der Zaya, Inv.-Nr. UF-22692
Ausführende Institution: Landessammlungen Niederösterreich, Bereich Ur- und Frühgeschichte,
Schlossgasse 1, 2151 Asparn an der Zaya
Autor des Berichts: Mag. Dr. Peter TREBSCHE, Landessammlungen Niederösterreich, Bereich Ur-
und Frühgeschichte, Schlossgasse 1, 2151 Asparn an der Zaya, Email: [email protected]
Anlass der Prospektionsmaßnahme Im Rahmen des Forschungsprojektes zur urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil,
das von den Landessammlungen Niederösterreich, Bereich Ur- und Frühgeschichte durchgeführt und
von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich finanziert wird, fanden begleitend zu den
Ausgrabungen (Maßnahmennummer 23134.14.01) auch Prospektionen mittels Rammkernsondierung
statt.1 Bei den seit 2010 jährlich durchgeführten Ausgrabungen hatte sich herausgestellt, dass bislang
in keiner der untersuchten Flächen 1–8 der anstehende Fels bzw. der zu erwartende natürliche
Hangschutt erreicht wurde. Die Mächtigkeit der urnenfelderzeitlichen Kulturschichten sowie der
darunterliegenden Bergbauhalden ist nach wie vor unbekannt. Um Einblick in den Schichtaufbau der
Halden zu gewinnen und um die alte Geländeoberfläche vor Beginn des Bergbaus in Gasteil zu
erreichen, wurde die Firma Balon aus Poysdorf mit der Durchführung von Rammkernsondierungen
beauftragt.
1 Literatur zur Fundstelle und zu den Grabungen ist im Bericht zu Maßnahme 23134.14.01 angeführt.
3
Topographie Die neuen Rammkernpunkte wurden – unter Bedacht auf die Möglichkeiten für den Transport und die
Aufstellung der Rammkernsonde – so festgelegt, dass die im Vorjahr sondierten Punkte RKS1–RKS9
zu drei ungefähr O–W-verlaufenden Profillinien ergänzt und verdichtet werden, sodass die wichtigsten
im Gelände sichtbaren anthropogenen Strukturen (v.a. Halden und Terrassen) erfasst werden. Die
Profillinien verlaufen soweit möglich in der Falllinie des Geländes und wurden von Süden nach
Norden mit 1 bis 3 nummeriert (Abb. 1).
Die südlichste Profilinie 1 (RKS12, 14, 5, 19, 9) verläuft von jener kleinen Terrassierung (RKS12) im
Wald, auf welcher sich der Wasserhochbehälter des Bauernhofs Gasteil Nr. 7 befindet, über einen in
der Wiese sichtbaren, aber nicht mehr benutzten Altweg (RKS14), zu einem zweiten Altweg (RKS5).
Zwischen diesen beiden Altwegen befindet sich jene Geländeterrasse, die in den Grabungsflächen 2–6
(2010–2013) bereits archäologisch untersucht wurde. RKS19 wurde unterhalb der Terrasse mit den
Grabungsflächen 2–6 auf dem heutigen Fahrweg angelegt, um eine möglichst große Tiefe zu
erreichen, da der Fahrweg hangseitig ungefähr 1,0 m (Böschungshöhe) in das Gelände einschneidet. In
der Profillinie 1 liegt eine weitere, nicht sondierte Terrassierung unterhalb des Fahrweges, bevor sie
auf den Punkt RKS9 auf der untersten Terrassierung oberhalb der Landesstraße fluchtet.
Die mittlere Profillinie 2 beginnt im anthropogen nicht beeinflussten Gelände oberhalb der obersten
im Wald erkennbaren Terrassierung, wo RKS10 auf dem steilen Forstweg abgeteuft wurde, um einen
Aufschluss über den natürlichen Hangschutt zu gewinnen. Sie verläuft weiter über die oberste
sichtbare Terrassierung mit RKS4 im Wald und erfasst sodann die zwei Terrassenstufe auf der Wiese.
RKS11 wurde auf der oberen der beiden Terrassen angelegt, RKS13 am hangseitigen Ende und RKS6
am talseitigen Ende der unteren Terrasse. RKS18 befindet sich direkt unterhalb wieder auf dem
Fahrweg (die Böschungshöhe beträgt hier ca. 1,2 m), und zwar knapp südlich einer Geländedelle (eine
alte „Sand“entnahme?). Profillinie 2 verläuft unterhalb des Fahrweges schließlich weiter über eine
kleinflächige Terrasse zu jener größeren Terrasse, auf welcher sich die Grabungsflächen 1, 7 und 8
oberhalb der Landesstraße befinden. Der Endpunkt RKS8 aus dem Jahr 2013 liegt mitten im Bereich
der 2014 angelegten Grabungsfläche 8.
Die nördlichste Profillinie 3 nimmt ihren Ausgangspunkt ebenfalls bei RKS10 auf dem Forstweg und
verläuft den steilen Hang abwärts über die Verebnungsfläche zwischen den beiden großen Halden II
und III, auf der Hampl 1956 den Suchgraben I anlegte. RKS16 wurde soweit wie möglich am Hangfuß
angelegt, RKS1 befindet sich etwa 17,5 m westlich der Oberkante der angrenzenden „Sandgrube“.
RKS15 wurde so knapp wie möglich am oberen Rand der „Sandgrube“ angesetzt, deren Böschung an
dieser Stelle rund 5,5 m hoch ist. Unterhalb der Sandgrubenkante liegen RKS2 und RKS17 auf dem
planierten Niveau des Holzlagerplatzes. Die Weiterführung der Profillinie 3 nach Osten über den
Abhang des Holzlagerplatzes hinaus, also über den Scheitel der großen Halde I, scheiterte an der
Unzugänglichkeit des Waldes für die Rammkernsonde.
5
Vorige Seite:
Abb. 1. Geländedarstellung der Fundstelle Prigglitz-Gasteil mit Lage der Grabungsflächen 1–8 und
der Rammkernsondierungen (RKS) 1–19 (RKS3 konnte nicht ausgeführt werden). Plan: P. Trebsche,
Landessammlungen Niederösterreich. – M. 1:1000.
Technischer Bericht Die Rammkernsondierungen wurden von Josef Balon mit einem Gerät der Firma Geotool, Type GTR
780 GHB durchgeführt (Abb. 2). Der Durchmesser der Schlitzsonden betrug von 0–1 m 80 mm, von
1–5 m 60 mm und ab 5 m bis Endteufe 50 mm. Das Schlaggewicht betrug 63,5 kg, die Fallhöhe
750 mm. Die Schlagzahlen pro Dezimeter Eindringtiefe wurden händisch aufgezeichnet und durch
Günther Weixelberger in Diagrammen dargestellt (siehe Anhang zum Bericht Weixelberger). Alle
Sondierungen wurden so tief geführt, bis sie auf hartem Gestein aufstanden oder aufgrund des
Verbruchs der dünnen Sondagelöcher nicht mehr nachgeschlagen werden konnten.
Das Sediment aus den Schlitzsonden wurde entnommen und in Holzkisten aufgelegt (Abb. 3).
Anschließend erfolgt die fotografische Dokumentation der Rammkerne mit einer digitalen
Spiegelreflexkamera Canon EOS 1000D. Die Rammkerne wurden von Michaela Fritzl im Maßstab
1:10 auf Millimeterpapier gezeichnet und unter Anleitung des Geologen Mag. Günther Weixelberger
gesteinskundlich und sedimentologisch beschrieben.
Zuletzt wurden sämtliche Funde, organische Materialien, Erz- und Sedimentproben den Rammkernen
entnommen und verpackt. Die Bohrlöcher wurden anschließend wieder verfüllt. Die genaue Lage der
Sondagen wurde mit einem Tachymeter Leica TS09 im Landeskoordinatensystem vermessen, wobei
die Grabungsfestpunkte verwendet wurden.
Insgesamt wurden sechs Pläne mit Handzeichnungen auf Millimeterpapier im Format A3 angefertigt
(Plan 1–6). Es wurden 91 Digitalfotos mit einer Auflösung von 3888 x 2592 Pixel angefertigt. Es
wurden 48 Fundnummern vergeben (Fn. 2000–2047), wobei die Nummerierung an die Ausgrabungen
und Rammkernsondierungen im Vorjahr (Maßnahmennr. 23134.13.1 und 2) anschließt.
Verlauf der Maßnahme Die Rammkernsondierungen wurden von 22.–25. Juli 2014 in der Reihenfolge ihrer Nummerierung
durchgeführt. Am 25.7.2014 wurden die Sondierungspunkte und einige Abschnitte der
Geländeprofillinien 1–3 tachymetrisch eingemessen. Am 14.8.2014 wurden die restlichen Abschnitte
der Profillinien vermessen.
6
Abb. 2. Prigglitz-Gasteil. Josef Balon bei der Arbeit mit der Rammkernsonde der Firma Geotool.
RKS10, Aufnahme von Südosten. Foto: P. Trebsche, Landessammlungen Niederösterreich.
Abb. 3. Prigglitz-Gasteil. Die aufgelegten Kerne von RKS10. Foto: P. Trebsche, Landessammlungen
Niederösterreich.
7
Darstellung der Stratigraphie Zuerst werden die Rammkernsondierungen der nördlichsten Profillinie 3 von oben nach unten
besprochen:
Rammkernsonde 10
Die Rammkernsonde 10 wurde absichtlich ein gutes Stück oberhalb der Terrassen und Halden auf dem
steilen Forstweg in 749,75 m Seehöhe angelegt, um Aufschluss über das anthropogen nicht veränderte
Gelände zu erhalten. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Unter der geringmächtigen Wegbefestigung
folgte bis in 5 m Tiefe natürlicher Hangschutt, der aus Lehm in unterschiedlicher Färbung (dunkel-,
mittel- oder hellbraun, rotbraun, hell- oder mittelgrau, teilweise orange) sowie ausschließlich
angerundeten Kalkgesteinen rötlicher oder grauer Farbe bestand. Einige Kalkblöcke wurden von der
Sonde durchschlagen, bis sie in 5,0 m Tiefe wahrscheinlich auf Fels oder einem großen Kalkblock
aufstand und sogar zerbarst. Mit dem Wissen, wie der natürlich Hangschutt aus kalkalpinem Material
aussieht, fiel die Beurteilung der weiteren Rammkernsonden erheblich leichter.
Rammkernsonde 16
Eine sehr ähnliche Stratigraphie weist die Rammkernsonde 16 (Seehöhe 728,55 m) auf, die gut 21
Höhenmeter tiefer als RKS10 am Hangfuß zwischen den Halden II und III angesetzt wurde. Hier lagen
unter rund 1,3 m mächtigem Hanglehm insgesamt 1,3 m starke Kulturschichten, die einen Kalkblock
einschlossen. Darunter folgte der natürliche kalkalpine Hanglehm (Mächtigkeit ca. 1,8 m). Die Sonde
stand in 4,4 m Tiefe auf einem Kalkfelsen oder dem Grundgebirge auf. In dieser Rammkernsonde
wurden keine Haldenschichten angetroffen.
Rammkernsonde 15
RKS15 wurde an der Oberkante der so genannten Sand- oder Schottergrube in 726,38 m Seehöhe
angelegt. Dieser Aufschluss ist also direkt vergleichbar mit dem von Hampl 1956 dokumentierten
Profil der „Schottergrube“. 2 In einer Tiefe von ca. 0,76–1,33 m sowie zwischen 5,02–5,13 m wurden
zwei Kulturschichten angetroffen, die von Haldenmaterial unterschiedlicher Zusammensetzung
(Quarz, Schiefer oder Siderit dominant) getrennt wurden, in denen häufig Verlehmungszonen
auftraten. Die Haldenschichten reichten bis in eine Tiefe von mindestens 9,0 m.
2 F. Hampl / R. Mayrhofer, Urnenfelderzeitlicher Kupferbergbau und mittelalterlicher Eisenbergbau in Niederösterreich. 2. Arbeitsbericht über die Grabungen d. NÖ. Landesmuseums 1953–1959. Archaeologia Austriaca 33, 1963, Abb. 15.
8
Rammkernsonde 17
Rammkernsonde 17 befindet sich in einer Seehöhe von 720,75 m unterhalb der Böschung der so
genannten Sandgrube auf dem Niveau des Holzlagerplatzes, schließt also quasi unterhalb von RKS15
an. Bis in 8,6 m Tiefe wurden hier abwechselnd Feinhalden mit überwiegend Schiefer oder Quarz
dokumentiert; Verlehmungen und Kulturschichten traten im Unterschied zu RKS15 nicht auf. Bei der
untersten, in einer Tiefe von 8,6–9,0 m angetroffenen Schicht könnte es sich um kalkalpinen
Hangschutt handeln.
Im folgenden Abschnitt werden die Rammkernsondierungen der Profillinien 2 und 3 parallel von oben
nach unten beschrieben:
Rammkernsonden 11 und 13
Rammkernsonde 11, die auf einer Seehöhe von 732,60 m auf der zweitobersten Terrasse in Profillinie
2 angelegt wurde, konnte bis 10 m abgeteuft werden (Abb. 4). Bis in 6,1 m Tiefe fanden sich drei
Kulturschichten, jeweils durch Feinhalden voneinander getrennt. Darunter folgt ein möglicher
Paläoboden, der über rund 2,2 m mächtigem Hangschutt aus kalkalpinem Material liegt. Die Sonde
stand in 10 m Tiefe wahrscheinlich auf dem Fels der Grauwackenzone auf.
Eine ähnliche Stratigraphie erbrachte Rammkernsonde 13, die unterhalb von RKS11 auf der
drittobersten Terrasse von Profillinie 2 in einer Seehöhe von 728,42 m angelegt wurde. Hier lagen
zwei Kulturschichten getrennt durch eine Feinhalde bis in 2,21 m Tiefe, es folgte eine ca. 4,6 m
mächtige Feinhalde aus Schiefer und in ca. 6,8 m Tiefe kalkalpiner Hangschutt. Die Sonde stand in
7,3 m Tiefe auf dem Fels auf.
Rammkernsonden 12 und 14
Rammkernsonde 12 liegt auf der obersten Terrasse der Profillinie 1 in 735,43 m Seehöhe knapp neben
dem Wasserhochbehälter des Bauernhauses. Hier wurde unter Humus und geringmächtigem
kalkalpinen Hangschutt eine 2,7 m mächtige Feinhalde aus Schiefer mit einigen Verlehmungszonen
angetroffen. Darunter lag wahrscheinlich ein Paläoboden in rund 3,6 m Tiefe über ca. 2,85 m starkem
kalkalpinen Hangschutt. Die Sonde stand in 6,6 m Tiefe auf dem Fels auf. Eindeutige Kulturschichten
konnten in RKS12 nicht angetroffen werden.
Rund 16 m Luftlinie unterhalb von RKS12 und 4,25 m oberhalb der Grabungsflächen 2–6 wurde
RKS14 in einer Seehöhe von 730,04 m angelegt. Sie erbrachte eine abwechslungsreiche, eher
untypische Stratigraphie: Unter dem dünnen Humus lag eine ca. 4,1 m mächtige inhomogene Halde,
bestehend aus Schiefer, groben kalkalpinen Gesteinen und feinkörnigem Quarz. Von rund 4,26–
4,44 m Tiefe wurde eine Kulturschicht angetroffen, die über kalkalpinem Hangschutt mit
Verlehmungen sowie einer dünnen, nur 0,16 m mächtigen Feinhalde (?) aus kalkalpinem Gestein
9
auflag. Es folgten insgesamt 4,1 m mächtige feine Sedimente, die wahrscheinlich der
Verwitterungszone des anstehenden Grundgebirges der Grauwackenzone angehören. In 9,0 m Tiefe
stand die Sonde auf.
Abb. 4. Prigglitz-Gasteil. Überblick über die Arbeiten an der RKS11, Aufnahme von Südosten. Foto:
P. Trebsche, Landessammlungen Niederösterreich.
Rammkernsonden 18 und 19
Diese beiden Rammkernsonden wurden auf dem Fahrweg vom Bauernhof zum Holzlagerplatz
abgeteuft, um die Profillinien 1 und 2 zu vervollständigen.
Rammkernsonde 18 gehört zu Profillinie 2 und wurde von der Seehöhe 719,64 m abgeteuft. Direkt
unter der Wegplanierung lag eine ca. 0,75 m starke Kulturschicht, darunter folgte eine rund 3,6 m
mächtige Feinhalde über einer weiteren dünnen Kulturschicht in 4,54 m Tiefe sowie rund 0,6 m
mächtigen Feinhalden bis 5,24 m Tiefe. Sie lagen auf rund 1,4 m starkem Hanglehm mit kalkalpinen
Gesteinen auf. Die Sonde stand in rund 6,73 m Tiefe auf kalkalpinem Gestein auf, wobei unklar bleibt,
ob es sich um einen großen Gesteinsblock oder den anstehenden Felsen handelt.
Die weiter südlich gelegene Rammkernsonde 19 gehört zu Profillinie 1 und lag in 719,84 m Seehöhe
(Abb. 5). Hier befanden sich unter der Wegplanierung eine 0,4 m mächtige Feinhalde und eine dünne
Kulturschicht, darunter wieder 0,4 m Feinhalde und eine 0,7 m starke Kulturschicht bis in 1,82 m
Tiefe. Es folgt 2,1 m mächtiger Hanglehm kalkalpiner Herkunft, darunter wahrscheinlich das
10
verwitterte Grundgebirge der Grauwackenzone (Mächtigkeit ca. 3,1 m). In 7,0 m stand die Sonde auf
dem Felsen auf.
Abb. 5. Prigglitz-Gasteil. Überblick über die Arbeiten an der RKS19 am Fahrweg, Aufnahme von
Norden. Foto: P. Trebsche, Landessammlungen Niederösterreich.
Darstellung des Fundspektrums Es wurden 48 Fundnummern vergeben. Je eine Fundnummer enthielt ein urgeschichtliches
Keramikfragment, ein kleines Bronzeblechfragment und ein Knochenfragment. Darüber hinaus
wurden vier Erzproben, 31 Holzkohleproben und 10 Schlämmproben (die größte mit einem Volumen
von 2 l) entnommen.
Zusammenfassende wissenschaftliche Bewertung Die Rammkernsondierungen erwiesen sich als kostengünstige und probate Methode, um in der
Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil Aufschlüsse über die Stratigraphie der Halden erlangen. Mit
den Erfahrungen des Vorjahres gelang es im zweiten Sondierungsjahr, einige Sonden bis 9 oder sogar
10 m Tiefe abzuteufen. Als wichtig für die Interpretation erwies es sich, eine Sonde (RKS10) oberhalb
der Halden anzusetzen, um den natürlichen Hangschutt zu erkunden. So konnte festgestellt werden,
dass die Mächtigkeit des Hangschuttes an dieser Stelle rund 5 m beträgt. Mit einiger
11
Wahrscheinlichkeit konnte der Fels des anstehenden Grundgebirges (kalkalpin oder Grauwackenzone)
auch in den Rammkernsonden RKS11 (Tiefe 10 m), RKS12 (Tiefe 6,6 m), RKS13 (Tiefe 7,3 m),
RKS14 (Tiefe 9,0 m), RKS16 (Tiefe 4,4 m), RKS18 (Tiefe 6,73 m) und RKS19 (Tiefe 7,0 m) erreicht
werden. Die Sondierungen der „Großen Halde“ I stießen hingegen bei RKS15 und RKS17 auf
mindestens jeweils knapp 9 m mächtige Feinhalden, ohne den Felsen zu erreichen.
Die bis dato durchgeführten 18 Rammkernsonden werden es ermöglichen, zumindest
annäherungsweise die Volumina der sicher prähistorischen Haldenkörper abzuschätzen. Wie bereits
im Vorjahr konnten in den Rammkernen nur sehr wenige Funde, dafür zahlreiche Holzkohleproben
gewonnen werden, die in Zukunft mit der C14-Methode datiert werden sollen. Nur auf diese Weise
wird es möglich sein, die Frage nach dem Beginn des Bergbaues und eventuellen älteren Phasen vor
der Urnenfelderzeit in Prigglitz-Gasteil zu beantworten.























![Надписи на целительной статуе Хорхебе [Die Statue des Horchebe]. Novosibirsk, 2014. ET II](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321cc3c64690856e108dd8a/nadpisi-na-tselitelnoy-statue-khorkhebe-die-statue.jpg)