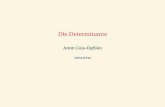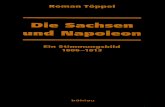Die urnenfelderzeitliche Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil - Grabungsbericht 2013
Transcript of Die urnenfelderzeitliche Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil - Grabungsbericht 2013
Bericht über die vierte Grabungskampagne in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil im südöstlichen Niederösterreich
Mag. Dr. Peter TREBSCHE
Urgeschichtemuseum Niederösterreich
Schlossgasse 1
2151 Asparn an der Zaya
2
03 Bericht Teil B – Gesamtdarstellung der Maßnahme
PRIGGLITZ-GASTEIL 2013
Maßnahmennummer: 23134.13.1
Maßnahmenbezeichnung: Prigglitz-Gasteil, Fläche 5 und 6
GZ des Grabungsgenehmigungsbescheides: 54.041/2/2013
Bundesland: Niederösterreich
Verwaltungsbezirk: Neunkirchen
Katastralgemeinde: Prigglitz
Flurname/Adresse: Gasteil Nr. 7 (Gruberhof)
Grundstück-Nummer: 1393/1
Anlass für die Maßnahme: Forschungsprojekt
Durchführungszeitraum: 8.7.2013 bis 16.8.2013
Fundverbleib: Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Asparn an der Zaya, Inv.-Nr. 22692
Ausführende Institution: Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse 1, 2151 Asparn an der
Zaya
Autor des Berichts: Mag. Dr. Peter TREBSCHE, Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse
1, 2151 Asparn an der Zaya, Email: [email protected]
Grabungsanlass
Die Grabung fand als Forschungsgrabung im Rahmen eines Projektes des Urgeschichtemuseums
Niederösterreich statt. Sie wurde von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich finanziert. Es
handelt sich um die Fortsetzung der 2010 begonnenen Grabungen in den Flächen 1–4 (Maßnahmen-
Nummern 23134.10.1 und 2; 23134.11.1; 23134.12.1). Ziel des Forschungsprojektes ist es, die
Ausdehnung des Fundplatzes1 zu dokumentieren und Daten zur Wirtschafts- und Versorgungsstruktur
der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung zu gewinnen.2 Außerdem spielen denkmalpflegerische 1 Zur Fundstelle und den ersten Grabungen vgl. F. Hampl / R. Mayrhofer, Urnenfelderzeitlicher Kupferbergbau
und mittelalterlicher Eisenbergbau in Niederösterreich. 2. Arbeitsbericht über die Grabungen d. NÖ.
Landesmuseums 1953–1959. Archaeologia Austriaca 33, 1963, 50–106 hier 56–74. 2 Zu den Grabungen seit 2010 vgl. P. Trebsche, Wiederaufnahme der Forschungen in der urnenfelderzeitlichen
Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil. Archäologie Österreichs 21/2, 2010, 18–19; ders., Die Wiederaufnahme der
Forschungen in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil. In: Beiträge zum Tag der
Niederösterreichischen Landesarchäologie 2010/2011. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums N.
F. 502 (Asparn/Zaya 2011) 41–42; ders., KG Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 49, 2010, 311; ders., KG
3
Überlegungen eine Rolle, da die Fundstelle im letzten Jahrzehnt durch kleinere Baumaßnahmen
fortwährend beeinträchtigt wurde.3
Grabungsverlauf
Ziel der Grabung (Abb. 1) war es, die in den Vorjahren erreichten Kulturschichten auf einer
künstlichen Verebnungsfläche (Terrassierung) genauer zu untersuchen. Am 3.7.2013 wurden daher die
ehemaligen Flächen 3 und 4 mit Hilfe eines Baggers wieder bis zur eingebrachten Abdeckung geöffnet
(= Fläche 6); im Süden, Westen und Norden wurde eine Böschung von ca. 45° hergestellt. In Fläche 5
wurde der dünne Humus maschinell abgezogen.
Als Fläche 5 wurde während der Grabungskampagne 2013 jener 4 m lange und 2,5 m breite Streifen
an der östlichen Böschung der Geländeterrasse bezeichnet, der 2011 innerhalb von Fläche 3 aus
Zeitmangel nicht untersucht werden konnte. Ziel war es, die Abfall- und Haldenschichten zwischen
Fläche 3 und 4 zu korrelieren und die Lücke zu schließen. Westlich anschließend blieb zwischen
Fläche 5 und Fläche 6 ein etwa 0,5 m breiter Profilriegel stehen, damit kein Material von oben
nachrutschen konnte. Die Schichten innerhalb von Fläche 5 wurden bis zur Oberfläche der
Haldenschicht SE 769 stratigraphisch abgebaut und dokumentiert. Das entspricht einer Tiefe von
0,70–0,85 m hangseitig im Westen und einer Tiefe von 0,45–1,3 m talseitig im Osten. Der tiefste
erreichte Punkt im Osten weist eine Seehöhe von 723,04 m auf, was einer Tiefe von rund 3,66 m
unterhalb der Terrassenkante bei 726,70 m entspricht. Da sich das Anstehende nirgendwo abzeichnete,
wurde anschließend eine ca. 1,3 x 1,25 m große „Tiefsondage“ in der Mitte von Fläche 5 angelegt.
Aufgrund der Enge dieser Tiefsondage konnte hier nicht stratigraphisch, sondern nur nach Abhüben
von ca. 20 cm Mächtigkeit gegraben werden. Die Schichten SE 769 bis 782 wurden daher jeweils nur
in den Profilen 6–9 fotografiert und vermessen. Die Tiefsondage wurde hangseitig im Westen 1,66 m,
talseitig im Osten 1,12 m abgetieft, sodass an der tiefsten Stelle eine Seehöhe von 723,10 m erreicht
wurde.
Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 50, 2011, 287–288; ders., Die zweite und dritte Grabungskampagne in der
urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil. Archäologie Österreichs 23/2, 2012, 14–16; ders.,
Resources and nutrition in the Urnfield period mining site of Prigglitz-Gasteil in Lower Austria – Preliminary
report on the excavations from 2010 to 2012. In: Mining in European History and its Impact on Environment and
Human Societies. Proceedings for the 2nd Mining in European History-Conference of the FZ HiMAT, 7.–10.
November 2012, Innsbruck (Innsbruck im Druck); ders./E. Pucher, Urnenfelderzeitliche Kupfergewinnung am
Rande der Ostalpen. Erste Ergebnisse zu Ernährung und Wirtschaftsweise in der Bergbausiedlung von Prigglitz-
Gasteil (Niederösterreich). Prähistorische Zeitschrift 88 (im Druck). 3 Zu den Notbergungen vgl. Th. Kühtreiber / P. Trebsche, KG Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 38, 1999,
778–779; R. Lang, KG Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 39, 2000, 596–597; Th. Kühtreiber / P. Trebsche,
KG Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 40, 2001, 599–600.
4
Als Fläche 6 wurde jener Bereich von Fläche 4 (2012) bezeichnet, der sich auf der Verebnungsfläche
der Geländeterrasse befindet und im Westen von einer Haldenschicht (SE 682) und im Osten vom
Abhang der Geländeterrasse begrenzt wird. Da die Mächtigkeit der Haldenschicht SE 682 im Westen
nicht abschätzbar war und aufgrund der Tiefe ohnehin eine Abböschung notwendig war, wurde das
östliche Ende dieser Schicht als künstliche Grabungsgrenze im Westen herangezogen. Der tatsächliche
Grabungsbereich maß daher in der Länge 5,30 m (Nord–Süd) und in der Breite 3,10 m (im Norden)
bzw. 4,40 m (im Süden). Hier wurde ein maximal 0,90 m mächtiges Schichtpaket aus zahlreichen
Kulturschichten auf der Verebnungsfläche untersucht, bis die Oberfläche der darunterliegenden
Haldenschicht SE 936 erreicht wurde. Diese Halde mit einer Oberkante auf einer Seehöhe von ca.
736,30 m stellt noch keinesfalls das Anstehende dar.
Nach Abschluss der Grabung wurden die Befunde in Fläche 6 mit einer Plane abgedeckt. Am
23.8.2013 wurden beide Flächen maschinell verfüllt und die ursprüngliche Geländeoberfläche wieder
hergestellt.
Abb. 1. Prigglitz-Gasteil, Übersicht der zusammenhängenden Flächen 2–6. T = Tiefsondage in Fläche
6. Maßstab 1:250. Plan: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Zusammenfassend konnte also das Anstehende in den zusammenhängenden Flächen 2–6 nirgendwo
erreicht werden. Insgesamt wurde von 2010 bis 2013 ein 102 m2 (max. 10,5 x 10 m) großer Ausschnitt
der Siedlungsterrasse untersucht. Bedingt durch die Steilheit des Geländes kann auf dieser Fläche ohne
größere Erweiterungen oder aufwändige Pölzungen praktisch nicht tiefer gegraben werden, sodass die
Untersuchung der Flächen 2–6 bis auf weiteres als abgeschlossen betrachtet werden muss.
5
Topografie, Bodenverhältnisse
Die Flächen 5 und 6 liegen auf einer deutlich erkennbaren Geländeterrasse und wurden als Viehweide
genutzt. Die Geländeterrasse wird im Osten durch einen alten Holzweg abgeschnitten. Unter einer
dünnen Humusschicht liegen im Wesentlichen mächtige anthropogene Halden und spätbronzezeitliche
Kulturschichten (Nutzungsniveaus). Das Anstehende wurde nicht erreicht.
Technischer Bericht
Alle Grabungsarbeiten wurden von Hand vorgenommen; nur zum Wiederöffnen der Fläche 6, zur
Entfernung des Humus in Fläche 5 sowie zum Zuschütten kam ein kleiner Löffelbagger zum Einsatz.
Die Vermessung erfolgte digital mit einem Tachymeter Leica TCR803; die Aufnahme wurde kodiert
und mittels des Programmes ArchäoCAD in AutoCAD 2010 überspielt. Von einigen Befunden und
von den Profilen wurden fotogrammetrische Aufnahmen hergestellt und mit der Software PhotoPlan in
AutoCAD entzerrt. Mit Ausnahme der „Tiefsondage“ in Fläche 5 (siehe oben) wurde nach der
Methode der stratigraphischen Grabung nach E. C. Harris gegraben. Die Dokumentation erfolgte als
Single-Layer-Dokumentation gemäß den Richtlinien für archäologische Grabungen in Österreich. Die
fotografische Dokumentation wurde mit einer digitalen Spiegelreflexkamera Canon EOS 1000D
durchgeführt. Zur Herstellung von Senkrechtaufnahmen der Grabungsfläche kam der Kameraaufsatz
„Hero“ der Firma Phottix zum Einsatz, mit dessen Hilfe die auf eine Teleskopstange aufgehängte
Kamera aus der Ferne ausgelöst werden konnte.
Für die Flächen 5 und 6 wurden 154 Pläne im Maßstab 1:50 angefertigt, darunter ein Übersichtsplan
der Profile (Plan 120), ein Lageplan der „Tiefsondage“ (Plan 121), drei Composite-Layer-Pläne der
Sedimentproben, die im Raster entnommen wurden (Plan 22, 76, 153), sowie 149 Single-Layer-Pläne
der einzelnen Schichteinheiten. Sieben Fotopläne wurden im Maßstab 1:10 hergestellt, um Details von
Fundlagen oder Schichten zu dokumentieren (Plan 71a, 90a, 91a, 145a, 150a, 151a, 152a). Außerdem
wurden 25 Profile aufgenommen, und zwar fotogrammetrisch als Fotopläne (Profile 1–11) oder als
Handzeichnungen im Maßstab 1:20 auf Millimeterpapier (Profilblätter 12–13 mit 14 Detailprofilen).
Es wurden 33 Befundnummern für Fläche 5 (SE 750–782) und 140 Befundnummern für Fläche 6 (SE
800–939) vergeben, wobei die Nummerierung an jene der Flächen 1–4 anschließt. Es wurden 711
Fundnummern (Fn. 1200–1910) vergeben, wobei die Nummerierung ebenfalls an jene im Vorjahr
anknüpft. Insgesamt wurden 1005 Digitalfotos mit einer Auflösung von 3888 x 2592 Pixel angefertigt.
6
Darstellung der stratigraphischen Einheiten
Fläche 5
Der Humus (SE 301) war bereits im Jahr 2011 händisch bis zur Oberkante von SE 307 abgegraben
worden. Daher wurde der mittlerweile neu aufgebrachte Humus maschinell abgezogen. Abgesehen
von einer N–S-verlaufenden, also hangparallelen rezenten Grube IF 750, in die 2011 beim Zubaggern
ein Stützbrett zur Sicherung der Böschung eingebracht worden war, und einem Wühlgang (IF 751)
befanden sich unter dem Humus einige kleinflächige Humusreste (SE 755, 756) sowie kleinteilige
Haldenschichten unterschiedlicher Konsistenz (SE 752, 753, 754, 758). Auffällig ist eine N–S-
verlaufende dünne rötliche Schicht (SE 757), die möglicherweise einen Verlehmungshorizont oder
eine Bodenbildung markiert. Die stratigraphische Beziehung von SE 757 zu den obersten mächtigeren
Grob- (SE 759, 760) und Feinhaldenschichten (SE 761) ist leider durch die erwähnte Grube IF 750
zerstört. Unter den SE 758 und 761 folgt jedenfalls noch eine rötliche Schicht (SE 762), also ein
weiterer Verlehmungs- oder Bodenbildungshorizont.
Darunter liegt SE 763, eine 0,4–0,5 m starke Haldenschicht aus geringmächtigen Schüttungen
unterschiedlicher Konsistenz (sandig bis kiesig). Im Liegenden folgt ein Paket aus maximal 0,4–0,5 m
mächtigen, lehmigen Kulturschichten der Urnenfelderzeit, die sich anhand ihrer Farbe differenzieren
ließen (SE 764 und 765: dunkelbraun, SE 766: rötlichbraun, SE 767: dunkelbraun, SE 768:
mittelgrau). Sie enthielten den allergrößten Teil der zahlreichen Funde. Die darunterliegende feine
Halde SE 769 fällt steil von W nach O, unten aber auch von S nach N ab. Um ihre Mächtigkeit
festzustellen, wurde, wie oben erwähnt, eine „Tiefsondage“ angelegt (Abb. 2).
Darin zeigte sich, dass SE 769 in feinere Schüttungen unterschiedlicher Korngröße differenziert
werden kann (769a–c). Sie liegt auf einer wesentlich weniger steil abgelagerten Schicht SE 770 aus
rötlichen Steinen (u.a. Kalkgestein) und der feinen ockerfarbenen Haldenschicht SE 771. Ein
höchstens 1 cm starkes schwarzes Band (SE 772) markiert eine horizontale Oberfläche und daher wohl
einen alten Bodenbildungshorizont, der nach Osten hin durch Erosion an der Böschungskante
abgeschnitten ist. Unter diesem Horizont liegt eine feinkörnige Haldenschicht SE 773 von etwa 0,3–
0,45 m Mächtigkeit, gefolgt von einem dünnen annähernd horizontalen Holzkohleband SE 774 und
einer geringmächtigen feinen Haldenschicht SE 775 auf einem dünnen horizontalen Lehmband (SE
778), das wohl auch eine Einschwemmung oder Bodenbildung darstellt und auf einer sehr feinen
Haldenschicht SE 780 liegt. Ebenfalls unter SE 773 befanden sich die feinen Haldenschichten SE 776
und SE 777, die auf einer dünnen Schicht SE 779 mit auffällig hohem Holzkohleanteil lagen, also
wahrscheinlich auf einem weiteren Brand- oder Bodenhorizont. Unter SE 779 und 780 folgte die nach
Süden einfallende grobe steinige Schicht SE 781, die etliche Kupfererze (SE 782) enthielt.
7
Abb. 2. Prigglitz-Gasteil, Fläche 5. Westprofil der „Tiefsondage“. Über dem annähernd horizontalen
dunklen Band (SE 772) und der rötlichen Schicht aus verwittertem Kalkgestein (SE 770) liegt die
Feinhalde SE 769. Blick von Osten. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Zusammenfassend lässt sich die Abfolge der Haldenschichten am östlichen Abhang der
Siedlungsterrasse folgendermaßen gliedern: Die ältesten fassbaren Ablagerungen stellen grobe
Haldenschichten (SE 781 und 782) dar, die erstaunlicherweise noch etliche Kupfererze enthielten. Sie
fallen leicht nach Süden und Osten ein und wurden daher offenbar von Nordwesten her geschüttet.
Auf diese Grobhalden folgen mehrere annähernd horizontale Verlehmungs- oder Brandschichten (SE
779, 778 und 774), die nur durch absichtliche Planierung und anschließende Bodenbildung und
Brandereignisse erklärbar sind. Die darüber angeschüttete feinkörnige Halde SE 773 fällt wiederum
leicht nach Süden und Osten ab, wurde also ebenfalls aus derselben Richtung (von Nordwesten)
geschüttet. Auch diese Halde wurde horizontal planiert, sodass sich darauf die dünne Lehmschicht SE
772 auf einer Seehöhe von 724,1–724,2 m bilden konnte. Darauf lagerten sich die feine Haldenschicht
SE 771 sowie die aus verwittertem rötlichen Kalkgestein bestehende Schicht SE 770 ab (siehe
geologischer Bericht G. Weixelberger), die flach nach Süden und Osten abfallen, also noch immer aus
Richtung Nordwesten geschüttet wurden. Die darüber liegende feine Haldenschicht SE 769 weist
dieselbe Schüttrichtung auf, ist aber etwas steiler gelagert und erreicht an der Oberfläche einen
Böschungswinkel von 33–40 °. Im obersten Bereich von SE 769 (SE 769a) ändert sich die
Schüttrichtung, denn die Oberfläche fällt nun von Süd nach Nord ab, während das Gefälle Richtung
Osten gleich bleibt. Offensichtlich wurde nun statt von Nordwesten von Westen ein Buckel
8
angeschüttet, dessen südliche Böschung in Fläche 3 liegt, wie im Jahr 2011 festgestellt werden konnte.
Die so entstandene Mulde wurde durch ein Paket an fundreichen Kulturschichten (SE 764–768)
wieder ausgeglichen. Die Kulturschichten wurden offenbar, wie an der gleichmäßig von West nach
Ost abfallenden Oberfläche zu erkennen ist, direkt von der oberhalb liegenden Terrasse aus abgelagert.
Die Datierung dieses Kulturschichtpakets in die Urnenfelderzeit ist anhand der Keramikfunde klar
ersichtlich. Die darüber folgenden Haldenschichten fallen auch gleichmäßig nach Osten ab; sie wurden
wohl direkt von Westen her geschüttet und durch zwei Bodenbildungen (SE 762 und 757)
unterbrochen.
Die Tiefsondage erbrachte also wichtige Einblicke in die Struktur der mächtigen Haldenschüttungen.
Aus den dünnen Bodenbildungs- und Brandschichten SE 779, 778, 774 und 772 konnten zwar keine
aussagekräftigen Funde, dafür aber naturwissenschaftlich datierbares Probenmaterial in Form von
Tierknochen und Holzkohlen geborgen werden. Es wird also in absehbarer Zeit möglich sein, den
Entstehungszeitraum bzw. die Ablagerungsgeschwindigkeit der Haldenkörper unter dem mächtigen
urnenfelderzeitlichen Schichtpaket präziser zu fassen.
Fläche 6
Die Beschreibung der Stratigraphie erfolgt hier von unten nach oben, beginnend mit der untersten
erreichten feinen Haldenschicht SE 936, welche in der südlich angrenzenden Fläche 3 der
Haldenschicht SE 374 und in Fläche 5 der Haldenschicht SE 769 entspricht.
Die Oberfläche dieser Feinhalde ist zu einer weitgehend horizontalen Terrasse (Arbeitspodium)
eingeebnet und stellt ohne Zweifel eine Begehungsoberfläche dar (Abb. 3). Nach Osten fällt sie ab der
Schnittkante steil ab. Am westlichen Rand befinden sich zwei Mulden, und bemerkenswerterweise
fällt die Oberfläche genau entlang der künstlichen Arbeitskante nach Westen hin ab. Eine Erklärung
dafür (Gräbchen zur Entwässerung? Setzungserscheinung durch die hohe Auflast?) kann im Moment
nicht gegeben werden. Die Begehungsoberfläche wird durch eine kleine ovale Herdstelle (0,55x0,62
m) markiert, bestehend aus einer in eine seichte Mulde gesetzten Steinlage (SE 939) als Unterbau,
einer lehmig-tonigen Herdplatte (SE 938), die an der Oberfläche fleckig gebrannt ist, einer weiteren
Lehmlage (SE 937), wohl eine Ausbesserungsphase, und einer Schicht aus ungebrannten Steinen und
zahlreichen Keramikfragmenten (SE 932), wahrscheinlich die Destruktionsschicht der Herdstelle.
Rund um die Herdstelle war die Oberfläche der Halde stellenweise rosa verbrannt (SE 935). In der
Nähe der Herdstelle waren drei Pfostenlöcher (IF 927, 933, 934) nur geringfügig (0,05–0,14 m) in das
Arbeitspodium eingetieft. Ihre Anordnung lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Art der
Holzkonstruktion und ihre Ausmaße zu.
9
Abb. 3. Prigglitz-Gasteil, Fläche 6. Oberfläche der Feinhalde SE 936, die als Arbeitspodium planiert
wurde. Rechts im Bild sind rötliche Brandspuren (SE 935) sowie der Versturz einer Herdstelle (SE
932) zu sehen. Senkrechtaufnahme mit Kamerakran; oben ist Osten. Foto: P. Trebsche,
Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Zwei der Pfostenlöcher, die Herdstelle sowie die verbrannten Bereiche der Halde wurden von einer
flächigen Brandschicht mit sehr viel Holzkohle (SE 931) bedeckt, die in etwa die Ausdehnung eines
verbrannten Gebäudes markieren könnte (Abb. 4).
Genau komplementär zu Brandschicht SE 931 lag die Kulturschicht SE 930 im nordwestlichen
Bereich der Terrassierung. Darin eingetieft waren eine unregelmäßige Pfostengrube (IF 926) mit den
Standspuren dreier dünner Pfosten sowie ein ungefähr O–W-verlaufendes seichtes Gräbchen (IF 925).
Über SE 930 lagen zwei kleinflächige gebrannte Lehmschichten (SE 922, 928), über SE 931 eine
weitere kleinflächige Lehmschicht (SE 929), die wahrscheinlich stark verwitterte Herdstellen ohne
Unterbau darstellen. Auf dieser Oberfläche erfolgten auch einige kleinflächige Aufschüttungen oder
Planierungen aus Haldenmaterial (SE 917, 923, 918, 919).
Den nächsten Nutzungshorizont markiert eine fast flächendeckend auf der Terrasse vorhandene
mittelgraue lehmige Kulturschicht (SE 916), die viel Holzkohle, vor allem aber zahlreiche Gusstropfen
und kleinteilige Buntmetallreste enthielt (Abb. 5). Diese konzentrierten sich vor allem in der südlichen
Hälfte der Grabungsfläche. Offensichtlich handelt es sich um einen Arbeitsplatz, an dem Buntmetall
gegossen und verarbeitet wurde.
10
Abb. 4. Prigglitz-Gasteil, Fläche 6. Die Oberfläche des Arbeitspodiums war von einer Brandschicht
(SE 931, rechts im Bild) sowie von einer dunklen Kulturschicht (SE 930, links) bedeckt.
Senkrechtaufnahme mit Kamerakran; oben ist Osten. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum
Niederösterreich.
Derart flächendeckende Schichten sind in der darüber folgenden Stratigraphie die Ausnahme. Es
handelt sich vielmehr um kleinflächige, nur wenige Zentimeter dicke Ablagerungen, wobei zwischen
holzkohlereichen Brandschichten, Planierschichten aus sterilem Haldenmaterial, Kulturschichten mit
Fundkonzentrationen (z. B. die knochenreiche Schicht SE 913; Abb. 6), Lehmstraten und vereinzelten
tonigen und sandigen Ablagerungen unterschieden werden kann. Generell stellt sich die Frage, ob
diese Ablagerungen von Aktivitäten auf der Terrasse selbst herrühren oder ob die Schichten von der
darüber liegenden Terrasse aus abgelagert wurden. Die Ausdehnung sowie die ungefähr horizontale
Oberfläche der meisten Schichten (ohne Schüttkegel) deuten eher auf die erste Möglichkeit. Zwischen
den Schichten ließen sich einige Interfaces beobachten, die auf eine Begehung bzw. Bebauung der
Terrasse hinweisen: eine 0,60x0,50 m große seichte Mulde (IF 901) am Nordrand der Fläche und zwei
möglicherweise zusammengehörige Pfostengruben (IF 883, IF 898) mit Tiefen von 0,19 bzw. 0,29 m,
die parallel zur Terrassenkante in einem Abstand von 1,54 m zueinander standen. Direkt neben der
südlichen Pfostengrube IF 883 befand sich eine unregelmäßige Herdstelle (0,68x0,39 m) mit einem
Unterbau aus Scherben (SE 881) und einer Lehmplatte (SE 880).
11
Abb. 5. Prigglitz-Gasteil, Fläche 6. Die Kulturschicht SE 916 bedeckte fast das gesamte
Arbeitspodium und enthielt zahlreiche Gusstropfen und Buntmetallreste. Im Quadratmeterraster
wurden Sedimentproben für geochemische Analysen sowie zur Flotation und Schlämmung
entnommen. Senkrechtaufnahme mit Kamerakran; oben ist Osten. Foto: P. Trebsche,
Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Insgesamt ließen sich – nach den zwei Brandschichten unter Kulturschicht SE 916 – mindestens 13
weitere übereinanderliegende Brandschichten feststellen.
Die nächste großflächigere Kulturschicht SE 846 bestand aus Lehm mit sehr vielen Tierknochen,
darüber wurden die Schichten SE 845 und 844 sowie eine weitere knochenreiche Schicht SE 842
anplaniert. Ohne erkennbaren konstruktiven Zusammenhang sind hier zwei Pfostengruben (IF 841, IF
868; Tiefen 0,09 bzw. 0,19 m) sowie eine 0,41x0,35 m große seichte Mulde (IF 847) für eine
Feuerstelle zu erwähnen. Es folgt ähnlich wie oben beschrieben eine Abfolge kleinflächiger Straten,
und zwar abwechselnd Brandschichten, Planierschichten und fundreiche Ablagerungen, wobei
mindestens acht übereinander liegende Brandschichten zu differenzieren sind. Im Zuge dieser
Ablagerungen wurde ganz im Westen ein ungefähr N–S-verlaufendes Gräbchen (IF 822; erh. Länge
2,8 m) eingetieft, dessen Funktion unklar bleibt. Es wurde jedenfalls rasch wieder aufgefüllt. Den
Abschluss der stratigraphischen Sequenz bildeten die großflächigen Kulturschichten SE 803, SE 802
(entspricht der im Jahr 2012 zuletzt dokumentierten SE 707) und SE 800.
12
Abb. 6. Prigglitz-Gasteil, Fläche 6. Die lehmige Ablagerung SE 913 mit zahlreichen Tierknochen am
nördlichen Ende der Grabungsfläche. Aufnahme von Westen. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum
Niederösterreich.
Zusammengefasst bilden die 2013 in Fläche 6 untersuchten Schichten ein rund 0,90 m mächtiges
Paket mit zahlreichen und vielfältigen Ablagerungen (Abb. 7), die ohne Zweifel verschiedene
menschliche Aktivitäten in sehr hoher Auflösung widerspiegeln. Obwohl zusammenhängende
Baustrukturen aufgrund der begrenzten Grabungsfläche nicht klar ersichtlich sind, zeugen
Pfostengruben und Herdstellen eindeutig von einer Bebauung der Arbeitspodien. Die Auswertung der
Schichtinhalte, die Verteilungsanalyse der Funde, der Inhalt der systematisch entnommenen
Schlämmproben (zur Gewinnung von Mikroabfällen und botanischen Resten) sowie die geplanten
geochemischen Analysen werden eine detaillierte Rekonstruktion der Aktivitäten ermöglichen.
Vorläufig lässt sich feststellen, dass auf der untersuchten Siedlungsterrasse in einer frühen
Benutzungsphase vor allem Buntmetall gegossen wurde (SE 916); später wurden wiederholt Tiere
geschlachtet bzw. Fleisch verarbeitet (knochenreiche Ablagerungen SE 913, SE 848, SE 842, SE 821).
Während des gesamten Nutzungszeitraumes fanden mindestens 23 aufeinanderfolgende
13
Brandereignisse statt – entweder handelt es sich dabei um Schadbrände oder die Überreste
ausgeräumter Öfen.
Abb. 7. Prigglitz-Gasteil, Fläche 6. Im Nordprofil zeigt sich die Abfolge zahlreicher feiner Schichten.
Aufnahme von Süden. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Darstellung des Fundspektrums
Fläche 5
In Fläche 5 wurden 130 Fundnummern vergeben, darunter 56 Sedimentproben für geochemische
Analysen und 16 Sedimentproben zur Flotation und Schlämmung mit einem Gesamtvolumen von
187,5 l. Unter den Funden überwiegen Tierknochen, gefolgt von Keramik, Hüttenlehm, feinen
Plattenschlacken, Gusstropfen, einem rundstabigen Bronzedraht, einer bronzenen Doppelspitze,
Schnecken, einigen bearbeiteten Geweihstücken, einem Knochengriff sowie drei Röhrenknochen mit
eingeschnittenen Rillen, die wahrscheinlich Abfallstücke der Herstellung von Knochenperlen
darstellen.
Fläche 6
In Fläche 6 wurden 579 Fundnummern vergeben, darunter 165 Sedimentproben für geochemische
Analysen und 96 Sedimentproben zur Flotation und Schlämmung mit einem Gesamtvolumen von
14
1154 l. Auch in dieser Fläche überwogen bei weitem die Tierknochen, außerdem wurden Keramik,
Hüttenlehm, feine Plattenschlacken, ein Klopfstein, ein Webgewichtfragment sowie einige bearbeitete
Geweihstücke gefunden. Als herausragender Fund ist das Fragment einer Gussform aus Sandstein für
ein jüngerurnenfelderzeitliches Griffdornmesser (L. 12,5 cm, B. 11,5 cm, max. D. 2,1 cm) zu
erwähnen (Abb. 8). Unter den zahlreichen Buntmetallfunden überwiegen die Gusstropfen und sonstige
amorphe Gussreste sowie einige Blechfragmente; eigens zu nennen sind das Fragment eines kleinen
plankonvexen Gusskuchens, ein Armreiffragment, eine Doppelspitze, etliche Drahtstücke, drei
Bronzezwecken (L. 2,1–2,3 cm) sowie eine vollständige Nagelkopfnadel mit vierkantig
geschmiedetem Schaft (L. 11,5 cm).
Abb. 8. Prigglitz-Gasteil, Fläche 6. Fragment einer Gussform für ein Griffdornmesser. Foto: N. Weigl,
Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Zusammenfassende wissenschaftliche Bewertung
Insgesamt wurde in den zusammenhängenden Flächen 2–6 von 2010 bis 2013 ein 102 m2 (max. 10,5 x
10 m) großer Ausschnitt eines urnenfelderzeitlichen Arbeitspodiums und der daran anschließenden
Abfallhalde so tief ergraben, wie es technisch möglich war. Dabei konnte das Anstehende nirgendwo
erreicht werden. Bedingt durch die Steilheit des Geländes kann auf dieser Fläche ohne größere
Erweiterungen oder aufwändige Pölzungen praktisch nicht tiefer gegraben werden, sodass die
Untersuchung der Flächen 2–6 bis auf weiteres als abgeschlossen betrachtet werden muss.
Das gesamte Gelände der Fundstelle ist anthropogen stark verändert und besteht aus
Haldenschüttungen, die meist kleinräumig und aus verschiedenen Richtungen erfolgten. Auf diesen
Halden wurden bei Bedarf Verebnungsflächen hergestellt (abgegraben oder angeschüttet), auf denen
man die notwendigen Arbeits- und Wohnstätten einrichtete. Die 2013 erreichte einstige Oberfläche der
15
Verebnung zeigt eine Herdstelle und Spuren von Pfostenbauten. Die darüber liegenden Schichten –
meist kleinräumige und dünne Ablagerungen ganz unterschiedlicher Art – spiegeln die folgenden
Aktivitäten in ungeahnt hoher Auflösung wider. Allein in dem 2013 untersuchten Ausschnitt konnte
eine Abfolge von mindestens 23 Brandereignissen dokumentiert werden. Die Funde belegen eine
Nutzung der Terrasse als Werkstätte für den Buntmetallguss; später wurde das Podium auch zur
Schlachtung oder Zerlegung von Tieren benutzt. Das umfangreiche Fundgut und das entnommene
Probenmaterial wird nach Abschluss der Ausgrabungen wesentliche Erkenntnisse zu den eingangs
erwähnten Forschungszielen beitragen können.