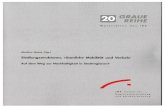Die Liturgische Gestaltung in ausgewählten Kirchenbauten von Emil Steffann
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Die Liturgische Gestaltung in ausgewählten Kirchenbauten von Emil Steffann
münsterdas
Zeitschrift für christliche Kunst
und Kunstwissenschaft
B 20329ISSN 0027-299X
4/2014 67. Jahrgang
Schwerpunkt: Skulptur
das münsterZeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft
Inhalt
242 Editorial Simone Buckreus
Schwerpunkt Skulptur
243 „Ein Künstler hat es gefertigt, es ist kein Gott“ (Hos 8,6) Skulptur im Kirchenraum Reinhard Hoeps
249 Entwicklungslinien – Kontinuitäten – Brüche Figurative Tendenzen in der Skulptur
des 20. Jahrhunderts im Erzbistum Paderborn Christoph Stiegemann
262 Schatz im Schutt Der Atzmann aus der Leonhardskirche
in Frankfurt am Main Anja Lempges
270 Der Beuroner Engelkelch P. Augustinus Gröger OSB und Claudia Lang
278 Zeitgenössische Skulptur im historischen Kirchenraum Beispiele aus der Diözese Linz Martina Gelsinger
Alte Kunst
287 Zu einem jetzt entdeckten hl. Sebastian und dem Predellenprogramm von Raffaels Pala Colonna
Ralf Scholz
298 Tödliche Langeweile? Spitzweg in Schweinfurt Rainer Alexander Gimmel
Neue Kunst
304 Neue liturgische Orte in der Kapelle des Cusanus-Stiftes in Bernkastel-Kues
Barbara Daentler
Architektur
307 Die Liturgische Gestaltung in ausgewählten Kirchenbauten von Emil Steffann
Tino Grisi
Berichte
314 FARBSTRÖME UND UMRISSE Verleihung des Schnell & Steiner Kulturpreises
„Kunst und Ethos“ 2014 an Jacques Gassmann Jürgen Lenssen
317 Nah am Text – Installation von Johanna Kandl an der Baustelle des Wiener Dommuseums bis März 2015
Christina Werner
317 Personalia
320 Impressum
U3 Ausstellungs- und Veranstaltungskalender
Wie in kaum einem anderen Land erlebte der Kirchenbau in Deutschland nach dem Zwei-ten Weltkrieg eine erstaunliche Blütezeit. Aus der Fülle der damals beteiligten Architekten ragen einzelne Persönlichkeiten heraus, mit deren Namen sich Ikonen der modernen Kir-chenarchitektur verbinden: Es sind vor allem Dominikus Böhm, Rudolf Schwarz und Emil Steffann (Abb. 1). Ihre Architektur war stilbil-dend und gilt in mancher Hinsicht bis heute als Maßstab.
Nach einer Phase der Rückkehr des Dekors war eine neue Art von Radikalität gefragt. Kir-chenneubauten und -umbauten der neueren und neuesten Zeit deuten darauf hin. Damit erhält die Nachkriegsmoderne insbesondere in ihrer konzentrierten Ausprägung durch Emil Steffann neue Aktualität. Tatsächlich ist Stef-fann für die Architekturgeschichtsschreibung und die Planungskultur ein Unbekannter. In der Beurteilung seines Werkes hat sich die Kri-tik eher zurückgehalten, denn als solche betä-tigt; Gelegenheiten zur Diskussion waren eher momenthaft, gering seine Wirkung über die Grenzen Deutschlands hinaus, dürftig die Zahl der deutschen Autoren, die sich mit seiner Rolle in der Kultur und mit dem Thema seiner Kirchen eingehender beschäftigt haben.
Dass meine Studie an der Universität von Bologna erstellt wurde, zeugt von dem inter-nationalen Stellenwert der deutschen Sakral-
architektur nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch von dem besonderen Interesse, das ge-rade aus Italien diesem Baubestand entge-gengebracht wird. Ich bin in mehrfacher Hin-sicht auf Spurensuche gegangen, indem ich alle Objekte eingehend besichtigt und doku-mentiert, Archive konsultiert und mit Zeitzeu-gen Gespräche geführt habe. Auf diese Weise ist es mir gelungen, von außen kommend dennoch quasi eine Binnensicht der Kirchen-architektur Emil Steffanns zu präsentieren, indem die Geistigkeit der Bauwerke in ihrem architektonischen und religiösen Kontext of-fengelegt wird.
Steffann steht in der Kirchenarchitektur des 20. Jahrhunderts für die geduldige Suche nach einer Formensprache für eine schlichte, aber brennende Empfindung und deren ma-terielle Umsetzung in umgrenzte Räume, in denen gleichsam die Ewigkeit in die Zeit ein-dringt, so wie die Schutz bietende Kirche gegen die Außenwelt steht und gleichzeitig für die daseinswichtigen Formen offen ist, für das Eigentliche und Wesentliche: den Einzel-menschen und die Menschheit. Steffann er-lebt in sich eine ursprüngliche Welt, die allem figürlichen, auf Formdarstellung gerichteten Denken vorausgeht, wobei die Form einem Zusammen-Sein entspringt, das sich nicht in überspannten oder einseitig metaphysischen Bezugnahmen verwirklicht, sondern in der Materie selbst, wo die liturgische, weihevolle Gegenwärtigkeit in der Stille eines ummauer-ten Raumes ihren Ausdruck findet.
Die Dissertation, aus der der folgende Bei-trag stammt, stellt die erste vollständige Stu-die mit Originalfotos des architektonischen Œuvres Steffanns in seinem aktuellen Zustand dar und ist eine Erzählung, die sich nicht an einer chronologischen Reihenfolge oder fikti-ven Rangfolge der Bedeutung dieser Werke orientiert, vielmehr die Bauwerke beschreibt, sie in analogen Sequenzen verbindet und ihren Gehalt diskutiert. Sie arbeitet andere und – in architektonischer Hinsicht – bisher nur wenig vertiefte Bezüge wie etwa Romano Guardinis kirchlich-liturgische und Hans Urs von Balthasars ästhetisch-theologische Ge-dankenwelt heraus, die ihre Entstehungsge-schichte und ihren Gehalt erhellen. Dadurch soll der Blick über die Länder- und Kulturgren-zen hinweg auf das Wesentliche des Kirchen-raums gelenkt und die bleibende Bedeutung des Beitrags der Kirchenarchitektur Steffanns
und seiner engsten Mitarbeiter, insbesondere Gisberth Hülsmann, zu unserer urbanen Kultur in Erinnerung gerufen werden.Wer bei dem Namen Steffann nur an den Archi-tekten von Zentralbauten denkt, verkennt seine Fähigkeiten als Schöpfer von Längsbau-ten. In den vorhergehenden Kapiteln konnten wir unter verschiedenen konstruktiven Ge-sichtspunkten zu der Erkenntnis gelangen, dass er, der in quadratisch geschnittenen Kir-chenräumen die Gruppierung der Gemeinde um den Tisch des Herrn so ausdrucksstark ge-staltete, ebenso in der Lage war, durch die An-ordnung in einem Langraum Sinn und Gebet auf den Altar auszurichten. Die Bilder aus dem Jahre 1960 (Abb. 2) nach Abschluss der Arbei-ten an der Pfarrkirche St. Johannes in Dorsten lassen die freie, gerichtete Leere spürbar werden: Der die ganze Stirnseite einnehmende Apsis-schluss nimmt die Feier unmittelbar in eine reale Immanenz voll elementarer Ausdrucks-kraft hinein, in der Handlung nicht rein phy-sisch vollzogen wird, sondern in unsichtbare Sphären hineinwirkt, so dass der der Kommu-nion geweihte Raum zur Schaustätte der litur-gischen Handlung wird und ihm – darüber hin-ausgehend – kosmische Transzendenz verleiht.
In einem Brief aus dem Jahre 1964, der an-lässlich des dritten Deutschen Liturgischen Kongresses in Mainz1 geschrieben wurde, schildert Romano Guardini, wie der Mensch mit seinem ganzen körperlichen und spirituel-len Sein in der liturgischen Handlung steht, da die Handlung ein religiöser Vollzug ist und die dabei vorhandenen Gegenstände nicht als äußerliche Hilfsmittel gedacht sind, sondern als sinnbegründende Bestandteile der Hand-lung als solcher. Die Eigenschaften, die er als grundlegend für das liturgische Gebet be-zeichnet, sind die heiligende Versammlung und die transzendente Spannung, die Offen-barung des existenziellen Wesens und die Ori-entierung des Menschen zur universalen Ge-meinschaft. Der Raum wird als der irdische Ort begriffen, in dem Gemeinschaft sich formiert, die liturgische Architektur hingegen als sakra-ler Raum, in dem sich die Kirche als eine aus le-bendigen Steinen bestehende Ganzheit und damit symbolisch als Ausdruck einer überna-türlichen Realität darstellt. Die reale Symbolik ist unmittelbar mit der Handlung verbunden und drückt sich in elementarer Form aus, da ihre Bedeutung kein benanntes oder gedach-tes Nebeneinanderstellen ist, sondern unmit-
Die Liturgische Gestaltung in ausgewählten Kirchen-bauten von Emil SteffannTino Grisi
1 Porträt von Emil Steffann
308 das münster 4/2014Architektur Liturgische Gestaltung in Kirchenbauten von Emil Steffann
2 St. Johannes Dorsten, Innenraum, 1960
3 St. Johannes Dorsten, Kirchenraum
309das münster 4/2014 Liturgische Gestaltung in Kirchenbauten von Emil Steffann Architektur
telbar in der Handlung selbst vollzogen wird. Daher wird die Anschauung der Innerlichkeit Sinnes in der äußeren des Realität, in der Un-mittelbarkeit der symbolischen Handlung er-lebt – vollzogen von dem, der der Liturgie vor-steht, und „gelesen“ von allen, die sie in sich aufnehmen. Einer bewussten Einstellung der universalen Kirche zufolge hat der Gläubige fortschreitend das eigene „betende Ich“ zu weiten, womit das individuelle Bewusstsein geweckt wird, das dann kraft der liturgischen Feier vor dem ewigen Gott steht.
Diese Betrachtungen sind für die Bauge-sinnung Emil Steffanns besonders folgenreich. Wie die liturgische Feier nicht nur einfache Seelenzustände ausdrückt, sondern zur Auf-nahme des Wesentlichen und der ihrem Inhalt eigenen Zusammenhänge aufruft, kann auch die Architektur einen „objektiven Selbstaus-druck“ erreichen, wenn sie sich „ein Hinabstei-gen ins Wesen“ versenkt.2 Vor diesem Hinter-grund gesehen, tut sich hinter der fensterlo-sen Front des Baues in Dorsten (1953–60, mit Wolfram Noeske und Friedrich Ott) ein Raum auf, dessen Grundriss einen dieser unendli-chen, potenziell atmosphärischen Bereiche in durchgehend halbkreisförmiger Hülle dar-stellt, der die beiden fensterverglasten Seiten-wände optisch streckt und vereint (Abb. 3). Der Besucher gelangt durch einen niedrigen seitlichen Anbau in den Kirchenraum und trifft zunächst auf den Taufstein unter der schräg geschnittenen Orgelempore, die, über eine fragil wirkende Aufgangstreppe zugänglich, wie ein Baldachin im Raum zu schweben scheint. Eine Seitenwand öffnet sich zu den wuchtigen Grundmauern des viereckigen Glockenturmes, der sich mit hochgespann-tem spitzen Dach in den Himmel reckt. Die Stirnseite fast zur Gänze einnehmend, schmiegt sich ein einstufiges Podest in den gebogenen Altarraum, über dem sich die Längsrippe des Satteldaches weich in die Rundung fügt. Reihen herabhängender, glän-zender Lampen charakterisieren den gesam-ten liturgischen Raum in der Sprache des Lichtes als einen Ort sakraler Handlungen, die nicht selbstzweckhaft sind, sondern ein Tun, dessen wahre Funktion in der Entfernung vom Zweck und in der Annäherung an den Sinn liegt.3 Im Denken von Guardini ist das li-turgische Geschehen wesentlich, nicht aber seine vermutete Bedeutung. Die grundle-gende Frage für den Gestalter ist, wie die Handlung sich in einen religiösen Akt wan-deln kann und ob der Mensch von heute des-sen fähig ist. Durch die dem Raum und den Gegenständen zugewandte Aufmerksamkeit offenbaren die von den sakralen Zeichen ver-hüllten Eigenschaften der Orte und Dinge ihren wahren Ursprung, daher darf der Mensch den Dingen keinesfalls Gewalt antun, sondern muss ihr Wesen öffnen, indem er sich
4 St. Hedwig Köln-Höhenhaus, Ausführungzeichnung
5 St. Hedwig Köln-Höhenhaus, Innenraum
ihnen öffnet. Die ehrerbietige Gestaltung der objektiven Natur ist eine weitere Bestätigung der Wahrheit der Welt, weil diese Fülle in den spirituellen Metamorphosen des Sakramentes erreicht wird.4
In der symbolischen Spannung zwischen spiritueller Anziehung und Abkehr von forma-ler Befriedigung findet sich das Wort Woh-nung – nicht im schönen Erscheinungsbild, noch weniger in der Materie selbst, sondern in der Notwendigkeit der Dinge, die tröstend vom Licht sprechen. Dies ist ein Raum im Werk selbst, in dem die Dinge und der Mensch ge-öffnet und durchlässig erscheinen; entschei-dend ist nicht was, sondern wie der Mensch die Wahrheit über das Sein erlebt, das sich in Form der Schönheit zeigt.
Tun wir einen weiteren Schritt in das ästhe-tische Denken über die Offenbarung des Un-aussprechlichen in der Erscheinung5 mit der Frage, warum die Freiheit des Werkes auch darin liegt, dass es reine Erscheinung wird, was nicht bloß durch eine Überlagerung des Chaos mit Harmonie geschieht. „Einhalt“ tritt
ein, eine zur Erstarrung gekommene Bewe-gung; dies ist das „Ausdruckslose“, das dem unaufhörlichen Pulsieren der Form Einhalt ge-bietet und ihre Schwingung zur Ewigkeit ge-rinnen lässt. Mit anderen Worten, wenn das Schöne sich zu seinem Ursprung wendet, er-hält es durch ein Innehalten Wert und Bedeu-tung, das, obwohl es die Erscheinung nicht vom Wesen trennt, die Vermischung beider verhindert. Das Maß, die Distanzierung, das Licht brechen in der Erscheinung die falsche, absolute Ganzheit auf, und so wird jeglicher Historismus, Expressionismus und Determinis-mus ausgehöhlt durch eine Kraft, die bar
„jeden Ausdrucks“ ist. Die Enthüllung ist in Wirklichkeit ein Erscheinen, das schwindet, indem es ein „notwendiges Verhältnis“ zum Ausdruckslosen schafft; „das Wesensgesetz der Schönheit zeigt sich somit, daß sie als sol-che nur im Verhüllten erscheint“. Als objektives Wesentliches nutzt sie nämlich das Phänomen als Hülle des Verhüllten, „denn weder die Hülle noch der verhüllte Gegenstand ist das Schöne, sondern dies ist der Gegenstand in seiner
Hülle“.6 Wie bereits zuvor erwähnt, ist die bloß funktionale Enthüllung, die auf konzeptionelle Vorherbestimmung der Schönheit zielt, eine unvollendete Preisgabe des Nicht-Erscheinen-den; die Erscheinung hingegen ist gerade
„nicht die überflüssige Verhüllung der Dinge an sich, sondern die notwendige von Dingen für uns“.
Nichts ist, wie es scheint, alles ist, was es ist. St. Hedwig in Köln (1964–68, E. S. und Gisberth Hülsmann – mit Josef Lorenz: Abb. 4, 5) ist ein Kleinod an Zartgefühl, das uns mit der Ruhe, der Dichte und dem gedämpften Licht ihres Feierraumes überwältigt.7 Die Verwendung der aus Trümmern gewonnenen Steine, die einheitliche Form und das ausgesprochen un-zeitgemäße Erscheinungsbild zeugen für den Stillstand von Ausdruck und Zeit, der die An-dacht der Gläubigen zentriert, die sich um den tief in die Raummitte und das Herz der
6 Köln-Longerich, Heilig-Geist-Krankenhaus, Kapelle, Innenraum
7 Kloster St. Katharina von Siena Düsseldorf-Angermund, Kirchenraum
310 das münster 4/2014Architektur Liturgische Gestaltung in Kirchenbauten von Emil Steffann
Gemeinde vordringenden Altar versammeln. Schützend spannt sich das mit einem Pinien-zapfen gezierte Pyramidendach darüber, das in der Untersicht eine fragil wirkende Konst-ruktion von Fachwerkträgern zeigt. Während die Gebäude des Pfarrzentrums sich linear darstellen, indem sie Durchgänge und offene Höfe schaffen, ist der Kirchenbaukörper klar geostet, liegt unter Straßenniveau in einer na-türlichen Senke und ist mit einem die Nord-seite begleitenden Flügel mit Atrium, Werk-tagkapelle und Sakristei verbunden. Eine Reihe Arkaden öffnet sich zu dem quadrati-schen Kirchenraum, dessen Mauern von Pfei-lervorlagen gegliedert sind, die, je zwei auf einer Seite, pyramidenartig emporstreben; zerstäubendes Licht flutet durch ein Band von Rundbogenfenstern. In diesem verhüllenden Erscheinen sind es die „symbolische Einbet-tung“ und die „erstrebte Einfachheit“, die in den Liturgiekonzepten nie die „Unruhe“ auf-kommen lassen, die so viele neue Kirchen so unerträglich macht. Steffann aktualisiert das religiöse Erleben und seine Darstellung, indem er sich jeglicher Andeutung von Schau und Sentimentalität enthält. In St. Hedwig ge-staltet der Architekt den Raum als existenzielle Bedingung, offen und verbunden mit der Ge-betshaltung der Gemeinde.8
Ebenfalls in Köln plante Steffann die Klos-terräumlichkeiten für die Cellitinnen des Heilig Geist-Krankenhaus. Die Kapelle (1955–59, mit Nikolaus Rosiny und Hermann Schorn: Abb.
8 Kloster St. Katharina von Siena Düsseldorf-Angermund, Altarraum
206–210)9 ist würfelförmig. Überkrönt von einem aufgesetzten, runden Oberlicht, durch dessen Fensterband Licht einströmt, ist sie dem Kloster und den anderen Pflegeeinrich-tungen gleichermaßen verbunden (Abb. 6).10 Die besonderen Bedingungen der liturgi-schen Widmung des Ortes führten zu einer Zweiteilung des Raumes in einen Eingangsbe-reich und Durchgang für die Schwestern und Patienten, dessen Deckenhöhe durch den oberen Chor stark reduziert ist, und den Feier-raum mit dem Presbyter- und dem Gemein-debereich, welch Letzterer mit kleinen Bank-einheiten und unabhängig zu schaltenden Doppellampen für die Stundenliturgie ausge-staltet ist. Der Zementring des großen Ober-lichtes scheint schwer auf den Ecken des ge-schlossenen Mauerwerks zu lasten, so dass vier oben und unten gestelzte Metallstützen, die vom Boden bis zum umlaufenden Balkon reichen, ihn abfangen. In diesem Kirchenbau, in dem die expressive Dimension denkbar stark zurückgenommen ist, erscheint der ei-gentliche Sinngehalt des Ausdruckslosen darin, dass alle Elemente der Kirche autonom zum Altar als liturgischem Zeichen ausgerich-tet sind. In der Gedankenwelt Guardinis wird die Objektivität stets über das Suggestive ge-stellt; dies spiegelt sich in der Gestaltung der Sakralarchitektur Emil Steffanns wider, weil auch sie von einer Konzeption der Liturgie als Form der Realität ausgeht und sich den Din-gen nicht mit Absichten nähert, die von einer nicht genauer bezeichneten Sakralität be-schworen werden, sondern eine echte spiritu-elle Spannung aufbaut, selbst in „einem Bild, in dem die verschiedenen Teile nicht mehr Absichten zu verbergen scheinen als wenn es sich um die Schilderung eines Sonnenunter-ganges handelte“.11 Die Geste der Bedeutung bietet überdies die Gelegenheit, ihr Wesen zu offenbaren, und nur als solche können wir sie in ihrer Intensität aufnehmen.
Im liturgischen Bereich wird „die geistliche Ausdrucksform bis zu einem gewissen Maße ihrer einzelhaften Bestimmtheit entkleidet, gesteigert, beruhigt, ins Allgemeingültige er-hoben“,12 wie „der Einzelne“ der liturgischen Handlung unterworfen ist, jedoch in der Summe „die Gemeinschaft“13 als „überindivi-duelle Wirklichkeit“ darstellt, „so kann die christliche Grundtatsache ‚Neues Leben‘ nur als Kirche und Einzelpersönlichkeit zumal ver-wirklicht werden“.14 Während der Liturgie ma-nifestieren sich durch die gemeinsame öffent-liche Handlung die innere Einheit der Gläubi-gen und ihre Kommunion im Gottesdienst.15 Die Kirche des Klosters der Dominikanerin-nen in Angermund in der Nähe von Düssel-dorf (1967–69: Abb. 7, 8) drückt, gemäß dem Zeugnis von Gisberth Hülsmann, mit ihrer po-lygonen Form – einem Ergebnis von Abwand-lungen und Formungen – das Verlangen aus,
über die Architektur die eigentliche Bedeu-tung der liturgischen Handlung sichtbar zu machen und wahrzunehmen – in dem Be-wusstsein, dass ihr Wert in nichts Geringerem als der Gegenwart der Gemeinde in Christus liegt. Der Raum dient in erster Linie der geord-neten Gruppierung der Gemeinde um den geheiligten Altar und weist den Orten Bedeu-tung zu, die die Raumwege der liturgischen Handlung markieren und aus der Unregelmä-ßigkeit des Raumgefüges plastisch herausge-arbeitet sind. Teilnahme und Kommunion werden hier als Ereignisse von Wahrheit, Maß und Licht betrachtet. Die große Fensteröff-nung mit tiefer, abgeschrägter Laibung sam-melt und leitet das Licht der Mittagssonne in den mit Backstein und hellem Marmor ausge-stalteten Raum, während das kleine Fenster über dem Chor das Licht von Osten auf den Altar lenkt. Ein einziger Deckenbalken, der so-lide wie ein Bootskiel, aber elegant auf den Mauern aufliegt, verläuft diagonal über dem Altar und bildet mit den Raumachsen den Schnittpunkt im Halbkreis der Gemeinde vor dem Altar und am Ort der Wortverkündigung. Eine winzige Apsis in der Nordwestecke des ungleichmäßigen sechseckigen Grundrisses birgt die Eucharistie. Die Kirche erhebt sich aus den Mauern und Dächern des großen Kreuz-ganges, der sich, die Flügel des Klosterkom-plexes begleitend, ringförmig um den Innen-hof legt. Dieser ist als Dachgarten gestaltet und ergänzt sich mit dem außen gelegenen Park, den der umlaufende Ring der Spazier-wege säumt.16 Die bereits von Guardini ge-stellte Frage über die Aktualität der liturgi-schen Handlung betrifft sowohl die Arten der Feierbegehung als auch seine Fähigkeit, im Menschen die eigene Wahrheit zu erwecken.17 Das Ereignis kann nur dann einen Platz finden, wenn es „darauf verzichtet, in einem Zustand der passiven Aktivität stattzufinden“,18 was, wie wir bereits gesehen haben, seine ästhetische Grundlage ist. Die Feierorte sind Grenzschwel-len der erwartungsvollen Leere; Bewegung und Ruhe ordnen sich wie Elementarteilchen als reale Symbole im priesterlichen Raum.19 Zu diesem Zweck ist die Gemeinde dort, wo die Handlung ist.
Mit der liturgischen Neuordnung der Pfarrkirche von St. Martin in Dornbirn im ös-terreichischen Vorarlberg (1966–69, mit Gis-berth Hülsmann: Abb. 9) ging Steffann so vor, dass der Raum sich als „der sichtbare Leib einer um den Altar versammelten christlichen Gemeinde“ zeigt. Die Achsensequenz des neoklassischen Baues (konsekriert im Jahre 1857), der als ein überwölbter Saalbau mit Büh-nenapsis konzipiert worden war, wurde durch die Neugestaltung in eine Folge von Raum-einheiten umgedeutet, beginnend mit dem urban wirkenden Pronaos, über den niedrigen Eingang unter der Chorempore, den Kirchen-
raum mit den parallel gegenüber gestellten beiden Bankreihen und der freien Raummitte, in der der Taufstein und der Altar platziert sind, bis hin zur Apsis, an deren abgetrepptem Rand der Ambo und der Präsidiumssitz ange-ordnet sind, während der Rundungshinter-grund Platz für die Chorsänger bietet. So ent-steht eine Verbindung zwischen gerichteter Form und Circumstantes-Anordnung. Die po-lare Folge entspricht dem Bedürfnis des In-empfangnehmens, ohne dass sich die Ge-meinde nur auf sich selbst bezieht. Vielmehr umhüllt sie einen Verweisraum für den Herrn, der unter den Seinen weilt, indem sie einen Erfahrungsraum erbaut, wo sich das persönli-che Erleben der Begegnung mit dem Trans-zendenten öffnet.20 Die von Herbert Albrecht realisierte, abschließende künstlerische Aus-gestaltung setzt sich, wenngleich nicht de-ckungsgleich mit dem Kanon Steffanns, in der Materialbehandlung kraftvoll ab und interpre-tiert die Aufeinanderfolge von hervortreten-den Elementen und Stufen mit Eindringlich-keit, so dass historischer Kirchenbau und neue Feierarchitektur zu einer Komposition ver-schmelzen.
Die Dissertation von Tino Grisi ist erschienen als Band 15 der Reihe „Bild – Raum – Feier. Stu-dien zur Kirche und Kunst“ unter dem Titel: Können wir noch Kirchen bauen? · Possiamo ancora costruire chiese? Emil Steffann und sein · e il suo Atelier, Regensburg 2014, ISBN 978-3-7954-2872-3, € 49,95.
1 Romano Guardini: Der Kultakt und die ge-genwärtige Aufgabe der Liturgischen Bil-dung. Ein Brief Brief (it. Übers. L’atto di culto e il compito attuale della formazione liturgica
– Una lettera, in: Romano Guardini, Formazi-one liturgica, Brescia 2008, S. 27–36).
2 Romano Guardini: Liturgische Bildung, Burg Rothenfels a. M. 1923 (it. Übers. Formazione liturgica, Brescia, Morcelliana 2008, S. 118–120).
3 Die Kirche wurde inzwischen erheblich ver-ändert: Der Altar wurde ausgetauscht und höher gesetzt, es wurden farbige Fenster eingebaut (1966), Taufstein, Ambo und Ta-bernakel in das Presbyterium versetzt (1982), der Seitenarm mit einer verglasten Wand ge-schlossen und neue Leuchtkörper ange-bracht, die, obwohl sie sich an den Original-lampen orientieren, von störender Wirkung sind (2009).
4 Romano Guardini: Liturgische Bildung (it. Übers. S. 88–90).
5 Im Folgenden wird auf Walter Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften, in: Neue Deutsche Beiträge II, 1924–25, Bezug genom-men (it. Übers. Le affinità elettive, in: Angelus novus. Saggi e frammenti, Torino 1962, S. 163–243).
312 das münster 4/2014Architektur Liturgische Gestaltung in Kirchenbauten von Emil Steffann
6 Eine auf das 9./10. Jahrhundert zurückge-hende Tradition, die sich von Deutschland aus in Europa verbreitete, bestand darin, in der Fastenzeit ein großes „Hungertuch“ über den Altar zu breiten und die Bilder in der Kir-che zu verhüllen. Bis heute enthält das Römi-sche Messbuch für den fünften Fastensonn-tag die Möglichkeit, Kreuze (bis Karfreitag) und Bilder (bis zum Beginn der Ostervigil) zu verhüllen. In der Kölner Jesuitenkirche Sankt Peter, einem Dialograum für Kunst und Litur-gie, werden alle Bilder am Aschermittwoch verhüllt, um ihren ästhetisch-theologischen Sinn wieder ins Bewusstsein zu bringen.
7 Siehe Gisberth Hülsmann: Bauten der letzten Jahre, S. 60f. Der für den Narthex vorgese-hene Taufstein wurde in den Kirchenraum versetzt; von dem Projekt existiert eine frü-here Version, die ins Jahr 1963 datiert und in Christliche Kunstblätter 103 (1965), S. 81 veröf-fentlicht wurde.
8 Herbert Muck: Mythologien, S. 28. 9 Das münster 13 (1960), S. 28; Bauwelt 51 (1960),
S. 714; Bauen+Wohnen 5 (1961), S. 174. 10 Steffann hatte im Jahre 1946 bereits einen
Feierraum für die bettlägerigen Patienten eines Krankenhauses im Süden von Lübeck gestaltet, den er aus einer ehemaligen Turn-halle herausarbeitete; dort waren der Altar auf einem zweistufigen Podest in den Raum-schwerpunkt gesetzt und die Sitze für die Gläubigen außen an den Wänden angeord-net worden, um die Mitte des Raumes für die Kranken freizulassen. Relevant ist hier die Nutzung von Kriegstrümmern, die nach dem Prinzip der Entwicklung neuer Material-qualitäten in einen neuen Kontext gesetzt wurden (Emil Steffann: Notkirchen, S. 100).
11 Marcel Proust: Contre Sainte-Beuve (it. Übers. S. 101).
12 Romano Guardini: Vom Geist der Liturgie, Freiburg 1918 (ital. Übers. S. 51).
13 Romano Guardini: Der Kultakt und die ge-genwärtige Aufgabe der Liturgischen Bil-dung. Ein Brief (it. Übers. S. 28).
14 Romano Guardini: Von Sinne der Kirche (it. Übers. S. 39, 41).
15 Odo Casel, Das christliche Kultmysterium, Re-gensburg 1932 (it. Übers. Il mistero del culto cristiano, Roma 1985, S. 52).
16 Das schlichte Außenbild des Hexagons im Kranze der Klostermauer wird durch die von dem pyramidenähnlichen Dach sternförmig ablaufenden Grate und der Abdeckung der Strebemauer an der Nordwestwand, die ur-sprünglich aus Sichtbeton bestand, ein wenig gehoben. Der Innenraum wurde durch das Setzen einer Orgel auf dem Podest stark verändert, das für den Ambo bestimmt war.
17 Romano Guardini: Der Kultakt und die ge-genwärtige Aufgabe der Liturgischen Bil-dung. Ein Brief (it. Übers. S. 35).
18 Jean-Hyves Hameline: Une poétique du ri-tuel (it. Übers. S. 86–87).
19 Hier wird in extremer Verkürzung auf die Idee der „Teilchen im Raum“ im Buch von Yona Friedman: L‘ordre compliqué et autres fragments, Paris 2008, Bezug genommen (it. Übers. L’ordine complicato. Come costruire un’immagine, Macerata 2011, S. 43–72).
20 Siehe Albert Gerhards (Hg.): In der Mitte der Versammlung. Liturgische Feierräume, Trier 1999.
9 St. Martin Dornbirn, Liturgischer Raum
313das münster 4/2014 Liturgische Gestaltung in Kirchenbauten von Emil Steffann Architektur
320 das münster 4/2014Impressum Ausblick · Bildnachweis
Ausblick:Schwerpunkt der nächsten Ausgabe:„Kirche baut Stadt“ (Arbeitstitel)
Abonnement erhältlich unter:
Telefon: +49 (0) 9 41 7 87 85-0Telefax: +49 (0) 9 41 7 87 [email protected]
Vorschau Heft 1/2015, 68. Jahrgang
Titelbild münster 4/2014:Der Beuroner Engelkelch, Foto: www.altrofoto.de
Impressum
Herausgeber: Dr. Albrecht Weiland
Herausgeber, Verlag, Redaktion: Verlag Schnell & Steiner GmbHLeibnizstraße 13, 93055 Regensburg, Postfach 20 04 29, 93063 Regensburg, Telefon (0941) 78785-0, Telefax (0941) 78785-16, E-Mail: [email protected],Liga Bank e.G. Regensburg (BLZ 750 903 00), Kto.-Nr. 1122150 IBAN: DE 47 7509 0300 0001 1221 50 BIC Code: GENODEF 1M05Erfüllungsort: Regensburg
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:Dr. Simone Buckreus
Redaktionsbeirat: Dr. Manuela Beer, Köln; Dr. Nor-bert Jocher, München; Dipl.-Ing. Johannes Krämer, Mainz; Ao. Prof. Dr. P. Gregor M. Lechner OSB, Stift Göttweig; Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen, Würzburg; Dipl.-Ing. Martin Struck, Köln; Dr. Walter Zahner, Regensburg.
Anzeigenverwaltung: Verlag Schnell & Steiner GmbH (Anschrift s. Verlag)Anzeigenverwaltung: Augustin Vidor
Verkauf und Abonnementaufträge: Bestellungen an den Buchhandel oder direkt an den Verlag. Be-zugspreis pro Einzelheft € 14,90 [D], im Abonne-ment € 52,- [D], Studentenabo (nur mit Immatriku-lationsnachweis) € 39,- [D], jeweils zzgl. Versandkos-ten (Inland Einzel ver sand € 1,64, Abonnements € 9,10). Mitglieds abonnement für Mitglieder des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker € 9,68 (statt € 14,90) für das Einzelheft – 5 Ausgaben im Jahr für insgesamt € 48,43 zzgl. € 9,10 Versandkosten. Die Abonnements gelten für das ganze Jahr und verlängern sich, falls nicht 3 Monate vor Jahres-ende gekündigt wird. Zahlung per Bank-überweisung oder Kreditkarte möglich: American Express, JCB-Cards, Master Card, VISA. Interessenten im Ausland wenden sich bitte an unsere Ausliefe-rungen. Schweiz: Herder AG Basel, Verlagsausliefe-rung, Muttenzerstr. 109, CH-4133 Pratteln 1, [email protected]; Holland und Belgien: Bruil & van de Staaij, Postbus 75, NL-7940 AB Meppel, www.bruil.info/dasmuenster; Spanien: PPC Acebo, apartado 19049, ES-54 Madrid. Bei Nichtlieferung durch höhere Gewalt, Streik oder Aussperrung be-steht kein Anspruch auf Ersatz.
Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte. Wir bitten bei der Manuskript erstel-lung um die Beachtung der redaktionellen Hinwei se, die beim Verlag anzufordern sind. Überarbeitungen und Kürzungen bleiben vorbehalten. Die mit Namen versehenen Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion identisch sein. Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – elektronisch, durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbe-sondere von Datenverarbeitungs anlagen, ver-wendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder auf ähnlichem Wege bleiben vorbehalten. Fotokopien für den persönlichen und sonstigen eigenen Ge-brauch dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus als Einzelkopien hergestellt werden. Jede im Bereich eines gewerblichen Unterneh-mens hergestellte oder benützte Kopie dient ge-werblichen Zwecken gemäß § 54 (2) UrhG und ver-pflichtet zu Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung Wissenschaft, Untere Weidenstraße 5, 81543 München, von der die Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.
Wichtiger Hinweis: Wir bitten bei der Manuskript-erstellung unbedingt um die Beachtung der redak-tionellen Hinweise, die beim Verlag anzufordern sind. Bitte reichen Sie nur vollständige Manuskripte ein (inkl. Bilder, Bildunterschriften, Vita etc.). Änderungen sind vorbehalten. Die Redaktion
Konzeption: Dr. Simone Buckreus, Dr. Albrecht WeilandLayout: Florian KnörlGesamtherstellung: Erhardi Druck GmbH, Leibnizstraße 11, 93055 Regensburg© 2014 Verlag Schnell & Steiner RegensburgPrinted in Germany
ISSN 0027-299X
Weitere Informationen zum Verlagsprogramm erhalten Sie unterwww.schnell-und-steiner.de
Bildnachweis
Reinhard Hoeps1 © Hohe Domkirche Trier, Foto: Rita Heyen, Amt für kirchliche Denkmalpflege Trier2 Archiv des Autors3 © Dombauhütte Köln / Foto: Matz und Schenk4 Anne Gold, Aachen
Christoph Stiegemann1, 2, 6, 8, 17 © Diözesanmuseum Paderborn, Foto: Ansgar Hoffmann, Schlangen3–5, 13–15, 19, 26 onebreaker.de 7, 16, 18, 19, 22 Erzbistum Paderborn, Fachstelle Kunst, Kunstinventarisation9, 11, 12, 20, 23–25 Erzbistum Paderborn, Fachstelle Kunst, Kunstinventarisation, Foto: Ansgar Hoffmann21 Erzbistum Paderborn, Fachstelle Kunst, Kunstinventarisation, Foto: Sabine Renger, Soest
Anja Lempges1, 4, 5 © Denkmalamt Frankfurt am Main2, 3 © Hochbauamt Frankfurt am Main und Uwe Dettmar6, 7, 9, 10 © Denkmalamt Frankfurt am Main und Eike Quednau8, 11 © Denkmalamt Frankfurt am Main und Hans Michael Hangleiter
P. Augustinus Gröger/Claudia Lang1–4 Kunstarchiv der Erzabtei Beuron5 Foto: Ludger Kruthoff, Beuron6,7 www.altrofoto.de8 Foto: Wolfgang Iske, Mengen
Martina Gelsinger1 Foto: Roland Kollnitz2 Foto: Günter Richard Wett3 Foto: Elisabeth Plank4–6, 9, 10 Foto: Ulrich Kehrer7, 8 Foto: Kramer & Hipfl11 Foto: Judith Wimmer12 Foto: Riepl Riepl
Ralf ScholzAbb. 11 © The President and Fellows of Harvard College/ Fogg Museum, Cambridge Mass., Geschenk von Edward W. Forbes zum Gedenken an Charles Eliot Norton, 1927.207.1-3Abb. 12 Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Elke EstelAbb. 14 Hl. Sebastian in Erwartung der Häscher, Strichzeichnung: Max Scholz, KarlsruheAlle übrigen Abb. Archiv des Autors
Rainer Alexander Gimmel1 Screenshot der Website http://www.schluss-mit- langeweile.de/hobby/stricken/]2–8 © Museum Georg Schäfer, Schweinfurt
Barbara DaentlerAlle Abb. Foto: Rita Heyen, Amt für kirchliche Denkmalpflege Trier
Tino Grisi1 Pfarramt St. Martin-St. Remaclus Cochem + Tino Grisi2, 4 Archiv Hülsmann3, 5–9 Foto: Tino Grisi
Jürgen Lenssen1 Foto: Rainer Boos, Regensburg2–4 Foto: Thomas Obermeier, Würzburg 5 Foto: Dirk Nitschke, Kitzingen
Christina Werner1 Foto: Richard Ferkl / Dommuseum Wien
Gregor M. Lechner OSBAlle Abb. Archiv des Autors
Anton Neugebauer1 Foto: Rainer Boos, Regensburg