Die Kapitolinische Wölfin - doch ein täuschend echt antikes Monument? in: K. B. Zimmer, Täuschend...
Transcript of Die Kapitolinische Wölfin - doch ein täuschend echt antikes Monument? in: K. B. Zimmer, Täuschend...
1 Bronzeabguss der Kapitolinischen Wölfin mit ergänzter Zunge und rekonstruierter Augenpartie (B. von Freytag gen. Löringhoff/O.-W. von Vacano). Tübingen, Institut für Klassische Archäologie Inv. 135
Faustulus. Dieser befindet sich, auf seinen Hir-tenstab gestützt, am linken Bildrand und ist ne-ben einer Tunika mit einem charakteristischen hohen Hut bekleidet. Mit seiner Rechten greift er in den Feigenbaum – den ficus Ruminalis –, unter dem er der literarischen Überlieferung nach die säugende Wölfin entdeckt hatte. Den größten Teil des Bildfeldes nimmt nun die übergroße Darstel-lung der Gruppe mit der Lupa und den Zwillingen ein. Die nach rechts stehende magere Wölfin, die vor allem auf dem Kamm ihres Rückens ein dich-tes Fell aufweist, hat dabei ihren Kopf in einer mächtigen Bewegung weit zurückgedreht, um die an ihren Zitzen saugenden Kinder zu betrachten.6 Ähnlich detailreich ist die Darstellung auf einem Karneol, einem römischen Ringstein des 1. Jhs. v. Chr. (Abb. 3). Auch hier stehen der Feigenbaum, die Wölfin mit Romulus und Remus sowie der Hir-te Faustulus als Kürzel für den gesamten Mythos. Verschafft man sich einen Überblick über das ge-samte Spektrum an Abbildungen, besonders in der Kleinkunst, so zeigt sich, dass die beiden an-geführten Beispiele in ihrer Darstellung tatsäch-lich zu den ausführlichsten zählen. Meist genügte jedoch als Chiffre die säugende Wölfin allein, wie dies auf einem unter Kaiser Vespasian für seinen Sohn Domitian geprägten aureus (77/78 n. Chr.) zu sehen ist (Abb. 4).7 Die Lupa steht hier im Ge-gensatz zu den anderen beiden Beispielen nach links, weist aber genauso das leicht gespreizte Standmotiv und den zurückgedrehten Kopf auf und entspricht damit ebenfalls dem in der römi-schen Bilderwelt fast durchgehend verwendeten ikonographischen Schema.
„[Vulcanus] zeigte auch, wie sich säugend in Mavors‘ grünender Grotte hinlagert die Wöl-fin, wie, rings an den Zitzen ihr hängend, spielten die Zwillingsknaben und furchtlos bei ihrer Amme saugten, wie jene mit wendigem Hals sich bog und die beiden koste und, strei-chend und bildend, die Leiber umfuhr mit der Zunge.“1
Es ist der römische Gott des Feuers und der Gatte der Venus, der in Vergils Aeneis mit dem Grün-dungsmythos der Stadt Rom den neu geschaf-fenen Schild des Aeneas schmückt. Das Bild der säugenden Wölfin steht hier neben anderen Sze-nen, die prophetisch auf die glorreiche Zukunft Roms verweisen. Die Geschichte um die ausge-setzten Zwillinge Romulus und Remus und die sich ihrer in der Höhle des Mars zu Füßen des Palatinhügels annehmenden Wölfin ist uns aber nicht nur durch Vergil, sondern zusätzlich durch eine Reihe weiterer römischer Autoren überlie-fert. Besonders Dionysios von Halikarnass und Plutarch fallen hierbei durch ihre detailreichen Schilderungen auf.2 Der Kern des Mythos wird in der gesamten Überlieferung jedoch kaum va-riiert.3 Auch in der römischen Bildkunst ist die Geschichte um die Gründung der urbs und beson-ders die sich um die beiden Knaben kümmernde Wölfin ein beliebtes Thema.4 Exemplarisch kön-nen dies verschiedene Stücke aus der Tübinger Sammlung veranschaulichen: Um eine besonders frühe und zudem detailreiche Darstellung han-delt es sich bei dem im Jahr 137 v. Chr. durch den Münzmeister Sextus Pompeius Fostulus in Rom geprägten Denar (Abb. 2).5 Das Münzrevers zeigt die Auffindung der Zwillinge durch den Hirten
Manuel Flecker
Die Kapitolinische Wölfin– doch ein täuschend echt antikes Monument?
82
Die heutzutage berühmteste Darstellung der Wölfi n stellt aber ohne Zweifel die bronzene Lupa Capitolina dar (Abb. 5). Eine Statue, die von der Forschung gemeinhin in das späte 6. oder begin-nende 5. Jh. v. Chr. dati ert worden ist. Auch sie ist als ein abgemagertes Raubti er mit hervortre-tenden Rippen dargestellt. Deutlich betont sind zudem die acht Zitzen an ihrem Unterkörper. Be-sonders charakteristi sch für die Kapitolinische Wölfi n ist das in ausgewählten Bereichen äußerst ornamental aus elegant geschwungenen und wohl gelegten Locken gestaltete Fell. Vergleicht man die Statue jedoch mit den oben angeführten Beispielen, so fällt vor allem die andere Kopfh al-tung auf. Hier ist das Haupt der Wölfi n nicht in großer Bewegung zurückgewandt, ja nicht einmal leicht zurückgeneigt, vielmehr blickt sie fast fron-tal, mit leicht geöff netem Maul, in Richtung des Betrachters. Es ist gerade diese veränderte Hal-tung, die immer wieder zu der Frage geführt hat, ob auch in der Anti ke unter ihren Zitzen die bei-den Knaben saßen, so wie es die im 15. Jahrhun-dert ergänzten Zwillinge heute vermitt eln.8
Erstmals sicher nachweisen lässt sich die Bron-zestatue bereits im 13. Jahrhundert. Magister Gregorius, ein englischer Gelehrter, beschreibt in seinen „mirabilia urbis Rome“ die Statue in der Porti kus des päpstlichen Lateranpalastes, die er dort wohl in der Regierungszeit Papst Gregors IX. (1227–1241) erblickt hatt e.9 Unklar ist der Moment, zu dem die Lupa die Porti kus wieder verließ. In jedem Fall ist sie für das Jahr 1438 in unmitt elbarer Nähe des Palastes nach-gewiesen. Zu diesem Zeitpunkt schmückte sie in
luft iger Höhe die Torre degli Annibaldi, die sich auf dem Vorplatz der päpstlichen Residenz, dem Campus Lateranensis, befand.10 Unter Papst Six-tus IV. wurde sie dann erstmalig auf das Kapitol verbracht, um über dem Eingang zur Porti cus des Konservatorenpalastes einen neuen Platz zu fi n-den. Im gleichen Zeitraum – dem späten 15. oder frühen 16. Jahrhundert – dürft en denn auch die Zwillinge hinzugefügt worden sein. Im Rahmen der Umgestaltung des Kapitolsplatzes und seiner Gebäude durch Michelangelo nach dem „Sacco di Roma“ (1527) wurde die Wölfi n im Inneren des neuen Konservatorenpalastes wieder aufgestellt, wo sie sich auch heute noch befi ndet.11
Für das anti ke Rom lassen sich durch die litera-rischen Quellen mindestens zwei wichti ge Bron-zegruppen nachweisen, die beide die säugende Wölfi n mit den Zwillingen wiedergaben. Zum ei-nen überliefert uns der bereits erwähnte Diony-sios von Halikarnass in seinen in augusteischer Zeit verfassten „Römischen Altertümern“ eine Gruppe im Bereich des Lupercal am Fuße des Palati ns; also genau an jenem Platz, an dem der Hirte Faustulus dem Mythos zufolge die von der Lupa umhegten Zwillinge entdeckte.12 Zum ande-ren berichtet Cicero mehrfach von einer weite-ren Gruppe auf dem Kapitol.13 Er erwähnt diese stets in Zusammenhang mit einem verheerenden Blitzschlag, der den Kapitolshügel im Jahre 65 v. Chr. traf und dabei nicht nur verschiedenste Ob-jekte wie Gött erstatuen und Inschrift en schwer beschädigt hatt e, sondern auch das Bronzebild-nis einer säugenden Wölfi n: „Hier pfl egte die Amme des römischen Volkes zu stehen, dem Wald und Mars zugehörig, welche die Säuglinge, die aus Mars‘ Samen hervorgegangen waren, an strotzenden Zitzen mit lebensspendendem Nass tränkte; auch sie stürzte damals, zusammen mit den Knäblein, unter dem fl ammenden Blitzschlag zu Boden und verließ, losgerissen, den Standort ihrer Füße“14.Die Forschung hat natürlich versucht, die auf uns gekommene Lupa Capitolina mit einer der beiden Textstellen zu verbinden. Besonders die Folgen des bei Cicero genannten Blitzschla-ges hat man dabei immer wieder an den Hin-terläufen der Kapitolinischen Wölfi n erkennen wollen. Diese Fragen haben durchaus ihre Be-rechti gung, müssen aber an dieser Stelle noch
2 Denar des Münzmeisters Sextus Pompeius Fostulus, 137 v. Chr. Tübingen, Insti tut für Klassische Archäologie, o. Inv. Nr.
83
3 Gemme (Karneol), 1. Jh. v. Chr. Original und Abdruck. Tübingen, Insti tut für Klassische Archäologie Inv. 7516
84
hinzu, die alles andere als einheitliche Ergebnis-se lieferten, wenngleich sie tendenziell auf eine mittelalterliche Entstehung hindeuteten. Dem-gegenüber sprachen sich die Protagonisten ei-ner ikonographischen Analyse durchgehend für eine Entstehung der Lupa Capitolina im späten 6. oder 5. Jh. v. Chr. aus und betonten zudem die verschiedenen in der Skulptur vereinten Einflüs-se aus anderen Regionen des Mittelmeerraums wie der Magna Graecia, Ionien, aber auch dem Orient. Besonders Claudio Parisi Presicce und Eugenio La Rocca waren sich dessen ungeachtet der Problematik bewusst und brachten bereits zum damaligen Zeitpunkt die Möglichkeit einer Kopie ins Spiel.19 Letzterer, ein Vertreter einer Datierung um 480/70 v. Chr., drückte sein Unbe-hagen darüber jedoch folgendermaßen aus: „op-pure – ma ci muoviamo in una terra incognita con una proposta che rasenta l’assurdo – che la Lupa stessa sia una copia fedelissima di età medievale, ricavata a stampo da un originale etrusco-italico in pessime condizioni di conservazione, e poi per-fezionata a cesello a imitazione del modello. Ma chi, a quell’epoca, poteva avere la maestria tecnica nel rifinire un’opera in bronzo con tale abilità?“20. Wie sich jedoch zeigen wird, trifft die von La Roc-ca zum damaligen Zeitpunkt nur mit großen Zwei-feln und Vorbehalten geäußerte Vermutung einer äußerst getreuen Kopie wohl das Richtige.Ein endgültiger Beweis für die Entstehung der Großbronze erst im späten Mittelalter wurde der Öffentlichkeit ebenfalls noch im Jahr 2008 zu-gänglich gemacht, allerdings kam die Publikati-on der Ergebnisse zu spät, um noch im Rahmen des bereits im Februar abgehaltenen Kongres-ses ausführlich diskutiert zu werden. Analysen an Gusskernresten der Lupa anhand der Radio-karbonmethode durch ein renommiertes italie-nisches Institut (CEDAD/Lecce) hatten eindeutig deren mittelalterliche Provenienz aufgezeigt und eine Datierung in das 13. Jahrhundert nahege-legt.21 In Folge der erneuten Restaurierung der Kapitolinischen Wölfin war es neben Carruba vor allem Edilberto Formigli, einer der besten Ken-ner antiker Bronzetechnik, der sich vehement und mit guten Argumenten für eine mittelalter-liche Schöpfung eingesetzt hatte.22 Fasst man die Argumentation der beiden Forscher zusammen, so sind es speziell folgende Punkte, die doch
ein wenig hintangestellt werden. Vielmehr soll das von Cicero überlieferte Ereignis als ein Sinn-bild für eine ganz ähnliche Begebenheit stehen, die die Lupa Capitolina, wenn auch nicht erneut von ihrem Sockel stieß, so doch aus ihrem wis-senschaftlichen Dornröschenschlaf erweckte. Ausschlaggebend für diesen neuen „Blitzschlag“
war eine Restaurierung der Kapitolinischen Wöl-fin in den Jahren 1997–2000,15 in deren Folge die zuständige Restauratorin Anna Maria Carruba ihre Ergebnisse monographisch publizierte und vor allem aufgrund der Herstellungstechnik für eine mittelalterliche Entstehung der Bronzeplas-tik plädierte.16 Es verwundert nicht, dass die neu vorgebrachte Datierung sogleich auf großen Wi-derstand stieß, steht die bronzene Wölfin doch wie kein anderes Monument für Rom und seine Geschichte: „La Lupa, simbolo per antonomasia di Roma sin dall’antichità, ha sempre seguito la capitale come un totem benevolo“17. In unmittel-barer Folge der neu losgetretenen Debatte fand im Jahr 2008 an der Università di Roma „La Sa-pienza“ ein Kolloquium statt, in dessen Kontext sich Wissenschaftler verschiedenster Diszipli-nen mit Carrubas Thesen auseinandersetzten.18 Der Kongress und die damit verbundene Publi-kation, die bereits 2010 erschien, gliedern sich dabei in zwei thematische Blöcke. Der erste be-schäftigt sich mit der Kapitolinischen Wölfin vor allem anhand naturwissenschaftlich-technischer Kriterien, während die zweite Gruppe sich der Bronzeskulptur „traditionell“ unter stilgeschicht-lichen und ikonographischen Gesichtspunkten nähert. Das Kolloquium ist ohne Zweifel Beispiel für eine gewinnbringende und über die Grenzen der Fächer hinweg ertragreiche Zusammenarbeit und wird auch in Zukunft die Basis für jedwede Beschäftigung mit der römischen Wölfin sein. Das damalige Ergebnis war aber doch in gewis-ser Weise – gerade für das nichtwissenschaftliche Publikum – ernüchternd, denn eine Annäherung der Vertreter einer traditionellen Datierung in etruskisch-frührömische Zeit und den Vertretern einer Einordnung in die mittelalterliche Kunst fand nicht statt. Dabei verliefen die „Gräben“ so-gar innerhalb der Gruppe naturwissenschaftlich --technischer Wissenschaftler. Erschwerend kamen die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Verfahren wie der Thermolumineszenz-Analyse
85
Wachsausschmelzverfahren. Während die letzt-genannte Technik bereits in der Anti ke angewen-det wurde, lässt sich der Guss in einem Stück unter Zuhilfenahme von Matrizen nicht für die Anti ke nachweisen und wird erstmals ausführ-lich von Benvenuto Cellini im 16. Jahrhundert be-schrieben.24 Neben den Argumenten, die oben bereits für die mitt elalterliche Dati erung ins Feld geführt wurden, sind es weitere von Formigli bei-gebrachte Detailbeobachtungen, die nun für die-se besondere Gusstechnik und damit ebenfalls für eine mitt elalterliche Entstehung sprechen: So fi ndet man gerade in signifi kanten Bereichen, den Kontaktzonen der verwendeten Matrizen, deutliche Überarbeitungsspuren, die einstmals vor dem Guss auf dem Wachsmodell vorgenom-men worden waren (Abb. 6). Darüber hinaus sind es vor allem Besonderheiten in verschiede-nen Bereichen der Statue, die ebenfalls nur auf nachträgliche Eingriff e und auf Überarbeitungen an der Wachspatrize zurückgeführt geführt wer-den können. Zu nennen sind hier die Verbreite-rung der Ohren an ihrer Basis, die nur ungenau ausgearbeiteten Zähne, das Fehlen der Zunge und die überarbeiteten Pupillen der Augen. Be-sonders klar wird eine nachträgliche Interventi on bei genauerer Betrachtung des Raubti erschwan-zes, welcher durch den mitt elalterlichen Künstler gänzlich neu geschaff en worden war. Die voll-kommen andersarti ge und einfache sti listi sche Ausarbeitung der Locken des Fells macht dies auf den ersten Blick deutlich. Auch die Positi onierung des Schweifes und seine Verbindung mit dem lin-ken hinteren Bein der Wölfi n deuten auf dessen
aus herstellungstechnischer Sicht bereits auf eine nach anti ke Entstehung verweisen: Der besonde-re Guss in einem einzigen Stück; das Gestänge im Inneren, das in einem Zug mit dem Guss des Kör-pers geschaff en worden war; der Verschluss gro-ßer Öff nungen durch Bronzeplatt en in Kaltarbeit; die unanti ke Pati na; das Fehlen jeglicher Spuren von überarbeitender Kaltarbeit und Ziselierung; die Existenz von immer noch vorhandenen Guss-kanten; das Fehlen von Ausbesserungsdübeln und Spuren von Abstandhaltern. All die aufge-führten Punkte sind für Carruba und vor allem für Formigli undenkbar im Kontext einer etruskisch-römischen Großbronze des 5. Jhs. v. Chr. Obwohl Formigli von einer mitt elalterlichen Da-ti erung überzeugt war, beschlichen auch ihn, ähnlich wie La Rocca, Parisi Presicce und Mura Sommella, Zweifel ob des disparaten Befundes: Zweifel, die sich nach der Publikati on des Kollo-quiums aus dem Jahr 2008 noch verstärkten und die ihn zu einer erneuten Untersuchung und ei-ner nahsichti gen Autopsie der Wölfi n veranlass-ten. Die erst seit kurzem publizierten und meines Erachtens überzeugenden Ergebnisse dieser Un-tersuchung vermögen es nun aber, die bisherige Kontroverse aus der Aporie herauszuführen und zukünft iger Forschung zu dieser bedeutenden Großbronze ein ganz neues und stabiles Funda-ment zu bieten.23 Formigli kann nämlich zeigen, dass es sich bei der Bronze der Lupa tatsächlich um eine Kopie, also um einen Abguss von einem anti ken Original, handelt. Dieser Abguss wurde in einer indirekten Technik unter Verwendung von Hilfsnegati ven, wahrscheinlich aus Gips, herge-stellt. Bei diesem Verfahren werden, um nur die wichti gsten Schritt e zu nennen, von einem Mo-dell, in diesem Fall also von dem anti ken Origi-nal der Wölfi n, Matrizen abgenommen. Dann wird um ein stabilisierendes Eisengestänge ein Tonkern aufgebracht, der fast die innere Form der verwendeten Hilfsnegati ve aufweist. Nach dem Zusammenfügen der Matrizen wird in den so entstandenen Raum zwischen Tonkern und Matrize Wachs eingefüllt. Nach dem Erkalten der Wachsmasse und dem Abnehmen der Ne-gati vformen konnte die neu entstandene Pat-rize schlussendlich überarbeitet und zusätzlich ergänzt werden. Am Ende des gesamten Ver-fahrens stand dann ein erneuter Hohlguss im
4 Unter Vespasian geprägter aureus, 77/78 n. Chr. Tübingen, Insti tut für Klassische Archäologie, o. Inv. Nr.
86
5 Die Kapitolinische Wölfin. Rom, Musei Capitolini
6 Aufsicht auf die Kapitolinische Wölfin. Deutlich zu sehen sind die am Wachsmodell vorgenommenen Überarbeitungen. Rom, Musei Capitolini
87
Weihung typologisch-stilistisch eher dem ent-sprochen haben, was beispielsweise auf der Mün-ze des Pompeius Fostulus zu sehen war (Abb. 2).29 Eine Verbindung der bronzenen Wölfin mit die-ser Statuengruppe ist deswegen kaum denkbar. So bleibt die von Cicero genannte Bronzestatue auf dem Kapitol. Wie weiter oben schon ange-deutet, hat die Forschung versucht, die Schad-stellen im unteren Bereich der beiden Hinterläufe mit dem dort erwähnten Blitzschlag in Verbin-dung zu bringen. Formigli hat jedoch gezeigt, dass die vorhandenen Öffnungen ziemlich sicher auf Fehler beim Gussvorgang zurückgeführt wer-den müssen und im Mittelalter wohl durch heu-te verlorene Einsatzstücke ausgebessert waren.30 Eine Verbindung zur Katastrophe des Jahres 65 v. Chr. auf dem Kapitol lässt sich auf diesem Weg also nicht herstellen. Formigli beschreibt jedoch noch eine weitere Besonderheit an den Beinen der Wölfin. Betrachtet man diese nämlich genau, so offenbart sich kurz über dem Bereich der Pfo-ten eine ungewöhnliche Durchbildung der bron-zenen Oberfläche, die auf eine Überarbeitung am Wachsmodell zurückzuführen sein muss. Die feststellbaren Eingriffe an den Beinen deuten da-rauf hin, dass das antike Bronzeoriginal dem un-tersten Bereich seiner vier Beine beraubt war und diese wohl erst ex novo durch den mittelal-terlichen Künstler geschaffen werden mussten.31 Dieser neu entdeckte Befund passt nun hervorra-gend zur Überlieferung des Magister Gregorius, der über die Wölfin in der Porticus des Lateran-palastes schreibt: „sed fractis pedibus a loco suo divulsa est“32. Sie sei also mit gebrochenen Bei-nen von ihrem ursprünglichen Standort entfernt worden.33 Der Befund deckt sich allerdings eben-falls sehr gut mit der Beschreibung des Cicero, dass die durch den Blitz getroffene Wölfin die ab-gerissenen vestigia ihrer Füße auf ihrer Basis zu-rückgelassen habe. Mit vestigia kann in diesem Fall sowohl der Fußabdruck als auch der untere Bereich des Fußes gemeint sein.34 Die Idee einer Verbindung von Lupa Capitolina und der ciceroni-schen Überlieferung bleibt so also mehr als ver-lockend, wenngleich sie in letzter Konsequenz natürlich hypothetisch bleiben muss.35 Verborgen bleibt uns auch die weitere Geschich-te der römischen Wölfin bis in nachantike Zeit. In jedem Fall scheint sie die urbs nie verlassen zu
Neukonzeptionierung hin. Wie Vergleiche mit an-tiken Bronzestatuen zeigen, dürfte der originale Schwanz der Lupa frei im Raum, ohne Verbindung zum Körper gestanden sein. Möglich machte dies das Wissen um eine Verbindung von Einzeltei-len mittels Löten, einer Technik, deren Kenntnis in nachantiker Zeit verloren ging. Der mittelal-terliche Handwerker war deswegen gezwungen, Schweif und Bein miteinander zu verbinden, um den Guss in einem Stück gewährleisten zu kön-nen.25 Auch wenn noch nicht alle Details der Restaurie-rung und der verschiedenen naturwissenschaft-lichen Untersuchungen vorgelegt sind, so bietet der jetzt erreichte Forschungsstand eine gute Basis, um grundlegende Fragen noch einmal zu stellen. Durch die Bestätigung der antiken Prove-nienz bleibt die ursprüngliche Datierung davon jedoch weitgehend unberührt und die zahlrei-chen Überlegungen der Vergangenheit behalten ihre Gültigkeit. Lediglich die verschiedenen klei-nen mittelalterlichen Überarbeitungen und Ein-griffe – wie die Umarbeitung der Augen – müssen nun in Zukunft bei der stilgeschichtlichen Einord-nung der Wölfin Berücksichtigung finden. Blickt man noch einmal auf die verschiedenen Beiträ-ge des schon mehrfach bemühten Kongresses in Rom, so kristallisiert sich ein Zeitraum für die antike Entstehung der Lupa zwischen 530–470 v. Chr. heraus, wobei eine Datierung in die ersten Jahrzehnte des 5. Jhs. v. Chr. gemeinhin favori-siert wird.26 Bedenkenswert scheinen mir jedoch nach wie vor die bereits von v. Vacano 1973 ge-äußerten Vermutungen bezüglich einer späteren zeitlichen Einordnung, sei diese nun durch ein Re-tardieren hinter der Stilentwicklung in den Zen-tren des griechischen Mutterlandes oder durch einen gezielten Einsatz archaischer Formelemen-te bedingt.27 Eng mit der Datierung der Kapitolinischen Wölfin ist die bereits weiter oben angerissene Frage ver-knüpft, ob sich unsere Lupa mit einer der in den literarischen Quellen genannten Statuen verbin-den lässt. Für den Bereich des Lupercals ist uns durch Dionysios von Halikarnass und vor allem durch Livius eine Bronzegruppe der Wölfin mit den beiden Zwillingen überliefert, die die Brü-der Gnaeus und Quintus Ogulnii dort im Jahr 296 v. Chr. geweiht hatten.28 Allerdings dürfte diese
88
auch nicht die spätere Porticus gemeint sein, so muss der Ort sich doch im Bereich des Lateranpa-lastes befunden haben.40 Die aufgeführten Stel-len sind deswegen ein deutlicher Beleg für eine Präsenz der Lupa auf dem Campus Lateranensis in der Zeit bereits um oder kurz nach 800. Wann aber wurde die Kopie der antiken Wölfin erstellt? Magister Gregorius dürfte sie jedenfalls, wie die von ihm beschriebenen gebrochenen Beine bele-gen, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts vor ihrer Neuerstehung gesehen haben. Darauf weist auch eine weitere Bemerkung in seinem Werk hin. Er berichtet von einer früheren Nutzung der Lupa als Fontäne. Aus ihren Zitzen sprudelte da-bei Wasser, an dem man sich die Hände waschen konnte. Da am heutigen Monument diesbezüg-lich nichts mehr zu erkennen ist, müssen sich die Beobachtungen des englischen Gelehrten auch in diesem Fall auf das antike Original beziehen. Schwer zu beurteilen ist, ob Dante, der die Wölfin 1301 in Rom gesehen hat und dem sie Sinnbild für das machtgierige und verkommene römische Papsttum war, dieser noch im Original oder be-reits im Nachguss begegnet ist.41 Laut C14-Ana-lyse liegt die Entstehung der Neuschöpfung im 13. Jahrhundert, also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Besuchen des Magister Gregorius und Dantes. Meines Erachtens existiert jedoch ein geeigneter Moment, der sich möglicherweise mit der Schaffung der Kopie in Verbindung brin-gen lässt: Die Verbringung der Bronzeskulptur auf die sogenannte Torre Annibaldi im Norden des Campus Lateranensis (Abb. 7). Bei dieser Maß-nahme handelt es sich doch weniger um eine Verbannung – so zuletzt Fried42 – denn um eine bewusste Neuinszenierung der Skulptur, die nun einem Wappen gleich über dem Platz thronte.43 Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte die Wöl-fin für die römische Kirche nun durchweg positiv konnotiert gewesen sein.44
Abgesehen vom genauen Zeitpunkt und Anlass der Entstehung der Kopie, sind vor allem der Akt des Kopierens an sich und der Umgang mit der antiken Originalskulptur für unsere Fragestel-lung von besonderer Bedeutung. Da sich in den Quellen keinerlei Hinweise auf eine zweite Wöl-fin finden, liegt der Verdacht nahe, dass man das antike Original ebenfalls zu einem unbestimm-ten Zeitpunkt dem Schmelzofen überantwortet
haben und teilt damit nicht das fatale Schicksal einer anderen Lupa. Niketas Choniates beschreibt in seiner Chroniké diégesis die Ereignisse um den Fall Konstantinopels im Jahr 1207 und die damit verbundenen Zerstörungen und Plünderungen. In seiner Schilderung verweist er auch auf eine Romulus und Remus säugende Wölfin, die im Hippodrom aufgestellt war und die die Plünde-rer dem Schmelzofen übergeben hatten.36 Mög-licherweise handelt es sich bei dieser Gruppe um die Statuenstiftung der Ogulnii, die in den Wirren der Spätantike nach Konstantinopel verschleppt worden war.37 Auch das antike Original unserer Wölfin dürfte dem Schmelzofen nicht entkommen sein, doch bewahrt die Kopie des 13. Jahrhunderts deren Er-innerung und Geschichte. Besonders spannend ist dabei die mittelalterliche Rezeption der Ka-pitolinischen Wölfin. Johannes Fried hat sich zu-letzt ausführlich damit beschäftigt und dabei die richtigen Fragen gestellt: „Wann also wurde die Wölfin gegossen? Warum? Für wen? Zu welchem Ziel?“38. Problematisch bei seinen Ausführungen ist jedoch, dass er das Bronzewerk – dem dama-ligen Forschungsstand entsprechend – für eine mittelalterliche Neuschöpfung hält. Von daher mag man seinem Weg, aber kaum seinem Ergeb-nis folgen. Er bringt die Entstehung der Wölfin mit einem der führenden Adelsgeschlechter der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Verbindung, den Grafen von Tusculum, und sieht in der Lupa ein „stolzes Zeichen des uralten Adels und der Macht dieser tuskulaner Grafen“39. Nach der Un-terwerfung des Adelsgeschlechtes durch Papst Alexander III. (1170) und der Zerstörung von Tus-culum durch die Römer (1191) wäre die Statue dann in fremde Hände gefallen und hätte schluss-endlich ihren Weg in den Lateranspalast gefun-den. Aufgrund ihres antiken Ursprungs wird man die Wölfin nun aber doch mit einer anderen mit-telalterlichen Überlieferung in Verbindung brin-gen wollen. So ist in einem Abschnitt des „Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma“ bereits im späten 9. Jahrhundert von einem Gerichts-ort namens „ad Lupam“ die Rede und auch das Chronicon des Benedikt von St. Andrea aus der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts nennt einen „locus ubi dicitur a Lupa“, der als Gerichtsstätte diente. Mag mit dem „bei der Wölfin“ bezeichneten Platz
89
Möglicherweise dürfte der neue repräsentative Wert, aber auch die durch die wiederverwende-te Bronze und vor allem durch die Verwendung von Matrizen bewahrte Authentizität den Ver-lust der alten Skulptur aufgewogen haben. Die im Geiste der Zeitgenossen bewahrte Authentizität der Skulptur könnte auch ein Grund dafür sein, dass sich in den Quellen keinerlei Hinweise auf eine Reproduktion der Lupa erhalten haben. Soll-te die antike Wölfin tatsächlich gänzlich in der neugeschaffenen Skulptur des 13. Jahrhunderts aufgegangen sein, so wäre dies meines Wissens ein singulärer Befund für die nachantike Zeit. In gewisser Weise lässt sich der Befund der Lupa jedoch an die verbreitete mittelalterliche Praxis der Umarbeitung von antiken Monumenten an-schließen, die dazu diente, diese in neue Kontex-te einzupassen und für neue Aufgaben nutzbar
hat. Formigli hat zuletzt aufgrund der besonde-ren Bronzelegierung der Kapitolinischen Wölfin vermutet, dass man für den Neuguss die Bronze des Originals wiederverwendete.45 Sollte sich die-se Vermutung durch weitere Analysen erhärten lassen, so würde sich dadurch ein ganz eigenes Verhältnis des spätmittelalterlichen Menschen zu den antiken Monumenten offenbaren. Wir hät-ten es hier dann weder mit einer Fälschung noch mit einer Imitation zu tun, sondern mit einer be-sonderen Form der Restaurierung und vielleicht auch Nobilitierung. Gerne wüsste man, ob es in diesem Fall zum Zeitpunkt der Transformation zu Diskussionen gekommen ist, ob die Gelehr-ten der Zeit Einspruch erhoben haben und auf den Wert des antiken Originals pochten oder ob sie auch nach vollzogener Umwandlung die Wöl-fin nach wie vor als eine antica lupa ansahen.
7 Hinrichtung auf dem Campus Lateranensis. Im Hintergrund ist die Torre degli Annibaldi mit der Lupa Capitolina und den daneben angebrachten abgehackten Händen von Dieben zu erkennen
90
7 RIC II, 241. Zusätzlich findet sich hier jedoch noch ein Kahn, der ebenfalls auf die Geschichte anspielt.
8 O.-W. von Vacano, Vulca, Rom und die Wölfin. Untersuchungen zur Kunst des frühen Rom, ANRW 1, 4 (1973) 560–563.
9 C. Nardella, Il fascino di Roma nel Medioevo. Le „Meraviglie die Roma“ di maestro Gregorio, La corte dei papi 1 (Rom 1997) 172 c. 34.
10 J. Fried, Die Rückkehr der Wölfin. Hypothesen zur Lupa Capitolina im Mittelalter, in: M. R.-Alföldi – E. Formigli – J. Fried (Hg.), Die römische Wölfin. Ein antikes Monument stürzt von seinem Sockel, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 49,1 (Stuttgart 2011) 110.
11 E. Simon, Die kapitolinische Wölfin, in: W. Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom 2 (Tübingen 1966) 277 f. Kat. 1454.
12 Dion. Hal. ant. 1, 79, 8.13 Cic. Catil. 3, 19; Cic. div. 1, 12, 20; 2, 21, 47.14 Cic. div. 1, 12, 20 (Übersetzung C. Schäublin 1991).15 M. R.-Alföldi – E. Formigli – J. Fried (Hg.), Die römische
Wölfin. Ein antikes Monument stürzt von seinem Sockel, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 49,1 (Stuttgart 2011) 7.
16 A. M. Carruba, La Lupa Capitolina. Un bronzo medievale (Rom 2006).
17 M. Ranieri Panetta, La Lupa per qualcuno è medievale, Il Giornale dell’Arte.com, >http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2007/4/110937.html< (27.08.2013).
18 G. Bartoloni, La Lupa Capitolina. Nuove prospettive di studio. Incontro-dibattito in occasione della pubblicazione del volume di Anna Maria Caruba, La Lupa Capitolina. Un bronzo medievale, Sapienza, Università di Roma, Roma 28 febbraio 2008 (Rom 2010).
19 E. La Rocca, Una questione di stile, in: Bartoloni a. O. (Anm. 17) 146; C. Parisi Presicce, Un’opera bronzea di stile severo, in: Bartoloni a. O. (Anm. 17) 183 Anm. 14. s. auch A. Mura Sommella, Contributo alla lettura dell’opera, in: Bartoloni a. O. (Anm. 17) 172 mit einer ähnlichen Vermutung.
20 E. La Rocca a. O. (Anm. 18) 146: „Oder – aber hier betreten wir unsicheres Terrain mit einem Vorschlag, der doch überaus seltsam anmutet – die Lupa ist eine getreue mittelalterliche Kopie, abgegossen von einem schlecht erhaltenen etruskisch-italischen Original und dann in Nachahmung des Vorbildes überarbeitet. Aber wer war in dieser Zeit von solch einer technischen Meisterschaft, um einem Bronzewerk mit derartiger Kunstfertigkeit den letzten Schliff zu verleihen?“
21 A. La Regina, La lupa del Campidoglio è medievale. La prova è nel test al carbonio, La Repubblica, >http://roma.repubblica.it/dettaglio/articolo/1485581< (27.08.2013).
22 E. Formigli, Die Lupa Capitolina. Zur technischen Geschichte der Großbronzen, in: M. R.-Alföldi – E. Formigli – J. Fried (Hg.), Die römische Wölfin.
zu machen. Die antiken Bildwerke und ihre hohe symbolische Bedeutung wurden denn im Mit-telalter von verschiedenen Gruppen der Gesell-schaft vornehmlich zur Repräsentation genutzt, um beispielsweise politische Ideen zu versinn-bildlichen oder Machtansprüche zu artikulieren.46 So diente sicherlich auch die Kapitolinische Wöl-fin das gesamte Mittelalter und die Renaissance hindurch vergleichbaren Zwecken. Den genauen Symbolwert der Lupa, gerade in Hinblick auf die mittelalterliche Kirche, gilt es jedoch aus histori-scher Sicht auf der Basis des neuen Forschungs-standes noch zu erschließen.In jedem Fall hat der Blitzschlag die Lupa Capito-lina weder von ihrem Sockel gestoßen noch hat er ihr in irgendeiner Weise geschadet. Vielmehr haben die neuen Erkenntnisse der berühmten Bronzeskulptur eine zusätzliche Tiefendimensi-on verliehen: Sie bleibt ein Symbol für die antike Geschichte Roms, ist aber nun umso mehr eine Brücke in die Neuzeit.
1 Verg. Aen. 8, 630–634 (Übersetzung J. Götte ⁶1983).2 Dion. Hal. ant. 1, 79, 4–8; Plut. Romulus 3–10.3 Zur lit. Überlieferung s. R. Weigel, Lupa Romana, LIMC
6 (1992) 293; M. R.-Alföldi, Die Schicksale der Lupa Romana. Ihr möglicher Weg nach Konstantinopel und ihr Ende 1204, in: M. R.-Alföldi – E. Formigli – J. Fried (Hg.), Die römische Wölfin. Ein antikes Monument stürzt von seinem Sockel, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 49,1 (Stuttgart 2011) 41 f.
4 S. die zusammengestellten Monumente bei Weigel a. O. (Anm. 3) und C. Dulière, Lupa Romana. Recherches d’iconographie et essai d’interprétation (Brüssel 1979).
5 Der Grund für die Wahl des Bildthemas dürfte zum einen darin zu suchen sein, dass sich S. Pompeius Fostulus als ein Nachfahre des Hirten Faustulus betrachtete (A. Trivero Rivera, La Lupa Romana nei nummi anonimi costantiniani, Quaderno di Studi 4, 2009, 187, >http://www.wildwinds.com/coins/pdfs/Rivera_wolf_and_twins.pdf< [27.08.2013]). Zum anderen könnte die schwierige militärische Lage auf der iberischen Halbinsel für die gens Pompeia den Ausschlag gegeben haben, sich für ein Sujet zu entscheiden, das in besonderer Weise auf die lange und göttliche Tradition Roms verwies. Dazu s. M. R.-Alföldi a. O. (Anm. 3) 46 f.
6 S. Böhm, Die Münzen der römischen Republik und ihre Bildquellen (Mainz am Rhein 1997) 77–79; M. R.-Alföldi a. O. (Anm. 3) 46 f.; Trivero Rivera a. O. (Anm. 5) 187.
zu beiden Seiten des Haupttors des staufischen Castel Maniace in Syrakus aufgestellt waren. Einer der beiden Widder hat sich erhalten und befindet sich heute im Museo Archeologico von Palermo: A. Wieczorek – B. Schneidmüller – S. Weinfurter (Hg.), Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa 2. Objekte, 69 f. Kat. III.B.18.
44 Zur anfangs äußerst negativen christlichen Bewertung der Wölfin s. I. Herklotz a. O. (Anm. 39) 18; J. Fried a. O. (Anm. 10) 124.
45 E. Formigli a. O. (Anm. 22) 525 f.46 V. Wiegartz, Antike Bildwerke im Urteil mittelalterlicher
Zeitgenossen, Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 7 (Weimar 2004) 292 f.
Ein antikes Monument stürzt von seinem Sockel, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 49,1 (Stuttgart 2011) 15–25.
23 E. Formigli, La Lupa Capitolina. Un antico monumento cade dal suo piedistallo e torna a nuova vita, RM 118, 2012, 505–530.
24 Vgl. die naturwissenschaftlich-technischen Untersuchungen am Jüngling vom Magdalensberg, bei dem es sich ebenfalls um einen neuzeitlichen Abguss handelt: K. Gschwantler, Guß + Form. Bronzen aus der Antikensammlung. Ausstellungskatalog Wien (Wien 1986) 51–61 Kat. 51. Zu Cellini s. E. Formigli a. O. (Anm. 22) 507 Anm. 10–13.
25 Zu den verschiedenen aufgeführten Hinweisen für einen mittelalterlichen Abguss s. ebenfalls E. Formigli a. O. (Anm. 22).
26 Vgl. die Zusammenstellung der verschiedenen Datierungsansätze bei W.-D. Heilmeyer, Rez. zu M. R.-Alföldi – E. Formigli – J. Fried a. O. (Anm. 14), BJb 210/11, 2010/11, 647.
27 V. Vacano a. O. (Anm. 8) 572–583.28 Dion. Hal. ant. 1, 79, 8; Liv. 10, 23, 12.29 Zur Verbindung der Weihung der Ogulnii mit den
überlieferten Bilder s. M. R.-Alföldi a. O. (Anm. 3) 42–59.30 E. Formigli a. O. (Anm. 22) 515 f.31 E. Formigli a. O. (Anm. 22) 514 bringt als weitere
Möglichkeit noch ins Spiel, dass die Beine des Bronzeoriginals getrennt vom Rest des Körpers waren, aber noch verfügbar. Dies scheint mir jedoch weit weniger wahrscheinlich als eine Neumodellierung.
32 C. Nardella a. O. (Anm. 9) 172 c. 34.33 Zur genauen Interpretation des lateinischen Textes
s. E. Formigli a. O. (Anm. 22) 523 Anm. 34.34 V. Vacano a. O. (Anm. 8) 563–566.35 Damit natürlich auch eine Verbindung der Lupa
mit den bei Cicero erwähnten Zwillingen und die damit verbundene Frage, ob die kapitolinische Wölfin bereits von Anfang an den römischen Ursprungsmythos versinnbildlichte.
36 CFHB XI/1, 650, 17–20.37 Dazu ausführlich M. R.-Alföldi a. O. (Anm. 3).38 J. Fried a. O. (Anm. 10) 124.39 J. Fried a. O. (Anm. 10) 134.40 Zusammenfassend mit Quellenangaben I. Herklotz,
Der Campus Lateranensis im Mittelalter, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 22, 1985, 18. Zur Lokalisierung s. auch J. Fried a. O. (Anm. 10) 112 f.
41 Dante, Inferno 1, 49–51; Purgatorio 20, 10–12. Zur Interpretation der Stellen vgl. J. Fried a. O. (Anm. 10) 107 f.; E. Formigli a. O. (Anm. 22) 524 f.
42 J. Fried a. O. (Anm. 10) 110.43 Heilmeyer a. O. (Anm. 25) 648 verweist als
Vergleichsbeispiel auf die beiden bronzenen Widder, die ebenfalls in beträchtlicher Höhe auf Steinkonsolen

















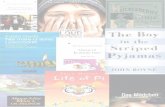









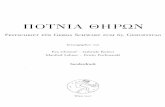
![The Silkroad in the History of the Ancient Period/Die Seidenstraße in der Geschichte der Antike, [in:] Die Krim. Goldene Insel im Schwarzen Meer. Begleitbuch zur Ausstellung in Bonn,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312a59ac32ab5e46f0c10ae/the-silkroad-in-the-history-of-the-ancient-perioddie-seidenstrasse-in-der-geschichte.jpg)




