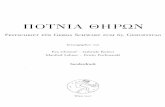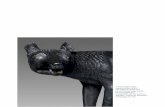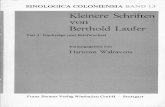Die Lieder Heinrich Isaacs – In aller Munde und doch ein unbekanntes Repertoire
Transcript of Die Lieder Heinrich Isaacs – In aller Munde und doch ein unbekanntes Repertoire
Sonja Tröster
Die Lieder Heinrich IsaacsIn aller Munde und doch ein unbekanntes Repertoire
Von Isaac sind heute etwa 30 deutsche Lieder bekannt.1 Diese Zahl mutet inder Gegenüberstellung mit seinem gesamten Schaffen nicht besonders großan, doch auch von deutschen Komponisten seiner Generation – etwa Hein-rich Finck und Paul Hofhaimer – sind nur wenige Liedsätze überliefert. Ausdiesem Grund sind Aussagen zu der Stellung, die diese Lieder in Isaacs Schaf-fen einnehmen, schwierig zu treffen. Offen bleiben auch die Fragen, von wemsie in Auftrag gegeben wurden und zu welchen Gelegenheiten sie tatsächlicherklangen. Gleichzeitig ist die Ansicht, dass Isaac eine zentrale Rolle in der Ent-wicklung der Gattung des deutschsprachigen mehrstimmigen Liedes einnahm,allgemein anerkannt.2 Bereits in frühen Zeugnissen der deutschsprachigenMusikwissenschaft brachte man Isaacs Liedern – mit einigem Nationalstolz,da man ihn als Deutschen ansah3 – besonderes Interesse entgegen. Die Volks-liedforscher betrachteten sie als einen Schatz an authentischen Zeugnissen desVolksgesangs,4 während die historisch orientierte Musikwissenschaft in diesemRepertoire einen ersten Höhepunkt des genuin deutschen Schaffens im Bereichder mehrstimmigen Komposition zu erblicken glaubte.5 Bereits im Jahr 1907erschien eine Edition der weltlichen Werke Heinrich Isaacs, die alle erhaltenenLieder wiedergibt.6 Im Blickfeld des Musikliebhabers hat das Lied Innsbruck
1 Kompositionen, die in zeitgenössischen Quellen mit einem deutschen Text oder einer Textmar-ke überliefert sind und bisher nicht als Kontrafaktur identifiziert wurden. Eine exakte Angabe istnicht möglich, da einige Kompositionen hinsichtlich der Gattungszugehörigkeit Probleme berei-ten. So scheinen etwa die ohne weiteren Text überlieferten Lieder Zart liepste Frucht und Wasfrewet mich mit deutschen Textmarken versehene Chansons zu sein; eine Überlieferung mit fran-zösischem Text oder ein Nachweis in einer Quelle, die nicht aus deutschsprachigem Gebiet stammt,konnte bisher jedoch nicht gefunden werden. Bei anderen Stücken wie Mich wundert hart ist wie-derum die Zuschreibung an Isaac unsicher.
2 Martin Staehelin, »Zur musikgeschichtlichen Stellung von Heinrich Isaac«, in: Literatur, Musikund Kunst, hrsg. von Hartmut Boockmann, Ludger Grenzmann u.a., Göttingen 1995, S. 126–245, hier S. 225–232; Wilhelm Seidel, Die Lieder Ludwig Senfls, Bern – München 1969 (= NeueHeidelberger Studien zur Musikwissenschaft, 2), S. 18–21.
3 Erst 1886 wurde das 3. Testament Isaacs vom 4. Dezember 1516 publiziert, das seine Herkunftaus Flandern ausweist. Giuseppe Milanesi, »Maestro Arrigo Isach«, in: Rivista critica della lette-ratura italiana 3 (1886), Sp. 187 f.
4 Im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen komponierte Isaac besonders viele Volksliedsätze. Vgl. KurtGudewill, »Deutsche Volkslieder in mehrstimmigen Kompositionen aus der Zeit von ca. 1450bis ca. 1630«, in: Handbuch des Volksliedes, hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich, Lutz Röhrich undWolfgang Suppan, 2. Bd., München 1975, S. 439–490, hier S. 464–468.
5 Siehe etwa noch Martin Staehelin, Artikel »Isaac«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,Personenteil Bd. 9, Kassel – Basel u.a. 22003, Sp. 672–691, hier Sp. 688.
6 Heinrich Isaac, Weltliche Werke, hrsg. von Johannes Wolf, Wien 1907 (= Denkmäler der Tonkunstin Österreich, Bd. 28). Ein Nachtrag ist im Anhang zu Bd. 32 im Jahr 1909 erschienen.
ich muss dich lassen einen festen Platz eingenommen und ist in seinen geistli-chen Kontrafakturen O Welt ich muss dich lassen und Nun ruhen alle Wälder inaller Munde. Weshalb sollte man dieses Repertoire also trotz seiner offensicht-lichen und seit der Wiederentdeckung erneut zwei Jahrhunderte andauerndenPopularität als ein »unbekanntes« bezeichnen?
Überblickt man die Literatur, wird deutlich, dass die wissenschaftliche Aus-einandersetzung mit den Isaac-Liedern in keinem Verhältnis zu deren Wert-schätzung steht. Die ausführlichste Abhandlung zu Isaacs gesamtem Lied-schaffen stellen einige Seiten in Die Niederländer und das deutsche Lied vonHelmuth Osthoff aus dem Jahr 1938 dar.7 Nur wenige Stücke wurden darüberhinaus in allgemeinen Betrachtungen zum mehrstimmigen Lied als Referenz-material herangezogen oder fanden in jüngerer Zeit in weiteren Zusammen-hängen Beachtung.8 Dabei sind vor allem zwei Lieder, die in den frühen musik-wissenschaftlichen Schriften immer wieder genannt wurden, in Vergessenheitgeraten: Es het ein Baur ein Töchterlein und Mein Freud allein in aller Welt. Siestellen je einen Vertreter der beiden Ausprägungen des Liedes dar, die meist als»Volkslied« und »Hofweise« benannt werden. Die durch diese Begriffe sugge-rierte soziale Zuordnung ist unzutreffend; da jedoch bis heute keine treffen-deren Benennungen vorgebracht wurden, stehen sie für zwei Liedarten, diesich nach Textform und -inhalt als auch in der Melodiebildung und Faktur desmusikalischen Satzes unterscheiden. Anhand eines Ausblicks auf ausgesuchteStationen der Rezeptionsgeschichte dieser zwei Stücke soll im Folgenden ihrBekanntheitsgrad zu unterschiedlichen Zeiten dokumentiert werden. Da sichdie Kompositionen noch aus heutiger Perspektive als Fallbeispiele anbieten,werden weitergehende Beobachtungen bisher wenig beachtete konstruktiveElemente der Lieder Isaacs und Eigenarten der analysierten Kompositionenaufzeigen.
I Vielfalt im Volksliedsatz Es het ein Baur ein Töchterlein
Johann Nikolaus Forkel veröffentlichte 1788–1801 eine Allgemeine Geschich-te der Musik, in deren drittem Band er unter anderem der Bedeutung Hein-rich Isaacs als »Contrapunktist« nachzugehen suchte. Er stellte fest, dass derSchweizer Humanist Glarean einige Stücke von Isaac in den 1547 erschiene-
Die Lieder Heinrich Isaacs 21
7 Helmuth Osthoff, Die Niederländer und das deutsche Lied, Berlin 1938, S. 49–84.8 Eine Ausnahme bildet Innsbruck ich muss dich lassen, zu dem zahlreiche Veröffentlichungen er-
schienen sind. Vgl. den Tagungsbericht Heinrich Isaac und Paul Hofhaimer im Umfeld von Kai-ser Maximilian I., hrsg. von Walter Salmen, Innsbruck 1997 (= Innsbrucker Beiträge zur Musik-wissenschaft, 16), dort auch weitere Literaturangaben. Als Auswahl zur Diskussion andererLiedsätze seien genannt: Leopold Nowak, »Das deutsche Gesellschaftslied in Österreich von1480–1550«, in: Studien zur Musikwissenschaft 17 (1930), S. 21–52; eine Analyse des Aufge-sangs von Ach weiblich Art enthält Nicole Schwindt, »Musikalische Lyrik in der Renaissance«, in:Musikalische Lyrik, Teil 1, hrsg. von Siegfried Mauser, Laaber 2004 (= Handbuch der Musikali-schen Gattungen, 8,1), S. 137–254, hier S. 187 f.
nen Musiktraktat Dodekachordon aufgenommen hatte, und »nach dessen Ur-theil viel Genie und Kunst daran zu erkennen seyn soll«.9 Dieser Einschätzungkonnte sich Forkel auf der Basis der abgedruckten geistlichen Kompositionennicht anschließen, er war jedoch überzeugt, dass die zu dem positiven Urteilverleitenden Werke verloren gegangen sein müssten. Forkel selbst wurde dage-gen in einem anderen Gattungsbereich des Isaac’schen Schaffens fündig, ihmlag Hans Otts Lieddruck Hundert und fünfftzehen guter newer Liedlein (RISM154420) vor: »In der weltlichen Composition hingegen scheint Isaac anderngleichzeitigen Componisten nicht gleichgeschätzt, sondern weit vorgezogenwerden zu müssen. Hierin hat er eine Klarheit des Gesangs, einen so schönund richtig markirten Rhythmus, und eine so vollkommen reine und zwang-lose Harmonie, daß man glaubt, Werke im gebildetern Styl des achtzehntenJahrhunder[t]s zu hören. In dieser Rücksicht hat Isaac einen Riesensprung überden Geist seines Zeitalters hinaus gemacht.«10 Als Beleg seiner Wertschätzungsuchte er aus den zehn Liedern, die in diesem Druck Isaac zugeschrieben wer-den,11 den Satz Es het ein Baur ein Töchterlein aus und gibt ihn vollständig wie-der. Der Text scheint ihm allerdings »erbärmlich«.
Auch Helmuth Osthoff war 140 Jahre nach dieser Wiederentdeckung vondem Satz angetan. Im Gegensatz zu Forkel wollte er ihn jedoch nicht längervom Text getrennt sehen: »Es ist ein Meisterstück humorvoller Textausdeu-tung, eine ausgesprochene Burleske, die in der geistvollen Behandlung desvolkstümlich-primitiven Stoffes die entsprechenden Seitenstücke ›Mein Müt-terlein‹ und ›Greiner, zancker, schnöpffitzer‹ noch weit übertrifft.«12 Er führteden eigentümlichen Reiz des Liedes also gerade auf die Gegenüberstellung vonschlicht gestaltetem Text mit anzüglichem Inhalt und kontrapunktisch reichund kunstvoll ausgestattetem Satz zurück. Obwohl der Liedtext auch den Leserdes 21. Jahrhunderts nicht besonders ansprechen wird – es ist von einer Bau-erstochter die Rede, die ihre »maidschaft«, also ihre Jungfräulichkeit,13 nichtlänger ertragen will, worauf sich ein Kandidat meldet, ihr behilflich zu sein –,handelt es sich um ein Lied, das tatsächlich in ganz besonderer Weise die Ab-sichten und Kompositionstechniken Isaacs im Volksliedsatz demonstriert. Dieeinfache Text- und Melodiegestaltung ermöglichen es dem Komponisten, dasInteresse in besonderem Maße auf die Bearbeitung der Melodie bzw. des Can-
22 Sonja Tröster
9 Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 2, Leipzig 1801, S. 671.10 Ebenda, S. 676.11 Diese sehr späte Überlieferungsschicht, die insgesamt immerhin fast ein Drittel des heute be-
kannten Isaac’schen Liedrepertoires ausmacht, stellt hinsichtlich der Zuschreibungen einen eige-nen Problemkomplex dar. Eines der Lieder, Mich wundert hart, ist in CH-Bu F X 1–4 LudwigSenfl zugeschrieben und nach stilistischen Gesichtspunkten kaum Isaac zuzusprechen. Unterden weiteren in Otts Drucks erstmals Isaac zugeschriebenen Liedern befinden sich ausgefalleneSätze wie Greiner, Zancker, Schnöpffitzer und Mein Mütterlein.
12 Osthoff, Die Niederländer und das deutsche Lied (s. Anm. 7), S. 76.13 Vgl. die Stichworte »maidlein« und »maidschaft«, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm
und Wilhelm Grimm, Bd. VI, Leipzig 1885, Sp. 1473. Online verfügbar unter http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB (letzter Zugriff: Januar 2010).
tus firmus im mehrstimmigen Satz zu lenken.14 Im Detail betrachtet scheintsich die von Osthoff als konstituierendes Merkmal des Stücks erkannte Dis-krepanz von kompositorischer Fertigkeit und Textschöpfung in der Gestalt desMelodiebeginns noch zu potenzieren. Dieser dürfte vielen Bewohnern desdeutschsprachigen Raums der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vertraut ge-wesen sein, denn er entspricht der damals weitverbreiteten Wallfahrtsleise InGottes Namen fahren wir.15 Isaac selbst schuf zwei mehrstimmige Vertonungendieses geistlichen Liedes. Besonders groß sind die Übereinstimmungen desMelodiebeginns von Es het ein Baur mit der Fassung, wie sie eine in der Staats-und Stadtbibliothek Augsburg unter der Signatur 2° 142a aufbewahrte Hand-schrift wiedergibt:
Es wäre zu spekulativ, diese Ähnlichkeit auf eine intendierte Bezugnahme derbeiden so unterschiedlichen Texte aufeinander zurückzuführen; etwa in demSinn, dass der unbenannte »Retter« nach vollzogener Tat weiterzieht oderunsittliches Verhalten von Reisenden und Pilgern beanstandet wird.16 Wahr-scheinlich war die melodische Übernahme der ersten Zeile neben dem Reizdes Kontrasts nur Garant für Wiedererkennung, leichte Eingängigkeit unddamit den Erfolg des Liedes.
Es het ein Baur gehört zu einer Gruppe von Liedern, in denen Isaac die gesam-te Melodie nacheinander durch mehrere Stimmen wandern lässt.17 Das Stück
Die Lieder Heinrich Isaacs 23
Notenbeispiel 1: Vergleich der Tenorstimmen In Gottes Namen fahren wir (II, nach D-As 2° 142a,fol. 30v) und Es het ein Baur (nach RISM 154420, Nr. 45)
14 Zu der von Isaac verwendeten Melodie sind keine Konkordanzen bekannt, Liedtexte mit dem-selben Incipit (auch in der Variante Es het ein Schwab ein Töchterlein) und ähnlicher inhaltlicherAusrichtung begegnen dagegen häufiger. Vgl. Franz Magnus Böhme, Altdeutsches Liederbuch,Leipzig 1877, S. 133–136.
15 Siehe Das deutsche Kirchenlied, Abteilung III, hrsg. von der Gesellschaft zur wissenschaftlichenEdition des deutschen Kirchenliedes e. V., Bd. 1, Teil 2, Textband, Kassel – Basel u.a. 1997,S. 76–79 (Ea1) .
16 Zu Klagen über Pilger und Reisende siehe Daniela Müller, »Rechtliche Aspekte des Santiago-Kultes unter Berücksichtigung von Beispielen aus Südwestdeutschland«, in: Jakobskult in Süd-deutschland, hrsg. von Klaus Herbers und Dieter R. Bauer, Tübingen 1995 (= Jakobusstudien,7), S. 293–309, hier S. 299 f. und Norbert Ohler, »Gastfreundschaft und Gasthäuser nach Boc-caccios ›Dekameron‹«, in: Reisen und Reiseliteratur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, hrsg.von Xenja von Ertzdorff und Dieter Neukirch, Amsterdam – Atlanta, GA 1992 (= Chloe. Bei-hefte zum Daphnis, 13), S. 507–530, hier S. 522 f.
17 Die weiteren Kompositionen dieser Art sind Greiner, Zancker, Schnöpffitzer und Wann ich desMorgens früh auffsteh.
ist in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten bis Mensur 27 werden teils leichtabgewandelte Cantus-firmus-Ausschnitte durch alle Stimmen imitiert. Es folgtein Täuschungsmanöver: Ein homophoner Diskantsatz zieht die Aufmerk-samkeit auf sich, doch nach zwei Mensuren setzt die Bassstimme ein; es wirdoffensichtlich, dass diese der eigentliche Melodieträger ist, und die Stimmenlösen sich aus dem homorhythmischen Gefüge. Die Basslinie endet in Men-sur 42, und nach einer kurzen Überleitung übernimmt der Tenor eine Okta-ve über dem Bass den Cantus firmus. Im letzten Abschnitt, einem nun durch-gehend homophonen Satz, überspringt die Melodie auf ihrer Wanderung dieAltstimme und erscheint sogleich im Diskant, wiederum in die höhere Oktav-lage versetzt. Es ist dabei bemerkenswert, mit welchem AbwechslungsreichtumIsaac vier Mal »dasselbe« präsentiert. An zwei Übergängen verknüpft er denBeginn des neuen Melodiedurchlaufs mit einer neuen Satztechnik – einmaldavon nur vorgetäuscht –, den verbleibenden Übergang gestaltet er dagegenfließend mit einer Überleitungspassage. Um der bloßen Aneinanderreihungentgegenzuwirken, setzt Isaac als verbindendes Element über die Abschnitteein in Abständen wiederkehrendes Klangerlebnis, das aus der Parallelführungzweier Stimmen besteht. Dieses an sich unspektakuläre Ereignis tritt hier immerund ausschließlich in Verbindung mit einer bestimmten Text- und Melodie-zeile, nämlich »du schöne mein Maruschka«, auf.
In den Mensuren 20–22 bewegen sich Diskant und Bass in Dezimen18, inMensur 51–53 treten Tenor und Bass in Terzen zueinander, und in Mensur65–69 sind parallele Sexten im Verlauf von Diskant zu Alt zu entdecken(Notenbeispiel 3). Allein in der entsprechenden Zeile des Melodiedurchlaufsim Bass (M. 37–39) ist eine solche Parallelführung allenfalls in der Annähe-
24 Sonja Tröster
Notenbeispiel 2: Es het ein Baur, M. 20–22 und M. 51–53
18 Die Textierung im Druck von Hans Ott wirkt an dieser Stelle nicht korrekt. Übereinstimmendmit der melodischen Linie und analog zum Bass sollte ab M. 20 im Diskant »du schöne meinMaruschka« unterlegt werden, wie es in Notenbeispiel 2 erscheint.
rung von Tenor und Bass angedeutet, die rhythmische Übereinstimmung derStimmen ist aber nicht gegeben.19
Zudem setzt Isaac eine Klammer um Anfang und Ende des Liedsatzes, indemer kurz vor dem Schluss noch einmal wie zu Beginn die Stimmen paarweise –Oberstimmen und Unterstimmen – aufspaltet. Zu Liedbeginn setzen Tenorund Bass an, worauf Diskant und Alt dieselben Linien eine Oktave darüberaufnehmen. In den Mensuren 65–69 geht dagegen das Oberstimmenpaar inder Imitation voran. An dieser Stelle treffen die beiden Einheit stiftenden Ele-mente des Satzes – die Wiedererkennungsmarke der Parallelführung und diesatztechnische Klammer der paarigen Imitation – zusammen. Für den bündi-gen Abschluss fallen alle Stimmen in ein überzeugtes »in dem Elend laß ichdich nit« ein:
Die Lieder Heinrich Isaacs 25
Notenbeispiel 3: Es het ein Baur ein Töchterlein, Beginn und Schluss
19 Bewusste Abweichungen von einem starren Konstruktionsprinzip scheinen ein Merkmal Isaac’-scher Liedsätze zu sein. So sehr etwa die Vertonungen auch auf die formale Gestaltung der Tex-te eingehen, eine Vorhersage der verwendeten Mittel ist selten möglich. Als Beispiel sei das LiedO werdes Glück angeführt, dessen Aufgesang ohne den Einsatz von Imitation gestaltet ist, woge-gen im Abgesang jeder der acht Zeilenanfänge vom Diskant vorimitiert wird – mit einer Aus-nahme. Ohne aus Textform oder -inhalt ersichtlichen Anlass setzt sich die zweite Zeile nicht miteiner Vorimitation, sondern einer ausgeprägten Zäsur und nachfolgender, kurzer homorhyth-mischer Passage von der vorhergehenden ab.
Die Praxis, einen vollständigen Cantus firmus durch die Stimmen wandern zulassen, war in Mitteleuropa bereits verbreitet. Mehrere Kompositionen dieserArt sind etwa im Codex des Nikolaus Apel (ca. 1490–1504 entstanden) auf-gezeichnet.20 Meist handelt es sich hierbei um Motetten, und so scheint dieseKompositionstechnik von der Gattung der Motette auf das Liedschaffen über-tragen worden zu sein. Besonders bekannt ist die Liedfamilie Greiner, Zanker,Schnöpfitzer, zu der Paul Hofhaimer einen dreistimmigen, Isaac einen vier-stimmigen und Heinrich Finck einen fünfstimmigen Satz mit wanderndemCantus firmus beisteuerten.21 Doch keiner dieser Sätze versucht wie Isaacs Eshet ein Baur ein größtmögliches Ausmaß an Varianz zu bieten und gleichzei-tig die Gesamtkomposition in einen stützenden und einenden Rahmen zuschließen.
Wie an den folgenden Liedbeobachtungen zu sehen sein wird, strukturiertIsaac auch in Hofweisensätzen den Aufbau der Komposition mit Rückgriffenauf musikalische Konstruktionen. Dabei sind in dieser Liedart die Schwer-punkte anders gelagert als im Volksliedsatz. Text und Melodik der Hofweisesind komplexer gestaltet und stehen zueinander in einem engen formalen Ver-hältnis, das von den begleitenden Stimmen gestützt wird. Da der Melodiebil-dung hier weitaus größere Kunstfertigkeit und Bedeutung zukommt, geht mandavon aus, dass die Tenores von den Komponisten im Zuge des mehrstimmi-gen Satzes neu geschaffen wurden. Wer jedoch die Texte der vorwiegend all-gemein gehaltenen Reflexionen zu den menschlichen Idealen Liebe, Glück undMoral fertigte, ist wie im Falle des Volksliedes meist unbekannt.22
II Komponieren in Paaren? Die Hofweisen Mein Freud allein in aller Weltund Kein Freud auf Erd 23
In seiner für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts maßgebenden Geschichteder Musik preist August Wilhelm Ambros Isaacs Mein Freud allein in aller Weltals ein »Juwel von unschätzbarem Werthe«: »Alles, was im deutschen GemütheZartes, Inniges, Herzliches leben mag, kommt hier zum Ausdruck. Es ist eines
26 Sonja Tröster
20 Etwa von Heinrich Finck: D-LEu 1494, Nr. 104 (fol. 143v–144r) und 108 (fol. 149v–150r).Eine Edition dieser Handschrift, hrsg. von Rudolf Gerber, ist in der Reihe Das Erbe deutscherMusik, Bd. 32–34, in den Jahren 1956–1975 erschienen.
21 Lothar Hoffmann-Erbrecht, Henricus Finck – musicus excellentissimus (1445–1527), Köln 1982,S. 185 f.
22 In einem Brief an den Humanisten Vadian schreibt Paul Hofhaimer, dass er ihm ein Lied schicke,dessen Text er selbst verfasst habe (abgedruckt bei Hans Joachim Moser, Paul Hofhaimer. EinLied- und Orgelmeister des deutschen Humanismus, Stuttgart – Berlin 1929, S. 55). Es ist jedochnicht davon auszugehen, dass alle Komponisten die Texte ihrer Lieder selbst verfasst hätten. Vgl.auch Harald Haferland, »Frühe Anzeichen eines Lyrischen Ichs. Zu einem Liedtyp der gedruck-ten Liedersammlungen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts«, in: Deutsche Liebeslyrik im15. und 16. Jahrhundert, hrsg. von Gert Hübner, Amsterdam – New York, NY 2005 (= Chloe.Beihefte zum Daphnis, 37), S. 169–200.
23 Der Notentext beider Stücke ist im Anhang zu diesem Aufsatz wiedergegeben.
der schönsten Liebeslieder aller Zeiten, die Melodie vom herrlichsten Flusseund wunderbarer Wärme der Empfindung zieht sich äusserst schön durch dieStimmen, Tenor und Sopran singen wie im Duett, die anderen beiden Stim-men gehen zur Seite, ohne zur blossen Begleitung herabzusinken.«24 Konkre-tere Beobachtungen zu Mein Freud allein enthält der Aufsatz »Zur musikge-schichtlichen Stellung von Heinrich Isaac« von Martin Staehelin.25 Als überdie zu erwartenden Eigenschaften eines Tenorliedes hinausgehend beschreibtStaehelin etwa die bogenartige Wiederaufnahme der Melodiebewegung derzweiten Zeile in der letzten. Darüber hinaus konstatiert er die feine Durch-dringung des Satzes mit imitatorischen Bildungen und die Hervorhebung desWortes »gentzlich« in der vorletzten Zeile durch eine zu seiner Umgebung kon-trastierende Satzfaktur und Harmonik.
Würde man davon ausgehen, dass die Anzahl der erhaltenen zeitgenössi-schen Quellen auch einen Hinweis auf die damalige Bekanntheit einerKomposition liefert, wäre Mein Freud allein eines der erfolgreichsten LiederIsaacs gewesen. Die Nachweise für dieses Stück übertreffen sogar die Zahl derQuellen, die den bekannteren Satz zu Innsbruck ich muss dich lassen enthal-ten.26 In den Kontext dieses Liedes gehört aber auch eine Komposition Isaacs,die nur in einer einzigen Handschrift überliefert ist und heute ebenso weit-gehend unbekannt scheint: Kein Freud hab ich auf Erd. Dennoch verkörpertdiese Komposition ein Konzentrat des Isaac’schen Hofweisensatzes, das dieRichtlinien dieser Liedart exemplifiziert, weshalb ich seine Besprechung an die-ser Stelle vorziehe.
Der Text des Liebesliedes Kein Freud besitzt einen relativ einfachen und re-gelmäßigen Strophenaufbau, was in Anbetracht der formalen Variationsbreiteder Liedtexte um 1500 beinahe auffällig ist.27 Eine Strophe besteht aus achtZeilen, die abwechselnd betont und unbetont enden. Die jambische, vierhe-bige Zeile ist als Grundschema durchgehend eingehalten, im Abgesang tretenauch zweihebige Kurzzeilen auf. Eine Ausnahme bildet allein die 1. Zeile der1. Strophe, hier scheint eine Hebung zu fehlen; eine Unregelmäßigkeit, dieweder in der Wiederholung des Aufgesangs noch in den folgenden zwei Stro-phen auftritt. Die Absenz zweier Silben könnte auf eine fehlerhafte Abschriftim Laufe der Überlieferung zurückzuführen sein. Osthoff, der das Stück bei-
Die Lieder Heinrich Isaacs 27
24 August Wilhelm Ambros, Geschichte der Musik, Bd. 3, Breslau 1868, S. 392.25 Martin Staehelin, »Zur musikgeschichtlichen Stellung von Heinrich Isaac« (s. Anm. 2), S. 228 f.26 Die zu diesem Lied verfügbaren Quellen sind CH-Bu F X 1–4 und F X 21 (nur Tenorstimme
erhalten), PL-Kj 40092 (nur Diskantstimmbuch), RISM 15407, RISM 154420; Übertragungenin Tabulatur: D-Mbs Mus.ms. 1512 (2 Versionen), Brown 15496, Brown 15585, Brown 15623,Brown 15565. Siehe Martin Picker, Henricus Isaac. A Guide to Research, New York – London1991, S. 116. (Siglen werden zitiert nach Howard Mayer Brown, Instrumental Music PrintedBefore 1600: A Bibliography, Cambridge/Mass. 1965).
27 Zur Vielfalt der Strophenformen der Hofweise siehe Christoph Petzsch, »Hofweisen. Ein Bei-trag zur Geschichte des deutschen Liederjahrhunderts«, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Lite-raturwissenschaft und Geistesgeschichte 33 (1959), S. 414–445, hier S. 423–425.
läufig erwähnt, ergänzt etwa den Titel offenbar unbewusst zu »Kein Freud habich auf dieser Erd«.28
Die ersten vier Zeilen, die beiden Aufgesangsteile, sind miteinander imKreuzreim verbunden. Mit dem Eintritt in den Abgesang ändert sich das Reim-schema: Die 5. Zeile zerfällt in zwei mit Binnenreim verbundene Kurzzeilen(»dann so ich dich – hertzlieb ansich«), ebenso die 7. Zeile (»Ach hochstezier – kum schier zu mir«). Die Zeilen 6 und 8 bilden dagegen vierhebige Ein-heiten aus und entsprechen sich im Endreim. Die letzte Zeile »tröst mich inmeinem Leiden« bildet den Abschluss jeder Strophe. Für die Hofweise ver-bindlich und bereits im Text angelegt ist die Barform des Liedes. Die Melodieist dem Tenor anvertraut und folgt der Struktur des Textes. Überwiegend ver-läuft der Tenor syllabisch deklamierend in Semibreven, nur an den Zeilen-enden tritt vor der abschließenden Klausel meist eine melismatisch gehaltenePassage auf. Das Zeilenende selbst ist im Melodieverlauf mit einem langenNotenwert und anschließender Pause gestaltet. Die Begleitstimmen unterstüt-zen diese Konstruktion, indem sie an diesen Stellen mit der Melodiestimme ineine Kadenz münden. Um jedoch einen ausgeprägten Einschnitt zu vermei-den und den Musikfluss nicht zu unterbrechen, verlassen die Außenstimmenden Schlusston nach kurzer Zeit und bilden an nahezu jedem Zeilenendebewegte überleitende Figuren in parallelen Dezimen. Allein der Schlussteil derKomposition bildet eine Ausnahme: Eine Kadenz nach d mit anschließenderPause in allen Stimmen bildet eine deutliche Zäsur. Die Erwartungshaltungnach diesem Einschnitt lenkt die Aufmerksamkeit auf den im Kontrast zumvorangegangenen Satz homophon gehaltenen Kehrvers.
Eine Eigenart der von Isaac vertonten Liedtexte, die in denjenigen seinerZeitgenossen nicht mit derselben Konsequenz begegnet, ist die Anlage desAbgesanges in zwei meist identisch gebaute Abschnitte. Eine besondere Bedeu-tung kommt dieser Zweiteilung in Kein Freud zu, da sie hier auch im Melo-dieverlauf abgebildet ist. In besonderem Maß trifft dies auf die Zeilenanfängezu. Den Abgesang eröffnet ein stufenweiser Aufstieg im Ausmaß einer Quart.Die neue Zeile beginnt mit einer Wendung, die einen Quartsprung aufwärtsund den folgenden Abstieg zur Ausgangsnote einschließt. Zum ersten Mal indiesem Lied wird an dieser Stelle der monorhythmische Melodieverlauf außer-halb des Schlussmelismas unterbrochen, um einen markanten Zeilenanfang zugestalten. Da dieser Melodieformel noch eine besondere Rolle zukommt,
28 Sonja Tröster
28 Osthoff, Die Niederländer und das deutsche Lied (s. Anm. 7), S. 67. Andererseits zeigt der musi-kalische Befund, dass sich der Komponist auch an der scheinbar mangelhaften Sechssilbigkeitder ersten Zeile orientiert, denn bereits auf der 6. Tenornote kadenziert der Satz nach c, um deneinleitenden Abschnitt abzuschließen. Eine überleitende Figur im Tenor schafft die Verbindungzu einer weit weniger deutlich herausgearbeiteten Kadenz, die in Mensur 6 ebenfalls auf c schließt;dort sind die Zeilenenden der dritten Textzeile und der entsprechenden Passagen in 2. und3. Strophe anzusetzen. Der Tonsetzer hat sich also in erster Linie an der textlichen Dispositionder ersten Strophe orientiert, denn wenn auch weitere Noten für die zwei zusätzlichen, »regulären«Silben vorgesehen sind, so tritt die Kadenz in Mensur 4 dort innerhalb eines Wortes auf: »Prichnit an mir din glop- te trew« und »Myn kleglich bitt vnd gro- ße pin«.
benenne ich sie als »Dreiecksformel« (Notenbeispiel 4); dass die Figur mit derRückkehr zur Ausgangsnote endet – es folgt eine beliebige Weiterführung, diein die Endklausel der Zeile mündet –, ist aus dem Verlauf der Begleitstimmenersichtlich. Diskant und Alt weisen diesen Abschluss mit einer Kadenz aus,obwohl die textliche Struktur hier keinerlei Zäsur aufweist:
Nun steht dem stufenweisen Aufstieg des Abgesangbeginns ein Quartfall indenselben Notenwerten und mit derselben Ausgangsnote gegenüber, dessenWeiterführung auf a schließt. Auf derselben Tonhöhe, also eine Terz unter derkorrespondierenden Passage in Mensur 18, wird nun die Dreiecksformel wie-derholt. Folglich bildet der Abgesang einen in sich geschlossenen Bogen:Quartaufstieg – Dreiecksformel – Quartabstieg – Dreiecksformel. Die Text-struktur des Abgesangs findet sich damit auch musikalisch abgebildet, die bei-den im Endreim verbundenen Langzeilen beginnen jeweils mit der Dreiecks-formel. Auch dem Inhalt nach scheinen die unterlegten Textzeilen in einemspiegelbildlichen Verhältnis zueinander zu stehen. Die Aussagen »so lebt meinHerz in Freuden« und »tröst mich in meinem Leiden« spiegeln zwei gegensätz-liche Gefühlslagen.
Zudem ist auch in diesem Liedsatz eine klammerartige Verknüpfung vonBeginn und Schluss gegeben, wie sie bereits im Volksliedsatz Es het ein Baurauftrat. Osthoff beobachtete, dass der Beginn von Kein Freud im ansteigendenMelodieverlauf und der mehrstimmigen Einkleidung mit parallelen Quartenin den Mittelstimmen dem Innsbruck-Lied ähnelt.29 Blickt man an den Schlussdes Stückes, so ist auch die letzte Zeile von parallelen Quarten durchzogen:Zunächst zwischen Diskant und Alt, in Vorbereitung der Kadenz zwischen Altund Tenor. Diese Form der Stimmführung tritt um 1500 bereits seltener auf,wird von Isaac jedoch des Öfteren in der Hinführung auf Kadenzen verwen-det. In diesem speziellen Fall bietet sie eine antipodische Verquickung vonBeginn und Ende des Liedes: Es beginnt mit einer aufsteigenden und endetmit einer absteigenden Passage deren Satz jeweils den akustischen Reiz paral-leler Quarten einschließt.
Kein Freud ist ein in den kompositorischen Mitteln bewusst eingeschränk-ter Hofweisensatz, der durch seine maßvolle Konzeption, die genaue Abstim-mung auf die Textstruktur und den in sich geschlossenen Aufbau besticht. Wo-rin besteht jedoch die angedeutete Verwandtschaft mit dem Satz Mein Freudallein? Auch bei Mein Freud allein handelt es sich um eine Hofweise mit Lie-
Die Lieder Heinrich Isaacs 29
Notenbeispiel 4: Dreiecksformel
29 Osthoff, Die Niederländer und das deutsche Lied (s. Anm. 7), S. 67.
besthematik, deren Text – von einem Einschub (»durch dich bin ich«) abge-sehen – sogar derselben Strophenstruktur wie Kein Freud folgt. Ein wesentli-cher Unterschied zwischen beiden Liedern ist der Einsatz von Imitation. Tratdiese Technik in Kein Freud kaum auf, markiert in Mein Freud allein eine Vor-imitation im Diskant bis auf einen Mittelteil sämtliche Zeilenanfänge. Auchdie rhythmische Gestaltung der Melodielinie, die in Kein Freud sehr schlichtgehalten ist – von kleinen melismatischen Auflockerungen abgesehen dekla-miert der Tenor in Semibreven –, unterscheidet sich von derjenigen in MeinFreud allein; diese nützt die Bandbreite an Notenwerten von der Brevis bis hinzur Semiminima aus.
Dennoch verbindet beide Vertonungen ein dichtes Netz an Bezugspunkten.Auf der melodischen Ebene sticht in der zweiten Zeile das Auftreten der Drei-ecksformel ins Auge. Die Tonhöhe entspricht sogar derjenigen, in der die For-mel in Kein Freud zum ersten Mal zu hören war – was allerdings nahe liegt, dabeide Lieder im 5. Modus auf f (mit b-Vorzeichnung) stehen, und die Drei-ecksformel die konstituierende Quarte c’ – f ’ dieses Modus umreißt. Diese Zei-le erregte auch Staehelins Aufmerksamkeit, da sie zum Ende von Mein Freudallein wieder aufgegriffen wird und auch hier das zweite Auftreten der Drei-ecksformel die letzte Zeile des Liedes bildet. Aber nicht homophon gesetzt wiein Kein Freud – es handelt sich in diesem Fall nicht um einen hervorzuheben-den Kehrreim – und auf derselben Tonhöhe wie in der zweiten Zeile. Die Text-passagen der beiden verwandten Lieder, die jeweils in der ersten Strophe mitdem Auftreten der Dreiecksformel zusammenfallen, lauten:
»mein Trost zu allen Stunden« (Mein Freud, M. 9 ff.)»tröst mich in meinem Leiden« (Kein Freud, M. 28 ff.), »mein Herz in rechter Lieb verpflicht« (Mein Freud, M. 37 ff.)»so lebt mein Herz in Freuden« (Kein Freud, M. 18 ff.)
Handelt es sich um einen Zufall, dass die Ausschnitte nicht nur musikalisch,sondern auch in der Wortwahl korrespondieren? Die starke Konzentration aufbestimmte Begriffe in diesen Lieddichtungen muss berücksichtigt werden, dasWort »Herz« gehört dabei wohl zu den am stärksten strapazierten Wörtern undtaucht nahezu in jedem Liedtext auf. Trotzdem könnte der Befund für einenbewusst hergestellten Konnex der Lieder sprechen, der ja bereits durch die ver-wirrend ähnlichen Textanfänge suggeriert wird. Lautet es im einen Fall »KeinFreud hab ich auf Erd«, so steht dem im zweiten »Mein Freud allein in allerWelt« entgegen. Weitet man die Analyse auf den vierstimmigen Satz aus, fin-den sich auch hier korrespondierende Momente. Obwohl das Satzgewebe vonMein Freud allein etwas weniger kompakt erscheint, was auf die Vorimitatio-nen, das zeitweise Aussetzen der Alt- und der Bassstimme und die bewegterenBegleitstimmen zurückzuführen ist, zeichnen sich beide Sätze etwa durch häu-fige Parallelführung der Außenstimmen in Dezimen aus. Zudem setzt Isaac inden Mensuren 34–36 die beiden Mittelstimmen in parallelen Quarten (diese
30 Sonja Tröster
Stelle hob Staehelin als Ausdeutung des Wortes »gentzlich« hervor), was wie-derum in Anlehnung an ähnliche Passagen in Kein Freud geschehen sein könn-te. Dort ist die parallele Quartführung auffallend an Beginn und Ende desLiedes gesetzt, hier erscheint sie – vielleicht als Erinnerung und Assoziations-brücke – direkt vor der Dreiecksformel.
Die unauffällig gehaltenen Verweise der beiden Lieder aufeinander beziehendemnach die Ebenen der Wortwahl, der formalen Gestaltung der Texte wieauch der Melodieführung (Dreiecksformel) und der mehrstimmigen Verto-nung mit ein. Der Auslöser für die Ausbildung eines solchen Verweisnetzeskönnte im Inhalt der Liedtexte verborgen liegen. Bei beiden handelt es sichum Liebeslieder, doch während das werbende ›Ich‹ in Mein Freud allein sichder Zusage der Dame sicher scheint und damit die freudige Grundstimmungder Liebesversicherung ausstrahlt, überwiegen in Kein Freud Klage und Un-sicherheit.30 Der Liebhaber ist von der verehrten Dame getrennt und sich ihrerTreue nicht sicher. Es wäre daher denkbar, dass das oft unabdingbar mit-einander verbundene Gegensatzpaar von »Liebesfreud« und »Liebesleid« alsgedanklicher Ausgangspunkt für die unterschiedliche Faktur der Sätze gedienthätte, die davon abgesehen zahlreiche gleichartige Elemente aufweisen.
Aus dem deutschen Liedrepertoire um 1500 sind weitere Beispiele bekannt,in denen zwei Lieder melodisch und inhaltlich aufeinander Bezug nehmen.Eines dieser Liedpaare ist im Lieddruck des Arnt von Aich aufgezeichnet.31 Diebeiden anonym überlieferten Sätze Ich trau kei’m alten Stechzeug nicht und Achguter G’sell von wannen her besitzen – bei unterschiedlicher mehrstimmigerEinkleidung – dieselbe Tenorstimme. Beide Lieder ziehen als Metapher für denLiebesakt das ritterliche Milieu heran und nehmen auch inhaltlich aufeinan-der Bezug: Auf die Aussage »Ich trau kei’m alten Stechzeug nicht« antwortetdie Schlusswendung der 1. Strophe von Ach guter G’sell mit »…wer gern sticht,der hat kein Fehl am Stechzeug nicht«.32 Ein subtileres Verfahren, Lieder mitLiebesthematik in ein gegenseitiges Verhältnis zu setzen, ist aus Vertonungenzu Ich stund an einem Morgen von Mathias Greiter und Ludwig Senfl bekannt.33
Melodie und Text stimmen aufgrund der Wahl desselben Cantus firmus über-
Die Lieder Heinrich Isaacs 31
30 Zur Typisierung von Liebesliedern des 16. Jahrhunderts siehe Hans Brunner, »Das deutsche Liedim 16. Jahrhundert«, in: Fragen der Liedinterpretation, hrsg. von Hedda Ragotzky, Gisela Voll-mann-Profe und Gerhard Wolf, Stuttgart 2001, S. 223–226 und ders., »Die Liebeslyrik in GeorgForsters Frischen Teutschen Liedlein (1538–1556)«, in: Deutsche Liebeslyrik im 15. und 16. Jahr-hundert (s. Anm. 22), S. 221–234.
31 RISM [1519]5, Nr. 33 und 57, in moderner Notation zugänglich in Das Liederbuch des Arntvon Aich, hrsg. von Eduard Bernoulli und Hans Joachim Moser, Kassel 1930.
32 Siehe auch Nicole Schwindt, »Kontrafaktur im mehrstimmigen deutschen Lied des 16. Jahr-hunderts«, in: Musikgeschichte im Zeichen der Reformation. Ständige Konferenz MitteldeutscheBarockmusik, Jahrbuch 2005, hrsg. von Peter Wollny, Beeskow 2006, S. 47–69, hier S. 57, undGaby Herchert, »Acker mir mein bestes Feld«. Untersuchungen zu erotischen Liederbuchliedern desspäten Mittelalters, Münster – New York 1996, S. 179–182.
33 Vgl. Nicole Schwindt, »Tradieren, Memorieren, Zitieren: Cantus-firmus-Bearbeitung im Tenor-lied«, in: Resonanzen: vom Erinnern in der Musik, hrsg. von Andreas Dorschel, Klaus Aringeru.a., Wien u.a. 2007 (= Studien zur Wertungsforschung, 47), S. 78–101, hier 92 f.
ein, die bekannte Liedmelodie ist jedoch jeweils mit einem Ostinato-Motiv inder Bassstimme verknüpft. Greiters Ostinato stellt ein Zitat aus JosquinDesprez’ Messe La sol fa re mi dar. In einer Basler Handschrift wurde die Sol-misationsfigur »rückwirkend« als soggetto cavato gedeutet: Auf Basis der über-einstimmenden Laute von Solmisationssilben (La sol fa re) und deutscher Wort-bildung ist dort im Bass-Stimmbuch vermerkt: »Bassus accinit Laß sy faren«.34
Dieses »Lass sie fahren« bezieht sich offensichtlich auf das im Liedtext ange-sprochene »Fräulein«. Senfl setzt dem ein gleichartig gearbeitetes Ostinato-Motiv mit der versöhnlichen Textmarke »Amica mea« entgegen.35 Wie in MeinFreud allein und Kein Freud ist der Kommentar in Liebesangelegenheiten hier-bei in der Verknüpfung von musikalischer Linie und Wort zu suchen.
In der einzigen Quelle, die Kein Freud aufzeichnet, ist auch Mein Freud alleinenthalten; allerdings entstanden die Einträge in der Handschrift der Univer-sitätsbibliothek Basel F X 1–4 zu unterschiedlichen Zeiten und wurden sogarvon unterschiedlichen Schreibern vorgenommen.36 Geht man also von einemLiedpaar aus, so geriet das Bewusstsein dafür schon bald in Vergessenheit. Esexistiert allerdings eine spätere Quelle, in der Mein Freud allein mit einem Liedgepaart auftritt, dessen Text mit den Worten »Kein Freud« beginnt. In Sig-mund Salmingers Selectissimae necnon familiarissimae cantiones, die 1540 inAugsburg gedruckt wurden (RISM 15407), geht Isaacs Mein Freud allein dasLied Kein Freud ohn dich von Ludwig Senfl voraus.37 Der Textinhalt wie auchdie formale Gestaltung sind Isaacs Kein Freud sehr ähnlich, auch Senfls Liedbesitzt einen Kehrvers. Obwohl der Schüler Isaacs seine Komposition auf eineandere Melodie gründet, sind einige Analogien im verwendeten melodischenMaterial auszumachen. Die Dreiecksformel jedoch, von der die Idee der Ge-meinschaft der Isaac-Lieder ausging, ist nicht auszumachen. Ein Vergleich mitMein Freud allein zeigt dagegen erneut Ähnlichkeiten im Kompositionsauf-bau. In diesem Stück setzte Isaac die Dreiecksformel als letzte Zeile des Auf-gesangs sowie als letzte Zeile des Abgesangs ein. Betrachtet man dieselben Pas-sagen in Senfls Stück, stellt man fest, dass auch sie mit einander verwandtemmelodischen Material gestaltet sind. Das Ende des Abgesangs wirkt wie eineParaphrase der letzten Zeile des Aufgesangs. Der von Senfl anstatt der Drei-ecksformel gewählte melodische Verlauf für den Zeilenbeginn umreißt wie-derum eine Quarte, und da auch dieses Stück im 5. Modus auf f gesetzt ist, istes in der zweiten Zeile erneut die Quarte c’ – f ’, der eine Abwärtsbewegung auf
32 Sonja Tröster
34 CH-Bu F X 1–4, Nr. 20.35 Ludwig Senfl, Sämtliche Werke, Bd. IV, hrsg. von Arnold Geering und Wilhelm Altwegg, Wol-
fenbüttel – Zürich 1962, S. 9 f. Zu übereinstimmendem Aufbau und Einsatz des Ostinatos vgl.Schwindt, »Tradieren, Memorieren, Zitieren« (s. Anm. 33), S. 92–95.
36 Mein Freud wurde als Nr. 12 noch von Jacob Ceir eingetragen, Kein Freud dagegen alsNr. 56 bereits von Jann Wüst; s. John Kmetz, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Basel.Katalog der Musikhandschriften des 16. Jahrhunderts. Quellenkritische und historische Untersu-chungen, Basel 1988, S. 230–251, hier S. 231.
37 Ediert in Ludwig Senfl, Sämtliche Werke, Bd. V, hrsg. von Arnold Geering und Wilhelm Alt-wegg, Wolfenbüttel 1949, Nr. 19.
die Kadenz hin folgt. Ein Verweis auf die Kompositionstechnik des Lehrerskönnte weiterhin darin bestehen, dass Senfl an dieser Stelle dieselbe Kadenz-konstruktion mit parallelen Quarten einsetzt, mit der Isaac den Schluss vonKein Freud gestaltete. Diese Art der Stimmführung im Vorfeld der Kadenz trittin Senfls Liedern sonst nur selten auf. Überzeugend ist jedoch wiederum einBlick auf die mit der melodischen Formel korrespondierenden Textpassagenzu Aufgesangs- und Abgesangsende. Wie aus der folgenden Gegenüberstellungersichtlich, fügt sich Senfls Stück in das anhand der beiden Isaac-Lieder defi-nierte Beziehungsschema von Wort und Formel:
(Isaac) (Senfl)Mein Freud allein in aller Welt, Kein Freud ohn dich ich haben mag,mein Trost zu allen Stunden. ! mein Trost auf dieser Erden.Mein Herz hat sich zu dir gestellt, Dann nur bei dir sein Nacht und Tag,mit Lieb und Treu verbunden. ! kann mir nichts Liebers werden.Durch dich bin ich, mit Liebes Kraft, schwerlich behafft, Mein einigs B. gleich noch als ehzu deinem Dienst mit Fleiß gericht, tu ich mich dir erzeigen.ohn argen List, dir gänzlich ist, Mein Lieb und Treu wird täglich neu,mein Herz in rechter Lieb verpflicht. ! mein Herz ist ganz dein eigen.
Möglicherweise schrieb Senfl Kein Freud ohn dich als Ersatz für den zur Zeitdes Drucks dem Herausgeber nicht verfügbaren Satz von Isaac mit gleichemTextbeginn. Das würde natürlich voraussetzen, dass die Idee eines Liedpaaresund damit ein bewusstes Zitieren tatsächlich vorgelegen hätten. Es sind aller-dings auch andere Szenarien denkbar, die die Verwandtschaft der Sätze deu-ten könnten. So fällt an Senfls Stück der außergewöhnlich bausteinhafte Auf-bau des Textes auf. Nicht nur die letzte Zeile kehrt in jeder Strophe wieder,auch die Anfangsworte »Kein Freud ohn dich« und die beiden ersten Zeilendes Abgesangs »Mein einigs B. gleich noch als eh, tu ich mich dir erzeigen« ge-hören zum Grundgerüst jeder Strophe. Der Text scheint daher wenig kunst-voll und in möglichst kurzer Zeit stereotyp erstellt. Daraus könnte man schlie-ßen, dass es sich bei diesem Lied um ein Übungsstück des Schülers Senflhandelt, bei dem der Text nur die notwendige Ausgangsbasis bildete, um einenan das Vorbild Isaacs angelehnten Satz zu erstellen.38 Der Druck von 1540 istjedoch die einzige Quelle für Kein Freud ohn dich, das damit erst zu einem rechtspäten Zeitpunkt nachweisbar ist. Eine weitere Deutung, die die Analogienaller drei Lieder einbeziehen würde, ist die Komposition anhand eines Modells,die nicht unbedingt eine pädagogische Absicht beinhalten muss. Es könntesich schlicht um eine Zeit sparende Methode der Liedproduktion handeln.
Die Lieder Heinrich Isaacs 33
38 Zu dem Lehrer-Schüler-Verhältnis von Isaac und Senfl vgl. den Beitrag »›Hic jacet … Isaci discipulus …‹. Heinrich Isaac als Lehrer Ludwig Senfls« von Stefan Gasch in diesem Band,S. 150–169.
Über die Verwendung von ähnlichen Klangwirkungen und Melodielinien inVerbindung mit denselben zentralen Worten könnte aber auch gezielt das Er-innerungsvermögen angesprochen werden, das Wiedererkennung und Asso-ziation ermöglicht. In diesem Fall ginge die Absicht und Wirkung eines Lie-des über die eigene Liedgrenze hinaus, und eine Betrachtung des einzelnenSatzes müsste immer unvollständig bleiben.
Damit habe ich an einigen Beispielen zu zeigen versucht, wie viele Fragendas Liedschaffen Isaacs derzeit noch aufwirft und welche Unsicherheiten hin-sichtlich der Anwendung adäquater Analysemethoden weiterhin bestehen.39
Die Popularität des Liedes Innsbruck ich muss dich lassen scheint über dieseoffensichtlichen Defizite hinweggetäuscht zu haben. In zahlreichen Musikge-schichtsdarstellungen wird der bekanntere der beiden Sätze als Beispiel für dasTenorlied angeführt, obwohl sowohl die Lage der Melodie im Diskant als auchdie Faktur des Satzes für die Gattung in dieser Zeit eher ungewöhnlich sind.Besonders in letzter Zeit ist zudem zu bemerken, dass in Konzertprogrammenund Einspielungen mit Liedern der Renaissance einzig dieses Stück von Isaacwahrgenommen wird. Eine aktuelle wissenschaftliche Erschließung könnte das»unbekannte« Repertoire aus dem Schatten seines bekanntesten Vertretersführen und auch akustisch wieder präsent werden lassen.
34 Sonja Tröster
39 Vgl. Staehelin, Artikel »Isaac« (s. Anm. 5) und Andrea Lindmayr-Brandl, »Alte Musik in denFängen der Analyse«, in: Zur Geschichte der musikalischen Analyse. Bericht über die Tagung Mün-chen 1993, hrsg. von Gernot Gruber, Laaber 1996 (= Schriften zur Musikalischen Hermeneutik,5), S. 13–24, hier S. 23 f.