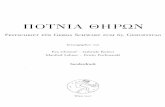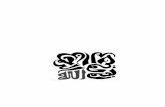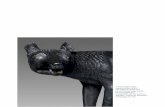Victoria, Apollon oder doch ein Athlet? Überlegungen zu den ITS-Stempeln OCK type 2574
Nun also doch Lehrbücher im Fremdsprachenunterricht?
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Nun also doch Lehrbücher im Fremdsprachenunterricht?
353
Johannes Kiersch
Nun also doch Lehrbücherim Fremdsprachenunterricht?
Bei der jüngsten Zusammenkunft des Sprachlehrer-Initiativkreises der Wal-dorfschulen in Frankfurt am Main mußten die Teilnehmer in wechselseitigenBerichten zur Kenntnis nehmen, daß sich der traditionell streng verpönteGebrauch von Lehrbüchern im Fremdsprachenunterricht an den deutschenWaldorfschulen in den letzten Jahren rapide ausgebreitet hat. Handelt es sichda um einen schlimmen Einbruch in die unabdingbaren Prinzipien unsererPädagogik? Geradezu eine Katastrophe, wie manche Kolleginnen und Kolle-gen meinen? Haben wir es mit einer leider unvermeidbaren Entwicklung zutun, die den wachsenden Disziplin- und Autoritätsproblemen in unserenSchulen Rechnung trägt, oder den infolge des Leistungskurssystems beimAbitur unerträglich verschärften intellektuellen Anforderungen in der Se-kundarstufe II? Oder gehört die traditionelle Reserve gegenüber Lehrbüchernim Fremdsprachenunterricht zu den vielen »alten Zöpfen« der Waldorfpäd-agogik, die endlich einmal mutig fallengelassen werden sollten? Jedenfallsscheint erneut Klärungsbedarf zu bestehen.*
Vor ein paar Tagen traf ich eine junge Frau, selbst ehemalige Waldorfschüle-rin, die sich besorgt und erschreckt über den aggressiven Ton äußerte, den sieauf dem Elternabend einer zweiten Klasse gegenüber der durchaus kompe-tenten und beliebten Klassenlehrerin wahrgenommen hatte. Selbst unter»normalen« Umständen und schon in den Anfangsklassen wird von unserenKolleginnen und Kollegen ein hohes Maß an Argumentationssicherheit undsolider Fachkenntnis, nicht zuletzt auch ein überzeugendes menschliches For-mat verlangt. Wie geht es da erst den Fachlehrern der Mittel- und Oberstufe,besonders dort, wo sie sich – was immer häufiger vorkommt – mit mangeln-der Kontinuität des Unterrichtsangebots infolge der Lehrerfluktuation, mitmangelnden Vorkenntnissen der Schüler oder Kontaktproblemen beim Neu-einstieg herumschlagen müssen? Selbst beim relativ soliden Gang der Dingewächst der Streß. Examina entscheiden über Lebenschancen. Wer will es daden Eltern verdenken, daß sie sich Sorgen machen und beizeiten nach demRechten sehen? Auch über Änderungen im Gesprächsstil brauchen wir uns
* Dieser Beitrag erscheint gleichzeitig in der Sprachlehrerkorrespondenz: FORUM forLanguage Teachers at Rudolf Steiner (Waldorf) Schools 1997
354
nicht zu wundern. Überall in den Medien wird schamlos und in den rüdestenTönen kritisiert. Warum nicht auch auf dem Waldorf-Elternabend?
Ein spezielles Problem im Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule, be-sonders im Fach Englisch, sind die natürlichen Begabungsdifferenzen derSchüler. Wir verzichten, wie wir immer wieder betonen, auf das an den staat-lichen Schulen übliche Ausleseprinzip. Rudolf Steiner hat sich – entgegenanderslautenden Gerüchten und Mythenbildungen – bis zuletzt eindeutiggegen eine Differenzierung der Lerngruppen nach Leistung ausgesprochen,auch und gerade im Fremdsprachenunterricht (Nachweise bei Kiersch 1992,S. 96 ff.). Wenn wir denn schon um unserer klassischen Ideale willen hieranfesthalten wollen: Sollten wir uns und den Schülern die damit verbundenenPlagen nicht wenigstens durch das zuverlässige »Gerüst« eines modernenLehrwerks erleichtern? Ich meine diese Frage keineswegs ironisch. Sie liegtfür mein Gefühl ganz offensichtlich in der Logik der gegenwärtigen Situation.Es soll sich deshalb hier auch nicht um die Kanonisierung eines Pro oderKontra handeln. Allgemein verbindliche Lösungen der Lehrbuchfrage sindgegenwärtig nicht mehr möglich. Es kann lediglich darum gehen, für kolle-giale Lösungen am Ort, möglichst unter Einbeziehung der Elternschaft, diebekannten Argumente noch einmal nach dem neuesten Stand der Diskussionzu sichten.
Vorteile des Lehrbuchs
Für die Einführung professionell durchorganisierter Lehrwerke gibt es eineganze Reihe mehr oder weniger gewichtiger Argumente. Die Schüler könnenanhand des Buches selbständig nacharbeiten, was sie womöglich versäumthaben. Im Fall eines Schul- oder Lehrerwechsels läßt sich nachschlagen, wel-ches Pensum bis dahin durchgenommen worden ist. Schwächeren Schülernkann zu Hause oder in der Nachhilfestunde gezielt geholfen werden, ohnedaß man beim Lehrer nachfragen muß. Die häßliche Zettelwirtschaft beimUmgang mit fotokopierten Texten wird vermieden. Vor allem aber: Eltern,Schüler und Lehrer können sich darauf verlassen, daß die Waldorfschule –wie es ja schon das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland fordert –hinter den staatlichen Schulen »nicht zurücksteht«, daß der landesübliche»Stoff« examenskonform bewältigt oder doch wenigstens als Maßstab zurVerfügung gestellt wird. Ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit stellt sichein, das mancher ängstlichen Kritik den Boden entzieht. Das Lehrwerk – soein ausgewiesener Fachmann – gilt »als Garant für einen lehrplankonformenUnterricht«. – »Die Lehrwerkmethodologien verleihen Verhaltenssicherheitfür Lehrende und Lernende, und ihre Kanonisierung gewährleistet die nichtzu unterschätzende Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Unterrichts-
355
geschehens für vorgesetzte Instanzen und Erziehungsberechtigte. Zudementlastet das Lehrwerk in hohem Maße von der täglichen Unterrichtsvorbe-reitung« (Legenhausen 1994, S. 469). Es ist wichtig, das gemeinsame Sicher-heitsbedürfnis aller Beteiligten, die Angst vor der Angst, als die Quelle derSehnsucht nach dem Lehrbuch zu identifizieren. Und diese Angst – wer woll-te das abstreiten – ist eben durchaus nicht unberechtigt.
Gegenargumente
Hat Rudolf Steiner die Verwendung von Lehrbüchern abgelehnt? Ja und nein.Er hat die Ausarbeitung eigener Lehrwerke nach den Prinzipien der Waldorf-pädagogik für eine ganze Reihe von Fächern, auch für den Fremdsprachen-unterricht, ausdrücklich befürwortet. Andererseits hat er sich wiederholt äu-ßerst scharf gegen die seinerzeit offenbar auch an der Waldorfschule ge-bräuchlichen Lehrbücher ausgesprochen. Als ein neueingetretener Lehrernach der Einführung eines solchen Buches fragt, stimmt er widerwillig zu; eingutes Jahr später beschwert er sich bitter über die »scheußliche, schundigeSchulbücherliteratur«, die er bei seinen Besuchen angetroffen hat. (Zu denEinzelheiten Kiersch 1992, S. 85 ff.) Seine expliziten Einwände zielen auf dieTrivialität der Lehrbücher und auf ihre lebensferne Künstlichkeit.
Für unsere heutige Situation eher noch gewichtiger sind jedoch die Einwän-de, die sich aus den menschenkundlichen Grundlagen der Waldorfpädagogikergeben. Kleine Kinder lernen ihre Sprache von der Bewegung her und ausder Empfindung, nur nebenher mit den kognitiven Fähigkeiten logischerAnalyse und Verknüpfung. Ein naturgemäßer Fremdsprachenunterricht wirdversuchen, daran anzuknüpfen. Ein Lehrbuch kann sich nicht bewegen, kannnicht singen oder tanzen, äußert sich nicht durch Mimik und Gestik. Vielesprachlich weniger begabte Kinder sind aber darauf angewiesen, gerade aufdem Umweg über diese Tätigkeiten in Gang gesetzt zu werden. Wie wir ausden anthroposophischen Interpretationen der bekannten Entdeckungen desamerikanischen Physiologen William Condon über die Mikro-Bewegungenbeim Sprechen und Sprachverstehen wissen, kommt der Körperhaltung unddem Bewegungsrepertoire des Lehrers eine entscheidend wichtige Vorbild-funktion beim Sprachenlernen zu: Auch Kinder im Schulalter lernen in die-sem Bereich durch Nachahmung, nicht durch Bücher (vgl. Jaffke 1994, Lutz-ker 1996). Schließlich dürfen wir nicht vergessen, daß Sprachenlernen weitge-hend eine Sache der sinnlichen Wahrnehmung ist, nur zum geringen Teil eineFunktion der bewußten logischen Verarbeitung. Dabei spielen die vier »obe-ren« oder »Sozial«-Sinne eine dominierende Rolle: Der Hörsinn, der Wort-oder Lautsinn (von Rudolf Steiner auch als Sprachsinn bezeichnet), der Ge-danken- und der Ichsinn, durch die ich die Gedanken und das Ich meines
356
Gegenübers wahrnehme (Lutzker 1996, S. 32 ff.). Alle diese Sinne wirkenprimär in der unmittelbaren sozialen Interaktion, nur in abgeblaßter abstrak-ter Form über das Lesen. Deswegen gibt es auffallend viele »schwache« Schü-ler im Fremdsprachenunterricht, die bei Gelegenheit einer Auslandsreise ihrean Buchgelehrsamkeit stärkeren Klassenkameraden an konkreter Verständi-gungsfähigkeit spielend übertreffen. Vielleicht könnte man bei der Deutungdieses Phänomens an den erweiterten Intelligenzbegriff denken, den der Har-vard-Psychologe Howard Gardner vor gut zehn Jahren vorgetragen hat(1985). Gardner unterscheidet neben der mathematisch-logischen und dersprachlichen »IQ-Intelligenz« fünf weitere Intelligenzformen: die räumliche,die musikalische, die kinästhetische (Bewegungs-)Intelligenz, die interperso-nale Intelligenz (Empathievermögen) und die intrapersonale, die Fähigkeitdes bewußten Umgehens mit der eigenen Person. Im wesentlichen kann nurdie »IQ-Intelligenz« über den Umgang mit Büchern mobilisiert werden. Werzum Sprachenlernen mehr auf die fünf anderen Intelligenzen angewiesen ist,bleibt beim lehrbuchzentrierten Unterricht ohne Nahrung.
Auch die bekannten neurologischen Forschungsergebnisse über die unter-schiedlichen Funktionen der beiden Hirnhälften sind ein starkes Argumentfür einen »ganzheitlichen« Fremdsprachenunterricht ohne Lehrbuch. Hans-Jörg Betz macht in seiner zusammenfassenden Darstellung diesbezüglich dar-auf aufmerksam, daß bei einer Vernachlässigung rechtshemisphärischer Fä-higkeiten im Fremdsprachenunterricht »die Gefahr besteht, daß die Schülernicht lernen, in der Fremdsprache zu kommunizieren, obwohl sie die Gram-matik der Fremdsprache verstehen und fremdsprachliche Texte lesen kön-nen.« Es sei deshalb wichtig, »im Fremdsprachenunterricht möglichst vieleElemente natürlicher Interaktion und Kommunikation zu berücksichtigen,um dadurch die neurophysiologische Verankerung kommunikativer Strategi-en in beiden Gehirnhälften zu begünstigen. Zu diesen Elementen gehörenBlickkontakte, das gemeinsame Ausführen von Handlungen, ein hohes Maßan Bewegung, emotionale Beteiligung und dadurch die Veränderung von Mi-mik und Gestik sowie die Veränderung von Stimmqualität, Tonhöhe undLautstärke beim Sprechen« (Betz 1995, S. 83). Besonders Renate Löffler undder Heidelberger Sprachdidaktikerkreis um Gerhard Bach und Johannes-Pe-ter Timm haben sich im Sinne solcher Überlegungen für einen weniger starklehrbuchgebundenen Fremdsprachenunterricht eingesetzt (Löffler 1979, Löff-ler/Schweitzer 1988, Timm 1995). Einen originellen Sonderweg in ähnlicherRichtung geht der Dorstener Gymnasiallehrer Hans-Jörg Modlmayr, der sei-nen Englischunterricht in der Mittelstufe mit der bekannten britischen Lady-bird-Kinderbuchserie beginnt und ohne jedes Lehrbuch in kürzester Zeit einerstaunliches Niveau erreicht (Behrendt 1993). Wie skeptisch heute auch au-ßerhalb der Waldorfpädagogik die Möglichkeiten der Arbeit mit dem Lehr-
357
buch eingeschätzt werden, zeigt das von Eckhard Rattunde herausgegebeneThemenheft der Zeitschrift Die Neueren Sprachen: »Offene Lerneinheiten imFremdsprachenunterricht« (1995), wo als Alternativen die storyline-Methodenach Steve Bell (Glasgow) und die simulation globale nach Jean-Marc Caréempfohlen werden.
Spezifische Waldorf-Ansätze
Wer im Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule ganz ohne Lehrbücherauskommen möchte, wird in der fachspezifischen Lernbiographie seinerSchüler einige Wegstrecken beachten müssen, die besondere Aufmerksamkeitverlangen. Im großen und ganzen ist ja der Lehrplan in den Fremdsprachenvon Rudolf Steiner bewußt sehr frei angelegt worden (Kiersch 1992, S. 94 ff.).Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben auf diesem Gebiet den denkbar größ-ten Spielraum für eigene Einfälle und auch persönliche Neigungen. Dennochsind einige Schwerpunkte zu nennen, auf die es ankommt:
1. Die Eingangsphase, in der ein Grundvokabular und die wichtigsten Form-wörter der fremden Sprache erworben und in spielerischer Kommunikationübend befestigt werden. Christoph Jaffke hat dieser Lernphase eine umfas-sende eigene Darstellung gewidmet (1994, 21996).
2. Die Phase des stärkeren Bewußtwerdens der Sprache in der »mittlerenKindheit« zwischen dem 9. und dem 12. Lebensjahr, in der das Schreiben undLesen im Fremdsprachenunterricht beginnt. (Zur psychologischen Situationdieses für den Spracherwerb so entscheidend wichtigen Lebensalters sieheMüller-Wiedemann 1989.) Hier wird der Lernstil der Primarstufe oft in un-überlegter Weise unverändert fortgesetzt. Das wache, bewußte Erfassen derSprachstrukturen kommt zu kurz. Rudolf Steiner hat ja nicht ohne Grund indie Zeit unmittelbar nach dem Grenzübergang (»Rubikon«) des 10. Lebens-jahres die erste Grammatik gesetzt. Bewährt hat sich das nach dem Musterdes »Epochenhefts« gestaltete selbstgeschriebene Sprach-Lernbuch: »My firstEnglish Reader«, »Mon Grand Cahier de Français« (Heyder 1984, Winterfeldt1984). Ließe sich die Arbeit mit einem solchen selbstgestalteten Heft womög-lich bis in die 8. Klasse hinein weiterführen? Entsprechende Versuche wärenfür uns alle äußerst wertvoll!
3. Die schon von Rudolf Steiner empfohlene große Rekapitulation des gesam-ten Grammatik-Stoffs in der 9. Klasse.
Wo diese drei Lernphasen in ihrer Eigenart ernstgenommen werden, läßtsich vielleicht doch ohne ein lektioniertes Lehrwerk erfolgreich arbeiten.
Wichtig erscheint dabei eine kontinuierlich oder regelmäßig erneuerte Be-
358
Im Fremdsprachenunterricht der Waldorf-schule spielen szenische Darstellungen einegroße Rolle: von den kleinen Alltagsszenen,Fabeln, Humoresken schon ab 1. Klasse bis zuTheater-Inszenierungen in der Oberstufe (hiereine russische Spielprobe in der StuttgarterSchule Uhlandshöhe; Foto: Schaden)
wußtmachung des Lernvorgangs.Michèle Strutz berichtete im Initia-tivkreis, daß sie jedes Jahr mit einemÜberblick über die geplanten Unter-richtsvorhaben auf einem Eltern-abend beginne. Magda Maier hat inihrer exemplarischen Studie überDickens’ A Christmas Carol (1984) ge-zeigt, wie man ein längere Zeit bean-spruchendes Lektürevorhaben imBewußtsein der Schüler so vorstruk-turieren kann, daß ein ähnliches Ge-
fühl der Sicherheit im gemeinsamen Fortschritt erreicht wird wie beim Gangdurch die (künstliche) Ordnung eines Lehrbuchs. Zu wünschen wären auchsystematische Versuche mit waldorf-eigenen Lehrbuch-Entwürfen, wie z. B.den von Peter Jobling (1992 und 1994) in der Art einer kommentierten Antho-logie zusammengestellten Bänden für den Englischunterricht der Klassen 7bis 9.
Von größter Wichtigkeit für die offensive Vertretung eines Fremdspra-chenunterrichts ohne Lehrbuch ist die kontinuierliche Präsentation der Lern-ergebnisse vor Schülern und Eltern, das »Monatsfeier«-Prinzip. Damit läßtsich schon in den Unterklassen beginnen. Bewährt haben sich besonders diegegenüber etwa einer großen öffentlichen Monatsfeier etwas intimeren fest-lich-familiären Nachmittage für die Eltern einer einzelnen Klasse, bei denen –neben den Früchten anderer Fächer – auch die laufenden Produktionen desFremdsprachenunterrichts, einschließlich der alltäglichen Übungen, darge-boten werden können. Der gemeinsame Stolz auf das Schritt für Schritt Er-reichte und die Freude daran sind für alle Beteiligten ein Heilmittel gegen die»Angst vor der Angst«.
359
Kompromisse
Wo angesichts all dessen, nach sorgfältiger Diskussion im Lehrerkollegiumund entsprechender Verständigung mit den Eltern, die Einführung eines lek-tionierten Lehrwerks doch unvermeidlich erscheint, sollte man Zank undStreit vermeiden. Die Schüler werden das landesübliche Lehrbuch mit Neu-gier, vielleicht sogar mit Spannung und Freude begrüßen. Wenn es dann nacheinigen Wochen oder Monaten den Reiz des Neuen verloren hat, mag dasvielversprechende Wundermittel noch als roter Faden für das befriedigendeGefühl geordneten Fortschritts oder als Alibi gelten; der eigentliche Unter-richt wird sich mehr und mehr davon lösen und die gemeinsame Aktivitätdoch wieder auf das freie Sprechen miteinander verlagern, die produktivsteTätigkeit im Fremdsprachenunterricht, die es überhaupt gibt. Wo allerdingsdas Lehrbuch die Herrschaft übernimmt, die Lehrer bequem werden und ihreInitiative bei der anonymen Hintergrundautorität der verantwortlichen Cur-riculum-Kommission abliefern, da beginnt die pädagogische Wüste – an Wal-dorfschulen wie an Staatsschulen.
Kleine Kinder lernen ihre Sprache von der Bewegung her und aus der Empfindung, nur nebenhermit kognitiven Fähigkeiten. Diese Einsicht sollte sich der Fremdsprachenunterricht zunutze ma-chen. Ein Lehrbuch kann sich nicht bewegen, kann nicht singen oder tanzen, äußert sich nichtdurch Mimik oder Gestik ...
360
Literaturhinweise
Behrendt, B.: Gesteigerte Lern-Ergebnisse durch Lese-Erlebnisse mit englischsprachi-ger Literatur: Ein neues Lehrgangsmodell von H.-J. Modlmayr. [Dortmunder Kon-zepte zur Fremdsprachendidaktik, Bd. 2] Bochum 1993
Betz, H.-J.: Spielerisch agieren, imaginieren und kommunizieren – ein Weg zu mehrGanzheitlichkeit im Englischunterricht. In: J.-P. Timm (Hrsg.): Ganzheitlicher Fremd-sprachenunterricht. Weinheim 1995, S. 78 - 104
Gardner, H.: Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: BasicBooks 1985. Deutsch: Abschied vom IQ. Die Rahmentheorie der vielfachen Intelli-genzen. Stuttgart 1994
Heyder, B.: Selbstgemachte Lehrbücher: Das Gestalten der Hefte im fremdsprachlichenUnterricht der 4. und 5. Klasse; in: J. Kiersch (Hrsg.): Zum Fremdsprachenunterricht.Stuttgart 1992, S. 113 - 120
Jaffke, C.: Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe. Seine Begründung und Praxisin der Waldorfpädagogik. Weinheim 1994 (2., revidierte Auflage 1996)
Jobling, P. M. (Hrsg.): Ring out, wild Bells! Oslo: Antropos Forlag 1992Jobling, P. M. (Hrsg.): Burning Bright! Oslo: Antropos Forlag 1994Kiersch, J. (Hrsg.): Zum Fremdsprachenunterricht. Erfahrungsberichte und Betrach-
tungen zur Methode des neusprachlichen Unterrichts in der Waldorfschule. Stuttgart1984 (21992)
Kiersch, J.: Fremdsprachen in der Waldorfschule. Rudolf Steiners Konzept eines ganz-heitlichen Fremdsprachenunterrichts. Stuttgart 1992
Legenhausen, L.: Vokabelerwerb im autonomen Lernkontext. In: Die Neueren Spra-chen 93:5 (1994), S. 467 - 483
Löffler, R.: Spiele im Englischunterricht. München 1979Löffler, R./Schweitzer, K.: »Brainlinks«. Bausteine für einen ganzheitlichen Englisch-
Unterricht. Weinheim und Basel 1988Lutzker, P.: Der Sprachsinn. Sprachwahrnehmung als Sinnesvorgang. Stuttgart 1996Maier, M.: Charles Dickens: »A Christmas Carol« in der achten Klasse; in: J. Kiersch:
Zum Fremdsprachenunterricht. Stuttgart 21992, S. 121 - 138Müller-Wiedemann, H.: Mitte der Kindheit. Das neunte bis zwölfte Lebensjahr. Beiträ-
ge zu einer anthroposophischen Entwicklungspsychologie. Stuttgart 31989Rattunde, E. (Hrsg.): Themenheft »Offene Lerneinheiten im Fremdsprachenunter-
richt«: Die Neueren Sprachen 94:1 (1995)Timm, J.-P. (Hrsg.): Ganzheitlicher Fremdsprachenunterricht. Weinheim 1995Winterfeld, D. v.: Ein Französischheft in der vierten Klasse; in: J. Kiersch (Hrsg.) 1992, S.
102 - 112
361
Peter Lutzker
Fremdsprachen ohne Lehrbuch
Am 12. Februar 1997 trafen sich in der Düsseldorfer Waldorfschule mehr als60 Waldorflehrer mit den Fächern Englisch, Französisch und Russisch zueiner ganztägigen Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema: »SteinersKonzept eines ganzheitlichen Fremdsprachenunterrichts und der Gebraucheines Lehrbuchs – Widerspruch oder Chance?« Eingeladen hatte – wie schoneinmal im Vorjahr – die Bezirksregierung Düsseldorf im Einvernehmen mitder Arbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen. Vonstaatlicher Seite waren Fachleiter für Englisch, Französisch und Russischsowie der zuständige Fachdezernent anwesend; es waren auch Vertreter ver-schiedener Lehrbuchverlage gekommen. Am Vormittag wurden im Plenumzwei Referate pro und contra Unterricht mit Lehrbuch gehalten, die wir imfolgenden gekürzt abdrucken. Verblüffend war einerseits, daß auch prominen-te Professoren gegen Lehrbücher votieren, andererseits, daß die älteren Lehr-bücher nicht mit heutigen Lehrwerken vergleichbar sind. Anschließend wurdedas Thema lebhaft und kontrovers diskutiert, vor allem unter den Waldorfleh-rern selber. Am Nachmittag befaßten sich drei nach Sprachen aufgeteilte Ar-beitsgruppen mit je einer – den Schulen schon vorher zugeschickten – Lektionaus einem Englisch-, Französisch- und Russischlehrbuch. Die Teilnehmerbegrüßten den schulübergreifenden fachlichen Gedankenaustausch und dievertrauensvolle Kooperation zwischen Waldorfschulen und Schulaufsicht.
Red.
Erlauben Sie mir, am Anfang etwas vorwegzuschicken, um eventuell auftre-tenden Mißverständnissen vorzubeugen. Ich denke, daß es an diesem Taggrundsätzlich nicht um Rechtfertigung oder Kritisieren geht. Ich versteheunser Zusammentreffen als die Möglichkeit, in einem offenen Austausch ver-schiedene Gesichtspunkte zu dieser Thematik darzustellen und gemeinsamzu besprechen. Es sollte selbstverständlich sein, daß man nicht pauschal vomFremdsprachenunterricht an der Waldorfschule und vom Fremdsprachenun-terricht an der Regelschule sprechen kann. Jeder weiß, daß es guten undschlechten Sprachunterricht in allen Schulformen gibt. Aus dieser Tatsachefolgt logischerweise, daß es guten und schlechten Sprachunterricht mit Lehr-büchern und ohne Lehrbücher gibt. Auch wenn das, was ich nachher sage,möglicherweise für manche sehr pointiert klingt, hoffe ich doch, in diesemSinn verstanden zu werden.
362
Im Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule wird in Klasse 1 bis 3 – ähnlich wie beim Erwerbder Muttersprache – rein mündlich gearbeitet. Die musisch-künstlerischen Elemente, vor allemRhythmus und Reim, bilden durch Lieder, Gedichte, Bewegungsspiele und kleine dramatischeSzenen eine Säule dieses Unterrichts; die andere besteht in Elementen der Alltagssprache ...
363
... Ab der 4. Klasse beginnt man, ein selbstgemachtes Sprachenbuch anzulegen: mit viel Poesie, miteinem Schlüsselwortschatz und den wichtigsten Grammatikregeln. Zu den sorgfältig geschriebe-nen Texten malen die Kinder Bilder. (Abbildungen aus: Christoph Jaffke/Magda Maier: »Fremd-sprachen für alle Kinder«, mit freundl. Genehmigung des Ernst Klett Grundschulverlages Leipzig)
364
Die Lehrbuch-Frage in der Fremdsprachendidaktik
Die grundsätzliche Frage, ob man im Fremdsprachenunterricht mit einemLehrbuch arbeiten soll, wird in Waldorfkreisen seit einigen Jahren bewegt,aber natürlich nicht nur in Waldorfkreisen. Wenn man sich die Fachzeitschrif-ten und neueren Publikationen in den letzten Jahren im Fremdsprachenbe-reich ansieht, wird deutlich, daß diese Lehrbuchfrage auch in der Regelschul-pädagogik zunehmend diskutiert wird. Eine Reihe von Artikeln in der Zeit-schrift »Die Neueren Sprachen« hat sich diesem Thema in den letzten Jahrenz. T. sehr kontrovers gewidmet, und es gibt auch verschiedene Bücher, diedieses Thema kritisch aufgreifen.1 Gemeinsam haben die Gespräche in Wal-dorfkreisen und in der Regelschuldidaktik, daß diese Frage als ein entschei-dender Faktor im Umgang mit Fremdsprachen nicht nur in methodischerHinsicht, sondern bis in die gesamten Zielsetzungen hinein angesehen wird.
Um einen Einblick in diese Auseinandersetzung außerhalb von Waldorf-kreisen zu geben, möchte ich mich auf zwei anregende Bücher in dieser Dis-kussion beziehen. Harald Weinrich vergleicht in seinem Buch »Wege derSprachkultur«2 die Arbeit mit einem Lehrbuch mit der Arbeit an einem litera-rischen Text und stellt dabei die »Unbequemlichkeit« des Lesens eines literari-schen Textes gegenüber der »Benutzerfreundlichkeit« des Lehrbuchs heraus.Diese »Unbequemlichkeit« der Literatur sieht er als unausweichlich an, daständig unbekannte Wörter, Wendungen, Strukturen usw. auftreten können.Er stellt jedoch die Frage, ob es der richtige Weg ist, diesen Schwierigkeitenund dieser Komplexität aus dem Wege zu gehen und die geordnete Progressi-on des Lehrbuches vorzuziehen. Er schreibt: »Ich räume ein, daß man mitsolchen radikalen komplexitätsabweisenden Methoden, wenn man dann einehübsch lernschrittige Unterrichtsreihe beschreibt, gewisse Effizienzen mel-den kann. Ein kritischeres Bewußtsein kann sich jedoch solcher Augenblicks-erfolge nicht recht erfreuen, denn mit der Komplexität wird natürlich auchdas Leben aus dem Sprachunterricht ausgetrieben … Der Komplexitäts-schock wird auf diese Weise nicht etwa aus der Welt geschafft, sondern nuraus dem Unterricht eliminiert und für die Zeit danach aufgehoben, wennnämlich die Sprache wirklich gebraucht werden soll. Ich finde eine Didaktik,die solches empfiehlt, feige. Ich bin daher der Ansicht, der Fremdsprachenun-terricht sollte der sprachlichen Komplexität nicht ausweichen, sondern Me-thoden entwickeln, ihr zu begegnen. Für diese Aufgabe bietet sich die Litera-tur hervorragend an.«3
Das Überraschende in Weinrichs Argumentation liegt jedoch m. E. nicht inseinem Plädoyer für Literatur im allgemeinen, sondern im Stellenwert, dendiese im gesamten Verlauf des Fremdsprachenunterrichts an der Schule ha-ben soll: »Die einzige Empfehlung, die ich allenfalls zu geben habe, läuft
365
darauf hinaus, dringend davor zu warnen, die Konfrontation mit der Kom-plexität immer weiter hinauszuschieben und den Sprachschüler durch immersanftere Übergänge, immer reduziertere Minimalgrammatiken, immer küm-merlichere Mindestwortschätze an ein weiches didaktisches Dahingleiten zugewöhnen und ihn in der bösen Täuschung zu wiegen, als ob es so etwas wiesprachliche und sachliche Komplexität in der Fremdsprache gar nicht gäbe.Die Literatur, wenn wir sie hier einmal als Erscheinungsform für die Komple-xität des Lebens nehmen dürfen, gehört daher nicht etwa erst in die Oberstufeoder die Mittelstufe, sondern sie gehört schon in die ersten Lektionen desSprachunterrichts.«4
Diese vielleicht überraschende Idee ist in den letzten Jahren in der Fachdi-daktik zunehmend aufgegriffen worden. Am beeindruckendsten und konkre-testen wird diese Problematik bei Hans Hunfeld in seinem Buch »Literatur alsSprachlehre« dargestellt.5 Demnach sei die zentrale Frage der Fremdspra-chenpädagogik die, ob man bereit ist, von der ersten Stunde an mit Gedichtenund Literatur im weitesten Sinn umzugehen oder ob man die pragmatischenZiele und Methoden eines Lehrbuchs bevorzugt. Über den Beispielsatz imLehrbuch schreibt er: »Er lehrt weder den tatsächlichen noch den persönli-chen, sondern den gewünschten Gebrauch der Sprache. Er verlangt Repro-duktionen einer Wirklichkeit, die er sprachlich und inhaltlich bestimmt. Wiedie Fiktion steht auch die Lehrbuchwelt in Distanz zur Wirklichkeit. Aberöffnet der fiktionale Text seinem Leser viele Möglichkeiten von Wirklichkei-ten, so schränkt der Lehrbuchtext diese Wirklichkeit auf das inhaltlich wiegrammatikalisch einfachste Muster ein.«6
Die »vereinfachte Welt«, die ein Lehrbuch konstruiert, um progressivesprachliche Schritte durchnehmen zu können, sieht er gerade in den Fremd-sprachen als besonders gefährlich an, da von vornherein sprachliche Begren-zungen vorhanden sind. Hunfeld schreibt weiter: »Literatur redet gegen einesolche Welt an. Sie muß gerade da zur Sprache kommen, wo die Vereinfa-chung und die Floskel sich aufdrängen wollen, wo die auf die Norm gebrach-te Sprache mit der Autorität eines Musters auftritt. Literatur durchbricht denZwang, der von Fremdsprachenlehre immer schon ausgeht.«7
Bei Hunfeld wie bei Weinrich wird jedenfalls sehr deutlich, daß die Lehr-buchfrage nicht einfach nur die Waldorfpädagogik von der Regelschulpäd-agogik trennt, sondern eine Reihe von Grundsatzfragen hinsichtlich des Zielsund der Methoden des Fremdsprachenunterrichts im allgemeinen aufwirft.
Fremdsprachen in den Waldorfschulen
Bevor wir noch tiefer in diese Problematik einsteigen, möchte ich versuchen,einen kurzen Überblick darüber zu geben, wie wir in Waldorfschulen ohne
366
Lehrbücher arbeiten, wobei nicht im geringsten ein Anspruch auf Vollstän-digkeit erhoben werden kann.
In den Klassen 1 bis 3 wird in den Fremdsprachen möglichst durchgehenddas ganzheitliche Lernen praktiziert. Es sind die musisch-künstlerischen Ele-mente, vor allem Rhythmus und Reim, die durch Lieder, Gedichte, Bewe-gungsspiele und kleine dramatische Szenen eine wesentliche Säule diesesUnterrichts bilden. Die andere Säule besteht in Elementen der Alltagssprache,kleinen Dialogen über Themen wie Familie, Haustiere, Wetter, Raumgegen-stände etc.
Ab der 4. Klasse beginnt man, ein selbstgemachtes Sprachenbuch mit vielPoesie, mit einem Schlüsselwortschatz und den wichtigsten Grammatikre-geln anzulegen. In dieser Altersstufe herrscht eine andere Stimmung als inden ersten drei Jahren. Hier ist spielerischer Wettbewerb am Platz; Gramma-tikregeln und Wortschatz werden jetzt bewußt »gesammelt«. (Es ist der An-fang eines Alters, in dem gerne alles mögliche gesammelt wird.) Es wird nochviel rezitiert, wobei das Dramatische zunehmend wichtiger wird. Inzwischengibt es einen Kanon von bewährten Lektüren, die in der Mittelstufe gelesenwerden und oft dramatisch bearbeitet worden sind: z. B. aus dem Englischun-terricht der 4. Klasse »Hay for my Ox«, aus der 4. oder 5. Klasse »Dick Whit-tington«, für die 5. Klasse »King Arthur«, die 6. Klasse »Robin Hood«,7. Klasse »The Jungle Book«, 8. Klasse »A Christmas Carol«. Letztendlich
367
sollen diese Beispiele als Anregungen verstanden werden: Es liegt in der Frei-heit und Verantwortung des Lehrers, das passende Werk für die jeweiligeKlasse auszuwählen.
In der Oberstufe wird in der Regel nur mit Originaltexten gearbeitet. Ge-dichte spielen hier gerade in der Rezitation noch eine wichtige Rolle. Manliest in erster Linie Literatur, aber natürlich auch Sachtexte, Biographien usw.Es wird grundsätzlich versucht, altersgemäße Texte zu finden, die den tat-sächlichen Interessen und Bedürfnissen der Schüler entsprechen und sichdeswegen auch am Waldorf-Lehrplan orientieren. Dies kann man z. B. an-hand der 11. Klasse verdeutlichen, wo im Gesamtlehrplan dieses Jahrgangsimmer wieder zwei wesentliche Motive erkennbar sind: erstens die Suchenach sich selbst: »Wie werde ich zu einem freien Menschen?«, oder andersausgedrückt: »Auf welche Kräfte in mir und im anderen kann ich mich wirk-lich verlassen?« Im Ringen um die Antwort zu dieser Frage spielt z. B. dasLesen des »Parzival« im Deutschunterricht dieses Schuljahres eine zentraleRolle.8 Zweitens die tiefe Bedeutung des »Apollinischen« (der Geistes- undFormenklarheit) und »Dionysischen« (der rauschhaft-dynamischen Bewegt-heit) in der Kunst; das Zusammenspiel dieser Kräfte soll in unterschiedlichenFächern auf verschiedene Weise konkret erlebt werden. Diese beiden Motivefinden sich in den Fremdsprachen im Lesen von großen dramatischen Lektü-
Abbildungen: Aus selbstgeschriebenen und -gemalten Sprachenbüchern von Waldorfschülern
368
ren wieder. Es ist in der Waldorfschule eine bewährte Tradition, daß in diesemJahrgang im Englischunterricht ein Werk von Shakespeare gelesen wird undim Französischen wo möglich ein Werk von Molière.
Eine bewußte Erarbeitung der Fremdsprachengrammatik ist bis zum 9./10.Lebensjahr (bis einschl. 3. Schuljahr) gar nicht gewollt. Zwischen dem 9. unddem 12. Lebensjahr hat die Wortformenlehre Vorrang. Erst nach dem 12. Le-bensjahr wird eine bewußte Erarbeitung der Syntax angestrebt. Zum Metho-dischen kann man sagen, daß es ein großes Anliegen Rudolf Steiners war, daßder Grammatikunterricht von einer inneren Lebendigkeit getragen sein soll.9
Es geht um einen phantasievollen Grammatikunterricht, oft situationsbezo-gen, in dem auch der Humor eine entscheidende Rolle spielt. Was letztendlichwirklich festgehalten und gelernt werden soll, sind die entscheidenden gram-matikalischen Regeln und nicht die Beispielsätze, die diese Regeln mit be-stimmten Inhalten »einengen«. Im Englischen spielt der Grammatikunter-richt neben dem Lesen, Sprechen, Spielen usw. eine eher untergeordnete Rol-le. Die Ausnahme bildet die 9. Klasse, wo dem eine größere Bedeutungbeigemessen wird, um es zusammenfassend nach den Mittelstufenjahren zueinem gewissen vorläufigen Überblick zu bringen. Im Französisch- und Rus-sisch-Unterricht wird die Grammatik eine stärkere Rolle spielen.
Am Ende ist die besondere Rolle der Fremdsprachenklassenspiele, die vonvielen Schulen traditionsgemäß als Klassenspiele in der 10. Klasse aufgeführtwerden, zu erwähnen, wobei meines Wissens am häufigsten Werke vonThornton Wilder und Bernard Shaw gewählt werden.
Es gibt einen klaren roten Faden von der 1. bis zur 12. Klasse, den ich inunserem Zusammenhang herausheben möchte. Die Texte, die auf allen Stufenrezitiert, gespielt und gelesen werden, sind allesamt Literatur im weitestenSinne. Es sind originale, möglichst nicht vereinfachte Texte, die nicht auspragmatischen Gesichtspunkten geschrieben worden sind. Dadurch stellensie etwas Reales und Lebendiges, wenn auch etwas Komplexeres dar. Das giltfür »Robin Hood« genauso wie für »Macbeth«. In beiden Fällen geht mannicht der Komplexität der Sprache oder des Lebens aus dem Weg, sondernversucht, ihr mit Lebendigkeit unmittelbar zu begegnen. Dadurch kann Inter-esse und Begeisterung bei den Schülern geweckt werden, da sie sich in derpassenden Textwahl des Lehrers direkt angesprochen fühlen können. Hierausentsteht die Bereitschaft, lange Texte zu lernen, Rollen zu üben, lange Haus-aufgaben zu machen, Aufsätze zu schreiben usw. Die drei Stunden in derSchule, die man pro Woche zur Verfügung hat, werden auf signifikante undwertvolle Weise ergänzt durch die Zeit zu Hause.
Die offene Frage, die in unserer anschließenden Diskussion bewegt werdenmuß, ist, inwiefern dieses Ideal realisiert werden kann bzw. welche Vorausset-zungen bei Lehrern und Schülern hierfür notwendig sind.
369
In welchen Zusammenhängen sind Lehrwerke notwendig?
Der Frage nach der eventuellen Notwendigkeit eines Lehrbuches kann manauch anhand eines Beispieles, wo ein Lehrbuch sich als unentbehrlich erwie-sen hat, weiter nachgegehen. Ich habe hier zwei Lehrwerke; das erste, das ichvon meinem Sohn ausgeliehen habe, wird für das anfängliche Lernen desCellospiels häufig benutzt.10 Das andere ist ein viel schwierigeres Lehrwerkfür ein Blasinstrument (Waldhorn), ein Etüdenwerk für Fortgeschrittene.11
Wie geht man gewöhnlicherweise mit einem solchen Lehrwerk um? Daserste sollte ausschließlich, ohne Hinzunehmen anderer Kompositionen, be-nutzt werden; beim zweiten setzt man voraus, daß gleichzeitig Original-Lite-ratur geübt wird, Konzerte, Sonaten usw. Sie sehen, das Beispiel läßt sich indieser Hinsicht gut auf verschiedene Schwierigkeitsgrade von Sprachlehr-werken übertragen.
Wie geht das Anfangsheft vor? Zunächst steht ein klares Fortschreiten imMittelpunkt. Gewisse Fähigkeiten werden in einer logischen Reihenfolge auf-gebaut, und der Unterricht wird mit bekannten Kinderliedern und gezieltenÜbungen abwechslungsreich gestaltet, um jeweils ein bestimmtes Ziel zu er-reichen – einen neuen Ton zu lernen, einen Bewegungsablauf zu meisternusw. Hier ist tatsächlich keine Komplexität gewünscht, sondern es geht umdas Prinzip, daß die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten eine gewisseAbfolge verlangt. Alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um etwas Neues zulernen, sollen schon vorhanden sein, um den nächsten Schritt so leicht wiemöglich zu machen.
Mit dem fortgeschrittenen Etüdenheft geht man zwar freier um, doch auchin diesem Lehrwerk ist das sinnvolle und konsequente Fortschreiten ganzentscheidend: Hier ist vor allem der langsame Aufbau der gesamten Lippen-muskulatur gefordert. Natürlich hat man für alle Instrumente solche Lehr-werke, und es gibt wahrscheinlich keinen Musiklehrer, der nicht mit Lehrwer-ken dieser Art arbeitet.
Die zentrale Frage ist, ob dieses Beispiel auf das Erlernen einer Fremdspra-che übertragbar ist. Haben wir hier nicht ein Beispiel vor uns, warum man miteinem Lehrbuch arbeitet und wie effektiv es sein kann?
Stellen Sie sich folgendes vor: Ein kleines Kind hört viel Violine, bekommtdie Geige selbst in die Hand, probiert es immer wieder für sich, und dann mitfünf Jahren kann es weitgehend korrekt spielen. Wenn das Kind noch einzweites Instrument hört, z. B. ein Blasinstrument, und dann vielleicht sogareines mit einem völlig anderen Tonsystem – sagen wir eine chinesische Flöte –,kann es die Flöte parallel zur Violine ebenfalls mit fünf Jahren korrekt spielen.Es hat keinen Unterricht gehabt und brauchte wenig Korrektur.
Für jedes Schulorchester wäre dies sehr zu wünschen, aber leider klappt es
370
in der Musik nicht so wie beim Erwerb der Sprache. Nur bei der Sprachefunktioniert es auf diese Weise, weil der Mensch eine angeborene Sprachfä-higkeit hat – jedoch keine angeborene Fähigkeit zum Geigenspiel. Spätestensseit Chomsky12 ist klar, daß die Sprache vom Kind selbsttätig erworben undnicht passiv gelernt wird, und dieses Erwerben beruht auch nicht auf einemdirekten Nachahmen. Ein Kind braucht nur den Kontakt zu Menschen undirgendwelcher Sprache (oder auch mehreren Sprachen), und es wird sie er-werben.13
Spracherwerb und Sprachenlernen
Wir wissen, daß sich der natürliche kindliche Spracherwerb tatsächlich nur inder Kindheit vollziehen kann. Die sogenannte kritische Periode14 stellt eineGrenze dar, und jenseits dieser Grenze vollzieht sich der Spracherwerb bzw.das Sprachenlernen anders. Die Gründe dafür sind vielfältig, hängen jedocheng mit neurologischen, aber auch psychologischen Entwicklungsprozessenzusammen. Allerdings ist die Fähigkeit, die jedem Menschen den Erwerb derMuttersprache ermöglicht, nicht ganz getrennt von der Fähigkeit, Fremdspra-chen zu lernen.
Wir wissen z. B., was es bedeutet, wenn Schüler auch nur ein paar Monateins Ausland gehen. Sie haben neue Begegnungen, machen neue Erfahrungen,und oft tauchen sie fast beiläufig in die Sprache ein und machen bedeutendeFortschritte. Dies gilt für schwache wie für gute Schüler. Im Zusammenhangmit unserem Thema möchte ich zwei Gesichtspunkte aus diesem Prozeß her-vorheben: Einerseits ist der Schüler unmittelbar mit dem realen Leben in allseiner Komplexität und mit vielen neuen Anregungen konfrontiert, und an-dererseits haben seine Fortschritte mit dem kontrollierten Aufbau von sprach-lichen Fähigkeiten wenig zu tun. Von einem geordneten sprachlichen Fort-schreiten kann innerhalb eines Auslandsaufenthalts keine Rede sein; hierherrschen »Inhalte«, aus dem unmittelbaren Leben genommen, vor.
Diese Prozesse spielen sich natürlich nicht nur in Auslandsaufenthalten ab.Forschungsergebnisse aus den letzten zwanzig Jahren zeigen z. T. bedeutendeVorteile der sogenannten Alternativen oder Humanistischen Methoden ge-genüber herkömmlichen Methoden im Hinblick auf Effektivität.15 Diese ver-schiedenen Methoden haben gemeinsam, daß der Erwerbsprozeß gegenüberden bewußten Lernprozessen methodisch hervorgehoben wird. Es wird allesunternommen – z. B. durch sanfte Musik, Entspannungstechniken usw. –, umeinen bewußten Lernvorgang auszuschalten und unmittelbar mit Erwerbs-prozessen arbeiten zu können. Obwohl diese Methoden sicherlich nicht direktauf den Schulunterricht übertragbar sind, können wir m. E. einiges darauslernen.16 Wir können auch vom erfolgreichen Sprachunterricht an vielen skan-
371
dinavischen Schulen lernen, wo seit Jahren verwandte Methoden angewen-det werden.17
Aber auch dort, wo diese alternativen Methoden nicht angewendet wordensind, wird zunehmend diskutiert, ob der Lernerfolg beim traditionellenFremdsprachenunterricht, wenn er eintritt, wegen der Arbeit mit dem Lehr-buch eintritt oder fast unabhängig davon. Lehnhard Liegenhausen schreibt in»Die neueren Sprachen«18: »Die empirischen Befunde deuten darauf hin, daßden Lehrvariablen nur ein ganz bescheidener Anteil am Lernerfolg zukommtbzw. daß man von einer eingeschränkten Lehrbarkeit von Sprache auszuge-hen hat. Auch unter Unterrichtsbedingungen läuft der Erwerb einer Fremd-sprache in hohem Maße als naturwüchsiger Prozeß ab, und naturwüchsigeProzesse erweisen sich gemeinhin gegenüber manipulativen Eingriffen vonaußen als weitgehend resistent. Mit anderen Worten, jeglicher Spracherwerbweist – ganz unabhängig von der jeweiligen Lernumgebung – ein hohes Maßan Eigengesetzlichkeit auf.«
Dieser Gesichtspunkt ist mir besonders wichtig, weil es für mich eine über-zeugende Erklärung wäre, warum in jeder Schulform auch ausgezeichneterSprachunterricht zu finden ist. Von dieser Perspektive aus betrachtet, kommtes hier nicht auf das Lehrbuch an, sondern auf die Qualitäten des Lehrers undbesonders auf seine Sensibilität für die Bedürfnisse des Schülers. Das Lehr-buch spielt in diesem lebendigen Vorgang eine untergeordnete Rolle, wennüberhaupt eine.
Schlußbemerkungen
Abschließend möchte ich zunächst folgende Frage stellen: Was gewinnen wir,wenn wir die Entscheidung treffen, ein Lehrbuch am Anfang eines Schuljah-res auszuteilen und es anschließend konsequent zu benutzen?
1. Wir gewinnen eine Ordnung, eine gewisse Garantie für einen logisch auf-gebauten Lernfortschritt in der Sprache.
2. Wir gewinnen ein bis ins Detail ausgearbeitetes Lernprogramm von Fach-leuten. Wir stehen dadurch mit unserer Unerfahrenheit bzw. unserer Un-vollkommenheit nicht allein da, und wir können die Sicherheit haben, daßwir nichts grundsätzlich falsch oder anders machen.
3. Wir gewinnen eine Transparenz in unserer Arbeit, die für Schüler, Elternund auch für nachfolgende Lehrer eine bedeutende Stütze sein kann.
Zu der Frage nach dem möglichen Gewinn möchte ich die folgende Fragehinzustellen: Was sagen wir gleichzeitig, wenn auch unausgesprochen, aus,wenn wir ein Lehrbuch austeilen und damit arbeiten?
372
1. Wir sagen, daß wir vielen Formen der Komplexität, sprachlich, inhaltlichoder beides zusammen, ausweichen möchten, um einen kontrollierbarenLernvorgang zu gewährleisten. Anders ausgedrückt: daß lernpragmati-sche Gesichtspunkte Vorrang haben vor der inhaltlichen und sprachlichenQualität eines Textes.
2. Wir sagen, daß wir lieber Texte von anderen auswählen lassen, als selbstaktiv für eine bestimmte Klasse in einer bestimmten Situation etwas su-chen zu müssen.
3. Wir sagen, daß die Verbindung von Inhalten des Sprachunterrichts zu denInhalten in anderen Fächern uns weniger wichtig ist, als den eigenen fach-spezifischen Weg zu gehen. Wir nehmen in Kauf, daß der Fremdsprachen-unterricht abgeschnitten wird von dem Waldorflehrplan als Ganzem.
Der Weg mit Lehrbuch ist eindeutig berechenbarer, glatter und mit wenigerHindernissen gepflastert; jedoch plädiere ich grundsätzlich für den steinigenund interessanteren Weg, mit der Erfahrung, daß die Schüler immer wiederbereit sind, diesen risikoreicheren Weg zu betreten. Das Fremde an Fremd-sprachen bleibt erhalten – und bleibt spannend –, gerade weil man auf dasganz Geordnete, das völlig Überschaubare verzichtet. Dies ist manchmal un-bequemer, aber immer lebensnäher; die Schüler lernen vieles dabei – undnicht nur für die Fremdsprache. In seinem grundlegenden Werk zum Fremd-sprachenunterricht an den Waldorfschulen schreibt Johannes Kiersch19: »ImWaldorf-Sprachunterricht geht es nicht um die Übermittlung vorgeprägterBegriffe über die Sprache, nicht um die Tradierung anerkannter Bildungswer-te oder um die bloße Nützlichkeit des Gelernten, sondern vor allem anderenum das freie Auffassen und Durchleben eines bestimmten Bereiches sinnli-cher Realität. Waldorfschüler bemühen sich um die lebendige Sprache in der›Anschaulichkeit‹ ihrer Laut- und Wortbildung und erwerben dabei artisti-sche Sicherheit im Umgang mit Empfindungen. Sie lernen Schweigen, Ab-warten, konzentriertes Hinhören, indem sie dazu angehalten werden, sichden Dunkelheiten und Überraschungen, den Fremdheiten einer Sprache un-befangen auszusetzen … Die Reichhaltigkeit des inneren Lebens, des Seelen-lebens besonders, wird in ihnen durch Unterricht in den Fremdsprachen ge-fordert. Zugleich lernen sie dabei, sich in die Empfindungen anderer einzu-fühlen. Sprachunterricht in der Waldorfschule ist Schulung der Fähigkeit zumenschlicher Anteilnahme, ist ›soziale Pädagogik‹, ist Friedenspädagogiknicht auf dem Wege der Diskussion oder des Informiertwerdens, sonderndurch Ausbildung von Wahrnehmungsfähigkeit.«
Diese Gesichtspunkte und ihre weitergehende Bedeutung sollten wir in denweiteren Betrachtungen der Lehrbuchfrage klar im Blick haben, auch wenndies manchmal in seinem Anspruch unbequem und in seiner Zielsetzunggewagt erscheint.
373
Anmerkungen:
1 Vgl. die Literaturliste in dem Artikel von J. Kiersch in diesem Heft auf S. 2 Harald Weinrich: Wege der Sprachkultur, München 19883 Ibid., S. 2494 Ibid., S. 2505 Hans Hunfeld: Literatur als Sprachlehre: Ansätze eines hermeneutisch orientierten
Fremdsprachenunterrichts, Berlin 19906 Ibid., S. 37-387 Ibid., S. 418 Vgl. Christoph Göpfert (Hrsg.): Jugend und Literatur. Anregungen zum Deutschun-
terricht, Stuttgart 1993, S. 1369 Vgl. Rudolf Steiner: Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches, GA 294, Dornach
61990, S. 129-13510 Egon Saßmannshaus: Früher Anfang auf dem Cello, Band 1, Kassel 197611 Joseph Singer: Embouchure Building for French Horn, Melville, New York 195612 Noam Chomsky: »A Review of B. F. Skinners's Verbal Behavior«, in: Language 35,
1959. In seiner berühmten Kritik an Skinners behavioristischem Ansatz von »Reizund Reaktion«, von »Belohnung und Verstärkung« als Erklärung des kindlichenSpracherwerbs definierte Chomsky den Umfang und die Art und Weise aller psycho-linguistischen Untersuchungen neu. Durch seine sorgfältig durchgeführten Unter-scheidungen zwischen dem, was ein Kind an Sprache gehört hat, und dem, was einKind von der Sprache schon »wissen« muß, um sie anzuwenden, wurden die in allenbehavioristischen Erklärungen vorhandenen Widersprüche offensichtlich. Es gab nieeine Antwort auf Chomskys Kritik. Alle rein behavioristischen Erklärungen des Er-werbs von Sprache waren innerhalb kurzer Zeit nur noch von historischem Interesse.
13 Ich habe die Sprachwahrnehmung und den Spracherwerb als Sinnesvorgang unter-sucht in meinem Buch: Der Sprachsinn – Sprachwahrnehmung als Sinnesvorgang,Stuttgart 1996
14 Die »kritische Periode« für den Erwerb der Sprache ist die Periode, in der ein Kindeine Sprache auf natürliche Weise erwerben kann. Jenseits dieser zeitlichen Grenze istein natürlicher Spracherwerb nicht mehr möglich. Die stärksten Argumente für dasVorhandensein einer kritischen Periode für den Erwerb der Muttersprache liefern dieForschungsergebnisse über Aphasie. Kinder können bis zu einem Alter von ca. 8Jahren auch nach massiven Verletzungen im Sprachzentrum des Gehirns die Mutter-sprache »neu« erlernen ohne anhaltende beeinträchtigende Auswirkungen. Nach derkritischen Periode ist dies nicht mehr möglich. Die genaue Zeitspanne dieser kriti-schen Periode ist umstritten: Im allgemeinen wird sie bis um das 7./8. Lebensjahrangesetzt; einige Forschungsergebnisse deuten jedoch auf einen Zeitpunkt um das10./11. Lebensjahr hin.
15 Vgl. S. D. Krashen/T. D. Terrell: The Natural Approach, Englewood Cliffs 1983, S. 3716 Eine gute Zusammenfassung dieser verschiedenen Methoden für den Fremdspra-
chenunterricht findet sich in Wil Knibbelers Buch: The Explorative-Creative Way –Implantation of a Humanistic Language Teaching Model, Tübingen 1989, S. 7–26
17 Vgl. Lienhard Legenhausen: »Vokabelerwerb im autonomen Lernkontext. Ergebnis-se aus dem dänisch-deutschen Forschungsprojekt LAALE«, in: Die neueren Sprachen93:5 (1994), S. 470
18 Ibid. S. 46819 Johannes Kiersch: Fremdsprachen in der Waldorfschule – Rudolf Steiners Konzept
eines ganzheitlichen Fremdsprachenunterrichts, Stuttgart 1992, S. 30
374
Gudrun Bogdanski
Fremdsprachenmit LehrwerkIm Gegensatz zu meinem Vorredner,Herrn Lutzker, der sich engagiertund mit sorgfältiger Begründung füreinen Fremdsprachenunterrichtohne Lehrbuch eingesetzt hat, vertre-te ich hier ebenso engagiert und, wieich meine, mit guten Gründen denEinsatz eines Lehrbuchs bzw. einesLehrwerks im Fremdsprachenunter-richt.* Zur Begründung meiner posi-tiven Einschätzung der heutigen Ge-neration von Lehrwerken möchte ichIhnen, gestützt auf den Artikel
* Referat auf einer Fortbildungsveranstaltung für Fremdsprachenlehrer an Waldorf-schulen in Nordrhein-Westfalen am 12.2.1997 in der Düsseldorfer Waldorfschule.(Vgl. die Vorbemerkung zum vorangehenden Beitrag von Lutzker.) Von G. Bogdan-ski stammte auch die Idee zu diesem Treffen.
1 Hrsg. von Bausch/Christ/Krumm, UTB, Francke Verlag, Basel 31995, S. 292
»Lehrwerke« von Gerhard Neuner in dem sehr informativen »HandbuchFremdsprachenunterricht«,1 kurz die Entwicklung vom traditionellen Lehr-buch zum heutigen Lehrwerk aufzeigen, um dann die Vorteile heutiger Lehr-werke für einen motivierenden und erfolgreichen Fremdsprachenunterrichtherauszustellen.
Man unterscheidet in der Fachdiskussion zwischen Lehrbuch und Lehr-werk. Ein Lehrbuch enthält alle zum Lernen benötigten Hilfsmittel zwischenzwei Buchdeckeln, während ein Lehrwerk ein ganzes Unterrichtspaket dar-stellt, bestehend aus Lektionsbuch, Schülerarbeitsbuch, Begleitgrammatik,Folien, Kassetten, wobei heute noch Lernsoftware hinzukommt. Lehrbuchbzw. Lehrwerke sind jeweils geprägt von den herrschenden didaktischen Vor-stellungen ihrer Zeit. Wenn Rudolf Steiner sich so entschieden gegen die Ver-wendung von Lehrbüchern im Fremdsprachenunterricht ausspricht, soscheint mir sein kritisches Urteil aus seiner Zeit heraus durchaus verständ-lich, aber heute nicht mehr zutreffend. Die damaligen Lehrbücher für diemodernen Fremdsprachen waren, um als gleichwertig mit den anerkannten
Umschlag eines brandneuen Lehrbuchs
375
Lehrbüchern für Latein und Griechisch zu gelten, allzu stark am Modell deralten Sprachen ausgerichtet. Sie förderten einseitig Kenntnisse in Grammatikund die Fertigkeit der Übersetzung, die in Einzelsätzen ohne Sinnzusammen-hang eingeübt wurde.
In der Zeit, die wir selbst als Schüler oder Sprachlehrer miterlebt haben,sind hauptsächlich drei Generationen von Lehrbüchern bzw. Lehrwerken zuunterscheiden.
In den fünfziger Jahren spiegelten die Lehrbücher die schon Rudolf Steinerbekannte Grammatik-Übersetzungsmethode wieder. Der Sprachunterrichthatte eine kulturkundliche Zielsetzung, er fand fast ausschließlich an höherenSchulen statt. Lesen, Grammatik und Übersetzen kennzeichneten ihn. Dieaktive Beherrschung der Fremdsprache spielte keine Rolle. Die Grammatik-Übersetzungs-Methode wurde dann – etwas modernisiert – zur sog. Vermit-telnden Methode, die auch den aktiven Sprachgebrauch anstrebte.
Mitte der sechziger Jahre wurde der Sprachunterricht nach dem Motto»Englisch für alle« auf die Hauptschule ausgeweitet. Im Mittelpunkt des In-teresses stand die Förderung der Sprachfertigkeit in Alltagssituationen. ImRahmen der audiolingual und audiovisuell, d. h. auf Hören und Sehen hinausgerichteten Unterrichtsmethode entstand das moderne Lehrwerk-Kon-zept, das die inzwischen entwickelten auditiven und visuellen Mittel für denSprachunterricht nutzte. Typisch waren die sog. Strukturübungen zum Ein-schleifen der neuen Formen.
Seit Mitte der siebziger Jahre und bis heute bestimmt der kommunikativeAnsatz die Lehrwerke. Wir sprechen von einer kommunikativen Didaktikund Methodik.
In der Weiterentwicklung der kommunikativen Didaktik rückten in denneunziger Jahren der Schüler als Subjekt des Lernprozesses und der Lernpro-
Im Klett-Verlag gibt es Lehrbücher fur jeden Geschmack, hier in Comic-Manier.
376
zeß selbst in den Mittelpunkt, während früher die Aufmerksamkeit vor allemauf den Lehrer als Steuerer des Lernprozesses und auf den Lernstoff gerichtetwar. Diese sog. Schüler- oder Lernerorientierung wirkt sich in mehrfacherHinsicht auf den Lernprozeß aus:1. Die Lehrerrolle ändert sich. Der Lehrer ist nicht mehr nur Wissensvermitt-
ler, sondern Moderator und Helfer im Lernprozeß. Der Lehrer wird da-durch nicht weniger wichtig, seine Aufgaben werden aber vielseitiger.
2. Die Schülerrolle ändert sich. Der Schüler soll den Lernprozeß aktiv, ja sogareigenverantwortlich mitgestalten.
3. Es geht um einsichtiges und bewußtes Lernen. Zur aktiven Mitwirkung amLernprozeß erwerben sie Lern- und Arbeitstechniken.
4. An die Stelle von konstruierten und inhaltsleeren Lektionstexten treten inden neuen Lehrwerken gehaltvolle Texte, die landeskundlich bedeutungs-voll sind und Jugendliche ansprechen.
5. An die Stelle des einseitig vorherrschenden Frontalunterrichts, bei dem derLehrer nur von vorne her die Schüler unterrichtet, treten wechselnde Sozi-alformen – Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit der Schüler – zum Lehrer-unterricht hinzu.
6. Dementsprechend müssen die Unterrichtsmaterialien so flexibel und offengestaltet sein, daß eine Differenzierung und Individualisierung im Unter-richt ermöglicht wird.
7. Der Sprachunterricht ist handlungsorientiert, d. h. die Schüler lernen, mög-lichst selbständig und spontan mit der Sprache umzugehen, sich nacheigenen Wünschen und Vorstellungen in der Fremdsprache zu äußern.Dazu dienen anregende Aufgaben.
Die Lehrwerke der neunziger Jahre tragen diesen vielfältigen Anforderun-gen Rechnung. Heute ist ein einzelner Autor nicht mehr in der Lage, einLehrwerk zu erstellen, sondern es bedarf eines ganzen Teams von Lehrwerk-autoren mit unterschiedlichen Begabungen – z. B. spannende Lektionstextezu schreiben, landeskundlich aktuelle Informationen zu bieten, vielfältige ab-wechslungsreiche Übungen zu entwerfen, kreative Aufgaben zu erfinden,unterschiedliche Sozialformen einzuplanen, anschauliche und schülerfreund-liche Grammatikübersichten zu erstellen und anhand konkreter Beispiele Ar-beitstechniken zu vermitteln.
Die neuen Lehrwerke bieten im Laufe des mehrjährigen Lehrgangs wichti-ge landeskundliche Informationen über das Zielland bzw. die Zielländer, imFall des Englischen also nicht nur über England, sondern auch über die vielenanderen englischsprachigen Länder in der Welt, im Falle des Französischenüber Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Kanada, Nordafrika und dieüberseeischen französischsprachigen Gebiete. Diese Länder werden mög-lichst realistisch, d. h. mit ihren Vorzügen, aber auch mit ihren Problemen
377
dargestellt. Die Lehrbücher enthalten sprachlich zugängliche authentischeTexte, z. B. Chansons, Gedichte, Geschichten, Szenen, Sprichwörter.
Die einzelnen Lektionen stellen zusammenhängende Unterrichtseinheitenzu einem bestimmten inhaltlichen Thema dar mit dem dazu passenden Wort-schatz und bestimmten grammatischen Elementen, mit einem reichhaltigenÜbungsangebot zum Einüben von Hören, Sprechen, Lesen und Schreibenund im Sinne des ganzheitlichen Lernens mit kreativen und spielerischenAufgaben, die die Schüleraktivität fördern. Ich nenne Ihnen dazu einige Bei-spiele aus dem Lehrwerk »Ensemble« für den Französischunterricht an Real-schulen. Schüler werden dazu aufgefordert, ihre Berufswünsche zu äußernund zu begründen, auf eine Zeitungsannonce zu antworten, aufgrund einesFotos das Porträt einer Person zu erstellen, z. B. eines senegalesischen Stra-ßenhändlers, die eigene Region oder Stadt französischen Austauschpartnernvorzustellen, eine Nachrichtensendung auf einer Kassette zu produzieren, inder Klasse über die Situation von Obdachlosen zu diskutieren.
Neu ist, daß in den Lehrwerken, über die Lektionen verstreut, Lern- undArbeitstechniken schülernah erläutert werden. Es geht dabei um das selbstän-dige Erschließen von Wortschatz, wobei auf Kenntnisse aus der Mutterspra-che und anderen Fremdsprachen hingewiesen wird, um den Umgang mitdem Wörterbuch, um das Entdecken grammatischer Gesetzmäßigkeiten, aberauch um die Förderung des sinnerschließenden Lesens, des Hörverstehensund des selbständigen Verfassens von Schülertexten; z. B. könnten die Schülereiner Klasse eine Schulzeitung auf französisch erstellen. Zu erwähnen ist auchdie besonders schülerfreundliche Gestaltung der Begleitgrammatik. Im Fallevon »Ensemble« ist es die sympathische Figur »Grammaric«, die die Schülerdirekt anspricht und ihnen beim Zurechtfinden hilft. Die Grammatik ist aufdas selbständige Erfassen durch die Schüler ausgerichtet. Sie enthält Hinwei-se auf die Muttersprache und das Englische. Dieses Prinzip gilt auch beimWortschatz, der zudem Sacherklärungen gibt und die neuen Wörter mit kon-kreten Beispielsätzen vorstellt.
Wer einmal an der Erstellung eines Lehrwerks mitgearbeitet hat, weiß, wiemühevoll und zeitaufwendig es ist, ein solch reichhaltiges Lernangebot zuentwerfen und zu erproben. Das übersteigt die Möglichkeiten eines einzelnenLehrers, der durch seine Unterrichtsverpflichtungen in vielen Klassen schoneine hohe Arbeitsleistung erbringen muß. Die anläßlich von Hospitationen anWaldorfschulen vorgelegten, von Lehrern selbst erstellten Unterrichtsmate-rialien konnten vielfach nicht überzeugen. Wenn ich hier aus didaktischenund pragmatischen Gründen so nachdrücklich den Einsatz von Lehrwerkenim Fremdsprachenunterricht empfehle, so ist damit nicht ein gleichmäßigesAbhandeln der einzelnen Lektionen gemeint. Ich sehe es vielmehr als Aufga-be des Lehrers an, das Lehrwerk als Leitmedium einzusetzen und daraus das
378
Passende für seine Lerngruppe auszuwählen. Er selber muß die didaktischenSchwerpunkte setzen, Übungen, die ihm überflüssig erscheinen, auslassen,andere ergänzen, zusätzliche Texte, Aufgaben und Spiele einbeziehen.
Ein modernes Lehrwerkstellt ein ganzesUnterrichtspaket dar,bestehend aus Lektions-buch, Schülerarbeits-buch, Begleitgrammatik,Folien, Kassetten,Lernsoftware.Charakteristisch ist dieVerschmelzung vonBild, Text und Hand-lungsanleitung für denSchüler.
379
Am besten wäre es natürlich, eigene Fremdsprachenlehrwerke für den Un-terricht an Waldorfschulen zu entwickeln. Solange es diese noch nicht gibt,sollten die Fachgruppen an den einzelnen Schulen das vorhandene Lehr-werkangebot sorgfältig prüfen und sich für ein Buch entscheiden.
Als wesentliches Ziel erscheint mir in jedem Fall, daß die Schüler im Fremd-sprachenunterricht gut auf die erweiterten Möglichkeiten in einem zusam-menwachsenden Europa vorbereitet werden und Fremdsprachen mit Freudeund Interesse lernen.
Für mehr traditionellen Geschmack haben waschechte Engländer die Bilder gezeichnet. Hier eineWortschatzübung: Aus dem Bild werden Wörter herausgelöst.
380
Eugen Räber
Französisch an einer Waldorf- undan einer staatlichen Schule
Mit ein Grund für meinen Wechsel an die Rudolf Steiner Schule Zürich vorfünf Jahren waren jahrelange, zunehmend unbefriedigende Erfahrungen aneiner staatlichen Sekundarschule. Der unaufhaltsame Einzug moderner obli-gatorischer Lehrmittel ging mit einer neuen, auch auf die Schule überschwap-penden Welle von technischen Hilfsmitteln einher. Mich aus dieser bedrohli-chen Flut »vorgekauten Sprachenfutters« zu retten war mir Anlaß zum Auf-bruch.*
Im folgenden möchte ich schildern, welche Tendenzen sich im modernenFremdsprachenunterricht, wie ich ihn an einer staatlichen Schule erlebt habe,manifestieren und welche Ziele wir an unserer Schule verfolgen. Meine Über-legungen beziehen sich auf das Französischlehrmittel On y va (7.-9. Schul-jahr), dessen methodischer Duktus und zeitgeistgemäßes Credo in weiten Leh-rer-, Eltern- und Fachkreisen ein breites, zustimmendes Echo gefunden hat.
Das erste, wichtigste Ziel dieses erneuerten Fremdsprachunterrichts bestehtim Beherrschen der gesprochenen Alltagssprache. Die mündliche Kommuni-kationsfähigkeit – sprechen können – soll mit allen Mitteln so weit gefördertwerden, daß der Volksschüler imstande ist, sich in Alltagssituationen korrektverständigen und ausdrücken zu können. Die Autoren des Lehrmittels äu-ßern sich folgendermaßen dazu: »Kommunikation und Interaktion sindSchlagworte aus der Zauberkiste der heutigen Fremdsprachendidaktik. Wirhaben uns bemüht, durch die Auswahl des Stoffes wie durch die Anlage derLektionen diesen Begriffen Inhalt zu geben.« Im Schüler soll durch diese Me-thode folgende Motivation geweckt (suggeriert) werden: »Ich will mich aus-drücken, ich kann mich mit meinen Mitteln ausdrücken.« Der Schüler sollmotiviert werden durch das Erlebnis, daß »sein« Französisch sofort anwend-bar ist.
Das Lehrmittel umfaßt ausgearbeitete Lektionspläne für Lehrer mit skiz-ziertem Ablauf jeder einzelnen Lektion, Schülerlehrbuch und -arbeitsheft mitArbeitsblättern (Strukturübungen mit Lücken), Kassetten oder Tonbänder
* Dieser Beitrag erscheint gleichzeitig in der Sprachlehrerkorrespondenz: FORUM forLanguage Teachers at Rudolf Steiner (Waldorf) Schools 1997. Zuerst veröffentlicht inden Mitteilungen der Rudolf Steiner Schule Zürich. Abdruck mit freundlicher Ge-nehmigung des Autors.
381
mit den Texten, Dialogen und Sprachlaborübungen, Dias oder Stehfilme,Hellraumprojektorfolien mit allen Übungen. Eine große Auswahl an Gele-genheitsstoffen (Lieder, Gedichte, Spiele, Texte aller Art) begleiten die einzel-nen Lektionen so, daß es einem ob der Fülle der Vorschläge die eigenenschöpferischen Möglichkeiten »verschlägt«. Dem Lehrer wird also ein vielfäl-tig aufgegliedertes Stoffprogramm vorgesetzt, gleichsam Hauptmahlzeiten(in Lektionen verpackte Konversationen, Kurztexte und Grammatik) mitreichlichen Garnituren. Selbstverständlich, um beim Vergleich zu bleiben,müssen Lehrer wie Schüler sich der Hauptspeise bedienen, und sie läßt oftkeinen Appetit mehr übrig auf anderes. Das in den Lektionen aufbereiteteGrundwissen, das anschließende Mittelschulen verlangen, ist in seinem Um-fang nicht gering, so daß zügig vorangeschritten werden muß, wobei derNotendruck gute Dienste leistet. Das Fach kann weniger begabten Schülernzum Greuel werden; und der Lehrer, der die Sprache gut beherrscht und aucheiniges pädagogisches Geschick mitbringt, fühlt sich durch ein solcherart ge-staltetes Lehrmittel gegängelt, bevormundet. Nebenbei: Waldorfschüler, diesich mit diesem Buch auf Mittelschuleintrittsprüfungen vorbereiten, findendie Übungen schrecklich einfältig.
Es wird klar, daß Effizienz des Unterrichts, meßbare und sofort ersichtlicheResultate in bezug auf das Beherrschen der Sprache in der heutigen ZeitVorrang haben. Dies ist weiter nicht erstaunlich, denn die Erwartungshal-tung, die in allen Bereichen des modernen Lebens vorherrscht, soll auch in derSchule wirksam werden: immer schneller, auf immer direkterem, bequeme-rem Weg zu einem Ziel zu gelangen. Wenn manier la langue avec plaisir zumwichtigsten Ziel wird, so steckt in diesem Anspruch auch der reine Zweck desSprachenerlernens nach heutiger Auffassung, nämlich der reibungslose Aus-tausch von Informationen zwischen Gespächspartnern. Reduziert auf dieseneinfachen Nenner, muß Sprachenvermittlung an Schüler auf nichts Rücksichtnehmen, kann sie alle beliebigen technischen Mittel einsetzen. In den erstenUnterrichtsjahren an der staatlichen Schule (ab 7. bzw. 5. Schuljahr) werdenSprachstrukturen für Konversationen eingefuchst, meistens vom Tonband.Unvoreingenommene Beobachter wie Waldorfschüler erkennen rasch an ih-ren Kameraden aus der staatlichen Schule die verblüffende, oft schlagfertigemündliche Beherrschung anspruchsloser Gespräche in der Fremdsprache. Dakönnte Neid aufkommen, könnten aus Unkenntnis unserer anderen Zielset-zung Vorwürfe erwachsen.
Nun, der Fremdsprachunterricht an Steiner Schulen hat weniger vor-dergründige Ansätze. Ausgangspunkt seiner Bemühungen ist wie in allenFächern der Schüler selbst als ein in der Auseinandersetzung mit dem Stoffesich individuell entwickelndes, aber doch altersgemäßen Gesetzen folgendesWesen (vgl. Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde). Der Stoff hat die-
382
nende Funktion, kann aber durch seinen Gehalt die menschlichen Anlagen bisin die Tiefe fördern. Aus diesem Grund gestalten Fremdsprachenlehrer anWaldorfschulen ihren Unterricht in der Regel nicht nach einem bestimmtenLehrbuch, sondern wählen frei nach ihrem Ermessen unter Berücksichtigungder hilfreichen, menschenkundlich begründeten Hinweise Rudolf Steinersfremdsprachliche Texte, deren Inhalte bildend und wesentlich sind, zum Bei-spiel Schriften aus der anerkannten Literatur, in mittleren Klassen manchmalin vereinfachter Textsprache (ausgenommen Gedichte), in den oberen Klassenjedoch vorzugsweise im Originaltext. Literarische Werke werden somit be-wußt früh an den jungen Menschen herangetragen, nicht daß er sie Wort fürWort zu verstehen brauchte, sondern damit er durch die Erarbeitung desInhalts und der Form den Sprachgenius keimhaft erleben kann. Einschlägesolcher Art werden später im seelisch-geistigen Wesen des Menschen wirk-sam werden.
Ab der vierten Klasse wird mit einfachster Grammatik begonnen (Bewußt-machung sprachlicher Gesetzmäßigkeit); sie wird den Unterricht bis in dieobersten Klassen begleiten, das Verständnis für die Sprache unterstützendund fördernd, dem Aufnahmevermögen und dem Entwicklungsstand derjeweiligen Klasse angepaßt.
Warum kein Lehrbuch, in dem doch portionenweise vom Einfachen zumSchwierigeren logisch aufgebaut wird? Lektüren oder Lektionstexte sind dortfast immer zurechtgeschustert, abgestimmt auf die Schritte, die im grammati-kalischen Aufbau aufeinanderfolgen, somit nur bedingt natürlich, geschwei-ge denn dichterisch wertvoll. Die Aufgliederung des Stoffes in kleine Schritteläßt dem Lehrer wenig Spielraum für kreativen Umgang mit dem sprachli-chen Gut. Die beste Voraussetzung für einen gedeihlichen Sprachunterrichthat derjenige, welcher die Sprache so weit beherrscht, daß er sich spielerischin ihr bewegen, sie mit seinem ganzen Wesen durchdringen und künstlerischvermitteln kann, jederzeit geistesgegenwärtig die pädagogische Situation er-fassend. Der be-geisterte Lehrer vermittelt auch auf ganz natürliche Weise denGeist der Sprache, der unmittelbar tiefe seelische Schichten des Schülers an-spricht und sie in »Schwingung« versetzt. Je nach Temperament, Fähigkeitund Willenseinsatz verbindet er sich mit der Sprache.
Unser großes Anliegen ist es deshalb, den Unterricht von Mensch zuMensch zu gestalten und nicht, der perfekten Aussprache und Intonationzuliebe, mittels Tonbandkonserven. Die beliebig abhörbare Stimme ist neutra-lisiert, weil die Person durch den Apparat ersetzt ist. Ja, das Individuelle wirdabsichtlich ausgeschaltet. Denn was zählt, ist die rein kommunikative Bedeu-tung des Gesprochenen. Die Qualität der Sprache aber lebt vom ganzen We-sen des Unterrichtenden und dessen individueller Ausgestaltung der Stim-me, in der ein unendlicher Reichtum an Empfindungen und Willensimpulsen
383
mitschwingt, welche im empfindsamen Schüler (Hörer, Gesprächspartner)differenzierte Anteilnahme hervorrufen.
Der Einseitigkeit des modernen Sprachenerwerbs will die Waldorfschuleeine persönliche, menschliche, menschenbezogene Art der Vermittlung ent-gegensetzen; das Individuelle des Lernenden und des Lehrers sind der frucht-bare Nährboden für das Schöpferische, Menschenbildende, das sich im Unter-richt entfalten soll. Es ist hinlänglich bekannt, daß schöpferisch erarbeitetesKönnen einen tief verwurzelten Bezug zwischen Mensch und Sache (Sprache)herstellt. Ein Schüler, der vielseitig und lebendig, ohne Sachzwänge (genorm-tes Lehrbuch) an die Sprache herangeführt wird, kann vielleicht nicht sofortabschätzen, welches die Vorzüge gegenüber der méthode rapide et efficacesind. Bei der praktischen Anwendung im Sprachgebiet aber wird sich erwei-sen, welche Würzelchen und Wurzeln einst das junge Sprachpflänzchen inwelchem Nährboden gefaßt hat. Die im ganzen Wesen veranlagte, verankerteSprache wird schöner zur Reife kommen als die im intellektuellen Bereichangesiedelte, drillmäßig eingeübte Konversation. Um eines aber wird auchder Waldorfschüler nicht herumkommen, nämlich um die regelmäßige, zäheÜbarbeit, die für ein kontinuierliches Vorwärtskommen in der Sprache erfor-derlich ist. Wenn es dem Sprachlehrer gelingt, in seinem Unterricht auf alleSeelenkräfte der Schüler anregend und bildend zu wirken, wird er durch dieFremdsprache einen Beitrag zur harmonischen Entwicklung der menschli-chen Fähigkeiten leisten. Wenn es ihm gelingt, in seinem Unterricht nebstliterarischen Werken auch den besonderen Charakter des Volkes und die lan-deskundlichen Eigenheiten zu vermitteln, trägt er bei zu einem erweitertenMenschheitsverständnis.
Autoren-Notizen:
• Johannes Kiersch war Fremdsprachenlehrer an der Bochumer Waldorfschule und lehrt am Insti-tut für Waldorfpädagogik (Lehrerseminar) in Witten-Annen. Zahlreiche Publikationen zur Wal-dorfpädagogik im allgemeinen und zum Fremdsprachenunterricht im besonderen, z. B.: Fragen andie Waldorfschule, Flensburg 1991; Fremdsprachen in der Waldorfschule – Rudolf Steiners Kon-zept eines ganzheitlichen Fremdsprachenunterrichts, Stuttgart 1992.• Peter Lutzker, gebürtiger Amerikaner, ist Englischlehrer an der Rudolf Steiner Schule Düsseldorfund Autor des Buches: Der Sprachsinn – Sprachwahrnehmung als Sinnesvorgang, Stuttgart 1996.• Gudrun Bogdanski war Gymnasiallehrerin für Italienisch und Französisch, dann Fachleiterin amStudienseminar Münster, seit 1986 Fachdezernentin für Französisch bei der Bezirksregierung Düs-seldorf und hat an dem Italienisch-Lehrwerk »Buongiorno« mitgearbeitet.• Eugen Räber war Fremdsprachenlehrer zunächst an einer staatlichen Sekundarschule in derSchweiz, dann an der Rudolf-Steiner-Schule Plattenstraße in Zürich.• Christoph Jaffke ist Fremdsprachenlehrer an der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stutt-gart und Dozent am Stuttgarter Waldorflehrerseminar sowie Lehrbeauftragter an der UniversitätAugsburg. In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der FreienWaldorfschulen gibt er die Reihe »Materialien für den Fremdsprachenunterricht an Freien Waldorf-schulen« heraus. Buch: Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe. Seine Begründung und Pra-xis in der Waldorfpädagogik, Weinheim 21996.
384
Christoph Jaffke
Periodischer SprachunterrichtDie Gegebenheiten des Stundenplans einer Waldorfschule führen nur in Aus-nahmefällen dazu, daß die Sprachstunden in einem gesunden Rhythmus aufdie einzelnen Wochentage verteilt werden können. Sinnvollerweise lägen dieStunden der einen Sprache am Montag, Mittwoch und Freitag, die der ande-ren am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Viel häufiger führen Sachzwängedazu, daß in einer Klasse zwei Sprachstunden am selben Tag unmittelbaraufeinander folgen und daß die Stunden in einer Sprache beispielsweise amMontag, Donnerstag und Samstag liegen. Bei so ungleicher Verteilung imWochenverlauf kann natürlich von Rhythmus keine Rede sein.
Um dieses Problem zu lösen, haben verschiedene Waldorfschulen vor eini-gen Jahren begonnen, den Sprachunterricht zeitlich neu zu gliedern. JederWaldorflehrer weiß, wie positiv sich die tägliche Beschäftigung mit einemUnterrichtsgegenstand im Hauptunterricht auswirkt. Jahrzehntelange Erfah-rungen haben uns gelehrt, daß das, was an einem Tag behandelt wurde, tagsdarauf – dadurch daß es »durch die Nacht gegangen« ist – den Schülern inganz anderer Weise zur Verfügung steht, als wenn es erst wieder nach einemAbstand von mehreren Tagen im Unterricht aufgegriffen werden kann.
Aus solchen Überlegungen heraus wurde an einer ganzen Reihe unsererSchulen der Sprachunterricht so verteilt, daß in einzelnen Klassen einige Wo-chen lang täglich nur die eine Fremdsprache unterrichtet wird, dann für diegleiche Anzahl von Wochen die andere Sprache. Was die Länge dieser »Peri-oden« betrifft, so haben verschiedene Schulen versucht, durch die Praxis her-auszufinden, welche Länge die optimale ist. Einerseits soll eine gewisse Ver-tiefung erreicht werden, weshalb diese Perioden nicht zu kurz sein dürfen.Andererseits dürfen die Zeiten, in denen die andere Sprache ruht, auch nichtzu lang sein. Es dürfte sehr schwer sein, hier bald zu einer objektiven Beurtei-lung zu kommen. An verschiedenen Schulen hat sich verschiedenes bewährt.(Das Forum für Sprachlehrer 1997 wird eine Vielzahl von Erfahrungsberich-ten aus den Schulen wiedergeben, die mit dem neuen System arbeiten.)
Bisher haben schätzungsweise 30 Prozent der deutschen Waldorfschulenperiodischen Sprachunterricht eingeführt, hauptsächlich in der Mittelstufe.Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, zeigt sich bei der überwältigendenMehrheit der Schulen große Zufriedenheit bei Lehrern, Eltern und Schülern:Die Schüler bekommen eine intensivere Beziehung zu der jeweils unterrichte-ten Sprache, der Unterricht wird wesentlich verbindlicher. Das zeigt sich ineiner besseren Lehrer-Schüler-Beziehung sowie in einer deutlichen Steige-
385
rung der Lernergebnisse. Viele Eltern berichten, daß ihre Kinder durch dieBeschränkung auf jeweils eine Sprache zu Hause ruhiger und konzentriertererscheinen.
Schließlich hat sich mancherorts auch ein gangbarer Weg für diejenigenSchüler ergeben, welche in der oberen Mittelstufe mit Mühe eine Sprachebewältigen, mit zwei Sprachen aber völlig überfordert sind. Sie könnendurchgehend am Englischunterricht teilnehmen und haben endlich wiederErfolgserlebnisse. Zur Abrundung seien einige Lehrerstimmen zitiert:
»Wir konnten tatsächlich tiefer in den Stoff eintauchen. Noch nie habe ich dieUmstände der Befreiung der Sklaven in Amerika so ausführlich und mit so-viel lebhaften Beiträgen der Schüler unterrichten können. In der 11. Klassegelang es mir zum ersten Mal, die Geschichte des englischen Theaters bisShakespeare nicht nur durch Referate zu behandeln, sondern auch über früheTheaterformen wirklich zu lesen und diese zu besprechen. Insgesamt schie-nen die Schüler am Unterricht interessierter teilzunehmen, das führte selbst-verständlich auch zu disziplinierterem Verhalten.«
»Für den reinen Sprachlehrer ist vorteilhaft, daß sich die sechs bis siebenKlassen, in welchen er unterrichtet, nun auf zwei Wochen verteilen, in wel-chen er sich nur auf drei bis vier Klassen einstellen muß. Wer als Fachlehrer im45-Minuten-Takt von Klasse 1 in Klasse 7, von Klasse 7 in Klasse 4, von Klasse4 in Klasse 12 geeilt ist, weiß es zu schätzen, wenn er sich innerhalb einerWoche mit der halben Schülerzahl zu beschäftigen hat. Das Lernen von Tag zuTag bringt auch für die Schüler Ruhe und Konzentration in die Arbeit. EinWochenziel kann angestrebt werden, und in der ›Ruhewoche‹ setzt sich derLernstoff deutlich wahrnehmbar.«
»Unsere Erfahrungen im Bereich der Unterstufe sind eher positiv. Man lerntneue Klassen schneller kennen und kann in kurzer Zeit verhältnismäßig vielvermitteln. Zwar sind erhöhte Anforderungen an variantenreichen Unterrichtgestellt, aber man kann auch eine höhere Intimität und Intensität erzielen.Diese reicht dann zusammen mit den großen Erinnerungskräften dieser Al-tersstufe dazu aus, in der folgenden Periode einmal Gelerntes schnell wiederhervorzuholen, um daran weiterarbeiten zu können.«
»In der sechsten Klasse erwies sich der periodische Unterricht sehr schnellals vorteilhafter gegenüber dem bisherigen Regelunterricht, in dem die zweiFremdsprachen parallel unterrichtet werden. Die Schüler konnten sich hierauf eine Sprache konzentrieren, durch die häufige Begegnung tauchten siebesser ein. Für die Schwächeren war es außerdem eine Erleichterung, Haus-aufgaben nur in einer Sprache erledigen zu müssen. Für die Beziehung zwi-schen Lehrer und Schülern empfand ich diesen Unterricht als positiv. Durchdie tägliche Begegnung entstand eine Vertrautheit, die der Fachlehrer sonst
386
selten erleben kann. Auffallend war, daß Schüler der sechsten Klasse nacheiner siebenwöchigen Unterrichtspause, bedingt durch eine vierwöchigeEpoche in der anderen Sprache und zusätzlich drei Wochen Osterferien, mü-helos-selbstverständlich und frisch im Unterricht mitmachten, so, als hättenwir uns vorgestern gesehen. Alles war wieder da.«
»Die Geschlossenheit des neuen Konzepts wirkt sich fruchtbar auf dieSprachvermittlung aus. Die andersgearteten Hausaufgaben, die nun von Tagzu Tag gegeben und korrigiert werden müssen, oder der generell größereArbeitsanfall für die Lehrer werden gern in Kauf genommen. Besonders her-vorzuheben ist die Fülle an positiven Urteilen und die stärkere Motivationvon Schülern und Lehrern, die dem Unterricht natürlich zugute kommt. Anunserer Schule möchte kein Sprachlehrer zur alten Unterrichtsform zurück-kehren.«
»Die Schüler können den Unterrichtsstoff gründlicher aufnehmen undwährend der ›Pause‹, d. h. in den Wochen, in denen sie an der anderen Spra-che arbeiten, das Aufgenommene in tiefere Schichten des Gedächtnisses ab-sinken lassen. Die tägliche Erledigung von Hausaufgaben für (nur) eine Spra-che wird zur selbstverständlichen Gewohnheit. Der Lehrer kann sich auf einekleinere Zahl von Schülern konzentrieren, mit denen er dafür täglich zu tunhat. Eine große Erleichterung bedeutet der periodische Sprachunterricht fürdas Problem der Einsprachler (speziell in der Mittelstufe): Ist es möglich, diebeiden Sprachen im Stundenplan einer Klasse parallel zu legen, so könnensich schwächere Schüler auf eine Sprache beschränken, in dieser aber tatsäch-lich Boden gewinnen, da sie alles zweimal durcharbeiten.«
Auf Initiative von Georg Kniebe haben im Rahmen der Pädagogischen For-schungsstelle beim Bund der Waldorfschulen bisher zwei Kolloquien zur Fra-ge des »epochalen Unterrichts« stattgefunden. Dabei konnte – für den peri-odischen Sprachunterricht – noch keine endgültige Antwort auf die grund-sätzlichen Fragen gefunden werden, die sich notwendigerweise an eine soeingreifende Maßnahme knüpfen. – Auch wenn die theoretische Begründungnoch aussteht, werden die zahlreichen Schulen, die die wohltuenden pädago-gischen Auswirkungen des periodischen Sprachunterrichts über Jahre erfahrenhaben, nicht wieder darauf verzichten wollen.
Im Klett Verlag erschienen:Christoph Jaffke/Magda Maier
F r e m d s p r a c h e n f ü r a l l e K i n d e rErfahrungen der Waldorfschule mit dem Frühbeginn
DM 29,– 120 Seiten ISBN: 3-12-58641
387
Karl-Ludwig Hepp
Löwenzahn und Wiesen-schaumkrautEine vergleichende Pflanzenbetrachtung
Während eines Spaziergangs im Frühling streifen unsere Blicke immer wie-der über die blumenbunten Wiesen, welche die Straße säumen. Deutlich er-kennen wir in manchen Gegenden vor allem zwei dominierende Blütenfar-ben, die das frische Grün überziehen: ein sehr intensives Gelb und ein ausge-sprochen zartes Violett, das man je nach Lichteinfall auch als weißliches Rosaempfinden kann. Wie ein flockiger Schaumteppich überzieht letzteres dieWiesen, dem leuchtenden Gelb nicht nur mengen-, sondern auch wirkungs-mäßig gleichwertig. Die Rede ist von der Sonnenwurzel und dem Storchen-kraut, besser bekannt als Gemeiner Löwenzahn und Wiesenschaumkraut.
Gleichsam Hand in Hand geht dieses seltsame Paar über unsere Wiesentrotz offensichtlicher Gegensätze, wie sie vollkommener nicht sein können.Der Volksmund sagt zum Wiesenschaumkraut »Storchenkraut«, damit sehrschön eine Grundgeste des Gewächses ausdrückend, denn es scheint tatsäch-lich wie ein Storch durch das Gras zu stelzen, das Schwergewicht seines We-sens auf die Blühzone gerichtet und damit über alle anderen Kräuter undBlumen hinauswachsend. Ein solches Schwergewicht hat der Löwenzahn inseiner Blüte zwar auch, aber seine größte Kraft legt er in den Ausbau seinermächtigen Pfahlwurzel, welche die steinigsten Untergründe zu durchdringenvermag. Das Storchenkraut verhält sich in dieser Beziehung ganz polar. Esläßt seine Primärwurzel bald völlig absterben und bewurzelt sich sekundärvom Sproß her neu, indem es im Kreis herum zahlreiche feine Würzelchenbildet, die der Pflanze durch ihre Vielzahl doch wieder einen sicheren Halt imErdboden ermöglichen. Der Löwenzahn entwickelt eigentlich überhaupt kei-nen Stengel. Die Blüte – bzw. deren 100 bis 200 Einzelblüten – würde unmittel-bar auf dem extrem gestauchten Sproß aufsitzen, wenn der enorm sich entfal-tende Blütenkorbstiel nicht wäre, der das Körbchen bis zur Höhe der Stor-chenkrautblüten hinaufhebt. Das geschieht in solcher Eile, daß man kaumnoch von Wachsen sprechen kann, viel eher von Emporschießen! Das Stor-chenkraut entwickelt polar dazu einen zwar hohlen, aber kräftigen, ordentli-chen Stengel, aus dem nach allen Seiten die gestielten Blüten seitlich heraus-wachsen und bald auch fruchten, während die Stengelspitze immer noch
388
weiterwächst und neue Blüten bil-det. Diese ganze Entwicklung desStorchenkrauts findet im Frühlingstatt. Dagegen entwickelt der Son-nenwirbel (wie der Löwenzahn oderdie Sonnenwurzel auch noch ge-nannt wird) schon im Herbst ganznahe am Boden seine vielen Blüten-knospen, um sie vor Wintereinbruchmit Hilfe seiner wundersamen Zug-wurzel etwas ins schützende Erd-reich zurückzuziehen. Überhauptsind seine Wurzeln von einer schierunbezwingbaren Wachstums- undRegenerationskraft. Aus einem abge-
rissenen Wurzelstückchen können sich gleich mehrere neue Blattrosetten bil-den. Die Löwenzahnblüten widerlegen auf ihre Art Darwins Nutz- undZwecktheorie, indem sie eine Überfülle von Pollen erzeugen: Für die Bienensind sie um diese Jahreszeit oftmals die Lebensrettung schlechthin. Für sichselbst brauchten die Löwenzähne diesen Aufwand gar nicht, denn sie entwik-keln ihren Samen auch ohne Bestäubung. Polar dazu verhält sich wiederumdas Wiesenschaumkraut. Es ist selbststeril und braucht deshalb unbedingt diePollen anderer Artgenossen, um Samen bilden zu können.
Sowohl Löwenzahn als auch Wiesenschaumkraut sind Rosettenpflanzen.Während aber das Rosettenblatt des Löwenzahns schon an Tierformen erin-nert (daher sein Name), bildet das Wiesenschaumkraut zunächst tropfenför-mige Blätter aus, die nach der Blüte hin immer strahliger und nadelbaumarti-ger werden. Der Löwenzahn verzichtet auf eine solche Umwandlung seinerBlätter und ähnelt darin mehr den Laubbäumen.
Geschmacklich ist zu bemerken, daß der Löwenzahn hauptsächlich bitterschmeckt, das Storchenkraut dagegen stark nach Senföl. Interessant ist auch,daß beiden Pflanzen in den oberirdischen Teilen eine gewisse Hinfälligkeitbeschieden ist, so daß wir sie selten zusammen in einer Blumenvase antreffen.
Was kann uns Pädagogen eine solche vergleichende Pflanzenbetrachtungbringen? Zunächst führt sie uns zu dem Begriff der Polarität, wie ihn Goetheals Leitfaden in seiner Naturforschung entwickelt hat. Er wurde angeregtdurch F. W. J. Schelling, dem die allgemeine Polarität als Prinzip aller Naturer-klärung ebenso notwendig erschien wie der Begriff der Natur selbst. DasGesetz der Polarität bezeichnete er als allgemeines Weltgesetz; mit der er-scheinenden Wirklichkeit seien immer schon entgegengesetzte Kräfte gege-ben – ohne sie seien keine lebendigen Bewegungen möglich. Schelling führte
389
1797 den Begriff Polarität in die philosophische Fachsprache ein. Erstmals solldieser Ausdruck 1670 bei Robert Boyle aufgetaucht sein; Goethe benutzte ihnseit 1792 gelegentlich. Für ihn ist Polarität ein letzter, nicht hinterschreitbarerSachverhalt.
Rudolf Steiner führt am 22. September 1918 (GA 184, 9. Kap., S. 182) dazuaus: »Und wird man einmal die Naturwissenschaft mehr in die richtigenBahnen der Goetheschen Weltanschauung leiten, dann wird auch die Natur-wissenschaft noch mehr Goetheanismus sein, als sie es heute sein kann, wo siees fast gar nicht ist. Dann wird das Gesetz der Polarität in der ganzen Naturals das Grundgesetz erkannt werden, wie es im Grunde genommen schonfiguriert hat in den alten Mysterien aus atavistischer [d. h. hellsichtiger] For-schung heraus. In den alten Mysterien baute man alles auf die Erkenntnis derPolarität in der Welt.«
Wacholder Tanne
Kiefer
EibeLärche
Fichte
In seinen Untersu-chungen zu einer wirk-lichkeitsgemäßen Far-benlehre stieß Goetheauf die Möglichkeit, diedie Farbenwelt durch-ziehenden Gesetze sichaussprechen zu lassendurch eine Anordnungvon drei Gegensatzpaa-ren (Abb. S. 388): DerBegriff der Polarität ent-wickelt sich weiter zu ei-nem dreifachen.
Dies kann nun dazuanregen, es versuchs-weise als eine ArtSchlüssel auf andere Na-turbereiche anzuwen-den. Sehr schön lassensich etwa die wichtig-sten waldbildenden Na-delhölzer unserer Brei-ten auf diese Weisegleichsam spielerisch ineine Anordnung brin-gen, die natürlich dannauf ihre Aussagemög-
390
lichkeiten hin näher unter-sucht werden müßte.
Vielleicht läßt sich auch et-was gewinnen durch eine sol-che Auslegung von Blättern ei-niger unserer waldbildendenLaubbäume (Abb. S. 392).
Der Begriff der dreifaltigenPolarität reichert sich immermehr an. Wir können bei denFarben ein Gegensatzpaar un-terscheiden, das die größtmög-lichste Gegensatzspannungzum Ausdruck bringt: Licht-nächste Farbe Gelb – finsternis-nächste Farbe Blau.
Ein ähnlich extremer Gegen-satz besteht im Reich der Bäu-me zwischen der Umraumof-fenheit der Birke und der Ei-genraumbildung der Eiche(Abb. S. 392).
Ein weiteres Gegensatzpaarbilden der HochgebirgsbaumLärche und die tiefebenen-lie-bende Kiefer.
Dann finden wir ein Paar, das in einer bestimmten Hinsicht ganz nah beiein-ander steht: Purpur und Grün haben fast die gleiche Eigenhelligkeit. Werkennt den Unterschied zwischen Tanne und Fichte, zwischen Rot- und Weiß-buche?
Dazwischen liegt ein Gegensatzpaar, das die Spannungen harmonisch-the-rapeutisch auszupendeln versucht: Orangerot – Himmelblau. Damit könnteman zwei Paare von Hölzern vergleichen: Eibe und Wacholder, deren Früchtemedizinisch von Bedeutung sind, und die beiden Frühblütler Weide und Ha-sel, wobei die Pollen der Weide durch Insekten weitergetragen werden, wäh-rend der Haselstrauch durch den Wind bestäubt wird. Bei der Verbreitung derFrüchte ist es umgekehrt: Die kleinen Samen der Salweide werden vom Windverfrachtet, die Nüsse der Hasel werden von Tieren geerntet und verschleppt.
Durch solche Übungen innerlich in Bewegung gebracht, kann uns ein Buchwie von Zeylmans van Emmichoven über »Die menschliche Seele« (1946) in
Der Löwnzahn wird im Volksmund auch Sonnen-wirbel oder Sonnenwurzel genannt. Seine mächtigePfahlwurzel vermag die steinigsten Untergründe zudurchdringen.
391
lebendiger Weise erste Schritte in eine goetheanistische Psychologie weisen.Zeylmans van Emmichoven greift den an der Pflanze entwickelten und an derFarbenlehre gesteigerten dreifachen Polaritätenbegriff Goethes auf, indem erdas Gebiet der menschlichen Seele zu durchdringen und zu umfassen ver-sucht mit Hilfe der drei Gegensatzpaare: Wahrnehmen und Handeln, Vorstel-len und Begehren, Urteilen und Fühlen. Dabei kommt es wohl darauf an, indie innere Differenziertheit dieser drei Polaritäten fühlend vorzudringen,sonst bleibt es abstrakt und wirklichkeitsfern.
Die vorliegende Skizze kann natürlich nur als allererste Anregung dienen,den gegebenen Denkanstoß selber beobachtend zu erproben.
Quellen- und Bildnachweis:Einige botanische Details wurden aus Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuro-pa, Berlin/Hamburg 1975, entnommen. Zu Goethe vgl. Alfred Schmidt: Goe-thes herrlich leuchtende Natur, München/Wien 1984, S. 197.Das Bild des Löwenzahns wurde im Gartenbau-Unterricht von einem Schülerder Kaspar-Hauser-Schule für Erziehungshilfe in Schopfheim-Schweigmattgemalt, das Bild des Wiesen-schaumkrauts von WurtilaHepp. Die einzelnen Baum-und Blattzeichnungen stam-men von Thomas Göbel (Mit-teilungen des Carl GustavCarus-Instituts in Niefern-Öschelbronn), Wolfgang Schad(in: Goetheanistische Natur-wissenschaft, 1982) und ausLexika.
Karl-Ludwig Hepp lebt und arbeitet inder Michael-Gemeinschaft in Schopf-heim-Schweigmatt am Südrand desSchwarzwalds als Erzieher in einemHeim für verhaltensauffällige Kinderund Jugendliche und unterrichtet da-neben in der angeschlossenen Kaspar-Hauser-Schule, einer Sonderschule fürErziehungshilfe, in den Fächern Gar-tenbau und Religion.
Das Wiesenschaumkraut heißt auchStorchenkraut.
393
AUS DER SCHULBEWEGUNG
Waldorfschulen in Australien, Manila und Thailand
Den Einladungen folgend, verbrachte ichmein Freijahr 1995/96 in ferneren Regio-nen, um mit Erwachsenen an den Grund-lagen der Waldorfpädagogik zu arbeiten.Das geschah zunächst in Perth in WestAustralien, wo die Waldorfschule jetzt biszur 10. Klasse ausgebaut ist. Um den Leh-rernachwuchs kümmert sich das »SophiaCentre for Anthroposophical Studies«, andem ich einige Monate unterrichtete. Eini-ge Schulen suchen dringend neue Lehrer,ebenso die in Gründung begriffene Eury-thmieschule. Trotz des Lehrermangelswurde in Perth gerade die zweite Schulegegründet. Zwei Autostunden südlichvon Perth, in idyllischer Natur, befindetsich die »Yallingup-School« mit Kinder-garten und den Klassen eins/zwei unddrei/vier. Diese Schule hat einen gutenKontakt zu den Aborigines der Region.Ganz im Süden, an der Küste des Südpo-lar-Meeres liegt in Denmark die »GoldenHill-Steiner-School« mit Klassen eins bisacht und einem Kindergarten.
Die nächste Station meiner Reise wardie Mount Barker School in der Nähe vonAdelaide. Diese Schule braucht keineStaatsexamen durchzuführen, ihre Schü-ler dürfen mit dem Waldorfabschluß stu-dieren, wenn die Lehrer ihnen dies be-scheinigen. Das hat einen sehr positivenEffekt auf die ganze Situation, da man un-beeinflußte Waldorfpädagogik hat. Vonhier ging es zur »Eucarima School« süd-lich von Sydney, dann zum »Parcifal Col-lege« in Sydney, dem dortigen Lehrerse-
minar, danach zur »Samford-Valley-School« in Brisbaine und schließlich nachArmidale zur »University of New Eng-land« und der Waldorfschule in diesemOrt, die bis zur siebten Klasse geht. An derUniversität ist es möglich, Waldorfpäd-agogik zu studieren, auch im Fernstudi-um. Das Fach wird dort von Paul Rubensvertreten, einem erfahrenen Waldorfex-perten. Die Ausbildung wird zusammenmit dem »Parcifal College« geleistet. InArmidale wird ebenfalls ein »Zentrum fürAnthroposophische Initiativen« aufge-baut. Nördlich von Brisbaine liegt Noosa,wo sich gerade eine Waldorfschule imAufbau befindet; das Gelände mit den er-sten Bauten wurde gestiftet.
Die nächste Station war Manila, wo ichdrei Monate Kurse gab, um damit der er-sten Waldorfschule der Philippinen ausden Startlöchern zu helfen. Seit einigenJahren arbeitete eine hochmotivierteGruppe von Menschen auf dieses Ziel hin.Vier ausgebildete Lehrerinnen betreutenseit zwei Jahren den Kindergarten, und imJuni 1996 begann man mit der ersten Klas-se in einer schön hergerichteten Garage;auf demselben Gelände ist auch der Kin-dergarten untergebracht. An dem ganztä-gigen Kurs nahmen über 25 Menschen –aus der Wirtschaft, Hochschullehrer, Leh-rer, Studenten, Ärzte, Sozialarbeiter, The-rapeuten, katholische Schwestern und El-tern – teil.
Die Initiative »Kerngruppe« hat aus-gezeichnete Beziehungen zu den Medien
394
Das Oberstufen-gebäude derWaldorf-schule in Perth
und einflußreichen Persönlichkeiten; siefindet viel Gehör in der pädagogischenFachwelt, da die Unzufriedenheit mitdem Erziehungssystem allgemein zu-nimmt. Es ist anzunehmen, daß dieUNESCO-Waldorf-Ausstellung weiteresInteresse wecken wird.
Der letzte Reisestation war Bangkok/Thailand, wohin mich Dr. Panosot zu eini-gen Vorträgen und einem Workshop aneiner der Universitäten eingeladen hatte.Panosot ist Arzt und hat sich in den USAzum Waldorflehrer weitergebildet. Er ver-sucht seit einigen Jahren, die Waldorfpäd-
agogik bekannt zu machen, indem er pu-bliziert, Kontakte zur Universität hat, Stei-ner ins Thailändische übersetzt und dieKeimzelle einer ersten kleinen Schule mitLeben erfüllt. Seine Frau arbeitet im Kin-dergarten und gibt Handarbeit. Am Wo-chenende widmen sie sich den Waisenkin-dern und machen mit ihnen künstlerischeÜbungen.
Alle Schulen, von denen ich sprach,freuen sich sehr, wenn Menschen aus derWaldorfbewegung sie besuchen und Er-fahrungen austauschen. Für die Eltern inder Pionierphase ist es stärkend und ver-
Blick in eine Klasseder »Golden HillSteiner School« inDenmark an derSüdküste Austra-liens
395
1968 starb in einer Pariser Klinik der Erz-bischof von Paris im Alter von 55 Jahrennach einer langen, furchtbaren Agonie.Sterbend vertraute er einem priesterlichenFreund an: »Wir verstehen es meisterhaft,
schöne Sätze übers Leiden zu machen.Auch ich habe übers Leiden in ergreifen-den Worten gepredigt. Sagen Sie den Prie-stern, sie sollen lieber schweigen; wir wis-sen nämlich nicht, was Leiden heißt.«
Leid als HerausforderungKatholische Religionslehrer/innen im Gespräch mit Waldorfpädagogen
Teilnehmer einesKurses über Waldorf-
pädagogik inManila, wo 1996eine erste Klasseeröffnet wurde.
Das Eurythmie-gebäude der Mount
Parker Waldorf Schoolbei Adelaide
denkbar knapp, jedoch sind Begeisterungund Tatkraft ein ganz besonderes Kapital.»Everybody is welcome!«
Horst Hellmann
trauengebend zu hören, was Waldorf-schüler tun und später einmal werden.
Überall werden Lehrer gebraucht undEurythmisten, aber die Geldmittel sind
396
Diese Worte wurden in der Einführungzu einer religionspädagogischen Tagungin Haltern/Westfalen vom 20.-22.2.1997zitiert; und die Leiterin der Tagung, Elisa-beth Schumann (Religionslehrerin an derRudolf Steiner Schule Witten-Annen),fügte hinzu: Wenn wir trotzdem vom Lei-den sprechen wollen, dann möchte ichdies so begründen: Nachdenken über dasLeid, solange wir gesund und »glücklich«sind, kann uns in den dunklen Stundendes Leidens zu einer Hilfe werden, unserLeiden anzunehmen und zu ertragen. Indieser Tagung soll Leid nicht beschönigtwerden. Wir wollen uns der bedrängen-den Frage stellen: Warum läßt Gott unsleiden?
Während der Unglaube nur Krankheitund Tod zu sehen vermag, glaubt derChrist, daß Gott durch Leid, Sterben undTod hindurch uns neues Leben gewährt,nicht erst in der Ewigkeit, sondern schonin unserem Erdenleben, wenn nämlich –so sagt Michaela Glöckler – wie in einerjeweils neuen Geburt der Mensch in derAuseinandersetzung mit der Welt und inLernbereitschaft aufbricht und sich in al-len Konsequenzen ganz zu seinem Ich(und damit zu Gott) bekennt. In diesemMoment, wo die Liebe zu den selbstvoll-zogenen Lebensschritten wieder erwacht,wo man sein Schicksal annehmen kannund nicht mehr mit ihm hadert, werdenungeheure Kräfte frei, die völlig selbstver-ständlich in einen sozialen Zusammen-hang gestellt werden können. (»Erzie-hungskunst« 9/1986, S. 542 f.)
Reinkarnation und Karma
Von anthroposophischer Seite versuchteLudwig Harloff, langjähriger Waldorfleh-rer, den Sinn des Leidens auf dem Hinter-grund von Wiederverkörperung und
Schicksal zu erhellen. Er ging von unge-wöhnlichen eigenen Erinnerungen undvon den Erfahrungen von Menschen un-serer Zeit an der Todesschwelle aus, be-leuchtete kritisch die sog. Reinkarnations-therapie und zeigte, daß Rudolf Steinernicht an indische Anschauungen an-knüpft, vielmehr in europäischer Traditi-on steht (z. B. Lessing). Ihm ging es umdas immer fortschreitende Lernen, dasmit dem Tode nicht abbricht, sondern ineinem neuen Leben – vorbereitet in einergeistigen Welt zwischen Tod und neuerGeburt – fortgesetzt werden kann. »Kar-ma« bedeutet hier nicht Vergeltung undStrafe, sondern »Wirkung« früherer Tatenin Form von Schicksalserfahrungen, diemir Gelegenheit geben, zu reifen und anmeinem Verhältnis zur Mitwelt zu arbei-ten.
Welche Fragen dazu von katholischerSeite kommen würde, war abzusehen:Handelt es sich hier nicht um Selbstver-vollkommnung? Und wo bleibt die Erlö-sungstat Christi? Harloff antwortete: »Ichbin persönlich fest davon überzeugt:Ohne Christus wären die Menschen so andie Materie gekettet worden, daß sie derUnsterblichkeit verlustig gegangen wä-ren.« Man konnte an dieser und ähnlichenGesprächssituationen erleben: Was die ka-tholischen Gesprächspartner überzeugteoder zumindest nachdenklich machte,waren nicht so sehr logische Gedanken-gänge, vielmehr die Wahrnehmung, wieein Mensch anthroposophische Anschau-ungen in seinem eigenen Leben erprobthat, so daß er mit seiner ganzen Existenzhinter seinen Aussagen steht.
Die Hiob-Frage: Ist Gott gerecht?
Von katholischer Seite referierte der Theo-loge Alfred Beckmann. Er sagte einlei-
397
tend, er hätte das Thema – die Frage nachder Gerechtigkeit Gottes angesichts un-verdienten Menschenleides – auch ge-danklich-theologisch behandeln können.Aber da hätte die Gefahr eines Theoreti-sierens bestanden, und genau das wollteder vorbereitende Lehrerkreis vermeiden.So wurde ein anderer Weg gewählt: sichin das Buch Hiob zu vertiefen und sichvon den dort aufgeworfenen Fragen her-ausfordern zu lassen. Tatsächlich gelanges Beckmann, nicht so sehr über das BuchHiob zu sprechen, sondern aus ihm her-aus. Und er präparierte auch keine glattegedankliche Antwort heraus, die es ja indem Buch nicht gibt.
So löste der Vortrag ein lebhaftes Ge-spräch aus, in dem es ein intensives ge-meinsames Fragen und engagierte per-sönliche Stellungnahmen gab, etwa ange-sichts des immensen Leides ganzer Völ-kerschaften in unserer Zeit, vor dem manfast nur verstummen kann. Ein einzigerPunkt sei herausgehoben: Beckmann gabzu bedenken, ob nicht die »Läuterungs-zeit« nach dem Tode, wie sie in der Kar-ma-Lehre begegne, auch in der alten An-schauung vom Fegefeuer enthalten sei;man dürfe diese Anschauung nur nichtwörtlich nehmen, sondern müsse sie alsBild interpretieren: Der Mensch werdenach dem Tod mit der Diskrepanz seinesTuns konfrontiert und könne sich verwan-deln.
Leid in der Schulwirklichkeit
Zwei parallele Arbeitsgruppen waren Fra-gen gewidmet, die sich im Religionsunter-richt und Schulalltag ergeben. In der Mit-telstufen-AG (Gesprächsleiterin: Elisa-beth Drießen) schilderten zunächst einzel-ne Teilnehmer Erfahrungen, die sie mitdem Leiden engster Angehöriger (etwa
Krebskranker) gemacht hatten. Dadurchentstand im Gespräch eine Offenheit, inder nun auch über schweres Schicksal vonSchülern berichtet und gesprochen wer-den konnte, sei es der Verlust von Mutteroder Vater, sei es eine unheilbare Krank-heit des Kindes selbst. Etwas ratlos kanneinen als Lehrer die Frage machen: Wastue ich, wenn die Betroffenen nicht möch-ten, daß darüber gesprochen wird? Es gibtdie Möglichkeit einer stillen, innerenZwiesprache, in der ich mich brüderlichmit dem Kind verbinde; manchmal zeigtsich dann auch in der äußeren Begegnungeine neue, tiefere Verbundenheit, ohnedaß Worte nötig sind.
Ein weiterer Austausch betraf den Um-gang mit der Pubertät. Erleichtert nahmendie Religionslehrer/innen zur Kenntnis,daß auch die sonst so souveränen Klas-senlehrer, wenn in der Mitte der 7. Klasseder Durchbruch von der Vorpubertät zurHauptphase erfolgt, zunächst hilflos vorder Tatsache stehen, daß die Klasse zusehr mit ihrer eigenen Turbulenz beschäf-tigt ist, als daß sie den Lehrer überhauptnoch richtig wahrnimmt. Seitens des Leh-rers muß nun mühsam eine neue Formgefunden werden: gelassen zu bleiben(nicht an sich selber zu verzweifeln), aberauch Konsequenz zu zeigen. Sollte mannicht eisern den Unterrichtsstoff durch-ziehen, um dem Chaos etwas Festes ent-gegenzusetzen? Hier regte sich Wider-spruch: Hat nicht gerade der Religionsleh-rer die Chance, dem, was spontan von denKindern kommt und in anderen Fächernkeinen Platz findet, Raum zu geben?
Das heißt allerdings nicht, daß er vonsich aus die seelischen Probleme der inder Pubertät befindlichen Schüler anspre-chen sollte. Damit würde er sie »entblö-ßen«, ihrer persönlichen Sphäre berauben,die in diesem Alter als Schutz so wichtig
398
ist. Mit der Scheu, zu zeigen, was manfühlt, hängt auch die Scheu vor dem Sin-gen und Beten zusammen. Und weil vieleJungen und Mädchen – gerade die stille-ren, unauffälligen – in diesen Jahren nichtwenig an inneren »Schmerzen« durchma-chen, wäre es höchst problematisch, dasLeid zum Unterrichtsthema zu machen.
Tatsächlich taucht dieses Thema in denkatholischen Religionslehrbüchern meisterst in der 10. oder 11. Klasse auf, wo imLehrplan der Waldorfschule für denDeutschunterricht das Nibelungenliedmit seinen inneren Abgründen und der»Parzival« mit seiner seelischen Pein vor-gesehen sind. Wichtig ist zu bemerken,daß auch bei solcher Lektüre die seelischeSituation der Jugendlichen nicht direktangesprochen wird, sondern indirektdurch die Bilder der Dichtung.
Lebensbilder vor die Schüler hinzustel-len ist im Religionsunterricht gut im Rah-men der Kirchengeschichte möglich; hierkann der Lehrer Gestalten auswählen, dieetwas »durchmachen« und dadurch denSchülern mit ihren inneren Klippen nahe-kommen können. Auch die Passionsge-schichte ist eine »Leidensgeschichte«. Wound wie wäre sie einzubeziehen? – In un-serer eigenen Zeit gibt es schwierige seeli-sche Prozesse bei Menschen in der DrittenWelt, die nach ihrer politischen Befreiungnun zu ihrer Identität finden müssen. Su-che nach der eigenen Identität ist ja auchein Zentralmotiv der Jugendjahre.
Leidensgestalten plastiziert
Als künstlerische Übungen wurden Pla-stizieren und Meditativer Tanz angebo-ten. Beim Plastizieren unter Anleitung ei-nes Waldorflehrers (Eugen Leuenberger,Bochum-Langendreer) gelangen den Teil-nehmern, die allesamt noch nie plastiziert
hatten, Leidensgestalten mit erstaunlichausdrucksvollen Körperhaltungen. In denMeditativen Tanz führte Schwester So-phia Vossel (Ursulinenkloster Bad Mün-stereifel) ein. Bibelworte und andere zurMeditation geeignete Texte wurden mitmusikalischer Begleitung in Schrittfolgen,choreographische Figuren und Gebärdenumgesetzt. Man mußte sich erst hineinfin-den, aber dann erlebte man immer stärkerdie aufrichtende und gemeinschaftsbil-dende Kraft solchen Tanzes.
Morgenandachten und ein Abendgot-tesdienst mit anschließender Agape (ge-meinsames Brotbrechen und besinnlichesBeisammensein) wurden künstlerisch-le-bendig von zwei Theologen (Günter Lan-ge und J. H. Schneider) gestaltet, die zu-gleich den Deutschen Katechetenvereinvertraten – einen freien Zusammenschlußvon katholischen Religionspädagogen,welcher als Schirmherr dieser jährlichenTagungen den veranstaltenden Lehrerin-nen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Klaus Schickert
Arbeit an der Mittelstufenreform
Der Mittelstufenarbeitskreis der FreienWaldorfschule Engelberg hat in der De-zember-Nummer der »Erziehungs-kunst« (12/96) im Rahmen eines Inter-views die dortige Mittelstufenreformvorgestellt. In diesem Interview wurdeangekündigt, daß ein Gedankenaus-tausch mit interessierten Kollegen an-derer Schulen über Probleme der Mit-telstufe stattfinden soll. Terminvor-schlag für diesen Gedankenaustausch:Samstag, 21. Juni 1997, Ort: Freie Wal-dorfschule Engelberg. Interessentenkönnen sich bis zum 14.6.1997, 12 Uhr,unter Tel. 07181-7040 (bei Frau Schlegeloder Frau Simon) melden. M.M.
399
Die Kasseler Waldorfschule – fünfzig Jahre nach derWiedereröffnung im Jahre 1946
Straße beherbergt vier Kindergartengrup-pen, Töpferei, Lebenskundewerkstatt, Se-minarräume und Mal- und Zeichenräu-me. (Zwei Kindergartengruppen sind ineinem ebenfalls der Schule gehörendenHaus in unmittelbarer Nähe unterge-bracht, in dem ein Hausmeisterehepaarwohnt. Das andere Hausmeisterpaarwohnt in dem ehemals KühnerschenHäuschen unmittelbar oberhalb des Alt-baus.) Dieser Altbau, eine Jugendstilvilla,inzwischen restauriert, war unser erstes»großes« Schulhaus, das unter wundersa-men Umständen unmittelbar vor derWährungsreform günstig erworben wer-den konnte. In der Nähe stehen die zweiWerkstattbauten mit den drei Werkstät-ten, wobei die Metallwerkstatt mit einemkleineren Gebäude, das Verwaltungs- undUnterrichtsräume und den Hort beher-bergt, verbunden ist, dem früheren Erzie-herseminar. Der andere Bau birgt dieSchreinerei, die Elektro-Werkstatt, diePädagogische Forschungsstelle und Un-terrichtsräume für die Oberstufe und dasSeminar. Auf der anderen Seite des Baches(südlich) befindet sich der eigentlicheHauptbau, hufeisenförmig, mit Festsaal,
Der Berichterstatter war 28 Jahre alt, als eran der Kasseler Waldorfschule zu unter-richten begann. Jetzt, als »Senior«, ver-sucht er, in Zuneigung und kritischer Di-stanz die Entwicklung dieser großen undoriginellen Schule zu skizzieren. Die fol-genden Zeilen sind der Dank an die Pio-niere, ohne deren Hingabe unsere Schulenicht hätte gedeihen können. Diese schul-geschichtliche Skizze soll aber auch Auf-ruf an die Eltern und Lehrer unserer Wal-dorfschule sein, immer neues Vertrauen indie sich entwickelnde Persönlichkeit zugewinnen und ständig weiterzulernen.
Die jetzige Kasseler Waldorfschule istrecht groß. Rund 900 Schüler besuchen dieSchule. Es gibt über hundert Mitarbeiter,davon sind mehr als die Hälfte Lehrer. Diegesamte Schule umfaßt noch drei Werk-stätten, einen Hort und einen Kindergar-ten mit sechs Gruppen. Angegliedert, abernaturgemäß selbständig arbeitend, sindOberstufenlehrer-Seminar und Pädagogi-sche Forschungsstelle. Im Schulgartenund im »Waldhof« am westlichen Randeder Stadt werden auch Gartenbaulehrerausgebildet. Der Werkstattbereich gliedertsich in Metallwerkstatt, Elektrowerkstatt
Neubau (1980)in der Brabanter-
straße
und Schreinerei.Der Gebäude-
komplex im We-sten der StadtKassel, am Dru-selbach gelegen,ist groß gewor-den. Der Altbauin der Brabanter
400
Das alte Schulhaus in der Brabanterstraße
den zahlreichen Klassen- und Fachunter-richtsräumen, dem Lehrerzimmer unddem Speiseraum mit Schulküche. An denFestsaal schließen sich, etwas bergabwärtsliegend, die beiden Turnhallen an. Gegen-über, nach Süden, steht die »Steinbarak-ke«, ein altes, ehrwürdiges Gemäuer, dasals Domizil für den Schularzt und für eineHolz- und Tonwerkstatt gebraucht wird.Unterhalb der Steinbaracke ist der Sport-platz.
Die Initiative
Einer winzigen Eltern-Lehrer-Initiative istes zu verdanken, daß in dem fast vollstän-dig zerstörten Kassel in dem Hinterzim-mer einer Gaststätte am 27. Februar 1946der Waldorfunterricht wieder begann.Else Niemann, Lehrerin der »alten« Kas-seler Waldorfschule, die bereits 1930 ge-gründet war und 1938 schließen mußte,danken wir es, daß der mutige Neubeginnmit siebzig Schülern möglich wurde. Daswar im heute noch bestehenden Gasthaus»Zur Dönche« an der Druseltalstraße. ImJahre 1956, bei der Zehnjahresfeier, um-faßte unsere Schule bereits 668 Schüler. ZuBeginn meiner Tätigkeit als Lehrer (1. Ok-tober 1958) hatte die Schule schon über
700 Schüler – und das in einerVilla, die früher als Einfamilien-haus bewohnt wurde.
Entwicklung der Schule
Ein wenig sei nun über die Ent-faltung unserer Schule und ihreneigenwilligen Weg berichtet. Er-hard Fucke, einer der Jüngerenunter den »Pionieren«, der baldnach der Wiedergründung derSchule eine Klasse zu führen be-gann, war der unermüdliche,klar analysierende, vorantrei-
bende, aber auch ein wenig beherrschen-de und ungeheuer fleißige »Entwick-lungshelfer« unserer Schule, dem wirletztlich die Differenzierung unsererOberstufe verdanken. Nach zahllosenVorgesprächen, Studien, Planungen undVersuchen entstand die neue Form unse-rer Schule vom Herbst 1969 an: Die Me-tall- und die Elektrowerkstatt begannenihre Arbeit, das Erzieherseminar öffneteseine Tore – und das alles für die Schülervon der elften bis zur dreizehnten bzw.vierzehnten Klasse, die nun, wenn sie die-sen Weg gewählt hatten, etwas ganz Neu-es erfuhren. Das Konzept (es beruft sichu.a. auf Ideen, die Rudolf Steiner schon imMai und Juni 1919, vor der Gründung derWaldorfschule, in drei Vorträgen überVolkspädagogik in Stuttgart entwickelthatte) wurde allmählich so weit ausgear-beitet, daß tatsächlich die berufliche zu-gleich mit der allgemeinen Ausbildungabsolviert werden konnte. 1979/80 kamnoch die Schreinerausbildung zum Be-rufsbildungsbereich dazu (Berufsab-schlüsse: Industriemechaniker, Industrie-elektroniker und Tischler). Anschließendkonnten und können die Absolventen beientsprechendem Fleiß und der nötigenVeranlagung in einem zusätzlichen Jahr
401
In der Metallwerkstatt
führte dazu, daß von jetzt an nach dervollendeten 10. Klasse fast alle Schüler ander Schule blieben. In den Jahren davorwar in der Regel nach der 10. Klasse etwadie Hälfte der Schüler abgegangen, umentweder anderswo eine Berufsausbil-dung zu beginnen oder das ersehnte Ab-itur, das an unserer Waldorfschule »ex-tern« abgenommen wurde und entspre-chend schwierig war, woanders zu versu-chen. Öffentliche Mittel wurden diesem»Kasseler Modell« zuteil. Stiftungs- undForschungsgelder flossen, nachdem auf-grund guter Öffentlichkeitsarbeit von Er-hard Fucke und seiner »Differenzierungs-gruppe« Behörden und Wissenschaftlerauf unser Vorhaben aufmerksam gewor-den waren.
Erfahrungen mit dem Modell
Seit Mitte der siebziger Jahre habe ich ne-ben meinen übrigen Lehrerpflichten imWerkstattbereich Sozialkunde (Politik,Wirtschaft, Recht) unterrichtet. Währenddieser gut zwanzig Jahre beobachtete ich,wie unsere Mädchen und Jungen in denWerkstätten gute, beherzte und sichereSchritte in das Leben tun konnten, die we-niger Begabten und die Talentierten, dieÄngstlichen und die Beherzten, dieSchwachen und die Starken. Sie produ-
noch die Fachhochschulrei-fe oder die AllgemeineHochschulreife (Doppel-qualifikation) erwerben, zu-mindest aber den Real-schulabschluß, in wenigenFällen »nur« den Haupt-schulabschluß, aber mit ei-ner soliden praktischenAusbildung. Diese Meta-morphose unserer Schule
zierten keinen »Edelschrott«, wie das zujener Zeit noch in den meisten Ausbil-dungswerkstätten die Regel war. Schrittfür Schritt wurden und werden die Schü-ler an die Produktion von Gütern, die manbrauchen kann, herangeführt: vom klei-nen, überschaubaren Schaltschrank biszur komplexen Bühnenlichtsteuerung,vom Holzschemel oder einer kleinenHausapotheke bis zur kompletten Kinder-gartenausstattung oder Praxiseinrich-tung, von der Bügelsäge zum Sägen vonverschiedenen Metallen bis zur kompli-zierten Flaschenprüfanlage. Planung,Ausführung, Kontrolle wurden und wer-den gelernt und praktiziert, das Fertigenauch mit Hilfe von CNC-gesteuerten Fräs-und Drehmaschinen wurde eingeführt,das Umgehen mit den dazu notwendigenComputern war die notwendige Folge.Speziallehrgänge bereiten die Schüler aufdie Handhabung der schnellaufendenund gefährlichen Holzverarbeitungsma-schinen vor.
Von den Bildungsprozessen, denen sichauch die Lehrkräfte unterziehen mußtenoder konnten, wenn sie sich der neuen Si-tuation öffneten, kann in der Kürze nichtdie Rede sein.
402
An der Nähmaschine
Neues im Fremdsprachen-bereich
Eine wichtige Veränderung gab esim Lehrplan der Kasseler Waldorf-schule im Bereich der Fremdspra-chen: Vor neun Jahre wurde Rus-sisch eingeführt, so daß die Schü-ler als zweite Fremdsprache alter-nativ (neben Englisch) Französischoder Russisch wählen können (abder ersten Klasse). Das Fach Latei-nisch wurde zunächst auf einen
dreijährigen Kurs reduziert und dann ab-geschafft.
Fast alle Rückmeldungen von »Ehema-ligen« –�in Briefen, in Gesprächen beiKlassentreffen, bei der Begegnung aufdem Weihnachtsmarkt in der Schule, wotraditionell viele ehemalige Schüler »ihre«Schule aufsuchen – waren positiv. Undwenn Kritik kam – um so besser für dieEntwicklung der Schule! Nur in äußerstseltenen Fällen berührte die Kritik unserKonzept insgesamt.
Im Rahmen der Festtage zum fünfzig-jährigen Bestehen der »neuen« Waldorf-schule in Kassel vom 2. bis 6. Oktober1996 fehlte es nicht an Würdigungen vonseiten der Politiker, der Behörden, derFachleute und vor allem der Freunde.Aber die schönsten Erlebnisse waren dochdie Begegnungen von ehemaligen Schü-lern und Lehrern. Da wurde dem Teilneh-mer und Betrachter deutlich, daß eine sol-che Schule wie die unsrige ein Organis-mus ist, der über das Persönliche hinaus-weist, der gesellschaftliche Relevanz ent-wickelt, der die Würde des Menschen, desKindes ernst nimmt, der Solidarität unterden Menschen schafft.
Karl Fischer
Die Praktika in der Oberstufe
Es wurden zu dem traditionellen Feld-meßpraktikum im Laufe der zehntenKlasse noch folgende Praktika hinzuge-fügt: das Forstpraktikum in der 9. Klasse,das Industrie- oder Sozialpraktikum inder elften und das Landbau-Praktikum inder zwölften Klasse.
Mehrere Forschungsprojekte (mit derGesamthochschule Kassel und mit ande-ren Institutionen) bestärkten und fundier-ten die Arbeit im Rahmen der Differen-zierten Oberstufe. Darüber gibt es wissen-schaftliche Publikationen. Aber es gabauch Rückschläge. Der Erzieherzweigmußte wegen neuer gesetzlicher Regelun-gen aus der Schule ausgegliedert werden,und den so hoffnungsvoll begonnenenZweig »Ländliche Hauswirtschaft« muß-ten wir nach fünf Jahren wieder beenden,da kein einmütiger Wille des gesamtenKollegiums dahinterstand.
In Zukunft werden wir neue Wege ge-hen müssen, um noch besser auch die»schwächeren« Schüler so qualifiziert aufdas Leben vorzubereiten, daß sie sich spä-ter selbst helfen können und nicht der Ar-beits- und Trostlosigkeit verfallen.
404
IM GESPRÄCH
Epochenhefte, Probearbeiten, Jugendbücher
Im Februarheft d. J. wurde – nach einemGespräch ehemaliger Schüler – die Ver-wendung der Epochenhefte in den oberenKlassen diskutiert. Der folgende Beitragenthält Anregungen für einen intensive-ren Gebrauch dieser Hefte und gedruckterWissensquellen.
Jene Arbeiten, die am Ende einer Epoche,vorher angekündigt, in der Schule ge-schrieben werden, heißen bei mir »Probe-arbeiten«, auch »Schulaufgaben« (im Ge-gensatz zu »Hausaufgaben«) oder einfach»Test«. Der Lehrer achtet während dieserArbeit darauf, daß die Schüler ihr Wissenund Können ohne gegenseitige Hilfe zuPapier bringen. Eine gewisse Spannungherrscht im Klassenzimmer während die-ser Zeit, denn ausnahmsweise hilft derLehrer nicht. In staatlichen Schulen wer-den Noten auf diese Arbeiten gegeben;diese Noten sind die Grundlagen für dieZeugniszensuren und damit für die Er-laubnis, in eine höhere Klasse aufzurük-ken. An Waldorfschulen haben diese Ar-beiten eine andere Funktion: Einerseitsbemerkt der Lehrer bei der Korrektur, ober den Stoff klar und gründlich genug andie Kinder herangebracht hat, und ande-rerseits erfährt der Schüler, die Schülerin,durch die Bemerkung unter der Arbeit, obder Lehrer mit der Leistung zufriedenwar. Im folgenden seien die eben charak-terisierten Arbeiten in der Mittel- undOberstufe angesprochen.
Die Epochenhefte, so sagt man, seiendie selbstgefertigten Schulbücher der Wal-dorfschüler. Man erwartet, daß sie aufge-
hoben, gelegentlich hervorgeholt undnochmals angesehen werden. Bücher sindja schließlich zum Nachschlagen da. DemNachschlagen hat der Schreiber dieserZeilen etwa ab der sechsten, siebten Klas-se verstärkt Bedeutung gegeben: Das Epo-chenheft durfte bei der oben beschriebe-nen Probearbeit verwendet werden. Esversteht sich, daß nur das eigene Heft inFrage kam, nicht das Epochenheft desNachbarn. Diese Praxis sei hier zur Dis-kussion gestellt.
Selbstverständlich wurde zu Beginn derEpoche auf die zu erwartende Probearbeithingewiesen und auch darauf, daß mandas eigene Epochenheft dabei verwendendarf. Dies hatte schon einmal die Folge,daß allgemein die Führung des Epochen-heftes ernster genommen wurde. Man be-mühte sich mehr als sonst, auf dem lau-fenden zu sein und Ordnung zu halten.Gelegentlich wurde ich gefragt, ob manauch mehr in das Epochenheft eintragendürfe, als man muß. Natürlich durfteman. Ich freute mich, denn damit begannein selbständiges Arbeiten. Manche Kin-der haben z. B. in das Mathematikheftstatt einem Beispiel mehrere eingetragen.Die Kartenskizzen im Erdkundeheft wur-den reichhaltiger angelegt. Physik-Tabel-len wurden selbständig erweitert usw. –Kurz vor der Probearbeit habe ich emp-fohlen, Seitenzahlen anzubringen und einInhaltsverzeichnis zu erstellen. Außer-dem empfahl ich als Vorbereitung für dieProbearbeit, sich im Epochenheft auszu-kennen.
405
Eine solche Probearbeit muß natürlichetwas anders aufgebaut werden als eineohne Epochenheftbenützung. Nach derGeschichtsepoche in der siebten Klassestellte ich z. B. die Frage, ob Kolumbuseine gedruckte Bibel in der Hand gehabthaben konnte (ja, Gutenberg druckte ab1445, Kolumbus wurde 1451 geboren). Inder Physikarbeit der achten Klasse wollteich wissen, ob Eichenholz in Benzinschwimmt (nein, Eichenholz 0,8 g/ccm,Benzin 0,7 g/ccm). Einmal mußten Jahres-zahlen nachgeschlagen und verglichenwerden, das andere Mal war in Tabellennachzuschauen. Es ging nicht nur umZahlen, ich wollte auch diverse Namenwissen. Wer sie auswendig wußte, war imVorteil, wer nicht, sah eben nach. Wäh-rend der Himmelskunde-Epoche lerntenwir den Tierkreis kennen, er wurde in dasEpochenheft gezeichnet. So konnte ichfragen, in welchem Sternbild der Voll-mond aufgeht, wenn die Sonne in den Fi-schen steht (in der Jungfrau). In diesemFall konnte es sein, daß jemand vergessenhatte, daß der Vollmond der Sonne gegen-übersteht; dann mußte er wohl etwas län-ger blättern, um die entsprechende Stelleim Epochenheft zu finden. Gerade dieHimmelskunde eignet sich für Fragen derangedeuteten Art ganz besonders gut.Natürlich ließ ich auch manches einfachnur nacherzählen, aber möglichst in neu-en Kombinationen. Eine gute Epochen-heftführung konnte auch hier eine Hilfesein. Einfach aus dem Heft abgeschriebenwurde eigentlich nie.
Eine Kollegin, der ich diese Methode fürdie Oberstufe empfohlen hatte, erzähltemir folgendes: Eine Sprachlehrerin be-klagte sich bei ihr wegen Unaufmerksam-keiten der Klasse einen Tag vor der Probe-arbeit. Man beschäftigte sich nebenbei un-ter den Tischen mit dem Biologie-Epo-
chenheft, was ja nicht ganz korrekt war.Auf die Frage, warum die Schüler dies tä-ten, bekam die staunende Sprachlehrerindie Antwort, es sei morgen eine Probear-beit, bei der das Epochenheft verwendetwerden darf. »Aber warum blättert ihrjetzt darin, wenn ihr es morgen dürft?«»Wir müssen uns doch auskennen imHeft«, war die Antwort. – Natürlichmöchte ich mit meinem Vorschlag keinenSprachlehrerinnen Schwierigkeiten ma-chen. Es geschah dies wohl nur bei derersten Anwendung der neuen Regel, soetwas reguliert sich von selbst.
Bei dieser Gelegenheit darf ich berich-ten, daß mir einmal eine Schülermutter,die selbst Waldorfschülerin gewesen war,gestand, sie hätte bis zum Abitur einschlechtes Gewissen gehabt, in einemBuch etwas nachzuschlagen. So ernst istdas mit dem »die Epochenhefte sind dieselbstgeschriebenen Schulbücher der Wal-dorfschüler« wohl nicht zu nehmen! An-dererseits wird gelegentlich geäußert:»Das Lexikon ist das Schulbuch der Wal-dorfschüler.« Ist es Ihnen, liebe Kollegen,noch nie so ergangen, daß Sie ein Kind derMittelstufe baten, die häusliche Nacher-zählung eines Themas der vorhergehen-den Tage vorzulesen, und Sie bemerktenbefremdlich den Brockhausstil? Was da-gegen tun? Eigentlich zeugt es von Inter-esse und Aktivität, wenn der Schüler da-heim zu einem Nachschlagwerk greift.Der unverarbeitete Text irritiert aber.
Es müßten gute Jugendbücher über diein den Epochen der Mittelstufe behandel-ten Stoffinhalte zur Verfügung stehen.Das Angebot in unseren Verlagen istreichhaltig: die Bücher von Rosemary Sut-cliff und Inge Ott zur Erweiterung der Ge-schichte z. B., oder die Biographien vonNobel, Kopernikus usw., von Kollegen ge-schrieben. Solche Bücher sollten für die
406
Mittelstufe vorhanden sein. Der Verfasserdieser Zeilen hatte das Glück, eine ent-sprechende Bibliothek zu Verfügung zuhaben. Diese Bibliothek war nach Epo-chen geordnet. Nachdem z. B. Marco Polobesprochen war, kam der Lehrer mit ei-nem Stapel Bücher über diesen Abenteu-rer an. »Wer möchte etwas über MarcoPolo lesen?« Fast alle wollten. So gerechtwie möglich wurden die vorhandenenBücher verteilt. Nach drei Tagen kamendie ersten schon wieder zurück, und eswar ein neuer Held aktuell, neue Bücherkamen dazu. Man las während der Ge-schichtsepoche und noch weit in die an-
schließende Rechenepoche hinein. Gewiß,nicht über jedes Thema gibt es genügendgute Jugendbücher, aber es gibt doch vie-le. Lesebücher über die Tier- und Pflan-zenkunde haben wir von Gerbert Groh-mann. Wir bräuchten z. B. Erdkunde-Bil-derbücher für die Mittelstufe, mit kurzenerklärenden Texten dazu. Solche Büchersind übrigens auch außerordentlich gutzur Vorbereitung des Klassenlehrers ge-eignet, sie waren mir eine große Hilfe beider Vorbereitung der Epochen.*
Walter Kraul
* Der Autor war Oberstufen- und Mittelstufen-lehrer an den Waldorfschulen in München.
Hansjörg Hofrichter leistet hier einenRundumschlag gegen jede Art der elek-tromagnetischen/elektromechanischenWiedergabe von Tönen, der meiner An-sicht so nicht unwidersprochen hinge-nommen werden kann. Anfangs verläuftdie Argumentation ziemlich sauber undist auch von Menschen nachvollziehbar,die seine Einstellung nicht unbedingt tei-len. Dann folgt jedoch ein Satz, der seineganze vorherige Arbeit mit einem Schlagzunichte macht: »Niemand wird wohl derFeststellung widersprechen, daß Stereo-anlagen der Waldorfpädagogik zutiefstwesensfremd sind« (S.1332).
Erst kurz vorher hat sich Hansjörg Hof-richter gegen schlagwortartige Erledi-gung von unbequemen Fragen aus derGegenrichtung entrüstet, und hier tut erein ähnliches. Ich beschäftige mich nochnicht sehr lange mit Waldorfpädagogik,
dafür um so länger mit Elektromagnetis-mus und kann vielleicht deshalb zwi-schen Waldorfpädagogik und elektroma-gnetischer Aufarbeitung von Tönen imPrinzip noch keinen Widerspruch erken-nen. Es gibt aber viele Leser, die genaudiesen Widerspruch in der Waldorfpäd-agogik verkörpert zu sehen glauben –überzeugen konnte mich bisher jedochnoch keiner.
Damit gibt es also zumindest einen, derdieser These widerspricht. Als polemischempfinde ich den Hinweis auf den GeigerMiha Pogacnik in der auf diesen Satz fol-genden Klammer. Als Künstler allerersterGarnitur mag es ihm wichtig sein, und esist für ihn bestimmt auch richtig, auf elek-tromagnetische Aufzeichnungen zu ver-zichten. Aber daraus kann ich noch nichtden Schluß ziehen, daß wir als Lehrer diesauch mit unseren Kindern machen müß-
Zum Einsatz von Tonträgern und StereoanlagenAnmerkungen zu »Musikunterricht an Waldorfschulen – (k)ein Problem?«von Hansjörg Hofrichter in Heft 12/1996, S. 1331 f.
407
ten. Ich erwarte nicht, daß alle diese Kin-der, die bei uns zur Schule gehen, spätereinmal Künstler werden. Im Gegenteilhoffe ich sogar, daß sie es »nur« im Sinnevon Beuys werden und ansonsten ganzpraktisch im Leben stehen.
Von daher sei die Frage erlaubt, ob das,was für einen Künstler richtig ist, auch füreinen Lehrer und den Unterricht in derSchule richtig sein muß.
Gleich der nächste Satz liefert einenAnalogieschluß, der so auf jeden Fallnicht korrekt ist, wie jeder Mensch in ei-nem Selbstversuch überprüfen kann. »DieTonträger verhalten sich zum Hörsinn wiedas Fernsehen zum Sehsinn …« (ebd.).
Im Gegensatz zum Fernsehen, bei demeine unechte Bildinformation geliefertwird, die nur durch die Unzulänglichkeitdes menschlichen Sehsinnes zu einemBild zusammengesetzt wird, liefert derTonträger einen um einige Oberwellenverringerten, aber insoweit echten Ton.Selbst mit dem besten Gehör und der be-sten technischen Ausrüstung lassen sichOriginal und Kopie nicht voneinander un-terscheiden, wenn sie z. B. durch eineWand gehört werden.
Der angesprochene Selbstversuch siehtso aus: Verglichen werden sollte die kör-perliche und vor allem geistige und, so-weit feststellbar, seelische Erfahrung nacheinem mehrstündigen Fernsehabend, bes-ser noch einem ganzen Tag, mit einermehrstündigen »Berieselung« durch qua-litativ hochwertige Musik oder sogarSprechsendungen ohne Bild.
Die Fernsehsendungen mögen noch soanspruchsvoll sein, der Fernseher lähmteigene Aktivitäten so sehr, daß sie ohnestarken Willensimpuls bis auf ein Mini-mum reduziert werden. Im Gegensatzdazu geht von entsprechenden Tonsen-dungen eher eine aktivitätssteigernde
Wirkung aus. Dazu braucht man nicht erstdie Untersuchungen Neil Postmans zu be-mühen, diese Feststellungen kann jeder,der einen Fernseher und einen Tonträgermit Abspielmöglichkeit zur Verfügunghat, selbst durchführen.
Die nächstgestellte Frage erübrigt sichdann von selbst. Der von Neil Postmandargestellte Sachverhalt läßt sich nicht aufden Bereich Tonträger und Hören übertra-gen, womit ich nicht gesagt haben will,daß der Einsatz von Tonträgern im Unter-richt keine schädlichen Auswirkungenhaben kann. Nur ist die Untersuchungnicht einfach mit dem Hinweis abzu-schließen, die Nachweiskette verliefe ana-log zum Fernsehen.
Dabei fällt auf, daß Hansjörg Hofrichterwillkürlich mit den Medien umgeht. Fürden schädlichen Einfluß bezieht er sichauf eine Untersuchung, die das Fernsehenzum Inhalt hat, das in etwa einem Radiovergleichbar wäre, wenn dieser Vergleichdenn nötig ist. Im vorletzten Absatz hin-gegen vergleicht er Kunstdruck und CDund hat so eine hervorragende Erklärung,warum das Problem Hörsinn nicht soleicht in den Griff zu bekommen sei wieder Sehsinn, da der Kunstdruck einfacherzu verstehen sei. Von einem Druck waraber in der ganzen vorherigen Argumen-tation nicht die Rede. Wenn als Tonträgerschon die CD benutzt wird, dann dochbitte zum Vergleich als optisches Materialeine Holografie des Gemäldes, bei der je-der Pinselstrich in einer Reinheit undKlarheit zu erkennen ist, die jemand nichterreicht, der das Bild nachmalt. Wobei zubemerken bleibt, daß es so gute Holografi-en heute noch nicht gibt.
Und wenn beim optischen Material aufeinen Kunstdruck zurückgegriffen wird,dann sollte der entsprechende Vergleichaus dem Bereich des Hörsinnes das Gram-
408
mophon sein. Dann kommt man nämlichauch beim Tonträger ohne Elektronik aus.
Zum Schluß sei wieder ein paar Schrittezurückgegangen, wo der Versuch unter-nommen wird, sich dem Medium zu nä-hern. Die Frage sei also erlaubt, worin sichder Tonträger von einem Original unter-scheidet. Genau darauf geht HansjörgHofrichter aber nicht ein. Betrachtet seidas von ihm erwähnte Beispiel des Einsat-zes von Musik im Eurythmieunterricht.Schockiert hat mich die Aussage, es seiunmenschlich, den begleitenden Klavier-spieler beim Üben immer wieder zu un-terbrechen. Da ich selbst kein Eurythmistund auch kein Klavierspieler bin, habe icheinmal an unserer Schule nachgefragt, obdas denn wirklich so wäre. Hätte Hans-jörg Hofrichter sich diese Mühe auch ein-mal gemacht, so hätte er bestimmt diegleiche Auskunft bekommen wie ich. Die-se Unterbrechungen sind keineswegs un-menschlich, sondern vielmehr unbedingtnötig, wenn in diesem Bereich künstle-risch gearbeitet wird. Gerade ein Klavier-spieler übt sehr selten ein ganzes Stück,sondern meistens nur kurze Teile daraus.Und die sind manchmal nicht länger alsein bis zwei Takte, die immer wieder undwieder geübt werden, bis daraus ein Gan-zes werden kann. Und so fügt sich das eu-rythmische Üben harmonisch in das mu-sikalische Erüben ein.
Der Unterschied zwischen einem tat-sächlich vorhandenen Klavier und einerStereoanlage liegt vielmehr in der Tatsa-che, daß die Stereoanlage im Gegensatzzum Klavier einzig und allein den Hör-sinn anspricht. Alle anderen Sinne sindausgenommen.
Und dies ist das Manko oder Übel, mitdem es sich auseinanderzusetzen gilt,wenn über den Einsatz von Stereoanlagenin Waldorfschulen nachgedacht wird.
Daß die Isolierung des Hörsinns wirk-lich den Kern des Problems darstellt, wirdeinem deutlich, wenn man einmal über-legt, warum– viele Stereoanlagen mit Mengen von un-
nötigem optischem Schnickschnackausgestattet sind,
– Jugendliche für teures Geld sogenannteLive-Konzerte besuchen, bei denen siedie Künstler nur über Verstärkeranla-gen hören und fast gar nicht sehen,
– selbst Playback-Konzerte, bei denen dieKünstler gar nicht selbst singen, son-dern nur so tun, gut besucht sind,
– Musiksender im Fernsehen, die nur Mu-sikvideos senden, einen enormen Zu-schaueranteil haben,
– die Qualität der Tonwiedergabe immerweiter verbessert wurde, ohne echtenErlebniszuwachs zu bekommen.Im Gegensatz zu Hansjörg Hofrichter,
der im letzten Absatz des Artikels be-hauptet, er suche »ein realistisches, dieganze Wirklichkeit zeichnendes Bild«,kann ich ein solches Bemühen leider nichterkennen. Aus dem Artikel wird für michnur deutlich, daß er seine Beurteilung derTonträger und Stereoanlagen schon abge-schlossen hat. Ob eine solche Verurteilungrichtig oder falsch ist, vermag ich mit mei-nem heutigen Wissens- und Kenntnis-stand nicht zu klären. Ich kann nur fest-stellen, daß sie auf falschen Voraussetzun-gen beruht, und das gereicht dem Musik-unterricht und der Akzeptanz der Wal-dorfschulen in der Öffentlichkeit sichernicht zum besten.*
Michael Heisler
* Der Autor ist Ingenieur für Nachrichtentech-nik und Berufsschullehrer. Zur Zeit unterrich-tet er als Physik- und Mathematiklehrer an derFreien Waldorfschule Minden.
409
Waldorfpädagogik im»Spiegel«
Es scheint wirklich ein Zeichen unsererZeit zu sein, daß immer mehr Menschenvom guten Kuchen der Waldorfpädago-gik ein schönes Stück abbekommen wol-len. Über Geschmack, Konsistenz undAussehen dieses Kuchens hört man ver-mehrt Lob, und die Nachfrage wächst. Er-staunlicherweise scheint sich aber kaumjemand mit der Rezeptur zu beschäftigen.
Viele konsumieren die Pädagogik anden Freien Waldorfschulen wie das Brotdes Bäckers, für dessen hingebungsvolleArbeit sie sich höchstens dann interessie-ren, wenn irgendwelche Skandalmeldun-gen in den Medien erscheinen. Noch selte-ner bedenkt man, daß auch dem Bäckerseine Zutaten gegeben sind durch denFleiß des Bauern, zuletzt jedoch durch einviel umfassenderes Wirken der Natur undihres Schöpfers. Wem solche Gedankennur ein müdes Lächeln entlocken, dersucht meist auch keinen Sinn in den Ent-wicklungsgesetzen der Kindheit und inden Bedingungen, unter denen die Erzie-hung zu freien und verantwortungsbe-wußten Menschen gelingen kann.
Die hier angedeutete Haltung liegt un-seres Erachtens auch dem Artikel überWaldorfpädagogik im Spiegel-Special(November 1996) zugrunde. »Wachsenmit der Roggensaat. Carsten Holm übergeistig freie Beine, schreinernde Mädchenund den Erfolg eines Modells (Waldorf-schulen)«, S. 34 – 40. Er wurde an alle Mit-glieder des Trägervereins unserer Schulezusammen mit der Einladung zur Mitglie-derversammlung (7.12.96) verschickt. Ober tatsächlich so positiv über die Waldorf-pädagogik berichtet, wie manche meinen,soll hier in Frage gestellt werden. Denn
wer die ersten Abschnitte dieses Artikelsgründlich liest, wird des Widerspruchsgewahr, der in ihm liegt.
Warum? Zu Beginn wird eine menschli-che Eigenschaft, die früher einmal zu denTugenden zählte, die aber heute wohlnicht mehr modern ist (»Sich-Zurückneh-men« als eine Form der Selbstlosigkeit),als Voraussetzung für den Eintritt eines»Ungläubigen« in die »Waldorf-Welt« er-kannt. Daß der Verfasser diesen Vorsatznicht lange durchhält, ist dann schon indem nächsten Satz zu erkennen, in wel-chem er mit einem einzigen Schwert-streich und ohne weitere Einleitung diehundertfünfzigprozentigen, kreuzfahren-den »Waldorferianer in ihrem Kampf ge-gen das Künstliche und das vermeintlichNatürliche« niederschlägt. Hier muß mansich wirklich fragen, wen er damit treffenwill. Das können doch eigentlich nur die-jenigen Menschen sein, die mit einer ge-wissen Ernsthaftigkeit und persönlichenKonsequenz die Inhalte der Waldorfpäd-agogik aufnehmen und in ihrem Lebenbewußt umzusetzen versuchen. Logi-scherweise sind damit auch all diejenigengemeint, die an der Gründung und demFortleben einer Waldorfschule mit Begei-sterung, Freude und Überzeugung mit-wirken, weil sie diese Arbeit als etwasSinnvolles und Wichtiges für ihr Kindund vielleicht auch für die allgemeine ge-sellschaftliche Entwicklung sehen.
Gemeint sind auch, und das wird imweiteren deutlich gemacht, die Anthropo-sophen und die Anthroposophie. Dennnun bemüht sich der Verfasser eifrig fest-zustellen, daß es nur etwa fünf Prozentsolcher »esoterischen Guru-Jünger« sind,die in Steiners Nachfolge dessen unsinni-ges, haarsträubendes Gefasel glaubenund damit die arme Waldorfgemeinschaftnerven. »Diese Hundertfünfzigprozenti-
410
gen gibt es eben überall«, bedauert er. Esscheint aber, daß man sich in der Redakti-on des »Spiegel« mit weitaus niedrigerenProzentsätzen zufrieden gibt. Denn vongutem Journalismus zeugt es keineswegs,Aussagen von Rudolf Steiner oder ande-ren Menschen aus ihrem Zusammenhangzu reißen und in der Argumentation zumißbrauchen. Dies zeugt vielmehr vonmangelnder Bereitschaft, sich mit dem,was man nicht versteht, auseinanderzu-setzen. Dies wird noch deutlicher in derBeschreibung der »Waldorfgemeinde«,mit ihren »Exerzitien« und ihren lächerli-chen Sorgen um die Auswirkungen vonMickey-Mouse oder E. T. sowie ihrer un-verständlichen Ablehnung von Fußball.
Zum Glück, resümiert Herr Holm,braucht das aber niemand zu glauben,und mit ein wenig Gelassenheit lassensich all diese »Verrücktheiten« ertragen.
Eine Antwort auf die Frage, ja auch dieFrage selbst, woraus die Waldorfpädago-gik denn eigentlich ihre Inhalte nimmt,bleibt der Verfasser schuldig. Mit gutemGrund: Denn dann müßte er sich ja inten-siver mit der Materie befassen. Er indesbegnügt sich mit der Botschaft an die El-tern: Liebe Eltern, Sie brauchen sich nichtzu interessieren, sich innerlich zu enga-gieren lohnt sich nicht; üben Sie einfachGelassenheit und sehen Sie über all denUnfug hinweg, der Rest ist ganz passabel.
Diese Botschaft jedoch kommt unausge-sprochen daher, denn sie ist keineswegsfür das wache Bewußtsein bestimmt. Sietrifft auch nicht die Wirklichkeit der Wal-dorfpädagogik, sie spiegelt nur die Hal-tung der Menschen wieder, die wie Car-sten Holm zu bequem sind, ihre eigeneWeltanschauung mit einer anderen zukonfrontieren, um sie dadurch auch inFrage stellen zu können. Sie können sichnicht zurücknehmen, weder in ihren Ur-
teilen noch in ihrem Konsumverhalten:Sie wollen alles haben; auch wenn sie des-sen geistige Wurzeln ablehnen. DieserMangel an wirklicher Bereitschaft, sichmit etwas bisher Unbekanntem wahrhaf-tig auseinanderzusetzen, erschöpft sichdann in einer allgemeinen Kritiksucht.
Die Wirklichkeit der Waldorfpädagogikläßt sich in diesem oberflächlichen Jour-nalistenstil eben nicht beschreiben. Es gibtwesentlich fundiertere und auch kriti-schere Auseinandersetzungen mit ihr.Aber das liest sich eben nicht so leicht; daserfordert eine Anstrengung, zu der vieleheute nicht mehr bereit sind.
Die Wirklichkeit der Waldorfpädagogikexistiert aber ganz sicher seit über 77 Jah-ren nicht deshalb, weil angeblich 95 Pro-zent der Eltern sich ihr gegenüber in Ge-lassenheit üben. Die Waldorfpädagogikist deshalb Wirklichkeit, weil viele Elternsich deren Quellen durch intensive innereund äußere Tätigkeit erschließen. Unddiese Quellen, diese tragende, impulsie-rende Kraft ist die Anthroposophie, obman das wahrhaben will oder nicht. Ausdieser Geisteswissenschaft ging die Wal-dorfpädagogik unzweifelhaft hervor, undaus ihr muß sie auch stets neu geschöpftwerden. Es ist jedoch nicht nur die Wal-dorfpädagogik, die aus dieser Quelleschöpft. In Medizin, Kunst, Therapie,Landwirtschaft und vielen anderen Le-bensbereichen wirkt die Anthroposophieimpulsierend. Dies ist die eigentliche Ur-sache dieses »erfolgreichsten alternativenPrivatschulversuchs in der modernen Ge-schichte der Pädagogik«.
Ganz sicher lebt jede Waldorfschuleauch aus den Kräften der vielen helfendenEltern, die sich nicht mit der Anthroposo-phie verbinden. Aber auch diese Kräftekommen aus Quellen, die ihr nicht fernliegen. Immer gehört zuerst dazu der gute
411
Wille; er führt zu echtem, kritischem In-teresse, zu Verständnis, Hilfsbereitschaftund schließlich zu der Erkenntnis, daß essich lohnt, an diesem vielschichtigen Pro-jekt mitzuarbeiten.
Diesen Gedanken können Sie ruhig ein-mal auf sich wirken lassen: wie etwas der-artig wirksam werden kann in der Kultur,daß auch nach einem dreiviertel Jahrhun-dert und trotz vieler diffamierender An-griffe von außen die Quellen dieses Im-pulses noch nicht annähernd erschöpftsind! Demgegenüber ist so ein »Spiegel«-artikel völlig bedeutungslos. Das wäre füruns auch so geblieben, wenn er nicht analle Vereinsmitglieder verteilt wordenwäre. Vielleicht regt dieser Umstand janicht nur unsere Gedanken an, sondernführt zu einem breiteren Gedankenaus-
tausch über die Grundlagen der Waldorf-pädagogik. Prüfen Sie aber bitte dochselbst, ob das, was in diesem Artikel ge-schrieben ist, mit Ihren eigenen Erfahrun-gen übereinstimmt.
In einem Punkt jedenfalls kann manCarsten Holm rechtgeben: Die Waldorf-pädagogik ist ein Versuch. Ob aber dieserVersuch fruchtbar bleibt, wird damit zu-sammenhängen, ob wir die Waldorfpäd-agogik als Herausforderung an uns auchweiterhin ernst nehmen.
Johannes Hanel/Johannes Kaiser
P.S.: Wenn sie diesem Schreiben bis hierher ge-folgt sind, gehören Sie mit größter Wahrschein-lichkeit auch schon zu den »Hochprozentigen«.In jedem Fall sind wir für Rückmeldungendankbar. Anschrift : Johannes Hanel, Schloß-berg 3, 67697 Otterberg.
Offener Brief an den Verlag UeberreuterSehr geehrte Damen und Herren,in Ihrem Verlag ist kürzlich das »Schwarz-buch Anthroposophie« der Brüder Guidound Michael Grandt erschienen. Es hatnachhaltig meine Hochschätzung für Ih-ren Verlag als Bürgen für Qualität in Fragegestellt. Wie konnten Sie sich nur für einesolch unseriöse Farce hergeben?
Nach den Ankündigungen erwartetman sensationelle Entdeckungen (»… da-bei kommen wir zu höchst beunruhigen-den, ja geradezu erschreckenden Erkennt-nissen«, S. 10). Schlägt man das Buchdann auf, muß man feststellen, daß es sichkeineswegs um eine seriöse Aufarbeitungeines gestellten Themas handelt, sondernum eine – im Niveau auf niedrigster Stufe– eingeleitete Diffamierungs-Kampagnegegen Rudolf Steiner, die Anthroposophieund die Waldorf-Schulbewegung. Das ge-samte Buch ist ein anschauliches Beispiel
journalistischer Manipulation, in der ge-zielt tendenziös recherchiert, haarsträu-bend verdreht und ungerechtfertigt beur-teilt wurde. Das wird auch zutreffend vonden maßgeblichen Pressevertretern so ge-sehen (vgl. die diversen Artikel zu demBuch). Das Inhaltsverzeichnis nennt sie-ben Kapitel, die unterbrochen sind vondrei Einschüben, welche alle drei mit »DerWaldorfschock« betitelt sind.
In den sieben Kapiteln kommen ver-schiedene Aspekte anthroposophischenWirkens zur Darstellung; diese folgt in derRegel dem Schema: 1. These, nämlich dieAnsicht der Autoren; 2. dazu Zitate ausdem Werk Rudolf Steiners oder anderenWerken, ohne auf den Zusammenhangeinzugehen, aus dem sie stammen, was zufolgenschweren, falschen Behauptungenführt;1 3. bestätigende »Stimmungsma-che«, die sich als Urteil der Autoren tarnt;
412
ein Beispiel: »… uns wird ganz flau imMagen, wenn wir, gewiß als medizinischeLaien, uns vorstellen, in die Hände einesArztes zu gelangen, der sicher seine fach-liche Qualifikation haben mag, seine gei-stigen Ergüsse jedoch aus einem solch ge-arteten Schwachsinn schöpft« (S. 59).
ln den konstruierten Parallelen zwi-schen der Anthroposophie und gewissenStrömungen der Gegenwart (Okkultis-mus, Rassismus, Satanismus), die die Au-toren zu kennen vorgeben, werden ent-scheidende Unterschiede zwischen diesenund der Anthroposophie mit keinem Worterwähnt, insbesondere fehlt das von Ru-dolf Steiner in allen einschlägigen Schrif-ten geforderte Streben nach Vervoll-kommnung des moralischen Wesens desMenschen, das allein vor undurchschau-ten und unkontrollierten Einflüssen undHandlungen schützen kann.
Von journalistischer Sorgfalt bzw. einerzulässigen und begründeten Beweisfüh-rung kann auch dort nicht die Rede sein,wo das Buch die verwerflichen Taten desNaziarztes Sigmund Rascher, der sich»nie zur Anthroposophie bekannt und sei-ne Waldorfschulzeit stets verschwiegenhat« (S. 197), als gewichtiges Argumentfür die Rechtslastigkeit der Anthroposo-phen anführt.
Wie kommen also zwei Brüder, die sich
mit Jugendsekten, Okkultismus und Sata-nismus beschäftigen (Klappentext) dazu,ein derart »schwarz« eingefärbtes, nichtim entferntesten objektives Bild zu zeich-nen? Die Antwort ergibt sich m. E. beimBetrachten der drei eingeschobenen Re-portagen.
Die erste beschreibt aus Sicht betroffe-ner Eltern auf zehn Seiten deren negativeErfahrungen mit der Waldorfschule. DerLeser bleibt allerdings im unklaren, wasan den Vorwürfen stimmt und was nicht.Eine Stellungnahme der Schule und desKindergartens wurde nicht eingeholt.
Der zweite Einschub liefert mit 46 Sei-ten den Schwerpunkt des Werkes. Hiergeht es um Erlebnisse, die schwer erzieh-bare Kinder in einem Waldorfinternat ge-macht haben sollen. Der Leser fragt sichspätestens beim anschließend in epischerBreite dargestellten Verlauf eines Prozes-ses, der gegen die Mutter eines Kindeswegen nicht gezahlter Internatskosten ge-führt wird, was denn das mit dem Themanoch zu tun haben soll. Vollends zum Rät-sel wird dieser Einschub durch die dannfolgende Darstellung der Kontaktaufnah-me der Autoren zu der Einrichtung. Hiergeht es nicht mehr um eine »zeitgemäßeAuseinandersetzung mit der Weltan-schauung der Anthroposophie« (S. 9),sondern um etwas ganz anderes. Bei sorg-fältiger neutraler Recherche hätten dieBrüder Grandt auch erfahren können, daßSchloß Hamborn von den staatlichen Ju-gendämtern immer wieder positive Stel-lungnahmen erhalten hat und erhält.
Im dritten Einschub wird von einemSymposium zur Anthroposophie, abge-halten in Paderborn am 22.6.1996, berich-tet. Interessant ist, daß man immer wiederderselben, zahlenmäßig aber recht kleinenGruppe von Aktivisten gegen die Wal-dorfschulen begegnet. Der Veranstalter
1 Zum Beispiel S. 153: »Ahriman« wird zum»Lenker für die äußeren Mächte und geistes-führungen unseres Zeitalters« (ohne Quellen-angabe zitiert). Daraus folgern die AutorenGrandt: »Damit schafft der Begründer der An-throposophie einen neuen Satanismus …« –Was für eine ungeheuerliche Behauptung, dieSie mit dem Vertrieb des Buches zu Ihrer eige-nen gemacht haben!Zum Beispiel S. 155, eine angebliche ÄußerungRudolf Steiners, die aber nachweislich aus demMunde »Luzifers« in einem von Rudolf Steinergeschriebenen Drama stammt und in seinerAussage genau das Gegenteil meint.
413
des Symposiums, Reinhard Wiechoczek,der die Resolution der IzAK (Initiative zurAnthroposophie-Kritik) an eine Reihenamhafter Vertreter in Politik und Kulturverschickte, erlebt eine ziemliche Enttäu-schung, da die Resolution selbst von dpa»verschwiegen« (S. 299) wird. Wiechoczekvermutet: »Ist es wirklich so, wie Kritikerbehaupten, daß Behörden und Politikergar nicht an der Aufdeckung dieser Miß-stände interessiert sind, weil sie selbstzum großen Teil mit diesen alternativenSchulen liebäugeln? Ist die Lobby der An-throposophen wirklich so groß?« (S. 299).
Anordnung und Aufbau dieser dreiEinschübe legen ganz offensichtlich denSchwerpunkt auf die Ereignisse um dasInternat Schloß Hamborn und hier spezi-ell auf die prozeßführende Mutter, diesich nach meinen Kenntnissen jetzt dieVerfolgung der Anthroposophie bzw.Waldorfschulbewegung, auch mit denMitteln unwahrer Behauptungen, zumZiel gesetzt hat. Hier ist wohl der Aus-gangspunkt für dieses »schwarze« Werkzu suchen. Nach den Enttäuschungen mitdem Internat und den »schlechten« Erfah-rungen mit der Presse sorgt man dafür,daß halt ein Buch geschrieben wird undkann mit der sensationsheischenden Ent-hüllungsbotschaft, »daß wir nach Erschei-nen des Buches bald wissen werden, wieeinflußreich die Anthroposophen wirk-lich sind und welche Mittel sie anwendenwerden, um diesen Bericht zu dementie-ren«, aufwarten (S. 299). Warum setzendie Brüder Grandt mit ihrem Buch irgend-
etwas in die Welt und erwarten im voraus,daß die Betroffenen dementieren? Ist das»moderner, objektiver Journalismus«?Wer sehen will, wie das, was die Autorendarstellen wollen, wirklich ist, kann an-throposophische Einrichtungen selbstaufsuchen oder sich im veröffentlichten,allgemein zugänglichen Werk Rudolf Stei-ners informieren.
Vielleicht muß man in unserer Zeit, inder man die Meinungsbildung gerne an-deren überläßt, immer mehr mit solchenflachen Werken rechnen. – Noch 1985 ur-teilte Peter Brügge in seiner Reportageüber die Anthroposophen so: »Phantastensind das ja meist nicht. Unverkennbar übtSteiners Werk gerade auf Vertreter strengempirischer akademischer Disziplineneine besondere Anziehungskraft aus. Ichhabe höchst qualifizierte Anhänger derAnthroposophie … gefunden« (S. 20).
Nun, sehr geehrte Verlagsleiter, verste-hen Sie vielleicht meine eingangs gestellteFrage besser.
Christoph Michael Hofmannehemaliger Geschäftsführer von
Schloß Hamborn, jetzt GeschäftsführerVerein Filderklinik
Anmerkung der Redaktion: In Deutschland ha-ben die Grossisten die Auslieferung des Bucheseingestellt. In der Schweiz wird das Buch der-zeit nicht verkauft; in Österreich wird es zurZeit mit fünf geschwärzten Stellen verkauft.Genauere Auskünfte gibt der Bund der FreienWaldorfschulen, Tel.: 0711-21042-22 (Frau Gro-the) oder Rechtsanwalt Bader, Tel.: 0711-2364787.
414
BUCHBESPRECHUNGEN – LITERATURHINWEISE
Extrastunde
Audrey McAllen: Die Extrastunde. Zei-chen- und Bewegungsübungen für Kindermit Schwierigkeiten im Schreiben, Lesenund Rechnen. 2., erw., überarb. und neuübersetzte Auflage. 148 S., geb. DM 39,–.Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart1996.
Immer mehr Kinder haben es schwer,Schulkinder zu werden. Zum einen ge-lingt es sie wegen ihrer Verhaltensauffäl-ligkeiten nur mühsam, in einer Klasse un-ter vielen Mitschülern einzugliedern, zumanderen hindern ihre Lernschwierigkei-ten sie daran, in der Klasse mitzukom-men.
Nun wird an vielen Orten versucht, die-se Kinder neben dem Unterricht zu för-dern. Audrey McAllens Buch »Die Extra-stunde« stellt solche Hilfen dar. Als Klas-senlehrerin arbeitete sie an einer engli-schen Waldorfschule und wandte sichdann hilfebedürftigen Kindern als Förder-lehrerin zu.
Die überarbeitete, zweite Auflage ihresBuches wurde von Uta Stolz übersetzt, dieselber als Förderlehrerin tätig ist. Dies hatsicherlich viel dazu beigetragen, daß dieDarstellungen verständlicher sind als inder vormals erschienenen Übersetzungder ersten Auflage.
Audrey McAllen versucht zunächst,möglichen Ursachen nachzugehen, wes-halb heute so viele Kinder Lernproblemeder einen oder anderen Art haben. Be-trachtet man die Art und Weise, wie unse-
re Kinder heute aufwachsen, so stößt manauf vieles, was durch unsere moderne Zi-vilisation bedingt ist. Die langsame undstetige Erweiterung des Wahrnehmungs-horizonts, die, ausgehend von der Wiege,dem Bettchen, fortschreitet zum Zimmer,zur ganzen Wohnung und dann darüberhinaus, hat sich verwandelt in ein Erfor-schen von Inseln – die der Großeltern, diedes Kinderarztes usw. Von einer zur ande-ren gelangt man durch Autofahrten, wo-bei die Welt draußen vorbeisaust. Die al-ten Kinder- und Ballspiele sind in der Re-gel verschwunden und mit ihnen das Er-üben körperlicher Tüchtigkeiten, wie Seil-springen, Hüpfen, Balancieren, also Ge-schicklichkeiten in Beinen, Armen, Hän-den und Fingern. Auch die Welt der Tech-nik und Medien beeinflußt die Ausbil-dung des Sinnes- und Wahrnehmungsor-ganismus.
In der kindlichen Entwicklung werdenBewegungsmuster erübt, überwunden,durch neue ersetzt usw., manche werdenauch übersprungen – man denke etwa andas Robben und Krabbeln –, bis schließ-lich der Körper der Seele als mehr oderweniger gutes Instrument zur Verfügungsteht. Die unterschiedlichsten Einflüssekönnen die Beherrschung der eigenenLeiblichkeit beeinträchtigen, und Unreife-zeichen treten dann im Schulalter zutage,z. B. im Gebrauch oder im Zusammen-spiel von linker und rechter Seite, vonoberem und unterem Menschen.
An gezielten, kleinen Aufgaben, dieman Kinder ausführen läßt, können ihreSchwierigkeiten deutlich werden, und es
415
zeigt sich dabei eine Richtung, in der es zuhelfen gilt. Eine solche Aufgabenreihewird als »erste Extrastunde« vorgestellt.Das Augenmerk wird, um einige Beispielezu nennen, darauf gelenkt, ob es nochfrühkindliche, nicht überwundene Bewe-gungsmuster gibt, ob bestimmte Entwick-lungsschritte im Ergreifen des Bewe-gungsorganismus vollzogen sind, welcheDominanz sich bei Auge, Ohr, Hand undFuß herausgebildet hat, wie Hand, Augeund Sprache koordiniert werden, ob dieAugenbewegung im Verfolgen von For-men sprunghaft ist usw.
Im zweiten Teil des Buches wird eineReihe von Übungen beschrieben. Eine the-matische Gliederung erleichtert die Hand-habung. Hilfreich sind auch die Beobach-tungen, die jeweils im Anschluß zu einerÜbung geschildert werden. Viele Elemen-te des Waldorflehrplanes wurden aufge-griffen, u. a. Formenzeichnen, geometri-sche Übungen, Malen. Insbesondere aberist die Zielrichtung, die Wahrnehmungs-funktionen zu koordinieren und den Be-wegungsmenschen zu fördern, der ggf.durch eine mangelhafte Strukturierungdes physischen Leibes eingeschränkt ist.
Strukturiert werde der physische Leib,so schreibt Audrey McAllen, indem derMensch einem archetypischen Pfad folge,wenn er seinen Körper nach und nach er-greift und zu gebrauchen lernt. Von Kin-derzeichnungen kennen wir den graphi-schen Niederschlag, wenn bestimmte Ent-wicklungsstadien erreicht sind.
Das Buch enthält viele Übungen, diezugleich Anregungen und Aufforderun-gen sind, sich mit den Hintergründen zubefassen. Dazu ist weiterführende Litera-tur angegeben. Ein Beispiel möchte ichherausgreifen. Es wird die Farbneigungdes Auges untersucht, da das linke Augezur Farbe Blau und das rechte zur Farbe
Rot eine objektive seelische Beziehunghabe.
Wer mit Kindern arbeitet, die Lern-schwächen haben, oder wer sich für die-ses Aufgabengebiet interessiert, wird si-cherlich durch die »Extrastunde« berei-chert, und sein Blick wird vielleicht in un-gewohnte Richtungen und Gebiete ge-lenkt. Möge das Buch in diesem Sinne vie-le Menschen anregen und sie in ihrer Ar-beit unterstützen. Ernst Bücher
Der Zahnwechsel
Armin J. Husemann: Der Zahnwechseldes Kindes. Ein Spiegel seiner seelischenEntwicklung. 130 S., geb. DM 36,–. Ver-lag Freies Geistesleben, Stuttgart 1996.
Armin J. Husemann hat uns mit einem Er-gebnis seiner Forschungstätigkeit alsSchularzt einen wertvollen Beitrag zurmedizinischen Menschenkunde gegeben.Im Sinne seiner sonstigen Bemühungenkann man die nicht übermäßig ausladen-de Monographie als einen Beitrag zur»plastisch-musikalischen Menschenkun-de« bezeichnen, von der schon sein WerkDer musikalische Bau des MenschenZeugnis ablegt.
Der Rahmen, den Husemann abschrei-tet, übersteigt das, was man vom Titel hererwarten würde. Zuerst wird das mensch-liche Gebiß in seinem Aufbau geschildert,wobei der Vergleich mit einigen Säugetie-ren hilft. Wohlbekannt ist die Feststellung,daß bei den Tieren verschiedener Stämmeeinzelne Zähne oder Zahngruppen starkbetont sind, während das beim Menschennicht der Fall ist: Wir kennen die Zuord-nungen Nager – Schneidezähne, Wieder-käuer – Mahlzähne, Raubtiere – Eckzähnerecht gut und legen sie mancher Unter-
416
richtsstunde zugrunde. Für Husemanngibt das zunächst den Anlaß, diese Zahn-gruppen den drei Gliedern der menschli-chen Natur zuzuordnen, um dann die Un-spezifiziertheit des Menschengebisses tie-fer zu begründen. Was aber könnte der»Urzahn« sein – wenn es so etwas in Ana-logie zur Goetheschen Urpflanze gibt?Husemann entwickelt – hier anknüpfendan den großen niederländischen ForscherBolk – daß der »Prämolare«, daß heißt der4. und 5. Zahn jeder Zahnreihe beim Er-wachsenen, dieser Proteus (Goethe) ist,der in alle Zahnformen schlüpfen kann.Seine Verwandlungsfähigkeit sowohl inRichtung der Schneide- als auch derMahlzähne wird belegt.
Husemann, immer besorgt, die Begriffs-welt anthroposophischer Menschenkundephänomenologisch zu begründen, gibt indem Buch erhellende Einblicke, an wel-chen Stellen in der Zahnbildung und -um-bildung ätherische, astrale und Ich-Ein-flüsse gefunden werden können. Mögli-cherweise erschließen seine knappen Be-griffsklärungen sogar manchem Leser die-se Begriffe der anthroposophischen Men-schenkunde erstmals klar. Mit diesen Be-zügen werden viele anatomisch-pädago-gischen Hinweise Rudolf Steiners am Bildund an der Entwicklung der Zähne besserverständlich. Charakteristischerweise tre-ten die genannten Prämolaren erst imZahnwechsel sichtbar in Erscheinung.Was man als Typus des Zahns bezeichnenkann, verbirgt sich also bis zu einem ho-hen Reifezustand des Gebisses noch ganz.Das Wesen der Zähne tritt nicht frühzeitig,sondern erst bei fortgeschrittener Ent-wicklung in Erscheinung. Ebenso ist es mitder Individualtendenz des Einzelgebisses,die erst mit den zweiten Zähnen zur Gel-tung kommt, wenn das vererbte Mustereiner Eigenform weicht.
Eine schöne Steigerung erfährt die Be-trachtung, wenn Husemann Zusammen-klänge von Zahnbildungsgesetzen undden Zahlengesetzen der Musik aufsucht.Recht ausführlich widmet er sich den Zu-sammenhängen von Milchgebiß und Pen-tatonik einerseits, von zweitem Gebiß undDiatonik andererseits. Den krönendenAbschluß findet die Arbeit in einer Be-trachtung der Kunstentwicklung von derRomanik zur Gotik – zu der auch die gu-ten Illustrationen wesentlich beitragen.Husemann zeigt, wie die Wandlung derarchitektonischen und sonstigen Aus-drucksformen von damals den Verwand-lungsweg des Kieferbogens vom kindli-chen zum Erwachsenengebiß widerspie-gelt. Darin findet man ein sprechendesBeispiel für das Motiv, in der Individual-entwicklung einen Spiegel der Mensch-heitsentwicklung zu sehen.
Um einen Eindruck von der begriffli-chen Dichte in Husemanns Schrift zu ge-ben, seien abschließend einige Sätze überdie seelische Kindesentwicklung nachdem 7. Lebensjahr wiedergegeben, diedem Rätselbegriff Autorität eine neueWendung geben: »In dieser Zeit, … wennder Lehrer oder die Lehrerin in den Som-merferien Briefe erhalten, da lebt in dermusikalischen Sexten-Stimmung desAstralleibes der liebevolle Aufblick zumErwachsenen, ja die Septim-Stimmungdes ›So werden wollen wie der Lehrer‹.Der Lehrer selbst verkörpert im Seelenleibdes Kindes die Oktav. Er wird Repräsen-tant des höheren Menschseins, zu demdas Kind beginnt zu streben. Damit ist diefraglose Hingabe an den Erwachsenen,die das Nachahmungsalter kennzeichnet,verschwunden. Kinder, die den Höhe-punkt des Zahnwechsels überschrittenhaben, beziehen jeden Erwachsenen mitgenauem musikalischem Sinn auf den
417
Grundton, den sie in sich gefunden haben,und sie prüfen, ob der Erwachsene Oktav-Qualitäten verkörpert. Das heißt nichtsanderes als: ob in seinem Leben die Richt-kraft von Idealen für das Kind spürbar ist– ob der Erwachsene selbst zu seiner Ok-tave hinstrebt, die doch dieselbe wie diedes Kindes ist.
Damit haben wir rein musikalisch be-schrieben, was Rudolf Steiner in einemneuen, leicht mißverständlichen Wortge-brauch ›Autorität‹ nennt.« (S. 86)
Georg Kniebe
Botschaften einerAutistin
Adriana Rocha/Kristi Jorde: Aus der Stilleder Ewigkeit. 350 S., tb DM 14,90. Bastei-Lübbe, Bergisch-Gladbach 1996.
Unter den zahlreichen Veröffentlichungen»schwellenüberschreitender« Erfahrun-gen nimmt der jüngst erschienene Berichtdes autistischen Mädchens Adriana undihrer Mutter eine herausragende Stellungein. Was zunächst beginnt als ein nichtungewöhnlicher Kampf der Eltern umEntwicklungschancen für ihr Kind,nimmt eines Tages eine dramatische Wen-dung, als sich mit Hilfe der »facilitatedcommunication«, des gestützten Maschi-nenschreibens (FC), zunächst ein Türspaltöffnet, durch den die Eltern einen Blick indas Innere der Tochter werfen können.
Während sich der Türspalt allmählichimmer weiter öffnet, gerät das Weltbildder Eltern aus den Fugen; ein Stützpfeilerihrer normalen Welt nach dem anderenwird abgebaut: zunächst das materialisti-sche Grunddogma vom Seelenleben alseiner Funktion des Körpers. »Ich handleaus einem erbärmlichen Körper heraus«,schreibt Adriana, und in mühsamen
schriftlichen Dialogen mit der Mutterzeigt sich eine Persönlichkeit, die nichtnur über verblüffende Lese- und Rechen-fähigkeiten verfügt, sondern auch überkomplexe naturwissenschaftliche Kennt-nisse unerklärlicher Herkunft.
Ihren Autismus führt die Neunjährigeauf einen eigenen, im Mutterleib gefaßtenEntschluß zurück. Immer deutlicherkommt Kristi, die Mutter, zu der Erkennt-nis, daß sie selbst die Lernende ist, undnicht das Kind.
Dann beginnt Adriana von ihren frühe-ren Existenzen zu schreiben, und wäh-rend Kristi in einer Art ständigem Schock-zustand um Verständnis ringt, reiht sichein Evidenzerlebnis an das andere. Daeine in Erwägung gezogene neuropatho-logische Erklärung keine Grundlage fin-det und Kristi der Tochter bedingungslosvertraut, bildet sich nun auf der Grundla-ge des Reinkarnationsgedankens eine völ-lig neue Sicht der Zusammenhänge, wo-bei sich auch das Erwachsenen-/Kindver-hältnis endgültig umkehrt bzw. zweiglei-sig wird – äußerlich ist »Adri« nach wievor ein autistisches Kind, aus dem Inne-ren aber kommen Aussagen wie: »Meisterwird man durch Liebeswerke währendlanger Lebenszeiten« … »ich öffne dieHerzen der Menschen für Gott«, denn: »esist Zeit, den Plan zu enthüllen, die Herzender Menschen für Gott zu öffnen«.
Schließlich ist für Kristi noch ein letzterharter Brocken zu schlucken: Sie wird vonAdriana auf ihre »Geistberater« verwie-sen. Am Ende ist ihr Weltbild umgebaut,ihr Leben und ihre soziale Berufstätigkeithaben eine neue Grundlage erhalten: »DieLiebe ist der einzige wichtige Grund fürunsere Existenz«.
Bruno Sandkühler
418
Bedrohte Zukunft
Theo Colborn/Diane Dumanoski/John Pe-ter Myers: Die bedrohte Zukunft. 398 S.,brosch. DM 34,–. Droemer/Knaur, Mün-chen 1996.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann dieHerstellung unzähliger hochgiftiger Che-mikalien in einem unvergleichlichenWettbewerb der chemischen Industrie,die bis heute jährlich Millionen Tonnen zueinem großen Teil ungeprüfter syntheti-scher Stoffe in die Umwelt entläßt.
In den meisten Fällen entdecken Wis-senschaftler oft erst Jahrzehnte später dieFolgeschäden dieses unverantwortlichenHandelns. Hierbei denken wir an die Fol-gen der FCKW‘s, PCB‘s, DDT.
Wir alle, die heute Kinder haben, müs-sen sie inmitten dieser Gefahren großzie-hen und ein Vorbild an umweltbewußtemHandeln sein. Schon stehen wir inmittenvon mysteriösen Erkrankungen, Immun-schwächen, Lernschwächen, Verhaltens-störungen, Fruchtbarkeitsabnahme, Miß-bildungen etc. – Folgen von Umweltver-giftungen im weitesten Sinne.
Dieses Buch ist in größter Sorge um dieZukunft der Erde geschrieben und reprä-sentiert kritisch und nüchtern den gegen-wärtigen Stand der Forschung – für jeder-mann verständlich. Man übertreibt nicht,wenn man dieses Buch als den nächstenMeilenstein nach »Der stumme Frühling«von Rachel Carson (1962) wertet.
Auch dem Laien wird durch die einge-henden Beschreibungen klar, mit welcherChemikalienflut wir uns in Form von Pla-stik, Kosmetik, Haushaltsreinigern, Bau-stoffen, Nahrungsmittelzusätzen fast lük-kenlos umgeben und unser Leben undmehr noch das unserer Kinder bedrohen,da wir nicht wissen, welche Langzeitwir-
kungen sie haben. Wir sind alle aufgeru-fen, uns ein Bewußtsein zu bilden, mitwelchen Materialien wir uns umgeben,und auch Unbequemlichkeiten in Kauf zunehmen zugunsten unserer schon jetzt be-lasteten Zukunft, denn nach gut 50 Jahrenpausenloser Vergiftung und deren erstsichtbaren Folgen wird niemand mehr dieAugen schließen oder wegsehen können.Verantwortung für die Zukunft der Erdeübernehmen kann doch nur heißen: Er-kenntnisse in Taten umsetzen. DiesesBuch gibt uns konkrete, lebenspraktischeAnregungen, die jeder zumindest anfan-gen kann zu realisieren, und ist jedem, be-sonders allen, die Kinder bekommen undKinder erziehen, ans Herz zu legen.
Astrid Pampuch
Hieronymus Bosch –neu entschlüsselt?
Lynda Harris: Hieronymus Bosch und diegeheime Bildwelt der Katharer. Aus demEnglischen von Sylvia Sokolowski. 312 S.mit 73 farb. und zahlr. s/w Abb., LeinenDM 98,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart1996.
Ein neues Buch über die rätselhafte Bil-derwelt des Malers Hieronymus Bosch,wie es der Verlag Urachhaus jetzt vorlegt,erregt die Neugier, ist aber zugleich einWagnis. Denn daß es sich bei diesemKünstler der Zeitenwende zwischen Mit-telalter und Neuzeit um eine höchst diffe-renzierte spirituelle Aussage handelt, istschon lange klar, nicht zuletzt durch diegründlichen Untersuchungen von Clé-ment A. Wertheim Aymès (1961), der aufder Geisteswissenschaft Rudolf Steinersfußt, und von Wilhelm Fraenger (zwi-schen 1947 und 1963).1 Sie und andere For-
419
scher gehen davon aus, daß es trotz derKetzerbekämpfung durch die Kirche wei-terhin verborgene esoterische Strömun-gen gab, in denen aber verschiedene Rich-tungen zusammengeflossen sind. LyndaHarris unternimmt es nun, nachdem neu-erdings Spuren vom Gedankengut derKatharer bis ins 16. Jahrhundert entdecktworden sind, nachzuweisen, daß dasWerk Boschs aus dieser einen Ketzerströ-mung stammt und vielleicht dort auchseine Auftraggeber hatte.
Die Autorin stellt deshalb in ihrem Buchzunächst die dualistische Weltanschau-ung der Katharer vor. Dazu wertet sie einreiches Quellenmaterial aus, zieht jedochaußer den wenigen erhaltenen geheimenSchriften der Katharer auch die Inquisiti-onsprotokolle heran, obgleich bekannt ist,daß die Geständnisse häufig erpreßt unddadurch verfälscht wurden. So tauchenbei Lynda Harris die Aussagen auf, daßdie Katharer Jehovah und Satan gleich-setzten, daß Johannes der Täufer einKomplize und Elias ein Engel Satans ge-wesen seien (S. 145). Um das richtig einzu-ordnen, wäre eine Orientierung an dengeisteswissenschaftlichen AusführungenR. Steiners zu diesem Themenkreis nötiggewesen. Auch die profunden Darstellun-gen Deodat Rochés über die Katharerbe-wegung hätte die Autorin stärker berück-sichtigen sollen.2 Er erläutert u. a. die apo-kryphe Überlieferung von dem hohen En-gelwesen Satanael, dem ältesten SohnGottes, wodurch manche für uns be-fremdliche Auffassungen der Katharererst verständlich werden. Im übrigen be-hält Lynda Harris in ihrer Untersuchungjedoch wesentliche Grundtatsachen esote-rischer Erkenntnis, wie sie damals in vie-
len spirituellen Gemeinschaften und ebenauch bei den Katharern lebten, im Auge:daß es ein Leben nach dem Tode und eineWiedergeburt gibt; daß der Mensch außerseiner Seele einen Geist, ein höheres Selbstbesitzt, zu dem er sich aber erst auf-schwingen muß, und daß Christus derWegbereiter für eine solche Höherent-wicklung ist. Das sind fundamentale Fra-gen des geistigen Lebens auch für uns,und schon deshalb ist das Buch äußerstanregend.
Der Nachweis, daß Boschs »Botschaftvon der Lehre der Katharer in jedem ein-zelnen seiner Gemälde sichtbar« sei(S. 234), überzeugt jedoch nur teilweise.So meint die Autorin vermuten zu dürfen,daß schon die Vorfahren Boschs Katharergewesen seien (S. 59). – Zugegebenerma-ßen ist es schwierig, die BildmotiveBoschs eindeutig zu entschlüsseln. AberLynda Harris schlägt aufgrund ihrer dua-listischen Sicht einige extreme Deutungenvor: So sei der vierte König auf der »Anbe-tung der Könige« (Madrid) Herodes bzw.Satan (S. 71) statt die nicht in die Verkör-perung eingetretene »ewige Adamseele«,die dem Erscheinen Christi entgegensieht(Fraenger aufgrund einer alten Überliefe-rung). Der Verband am Bein des »Verlore-nen Sohnes« und anderer Gestalten mußnicht Zeichen der Sünde sein, so Harris(S. 155), sondern kann viel eher als Weihe-binde eines Einzuweihenden aufgefaßtwerden (Fraenger). Oder: Ist die allgegen-wärtige Eule Teufelssymbol (Harris S. 82ff.), Ausdruck der irdischen Intelligenz(Wertheim Aymès) oder meditative Ver-senkung in die nächtliche Urweisheit(Fraenger)? Am weitesten klaffen dieDeutungen aber auseinander, wenn dieAutorin auf der Paradiesestafel des sog.»Gartens der Lüste« (Madrid) die lichte,jugendliche Gottesgestalt zwischen Adam
1 Rezension über Fraenger in »Erziehungs-kunst« 1981, Heft 2, S. 102.
2 Vgl. »Erziehungskunst« 1994, Heft 5, S. 493.
420
und Eva nicht als den weltenschaffendenLogos, d. h. Christus erkennen will, son-dern als verkappten Satan.
Lynda Harris sieht jedoch in Bosch nichtnur den Höllenmaler. In den späteren Ka-piteln ihres Buches wendet sie sich jenenBildern zu, die Fragen der spirituellenEntwicklung des einzelnen Menschen be-handeln: So faßt sie die »Hochzeit zuKana« (Rotterdam) – über die Darstellungder entsprechenden Bibelstelle hinaus –als »Heilige Hochzeit« der Seele mit ihremhöheren Selbst auf, das als Kind mit Kelchund Weihebinde segnend im Mittelpunktdes Gemäldes steht – eine überzeugendeInterpretation (S. 158 f.). Dem stellt sie»Das Steinschneiden« (Madrid) gegen-über, in dem einem Manne das spirituellePotential aus der Stirnmitte entfernt wird.Es ist das »dritte Auge«, das hier die Ge-stalt einer Lotosblüte besitzt (S. 150).
Ein besonderes Augenmerk richtet dieAutorin auf die Altartafeln in Venedig.Hier scheint Bosch im Anschluß an dasapokryphe Henoch-Buch aus dem 1. Jh. n.Chr. das »Paradies des dritten Himmels«darzustellen, eine nachtodliche Durch-gangsstation (auch »neue Erde« und»Abrahams Schoß« genannt). Wir seheneinen Ort der Ruhe, in dem die Seelennachdenken, miteinander und mit ihren»Seelenvögeln« reden, von Engeln belehrtwerden. Von hier aus führt ein Tunnel ausLicht (in der zweiten Tafel) ins wahre,himmlische Paradies. Zu ihm streben dieSeelen, unterstützt von Engeln. Verschie-den weit sind sie aufgestiegen, die ober-sten lösen sich bereits in Licht auf (S. 198ff.). Auch im Mittelteil des sogenannten»Gartens der Lüste« erkennt Lynda Harrisdiesen Ort der Ruhe zwischen den Inkar-nationen, in dem die Seelen unter Tier-kreiswirkungen stehen (S. 101 und 206).All das ist in der Tat Gedankengut der Ka-
tharer, aber eben auch anderer esoterischerGemeinschaften, von denen es gerade inden Niederlanden damals etliche gab.
Noch eine interessante Einzelheit sei er-wähnt, die Lynda Harris herausgefundenhat: Der fliehende Jüngling bei der Gefan-gennahme Jesu (linker Außenflügel der»Versuchung des Hl. Antonius«, Lissa-bon) sei nach einer neuentdeckten gehei-men Version des Markus-Evangeliums inder vorherigen Nacht von Christus einge-weiht worden; die damit verbundene Los-lösung der Seele drücke sich in dem zu-rückgelassenen Gewand aus (S. 223 f.).Von R. Steiner erfahren wir ergänzenddazu, daß es die Geistgestalt dieses Jüng-lings war, die am leeren Grab von der Auf-erstehung kündete (GA 175, 10. Vortrag).
In dieser Richtung gibt es bei LyndaHarris für den (kritischen!) Leser nochmanches zu entdecken, zumal sie reich-haltiges farbiges Bildmaterial bereitstellt(Abb. 48 leider seitenverkehrt). Dabei istihr tieferes Anliegen, uns das »spirituelleVermächtnis« Boschs nahezubringen: daßnämlich hinter der sichtbaren Welt dieverschiedensten kosmischen Wesenheitenwirken und der einzelne Mensch durchBewußtseinserweiterung mit ihnen in Be-rührung kommen kann. Die Beschäfti-gung mit Hieronymus Bosch kann uns fürdiesen Weg immer wieder Impulse geben.
Christoph Göpfert
Geschichte einerHilfsaktion
Ellen Tijsinger: Feindliches Feuer. 140 S.,geb. DM 28,–. Verlag Urachhaus, Stutt-gart 1996.
Mariska hat in ihrer Schule eine Hilfsakti-on für ein rumänisches Dorf initiiert und
421
fährt nun zusammen mit ihrem Bruder Ist-van, dem Vater und einem Lehrer dorthin,um die Spenden zu verteilen. Sie werdenfreundlich empfangen und erleben da-durch, daß sie bei der Lehrerfamilie woh-nen, hautnah die Armut der Dorfbewoh-ner, die mit dem Nötigsten auskommenmüssen. Schon bald freunden sie sich mitdem Romajungen Django an und lernen sodie noch viel schlimmeren Zustände in dernahegelegenen Romasiedlung kennen.Während die Lehrersfrau hilft, wo siekann, sind die meisten Dorfbewohnernicht gut auf die »Zigeuner« zu sprechen,da sie oft von ihnen bestohlen werden undderen Lebensweise nicht verstehen kön-nen. Als einige Romamänner die gespen-deten Kleider an sich nehmen und sie aufdem Markt verschachern wollen, eskaliertder Konflikt: Ein Bauer aus dem Nachbar-dorf wird im Streit erstochen, worauf derVerantwortliche gelyncht und die Hütten-siedlung der Roma angezündet wird.
Man spürt der Geschichte an, daß dieAutorin selbst einen Hilfstransport nachRumänien begleitet und eine Zeitlangdort gelebt hat, sonst könnte sie die Situa-tion nicht so detailliert und wirklichkeits-getreu beschreiben. Sie hat genau beob-achtet und entfaltet die Stimmungen soglaubhaft, daß der Leser sofort mitten imGeschehen ist. Darf man aus Hunger steh-len? Wie kann man bloß diesen Menschenhelfen? Am Ende sind die Helfer indirektzu den Auslösern des Pogroms geworden!Die Autorin nimmt dem Leser das Dilem-ma nicht ab, daß es keine einfache Lösungfür diese drängenden Probleme gibt. Abersie zeigt die Einsatzbereitschaft und Vor-urteilslosigkeit von Mariska und Istvan,die mit dem Renovieren des Schulhauseseinen großen Schritt in die richtige Rich-tung schaffen.
»Feindliches Feuer« ist ein aufrütteln-
des Buch voller Echtheit und Aktualitätfür Jugendliche ab zwölf Jahren. Auf ein-fühlsame Weise macht es mit der Not an-derer Menschen vertraut, und die da-durch geweckte Betroffenheit regt die Fra-ge danach an, wie wir mit Andersartigenumgehen. M. und U. Schmoller
Göttliche Komödie
Dante Alighieri: Divina Commedia – In-ferno – Purgatorio – Paradiso. Italieni-scher Text mit wörtlicher deutscher Über-setzung und ausführlichem Kommentar,dargeboten von Georg Hees. 3 Bände, 725,699, 799 S., DM 144,–. Verlag der Koope-rative Dürnau, Dürnau 1995.
Von Dantes Göttlicher Komödie gibt esmehrere dichterisch schöne Übersetzun-gen, und auch an gelehrten Kommentarenfehlt es nicht. Dennoch ist diese (fastschon monumentale) Ausgabe in dreischweren Bänden wohl einzigartig: Demoriginalen Text (im mittelalterlichen Italie-nisch) bietet jeweils die gegenüberliegen-de Seite eine Prosaübersetzung. Damitman sich in der Dichtung leichter zurecht-findet, ist jedem der hundert Gesänge aufeiner Doppelseite eine kurze Inhaltsanga-be vorangestellt, und auf jeden Gesangfolgt gleich ein rundes Dutzend Seiten mitAnmerkungen, die die einzelnen Zeilenerklären. Man hat es also nicht weit, wennman Aufschluß sucht zu Wortbedeutun-gen, zu geistesgeschichtlichen Ideen, zuden Hunderten von Personen, die Danteaus der Antike, der Bibel und seiner eige-nen wildbewegten Zeit in die Hölle, aufden Läuterungsberg oder in die Himmelversetzt. So vollständig und zugleich fürjeden Laien leicht zugänglich kenne ichnichts Vergleichbares.
422
Man merkt es dem Buch an, daß GeorgHees schon vor mehr als vierzig Jahrenseine Doktorarbeit über Dante (und denEinfluß von Brunetto Latinis »Tesoretto«auf die Göttliche Komödie) verfaßt hatund daß ihn seitdem das Thema nichtmehr ganz losgelassen hat. Nun liegt alsAlterswerk diese Übersetzung und Erläu-terung all der 14 000 Verse vor (übrigens:sämtlichen fremdsprachlichen Zitaten,auch im Kommentarteil, ist eine deutscheÜbersetzung beigegeben). Hees hat sichin den Kommentaren weitgehend an dievorher geleistete Arbeit anderer Wissen-schaftler gehalten; er »will es gern hinneh-men, wenn man die vorliegende Arbeit alsdie eines Kompilators bezeichnet, dem esan eigenschöpferischer Substanz und Ori-ginalität mangelt.« Solches Zusammen-tragen wäre ja nicht geringzuschätzen,vor allem wenn es mit der Sorgfalt einersolch umfangreichen Übersetzung einher-geht.
Dennoch hat diese Ausgabe einen sehreigenständigen Charakter: Hees machtErnst mit den zahlreichen ÄußerungenRudolf Steiners, der Dantes Göttliche Ko-mödie aus der Einweihung erklärt, die zu-nächst schicksalsmäßig in das Leben Bru-netto Latinis hereinbrach und dann dieImaginationen des Jenseits ermöglichte.Steiners viele Schilderungen zu Dante, La-tini und zur Hierarchienlehre des Diony-sius Areopagita werden in die Texterklä-rungen ohne Zwang eingearbeitet, unddamit verbindet Hees die Erträge einerumfangreichen Studie des ZisterziensersRobert L. John, der Dante als Mitglied ei-ner Templer-Kongregation sieht. DieTempler wurden zu Dantes Lebzeiten blu-tig verfolgt, und wenn man auf die vielenAnspielungen (mehr durfte sich Dantenicht erlauben) achtet, so ist es durchausplausibel, daß die Liebe zu Beatrice zwar
auf einem irdischen Erlebnis Dantes ba-sieren mag, daß aber die Geistgestalt, zuder Vergil den Dichter in immer strahlen-dere Höhen führt, eine »Templergnosis«repräsentiert.
Daß Mysterienbilder in dieses Meister-werk der Weltliteratur hineinleuchten,wird wohl jedem deutlich, der sich dieRuhe für diese Ausgabe gönnt. Ein kleinerSeitenblick auf die »konstantinischeSchenkung« sei hier erlaubt: Im Mittelal-ter berief sich die Kirche gern auf eineSchenkungsurkunde, mit der Konstantin»der Große« ihr das Reich übertragenhabe. Später wurde dies als absichtsvolleFälschung entlarvt. Dante konnte von die-sem Betrug nichts wissen, aber sein Wahr-heitsgefühl und die hohe Idee vom Reicheiner Geistkirche, die durch brutaleMachtausübung nur korrumpiert werdenkann, klingt mit seiner Nähe zu denTemplern und zu Joachim von Fiore zu-sammen. So wird der Eifer verständlich,mit dem er in jedem seiner drei Teile diesekonstantinische Schenkung hart verur-teilt, so wie er überhaupt die damaligeZügellosigkeit einer machtgierigen undinnerlich unwahrhaftigen Amtskirche im-mer wieder sarkastisch brandmarkt. Umso ergreifender wirken inmitten der Zeit-kritik seine Hymnen auf irdische undgöttliche Liebe, seine Liebe zur Spirituali-tät des Franziskus von Assisi und desThomas von Aquino.
Die Lektüre wird durch die übersichtli-che Gliederung erleichtert. Um es ein we-nig subjektiv auszudrücken: Meine äußer-lich handlichen kleinen Ausgaben ausdem Manesse- und dem Reclam-Verlagerscheinen mir sperriger als diese drei dik-ken Bände.
Jedem der Bücher ist als Motto ein Aus-spruch von Rudolf Steiner vorangestellt,der Hees’ Vorhaben bekräftigt: »Wenn Sie
423
die Lehren der Templer verfolgen, so istda etwas im Mittelpunkte, das als etwasWeibliches verehrt wurde. Dieses Weibli-che nannte man die göttliche Sophia, diegöttliche Weisheit. … Dante hat mit seiner»Beatrice« nichts anderes als diese Weis-heit zur Darstellung bring. n wollen. Nurder versteht Dantes ›Göttliche Komödie‹,der sie von dieser Seite betrachtet.«
Frank Hörtreiter
Über das Leben derBienen
Michael Weiler: Der Mensch und die Bie-nen – Betrachtungen zu den Lebensäuße-rungen des Bien. 88 S., 58 Abb., kart. DM20,–. Hrsg. vom Forschungsring für bio-logisch-dynamische Wirtschaftsweise imVerlag Lebendige Erde, Darmstadt 1996.
Ein kleines, schönes, inhaltsreiches Buchüber das Leben der Bienen ist im Sommervergangenen Jahres erschienen. In seinerArt ist es einzig und nimmt dadurch eineneigenen Platz unter den schönen Büchernein, die es über die Bienen gibt.
Lebendig und anschaulich wird manvon Michael Weiler in das Leben der Bie-nen eingeführt. Der Weg, den das Buchdabei nimmt, geht von außen, von denWiesen, der Luft und der Sonne, nach in-nen, ins Dunkel des Stockes und wiederins Freie zurück.
Das erste Kapitel schildert in vielerleiabwechslungsreichen Ereignissen alles,was man als aufmerksamer Beobachter imLaufe der Zeit mit den Bienen erlebt, nochohne die Beute des Bienenvolkes zu öff-nen.
Was ist schon von dieser Warte aus alleszu erleben! – »Es laufen viele Bienen ausdem Flugloch, erheben sich langsam vor
den Kästen in die Luft und wenden sichsogleich fliegend mit dem Kopf in Rich-tung der Stirnwand der Kästen. Dann flie-gen sie auf und nieder, hin und her, lan-den wieder … Dieses Phänomen nennendie Imker (Jungbienen-) ›Vorspiel‹«.
In diesem ersten Teil werden zugleichFragen wach nach dem Leben des Volkes,nach der Entwicklung der einzelnen Bie-nen und dem Zusammenhang mit demganzen Jahreskreislauf. Dies ist dann auchder Inhalt des zweiten und dritten Teilesdes Buches.
Auch im Inneren des Bienenstockeswird der Blick zunächst wieder auf dievielen Einzelheiten hingelenkt, die ohneHilfsmittel zu beobachten sind – dannaber auch auf all das, was man meist nurexperimentell finden kann: vor allem dieEntwicklung der einzelnen Arbeiterinund ihrer Tätigkeiten vom Ei an bis zumTod; z. B. »Bienenschlupf«: »Der Imkerweist auf eine noch verdeckelte Zelle hin,in deren Oberfläche am Rand ein kleinesLoch erscheint, worin sich etwas bewegt.Näheres Beobachten zeigt, daß es eineKiefernzangenhälfte ist, die dort heraus-ragt und offenbar gegen die nicht sichtba-re andere am Zelldeckel nagt. Das Lochwächst, die Zange zieht sich zurück, undein Fühler ragt kurz daraus hervor.«
Gegen Ende des Buches folgen an-schauliche, stimmungsvolle Schilderun-gen des Lebens im Jahreslauf. Beginnendmit der Rolle der Drohnen und Königin-nen und deren Entwicklung als einzelne,geht es über die Einwinterung des Volkesim Spätsommer über den Winter bis zumhohen Sommer wieder hinauf; z. B.»Drohnenabschied«: »Am Mittag diesesTages ist zu erleben, daß der Drohnenflugtrotz warmer Temperaturen und Sonnen-schein merklich schwächer ist als nochvierzehn Tage zuvor … Kaum einem
424
Drohn gelingt es noch, in einen Kasteneinzudringen … Meisen, Spatzen … pik-ken die Puppen auf.«
Eingefügt in diese jahreszeitlichen Be-schreibungen sind Betrachtungen einigerKrankheiten und Notfälle. Den Abschlußbildet ein Zitat Rudolf Steiners aus denArbeitervorträgen zum Thema, und imAnhang findet man die Voraussetzungenfür die Demeter-Anerkennung einer Im-kerei, geschrieben von Günter Friedmann.
Das Buch ist für den interessierten Lai-en geschrieben, der sich frei von Spekula-tionen in das Leben der Honigbiene einle-ben will. Es kann auch für Jugendliche abder Pubertät empfohlen werden. Auchdem Imker wird es – durch seine Art –vielleicht manche Erkenntnis bringenkönnen. Wer als Lehrer von den Bienenanschaulich erzählen will, wird kaumeine bessere Quelle als dieses Büchlein be-nutzen können. Es ist so geschrieben, daßman nicht unbedingt gleich bemerkt, wieviel an kleinen und großen Zusammen-hängen darin enthalten ist.
Tobias Schaumann
Das Lóczy-ProjektMyriam David/Genevieve Appell: Müt-terliche Betreuung ohne Mutter. 184 S.,geb. DM 34,–. Cramer-Klett & Zeitler-Verlag, München 1995.
Nun ist auch dieses Buch erschienen alsweiterer Beitrag zum Vertrautwerden mitder Erziehungsmethode des von Dr. E.Pikler gegründeten und bekannten unga-rischen Kinderheims Lóczy. Das Buch er-schien 1973 erstmals in Frankreich undwurde 1995, noch vor dem 50. Jubiläumdes Institut erstmals auf deutsch heraus-gegeben.
Nach den von den Mitarbeitern des
Lóczy-Kinderheims selbst geschriebenenund herausgegebenen Büchern (Pikler etal.: »Friedliche Babies, zufriedene Müt-ter«, »Laßt mir Zeit«, »Miteinander ver-traut werden«) sind die Autorinnen die-ses Buches zwar Fachleute, jedoch außen-stehende Beobachter des Heimes, das siezwar kritisch, aber mit aller Hochachtungund Bewunderung für das Engagementund die Professionalität beschreiben. Diestete Ehrfurcht vor dem anderen Men-schen, hier dem Kinde und den Mitarbei-tern des Institut und die sich davon ablei-tende Bereitschaft, das für richtig erkann-te Tun, die Prinzipien und Methoden desHeimes gleichwohl kritisch zu reflektie-ren und den persönlichen Gegebenheitenanzupassen, wird voll anerkannt in derBeurteilung der französischen Autorin-nen.
Die Tatsache, daß die Methode des Lóc-zy die dort betreuten Kleinkinder vorschweren Störungen des Hospitalismusbewahrt und die persönliche Beziehungder Betreuerin so strukturiert ist, daß eineRückführung in die Familie möglich wirdbzw. Übernahme in eine Adoptions- oderPflegefamilie ohne tiefe Verletzungen vorsich gehen kann, wird als besondere Lei-stung gewürdigt, denn die Einrichtung istja als Auffangstation gedacht für Kinder,die keine funktionsfähige Familie haben,aber in eine Familie rückgeführt werdensollen.
Das Buch beschreibt das Institut, dieKinder und die sich um sie gruppieren-den Erwachsenen. Es stellt die Grund-prinzipien der Erziehungsmethoden darmit ihren vier Säulen: 1. Die Bedeutungder selbständigen Aktivität. 2. Die Bedeu-tung der privilegierten emotionalen Be-ziehung, auch unter Heimbedingungen.3. Die Forderung der Wahrnehmung sei-ner selbst und seiner Umwelt. 4. Die Ge-
425
sundheitserziehung nach Prinzipien dernaturheilkundlichen Methoden mit vielFreiluftbehandlung.
Es wird die Organisation der Gruppenund ihrer Lebensbereiche geschildert, dieDurchführung der pflegerischen Maßnah-men, das Freispielen und selbständigeAktivitäten, wobei beeindruckend ist, wiesparsam und durchdacht das Spielzeug-angebot ist. Die anderen Aktivitäten, diedazu dienen, Außenkontakte räumlichund menschlich zu pflegen, werden ge-schildert sowie die Teamarbeit der Pfle-genden (Schwerpunkt Beobachtung undSupervision) und die Zusammenarbeitmit den leiblichen oder zukünftigen Pfle-ge- bzw. Adoptiveltern.
Die Autorinnen gehen kritisch mit denWahrnehmungen um, die sie bei ausführ-lichen Hospitationen im Lóczy machten,wobei aber die positiven Eindrücke über-wiegen.
Das Büchlein interessiert neben denMenschen, die bereits die Bücher und dieErziehungsansichten sowie Methodenvon Pikler kennen, alle Menschen, die mitder Erziehung von Kindern und mit erzie-henden Familien zu tun haben, alsoHeimerzieher, Adoptiv- und Pflegeeltern,Sozialarbeiter, Jugendämter, Behörden,die mit der Einrichtung medizinisch-so-zialer Dienste betraut sind, neben Kinder-schwestern, Kinderärzten, Lehrern, Heil-pädagogen, Psychologen, Psychiaternund Kinderdorfeltern. In dem Büchleinwird deutlich, daß im Lóczy das von Ru-dolf Steiner formulierte Erziehungsprin-zip uneingeschränkt gilt: »Nicht morali-sche Redensarten, nicht vernünftige Be-lehrungen wirken auf das Kind, sonderndasjenige, was die Erwachsenen in ihrerUmgebung sichtbar vor Augen tun.«
Man gewinnt den Eindruck, daß dieselbstlose und freilassende Erziehungs-
methode des Lóczy der Kinderseele denEntwicklungsraum läßt, um sich auf diefolgende familiär-persönliche Beziehungvorbereiten zu können.
Kaspar Mittelstrass
Der Pyrit
Pyrit. extraLapis Nr. 11. 98 S., farb., z. T.großform. Aufn., DM 34,–. ChristianWeise Verlag, München 1996.
Den Griechen war er bereits bekannt; siewußten, daßl Feuer geben kann, wennman ihn aneinanderschlägt. Und so nann-ten sie ihn »pyrites lithos« – pyr heißt Feu-er und lithos Stein.
Und später berichtete Plinius d. Ältereausführlich über den Pyrit. Plinius, derunermüdlich geforscht haben muß undim Jahre 79 sein Leben am ausbrechendenVesuv ließ, erzählt vom Pyritstein, dermessing- oder gar goldfarben sei und inden Bergwerken Zyperns vorkomme.
Im Mittelalter hatte er Bedeutung fürdie Alchimisten, die ihn aber als Markasitbezeichneten, was aus dem Arabischenkommt. Später wurde der Begriff Kießoder Kies eingeführt für allerlei sulfidi-sche Verbindungen, wie Eisenkies, Kup-ferkies oder eben Schwefelkies.
Und volkstümlich wurde der Pyrit auchimmer wieder als »Katzengold« bezeich-net, weil er manchen Goldsucher zumNarren gehalten hat.
Der Pyrit, der zur Pyrit-Markasit-Fami-lie gehört, ist als »Durchläufer« weltweitverbreitet. Sei es in der Mineralisation derLagerstätten oder aber, was seltener ist,als eine Sekundärbildung in der Kluftpa-ragenese.
Wir erfahren in diesem aufschlußrei-chen, äußerst aufwendig gestaltetenWerk, wie facettenreich sich die Pyrit- und
426
Neue Literatur
Pädagogische Forschungsstelle:
Alec Templeton: Aus dem Englischunterrichtauf der Mittelstufe (mit Beiträgen von Rose-Marie Hauf und Robert Sim). In Vorbereitung1997. 255 S. ca. DM 22,–. Der Sprachlehrer vor-nehmlich der Mittelstufe findet in diesem Bandzahlreiche anregende Betrachtungen und Bei-spiele, wie er seinen Englischunterricht leben-dig gestalten kann.
Martin Tittmann: Szenen und Spiele für denUnterricht. In Vorbereitung 1997. 375 S. ca. DM22,–. Tittmann, Klassenlehrer der ersten Wal-dorfschule, hat viele Klassenspiele selbst ge-dichtet. Die vorliegende Sammlung gibt für alleKlassenstufen Möglichkeiten an die Hand, klei-nere oder größere Spiele für die Schüler auszu-wählen.
Maria Führmann: Die Praxis des Gesanges un-ter geisteswissenschaftlichem Gesichtspunkt.3., überarbeitete Aufl., hrsg. von Gisela Röschund Hartmut Bär, 1997. 97 S., brosch., Spiralbin-dung, DM 30,–. Dieses Buch enthält das Ergeb-nis einer lebenslangen Beschäftigung mit demThema auf der Grundlage der Angaben RudolfSteiners mit vielen Anregungen für alle, diekünstlerisch, pädagogisch und therapeutischmit der Gesangsstimme arbeiten. Die kosmi-schen Hintergründe der Töne und Laute undderen Wirkungen auf den Menschen sowie derWeg zum Erringen eines lichtvollen, ätheri-schen Tones werden aufgezeigt.
Georg Kniebe: Soll bei uns eine Waldorfschuleentstehen? – Hilfen und Überlegungen für eineSchulgründung. In Vorbereitung 1997. 69 S. ca.DM 25,–. Für Gründungsinitiativen und Grün-dungsberater dient diese Zusammenschau, diemögliche Stationen einer Gründungsinitiativeverfolgt. Mit aktuellen Adressen und nützli-chen Tabellen.
Elsbeth Schouten: Die Zweitklaß-Untersu-chung. Niederländischer Schulbegleitungs-dienst für freie Schulen (Hrsg.). Ausgabe 1995.Übersetzung aus dem Niederländischen. InVorbereitung 1997. 31 S. und 5 Seiten Auswer-tungsformular. DM 32,–. Die vorliegende Über-setzung aus dem Niederländischen zeigt einenTest, der mit den Schülern von zweiten Klassen
Markasitgruppe zeigt. Bestechend klareAufnahmen herrlichster Pyritkristallekommentieren die theoretischen Ausfüh-rungen.
Im Fundortteil kommen jene Regionenzur Geltung, die immer schon außeror-dentlich schöne Pyritkristalle geliefert ha-ben. Erwähnt sei an dieser Stelle die InselElba, der Toskana vorgelagert. Wie vieleandere Pyritbegeisterte hat auch der Au-tor dieses Beitrages am Osthang nahe desSchwefelsees »terra nera« gegraben undgeschwitzt und manch schöne Pyritkri-stalle nebst regenbogenfarben schillern-dem Hämatit geborgen. Seit einigen Jah-ren sind nun die Minen auf Elba aufgelas-sen, die Fundmöglichkeiten immer mehreingeschränkt, andere Gebiete gesperrtwegen vormaligem wilden und zerstöre-rischen Sprengen.
Über viele andere Fundorte wird be-richtet, etwa über die exakten Naturwür-fel von Navajún (Spanien) oder über dieabenteuerliche Suche im US-Staat Wa-shington. Ebenso erfahren wir über dieschier unermeßlichen Fundstellen inPeru, wo freilich die Bedingungen derBergarbeiter bekanntermaßen trostlossind, so daß der wilde Straßenhandelblüht.
Eine typische Kristallform des Pyrites,der Pentagondodekaeder, war schon im-mer Sinnbild für Künstler und Architek-ten verschiedenster Epochen. Grandiosesund Bizarres zeigt uns der Pyrit in seinerFormenwelt, aufgefangen in der »Pyrit-Galerie« in diesem Werk.
Wieder ist den Autoren ein Kleinod inder extraLapis-Reihe besonderer Minera-lienporträts gelungen. Augenweide undfaszinierendes Wissen zugleich! Preiswertdazu allemal!
Joachim Hoßfeld
427
gemacht werden kann, um eventuelle Entwick-lungsstörungen zu entdecken. Mit Anleitungund Beobachtungsbogen.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart:
Barbara Bartos-Höppner: Die Königstochteraus Erinn. 153 S., geb. DM 19,80.
Peter Carter: Gejagt. Jugendroman. 354 S., geb.DM 36,–.
Rüdiger Grimm (Hrsg.): Heilende Kräfte inder Bewegung. Die Anwendung der Heileury-thmie in der Heilpädagogik. 172 S., kart. DM48,–.
Henning Köhler: Jugend im Zwiespalt. EinePsychologie der Pubertät für Eltern und Erzie-her. Neuauflage, 236 S., kart. DM 24,–.
Jean-Claude Lin/Andreas Neider (Hrsg.): Al-manach 1997. Der Weg in die Zukunft. Perspek-tiven anthroposophischer Arbeit. 380 S., kart.DM 20,–.
Inge Ott: Geier über dem Montségur. Der hel-denhafte Kampf einer Schar auserlesener Rittergegen König und Papst. Neuauflage, 180 S.,geb. DM 19,80.
Sergej O. Prokofieff: Der Jahreskreislauf als Ein-weihungsweg zum Erleben der Christus-We-senheit. Eine esoterische Betrachtung der Jah-resfeste. Neuauflage, 510 S., kart. DM 58,–.
Theodor Schwenk: Das sensible Chaos. Strö-mendes Formenschaffen in Wasser und Luft.Neuaufl., 144 S., 88 S. s/w Aufn., kart. DM 39,–.
Rosemary Sutcliff: Morgenwind. Owins Weg indie Freiheit. 285 S., geb. DM 19,80.
Rosemary Sutcliff: Schwarze Schiffe vor Troja.Die Geschichte der Ilias. 128 S. geb. DM 39,–.
Rudolf Treichler: Die Entwicklung der Seele imLebenslauf. Stufen, Störungen und Erkrankun-gen des Seelenlebens. Neuaufl. 375 S., kart. DM39,–.
Andere Verlage:
M. Brater/C. Hemmer-Schanze/A. Maurus/C.Munz: Wird Arbeit Kunst, kann die Natur le-ben. 152 S., brosch. DM 39,–. edition tertium,Ostfildern.
Henri van Daele: Joran, der Zauberer mit ei-nem Stern. 239 S., geb. DM 26,–. Verlag Urach-haus, Stuttgart.
Johannes Flügge/Robert Pfister/Ernst Schu-berth/Matin Wagenschein/Daniel Wirz: Rettetdie Phänomene! Hrsg.: Schweiz. Gesellsch. f.Bildungs- u. Erziehungsfragen, CH-8135 Lan-genau/Freier Pädagogischer Arbeitskreis Uet-zikon, CH-8634 Hombrechtikon. 90 S., kart.DM 15,–. Mellinger Verlag, Stuttgart. DieseBroschüre mit dem berühmt gewordenen Auf-satz von Wagenschein ist noch lieferbar!
MITTEILENSWERTES IN KÜRZEdes Ministers zustande. Auch wenn dieBundesregierung keine unmittelbare Zu-ständigkeit für das Schulwesen hat, hatder Bundesjustizminister, der zugleich»Verfassungsminister« ist, naturgemäßein Interesse an diesen Fragen.Dabei machten die Vertreter der Waldorf-schulen auf die Gefahren aufmerksam,die dem durch die Verfassungsrechtspre-chung hervorgerufenen positiven Ent-wicklungsprozeß im Bereich der Grund-rechtsauslegung durch die gegenwärtigsich verschärfende Sparpolitik der Länder
Waldorfschulen bei Bundesjustiz-minister Schmidt-Jortzig
Am Montag, dem 10.3.1997, konnten Ver-treter des Bundes der Freien Waldorfschu-len mit Bundesjustizminister Prof.Schmidt-Jortzig über die aktuellen Proble-me der Waldorfschulen, insbesondere sol-che verfassungsrechtlicher Art sprechen.Das Gespräch kam auf Vermittlung vonBernd Hadewig (Sprecher der Landesar-beitsgemeinschaft Schleswig-Holstein)aufgrund der landespolitischen Bezüge
428
drohen. U.a. wurde auf die ungenügendeRegelfinanzhilfe und Schulbauförderung,die gründungsfeindliche Wartefristpraxis,die Errichtungssperre für neue Schulen(in Bayern) und die zugangsbeschränken-den Landeskinderklauseln (in Nord-deutschland) hingewiesen. Dabei wurdenauch bildungsökonomische Fragen unddie Schwierigkeiten der Bemessung derFinanzhilfe berührt, die aus dem Versuchder Übertragung der kameralistischenRechnungslegung der Öffentlichen Handund dem daraus folgenden Anpassungs-druck für Freie Schulen entstehen.In diesem Zusammenhang kam auch dieproblematische Stellung der staatlichenSchulverwaltung zur Sprache, die nachAuffassung des Bundesverfassungsge-richts als Betreiber des staatlichen Schul-wesens gegenüber den konkurrierendenErsatzschulen keine neutrale Stellung ein-nimmt.Schließlich wurde auch die im Zuge derSteuerreform drohende Streichung desSonderausgabenabzuges für Schulgeldangesprochen, die seinerzeit wesentlichmit Hilfe der FDP als eine Teilentlastungfür die Einschränkung der steuerlichenBerücksichtigung von Elternspenden ge-schaffen worden war. Hier müsse derBund im Sinne einer sachgemäßen steuer-lichen Freistellung des Existenzmini-mums für eine entsprechende Schonungder Eltern Freier Schulen sorgen. Ohnehinverstünden die Eltern nicht, warum siedas staatliche Schulwesen voll und dieFreie Schule ihrer Kinder, die sie in Aus-übung eines Grundrechts nutzen, zu ei-nem guten Teil noch einmal bezahlen soll-ten.Am Rande konnten auch die z. Zt. laufen-den Angriffe auf Anthroposophie undWaldorfpädagogik und mögliche negati-ve Auswirkungen auf Waldorfschulen be-sprochen werden. Dabei war deutlich,daß die Anerkennung der Anthroposo-phie als wissenschaftszugehörig (Art. 5Abs. 3 GG) und die Hochschulanerken-nung der Lehrerbildung der Waldorfschu-
len in der höchstrichterlichen Rechtspre-chung und der rechtswissenschaftlichenLiteratur eine sichere Grundlage hat.
Hans-Jürgen Bader
Freie Schule Norddeich gegründet
Im Küstenbadeort Norddeich, im äußer-sten Nordwesten Deutschlands, nahm mitErhalt des Genehmigungsbescheides derzuständigen Bezirksregierung am 1. Fe-bruar 1997 die Freie Schule Norddeichihre Arbeit auf. Träger der Schule ist derVerein »Freie pädagogische ArbeitsstättenNorden-Ostfriesland e. V.«, der seit 1994die Pädagogische Arbeitsstätte Norddeichbetreibt (Veranstaltungen, Kurse, Vorträ-ge, Laden, Kindergarten). Von Anfang anarbeitete die Initiative eng mit der anthro-posophischen Gesellschaft in Frieslandzusammen. Der Verein ist weder Mitgliedder Internationalen Vereinigung der Wal-dorfkindergärten noch des Bundes derFreien Waldorfschulen, sondern der nie-derländischen Vereniging voor Vrije Op-voedkunst. Das Gesamtkonzept zielt aufeine Maximalgröße der Einrichtung (in-klusive Kindergarten) von ca. 100 Kin-dern. Die Schule hat vier jahrgangsüber-greifende Lerngruppen (Klasse 1-3, 4-6,7/8 und 9/10) und führt nur bis zum Ab-schluß der niedersächsischen Sekundar-stufe I. Weitere Veränderungen gegen-über der traditionellen Waldorfschulesind der Fremdsprachenunterricht inHauptunterrichtsepochen; die Fremd-sprache ist Niederländisch. Die Konzepti-on des Unterrichtes in den Klassen 9 und10 ist auf die Selbständigkeit der Schülersowie die intensive pädagogische Zusam-menarbeit mit dem Kindergarten im glei-chen Haus abgestimmt.
Die Freie Schule Norddeich ist nebender Freinet-Grundschule die erste, für diein Niedersachsen seit dem Grundschulur-teil des Bundesverfassungsgerichtes von1992 (Kreuzberg-Urteil) eine Genehmi-gung beantragt wurde. M.M.
429
Russische Waldorfassoziationgegründet
Nach langer Vorbereitungsarbeit konntendie russischen Waldorfschulen und -semi-nare auf ihrem Treffen vom 21. bis23.2.1997 in St. Petersburg die »Assoziati-on der Waldorfschulen in Rußland« alsselbständigen Landesverband gründen.Die entferntesten Vertreter kamen dies-mal aus Irkutsk (Mittelsibirien) und Na-chodka (am Stillen Ozean).In der Assoziation schließen sich zunächst14 Schulen und Lehrerseminare aus 10Städten zusammen. Weitere Einrichtun-gen können Mitglied werden, sofern sieu. a. mindestens drei Jahre im Sinne derWaldorfpädagogik gearbeitet haben. Fürden Status einer vorläufigen Mitglied-schaft genügt eine einjährige Tätigkeit. Inder Weltliste der Waldorfschulen sindz. Zt. 18 russische Schulen eingetragen.Die tatsächliche Zahl der nach der Wal-dorfpädagogik arbeitenden Initiativeneinschließlich Einzelklassen, Schulen inUmstellung usw. ist jedoch erheblich grö-ßer.Die neugegründete Assoziation löst dieLandesgruppe Rußland der Internationa-len Assoziation für Waldorfpädagogik inMittel- und Osteuropa (IAO) ab, die biszum Vorjahr die Aufgaben einer landes-weiten Zusammenarbeit wahrgenommenhatte. Die russische Schulbewegung ist je-doch auch weiterhin dringend auf auslän-dische Hilfe und Beratung angewiesen.
Nicolai Petersen
»Forum Freie Schulen« – Waldorf-pädagogik auf der INTERSCHUL
Im neuen »Forum Freie Schulen« werdengrundlegende Fragen zur Schulgestal-tung bewegt. Die Bestrebungen hin zuSchulen in erweiterter Verantwortung zei-gen, daß die Detailgestaltung von Schuledurch eine bürokratische Staatsverwal-tung nicht mehr zeitgerecht ist. Schulen inFreier Trägerschaft beweisen, wie eine
von Lehrern, Eltern und Schülern gestal-tete freie Entfaltung von Schule Grundla-ge für eine eigendynamische Bildungs-vielfalt sein kann. Unter Teilnahme voninternational renommierten Experten sollim »Forum Freier Schulen« auch die euro-päische Dimension mit einbezogen wer-den. Veranstalter ist das European Forumfor Freedom in Education, mit Unterstüt-zung des Bundesverbandes der Freien Al-ternativschulen, dem BundesverbandDeutscher Privatschulen und dem Bundder Freien Waldorfschulen.Mit insgesamt 64 verschiedenen Veran-staltungen auf einer großen Aktionsflächebietet die Arbeitsgemeinschaft Waldorf-pädagogik das mit Abstand umfangreich-ste Rahmenprogramm am Stand bei derINTERSCHUL Messe in Berlin vom 8. bis11. April 1997 an. Aus verschiedenen Wal-dorfschulen in Berlin und Brandenburgzeigen Schüler und Lehrer einen Aus-schnitt des kontrastreichen Schulalltagsquer durch alle Altersstufen und Fächer.Das Angebot reicht von Buchbinden überComputertechnologie bis zur Eurythmie,von Fremdsprachen über ein Schülerpro-jekt Chemiebaukasten bis zu Zirkusdar-bietungen. Unter der Überschrift »FreieSchulen brauchen eigenverantwortlicheLehrer« bietet das Programm am Standauch vielfältige Möglichkeiten zum Ge-spräch. Ausstellungen von Schülerwerk-stücken und Schülerheften, vielfältige Li-teratur zur Waldorfpädagogik und Kin-derbücher runden das Angebot ab.Ein Faltblatt zum »Forum Freie Schulen«sowie zu den Aktivitäten am Stand derArbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogikist erhältlich von der ArbeitsgemeinschaftWaldorfpädagogik, Gerberstr. 12, 58456Witten. Detlef Hardorp
Welcome to Waldorf World-Wide
So begrüßt die Webseite der Arbeitsge-meinschaft Waldorfpädagogik in Berlin-Brandenburg die elektronischen Wellen-reiter, die davon sprechen, im »Web« zu
430
»surfen«, aber tatsächlich nur »clicken«.Unter der Adresse »waldorf.net« findetman allgemeine Information zur Waldorf-pädagogik und Aktuelles aus Berlin-Bran-denburg in deutscher sowie in englischerSprache. Link Vorschläge sind erwünscht.
Detlef Hardorp
Waldorfschüler gewinnen Hand-werk- und Technik-Preis
Die 10. Klasse der Freien WaldorfschuleWangen hat im Bereich Handwerk undTechnik den ersten Preis des Wettbewerbs»Schule des Jahres« für ihre Aufbauarbeitin der Ukraine gewonnen. Zusammen mitihrem Lehrer Herbert Grob wird sie ge-schlossen am 8. April im Rahmen der IN-TERSCHUL in Berlin den Preis entgegen-nehmen. Detlef Hardorp
Ausbildung während der Schulzeit
In drei Werkstätten bildet das Berufsbil-dende Gemeinschaftswerk in Metall- undElektroberufen und Tischlerei aus. DieAuszubildenden sind Schüler der FreienWaldorfschule Kassel, die während derDifferenzierten Oberstufe die Möglichkeithaben, Schul- und Berufsausbildung zuverbinden.Vor wenigen Tagen wurden in einer Feierelf Auszubildende nach bestandenerLehrabschlußprüfung verabschiedet. DieMehrheit verließ die Werkstatt mit gutenbis sehr guten Abschlüssen.Ausgebildet wird an realen Kundenauf-trägen, die von Privatkunden, aus Hand-werksbetrieben, von Partnerbetrieben derIndustrie, Universitäten und vielen ande-ren Bereichen eingehen. Die Prüflingeselbst werteten ihre praxisbezogene Aus-bildung als gute Basis für eine spätere Be-rufstätigkeit.Ab dem kommenden Schuljahr stehennoch Ausbildungsplätze für Industrieme-chaniker zur Verfügung. Auch Mädchensollten sich überlegen, ob sie nicht Indu-striemechanikerin werden wollen, undsich bewerben. Für alle Bewerber bedingt
die Ausbildung in den Werkstätten einegleichzeitige Aufnahme in die 11. Klasseder Freien Waldorfschule Kassel. An-schrift: Berufsbildendes Gemeinschafts-werk Kassel, Brabanterstraße 45, 34131Kassel, Tel. (0561) 93758-10, Fax: 93758-46.
M.M.
Neue Ausbildung für Waldorf-kindergärtnerinnen
Das Waldorfkindergarten-Seminar in Wit-ten-Herbede bietet seit Herbst 1996 neueMöglichkeiten der Aus- und Weiterbil-dung zur Waldorfkindergärtnerin/zumWaldorfkindergärtner an. Neben der seitlangem bestehenden zweijährigen Ausbil-dung gibt es jetzt an zwei Orten (Witten-Herbede und Bielefeld) eine dreijährigekontinuierliche Ausbildung, in der dieTeilnehmer im ersten Ausbildungsab-schnitt über zwei Jahre einen Tag in derWoche zum Unterricht kommen. Der Un-terricht umfaßt Menschenkunde, Metho-dik, Fragen der Praxis, Psychologie undGrundlagen der Rudolf Steiner-Pädago-gik sowie Kunst. Anfragen: Waldorfkin-dergarten-Seminar, Gerberstr. 12, 58456Witten, Tel. 02302-79875. M.M.
Heilpädagogische Ausbildung inWitten
Im Bereich der Heilpädagogischen Wal-dorfschulen besteht ein jährlicher Bedarfvon rund 70 Lehrern. Die bestehendenAusbildungsstätten können, wenn alle Se-minare gefüllt sind, max. 40 bis 50 Lehrerausbilden.Seit nunmehr drei Jahren wird vom Insti-tut für Heilpädagogische Lehrerbildungam Lehrerseminar in Witten-Annen dasFachstudium Heilpädagogik/Sonderpäd-agogik durchgeführt. Dieser Fachstudien-gang findet im Rahmen der Waldorf-Klas-senlehrerausbildung des Instituts Witten-Annen statt. Zur Zeit sind 21 Studierendein zwei Fachkursen am Institut.• Für Quereinsteiger beginnt zum Herbst1997 ein neuer erster Fachkurs.
431
• Die Grundständige Ausbildung zumLehrer an Heilpädagogischen Schulenrichtet sich an junge Menschen, die dieLehrertätigkeit an HeilpädagogischenSchulen anstreben und bereits ein Prakti-kumsjahr absolviert haben.• Das Studium Gesamt-Studiengang dau-ert in Witten-Annen in der Regel fünf Jah-re. Das erste Jahr (Grundstudium) bieteteine Einarbeitung in die anthroposophi-sche Geisteswissenschaft.Im zweiten Jahrbeginnt das Hauptstudium (Klassenleh-rer an Waldorfschulen/Fachstudium zumLehrer an Heilpädagogischen Schulen).Im dritten Jahr findet ein einjähriges Prak-tikum an einer Heilpädagogischen Schulestatt. Im vierten Jahr wird das Haupt- undFachstudium fortgesetzt und die Diplom-arbeit angefertigt. Das fünfte Jahr (Ab-schlußkurs) bildet eine Brücke zu der sichanschließenden Berufstätigkeit an denSchulen.Weitere Information, Bewerbungund Anmeldung: Institut für Waldorfpäd-agogik, Renate Stimming, Institut fürHeilpädagogische Lehrerbildung, Mari-anne Bauer/Roland Horst. GemeinsameAdresse: Annener Berg 15, 58454 Witten,Tel. 02302-96730, Fax 02302-68000. M.M.
Studie: Deutsche Schüler in Natur-wissenschaften mittelmäßig
Die Leistungen deutscher Schüler in Ma-thematik, Biologie und Physik sind in derRegel nur mittelmäßig. In einem Vergleichvon Schülern der siebten und achten Klas-sen in 45 Staaten schneiden die Deutschenetwa so gut ab wie die USA oder Austra-lien. Die mit Abstand besten Noten beka-men in der Dritten Internationalen Mathe-matik- und Naturwissenschaftsstudie(TIMSS) die Kinder in Singapur, Süd-Ko-rea und Japan. Die Ergebnisse der reprä-sentativen Untersuchung unter Federfüh-rung des Berliner Schulforschers JürgenBaumert (Max-Planck-Institut für Bil-dungsforschung), an der weltweit gut einehalbe Million Kinder teilnahmen, wurdenam 18. Februar in Berlin vorgestellt.
Die Studie war in Fachkreisen seit Mona-ten erwartet worden, insbesondere weilneue Aussagen über das Leistungsvermö-gen der unterschiedlichen Schulformen inDeutschland vermutet worden waren.Nach Ansicht der Wissenschaftler sind dieErgebnisse jedoch weitgehend unabhän-gig von der Unterrichtsform wie von derSchulform. Ob große Klassen, Frontalun-terricht oder Gesamtschul-Organisation –es komme ihrer Auffassung nach vielmehr auf die Art des Unterrichts an. »Esmuß mehr experimentiert werden«, for-derte der Schulforscher Horst Bayrhubervom Institut für die Pädagogik der Natur-wissenschaften in Kiel. Die Lehrpläne sei-en zu voll.Mädchen in Deutschland weisen nachAussage von Baumert durchschnittlichein deutlich schlechteres Niveau auf. DieMathematik sei noch zu »männerfreund-lich«, meinte er.»Die Ergebnisse sind ausgesprochen be-sorgniserregend und waren so nicht er-wartet worden«, sagte Bayrhuber. Es be-stehe Handlungsbedarf bei den Kultusmi-nistern, äußerte bei der Vorstellung derVertreter des Bundesbildungsministeri-ums, Heinz Westkamp.Überrascht habe das Ergebnis, daß Gym-nasiasten in den neuen Bundesländern et-was besser abschneiden als ihre Kamera-den in der alten Bundesrepublik.
M.M./dpa
DWI sieht Deutschland beiBildungsausgaben auf Platz acht
Deutschland nimmt nach einer Untersu-chung des Deutschen Instituts für Wirt-schaftsforschung (DIW) bei den Bildungs-ausgaben unter elf Industrieländern denachten Platz ein. 5,9 Prozent des Bruttoin-landsprodukts werden in der Bundesre-publik für Bildung ausgegeben, wie dieam 19. Februar in Berlin vorgelegte Unter-suchung ergab. Die Ausgaben reichtenvon 5,0 Prozent (Italien, Großbritannien)bis 7,8 Prozent (Kanada, Dänemark).
432
Die gesamten Bildungsausgaben beziffer-te das DIW für 1995 auf 200 MilliardenMark. Bund, Länder und Gemeindenbrachten 162 Milliarden Mark auf, 18 Mil-liarden Mark mehr als 1992. Von diesenöffentlichen Ausgaben entfiel 1995 runddie Hälfte auf die Schulen, 30 Prozent aufdie Hochschulen und 10 Prozent auf Kin-dergärten. Die Ausgaben pro Schüler be-trugen umgerechnet 6 802 Mark. Pro Stu-dent gab die Bundesrepublik 25 900 Markaus (1992: 23 200 Mark).Insgesamt wuchsen die Bildungsausga-ben zwischen 1992 und 1995 um 3,1 Pro-zent pro Jahr. M.M./dpa
Behler auf der Didacta:Mehr Freiräume für Schulen
Durch größere Selbständigkeit und mehrEigenverantwortung sollen die Schulenkünftig gestärkt werden. Dies hat dieNRW-Schulministerin Gabriele Behler(SPD) am 17. Februar anläßlich der Bil-dungsmesse »Didacta« in Düsseldorf un-terstrichen. Die Überzeugung von derNotwendigkeit eines Freiraumes fürSchulen anstelle eines bisher üblichen»zentralistischen Blicks« auf die Schulauf-sicht habe sich ihrer Meinung nach auchüber die Ländergrenzen hinweg durchge-setzt.In der Praxis bedeute dies eine Beteili-gung der Schulen bei der Lehrereinstel-lung, eine »Stärkung der Kompetenzen«für die Schulleitung sowie die Förderungbei der Entwicklung von Schulprogram-men, mit denen sich die einzelnen Schu-len neben dem Pflichtunterricht einen zu-sätzlichen eigenen Schwerpunkt geben.Allerdings dürfe die Sicherung der Quali-tät des Unterrichtes dabei keinesfalls ausdem Blick geraten.Mit mehr als 74 000 Besuchern bis zum 21.Februar wurden die Erwartungen der Ver-anstalter weit übertroffen. Insgesamt be-teiligten sich an der Messe 540 Ausstelleraus 18 Ländern. M.M./dpa
Rechtschreibreform:Kein Verbot für Volksbegehren
Die Kultusminister der 16 Bundesländerkönnen und wollen die in drei Bundeslän-dern angestrebten Volksbegehren gegendie Rechtschreibreform nicht verbieten.Nicht die Kultusminister, sondern viel-mehr die in den jeweiligen Ländern zu-ständigen Organe prüften gegenwärtig,ob die Volksbegehren gemäß der jeweili-gen Landesverfassung zulässig seien. Mitdieser Klarstellung reagierte der Präsidentder Kultusministerkonferenz (KMK), Nie-dersachsens Kultusminister Rolf Wern-stedt (SPD), am 4. März auf heftige Kritikder Bürgerinitiativen, die den Schulmini-stern einen »Putsch« vorgeworfen und siezum Rücktritt aufgefordert hatten.Der erfolgreiche Abschluß auch nur einesder drei laufenden Volksbegehren gegendie Rechtschreibreform muß nach Auffas-sung ihrer Initiatoren zu einem Stopp derNeuregelung in allen 16 Bundesländernführen. Dies unterstrich die Bürgerinitiati-ve »Mehr Demokratie« am 2. März in ei-ner Pressemitteilung. Bürgerbegehren ge-gen die Einführung der neuen Schreibre-geln gibt es derzeit in Bayern, Niedersach-sen und Schleswig-Holstein.Die Reform tritt offiziell Mitte 1998 inKraft, eine Übergangsregelung gilt biszum Jahre 2005. M.M./dpa
Protest gegen Sparpolitikin Bremen und Kiel
In Bremen und Schleswig-Holstein sindSchüler und Lehrer gegen die Sparpolitikder Landesregierungen im Schulbereichauf die Straße gegangen. In Bremen nah-men am 4. März rund 4 500 Schüler aneiner Protestkundgebung teil. Dabei kames auch zu Ausschreitungen. Die Demon-stration, zu der die Gesamtschülervertre-tung (GSV) aufgerufen hatte, stand unterdem Motto »Die Zukunft gehört uns«. MitTrillerpfeifen, Sprechchören und Spruch-bändern hatten die Schüler zunächst ihren
433
Unmut über die Absicht geäußert, in dennächsten Jahren rund 20 Millionen Markim Bildungshaushalt einzusparen.Darüber hinaus richtete sich der Protestgegen eine Verlängerung der Lehrerar-beitszeit auf 26 Wochenstunden und derzur Disposition gestellten Lernmittelfrei-heit. M.M./dpa
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung»Alte Ziegelei Rädel«
Am 13. Februar 1997 wurde in Rädel beiLehnin (südwestlich von Berlin) die »Kin-der- und Jugendhilfeeinrichtung Alte Zie-gelei Rädel« feierlich eröffnet. MichaelSchubert von der Michael-GemeinschaftSchweigmatt hielt den Festvortrag überdas Thema: Erziehungsschwierige Kinder– eine Herausforderung für uns. Vertreterder Jugendämter, anderer Einrichtungenaus der Umgebung, der Waldorfschulenaus Berlin und Brandenburg sowie Freun-de und Förderer überbrachten persönlichihre Glückwünsche.In der Einrichtung finden erziehungs-schwierige Kinder von 6 bis 13 JahrenAufnahme und wohnen auf dem Geländein kleinen Gruppen. Angefangen hat manmit drei Kindern, die in dem jetzt fertigge-stellten Gebäude untergebracht sind. Aufdem rund vier Hektar großen Geländesollen die Kinder durch den täglichenUmgang mit Tieren (Pferde, Schafe undZiegen) und durch die Arbeit an der ErdeEntwicklungsstörungen kompensierenund ihr inneres Gleichgewicht wiederfin-den. Die Kinder werden hier auch unter-richtet. Die kleine Schule ist der Potsda-mer Waldorfschule angegliedert.Weitere Informationen unter Tel. (030)8017477 (Raganhild Zühlke). M.M.
Haschisch-Handel
Ein Schüler, der in der Schule mit Ha-schisch handelt, darf an eine andere Schu-le verwiesen werden. Das hat das BerlinerVerwaltungsgericht in einem Eilverfahrenentschieden (Az.: 3 A 1/97). Damit könne
deutlich gemacht werden, daß Drogen-handel in der Schule keineswegs geduldetwerde, hieß es. M.M./dpa
Fremdsprachenunterricht oftfrustrierend
Gymnasiasten sind vom Fremdsprachen-unterricht oft frustriert. Dies zeigtenSprachwissenschaftler der Universität Bo-chum in einer empirischen Untersuchung.Der Grund für die Frustration sei eine Un-terforderung von Intellekt und Neugierder Schüler durch uninteressante und ba-nale Texte, erläuterte der Linguist RichardBausch. Aus dieser »unterrichtsmethodi-schen Gleichförmigkeit« folge Demotiva-tion, Frust und schließlich Abwahl des Fa-ches. M.M./dpa
Aufruf des Steiner Archivs
Das Archiv der Rudolf Steiner Nachlaß-verwaltung ist in den letzten Jahren zu ei-ner viel gefragten öffentlichen For-schungsstätte geworden, welche laufendAnfragen und Informationswünsche ausaller Welt, von Einzelpersonen wie vonInstitutionen, zu behandeln hat. Aller-dings muß diese Arbeit neben der eigent-lichen Aufgabe, der Herausgabe der Bän-de der Rudolf Steiner Gesamtausgabe,von nur wenigen festen Mitarbeitern inzudem recht beengten Räumlichkeiten ge-leistet werden. Die Finanzierung erfolgtebislang ausschließlich über Spenden we-niger privater Förderer sowie durch viel-fachen Honorarverzicht.Mit den wachsenden Aufgaben des Ru-dolf Steiner Archivs und seiner immerbreiteren Inanspruchnahme soll es nunauch in finanzieller Hinsicht auf eine brei-tere Grundlage gestellt werden: nämlichauf die Förderung durch möglichst vieleMenschen, die in einer solchen vielfälti-gen Archivarbeit eine sinnvolle und un-terstützenswerte Aufgabe sehen. Aus die-sem Grund hat sich kürzlich die Interna-tionale Fördergemeinschaft Rudolf Stei-ner Archiv, Rüttiweg 52, CH-4144 Arles-
434
heim, Tel. und Fax 0041 (0)61 701 35 89, alsein gemeinnütziger Verein begründet undsoeben einen ersten Aufruf (Rudolf Stei-ners Werk erschließen, pflegen, erfor-schen) veröffentlicht. Der Aufruf kann beider obengenannten Adresse angefordertwerden. M.M.
Schulungswege zu neuenWirtschaftsformen
Mitarbeiter und Unternehmensverant-wortliche in der Naturkostbranche stehenheute vor vielen neuen Fragen. Für vieleist »Professionalisierung« geradezu zumZauberwort geworden. Man hat das Ge-fühl, daß neue Fähigkeiten ausgebildetwerden müssen, damit man den wachsen-den Anforderungen gerecht werden kann.Diese Anforderungen hängen mit zuneh-menden Ansprüchen der Kunden und er-schwerten Vermarktungsbedingungenzusammen. Vielfach wird unter Professio-nalisierung jedoch nur die Übernahmevon Trainingsverfahren und Manage-menttechniken verstanden, wie sie in der»konventionellen« Wirtschaft üblich ge-worden sind. Entspricht das aber dem An-spruch einer Branche, die doch ausdrück-lich gegenüber den Methoden der kon-ventionellen Landwirtschaft eine Alterna-tive bieten will? Muß die andere Produkt-qualität nicht auch durch eine andere So-zialqualität ergänzt werden? Müssennicht konventionelle Formen der Wirt-schaft wie das Konkurrenzprinzip, das in-nerbetriebliche »Arbeitgeber-Arbeitneh-mer«-Verhältnis, Eigentumsformen, For-men des Umgangs mit Boden und Kapitalebenso hinterfragt werden wie die kon-ventionellen Produkte?Die neue, vom Großhandel, dem VerbundFreie Unternehmensinitiativen und demInstitut für soziale Gegenwartsfragen an-gebotene Seminarreihe will helfen, neueWege zu gehen und diejenigen professio-nellen Fähigkeiten zu entwickeln, die inder Naturkostbranche heute gebrauchtwerden, die aber auch in anderen Bran-
chen zunehmend an Bedeutung gewin-nen.Wie arbeiten wir innerbetrieblich zusam-men? Wie entwickeln wir überbetriebli-che Zusammenarbeitsformen, die dasÜberleben der Naturkost sichern helfenund neue Entwicklungschancen erschlie-ßen? Wie müssen wir den Kunden, denVerbraucher ansprechen und in unsereArbeit einbeziehen? Was kann der Einzel-ne tun, um seine beruflichen und mensch-lich-sozialen Fähigkeiten zu steigern? Ansolchen Fragen soll bei zwei Seminarengearbeitet werden:Das erste Seminar (Samstag, 31. Mai bisMontag, 2. Juni 1997: »Durch Zusammen-arbeit zu persönlicher Entwicklung«) istfür Mitarbeiter/innen, Auszubildendeund Unternehmensverantwortliche in derNaturkostbranche ausgelegt. Es ist aberauch offen für Mitarbeiter anderer Unter-nehmen, die nach neuen Wirtschaftsfor-men suchen. Das zweite Seminar (4. bis 6.Oktober 1997: »Führung und Selbstfüh-rung«) ist vor allem für Unternehmens-verantwortliche gedacht.Die Seminare finden statt im Haus Argodes Handelskontors Willmann, TafingerStr. 8, 71665 Vaihingen-Enz. Veranstaltersind das Handelskontor WillmannGmbH, der Verbund Freie Unterneh-mensinitiativen und das Institut für sozia-le Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart. Ver-antwortlich sind Christian Czesla, UdoHerrmannstorfer, Jürgen König, Dr. Chri-stoph Strawe. Das detaillierte Programmund Anmeldeunterlagen erhalten Siebeim Institut für soziale Gegenwartsfra-gen, Haußmannstr. 44 A, D-70188 Stutt-gart, Tel.: 0711-236 89 50, Fax: 236 02 18
Fortbildungskurse in den SchweizerAlpen
• Forstpraktika im Bergwald. Fortbil-dungskurs vom 17. bis 19. Oktober 1997 inSaxeten im Berner Oberland. Dieser Kurszeigt auf, wie im Rahmen von fachkundiggeführten Praktika ganze Schulklassen im
435
Jugendalter in verantwortungsvolle Pfle-ge- und Bewirtschaftungsaufgaben in un-seren Gebirgswäldern einbezogen wer-den können.• Feldbiologisch-goetheanistische Studi-enwoche am Rande des Großen Aletsch-Gletschers, vom 11. bis 16. August 1997 imNaturschutzzentrum Aletsch/Oberwal-lis.Der Fortbildungskurs bietet ein prakti-sches Übungsfeld für Lehrer und natur-wissenschaftlich Tätige, welche die ge-wohnte zergliedernde Naturbetrachtungbewußt erweitern wollen. Er will Wegeaufzeigen, wie wir durch phänomenologi-sches Arbeiten in freier Natur zu einergoetheanistischen Naturkunde gelangenkönnen und wie diese unter anderem ineiner zeitgemäßen Umweltpädagogikumgesetzt werden kann.»Bildungswerkstatt Bergwald« ist eineprivate Initiative für praxisnahe Jugend-pädagogik und arbeitet eng mit der forst-lichen Berufswelt zusammen. Sie ist einTeilprojekt von CH-WALDWOCHEN, ei-ner gesamtschweizerisch tätigen Organi-sation für ökologische Bildungsarbeit.Programme und Anmeldung: Bildungs-werkstatt Bergwald, Christoph Leuthold,Postfach 72, CH-3700 Spiez, Fax: 0041- 33-6540845. M.M.
Vorblicke für Schulabgänger undStudienanfänger
Nach vorne sich wenden, der eigenen Le-benszukunft zu: Nach dem Abschluß derSchulzeit lebt dieses Ziel im Menschen.Dabei stellen sich die Fragen nach der ei-genen Aufgabe, dem Beruf, nach Ausbil-dung und Weiterbildung. Sie sind Teil derFrage nach der Zukunft, der eigenen undder der Menschengemeinschaft. Dozen-ten von Universitäten und anderen Aus-bildungsstätten, Berufstätige und Studie-rende, die die Hochschulen kennen, bie-ten mit diesem Kurs Vorbereitungsmög-lichkeit für Ausbildung und Studium.Man kann »sich nicht ausbilden lassen«,
man muß es selber tun – dafür wollen dieDozenten eine Hilfestellung bieten. Schul-abgänger, Wehr- und Zivildienstleistende,Studienanfänger und Auszubildende sinddazu vom 24. bis 29. August 1997 nach Il-menau in Thüringen eingeladen. Dort fin-den täglich statt: Künstlerische Übungenin Gruppen, gemeinsame Kurse, Fachkur-se in Gruppen zu Architektur, Bildhaue-rei, Malerei, Bio-Wissenschaften, Mathe-matik, Medizin und anderen Heilberufen,Pädagogik, Physik, Sprache, Gesprächeim Plenum. Außerdem gibt es Vorträgeund Darbietungen, Einzelgespräche undBeratung.Anmeldung: schriftlich unter Angabe vonAlter und Schulabgangsjahr an Dr. MariaKusserow, Krumme Str. 25, 89518 Heiden-heim, Tel.: 07321-45686 oder 43741. M.M.
Zürich: Vom Atelier zur Schule
Anfänglich bot die Maltherapeutin Adel-heid Thulcke im »Künstlerisch-therapeu-tischen Atelier« Kurse und Einzelthera-pien für Erwachsene in Malen, Zeichnenund Plastizieren an. Bald kamen durchChristian Althaus Kurse in Sprachgestal-tung und Einzeltherapie dazu. Auch bil-dete sich unter seiner Leitung die Laien-spielbühne Jakchos. Darüber hinaus wer-den Kurse zur Biographiearbeit als Halb-jahreskurse, Vertiefungsseminare und alsAusbildung angeboten.Adelheid Thulcke erweiterte ihre Malthe-rapie, die auf der von MargaretheHauschka beruhte, durch jene von LianeCollot d‘Herbois. Dabei übernahmenJeroen van Houten den medizinisch-men-schenkundlichen und Christian Althausden anthroposophisch-geisteswissen-schaftlichen Teil. Da die eher werkstatt-mäßige Arbeitsweise im Laufe der Jahreeinen ausbildungsartigen Charakter an-nahm, wurde das »Künstlerisch-thera-peutische Atelier« zur »Schule Jakchos«umbenannt. Zur Aufführung kommenGoethes Drama »Iphigenie auf Tauris«und Edouard Schurés »Das heilige Drama
436
von Eleusis«. Nähere Auskunft erteilt:Schule Jakchos, Ekkehardstr. 11, CH-8006Zürich. Doris Tanner-Christen
Der Ketzer – ein Theaterstück überGiordano Bruno
Wer war Giordano Bruno, und was hat ermit uns zu tun? – Dieser Frage widmensich Olaf Bockemühl (Regisseur) und Tor-sten Blanke (Schauspieler) in einem Ein-Mann-Theaterstück, das am 5. April imForum Theater Stuttgart zur Urauffüh-rung kommen wird.Aufführungen: 5. April 1997 (Urauffüh-rung), 8., 9., 10., 11., 12., 15., 19., 22., 23.April 1997 im Forum-Theater Stuttgart.Kartenvorbestellung: 0711-297174. Am 22.August 1997 wird das Stück im Rahmen-programm der documenta im Anthropo-sophischen Zentrum Kassel aufgeführt.Ab November 1997 findet eine Tournee imdeutschsprachigen Raum statt. Nähere In-formationen: Das Zelt-Projekttheater:0711-2367736. M.M.
Kinder-Circus Festival in Hamburg
Vom 8. bis 19. Mai findet in Hamburg-Nienstedten auf dem Gelände der Elb-schloßbrauerei das Internationale Kinder-und Jugend-Circus- & Theaterfestivalstatt. Veranstaltet wird es vom integrati-ven Kinder- & Jugendprojekt von HausMignon und dem Circus Mignon aus An-laß des 700jährigen Bestehens von Nien-stedten. Auf dem Programm stehen öf-fentliche Zirkusaufführungen, Work-shops, Abendveranstaltungen im Nacht-café (Kleinkunstdarbietungen, Kabarett,Lesungen, Kino) sowie Konzerte. Dazuwerden Kinder und Jugendliche aus der
ganzen Welt eingeladen. 30 Gruppen ausÄthiopien, Rußland, Lettland, Finnland,Schweden, Holland, Wales, England, Bel-gien, der Schweiz und aus Deutschlandwollen dazu gerne nach Hamburg kom-men. Für jedes Gastkind werden für Un-terbringung und Verpflegung 100 Markbenötigt. Wer eine Patenschaft für auslän-dische Kinder übernehmen möchte, wen-de sich an: Martin Kliewer, Tobias Fiedler,Haus Mignon, Georg-Bonne-Str. 9, 22609Hamburg, Tel.: 040-822742-14, Fax:822742-42. M.M.
Globales Studienforschungsprojekt
Fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 18Jahren haben einen ganz großen Plan, derder Anfang einer neuen Studienart wer-den werden soll – eine Forschungsreiserund um die Erde. Neue Studienmöglich-keiten für Jugendliche, über den gewohn-ten Rahmen hinaus, zu schaffen, geht aufeine Idee des Wilhelm Ernst Barkhoff-In-stitutes in Hannover zurück. Der Grund-gedanke des Studiums ist, daß der Ju-gendliche sich selbst zusammenstellt, waser studieren will, um dann gemeinsammit dem Institut einen Weg zu erarbeiten,sein Studium zu verwirklichen. Für ihreReise, die von Slowenien über Tibet, Indi-en, Südostasien, Australien, Neuseeland,Kalifornien, Mexiko, dann weiter überMittel- und Südamerika, schließlich überAfrika bis nach Israel führen soll, habensich die fünf Jugendlichen die ThemenKunst, Frieden und Sinnesökologie vorge-nommen.Wer die die Gruppe unterstützen möchte,wende sich an das Wilhelm Ernst Bark-hoff-Institut, Weidkampshaide 17, 30659Hannover. M.M.