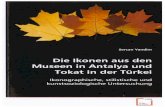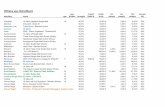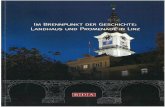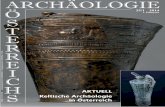Die Funde aus dem römischen Auxiliarkastell Till-Steincheshof
Die kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik aus Patara
Transcript of Die kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik aus Patara
die kaiserzeitlichen gebrauchskeramik aus patara
Taner korkut
Das archäologische Institut der Akdeniz Universität von Antalya führt erst seit 1989 Grabungen in der westlykischen Stadt Patara durch. Der Schwerpunkt der bisherigen Ausgrabungen war das Areal des Hügels Tepecik, die unterirdischen Kammergräber, das Bouleuterion, die Hafenthermen, etc. Aus den genannten antiken Plätzen kam viele Keramik an den Tag, die sich von 3. Jht. v. Chr. bis ins Mittelalter datieren lassen. Der größte Teil dieser Keramik wird im Depot des Grabungshauses aufbewahrt, während einige ausgewählte Exemplare im Museum von Antalya ausgestellt sind.
Obwohl die lykischen Städte im allgemeinen seit langem Gegenstand der Forschung sind, liegt, mit Ausnahme von einigen kurzen Aufsätzen oder Vorberichten, eine umfassende Betrachtung regionaler Gruppe der Keramik in Südwest-Kleinasien bisher leider nicht vor. Ebenfals steht eine archäologisch-historische Bestimmung der in Patara gefundenen Keramik noch aus. Die nicht zahlreichen Publikationen konnten zwar den Typus der Keramik in Lykien grob definieren, doch ist ihnen allen eine relativ dünne Materialbasis gemein. Dies führt zu eingeschränkten Ergebnissen im Bezug auf chronologische Fragen ebenso wie im Falle der Typologie oder der Bestimmung von Werkstätten.
Die aufgezeigten Schwachpunkte der bisherigen Arbeiten machen die Notwendigkeit einer möglichst vollständigen Sammlung und Untersuchung des bisher verfügbaren Materials aus Patara sichtbar, anhand derer die oben genannten Problemen gelöst werden könnten. Zu diesem Zweck wurde im Jahr 1999 mit der Bearbeitung der im Depot des Grabungshauses in Patara aufbewahrten Keramik begonnen. Das gesamte Material wurde zunächst chronologisch und typologisch geordnet. Im Rahmen der verschiedenen Projekte wurde mit den Dokumentationsarbeiten dieser erfaßten Stücken angefangen. Ein ähnliches Projekt wurde im Jahr 2000 im Museum von Antalya durchgeführt. Diese Unternehmung ist bereits mit Erfolg beendet. Im Mittelpunkt meines Projektes steht nun die „kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik“ aus Patara, von der hier nur einige ausgewählte Beispiele vorgestellt werden sollen.
192 T. KORKUT
Unter der Bezeichnung “kaiserzeitliche Gebrauchskeramik” wird das Material, das sowohl aus dünnwandigen als auch aus dickwandigen Gefäßen besteht, zusammengefaßt. Diese Gefäße gehören weder zu den Gattungen der bemalten Keramik, wie z. B. Terra Sigillata, noch zur Reliefkeramik, die während der römischen Kaiserzeit ebenfalls als Tafelgeschirr in Patara verbreitet war. Es handelt sich hier meist um Stücke, die im Alltagsleben verwendet worden sind. Nach ihren Gefäßformen lassen sie sich folgender Weise untergliedern: Einhenkelige Kannen, Bauchige Krüge mit Langem Hals, Zylindrische Eimer, Schüsseln, Kochtöpfe, Pfannen, Kohlenbecken, Reibschale, Deckel, Vorratsamphoren, Balsamaria. Meine bisherigen Untersuchungen zeigen, daß der Typus der kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik aus Patara weitgehend in der Tradition der hellenistischen Vorläufern steht. In der Regel wurden die schon aus hellenistischer Zeit bekannten Gefäßformen hier weiterhin tradiert.
Da ähnliche Stücke anhand ihrer Gefäßformen, Größen und Wandstärken untereinander mehrere Unterschiede aufweisen, werden sie in der Literatur als Fein- oder Grobkeramik, dünnwandige oder dickwandige Keramik, grobtonige Küchenwaren bzw. einfach Küchenkeramik genannt 1. In der Literatur neu hinzugekommen ist die Benennung der kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik als dünnwandige Hartware 2. In der englischen Literatur werden auch die verwandten Bezeichnungen, so z. B. fine ware, coarse ware, thin-walled ware, cooking pots bzw. kitchen ware, häufig verwendet 3. Darüber hinaus wird häufig zum Ausdruck gebracht, daß die Formate der dünnwandigen Keramik kleiner als die der dickwandigen sind. Eine sorgfältigere Herstellung und die Bemalung der Gefäße werden zwischen Fein- und Grobware ebenfalls als wichtiges Kennzeichen angenommen 4.
Es muß jedoch an dieser Stelle jedoch hervorgehoben werden, daß bei der Trennung von zwei Gefäßgruppen, wie Fein- oder Grobware, die oben erörterten Behauptungen nicht immer eine wichtige Rolle spielen. Denn wie die Keramik aus Patara zeigt, kommt es häufig vor, daß eine Gefäßform unterschiedliche Variationen aufweisen kann. So sind z. B. die dünnwandigen Kochtöpfe, Kochkesseln oder Kasserollen sehr sorgfältig sowohl in großem als auch in kleinem Format hergestellt worden. Die unterschiedliche Wandstärke innerhalb einer Gefäßform, die dem gleichen Zweck gedient hatte, ist in dieser Region ebenfalls durch zahlreiche Exemplare vertreten. Eine solche variantenreiche Herstellung findet sich häufig in der Gruppe von einhenkeligen Kannen oder Krügen. Schließlich wurden während der römischen Kaiserzeit mehrere Gefäßformen mit einem Firnis oder Überzug verwendet. Derartige
1. Mitsopoulos-Leon 1991, 131 ff.; Gassner 1997, 155 ff.; Hübner 1997, 89 ff.2. Japp 1999, 301 ff.3. Degeest 2000, 67 ff.4. Hübner 1997, 90.
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 193
Exemplare können mit einer Farbe teilweise oder völlig abgedeckt sein. Ferner ist es auch üblich, daß diese Beispiele hinsichtlich der Bearbeitung der Wandung voneinander abweichen können. Aus diesen Gründen werde ich hier die zusammengestellten Exemplare aus Patara nicht in üblicher Art und Weise unterteilen, sondern die Gefäße nach ihren Formen und ursprünglichen Funktionen gruppieren.
Hinsichtlich der Gefäßformen finden die Exemplare aus Patara ihre Parallelen sowohl im ganzen anatolischen Raum als auch im griechischen Bereich oder auf italischem Boden. Daher werden bei der Datierung dieser Keramik die Vergleichsbeispiele auch aus anderen Gebieten in Betracht gezogen. Die meisten Exemplare wurden in den Auffüllschichten gefunden. Die Anzahl der Gefäße, die nach dem Fundzusammenhang sicher zu datieren sind 5, ist geringer. Ob es sich dabei in Patara um Importware aus den verschiedenen Herstellungszentren handelt oder ob diese Keramik als einheimische Erzeugnisse zu verstehen ist, wird nach der Tonanalyse deutlich erklärt, wobei der Ton der hier behandelten Gefäße in der Regel homogenen Zustand zeigt 6.
5. In diesem Zusammenhang sind die festdatierten unterirdischen Kammergräber aus Patara, von denen bisher mehr als 50 Stücke freigelegt worden sind, von besonderer Bedeutung, vgl. İ‚kan & Çevik 1995, 187 ff.
6. Die Farbenbestimmungen erfolgen nach: Munsell Soil Color Charts �1975�.Die Farbenbestimmungen erfolgen nach: Munsell Soil Color Charts �1975�.
Abb. 1. Patara, Profil des Keramikofens auf dem Tepecik-Hügel.
194 T. KORKUT
Neben den Gruppen bekannter Keramik gibt es in Patara jedoch Exemplare, so z. B. die Vorratsamphoren, deren Form außerhalb dieser Region nirgendwo zu finden ist. Sie weisen eher einheimische Merkmale auf. Daher ist es durchaus möglich, daß viele Keramikformen vor Ort in einer oder mehreren lokalen Werkstätten produziert worden sind. Einige dieser Produktionsstätten wurden in Patara bereits in den vergangenen Jahren auf dem Tepecik-Hügel lokalisiert �Abb. 1, 2� 7. In diesem Zusammenhang verdienen neben der am Ort gefertigten Keramik auch die Formschüsseln oder die Abfallprodukte eine besondere Beachtung.
Ferner wurden in Patara Gefäße gefunden, die sicher nicht hier produziert worden sind. Es handelt sich dabei um Importkeramik, die durch viele Beispiele in Patara vertreten sind, so z. B. die Transportamphoren des Gazatypus, die mit rotem Überzug abgedeckte Reliefkeramik aus Knidos, oder die bemalte nabatäische Keramik aus dem jordanischen Raum. Unter der importierten Terra Sigillata Keramik sind die reliefierten Exemplare der westlichen Gruppe, und zwar die arretinische Terra Sigillata von besonderem Interesse. Alle diese Stücke gehören jedoch nicht zur Gattung der hier behandelten kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik. Gemeinsam ist ihnen nur, daß beide Gruppen aus der römischen Kaiserzeit stammen und in Patara zusammengefunden wurden.
7. Vgl. IVgl. I‚in & Uygun 2001, 79 f. Abb. 3.4.
Abb. 2. Patara, Keramikofen auf dem Tepecik-Hügel.
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 195
1. die gefässformen
Einhenkelige Kannen: Nr. 1-10
Diese Gruppe der Gefäßformen zeichnet sich durch einen flachen Boden oder ringförmigen Fuß, kugelige Wandung, starken Vertikalhenkel und eine breite Mündung auf der Oberseite aus. Hinsichtlich der Gliederung der Lippe und der Wölbung des Körpers kann man diese Gruppe in fünf Varianten unterteilen: Bei der ersten Variante �Nr. 1-3� weisen die Gefäße einen gedrungenen bauchigen Körper und eine trichterförmige Mündung auf. Die Wandstärke dieser Stücke ist im Vergleich zu den anderen Exemplaren verhältnismäßig dünn. Die Vergleichsbeispiele dieser Variante kommen im 1. Jh. n. Chr. häufig vor. Unter der zweiten Variante sind die Stücke zusammengefaßt, deren Oberkörper dünner als unteren Teil ist �Nr. 4-6�. Bei diesen Exemplaren liegt die weiteste Körperausdehnung im unteren Bereich des Gefäßes, doch ist die trichterförmige Mündung weiterhin verwendet, wobei sie wie es bei der ersten Variante der Fall ist, nicht weit außen gezogen wurde. Die Wandstärke dieser Gefäße ist im Vergleich zur ersten Variante stärker. Ähnliche Beispiele dieser Variante werden ab der flavischen Zeit datieren. Zwei Stücke der dritten Variante, die ins 2. Jh. n. Chr. zu datieren sind, unterscheiden sich von diesen Exemplaren nur dadurch, daß diese Gefäße nicht mehr die trichterförmige Mündung aufweisen �Nr. 7-8�. Der Rand ist außerdem relativ steil geschnitten. Im 3. Jh. n. Chr. kann man allgemein bei den Formen der einhenkeligen Kannen große Änderungen beobachten �Nr. 9�. In diesem Fall ist der Körper kaum gewölbt. Auf der Oberseite ist die trichterförmige Mündung vom Körper deutlich abgesetzt. Der Fuß ist dagegen dünn und ziemlich nach unten gezogen, so daß das Gleichgewicht des Gefäßes gestört wurde. Diese vierte Variante ist in Patara bisher nur durch zwei Exemplare vertreten. Der späteste Vertreter der einhenkeligen Kannen aus Patara stammt aus dem 4. Jh. n.Jh. n. Chr. �Nr. 10�. Dieses Gefäß weist im Gegensatz zu den bisherigen Varianten, die meist�Nr. 10�. Dieses Gefäß weist im Gegensatz zu den bisherigen Varianten, die meist aus orange-rotem oder braunem Ton bestehen, die Tonfarbe grau auf und wurde aus glimmerhaltigem Ton produziert. Ferner wurde auf der Schulter dieses Gefäßes das für diese Zeit charakteristische Schmuckmotiv, die geritzte Wellenlinie dargestellt.
196 T. KORKUT
1. PTR 1992 Nek. 15 Schicht: -70. H 11,8; ODm 8,4; UDm 6,3. Ton: 10 �R �� 7�4 �very paleTon: 10 �R �� 7�4 �very pale brown�, Überzug: 7, 5 �R �� 6�6 �reddish yellow�.Vgl.: Jones 1950, 149 ff. Nr. 711 Abb. 200 �1. Jh. n. Chr.�; Catling 1981, 92 f. Nr. 297 Abb. 5 �Frühkaiserzeit�; Slane 1986, 289 Nr. 71 Taf. 66 �1. Jh. n. Chr.�; Mitsopoulos-Leon 1991, 132 K 8 Taf. 183 �1. Jh. n. Chr.�; Anderson-Stojanovic 1992, 43 ff. Nr. 220-222 �Mitte 1. Jh. n. Chr.�;Jh. n. Chr.�; Anderson-Stojanovic 1992, 43 ff. Nr. 220-222 �Mitte 1. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992, 197 ff. Nr. 84.85 Taf. 205 �Mitte 1. Jh. n. Chr.�; Hayes 1998, 444 ff. Abb. 16, 20 �Mitte 1. Jh. n. Chr.�; Japp 1999, 317 ff. Nr. 33 Abb. 2 Taf. 27 �1. Jh. n. Chr.�; Eiring 2001, 116Jh. n. Chr.�; Eiring 2001, 116 f. Abb. 3.12 m �1. Jh. v. Chr.�.2. PTR 1999 TN 3 Schicht: -62�-69. H 8; ODm 5,6; UDm 3,3.Vgl.: Robinson 1959, 22 ff. G 182 Taf. 7 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Moevs 1973 Nr. 68. 70 �Mitte 1. Jh. n. Chr.�; Love 1974, 85 ff. Abb. 27 �1. Jh. n. Chr.�; Heimberg 1982, 88 f. Nr. 680. 681Jh. n. Chr.�; Love 1974, 85 ff. Abb. 27 �1. Jh. n. Chr.�; Heimberg 1982, 88 f. Nr. 680. 681Jh. n. Chr.�; Heimberg 1982, 88 f. Nr. 680. 681 Taf. 37 �1. Jh. n. Chr.�; Hayes 1983, 128 Nr. 118 Abb. 10 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Hayes 1991, 59 Taf. 22, 17 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Schmaltz 1994, 222 f. Nr. 58 Abb. 25 �1. Jh. n. Chr.�; BordosJh. n. Chr.�; Bordos 1997, 236 Taf. 154 a �1. Jh. n. Chr.�; Tekkök-Biçken 1996, 122 F 33 Abb. 88 �Früh 2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1997, 70 f. Nr. 2 �2. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Gassner 1997, 166 f. Nr. 680 Taf.Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Gassner 1997, 166 f. Nr. 680 Taf. 55 �Mitte 1. Jh. n. Chr.�; Istenic �� Schneider 2000, 341 ff. Abb. 3, 2; Başaran 2003, 72 f. Nr. 1-4 Taf. 46 �Spät 1. Jh. v. Chr.�.Jh. v. Chr.�.
3. PTR 1999 TN 3 Schicht: -30�-42. H 6,4; ODm 5,5; UDm 3,5.Vgl.: s. oben Nr. 2.
4. PTR 1998 TN 8 Schicht: -150�-160. H 13; ODm 9,2; UDm 6,6. Ton: 2,5 �R �� 7�4 �lightTon: 2,5 �R �� 7�4 �light reddish brown�, Überzug: 2,5 �R �� 7�4 �light reddish brown�.Vgl.: Walter 1958, 67 ff. Abb. 53 �Früh 2. Jh. n. Chr.�; Mitsopoulos-Leon 1978-80, 128 ff. Abb. 23 �Früh 2. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 Nr. 18 Taf. 170 �Trajanisch�; Hayes 2000, 316 Nr. 17 Taf. 4, 65 �Früh 2. Jh. n. Chr.�; Başaran 2003, 72 f. Nr. 5 Taf. 46 �1. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
5. PTR 1998 TN 8 Schicht: -180 �östlicher Kanal�. H 14,3; ODm 8,3; UDm 6. Ton: 10 �RTon: 10 �R �� 8�3 �very pale brown�, Überzug: 2,5 �R �� 6�6 �light red�.Vgl.: ÖzyiÏit 1991, 138 Abb. 14 a. b �2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.�; Sackett 1992 Nr. 17 Taf. 176 �Hadrianisch�; Meriç 2000, 95 Abb. 6, 1 �Flavisch�; Degeest 2000, 256 Nr. 4 H 100 Abb. 182-185 �2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.�; Meriç 2002, 75 K 452. 454 Taf. 38 �Spät 1. Jh. n. Chr.�.Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.�; Meriç 2002, 75 K 452. 454 Taf. 38 �Spät 1. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
6. PTR 1998 TN 8 Schicht: -110�-180 �östlicher Kanal�. H 13,4; ODm 7,3; UDm 6,2. Ton: 10Ton: 10 �R �� 7�4 �very pale brown� Vgl.: Coleman 1986, 134 ff. E 36. 37 Taf. 51 �Früh 2. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992, 147 ff. Nr. 17 Taf. 169 �Trajanisch�.
7. PTR 1998 TN 8 Schicht: -180 �östlicher Kanal�. H 13,8; ODm 8,5; UDm 5,7. Ton: 10 �RTon: 10 �R �� 7�4 �very pale brown�, Überzug: 2,5 �R �� 5�8 �red�.Vgl.: Robinson 1959, 91 M 69 Taf. 21 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Kahil 1969, 237 Nr. 10 Taf. 49 �2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.�; Diederichs 1980, 35 ff. Nr. 139-141 Taf. 89. 90 �2. Hälfte des 2. Jhs.
198 T. KORKUT
n. Chr.�; Forster 2001, 163 f. Abb. 4.14 d.e �Mitte 2. Jh.Jh. n. Chr.�.
8. PTR 1998 TN 8 �östlicher Kanal�. H 15,3; ODm 9,2; UDm 6. Ton: 10 �R �� 8�4 �very pale brown�, Überzug:Ton: 10 �R �� 8�4 �very pale brown�, Überzug: 2,5 �R �� 6�8 �light red�.Vgl.: Brock 1949, 65 Nr. 23 Taf. 22 �Früh 3. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 Nr. 2 Taf. 182 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Gürler 2000, 114 Nr. 4. 5 Abb. 1 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Forster 2001, 152 f. Abb. 4.7 j.k �Mitte 2. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
9. PTR 1991 Nek. K 3 Schicht: -25 �Hinter der byzantinischen Mauer�. H 10,2; ODm 6; UDm 3,1. Ton: 5 �R �� 6�6 �reddish yellow�.Vgl.: Robinson 1959, 55 J 43 Taf. 9 �Früh 3. Jh. n. Chr.�; Pülz 1986, 14 f. Nr. 13 Abb. 4 Taf. 4,1 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 Taf. 172, 7. 8 �Hadrianisch�;8 �Hadrianisch�; Anderson-Stojanovic 1992, 43 Nr. 219. 223 Taf. 26 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1997, 70 f. Taf. 25, 1 �3. Jh.Jh. n. Chr.�; Hayes 1997, 70 f. Taf. 25, 1 �3. Jh.Jh. n. Chr.�; Gassner 1997, 156 ff. Taf. 51 �3. Jh. n. Chr.�; Meyer-Schlichtmann 1999, 223 f. Nr. 34 Abb. 87 �1. Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.�; Forster 2001, 152 f. Abb. 4.7 ¬ �Spät 2- Früh 3. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
10. PTR 1990 Hafenkirche-Kapelle, Schicht: -30 �Vor dem Apsis�. H 13,9; ODm 7,3; UDm 5,18. Ton: Gley 2Ton: Gley 2 �� 5�1 �greenish gray�.Vgl.: Felten 1975, 71 f. Nr. 110. 111 Taf. 23 �Frühchristlich�; Heimberg 1982 Nr. 12 Taf. 52 �3-4 Jh. n. Chr.�; Strobel �� Gerber 2000, 258 f. Abb. 16 d �3-4 Jh. n. Chr.�.
Bauchige Becher: Nr. 11-13
Die bauchigen Becher mit abgesetztem Schrägrand bzw. eingekehltem Rand sind innerhalb der bisherigen Fundgruppen aus Patara nur durch wenige Exemplare vertreten, die sich anhand der Gefäßform in zwei Varianten unterteilen lassen. Das Gefäß mit der Nr. 11, der ersten Variante zugehörig, weist eine hohe Wandung, einen kleinen und feinen Fuß sowie eine nach
8
9
10
0 3 cm
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 199
außen gezogene Lippe auf. Eine derartige Form findet sich meist in den westlichen Gefäßgruppen, so z. B. bei den Barbotine-Gefäßen oder den sog. Grätenbecher. Die ältesten Exemplare dieser Gefäße tauchen im anatolischen Bereich erst in der frühen Kaiserzeit auf. Die Stücke der zweiten Variante sind in der Form der kalottenförmigen Näpfe gestaltet und mit orangenbraunem bzw. mit schwarzem Überzug versehen �Nr. 12-13�. Die Parallelen dieser Variante kommen häufig ebenfalls im Westen vor. Im anatolischen Raum sind sie erst ab tiberischer Zeit vermehrt anzutreffen.
11. PTR 2000 OG 47 Schicht: -268. H 7,9; ODm 7,3; UDm 3,6. Ton: 10 �R �� 5�8 �red�, Überzug: 10 R �� 4�1 �dark reddish gray�.Vgl.: Robinson 1959, 13. 24 F 25 G 18 Taf. 1. 7 �Frühkaiserzeit�;7 �Frühkaiserzeit�; Hayes 1991, 59 ff. Abb. 22, 2. 3; Mitsopoulos-Leon 1991, 132 Nr. K 1.6 Taf. 180.182; Tsimpidou-Auloniti 1994, 86 Taf. 42 a �Späthellenistisch-Frühkaiserzeit�; Tekkök-Biçken 1996, 131 f. G 28-30 Abb. 78 �Frühkaiserzeit�; Peignard 1997, 310 f. Taf. 231 b �Späthellenistisch�; Petriaggi 1997, 207 Nr. 28. 28 Taf. 284 �Frühkaiserzeit�; Chatzedakes 1997, 304 Taf. 226, 1-5; Karadema 1997, 384 Nr. S 38 Taf. 286,5 �Späthellenistisch-Frühkaiserzeit�; Elaigne 2000, 22 f. Nr. 19 Abb. 1 �Augusteisch�.
12. PTR 1997 M 42. H 8; ODm 11.Vgl.: Riley 1979, 329 ff. Nr. 801-810 �Frühkaiserzeit�; Mitsopoulos-Leon 1991, 134 f. Nr. K 32 Taf. 194 �Spätaugusteisch-Frühtiberisch�; Anderson-Stojanovic 1992, 114 Nr. 881 Taf. 104; Zafeiropoulou 1994, 247 f. Taf. 201 a �1. Jh. v. Chr.�; Meriç 2002, 110 Nr. K 738 Taf. 64 �1. Jh. n. Chr.�; Denizli �� Kaya 2003, 61 Abb. 12 Taf. 6 �Frühkaiserzeit�.
13. PTR 1997 M 43. H 7,2; ODm 13.Vgl.: s. oben Nr. 12.
11
12
13
200 T. KORKUT
Bauchige Krüge mit Langem Hals: Nr. 14-19
Durch die hier zusammengefaßten sechs Gefäße kann man allgemein den Typus der kaiserzeitlichen Krüge aus Patara, die anhand der Vielzahl der bisher bekannt gewordenen Stücken in drei Varianten einzuteilen sind, definieren. Die Körper der Krüge der ersten Variante sind gedrungen und kugelig gestaltet �Nr. 14�. Sonst gehören ein schmaler und zylindrisch langer Hals mit einem Bandhenkel und ein niedriger Ringfuß zu den charakteristischen Besonderheiten dieser Gefäße. Derartige Krugformen ähneln den hellenistische Lagynoi. Daher wird in der Literatur häufig zum Ausdruck gebracht, daß sie die hellenistischen Lagynoi ersetzt haben. Doch kommt diese Gefäßform bereits in der späthellenistischen Zeit vor, in der Gruppe von ESA oder etwas später in der arretinischen Keramik. Die kaiserzeitlichen Imitationen der späthellenistischen Gefäße in kugeliger Form wurde erst im 1. Jh. n. Chr. in Vielzahl produziert. Derartige Imitationen konnten sowohl als unbemalte Tonkrüge, als auch
14
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 201
mit einem weißen Überzug versehen, vorkommen. Darüber hinaus gibt es in dieser Zeit auch Imitationen, die jedoch aus Glass hergestellt sind. Die Stücke der zweiten Variante bilden gleichzeitig die spätere Entwicklungsphase der Tonkruge �Nr. 15�. Sie lassen sich anhand der Vergleichsbeispiele in das 2. Jh. n. Chr. datieren. Besonders hervorzuheben ist für diese Variante der durch mehrere Rillen gegliederte Rand, der in dieser Zeit für ähnlichen Gefäße charakteristisch ist. Außerdem ist der Körper dieser Gefäße im Vergleich zur ersten Variante etwas gröber bearbeitet. Aufgrund der Modellierung der oberen Teile der Gefäße kommen diese Stücke in zwei Formen vor. Es handelt sich um die normale runde Mündung �Nr. 16� oder die Kleeblattmündung �Nr. 17�. Daß es im 3. bzw. 4. Jh. n. Chr. bei den Krügen auch eine bestimmte Standartform gab, wird durch mehreren Exemplaren, die die dritte Variante bilden, bestätigt �Nr. 18-19�. Für diese Variante charakteristisch ist ein dünner- und langer Hals mit einem vertikalen Henkel, ein kugeliger Körper mit zarten Rillen und ein flacher Boden. Eine besondere Beachtung verdienen die spiralförmigen Motive auf dem Gefäßkörper, die aus einer roten Farbe gemacht wurden. Identische Gefäße mit ähnlichen Motiven sind sowohl in Anatolien als auch im ganzen ägäischen Raum weit verbreitet.
14. PTR 1993 TN 3. H 32; ODm 8; UDm 16,4.Vgl.: Mc Fadden 1946,476 ff. Nr. 45-48.51 Abb. 40.41�1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Vessberg �� Westholm 1956, 66 ff. Abb. 30, 21.22; 31,1-5 �1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Hayes 1976, 90 Nr. 50 Taf. 5 �1. Jh. n. Chr.�; Anderson-Stojanovic 1992, 115 Nr. 890 Taf. 105; Rotroff 1997, 396 Nr. 1548 Abb. 93 Taf. 120 �50 v. Chr. �� 50 n. Chr.�; Meriç 2000, 92 f. Nr. 1 Abb. 3 �1. Jh. n. Chr.�; Başaran 2003, 74 Nr. 8 Taf. 46 �Spät 1. Jh. v. Chr.-Früh 1. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
15. PTR 1998 TN 1 Schicht: 0�-90. H 11; ODm 6,2.Vgl.: Jones 1950 Nr. 797 Abb. 162 �2. Jh. n. Chr.�; Robinson 1959, 88 M 45. 125 Taf. 20.23 �2.Jh. n. Chr.�; Robinson 1959, 88 M 45. 125 Taf. 20.23 �2. Jh. n. Chr.�; Kombou 1997, 242 Taf. 160 d. 161 a �2. Jh. n. Chr.�.
15
202 T. KORKUT
16. PTR 1999 TN 3 Brandoffen. Schicht: +10�-42. H 8,9; ODm 4,3.Vgl.: Riley 1979, 91 ff. Nr. 1167 Abb. 141 �2-3. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 Nr. 56 Taf. 180 �Hadrianisch�; Brogli 1996, 231 ff. Nr. 93 Abb. 820; 108, 835; Gassner 1997, 182 f. Nr. 768-770 Taf. 61 �2-3 Jh. n. Chr.�; Raeck 2000, 345 f. Nr. 6.12 Abb. 18.
17. PTR 1999 TN 3 Brandoffen. Schicht: +10�-42. H 10, 3.H 10, 3.Vgl.: Robinson 1959, 65 ff. K 67 M 42 Taf. 13. 20 �Spät 2 - Früh 3.20 �Spät 2 - Früh 3. Jh. n. Chr.�; Riley 1979, 91 ff. Nr. 1190. 1191 Abb. 142 �Spätrömisch�; Hayes 1983, 122 Nr. 76 Abb. 6 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Willams 1989Jh. n. Chr.�; Willams 1989 Nr. 531. 534. 535 Abb. 53; Özyi534. 535 Abb. 53; ÖzyiÏit 1992, 118 Abb. 14 �2. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 Nr. 9 Taf. 215 �Antoninisch�; Tekkök-Biçken 1996, 107 D 42 Abb. 61 �2-3. Jh. n. Chr.�; Raeck 2000, 347 f. Nr. 6.16 Abb. 20; Forster 2001, 158 f. Abb. 4.11 c �Mitte 2. Jh. n. Chr.�; Meriç 2002, 111 Nr. 761-763 Taf. 67 �2. Jh. n. Chr�.
18. PTR 1996 Hurmal¬k-Thermen, Schicht:Westraum -90�-40. H 14,5;H 14,5; UDm 6,2. Ton: 7,5 �R �� 7�6 �reddish yellow�. Überzug: 10 �R �� 7�3 �very pale brown� Vgl.: Robinson 1959 M 362 Taf. 33 �Spätrömisch�; Wintermeyer 1980 Nr. 139 Taf. 61 �3�4.Jh. n. Chr.�; Gawlikowski 1995, 89 Abb. 6 �Spätrömisch�.
19. PTR 1989 Nekr. H 18,8; ODm 4,8; UDm 11,4. Ton: 5 �R ��6�6 �reddish yellow�. Überzug: 7,5 �R �� 8�6 �reddish yellow�.Vgl.: s. oben Nr. 18
18
17
19
16
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 203
Zylindrische Eimer: Nr. 20-22
Die zylindrischen Eimer gehören auch zu den Haushaltwaren der römischen Kaiserzeit aus Patara. Ebenfalls sind diese Gefäße in großer Anzahl erhalten und lassen sich in zwei Varianten unterteilen. Bei der ersten Variante kommen die Eimer ohne Henkel vor �Nr. 20-21� und weisen eine einfache Wandung auf. Die Exemplare der zweiten Variante unterscheiden sich dadurch, daß sie zwei horizontale Henkel haben �Nr. 22�. Ähnliche Stücke werden in der Zeit zwischen den 1. Jh. v. Chr. und den 4. Jh. n. Chr. datiert. Da derartige Gefäße ohne große Änderung in einer langen Zeitspanne weit verbreitet waren, kann man anhand der Profile keine sichere Chronologie erstellen. Viele Beispiele zeigen lokale Besonderheiten, doch haben die früheren Exemplare �Nr. 20� einfache Gefäßkörper 8, während bei den späteren �Nr. 21� die geritzten Wellenmuster charakteristisch sind 9. Die Vergleichsbeispiele der Eimer mit horizontalen Henkeln �Nr. 22� kommen aber erst im 2. Jh. n. Chr. vor.
20. PTR 1999 TN 1 Schicht: 0�-100. H 11,7; ODm 24. Ton: 2,5 �R - 5�8 �red�.Vgl.: Robinson 1959, 42 G 187 Taf. 7 �Spät 1- Früh 2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1983, 97 ff. Nr. 117 Abb. 10 �Mitte 2. Jh. n. Chr.�; Bailey 1993, 227 f. Nr. 39. 40.Jh. n. Chr.�; Bailey 1993, 227 f. Nr. 39. 40.40.
8. Für späthellenistisch-frühkaiserzeitliche Eimer s. I. R. Metzger, AntK 22, 1, 1979, 14 ff. Taf. 8, 6; ders., Metzger 1993, 112 ff. Nr. 76 Abb. 172.
9. Die Gefäße mit geritzten Wellenlinien in dieser Art kommen in der Regel erst ab dem 3. Jh. n. Chr. häufig vor, vgl. Tekkök-Biçken 1996, 125 ff.; Poblome 1999 310; Ströbel & Gerber 2000, 258 f. Abb. 16 d.
20
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 205
21. PTR 1999 TN 9. H 10.8. Ton: 5 �R - 6�8 �reddish yellow�.Ton: 5 �R - 6�8 �reddish yellow�.Vgl.: Poblome 1999, 310 Nr. 1 F 140 Abb. 78 �3-4 Jh. n. Chr.�.
22. PTR 1998 TN 8 Schicht: -180 Nordostecke. H 24; ODm 23; UDm 18. Ton: 7,5 �R �� 7�6Ton: 7,5 �R �� 7�6 �reddish yellow�, Überzug: 10 �R �� 7�6 �yellow�.Vgl.: Diedrichs 1980 Nr. 332 Taf. 100-102 �2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1983, 97 ff. 173-176 Abb. 14.15 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 Nr. 12 Taf. 184 �Spätantoninisch�; Forster 2001, 164 f. Abb. 4.15 h.j �160-170�.
Schüsseln: Nr. 23-26
Die große Anzahl der erhaltenen Stücke oder Fragmente von Schüsseln geben erhebliche Hinweise auf die Entwicklung und Typologie dieser Gefäßgruppe. Die konische Form der Schüsseltypus mit nach außen gebogenem Rand und flachem Boden ist am meisten vertreten �Nr. 23-25�. Die früheren Beispiele dieser Form sind im späteren Hellenismus bzw. In die frühere Kaiserzeit anzusetzen. Im Gegensatz zu den hellenistischen Schüsseln, die sehr tief modelliert sind �Gasparetti 2003, 151 Nr. 39 Taf. 93�, sind diese Gefäße sehr flach modelliert. Die gerippte Wandung der hellenistischen Tradition kommt außerdem bei diesen Gefäßen nicht mehr vor. Die Schüssel in dieser Form sind zwischen den 2. und 3. Jh. n. Chr. im ganzen Mittelmeerraum weit verbreitet. Der Unterschied zwischen den Exemplaren aus den zwei verschiedenen Jahrhunderten besteht nur darin, daß die späteren Gefäße einen gewölbten Boden, so wie weit überhängenden und konvex gewölbte Ränder haben �Nr. 25�. Neben den konischen Schüsseln gibt es in Patara auch Exemplare, die eine schlanke, tiefe, fast eimerartige Form aufweisen �Nr. 26�. Die Außenseiten dieser Gefäße sind mit geritztem Wellenmuster versehen. Parallelen zu diesen Beispielen finden sich in Anatolien aber auch im ägäischen Raum und werden ins 3. bzw. 4. Jh. n. Chr. datiert.
23. PTR 1999 TN 2 Schicht: -100. H 10,8; ODm 36,4; UDm 24. Ton: 10 �R �� 7�4 �very paleTon: 10 �R �� 7�4 �very pale brown�, Überzug: 2,5 �R �� 7�3 �pale yellow�.Vgl.: Adamsheck 1979, 141 RC 88 a. b �1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Hayes 1983, 97 ff. Nr.Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Hayes 1983, 97 ff. Nr. 188.190 Abb. 16 �2. Jh. n. Chr.�; Pülz 1986 Nr. 27. 28 Abb. 9. 10 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Slane 1986, 271 ff. Nr. 16 Taf. 62 �Frühkaiserzeit�; Anderson-Stojanovic 1992, 112 ff. Nr. 846. 10031003 Taf. 99. 187; Sackett 1992, 147 ff. Nr. 4 a. 17 Taf. 174. 175 �Hadrianisch�; Hayes 1991, 65 f. Taf.175 �Hadrianisch�; Hayes 1991, 65 f. Taf. 24, 1-3; Gassner 1997, 162 Nr. 662.663 Taf. 53 �1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.�; Forster 2001, 163 f. Abb. 4.14 b �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Meriç 2002, 108 ff. Nr. 708. 709 Taf. 60-62 �Frühkaiserzeit�; Gasperetti 2003, 151 Nr. 38 Taf. 93 �Frühkaiserzeit�.
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 207
24. PTR 1998 TN 8 Schicht: -180. H 11,9; ODm 36; UDm 28. Ton: 5 � �� 7�4 �pale yellow� Vgl.: s. oben Nr. 23.
25. PTR 1998 TN 1 Schicht: -110. H 16,3; ODm 38; UDm 30. Ton 7,5 �R �� 7�6 �redishTon 7,5 �R �� 7�6 �redish yellow�.Vgl.: Pülz 1985, 77 ff. Nr. 63. 64 Abb. 11 �Spät 2 - 3. Jh. n. Chr.�; Gasperetti 2003, 150 Nr. 34 Taf. 92 �2-3 Jh. n. Chr.�.
26. PTR 1999 TN 2 Schicht: -100. H 10,8. Ton: 2,5 �R �� 7�8 �light red�, Überzug: 7,5 �RH 10,8. Ton: 2,5 �R �� 7�8 �light red�, Überzug: 7,5 �R �� 7�4 �pink�.Vgl.: Welles 1968, 29 Nr. 140 Taf. 7 �Mitte 3. Jh. n. Chr.�; Tekkök-Biçken 1996, 125 f. F 54 Abb. 93 �4. Jh. n. Chr.�; Gassner 1997, 156 ff. Nr. 640. 641. 655 Taf. 53 �3. Jh. n. Chr.�; Degeest641. 655 Taf. 53 �3. Jh. n. Chr.�; Degeest 2000, 254 Nr. 1 G 130 Abb. 80 �3-4. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
Kochtöpfe: Nr. 27-34
Einen großen Anteil an der erhaltenen Gebrauchskeramik aus Patara hat die Keramikgruppe, die als Kochgefäße und Vorratsgeschirr verwendet worden sind. Unter diese Bezeichnungen werden verschiedenen Formen der Küchengefäße gefaßt. Einige von diesen weisen bauchige Körper mit absteigendem Rand auf �Nr. 27-28�. Die unteren Teile der Körper sind in diesen Fällen fein gerippt. Außerdem sind die unteren Seiten der Gefäße konvex gestaltet, so daß sie ursprünglich nur auf Dreifußen, Standringen oder ähnlichen Trägern aufgestellt werden konnten. Ferner weist ein Kochtopf zwei horizontale Bandhenkel und noch zwei Henkel in vertikaler Form auf und ruht auf einem breiten Ringfuß �Nr. 29�. Dadurch ähnelt dieses Stück seiner Form den Hydrien. Eine derartige Gefäßform ist, abgesehen von einem Stück, das ebenfalls die gleiche
26
208 T. KORKUT
Form und vier Henkel aufweist 10, innerhalb der hier behandelten kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik ein Unikat. Identische Formen in Athen werden bereits ins 1. bzw. 2. Jh. n. Chr. datiert 11. Eine andere Variante der Kochgefäße zeigt einen beutelförmigen Bauch �Nr. 30�. In diesem Fall ist der ganze Körper fein gerippt. Die untere Seite des Gefäßes ist ebenfalls konvex ausgeformt. Da diese Gefäße in einem großen Format hergestellt sind, kann man für sie statt Kochtopf den Begriff „Kochkessel“ verwenden. Doch gibt es Exemplare in ähnlicher Form, die jedoch ziemlich klein modelliert sind und zwei sich gegenüber stehende Bandhenkel aufweisen �Nr. 31�. Diese Gefäße dienten ursprünglich als Kochtöpfe. Zu den Kochgefäßen kann man auch die Knickwandtöpfe mit horizontal abstehendem Rand und zwei sich gegenüber stehenden Henkeln zählen �Nr. 32�. Einige von diesen haben einen konvexen Unterteil, während die meisten einen flachen Boden aufweisen. Auch derartige Gefäße, jedoch ohne Henkel, sind in Patara durch zahlreiche Exemplare vertreten �Nr. 33�. Für die letztgenannten Gefäße wird in der Literatur auch der Begriff Kasserolle verwendet. Im Gegensatz zu anderer Gebrauchskeramik zeigen diese Knickwandtöpfe bessere Qualität. Darüber hinaus gibt es eine andere Variante von Kasserollen, die zwei Henkeln und einen flachen Boden aufweisen �Nr. 34�. Der ganze Körper ist in diesem Fall gerippt. Dieses Stück ist innerhalb der hier behandelten Keramikgattung ebenfalls als Unikat zu bezeichnen. Die Vielfältigkeit der Formenvarianten innerhalb der Kochgefäße gibt keine sicheren Datierungskriterien. Für die Datierung des hier behandelten Kochgeschirrs spielen in der Regel die einzelnen Besonderheiten der Gefäße eine wichtige Rolle. Anhand letzterer werden diese Stücke in die Zeit zwischen den 1. und 3. Jh. n. Chr. datiert.
27. PTR 1996 Hurmal¬k Thermen, Caldarium. H 21,4; ODm 19. Ton: 2,5 �R �� 6�8 �light red�.Vgl.: Pülz 1987, 55 Nr. 46 Abb. 15 �Spät 1- Früh 2. Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I Ç 1 Taf. 10; Tekkök-Biçken 1996, 68 A 162. 163 Abb. 30 �1. Jh. n. Chr.�; Hausmann 1996, 35 ff. Nr. 69. 70 Taf. 14 �1. Jh. v. Chr.�; Gassner 1997, 166 f. Nr. 688 Taf. 55 �1. Jh. n. Chr.�; Meriç 2002, 110 Nr. 742. 743 Taf. 65 �Flavisch�.
28. PTR 1998 TN 6 Schicht: -250�-330. H 8,4.Vgl.: s. oben Nr. 27.
29. PTR 1997 Gruft M 42. H 15; ODm 12; UDm 6,9.
10. Dieses Gefäß wurde ebenfalls in einem Kammergrab, das in die späthellenistische bzw. frühe Kaiserzeit datiert wird, gefunden, s. dazu İ‚kan & Çevik 1995, 194 f. Abb. 9 b.
11. Robinson 1959, 51 ff. J 4. J 40 M 39 Taf. 10. 18.
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 211
Vgl.: Jones 1950 Nr. 709 Abb. 157 �Kaiserzeitlich�; Robinson 1959, 51 ff. J 4. J 40 Taf. 10 �2. Jh. n. Chr.�; İ‚kan �� Çevik 1995, 194 f. Abb. 9 b �1. Jh. v. Chr.�; Forster 2001, 155 f. Abb. 4.9 a �Frühkaiserzeit�.
30. PTR 2001 Zwischen Theater und Bouleuterion. H 22,5; ODm 21,2. Ton: 2,5 �R �� 6�8H 22,5; ODm 21,2. Ton: 2,5 �R �� 6�8 �light red�.Vgl.: Hayes 1983, 97 ff. Nr. 67. 68 Abb. 6; Mitsopoulos-Leon 1991, 134 ff. K 25 Taf. 189 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I Ça 2. I Ça 4 Taf. 11. 12; Gassner 1997, 166 f. Nr. 683 Taf. 55; Hübner 1997, 91 ff. Abb. 1,7; 2, 6 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Forster 2001, 155 f. Abb. 4.9 c.d �100-150�.
31. PTR 1990 Nekr. III L 57 Schicht: -255. H 24,5; ODm 18,6. Ton: 5 �R �� 7�8 �reddishH 24,5; ODm 18,6. Ton: 5 �R �� 7�8 �reddish yellow�.Vgl.: Robinson 1959, 56 J 56.57 Taf. 11 �2. Jh. n. Chr.�; Riley 1979, 265 f. Nr. 515-517 Abb.Jh. n. Chr.�; Riley 1979, 265 f. Nr. 515-517 Abb. 104 �2-3. Jh. n. Chr.�; Diedrichs 1980, 41 Nr. 135 Taf. 13. 14; Hayes 1983, 138 Nr. 226 Taf. 7Jh. n. Chr.�; Diedrichs 1980, 41 Nr. 135 Taf. 13. 14; Hayes 1983, 138 Nr. 226 Taf. 7 �Mitte 2. Jh. n. Chr.�; Pülz 1985, 91 ff. Nr. 67 Abb. 14; Eskici 1992 II Çb 2- II Çb 6 Taf. 38. 39; Sackett 1992, 147 ff. Nr. 33 Taf. 174; 33, 207 �Neroisch-Hadrianisch�; ÖzyiÏit 1992, 104 Abb. 15 �Früh 3. Jh. n. Chr.�; Istenic �� Schneider 2000, 342 ff. Abb. 3,4; 4,5 �2. Jh. n. Chr.�; Forster 2001, 158 f. Abb. 4.11 a.b �3. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
32. PTR 1998 TN 8 Schicht: -80�-100. H 5,8; ODm 12,6.Vgl.: Jones 1950 Nr. 808 Abb. 183 �2. Jh. n. Chr.�; Robinson 1959, 42 f. G 194-196 Taf. 7 �Spät 1- Früh 2. Jh. n. Chr.�; Riley 1979, 261 f. Nr. 501-503 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Wintermeyer 1980, 151 Nr. 201-206 Taf. 59. 60 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1983 Nr. 79.81.82.84-90 Abb. 7 �Antoninisch�; Pülz 1985, 91 ff. Nr. 68 Abb. 16 �2. Jh. n. Chr.�; ÖzyiÏit 1991, 138 Zeichnung 12 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I Ga 1 - I Ga 4; I Gb 2 - I Gb 7 Taf. 3-6; Gassner 1997, 178Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I Ga 1 - I Ga 4; I Gb 2 - I Gb 7 Taf. 3-6; Gassner 1997, 178 Nr. 742 Taf. 59 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Istenic �� Schneider 2000, 342 ff. Abb. 2 �1-2. Jh. n. Chr.�;Jh. n. Chr.�; Istenic �� Schneider 2000, 342 ff. Abb. 2 �1-2. Jh. n. Chr.�; Forster 2001, 155 f. Abb. 4.9 g.h �100-150�.
33. PTR 1998 TN 8 Schicht: -80�-100 H 4,8.Vgl.: Hamdorf 1976, 216 Nr. 161 Abb. 248 �Mitte 3. Jh. n. Chr.�; Riley 1979, 261 f. Nr. 504.506.509.510 Abb. 103 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1983, 122 Nr. 80.83 Abb. 7 �Antoninisch�; Willams 1989, 62 f. Nr. 360. 361 Abb. 32 �2-3. Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I Gb1 Taf. 5; Schmaltz 1997, 36 ff. Nr. 20 Abb. 21 �Frühkaiserzeit�; Hübner 1997, 91 Abb. 1, 10; 2, 7. 8 �Spät 1. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
33
212 T. KORKUT
34. PTR 1998 TN 8 Schicht: Nordostecke -180. H 9; ODm 8;UDm 4. Ton: 5 �R �� 6�6 �reddish yellow�, Überzug: 2,5 �R �� 7�6 �reddishTon: 5 �R �� 6�6 �reddish yellow�, Überzug: 2,5 �R �� 7�6 �reddish yellow�.Vgl.: Wintermeyer 1980, 150 f. Nr. 202-205 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Anderson-Stojanovic 1992 Nr. 1174. 1175 Taf. 136 �2-3. Jh. n. Chr.�; Degeest 2000, 256 Nr. 91 N 110-21 Abb. 167 �2. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
Pfannen: Nr. 35-39
Die Bratpfannen mit gedrehtem Stielhenkel, dessen Innenseite ausgehöhlt ist, gehören auch zum typischen Kochgeschirr der römischen Kaiserzeit aus Patara. Diese Pfannenform ist seit hellenistischer Zeit bekannt 12. Mit dem Beginn der römischen Kaiserzeit weisen derartige Pfannen eine dicke Wandung und einen flachen Boden auf 13. Der Rand ist nach außen gezogen und die Henkel sind kürzer geworden �Nr. 35�. Bei den späteren Exemplaren, und zwar im 3. Jh. n. Chr. ist die Wand etwas dünner gestaltet. Diese dünnwandigen Pfannen zeigen eine gerundete Bodenfläche. Von besonderem Interesse ist die Bildung des Ausgusses einer Pfanne in Form einer keilförmigen Schnauze. Neben den Stielhenkeln sind in dieser Zeit Griffe mit Fingerabdrücken für Pfannen charakteristisch �Nr. 36�. Hinsichtlich der Gliederung und Betonung der Henkelformen lassen sich einige dünnwandige Pfannen in einer Variante eng zusammenschließen. Es handelt sich in diesem Fall um
die Pfannen in kugeliger Form, deren Henkel sehr einfach, und zwar ringförmig �Nr. 37� oder U-förmig gestaltet sind �Nr. 38�. Diese Exemplare werden anhand der Vergleichsbeispiele aus anderen Gebieten ins 3 bzw. 4. Jh. n. Chr. datiert. Ferner gibt es auch ganz flache Pfannen mit horizontalen Henkeln �Nr. 39�. Bei diesen Beispielen ist die Wandung sehr dick modelliert. Der Rand ist außerdem für die Flüssigkeit eingekehlt gestaltet. Ebenfalls werden für derartige Stücke aus der römischen Kaiserzeit unterschiedliche Datierungen zwischen den 1. und 3. Jh. n. Chr. vorgeschlagen.
35. PTR 1999 TN 9. H 3,4; ODm 12,8;UDm 5,5. Ton: 5 �R �� 5�6Ton: 5 �R �� 5�6 �yellowish red�.
12. Edwards 1975, 131 f. Nr. 700 Taf. 32.62.Edwards 1975, 131 f. Nr. 700 Taf. 32.62.13. Meriç 2002, 100 f. Hier wird außerdem hervorgehoben, daß diese Pfannenform von Phokaia
aus in den gesamten Mittelmeerraum exportiert wurden. Zu ähnlichen Behauptungen s. auch Forster 2001, p. 155.
34
35
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 213
Vgl.: Robinson 1959, 33 G 114. 115 Taf. 7 �Anfang 2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1971, 249 ff. Nr. 99. 102 Abb. 9 �2.102 Abb. 9 �2. Jh. n. Chr.�; Adamscheck 1979, 144 f. RC 99. 100 Taf. 38 �1. Jh. n. Chr.�; Riley 1979, 270 ff. Nr. 462-472 �1. Jh. n. Chr.�; Hayes 1983, 126 f. Nr. 99 Abb. 9 �Mitte 2. Jh. n. Chr.�; Pülz 1985, 91 Nr. 73. 74 Abb. 8; ÖzyiÏit 1991, 138 Zeichnung 9 �1-2 Jh. n. Chr.�; Sackett 1992 S1,10 Taf. 218. 220 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I T1-I T8 Taf. 1-2; Tekkök-Biçken 1996, 124 F 143 Abb. 90 �2. Jh. n. Chr.�; Hayes 2000, 317 Nr. 24. 25 Taf. 4.Jh. n. Chr.�; Hayes 2000, 317 Nr. 24. 25 Taf. 4.25 Taf. 4. 65 �2. Jh. n. Chr.�; Forster 2001, 155 ff. Abb. 4.10 d-h �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Meriç 2002, 100 f. K 654-659 Taf. 55 �1-2 Jh. n. Chr�; Gasperetti 2003, 153 Nr. 56 Taf. 9 �1. Jh. n. Chr.�.
36. PTR 1999 TN 9. H 5,5. Ton: 5 �R �� 5�8 �yellowishTon: 5 �R �� 5�8 �yellowish red�.Vgl.: Riley 1979 Nr. 473 Abb. 101 �Frühkaiserzeit�; Sackett 1992 Nr. 87. 88 Taf. 195; Meriç 2002, 101 Nr.88 Taf. 195; Meriç 2002, 101 Nr. 660-666 Taf. 56. 57 �2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.�.57 �2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.�.
37. PTR 1999 TN 3 Brandoffen, Schicht: +10�-42. H 2,3. Ton: 2,5 �R �� 5�8 �red�, Überzug: 10 �R �� 4�6 �red�.Vgl.: Riley 1979, 271 f. Nr. 528 Abb. 105 �Spätrömisch�; Williams 1989, 62 ff. Nr. 354 Abb. 32 �3. Jh. n. Chr.�;Jh. n. Chr.�; Crawford 1990, 106 Abb. 536 �3-4. Jh. n. Chr.�; Hayes 1991, 81 f. Taf. 36, 3 �3. Jh. n. Chr.�.
38. PTR 1999 TN 3 Brandoffen, Schicht: +10�-42. H 2,8; ODm 26. Ton: 2,5 �R �� 5�6 �red�, Überzug: 2,5 �R �� 6�6 �light red�.Vgl.: Riley 1979, 271 f. Nr. 528 Abb. 105 �Spätrömisch�; Crawford 1990, 106 Abb. 536 �3-4. Jh. n. Chr.�; HayesJh. n. Chr.�; Hayes 1991, 81 f. Taf. 36, 3 �3. Jh. n. Chr.�.
39. PTR 1999 TN 9. L 9,5; H 2,1. Ton: 10 �R �� 6�6Ton: 10 �R �� 6�6 �brownish yellow�.Vgl.: Riley 1979, 224 Nr. 428 Abb. 99 �1. Jh. n. Chr.�; Williams 1989, 61 ff. Nr. 353 Abb. 32 �2-3. Jh. n. Chr.�;Jh. n. Chr.�; Atik 1995, 43 f. Nr. 39 Taf. 9 �Frühkaiserzeit�.
36
37
38
39
214 T. KORKUT
Kohlenbecken: Nr. 40-42
Die Kohlenbecken gehören ebenfalls zur Gruppe der Küchenkeramik, da sie häufig neben den Heizen auch zum Kochen verwendet wurden. Bisher wurde in Patara leider kein vollständiges Stück ausgegraben. Nur einige Fragmente, wie z. B. mit Masken verzierte oder unverzierte seitliche Topfstützen �Nr. 40�, Randfragmente �Nr. 41� so wie Fußfragmenten �Nr. 42�, erlauben den Typus der kaiserzeitlichen Kohlenbecken aus Patara zu definieren. Jedoch scheint eine Datierung dieser Fragmente aus Patara in die römische Kaiserzeit nicht sicher zu sein. Denn derartige Kohlenbecken sind auch aus späthellenistischer Zeit bekannt 14.
40. PTR 1999 TN 9. H 8. Ton: 5 �R �� 4�6 �yellowish red�.Ton: 5 �R �� 4�6 �yellowish red�.Vgl.: Edwards 1975, 119 f. Nr. 646. 647 Taf. 61 �Späthellenistisch�; Riley 1979, 305 Nr. 691-693647 Taf. 61 �Späthellenistisch�; Riley 1979, 305 Nr. 691-693 Abb. 113 �1. Jh. n. Chr.�; Gassner 1997, 229 Nr. 956. 957 Taf. 70;957 Taf. 70; Şahin 2001, 107 f. Ha 57 Abb. 66 �Hellenistisch�.
41. PTR 1999 TN 9. H 4. Ton: 2,5 �R �� 5�8 �red�.Ton: 2,5 �R �� 5�8 �red�.Vgl.: Şahin 2001, 109 Ha 65 Abb. 74 �Hellenistisch�.
42. PTR 1999 TN 9. H 2,5; UDm 20. Ton: 2,5 �R �� 4�6 �red� Vgl.: s. oben Nr. 40.
14. Zur hellenistischen Form der Kohlenbecken s. Conze 1890, 118ff; Leonard 1977, 19 ff.; Şahin 2001, 91 ff.
40 41
42
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 215
Reibschale: Nr. 43-44
Die Reibschalen, also die Mortarien, haben in Patara eine lange Tradition. Die aus weißem Kalkstein hergestellten Mörserschalen mit Ausgussen wurden in Patara von der hellenistischen bis in die spätrömische Kaiserzeit verwendet 15. Eine Nutzung dieser Gefäße als Mörser ergibt sich nicht nur aus der Gefäßform sondern auch aus den zusätzlichen Funden der für Mörser charakteristischen Stößel. Diese Stößel kommen in zwei Varianten vor: Der weit verbreitete Typus ist der Reibefinger, der in Gestalt eines gekrümmten Fingers geformt ist. Den zweiten Typus bilden die Stößel, die in Stempelform modelliert sind. Diese Steinschalen dienten sowohl als Küchengeräte zum Reiben und Anrühren von Nahrungsmitteln als auch in der Kosmetik zur Herstellung von Salben und Tinkturen. Die Verwendung der hier behandelten Reibschalen aus Ton konzentrierte sich höchstwahrscheinlich ebenfalls auf die genannten Bereiche �Nr. 43�. Die leicht ansteigende konvexe Wandung, der flache Boden und der weit ausladende Rand gelten als charakteristische Besonderheiten. Von besonderem Interesse ist die Bildung des Ausgusses in Form einer keilförmigen Schnauze �Nr. 44�. Außerdem ist die Innenseite der Gefäßen konkav geformt.
43. PTR 1998 TN 3. H 11,2. Ton: 2,5 �R �� 8�4 �pale yellow�.Vgl.: Jones 1950, 239 Nr. 353 Abb. 143 �1. Jh. n. Chr.�; Robinson 1959, 19 F 90 Taf. 2Jh. n. Chr.�; Robinson 1959, 19 F 90 Taf. 2 �Frühkaiserzeit�; Riley 1979, 295 f. Nr. 662-671 Abb. 112 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Hayes 1991, 73Jh. n. Chr.�; Hayes 1991, 73 Taf. 26, 1-4 �1-2. Jh. n. Chr.�.
44. PTR 1952 Tepecik, Dönmez Açmas¬.Vgl.: s. oben Nr. 43.
15. Korkut 2002, 233 ff.
43
44
216 T. KORKUT
Deckel: Nr. 45-46
Daß die hier behandelten Deckel zu den Küchenwaren gehören, wird auch durch die Fundzusammenhänge von Patara bestätigt. Anhand ihrer Formen lassen sich diese Stücke in zwei Varianten unterteilen. Es handelt sich um die Deckel der ersten Variante, die dünnwandig modelliert sind �Nr. 45�. Die Außenseite des Körpers dieser Deckel ist fein gerippt und weist einen runden, im inneren vertieften Knaufring auf. Aufgrund der angegebenen Merkmale werden derartige Deckel fälschlich als Näpfe bezeichnet. Die Exemplare der zweiten Variante sind sehr flach hergestellt und zeigen eine dickere Wandstärke �Nr. 46�. Der Griff ist in diesem Fall ringförmig modelliert. Parallelen zur ersten Variante finden sich im ganzen Mittelmeerraum und werden ins 1. bzw. 2. Jh. n. Chr. datiert 16. Da die Exemplare der zweiten Variante meist sehr grob produziert sind, geben sie für ihre Datierung keine sicheren Anhaltspunkte.
45. PTR 2000 OG 47 Schicht: ��245. H 7,9; ODm 21,2; UDm 7,2. Ton: 7,5 �R �� 7�4 �pink�.Vgl.: Robinson 1959, 34 G 121 Taf. 7 �Spät 1. Jh. n. Chr.�; Pülz 1985, 91 f. Nr. 75. 76 Abb. 15; Pülz 1987, 37 Nr. 62 Abb. 20 �1. Jh. n. Chr.�; Eskici 1992 I Ka 1. I Ka 2 Taf. 21; Atik 1995, 104 f. Nr. 183. 185 Abb. 38 �2. Jh. n. Chr.�; Istenic �� Schneider 2000 Abb. 5, 1. 2; Meriç 2002 K2; Meriç 2002 K 676. K 687 Taf. 58 �Flavisch�.
46. PTR 1999 TN3 Schicht: -42�-30. Dm 14,2; H 4,5.Vgl.: Adamscheck 1979, 144 f. RC 102 b. Abb. 38 �Spät 1. Jh. n. Chr�; Degeest 2000, 256 3 JJh. n. Chr�; Degeest 2000, 256 3 J 110 Abb. 143. 144 �6-7 Jh. n. Chr.�; Korkut 2002, 243 Nr. 15 �Frühkaiserzeit�.144 �6-7 Jh. n. Chr.�; Korkut 2002, 243 Nr. 15 �Frühkaiserzeit�.
16. Eine Datierung dieser Deckel ins 1-2. Jh. n. Chr. wird in Patara durch andere zusammengefundene Gefäße unterstützt.
45 46
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 217
Vorratsamphoren : Nr. 47
Unter die Bezeichnung Vorratsamphora wird hier ein Gefäß gefaßt, das einen gerippten, bauchigen Körper und einen trichterförmig modellierten Rand aufweist �Nr. 47�. Für dieses Stück charakteristisch ist außerdem der flache Boden. Da der Typus dieser Amphora innerhalb der bisher bekannten Exemplare als Unikat gilt, kann ihre Form mit den bekannten Amphorentypen nicht verglichen werden. Daher kann man annehmen, daß derartige Exemplare in Patara als Vorrat- oder als Lagerungsgefäß in lokalen Formen hergestellt wurden.
47. PTR 1994 Hurmal¬k Thermen. H 23,4; ODm 10,2; UDm 8. Ton: 7,5 �R �� 5�4 �strongH 23,4; ODm 10,2; UDm 8. Ton: 7,5 �R �� 5�4 �strong brown�.Vgl.: Jones 1950 Nr. 829 Abb. 167 �Spätrömisch�; Fulford 1984, 155 ff. Nr. 37 Abb. 70 �5. Jh. n. Chr.�; Brogli 1996, 219 ff. Nr. 38 Abb. 765 �4. Jh. n. Chr.�.Jh. n. Chr.�.
47
218 T. KORKUT
Balsamaria : Nr. 48
Die Balsamarien oder Behälter für Essenzen kommen seit der hellenistischen Zeit in verschiedenen Formen vor. Von diesen unterschiedlichen Formen sind mehrere Beispiele aus Patara bekannt 17. Gemeinsam ist bei diesen Gefäßen, daß sie in der Regel bauchige Körper so wie schmale und lange Hälse aufweisen. Ein Typus dieser Gefäße, und zwar der sog. Stöpsel, ist von besonderer Beachtung, da derartige Stücke in der Literatür häufig irrtümlicher Weise als Abdichtungsgerät von Amphoren bezeichnet worden sind �Nr. 48�. Für diese Form charakteristisch sind ein beutelförmiger Bauch, ein langer Hals und ein Spitzfuß. Der Körper ist außerdem fein gerippt und weist eine ziemlich dicke Wandung auf. Von diesen Gefäßen sind in Patara mehrere Exemplare ans Tageslicht gekommen. Kein einziges Gefäß wurde aber im Zusammenhang mit einer Amphora gefunden. Es scheint, daß diese Gefäße
nicht unbedingt als Stöpsel verwendet werden sollten, denn diese Stücke sind sehr hoch geformt und haben eine ziemlich dicke Wand. Der Fuß ist außerdem nicht ordentlich modelliert, so daß eine Amphora abgedicht werden konnte.
48. PTR 1999 TN 1 Schicht: -53. H 11,9; UDm 2,3.Vgl.: Jones 1950, 269 Nr. 717 Abb. 158; Riley 1979, 359 Nr. 1003 Abb. 130 �2. Jh. n. Chr.�; Wintermeyer 1980, 142 Nr. 134 Taf. 59 �2-3. Jh. n. Chr.�; Diedrichs 1980, 39 Nr. 126-129 Taf. 11. 12; Hayes 1983, 97 ff. Nr. 170 Abb. 13 �Spät 2. Jh. n. Chr.�; Willams 1989, 100 f. Nr. 589 Abb. 63Jh. n. Chr.�; Willams 1989, 100 f. Nr. 589 Abb. 63 �2-3. Jh. n. Chr.�; Hayes 1991, 74 Taf. 23, 8-11 �2. Jh. n. Chr.�; Hayes 1997, 35 Abb. 12, 1 �1-2 Jh. n. Chr.�; Hübner 1997, 91 f. Abb. 1,3.
2. importgefässe
Die oben erörterten Exemplare können in der Regel sowohl als lokale Produkte angenommen werden, als auch anhand ihrer Formenschätze oder Landschaftsbeziehungen als Importware gelten. Darüber hinaus wurde in Patara während der Grabungen Keramik ans Tageslicht gebracht, deren Anzahl im Vergleich zu den anderen nicht gering ist. Darunter sind Handelsamphoren in unterschiedlichen Typen, verschiedene Gruppen von bemalter Keramik oder reliefierte Gefäße besonders zu erwähnen. Die Gefäßformen und andere Besonderheiten deuten darauf hin, daß diese Keramikgattungen höchstwahrscheinlich als Importware nach Patara gekommen sind. Von diesen Keramiken werden hier folgende Beispiele behandeln.
17. I‚in 2002, 85 ff.
48
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 219
Gaza-Amphoren : Nr. 49
Zwischen den 4. und 6. Jh. n. Chr. dienten die Gaza-Amphoren hauptsächlich dem Transport des berühmten weißen Weines -Vinum Gazentum- aus der Region Süd-Palestina in den gesamten Mittelmeerraum �Nr. 49�. Ferner ist es auch bewiesen, daß diese Amphoren zum Transport des Sesamöls verwendet wurden 18. Der zylindrische Gefäßkörper, der kugelige nicht feststehende Boden und die Ringhenkel zwischen Schulter und Unterkörper gelten als besondere Charakteristika dieser Amphoren. Außerdem ist der ganze Körper fein gerippt.
49. PTR 2001 Westseite von Hurmal¬k Thermen. H 15; ODm 16; Ton: 5 �R �� 6�6 �reddish yellow�, Überzug: 2,5 �R �� 5�6 �red�.Vgl.: Jones 1950 Nr. 835 Abb. 167 �Spätrömisch�; Anderson-Stojanovic 1992, 96 Nr. 703 Taf. 184 �5-6 Jh. n. Chr.�; Hayes 1992, 62 ff. Abb. 22, 5 �4-6 Jh. n. Chr.�; Majcherek 1995, 163 ff. Taf. 5. 6
Nabatäische Keramik : Nr. 50
Unter der bemalten Keramik fällt eine Gruppe auf, deren Vertreter einen bauchigen Körper und eine dicke Wandung aufweisen �Nr. 50�. Der ganze Körper ist mit einem hellbraunen Überzug versehen. Der Schulterbereich ist mit schwarzer Farbe horizontal geteilt. Zwischen den Streifen sind meist stilisierte Nadelmuster oder einfach Zierlinien mit verschiedenen Farben gemalt. Diese in der Literatur als „nabatäische
18. Şenol 2000, 245 f. mit Anm. 674.
49
220 T. KORKUT
Keramik“ bezeichneten Gefäße haben im östlichen Mittelmeerraum zwischen den 1. Jh. v. Chr. und den 2. Jh. n. Chr. eine große Verbreitung gefunden.
50. PTR 1999 TN 9.Vgl.: Schneider 1996, 168 ff.; Schmid 2000, 1 ff.
Reliefierte knidische Keramik : Nr. 51
Die reliefierten Gefäße aus der römischen Kaiserzeit sind in Patara, abgesehen von der Gruppe der Öllampen, nicht wenig vertreten. Bisher sind zahlreiche Exemplare von dieser Keramikgattung ans Tageslicht gekommen. Wie das Fragment eines Skpyhos oder einer Schüssel hier zeigt, sind die erhaltenen Gefäße in der Regel aus der Formschüssel gearbeitet �Nr. 51�. Diese Stücke weisen meist eine braune Tonfarbe auf, während ihre Überzugsfarbe dunkel- oder rötlichbraun ist. Diese Besonderheiten deuten auf knidischen Reliefkeramik hin, die in mehreren Formen seit der frühen Kaiserzeit in viele antike Städte exportiert wurde. Wie beim Beispiel aus Patara der Fall
ist, wurden diese Gefäße meist durch mythologische Darstellungen geschmückt. Häufig wurden dazu Themen aus dionysischem Kreis ausgewählt.
51. PTR 1991 Nek. K 2 Schicht: DoÏu ��40. H 6,4. Ton: 5 �R �� 6�8 �reddishH 6,4. Ton: 5 �R �� 6�8 �reddish yellow�, Überzug: 5 �R �� 5�6 �yellowish red�.Vgl.: Bailey 1972-73, 67 ff.; Bailey 1979, 257 ff.; Mandel 1988, 99 ff.; Mandel 2000, 57 ff.
50
51 (échelle 1/2)
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 221
Terra Sigillata : Nr. 52
Der Großteil der bemalten Keramik aus dem kaiserzeitlichen Patara besteht aus Terra Sigillata. Hier kommen in der Regel die östlichen Gruppen häufiger vor. Doch ist die westliche Terra Sigillata auch mit einigen Exemplaren vertreten. Hier wird von diesen Exemplaren ein Fragment gezeigt, das innerhalb der erhaltenen Stücke von besonderer Bedeutung ist �Nr. 52�. Es handelt sich um ein Relieffragment eines aretinischen Napfes bzw. steilwandigen Tellers aus der frühen Kaiserzeit, worauf eine Soldatenbüste mit Helm und Panzer innerhalb eines Girlandenkranzes wiedergegeben ist.
52. PTR 1991. Nek. D 1 B 8. H 3,6. Ton: 5 �R �� 7�4 �pink�.H 3,6. Ton: 5 �R �� 7�4 �pink�.Ton: 5 �R �� 7�4 �pink�.Vgl.: Johns 1971, 9 ff. Abb. 2 ; Hayes 1985 Taf. 59, 11. 12. 18. 20; 61, 17-20; 62, 1. 2; F¬rat 2003, 94 f. Taf. 68,2; Forster 2001, 141 f. Abb. 4.2 a-d.
abkürzungsverzeichnis
Abadie-Reynal, C., éd. �2003� : Les Céramiques en Anatolie aux époques Hellénistique et Romaine, Actes de la Table Ronde d’Istanbul, 23-24 Mai 1996, Varia Anatolica 15.
Adamscheck, B. �1979�: Kenchreai. Eastern Part of Corinth. The Pottery, Corinth IV, Leiden, 1979.Anderson-Stojanovic, V. R. �1992� : Stobi. The Hellenictic and Roman Pottery, Princeton.Atik, N. �1995� : Die Keramik aus den Südthermen von Perge, IstMitt, Beiheft 40, Tübingen.Bailey, D. M. �1972-73� : “Cnidian Relief Ware Vases and Fragments in the British Museum. Part I,
Lagynoi and Headcups”, RCRF Acta 14�15, Abingdon ,11-25.— �1979� : “Cnidian Relief Ware Vases and Fragments in the British Museum. Part II, Oinophoroi and
Jugs”, RCRF Acta 19�20, Abingdon, 257-272.— �1993� : “Excavations at Sparta. Hellenistic and Roman Pottery”, BSA 88, 221-249.Ba‚aran, S. �2003� : “Ainos’un Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi Seramik Buluntular¬”, in : Abadie-
Reynal, éd. 2003, 71-77.Bordos, A. �1997� : “Kleisto sunolo keramikhj apo to phgadi tou oikopedou kwnstantinou lhmuaiou
sthn Etanw Jkala Mutilhnhj”, in : D& EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN ELLHNIJIKH KEPAMIKH, März 1994, Mytilène, 233-240.
Brock, J. K. �1949� : “Excavations in Siphnos”, BSA 44, 2-79.Brogli, R. F. �1996� : “Keramik aus den spätrömischen Bauten”, in : Petra. Ez Zenturi. Ergebnisse der
schweizerisch-liechtensteinischen Ausgrabungen 1988-1992, Terra Archaeologica II.Catling H. W. �1981� : “Barbarian Pottery from the Mycanean Settlement at the Menelaion-Sparta”, BSA
76, 71-82.Chatzedakes, P. �1997� : “Ktirio notia tou Ierou ton Promacwnoj. Mia taberna vinaria sth Dhlo”,
in : D& EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN ELLHNIJIKH KEPAMIKH, März 1994, Mytilene, 291-307.
Coleman, J. E. �1986� : Excavations at Pylos in Elis, Hesperia Suppl. 21, Princeton.
52
222 T. KORKUT
Conze, A. �1890� : Griechische Kohlenbecken, JdI 5, 118-141.Crawford, J. S. �1990� : The Byzantine Shops at Sardis, Archaeological Exploration of Sardis, Monograph
9, Cambridge, Mass.Degeest, R. �2000� : The Commom Wares of Sagalassos. Typology and Chronology, SEMA III, Turnhout.Denizli, H. et V. Kaya �2003� : “Kaletepe Nekropolu”, in : Anadolu Medeniyetleri Müzesi2002Y¬ll¬Ï¬, 56-75.Diederichs, C. �1980� : Céramiques hellénistiques, romaines et byzantines, Salamine de Chypre IX, Paris.Edwards, G. R. �1975� : Corinthian Hellenistic Pottery, Corinth VII 3, Princeton.Eiring, L. J. �2001� : “The Hellenistic Period”, in : Knossos Pottery Handbook. Greek and Roman, BSA Studies
7, 91-136.Elaigne, S. �2000� : “Fine Ware from Late Hellenistic, Augustan and Tiberian Deposits in Alexandria”,
RCRF Acta 36, Abingdon, 19-30.Eskici, H. �1992� : Phokaia Keramik ÇöplüÏü Kaz¬s¬, A 2 Açmas¬, Unpubl. Diplomarbeit, Izmir.Felten, F. �1975� : “Die christliche Siedlung”, in : Die spätrömische Akropolismauer, Alt-Ägina I 2, 1975,
55-79.F¬rat, N. �2003� : “Perge Konut Alan¬ Kullan¬ SeramiÏi”, in : Abadie-Reynal, éd. 2003, 91-95., 91-95.Forster, G. �2001� : “The Roman Period”, in: Knossos Pottery Handbook. Greek and Roman, BSA Studies
7, 137-164.Fulford, M. G. �1984� : “The Coarse �Kitchen and Domestic� and Painted Wares”, in : Excavations at
Carthage: The British Mission I, 2, 155-231.Gasperetti, G. �2003� : “Osservazioni Preliminari Sulla Ceramica Romane Di Iassos Di Caria”, in :
Abadie-Reynal, éd. 2003, 141-163.Gassner, V. �1997� : Das Südtor der Tetragonos-Agora. Keramik und Kleinfunde, Forschungen in Ephesos XIII
1, 1, Vienne.Gawlikowski, M. �1995� : “Ceramiques Byzantines de Jerash”, in : Hellenistic and Roman Pottery in the
Eastern Mediterranean, 83-91.Goldman, H., éd. �1950� : Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I. The Hellenistic and Roman Periods.Gürler, B. �2000� : “A Tomb Group of Roman Ceramics from the Village Uzgur in Tire”, RCRF Acta 36,
113-118.Hamdorf, F.W. �1976� : “Schichtfunde der Grabung 1967�68, in: Kerameikos X, 196-223.Hausmann, U. �1996� : “Hellenistische Keramik. Eine Brunnefüllung nördlich von Bau C und
Reliefkeramik verschiedener Fund plätze in Olympia”, OF 27, Berlin�New �ork,1996.Hayes, J. W. �1971� : “Four Early Roman Groups from Knossos”, BSA 66, 249-275.— �1976� : Roman Pottery in the Royal Ontario Museum, Toronto.— �1983� : “The Villa Dionysos Excavations, Knossos: The Pottery”, BSA 78, 1983, 97-169.— �1985� : “Sigillate Orientali”, in : Pugliese Carratelli, dir. 1985, 1-96.— �1991�: Paphos: The Hellenistic and Roman Pottery, Paphos III, Nicosie.— �1992� : Excavations at Saraçhane in Istanbul, 2. The Pottery, Princeton.— �1997�: Handbook of Mediterranean Roman Pottery, Londres.— �1998� : “University of Chicaco Excavations at Isthmia”, Hesperia 67, 405-456.— �2000� : “Roman Pottery from the Sanctuary”, in : Shaw, éd. 2000, 312-320.Heimberg, U. �1982� : Die Keramik des Kabirions, Berlin.Hübner, G. �1997� : “Zur Küchen- und Grobkeramik aus Patras”, RCRF Acta 35, 89-95.Istenic, J. et G. Schneider �2000� : “Aegean Cooking Ware in the eastern Adriatic”, RCRF Acta 36,
Abingdon, 341-348.I‚¬k, F. �2001� : “Patara 1999”, KST, 22.I‚¬n, G. �2002� : “Ointment � Medicine Vessels from Patara”, AA, 2, 85-96.I‚¬n, G et Ç. Uygun �2001� : “TN 1-3 Açmalar¬”, in : I‚¬k 2001, 79-80.|‚kan, H. et N. Çevik �1995� : “Die Grüfte von Patara”, Lykia 2, 187-216.Japp, S. �1999� : “Frührömische dünnwandige Hartware aus Pergamon”, IstMitt, 49, 301-331.Johns, C. �1971� : Arretina and Samian Pottery, Londres.Jones, F. F. �1950� : “The Pottery”, in : Goldman, éd. 1950, 149-296.
DIE KAISERZEITLICHEN GEBRAUCHSKERAMIK AUS PATARA 223
Kahil, L. �1969� : “Petits Objets”, in : Schmidt, éd. 1969, 235-245.Karadema, Ch. �1997�: “Tafka sunola ellhnistikhj keramikhj apo th Jamoqrakh”, in : D&
EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN ELLHNIJIKH KEPAMIKH, März 1994, Mytilene, 381-384.
Kombou, M. �1997� : “Aggeia Kaqhmerinhj Crhshj apo to phgadi thj odou Nikomhdeiaj sthn Epanw Skala Mutilhnhj”, in : D& EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN ELLHNIJIKH KEPAMIKH, März 1994, Mytilene, 241-246.
Korkut, T. �2002� : “Steinerne Mörserschalen aus Patara”, AA, 233-245.Lausanne, P., éd. �1993� : Le Quartier de la Maison aux Mosaïques, Eretria. Fouilles et recherches VIII.Leonard, M. L. �1973� : “Braziers in the Bodrum Museum”, AJA 77, 19 ff.“Braziers in the Bodrum Museum”, AJA 77, 19 ff.Braziers in the Bodrum Museum”, AJA 77, 19 ff.”, AJA 77, 19 ff., AJA 77, 19 ff.Love, I. C. �1974� : “Excavations at Knidos 1972”, TürkAD 21, 2, 85-129.Majcherek, G. �1995� : “Gazan Amphore”, in : Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean,
163-178.Mandel, U. �1988� : Kleinasiatische Reliefkeramik der mittleren Kaiserzeit. Die Oinophorengruppe und Verwandten,
PF 5, Berlin � New �ork.— �2000�: “Die frühe Produktion der sog. Oinophorenware. Werkstätten von Knidos”, RCRF Acta 36,
Abingdon, 57-68.McFadden, G. H. �1946� : “A Tomb of the Necropolis of Ayios Ermogenis at Kourios”, AA 1946, 476-
492.Meriç, R. �2000� : “Ein ephesischer Schachtbrunnen: Chronologie und ausgewählte Funde der
späthellenistisch-römischen Zeit”, RCRF Acta 36, Abingdon, 91-96.— �2002� : Späthellenistisch-römische Keramik und Kleinfunde aus einem Schachtbrunnen am Staatsmarkt in
Ephesos, Forschungen in EphesosForschungen in Ephesos IX, 3, Vienne.Metzger, H. �1993� : “Keramik und Kleinfunde”, in : Lausanne, éd. 1993, 97-143.“Keramik und Kleinfunde”, in : Lausanne, éd. 1993, 97-143.Keramik und Kleinfunde”, in : Lausanne, éd. 1993, 97-143.”, in : Lausanne, éd. 1993, 97-143., in : Lausanne, éd. 1993, 97-143.Meyer-Schlichtmann, C. �1999� : “Keramik aus datierenden Befunden im Stadtviertel zwischen
Hauptstraße, Mittelgasse und Ostgasse”, AvP XV 3, 215-229.Mitsopoulos-Leon, V. �1978-80� : “Dreizehnter vorläufiger Bericht über die Grabungen Eilis”, ÖJH 52,
Beiblatt, 101-132.— �1991� : Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. Keramik hellenistischer und römischer Zeit, Forschungen in
Ephesos IX 2, 2.Marabini Moevs, M. T. �1973� : The Roman Thin Walled Pottery from Cosa (1948-1959), MemAmAc 32, New
�ork.ÖzyiÏit, Ö. �1991� : “1989 y¬l¬ Phokaia kaz¬ çal¬‚malar¬”, KST XII 1, 127-153.— �1992� : “1990 y¬l¬ Phokaia kaz¬ çal¬‚malar¬”, KST XIII 2, 99-122.Peignard, A. �1997� : “La vaisselle de la Maison des Sceaux, Délos”, in : D& EPISTHMONIKH
SUNANTHSH GIA THN ELLHNIJIKH KEPAMIKH, März 1994, Mytilene, 308-316.Petriaggi, R. �1997� : “Scavi a Ponte Galeria”, in: D& EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN
ELLHNIJIKH KEPAMIKH, März 1994, Mytilene, 202-210.Poblome, J. �1999� :: Sagalassos Red Slip Ware. Typology and Chronology, SEMA II Turnhout.SEMA II Turnhout.Pugliese Carratelli, G., dir. �1985� : Atlante delle Forme ceramiche II, Ceramica fine romana nel bacino
mediterraneo (tardo ellenismo e primo empero), Rome.Pülz, S. �1985� : “Milet 1983-1984”, IstMitt 35, 77-115.— �1986� : “Milet 1985”, IstMitt 36, 13-33.— �1987� : “Milet 1986”, IstMitt 37, 34-69.Raeck, W. �2000� : “Vorgängerbebauung des Trajaneum”, IstMitt, 50, 307-364.Riley, J. A. �1979� : “Coarse Pottery”, in : Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), Suppl. To Libya
Antiqua V, 2, 91-467.Robinson, H. S. �1959� : Pottery of the Roman Period, The Athenian Agora V, Princeton, 1959.Rotroff, S.I. �1997� : Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material,
The Athenian Agora XXIX, Princeton.
224 T. KORKUT
Sackett, L. H., éd. �1992� : Knossos from Greek City to Roman Colony. Excavations at the Unexplored Mansion II, BSA Suppl. 21, Londres.
Sackett, L. H. �1992� : The Roman Pottery, in : Sackett, éd. 1992, 147-256.Schmaltz, B. �1994� : “Kaunos 1988-1991”, AA, 185-237.— �1997� : “Der Rundbau am Theater in Kaunos”, AA, 1-44.Schmid, S. G. �2000� : “Die Feinkeramik der Nabatäer. Typologie, Chronologie und kulturhistorische
Hintergründe”, in : Petra, Ez Zentur II, Terra Archaeologia Bd. IV.Schmid, S. G. �1996� : “Nabatäische Keramik aus Oboela”, in : Petra, Ez Zentur I, 168-171.Schmidt, H., éd. �1969� : Laodicée du Lycos. Le nymphée. Campagnes 1961-63.Shaw, J. W., éd. �2000� : Kommos IV: The Greek Sanctuary 1.Slane, K. W. �1986� : “Two Deposits from the Early Roman Cellar Building Corinth”, Hesperia, 55, 271-
318.Strobel, K. et Ch. Gerber �2000� : “Tavium. Bericht über den Stand der Forschungen nach den ersten drei
Kampagnen 1997-1999”, IstMitt, 50, 215-265.¥ahin, M. �2001� : “Hellenistic Braziers in the British Museum: Trade Contacts Between Ancient
Mediterranean Cities”, AnatSt, 51, 91-132.¥enol, A. K. �2000� : |skenderiye kaz¬lar¬nda ele geçen amphoralar ¬‚¬Ï¬nda kentin Roma Dönemi ‚arap, zeytinyaϬ,
salamura bal¬k ve sos ticareti, Unpubl. Doktorarbeit,Doktorarbeit, |zmir.Tekkök-Biçken, B. �1996� : The Hellenistic and Roman Pottery from Troia: The Second Century B. C. to the Sixth
Century A. D., Missouri-Columbia.Tsimpidou-Auloniti, M. �1994� : “Sunola keramikhj apo to ellhnistiko nekrotafeio thj Qessalonikhj”,
in : Gë EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN ELLHNISTIKH KERAMEIKH, 24-27 September 1991, Thessalonique, 80-89.
Vessberg, O. et A. Westholm �1956� : The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus, SCE IV.Walter, H. �1958� : “Bericht über die Ausgrabungen in Olympia”, Olympia Bericht V 1.Welles, J. �1968� : “The Excavations at Dura-Europos”, Final Report IV 1.Williams, C. �1989� : Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery, Subsidia Mediaevalia 16,
Toronto.Wintermeyer, U. �1980� : “Didyma. Bericht über die Arbeiten der Jahre 1975-1979”, IstMitt, 30, 122-
159.Zafeiroupolou, F. �1994� : “Dhloj �� Keramikh apo ton dromo boreia tou Andhrou twn Leontwn”,
in : Gë EPISTHMONIKH SUNANTHSH GIA THN ELLHNISTIKH KERAMEIKH, 24-27 September 1991, Thessalonique, 235-248.