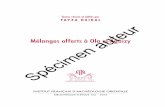H. İşkan, "Ein Siegersarkophag aus Patara", Asia Minor Studien 44, 2002, 145-164.
Transcript of H. İşkan, "Ein Siegersarkophag aus Patara", Asia Minor Studien 44, 2002, 145-164.
ASIA MINOR STUDIEN
herausgegeben von der
Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Band 44
Studien zum antiken Kleinasien V
2002
DR. RUDOLF HABELT GMBH • BONN
E I N SIEGERSARKOPHAG AUS PATARA*
(Taf. 37-44)
Zwischen dem Theater und dem großen Rathaus des Lykischen Koinon in Patara sammelte sich im Laufe der Jahrhunderte Sand, der vor dem Beginn der Ausgrabungen fast das Aussehen eines kleinen Berges hatte (Taf. 37, l).1 Um das Theater, vor allem aber das Bouleuterion, in dem für die Geschichte Lykiens wichtige Inschriften vermutet werden, von den bedrückenden Sandmassen zu befreien, beschloß die Grabungsleitung, dieses Areal freizulegen.2 Während der Kampagne im Jahre 2000 kam 5 m südlich der justinianischen Stützmauer des Bouleuterions unerwartet ein Sarkophag zu Tage (Taf. 37, 2)3, der durch seine einmalige Verzierung nicht nur für die kleinasiatische Sarkophagforschung, sondern auch für die Agonistik der römischen Epo-che von besonderer Bedeutung ist.
Er stand auf einer geebneten Erhöhung am leichten Hang. Die Fundsituation gibt sicherlich nicht die ursprüngliche Aufstellung wieder, da ansonsten die verzierte Vorderseite des Sarko-phags zum Hang hin gerichtet gewesen wäre (Taf. 37, 3). Anhand der in der justinianischen Mauer verbauten agonistischen Inschriften läßt sich vermuten4, daß sich zwischen dem Theater und dem Bouleuterion eine Art Wettkampfstätte oder vielleicht eine 'Siegesallee' befunden hat.5
Dort könnte also auch dieser Sarkophag aufgestellt gewesen sein.6
Die Grabung in diesem Areal leitete Süleyman Bulut. Die Aufnahmen im Gelände sowie des Sarkophages stam-men von Şevket Aktaş. Beiden sei hier herzlich gedankt.
Außer den Abkürzungen gemäß AA 1997, 611-628 sowie der Archäologischen Bibliographie 1993 werden hier noch folgende benutzt:
Franke P, R. Franke, Kleinasien zur Römerzeit. Griechisches Leben im Spiegel der Münzen (1968).
KST Kazı Sonuçları Toplantısı
Rumscheid J. Rumscheid, Kranz und Krone. Zu Insignien, Siegespreisen und Ehrenzeichen der römi-schen Kaiserzeit, IstForsch 34 (2000).
Salzmann D. Salzmann, Kaiserzeitliche Denkmäler mit Preiskronen. Agonistische Siegespreise als Zei-chen privater und öffentlicher Darstellung, Stadion 24, 1, 1998, 89-99.
Wiotte C. Wiotte, Zur Typologie kaiserzeitlicher Agonistikdarstellungen, Stadion 24, 1, 1998, 71-88.
Ziegler R. Ziegler, Städtisches Prestige und kaiserliche Politik. Studien zum Festwesen in Ostkilikien im 2. und 3. Jh. n. Chr. (1985).
1 Zu Patara allgemein s. F. Işık, AW 30, 5, 1999,477 ff.; ders., Patara. The History and Ruins of the Capital City of Lycian League (2000). 2 Die Grabungsberichte erscheinen jährlich in Kazı Sonuçlan Toplantısı: M. Karaosmanoğlu - N. Çevik, KST 19, 2, 1997, 56 f.; M. Kunze - G. Grosche - N. Çevik, KST 21, 2, 1999, 93 f.; Ş. Aktaş - T. Kimyonok, KST 22, 2, 2000, 86. 3 S. Bulut, KST 23, 2, 2001 (im Druck). 4 Diese Inschriften, die demnächst von H. Engelmann publiziert werden, berichten von gymnischen und musischen Agonen in Patara, die für diese Stadt bislang nicht belegt waren. 5 Mündliche Mitteilung von H. Engelmann. 6 Das ursprüngliche Gehniveau dieses Areals ist z. Z. noch nicht erreicht. Daß ein Grab sozusagen mitten in der Stadt zugleich als Erinnerungsmonument gedient hat, ist bekanntlich in Lykien kein Sonderfall. Es handelt sich dabei um eine einheimische Sitte, deren bekanntes Beispiel wohl der sog. Inschriftenpfeiler von der Agora in
146 H. İşkan
Der Sarkophagkasten beinhaltete eine wohl sekundäre Bestattung mit einem einzigen Individu-um (Taf. 37, 4).7 Wegen der starken Korosion war es nicht möglich, die zusammen mit dem Skelett erhaltene Münze, den Charonsgroschen, zu datieren.8 Der Sarkophag wird heute im Museum von Antalya aufbewahrt.9
Bei dem Neufund handelt es sich um einen Sarkophag aus Marmor, der 1,98 m breit, 0,90 m hoch und 0,80 m tief ist (Taf. 38, 1). Ein einfaches Profil vermittelt zwischen einer breiten Standleiste und dem eigentlichen Kasten. Am oberen Rand hat man sich um eine reichere Pro-filierung bemüht, eine Verschlußleiste zur Aufnahme des Deckels schließt oben ab. Es besteht die Möglichkeit, daß ein in zwei Teilen erhaltener Deckel, den wir vor zwei Jahren in demsel-ben Areal, aber auf einem höheren Bodenniveau gefunden haben, zu diesem Sarkophag gehört. Nicht nur die vorgenommene Anpassung scheint dafür zu sprechen (Taf. 38, 2), sondern auch der Inhalt der auf dem Deckel angebrachten Inschriften (Taf. 38, 3 -4) , die allesamt von ver-schiedenen Agonen zeugen. Hierbei gibt es jedoch zweierlei Probleme: Die Inschriften des Deckels sind flüchtiger angebracht als die auf dem Kasten, so daß ihre spätere Entstehung nicht mit Sicherheit auszuschließen ist - zumal auch der Besitzer des Sarkophages seinen Kindern erlaubt hat, in diesem Grab bestattet zu werden. Der Sarkophag könnte also lange benutzt wor-den sein. Dieser Umstand und die besondere Aufstellung/Plazierung des Sarkophages führen aber zwangsläufig zu der Annahme, daß das Kind/die Kinder des Verstorbenen ebenfalls Sport-ler gewesen sein müssen. In diesem Fall würde man jedoch erwarten, daß auch sie mit Namen erwähnt werden, was hier nicht der Fall ist. Die Zugehörigkeit des Deckels zum Sarkophag bzw. die Gleichzeitigkeit der Inschriften muß daher zunächst hypothetisch bleiben.
Nach inschriftlichem Zeugnis »gehört der Sarkophag dem Lucius Septimius Theronides, dem Außergewöhnlichen. Er hat in seinem Testament bestimmt, daß niemand zu ihm gelegt wird, es sei denn die Zeit seiner Kinder (sei gekommen). (Wer dagegen verstößt), soll der Gerusie (von Patara) 1000 Denare schulden«10. Theronides, der auch das römische Bürgerrecht besaß, be-nutzt auf seinem Grab für sich selbst den Titel 'paradoxos'. Somit gibt er uns die Möglichkeit, ihn als einen Sportler zu bezeichnen."
Xanthos ist, C. Deltour-Levie, Les Piliers funéraires de Lycie (1982) 163 ff. mit weiterer Literatur. Zur Lage der Nekropolen bzw. Gräber in einer lykischen Siedlung s. Verf., IstMitt 51, 2001, 2 Anm. 4 (im Druck). 7 Auf dem Hang nordwestlich vom Theater, also ganz in der Nähe der Fundstelle des Sarkophages wurde auf der Oberfläche eine Urnenbestattung aus der spätrömischen Zeit aufgelesen. Das bedeutet, daß dieser Teil der Stadt auch sonst Bestattungen aufgenommen hat, deren Umfang jedoch ohne Grabung nicht festgestellt werden kann. 8 Zum Charonsgroschen bei den Bestattungen in Patara s. H. Yılmaz, KST 15, 2, 1993, 284; H. İşkan-Yılmaz -N. Çevik, Lykia II, 1995, 198 f. 9 Museum Antalya, Inv. Nr. 51. 31. 2000. 10 Übersetzung von H. Engelmann, dem ich an dieser Stelle für seine immer wieder bewährte Kollegialität in Fragen zu den Inschriften von Patara danken möchte.
" L. Moretti, Iscrizioni agonistichi greche (1953) 189 äußert sich nämlich zu dieser Bezeichnung folgendermaßen: »Paradoxonikes é infatti appellativo anche di pugilatori, di pancraziasti, di corridori e perfino di vincitori in gare ippiche. Col termine parodoxonikes si allude vagamente al carattere straordinario ed eccezionale dei successi dell'athleta che si fregia di quel titolo. C'e appena bisogno di dire che paradoxonikes é equale a paradoxos che é l'aggettivo corrispondente«. Das Adjektiv 'paradoxos' kommt noch in einigen agonistischen Inschriften vor, wie z. B. in einer aus Ephesos; H. Engelmann - D. Knibbe - R. Merkelbach, Die Inschriften von Ephesos II, Inschrif-ten griechischer Städte aus Kleinasien 14, 4 (1980) Nr. 1085.
Ein Siegersarkophag aus Patara 147
Als Verzierung weist der Kasten insgesamt sieben sog. Preiskronen auf12; fünf auf der Vorder-seite und je eine auf den Nebenseiten. Die Rückseite des Sarkophags wurde glatt belassen. Auf den in der Mitte der Preiskronen befindlichen Inschriftbändern sind Namen bekannter Agone angebracht. Diese sind Olympia, Pythia, Kapitolia, Aktia und KoinaAsias auf der Vorderseite; Hadrianeia auf der linken, der in Kaisareia in Kappadokien auf der rechten Nebenseite. Die sich nach außen wölbenden, bauchigen Gegenstände können - von links nach rechts - folgen-dermaßen beschrieben werden:
Olympia (Taf. 39, 1): Die Öffnung ist rund und verläuft ohne Unterbrechung. Durch eine zweite Bohrlinie wird der Rand betont, daran schließt ein schmales Band mit schrägen Einkerbungen an. Dieses wiederholt sich als Rahmen der Inschrift und als fester Untersatz (?). Die zwei Haupt-paneele, die durch die zentrale Inschrift gegliedert werden, weisen jeweils drei gegenständige und in der Größe unterschiedliche wellenförmige Verzierungen auf, deren Funktion unklar ist. Diese Wellen berühren die Inschriftzone nicht. In den freien Zwischenräumen zwischen diesen gerundeten, unten offenen Dreiecken sind jeweils vier Kreise angebracht. Die Konturlinie der Preiskrone wird nirgendwo von inneren Motiven berührt.
Pythia (Taf. 39, 2): Die Öffnung ist perspektivisch wiedergegeben und schließt hinten nicht ab. Der unverzierte Rand wird auch hier durch eine zweite Linie eingefaßt. Je ein Flechtband mit schrägen Einkerbungen rahmt die Inschrift. Über und unter der zentralen Inschriftzone sind jeweils vier Kreise eingraviert, deren Mitte mit einem Kreuz ausgefüllt ist. Der Untersatz ist ebenso wie der obere Rand durch eine innere Linie betont.
Kapitolia (Taf. 39, 3): Die Öffnung ist rund und verläuft ohne perspektivische Wiedergabe. Die Inschrift wird oben durch ein glattes Band, unten von einer breiten, im Schnitt V-förmigen Einkerbung eingefaßt. Der Untersatz weist zwei horizontale Linien auf, der Körper der Preis-krone ist hier ohne weitere Verzierung.
Aktia (Taf. 39,4): Die Öffnung ist perspektivisch durch einen einfachen, hinten nicht abschließen-den Rand gestaltet. Über der zentralen Inschrift befindet sich ein Flechtband mit Einkerbungen, darunter schließen zwar die schrägen Einkerbungen, jedoch nicht die einfassende Linie des Bandes an. Der Untersatz ist unverziert. Die zwei Paneele des Körpers weisen jeweils vier
12 Zu der Beschaffenheit und antiken Überlieferung der Preiskronen s. Salzmann 89 f. und Rumscheid 79 f. Auf dem Sarkophag aus Patara weisen die schmalen Bänder unter- und oberhalb der Agon-Inschriften sowie bei man-chen an der Mündung und am Fuß kurze, schräge Einkerbungen auf, die Flechtwerk meinen könnten. In dieser Bildtradition steht auch die Mehrzahl der agonistischen Münzen, wie z. B. eine Prägung aus Nysa: gute Abbildung bei K. Regling in: W. von Diest, Nysa ad Maeandrum, 10. Ergh. Jdl (1913) Nr. 195. Die Vergänglichkeit dieses Materials war in der Antike kein Hindernis für seine breite Nutzung, so daß solche Produkte z. B. auch den Toten als Beigaben mitgegeben wurden, s. W. Gaitz, Antike Korb- und Seilerwaren (1986) passim. H. Dressel, ZfNum 24, 1904, 36 denkt sich dagegen »diese Preiskronen aus dünnem Metallblech hergestellt, das, nach der oft sehr detail-lierten Wiedergabe zu urteilen, mit reicher Ornamentierung in getriebener und wohl auch in durchbrochener Arbeit versehen war; je nach der Bedeutung der Agone und der Stadt, in welcher die Spiele gefeiert wurden, mochte Gold oder Silber oder nur vergoldete Bronze dafür verwendet werden«. Ebenfalls für wertvolles Material plädieren z. B. J. Meischner, Jdl 89, 1974, 336: »Die Kronen erweisen sich als ca. 25 cm hohe, breit ausladende Zylinder aus mehreren horizontal übereinandergesetzten Streifen von Goldblech; Zickzackmusterung des Goldzylinders und großformatiger Edelsteinbesatz bereichern den materiellen Wert und das prächtige Aussehen solcher Preiskronen«. Wiotte 74: »Vermutlich bestand die Preiskrone aus mehreren horizontal übereinandergesetzten Streifen von Gold-blech mit einem Edelsteinbesatz«. M. Karola - J. Nolle, Götter, Städte, Feste. Kleinasiatische Münzen der römi-schen Kaiserzeit (1994) 112: »Preiskronen bestanden anscheinend aus kostbaren Metallen und waren mit Juvelen besetzt«. Daß man jedoch bisher bei den Grabungen kein einziges Exemplar aus Metall etwa in Form einer Beiga-be ausfindig gemacht hat, was in dem Grab eines bekannten Sportlers/Siegers zu erwarten wäre, unterstützt jedoch eher die These von vergänglichem Material.
148 H. İşkan
ungleichmäßig gestaltete Wellenmotive auf, die mit Ausnahme der äußeren Bögen aus zwei Linien bestehen. Das obere Wellenmotiv berührt das Flechtband, das untere dagegen nicht.
KoinaAsias (Taf. 39,5): Der runde Gefäßrand biegt sich nur an der rechten Seite perspektivisch nach hinten. Rand und Untersatz sind glatt belassen. Von den beiden die Inschrift rahmenden Bändern ist das obere glatt und breiter gehalten, während das untere schräg eingekerbt ist. Je vier Kreise fassen die Inschriftzone oben und unten ein. Sie sind mit einer kurzen Linie - wie mit einem Radius - gefüllt, deren Richtung variiert.
Hadrianeia (Taf. 39, 6): Bei der perspektivischen Wiedergabe der runden Öffnung mit schma-lem Rand biegen die Konturlinien nach unten ab. Der Untersatz ist schmal gehalten. Zwei mit schrägen Kerben gefüllte Bänder rahmen die Inschrift. Die Wellenverzierung in der oberen und unteren Hälfte der Preiskrone besteht aus Doppellinien. Oben sind die einzelnen Wellenbögen so breit, daß an den Seiten nur halbierte Wellen Platz haben. Das obere Flechtband berührt den Wellenbogen, das untere schneidet ihn sogar.
Agon in Kaisareia in Kappadokien (Taf. 39, 7): Zusätzlich zu der runden Öffnung mit dem perspektivisch nach hinten gebogenen, breiten Rand hat man hier in die Öffnung ein Dreieck eingraviert, das zu einem Palmzweig ergänzt werden kann. Die die Inschrift rahmenden Bänder sind ohne Verzierung. Der Untersatz hat keine Binnenlinie.
Bei genauerer Betrachtung der beschriebenen Gegenstände ergibt sich ein entscheidender Hin-weis auf ihre Funktion. Sie sind nämlich entgegen der verbreiteten Meinung, es handle »sich um oben und unten offene, breit ausladende Zylinder«13, unten geschlossen. An sich ist es ver-wunderlich, warum diese Eigenschaft, die durch zahlreiche andere Darstellungen doch so ein-deutig ist, bisher nicht wahrgenommen wurde, zumal schon F. Matz sie als 'Korb' bezeichnete.14
Zur Beweisführung sollen hier zunächst einige Beobachtungen dargelegt werden, ohne jedoch die unterschiedliche Größe und den Typus der dargestellten Objekte als Hauptkriterium zu Grunde zu legen.15
Vor allem auf Münzen befinden sich unzählige Darstellungen von sog. Preiskronen, in die meist weitere Siegerzeichen, nämlich Palmenzweige, gesteckt sind; ein Zustand, der die Geschlos-senheit des unteren Gefäßteiles zwangsläufig voraussetzt (Taf. 40, l).16 Bei denjenigen Exem-
13 Salzmann 89. Diese Meinung ist auch von vielen anderen Forschern vertreten: Dressel a. O. 35: »... weil er unten stets offen gebildet ist, also keinen Boden hat«; C. Bosch, Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 1, 1950/51, 86: »Preiskronen sind oben offene, runde Gefäße, wahrscheinlich aus einem leichten Korbgeflecht bestehend, die bei den Festspielen Siegern als Preise verliehen wurden«; P. Wolters, Zu griechischen Agonen, 30. Programm des Kunstgeschichtlichen Museums der Universität WUrzburg (1901) 14: »., , , daß dieser Gegenstand oben ebenso gebildet ist, wie unten, daß er auch unten offen ist, also die Form eines Ringes hat«. Bei Wiotte 74 kommen die Gegensätzlichkeiten in der Beschreibung und Bestimmung besonders gut zur Geltung, nämlich, daß »die Preis-krone in der Mitte eine durchgehende Öffnung besitzt, in der häufig Palmzweige stecken und in einigen Fällen liegen Äpfel in der Öffnung«, 14 M a t z - D u h n II 27 Nr. 2251. 15 Salzmann 97 f. Rumscheid 80 unterscheidet zwei Gruppen: »Es gibt 1. den bauchigen, an den Seiten sich wöl-benden Zylinder und 2. einen niedrigeren Reif, der seitlich wenig oder gar nicht konvex ist. Beide Formen kom-men bei der großen und kleinen Preiskrone vor.« 16 Meischner a. O. 336: »Die Palmwedel werden gerne in die Mitte der Kronen gesteckt wie in Blumenvasen.« Diese Darstellungen sind sehr gut mit zwei weiteren Gefäßtypen, modii und Preiszylinder, zu vergleichen; J. Meischner, Jdl 110, 1995, 448 ff. Die Verwandschaft zwischen Preiskronen und -Zylindern in bezug auf ihre Gestaltung und Verwendung wird von J. Meischner, Jdl 89, 1974, 342 und 345 f. ausführlich beschrieben.
Ein Siegersarkophag aus Patara 149
plaren, die mit geradem Unterteil fest auf einem Tisch/Altar stehen (Taf. 40,2)17 , mag dies zwar nicht von Belang sein, aber auch sonst ragen die Palmzweige niemals unten heraus.18 Einige Münzen weisen in den Preiskronen liegend kugelartige Objekte auf, die oft als Äpfel gedeutet wurden (Taf. 40, 3).19 Dies wiederum zeugt von der Geschlossenheit des unteren Teiles. Man-che Preiskronen weisen sogar einen Ringfuß (Taf. 40, 4)20 bzw. einen Untersatz (Taf. 40, 5)21
auf, wobei man hervorheben muß, daß von einer ähnlichen Wiedergabe des oberen und unteren Teiles eher selten gesprochen werden kann.22
Auf einigen Münzen trifft man Darstellungen von Preiskronen, die unten und oben eine ähnli-che Rundung aufweisen (Taf. 40, 6)23; eine Darstellungsart, die auch von P. Wolters im Hinblick auf die Grabstele des Aneiketos in Mytilene festgestellt wurde und ihn dann zu der Annahme führte, daß sie unten offen sind (Taf. 40, 7).24 Diese Art der Wiedergabe erklärt sich aber m. E. aus der Bemühung des jeweiligen Künstlers, das 'geschlossene Rund' im Bild wiederzugeben. Die oben offene Rundung konnte man ja oft durch die Palmzweige deutlich machen. Man be-mühte sich auch, dies perspektivisch zu betonen, indem man die Kontur der Preiskrone kreis-förmig darstellte und den Körper perspektivisch mit einer nach innen gebogenen Linie beginnen läßt (Taf. 41, 4).25 Einige Münzbilder zeigen aber unter den Preiskronen eine Linie, die diese Gegenstände unten abschließt.26 Auf der Grabstele übernimmt die Standleiste diese Aufgabe. Einen weiteren Beweis dafür liefert ein Mosaik aus dem südlichen cubiculum der Piazza Armerina.27 Die unteren Teile der Blütenkörbe zweier Kreuzbinderinnen (Taf. 40, 8) und der Preiskronen auf dem Tisch werden in derselben Art und Weise wiedergegeben, nämlich nach innen bzw. oben gebogen (Taf. 40, 9). In den Preiskronen befinden sich noch Blütenkronen, die auch hier nicht unten aus den Preiskronen herausragen; dagegen schließen die Preiskronen un-ten mit einer schattenartig wiedergegebenen Verbindungslinie ab, ähnlich wie auch auf den
17 SNG v. Aulock 2739.6761.7031.6077.8422 (= Franke 240. 247. 248.251.252). Auf der Münze Ziegler Taf. 2,17 steht die Preiskrone auf einem Tisch, der in perspektivischer Verkürzung von unten gesehen wird; sie ist unten geschlossen. 18 SNG v. Aulock (= Franke 242); s. dagegen Dressel a. O. 35 Anm. 2: »Am deutlichsten erkennt man das Fehlen des Bodens daran, daß die in diese Preiskronen gesteckten Palmzweige nicht selten unten herausragen.« Mir ist bisher eine solche Darstellung nur aus einer Zeichnung von zwei Preiskronen bekannt geworden, die sich auf einem Sarkophag befunden haben, J. Keil - A. von Premerstein, Bericht über eine dritte Reise in Lydien (1914) 94 Nr. 131 Abb. 55. Doch dieser Sarkophag wurde nach den dortigen Angaben lange Zeit als Wasserbassin verwendet, weswegen man auf seiner Oberfläche mit Änderungen rechnen muß (keine Autopsie). 19 Bosch a. O. 86 C5 Taf. 13,6. 20 Münze aus Nikaia: SNG v. Aulock 7030 (= Franke 243); W. Weiser, Katalog der bithynischen Münzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln I: Nikaia. Papyrologica Coloniensia XI (1983) 351 Taf. 29, 5. 21 SNG v. Aulock 5508. 8414 (= Franke 248. 254). 22 Karola - Nolle a. O. 113 Nr. 128; P.Weiß, Chiron 11, 1981,345 Nr. 11 Taf. 27,5. 23 SNG v. Aulock 5122 (= Franke 242). 24 P. Wolters, Zu griechischen Agonen, 30. Programm des Kunstgeschichtlichen Museums der Universität Würz-burg (1901) 14 Abb. 12. Zu dieser Grabstele s. auch Pfuhl - Möbius I 79 Nr. 107 Taf. 25. 25 SNG v. Aulock 3231. 7030 (= Franke 246. 243). 26 SNG v. Aulock 4715 (= Franke 253). 27 Rumscheid Taf. 46, 1-2 Kat. Nr. 102 mit weiterer Literatur; s. auch A. Carandini - A. Ricci - M. de Vos, Filosofiana la Villa di Piazza Armerina (1982) 289 Abb. 177. 178.
150 H. İşkan
Münzen. Ein Blick auf die Preiskrone auf der Altarbasis in Side zeigt noch zusätzlich in aller Deutlichkeit, wie diese oben eine kleine runde Öffnung aufweist und unten viel breiter auf einem niedrigen Ringfuß ruht (Taf. 41, 2).28 Genauso ist auch die Preiskrone mit dem Blumen-dekor aus dem Nymphäum in Side dargestellt (Taf. 41, 6).29
Der Theaterfries von Hierapolis weist zwei herausragende Beispiele von Preiskronen auf.30 Auf diesen in einen agonistischen Kontext gehörende Platten des Frieses ist die Monumentalität der Preiskronen im Vergleich zu den dargestellten Figuren sehr auffällig. Eine auf der Friesplatte mit Opferszene dargestellte Preiskrone steht nicht auf einem Tisch, sondern ist hoch oben zwi-schen zwei weibliche Figuren gerückt (Taf. 41,3) . Auf der anderen Platte wird in der Haupt-szene zusätzlich zu der riesigen, auf einem Tisch stehenden Preiskrone auch die severische Kaiserfamilie wiedergegeben (Taf. 41, l).31 Salzmann ordnet diese Preiskronen in den Bereich der städtischen Repräsentation und weist daraufhin, »daß auch die Preiskronen in das Inventar feierlicher Selbstdarstellung gehören mit der genaueren Bestimmung, daß sie auf privilegierte musische und gymnische Agone verweisen«32. Dieser trefflichen Formulierung hinzufügend halte ich die großen Preiskronen für das Symbol, für das Wahrzeichen dieser Spiele.33 Sie müs-sen zugleich auch als das Prestigeobjekt der Stadt verstanden werden. Sie waren nicht für den Sieger bestimmt. Vielmehr standen sie während der Festtage am meist besuchten Platz der Stadt, um jedem von diesem wichtigsten Ereignis des städtischen Lebens Kenntnis zu geben. Denn »die Teilnahme der Bürger an diesen kombinierten religiösen und politischen Festen war eine Demonstration der Loyalität gegenüber der Heimatstadt und gegenüber dem römischen Reich und seinen Repräsentanten. In der Feier ihrer Feste stellte eine Stadt sich als lebendige und sichtlich existierende Bürgergemeinde dar; der Zusammenhalt der Gemeinde wurde ge-stärkt«34. Die dekorative Nutzung dieser Preiskronen in verschiedenen baulichen Zusammen-
28 Weiß a. O. 341 ff.; gute Abbildung auch bei P. R. Franke - W. Leschhorn - B. Müller - J. Nolle, Side. Münz-prägung, Inschriften und Geschichte einer antiken Stadt in der Türkei (1989) 48 Abb. 26. Eine mit ihr identische Preiskrone ist auf der Rückseite einer sidetischen Münze, ebenda Abb. 27, wiedergegeben und auch hier wird die runde Öffnung sowie das glatte Unterteil deutlich faßbar. Ähnlich dargestellt auch die Preiskrone auf einer Kasset-te aus Hierapolis, T. Ritti, Hierapolis. Scavi e richerche I: Fonti letterarie ed epigrafiche (1985) Taf. 7 b. 29 A. M. Mansel, Side. 1947-1966 yılları kazıları ve araştırmalarının sonuçları (1978) 101 Abb. 107. 30 Ritti a. O. 57 ff. Taf. 2 a; 7 a; F D 'Andr ia-T. Ritti, Hierapolis. Scavi e ricerche II: Le sculture del teatro (1985) pas sim. 31 Diese riesige Preiskrone, Ritti a. O. Taf. 2 a, kann auf dem mittleren Band eine bemalte Inschrift getragen haben. Auch bei dem Körper ist anzunehmen, daß er durch Bemalung bereichert war. Dies gilt ebenfalls für die Preiskrone auf der zweiten Platte, Ritti a. O. Taf. 7 a, vor allem für das Inschriftenband. An diesen Platten ist die unterschied-liche Darstellungsform der Preiskronen auffallend und bedarf einer Erklärung, sollten sie sich wirklich auf ein und denselben Agon beziehen. Mehrere Preiskronen aus demselben Material sind zumindest in bezug auf die Münzen dahingehend interpretiert, daß »jede von ihnen ganz bestimmte Spiele symbolisiert« (Ziegler 44). s. dazu auch Wiotte 79 Anm. 42: »Ob die Anzahl der Preiskronen, die auf den Münzen dargestellt sind, die Anzahl der Agone wiedergibt, ist nur durch einen direkten Vergleich zwischen den Bezeichnungen der Agone und dem epigraphischen Material feststellbar«. Bei der kleineren Darstellung, Ritti a. O. Taf. 7 a, ist nicht auszuschließen, daß sie einen Preiszylinder darstellt, da die betont zylindrische Form ohne Ausbuchtung in der Mitte oben und unten dieselbe dicke Profilierung aufweist; J. Meischner, Jdl 89, 1974, Abb. 1-3. 32 Salzmann 94 f. 33 So auch M. Karola - J. Nolle, Götter, Städte, Feste. Kleinasiatische Münzen der römischen Kaiserzeit (1994) 112: »Sie waren das eigentliche Symbol für die Wettkämpfe« und C. Bosch, Jahrbuch für kleinasiatische For-schung 1, 1950/51, 86: »Sie dienen in der Bildersprache als Symbol der Festspiele«. 34 Karola - Nolld a. O. 111.
Ein Siegersarkophag aus Patara 151
hängen wie z. B. als Kassettenfüllung im Theater von Hierapolis35 und im großen Nymphäum von Side (Taf. 41, 6)36 oder auf einem korinthischen Kapitell in Perge37, kommt dieser Interpre-tation bestätigend entgegen. Auch die Tatsache, daß gelagerte Flußgötter gelegentlich Preis-kronen in der Hand halten, betont nochmals ihren symbolhaften Charakter.38
Die Altarbasis aus Side, die von zwei sidetischen bouleutai anläßlich der dritten Feier der Pythia-Spiele gestiftet worden war39, erweist sich in diesem Zusammenhang als besonders wichtig (Taf. 41,2) . Weiß kommt in seiner Behandlung dieses Denkmals zu dem Schluß, daß »auf dem sidetischen Podest die Artisten auftraten, die die thymelischen Agone bestritten«40. Die zugehö-rige Inschrift berichtet jedoch von einem vergoldeten bomos mit einer Basis; ein Zustand, der Wörrle zu dem berechtigten Einwand führt: »Bei einem vergoldeten Bomos denkt man doch mehr an ein kostbares Kultgerät geringer Größe aus Metall als an einen großen Marmorblock mit vergoldeten Reliefs; und wenn die Basis für den Altar als Bestandteil der Weihung in der Inschrift besonders erwähnt ist, spricht das doch auch dafür, da es sich bei dieser eher um ein bedeutendes Element von eigenem Wert als bloß um einen einfachen Unterbau handelte«41. Er zieht noch den versilberten bomos aus Oinoanda zum Vergleich heran42, wodurch der tragbare Charakter des vergoldeten bomos, der nur in der Zeit der Spiele eben auf diese Basis aufgestellt wurde, deutlich wird. Aus diesen Überlegungen möchte ich den Schluß ableiten, in dem bomos »nicht in dem von P. Weiß als Dreifuß bezeichneten Gegenstand wiederzuerkennen«43, sondern die auf der Vorderseite der Basis in Relief wiedergegebene Preiskrone. Nicht nur ihre alles andere im Bildprogramm überragende Stellung, sondern auch die Tatsache, daß der Betrachter in der langen Zeit zwischen zwei Spielen nur durch dieses Abbild von dem vergoldeten bomos Kenntnis nehmen konnte, läßt diese Überlegung zu. Das Denkmal trägt also an der Vorderseite das Symbol und Prestigeobjekt des bekanntesten Agons der Stadt Side - vielleicht in voller Größe und nicht in der vergrößerten Version einer, wie immer vermutet wird, auf dem Kopf zu tragenden Preiskrone. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß diese Krone mit dem Dreifuß des für Side so wichtigen Gottes Apollon in enger Beziehung stehen könnte.
Eine zu der oben genannten Stiftung ungefähr gleichzeitige Münzemission aus Side (geprägt unter Gallien) zeigt nämlich auf der Reversseite einen Dreifuß und darauf eine Preiskrone mit Palmzweigen44, die den Zustand der Festaufstellung wiedergeben könnte.
35 Ritti a. O. 76. 36 Mansel a. O. 101 f. Abb. 107-108. Zur Datierung dieser Platten bzw. des Nymphäums in die Zeit von Gordian III. oder sogar später, s. P. Weiß, Chiron 11, 1981, 341 ff. 37 Salzmann Abb. 23. 38 z. B. Aspendos: BMC Greek Coins, Lycia 107 Nr. 97 Taf. 22, 12; Side: T. E. Mionnet, Description des médailles antiques grecques et romaines III (1806-1837) 479 Nr. 196. 39 Weiß a. O. 315 ff. Taf. 19 ff.; Salzmann Abb. 21. 40 Weiß a. O. 330. 41 M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, Vestigia 39 (1988) 191. 42 Ebenda passim. Auf der Basis muß sich noch eine Platte befunden haben. 43 Ebenda 192 Anm. 49. 44 W. Weiser, Katalog der bithynischen Münzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln I: Nikaia. Papyrologica Coloniensia XI (1983) 340 Taf. 26 Abb. 9. Diese Verbindung ist in Side auch noch auf weiteren Emissionen belegt, P. R. Franke-W. Leschhorn-B. Mül le r - J . Nollé, Side. Münzprägung, Inschriften und Geschichte einer antiken Stadt in der Türkei (1989) 49 Abb. 27.
152 H. İşkan
Unter diesem Gesichtspunkt verdient die Überlieferung bei Sextus Pompeius Festus besondere Beachtung. »Die coronae, die coronae donaticae genannt worden sind, weil mit ihnen die Sie-ger bei den Spielen beschenkt wurden, sind später der Großartigkeit wegen über ein für Köpfe geeignetes Maß hinaus dimensioniert worden; sie werden in der Größe eines Flechtkorbes an-gefertigt, wenn die Laren geschmückt werden«45 (Übersetzung J. Rumscheid). Dabei ist es bemerkenswert, daß das Wort donare sowohl für die Bezeichnung der Krone wie auch für deren Aufgabe gewählt wurde.46 Man muß sie wohl wörtlich verstehen; sie werden also geschenkt und sind im griechischen Sinne keine stephanoi.41 Nach Robert ist das Wort 'Brabeion' die exakte Bezeichnung für die Preiskrone48, wenn auch dies von einigen Forschern skeptisch beur-teilt wurde.49 Doch »mehrmals werden aber Brabeion und Stephanos nebeneinander genannt, also voneinander unterschieden. An mehreren Stellen kann man Brabeion durchaus 'klassisch' mit Siegespreis übersetzen - und findet es auch so in den Übersetzungen. Dabei soll nicht abgestritten werden, daß die Preiskronen informell durchaus oft einfach als Brabeia bezeichnet worden sein können - sozusagen eine Benennung totum pro parte, zumal die Preiskrone im 3. Jahrhundert nach dem Zeugnis der Münzen offenbar der Siegespreis schlechthin wurde«50. Dem Vorschlag von L. Robert steht daher m. E. zunächst nichts im Wege. Die geläufige Be-zeichnung 'Preiskrone' muß freilich, bis diesbezügliche neue epigraphische Zeugnisse gefun-den werden, Gültigkeit haben.
Erst unter diesem Gesichtspunkt kann also die Behauptung überprüft werden, ob »sich die sieg-reichen Wettkämpfer nach gewonnenem Agon die Preiskronen auf den Kopf setzten«51. Die
45 Rumscheid 79. »Festus zufolge gab es also Kronen, die die Sieger auf dem Kopf tragen konnten, und solche, die wegen ihrer Größe dafür nicht geeignet waren.« Offen bleibt hierbei natürlich, ob es sich bei diesen zwei Möglich-keiten um ein und denselben Typus der Preiskrone handelt. 46 Diesbezüglich halte ich noch die Aussage der AQPEA- und DONATIO-Beischriften für aufschlußreich. P. Weiß a. 0 . 3 3 2 Anm. 67 versteht unter 0eia Swpea »kaiserliche Autorisation«, wobei unter dem in der 'Tasahir' Inschrift aus der näheren Umgebung von Side belegten Ausdruck tccttct Öeiav Scopeav grundsätzlich auch ein Inhalt wie durch das kaiserliche Geschenk/die kaiserliche Gabe' im materiellen Sinn verstanden werden kann. Ebenfalls ist
eine weitere Interpretation dieses Wortes wie 'Privileg', J. Nolle, Chiron 16, 1986, 206, auf einer Münze SNG v. Aulock 4856 dahingehend zu fassen. Diese Bedeutung als 'Geschenk' wurde von Weiser a. O. 73 Taf. 26, 5 auf-grund der bekannten Münze aus Mopsos mit der Darstellung der vom Kaiser Valerian gestifteten Brücke m. E. bewiesen. Interessanterweise kommt die AQPEA-Beischrift auf einer weiteren Emission mit Preiskronen eines Agons, SNG v. Aulock 5749, vor; eine Tatsache, die, wie Ziegler 53 in bezug auf die Münzen von Tarsos äußerte, »die Einrichtung oder Aufwertung von Spielen aufgrund einer Swpeoc der Kaiser Valerian und Gallienus bezeugt«. Nach Ziegler Anm. 184 »wurde diese agonistische öcopea bisher übersehen«. Diese Geschenke könnten sehr gut die von der Stadt anläßlich der Spiele zu vergebenden Preiskronen sein, die durch das kaiserliche Geld geschaffen wurden, s. dazu Franke 26: »Oft kam es auch vor, daß ein reicher Bürger die Spiele auf eigene Kosten durchführen ließ, was dann - außer auf Ehreninschriften - auch auf den dazu geprägten Münzen vermerkt wurde, sei es durch AflPEA oder ANE0HKEN, sei es - bei römischen Kolonien - durch die Aufschrift DONATIO SACRVM CERTAMEN (263) oder ähnlich, auch die lateinisch-griechische Mischform DONATIO HIEROS (242) kommt vor«. Dieser Gedankengang bestätigt m. E. die hier vertretene Auffassung, in diesen den Siegern geschenkten Preis-kronen die überdimensionierten coronae donaticae zu sehen, freilich ohne sie alle als kaiserliche Gabe zu verstehen.
47 s. dagegen D. A. 0 . Klose, JNG 47, 1997, 44: »Als Weiterentwicklung der Kränze müssen die Preiskronen wie diese auch immer noch als stephanos bezeichnet worden sein«. Aber ebenda 30: »Nirgendwo ist ein spezielles Wort für diese Preiskronen überliefert und expressis verbis von ihrer Verleihung die Rede«. 48 L. Robert, Opera Minora Selecta II (1969) 1024 Anm. 2. 49 Rumscheid 80; Klose a. O. 30 Anm. 6. 50 Ebenda, dort aber: »Ein exakter terminus technicus für Preiskronen kann Brabeion m. E. aber nicht geworden sein«. 51 Salzmann 97. So auch M. Karola - J. Nolle, Götter, Städte, Feste. Kleinasiatische Münzen der römischen Kaiser-zeit (1994) 112: »Die Sieger durften sich in den Wettkampfstätten mit sogenannten Preiskronen bekrönen«;
Ein Siegersarkophag aus Patara 153
dafür herangezogenen Beispiele sind vor allem Münzbilder, wie etwa ein Exemplar aus Hierapolis (Taf. 42,4)52, einige Lampen53 und das Relief des Antonianos aus Ephesos in Kyrene (Taf. 42, 3)54. Betrachtet man das Grabrelief näher, so fällt hier zunächst auf, daß seine Preiskronen neben dem rechten Bein der Größe nach gestapelt sind. Die Sorge um Raumfüllung ist unübersehbar.55
Obwohl die Krone, die er mit der rechten Hand hält, weitgehend zerstört ist, so daß weder ihre Form noch ihr Aussehen bestimmbar ist, kann eindeutig beobachtet werden, daß sie den Kopf nicht berührt. Dazwischen liegen die Finger der rechten Hand. Genau wie diese Darstellung sind auch die beiden Wagenlenker auf zwei Lampenreliefs wiedergegeben. Die Preiskronen liegen auch hier nicht auf dem, sondern über dem Kopf, wie es besonders auf dem Lampen-model gut zu sehen ist (Taf. 42,1) . Auch auf den Münzen ist »die Krone über dem Kopf schwe-bend dargestellt«, wie Dressel es schon in bezug auf das Goldglas aus der Nekropole der Heili-gen Agnes richtig beobachtet hat (Taf. 42, 5).56
Daher möchte ich behaupten, daß diese wohl entsprechend ihrer geringen Bedeutung m. W. auf nur einigen Darstellungen57 wiedergegebene Selbstbekrönung mehr ein symbolischer Akt, ein Siegergestus ist. Wie obligatorisch dieser Gestus sein kann, zeigt die interessante Darstellung eines musischen Agons in der Villa bei Piazza Armerina, auf dem die männliche Figur neben dem Kitharöden eine kleine Orgel über dem Kopf hält (Taf. 42, 2)58. Die von Festus überliefer-ten 'in der Größe veränderten' Preiskronen fanden also eher wie die heutigen Siegespokale Verwendung.59 Auch Dressel ist in bezug auf die Benutzung der großen Preiskronen ähnlicher Meinung, nämlich, daß diese »Preiskronen nicht dazu bestimmt waren, wie der Siegerkranz getragen.. . , sondern vielmehr vom Sieger selbst an geheiligter Stätte als Weihgeschenk nieder-
C. Bosch, Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 1, 1950/51, 86: »Die Sieger setzten sich die Preiskronen aufs Haupt«; Wiotte 74: »Der Athlet setzte sich diese selbst auf den Kopf und wurde so von ihr bekrönt.« 52 SNG v. Aulock 3636 (= Franke 261). 53 Rumscheid Kat. Nr. 123/155 Taf. 53, 2 und Kat. Nr. 134. 161 Taf. 54, 3; Salzmann Abb. 24. 54 Rumscheid Kat. Nr. 144 Taf. 57, 3; Salzmann 92 Abb. 8. Ich gehe davon aus, daß die Preiskronen wohl bemalt, sicher aber die Inschriften mit Farbe geschrieben waren, da sonst der Zweck der Selbstdarstellung nur halbwegs erfüllt wäre. s. dagegen Salzmann ebenda: »Die Selbstdarstellung als Sieger wird also auch ohne Inschrift und nur durch die Preiskronen verständlich.« 55 Weitere Darstellungen von aufeinander gestapelten Preiskronen findet sich z. B. auf einem Goldglas im Vatikan, J. Meischner, Jdl 110, 1995, 465 Abb. 20. 56 H. Dressel, ZfNum 24, 1904, 37 Anm. 2; Salzmann 93 Abb. 10. i7 Dies geht in aller Deutlichkeit aus der Liste zur Typologie kaiserzeitlicher Agonistikdarstellungen' hervor, die von Wiotte 71 ff. zusammengestellt ist, Gruppe I d: Drei Beispiele. Überhaupt ist es auffällig, »daß Athleten nur selten auf Münzen der Kaiserzeit dargestellt wurden. Die Untersuchung ergab, daß nur etwa 13 % des gesamten Materials Athletendarsteliungen sind«, ebenda 72. Dagegen machen die Darstellungen der Preiskrone 70 % des Gesamtmaterials aus, ebenda 74. Auch daraus geht hervor, daß die Städte zur Repräsentation ihrer Agone die Preiskrone vorgezogen haben und nicht den symbolischen Akt des Sich-Bekrönens. s. dazu auch J. Meischner, Jdl 89, 1974, 336: »Nur wenige Darstellungen zeigen die Preiskrone im Moment der Siegerehrung, auf dem Kopf des Wettkämpfers.« 58 Rumscheid Kat. Nr. 102 c Taf. 45, 2. 39 Rumscheid 80. s. dazu auch Wiotte 75: »Offen bleibt jedoch vorerst mangels antiker Zeugnisse die Frage, ob die Preiskrone als symbolischer Preis galt, den sich die Athleten nach dem Sieg aufsetzten, der jedoch in der veranstal-tenden Stadt verblieb (Anm. 50: Dies könnte heute mit einem Wanderpokal verglichen werden, auf den man den Namen des Siegers und des Jahres eingraviert.), oder ob die Preiskrone als Preis angesehen werden kann, der in den Besitz des Athleten Uberging (Anm. 51: Vergleichbar mit den Medaillen bei den modernen Olympischen Spielen.).«
154 H. İşkan
gelegt zu werden«60. Zwei Beispiele mögen diese Feststellung untermauern. Auf einem Mosaik der Therme in Baten Ezzamour ist ein siegreicher Athlet auf der Ehrenrunde dargestellt, der auf dem Kopf eine Blütenkrone trägt und in seiner linken einen langen Palmwedel hält (Taf. 42, 6).61
Mit der rechten Hand trägt er dagegen eine Preiskrone62; Bekrönung und Beschenkung sind hier also unterschieden. Weiterhin zeigt eine Münze aus Pergamon beispielhaft alle Utensilien eines Agons (Taf. 43, 5)63: Auf die Stufen (eines Podestes?) ist ein Tisch gestellt. Unter dem Tisch sind die Losamphora mit zwei Geldbeuteln als Wertpreise angeordnet. Auf dem Tisch liegt zur Bekrönung in der Mitte ein Kranz mit der Inschrift Olympia, flankiert von Preiskronen mit Palmzweigen zur Beschenkung der Sieger als Symbol des hiesigen Agons bzw. als Ehrenpreise. Auch die Tonlampe mit einem siegreichen Wagenlenker im Kunsthistorischen Museum von Wien kann in diesem Zusammenhang herangezogen werden.64 Der Sieger ist mit einer Blüten-krone dargestellt und zu seiner linken Seite wurden seine Preise und Pokale in Form von Preis-kronen, Preiszylindern und Geldsäcken aufgeschichtet (Taf. 43, l).65 Genau dieser Vorgang ist auch auf einem weiteren Mosaik in Baten Ezzamour wiedergegeben (Taf. 43, 4).66
Was wirklich auf dem Kopf getragen werden konnte, ist nicht der bauchige Typus der Preis-kronen, sondern die niedrigere, reifartige, sich kaum wölbende Krone67, wobei diese Untertei-lung freilich nur dann gültig ist, wenn man beide für ein und denselben Gegenstand hält.68
Letztere kommt z. B. auf dem Kopf eines Tubicen auf dem Theaterfries in Hierapolis vor (Taf. 43, 2)69 oder, um stadtrömische Exemplare zu nennen, auf dem Porträtkopf im Phoebe Hearst Museum of Antropology in Berkeley (Taf. 43, 3)70 und einem Sarkophagkastenfragment in Chatsworth (Taf. 43, 6).71 Beide Male ist zu beachten, daß die Kronen wirklich auf dem Kopf
60 Nach J. Banko, ÖJh 25, 1979, 123 f. 61 R. D. Pausz - W. Reitinger, Nikephoros 5, 1992, 122; Rumscheid Kat. Nr. 92 c Taf. 41, 2. 62 Beachtenswert an dieser Szene ist noch die Tatsache, daß »der Zylindermantel für den Arm an einer Seite offen ist«, Pausz - Reitinger a. O. 122. Nach ihnen wird die Krone im Inneren von einem nicht sichtbaren Griff gehalten. Diese Art von Öffnung wird von Rumscheid 80 auch in bezug auf andere Darstellungen geäußert. Doch bei den perspektivisch wiedergegebenen Preiskronen des Patara-Sarkophages mit nach hinten führenden, gebogenen Li-nien kann von einer solchen Öffnung nicht gesprochen werden. Auf demselben Mosaik werden die Preiskronen auch noch vor einem Preistisch mit vier Geldbeuteln dargestellt; Rumscheid Kat. Nr. 92 d Taf. 41, 1. Sie sind jeweils zu dritt aufeinandergestapelt, wie auf dem Grabrelief des Antonianos in Kyrene. Auch diese Wiedergabe erklärt sich m. E. nur dadurch, daß es sich hierbei um Siegerpokale handelt. In der Interpretation ähnlich auch zum Goldglas-Fragment im Vatikan; s. hier Anm. 55. 63 Gute Zeichnung bei P. Wolters, Zu griechischen Agonen, 30. Programm d. Kunstgeschichtlichen Museums der Universität Würzburg (1901) 14 Abb. 13. M Rumscheid Kat. Nr. 134 Taf. 54, 1. 65 Ähnlich verhält es sich mit einer anderen Lampe im Museum von Carnuntum, Rumscheid Kat. Nr. 184. 66 Rumscheid Kat. Nr. 92 b Taf. 41, 1. 67 Rumscheid 80 Kat. Nr. 117 Taf. 52, 1; Kat. Nr. 126 Taf. 54,4; Kat. Nr. 146Taf. 56,3; Kat. Nr. 149 Taf. 58, 2; Kat. Nr. 150 Taf. 58, 3-4; Kat. Nr. 153 Taf. 59, 3-4. 68 Obwohl ich im Rahmen dieses Beitrages nicht alle Darstellungen der Preiskronen behandelt habe, möchte ich die auf dem Kopf tragbaren Kronen von den großen, bauchigen oder zylinderförmigen Preiskronen unterscheiden. 59 T. Ritti, Hierapolis. Scavi e richerche I: Fonti letterarie ed epigrafiche (1985) 64 f. Taf. 3 b; Rumscheid Kat. Nr. 139 Taf. 55,4. 70 Rumscheid Kat. Nr. 150 Taf. 58, 4. 71 Rumscheid Kat. Nr. 117 Taf. 52, 1. Zu den bisher erwähnten Sarkophagen mit Wiedergabe der Preiskronen kommen noch zwei Exemplare hinzu, deren Deutungen aus den Darstellungen selbst gewonnen werden können.
Ein Siegersarkophag aus Patara 155
sitzen und nicht, wie bei den vorangehenden Beispielen, provisorisch über dem Kopf gehalten werden. Auch bei der Münze aus Hierapolis (Taf. 42, 4) handelt es sich m. E. um eine solche Krone, wie auch auf einem Sarkophagkasten im Nationalmuseum in Rom.72
Nach Rumscheid »ist kaum sicher zu sagen, ob es sich um die große oder kleine Variante der Preiskrone handelt, wenn der Größenvergleich im Bild fehlt«73. Bei einer detaillierten Unter-scheidung der Funktion der Preiskronen aus dem jeweiligen Bildkontext heraus läßt sich jedoch dieses Problem in einigen Fällen lösen, wie an der sidetischen Basis gezeigt werden konnte. Doch oft hilft ein solcher Vergleich nicht weiter, wie z. B. bei den Preiskronen auf dem Grab-relief des Läufers Aneiketos von Mytilene74(Taf. 40, 7) und dem Relief von der Agora in Izmir mit dem in Argos gewonnenen Heraia-Schild (Taf. 44,4)75. Der Sarkophag in Selge (Taf. 44, 1), der nicht zuletzt aufgrund seiner Plazierung gleich hinter dem Theater wohl den besten Ver-gleich zu dem aus Patara bietet76, weist auf allen vier Seiten sechzehn Preiskronen im hohen Relief auf.77 Diese und die auf dem pataräischen Sarkophag dargestellten Preiskronen könnten in ihrer Größe den originalen entsprechen. Bei allen diesen Beispielen stellen also die Sieger ihre Preise, d. h. Pokale in Form von Preiskronen zur Schau, die sie im Laufe ihrer agonistischen Karriere gewonnen haben. Sie zeigen hiermit eine der verschiedenen Möglichkeiten der priva-ten Selbstdarstellung des römischen Bürgertums vor allem in den östlichen Provinzen.
Die Münzen mit Darstellungen von Preiskronen sind neben den öffentlichen Bauten die besten Zeugnisse zur städtischen Selbstdarstellung, doch ihre Deutung ist schwierig. Die auf verschie-dene Art und Weise dargestellten Preiskronen78 werden auf Münzen sowohl in ihrer Funktion als agonistisches Symbol79 wie auch als zu verteilender Siegespokal wiedergegeben.80 Für
Auf einem Deckelfragment aus der Via della Scala, R. Amedick, Vita privata. Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben, ASR I 4 (1991) Kat. Nr. 226, liegt die große Krone, die nur für den besten der Läufer als Siegespokal bestimmt sein kann, auf dem Preistisch. Auf einem weiteren Deckelfragment aus der Sammlung Zeri in Mentana, Amedick ebenda Kat. Nr. 73 Taf. 79, 3; Rumscheid Kat. Nr. 156 Taf. 60, 1, befindet sich die Krone zwischen zwei Geldbeuteln. Wenn auch das Größen verhältnis der dargestellten Objekte nicht buchstäblich ist, so lassen die im Verhältnis zur Preiskrone größer gehaltenen Geldbeutel vermuten, daß diese als ein dicker Reif zu verstehende Preiskrone wie ein Kranz auf den Kopf gesetzt werden kann. Die Identifizierung dieses Gegenstandes als Preiskrone wurde von Amedick angezweifelt. 72 Rumscheid Kat. Nr. 179. 126 Taf. 54, 4. Auch hier trifft man auf dasselbe Phänomen wie auf den Mosaiken in Baten Ezzamour und Piazza Armerina, s. hier Anm. 27 und 61, wo der Sieger auf dem Kopf eine Blütenkrone trägt und ihm weiterhin Geld und eine Preiskrone geschenkt werden sollte. 73 Rumscheid 79. 74 Pfuhl - Möbius I 79 Nr. 107 Taf. 25. 75 Salzmann 198 Abb. 5. 76 A. Machatschek - M. Schwarz, Bauforschungen in Selge (1981) 102 Abb. 75; Ritti a. O. Taf. 9 b; Rumscheid Kat. Nr. 180. Ein weiterer Sarkophag mit Girlanden und drei Preiskronen ist von J. Keil - A. von Premerstein, Bericht über eine dritte Reise in Lydien (1914) 94 f. Nr. 131 Abb. 55 bekannt gemacht, von dem jedoch m. W. bisher noch keine Aufnahmen existieren, s. dazu auch hier Anm. 18. 77 Eine fragmentierte Preiskrone mit der Inschrift TcavKpatiov 'OA.i)|i7ua aus Selge dürfte zu diesem Sarkophag gehören, J. Nolle - F. Schindler, Die Inschriften von Selge, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 37 (1991) 117 Nr. 58 Taf. 36. Zu zwei weiteren Darstellungen von Preiskronen s. ebenda 109 Nr. 46 Taf. 29 und 114 Nr. 53 Taf. 32. 78 s. dazu die ausführliche Liste der 'Gruppe II' von Wiotte 82 ff. 79 Side: BMC Greek Coins, Lycia and Pamphylia 155 Nr. 87 Taf. 28, 12; 156 Nr. 90 Taf. 28, 14; Kaisaria in Kappadokien: E. A. Sydenham, The coinage of Caesarea in Cappadocia (1933) 107 Nr. 458 Abb. 88. 80 z. B. SNG v. Aulock 3637.
156 H. İşkan
besonders erwähnenswert halte ich die Darstellung auf einer bithynischen Münze (Taf. 44, 3), die auf dem Preistisch die Büste des Kaisers Commodus zwischen zwei Preiskronen zeigt8', wodurch ihre Verwendung als Siegespreis offenkundig wird.82
Weiterhin muß noch die Tatsache hervorgehoben werden, daß bei den (Haupt-)Spielen Olym-pia, Kapitolia, Aktia und Pythia grundsätzlich Kränze verliehen wurden83 und das Vorkommen der Preiskronen - zumindest auf Münzen - sich erst unter Commodus nachweisen läßt.84 So-wohl diese plötzliche, aber bildtypologisch absolut reife Entstehung85 wie auch der Übergang vom Kranz zur Preiskrone konnte bisher nicht zufriedenstellend geklärt werden86, sollte die Preiskrone wirklich anstelle des Kranzes angetreten sein. Lämmer behauptet in bezug auf die Olympien, daß »wie in Olympia und bei allen anderen späteren lokalen Olympien der Sieges-preis ausdrücklich in einem Ölzweig bestand, den sich der Sieger selbst zu einem Kranz auf-band«87. Daß bei den Olympien in Kleinasien wie bei denen in Elis auch nach Commodus noch Kränze verliehen wurden, sollen zwei Münzen aus Ephesos und Tralleis zeigen (Taf. 44, 7).88
Der Siegespreis bei den Aktia war ebenfalls ein (Lorbeer-)Kranz89, wie z. B. in Hierapolis.90
Dies gilt wohl auch für »die Spiele, die nach dem Vorbild der römischen Capitolia ausgetragen wurden«91. Bei diesen Spielen wurden bekanntlich Kränze aus Eichenlaub verliehen.92 Die Hadrianeen zu Ephesos waren zwar ein dycov crx£(j>avixr|<;, der offizielle Kampfpreis war aber ein ßpdßeiov93, was wiederum den oben angestellten Überlegungen entgegenkommt. Die Pythien waren ebenfalls 'kranzspendende' Agone, und für sie ist hauptsächlich der Lorbeerkranz über-liefert.94 Zwei Denkmäler aus Ephesos mit Inschriften zeigen diese Situation am eindrucksvoll-
81 BMC Greek Coins, Bithynia Nr. 63 Taf. 33, 2. 82 Das Tetrasserion von Nikaia, W. Weiser, Katalog der bithynischen Münzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln I: Nikaia. PapyrologicaColoniensiaXI (1983) 351 Taf. 29,4. s. dazu auch C. Bosch, Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 1, 1950/51, 86: »...unter den Siegespreisen befinden sich auch Kaiserbüsten, die demnach ebenfalls an Sieger vergeben werden«. Diese Tradition scheint erst unter Commodus vorgekommen zu sein. 83 I. Weiler, Der Sport bei den Völkern der alten Welt (1981) passim\ J. H. Krause, Die Pythien, Nemeen und Istmien (1975) passim\ M. Blech, Studien zum Kranz bei den Griechen (1982) passim\ D. A. O. Klose, JNG 47, 1997, 32. 84 Ebenda 30. 85 s. den Anhang 2 von Wiotte 87. Die commodeischen Münzen aus Nikaia/Bithynien zeigen in einer sehr breiten Palette gleich neun Münztypen; alle anderen Kaiser prägen dann nur in wenigen Typen. 86 Klose a. O. 42 versucht zu zeigen, daß »die Preiskronen sich wohl über mehrere Zwischenstufen aus den Preis-kränzen entwickelt haben«; im Fall der Aktia aus Schilfkränzen. Seine Überlegungen scheinen mir jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden zu sein, die hier nicht im einzelnen behandelt werden können (wie z. B. daß es in der Zeit seiner wichtigen Beweisstücke, den Münzen aus Tarsos, dort noch keine - überlieferten - Aktia gibt). 87 M. Lämmer, Olympien und Hadrianeen im antiken Ephesos (1967) 21 mit Anm. 74. 88 Ephesos: SNG v. Aulock 1905; Tralleis: SNG v. Aulock 3297 (= Franke 245). 89 M. Lämmer, Stadion 12/13, 1986/87, 27 ff. mit weiterführender Literatur. Nach Klose a. O. 32 ff. bestehen dagegen die Kränze der Aktia in Nikopolis aus Schilf, obwohl dafür auch Lorbeerkränze vorgeschlagen wurden, Lämmer a. O. (1986/87) 30. 90 SNG v. Aulock 3629. 91 Ziegler 147. 92 RE III 2 (1991) 1527 f. s. v. Capitolia (Wissowa).
»Lämmera . O. (1967) 52. 94 J. H. Krause, Die Pythien, Nemeen und Istmien (1975) 47 ff.
Ein Siegersarkophag aus Patara 157
sten, in deren Kränze die Namen der verschiedenen Agone geschrieben wurden, wie z. B. Koinon Asias in Smyrna.95
Salzmann sieht hierbei zwei Möglichkeiten: »Einmal mag es so gewesen sein, daß bei den Spielen Preiskronen die traditionellen Kränze ersetzten und folgerichtig auf den Denkmälern dargestellt wurden. Zum anderen ist denkbar, daß in Wirklichkeit die Verleihung des Kranzes üblich blieb, der Auftraggeber aber die Preiskronen als Symbol auf das Denkmal setzen ließ«96. Die letztere, m. E. richtige Folgerung kann freilich nur zutreffen, wenn die sog. Preiskronen nicht als 'Kronen', sondern als eine Art 'Pokale' verstanden werden. Die Wahl der privaten Repräsentationsalternativen liegt freilich allein bei dem Auftraggeber des jeweiligen Denkmals.
Bei dem Vergleich mit dem Sarkophag in Selge (Taf. 44, 1) fällt zugleich ein wichtiger Unter-schied zu dem aus Patara auf. Auf letzterem waren nämlich die dargestellten Preiskronen be-malt. Das heute Erhaltene ist die graphische Vorzeichnung der Kronen.97 Jede Krone wurde dann in der Farbe ausgemalt, die für den betreffenden Agon, in dem Theronides gewonnen hatte, typisch war. Den nächsten Vergleich dafür bildet die Preiskrone des sidetischen Nymphäums mit der Inschrift Oikumenikos, die ebenfalls bemalt war (Taf. 44, 2). Ihr Pendant vom selben Bauwerk mit der Inschrift Hieros ist dagegen plastisch gestaltet (Taf. 41,6), so daß die 'Nacktheit' der bemalten Preiskrone störend wirkt.98 Tatsächlich haben sich auf dem Sarkophag auch Farbspuren erhalten. Die Inschriftenbänder waren alle rot bemalt, wie es bei den Preiskronen der Koina Asias und Aktia deutlich zu erkennen ist. Aber auch Spuren von Ockergelb und Blau sind vorhanden. Sogar einige Schreibfehler müssen mit Farbe korrigiert gewesen sein.
Für die Datierung des Sarkophages muß zunächst der zeitliche Rahmen anhand der Darstellung von sog. Preiskronen auf Münzen bestimmt werden.99 »Die Preiskrone als Münzbild tritt erst-malig auf Münzen von Nikaia/Bithynien und Tarsus/Kilikien unter Commodus auf.100 Unter den Severern nimmt dieses Motiv stark zu und erfreut sich wachsender Beliebtheit bis zur Zeit des Gallienus. Zum letzten Mal erscheint die Preiskrone auf Münzen von Kremna/Pisidien, geprägt unter Kaiser Aurelian bzw. auf Münzen von Perge/Pamphylien, geprägt unter Taci-tus«101. Auch Leschhorn betont den »gewaltige(n) Zuwachs agonistischer Themen in der frühen severischen Zeit«102. Übertroffen wird diese Situation in der Regierungsperiode von Valerianus
95 H. Engelmann - D. Knibbe - R. Merkelbach, Inschriften von Ephesos IV, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 14, 4 (1980) Nr. 1130. 1131. Vgl. auch die Siegerinschrift aus Isthmia, im Museum von Korinth, D. A. 0 . Klose, JNG 47, 1997, 36 Abb. 7. 96 Salzmann 92 in bezug auf die Grabstele des Markos Tullios aus Apameia in Bithynien, dort Abb. 7. 97 Auf einigen Siegerinschriften in Selge sind Preiskronen in Ritztechnik erhalten, J. Nolle - F. Schindler, Die Inschriften von Selge, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 37 (1991) 109 Nr. 46 Taf. 29; 114 Nr. 53 Taf. 32. Diese und das Relief von der Agora in Smyrna dürften ebenfalls bemalt gewesen sein. 98 A. M. Mansel, Side. 1947-1966 yılları kazıları ve araştırmalarının sonuçlan (1978) 101 ff. Abb. 107-108. 99 Der nach Rumscheid 88 Kat. Nr. 150 Taf. 58, 3-4 früheste Beleg einer Preiskrone ist auf einem Porträtkopf in Berkeley erhalten, wobei es sich hier nicht um den bauchigen Typus handelt, sondern um den niedrigeren Reif. 100 Rumscheid 88 übernimmt die Chronologie von Dressel und datiert diese Münze früher, d. h. in die Zeit von Marc Aurel. In diesem Zusammenhang ist auch die Datierung der m. W. frühesten Darstellung von Preiskronen in Rom wichtig, einer Basis, die die Statue des Pantomimen L. A. Apolaustus Memphius, eines Freigelassenen der Kaiser M.Aurelius und L. Verus, getragen hat. Eine im Typus identische Basis steht in Perge vor den großen Thermen. 101 BMC Greek Coins, Pamphylia 140 Nr. 102 Taf. 25, 5; Wiotte 75. 102 W. Leschhorn, Stadion 24, 1, 1998, 37: »Die Münzprägung mit agonistischen Themen vervielfacht sich plötz-lich. In 35 Städten werden unter der Regierung des Septimius Severus und Caracalla derartige Münzen ausgegeben«.
158 H. İşkan
und Gallienus.103 Zu den numismatischen Zeugnissen kommen noch die historischen Überliefe-rungen hinzu. Die Aktischen Spiele sind zum letzten Mal im Jahr 275 n. Chr. erwähnt, danach gab es diese Spiele wohl nicht mehr.104 Gleich nach der Jahrhundertmitte dürften auch die Hadrianeen nicht mehr gefeiert worden sein.105 Als Diokletian Asia in sieben Provinzen aufteil-te, fand auch das Koinon Asias ein Ende.106 Man bewegt sich also innerhalb etwa eines Jahrhun-derts.
Den wichtigsten Hinweis zur Datierung des Sarkophages liefert die Inschrift, in der der Inhaber des Sarkophages das nomen gentile Septimius führt, wonach er also das römische Bürgerrecht innehatte.107 Dies assoziert auf jeden Fall eine Zeitspanne vor der constitutio Antoniniana. Ein zweites Datierungskriterium wird durch die Preiskrone des Agons in Kaisareia gegeben. Im Jahr 13 (d. h. 204/205) und 14 (d. h. 205/206), also wohl im Hochsommer/Herbst 205 prägt diese Stadt neue Münzen mit der Legende »Hieros Severios Philadelphios Koinos Agon«.108
Genau dieser 'heilige allgemeine severische Agon der Bruderliebe' müßte auf dem Sarkophag aus Patara gemeint sein. Erhalten hat sich jedoch nur die Inschrif t EN KAICAPIA KAnnAAOKON; der vollständige Titel des Wettkampfs war sicher mit Farbe aufgemalt, da die Inschrift alleine sonst keinen Sinn ergeben würde.109
Eine weitere Beobachtung betrifft die unter Septimius Severus im Jahre 204 geprägte Emission von Nikaia, deren Preiskrone auf der Reversseite m. W. als einziges Beispiel die obere Öffnung mit zwei halb nach innen gebogenen Linien perspektivisch wiedergibt (Taf. 44, 6)"°. Dies mag zwar nicht unbedingt von entscheidender Bedeutung sein, doch die Einmaligkeit könnte eine zeitspezifische Art in der Darstellung widerspiegeln. Dafür spricht z. B. auch eine weitere Emis-sion mit dem Münzbild des Geta, deren Revers zwei Preiskronen zeigt, die oben deutlich eine runde Öffnung aufweisen.111 Diese Darstellungsart auf Münzen ist m. W. singulär.
Aus diesen Überlegungen geht hervor, daß diese Preiskronen hauptsächlich bei den Spielen in der Regierungszeit von Septimius Severus und Caracalla vergeben wurden. Damit ist jedoch der Sarkophag selbst noch nicht datiert. Nach der Inschrift zu urteilen muß der Verstorbene sein Grab zu seinen Lebzeiten und mit dieser unüblichen Komposition selber bestellt haben. Wann
103 Ebenda 39: »48 Städte mit etwa 80 Agonen«. 104 M. Lämmer, Stadion 12/13, 1986/87, 29 f. 105 Ders., Olympien und Hadrianeen im antiken Ephesos (1967) 42. 106 RE II 2 (1896) 1559 s. v. Asia (Brandis). 107 Bekanntlich »war der agonistische Erfolg eine Möglichkeit, aus der sozialen Unterschicht in die oberen Ränge der Gesellschaft aufzusteigen« und »Offensichtlich gehörte in vielen Orten die Verleihung des Bürgerrechts zu den Bestandteilen eines Sieges« (Salzmann 91). Auch nach Lämmer a. O. 53 »erhielten die Sieger bei den ephesischen Hadrianeen mehrfach das ephesische Bürgerrecht«. Dementsprechend muß auch Theronides andere Bürgerschaf-ten nach seinen gewonnenen Siegen bekommen haben. 108 F. A. Sydenham, The Coinage of Caeserea in Cappadocia (1933) 107 ff.; BMC Greek Coins, Galatia, Cappadocia and Syria 82 Nr. 280 Taf. 12, 2; Ziegler 35. Es gab für die beiden Kaiserkinder weitere Spiele, Th. Corsten, Die Inschriften von Laodikeia am Lykos, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 49 (1993) 119 ff. 109 Eine ähnliche Wiedergabe der Inschrift als EN AOHNAII befindet sich auf einem Grabrelief auf der Agora von Smyrna, Salzmann 91 Abb. 5. im w Weiser, Katalog der bithynischen Münzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln I: Nikaia. Papyrologica Coloniensia XI (1983) 352 Taf. 29, 10. 111 Anazarbos: Ziegler Taf. 5. 34.
Ein Siegersarkophag aus Patara 159
dies aber geschah, kann nicht genau bestimmt werden.112 Zugleich stellt sich die wichtige Fra-ge, ob die Preiskronen chronologisch gereiht wurden und wenn ja, wie diese Chronologie abzu-lesen ist."3 Die Konzentration aller - großen - Spiele auf der Vorderseite könnte jedoch darauf hinweisen, daß eine zeitliche Reihung vielleicht gar nicht angestrebt war. Aus welchem Grund auch immer sind die Städte, in denen die Spiele abgehalten wurden, in den eingemeißelten Inschriften nicht namentlich genannt. Nur Kaisareia bildet eine Ausnahme, da der dortige Agon in seiner Titulatur zwangsläufig den Namen der Stadt beinhaltet. Die Preiskronen scheinen im bemalten Zustand als Vertreter der jeweiligen Spiele jedem zeitgenössischen Betrachter be-kannt gewesen zu sein. Die Möglichkeit, daß die Namen dieser Städte mit Farbe aufgemalt waren, besteht nur bei den Preiskronen für Kapitolia und für die Spiele in Kaisareia, bei allen anderen ist dafür nicht ausreichend Platz vorhanden.
An dieser Stelle müssen noch die auf dem Deckel inschriftlich erwähnten Agone sowie ihre zeitliche Einordnung behandelt werden. Auf der einen Schmalseite steht KOINA BEIOYNON. Bekanntlich wurden die Festspiele des commune Bithyniae in Nikomedeia und Nikaia abgehal-ten.114 Im Gegensatz zu den epigraphischen Belegen aus der Zeit des Commodus115 findet sich auf den Münzen von Nikaia keine Überlieferung von einem Agon dieses Namens.116 Ähnliches gilt für Nikomedeia, auch hier fehlen numismatische Hinweise. Über der Inschrift des Deckels sind drei Zeilen eradiert. Ob das mit der Tilgung des Namens von Geta zusammenhängt, zu dessen Ehren von seiner Familie in beiden Städten großangelegte Spiele veranstaltet wurden, ist zwar nicht sicher zu bestimmen, mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch anzunehmen. Dem-zufolge käme Nikaia dafür eher in Frage, da die Severeia »in Nikaia mit größerer Intensität gefeiert sind als in der benachbarten Stadt Nikomedeia«"7. Auf der anderen Schmalseite des Sarkophagdeckels steht EN HAH TO B (Taf. 38, 4). Hierbei ist interessant, daß der Name des Agons nicht genannt worden ist. Die sidetischen Agone bekamen zwar unter Gordian III. eine Aufwertung, doch gab es auch schon vorher in Side etablierte gymnische wie musische Ago-ne.118 Seit Gordian tragen die Spiele die Namen des Gottes Apollon und des Kaisers, kurz nach seiner Regierung nur noch den Namen Apollon. Des öfteren hießen sie kurz 'Pythia'. Da hier jegliche Bezeichnung fehlt, könnte ein Hinweis auf einen älteren Agon vorliegen. Auf der Haupt-seite ist zuerst der Agon AIAYMHA erwähnt, der seit dem Hellenismus bekannt ist.119 In der Herrschaftszeit des Commodus gewannen die Spiele anscheinend durch die Hinzufügung des
112 Es kann nur daraufhingewiesen werden, daß bei der anthropologischen Untersuchung an den Skeletten aus unterirdischen Kammergräbern der späthellenistisch-römischen Epoche in Patara das Durchschnittsalter der männ-lichen Bevölkerung auf max. fünfzig Jahre gerechnet wurde; K. Großschmidt, Lykia II, 1985, 212 ff. 113 Etwa von Hadrianeia zu dem Agon in Kaisareia. 114 RE III 1 (1897) 535 s. v. Bithynia (Brandis); S. Şahin - R. Merkelbach, Katalog der antiken Inschriften des Museums von Iznik (Nikaia), Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 10, 3 (1987) 67. 115 Şahin - Merkelbach a. O. 68 f. 116 Weiser a. O. 321 f.; Wiotte 87 Anhang 2. 1,7 Ebenda 70. 118 J. Nolle, Side im Altertum I. Geschichte und Zeugnisse, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 43 (1993) 84 ff.; s. auch P. Weiß, Chiron 11,1981, 339. Vgl. dieagonistischen Münzen von Side aus derZeit Elagabals und des Alexander Severus, BMC Greek Coins, Lycia and Pamphylia 155 f. Taf. 28, 12. 14. Die Namen dieser Spiele sind nicht bekannt. Es könnte sich aber vielleicht um die Pythien handeln. 119 RE V 1 (1903) 442 f. s. v. Didymeia (Stengel).
160 H. İşkan
Namens Kommodeia an Bedeutung, die aber, nach milesischen Münzen aus der Zeit Valerians und Galliens zu urteilen, mit dem Kaisernamen nicht weitergeführt wurden. Neben dieser kur-zen Inschrift steht KOINON A l l AI, ein auch schon auf dem Sarkophagkasten erwähntes Fest.120
Rechts anschließend ist in schrägem Lauf KOMOAIOC geschrieben, der von dem Kaiser Commodus eingerichtete Agon.121 Dieser Agon ist in Kleinasien numismatisch in den Städten Nikaia, Didyma/Milet, Laodikeia und Tarsos belegt.122 Er ist sicherlich nicht lange abgehalten worden, da - wie Ziegler festgestellt hat - »nach seiner Ermordung alle dem Commodus gewid-meten Neokorien annuliert wurden«123 und die severische Familie in Kleinasien ihre eigenen Interessen bezüglich der Agone hatte. In Nikaia und Didyma wurde dieses Fest nur unter Commodus gefeiert. In Tarsos und Laodikeia dagegen wurden die Kommodeia unter Caracalla zwar rehabilitiert, doch anscheinend nur für eine kurze Zeit.124
Ebenso wie die auf dem Sarkophagkasten erwähnten Agone geben uns die auf dem Deckel genannten, mit Ausnahme von Didyma und Side, keinen Hinweis auf den jeweiligen Austra-gungsort. Daher ist es grundsätzlich nicht mehr möglich, die Lokalisierung der angegebenen Agone mit Sicherheit vorzunehmen. Man kann nur vor allem aufgrund der Münzen Vermutun-gen äußern. Auf jeden Fall soll es sich bei den Wettkämpfen nicht um lokale Aktivitäten kleine-rer Städte, sondern um groß angelegte, oikumenische Agone handeln.
Ein weiteres Indiz, was für die Zusammengehörigkeit von Sarkophagkasten und Deckel spricht, ist die zeitliche Einordnung der inschriftliche aufgeführten Agone des Deckels: ebenso wie die durch die Darstellungen der sog. Preiskronen gemeinten Agone des Sarkophagkastens lassen sich auch die Agone des Deckels in die severische Epoche datieren.
Die Identifizierung der auf den Preiskronen genannten Städte, in denen diese Spiele gewonnen wurden, ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Einen guten Einblick in die Problema-tik geben zunächst die Überlegungen von Leschhorn: »In den kaiserzeitlichen Inschriften und Münzen werden mindestens 500 verschiedene Agone erwähnt125 und in 94 Städten und unter 27 Kaisern wurden Münzen mit Bezug auf Spiele ausgegeben... Die verschiedenen Namensfor-men und Abkürzungen sowie die Münzbilder weisen auf etwa 150 bis 170 verschiedene, meist periodisch abgehaltene Spiele«126. Trotz dieser Vielfalt muß man jedoch berücksichtigen, daß »nur ein kleiner, allerdings wichtiger Teil der kaiserzeitlichen Agone numismatisch bezeugt ist«127.
120 s. zu diesem Agon die vorangehenden Überlegungen. 121 Es gibt Spiele, die den Namen 'Koina Asias Komodeia' tragen, wie z. B. in Laodikeia am Lykos, W. Leschhorn, Stadion 24, 1,1998,53 oder in Pergamon, Ziegler 11. Doch das Wort Komodios steht auf dem Deckel weit entfernt von den vorangehenden 'Koina Asias' wie Didymeia, so daß sie nicht zusammen gehören müssen. 122 Leschhorn a. O. 49 ff. 123 Ziegler 73. 124 Ziegler 69. 73. 75. 125 Leschhorn a. O. 31. 126 Ebenda 33. S. 40 listet er auch »die Namen der Spiele, die auf den Münzen Erwähnung fanden« auf. Mit Heranziehung aller Quellen kommt er zu folgendem Schluß: Olympien oder Isolympien fanden in 38 Städten, Pythien oder Isopythien in 33 Städten, Aktien oder isaktische Spiele in 15 Städten, Kapitolinische Spiele in 9 Städten statt. 127 Leschhorn a. O. 41. Diese Behauptung wird jetzt durch den Neufund agonistischer Inschriften von Patara bestä-tigt, einer Stadt, von der diesbezüglich bisher weder Münzen noch Inschriften bekannt waren. Den einzigen ar-
Ein Siegersarkophag aus Patara 161
Bei den auf dem Sarkophag genannten großen'Agonen (Olympia, Pythia, Kapitolia und Aktia) ist grundsätzlich von einer bewußten 'Angleichung' der Spiele in den östlichen Provinzen an die Hauptspiele auszugehen128, ohne freilich die Möglichkeit auszuschließen, daß Theronides in den Ursprungsstädten gewonnen hätte. Auf der ersten Preiskrone der Vorderseite steht Olym-pia. 129 Bedeutende Olympia-Spiele hat es in Kleinasien in folgenden Städten gegeben130: Ephesos, Kyzikos, Pergamon, Smyrna, Nikaia, Adana, Anazarbos, Sardes, Attaleia, Aspendos, Side, Tarsos, Tralleis und Hierapolis. Die Pythien wurden in Kleinasien in mehreren Städten durchgeführt, vor allem Hierapolis und Side waren dafür berühmt.131 Auf der hier dargestellten Preiskrone (Taf. 39, 2) sind die mit einem Kreuz verzierten Kreise wohl als Äpfel zu deuten.132 Der vom Kaiser Domitian eingeführte Agon Capitolinus wetteiferte immer mit den olympischen Spie-len. Aber »Spiele, die nach dem Vorbild der römischen Capitolia ausgetragen wurden, sind uns nur in geringer Zahl bekannt«133. In Kleinasien sind diese Spiele nur in den karischen Städten Aphrodisias und Antiochia sowie in Olbasa/Pisidien überliefert.134 Abgesehen von diesen sind sie noch in den syrisch-phönizischen Kolonien Laodicea, Heliopolis, Tyros und Sidon nachge-wiesen.135 Die berühmten Aktien Kleinasiens wurden in Hierapolis und Sardeis abgehalten, aber auch in Ankyra, Nikomedia und Neokaisereia am Lykos hat es aktische Spiele gegeben.136
Die Spiele Koina Asias hängen »mit der Neuorganisation des Landtags zusammen und sind wohl aus dem ursprünglichem Roma und Augustus-Kult entstanden«137. Als Versammlungsorte des Koinon sind Ephesos, Smyrna, Pergamon, Sardeis, Kyzikos, Laodikeia und Philadelphia bekannt. »In mindestens 19 Städten fanden Hadrianeia statt oder wurden Spiele mit dem Namen
chäologischen Beweis bilden, wie es sich erst jetzt herausstellt, zwei große Kränze im hohen Relief an der Süd-mauer der Hafenthermen. 128 Dies geht auch daraus hervor, daß Preiskronen in Griechenland nicht beliebt waren, wie es den Münzbildern entnommen werden kann. »Anzutreffen ist sie auf Münzen in Makedonien, Thrakien, Kleinasien und Syrien«, Wiotte 75. 129 RE XVIII 1 (1995) 46 f. s. v. Olympia (Ziehen); I. Weiler, Der Sport bei den Völkern der alten Welt (1981) 105 ff. 130 M. Lämmer, Olympien und Hadrianeen im antiken Ephesos (1967) 1 Anm. 1. 131 J. H. Krause, Die Pythien, Nemeen und Isthmien (1975) 56 ff. Ausführlich zu den sidetischen Pythien s. J. Nolle, Side im Altertum I, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 43 (1993) 86 ff. und zu den in Hierapolis T. Ritti, Hierapolis. Scavi e ricerche I: Fonti letterarie ed epigrafiche (1985) passim. 132 Krause a. O. 49 f. Äpfel in bzw. über der Preiskrone werden oft auf Münzen als Symbol eines Agones verwen-det, s. die 'Gruppe II' von Wiotte 82 f. Nr. 24-67. Sie stehen dabei fast immer mit Pythien in Verbindung; stellver-tretend sei hier auf eine Münze aus Perinthus hingewiesen, die in einer guten Zeichnung bei H. Dressel, ZfNum 24, 1904, 34 abgebildet ist. s. dazu auch die Äußerungen von Th. Corsten, Die Inschriften von Prusa ad Olympum, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 40 (1993) 49: »Man hatte die Spiele des alten Griechenlands so genau nachgeahmt, daß auch die Art der Siegespreise übernommen wurde. Es ist bekannt, daß die Preise bei den Olympischen Spielen Palmzweige waren, und bei den Pythischen Spielen erhielt der Sieger Äpfel. Genauso wurde es in Prusa gehandhabt: Die Uber den Preiskronen auf den Münzen dargestellten Palmzweige gehören zu den 'OX,u|i7tia, die kugelförmigen Gebilde sind die zu den ni>9iot gehörenden Äpfel«. In Olympia war jedoch der Siegespreis ein Kranz aus Ölzweigen. Zur Beziehung der Äpfel mit pythischen Spielen s. auch Krause a. O. 49 ff. 133 Ziegler 147. 134 Ebenda. 135 Ebenda 148. 136 RE I 1 (1895) 1213 f. s. v. Aktia (Reisch). 137 RE II 2 (1896) 1559 s. v. Asia (Brandis).
162 H. İşkan
Hadrians geschmückt«138. Die Hauptstadt der Hadrianeia ist Ephesos gewesen.139 Auch in Anazarbos, Kyzikos, Smyrna und Tarsos sind Hadrianeia Olympia gefeiert worden.140 Die letz-te Preiskrone bezieht sich auf einen Agon in Kaisareia (Caesarea) in Kappadokien.
Auf dem Sarkophag ist jede Preiskrone unterschiedlich gestaltet. Robert verweist darauf, daß »die Preiskronen der einzelnen Spiele ihr unverkennbares Bildmuster hatten. Die Aktia in Nikopolis z. B. Rosen, die Pythien Äpfel, die Sebasteia in Pergamon Eichenlaub, die sidetischen Agone Granatäpfel und die Chrysantina in Sardeis Blumen«141. Es ist jedoch sicher ein noch langer Weg, bis alle in Frage kommenden Denkmälergattungen, zumindest in einigen für die dieses Thema wichtigen Städten, auf das Problem der Bestimmung von Preiskronen hin unter-sucht sind.142 Einige Vorschläge seien hier jedoch trotzdem erlaubt, die sich allerdings nur auf die numismatischen Untersuchungen von Leschhorn gründen, da eine ähnliche Dokumentation zu Inschriften agonistischen Inhalts m. W. nicht vorliegt. Für den Agon Olympia können Perga-mon143, Tarsos144 oder eher Tralleis145 vorgeschlagen werden. Side kommt für den pythischen Agon nicht in Frage, da dort Spiele unter dem Namen Pythia erst ab dem Jahr 243 n. Chr. belegt sind.146 Ankyra und vor allem Hierapolis würden sich dafür anbieten, denn für die Pythia in Hierapolis wurde ja der große Theaterfries mit der Darstellung der severischen Kaiserfamilie geschaffen.147 Die kapitolinischen Spiele sind in Kleinasien in dieser Zeit numismatisch nicht belegt. Entweder muß es sich dabei um ein Spiel in den oben genannten syrischen Städten handeln, oder um die Chrysantina in Sardeis, die auf einer Gemme aus der Zeit des Pertinax wohl als Kapetoleina Chrysantina Helvia belegt sind (Taf. 44, 5)148. In Hierapolis wurden auch die Aktien gefeiert.149 Die Spiele Koina Asias wurden in Laodikeia am Lykos und Smyrna ge-halten. Für die Hadrianeia kommt schließlich Ephesos in Betracht.
138 W. Leschhorn, Stadion 24,1,1998,36. Aber ebenda, »die Gründung oder Aufwertung von Agonen unter Hadrian wirkte sich auf den Münzen noch nicht sogleich aus. Hadrianeia werden sogar erst im dritten Jahrhundert auf Münzen erwähnt«, s. dazu auch RE VII 2 (1912) 2165 s. v. Hadrianeia (Stengel). 139 Lämmer a. O. 39. 140 Ebenda Anm. 15. 141 L. Robert, A travers l'Asie Mineure (1980) 431. s. dagegen D. O. A. Klose, JNG 47, 1997,40: »Oft - und sogar in der Mehrzahl der Fälle - werden die Kränze und Kronen der verschiedenen Feste nicht individuell charakteri-siert, sondern es erscheinen für alle die gleichen standartisierten Formen«. 142 Erst die Zusammenfassung des archäologischen, numismatischen und inschriftlichen Materials schafft ein gesi-chertes Bild der kaiserzeitlichen Agonistik, wie auch Leschhorn a. 0 . betont. 143 P. Wolters, Zu griechischen Agonen, 30. Programm d. Kunstgeschichtlichen Museums der Universität Würz-burg (1901) 14 Abb. 13. 144 Ziegler 22 ff. Taf. 1,5. 145 Tralleis käme nicht nur wegen der geographischen Nähe eher in Betracht, sondern auch deswegen, weil dort die Olympien eine lange Tradition zu haben scheinen. Es gab zahlreiche Inschriften zu den 62. Olympien in Tralleis, s. dazu F. B. Poljakov, Die Inschriften von Tralleis und Nysa, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 36, 1 (1989) 130 ff. Die Datierungsfragen der Olympia in Tralleis wurden von L. Robert, Etudes Anatoliennes (1937) 420 ff. und ders., Opera Minora Selecta I (1957) 646 ff. eingehend behandelt. 146 s. dazu hier Anm. 118. 147 Die geographische Nähe ist auch hier von Vorteil, P. Frisch, Die Inschriften von Ilion, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 3 (1975) 227 f. Nr. 125: »Der Athlet Pergamos ... hat vor allem Siege in nicht weit entfernten Städten errungen«. 148 Salzmann 96 Abb. 23; Rumscheid 83. 149 BMC Greek Coins, Phrygia 239 Nr. 71 Taf. 30, 7.
Ein Siegersarkophag aus Patara 163
Lucius Septimius Theronides liefert uns mit seinem Sarkophag ein sehr außergewöhnliches Exemplar, so außergewöhnlich, wie er sich selber auch genannt hat. Das Prädikat 'Paradoxos' ist in Patara noch für einen Ringer in einer anderen Inschrift aus der Zeit des Caracalla belegt. Nach epigraphischer Evidenz scheint der Ringkampf unter den Bürgern von Patara besonders beliebt gewesen zu sein, weswegen diese Disziplin auch für Theronides vorgeschlagen werden kann.150
T a f e l v e r z e i c h n i s (Münzen nicht maßstäblich abgebildet)
Taf. 37, 1 Patara, Areal zwischen Theater und Bouleuterion von Süden (Photo Grabungs-archiv)
Taf. 37 ,2 Patara, justinianische Stützmauer des Bouleuterions, Aufstellungsort des Sar-kophages (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 37 ,3 Patara, Fundlage des Theronides-Sarkophages (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 37 ,4 Die Bestattung im Sarkophag (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 38, 1 Vorderseite des Sarkophages (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 38 ,2 Sarkophag mit der aufgelegten Deckelhälfte (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 38, 3 Vorderseite des Sarkophagdeckels (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 38 ,4 Schmalseite des Sarkophagdeckels (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 39, 1-7 Die Preiskronen des Sarkophages (Photo Grabungsarchiv)
Taf. 40, 1 Münze aus Thyateira, 218-222 n. Chr. (nach Franke 246)
Taf. 40 ,2 Münze aus Nikaia, 177-192 n. Chr. (nach Franke 243)
Taf. 40 ,3 Münze aus Perinthos, 238-244 n. Chr. (nach H. Dressel, ZfNum 24, 1904, 34)
Taf. 40 ,4 Münze aus Nikaia, 177-192 n. Chr. (nach Franke 248)
Taf. 40 ,5 Münze aus Tarsos, 238-244 n. Chr. (nach Ziegler Taf. 1, 6)
Taf. 40 ,6 Münze aus Kremna, 270-275 n. Chr. (nach Franke 242)
Taf. 40 ,7 Grabrelief des Läufers Aneiketos in Mytilene (nach Pfuhl - Möbius I Nr. 107 Taf. 25)
Taf. 40 ,8 Mosaik in der Villa bei Piazza Armerina (nach Rumscheid Taf. 46, 2)
Taf. 40 ,9 Mosaik in der Villa bei Piazza Armerina (nach Rumscheid Taf. 46, 1)
150 Der Ringkampf war in Lykien schon seit der Archaik bekannt und beliebt. Das früheste Beispiel eines Ring-kampfesist auf dem Isinda-Monument erhalten, E. Akurgal, Griechische Reliefs des VI. Jhs. aus Lykien (1941) 86 ff.; M. Özhanli, Adalya 5, 2001 (im Druck). Eine weitere Reliefplatte aus Xanthos stellt ebenfalls ein Ringerpaar dar, E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens (1961) 134 Abb. 86; P. Demargne, Les Piliers funéraires, Fouilles de Xanthos I (1958) 51 ff. Taf. 13. Daß diese Sportart auch für die Ranghöheren von großer Bedeutung war, geht aus dem sog. Inschriftenpfeiler in Xanthos hervor. Dort rühmt sich der Dynast in der griechischen Inschrift dadurch, daß er ein siegreicher Ringer gewesen sei, T. R. Bryce, The Lycians in Literary and Epigraphic Sources (1986) 97 f. s. dazu auch Verf., IstMitt 51, 2001 (im Druck). Der Ringsport versteht sich als uralte Landestradition in Lykien, ist heute noch sehr verbreitet und wird besonders im Spätsommer an mehreren Yayla-Siedlungen als großes Volksfest gefeiert.
164 H. İşkan
Taf. 41 ,1 Hierapolis, Theaterfries (nach T. Ritti, Hierapolis I. Fonti letterarie ed epigraphica [1985] Taf. 2 a)
Taf. 41 .2 Hierapolis, Theaterfries (nach Ritti a. O. Taf. 7 a)
Taf. 41, 3 Side, Altarrelief (nach P. R. Franke - W. Leschhorn - B. Müller - J. Nolle, Side. Münzprägung, Inschriften und Geschichte einer antiken Stadt in der Türkei [1988] 48 Abb. 26)
Taf. 41, 4 Münze aus Side, 244-249 n. Chr. (nach P. Weiß, Chiron 11, 1981, Taf. 27, 5).
Taf. 41 ,5 Münze aus Side, 253-268 n. Chr. (nach Franke - Leschhorn - Müller - Nolle a. O. 49 Abb. 27 c)
Taf. 41 ,6 Side, Nymphäum, Kassettenrelief (nach A. M. Mansel, Side [1978] Abb. 107)
Taf. 42, 1 London British Museum, Lampen-Model (nach Rumscheid Taf. 53, 2)
Taf. 42, 2 Mosaik in der Villa bei Piazza Armerina (nach Rumscheid Taf. 45, 2)
Taf. 42, 3 Kyrene, Grabrelief des Athleten Antonianos (nach Rumscheid Taf. 57, 3)
Taf. 42, 4 Münze aus Hierapolis, 2.-3. Jh. n. Chr. (nach Franke 261)
Taf. 42, 5 Rom, Goldglas aus der Nekropole der Heiligen Agnes (nach Salzmann 199 Abb. 10)
Taf. 42, 6 Mosaik in Baten Ezzamour (nach Rumscheid Taf. 41,2)
Taf. 43, 1 Mosaik in Baten Ezzamour (nach Rumscheid Taf. 41,1)
Taf. 43, 2 Rom, Antiquarium Comunale, Tonlampe (nach Rumscheid Taf. 54, 1)
Taf. 43, 3 Münze aus Pergamon (nach P. Wolters, Zu griechischen Agonen [1901] Abb. 13)
Taf. 43, 4 Hierapolis, Tubicen (nach Rumscheid Taf. 55, 4)
Taf. 43, 5 Berkeley, University of California, Porträtkopf (nach Rumscheid Taf. 58, 4)
Taf. 43, 6 Chatsworth, Athlet (nach Rumscheid Taf. 59, 2)
Taf. 44, 1 Selge, Sarkophag (Photo Archiv des Lykischen Forschungszentrums)
Taf. 44, 2 Side, Nymphäum, Kassettenrelief (nach A. M. Mansel, Side [1978] 102 Abb. 108)
Taf. 44, 3 Münze aus Nikaia, um 188 n. Chr. (nach W. Weiser, Katalog der bithynischen Münzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln I: Nikaia. Papyrologica Coloniensia XI [1983] Taf. 29, 4)
Taf. 44, 4 Izmir, Relief auf der Agora (nach Salzmann 198 Abb. 5)
Taf. 44, 5 St. Petersburg, Gemme (nach Salzmann 202 Abb. 23)
Taf. 44, 6 Münze aus Nikaia, um 203 n. Chr. (nach Weiser a. O. Taf. 29, 10)
Taf. 44, 7 Münze aus Tralleis, 253-260 n. Chr. (nach Franke 245)
Antalya Havva İşkan
INHALT
Vorwort VII
Tuna-Nörling, Yasemin
Attisch-schwarzfigurige Keramik aus Alt-Smyrna (Bayraklı). Addenda 1
Brehm, Oliver
Artemis, Hekate oder Persephone? Überlegungen zur jugendlichen Göttin auf einem spätklassischen Relief aus Kyzikos 25
Schulz, Armin J. P. H.
Die Befestigungsanlage von Alexandreia Troas 33
Schwertheim, Elmar
Statuenbasis für einen Nauarchen in Alexandreia Troas 59
Diler, Adnan The Northern Rock Necropolis of Caunus 63
Hübner, Sabine - Rohde, Dorothea
Germe oder A r — ? En antiker Kurort bei Pergamon 97
Ergeç, Rifat
Neufunde am Westufer des Euphrat 117
Ergeç, Rifat
Doliche in hellenistisch-römischer Zeit 123
Atik, Sema
An Ionic Corner Capital from Alexandria Troas 129
İşık, Fahri
Neue Überlegungen zu einem Sarkophagfragment in Münster 135
İşkan, Havva Ein Siegersarkophag aus Patara 145 Gregarek, Heike - Petzl, Georg
Eine kleinasiatische Landärztin und ihre Kinderschar 165 )
Alpers, Michael - Halfmann, Helmut - van Wickevoort Crommelin, Bernhard
Vom Nutzen epigraphischer Datenbanken Das Hamburger EDV-Projekt 'Lydien' 181
Tafel Verzeichnis 195
Tafeln
Beilage