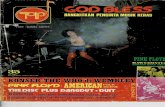Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards "Der Untergeher", in Raul Calzoni / Peter Kofler /...
-
Upload
geo-social -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards "Der Untergeher", in Raul Calzoni / Peter Kofler /...
Sonderdruck aus
Raul Calzoni / Peter Kofler /Valentina Savietto (Hg.)
Intermedialität – Multimedialität
Literatur und Musik in Deutschlandvon 1900 bis heute
Mit 14 Abbildungen
V& R unipress
ISBN 978-3-8471-0498-8ISBN 978-3-8470-0498-1 (E-Book)ISBN 978-3-7370-0498-5 (V& R eLibrary)
Inhalt
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Federica La MannaDas Gänsemännchen von Jakob Wassermann . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Albert GierFranz Schreker (und andere ›ernste‹ Komponisten) und die Operette . . 37
Valentina SaviettoIntermediales Potenzial und musikalisches Pathos. Zu Klaus MannsMusiker-Roman Symphonie Path�tique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Frank WeiherDie literarische ›Wiedergabe‹ fiktiver Musik. Über Adrian LeverkühnsKompositionen im Doktor Faustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Siglind BruhnMing I – Verwundung des Hellen. Die Dichtung von Nelly Sachs inKompositionen von Walter Steffens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Guglielmo GabbiadiniIntermediale Missverständnisse. Franz Fühmann, die Tradition derOperette und das schiefe E.T.A. Hoffmann-Bild in der Spät-DDR . . . . . 119
Micaela LatiniDie Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher . . . . . . . 137
Peter KoflerSemiotische und mediale Verflechtungen in den Theaterstücken vonElfriede Jelinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Raul Calzoni›Moments musicaux‹. W.G. Sebald und die Musik . . . . . . . . . . . . . 167
Gustav-Adolf PogatschniggMusik und Übersetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Die Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Inhalt6
Micaela Latini
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher
I.
Der Untergeher (1983) ist der ausdrücklich der Musik gewidmete Roman Tho-mas Bernhards, der mit Alte Meister, 1985 (den bildenden Künsten gewidmet),und Holzfällen, 1984 (dem Theater), eine Art Trilogie der Künste bildet.1 Eshandelt sich um einen teilweise autobiographischen Roman, eine Art Verflech-tung aus Dichtung und Wahrheit. In der Wirklichkeit besuchte Bernhard von1955 bis 1957 die berühmte Salzburger Musikhochschule, das Mozarteum, trafaber Glenn Gould, das Vorbild des Protagonisten des Romans Der Untergeher,niemals persönlich. Tatsächlich war der kanadische Klavierspieler nur anlässlichzweier Konzerte, am 10. August 1958 und am 25. August 1959, in Salzburg, dasheißt nach dem Besuch Bernhards und außerhalb der in der Erzählung ange-gebenen Zeitspanne.2 Aber sein plötzlicher Tod muss den Anstoß für den Romangegeben haben. Und in der Tat geht aus den Seiten von Der Untergeher einbesonderes Charakterbild Glenn Goulds hervor, eher nach der Silhouette desberühmten Klavierspielers geschildert – das heißt nach der Legende, nach demMythos – als nach der Wirklichkeit seiner Person,3 und stark charakterisiert vonden typisch bernhardschen Tonalitäten. Es ist kein Zufall, wenn die Kunstfigurdes Glenn bei Bernhard an ein einziges Werk gebunden ist, an seine Interpre-
1 Das ist zum Beispiel, die Theorie von Gregor Hens, Thomas Bernhards Trilogie der Künste. DerUntergeher, Holzfällen, Alte Meister (Camden House: Rochedster, 1999).
2 Vgl. zu diesen Parallelismen: Renate Langer, ›Nachwort‹, in Thomas Bernhard, Der Unter-geher, in Thomas Bernhard Werke, Bd. 6, hrsg. von Renate Langer (Frankfurt am Main:Suhrkamp, 2006), S. 153–188.
3 Zum Klavierspieler Glenn Gould siehe: The Glenn Gould Reader, ed. by Tim Page (Toronto:Lester & Orpen Dennys, 1984) und die Untersuchungen von Katie Hafner, A Romance onThree Legs. Glenn Gould’s Obsessive Quest for the Perfect Piano (New York: Bloomsbury PubPlc, 2008), Michel Schneider, Glenn Gould. Piano solo. Aria et trente variations (Paris: Gal-limard, 1989), Michael Stagemann, Glenn Gould. Leben und Werk (München: Piper, 2007) undOtto Friedrich, Glenn Gould. Eine Biographie (Reinbek: Rowohlt, 1991).
tation der Goldberg Variationen von Johann Sebastian Bach; das heißt, dass derRoman nur einen Aspekt seiner Musik herausgehoben hat.4
Aber gehen wir von einem Brennpunkt aus: Im Mittelpunkt von Der Unter-geher steht die Musik, die par excellence dem Absoluten geweihte und von derNebensächlichkeit des Lebens getrennte Kunst, zumindest nach dem Clich�, dassich in der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts gebildet hat. In dieserLiteraturszene hat die Figur des Musikers eine hervorgehobene Position inne,weil er den Verzicht auf das weltliche Leben für die Kunst darstellt. Genau dasgeschieht im Plot von Bernhards Roman mit dem Musiker Glenn Gould, aberauch, in anderer und nur vorübergehender Form, mit den anderen beidenProtagonisten in Bernhards Roman, Wertheimer, dem Untergeher, und demErzähler-Ich. Die drei Studienkameraden begegnen einander im Unterricht beiVladimir Horowitz5 in Salzburg und binden sich durch eine Art intellektuelleFreundschaft aneinander, indem sie sich mit Haut und Haaren der künstleri-schen Dimension widmen. Eine Art rücksichtsloses Exerzieren am Klavier,voller Selbstdisziplin, unbeugsam, in Einklang mit ihrem Klavierradikalismus.6
In dieser Disziplin sind sie allerdings selbst die Opfer. Für die drei jungenMusiker übersetzt sich diese totalisierende Aktivität in eine klare Trennung vonder Welt, in eine extreme Form der Kunst der Idiosynkrasie und der Isolation.Aber nur Glenn strebt wirklich danach, ganz in die Musik einzutreten. Er istderjenige von den dreien, der sofort als Genie hervorsticht, als Wunderkind, dasnicht nur fähig ist, die anderen beiden, sondern auch den Lehrer zu übertreffen.Und das, weil, mit Worten, die auf Kants Kritik der Urteilskraft (1790) verweisen,seine ästhetische Genialität kein Konzept braucht, nicht den Regeln unterliegt,
4 Vgl. Manfred Mittermayer, ›Ein musikalischer Schriftsteller. Th. Bernhard und die Musik‹, inSprachmusik. Grenzgänge der Literatur, hrsg. von Gerhard Melzer und Paul Pechmann (Wien:Sonderzahl, 2003), S. 63–88, insbesondere S. 67, und Michael P. Olson, ›Thomas Bernhard,Glenn Gould and the Art of Fugue: Contrapuntual Variations in »Der Untergeher«‹, ModernAustrian Literatur, 24, 3–4 (1991), S. 73–83.
5 Vgl. zu Vladimir Horowitz: C. Schonberg, Horowitz. Ein Leben für die Musik (München:Albrecht Knaus, 1992).
6 Vgl. die Studien Gudrun Kuhns zur Musik bei Bernhard: »Ein philosophisch-musikalisch ge-schulter Sänger«. Musikästhetische Überlegungen zur Prosa Thomas Bernhards (Würzburg: Kö-nigshausen & Neumann, 1996), S. 213–223 und Thomas Bernhard. Schallplatten und Noten(Salzburg: Bibliothek der Provinz, 1999). Vgl. hierzu Barbara Diederichs, Musik als Generati-onsprinzip von Literatur. Eine Analyse am Beispiel von Thomas Bernhard ›Der Untergeher‹ (Diss.Giessen 2000), Lisbeth Bloemsaat-Voerknecht, ›Thomas Bernhard und die Musik: Der Unterge-her‹, in Thomas Bernhard. Traditionen und Trabanten, hrsg. von Joachim Hoell und Kai Luehrs-Kaiser (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995), S. 195–206, Lisbeth Bloemsaat-Voer-knecht, Thomas Bernhard und die Musik, (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006), ins-besondere S. 177–226. Vgl. auch Markus Scheffler, Kunsthass im Grunde (Heidelberg: Winter,2007), insbesondere S. 295–316, Axel Diller, Ein literarischer Komponist? Musikalische Strukturenin der späten Prosa Thomas Benrhards, (Heidelberg: Winter, 2011), S. 246–273. In Italien vgl.Thomas Bernhard e la musica, hrsg. von Luigi Reitani (Roma: Carocci, 2006).
Micaela Latini138
sondern sie schafft.7 Das Erzähler-Ich erklärt es folgendermaßen: »WertheimersNatur war der Natur Glenns vollkommen entgegengesetzt […] er hatte eineKunstauffassung, Glenn Gould brauchte keine«.8 Wegen dieser Einzigartigkeitwar es – wie das »Erzähler-Ich« betont – Glenn, der Horowitz zu seinem Lehrergemacht hat, nicht Horowitz, der aus Glenn das Genie gemacht hat: »Glennmachte aus Horowitz in diesen Salzburger Monaten den idealen Lehrer für seinGenie durch sein Genie, dachte ich«.9
Natürlich wird die Figur Glenn Gould von Bernhard, außer anhand seinerPersönlichkeit, auch in perfekter Affinität zu den Protagonisten seiner Romanegeschildert, die sich bemühen, aus ihrem Werk die fremden Elemente zu ent-fernen, sich einen anderen Raum zu erobern, jenen utopischen der Kunst, ge-genüber der Dimension des Lebens.10 Das Erzähler-Ich beschreibt Glenn mit denfolgenden Worten:
Er war der rücksichtsloseste Mensch gegen sich selbst. Er gestattete sich keine Unge-nauigkeit. Nur aus dem Denken entwickelte er seine Rede. Er verabscheute Menschen,die nicht zuende Gedachtes redeten, also verabscheute er beinahe die ganze Menschheit[…] Er kaufte sich das Haus im Wald […] Er und Bach bewohnten dieses Haus inAmerika bis zu seinem Tod. Er war ein Ordnungsfanatiker.11
Aus diesem Grund schließt sich Glenn in eine freiwillige Isolation, in ein Sich-in-sich-selbst-Sammeln, das sich auch in seiner typisch zusammengesunkenenHaltung am Klavier ausdrückt. So liest man, Glenns freiwillige Klausur betref-fend, in Der Untergeher :
7 Laut Kants Kritik der Urteilskraft : »Genie ist die angeborene Gemütsanlage (ingenium),durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt« (§ 46). Es handelt sich um eine Fähigkeit desGemüts, welche auf unerklärbare Art und Weise die Regel hervorbringt. Das Genie istnämlich – erklärt Kant weiter – die Fähigkeit des ästhetischen Gedankens, und damit meintman »diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlasst, ohne dass ihrdoch irgend ein bestimmter Gedanke, d.i. Begriff, adequat sein kann, die folglich keineSprache völlig erreicht und verständlich machen kann« (§ 49). Vgl. dazu Beadley Murray,›Kant on Genius and Arts‹, The British Journal of Aesthetics, 47, 1 (2007), S. 199–214.
8 Bernhard, Der Untergeher, S. 78.9 Ebd., S. 76. Hier erinnert Bernhard an Ludwig Wittgensteins These über den Genius: »Genie
ist das, was macht, dass wir das Talent des Meisters nicht sehen können«, Ludwig Witt-genstein, Vermischte Bemerkungen, in Werkausgabe, Bd. 8, Über Gewissheit und andereWerke, hrsg. von Georg Henrik von Wright (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994), S. 311.
10 Zum Thema der freiwilligen Isolation wird verwiesen auf Renate Fueß, ›Wo hab ich jemalseinen Kontakt haben wollen? Vom Mythos des Einsamen in der Bergwelt und seinem Aus-verkauf‹, Literaturmagazin, 12 (1981), S. 78–92, Juliane Vogel, ›Die Ordnung des Hasses. ZurMisanthropie im Werk Thomas Bernhards‹, in Statt Bernhard, hrsg. von Martin Huber undWendelin Schmidt-Dengler (Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1987),S. 153–169 und Wendelin Schmidt-Dengler, ›Der Verrammelungsfanatiker‹, in Der »Hei-matdichter« Thomas Bernhard, hrsg. von Pia Janke und Ilja Dürhammer (Wien: Holzhausen,1999), S. 157–167.
11 Bernhard, Der Untergeher, S. 24.
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher 139
Er (Glenn) habe sich in seinem Haus verrammelt. Auf lebenslänglich. Den Wunschnach Verrammelung haben wir drei lebenslänglich immer gehabt. Alle drei waren wirdie geborenen Verrammlungsfanatiker, Glenn hatte seinen Verammlugsfanatismus amweitesten vorangetrieben.12
Von den drei Verrammelungsfanatikern wird jedoch Glenn der einzige sein, derwirklich jegliche Verbindung zur Welt kappt, während Wertheimer und Horo-witz, wenn auch auf unterschiedliche Art, dazu verurteilt sind, im Netz derWirklichkeit hängen und gefangen zu bleiben.
II.
Dieses sich Entfernen vom Leben, vom Chaos der Welt, stellt für viele derbernhardschen Figuren den notwendigen, aber nicht zureichenden Zustand fürdas künstlerische Schaffen dar. Im Gegensatz zu vielen bernhardschen Prot-agonisten, die beim krampfhaften Versuch, ihr Vorhaben zu realisieren, schei-tern, gelingt Glenn die Vollendung seiner Kunst. Wie der Protagonist von Kor-rektur (1982), Roithamer, erntet auch Bernhards Glenn den höchsten Erfolg inseiner Kunst, aber die Folgen seines Genies werden für ihn und für die, die ihmam nächsten stehen, tödlich sein. In völliger Isolation entwickelt Glenn Gouldsein Genie, aber auch� in einer Art Kreuzschritt� seinen Tod, und mit ihm, ineinem für die bernhardsche Dynamik typischen Domino-Effekt, den SelbstmordWertheimers. Tatsache ist, dass man, ob Selbstmörder oder nicht, immerSelbstmord begeht, um die Aufgabe des Lebens zu verfolgen. Auch ohneSelbstmord geht man immer dem Tod entgegen, weil man leben will, und des-halb geht man einer Art Selbstmord entgegen, wo der Tod gehegt wird, indemman sich danach sehnt, sein Leben zu korrigieren. Der Untergeher ist also nichtnur Wertheimer, sondern auch Bernhards Glenn, der sich Bach opferte und denGoldbergvariationen seine ganze Energie widmete, seine ganze Existenz. Glennhuldigte dem Tod, indem er seine Kunst vervollkommnete, während WertheimerGlenns Tod nicht ertrug. Er konnte den »Untergang der Götter« nicht dulden.Wie das Erzähler-Ich in Der Untergeher erklärt, war der auslösende Grund fürden Selbstmord Wertheimers nämlich nicht die Tatsache, dass seine geliebteSchwester ihn verlassen hatte, um in die Schweiz zu ziehen, sondern seine Un-fähigkeit zu ertragen, dass Glenn einen Schlaganfall erlitten hatte, als er nun-mehr den Höhepunkt seiner Kunst erreicht hatte. Bei genauer Betrachtung passtdie Definition »Untergeher – Asphaltgeher«, wie der erste Titelvorschlag laute-te,13 oder auch »Mann, der fällt«, um den Titel eines Werkes des amerikanischen
12 Ebd., S. 19. (Hervorhebung im Original, M.L.).13 Ebd., S. 27.
Micaela Latini140
Schriftstellers Don DeLillo14 ins Gedächtnis zu rufen – sowohl zu Wertheimer alsauch zu Glenn, dem Amerikaner, der in Bernhards Fiktion tot neben dem Klavierzu Boden fiel. Auch Glenn scheiterte also, wie sein Leichnam unter jenem In-strument beweist, in das er sich sein Leben lang verwandeln wollte.15 In seinemScheitern jedoch brachte er seine Kunst auf höchstes Niveaus und erwirktedamit die Ewigkeit seines Werkes. Man braucht nur an die Übergänge zu denken,an die das Erzähler-Ich in seinen künstlerischen Darbietungen erinnert, eine Artdreifacher Verwandlung: Tier-Krüppel-schöner Mensch:
Kaum saß er am Klavier, war er auch schon in sich zusammengesunken gewesen,dachte ich, er sah dann aus wie ein Tier, bei näherer Betrachtung wie ein Krüppel. Beinoch näherer Betrachtung aber wie der scharfsinnige, schöne Mensch, der er gewesenwar.16
Um aber die Ausdrücke in Fragen zu verkehren: Auch Wertheimer war auf seineArt ein Klaviervirtuose, und wenn das Schicksal ihn nicht mit Glenn, dem Genie,zusammengeführt hätte, wäre er sicherlich ein exzellenter, vielleicht gar welt-berühmter Klaviervirtuose geworden. Wenn aber Wertheimer die Existenz desGenies Glenn akzeptierte, schaffte er es nicht, dessen Tod zu ertragen, ein of-fensichtliches Zeichen menschlicher Unvollkommenheit. Wie man in Der Un-tergeher lesen kann: »er schämte sich nach Glenns Tod, noch am Leben zu sein,sozusagen das Genie überlebt zu haben, das peinigte ihn das ganze letzte Jahr,wie ich weiß«.17 Angesichts der Perfektion, dem Außerordentlichen gibt es fürThomas Bernhard zwei Antwortmöglichkeiten: die dessen, der sich auflehnt,indem er die menschliche Dimension unterstreicht, und die dessen hingegen,der sich dem Außerordentlichen opfert, im krampfhaften und unsinnigen Ver-such, den Höhepunkt der Kunst zu erreichen.18 Wenn das Erzähler-Ich, nachdemes sich des Genies Glenns bewusst wurde, auf jegliche künstlerischen Ambi-tionen verzichtet, schlägt Wertheimer, da er weder dem Leben noch der KunstForm geben kann, den Weg des Wetteiferns mit dem Genie ein, und, indem er aufseine eigene Natur verzichtet, tritt er in die Gedankenwege des anderen ein und
14 Don DeLillo, ›Counterpoint: Three Movies, a book, and an old photograph‹, Grand Street, 73(2004), S. 36–53.
15 Zum Scheitern des Genies vgl. Anne Thill, Die Kunst, die Komik und das Erzählen im WerkThomas Bernhards. Textinterpretationen und die Entwicklung des Gesamtwerkes (Würz-burg: Königshausen & Neumann, 2011), S. 420–470.
16 Bernhard, Der Untergeher, S. 23.17 Ebd.18 Unter diesem Gesischtpunkt kommt die Position des Untergeher (die Suche nach der per-
fekten Musik) der von Die Macht der Gewohnheit sehr nahe. Vgl. dazu Willy Riemer,›Thomas Bernhard’s Der Untergeher. Newtonian Realities and Deterministic Chaos‹, in ACompanion to the Works of Thomas Bernhard, hrsg. von Matthias Konzett (Camden House:Boye, 2002), S. 209–222 und Gernot Gruber, ›Marginalien zur Musik-Metapher‹, in Der»Heimatdichter« Thomas Bernhard, S. 169–173.
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher 141
löscht so sich selbst aus. Es ist kein Zufall, dass Wertheimer – wie sich das»Erzähler-Ich« erinnert – jegliche Spur seines Buches, einer Art Autobiographie,die den Titel Der Untergeher getragen hätte, löschen wollte:
Ein Buch hätte er veröffentlichen wollen, aber dazu ist es nicht gekommen, weil er seinManuskript immer wieder geändert hat, so oft und so lange geändert, bis von demManuskript nichts mehr dagewesen ist, die Veränderung seines Manuskripts warnichts anderes, als das völlige Zusammenstreichen des Manuskripts, von demschließlich nichts anderes als der Titel Der Untergeher übriggeblieben ist.19
In einer Art Korrektur des Werkes, die auch eine Korrektur des Lebens ist, hatWertheimer Schritt für Schritt an der Selbstauslöschung gearbeitet und sich soden Weg für die endgültige Auslöschung vorbereitet, den Selbstmord: »KeineSpuren hinterlassen, ist ja auch einer seiner Aussprüche. Ist der Freund tot,nageln wir ihn an seinen eigenen Aussprüchen, Äußerungen fest, töten ihn mitseinen eigenen Waffen«.20 Das Wetteifern mit dem Genie, die Anziehungskraftder Vollkommenheit werden fatale Auswirkungen auf Wertheimer haben. Wiedas Hauptmotiv in Thomas Bernhards Alte Meister (1986) zeigt, kann derMensch die Perfektion nicht ertragen, und deshalb geht er unter. In diese töd-liche Falle ist laut dem Erzähler-Ich Wertheimer geraten:
Es gibt ja nichts Entsetzlicheres, als einen Menschen zu sehen, der so großartig ist, dassseine Großartigkeit uns vernichtet und wir diesen Prozeß anschauen und aushaltenund schließlich und endlich auch akzeptieren müssen, während wir tatsächlich nicht aneinen solchen Prozeß glauben, noch lange nicht, bis er uns zur unumstößlichen Tat-sache geworden ist, dachte ich, wenn es zu spät ist für uns.21
Genau das ist Wertheimer passiert, der so von der Nacheiferung des Anderenerdrückt wurde und sich dazu verurteilt hat, der Untergeher zu sein.
III.
Sowohl das »Erzähler-Ich« als auch Wertheimer haben keinerlei Zweifel underkennen in Glenn vorbehaltlos das Genie, das sogar dem Lehrer Horowitzüberlegen ist.22 So liest man im Untergeher : »Und bei Glenn war es von vorn-herein klar, dass er ein Genie ist. Unser amerikanisch-kanadisches Genie«.23 Undnoch:
19 Bernhard, Der Untergeher, S. 50.20 Ebd., S. 51.21 Ebd., S. 75.22 Ebd., S. 31.23 Ebd.
Micaela Latini142
Als wir den Unterricht bei Horowitz beendet hatten, war es klar, daß Glenn schon derbessere Klavierspieler war als Horowitz selbst, plötzlich hatte ich den Eindruck gehabt,Glenn spiele besser als Horowitz und von diesem Augenblick an war Glenn derwichtigste Klaviervirtuose auf der ganzen Welt für mich, so viele Klavierspieler ichauch von diesem Augenblick an hörte, keiner spielte so wie Glenn, selbst Rubinstein,den ich immer geliebt habe, war nicht besser.24
Daher die kristallklare Gewissheit: Niemand ist wie er. Es gibt einen erschüt-ternden, völlig zufälligen Moment (einen kairos), der in der von Bernhard indiesem Roman gezeichneten Geschichte der Musik den endgültigen UntergangWertheimers als Künstler und seinen Eintritt in die Welt des Ehrgeizes dar-stellt.25 Das bedeutet, dass er zwar ein exzellenter Klaviervirtuose wird, nichtaber ein Genie. Dieser verhängnisvolle Augenblick manifestiert sich im Ver-gleich mit dem Klavier spielenden Genie:
Wertheimers Verhängnis war, gerade in dem Augenblick am Zimmer dreiunddreißigdes Mozarteums vorbeigegangen zu sein, in welchem Glenn Gould in diesem Zimmerdie sogenannte Aria spielte. Wertheimer berichtete mir von seinem Erlebnis, daß er,Glenn spielen hörend, vor der Tür des Zimmers dreiunddreißig stehengeblieben sei biszum Ende der Aria (…) 1953 hat Glenn Gould Wertheimer vernichtet.26
Und weiter, in der charakteristischen und wohlbekannten WiederholungskunstBernhards, aus den Erinnerungen des Erzähler-Ichs, das daran denkt, wieschockiert Wertheimer war, als er Glenn spielen sieht und hört: »Wertheimer[…] war stehengeblieben an der Tür, unfähig, sich zu setzten […] hatte dieAugen geschlossen, das sehe ich noch ganz genau, dachte ich, redete nichtsmehr«.27
Dieser Moment bedeutet das Ende der virtuosen Karriere Wertheimers.28 WasBernhard in der Erzählung mit dem Titel Goethe schtirbt (1982) über das GenieGoethe schreibt, passt exakt auch zu Glenn Gould in Der Untergeher. Aus denWorten des bernhardschen Goethe in der literarischen Fiktion der ErzählungGoethe schtirbt: »Was ich dichtete, ist das Größte gewesen zweifellos, aber auchdas, mit welchem ich die deutsche Literatur für ein paar Jahrhunderte gelähmthabe. Ich war, mein lieber (…) ein Lähmer der deutschen Literatur«.28 So lähmtein Der Untergeher das Genie Glenns Wertheimer, den schwächsten der dreiFreunde, indem es ihn in eine Spirale des Ehrgeizes fallen ließ, in einen Nach-eiferungskoller, und von hier in eine Krankheit zum Tode.
24 Ebd., S. 7.25 »Glenn war das Genie, Wertheimer war nichts als Ehrsgeiz […]«, ebd., S. 96.26 Ebd., S. 136–137.27 Ebd., S. 76.28 Thomas Bernard, Goethe schtirbt, in Thomas Bernhard Werke, Bd. 11, hrsg. von Hans Höller,
Martin Huber und Manfred Mittermayer (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), S. 406.
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher 143
Diesbezüglich kommentiert das Erzähler-Ich die zerstörerische Wirkung, diein der Gewalt der Musik liegt:29
Während die Goldbergvariationen doch nur zu dem Zweck komponiert worden sind,die Schlaflosigkeit Leidenden erträglich zu machen, dachte ich, haben sie Wertheimerumgebracht. Zur Gemüthsergetzung waren sie ursprünglich komponiert worden undhaben fast zweihundertfünfzig Jahre danach einen hoffnungslosen Menschen, ebenWertheimer, umgebracht, dachte ich auf dem Weg nach Traich. […] Wäre Wertheimervor achtundzwanzig Jahren nicht am Zimmer dreiunddreißig im ersten Stock desMozarteums vorbeigegangen […] er hätte sich nicht achtundzwanzig Jahre später inZizers bei Chur erhängt […].30
Ab diesem von der Begegnung mit dem Genie dargestellten Wendepunkt be-schließt das Erzähler-Ich, jegliche künstlerischen Ambitionen aufzugeben, seinKlavier der absolut unfähigen und wenig musikbegabten Tochter eines Lehrersaus Altmünster zu schenken und so sein (sündteures) Steinwayklavier zu einemAbstieg dem Ende entgegen zu verurteilen. Das wiederum heißt, die Kunst fürdas Leben sterben zu lassen, dort, wo Glenn das Leben für die Kunst sterben ließ.Wertheimer hingegen macht sich auf einen Weg ohne Rückkehr im Wetteifer mitdem Genie und daher im Verlassen der Kunst des Lebens. Der Lebenskünstler istfür Bernhard jenes menschliche Wesen, das, obwohl es sich im verzweifeltenZustand der Existenz befindet, seine eigene Unabhängigkeit und Freiheit schütztund pflegt. Wie das Erzähler-Ich in Bezug auf Wertheimer behauptet, »wollte [er]Künstler sein, Lebenskünstler genügte ihm nicht«.31 In diesem Sinne versuchteWertheimer sein Leben lang, sich selbst zu entschlüpfen, in seinem Streben nachdem Genie. Jedoch scheitern wir, wie Bernhard betont, »in diesem Versuch,lassen uns immer wieder auf den Kopf schlagen, weil wir nicht einsehen wollen,dass wir uns nicht entschlüpfen können, es sei denn durch den Tod«.32
Eine unterschiedliche Position nimmt das überlebende Erzähler-Ich ein, dasseine Distanz zum gescheiterten Wertheimer bestätigt, nachdem es sich zuvorschon von Glenn distanziert hat:
ich wollte immer ich selbst sein, Wertheimer aber war immer jenen zugehörig, dieständig und lebenslänglich und bis zur fortwährenden Verzweiflung, ein anderer, wiesie immer glauben mussten, Lebensbegünstigter sein wollen.33
29 Vgl. Lutz Koepnick, ›Goldberg und die Folgen. Zur Gewalt der Musik bei Thomas Bernhard‹,Sprachkunst, 23 (1992), S. 267–290.
30 Bernhard, Der Untergeher, S. 137 (Hervorhebungen im Original, M.L.).31 Ebd., S. 93 (Hervorhebung im Original, M.L.).32 Ebd., S. 81.33 Ebd.
Micaela Latini144
Was Wertheimer, der Untergeher, nicht verstehen wollte, kann in folgenderFormel zusammengefasst werden: »Jeder Mensch ist ein einmaliger Mensch,und tatsächlich, für sich gesehen, das größte Kunstwerk aller Zeiten«.34
Aber diese Verweigerung des Lebens selbst hat die Existenz und die KunstGlenn Goulds gekennzeichnet. Im Grunde hat auch er, in einer Gesellschaft, inder die Einzigartigkeit des Einzelnen auf seinen Tauschwert reduziert ist, zu-gunsten des Werks auf das Leben verzichtet und ist also aus der menschlichenHaut geschlüpft, um zum Instrument selbst zu werden, für die Künstlichkeit.
IV.
Im Verlauf der Handlung rekonstruiert das Erzähler-Ich in Bernhards Romandas Untergehen Wertheimers vor dem von ihm erkannten Genie Glenns. ImGegensatz zum Erzähler-Ich ist der Untergeher in die Gedankenabläufe Glennseingetreten, in seinen labyrinthartigen geistigen Aufbau. Bei besserem Hinsehenjedoch wird die Figur des Glenn von Bernhard anhand des Mythos Gould ge-zeichnet, wie in einem Status vorübergehender Perfektion, immer im Schwe-bezustand zwischen Wahnsinn, Genie und Künstlichkeit. Nicht zufällig wird dasGenie an einigen Stellen des Romans als der wichtigste Klaviervirtuose definiert,wie ein von seiner Kunst Besessener und Sklave eines »Klavierradikalismus«.35
Die klassische Verbindung zwischen Genie und Wahnsinn wird von Bernhard anverschiedenen Stellen des Romans aufs Neue behandelt, und erinnert vielleichtan ein zentrales Motiv in der Philosophie Arthur Schopenhauers.36 Man liestzum Beispiel über Glenn: »Er war in der Zwischenzeit der hellsichtigste allerNarren geworden. Er hatte den Gipfel seiner Kunst erreicht und es war nur eineFrage der allerkürzesten Zeit, dass ihn der Gehirnschlag treffen mußte«.37 Und
34 Ebd., S. 83–84.35 Ebd., S. 8.36 Es bezieht sich klarerweise auf die von Arthur Schopenhauer im dritten Buch von Die Welt als
Wille und Vorstellung (1819) über das Genie vorgebrachten Überlegungen, einem Text vonhöchster Wichtigkeit für das Werk Bernhards. Vgl. Stephan Atzert, Schopenhauer undThomas Bernhard. Zur literarischen Verwendung von Philosophie (Freiburg: Rombach,1999), S. 167–182, Martin Huber, ›Vom Wunsch, Klavier zu werden. Zum Spiel mit Ele-menten der Schopenhauerschen Musikphilosophie in Thomas Bernhards Roman »Der Un-tergeher«‹, in Die Musik, das Leben, und der Irrtum. Thomas Bernhard und die Musik, hrsg.von Otto Kolleritsch (Wien-Graz: Universal Edition, 2000), S. 100–110, und Martin Huber,»›Diese Musik möge (…) kein Ende nehmen«. Zur Schopenhauerschen Tönung von Bern-hards Schreiben über Musik‹, in Sprachmusik, S. 107–118. Vgl. auch Reinhild Steingröver,›Der Hellsichtigste aller Narren. Diskurs über das Genie‹, in Thomas Bernhard. Die Zu-richtung des Menschen, hrsg. von Alexander Honold und Markus Joch (Würzburg: Kö-nigshausen & Neumann, 1999), S. 83–91.
37 Bernhard, Der Untergeher, S. 18.
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher 145
weiter : »Manchmal nähern wir uns, nähern uns sogar ganz extrem diesem Ideal,sagte er, und genau dann glauben wir, verrückt zu werden, fast den Wahnsinnerreicht zu haben«.38 Aber in Bernhards Untergeher fällt die Stufe des Wahnsinnsmit dem »Sex Appeal des Anorganischen« zusammen, um einen bekanntenAusdruck Walter Benjamins zu verwenden.39 Wenn Wertheimer sich nämlichdamit quält, Glenn werden zu wollen, steht das von Letzterem verfolgte Zielparadoxerweise genau im Einklang mit seinem gequälten und unversöhnlichenWesen, die Perfektion der Maschine in sich zu erreichen, die Möglichkeit selbst,Fehler zu machen, zu überwinden, über die Natur hinauszugehen. Dieses Dar-überhinausgehen ist die »andere Welt«, in der sowohl die Wahnsinnigen als auchdie Genies leben: eine Art künstliches Paralleluniversum. Diese Dimensionstrebt Glenn an, der in seiner Sehnsucht nach Vollkommenheit ein Klavier hättewerden wollen, ein Instrument, welches das Werk Bachs automatisch und per-fekt ausführt und dabei jene Fehlermöglichkeit vernichtet, die jedoch für diekünstlerische Arbeit notwendig ist. In diesem Sinne wird Glenn von Bernhardals erbitterter Feind der Natur dargestellt:
Die Natur ist gegen mich, sagte Glenn in derselben Anschauungsweise wie ich, der ichauch diesen Satz immer wieder sage, dachte ich […] Unsere Existenz besteht darin,fortwährend gegen die Natur zu sein und gegen die Natur anzugehen, sagte Glenn, solange gegen die Natur anzugehn, bis wir aufgeben, weil die Natur stärker ist als wir, diewir uns zu einem Kunstprodukt gemacht haben aus Übermut. Wir sind ja keineMenschen, wir sind Kunstprodukte, der Klavierspieler ist ein Kunstprodukt, ein wi-derwärtiges […]40
V.
Der Wunsch, »Klavier zu werden« bedeutet, eine Perspektive absoluter Künst-lichkeit umarmen zu wollen, gegenüber jener natürlichen Dimension, die dasgelebte Leben formt. In diesem Sinne ist die von Glenn durchgeführte Handlungbesonders bedeutungsvoll, die Esche (die Natur) umzuschneiden, die ihm vordem Fenster seines Hauses die Sicht verstellte. So wollte Glenn, indem er dieKunst des Umschneidens der geistigen Eschen im höchsten Grade ausübte, seineKunst der Flucht vor der menschlichen Natur vervollkommnen. Einer wesent-lichen Stelle in Der Untergeher vertraut Bernhard das Motiv »Wir sind keineMenschen, wir sind Kunstprodukte« an:
38 Ebd., S. 7439 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, in Gesammelte Schriften, Bd. V.1, hrsg. von Rolf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991), S. 130.40 Bernhard, Der Untergeher, S. 74 (Hervorhebungen im Original, M.L.).
Micaela Latini146
Im Grunde wollen wir Klavier sein, sagte er, nicht Menschen sein, sondern Klavier sein,zeitlebens wollen wir Klavier und nicht Menschen sein, entfliehen dem Menschen, derwir sind, um ganz Klavier zu werden, was aber misslingen muss, woran wir aber nichtglauben wollen, so er. Der ideale Klavierspieler (er sagte niemals Pianist!) ist der, derKlavier sein will, und ich sage mir ja auch jeden Tag, wenn ich aufwache, ich will derSteinway sein, nicht der Mensch, der auf dem Steinway spielt, der Steinway selbst willich sein. Manchmal kommen wir diesem Ideal nahe, sagte er, ganz nahe, dann, wenn wirglauben, schon verrückt zu sein, auf dem Weg quasi in den Wahnsinn, vor welchem wiruns wie vor nichts fürchten […] Lebenslänglich habe ich Angst, zwischen Bach undSteinway zerrieben zu werden, und es kostet mich die größte Anstrengung, dieserFürchterlichkeit zu entgehen, sagte er. Das Ideal wäre, ich wäre der Steinway, ich hätteGlenn Gould nicht notwendig, sagte er, ich könnte, indem ich der Steinway bin, GlennGould vollkommen überflüssig machen.41
Wenn Wertheimer sich verzehrt und zerstört, um dem Genie gleichzukommen,sehnt sich jener hingegen danach, der Steinway selbst zu werden, und so dieGrenzen des Versagens (das heißt des Menschlichen) zu überschreiten. Wie manin Bernhards Theaterstück Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972) über dieProtagonistin liest, die in der Fiktion der Bühne die »Königin der Nacht« ausMozarts Zauberflöte darstellen muss:
ein vollkommen künstlerisches Geschöpfein solcher zu einem vollkommenen künstlerischen Geschöpfein solcher zu einem vollkommenen künstlerischen Geschöpf gerwordenener Men-schenda ja kein Mensch mehr.42
Die weibliche Figur hat sich hier selbst auf einen Unterhaltungsmechanismusreduziert, auf eine Marionette in den Händen der Konsumgesellschaft. Ähnli-ches gilt für Glenn, der sich, indem er Glenn Gould wurde, in eine Kunstma-schine verwandelte, sich in die Künstlichkeit tauchte, in die Unausführbarkeitjeglicher Art von Spontaneität : »Schließlich hätten Menschen wie Glenn sich amEnde zur Kunstmaschine gemacht, hätten mit einem Menschen nichts mehrgemein, erinnerten nur noch selten daran, dachte ich«.43 Die gleiche Dynamikgreift in dem Theaterstück Die Macht der Gewohnheit (1974) ein, wo man lesenkann:
41 Ebd. S. 74f.42 Thomas Bernhard, Der Ignorant und der Wahnsinnige, in Werke, Bd. 15, Dramen I, hrsg. von
Manfred Mittermayer und Jean-Marie Winkler (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004,S. 237). Für eine Analyse dieses Theaterstückes Bernhards, auch im Zusammenhang mit DerUntergeher, vgl. Bloemsaat-Voerknecht, Thomas Bernhard und die Musik, S. 71–127, Thill,Die Kunst, die Komik und das Erzählen im Werk Thomas Bernhards, S. 131–149 undSchmidt-Dengler, ›Der Verrammelungsfanatiker‹, S. 162f.
43 Bernhard, Der Untergeher, S. 83.
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher 147
Durch diese Türkommen Ihre Opfer hereinHerr CaribaldiIhre InstrumenteHerr CaribaldiNicht MenschenInstrumente.44
In der bernhardschen Figur Glenn verkörpert sich eines der Paradoxe der WerkeBernhards: der Wunsch nach einer intellektuellen und künstlerischen Voll-kommenheit ist so stark, dass seine Resultate pathologisch sind, deformiert,pervers, bis sie den Zusammenbruch der Kunst selbst bewirken. Ebenso liestman in Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972): »Das Genie ist eine Krank-heit«.45 Der von Bernhard in Der Untergeher beschriebene, fehlgeschlageneVersuch zur Künstlichkeit überzugehen, steht einem zentralen Motiv von KafkasErzählung In der Strafkolonie (1914) nahe, in dem klar ausgedrückt wird, wie derWunsch, eins zu werden mit der eigenen Schöpfung, immer gebieterischer wird.Das Thema wird von Bernhard in Frost (1963) erneut behandelt:
Wie das Gehirn plötzlich nur mehr Maschine ist, wie es noch einmal alles exakt her-unterhämmert, womit es Stunden und Tage, ja Wochen vorher geschlagen, malträtiertworden ist […] Als zöge ein zwergenhafter Diktator, unsichtbar, wenigstens für denMenschen unnahbar, an einem ungeheueren Mechanismus, der alles und alles in Gangsetzt, in fürchterlicher verheerender Lärmentwicklung, gegen die man aber nichtvorgehen kann.46
Kafkas Bild des unsichtbaren, zwergenhaften Diktators ist die perfekte Antwortauf die Erbarmungslosigkeit und Ungeheuerlichkeit, die Glenn in seinem Kampfgegen die Natur verwendet, um reine Künstlichkeit zu werden. Aber das Genie,das wohl verzweifelt versucht, den Fehler, die Natur, zu bekämpfen, mussschließlich unter dem Gewicht der Natur selbst untergehen, da er in die Sack-gasse der Künstlichkeit geraten ist. So lässt Bernhard das Erzähler-Ich des Ro-mans sagen:
Das ganze Leben laufen wir dem Dilettantismus davon und er holt uns immer wiederein, dachte ich und wir wünschen nichts mit einer größern Intensität, als dem Dilet-tantismus zu entkommen lebenslänglich, und sind immer wieder von ihm eingeholt.47
44 Thomas Bernard, Die Macht der Gewohnheit, in Werke, Bd. 16, Dramen II, hrsg. von ManfredMittermayer und Jean-Marie Winkler (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005), S. 28.
45 Bernard, Der Ignorant und der Wahnsinnige, S. 275. Vgl. Mark M. Anderson, ›The Theater ofBernhard’s Prose‹, in A Companion to the Works of Thomas Bernhard, hrsg. von MatthiasKonzett (Woodbridge: Boydell & Brewder, 2002), S. 119–133.
46 Thomas Bernard, Frost, in Werke, Bd. 1, hrsg. von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), S. 309f.
47 Bernhard, Der Untergeher, S. 69.
Micaela Latini148
Der Dilettantismus hat hier mit der Möglichkeit zum Fehler zu tun, mit diesemfür die Kunst typischen dem Versagen Ausgesetztsein. So wird nicht nur dieNatur geschändet, sondern auch der Geist. Dies liest man in einem wichtigenAbschnitt des Romans:
Die großen Denker haben wir in unsere Bücherkästen gesperrt, aus welchen sie uns,dachte ich, für immer zu Lächerlichkeit verurteilt, anstarren, sagte er, dachte ich […]Tag und Nacht höre ich das Gejammer der großen Denker, die wir in unsere Bücher-kästen gesperrt haben, diese lächerlichen Geistesgrößen als Schrumpköpfe hinter Glas[…] Alle diese Leute haben sich an der Natur vergriffen, sagte er, das Kapitalverbre-chen am Geiste haben sie begangen […] Unsere Bibliotheken sind sozusagen Straf-anstalten, in welche wir unsere Geistesgrößen eingesperrt haben, Kant naturgemäß ineine Einzelzelle wie Nietzsche, wie Schopenhauer, wie Pascal, wie Voltaire, wie Mon-taigne, alle ganz Großen in Einzelzellen, alle andern in Massenzellen, aber alle fürimmer und ewig, mein Lieber, für alle Zeit und in der Unendlichkeit.48
Wenn Wertheimer keine Spuren von sich hinterlassen wollte, aus Angst, zueinem Aphorismus gemacht zu werden, hinterließ Glenn hingegen eine genialeInterpretation von Bach, die ihn de facto unsterblich machte und gleichzeitig dieSterblichkeit des Anderen hervorhebt:
Glenns Goldbergvariationen hatte ich mir übrigens vor meiner Abreise nach Chur inmeiner Wiener Wohnung angehört, immer wieder von vorne. War währenddessenimmer wieder von meinem Fauteuil aufgestanden und in meinem Arbeitszimmer auf-und abgegangen in der Vorstellung, Glenn spielte die Goldbergvariationen tatsächlichin meiner Wohnung, ich versuchte während meines Hinundhergehens herauszufinden,worin der Unterschied besteht zwischen der Interpretation auf diesen Platten, und derInterpretation achtundzwanzig Jahre vorher unter den Ohren von Horowitz und uns,also Wertheimer und mir, im Mozarteum. Ich stellte keinen Unterschied fest […] ichhörte ihn die Goldbergvariationen spielen und dachte, dass er geglaubt hat, sich mitdieser Interpretation unsterblich gemacht zu haben, möglicherweise ist ihm das auchgelungen.49
Wir nähern uns so einem Brennpunkt des Romans, und zwar dem Schluss. Nachdem Tod Wertheimers begibt sich das Erzähler-Ich nach Traich, auf WertheimersLandgut, und entdeckt hier dank den Erzählungen des Hausknechtes Franz, dassder verstorbene Freund in den Tagen unmittelbar vor der Abfahrt nach Churund dem Selbstmord in den Sälen seines Wohnsitzes ein Fest veranstaltet hatte,zu dem er alle seine Freunde von auswärts eingeladen hatte. Aber bei diesem Festfür seinen (nicht kundgetanen) Abschied hatte er völlig falsch Klavier gespielt,auf einem verstimmten Klavier. Wertheimer hatte nämlich für den Anlass einInstrument für Dilettanten nach Traich bringen lassen, ein Ehrbar-Klavier ohne
48 Ebd., S. 62.49 Ebd., S. 56 (Hervorhebungen im Original, M.L.).
Die Gewalt der Musik. Zu Thomas Bernhards Der Untergeher 149
jeglichen Wert, und auf diesem Instrument hatte er Bach und Händel gespielt,indem er einen äußerst unangenehmen Lärm hervorbrachte, der alle in dieFlucht schlug. Wie aus den letzten Seiten des Romans hervorgeht: »einen völligwertlosen, einen entsetzlich verstimmten Flügel […], ein völlig wertloses In-strument, ein entsetzlich verstimmtes Instrument«.50 Die HandlungsweiseWertheimers versteht man nur, wenn sie als Ausdruck extremer Konsequenzinterpretiert wird: er wollte seine eigene Natur als Untergeher radikalisieren,sein eigenes Versagen, indem er es bis zu den extremsten Folgen steigerte undseine Kunst mit der Hilfe des verstimmten Klaviers zugrunde richtete. Wie wiram Ende des Romans lesen, wiederholt das Erzähler-Ich genau in diesem Mo-ment eine der letzten Handlungen Wertheimers und wendet sich einer phono-graphischen Wiedergabe von Glenns Goldbergvariationen zu: »Ich bat denFranz, mich für einige Zeit in Wertheimers Zimmer allein zu lassen und legte mirGlenns Goldbergvariationen auf, die ich auf Wertheimers Plattenspieler liegengesehen hatte, der noch offen war«.51
Das, was von so viel Kunst übrigbleibt, ist die technische Reproduzierbarkeit,und in dieser ganz besonderen Lektüre hat Bernhard sicher die Lehre derFrankfurter Schule beerbt.52
50 Ebd., S. 150.51 Ebd.52 Vgl. Elamr Budde, ›Fülle des Wohllauts oder d�cadence im Zeitalter der technischen Re-
produzierbarkeit‹, in Die Musik, das Leben, und der Irrtum, S. 10–20.
Micaela Latini150