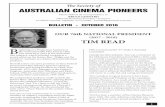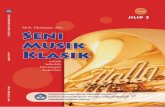Musik - CINEMA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Musik - CINEMA
! " # $ % & ' (unabhängige Schweizer Filmzeitschrift, 49. Jahrgang
HERAUSGEBERSCHAFT UND REDAKTIONNatalie Böhler, Laura Daniel, Meret Ernst, Flavia Giorgetta,
Veronika Grob, Andreas Maurer, Jan SahliRedaktionsschluss dieser Ausgabe: 1. Dezember 2003
VERLAGSchüren Verlag
Universitätsstrasse 55, D–35037 Marburg
© 2004Die Vervielfältigungsrechte der einzelnen Beiträge liegen bei den jeweiligen AutorInnen, alleRechte an dieser Ausgabe sowie die Rechte an den vorliegenden deutschen Übersetzungen
beim Schüren Verlag, Marburg.
ISBN 3-89472-600-8
ISSN 1010-3627
Umschlagbilder: Mirjam Staub, Zürich und Berlin
Gestaltung: Erik SchüßlerDruck und Verarbeitung: WB-Druck, Rieden
CINEMAerscheint einmal im Jahr.
Abonnements gelten bis auf Widerruf.Bestellung und Kündigung von Abonnements
sind schriftlich zu richten anSchüren Verlag, Universitätsstrasse 55, D–35037 Marburg.
Eine Kündigung hat bis zum 31. Juli des jeweiligen Jahres zu erfolgen.www.cinemabuch.ch
www.schueren-verlag.de
Preis dieser Ausgabe CHF 34.– / EUR 24.–im Abonnement CHF 28.– / EUR 19.–
Veröffentlicht mit Unterstützung des Bundesamts für Kultur.
")*+,-
Editorial 7
Musik
MATTHIAS MICHELMOONAGE DAYDREAM
Eine Projektskizze 10
THOMAS TODETöne stürmen gegen das BildMusikalische Strukturen im Werk von Dziga Vertov 21
FLORIAN KELLERHeavy RotationMTV als narratologische Anstalt 36
LAURA DANIELKomponieren im Akkord?Interview mit Martin Tillmann 47
BARBARA FLÜCKIGERWhere’s the Link?Original und Aufnahme im Zeitalter des digitalen Cut-and-Paste 58
MIRJAM STAUBBerlin, Café Moskau, Golden GateEin Bildessay 70
CHRISTIAN JUNGENBryan Adams’ Mustang im KinoDer Soundtrack und seine Interpreten als Marketinginstrumente 86
PHILIPP BRUNNERCon intimissimo sentimentoDas Gesicht der musizierenden Figur im Film 96
5
RETO BAUMANNUsing the ThingFunktion und Bedeutung der Musik in Car Wash – Ein Fallbeispiel 109
JAN ROHLFGenerieren, nicht collagierenTon-Bild-Korrespondenzen im Kontext zeitgenössischerelektronischer Musik 121
JÜRG ZBINDENThank God It’s Friday oder Saturday Night Fever auf dem Lande 133
CH–Fenster
VINZENZ HEDIGER / ALEXANDRA SCHNEIDERKomische Beamte, vernakuläre StarsZum Phänomen des Filmstars in Deutschschweizer Filmen 136
RETO KROMERFilmrestaurierung in der SchweizEin steiniger Weg 148
WALTER RUGGLEFilmkritik als VermittlungMartin Schaub und der kritische Verstand 152
Filmbrief ...
JESPER ANDERSEN… aus Dänemark: Dänischer Film ist mehr als «Dogma» 156
Index
Kritischer Index der Schweizer Produktion 2002/2003 162
Anhang
Zu den Autorinnen und Autoren 196Anzeigen 199
6
!"#$%&#'(
Es gibt viele Berührungspunkte zwischen Musik und Film. So hielten wir un-sere Augen offen und hörten genauer hin: Es war uns ein Bedürfnis, die man-nigfachen Verbindungen zwischen Klängen und Bildern zu berücksichtigen.Während die Regisseure von Videoclips nach Bildern zur Musik suchen, giltim Kino die Musik oft als blosse Unterstützung der Geschichte, die in Wortund Bild auf der Leinwand zu sehen ist. Vielleicht wurde deshalb die Musikvon der Filmwissenschaft lange Zeit so stiefmütterlich behandelt. Dabei ist dieFilmmusik so alt wie das Kino selbst. Bereits die Filme der Brüder Lumièrewurden von einem Pianisten begleitet. Nicht nur, weil sich das frühe Kino anden Aufführungspraktiken des Theaters und des Variétés orientierte, sondernauch, weil die Musik anfangs dazu diente, das störende Geräusch des Projek-tors zu überdecken.
1981 hat sich ein besonderer Kontext zwischen Musik und Bild einer brei-ten Masse eröffnet: MTV ging auf Sendung. Für die CINEMA-Redaktion ge-hört die Clipkultur zu einem wichtigen visuellen Referenzrahmen, allerdingsbleibt auch eine zwiespältige Haltung bestehen, die so oft die Beziehung vonCinephilen gegenüber der MTV-Kultur prägt. Einerseits waren Videoclips im-mer schon ein Tummelfeld der filmischen Avantgarde, andererseits haftet ih-nen, so wie dem Werbefilm, etwas Anrüchiges an, da sie in erster Linie der Pro-motion der Musikindustrie dienen.
Im zeitgenössischen Filmschaffen verschwimmen die Grenzen zwischen Mu-sik und Film immer mehr. Die Pop- und Rocksoundtracks, die etwa ein Quen-tin Tarantino zu seinen Filmen zusammenstellt, haben nichts mehr mit der die-nenden Funktion der orchestral eingespielten Filmmusik zu tun, wie sie vomklassischen Hollywood geprägt wurde. Überspitzt gesagt, dreht Tarantinovielleicht auch nur Filme, um die Compilations seiner Lieblingssongs zu ver-öffentlichen. Die Marketingoffensive im Bereich des Filmsoundtracks ist all-gemein unübersehbar. Diese Entwicklung zeichnet Christian Jungen in seinemText Bryan Adams’ Mustang im Kino bis hin zur Kreation des Crosspromoti-on-Stars nach. Es ist auffallend, wie viele schauspielernde Sänger und Sänge-rinnen neuerdings unsere Leinwände bevölkern beziehungsweise wie vieleSchauspieler und Schauspielerinnen ihre Gesangstalente entdecken.
Die Stars des klassischen Hollywood-Musicals mussten seit jeher sowohlsingen, spielen wie auch tanzen können. Reto Baumann benutzt in seinem
7
Aufsatz Using the Thing das (weisse) Musical als Folie, um am Beispiel vonMichael Schultz’ Car Wash über die besondere Bedeutung der Musik im so ge-nannten Schwarzen Kino nachzudenken. Er kommt zum Schluss, dass der Ge-brauch der Musik der repetitiven Struktur der Erzählung entspricht, in dersich vielleicht das spezifisch «Schwarze» der schwarzen Populärkultur insge-samt spiegelt.
Musikalische Strukturen sind eben nicht nur auf der Tonspur zu verorten,sondern auch in der Abfolge der Bilder. Untersucht wird dieses Phänomenetwa im Beitrag Töne stürmen gegen das Bild, worin sich Thomas Tode mitden musikalischen Kompositionen von Ton und Bild im Werk von Dziga Ver-tov auseinander setzt. Florian Keller interessiert sich in Heavy Rotation eben-falls für die Wechselwirkung von Bild und Musik, allerdings ist sein Materialgut 70 Jahre jünger. Er kontert eine oft gehörte Kritik an der Ästhetik vonMTV, die in der Clipkultur bloss eine oberflächliche Beschleunigung undZerstückelung sieht und zudem behauptet, dass sie das filmische Erzählen ka-putt mache, mit einer genauen Analyse von ausgewählten Videos. In den Clipsvon Björk, Cibo Matto und Radiohead lässt sich seiner Meinung nach ein gan-zes narratologisches Lexikon finden.
In Con intimissimo sentimento fragt sich Philipp Brunner, wie der künstle-rische Prozess des Musikers und der Musikerin in den zahlreichen fiktionalenund dokumentarischen Künstlerporträts dargestellt wird. Er stellt fest, dassdie manuelle und technische Seite des Vorgangs selten eingesetzt wird, da diesehöchstens ein Fachpublikum interessieren würde, dafür aber das Gesicht dermusizierenden Figur in den Vordergrund rückt, in dem sich die kreativen Pro-zesse regelrecht veräussern.
In gewohnter Manier beschränkt sich CINEMA auch in der aktuellenAusgabe über Musik nicht nur auf den Film und wagt mit Jan Rohlfs BeitragGenerieren, nicht collagieren einen Seitenblick auf die Clubkultur, wo in denletzten Jahren heftig mit dem Zusammenspiel von Musik und Bild experimen-tiert wurde. Mirjam Staub sucht in ihrem Bildessay Berlin, Café Moskau, Gol-den Gate ebenfalls nach den Spuren, die ein Club mit seiner Mischung aus Mu-sik und Licht auf den tanzenden Körpern hinterlässt. Sie schreibt dazu: «DasStroboskop-Licht gibt den Bildern etwas Dramatisches, Aufgeladenes, wie aufeinem nächtlichen Filmset kurz vor dem Showdown. Die Abbildung der Be-wegung funktioniert dabei als eigentliche Umkehrung der Filmprojektion, beiwelcher ganz viele Einzelbilder nacheinander projiziert werden, während sichin meinen Fotografien der Bewegungsablauf durch das Übereinanderlagernder Bilder auffächert.»
David Bowie wusste die Mechanismen der Popkultur auf der Ebene vonBild und Musik besonders kreativ zu nutzen. In seinem Text MOONAGE DAY-DREAM präsentiert Matthias Michel Bowie als Gesamtkunstwerk und zeichnetseinen Werdegang in einer wilden Retro-Futuro-Geschichte von einem etwas
8
anderen Blickpunkt aus nach. In Thank God, It’s Friday oder Saturday NightFever auf dem Lande geht Jürg Zbinden in sich, um seinen ganz persönlichenSoundtrack nachklingen zu lassen, der sein jugendliches Lebensgefühl zwi-schen Kuhstall und Landdisco bestimmte.
Und schliesslich haben uns bei unserem Schwerpunktthema Musik auchKlangkonzeptionen des Mainstream-Kinos interessiert. Barbara Flückiger, diemit Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films ein Standardwerk schuf,erlaubt uns in ihrem Beitrag Where’s the Link? Einblicke in die Produktion derTonspur. Die kritisch-analytischen, experimentellen und literarischen Beiträ-ge werden ergänzt durch ein Interview von Laura Daniel mit dem Cellistenund Filmmusiker Martin Tillmann, das die praktische Seite der Filmmusikpro-duktion im heutigen Hollywood unter die Lupe nimmt.
Der Filmbrief berichtet in diesem Jahr über die neuesten Entwicklungen inder Kinolandschaft Dänemarks jenseits der «Dogma»-Bewegung. Doch auchdie Schweiz kommt nicht zu kurz: Neben dem Überblick über die SchweizerFilmproduktion vom letzten Jahr im Kritischen Index beschäftigen sich imCH-Fenster gleich drei Texte mit dem schweizerischen Filmschaffen. Der Res-taurator Reto Kromer berichtet von den Problemen der Restaurierung undKonservierung von Filmen, kann sich aber auch immer wieder über kleine Er-folge freuen. Vinzenz Hediger und Alexandra Schneider sind in ihrem TextKomische Beamte, vernakuläre Stars der Frage nachgegangen, ob es im neue-ren Schweizer Film auch richtige Stars gibt. Während dies wohl die meistenenergisch bestreiten würden, kommen sie zu anderen Ergebnissen. Ihre The-sen werden denn auch dadurch gestützt, dass die RS-Komödie Achtung, fertig,Charlie! bei Drucklegung gerade zum in der Schweiz erfolgreichsten Film desJahres avanciert war.
Letztes Jahr ist der profilierte Filmpublizist Martin Schaub gestorben, derals ehemaliger Redaktor von CINEMA auch die treibende Kraft bei der Ret-tung und Umwandlung der Quartalszeitschrift in ein Jahrbuch war. WalterRuggle nahm seine Würdigung zum Anlass, über die Aufgabe der Filmkritikzu reflektieren.
Für die RedaktionLaura Daniel und Veronika Grob
9
)*++,-*. )-/,!0
)112*3!45*657!*)
!#894:&%;9<$=<#>>9
Datum: 18. September 1968Dokument: Memo/SYNTHESIS INTERNATIONAL/internKlassifikation: streng vertraulichBetreff: MOONAGE DAYDREAMVerfasst von: Shinya Takabayashi/Marketing Manager POP!, L. A. CAGeht an: Jennifer Roth-Douglas, Presseagentin British Invasion, Lon-
donKopie an: —-
Liebe Jenny,wie versprochen, sende ich dir anbei einige Notizen zum Projekt MOONAGEDAYDREAM. Da der definitive Masterplan auf Anweisung der Konzernlei-tung und aus Gründen, die du dir ohne Weiteres denken kannst, derzeit nochstreng unter Verschluss gehalten werden muss, stelle ich hier bloss die wich-tigsten Fakten, Vorschläge und Auszüge zusammen, um dir einen ungefährenEindruck von der Anlage und dem Planungsstand des Projekts zu vermitteln.
1. Hintergrund: POP!-Songs
«A good pop song is like a short featurefilm directed by the fantasies of the au-dience.»
Vince Wonderwall (27), Rockmusi-ker und Songwriter, Playboy-Interview,Februar 1968
Der POP!-Song ist die Matrix, der Nuklearzustand dessen, was wir die neuePopkultur nennen, und sein auf einen Tonträger gebanntes Format ist leicht zuanalysieren. Er ist zwischen zwei und vier Minuten lang, enthält eine sich min-
10
destens drei Mal wiederholende Ton- oder Klangsequenz, die nach einmaligemHören nachzusingen ist usw. Aber diese Strukturelemente sind ebenso beliebigund austauschbar wie die Interpreten. Sie sind völlig ungeeignet, einen gutenvon einem schlechten Popsong oder generell den Popsong von irgendeiner an-deren Liedform zu unterscheiden. Was den «guten» Popsong ausmacht, ist, dasser ein Bild war, bevor er Musik wurde, und dass dieses Bild wiederum das Kon-densat einer Geschichte ist. Ob es sich dabei um eine erhoffte, erdichtete oder er-lebte Geschichte handelt, ist nicht von Belang; wichtig ist, dass sie trivial undmehrdeutig genug ist, um von möglichst vielen Menschen direkt adaptiert odernachvollzogen werden zu können: dass sie über eine gleichsam «alltagsmythi-sche» Dimension verfügt. Jedenfalls ist es diese mehrschichtige Übersetzungvon der narrativen oder dramatischen über die visuelle zur musikalischen Form,in der sich gute von schlechten Popsongs unterscheiden. Ein Song ist niemalsbesser – bunter, ergreifender, verführerischer, was auch immer – oder schlechterals das Bild, dessen Übersetzung er ist, und die Qualität dieses Bildes hängt di-rekt von derjenigen der Geschichte ab, die es repräsentiert. Das lässt sich leichtan der Resonanz überprüfen, die ein Popsong beim Publikum hervorruft, denndas Publikum vollzieht diesen Übersetzungsvorgang rückwärts, wenn es denSong hört: Die Komposition von Poesie, Melodie, Gesang und Rhythmus evo-ziert gemeinhin zunächst ein Bild, das Bild beginnt sich zu bewegen, verwandeltsich in eine Bildsequenz und damit in ein Erzählfragment, möglicherweise sogarin eine konsistente, in sich geschlossene Erzählung, und ebendiese Verwand-lung, verschlüsselt und konzentriert in einem simplen Stück Vokalmusik, ist es,die das Publikum unmittelbar berührt. Der perfekte Popsong ist eine Botschaft,bei deren Abhören sich die Verwandlung simultan und unvermittelt einstellt,d. h. weder durch einen expliziten Text noch durch eindeutige Klangeffekte ge-leitet, erklärt oder vorweggenommen ist. So steht den Empfängern der grösst-mögliche Spielraum zur Verfügung, das Bild und die darin kodierte Erzählungmitzugestalten, sie mit ihren eigenen Bildern, Geschichten, Erinnerungen, As-soziationen anzureichern und zu verweben. Genau dadurch kommt diese eigen-tümliche, überaus intime, leidenschaftliche und unauflösliche Bindung zwi-schen dem Popsong und seiner Hörerschaft zu Stande.
Damit ist auch klar, worin sich das Liedgut der Nachkriegspopkultur vonfrüheren Liedformen unterscheidet: Der Popsong ist untrennbar und auf viel-fältigste Weise mit der Bild- und Erzählkultur seiner Zeit verknüpft, insbeson-dere mit deren Medien und Reproduktionstechniken – Film, Fernsehen, De-sign, Elektronik, Informationstechnologie usw. Der buchstäblich grenzenloseErfolg des Projekts POP!, zumindest was die Produktion und die Vermark-tung unserer Erzeugnisse betrifft, basiert wesentlich auf der konsequentenstrategischen Nutzung und Exploration ebendieser Zusammenhänge sowieauf der entsprechenden Auswahl und visuellen Gestaltung der Interpreten undihrer Erscheinung im öffentlichen Raum.
11
2. Ausgangslage
Dass Popmusik wesentlich ein visuelles Phänomen ist – eine Frage der looks undimages, motions und attitudes, oder, im oben genannten Sinn, ein Phänomen deraudiovisuellen Sinn- und Emotionsverschaltung –, haben Publikum und Produ-zenten rasch begriffen, es war ja bereits beim jungen Elvis offensichtlich genug,und dadurch sind wir unter enormen Innovationsdruck geraten, um die Maschi-ne am Laufen halten zu können. Zuerst haben wir die Popstars in eigens dafürkonzipierten Fernsehshows und in Spielfilmen (The Girl Can’t Help It, die Elvis-Filme und all der Ramsch) auftreten lassen, dann haben wir die Musik und dieStars selbst zum Gegenstand von Filmproduktionen gemacht (A Hard Day’s Night,Don’t Look Back oder, als jüngstes und fortgeschrittenstes Beispiel, Yellow Sub-marine, in dem die fiktiven Figuren und Erzählfragmente aus den Songs direktin Zeichentrickfilmsequenzen übersetzt werden), und schliesslich haben wir dasFormat der Promotionsfilme für Single-A-Seiten entwickelt, die von den Beatlesan die Fernsehstationen in aller Welt verschickt werden, seit sie vor zwei Jahrenmit ihren Live-Auftritten aufgehört und Stücke einzuspielen begonnen haben, dieausserhalb des Tonstudios gar nicht mehr reproduzierbar sind (ein Format übri-gens, dessen langfristiges kommerzielles Potenzial ich besonders hoch einschätze).Inzwischen werden Plattenhüllen von Künstlern gestaltet und vertonte Film-skripts in Vinyl gepresst (She’s Leaving Home), Rockkonzerte zu Multimedia-Shows erweitert (wie bei Pink Floyd, Grateful Dead oder Warhols Velvet Un-derground), ganze Filmsoundtracks aus Popmusik zusammengesetzt, und ge-wisse, so genannt epische Popsongs sind gerade noch kurz genug, dass sie auf eineLangspielplatte passen (In Held Twas In I). The Who werden nächstes Jahr aufeinem Doppelalbum die erste kompakte Rockoper herausbringen. Mit anderenWorten: Auch die erzählerische und dramaturgische Dimension der Popmusikist dabei, in die Ausdrücklichkeit gezerrt, bis in die letzten Winkel ausgelotet undoffen gelegt zu werden. Was das für uns und den weiteren Planungshorizont desProjekts POP! bedeutet, ist derzeit schwierig abzuschätzen, aber ohne Zweifelbesteht dringender Handlungsbedarf. Insbesondere geht es darum, sofort reali-sierbare Konzepte zu entwickeln für eine nachhaltige Expansion in sämtliche mas-senmedialen, technologischen und künstlerischen Tangentialgeschäftsbereiche.
3. Grundkonzept und bisheriger Projektverlauf
In diesem Zusammenhang hat unsere Abteilung bereits vor Jahresfrist einenEntwurf für ein auf mehrere Folgen angelegtes Spielfilmprojekt ausgearbeitet,mittels dessen eine massenwirksame, transmediale Implementierung des POP!-Basiszeichensatzes beiderseits des Atlantiks auf mehrere Jahre hinaus vorange-trieben und kontrolliert werden könnte. Im Zentrum der Filmhandlung steht
12
ein fiktiver Rockmusiker, der von Folge zu Folge seine Identität und seine musi-kalische Stilrichtung ändert, um unsere jeweils neusten Stilkreationen und -strö-mungen zu lancieren. Diese persönlichen und stilistischen Metamorphosen solleneinerseits subtil und fliessend genug sein, um – im Rhythmus von einem, maxi-mal zwei Jahren – eine konsistente Dramaturgie und einen lückenlosen marke-tingstrategischen Ablauf von einer Folge zur nächsten zu gewährleisten; gleich-zeitig aber auch drastisch genug, dass jede Rolle, in die der Protagonist schlüpft,dem Publikum radikal neu und unvorhersehbar erscheint. Obwohl das Projektseriell aufgebaut ist, bildet jede Folge ein vollständiges, in sich geschlossenesNarrativ, flankiert von jeweils mindestens zwei Singles, einem Promotionsfilm,einem Langspielalbum, einer dramatisch gestalteten und inszenierten Bühnen-show sowie einer lose assoziierten Kollektion von Accessoires und Lifestyle-Artikeln in den Bereichen Raum-, Textil-, Mode-, Körper- und Gebrauchsde-sign. Sowohl über die gesamte Produktpalette hinweg als auch von Episode zuEpisode ist zwar eine ästhetische Kontinuität, mithin ein unmittelbarer Wieder-erkennungseffekt anzustreben, aber der Eindruck einer grossräumig geplantenMarketingkampagne muss dabei mit allen Mitteln vermieden werden. Das Pro-jekt zielt nicht auf eine kurzfristige Umsatzsteigerung, sondern auf eine langfris-tige Institutionalisierung und Automatisierung künstlerischer Innovation ab: Eskann prinzipiell beliebig lange weitergeführt werden, wenn es erst einmal instal-liert ist. Die im Konzernleitprogramm («Ästhetisierung der Gegenwart») fest-geschriebenen drei Kardinalfunktionen sind demnach bedingungslos zur An-wendung zu bringen: «Kontinuität» – «Infinität» – «Simultaneität».
Der Projektentwurf wurde der Konzernleitung von SYNTHESIS INTER-NATIONAL am 7. Januar 1968 vorgelegt und von dieser ohne Vorbehalte geneh-migt. Mit der Genehmigung verbunden waren der Auftrag für das Erstellen einesMasterplans und eines Rahmenbudgets über fünf Jahre sowie für erste Verhand-lungen mit allfälligen Projektpartnern unter strikter Geheimhaltung des Gesamt-konzepts bis zum 2. August 1968. Im Weiteren erging die Anweisung, den offiziel-len Projektstart, wenn irgendwie möglich, bereits für den Frühsommer 1969 zuplanen und Publicity strategisch mit der Mondlandung der Nasa zu verknüpfen,die voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt stattfinden wird. Unter diesem Gesichts-punkt hat das Projekt den Arbeitstitel MOONAGE DAYDREAM erhalten.
Masterplan und Budgetierung wurden fristgerecht fertig gestellt. Die ver-anschlagten Investitionen sind erwartungsgemäss exorbitant, aber da die Lauf-zeit des Projekts grundsätzlich unbeschränkt ist, hat die Konzernleitung unse-ren Plänen auch in dieser erweiterten Form zugestimmt, die gegenüber derRohfassung vom vergangenen Januar einige entscheidende, nachfolgend unter4. erwähnte Modifikationen und Aktualisierungen enthält. Unsere Abteilungist mit der Koordination und Durchführung von MOONAGE DAYDREAMbetraut worden. Die Vorbereitungen für den Projektstart im kommendenSommer sind unverzüglich angelaufen.
13
4. Wichtigste Modifikationen
?@A@
Die Konzernleitung hat ursprünglich darauf bestanden, dass MOONAGEDAYDREAM von den USA aus auf den Weg gebracht werden und der Prota-gonist folglich Amerikaner sein soll. Gestützt auf komplexe Prognosemodelleund umfassende Vergleichsstudien zum derzeitigen innovativen, experimen-tellen und intellektuellen Potenzial der britischen und der amerikanischenRockmusik, vor allem aber aufgrund des Arguments, dass der dramaturgischeWert der «Eroberung» Amerikas durch einen Europäer denjenigen in umge-kehrter Richtung bei Weitem übersteigt, hat sich schliesslich die Überzeugungdurchgesetzt, dass die Hauptfigur aus England, nächstliegend aus Londonstammen muss.
?@B@
Am 1. April dieses Jahres fand in New York die Kritikerpremiere von StanleyKubricks 2001 – A Space Odyssey statt. (Ich nehme an, dass du ebenfalls einge-laden warst, habe dich aber nicht angetroffen, weshalb ich davon ausgehe, dassdu den Anlass verpasst hast.) Die Reaktionen waren extrem zwiespältig, ja so-gar vorwiegend negativ, es gab zahlreiche «walkouts», aber mir war sofortklar, dass das «moonage» um ein Jahr vorverschoben worden ist. Der Publi-kumserfolg und die künstlerische Wirkung sind bislang bemerkenswert, derFilm hat in vielerlei Hinsicht neue Massstäbe gesetzt. Wir haben uns daher ent-schieden, 2001 in die Pilotphase von MOONAGE DAYDREAM zu integrie-ren (entsprechende Kooperationsverhandlungen mit Metro-Goldwyn-Mayersind bereits im Gang).
?@C@
Der «impact» der Mondlandung auf die mittelfristige Entwicklung von Designund Popkultur wird in Konjunktion mit 2001 beträchtlich sein. Vor diesemHintergrund ist MOONAGE DAYDREAM als Science-Fiction-Projekt zukonzipieren. Im Lauf der Erarbeitung des Masterplans sind allerdings wohlbe-gründete Zweifel aufgekommen, ob der Spielfilm tatsächlich das geeignetezentrale Medium sei, um welches das Unternehmen organisiert werden soll;zum einen besteht im Moment grosse Unsicherheit darüber, wie weit die Ak-zeptanz eines Massenpublikums gegenüber einer vergleichsweise stark kon-ventionalisierten Form wie dem Spielfilm in den nächsten Jahren noch weiterstrapaziert werden kann, und zum anderen ist zu befürchten, dass die beson-ders aufwändigen Produktionsbedingungen im Filmgeschäft und die damit
14
verbundenen finanziellen, technischen und terminlichen Risiken gelegentlichzu massiven Verzögerungen und Diskontinuitäten innerhalb einzelner Pro-jektphasen führen könnten. Zumal deren zeitliche und räumliche Komplexitätohnehin ungewöhnlich gross und eine perfekte Koordination der Teilprojekteentsprechend schwierig sein wird. Ich habe deshalb vorgeschlagen, MOON-AGE DAYDREAM in die Realität zu verlagern, d. h. nicht um einen fiktiona-len Spielfilm oder irgendein anderes Kunstprodukt herum aufzubauen, son-dern das Projekt in all seinen Facetten, Figuren, Geschichten und Paratexten,an all seinen Haupt- und Nebenschauplätzen tatsächlich stattfinden zu lassen –mit anderen Worten: die Zukunft gewissermassen als Direktübertragung in dieGegenwart zu inszenieren. Was das für unser Unternehmen bedeutet, kannstdu dir wahrscheinlich nicht fantastisch genug vorstellen, und ich muss zuge-ben, dass mich die prompte Zustimmung der Konzernleitung für ein solchesVorhaben doch einigermassen überrascht hat.
5. Der Protagonist
Der Protagonist unserer Geschichte ist ein blonder, bleicher, schwächlicher,überhaupt von der Natur nicht eben mit physischen Vorzügen ausgestatteterJunge aus der englischen Unterschicht, vielleicht mit unregelmässigen Zahnab-ständen oder einer auffälligen Gesichtsverletzung, die er sich unter biografischbedeutsamen Umständen zugezogen haben könnte (z. B. bei einer Schlägereimit einem langjährigen Freund), irgendeine körperliche Unregelmässigkeit,sodass das allmähliche Styling zum Star besonders augenfällig zu inszenierenist. Er ist kurz nach dem Krieg geboren, sagen wir: am 8. Januar 1947 in Lon-don, aufgewachsen in den Stadtteilen Brixton oder Bromley, ein kauziger, aberblitzgescheiter Eigenbrötler, ein trotzig-verschlossener Charakter, ein selbsternannter Rebell und Intellektueller, möglicherweise ein Kunst-, Grafik- oderSchauspielstudent, jedenfalls unwiderstehlich angezogen von jeder Art avant-gardistischer Pose, mit einer gewissen darstellerischen Grundbegabung undfest entschlossen, als Popstar Karriere zu machen. Seinem Milieuwechsel ent-sprechend hat er sich zunächst vielleicht für die Jazz-Szene begeistert und einentsprechendes Musikinstrument spielen gelernt, z. B. Saxofon, bevor er Mitteder Sechzigerjahre im Windschatten der Yardbirds, der Kinks oder der RollingStones seine erste Rhythm-&-Blues-Band gegründet, bei Gelegenheit zu sin-gen angefangen und eine Gitarre zur Hand genommen hat. Er hat einige Auf-lösungen und Neugründungen von Bandformationen hinter sich, alle einiger-massen erfolglos, bevor er beschliesst, sich als Solokünstler zu versuchen,eventuell in wechselnden Kooperationen mit Gleichgesinnten, die er bei sei-nen Streifzügen durch die Clubszene des Swinging London kennen lernt; einereizvolle Variante könnte ein Abstecher in die Folk-Musik sein, den er auch
15
deshalb unternimmt, um sich von seinen Konkurrenten abzuheben. 1967 oder1968 wäre dann der erste Langspielplattenvertrag bei einem kleinen, aber pres-tigeträchtigen Sublabel von Decca oder eines anderen Branchenriesen fällig.Ermuntert durch seinen umtriebigen Produzenten, entwickelt er die Idee füreinen längeren Promotionsfilm zum Album: eine soloschauspielerische Um-setzung der Songtexte, inspiriert durch ein vorübergehendes Engagement ineiner Pantomimentruppe oder etwas Ähnlichem, bei dem er auch das nötigeFlair für den Einsatz androgyner Kostüme und gewisse Schwuchtelallürenmitbekommen haben könnte. Platte und Film – der derzeit favorisierte Titel-vorschlag lautet Love You Till Tuesday – werden natürlich Flops, aber der jun-ge Mann ist jetzt eigentlich reif für den Durchbruch. Sein bürgerlicher Nameist der trivialste, den es gibt, und bestens geeignet, zu unliebsamen Verwechs-lungen zu führen, David Robert Jones beispielsweise, und er hat längst be-schlossen, ihn in einen Künstlernamen zu verwandeln: etwa in David «Bowie»,in Anspielung auf das zweischneidige Jagdmesser ...
(Eine deiner ersten Aufgaben wird darin bestehen, die Idealbesetzung für dieseFigur aufzuspüren; nicht irgendeinen beliebigen Dandy von der Schauspiel-akademie, der den Protagonisten «spielen» kann, sondern einen, der ihn vollund ganz verkörpert, am besten denjenigen, der er ist: unseren David RobertJones höchstpersönlich.)
6. Die Pilotphase
Ich skizziere hier ganz kurz den chronologischen Ablauf der ersten fünf vor-gesehenen Teilprojekte, für die wir zurzeit konkretere Entwürfe ausarbeiten.Obwohl es reale Ereignisse sind, die wir vorbereiten, sind unsere Mitarbeiterangehalten, sämtliche Rohkonzepte in der Form von Filmskripten und -treat-ments abzufassen, damit die ursprünglich intendierte dramaturgische Logikund Struktur des Projekts erhalten bleiben. Ziel dieser Pilotphase ist es, denProtagonisten (ich nenne ihn im Folgenden der Einfachheit halber «David») infünf Jahren weltweit zur massgeblichen Grösse im Popgeschäft aufzubauen,sodass er als POP!-Star künftig auf unbeschränkte Dauer und losgelöst von ei-ner, determiniert realen, Identität in jedes beliebige mediale Format exportier-bar ist. (Es ist mir im Übrigen ein Anliegen, dich und deine Leute möglichstbald in diesen Planungsprozess mit einzubeziehen, um die «britische Perspek-tive» optimal zu integrieren, auf die ihr euch so viel einbildet!)
1969: MAJOR TOM / SPACE ODDITYUnter dem Eindruck von Kubricks 2001 – A Space Odyssey hat David einenSong über einen Astronauten geschrieben, dessen Raumschiff den Kontakt zur
16
Kontrollstation auf der Erde verliert und in der endlosen Tiefe und Einsamkeitdes Alls entschwindet. Das suggestive Erzählfragment hat sich auf poe-tisch-romantische Weise mit Davids Schmerz über die Trennung von seinerGeliebten verknüpft, einer Frau mit einem schillernden Namen wie z. B. Her-mione Farthingale, die mit einem hübschen Profitänzer durchgebrannt ist. DerAstronaut erhält den Namen Major Tom und nimmt die Konturen von Davidserster fiktionaler Identität an. Der Song wird mit Space Oddity betitelt, in per-fekter zeitlicher Abstimmung mit der Mondlandung der Amerikaner heraus-gebracht und zwangsläufig zu einem – wenn auch vergleichsweise bescheide-nen – Single-Erfolg. Das gleichnamige Langspielalbum vertieft sowohl musi-kalisch als auch thematisch die subtile Mischung aus melancholischerSinger/Songwriter-Ästhetik und epischer Exploration von POP!-Mytholo-gien und Psychedelia.
1970/1971: THE MAN WHO SOLD THE WORLD / HUNKY DORYDas nächste Teilprojekt lässt sich zunächst als eine Fortsetzung des Rezeptsvon Space Oddity an, im Stil allerdings etwas härter und hermetischer ausge-führt, nicht zuletzt weil sich David inzwischen eine solide Drei-Mann-Rock-band zusammengestellt hat. Diese Episode bereitet uns vorderhand noch et-was Sorgen, weil sie als Übergangsphase angelegt ist, in der sich der Held überseine künstlerische Orientierung klar werden muss und die daher mit einer ge-wissen erzählerischen Ziellosigkeit verbunden sein wird. Es muss, mit anderenWorten, völlig offen bleiben, wohin die Reise gehen wird, ob ein Durchbruchoder ein totaler Absturz bevorsteht, und dies durchaus im Sinn einer Spiege-lung der allgemeinen Lage in der Popindustrie nach der Euphorie und dem ex-plosionsartigen Wachstum der Sechzigerjahre. Hier liesse sich möglicherweiseeine Heirat mit einer üppigen, extrovertierten Bilderbuchamerikanerin na-mens Betty oder Carol oder Angela einbauen, als Katalysator für spätere sexu-elle Vexierspiele gewissermassen; vielleicht wäre sogar die Geburt eines Soh-nes in Erwägung zu ziehen. Ansonsten ist die Handlung geprägt von Experi-menten mit der Travestie und der bewussten Brüskierung von Publikumser-wartungen sowie vom Erkunden der Grenzen, innerhalb derer Popmusikplan- und konstruierbar ist. (Mit The Man Who Sold the World ist natürlichauf Christus angespielt; die Auseinandersetzung mit Religion und Spirituali-tät, mit deren normativem Potenzial in einer Zeit individueller und kollektiverDesorientierung wird absehbar zu einem virulenten Bestandteil der Popkultur.)
Es geht im Wesentlichen darum, David in kürzester Frist als ernst zu neh-mende Autorität im POP!-Geschäft zu legitimieren. Zum Abschluss dieserÜbergangszeit präsentiert er deshalb eine LP aus einer Perspektive, die souve-räner nicht sein kann: Er konzeptualisiert sich nicht mehr als Beteiligten, son-dern als Kommentator des Geschehens. Die abgeklärten, von einem gewachse-nen Selbstvertrauen zeugenden Stücke repräsentieren Einzelgeschichten, die
17
sorgfältig zu einer umfassenden Zustandsanalyse des Projekts POP! und derJugendkultur der Gegenwart zusammengefügt sind. Sie handeln u. a. von ein-schlägigen Figuren aus der amerikanischen Popmusik, mit denen David inzwi-schen bekannt und vertraut geworden ist: von Andy Warhol, Lou Reed, BobDylan, King Curtis. Der erste Song in dem Zyklus trägt den programmati-schen Titel Changes. Die Band wird vorübergehend durch einen Pianisten er-gänzt, um sie etwas kühler und intellektueller klingen zu lassen. Für diese Pro-jektphase ist es entscheidend, dass ein weitgehend einhelliges Lob der mass-geblichen Musikkritik – insbesondere auch in den USA – durchgesetzt werdenkann; allerdings sollte sich der kommerzielle Erfolg noch in Grenzen halten,um dem Aufstieg zum Superstar in den nächsten zwei Episoden nicht vorabdie Spannung zu entziehen.
1972: THE RISE & FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERSFROM MARSMit diesem Teilprojekt wird MOONAGE DAYDREAM (möglicherweiseein Songtitel auf dem entsprechenden Album) in seiner ganzen Effektivitätlanciert. David schlüpft für ein Jahr in die Rolle von Ziggy Stardust, einerausserirdischen Karikatur des POP!-Superstars. Das musikalische Spektrumverschiebt sich hin zum exaltierten Brachialrock, und der Umschlag der LPwird im Stil eines Science-Fiction- oder Horror-Filmplakats aus den Fünfzi-gerjahren gestaltet. Die Konzerttournee ist mit systematischen Provokatio-nen und Geschmacklosigkeiten anzureichern (einer meiner Mitarbeiter hatvorgeschlagen, die Gigs mit Wagner-Ouvertüren zu eröffnen): eine kompro-misslose Entfesselung der Ausschweifungen und der Personenkulte, die derRock’n’Roll hervorgebracht hat, begleitet von gezielt gestreuten Skandal-meldungen um Ziggy und seine Band The Spiders from Mars, gipfelnd in deröffentlichen Deklaration seiner Homosexualität, wobei die eigentliche Bri-sanz nicht in der Aussage selbst, sondern darin besteht, dass sie nicht «wahr»ist. Der «Aufstieg und Fall» von Ziggy wird gleichsam abgebrannt wie einFeuerwerk. Als Finale findet ein Konzert im Hammersmith Odeon statt, beidem Ziggy vor der letzten Darbietung im Namen der Band verkündet, dassdies ihr letztes Konzert gewesen sei. Der Albtraum endet ebenso plötzlich,wie er begonnen hat.
1973: ALADDIN SANEDer fünfte Projektabschnitt handelt von Davids Eroberung Amerikas und istmit ungefähr einem halben Jahr Verzögerung in das Stardust-Projekt zu inte-grieren. Für den konservativeren US-Markt wird das Ziggy-Konzept etwasmodifiziert werden müssen. Die provokativen Kostüme, Ziggys rot gefärbte,in einem bizarren Bürstenschnitt auftoupierten Haare, die schrille Überzeich-nung der musikalischen Grundelemente des Rock’n’Roll und die transsexuelle
18
Glitzerästhetik sind zwar grundsätzlich beizubehalten (als Genrebegriff sinddie Ausdrücke «Glam-» und «Glitter-Rock» im Gespräch), aber Aladdin Sane(«A lad insane») ist als eine etwas sentimentalere, tragischere und «irdischere»Variante der Ziggy-Figur zu konzipieren, mit etwas mehr Dekadenz und Ma-ke-up. Er ist erwachsen, schwermütig, schizophren, eine Art personifizierterProlog zum Dritten Weltkrieg. Der technischen Perfektion ist von nun anhöchste Priorität einzuräumen, und dies in allen Aspekten des Programms:Mode, Grafik, Klangqualität. Das assoziierte Album und der Promotionsfilmfür die erste Single-Auskoppelung werden unmittelbar vor dem US-Tournee-start in New York aufgenommen. Die Musik klingt wesentlich professioneller,experimenteller, opulenter als zuvor; einmal mehr wäre ein Engagement vir-tuoser Studiomusiker in Erwägung zu ziehen.
1974: 1984/DIAMOND DOGSDavid hat die «pubertären» Phasen des Rockstardaseins in Rekordzeit hintersich gebracht und repräsentiert fortan jederzeit, sowohl künstlerisch als auchtechnologisch, den «state of the art», die ultimative POP!-Avantgarde. Vordiesem Hintergrund und dennoch in nahtloser Fortsetzung der vorangegange-nen Produktionen steht eine POP!-Bearbeitung von George Orwells Roman1984 in Form eines Konzeptalbums und einer theatralisch aufbereiteten Büh-nenshow an, die in technischer und künstlerischer Hinsicht alles bisher Dage-wesene übertreffen soll. David aktualisiert den Stoff mit neuen politischen Be-zügen, eigenen futuristischen Elementen und evtl. mit Reminiszenzen an wei-tere Kubrick-Filme (Gerüchten zufolge plant Stanley nach seinem Napole-on-Projekt eine Verfilmung von Burgess’ A Clockwork Orange). Für Di-amond Dogs nimmt er die Gestalt eines apokalyptischen Mischwesens ausMensch und Tier an, eines Monstrums, in dem die dystopischen Fantasien sei-ner Erzählung inkorporiert sind.
7. Ausblick
Über den weiteren Projektverlauf bestehen derzeit nur sehr vage Vorstellun-gen. Er wird entscheidend von technologischen Innovationen speziell in derMusik- und generell in der Unterhaltungsindustrie abhängen. Neue Instru-mente zur elektronischen Klangerzeugung und -verarbeitung, nicht zuletztaber auch allfällige neue Tonträgersysteme werden in diesem Zusammenhangeine entscheidende Rolle spielen, denn das Projekt lässt sich nur unter der Be-dingung weiterführen, dass David jederzeit die neusten Entwicklungen derPopkultur vorwegzunehmen oder wenigstens entscheidend mitzuprägen inder Lage ist. Wir gehen davon aus, dass 1975 der Zeitpunkt für einen radikale-ren Imagewandel gekommen sein wird. Eine Idee geht dahin, David in die
19
Richtung eines General-Entertainers weiterzuentwickeln, der es sich leistenkann, mehr Fremdeinflüsse in seine Projekte einzubinden (ein entsprechendesStichwort ist «plastic soul», das ich auf einem Tonband mit «studio run-throughs» der Beatles aus dem Jahr 1965 aufgeschnappt habe). Insbesonderesollten wir 1975 auch so weit sein, ihn als Musical-, Theater- (Brecht/Weill unddergleichen) und Filmschauspieler in Grossproduktionen einsetzen zu kön-nen; allerdings nur dann, wenn die Produzenten bereit sind, sich den ästheti-schen und marketingstrategischen Rahmenbedingungen seiner eigenen Pro-jekte bedingungslos unterzuordnen. Als Einstieg in die Filmkarriere denkenwir u. a. an einen Science-Fiction-Film mit dem Titel The Man Who Fell toEarth, der in mehrfacher Hinsicht auf vorangegangene Projektphasen anspieltund sich mit einer weiteren kombinieren liesse, die wir provisorisch für 1976geplant haben und in der für David die Rolle des THIN WHITE DUKE vor-gesehen ist, einer ätherisch-modernistischen Engelsgestalt, «throwing darts inlovers’ eyes». Unser Wunschkandidat für die Regie ist ein junger, heute nochunbekannter Kameramann namens Nicolas Roeg (vielleicht kennst du ihn so-gar; er dreht mit Donald Cammell in London gerade Performance, mit JamesFox, Mick Jagger und Anita Pallenberg in den Hauptrollen). Ich kann mirdurchaus vorstellen, dass Davids Filmografie bis zum Ende des Jahrtausendsnebst etlichen Filmsoundtracks einige Dutzend Auftritte als Darsteller in un-terschiedlichsten Genres umfasst.
Generell planen wir aber für die zweite Hälfte der Siebzigerjahre einenmehrteiligen experimentellen Abstecher in den Bereich der elektronischenMusik, die bis dahin weit genug entwickelt und durchaus POP!-kompatibelgeworden sein dürfte. Bis 1980 soll MOONAGE DAYDREAM dann inso-weit abgeschlossen werden, dass das Projekt «selbst organisiert» und ohnegrössere Investitionen von unserer Seite endlos weiterlaufen kann. Zu diesemZweck wäre es reizvoll, nach zehn Jahren auf Space Oddity und v. a. auf denEinstiegscharakter Major Tom zurückzukommen, ihn für einen Moment auf-erstehen zu lassen und dann in einem mediengerecht inszenierten POP!-Ritualgleichsam zu Grabe zu tragen (als Titel schwebt mir etwas wie ASHES TO AS-HES vor). Dieses Vorgehen würde auch einen idealen Einstieg bieten für eineReihe kommerziell höchst interessanter Reeditionen vergangener Projekte,vielleicht mit zusätzlichem, bis dahin unveröffentlichtem Material. Möglicher-weise bringen wir David eines Tages als ersten POP!-Star an die Börse – und ineinem Anflug von Selbstironie habe ich auch schon daran gedacht, dass wir ir-gendwann in ferner Zukunft auf den Gedanken kommen könnten, eines seinerLangspielalben unter dem Titel REALITY herauszubringen ...
Wie du siehst, haben wir uns für MOONAGE DAYDREAM einiges vor-genommen. Ich bin gespannt auf deine Kommentare und Ergänzungen undmelde mich spätestens in zwei Wochen mit einem ersten Projektauftrag an dieAbteilung British Invasion.
20
!"#$%& !#'(
!)*+,-./01+*,2+2+*,34-,5673
$8-69476-:;+,&.089.80+*,61,<+09,=>*,'?624,@+0.>=
Dziga Vertovs erster Tonfilm, Entusiasm (Enthusiasmus, SU 1930), beginntmit einer Verkehrung von Auge und Ohr. Eine junge Frau vor einem Radio-empfänger setzt einen Kopfhörer auf. Wir sehen nun im Bild, was sie hört: EinDirigent vor einem Radiomikrofon gibt mit dem Taktstock den Einsatz: Kon-trabass, Bassklarinette und ein Metronomticken setzen ein, und auf ein weite-res Zeichen ertönt mit einem Glockenschlag Kirchenmusik nach der Melodievon We Shall Overcome, die schliesslich in eine spöttische Tonkakofonieüberführt wird. Das Bild zeigt zahllose sich bekreuzigende Kirchgänger, im-mer wieder unterschnitten mit der Radiohörerin. Energisch geläutete Glockenin Ton und Bild leiten über zu Gläubigen, die sich vor der Kirche auf den Bo-den werfen, unaufhörlich eine Christusdarstellung und ein Kreuz küssen, un-
21
Abb. 1 Dziga Vertov mit Kamera und Mikrofon (links).
terlegt mit inbrünstigem russischen Chorgesang. Im Wechsel mit der Ekstaseder Gläubigen schneidet Vertov nun mehrfach Wodka trinkende Alkoholikerein, die mit glasigem Blick vor der Kamera taumeln oder ihren Rausch aus-schlafen, unter dem Jammer und Wehklagen ihrer Frauen. Vertov setzt hier ei-nen gängigen Slogan der Zeit in dokumentarische Bilder um: Religion ist Al-kohol für das Volk!1
Die Sequenz war eingeleitet worden durch eine Ansage von Radio Lenin-grad: «Wir senden den Marsch Der letzte Sonntag2 aus dem Film Donbass-Sin-fonie.» Die gesamte Bild-Ton-Folge ist also auch als musikalische Kompositi-on entworfen und besteht aus instrumentalen Tönen und autonomenKlangphänomenen (Glockenläuten, Geschrei, Gesang) – ein früher Vorläufervon Pierre Schaeffers «musique concrète».3 Die erwähnte Donbass-Sinfonie istder Unter- und Arbeitstitel des Films Enthusiasmus. Die junge Frau hört alsoeine Musik-Geräusch-Komposition aus genau dem Film, den wir gerade se-hen. Eine Art Futur-II-Konstellation, ein Futurum exactum, da es die Herstel-lung des Films und seine Auswertung im Radio als vollzogen denkt. Haltenwir hier nur fest, dass diese Ambivalenz zwar nicht die ideologische Aussageder Sequenz abschwächt, aber doch ihre Aussagestruktur thematisiert. Es istwie ein Riss in der Oberfläche des Films, der seine Produziertheit zum Vor-schein bringt.
Vertov schleppte die Tonkamera aus dem schallisolierten Atelier hin zuden Klängen und Geräuschen der Zechen im Donbass-Gebiet und zu antireli-giösen Kundgebungen und schuf so eine «Sinfonie». Das erkannte bei der Pro-jektion des Films in London auch Charlie Chaplin, bis dato ein notorischerTonfilmgegner: «Ich hätte nie gedacht, dass sich industrielle Töne so organisie-ren lassen, dass sie schön erscheinen. Ich halte Enthusiasm für eine der aufre-gendsten Sinfonien, die ich je gehört habe. Mister Dziga Vertov ist ein Musi-ker.»4 Diese Aussage wirft nun hinsichtlich der Schnittstelle Musik und Filmdie Frage auf: Wo beginnt eigentlich Musik? Im Duden wird Musik definiertals die Kunst, «Töne in bestimmter […] Gesetzmässigkeit hinsichtlich Rhyth-mus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistisch
22
Abb. 2 Dziga Vertov bringt das Mikrofonzum Laufen.
eigenständigen Komposition zu ordnen». Diese Töne können auch aus Natur-klängen bestehen. Im Folgenden möchte ich musikalischen Strukturen imWerk Dziga Vertovs nachgehen, die ihren Horizont in seinem ersten Tonfilm,Enthusiasmus, finden. Dieser galt nicht nur Zeitgenossen als Paradebeispiel ei-nes ambitionierten Tonfilms, sondern ruft aufgrund seiner experimentellenRadikalität und der ausserordentlich genau durchdachten Ton-Bild-Verhält-nisse auch heute noch Verblüffung hervor.
Im «Laboratorium des Gehörs»
Die Verkehrung von Auge und Ohr hatte Vertov bereits 1916 in den Arbeitenseines «Laboratorium des Gehörs» praktiziert. Er versuchte, die Klänge einesSägewerks und eines Wasserfalls zunächst mit Worten und dann mit Buchsta-ben wiederzugeben und aufzuzeichnen. Bereits als Schüler hatte er sich fürMusik begeistert und gleichzeitig (Laut-)Gedichte geschrieben. Vertov stu-diert 1912–15 an der Musikschule in Bialystok, beherrscht Geige und Piano. Ersoll – wie seine erste Frau Olga Toom berichtet – komplizierte Etüden vonSkrjabin ab Blatt gespielt haben. 1916 nimmt er ein Studium am Psychoneuro-logischen Institut in Petrograd (St. Petersburg) auf. Der Institutsleiter, Wladi-mir Bechterew, ein renommierter Psychiater und Neurologe, der PawlowsLehre von den «bedingten Reflexen» weiterentwickelt hatte, animiert die Stu-denten zu Versuchen, in denen eigene Verhaltensformen, Gedanken und Re-aktionen beobachtet und protokolliert werden. Vertov experimentiert mit derHörwelt und tauft seine Arbeiten und die Lokalität seines Zimmers «Labora-torium des Gehörs».
Es beginnt mit dem Einsatz eines Trichtergrammofons: «Ich versuchte,einzelne Bruchstücke der Aufzeichnung auf Grammofonplatten in bestimmterForm zu montieren und so neue Werke zu schaffen.»5 Von Beginn an stehtMontage im Mittelpunkt von Vertovs Experimenten. Sein Interesse gilt nichtso sehr den Einzelelementen (in diesem Fall: Gesangs- und Geigenmusik) alsihrer Wechselwirkung. Zugleich nennt er auch ein Kriterium, an dem er sichbei der Vervollkommnung seiner Aufzeichnungsversuche orientiert: die Viel-gestaltigkeit der Welt. «Diese Versuche mit aufgezeichneten Klängen befrie-digten mich nicht. In der Natur hörte ich eine bedeutend grössere Menge ver-schiedenartiger Klänge. [...] Ich beschloss, in den Begriff des ‹Hörens› die ge-samte hörbare Welt einzuschliessen. Auf diese Periode bezieht sich auch meinVersuch, die Klänge eines Sägewerks aufzuzeichnen. [...] Ich versuchte, denHöreindruck von der Fabrik so zu beschreiben, wie sie ein Blinder wahr-nimmt. Am Anfang wurde die Aufzeichnung mit Worten durchgeführt, dochdann machte ich den Versuch, all diese verschiedenen Geräusche mit Buchsta-ben aufzuzeichnen.»6 Aber auch diese lautmalende Reproduktionstechnik
23
führt Vertov nicht zu seinem erklärten Ziel einer nuancenreichen Wiedergabe,vor allem da «das vorhandene Alphabet nicht genügte, um all die Klänge auf-zuzeichnen, die man in einem Sägewerk hört». Frustriert sucht er nach eineranderen Lösung.
Die Umpolung von Ton und Bild in seiner Arbeit schildert Vertov als ein-schneidendes Damaskus-Erlebnis: «Als ich einmal im Kino sass und auf dieLeinwand schaute, wo der Einsturz eines Stollens und andere Ereignisse ge-zeigt wurden, in chronologischer Folge, kam mir in den Kopf, vom Hören aufdas Sehen umzuschalten. Ich urteilte so: Hier existiert ein Apparat, der dieMöglichkeit besitzt, für das Auge diesen Wasserfall aufzuzeichnen, den ich fürdas Gehör nicht aufzeichnen konnte.»7 Wie bereits in seinen frühen Experi-menten ersetzt Vertov schlicht eine Aufzeichnungstechnik durch die andere.Sein Start ins neue Medium Film wird dadurch begünstigt, dass sich sein Ate-lier in Petrograd auf demselben Hof wie das Pathé-Laboratorium befindet. Sokommt er schon 1917 mit der Pathé-Wochenschau in Kontakt und arbeitet zu-sammen mit seinem Freund Michail Kolzow auch an Wochenschauen des sogenannten Skobelewski-Komitees. Jelisaweta Swilowa, Vertovs Frau, hat dieserst kurz vor ihrem Tod preisgegeben,8 hatte Vertov doch bis dato stets be-hauptet, erst im Mai 1918 und damit nach der Oktoberrevolution zum Film ge-kommen zu sein.
An anderer Stelle beschreibt er die zu filmende Bildwelt wie ein Blinder,der sein Hörorgan extrem verfeinert hat: «Einst, im Frühjahr 1918, Rückkehrvom Bahnhof. In den Ohren noch das Ächzen und Stuckern des fahrenden Zu-ges ... irgendwelches Geschimpfe ... einen Kuss ... irgendeinen Ausruf ... La-chen, einen Pfiff, Stimmen, Schläge der Bahnhofsglocke, das Keuchen der Lo-komotive ... Flüstern, Rufe, Abschiedsgrüsse ... und Gedanken beim Laufen:Es muss endlich ein Apparat geschaffen werden, der nichts beschreiben, son-dern diese Töne aufzeichnen, fotografieren wird. [...] Kann es vielleicht eineFilmkamera? Das Sichtbare aufzeichnen ... Das Hörbare ist nicht zu organisie-ren, nur die sichtbare Welt.»9 Wie ein aus zahlreichen Einzelbeobachtungenmontierter Film läuft diese Schilderung einer Bahnhofshalle vor unseren Au-gen ab. Vertovs Auffassung vom Film als Montageprodukt ist nachhaltigdurch seine vorangegangene Tonpraxis geprägt, wie auch Oksana Bulgakowatreffend analysiert: «Es ist der Ton, der ihn auf die Idee der Zerstörung derGanzheitlichkeit der Gestalt und einer neuen Zusammensetzung dieser Ganz-heit in der Montage der Bilder gebracht hat.»10 Ausgiebige Montagepraxis istvor allem als Erfindung des Russenfilms ins Weltkino gelangt. Anfang derZwanzigerjahre gibt es in Russland nur zwei Filmpioniere, die die Montagepraktisch und theoretisch fundieren: Lew Kuleshow und Dziga Vertov.
24
Rhythmus als mathematische Operation
Vertovs erste selbstständige Arbeit, in der die Montage das Primat erhält, istder Bürgerkriegsfilm Boi pod Zarizynom (Die Schlacht bei Zarizyn, 1919). Ineinigen Passagen steigerte er die Anzahl der Bildfelder nach dem Dezimalsys-tem (5, 10, 15, 20),11 sodass die Cutterin die extrem kurzen Stücke zunächst fürAusschuss hielt und sich weigerte, sie zu montieren. Als Schulbeispiel fürrhythmische Montage berühmt geworden ist die Szene des Hissens der Pio-nierfahne aus Kinoglas (siehe Abb. 3). 16 Bildmotive aufgeteilt in 52 Einstel-lungen wechseln einander in weniger als einer Minute ab, häufig nur fürBruchteile von Sekunden. Zugrunde liegt ein Schnittplan, der auf mathemati-schen Zahlenfolgen aufgebaut ist (siehe Abbildung). Er muss wie eine Partiturgelesen werden und steht für die Nähe von Mathematik und Musik: die Mon-tage als mathematische Operation.
Der Rhythmus der Komposition kann visuell wahrgenommen werden.Boris Eichenbaum, ein Zeitgenosse Vertovs aus der Schule der LeningraderFormalisten, präzisiert: «Im zeitgenössischen Film haben wir keinen Rhyth-mus im genauen Sinne des Wortes (wie in der Musik, im Tanz, im Vers), son-dern eine gewisse allgemeine Rhythmizität, die in keinerlei Beziehung zur Fra-
25
Abb. 3 Schnittplan Kinoglas (Filmauge 1924).
ge nach der Musik im Film steht. Zwar kann die Länge der Einstellungen bis zueinem gewissen Grad als Grundlage zur Konstruktion eines Filmrhythmusdienen, aber dies ist eine Sache der Zukunft, über die jetzt nur schwer entschie-den werden kann.»12 Dass Bildzahl und Kadenz der Einstellungsfolge dabeieine Rolle spielen, wird auch aus der etymologischen Ableitung des Wortesdeutlich, denn das griechische «rhythmós» bedeutet «geregelte Bewegung,Zeitmass, Gleichmass». Aber auch für Vertov spielt die Einstellungslängenicht die zentrale Rolle in der Montage, sondern die möglichen Korrelationenbeim Übergang zweier Bilder. Dies beschreibt er erstmals 1923 in seinem Ma-nifest «Wir» mit Hilfe einer so genannten Intervalltheorie. Diese greift auf denmusikalischen Begriff des «Intervalls», dem Abstand zweier aufeinander fol-gender Töne, zurück und zielt nun auf die «Übergänge von einer Bewegungzur anderen», gewissermassen die Harmonie der «zwischenbildlichen Bewe-gung zwischen zwei benachbarten Bildern».13 Erneut wird musikalischer Zu-sammenklang in bildliches Zusammenwirken überführt.
In Kinoglas gibt es auch eine Verkehrung von Klang in Schrift. Vertov be-dient sich «des Verfahrens der Substituierung einer Aufzeichnungstechnikdurch eine andere, indem er die Zwischentitel nicht nur als Schrift und Gra-phik begreift, sondern auch als Klangassoziationen einsetzt, als Aufzeichnungeiner Lautschrift, die Geräusche, Stottern oder einen chinesischen Akzent wie-dergibt. Film ist nur möglich im switch zwischen den Wahrnehmungskanälenund Aufzeichnungstechniken».14 So setzen die Zwischentitel die Sprache deschinesischen Magiers wie folgt um: «Hiel ist ein Kunststück. Schau hiel. Handganz [...] Gleich machen lebendig Maus.» Warum aber interessiert sich Vertovimmer wieder für diese Verkehrung? Die Antwort führt in den Kern seinesVerfahrens: Gerade in der Verkehrung wird der mediale Charakter des Bildesakzentuiert. Die unkonventionelle Verwendung von Schrift (nämlich als Auf-zeichnung von Klang) macht die mediale Produziertheit des Films präsent.Genau dies ist auch die Funktion der Radiohörerin und der Futur-II-Zeitkon-stellation in Entusiasm. Vertov hat ein ganzes Arsenal an Stilmitteln entwi-ckelt, die auf den Filmapparat selber verweisen, das heisst auf die Konstruktiondes Films und seine Produziertheit.
Dieses Verfahren erlernte Vertov – wie Ute Holl kürzlich herausgearbeitethat – in Bechterews Psychoneurologischem Institut: «Das Ideal psychoreflek-torischer Forschung ist die Kombination des subjektiven und des objektivenVersuchsprotokolls: wie ein schriftliches Arbeitsjournal zu gleichzeitigenFilmaufnahmen, oder besser noch, das ‹Tagebuch eines Kameramannes›, dergleichzeitig selbst gefilmt wird, ein Tagebuch, dem ‹Eindrücke auf Zelluloid insechs Rollen› beigefügt sind, wie es präzis im Untertitel des berühmten Tsche-lowek s kinoapparatom von 1929 heisst.»15 Die Parallelmontage der verschie-denen Versuchsprotokolle problematisiert letztlich die Rahmenbedingungender Aufnahmen. Im Film wie im Leben schauen wir stets «unter Bedingun-
26
gen». Alles Sehen und Messen von sozialen Beziehungen unterliegt histori-schen Techniken. Vertov vermittelt uns damit eine radikale Konsequenz, wieHoll scharfsinnig folgert: «Die Wahrheit der Abbildung kann nichts anderessein als die Analyse des Wesens der Technik, durch die sie hergestellt wird.»16
Daher kann Vertov auch von einer «kommunistischen Dechiffrierung desSichtbaren»17 sprechen – eine Formulierung, die impliziert, dass daneben nochandere Dechiffrierungsmöglichkeiten existieren. Es gehört aber zur Definitionder Wahrheit, dass es nur eine einzige gibt und dass sie der Tod jeder Intentionist. Von Menschen zusammengestellte dokumentarische Filmbilder könnenalso niemals die absolute Wahrheit zeigen, sondern stets nur eine Annäherungan sie. Michael Kaufman, Vertovs Bruder und Kameramann, betont, dass es dieAufgabe der Montage ist, eine «Interpretation der Bilder»18 herzustellen (undzwar aus kommunistischer Sicht). Vertovs Verdienst besteht darin, dass er diesauch stets im Film signalisiert hat. Der feine Unterschied zwischen (berechtig-ter) Parteilichkeit und Propaganda entsteht dort, wo ein urteilender Menschhinter der Schilderung zu spüren ist. Gerade das Künstliche und Zusammenge-setzte verweist aber auf die Konstruktion des Films und damit auf die arbeiten-den Menschen hinter dem Werk. Gerade in der (spürbaren) überschwängli-chen Begeisterung für die Errungenschaften der russischen Revolution, dempropagandistischen «Überschuss», legt Vertov offen, dass er die vorgefundenesichtbare Welt interpretiert. Und in der Tat: Vertovs Aufnahmen zeigen, wasWochenschaubilder nicht besitzen, die Vision einer sinnerfüllten Geschichtedes Menschen.
Tönender Film vor Erfindung des Tonfilms
Wie kaum ein anderer Regisseur hat Vertov auch im stummen Film den Tonstets mitgedacht und dies auch in seinen Artikeln immer wieder gefordert. Inseinem Manifest «Kinoki – Umsturz» von 1923 heisst es dazu: «Auge und Ohr.Das Ohr beobachtet nicht heimlich, das Auge belauscht nicht. Teilung derFunktionen. Radio-Ohr – das montagehafte ‹Ich höre!› Kino-Auge – das mon-tagehafte ‹Ich sehe!›»19 Mit dem Plädoyer für ein «montagehaftes ‹Ich höre›»sind Filme gemeint, die das Klangliche allein durch (optische) Montage evozie-ren. Solche Streifen nennt er an gleicher Stelle auch «Radio-Chroniken».20
Vertovs eigene Arbeiten liefern dafür instruktive Beispiele, wie er selbst be-tont: «Schon in Ein Sechstel der Erde wurden die Zwischentitel durch ein kon-trapunktisch gebautes Wort-Radio-Thema ersetzt. Das elfte Jahr ist als sicht-bar-hörbare Filmsache konstruiert, das heisst, montiert nicht nur in visueller,sondern auch in geräuschlicher, klanglicher Beziehung. Ebenso, das heisst inRichtung vom ‹Kinoglas› zum ‹Radioglas›, ist der Mann mit der Kamera ge-baut.»21
27
In Odinnadzaty (Das elfte Jahr, 1928) ruft Vertov die Klänge einer indust-riellen Grossbaustelle am Dnepr visuell ins Bewusstsein: Drei Männer schla-gen im rhythmischen Wechsel mit Hämmern gemeinsam einen Metallbolzenein, der Zwischentitel «Echo» erscheint, gefolgt vom freigelegten Skelett einesSkythenkriegers. Eine Detailaufnahme des versinkenden Bolzens wird demSkythen unterkopiert. Er scheint den ungewohnten Geräuschen zu lauschen.Vertov notiert dazu im Drehtagebuch: «Der Skythe im Grab und der Lärm desAnbruchs einer neuen Zeit. Der Skythe im Grab und der Kameramann Kauf-man, der verwirrt das Objektiv auf die 2000-jährige Stille richtet.»22 Sobald derSkythe als Bild für Schweigen und Lautlosigkeit etabliert ist, montiert Vertoveine rhythmisch getaktete Bildfolge aus hektischem Glockengeläut (alsSprengwarnung), dem stummen Skelett und detonierenden Sprengungen aufder Grossbaustelle.
In Tschelowek s kinoapparatom (Der Mann mit der Kamera, 1928/29) lässtVertov die Klangwelt in einem Arbeiterklub mit Schach spielenden Arbeiternrein visuell erstehen: Aus einem Radiolautsprecher ertönt – wie ein einkopier-ter Akkordeonspieler suggeriert – Musik. Ein dort ebenso einkopiertes Ohrüberblendet zu Klavier spielenden Händen und zu einem singenden Mund.Hierauf folgen Bilder einer improvisierten Geräuschmusik, in der mit Löffelngegen Flaschen, Topfdeckel und Waschbrett geschlagen wird, unterschnittenin immer schnellerer Folge mit lachenden Gesichtern russischer Frauen undMänner. Durch die sich rasant steigernde Schnittfrequenz wird ein musikali-sches Crescendo simuliert, das in ekstatisch tanzenden Schuhen mündet. Manweiss, wie gerne Vertov Ekstase-Motive gefilmt hat (Tänze, Feiern, Verkehrs-chaos, Betrunkene, religiöse Verehrung) – nicht zuletzt, da sie eine eigene in-nere Bewegung besitzen, deren Logik sich durch exzessive Bildmontage dar-stellen lässt.
Filmische Sinfonien
Der Mann mit der Kamera galt der russischen Kritik als «Versuch visuellerMusik, ein visuelles Konzert», und auch der Regisseur selber hatte den Film imExposé als «visuelle Symphonie» betitelt.23 Als Vertov 1929 nach Berlinkommt, wird sein Film in der Presse als fanatischere Fortsetzung der Prinzi-pien von Walter Ruttmanns Berlin, die Sinfonie der Grossstadt (D 1927) be-zeichnet. Vertov reagiert scharf und veröffentlicht mit Hilfe von Siegfried Kra-cauer einen offenen Brief in der Frankfurter Zeitung: «Diese halbe Mutmas-sung, halbe Behauptung ist absurd. [...] Besonders muss herausgestellt werden,dass die meisten ‹filmtauglichen› Filme gebaut waren entweder als Symphonieder Arbeit oder als Symphonie des gesamten Sowjetlandes oder als Symphonieeiner einzelnen Stadt. Dabei verlief die Entwicklung in diesen Filmen häufig
28
vom frühen Morgen bis zum späten Abend.»24 Da Vertov der Spielfilmfabel,den «süss durchfeuchteten Romanzen» den Kampf angesagt hatte, muss er aufandere als narrative Organisationsstrukturen der Bilder zurückgreifen. Eineam Lied oder der Sinfonie orientierte Komposition liegt für den Musikadeptennahe. Doch ist der Begriff Sinfonie hier nicht streng musikalisch zu verstehen,sondern meint letztlich nur – wie bei Ruttmann auch – die Fülle und reichhalti-ge Palette der Einzelheiten, die eindrucksvoll zusammenwirken. Die breite,epische Anlage zeigt sich auch darin, dass dem Film zusätzlich die Struktur ei-nes Tagesablaufs gegeben wurde. Die freie, assoziative Montage funktioniertnur innerhalb starker Strukturen. Diese bestehen bei Vertov häufig aus Gegen-satzpaaren, die sich in der Montage gut konfrontieren lassen, zum Beispiel da-mals und heute, hier und anderswo, Stadt und Land, Ablauf vom Morgen biszum Abend.
Auch Entusiasm, die «Sinfonie des Donbass», funktioniert so. Es ist eineSinfonie der Arbeit, ein Loblied auf die Maloche. Nach dem antireligiösenAuftakt folgt der Sprung ins Donbass-Gebiet, das Ruhrgebiet der Ukraine.Zunächst wird der dortige Arbeitsverzug mit lang gezogenen Sirenentönensignalisiert, einen Notruf morsend. Auf der Radiomembran erscheint immerwieder der einkopierte Schriftzug «Planrückstand», die Zechentürme stehenstill, ein Ruf verkündet das Ende der Kohlevorräte, leere Kisten und in der Be-wegung eingefrorene Transportkörbe machen den Mangel augenfällig. DasPublikum im Kino erfährt auf der Leinwand von den Schwierigkeiten und be-antwortet den Hilferuf des Donbass mit dem gemeinsamen Singen der Inter-nationalen. Diese Klänge entweichen aus dem Kino und begleiten eine zumArbeitseinsatz im Donbass aufbrechende Komsomolzengruppe, die dort inden Arbeitstechniken unterwiesen wird. Der dritte Teil des Films zeigt undfeiert den Erfolg der Gegenoffensive: Nun fliesst die Kohleproduktion wieder,Laufband und Sortiermaschinen kommen in Gang, die Martinöfen dampfen,das Metall verflüssigt sich und die Walzmaschinen pressen wieder Stahlträger.Im Dunkel der Fabriken «jubelt» ein Ballett aus im Zeitraffer gefilmten, glü-henden Eisenträgern.
Das Gegensatzpaar aus Planrückstand und Aufholjagd verleiht dem Filmdie Struktur. Der Rückstand ist der Widerpart, gegen den die einsetzendenAnstrengungen gerichtet sind – ein Kraftakt, der von grossem Pathos gekenn-zeichnet ist: Drei Arbeiter stemmen einen Riesenhammer, unter dessen Schlä-gen Worte wie «Ehrensache» und «Tapferkeit und Heldentum» fallen.25 Unddoch gibt es hier keine individuellen Helden wie im antiken Epos. Selbst jeneStossarbeiter, die durch Synchronaufnahmen ihrer Arbeitsgelöbnisse heraus-gehoben werden, fallen mit voraussehbarer Sicherheit wieder in die Masse zu-rück. Die Menge übernimmt die Funktion eines Chores. Der epische Zug desFilms zeigt sich auch an den wiederholt eingeschnittenen Bildern mit ziehen-den Wolkenformationen: Hier vergeht Zeit, wird der Welten- und Zeitenlauf
29
beschworen. Solche Aufnahmen finden sich nicht in einfachen Reportagen.Dass der Film als Epos konzipiert ist, zeigt sich nicht zuletzt an seinem deut-lich referierenden, beschreibenden Charakter, an dem durch stete Bildwieder-holung erzeugten Gleichmass und an der Einheit von Realem und Idealem. Eshandelt sich hier um ein Epos der Arbeit.
In der Klangwelt des Donbass
Auf dem Höhepunkt der Schilderung kommt es wiederum zu einer Verkeh-rung der Töne und Bilder. Der Klang von Marschmusik, Hurrarufen, Demonst-rationen und Parolen einer Parteikonferenz dringt plötzlich in die Arbeitshal-len des Donbass ein, und umgekehrt fallen die Fabrikgeräusche in die Strassenund Plätze der Städte ein, begleiten die Demonstrationen. Der gezielt herge-stellte Austausch der Töne soll den Kampf gegen den Planrückstand in eine gi-gantische, landesweite Anstrengung zur Übersollerfüllung, eine vorwegge-nommene Stachanow-Bewegung, verwandeln. So zumindest hat der Regisseurseine Intentionen in einer Inhaltsangabe (dem so genannten Autorenlibretto)beschrieben.26 Gerade in dieser Verkehrung lässt Vertov die Absichten seinerDarstellung für den Zuschauer spürbar werden. Es geht ihm darum, eine kol-lektive Mentalität zu stimulieren, nicht um die reportagehafte Beschreibungrealer Verhältnisse. Von jeher beschrieb Vertov nicht eigentlich die Gesell-schaft, wie sie war, sondern wie sie noch werden sollte. In seinen Filmen spürtman stets dieses utopische Vorauseilen. «Enthusiasmus» ist der Titel diesesWerkes, doch könnten alle seine Filme so heissen.
Diese Absicht, das Denken und Fühlen zu beeinflussen, wird ihm dannauch von der sowjetischen Administration zum Vorwurf gemacht. Die Lon-doner Film Society verkündet dies gar im Programm: «In official circles thecomplaint is made that the film has all the faults of capitalist production in mi-nimising difficulties and presenting the way to perfection in too easy a light,that it is rather a hymn in praise of ideal conditions than an examination of theproblems of a difficult situation.» Der Drahtzieher dieser Kampagne und Mei-nungsmacher aus der höchsten politischen Führungsriege ist Karl Radek. Ineiner nach der Moskauer Premiere vom 1.4.1931 publizierten Rezension atta-ckiert er den Film scharf mit Vorwürfen wie Unverständlichkeit der Form,Ton-Kakofonie, unklare Funktion der Radiohörerin, dass Stossarbeiter nur inDefilees und nicht im Einsatz zu sehen seien, der Film keine Begeisterung aus-löse, kurz: «Ein solcher Film ist nur ein Bluff, ist nicht nützlich.»27
Radek hat allerdings eine ganz klare, utilitaristische Vorstellung von derAufgabe der staatlich finanzierten Filmproduktion innerhalb des Fünfjahres-plans: «Der Film soll die zu überwindenden Schwierigkeiten zeigen, die Me-chanismen, mit denen man sie aus dem Weg räumt.» Andere Kritiker stossen
30
ins gleiche Horn: «Stahlgiessen, Koksverbrennung, das Bessemerverfahren –all das ist durcheinander gezeigt, wahrscheinlich wollte Vertov dem Zuschauergar nicht eine genaue Vorstellung von den konkreten Arbeitsprozessen ge-ben.»28 In einer öffentlichen Antwort auf Radek «gesteht» Vertov einige Män-gel seines Films ein. Doch widerborstig wie er ist, nimmt er nicht alle Schuldauf sich: «Diese Mängel erklären sich zu einem bedeutenden Grade aus jenemBruch, der zum Zeitpunkt der Produktion [...] zwischen unseren Plänen [...]und jenem Zustand der Tonfilmtechnik, den wir Anfang 1930 hatten, be-stand.»29 Zudem weist er auch Radeks Kritik an der experimentellen Tonar-beit als «professoral» zurück: «alles, was nicht ‹doremifasola› klang, wurdevorbehaltlos ‹Kakophonie› genannt».
Und in der Tat findet der Film auch Verteidiger, vornehmlich im Ausland.Nicht nur Charlie Chaplin, auch der Filmmusiker Hanns Eisler lobt vor allemdie Ton-Bild-Beziehungen: «Vertov ist der Mann, der zum ersten Mal im Ton-film mit der illustrativen musikalischen Begleitung wirklich gebrochen hat.Grossartig ist die Art, wie bei ihm die Musik gegen das Bild stürmt, Gegensät-ze zwischen den beiden herausgearbeitet werden. Das alles ist durchaus neu,das Genialste, was der Tonfilm hervorgebracht hat, und alle Komponisten Eu-ropas können daraus lernen.»30 Wenn Vertov zuweilen auch den Ton kontra-punktisch verwendet, so wehrt er sich doch gegen eine pauschal verordneteNicht-Synchronität von sichtbaren und hörbaren Phänomenen wie sie SergeiEisenstein, Wsewolod Pudowkin und Grigori Alexandrow in ihrem «Tonma-nifest» (1928) vorgeschlagen hatten.31 Es gibt bei Vertov immer wieder auchSynchronführung von Bild und Ton. Er plädiert für eine Vielfalt der Bezie-hungen, für komplexe Wechselwirkungen. Das lässt sich bereits aus den dreiverwendeten Produktionstechniken ablesen. Nach eigener Aussage habenVertov und sein Kameramann Boris Zeitlin zuweilen Ton und Bild völlig ge-trennt voneinander aufgenommen, zuweilen synchron auf zwei Streifen aufge-zeichnet (mit einer Bild- und einer zweiten Tonkamera) und zuweilen auchsynchron auf einem einzigen Filmstreifen (Letzteres verunmöglicht es, Bild-und Tonspur getrennt zu montieren).32
Tonapotheose
In einem Artikel zur Hamburger Uraufführung schildert Vertov das Finale:«Der Film Enthusiasmus [...] schliesst mit einer Symphonie, in der die Geräu-sche der Industrialisierung sich in die festlichen Demonstrationen zwängen,die Laute des Festtags in den Werktag des Donbass überfluten, Bessemeröfendie Sprache unwahrscheinlicher Feuerwerke ertönen lassen und Spezialma-schinen den in Ziffern verwandelten Enthusiasmus der Arbeiter vom Donbassregistrieren.»33 Wie schon erwähnt, findet sich eine nahezu identische Be-
31
schreibung im Autorenlibretto. Tatsächlich fehlen aber diese finalen Aufnah-men in den heute kursierenden Kopien. Nicht nur, dass der Film heute unge-wöhnlich abrupt aufhört, man konnte von einem Montagespezialisten wieVertov auch eine exzessiv montierte Schlussapotheose erwarten, wie er sie bei-spielsweise im vorangegangenen Film Der Mann mit der Kamera mit viel Raf-finement praktiziert hatte.
Es gibt aber auch im erhaltenen Film Hinweise, dass das komplette Endenicht überliefert ist. Im Titelvorspann wird neben der Musik Nikolai Timofe-jews auch der Schlussakkord der 1.-Mai-Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch(Schostakowitschs 3. Sinfonie) angekündigt. Tatsächlich aber ist in den erhal-tenen Filmkopien keine Schostakowitsch-Musik zu hören. Das Finale dieserSchostakowitsch-Sinfonie ist in der Tat für eine Schlussapotheose aufgrundseiner fetzenhaften, montierten Form besonders geeignet. Sophie Küppersund ihr Mann El Lissitzky, enge Freunde Vertovs, berichten, dass sie von Ver-tov während der Entstehung des Films in eine Leningrader Kellerkneipe ge-führt wurden, wo ein unbekannter Musiker spielte, dem Vertov eine grosseZukunft vorhersagte: Schostakowitsch.34 Nicht zuletzt zeigen auch die über-
32
Abb. 4 Enthusiasmus (Dziga Vertov, 1930).
33
lieferten Längenangaben zum Film, dass nennenswerte Passagen fehlen. Mitnur 1806 Metern (65 Minuten) ging der Film am 8.9.1931 gekürzt durch diedeutsche Zensur, wobei die Presse berichtete, dass vor allem antireligiöse Pas-sagen entfernt worden waren. Heutige Kopien haben eine Länge von 1830 Me-tern (67 Minuten), doch ein Frachtbrief der Europatournee von 1931 belegt,dass der Film in England und Frankreich eine Länge von 2083 Metern (76 Mi-nuten) besass.35 Eine ursprüngliche, erste Fassung des Films hatte – nach JayLeyda und Alexander Derjabin – sogar eine Länge von 2600 Metern (95 Minu-ten). Wenn wir also heute den Film anschauen, erhalten wir nur einen Abglanzder ursprünglichen Konzeption, da mindestens 9 Minuten fehlen. Nichtsdes-totrotz zeigt schon das Vorhandene eine selten erreichte Konsequenz in derexperimentellen Konfrontation von Geräusch, Musik und Bild. Gerade durchdie Verkehrung der Ton-Bild-Verhältnisse schlägt Vertov Risse in die Ober-fläche des Films und zeigt dessen Produziertheit. In einem Gedicht aus demLaboratorium des Gehörs schreibt er 1917: «Wir sprengen den Film, um FILMzu sehen.»36
Anmerkungen
1 Vertov beschreibt auch andernorts dieReligion als Taumel, in: Wolfgang Beilenhoff(Hg.), Dziga Vertov – Schriften zum Film,München 1973, S. 37 f.
2 Kann auch «Die letzte Auferstehung»heissen, da sich die Worte nur durch ein (nichtgesprochenes) Weichheitszeichen unterschei-den. Die Bilder wurden beim orthodoxenOsterfest 1930 gefilmt (20.4., nach juliani-schem Kalender 7.4.1930).
3 So zumindest suggeriert es der Film. Tat-sächlich hatte der junge Komponist Nikolai Ti-mofejew auf der Grundlage von Vertovs Exposéfür die gesamte Filmlänge eine symphonischeMusik komponiert, aus der Vertov nur Passagenverwendete und diese mit dokumentarischenGeräusch- und Musikaufnahmen kombinierte(freundlicher Hinweis von Wolfgang Mende,
basierend auf Timofejews Klavierauszug,RGALI-Literaturarchiv, Moskau).
4 Englisches Faksimile in: Thomas Tode /Alexandra Gramatke (Hgg.), Dziga Vertov, Ta-gebücher/Arbeitshefte, Konstanz 2000, S. 23.
5 Vortrag Vertovs vom 5. April 1935, un-publiziertes Typoskript im Archiv des Öster-reichischen Filmmuseums, Wien. Zitiert nachJeanpaul Goergen, Dziga Vertov: Texte überdas Hörlaboratorium und das Radio-Ohr, Ra-diosendung WDR 3, 1999.
6 Vertov (wie Anm. 5).
7 Vertov (wie Anm. 5).
8 Jelisaweta Swilowa, «... und eines Tagesflog er durch die Luft», in: Film und Fernsehen
34
2 (1974), S. 36; weitere Belege in: Tode/Gra-matke (wie Anm. 4), S. 204 f.
9 Dziga Vertov, «Die Entstehung des ‹Ki-noglas›», in: Wolfgang Klaue / Manfred Lich-tenstein (Red.), Sowjetischer Dokumentarfilm,Berlin (DDR) 1967, S. 186.
10 Oksana Bulgakowa «Vertov und die Er-findung des Films zum zweiten Mal», in: Na-tascha Drubek-Meyer / Jurij Murasov (Hgg.),Apparatur und Rhapsodie. Zu den Filmen desDziga Vertov, Frankfurt a. M. 2000, S. 103.
11 Jelisaweta Swilowa in: Tode/Gramatke(wie Anm. 4), S. 49. Vertov (wie Anm. 1), S. 82.Ebd. S. 78 spricht Vertov über die «zahlenmäs-sige Berechung der Montagegruppierungen».
12 Boris Eichenbaum, «Probleme der Film-stilistik», in: Wolfgang Beilenhoff (Hg.), Poetikdes Films, München 1974 (Text von 1927), S. 22.
13 Vertov (wie Anm. 1), S. 9 und 79.
14 Bulgakowa (wie Anm. 10), S. 104.
15 Ute Holl, Kino, Trance & Kybernetik,Berlin 2002, S. 288. Nur wenige zeitgenössi-sche Filme sind Vertov dorthin nachgefolgt, soLili Briks und Witali ShemtschushnysStekljanny glas (Das Glasauge, 1928) und EsfirSchubs Komsomol, schef elektrifikazii (Kom-somol, Pate der Elektrifizierung, 1932), dieihre Produktionsmittel offen legen.
16 Holl (wie Anm. 14), S. 287.
17 Dziga Vertov, «Über den Film ‹Das elfteJahr›», in: Sergej Drobaschenko (Red.), DsigaWertow, Aufsätze, Tagebücher, Skizzen, Ber-lin (DDR) 1967, S. 144.
18 Interview in: October 11 (Winter 1979),S. 54–76, hier S. 62.
19 Vertov (wie Anm. 1), S. 21. Nach Vertovseigener Aussage findet sich die Intervall-The-orie aber bereits in einer frühen Form des Ma-nifests von 1919.
20 Ausführlich dazu: Dziga Vertov, «Kino-prawda und Radioprawda. (Als Vorschlag)»,
in: Prawda 150 (16.7.1925), deutsch in: Droba-schenko (wie Anm. 17), S. 113 f.
21 Vertov in: Drobaschenko (wie Anm. 17),S. 157. Bereits Viktor Schklowski hatte dieKomposition von Schestaja tschast mira (EinSechstel der Erde) als «Lied» bezeichnet, in:Kino, Nr. 44, 30.8.1926 (Moskau).
22 Vertov (wie Anm. 4), S. 19.
23 Vertov (wie Anm. 17), S. 148 und 308.
24 Frankfurter Zeitung, 12.7.1929 (Abend-ausgabe).
25 Diese Szene ist einer der überzeugends-ten Belege für die Verschiebung der Synchron-tonspur in der gängigen aus dem Gosfilmo-fond stammenden Kopie des Films: Die offen-sichtlich als Synchronereignisse gemeintenHammergeräusche und Wortbegriffe ertönendort verschoben (ebenso das Taktstockge-räusch des Dirigenten am Filmanfang). PeterKubelka hat daher mit guten Gründen eineRestauration durchgeführt, die der gängigenKopie vorzuziehen ist, vgl. Lucy Fischer,«Restauring Enthusiasm: Excerpts from an In-terview with Peter Kubelka», in: Film Quar-terly 2 (Winter 1977), S. 35–36.
26 Vertov (wie Anm. 17), S. 319 f. Die Auf-nahmen fehlen allerdings in den überliefertenKopien.
27 Karl Radek in: Iswestija (3.4.1931), auchin: Mir (4.12.1931), französisch in: Monde(5.12.1931).
28 S. Walerin in: Sowjetskoje iskusstwo(17.2.1931), deutsch in: Oksana Bulgakowa(Hg.), Die ungewöhnlichen Abenteuer des Dr.Mabuse im Lande der Bolschewiki, Berlin1995, S. 158.
29 Vertov «Erste Schritte», in: Kino(16.4.1931), deutsch: Vertov (wie Anm. 17), S.179.
30 Hanns Eisler, «Musiker und Maler überDziga Wertoff», in: Bulgakowa (wie Anm. 28),S. 158.
35
31 Vertovs Widerspruch gegen das Tonma-nifest in: Klaue (wie Anm. 9), S. 92 und S. 94.
32 Vgl. Vertov, «Speech to the FirstAll-Union Conference on Sound Cinema»,August 1930, in: Richard Taylor / Ian Christie(Hg.), The Film Factory, Cambridge (Mass.)1988, S. 301–305, hier 303.
33 Vertov, «Der Film Enthusiasmus», in: So-zialistische Film-Kritik 6 (8.9.1931).
34 Sophie Lissitzkaja-Küppers, «Skwos dalminuwschich let», in: Jelisaweta Wertowa-Swilowa / Anna Winogradowa (Hgg.), DzigaVertov w wospominanijach sowremennikow,Moskau 1976, S. 181–194.
35 Archives Moussinac à la Bibliothèqued’Arsenal, dossier LM 023 (31), 3405.
36 Vertov «Start», in: Tode/Gramatke (wieAnm. 4), S. 200.
!"#$%&' ()"")$
*+,-./$01,1203
456/,78/3,99,1070:28;<+/&381,71
Vom Urknall bis zur Geburt eines Drehbuchautors in weniger als einer Minu-te: Es ist eine kleine Evolutionsgeschichte im Schnelldurchlauf, was uns SpikeJonze in einer kurzen Sequenz zu Beginn seines Films Adaptation (USA 2002)vorführt. Auf gewisse Weise ist das Pop im Wortsinn, denn Popsongs bean-spruchen genau das für sich, was hier inszeniert wird: Auch Pop will in weni-ger als dreieinhalb Minuten die Welt erklären. Aber entscheidend ist hier etwasanderes. Die beschleunigte Evolutionsgeschichte aus Adaptation ist nämlichZitat: Regisseur Spike Jonze verneigt sich mit dieser Sequenz vor dem Musik-video zum Track Right Here, Right Now (1999) von Fatboy Slim, einem briti-schen Musiker, für den Jonze selber einige Clips inszenierte. In einem ver-gleichbaren Schnelldurchlauf beschreibt das Video zu Right Here, Right Now(Regie: Hammer & Tongs) die Entwicklungsgeschichte von einem Einzellerüber prähistorische Amphibien und frühe Menschenaffen als atemlosen Dau-erlauf. Evolution wird als fieberhaftes Morphing inszeniert, und am Ende die-ses Reigens der Mutationen setzt sich ein völlig verfettetes Exemplar des in-zwischen zivilisierten Menschen auf eine Bank, erschöpft von der rastlosenEntwicklung seiner eigenen Spezies. Anders gesagt: Der Mensch in RightHere, Right Now ermüdet an der Geschwindigkeit, in der seine eigene Vorge-schichte erzählt wird.
Wenn nun die Gattung Musikvideo gern mit einer Ästhetik der Beschleu-nigung in Verbindung gebracht wird, dann unterläuft der Clip zu RightHere, Right Now dieses Tempodiktat, gerade indem er es erfüllt, weil diesesVideo letztlich ja besagt: Geschwindigkeit macht müde. Das ist die ironischePointe dieses Clips, und damit wird hier auch jene landläufige Kulturkritikgekontert, die Musikvideos (und die «Clipästhetik» von MTV im Allgemei-nen) in erster Linie in Parametern der Beschleunigung sieht. Die Marke MTVist ja längst nicht mehr nur ein Synonym für Musikvideos, sondern auch eineChiffre für eine Ästhetik der horrenden Schnittfrequenzen und der Zerstü-ckelung des Erzählens in diskontinuierliche Bilderfolgen.1 Überspitzt for-muliert, läuft diese traditionelle Kritik stets darauf hinaus, dass die GattungMusikvideo das filmische Erzählen kaputt mache.2 Der Clip zu Right Here,
36
Right Now, auf den Spike Jonze in Adaptation anspielt, ist für diese Debattenun deshalb entscheidend, weil er diese Kritik gleichsam mit inszeniert unddadurch ihren blinden Fleck aufzeigt: Denn dieses Musikvideo macht zwarTempo, aber es kommt dabei ohne einen einzigen Schnitt aus; der Erzählflussbleibt ungebrochen, von einer Ästhetik der Zerstückelung kann keine Redesein.3
Das heisst nun nichts anderes, als dass die Kritik an der Clipästhetik vonMTV mittlerweile zu einem Bestandteil des Programms von MTV gewordenist.4 Vielleicht ist es deshalb an der Zeit, nicht mehr nur vom frenetischen Fla-ckern der Bilder zu reden, das seit jeher als kulturelles Kernsymptom vonMTV gilt, sondern den Fokus zu verschieben auf eine jüngere Generation vonClipregisseuren, die in ihren Musikvideos die alten kulturkritischen Vorwürfegegenüber dem Musiksender oft ins Leere laufen lassen, weil sie diese Kritikgleichsam verinnerlicht haben.5 Anzeichen dafür wurden in den vergangenenJahren gerade auch im Kino sichtbar, und zwar in den ersten Kinofilmen dreierClipregisseure, um deren Musikvideos es hier vornehmlich gehen soll. NebenSpike Jonze sind das der Engländer Jonathan Glazer und der Franzose MichelGondry, die das Musikvideo in den Neunzigerjahren massgeblich geprägt hat-ten, bevor sie sich um das Jahr 2000 herum erstmals ins Kino wagten — undwie zunächst bei Being John Malkovich (USA 1999) von Spike Jonze konnteman auch bei Glazers Gangsterfilm Sexy Beast (GB/Spanien 2000) und beiGondrys Zivilisationssatire Human Nature (F 2001) erahnen: An einem Kino,wie es üblicherweise mit der «Generation MTV» assoziiert wird, sind dieseFilmemacher nicht interessiert. Oder um es mit den Worten von Jonathan Gla-zer zu sagen: «doing very flashy things with huge budgets», das ist nicht, wasdiese drei Regisseure anstreben im Kino.6
Diese Erstlinge machen deutlich: Die Chiffre MTV taugt hier nur noch be-dingt als ästhetische Kategorie. Die britische Zeitschrift Sight and Sound hatdas schon anlässlich von Being John Malkovich erkannt und bemerkt, dass esverfehlt wäre, eine gemeinsame Ästhetik für Jonze, Gondry und andere Clip-regisseure ihrer Generation formulieren zu wollen.7 Möglicherweise passiertin den Musikvideos jener Filmemacher aber etwas auf einer fundamentalerenEbene als in der Form beschleunigter Oberflächenreize, die immer wieder alsdie «Bilderflut» von MTV beschrieben wurde. Wie Neil Feinemann in seinerEinführung zum Bildband Thirty Frames Per Second: The Visionary Art of theMusic Video festhält, ist es nämlich eine der grundlegendsten Konsequenzender Musikvideos, dass sie filmische Ästhetik als traditionelles Kriterium derAutorschaft obsolet machen: «The video’s ability to handle diverse images,styles, and techniques – often within an individual director’s portfolio – hasforced us to redefine the concept of the auteur.»8 Und wenn sich die Autor-schaft eines Clipregisseurs demnach gerade nicht über ihm eigene formale Sig-naturen bestimmen lässt, macht es auch keinen Sinn, das Kino eines Spike Jonze,
37
Jonathan Glazer oder Michel Gondry im Kontext einer Ästhetik des Musikvi-deos zu sehen.
Vielleicht ist nun das, was diese drei Regisseure gemein haben, weniger ineiner spezifischen Filmsprache zu suchen als in einer erzählerischen Haltung,einem eigentümlichen Verhältnis zur Narration, das gerade in ihren Clips amstärksten zutage tritt. Und vielleicht lässt sich dieses besondere Verhältnis zumErzählen als Konsequenz ihrer Arbeiten auf dem Gebiet des Musikvideos fas-sen, zumal eine der fundamentalen Differenzen zwischen Clip und Kino ja ge-rade die Frage der Narration betrifft. Wie beispielsweise Klaus Neumann-Braun und Axel Schmidt festhalten, wurde in der Forschung immer wieder da-rauf verwiesen, dass die Bilder der meisten Musikvideos «keinem Erzählstrangfolgen, wie man ihn aus dem Erzählkino kennt»; und das, fahren sie fort, werdegerade von Vertretern der Postmoderne immer wieder als «Befreiung von eta-blierten gesellschaftlichen Darstellungs- und Deutungsmustern» begrüsst.9
Doch wenn sich die Gattung Musikvideo kaum an die traditionellen Codes desErzählkinos hält, ist das immer auch als Konsequenz des besonderen Funk-tionszusammenhangs zu sehen, in dem Musikvideos zirkulieren.
Der Kernauftrag des Clips besteht ja nach wie vor darin, einen Star undsein Image zu verkaufen, weshalb das weitaus häufigste Genre auch heute nochdas klassische Präsentationsvideo ist, das den Star in irgendeiner Weise bei derInszenierung seiner selbst zeigt. Aufgrund der Programmstruktur von MTVmuss ein Clip auch möglichst so beschaffen sein, dass er seine Schauwerteselbst bei mehrfachem Sehen nicht einbüsst. Deshalb, schreibt Neil Feine-mann, sei der Vorwurf auch absurd, dass Musikvideos das Erzählen kaputtmachen würden: «Although it is commonly attacked for destroying narrative,for example, a plot-driven video usually gets boring the third time you watch itand unbearable soon thereafter.»10 Wenn die wenigsten Musikvideos Plot-orientierte Erzählstränge aufweisen, liegt das also an der Logik der «heavy ro-tation», und wenn Clipregisseure ihre Musikvideos kaum je als Erzählfilme ineinem klassischen Sinn gestalten, dann auch deshalb, weil die kulturelle Öko-nomie von MTV sie dazu verpflichtet. Es scheint demnach durchaus berech-tigt, wenn der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl anmerkt, «dass das Ver-hältnis von Musikvideo und Erzählung eigentlich ein Widerspruch ist, mankönnte fast sagen ein ganz kategorischer Widerspruch».11
Nun ist es aber so, dass gerade dieser Widerspruch, dieses von MTV gewis-sermassen institutionalisierte Diktat gegen das Erzählen von Geschichten,manche Clipregisseure zu Auseinandersetzungen mit den Bedingungen desErzählens selbst provoziert. Man kann deshalb die These aufstellen, dass gera-de das prekäre Verhältnis des Musikvideos zur Erzählung zu einem verstärk-ten Bewusstsein für narrative Prozesse führt. Jedenfalls haben gerade Filme-macher wie Jonze, Gondry und Glazer in ihren Musikvideos immer wieder dasErzählen selbst zum Thema gemacht, und die bestechendste Arbeit in dieser
38
Hinsicht ist sicherlich Michel Gondrys Clip zu Bachelorette (1997; Abb.1.1–4) von Björk, einem Märchen über die Geburt eines Stars. Diese kleineMeta-Erzählung beginnt damit, dass Björk als einsiedlerisches Mädchen imWald ein Buch mit lauter leeren Seiten findet, während uns ihre Stimme viaVoice-over gleichzeitig genau das nacherzählt: dass sie nämlich eines Tages imWald ein Buch mit lauter leeren Seiten gefunden habe. Das Buch habe sichdann vor ihren Augen selbst zu schreiben begonnen, und wie sich so die Seiteneigenmächtig mit Text füllen, ereignet sich auf der Bildebene genau das, wasdas Buch auf der Textebene beschreibt: Björk sitzt im Zug, fährt in eine Gross-stadt, bringt ihr Buch zu einem Verleger. Dabei findet eine Umkehrung destraditionellen Verhältnisses zwischen Ereignis und Narration statt, denn dieNarration, so schreibt das Buch an einer Stelle, ist den erzählten Ereignissenimmer einen Schritt voraus. Doch das ist erst der Anfang in diesem vielschich-tigen Spiel um die Verselbstständigung einer Erzählung.
Denn noch vor der ersten Strophe des Songs hat sich das Buch zu Ende ge-schrieben, und was der Clip fortan zeigt, ist die weitere Geschichte des Buchesals Kulturprodukt, das inzwischen unter dem Titel My Story in den Buchhand-lungen aufliegt und als dessen Autorin das Mädchen aus dem Wald gefeiertwird. Als My Story dann als Musical auf die Bühne gebracht wird, bekommtder bislang schwarzweisse Clip Farbe, und mit dieser ersten Bühnenadaptionsetzt nun ein Reigen von ineinander verschachtelten Inszenierungen ein; dasMusical nämlich, das ja selber schon eine Reproduktion von My Story ist, läuftdann seinerseits darauf hinaus, dass es die Inszenierung der Geschichte des Bu-ches als Musical auf der Bühne nochmals inszeniert, als Spiel im Spiel. Inner-halb der Bühnenversion läuft also eine Kopie der Bühnenversion ab, und damitbeschreibt dieser Clip eine Bewegung, die man in der Erzähltheorie mit demBegriff der mise-en-abîme bezeichnet: Eine Figur innerhalb eines Textes pro-duziert ihrerseits einen Text, der nahezu identisch ist mit demjenigen, von demsie selber ein Teil ist. Man kennt dieses Prinzip aus Adaptation, dem Film übereinen Drehbuchautor, der seine Schaffenskrise überwindet, indem er sich sel-ber mitsamt seinem Schreibstau ins Drehbuch hineinschreibt: Der Film, andem der Autor im Film schreibt, ist weitgehend identisch mit diesem Film na-mens Adaptation, den wir im Kino sehen. Da möchte man fragen: Ist es Zufall,dass ausgerechnet ein Film des Clipregisseurs Spike Jonze die bestechendsteKinoversion dessen liefert, was der Clipregisseur Michel Gondry in einem sei-ner brillantesten Musikvideos als ein märchenhaftes Essay über das Erzähleninszeniert hat?
Doch nochmals zurück zu Bachelorette. Mit dem Prinzip der mise-en-abîme setzt Gondry nun eine potenziell endlose Regression in Gang: Jede In-szenierung von My Story verweist nur auf frühere Inszenierungen, mit jederReproduktion entfernt sich die Fiktion weiter von der erzählten Wirklichkeit.Am Ende beginnt das Buch, seinen Text eigenmächtig zu löschen, und inner-
39
halb der labyrinthischen Kulissen des Musicals wird es schliesslich vonwucherndem Gestrüpp verschluckt – der Waldboden fordert das enteigneteBuch zurück, aus dem umjubelten Star wird wieder das einsame Waldmädchenvon früher, und das einzige Element, das diese narrative Kreisbewegung nichtmitmacht, ist die Farbe, die am Schluss nicht wieder aus dem Film verschwin-det. Das Musikvideo zu Bachelorette wird dadurch einerseits lesbar als Parabelüber den Star, der sich in den mehrfachen Inszenierungen und Reproduktio-nen, die zu seiner Vermarktung dienen, buchstäblich abhanden kommt undder in den Kulissen des Popzirkus einen Weltverlust erleidet. Überdies ver-schränkt sich hier das Genre des narrativen Clips mit jenem des Präsentations-videos, indem Björk als «Bachelorette» auch ihr eigenes Image inszeniert undreflektiert: das Image des Mädchens aus der natürlichen Abgeschiedenheit Is-lands, das in den Zentren der Kulturindustrie zum Star wurde. Im Kontextmeiner These ist dieser Clip aber auch ein dreister Versuch, den stillschweigen-den Kontrakt, wonach ein Musikvideo keine einfache Erzählung offerierendürfe, dadurch zu unterlaufen, dass die Narration selbst zum Thema gemachtwird. Statt im eigentlichen Sinn zu erzählen, liefert Michel Gondry mit diesemClip ein kleines Lexikon der Narratologie.
Im Extremfall hebt ein Clip den institutionalisierten Widerspruch zwi-schen Musikvideo und Erzählung also dadurch auf, dass die Narration der-
40
Abb. 1.1–4 Björks Bachelorette.
massen ins Zentrum gerückt wird, dass aus dem Clip ein Film über das Erzäh-len selbst wird, und als eine der verblüffendsten Arbeiten in dieser Hinsichtdarf Michel Gondrys Video zu Sugar Water (1996) des japanischen Frauendu-os Cibo Matto gelten (Abb. 2.1–4). Auf dem halbierten Bildschirm laufen hierzeitgleich zwei spiegelsymmetrische Geschichten ab, und zwar je einmal vor-wärts und einmal rückwärts. In der linken Bildhälfte erhebt sich zunächstYuka Honda aus dem Bett, duscht sich, kleidet sich an und verlässt das Haus,in der rechten Hälfte macht gleichzeitig ihre Bandkollegin Miho Hatori dassel-be in der genau gleichen Abfolge – nur dass dieser Film rückwärts und spiegel-verkehrt abläuft (und dass sich die Frau hier mit Zucker statt mit Wasserduscht). In der Hälfte des Clips überkreuzen sich die beiden Geschichten, dieProtagonistinnen wechseln die Seiten und also gleichsam auf die andere Seitedes Spiegels, der dieser Clip ist. Damit kehrt sich auch der jeweilige Bewe-gungsmodus von Film und Figur ins Gegenteil: Der Film, der bislang links ab-lief, rollt jetzt in der rechten Bildhälfte spiegelverkehrt an seinen Anfang zu-rück, und der Film, der bislang in der rechten Bildhälfte spiegelverkehrt imRückwärtsmodus abrollte, läuft jetzt links dem Ende entgegen, das sein An-fang war.
Das klingt genauso kompliziert, wie es ist, und in einem noch strengerenSinn als im Clip zu Bachelorette vollzieht sich auch in der Spiegelgeschichte,die Gondry in Sugar Water vorführt, eine narrative Kreisbewegung – aller-dings eine, die letztlich nicht einfach zurück zum Anfang führt, sondern eine,
41
Abb. 2.1–4 Cibo Mattos Sugar Water.
die Anfang und Ende schlechterdings suspendiert. Nun darf man nicht denFehler machen, diese zirkuläre Struktur als selbstzweckhafte Spielerei zu se-hen; denn wenn dieser Clip als potenziell endlose Erzählschlaufe funktioniert,wird damit das Rotationsprinzip von MTV auf die Spitze getrieben. So wirddie kulturelle Ökonomie von MTV gleichermassen bedient und entlarvt durchdiesen Clip, der in jeder Hinsicht um seine eigene Achse rotiert.12 Und inso-fern ist dieses Video auch radikaler Pop, weil es Pop gewissermassen beimWort nimmt: Genauso, wie sich das Palindrom «Pop» von hinten wie von vor-ne lesen lässt, funktioniert auch dieser Clip auf der Bildebene von hinten wievon vorne genau gleich.13
Eine einfachere Variante einer zirkulären Erzählstruktur hat unlängst Ja-mie Thraves mit seinem Clip zum Song The Scientist (2002) von Coldplay ge-zeigt, einer Ballade, in der Chris Martin von der Unmöglichkeit singt, eine ge-scheiterte Beziehung in einer Kreisbewegung zurück an ihren Anfangspunktzu führen. «Running in circles / Chasing our tails», singt er da und beschwörtdas unmögliche Zurückspulen zum Beginn der Liebe: «Oh take me back to thestart». Im Clip nun wird ihm dieser Wunsch erfüllt, denn auch dieser Filmspult sich zurück, zeigt also Chris Martin, wie er rückwärts durch die Weltgeht.14 Gegen Ende seines Wegs kommt der Sänger auf eine Waldlichtung, wodas Wrack eines Autos und eine tote Frau am Boden liegen, und hier machtsich dann in Zeitlupe der Autounfall rückgängig, der die Freundin des Stars inden Tod gerissen hat, während er selber unverletzt geblieben ist. Wenn die bei-den am Schluss dieser filmischen Rückgängigmachung nebeneinander im Autofahren, ist dies das glückliche Ende des Films und insofern ein klassisches Hap-pyend. Mit dem Schlussbild vom glücklichen Paar benutzt der Clip zu TheScientist also eine konventionelle Formel aus dem klassischen Erzählkino,doch dadurch, dass sich der Film zurückspult, wird das Happyend hier alsAuftakt zur Tragödie umgedeutet, weil es in der eigentlichen Chronologie derEreignisse den Beginn des Verlustes markiert. Der Clip erzählt insofern vomErzählen selbst, als er eine der ältesten Konventionen des Kinos einer Umwer-tung unterzieht – und damit geht er auch über die blosse zitathafte Aneignungder Ikonografie des Erzählkinos hinaus, von der im Zusammenhang mit Mu-sikvideos so oft die Rede ist.
Das gilt auch für Jonathan Glazers alptraumartiges Musikvideo zu Rabbit inYour Headlights (1998) von Unkle. Glazer verdichtet hier mehrere Narrative zueinem intertextuellen Zeichenkomplex, der zunächst lediglich eine wörtliche In-szenierung der Titelzeile des Songs zu sein schient: Das Sprachbild vom Kanin-chen im Scheinwerferlicht wird hier übersetzt in das Drama eines zerlumptenMannes in einer Kapuzenjacke, der durch ein Strassentunnel hastet, gejagt vonden Scheinwerfern der Autos, die ihn passieren. Deren Motoren- und Hupge-räusche übertönen immer wieder den Song, ebenso wie die Stimme des Kapu-zenmannes, der unverständliches Zeugs murmelt und mitunter Laute ausstösst,
42
die wie Verwünschungen klingen. Bleibt dieser Irrläufer im Tunnel zunächstnoch unberührt, so wird er bald immer wieder von vorbeifahrenden Autos ge-rammt, aber auch wenn sein Körper dabei in grotesken Verrenkungen durch dieLuft katapultiert wird, richtet er sich immer wieder auf und eilt unversehrt wei-ter wie eine Figur in einem Videogame. Wenn man nun aber unter der Kapuzeden französischen Schauspieler Denis Lavant erkannt hat, erweist sich diesesSzenario serieller Kollisionen als albtraumhafte Um- und Weiterschrift der An-fangsszene von Les amants du Pont-Neuf (Leos Carax, F 1991). Denn auch dortspielt Denis Lavant einen Clochard, der anfangs auf offener Strasse von einemAuto angefahren wird.15 Mit diesem Filmzitat kommt aber auch der SchauplatzParis ins Spiel. Und indem Glazer den Ort der Kollisionen in einen Tunnel ver-legt, ruft er eine weitere Referenz auf, nämlich jenen tödlichen Unfall, der imJahr vor der Veröffentlichung von Rabbit in Your Headlights zu einem interna-tionalen Medienereignis wurde. In einem Pariser Strassentunnel kam PrinzessinDiana ums Leben, bei einem Autounfall auf der Flucht vor den Blitzlichtern derPaparazzi – und damit bringt uns der Clip wieder zurück in den Text des Songs,in dem Thom Yorke von Radiohead singt: «I’m a rabbit in your headlights / Sca-red of the spotlight». Und ein paar Zeilen weiter könnte er auch von der «Queenof Hearts» singen, wenn es heisst: «She laughs when she’s crying / She crieswhen she‘s laughing». Glazers Musikvideo zu Rabbit in Your Headlights ist alsoaus drei narrativen Strängen gebaut, die ineinander greifen wie in einem borro-mäischen Knoten, der zerfiele, sobald auch nur eine der Schnüre zerschlagenwürde. Und für diesen komplexen Knoten aus Songtext, filmischem Intertextund dem Tod von Lady Diana als massenmedialem Referenztext fungiert dieMusik als Bindemittel.
Dass ein Musikvideo fürs Erzählkino seinerseits zu einem eigentlichenfilmhistorischen Bindemittel werden kann, zeigt schliesslich Spike Jonzes Clip
43
Abb. 3.1–4 Unkles Rabbit in Your Headlights.
zu It’s Oh So Quiet (1995) von Björk. Wenn die Sängerin hier in Zeitlupedurch stille Alltagsszenen spaziert, bis sich jeweils im Refrain die Passanten zueiner Tanzgruppe formieren und wie in einem klassischen Hollywood-Musi-cal die Protagonistin tänzerisch umschwärmen, kann man in diesem Clip zwei-felsfrei einen Anstoss für Lars von Triers Neo-Musical Dancer in the Dark(Dänemark u.a. 2000) erkennen. Dort feiert wiederum Björk als Hauptdarstel-lerin die Verzauberung ihres Alltags durch Musical-Fantasien, und die Freun-din an ihrer Seite, die sich jeweils nur widerwillig auf die Lieder einlässt, wirdgespielt von Catherine Deneuve. Das ist nun deshalb von Bedeutung, weilschon It’s Oh So Quiet von Spike Jonze eine Hommage an das Musical Les pa-rapluies de Cherbourg (Jacques Demy, F/BRD 1964) war, in dem Deneuve dieHauptrolle spielte.16 Und hier zeigt sich denn, dass das Musikvideo längstnicht mehr nur ein einseitig parasitäres Verhältnis zum Erzählkino pflegt, in-dem es dessen Ikonografie plündert und zu Parodien und Pastiches verarbei-tet. It’s Oh So Quiet ist ein intertextueller Knotenpunkt, der nicht einfach zi-tathaft auf die Filmgeschichte zurückverweist, sondern der seinerseits dasKino inspiriert hat.
So prägen Clipregisseure wie Jonze, Glazer und Gondry mit ihrem narra-tiven Bewusstsein ihrerseits das Erzählkino – und zwar gerade auch dort, woman das auf den ersten Blick gar nicht sieht, weil die Filmbilder nicht frene-tisch flackern, wie man das von MTV zu kennen meint. Denn MTV hat nichtnur die Sehgewohnheiten verändert, wie es immer heisst, und es bedeutet auchnicht einfach die Zerstückelung des Erzählens in einer Ästhetik der Beschleu-nigung. Vielmehr haben Filmemacher der Generation um Jonze, Glazer undGondry aus dem eigentlich paradoxen Verhältnis zwischen Musikvideo undErzählung einen hochgradig selbstreflexiven Umgang mit Narration entwi-ckelt, der keineswegs den Untergang des Erzählens bedeutet. Im Gegenteil: In-dem sie sich MTV als Testgelände des Erzählens zunutze machen, steigern siemit ihren Clips die narratologische Kompetenz des Publikums. Das darf mandurchaus als Versprechen für das Erzählkino sehen, wie es sich um diese Clip-regisseure nun allmählich herausbildet – ein Erzählkino, das viel von MTV ge-lernt hat, auch wenn man ihm das äusserlich nicht ansieht, weil es in seinerBildsprache gerade nicht den gängigen Vorstellungen einer Clipästhetik ent-spricht.17
44
45
Anmerkungen
1 Einen breiten Überblick mit ausführli-cher Bibliografie zur Forschung über MTVund die Gattung Musikvideo bieten KlausNeumann-Braun / Axel Schmidt, «McMusic»,in: Klaus Neumann-Braun (Hg.), VIVA MTV!Popmusik im Fernsehen, Frankfurt/M 1999, S.7–42.
2 Vgl. Herbert Gehr, «The Gift of Sound &Vision», in: Deutsches Filmmuseum Frankfurt(Hg.), Sound & Vision: Musikvideo und Film-kunst, Frankfurt/M, 1993, S. 10–27.
3 Dasselbe gilt für ein weiteres Musikvideoaus der Filmografie des Regie-KollektivsHammer & Tongs: Auch der Clip zu Imitati-on of Life (2001) von R.E.M. kommt ohne ei-nen einzigen Schnitt aus und zwar dank einerTechnik, die ein Stück weit an das dramatischePrinzip der Simultanbühne erinnert. SämtlicheEpisoden, die sich in diesem Clip abspielen,passieren nämlich innerhalb eines einzigenTableaus, das ein dicht bevölkertes kleinesPartygelände zeigt. Die besondere Erzähltech-nik besteht nun darin, dass der Clip immerwieder auf andere Bildausschnitte fokussiertund dadurch nacheinander einzelne kleineSzenen im Tableau zeigt, die in Wahrheit allemehr oder weniger zeitgleich ablaufen. Die er-zählte Zeit wird also keineswegs beschleunigt,sondern im Gegenteil verlangsamt im Nach-einander von eigentlich simultanen Ereignis-sen.
4 Das ist auch der Grund, weshalb bezüg-lich MTV jede Debatte um Kommerz undAvantgarde zum Scheitern verurteilt ist.Denn MTV funktioniert wie ein totalitäresSystem, das sich jede auch nur im Ansatz sub-versive Geste sofort einverleibt. Klaus Neu-mann-Braun und Axel Schmidt halten in ih-rem Forschungsüberblick denn auch fest,dass die «Unterscheidung zwischen populä-rem Realismus und subversiven Avantgarde-strategien, zwischen U- und E-Kultur, zwi-schen Kommerz und Kunst, zwischen Heuteund Gestern» im Zusammenhang mit MTVheute weitgehend als obsolet erachtet werde(Neumann-Braun/Schmidt, wie Anm. 1, S.15).
5 Dass diese Tendenz zur Selbstreflexivitätvon Anfang an in MTV angelegt war, zeigt sichschon an dem allerersten Musikvideo, dasüberhaupt auf dem Sender zu sehen war: DerSong Video Killed the Radio Star (1981) vonden Buggles war ja eigentlich eine ironischeKritik des Musikfernsehens; indem MTV mitdiesem Clip (Regie: Russell Mulcahy) seinProgramm eröffnete, münzte der Sender dieseKritik zu einer Art Kampfansage an das Kon-kurrenzmedium Radio um.
6 Zitiert nach: Nick James, «Thieves on theVerge of a Nervous Breakdown», in: Sight andSound 11:1 (2001), S. 20.
7 John Mount, «How to Get a Head in Mo-vies», in: Sight and Sound 10:3 (2000), S. 12.
8 Neil Feineman, «Introduction», in: Ste-ven Reiss / Neil Feinemann (Hgg.), ThirtyFrames Per Second: The Visionary Art of theMusic Video, New York 2000, S. 24.
9 Neumann-Braun/Schmidt (wie Anm. 1),S. 16.
10 Neil Feineman (wie Anm. 8), S. 13.
11 Zitiert nach: Fantastic Voyages: Eine Kos-mologie des Musikvideos Vol. 3: «Short sto-ries», ZDF, 2000.
12 Eine weniger komplexe Version einer sol-chen Parallel-Erzählung hat Francis Lawrencein seinem Musikvideo für Precious Illusions(2002) von Alanis Morissette inszeniert. DerClip setzt mit einem einfachen Schwenk durcheine Party ein, bevor die Kamera in einer Nah-aufnahme auf Alanis Morissette fokussiert.Nun teilt sich ihr Bild in zwei Hälften: DerFilm rechts setzt die Ästhetik des Einstiegs fortund zeigt in kleinen Episoden den Verlauf einerLiebe, die sich auf der Party zwischen der Sän-gerin und einem Mann ergibt; der Film links er-zählt dieselbe Geschichte in der märchenhaftverfremdeten Version einer ritterlichen Ro-manze. Am Ende dieser gedoppelten romanti-schen Erzählung fügen sich die beiden Bildervon Alanis Morissette wieder zusammen, der
46
Clip führt uns zurück zur Party, und der genaugleiche Schwenk, mit dem der Film begonnenhat, bringt uns schliesslich zurück auf die Aus-gangsposition.
13 Ähnliches gilt auch für den Clip zu SpecialCases (2003) von Massive Attack, in dem dasfranzösische Regie-Kollektiv H5 aus «stockfootage» die Entwicklung eines Klon-Babysmontiert. Dieses wächst zu einem jungenMann heran, und dessen Romanze mit einerjungen Frau wird dann zum narrativen Schei-telpunkt, indem der Clip von hier an die Ent-wicklung der jungen Frau zurückverfolgt. AmEnde schliesst sich der Kreis, indem der Filmwieder in der Klon-Fabrik und damit bei sei-ner unheimlichen Pointe ankommt, dass beid-seits dieser Romanze ein künstlicher Menschsteht. Konsequenterweise gibts den Clip auchin zwei Versionen: Die eine beginnt mit demmännlichen und endet mit dem weiblichenKlon, die andere verläuft umgekehrt.
14 Song und Film werden also gegenläufigzueinander abgespielt. Damit das Playback imrückwärts laufenden Clip dennoch lippensyn-chron ist, hat Sänger Chris Martin, der sich beiden Dreharbeiten vorwärts bewegte, für dieFilmaufnahmen den Song rückwärts singengelernt. Die Umkehr-Version des Clips, in der
die Bilder vorwärts laufen, während die Musiksich an den Anfang zurück spult, ist auf derDVD-Single zu finden.
15 Der markanteste Unterschied zu Lesamants du Pont-Neuf besteht dabei in der Un-verwundbarkeit des Irrläufers in Rabbit inYour Headlights, einem Clip, der einer ArtAlbtraumlogik gehorcht: Zum Schluss, als einAuto von hinten auf den Irrläufer auffährt, ex-plodiert dieses beim Aufprall, während er sel-ber wie unberührt stehen bleibt, als hätte er dieKräfteverhältnisse zwischen Mensch und Ma-schine eigenmächtig suspendiert.
16 Siehe dazu http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-15/.
17 Bei Drucklegung dieses Textes waren dieersten Veröffentlichungen des von Spike Jonze,Michel Gondry und Chris Cunningham ge-gründeten Directors Label angekündigt: DieDVDs The Work of Director Spike Jonze, TheWork of Director Michel Gondry und TheWork of Director Chris Cunningham sind ei-gentliche Werkausgaben des jeweiligen Regis-seurs, was für die Publikationspraxis von Mu-sikvideos ein absolutes Novum bedeutet. DieReihe soll mit weiteren bedeutenden Clipre-gisseuren fortgesetzt werden.
!"#$" %"&'(!
)*+,*-./0/-1.+1"22*034
'-5/06./71+.518905.-1:.;;+9--
Martin Tillmann hat in der Schweiz klassische Musik und Cello studiert. 1988ging er nach Amerika und erhielt dort 1989 seinen Master an der University ofSouthern California. Als Musiker, der immer bestrebt war, die traditionellenGrenzen des Celloklangs zu sprengen, hat er sich mit dem Elektrocello einenneuen Sound erarbeitet, der vielerorts Gehör findet.
Seit seiner Ankunft in Amerika hat Martin Tillmann bei über hundert Fil-men, Fernsehserien und Werbespots mitgewirkt sowie verschiedene Musike-rInnen live oder im Studio begleitet, darunter B. B. King, Beck, Tracy Chap-man, Vonda Shepard, Chicago und Air Supply. Er hat mehrere CDs veröffent-licht und arbeitet derzeit an weiteren Eigenkompositionen. Stücke seiner CDEastern Twin wurden für den Soundtrack von Ali (Michael Mann, USA 2001)verwendet. Als Cellist wirkte er u. a. bei folgenden Filmen mit: The Fan, Ar-mageddon, Face/Off, Kiss the Girls, Black Hawk Down, The Pledge und TheRing.
Martin Tillmann arbeitet seit einiger Zeit mit Hans Zimmer zusammen,der als Komponist, Produzent und Head of Music Department bei Dream-works für die Musik unzähliger Hollywoodfilme verantwortlich ist.1 Eine be-sonders enge Zusammenarbeit verbindet Hans Zimmer mit Jerry Bruckhei-mer, dem Blockbuster-Produzenten schlechthin.2
Das in Auszügen wiedergegebene Gespräch wurde im Juli 2003 geführt.
!9<09 %9-./; Wie bist du dazu gekommen, Filmmusik zu machen?
8905.- :.;;+9-- Begonnen hat eigentlich alles mit Rock-/Popaufnahmen undTourneen, dann habe ich jemanden vom Fernsehen kennen gelernt.
!% Du hast ja unter anderem für Serien wie Ally McBeal Musik eingespielt.
8: Ally McBeal, ER, Profiler und solche Sachen. Das habe ich dann währenddrei Jahren gemacht, bis Hans Zimmer von mir gehört hat und mich angefragt
47
hat, bei The Fan mitzuarbeiten. Das war unser erster gemeinsamer Film. ZumGlück!
!% War das damals auch wegen deines Instruments?
8: Ich hatte Glück, da Elektrocellisten relativ begehrt waren, und Hans liebtdas Cello als Instrument sowieso. Ausserdem ist das Elektrocello sehr vielsei-tig. Ich kann lauter spielen als ein Schlagzeug, und der Klang ist sehr wandel-bar. Es lässt sich deshalb auch für viele Projekte einsetzen.
!% Wie war das damals, hast du da einfach deine Celloparts eingespielt oderwarst du von Anfang an verantwortlich für die ganze Filmmusik? Wie hat sicheuer Arbeitsverhältnis im Laufe der Jahre verändert? Du trägst ja mittlerweileVerantwortung in verschiedenen Bereichen.
8: Beim ersten Film habe ich die Band keinen einzigen Tag gesehen. Hans hatmich begrüsst und dann in ein Zimmer gestellt mit den Toningenieuren. MeineAufgabe war es einfach zu spielen. Später, bei Projekten wie The Pledge, wardas Team viel kleiner, wir sassen oft alle zusammen in einem Aufnahmeraumund haben diskutiert. Durch die Ideen, die dabei entstanden, wurde auch seinInteresse geweckt. Nach zwei, drei kleineren Projekten hat er dann gemerkt,dass er mir mehr Verantwortung übertragen kann. Bei den letzten Filmendurfte ich zum Teil sogar von zu Hause aus arbeiten, vor allem bei The Ring(Gore Verbinski, USA 2002) und Black Hawk Down.
!% Was war für dich bisher der Höhepunkt deiner Filmmusik-Karriere?
8: Das war sicher Ali, bei dem ein Stück von meinem Album Eastern Twin füreine Szene verwendet wurde. Ursprünglich wurde die Musik für den Film vonLisa Gerrard gemacht; als sie dann auf mein Stück stiessen, wurde mir die Ver-antwortung für diese Szenen übertragen, was natürlich grossartig war, weil ichziemlich freie Hand hatte. Ich habe mich auch entgegen allen Befürchtungensehr gut mit dem Regisseur Michael Mann verstanden, der allgemein als sehrschwierig gilt. Allerdings fand ich den Film dann nicht völlig überzeugend. Erbleibt sehr an der Oberfläche und ähnelt stellenweise einem – wenn auch visu-ell beeindruckenden – Musikvideo.
!% Es gibt berühmte Kollaborationen, wie die von Angelo Badalamenti undDavid Lynch, wo die Musik bereits in einem sehr frühen Stadium des Projektsin den Arbeitsvorgang einfliesst und somit den Film, dessen Choreografie, seinTempo und seine Stimmung von Beginn an massgeblich beeinflusst. Sind dirsolche Arbeitsprozesse vertraut?
48
8: Sicher gibt es Regisseure, die so eng mit Filmkomponisten zusammenar-beiten, oder Regisseure, die schon am Set Musik laufen lassen, um die Stim-mung und die Bewegungen zu beeinflussen. Gerade Michael Mann macht dassehr gerne, und das sieht man einigen Szenen auch an. In Hollywood sind sol-che Regisseure aber sicherlich die Ausnahme.
!% Wie gehst du an ein Projekt heran?
8: Wenn das Video-Editing beendet ist, kommen wir ins Spiel und erhalten inder Regel fünf bis sechs Wochen Zeit, um die Musik zu komponieren, aufzu-nehmen etc. Meist steht bereits das Premieredatum fest. Da bei der Musik ehergespart werden soll, ist die Zeit knapp bemessen. Wir arbeiten unter grossemTermindruck, was aber nicht immer negativ ist. Die Arbeit ist effizienter, undder Regisseur hat nicht die Möglichkeit, noch tausend Änderungswünsche an-zubringen.
!% Ist es nicht manchmal frustrierend, nur das abliefern zu können, was in derverfügbaren Zeit entsteht?
8: Ich glaube eher, dass es eine Illusion ist, davon auszugehen, mit mehr Zeitwerde der Film besser. Oft ist es die Musik, die aus der ersten, spontanen Reak-tion entsteht, welche am besten funktioniert. Je mehr Revisionen gemachtwerden, desto schwieriger wird es, das Gefühl beim Sehen in Musik umzuset-zen. Wir kennen Leute, die mit bis zu 120 Revisionen arbeiten, das ist dann nurnoch mühsam.
!% Gibt es RegisseurInnen, die sagen, so und so stelle ich mir das vor, und wie-der andere, die finden, ihr sollt euch den Film mal anschauen und eure eigenenIdeen entwickeln?
8: Meist sind die Filme schon mit einem guten Temp-Track3 unterlegt, ausder die grundlegenden Vorstellungen des Regisseurs ersichtlich sind. Danachgeht es aber auch darum, den Film an sich zu verstehen und als Komponist ei-nen Weg zu finden, die Idee des Regisseurs mit den eigenen Ideen zu berei-chern, und nicht, sie zu korrumpieren. Generell werden uns bei den grossenProduktionen klare Grenzen gesetzt. Gerade Jerry Bruckheimer hat als Pro-duzent sehr genaue Vorstellungen von seinen Filmen und liebt es gross undamerikanisch, mit viel Schlagzeug und Trompeten und einem klaren HappyEnd. Es lässt sich mit einem Neubau vergleichen, der einfach gewisse Anforde-rungen erfüllen muss.
Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere Projekte wie The Pledge(Sean Penn, USA 2001), wo der grösste Teil der Arbeit Improvisation ist.
49
!" Bei Ali, Hannibal, MI-2 (John Woo, USA 2000) und Black Hawk Down istmir aufgefallen, dass eure Musik für so grosse Hollywood-Produktionen rela-tiv atypisch ist. In Hannibal etwa gibt es keine oder nur wenige musikalischeThemen, die mit den Figuren zusammenhängen, was sonst im klassischen Hol-lywood-Score sehr häufig ist: Z. B. wird in American Beauty (Sam Mendes,USA 1999) jede Figur mit einem eigenen Thema oder genauer mit einer eige-nen Klangfarbe verbunden ...
#$ ... oder mit einzelnen Instrumenten.
!" Bei Hannibal geschieht das nur bedingt, z. B. in der Figur des entstelltenOpfers Mason Verger. Immer wenn er auftritt, wird er mit «klischierter» klas-sischer Musik versehen, z. B. mit einem Walzer. Wie arbeitet ihr? Lasst ihr dasbewusst weg, oder denkt ihr euch Musik für die einzelnen Figuren aus?
#$ Hannibal war besonders Hans’ [Zimmer, L.D.] Baby. Er arbeitet natürlichsehr gerne atypisch, besonders bei Filmen, bei denen man auf Grund ihrerGenrezugehörigkeit eine besonders klischierte Musik erwartet, wie bei Hor-rorfilmen oder Thrillern. Er verwendet sehr gerne Musik, die eine gewisse Dis-tanz zu diesen Konventionen schafft. Ich habe dennoch genügend Horror-Celli bei Hannibal einspielen müssen. Grundsätzlich versuchen wir aber eheretwas zu finden, das den Film nicht auf einen Eindruck festnagelt, sondern seinGenre komplementiert.
Aber es ist sehr schwierig zu sagen, wie das Ganze genau vor sich geht. Esist immer auch eine Frage der eigenen Verfassung, der Situation, in der mansich selbst befindet, während man an einem solchen Projekt arbeitet. VieleFaktoren spielen eine Rolle.
!" Du sagtest, ihr hättet während der Arbeit an Black Hawk Down zum Teilim Studio übernachtet und rund um die Uhr gearbeitet. Steht ihr immer untersolchem Druck?
#$ Bei Black Hawk Down war das auch deshalb extrem, weil Hans wollte,dass wir uns wenigstens ein bisschen in die Stimmung des Films versetzen,der ja ein Kriegsfilm ist. Aber es kann auch sonst schon mal bis drei Uhr mor-gens dauern. Das sind unsere normalen Arbeitszeiten, aber nur während fünfbis sechs Wochen. Bei Black Hawk Down waren es vier Monate, das warschon hart. Man muss dann gut auf sich Acht geben, Vitamine nehmen etc.(lacht)
!" Wie war das mit dem berühmten musikalischen Thema zu Mission: Impossi-ble II, habt ihr das vom ersten Film so übernommen?
50
8: Soweit ich informiert bin, war das bereits die Melodie der TV-Version.Diese Melodie an sich ist natürlich schon zu einem Brand, einer Marke, gewor-den, und es ist unsere Aufgabe, gerade bei einem Sequel oder Remake diesemStück während des Films auch genügend Gewicht zu geben. Ansonsten habenwir versucht, so unbelastet wie möglich an die Fortsetzung heranzugehen.Nachahmen ist immer schlecht.
!% Auffallend bei den anderen Filmbeispielen ist, dass die Musik praktisch niein den Vordergrund gerückt wird. Sie ist wie im klassischen HollywoodkinoHintergrundinformation, aber doch nicht so belanglos, dass sie nicht wahrge-nommen wird. Eine Strömung, die sich im Hollywoodkino meiner Meinungnach schon länger beobachten lässt – z. B. in Road to Perdition (Sam Mendes,USA 2002) oder American Beauty – geht eher in die entgegengesetzte Rich-tung: Musik wird immer lauter und vordergründiger.
Auffällig ist die Zurückhaltung besonders bei der Stelle in Black HawkDown, als die Soldaten zu Beginn des Films in einem Hubschrauber sitzen undzu ihrem Stützpunkt zurückfliegen. Die Stelle ist unterlegt mit einem rocki-gen, pulsierenden Stück, von dem man jeden Moment erwartet, dass es über-hand nehmen wird. Zumindest haben mich meine Seh- resp. Hörgewohnhei-ten bezüglich Kriegsfilm zu der Annahme verleitet, die Musik würde voll auf-gedreht werden, sobald man den Hubschrauber von aussen sieht. Ihrunterbindet dieses Überhandnehmen der Musik, bewusst?
8: Als wir uns den Film das erste Mal mit seinem Temp-Track angeschaut ha-ben, war diese Rockmusik sehr im Vordergrund. Der Film wirkte wie ein Mu-sikvideo oder eine Werbekampagne für die Armee, à la «Join the Army!», oderwie Apocalypse Now oder Platoon. Er liess sich also nahtlos in die Reihe ande-rer Kriegsfilme einordnen.
In Apocalypse Now gibt es ja verschiedene Szenen, in denen die Musik aus-serordentlich prägend ist, nicht nur Rockmusik, sondern auch klassische, wiez. B. in der Szene, die mit Wagners Walkürenritt unterlegt ist.
Wir wollten einfach nicht, dass der Film eine gefährliche Mischung vonArmy und Rock’n’Roll wird, mit muskulösen Soldaten usw. Wir wollten auchnicht, dass der Film in dieser Hinsicht noch «amerikanischer» wird, als er oh-nehin schon ist. Der Film konzentriert sich ausschliesslich auf den Einsatz derAmerikaner, also auf die Soldaten. Die Einwohner Mogadischus bleiben imHintergrund, und man lässt sie nicht einmal einen ganzen Satz sagen, sie kom-men einfach nicht zu Wort. Wir versuchten, sie zumindest in der Musik zu re-präsentieren, und stellten eine afrikanische Band zusammen, bestehend aus ei-nem Schweizer, einem Deutschen und einem Asiaten! (lacht)
51
!% Wie muss ich mir das genau vorstellen? Habt ihr Stücke komponiert oderwurde mit verschiedenen Instrumenten improvisiert?
8: Ursprünglich war die Idee schon, den Sound relativ rockig zu halten. Auf-grund der bereits geschilderten Beobachtungen entschieden wir uns aber da-für, möglichst viele ethnische Instrumente zu integrieren. Wir experimentier-ten auch mit elektronischer Musik und bauten verschiedene Loops ein. Wirhatten zudem das Glück, ein relativ breites Klangspektrum verwenden zu dür-fen. Die Idee war, dem Film mit der Musik auch eine Wärme zu geben undnicht nachzudoppeln, indem wir auf das Publikum auch mit der Musik ein-hämmern. Ich glaube, das ist uns auch gelungen, weil der Film an sich, ohne dieMusik, diese Dimension eben gar nicht hat.
!% Ich war sehr erstaunt, dass es möglich war, in einem solchen Film mit derMusik so subtil zu arbeiten. War das eure eigene Idee, oder wurde es euch be-reits vom Produzenten oder Regisseur nahe gelegt, in diese Richtung zu arbei-ten?
8: Das war ja einerseits eine Produktion von Jerry Bruckheimer, der selbst ei-nen grossen Hummer fährt und Filme über die Armee, Top Gun, Armageddonund all diese Filme, liebt.4 Auf der anderen Seite steht dann Ridley Scott, der einsehr feinfühliger Regisseur und Mensch ist, der zwar grosse Filme macht, abereine sehr elegante Art hat, nur schon wie er mit den Leuten spricht. In einem Ge-spräch merkt man sehr schnell, dass man bei ihm etwas erreichen kann mit gutenIdeen. Er ist offen für Verbesserungsvorschläge, natürlich steht er auch nichtmehr unter einem so grossen Erfolgsdruck, er muss es Hollywood nicht mehrbeweisen, nach all seinen erfolgreichen Filmen. Oft ist es bei eher jungen Regis-seuren doch sehr anders, die stehen unter einem wahnsinnigen Druck, ihre Fä-higkeiten unter Beweis zu stellen, was für uns dann auch sehr mühsam seinkann. Unbekannte Regisseure sind viel abhängiger von den Produzenten, die beisolchen Projekten dann auch viel mehr zu sagen haben. Pirates of the Caribbeanwar so ein Fall. Bruckheimer versuchte, massiv Einfluss zu nehmen auf den rela-tiv jungen Regisseur. Dank Hans gelang es dann doch, einen Kompromiss zufinden. Das muss ich ihm wirklich zugute halten, denn er hat eine unglaublicheGabe, Menschen zu verbinden, und ein gutes psychologisches Gespür dafür,wie er sowohl den Produzenten, der 50 bis 100 Millionen Dollar investiert hat,als auch den Regisseur, der eine klare Vision hat, zufrieden stellen kann.
Blockbuster-Produktionen sind in künstlerischer Hinsicht recht hart. Wasgefordert wird, lässt sich eigentlich mit einem Formel-1-Rennen vergleichen:Wenn man gute Pneus hat, kann auch bei Regen nicht viel schief laufen, allesmuss kalkulierbar bleiben. Kleine Produktionen sind mir deshalb oft sympa-thischer.
52
!% Ist der Zeitdruck bei kleineren Produktionen geringer?
8: Das kann sein, muss aber nicht. Es kann in zeitlicher Hinsicht genausoknapp werden, wenn das Budget so beschränkt ist, dass man einfach nur wenigZeit fürs Studio hat. Allerdings ist die ganze Produktion oft transparenter, klei-ner und damit eben überschaubarer. Man gerät nicht so schnell in ein vorgefer-tigtes Produktionsschema. Bei Black Hawk Down arbeiteten wir in 21 Studiosmit 21 Protool-Systemen,5 was schon rein logistisch eine ungeheure Schwierig-keit darstellte. Das Ganze nimmt dann einen sehr schweren Körper an.
!% Wie wird das alles koordiniert?
8: Der Studiokern, der Mittelraum, ist der Aufnahmeraum, in dem wir spiel-ten. Gleich angrenzend sind vier Video-Edit-Räume, in denen das Gespieltesofort verwertet wird, indem die Editors es schneiden und zu möglichen The-men zusammenfügen, die sie gleich den zugehörigen Stellen unterlegen.
!% Direkt?
8: Ja, direkt. Drei andere Editors arbeiten mit herkömmlichen Temps.
!% Bedeutet «herkömmlich» aus bestehenden Sounds?
8: Genau, häufig aus bereits bestehenden Filmen und Stücken. Es ist oft inter-essant, eigene Kompositionen plötzlich in anderen Filmen wieder zu hören.Das Stück hat folglich funktioniert und wird sehr wahrscheinlich wieder ver-wendet werden.
!% Was passiert sonst noch in diesen Studios?
8: Bei Black Hawk Down arbeiteten wirklich grosse Schneideteams, da beidiesem Film vieles live gespielt wurde. Es bedurfte folglich grosser Arbeit, sichdie ganzen Tracks anzuhören, geeignete Stellen herauszuschneiden und zuStücken zusammenzufügen. Das funktioniert natürlich völlig anders, als wennman Stücke in Noten aufschreibt.
!% Die Musik ist also mehrheitlich improvisiert?
8: Ja, das Improvisierte wird nachher zu Themen zusammengefügt. Allerdingsergeben sich manchmal viel zu lange Themen, die nicht passen. Wir hatten kei-ne Zeit, die Stücke genau zu erarbeiten, aber mit Hilfe der Editors konnte manziemlich rasch herausfiltern, wie das Ganze klingen sollte. Wir improvisierten,
53
zwei Tage später gab es ein Tape und genaue Anweisungen, wie wir es noch-mals zu spielen hätten.
!% Wie viele Musiker waren daran beteiligt?
8: Wir waren fünf Musiker und hatten 21 Instrumente zur Verfügung. DreiSchlagzeuge sowie verschiedene Trommeln.
!% Wenn du deine Projekte vergleichst, kannst du sagen, dass es sich dabei umimmer wiederkehrende standardisierte Arbeitsabläufe handelt?
8: Nein, jedes Projekt ist anders. Jedes Mal ist es ein anderer Produzent, oderwir haben unterschiedlich viel Zeit zur Verfügung. Oft dreht der Regisseur be-reits einen neuen Film, während wir an der Musik arbeiten, so dass wir uns nureinmal in der Woche sehen. Diese Arbeit ist dann sehr entspannt. Manchmal istder Regisseur noch involviert, das bedeutet häufigere Konsultationen, mehrÄnderungswünsche, weniger Selbstständigkeit, wie dies z. B. bei Pirates of theCaribbean der Fall war. Oft ist den Regisseuren gar nicht bewusst, was es füruns bedeutet, nämlich jedes Mal eine Nachtschicht. Auch wenn es sich nur umeine bestimmte Note handelt oder um die Verlängerung eines Musikstücks beieiner Szene, macht das relativ viel Arbeit aus und wird für uns jedes Mal zurHerausforderung.
!% Wie bereitest du dich auf kommende Projekte vor? Weisst du schon, wanndu für welchen Film etwas einspielen musst?
8: Nein, eigentlich nicht. Meistens bin ich in der Schweiz am Kochen oder aufeinem Spaziergang, wenn das Telefon klingelt und eine Stimme am anderenEnde mir mitteilt, dass ich in vier Tagen in L. A. sein soll, um diesen oder jenenFilm zu vertonen. Diesen Sommer wurde ich von einem Komponisten kontak-tiert, der gerade an Bad Boys II (Michael Bay, USA 2003) arbeitete. Er teiltemir mit, dass er mich für zwei Tage brauchen würde, da Jerry Bruckheimermich bei diesem Projekt dabeihaben wollte. Ich nahm mir also vor, für etwavier Tage rüberzugehen. Als ich aber dort ankam, war der Komponist, dermich eingestellt hatte, bereits wieder entlassen worden. Ich musste also eineWoche warten, bis der nächste Komponist gefunden war.
!% Da werden also Komponisten wild ausgetauscht?
8: Ja, das ist gar nicht so unüblich. Bei diesem Film waren es am Ende drei ander Zahl, und ich bin so ziemlich der Einzige, der die ganze Zeit über daran be-teiligt war.
54
!% Weshalb werden die Komponisten entlassen?
8: Meistens sind es persönliche Gründe. Im Falle von Bad Boys II war MarkMancina bereits beim ersten Film für die Musik verantwortlich gewesen. Al-lerdings wohnte er zu weit weg, zwei Stunden ausserhalb von L. A. Man ver-langte deshalb, er müsse in die Stadt kommen, es komme nicht in Frage, dieAufnahmen ausserhalb zu machen. Mancina aber hatte keine Lust, sich deswe-gen an die Produktionsfirma zu verkaufen, und liess es lieber bleiben. Ausser-dem fand man, seine Musik klinge zu alt. Sie wollten etwas Modernes, Neuesund nicht etwas, das gleich klang wie beim ersten Film. Mancina hatte zu die-sem Zeitpunkt bereits für 60 Minuten des Films Musik komponiert.
!% Aber wie funktioniert denn in so einem Fall die Kommunikation? Weissman da von Beginn an, wie es klingen soll, und teilt man dies dem Komponis-ten mit, oder improvisiert man ein bisschen und lässt ihn machen, bis manmerkt, das war wohl nichts? Wenn es so ist, erscheint mir das doch bemerkens-wert, wenn man bedenkt, mit welchen Budgets wir es hier zu tun haben.
8: Das Auswechseln von Mancina kostete sie eine Million. Aber das ist ver-hältnismässig wenig Geld für solche Produktionen, in denen 30 Sekunden Spe-cial Effects bereits diese Summe verschlingen. Man hat sich an solche Ausga-ben gewöhnt, so dass das Ersetzen Mancinas keinen grossen finanziellen Ver-lust darstellte. Natürlich ist das wahnsinnig, besonders wenn man bedenkt,wie dann bei anderen Sachen doch möglichst viel eingespart werden soll. Gera-de in der Filmmusik gibt es viele, die schauen müssen, dass sie davon lebenkönnen.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Die Job-Vergabe läuft natür-lich meist über persönliche Kontakte. Es kommt vor, dass ich jemanden in L. A.treffe oder dass ich bei Hans vorbeigehe, und der arbeitet gerade an einem Pro-jekt, in das ich eingespannt werde.
!% Arbeitest du immer mit Hans zusammen?
8: Nicht immer, gerade bei Bad Boys II oder bei einem anderen Film, TheRoad to El Dorado (Bibo Bergeron et al., USA 2000), habe ich eigenständiggearbeitet. Aber besonders in den letzten vier Jahren arbeitete ich vorwie-gend mit Hans zusammen. Unsere Zusammenarbeit ist in vielerlei Hinsichtziemlich exklusiv, und ich geniesse das sehr. Einerseits sammle ich Erfahrun-gen punkto Komposition und Spiel, gewinne aber auch Einblicke in das gan-ze System.
!% Er ist ja auch sehr gut etabliert.
55
8: Hans ist nicht nur Komponist, er ist auch Agent. Er ist Head of Music beiDreamworks und entscheidet damit für alle Dreamworks-Filme, welcheKomponisten angestellt werden. Damit ist sein Einfluss bestimmt nicht zu un-terschätzen.
!% Und wie ist das mit Jerry Bruckheimer? Das ist doch bestimmt auch einerder exklusiven Kontakte in Hollywood.
8: Natürlich. Jerry produziert eigentlich keine Filme, an denen Hans nicht inirgendeiner Weise beteiligt ist, sei es als Komponist oder als Produzent. Ichempfinde das manchmal als ziemlich hart, besonders für junge Komponisten,denen ich wünschen würde, dass sie mehr Chancen kriegten oder dass die be-reits so Mächtigen mehr an Jüngere abgeben würden. Das Hierarchiedenken inHollywood ist aber sehr stark, jeder möchte der Erste sein.
Das hat mir besonders zu Beginn meiner Arbeit in Hollywood Mühe be-reitet. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Durch meine Zusammen-arbeit mit Hans habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich relativ sorgen-frei meinen eigenen Kompositionen zu widmen. Ich geniesse die Zeit zwischenden Projekten und habe aufgehört, das Ganze so ernst zu nehmen – ich musseigentlich oft über gewisse Verhältnisse in Hollywood lachen. Ich wäre wohlauch nicht glücklich, ständig vor Computern zu sitzen und irgendwelche Fil-me zu vertonen. Denn ich bin grundsätzlich daran interessiert, gute Musik zumachen.
!% Befriedigt dich deine Arbeit?
8: Ja, auf jeden Fall. Sonst würde es nicht funktionieren.
!% Aber ist es nicht manchmal frustrierend, ein kleines Rädchen in dieserTraumfabrik zu sein?
8: Klar gibt es Projekte wie z. B. Pirates of the Caribbean, bei denen du in ei-nem kleinen Aufnahmeraum mit irgendwelchen Toningenieuren zusammen-arbeitest, die dir täglich die neusten Stücke aus dem Studio-Network runterla-den, zu denen du dann deine Cello-Soli spielen musst. Dies ist bestimmt nichtsehr interaktiv und stimulierend, aber andererseits versuche ich, immer das Be-ste daraus zu machen und mich mit all meiner Energie auf die Arbeit zu kon-zentrieren. Für mich bleibt es jedes Mal eine Herausforderung.
Auch wenn ich nur einen kleinen Teil der Arbeit mache, ist es mir wichtig,in der jeweiligen Situation das Bestmögliche abzuliefern, sei es spieltechnischoder auch energetisch. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen.
56
57
Anmerkungen
1 Darunter Spirit: Stallion of the Cimarron(2002), Pearl Harbor (2001), Hannibal (2001),Gladiator (2000), The Thin Red Line (1998),As Good as it Gets (1997), Smilla’s Sense ofSnow (1997), The Fan (1996), The Lion King(1994), The House of the Spirits (1993), TrueRomance (1993), Thelma & Louise (1991),Driving Miss Daisy (1989), Rain Man (1988).Alle Filme wurden in den USA produziert.
2 Bruckheimer wird nebst seinem grossenEinfluss in Hollywood auch die Erfindung desBuddy Movies zugesprochen. Zu seinen Pro-duktionen gehören Pirates of the Caribbean:The Curse of the Black Pearl (2003), Black
Hawk Down (2001), Pearl Harbor (2001), Ar-mageddon (1998), Con Air (1997), The Rock(1996), Top Gun (1986), Flashdance (1983),American Gigolo (1980), um nur einige seinerberühmtesten zu nennen.
3 Eine provisorische erste Musikspur.
4 Bekannteste Äusserung gemässwww.imdb.com: «We are in transport busi-ness. We transport audiences from one place toanother.»
5 Protool ist ein amerikanisches Pendantzu Logic, einer Audio-Produktions-Software.
!"#!"#" $%&'()*+#
,-./.0123-.2%4567
8/4945:;2<5=2"<>5:[email protected]:;3./2=.12=4943:;.52'<3A:5=AB:13.
Seit den futuristischen Tonexperimenten zu Beginn des letzten Jahrhundertswerden Klangobjekte künstlich erzeugt oder bis zur Unkenntlichkeit verfrem-det. Neben der ursprünglich dokumentarischen Funktion von Tonaufnahmenhaben sich andere Formen entwickelt, von der abstrakten Geräuschkompositi-on bis hin zur fiktionalen Konstruktion intergalaktischer Klangwelten, vonTräumen oder Halluzinationen.
Die Fiktion begibt sich jedoch auf brüchiges Terrain, wenn sie den ver-trauten Horizont der Alltagserfahrung verlässt. Wenn ein Sounddesigner wieMark Mangini tibetanischen Mönchsgesang zum Vorbeirauschen eines Raum-schiffs transformiert oder Richard Beggs aus dem Geräusch von industriellenMetallscheren ein Atmen mit subtilem metallischem Touch bastelt, muss dieFrage der Beziehung zwischen Original und Abbildung neu gestellt werden.
Klassische Positionen
Von Balázs über Metz bis Kittler haben Filmtheoretiker die These vertreten,dass der Filmton in der Kette seiner Aufnahme und Wiedergabe keiner Verän-derung unterworfen sei. «Im Prinzip», so Metz, «gibt es keinen Unterschiedzwischen einem Schuss, den man in einem Film hört, und einem Schuss auf derStrasse.»1 Balázs hat diesen Gedanken sogar noch konkreter formuliert: «DerTonoperateur hat nicht die Möglichkeit, den gleichen Ton, seiner künstleri-schen Persönlichkeit entsprechend, auf verschiedene Art darzustellen.»2 Noch1989 taucht bei Kittler3 ein ähnlicher Gedanke auf, mit dem Ziel zu beweisen,dass Tonmeister nicht schöpferisch tätig sind, sondern höchstens im Rahmeneines weitgehend automatisierten Prozesses eine steuernde Funktion ausüben.Diese Auffassung ist immer noch weit verbreitet und von verheerender Konse-quenz auch für die Praxis. Denn aus diesem Grund sind Sounddesigner von al-len Urheberrechtsansprüchen bis heute ausgeschlossen.
Kunst wird in den zitierten klassischen Positionen als ein Filterungs- undTransformationsprozess verstanden. Auf der einen Seite stehen die Phänome-
58
ne der physikalischen Welt, einer wie auch immer wahrgenommenen Wirk-lichkeit, auf der anderen Seite das Kunstprodukt, in das sich eine subjektiveWeltsicht des schöpferischen Individuums einschreibt. Diese Theoretikersprechen der Tonaufzeichnung einen künstlerischen Mehrwert ab, weil sie imAufnahme- und Wiedergabeprozess keine geometrische Dimension verliert.Sie erheben somit die phänomenologische Betrachtung eines einzelnen physi-kalischen Aspekts zum alles entscheidenden Kriterium.
Selbstverständlich ist es nicht möglich, im Rahmen dieses Aufsatzes dieganzen abbildungstheoretischen Fragestellungen erschöpfend zu behandeln.4
Vielmehr werde ich einige Aspekte dieser Debatte auswählen und auf demHintergrund der gegenwärtigen Praxis diskutieren.
Nun hat sich in eben dieser Abbildungstheorie ein Katalog von Kriterienherausgebildet, die auch dem Alltagsverständnis zugänglich sind.
(:<1:;43C31D.E4.-<59
Zunächst geht man davon aus, dass es eine Kausalitätsbeziehung gibt. Mannimmt als Zuschauer/Hörer an, dass am Anfang eine Originalszene stand – einObjekt oder Ereignis – das als Sujet für die Abbildung dient, zum Beispiel derSchuss bei Metz. Die Aufnahme wäre dann die Spur einer vergangenen Wirk-lichkeit. Die Kausalitätsbeziehung ist jedoch nicht hinreichend, weil sie alleinkeine getreue Wiedergabe garantieren kann. Die Tonaufnahme eines Schusseskann bei Übersteuerung wie ein gigantisches Knattern klingen, bei Unter-steuerung wäre hingegen nur ein leises «Plopp» zu hören.
Zweitens ist die Kausalitätsbeziehung nicht notwendig; dies gilt im Beson-deren für neuere Technologien der virtuellen Bild- oder Tonproduktion.Klangobjekte können am Synthesizer simuliert werden – zum Beispiel dasSchlagen der Rotorblätter eines Hubschraubers oder das Sausen des Windes –,oder man kann sie auf einer drucksensitiven Monitorfläche zeichnerisch ent-werfen.
Drittens wird in der Praxis des Sounddesigns die Kausalitätsbeziehungmeist durch Substitution aufgelöst, wie das rhythmische Klappern von Kokos-nussschalen als Ersatz für Pferdegetrappel.
Ein Beispiel aus Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, USA1991) soll diesen Substitutionsprozess beschreiben. Dort stellt sich die Frage,wie man einen Cyborg, ein hybrides Mensch-Maschinen-Wesen, in halbflüssi-gem Zustand klanglich charakterisieren kann. Wenn es darum geht, solcheDrehbuchideen und optische Tricks mit einem Klangobjekt zu versehen, hatdie Stunde der echten Audiophilen geschlagen: «Ich versuchte, Effekte vonFlüssigkeiten auf eine besondere Art aufzunehmen. Deshalb spielte ich mitHundefutter herum und liess es aus der Dose gleiten, was ein metallisch-flüssi-ges Geräusch erzeugt, das ich besonders mag. Man dreht die Dose um, sodass
59
das Hundefutter mit einem saugenden Geräusch herausrutscht. […] Ausser-dem hielt ich einen Topf voll Schlamm, einer Mischung aus Mehl und Wasser,zwischen meinen Knien, tauchte ein Mikrofon hinein, das ich zuvor in ein Prä-servativ eingepackt hatte, und sprühte mit einem Dust-Off-Spray Luft in dieseMasse, bis sich Blasen bildeten. Während sich die Blasen entwickeln, entstehtein Geräusch, das ähnlich klingt wie diese Cappuccino-Milch-Aufschäumer.Es hat eine zugleich metallische und flüssige Eigenschaft, die sich zudem sehrschön in der Zeit verändert.»5
F-5;4G-6.43
Um die drohende Gefahr eines Misslingens der Abbildung abzuwenden, solleine Abbildung dem Original ähnlich sein. Wir erwarten mit anderen Worten,dass wir das Sujet der Abbildung wiedererkennen. Dieser Aspekt des Wieder-erkennens nimmt unmittelbar auf ein gegebenes Weltwissen des RezipientenBezug. Wir können nur wiedererkennen, was uns schon einmal begegnet ist.Zur Konstruktion phantastischer Objekte oder Welten muss die kinematogra-fische Abbildung über ihre mehrfach kodierte Anlage – Bild, Text, Klangob-jekte – die Ähnlichkeit selber erzeugen, indem sie eine Beziehung zu bereitsetablierten Objekten, Verhaltensweisen oder Ereignissen herstellt. Das kannzum Beispiel über die Sprache geschehen. Wenn von einem unbekannten Ob-jekt gesagt wird: «Dies ist ein Laserschwert», so ordnet die sprachliche Benen-nung das Objekt in das bereits bestehende Konzept «Waffen» ein.
)53.534H5
Die Intention ist eine übergeordnete Instanz, welche das Ensemble sämtlicherakustischer Erscheinungen im Hinblick auf seine erzählerischen und formalenFunktionen koordiniert. Dabei beeinflusst der Verwendungszweck den Auf-nahme- und Weiterverarbeitungsprozess massgeblich.
Wenn Sounddesigner seit Ende der Siebzigerjahre das perfekte Klangbildvon Studioaufnahmen wohldosiert zerstören, um einen mangelhaften doku-mentarischen Ton zu simulieren und damit eine höhere Form der Authentizi-tät auszudrücken, so reagieren sie damit auf den Konditionierungsprozess dermedialen Abbildung. Störgeräusche wie Rauschen, Kratzen und Knistern sindlängst Indizien des Dokumentarischen geworden, besonders dort, wo diesesDokumentarische erzählt, also konstruiert werden soll.
Die Abbildungen sind nicht einfach da, sondern sie werden geschaffen, umim Kontext einer Narration interpretiert zu werden. Bei der Analyse einesKorpus von nahezu hundert US-amerikanischen Mainstreamfilmen habe ichkein einziges Schussgeräusch gehört, das nicht durch den narrativen Kontextgerechtfertigt war. Niemals ist beispielsweise ein Schauplatz, an dem sich eine
60
Liebesgeschichte entwickelt, zufällig in der Nähe eines Schiessstandes angesie-delt, obwohl ein solches Nebeneinander in der natürlichen Welt durchaus vor-stellbar wäre und somit plausibel ist.
(H53.I3
Im Rahmen der Intention schaffen die Filmemacher einen Kontext, in dem sichdie Bedeutung jedes einzelnen Elements der filmischen Narration im Austauschmit den anderen Elementen entwickelt. «Der Austausch von Information ist imGegensatz zum Austausch von Energie äusserst kontextabhängig. […] DerKontext der ursprünglichen Quelle ist grundverschieden von dem des reprodu-zierten Signals. Das Konzept der Wiedergabetreue stellt die Qualität der Auf-nahme ins Zentrum und lässt darum völlig ausser Acht, dass der Kontext vonOriginal und reproduziertem Ton nicht identisch sein kann.»6 Ein unspezifi-sches Rauschen kann man zum Beispiel durch geeignete Kombination mit ande-ren Ton- und Bildelementen in das Geräusch von Wind in den Bäumen, von Re-gen oder einer Lüftung transformieren. Klangobjekte sind aus diesem einfachenGrund nach der Montage nicht mehr das, was sie bei der Aufnahme waren, son-dern es kommt zu komplexen Auflösungs- und Verschmelzungsprozessen.
Eine Matrix der Abbildungsbeziehungen
Edison hat den Fonografen erfunden, um Schall zu dokumentarischen Zwe-cken aufzuzeichnen. Rund dreissig Jahre später – in den Zehnerjahren des 20.Jahrhunderts – kam die Idee auf, Aufnahmen von Geräuschen nach musikali-schen Prinzipien anzuordnen, sie zu musikalisieren. Als nicht minder bedeut-sam erwies sich die dritte Entwicklungslinie der Tonaufnahme, die Konstruk-tion fiktionaler Welten in Theater, Hörspiel und Kino. In diesen drei Linien –Dokumentation, Musikalisierung und Fiktion – werden verschiedene Kon-zeptionen der Schallaufzeichnung wirksam. Die klassischen Positionen derTheoretiker beziehen sich jedoch nur auf die Dokumentation von Schallereig-nissen. Mein Augenmerk gilt im Gegensatz dazu hauptsächlich der Konstruk-tion von fiktionalen Welten.
Wenn wir also diese drei Entwicklungslinien nach den Kriterien für einenAbbildungsprozess durchforsten, der vom Rezipienten als gelungen wahrge-nommen wird, ergibt sich folgendes Bild:
Dokumentation Musikalisierung Fiktion
Kausalitätsbeziehung X – –
Ähnlichkeitsbeziehung X – X/?
Intention X X X
61
Eine Kausalitätsbeziehung wird überhaupt nur noch bei der dokumentari-schen Aufzeichnung von Schallereignissen vorausgesetzt, wenn auch nicht un-bedingt realisiert. Längst werden Dokumentarfilme ähnlich komplexen Ton-bearbeitungen unterworfen wie erzählerische Genres.
Hingegen wird nicht nur in Dokumentationen, sondern auch in fiktiona-len Genres eine Ähnlichkeit zwischen Original und Abbild erwartet, damit dieVerständigung mit dem Rezipienten gelingt. Eine solche Beziehung wird je-doch kritisch, wenn unbekannte oder phantastische Welten dargestellt werdensollen, die Stimme Gottes, ein übersteuerter Dilythiumkristall oder das mark-erschütternde Gebrüll des Tyrannosaurus Rex.
Nehmen wir als Beispiel das viel zitierte Laserschwert aus Lucas’ Star-Wars-Welt. Ausgeschaltet sieht es aus wie ein kurzer Metallstock oder eine Ta-schenlampe, eingeschaltet wie eine leuchtende Neonröhre. Die Ähnlichkeit,auf welche der Sounddesigner Ben Burtt das Klangobjekt aufbaute, war dieVerwandtschaft von Leuchtstoff- und Kathodenstrahlröhre. Burtt nahm des-halb ein nicht funktionierendes Fernsehgerät, das ein unangenehmes Summenproduzierte. Dieses Summen spielte er einem Lautsprecher zu, vor dem er miteinem Interferenz-Richtmikrofon, einem Sennheiser MKH 816, die Bewegun-gen bildsynchron ausführte. Darüber erzeugte er ein Phasing.7 Zusätzlichmontierte er zu den Berührungen knisternde Akzente.
Während Kausalität und Ähnlichkeit in fiktionalen Genres stützende Pfei-ler einer akustischen Abbildung sind, nimmt die Intention eine zentrale Stel-lung ein. Sie ist das alles entscheidende Kontrollorgan dafür, dass eine Abbil-dung im Rahmen des medialen Kunstprodukts sinnvoll und akzeptabel er-scheint. Zu beobachten ist mit anderen Worten eine Verschiebung weg vomPhänomen – der phänomenalen Kausalitäts- und Ähnlichkeitsbeziehung – hinzur Bedeutung.
Wie die Abstraktion in die Fiktion Einzug hielt
Im Lauf der Geschichte des Filmtons wird ein interessanter Prozess sichtbar.Produktion und Abbildung nähern sich einander an, bis sie sich vereinen. Mit-te der Siebzigerjahre begannen findige Soundtüftler wie Ben Burtt, FrankWarner, Richard Beggs oder Walter Murch mit primitiven technischen Mittelnmehrschichtige Klangkonzepte zu planen und deren Bausteine in mühevollenTrial-and-Error-Prozessen herzustellen. Überraschenderweise taten sie nichtsRevolutionäres, sondern führten zwei Traditionen zusammen, die währendlanger Zeit in verschiedenen medialen Umfeldern gewachsen waren: die ab-strakte Klangproduktion und die Klangsubstitution.
Kompositorisches Schaffen mit Geräuschen wurde erstmals von den italie-nischen Futuristen – einer Gruppe aus Malern, Dichtern und Musikern – zu
62
Beginn des 20. Jahrhunderts propagiert. F. T. Marinetti besang bereits im ers-ten futuristischen Manifest (1909) «das dröhnende Geräusch der grossenzweistöckigen Strassenbahnen, das Knacken der Knochen der sterbenden Pa-läste und das Aufbrülllen hungriger Autos.» Luigi Russolo stellte die Geräu-sche künstlich her. Er entwickelte zusammen mit dem Maler Ugo Piatti so ge-nannte Intonarumori, grosse mechanisch-akustische Klangerzeuger. Die Ar-beit mit Aufnahmen natürlicher Geräusche scheiterte damals nicht nur an derunausgereiften Technik; in Russolos Augen war es eine Notwendigkeit, dasGeräusch aus dem referenziellen Bezug zur Wirklichkeit zu lösen, um es fürdie kompositorische Arbeit zu benützen. Die Geräusche, einmal aus der Refe-renzialität befreit, sollten aufeinander abgestimmt und harmonisch angeordnetwerden, indem die vorherrschenden Klangaspekte miteinander korrespon-dierten, ohne ihre Unregelmässigkeit und Wildheit einzubüssen.
Weiter etablierte sich im Kontext der Radio-Kunst in Deutschland seit1924 die kompositorische Arbeit mit Geräuschen. Eines der frühesten Beispie-le ist Hans Fleschs Zauberei auf dem Sender, welches mit Kontrasten, unmoti-vierten Toneffekten und verzerrten musikalischen Tempi den Machtkampfzwischen dem künstlerischen Direktor eines Senders und einem Zauberer dar-stellte. Hörbilder – die klangliche Darstellung von Orten – ebenfalls vonFlesch und seinem Nachfolger Hans Bodenstedt folgten. 1926 nannte AlfredBraun seine Produktion Der tönende Stein einen akustischen Film. Unter demEinfluss von Bert Brecht propagierte der Komponist Kurt Weill eine absoluteRadio-Kunst, welche Tier- und Menschenschreie, natürliche Geräusche vonWind und Wasser sowie künstliche Geräusche mit musikalischen Rhythmenund Melodien verbinden sollte.8
Bekanntestes frühes Beispiel einer Geräuschkunst ist Walter RuttmannsWeekend (D 1930). Weekend, ein Film ohne Bild, ist eine stellenweise witzigeund – angesichts der technischen Limiten – sehr gekonnte Montage von Klang-objekten auf Lichtton. Neben der semantischen Kohärenz, die dem Themaentlang verschiedene Stationen eines Wochenendes andeutet, entwickelt Rutt-mann klangliche Stränge, die sich aus der rhythmischen Anordnung ähnlichklingenden Materials ergeben. Dazu gehören Sequenzen von perkussiven undstampfenden Maschinen- und Handwerksgeräuschen mit Registrierkassenund startenden Motoren.
Zwanzig Jahre später – 1948 – bezeichnete Pierre Schaeffer solche Kompo-sitionen mit konkretem, das heisst in der Umwelt vorgefundenem akustischemMaterial als Musique concrète. Verfremdet und rhythmisiert wurden die Ge-räusche in einem neuen Kontext montiert. Die Rhythmisierung von einzelnenKlangobjekten war eines der Hauptverfahren, mit denen in der Musique con-crète das Klangmaterial musikalisiert wurde.
Die Klangsubstitution auf der anderen Seite hat eine wesentlich längereGeschichte als die abstrakte Klangproduktion. Sie reicht bis in die Antike zu-
63
rück. Schon im Theater der Griechen kamen hydraulische Tonmaschinen zumEinsatz, wurden Donner und Wind künstlich, wenn auch mechanisch produ-ziert. Schon früh musste also jemand festgestellt haben, dass grosse Metallku-geln wie Donner klingen, wenn sie durch Röhren rollen. Ob dieser Entwick-lungsprozess der Intuition folgte oder das Produkt einer gezielten Suche war,lässt sich nur partiell beantworten. Immerhin gibt es Dokumente eines Heronvon Alexandria, der schon im 1. Jahrhundert vor Christus verschiedene Appa-rate zur Klangproduktion entworfen hatte. Besonders im Barock wurden sol-che und ähnliche Techniken weiterentwickelt und verfeinert, während gleich-zeitig in der Musikkomposition mit Klangmalereien ein bildhafter Bezug zurlebensweltlichen Erfahrung geschaffen wurde. 1914 entwirft De Serk in sei-nem kleinen Traktat mit dem Titel «Les bruits de coulisses au cinéma» einenGrundstock an Klangsubstitutionen, von Naturlauten bis zu akustischenSchlachtengemälden, mit denen ein Geräuschemacher die Stummfilme imKino live vertonen sollte.9 Notabene beschreibt De Serk Techniken, die bisheute Bestand haben.
Neu an den Verfahren, die in den Siebzigerjahren analog eingeführt wur-den, waren mehrschichtige Klangobjekte, die aus kleinräumigen Elementenbestanden. Die geplanten Klangobjekte wurden analytisch in ihre Bestandteilezerlegt, diese Bestandteile in einem Produktions-, Aufnahme- und Schnittpro-zess hergestellt und zu einem Wahrnehmungsgegenstand zusammengefügt,zum «Laserschwert», zum «Hubschrauber», zum «halbflüssigen Cyborg».Die historisch gewachsene Eins-zu-eins-Substitution – klappernde Kokos-nussschalen gleich Pferdegetrappel, wabbelnde Bleche gleich Donnergrollen –wich einer komplexen Abbildungsbeziehung, die in ihren Grundmechanismenmit der gegenständlichen Malerei vergleichbar ist. Man kann dort eine Farbenehmen, die einer Schattierung des Objekts entspricht oder sich auch in künst-lerischer Freiheit davon unterscheidet, und damit eine Fläche, einen Strichoder einen Punkt malen, der sich später mit anderen Flächen, Strichen oderPunkten zu einem Bild des Objekts zusammenfügen wird. In ähnlicher Weisekönnen die Elemente eines Klangobjekts miteinander in eine Beziehung treten.Im Unterschied zur Malerei kommt im Klangentwurf zusätzlich die Zeitdi-mension ins Spiel: Die Elemente können sowohl synchron – wie ein Akkordgleichzeitig – als auch diachron – in der Zeit – eine Gestalt bilden.
Das Verfahren lässt sich sehr schön anhand eines der berühmtesten Klang-objekte der Filmgeschichte, des Hubschraubers aus Apocalypse Now (FrancisFord Coppola, USA 1979), darstellen. Der Sounddesigner Richard Beggs stell-te die Teilkomponenten des Hubschraubergeräuschs – das Schlagen der Ro-torblätter, das hochfrequente Heulen der Turbinen und das Motorengeräuschvon brummend bis rauschend – teils auf dem Synthesizer her, teils indem erKomponenten substituierte, z. B. das Schlagen der Rotorblätter durch einBlatt Papier, das er in einen Ventilator hielt. Kombiniert mit realen Aufnah-
64
men konnte er auf diese Weise eine beeindruckende Vielfalt von Hubschrau-bertönen zusammentragen, die sowohl erdrückend authentisch oder äthe-risch-surreal wirken können.
Auflösung und Verknüpfung / Cut-and-Paste
Mit diesem Gestaltungsprozess des Zerlegens und Neu-Zusammenfügens, desCut-and-Paste, bildet das Sounddesign in frappierender Weise ein Verfahrennach, das in den derzeitigen neuropsychologischen Konzeptionen für diemenschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung angenommenwird. Man stellt sich heute solche mentalen Konzepte als konnektionistischeRepräsentationen oder so genannte neuronale Netze vor. Ein solches Netz be-steht aus einer Vielzahl von Knoten, die Merkmale repräsentieren. DieseMerkmale sind sehr klein dimensioniert, könnten also beispielsweise einer ein-zelnen Frequenz eines komplexen Klangs entsprechen. In dieser Vorstellungaktiviert das Gehirn ad hoc neuronale Verbindungen zwischen den einzelnenKnoten. Die mentalen Repräsentationen im Langzeitgedächtnis werden zu-dem laufend anhand neuer Erfahrungen verändert und angepasst. Der Ein-druck von Stabilität dieser Konzepte entsteht durch eine Mittelwertbildungüber viele Personen, Situationen und Aufgaben. Ausserdem können diese kon-nektionistischen Netze unterschiedlich gut verankert sein. Damit kommt einAspekt ins Spiel, der für die weitere Betrachtung wichtig sein wird: die Schärfevon mentalen Repräsentationen bzw. Abbildungen.
Je öfter ein bestimmtes neuronales Netz aktiviert wird, desto ausgeprägterentwickeln sich die plastischen Konnektionen, welche die einzelnen Knotenmiteinander verbinden. Das bedeutet, dass mit zunehmender Erfahrung dieAktivierung dieses Musters immer schneller und automatischer verläuft unddas Muster somit schärfer erscheint, nicht zuletzt, indem es Merkmale, die sichausschliessen – zum Beispiel «rund» und «eckig» – über hemmende, so ge-nannt inhibitorische Verbindungen aktiv ausklammert. Aus zwei Gründen istdas Geräusch einer Sirene ein Beispiel für ein scharfes Konzept. Es ist im Alltagnicht nur von hoher Relevanz, sondern verfügt auch über eine eindeutige phy-sikalische Struktur, welche die Informationsverarbeitung durch das Gehirn er-leichtert.
Auf der anderen Seite der Skala befinden sich extrem unscharfe Konzepte,ich nenne sie UKO, unidentifizierbare Klangobjekte. Die unterbrochene Ver-bindung zur Quelle ist ein Hauptcharakteristikum des UKO, das heisst, eineQuelle ist weder im Bild sichtbar, noch wird sie aus dem Kontext erkenntlich.Ausserdem wird dem Rezipienten auch die Hilfestellung des Wiedererken-nens verweigert, so dass es im Allgemeinen nicht zu einer Reduktion derMehrdeutigkeit kommt. Im Akt der Wahrnehmung und Informationsverar-
65
beitung werden bei unscharfen Konzepten keine Verbindungen zwischen deneinzelnen Merkmalen aktiv, das UKO spricht kein bereits bestehendes Musteran. Ein typisches Beispiel für ein solch unscharfes Konzept ist ein undefinier-bares breitbandiges Rauschen. In die Kategorie UKO gehören auch ein unspe-zifisches Zischen oder das generische Rumpeln, das im Film oftmals dann hin-geklebt wird, wenn eine Gefahr droht.
Das Miauen einer Katze oder das Geheul einer Sirene ist wesentlich weni-ger kontextsensitiv als das eben angesprochene bassige Grummeln. Ein undefi-nierbares Zischen kann eine Vielzahl von Aktionen vertonen, von Türeschlies-sen bis hin zur Kennzeichnung von allen möglichen Bewegungen, etwa sogardie jeder einfachen Powerpoint-Präsentation. Das heisst, es geht mit verschie-denen denkbaren Situationen und Klangkontexten sofort Verbindungen ein.Diese erhöhte Kontextsensitivität nützt der Sounddesigner aus, indem erKlangobjekte planvoll zerstört, mithin aus scharfen Konzepten unscharfeTeilkonzepte herstellt, nur um sie im nächsten Schritt, der Tonmontage, in ei-nen neuen Zusammenhang zu stellen, in dem sie Teilkonzepte eines neuen, in-tendierten Klangobjekts werden.
Diese Praxis des Sounddesigns ist von einiger Konsequenz für die auditiveWahrnehmung des Films. Digitale (Re-)Konstruktionen entbehren jeder Per-spektive, oder genauer, sie gehen durch ein Stadium der Perspektivlosigkeit,das erst dann beendet ist, wenn sie in der Mischung fixiert und ein für allemal indie Tonspur integriert worden sind. Während des Prozesses der Fragmentie-rung und Neukonstruktion existieren die Klangobjekte in der Vorstellungs-kraft des schöpfenden Sounddesigners und in physischer Gestalt nur als ab-strakte Modelle. Zerlegt in ihre Einzelteile, die oft nur wenige Merkmale auf-weisen, durchlaufen sie eine Entwicklung, in der alle ihre räumlichen undzeitlichen Verankerungen aufgelöst sind, es keine Vergangenheit und keineZukunft zu geben scheint und alles möglich ist. Um es konkreter zu formulie-ren: Nicht mehr die Herkunft – egal ob Hundefutter, Metallschere, Mönchsge-sang oder Tierschrei – bestimmt die weitere Entwicklung eines Klangobjekts,sondern allein die flottierende Phantasie eines Sounddesigners.
Zur Abstraktion der Wirklichkeit: digitalisierte Merkmale
Längst hat sich die filmische Klangproduktion vom funktional bestimmtenErzählgestus des klassischen Hollywoodfilms wegentwickelt. Während dieTonspur dort in erster Linie dazu diente, die bildlich dargestellte Welt mitklanglichen Mitteln zu stützen, sie wirklicher und besonders auch kontinuier-licher erscheinen zu lassen, sind seit Einführung der Mehrspurformate in denFünfzigerjahren, besonders aber seit den Siebzigerjahren eine Vielzahl vonkomplexen Funktionen dazugekommen. Zwar steht die indexikalische Bezie-
66
hung zu dargestellten Handlungen und Objekten immer noch im Vorder-grund. Denn es geht immer auch darum, mit klanglichen Mitteln zu erzählen,und es ist immer noch unabdingbar, dass einige Klangobjekte auf die Gescheh-nisse der filmischen Erzählung hinweisen. Gleichzeitig – und dieser Funktionüberlagert – feilen die Sounddesigner mit Akribie an der sensorischen Dimen-sion, bauen subtile materielle Nuancen ein, tunen das Geräusch in Überein-stimmung mit der klassischen Harmonielehre oder aber in entschiedenemKontrast dazu. Das klassische Pferdegetrappel – vom Geräuschemacher imStudio hergestellt, also maximal standardisiert – hatte nur die Aufgabe, demPferd im Bild eine akustische Dimension beizufügen, die nichts anderes aus-sagte als «da ist ein Pferd», also eine redundante Hinweisfunktion übernahm.Heute kann das Pferdegeräusch in Myriaden unterschiedlicher Nuancen auf-treten, in denen sich möglicherweise sogar die psychische Befindlichkeit desReiters niederschlägt. Das Geräusch soll nicht nur erzählen, sondern auch un-terschwellig die Emotionen des Publikums ansprechen, intertextuelle Verwei-se beinhalten, räumliche Verhältnisse darstellen und in eine vielschichtigeklangliche Beziehung zum Ensemble sämtlicher akustischer Erscheinungenauf der Tonspur treten.
Bis kürzlich galt die spezifisch enge Verschlingung von filmischer Darstel-lung und Wirklichkeit – die Indexikalität des Films – als seine ureigene Quali-tät, die ihn von anderen Künsten – Literatur, Malerei – unterscheidet. In seinerbemerkenswerten Arbeit zu den Transformationen von Abbildung, Kunstund Kognition im digitalen Zeitalter stellt Wolf10 die These auf, dass sich dieKünste, die ihre Abbildungen durch einen technischen Aufzeichnungsprozessherstellen – wie die Fotografie, der Film, die Tonaufzeichnung – vom Indexwegbewegen und statt dessen Modelle herstellen. Die Abbildung steht in die-ser Konzeption nur noch in einer losen, mediatisierten Beziehung zur Wirk-lichkeit und bezieht sich vielmehr auf kognitive Vorstellungen der Welt, derObjekte und Prozesse, die in ihr angesiedelt sind.
In der Welt des Sounddesigns hat dieser Umbruch längst stattgefunden. Dasabstrakte Hören, die genaue Analyse natürlicher Klänge und ihre synthetischeNachbildung sind ein unverzichtbares Instrument jedes Sounddesigners. Mitseinem Traité des objets musicaux hatte Pierre Schaeffer 1966 jenes fundamenta-le Lexikon von Eigenschaften natürlicher akustischer Ereignisse geschaffen, daswahrscheinlich die wenigsten Tonarbeiter gelesen haben dürften, das jedoch ingenauester Weise über den damaligen Stand der Klanganalyse Auskunft gibt.11
Es ist ein Produkt jener Beschäftigung mit Klangobjekten, die seit Beginn des 20.Jahrhunderts unter anderem von avantgardistischen Komponisten wie Busoni,Varèse oder Cage betrieben wurde, womit ein weiterer unverzichtbarer Einflussauf die heutigen Formen des Sounddesigns deutlich wird.
Die Klangobjekte des Sounddesigners entstehen heute selten am Synthesi-zer. Auch werden sie selten zeichnerisch entworfen. Fast immer wird vorge-
67
fundenes Material in seine Bestandteile zerlegt und neu zusammengesetzt.Mark Mangini beispielsweise arbeitet bevorzugt mit Stimmen, mit menschli-chem Gesang, mit Flüstern und Schreien oder mit Tierlauten, die generell beiden Sounddesignern sehr beliebt sind. Aus dem Schrei eines Gibbons entwi-ckelte er beispielsweise das Geräusch einer Sirene des 23. Jahrhunderts. In-stinktiv haben er und andere erkannt, dass natürliche Geräusche mit einerQualität ausgestattet sind, die sich synthetisch kaum herstellen lässt. DieseQualität entsteht aus der Schönheit des Zufalls, aus den kleinen Störungen undVerschmutzungen, die der Natur anhaften. Natürliche Geräusche sind viel-schichtig und komplex, sie sind wild und rau und abwechslungsreich. DieseEigenschaften sind robust und überstehen die phantastischsten Verfrem-dungsprozesse. Die Gibbonsirene, zu hören in The Fifth Element von LucBesson (USA 1997), geht durch Mark und Bein, in einer Weise, wie sie am Syn-thesizer nicht herzustellen ist.
Anything goes, oder anders gefragt: Ist alles möglich? Welches sind die Be-dingungen, damit die Operation des Cut-and-Paste gelingt? Am wichtigstenist dabei die Ähnlichkeitsbeziehung: Ein glaubwürdiges Klangobjekt muss dietägliche Erfahrung der Zuschauer mit diversen Materialien sowie mit Masseund Ausdehnung von Objekten berücksichtigen. Ausserdem muss das glaub-würdige Klangobjekt aus der Kenntnis der kulturellen Codes heraus gestaltetwerden. Der emotionale Appell resultiert aus der bewusst angelegten Span-nung zwischen natürlicher Darstellung und der Entfernung davon, die sich inder künstlichen Verfremdung manifestiert. Dabei werden einige Merkmaleüberbetont, während andere unterdrückt oder modifiziert werden. DieseOperationen müssen so lange innerhalb eines Rahmens der Ähnlichkeitsbezie-hung angeordnet sein, als eine Zuordnung zu einer Quelle gewünscht wird.
Die akustische Repräsentation von Klangereignissen steht somit nicht indirekter Beziehung zur äusseren Welt, sondern vielmehr zu inneren, mentalenRepräsentationen in den Köpfen der Adressaten. Diese mentalen Repräsenta-tionen werden ebenso sehr durch mediale Abbildungen in allen möglichen Er-scheinungsformen geprägt, durch Radio, Fernsehen, Kino, Computergames.Der Link befindet sich also im Kopf des Hörers; der Rezipient ist es, der denLink herstellt, und die Sounddesigner können froh sein, dass diese Hörer/Zu-schauer nur über eine begrenzte auditive Kompetenz verfügen und dahermehrheitlich nicht in der Lage sind, sich die tatsächliche Quelle eines Klangszu vergegenwärtigen: den Schlamm in der Schüssel, die kaputte Fernsehröhreoder den schreienden Gibbon.
68
Anmerkungen
1 Christian Metz, «Le perçu et le nommé»,in: Essais sémiotiques, Paris 1977, S. 158.
2 Béla Balázs, Der Film: Das Werden undWesen einer neuen Kunst, Wien 1949, S. 224.
3 Friedrich A. Kittler, «Fiktion und Simu-lation», in: Ars Electronica: Philosophien derneuen Technologie, Berlin 1989, S. 57 ff.
4 Ausführliche Darstellung in: BarbaraFlückiger, Sound Design: Die virtuelle Klang-welt des Films, Marburg 2001, Kapitel 2.
5 Interview mit Gary Rydstrom in: VincentLoBrutto, Sound-on-Film, Westport/London1994, S. 223.
6 Barry Truax, Acoustic Communication,Norwood, NJ, 1984, S. 10.
7 Durch die Überlagerung zweier identi-scher Signale, die geringfügig zeitlich verscho-ben sind, entstehen Auslöschungen und Ver-stärkungen, die man Phasing nennt.
8 Mark E. Cory, «Soundplay: The Poly-phonous Tradition of German Radio Art», in:Douglas Kahn et al. (Hgg.), Wireless Imagina-tion, Cambridge, Mass., 1992, S. 46.
9 S. De Serk, Les Bruits de coulisses au ciné-ma. Paris 1914.
10 Mark J. P. Wolf, Abstracting Reality: Art,Communication, and Cognition in the DigitalAge, Lanham, Md., 2000.
11 Pierre Schaeffer, Traité des objets musi-caux. Essais interdisciplines, Paris 1966.
69
!"#$%&$'( )*(+,(
-./012'304562785901:2;42<;1=
>?.2%=8139.0@A281325?;1?2$19?.B.?9?120C5270.A?9;1:;159.84?19?
Die Schweizer Unterhaltungsfilme haben sich 2003 so gut angehört wie nochnie. Schon Wochen, bevor Achtung, fertig, Charlie! (Mike Eschmann) undGlobi (Robi Engler) in den Kinos anliefen, figurierten die Titelsongs Hie ujetzt und The Most Beautiful Song in der Hitparade.1 Und der Umstand, dassdie Songs mit Mia Aegeter und Jaël, der Sängerin der Gruppe Lunik, von Musi-kerinnen stammten, die im Film selber mitspielen bzw. eine Sprechrolle wahr-nehmen, bescherte den Filmen bereits im Vorfeld eine in der Geschichte desSchweizer Films wohl einmalig hohe Aufmerksamkeit.2 Nachdem die Unter-haltungsmedien den Weg geebnet hatten, erschien die populäre Tonspur auchder Kritik derart aussergewöhnlich, dass sie in kaum einer Rezension uner-wähnt blieb. Noch nie wurde so viel über den Soundtrack von Schweizer Fil-men geschrieben wie anlässlich von Achtung, fertig, Charlie! und Globi. DerenProduzenten dürfen sich auf die Schulter klopfen. Sie hatten Erfolg mit einemMarketingkonzept, das die amerikanischen Major-Studios seit über zwanzigJahren anwenden: die Musik und deren Interpreten instrumentalisieren, umihren Filmen Gehör zu verschaffen.
Seit Mitte der Siebzigerjahre produzieren die Majors High-Concept-Blockbuster wie Jaws (Steven Spielberg, USA 1975), Star Wars (George Lucas,USA 1977) oder First Blood (Ted Kotcheff, USA 1982), bei denen Idee, Beset-zung und Zielpublikum («ein Actionfilm mit Sylvester Stallone für 14- bis 29-Jährige») schon vor dem kreativen Prozess feststehen. Um den Rückfluss deroft immensen Kosten zu garantieren, setzt auch das Marketing vor dem Pro-duktionsprozess ein: Den Filmen soll sogleich ein unverwechselbares Corpo-rate Design verliehen werden. Dieser Begriff definiert die Summe aller Er-scheinungsformen, die zum unverwechselbaren Image einer Firma oder einesProduktes gehören.3 Bei einem Film umfasst das Corporate Design den Titel-schriftzug, das Plakat, den Kinotrailer, den Internetauftritt, allfälliges Mer-chandising – und den Soundtrack.
Welches kommerzielle Potenzial in der Tonspur steckt, bemerkten dieStudios, als Zuschauer das mitreissende Kino-Erlebnis der Discowelle-FilmeSaturday Night Fever (1977), Grease (1978) oder Flashdance (1983) verlängern
86
wollten, indem sie die Soundtracks kauften. In der Folge kamen die Studios abvon der orchestral eingespielten Hintergrund- bzw. Begleitmusik und durch-wirkten ihre Filme mit Gewinn versprechenden Poprock-Songs etablierter In-terpreten. Auf der Tonspur populärer Nicht-Musikfilme wie Ghostbusters(1984), Top Gun (1986) oder Cocktail (1988) waren fast nur noch hitparaden-erfahrene Sänger und Gruppen zu hören. Entsprechend gelangte in den Acht-ziger- und Neunzigerjahren der Soundtrack fast jeder grossen Hollywood-produktion in die Hitparaden.
Die erste Franchise, die Popsongs als Bestandteil des Corporate Designverstanden hatte, waren die James-Bond-Filme. Zu Goldfinger (Guy Hamil-ton, GB 1964), Diamonds Are Forever (Guy Hamilton, GB 1971) und Moon-raker (Lewis Gilbert, GB/F 1979) lieferte die durch das Fernsehen bekannt ge-wordene Popsängerin Shirley Bassey die Titelsongs; diese besassen stets den-selben Titel wie die Filme selbst, was den Werbe-Effekt zusätzlich steigerte.Allerdings blieb der Aufmerksamkeitsgewinn durch eine vor dem Filmstartaus dem Soundtrack ausgekoppelte Single erstaunlicherweise bis Ende derAchtzigerjahre ungenutzt: Der Soundtrack samt Titelsong kam häufig erstnach dem Filmstart auf den Markt. A View to a Kill (John Glen, GB 1985) z. B.lief in den USA am 24. Mai 1985 an, am selben Tag erst wurde der Titelsongvon Duran Duran veröffentlicht. Als einziger Bond-Song erreichte er in denUSA Platz 1 der Billboard-Top-200-Charts.4 Gleichzeitig markierte A Viewto a Kill das Ende einer Erfolgsserie. In der Folge schaffte in den USA (andersals in Europa) kein Bond-Song mehr den Sprung in die Hitparade, bis 2002Madonna für Die Another Day engagiert wurde.
Die James-Bond-Franchise gilt allgemein als Vorreiterin der Filmpromo-tion durch den Soundtrack. Dies mag hinsichtlich des Konzepts zutreffen,nicht aber hinsichtlich dessen Umsetzung, die in den USA, dem wichtigstenMarkt, in den Neunzigerjahren nie gelang. Führend waren diesbezüglich Ani-mationsfilme. Diese verfügen nun mal über keine Stars, die für PR-Zweckeeingespannt werden könnten. So bietet sich die Zusammenarbeit mit klingen-den Namen aus demMusikgeschäft an. Am erfolgreichsten war hierbei dasDisneystudio, das in den Neunzigerjahren mit Stars aufwarten konnte wie Ce-line Dion (Beauty and the Beast, 1991), Elton John (The Lion King, 1994) oderPhil Collins (Tarzan, 1999).5 In allen Fällen figurierten die Songs schon zudem Zeitpunkt in den Hitparaden, als der Film anlief. Das Konzept, den Filmüber den Sound und seinen Interpreten anzukündigen, wurde vom Dream-Works-Studio kopiert. Es vermarktete den Animationsfilm Spirit: Stallion ofthe Cimarron (Kelly Asbury / Lorna Cook, USA 2002) konsequent und er-folgreich über den Soundtrack mit der Hitsingle Here I Am von Bryan Adams.Am Filmfestival Cannes, wo der Film im Wettbewerb lief (ein cleverer Schach-zug des Studios, der eine Berichterstattung in den Feuilletons garantierte), be-gleitete Adams die Premiere mit einem Live-Konzert. Davor war er wie ein
87
Filmstar über den roten Teppich geschritten. So erhielt ein Trickfilm, dessenHeld ein imaginäres Pferd ist, auch in der internationalen Klatschpresse Gra-tiswerbung und obendrein ein Gesicht. Später unterstützte Adams die Premie-re in vielen weiteren Ländern mit einer Promotions- und Konzerttournee, dieihn auch nach Zürich führte. Das mittelmässige Werk erreichte in der Schweizerstaunliche 172 409 Zuschauer. Zum Vergleich: Disneys wenig später lancier-ter Animationsfilm Treasure Planet (Ron Clements / John Musker, USA 2002)verbuchte 113 736 Eintritte.6 Der Erfolg von Spirit wäre ohne Bryan Adamsund seinen Song Here I Am, der sich 31 Wochen in der Schweizer Hitparadehielt, undenkbar gewesen. Die meisten Medien, die über den Film schrieben,machten ihre Berichterstattung am Musiker fest; der Blick betitelte einen Arti-kel zum Filmstart gar mit «Bryan Adams’ Mustang im Kino».7 Wenn einePR-Abteilung die Medien dazu bringt, einen Animationsfilm als Bryan-Adams-Film zu bezeichnen, hat sie ganze Arbeit geleistet. Tatsächlich ist an-zunehmen, dass ein Grossteil des Publikums nicht in den Pferdefilm, sondernin den Film mit (der Musik von) Bryan Adams ging.
The Bodyguard – Musikstars als singende Schauspieler
Bei den Realspielfilmen muss The Bodyguard (Mick Jackson, USA 1992) alsMeilenstein gelten hinsichtlich der Vermarktung durch den Soundtrack. Diedamals als Soulsängerin weltweit erfolgreiche Whitney Houston spielte darindie Hauptrolle einer Sängerin – so waren auch gleich ihre Soundtrack-Songs indie Diegese des Films integriert. Dieser lief am 25. November 1992 in den ame-rikanischen Kinos an, der von Houston im Film gesungene Song I’ll AlwaysLove You war indes bereits am 13. November als Single veröffentlicht wordenund war zur Zeit des Filmstarts schon in aller Ohren.
Der Werbe-Effekt war gigantisch: In praktisch jeder An- oder Abmodera-tion des Songs am Radio oder auf den Musikfernsehkanälen wurde darauf ver-wiesen, dass es sich um den Titelsong des demnächst anlaufenden Films han-delt. Aber auch die Single in den Regalen und Schaufenstern der Plattenlädenfungierte als Werbeträgerin: Das Cover zeigt (in einem dem Film entnomme-nen Bild) Whitney Houston als Sängerin, im Hintergrund sind kleine Aufnah-men ihres Bodyguards Kevin Costner zu sehen; darunter prangt der Schriftzugdes Films. Das Cover leistete damit, ähnlich einem Plakat, einen entscheiden-den Beitrag zur Etablierung des Corporate Designs des Films. Zudem erwei-terte die vorgängige Singleauskoppelung das Produkt The Bodyguard um eineKonsumstufe. Idealerweise nämlich sollte der Konsument zuerst die Singlekaufen, dann den Film sehen und schliesslich noch den Soundtrack erwerben.Dieser kam am 17. November auf den Markt und verkaufte sich weltweit 26,8Millionen Mal. Damit belegt der Titel gemäss der Recording Industry Associa-
88
tion of America (RIAA), dem Branchenverband der amerikanischen Musikin-dustrie, Rang zehn der meistverkauften Tonträger aller Zeiten und ist bis heuteder erfolgreichste Soundtrack der Filmgeschichte (gefolgt von Titanic mit 25Millionen verkauften Exemplaren).8 Der Soundtrackverkauf erbrachte Ein-nahmen von 402 Millionen Dollar, der Film spielte an den Kinokassen 411Millionen Dollar ein.
Einen Schönheitsfehler hatte der Erfolg für das Filmstudio Warner Bros.allerdings: Die Rechte für die Filmmusik lagen bei Arista Records, womit dieEinnahmen aus dem Soundtrackverkauf grösstenteils in die Kasse eines Kon-kurrenten flossen. Um solche Synergieverluste zu verhindern, gründete War-ner Bros. 1996 mit Warner Sunset Records ein eigenes Soundtracklabel, dasfortan für die Zusammenstellung der Filmmusik verantwortlich war – eineKompetenz, die zuvor oft bei den Regisseuren lag. Andere Studios folgten demBeispiel. Mit Warner Sunset Records gewann die Musik für Filme markant anBedeutung. Das Label setzte sich für «music-driven pictures» ein wie etwaWhy Do Fools Fall in Love (Gregory Nava, USA 1998) und schaffte es, Filmenwie Three Kings (David O. Russell, USA 1999; mit Rapper Ice Cube in einerHauptrolle) oder The Matrix (Andy und Larry Wachowski, USA 1999) einenattraktiven Sound beizumischen. Dabei berücksichtigte es selbstverständlichin erster Linie Musikstars, die bei einem der Warner-Music-Labels unter Ver-trag standen. So engagierte Sunset Records zum Beispiel Madonna für den Ti-telsong Beautiful Stranger zum Film Austin Powers: The Spy Who Shagged Me(Jay Roach, USA 1999). Dieser wurde von New Line Cinema produziert, einerProduktionsfirma, die ebenso zum Time-Warner-Medienkonzern gehörte wiedas Label Maverick, das den Madonna-Song produzierte.
Eine Paradeleistung von Sunset Records war der Soundtrack zu Wild WildWest (Barry Sonnenfeld, USA 1999), dessen Titelsong vom Hauptdarstellerund Rapper Will Smith stammt. Der Film bekam zwar fast durchweg schlechteKritiken, wurde aber mit einem Einspielergebnis von 218 Millionen Dollar zueinem kommerziellen Erfolg. Diesen schreibt der CEO von Sunset Records,Gary LeMel, dem Titelsong zu. «Will Smith consented to do a song and a vi-deo. While the video [cost $3 mio.] it was worth every penny because it was theengine that got people to go to the theater.»9 Der Song wurde einen Monat vordem Filmstart veröffentlicht und war zum Zeitpunkt der Premiere bereits inden amerikanischen Top Ten klassiert – und somit schon Teil des kollektivenGedächtnisses sowie eine vielversprechende Verabredung mit dem potenziel-len Kinopublikum. Dass die Hitsingle denselben Titel trug wie der Film unddas Cover wie das Filmplakat aussah, potenzierte einmal mehr den Werbe-Effekt.
89
Von Hip-Hop- und R’n’B-Sternchen zu Crossover-Stars
Vom Erfolg mit den Soundtracks ermutigt, rückten die Studios und die Plat-tenindustrie noch enger zusammen. Das Zusammenspiel machte sich bezahlt.Der Verkauf von Soundtracks bescherte ihnen in den Neunzigerjahren rasantansteigende Gewinne. Im Jahr 2000, als das Geschäft auf seinem Höhepunktangelangt war, schrieb die britische Tageszeitung The Guardian: «These daysit’s as important for a movie to have a hit soundtrack as it is to have, well, Leo-nardo DiCaprio in the starring role.»10 Erst neue Technologien wie das MP3-Format, welches das kostenlose Herunterladen von Musik vom Internet er-möglicht, sowie die Wirtschaftskrise nach dem 11. September 2001 bremstenden Soundtrack-Boom. 2002 gingen die Verkaufszahlen gegenüber dem Vor-jahr um über einen Drittel zurück.11 Mit ein Grund dafür war aber auch diezunehmende Beliebigkeit der Compilations. Die Hits hatten oft keinerlei Be-zug mehr zum Film und zu seinem Inhalt, wie Glenn Burmann, Präsident vonSonys Epic Soundtrax, feststellte: «Soundtracks have only ever been as suc-cessful as the role of the music in the movie.»12
Um diesem mannigfach geäusserten Befund Rechnung zu tragen, solltendie Musik und ihre Interpreten künftig sogar Hauptrollen spielen. Die Studi-os machten sich daran, Musiker als Schauspieler anzuwerben und sie alsCrossover-Stars – Berühmtheiten, die in zwei Unterhaltungsbereichen tätigsind – aufzubauen. Solche spartenübergreifenden Stars entsprachen auchdem Bedürfnis der nach den Grossfusionen der späten Neunzigerjahre bzw.um 2000 entstandenen Medienkonglomerate wie AOL Time Warner, Via-com oder Vivendi. Denn so konnten sie die hauseigenen Stars mittels ihrer ei-genen Medienmaschinerie promoten. Bevorzugt wurden dafür Teenagerido-le aus den Sparten Rap, Hip-Hop, R’n’B13 und Pop: Mary J. Blige (PrisonSong), Beyoncé Knowles (Austin Powers in Goldmember), Eminem (8 Mile),Britney Spears (Crossroads), Mariah Carey (Glitter), Aaliyah (Queen of theDamned), die ’N Sync-Mitglieder James Lance Bass und Joey Fatone (On theLine), Mandy Moore (A Walk to Remember), Snoop Dogg (Bones), MethodMan und Redman (How High), DMX (Exit Wounds) und Dr. Dre (TheWash) erhielten in den Jahren 2001 und 2002 eine Hauptrolle in Filmen, meh-rere von ihnen gaben dabei ihr Kino-Schauspieldebüt. Zwar hat es Crosso-ver-Stars seit den ersten Tagen des Films gegeben, vom Opernsänger EnricoCaruso in den Zehnerjahren über Bing Crosby, Frank Sinatra, Elvis Presley,Johnny Cash, Barbra Streisand bis zu Whitney Houston und Will Smith inden Neunzigerjahren. Doch noch nie wurden sie so zahlreich und so kalku-liert aufgebaut. Im Unterschied zu schauspielernden Musikgrössen wieFrank Sinatra oder Barbra Streisand, die sich aus eigenem Antrieb auch imFilmgeschäft versuchten, sind die Crossover-Stars dieses Jahrtausends vor-sätzlich kreierte Marketing-Tools.
90
Musiker sind Stars vor allem dank jenem Publikumssegment, das am häu-figsten ins Kino geht, den 12- bis 29-Jährigen.14 Sie sind darüber hinaus ver-gleichsweise günstig zu engagieren. Eminem bekam für 8 Mile eine Gage vondrei Millionen Dollar; A-List-Darsteller wie Harrison Ford oder Julia Ro-berts dagegen sind unter 20 Millionen Dollar nicht zu haben. Die Filme mitMariah Carey oder den ’N Sync-Mitgliedern kosteten insgesamt weniger alszehn Millionen Dollar. Auch wenn ein solcher Film an den Kinokassenfloppt, lässt sich dieser Betrag über die TV-Rechte, den Erlösen aus Video-und DVD-Verkauf sowie aus der Lizenzvergabe an Fluggesellschaften amor-tisieren. Unbezahlbar ist indes der Mobilisierungseffekt, den afroamerikani-sche oder hispanische Musikstars bei den wachsenden ethnischen Minderhei-ten in den USA haben.15 Gemäss der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2000machen die Hispanics 12,5, die Afroamerikaner 12,3 Prozent der amerikani-schen Bevölkerung aus.16
Im Vergleich zur weissen Bevölkerung sind beide ethnischen Gruppendeutlich jünger: Die Hälfte der Hispanics ist beispielsweise noch nicht 26 Jahrealt, 40 Prozent sind gar jünger als 18 Jahre und gehören somit zur Gruppe derhäufigsten Kinogänger. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter der gesamtenamerikanischen Bevölkerung liegt bei 36 Jahren. Überdies geben Hispanics –wie auch Afroamerikaner – gemäss verschiedenen Studien pro Kopf mehrGeld fürs Kino aus als der Bevölkerungsdurchschnitt.17
Eingedenk solcher Zahlen hat Warner Bros. die afroamerikanische Front-sängerin der R’n’B-Gruppe Destiny’s Child, Beyoncé Knowles, für Austin Po-wers in Goldmember (Jay Roach, USA 2002) engagiert. Darin spielt Knowleszwar nur ein kleine Rolle, die jedoch der Marketingkampagne des Films dreigrosse Vorteile bot: Erstens fungierte die Singleauskoppelung ihres SongsWork It Out als Vorabwerbung für den Film. Zweitens half Knowles, neuePublikumssegmente zu erschliessen. Die ersten Austin-Powers-Filme schufensich mit der Verballhornung der James-Bond-Abenteuer und dem nostalgi-schen Revival der Swinging Sixties ein Liebhaberpublikum, das diese Ära teil-weise noch aus eigener Erinnerung kennt. Dieses Publikum ist wohl älter alsder Durchschnittskinogänger, männlich, angelsächsisch und weiss. BeyoncéKnowles indes ist das Idol weiblicher Teenager, und vor allem ist sie eine Iden-tifikationsfigur für Afroamerikaner.18 In einem Interview antwortete Produ-zent John Lyons auf die Frage, ob Beyoncé Knowles eine strategische Beset-zung zur Erschliessung jüngerer Publikumssegmente war: «Of course, thiswas part of the attraction». Regisseur Jay Roach pflichtete ihm bei: «This waspart of the idea.» Und auf die Frage, ob der Film ein Crosspromotion-Vehikelsei, antwortete Lyons:
We’re deriving so much from pop culture and celebrities, we are crosspro-moting everything. [...] We don’t pretend like we were not part of some
91
media corporate thing, we are! Guess what: it’s a commercial thing. We area big commercial movie that crosspromotes us.19
Der dritte Vorteil für das Studio war, dass es mit Knowles über ein attraktivesAushängeschild für die Medien verfügte, bei denen der öffentlichkeitsscheueHauptdarsteller Mike Myers nicht unbedingt als «sexy» gilt. Das Studio stellteim Zuge der Kampagne konsequent Knowles in den Vordergrund: Sie ist jung,ambitioniert, sexy und eine Geschichte wert («Starsängerin gibt Hollywood-Debüt»). Das Konzept machte sich bezahlt. In den USA übertraf Austin Po-wers in Goldmember mit Einnahmen von 213 Millionen Dollar sogar den Vor-gänger The Spy Who Shagged Me, der 205 Millionen eingespielt hatte. Der Er-folg der Franchise ist vor allem ein Erfolg des Marketings.
Mariah Carey, Britney Spears und Eminem –das Marketing emanzipiert sich vollends
Den (vorläufigen) Höhepunkt der Entwicklung, den Soundtrack und seine In-terpreten für das Marketing zu instrumentalisieren, markieren die Filme Glit-ter (Vondie Curtis-Hall, USA 2001) mit Mariah Carey, Crossroads (TamraDavis, USA 2002) mit Britney Spears und 8 Mile (Curtis Hanson, USA 2002)mit Eminem. Alle drei Filme erzählen, wie aus einer/einem Provinz- oder Vor-stadtjugendlichen ein Musikstar wird. Marketingstrategien und praktischeNotwendigkeiten (Sänger können, wenn überhaupt, am ehesten Sänger spie-len) begründeten so ein neues Genre, den «A Music Star Is Born»-Film, derauf selbstreferenzielle Weise die Erfüllung des American Dream in der Enter-tainment-Industrie schildert.
Mariah Carey war mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern einer dererfolgreichsten Musikstars der Neunzigerjahre. In den Medien wurde sie alsNachfolgerin Whitney Houstons gehandelt. Weshalb also nicht auch einenFilm mit ihr machen? Das Projekt bot sich umso mehr an, als Carey bei Co-lumbia Records unter Vertrag stand, die mit Columbia Pictures (unter demDach des Sony-Konzerns) eine Schwesterfirma im Filmbereich hatte. Glitterwurde denn realisiert mit dem Ziel möglichst grosser Synergiegewinne. DasVorhaben scheiterte allerdings. Als der Film ein Jahr nach Ende der Dreharbei-ten in die Kinos kam, war Careys Stern im Sinken begriffen. Das ColumbiaStudio verlor das Interesse und verkaufte die Verleihrechte an 20th CenturyFox. Carey ihrerseits verkrachte sich mit ihrem Plattenlabel und verkaufte denSoundtrack für 80 Millionen Dollar an ihr neues Label, Virgin Records, daszum Sony-Konkurrenten EMI gehört. Überdies erlitt Carey kurz vor der Pre-miere einen Nervenzusammenbruch und verbrachte längere Zeit in einer Kli-nik. Die einst strahlende Erfolgsfrau erschien als Wrack und wurde von den
92
Medien – Ironie des Schicksals – wie ihr Vorbild Whitney Houston fallen ge-lassen. Glitter spielte in den USA bloss 4,3 Millionen Dollar ein und ging als ei-ner der grössten Flopps in die Geschichte ein. Auch der Soundtrackverkaufblieb mit 1,5 Millionen verkauften Einheiten weit unter den Erwartungen.
Zu der Zeit, als Mariah Carey von der Bildfläche verschwand, erstrahlteein anderes Popsternchen am Himmel: Britney Spears war in den Jahren 2000und 2001 die erfolgreichste Sängerin, ihre Alben Ooops! ... I Did It Again undBritney belegten wochenlang Platz 1. An der Beliebtheit des propren «all-American girl» wollten auch die Filmstudios verdienen. Warner Bros. enga-gierte sie denn für einen öffentlichkeitswirksamen Kurzauftritt in Austin Po-wers in Goldmember, während der Ko-Vorsitzende von Miramax, HarveyWeinstein, Spears für eine kleine Rolle in Chicago gewinnen wollte, dann aberdoch davon absah, weil Rob Marshall, der Regisseur, energisch dagegen war.Der erste Langspielfilm mit Spears wurde schliesslich unter dem Dach des Me-dienkonglomerats Viacom realisiert, als Koproduktion des hauseigenen Studi-os Paramount mit dem hauseigenen Musiksender MTV. Auch beteiligte sichSpears’ Label Zomba Records, das damals unabhängig war, am Projekt. MTV,welches das Produkt Britney Spears mitkreiert hatte, war vor allem für dieLancierung des Films wichtig: Der Sender spielte den mit Filmausschnittendurchsetzten Clip des Titelsongs I’m Not a Girl in kurzen Intervallen und in-szenierte den Premierenhype. Obwohl der Film von himmelschreiendschlechter Qualität ist, spielte er seine Produktionskosten von 12 MillionenDollar schon am Startwochenende wieder ein; letzten Endes brachte Cross-roads über 75 Millionen Dollar ein.
Noch erfolgreicher wurde 8 Mile, der Film mit und über den notorischenweissen Rapper Eminem, der in vier Jahren 45 Millionen Tonträger verkaufthatte. Realisiert unter dem Dach von Vivendi, wurde 8 Mile von Imagine En-tertainment produziert, einem Tochterunternehmen von Universal Studio.Der Soundtrack wurde von Interscope, einem Tochterlabel der Universal Mu-sic Group, zusammengestellt und vermarktet. Sowohl der Film als auch derSoundtrack schossen in den US-Charts auf Platz 1, womit Eminem nach Jenni-fer Lopez erst der zweite Künstler ist, der gleichzeitig an der Spitze der Film-und der Musikhitparade stand. Der Film spielte weltweit über 240 MillionenDollar ein, und der Soundtrack verkaufte sich weltweit über acht MillionenMal. Was das Studio veranlasste, umgehend einen zweiten Soundtrack mit demTitel More Music from 8 Mile auf den Markt zu bringen – eine Mogelpackung:Zwar ziert Eminem gross das Cover (wie auch das Filmplakat), die Scheibeenthält aber keinen einzigen Song von ihm. Ähnliche Folge-Soundtracks wa-ren schon zu Trainspotting oder Titanic lanciert worden, um das Geschäft aus-zureizen.
Der im Vergleich zu Glitter oder auch Crossroads gigantische Erfolg hatteverschiedene Gründe. Zum einen besitzt Eminem fraglos mehr schauspieleri-
93
94
sches Talent und «street credibility» als Mariah Carey und Britney Spears.Zum anderen war bei 8 Mile mit Curtis Hanson ein erfahrener, anspruchsvol-ler Regisseur am Ruder. Eminent wichtig dürfte aber auch gewesen sein, dassder Film semiautobiografisch ist. Viele Elemente wie die Jugend in der Vor-stadt, die alkoholkranke Mutter, der Durchbruch bei einem Rap Contest deck-ten sich mit dem skandalumwitterten Leben Eminems. Der Film bot den Me-dien Anlass, das Enfant terrible der Musikszene mit soziologischem Blick un-ter die Lupe zu nehmen. 8 Mile zog nicht nur die Aufmerksamkeit derkonglomeratseigenen Medien auf sich und vermochte deshalb auch Publi-kumssegmente jenseits der jugendlichen Eminem-Fangemeinde zu erschlies-sen.
8 Mile stellt den vorläufigen Höhepunkt dar einer gut zwanzigjährigenEntwicklung in der Filmindustrie, aus der Musik und ihren Interpreten Kapi-tal zu schlagen. Man könnte auch sagen, dass es sich hierbei um einen «friend-ly take-over» des Inhalts durch die Form handelt: Die Künstler des CorporateDesigns sind mittlerweile so wichtig, dass sie zum Thema eines Films werdenkönnen.
Anmerkungen
1 Hie u jetzt von Mia Aegeter stieg am 31.August 2003 in die offizielle Schweizer Hitpa-rade ein, der Film kam am 18. September in dieKinos. The Most Beautiful Song von Lunikschaffte am 7. September 2003 den Sprung, derFilm lief am 2. Oktober an.
2 Bereits vor dem Filmstart von Globi nah-men die drei grössten Zeitungen der Schweizden Titelsong der Berner Gruppe Lunik zumAnlass, über den Film zu schreiben: Sonntags-Blick («Beim Sound geben Schweizer den Tonan»), 24. August 2003; Blick («Die BernerGruppe Lunik: Von Gröni zu Globi»), 25. Au-gust 2003; 20 Minuten («Globi-Clip: Verfüh-rerische Jaël»), 26. August 2003.
3 Vgl. Olaf Leu, Corporate Design, Mün-chen 1992, S. 22.
4 Die vom gleichnamigen Musikmagazinrealisierte Hitparade gilt als die offizielle Hit-parade der USA. Die aktuellen Charts könneneingesehen werden unter www.billboard.com.
Die im Folgenden gemachten Angaben überHitparadenklassierungen in den USA stam-men aus dem Billboard-Archiv.
5 Den grössten Erfolg feierte das Disney-Studio mit dem Soundtrack zu The Lion King,der sich über 10 Millionen Mal verkaufte undin den USA neun Wochen lang auf Platz 1 derBillboard-Top-200-Charts stand.
6 Die Zahlen stammen von Procinema.
7 Blick, 19. Juli 2002.
8 Die RIAA nimmt die Beglaubigung derVerkaufszahlen in den USA vor und vergibtGold- und Platinstatus. Die Top-100-Albensind einsehbar unter www.riaa.com/gp/bestsellers/topalbums.asp.
9 USA Today, 30. Oktober 2002.
10 The Guardian, 8. Februar 2000.
95
11 Vgl. «O Soundtrack, Where Art Thou?»,in: The Hollywood Reporter, Spezialnummer«Winter Film & TV Music», Januar 2003, S.2–3.
12 Ebd.
13 Die Berücksichtigung von Musikern die-ser Genres ist kein Zufall. Rap/Hip-Hop undR’n’B waren gemäss einer Studie der RIAA imJahr 2002 die zweit- und drittbeliebtestenGenres der Konsumenten (hinter Rock), mitMarktanteilen von 13,8 bzw. 11,2 Prozent,Tendenz klar steigend. Noch 2001 hatte Popan zweiter Stelle figuriert. Die zunehmendeBeliebtheit von Rap, Hip-Hop und R’n’B hatdemografische Gründe: Es sind die Lieblings-genres der wachsenden Minderheiten von Hi-spanics und Afroamerikanern. Die Studie«Consumer Trends» kann eingesehen werdenunter www.riaa.com/news/marketingdata.
14 Gemäss der U. S. Movie Attendance Stu-dy des amerikanischen BranchenverbandesThe Motion Picture Association of America(MPAA) machen die 12- bis 29-Jährigen 31Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus,allerdings gehen 50 Prozent aller Kino-Ein-tritte auf ihr Konto. Innerhalb dieser Gruppesind die Teenager die fleissigsten Kinogänger.88 Prozent der 12- bis 17-Jährigen bezeichnensich als «häufige» oder «gelegentliche» Kino-gänger. Die Studie kann unter www.mpaa.org/useconomicreview/ eingesehen werden.
15 Welch grosses Identifikationspotenzialdie ethnische Zugehörigkeit eines Stars fürethnische Minderheiten darstellt, beschreibt
Vinzenz Hediger anhand des Beispiels Jenni-fer Lopez in «I Didn’t Know I Couldn’t», in:Meret Ernst et al. (Hgg.), Landschaften, Cine-ma 47, Zürich 2002, S. 131–137.
16 Die Daten stammen vom U. S. CensusBureau und finden sich unter http://quickfacts.census.gov/qfd/states/39000.html.
17 Aus der von der Screen Actors Guild inAuftrag gegebenen Studie «Still Missing: Lati-nos in and out of Hollywood» des Tomás Ri-vera Institute geht hervor, dass Hispanics im-mer mehr Geld fürKino-Eintritte ausgebenund zudem gemessen an den Gesamtausgabenfür Unterhaltung am meisten in Kino-Ein-tritte investieren. US-Hispanics investieren6,5 Prozent ihres Geldes für Unterhaltung inKino-Eintritte, Afroamerikaner 5,9 Prozentund weisse Amerikaner 5 Prozent. Zwar gebenweisse Amerikaner insgesamt mehr Geld ausfürs Kino, im Verhältnis zum Einkommensind die Hispanics aber die grössten Kinofilm-konsumenten. Statistiken und Zahlen dazufinden sich unter www.trpi.org/PDF/still_missing_in_action.pdf, S. 9–11.
18 Das Magazin Newsweek widmete die Ti-telstory vom 6. März 2003 der Stellung vonschwarzen Frauen und bildete auf dem CoverBeyoncé Knowles ab.
19 Interview des Autors mit Jay Roach, demRegisseur, und John S. Lyons, einem der Pro-duzenten, vom 8. Juli 2002 in London (unver-öffentlicht).
!"#$#!! %&'(()&
*+,-.,/.0.11.0+-12,/.02,/+
341-521.67/-829-0:1.;.292,82,-<.=:9-.0-<.>0
Wenn ein Film von Musikerinnen oder Musikern handelt, können wir davonausgehen, dass sie früher oder später beim Musizieren gezeigt werden. Das giltfür Biopics und ihre mehr oder weniger bekannten Personen der Musikge-schichte, für Spielfilme über frei erfundene Musikerfiguren, aber auch für dasdokumentarische Künstlerporträt, eine meist aus Interviews, Konzertauf-zeichnungen und Probenaufnahmen zusammengestellte Kompilation. Aus-serdem gilt es für alle musikalischen Stilrichtungen, den Techno, den Rock,den Jazz oder die so genannt klassische Musik, um die es hier gehen wird. Dasser den künstlerischen Prozess darstellt, zeichnet aber nicht nur den Musiker-film aus, sondern den Künstlerfilm allgemein.1 Welches Biopic über van Goghverzichtet schon darauf, den Maler als Malenden zu inszenieren? Und welchesDokuporträt über Maria Callas kommt ohne Sequenzen aus, die die Sängerinbeim Singen zeigen?2
Den Akt des Musizierens darzustellen, ist zwar gängig, aber nicht selbst-verständlich. Für die Filmschaffenden liegt der Reiz solcher Sequenzen wohlin deren Selbstreflexivität, denn die Darstellung eines künstlerischen Prozes-ses, auch des musikalischen, ist immer eine Aussage über das Aussagenschlechthin – und damit ein möglicher Verweis auf den filmischen Prozess.Nicht jeder Film schöpft dieses Potenzial gleich aus: Manche wählen im Hin-blick auf bruchlose Spannungskurven ein unauffälliges Erzählen, setzen aufden unbemerkten Fluss einer Geschichte. Andere flechten eine zweite, oft me-taphernreiche Ebene ein, auf der sie sich über das künstlerische Aussagen äus-sern. Wieder andere verfahren experimenteller und sistieren vorübergehendden Verlauf der Erzählung, um unterschiedliche Facetten des (film-)künstleri-schen Aktes zu beleuchten.
Typischerweise ist in den Darstellungen des Musikmachens das Gesichtder musizierenden Figur zu sehen. Das ist weniger banal, als es scheint, dennder Akt des Musizierens ist ja (auch) ein handwerklich-technischer, und sowäre es denkbar, dass der Film besonderes Gewicht auf die Inszenierung vonInstrument und Händen legt. Das tut er zwar, aber nicht nur – vielleicht, weilsolche Bilder nur bedingt aussagekräftig sind und sich obendrein rasch ver-
96
brauchen. Schon die schiere Geschwindigkeit, mit der sich die Hände auf derTastatur eines Klaviers oder dem Griffbrett einer Geige bewegen, ist oft sohoch, dass sie das Auge überfordert – es sei denn, die Bewegung wird in Zeitlu-pe gezeigt. Aber selbst das ist riskant. Zum einen laufen Bild und Ton dannmeist asynchron, da in derRegel nur die Bildspur verlangsamt wird. Die Ton-spur dagegen ertönt in gewohntem Tempo; ihre Verlangsamung würde zwardem Prinzip der Synchronität genügen, aber das Stück bis zur Unkenntlichkeitverfremden. Zum anderen besteht die Gefahr, dass sich die Mehrheit des Pub-likums zu langweilen beginnt: Auf den Händen eines Pianisten in Detailauf-nahme und Zeitlupe zu verweilen, ist vor allem für den Klavier spielenden Teilder Zuschauer eine Attraktion (die umso grösser ist, je höher der Schwierig-keitsgrad des Stücks gilt). Der überwiegende Teil des Publikums, der über kei-ne pianistischen Kenntnisse verfügt, reagiert jedoch skeptisch auf derartigeAusführlichkeit.
Den manuellen Aspekt des Musizierens dosiert der Film also zurecht vor-sichtig. Umso regelmässiger konzentriert er sich auf die Gesichter der Musike-rinnen und Musiker. Ein scheinbar problemloses Verfahren, da der interpreta-torische Akt immer auch ein kreativer Prozess ist, der sich, ähnlich den emo-tionalen und mentalenVorgängen, im Inneren einer Figur abspielt. Prozessedieser Art kann der Film freilich nur indirekt darstellen: durch suggestive Mu-sik, bedeutungsvolle Kamerawinkel und auffällige Lichtsetzung oder durcheine explizierende Voice-over. Zur bevorzugten Variante gehört es, die Inner-lichkeiten der Figur im Sinn einer «extériorisation de l’intérieur» auf deren Ge-sicht zu veräusserlichen.3
Ein erster Blick auf einschlägige fiktionale und dokumentarische Musi-ziersequenzen zeigt, dass diese Gesichter äusserst verschieden sind, sei es in ih-rem Ausdruck, sei es in ihrem Verhältnis zur interpretierten Musik. Hoch ex-pressive Mimiken stehen neben eigentümlich leeren Gesichtern. Ausserdemkorreliert in manchen Filmen der mimische Ausdruck mit dem der Musik,während sie in anderen Fällen eigenartig quer zueinander stehen. Diese Ver-schiedenheit allein mit den unterschiedlichen Gesichtern der Darsteller (imSpielfilm) und Personen (im Dokumentarfilm) zu begründen – also mit vorfil-mischen Gegebenheiten und damit mit der Abhängigkeit von Zufälligem –,liegt auf der Hand, greift aber zu kurz. Tatsächlich scheut der Film das Zufälli-ge, denn solange er auf herkömmliche Art Geschichten erzählt oder dokumen-tarisch berichtet, achtet er mit Vorteil auf reibungslose Verständlichkeit, berei-tet selbst überraschendste Wendungen planvoll vor und fügt sie einer diskursi-ven Logik ein.
Die unterschiedlichen mimischen Ausdrucksformen müssen also andersbegründet und scheinbar Beliebiges muss auf mögliche Konventionen hin ge-prüft werden. Ich beschränke mich dazu weitgehend auf den Fall der Klavier-spielenden Figur. Das hat damit zu tun, dass Klavier und Flügel von allen In-
97
strumenten im Film am präsentesten sind. Etliches spricht dafür: Dank möbel-hafter Gestalt und Hochglanz-Lackierung wird gerade der Flügel zurattraktiven Requisite, die sich vielfältig verwenden lässt – zur grafischen Ge-staltung des filmischen Bildes (durch das regelhafte Schwarzweiss der Tasten,die Diagonale des geöffneten Deckels oder die Einbuchtung an seiner Längs-seite), zur Betonung von Räumlichkeit (durch seine Länge und Breite), zurStudie einer in sich gekehrten Figur, eines nachdenklichen Gesichts (durch sei-ne spiegelnde Oberfläche).
Ausserdem erlauben es Klavier und Flügel, unauffällig zwischen dem Kör-per des Pianisten und seinen Händen hin- und herzuschneiden – eine Möglich-keit, die der Spielfilm dankbar nutzt, wenn er auf die Hände eines Doubles an-gewiesen ist, um darüber hinwegzutäuschen, dass ein Schauspieler nicht Kla-vier spielen kann.
Schliesslich begünstigen beide Instrumente eine nahezu unbeeinträchtigteInszenierung des Gesichts: weil die Distanz zwischen Kopf und Instrumentvergleichsweise gross ist (die Mimik des Schauspielers also nicht durch das In-strument verdeckt wird) und weil der Kopf nicht in die Handhabung des In-struments eingebunden ist, sondern eine fast natürliche Haltung einnimmt undüber grosse Bewegungsfreiheit verfügt. Dagegen bringen andere InstrumenteLimitationen mit sich: So zwingt die zwischen Kinn und Schulter platzierteGeige zu schräger Kopfhaltung und eingeschränkter Mobilität – zu schweigenvon Blasinstrumenten, die nur bedingten Raum für mimisches Spiel lassen.
Integrierte Musiziersequenzen
Als erstes Beispiel dient das Familiendrama Tout va bien, on s’en va (ClaudeMouriéras, F 2000). Im Mittelpunkt stehen die Schwestern Laure (Miou-Miou), Béa (Sandrine Kiberlain) und Claire (Natacha Régnier), die mit der un-vermuteten Rückkehr des jahrelang abwesenden Vaters (Michel Piccoli) kon-frontiert werden – ein Ereignis, das die Lebensentwürfe der Töchter und die-Balance zwischen ihnen bedroht. Während Laure sich dem Vater verschliesst,entlädt sich Béas Verletzheit in groben Ausbrüchen; Claire wiederum ziehtsich, mehr irritiert als verletzt, in die Musik zurück.
In der fraglichen Sequenz sitzt sie allein am Flügel. Der Raum ist dürftigbeleuchtet, eine Schreibtischlampe lässt kleine Stapel von Büchern und Notenerahnen. Claire spielt den letzten Teil aus Robert Schumanns Zyklus Kreisle-riana, op. 16, ein in c-Moll gesetztes Stück, dessen Tempo in der Partitur mit«sehr rasch» vorgeschrieben ist. Claire geht weit darüber hinaus und spielt esin horrender Geschwindigkeit. Sie atmet heftig, Körper und Kopf wippen un-ruhig hin und her, aus dem nachlässig zusammengebundenen Haar lösen sichSträhnen und fallen in das gequälte Gesicht. Die Kamera erfasst das Geschehen
98
in verhaltenen Bewegungen, lässt uns abwechselnd die spektakuläre Ge-schwindigkeit von Claires Fingern oder die Unruhe ihres Kopfs beobachten.Dieser ist aus grosser Nähe fotografiert, so dass er immer wieder aus dem Ka-der hinauszuschnellen droht, was die Fahrigkeit der Protagonistin noch zu-sätzlich erhöht.
Alle Zeichen stehen auf Sturm: der brodelnde Charakter des Schumann-Stücks, der gehetzte Ausdruck in Claires Mimik, die Härte und Rücksichtslo-sigkeit der musikalischen Interpretation – alles vereinigt sich zur Momentauf-nahme einer Figur, deren emotionale Welt aus den Fugen gerät. Dass diesesBild eindeutig ist, liegt an der Äquivalenz von mimischem und musikalischemAusdruck, aber auch an der narrativen Einbettung der Sequenz. Unmittelbarvoran ging Claires Eingeständnis, mit der familiären Situation überfordert zusein. Wenn sie nun am Flügel sitzt, dann nicht aus Gründen des Übens; viel-mehr scheint sie sich die emotionale Unruhe von der Seele zu spielen. Dass sieihr Spiel nicht eigentlich beherrscht, sondern sich von ihm forttragen lässt, fügtsich in die Logik dieser Stimmung ein.
Das zweite Beispiel stammt aus Ingmar Bergmans Höstsonaten (S/BRD1978), der kammerspielartigen Schilderung eines Mutter-Tochter-Konflikts.Nach Jahren der Abwesenheit meldet sich die Pianistin Charlotte (IngridBergman) zum längeren Besuch bei ihrer Tochter Eva (Liv Ullmann) an. Wasals Neuanfang gemeint ist, vermag den alten Verletzungen und Missverständ-nissen nicht standzuhalten: Die Begegnung mündet in eine schmerzhafte Aus-einandersetzung, nach der Charlotte vorzeitig abreist.
Noch vor dem Ausbruch des Konflikts – aber zu einem Zeitpunkt, da ersich längst abzeichnet – soll Eva auf dem Flügel vorspielen; eine unheilvolleIdee, da das Mutter-Tochter-Verhältnis augenblicklich um eine Lehrerin-Schülerin-Konstellation erweitert wird. Eva fügt sich, spielt pflichtbewusstund unsicher Frédéric Chopins Prélude Nr. 2, op. 28, in a-Moll, ein unbeque-mes, weit von jeder Leichtigkeit entferntes Stück: Melodische Andeutungenversiegen in langen Pausen, gehen nie über ein «piano» hinaus und werden ein-zig durch das pulsierende Wechselspiel tiefer Akkorde gestützt. Evas Gesichtwird im Viertelprofil gezeigt, ihre Züge sind erahnbar, aber nicht wirklich les-bar. Umso eindeutiger ist der Ausdruck der zuhörenden Charlotte, die demVortrag in einer Mischung aus Mitleid und Missfallen folgt. Unzufrieden mitdem eigenen Spiel, fordert Eva die Mutter zur Kritik auf: Diese gerät ins Do-zieren, äussert sich über Chopin im Allgemeinen und das Prélude im Besonde-ren. Dann setzt sie sich, ganz professionelle Pianistin, ihrerseits an den Flügel,um dasselbe Stück zu interpretieren.
Anders als zuvor bei der Tochter ist nun das Gesicht der Mutter deutlicherzu sehen: In steiler Aufsicht und als Dreiviertelprofil fotografiert, zeigt es kei-nerlei emotionale Regung, wirkt kalt und unzugänglich und passt auf eklatanteWeise zum Prélude, das Charlotte als Ausdruck vollkommener Beherrschung,
99
unterdrückter Schmerzen und nur punktueller Linderung beschrieben hat.Dann wechselt die Kamera ihre Position, zeigt in einer einzigen Grossaufnah-me Charlottes Profil und die Frontalansicht der neben ihr sitzenden Eva, dieerfolglos versucht, in der mütterlichen Mimik ein Gefühl zu entdecken. DieEinstellung ist doppelt nah, da sie die Protagonistinnen in einen allzu engenRahmen zwängt und die Unvereinbarkeit zweier emotionaler Ausgangslagenpotenziert. Aber sie zwingt auch uns, das bildfüllende Scheitern einer Kom-munikation aus ungewollter Nähe mitzuverfolgen.
Tout va bien, on s’en va und Höstsonaten gleichen sich nicht nur in der Er-zählung eines familiären Konflikts. Beide Musiziersequenzen werden durchdie vorangegangenen Geschehnisse bestimmt, kristallisieren sich aus der je-weiligen Handlung heraus: Hier wie dort setzen sich die Protagonistinnennicht um des Klavierspielens willen an den Flügel; vielmehr ist der Akt desMusizierens ein emotionales Ereignis, dessen Emotionalität sich aber nichtprimär aus dem Musikstück, sondern aus der konflikthaften Familienkonstel-lation erschliesst. Diese Integriertheit in die Handlung zeigt sich, wenn mandie Ausschnitte isoliert betrachtet: Claires mimische Vehemenz und die Aus-druckslosigkeit in Charlottes Gesicht wären zwar feststellbar, aber ohne dieKenntnis der Konflikte – die die Frauen ja erst ans Instrument führen – nichthinreichend erklärbar. Den Gesichtern kommt damit eine narrative Funktionzu: Sie sind lesbarer (und zu lesender), in den Fluss einer Geschichte eingebet-teter Ausdruck einer Gefühlsregung.4
In beiden Sequenzen stimmt der Ausdruck der Mimik mit dem der Musiküberein. Dass Claire und Eva ausgerechnet Schumann und Chopin spielen,dürfte nebensächlich sein. Wichtiger scheint, dass die Komponisten der euro-päischen Romantik angehören und damit einem musikalischen Reservoir, des-sen sich der Spielfilm mit Vorliebe bedient, wenn es gilt, Emotionales musika-lisch zu verdeutlichen.5 Und wirklich geht es in beiden Beispielen darum, dieaffektive Verfassung der Figuren zu vermitteln, denn diegetische Musik «ver-mag über die Figuren viel auszusagen, wenn wir beobachten, wie sie auf dieMusik, die sie hören oder selbst spielen, reagieren».6 Auf dem Gesicht der Fi-gur soll das Kinopublikum sehen, was es hört. Die Musik selber bleibt im Hin-tergrund: Sie ist den Bedürfnissen der Geschichte untergeordnet und über-nimmt jene von Adorno und Eisler so heftig kritisierte, dem Bild dienendeFunktion.7
Separierte Musiziersequenzen
Nicht alle Musiziersequenzen stehen in so enger Abhängigkeit zu ihrer narra-tiven Umgebung. Manche sind dem erzählenden Teil des Films nur lose beige-fügt. Ein Beispiel dafür ist Clarence Browns Song of Love (USA 1947), eine in
100
den 1840er Jahren angesiedelte Dreiecksgeschichte zwischen Robert Schu-mann (Paul Henreid), Clara Wieck (Katharine Hepburn) und JohannesBrahms (Robert Walker), die melodramatische und komische Obertöne glei-chermassen freisetzt.
Die Eröffnungssequenz spielt in der Dresdner Oper und zeigt Claras In-terpretation von Franz Liszts Klavierkonzert Nr. 1 in Es-Dur, einem Werk dergrossen Geste und wuchtigen Effekte. Zunächst ist die Kamera in einer derzentralen Logen untergebracht und etabliert in einer Panorama-Aufnahme dieSituation: prunkvolle Deckenlüster beleuchten Parkett und Ränge; geraffteSeitenvorhänge rahmen die Bühne; ein immenser Zwischenvorhang schliesstden Hintergrund ab; davor warten Orchester und Flügel auf die Solistin. Diesebetritt unter Applaus die Bühne und setzt sich ans Instrument. Das Konzertbeginnt – «allegro maestoso» –, und mit dessen Eröffnungstakten werden dieCredits eingeblendet.
Ein anderer Film würde sich nach diesem Vorspann aus dem Opernsaalentfernen und die eigentliche Geschichte beginnen lassen. Song of Love nimmtsich Zeit und bleibt weitere vier Minuten im Konzert. Bedächtig gleitet die Ka-mera an die Hauptfigur heran, lässt nach und nach ihre Züge und damit auchden Star Katharine Hepburn erkennen. Sie verweilt auf ihr (von wenigen Ab-stechern ins Konzertpublikum abgesehen), zeigt in derselben Einstellung im-mer wieder ihren Körper und ihre Hände, die mit rigorosen und vor allem pas-senden Bewegungen die Tasten des Flügels bedienen. Solche Beharrlichkeit hatdie Funktion eines Beweises: Katharine Hepburn tut nicht nur so, als würde siedas Liszt-Konzert spielen – sie spielt es tatsächlich.8
Dagegen wird Claras Gesicht eher beiläufig gezeigt. Ausserdem lässt eskein besonderes emotionales Engagement erkennen, sondern drückt vor allemKonzentration und Ernsthaftigkeit aus. Das gilt selbst für den Moment derZugabe: Aus Liebe zu Robert und gegen den Willen des eifersüchtigen Vatersspielt Clara «Träumerei» aus Schumanns Kinderszenen, op. 15. Damit ist eineemotionale Prämisse geschaffen, die eine hoch expressive Mimik erwartenlässt. Dennoch ist dasselbe konzentrierte Gesicht zu sehen, dessen Ausdruckweit weniger mit dem der Musik übereinstimmt als in Tout va bien, on s’en vaund Höstsonaten.
Ähnlich wie Song of Love verfährt Frühlingssinfonie von Peter Schamoni(BRD/DDR 1983), ein weiteres Schumann-Wieck-Biopic mit Herbert Gröne-meyer und Nastassja Kinski in den Hauptrollen. Zum einen wird erneut der(wenn auch flüchtigere) Beweis erbracht, dass Kinski selber spielt. Zum ande-ren tendiert auch ihr Gesicht zu konzentrierter Gelassenheit, gleichgültig, obsie Schumanns luftig-amüsierte Papillons, op. 2, interpretiert oder die virtuoseSchwere seiner Études symphoniques, op. 13. Daran ändern auch aufwühlendeEreignisse nichts – die vorübergehende Trennung der Liebenden, ihre Versöh-nung, eine neuerliche Intrige von Claras Vater (Rolf Hoppe) –, selbst wenn sie
101
den Musiziersequenzen unmittelbar vorangehen. In all diesen Momenten wirdClaras Gesicht eher nebenher gezeigt, ist Atmosphärisches wichtiger: dasLeipziger Gewandhaus, die aristokratischen Landgüter, die erlesenen Interi-eurs in Pariser Salons und die Beflissenheit des biedermeierlichen Publikums.
In Song of Love und Frühlingssinfonie ist der Aussagewert der Musizierse-quenzen weniger durch Vorangegangenes bestimmt. Die Pianistinnen spielennicht aus inneren Konflikten heraus, sondern um des Konzertierens willen.Die zahlreichen Vortragssequenzen sind von ihrem narrativen Umfeld gerade-zu separiert, verhalten sich weitgehend autonom und neigen dazu, den Fort-gang der Erzählung zu sistieren.9 Den Konzert-Einlagen eignet damit einNummerncharakter, der sie in unmittelbare Nähe zu den Tanz- und Gesangs-nummern des amerikanischen Musicals rückt: Sie enthalten kaum handlungs-relevante Informationen, sondern dienen dem visuellen und akustischen Ver-gnügen des Kinopublikums (auch wenn die Konzertsequenzen kaum je mitderselben rauschhaften Opulenz inszeniert sind wie die Musicalnummern).10
Dem entspricht, dass sich die Ausschnitte aus Song of Love und Frühlingssin-fonie leicht aus ihrem Kontext isolieren lassen, ohne an Sinnhaftigkeit zu ver-lieren.
Anders als in Tout va bien, on s’en va und Höstsonaten geht es nicht darum,im Akt des Musizierens Emotionales zu verdeutlichen und damit Handlungsbo-gen aufrecht zu erhalten. Stattdessen genügen sich die Konzertsequenzen selbstund ruhen als kleine Inseln im Fluss der Erzählung. Ihre Musik rückt dadurchnicht nur in den Vordergrund, sie verliert auch ihre herkömmliche, dem Bild un-tergeordnete Funktion der akustisch-emotionalen Illustrierung. Eine Äquiva-lenz zwischen Musik und Mimik ist unter diesen Voraussetzungen nicht nötig,die Gesichter von Hepburn und Kinski müssen nicht lesbar sein.
Freilich, die Grenze zwischen zwei Spielarten filmischer Musiziersequen-zen – der narrativ integrierten und der separierten – aufzuspüren, ist ein analy-tischer Vorgang, den die Filme so nicht vornehmen. Viele verwenden nachein-ander beide Varianten. Andere wie The Music Lovers (Ken Russell, GB 1970),Farinelli: il castrato (Gérard Corbiau, B/F/D/I 1995) oder Shine (Scott Hicks,AUS 1996), heben die Grenze zwischen Integriertheit und Separiertheit aufund verweben in derselben Sequenz routiniertes Konzertieren mit hochemo-tionalen Ereignissen.
Dokumentarische Konzertsequenzen
Die gezielte, auf narrative Integration oder Separation abgestimmte Inszenie-rung der Mimik während des Musizierens kann das dokumentarische Künst-lerporträt aus gattungsspezifischen Gründen nicht leisten. Sein Ziel ist nicht Il-lusion, sondern Information über die Wirklichkeit; ausserdem ist es mit Perso-
102
nen konfrontiert, die sich anders als Schauspielerinnen und Schauspieler oftunsicher und inkonsequent, zurückhaltend oder übertreibend vor der Kameraverhalten.11 Dennoch kehrt es in Konzertsequenzen immer wieder zum Ge-sicht der Interpretinnen und Interpreten zurück, freilich ohne ein Äquivalentzwischen mimischem und musikalischem Ausdruck garantieren zu können.
Ein erstes Beispiel stammt aus L’art du piano (Donald Sturrock / ChristianLabrande, F 1999), einer für das Fernsehen zusammengestellten dreiteiligenKompilation zahlreicher Konzertaufzeichnungen und Interviews, deren Duk-tus einem bildungsbürgerlichen Verständnis von klassischer Musik und einemscheinbar zeitlosen Geniebegriff geschuldet ist. Entsprechend beschränkt sichder Film auf den Kanon der bekanntesten Starpianisten.
Einer der Konzertausschnitte zeigt Arthur Rubinstein bei der Interpretati-on von Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 4, op. 58, in G-Dur. Dasses sich dabei um die Kadenz (des ersten Satzes) handelt, ist weniger zufällig, alses den Anschein hat. Kadenzen sind solistische Exkurse im Schlussteil einesSatzes und gelten als Ort höchster Expressivität, wo lyrische Zartheit und fu-riose Brillanz in dramatischem Wechsel aufeinander folgen. Wie das Schluss-bouquet eines Feuerwerks haben sie die Funktion eines Höhepunkts, aller-dings weniger in Bezug auf die musikalische Aussage des Werks, sondern mehrim Hinblick auf die Performance des Interpreten. Spätestens hier erwartet undgeniesst das Publikum dessen Starqualitäten, die sich analog zu den Filmstarsaus Eigenschaften zusammensetzen, die weit über das rein musikalische Kön-nen hinausgehen. Während der Kadenz werden die Solistinnen und Solistenselbst zur Attraktion: Ihre technische Bravour und oft genug ihre Exzentrikrücken das interpretierte Werk in den Hintergrund.
Gemessen an solchen Sehgewohnheiten wirkt Rubinsteins Ausstrahlungumso unerwarteter. Gewohnte Signale innerer Anteilnahme sucht man verge-bens: kein hektisches Hin- und Herwippen des Oberkörpers, keine ange-strengten, schweisstropfenden Grimassen oder aufgerissenen Augen.12 Statt-dessen ist die Bewegung der Arme von geschmeidiger Präzision, bestimmenhalb gesenkte Lider seine Züge, so dass der Eindruck eines schlafenden Ge-sichts entstehen könnte.13 Die äusserste Ruhe seiner Mimik steht in markan-tem (und gelegentlich komischem) Gegensatz zur zügigen Bewegtheit des mu-sikalischen Ausdrucks. Einzig gegen Ende der Kadenz richtet Rubinsteinplötzlich seinen Blick auf den Dirigenten; die Geste scheint zunächst unver-mittelt, passt aber in ihrer Unaufgeregtheit zur bisherigen Stimmung.
Der Ruhe des Interpreten entspricht diejenige der Kamera: Nachdem sieOberkörper und Hände in halbnaher Aufsicht von links beobachtet hat,zoomt sie auf die Hände, bis sie nach einer Überblendung sein rechtes Drei-viertelprofil zeigt. Gegen Ende der Kadenz kehrt sie zur Ausgangspositionzurück, und mit dem erneuten Einsatz des Orchesters bewegt sie sich rück-wärts, bis sie das ganze Halbrund der Musikerinnen und Musiker erfasst – ein
103
filmisches Signal, das den unmittelbar bevorstehenden Schluss des ersten Sat-zes ankündigt.
Anders gelagert ist Georges Gachots Martha Argerich – Conversation noc-turne (F/CH 2002), ein nächtliches Gespräch zwischen Filmemacher und Pia-nistin, in das verschiedene Konzertaufzeichnungen eingebettet sind. Eine da-von zeigt die Aufführung von Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 1, op. 11,in e-Moll. Wir befinden uns im ersten Satz und hören einen musikalischen Ge-danken, der sich aus dem ersten Thema entwickelt. Die Stelle ist von grosserWehmut, «piano» und «espressivo»zugleich, durchzogen von filigranen Ver-zierungen in hohen Lagen. Von sentimentaler Süsslichkeit kann jedoch keineRede sein: Nur wenig später wird sich das Thema zu heftiger Unruhe steigern,um schliesslich «con fuoco» in ein dreifaches «forte» auszubrechen – was imFilmausschnitt bereits nicht mehr zu sehen ist.
Die Kamera steht im rechten Winkel zu Argerich, würde ihr Profil zeigen,wenn es nicht hinter dem offenen Haar verborgen wäre. Erst einWechsel andas untere Ende des Flügels eröffnet die Frontalansicht. Anders als bei Rubin-stein ist Argerichs Oberkörper in ständiger Bewegung, neigt sich rhythmischvon links nach rechts. Ausserdem blickt sie zunächst von der Tastatur weg ineine ungewisse Ferne, neigt dann das Gesicht wieder leicht vornüber. Ihre Li-der sind nun halb gesenkt und blinzeln langsam und emphatisch; die Stirn istgefurcht, wiederholt schüttelt sie den Kopf, und plötzlich spricht sie (wohlstumm) vor sich hin. Dennoch scheint dies alles nicht auf eine Verärgerung(etwa über eine Fehlleistung ihrer selbst oder des Orchesters) hinzudeuten.Vielmehr entsteht der Eindruck einer mimisch-musikalischen Übereinstim-mung, als würde Argerich jene Emotionalität durchleben, die sie in der Inter-pretation vermittelt, ein Eindruck, der sich bei Rubinstein nicht einstellt.14
Die Liste dokumentarischer Beispiele liesse sich verlängern, etwa um Bru-no Monsaingeons Richter, l’insoumis (F1998), das kluge Porträt des russischenPianisten Swjatoslaw Richter, oder um die Musikdokumentationen, die derSender Arte ausstrahlt. In der Tat scheint das Spektrum mimischer Ausdrucks-formen so gross wie die Zahl an Musikerinnen und Musikern. Gleichzeitig er-weist sich deren Mimik im Vergleich zum Spielfilm als «weniger kodiert undweniger eindeutig, weniger ausbalanciert und nur punktuell mitreissend».15
Obendrein ist keine Regelhaftigkeit darin zu erkennen, wann mimische undmusikalische Ereignisse übereinstimmen oder voneinander abweichen. DasVerhältnis von Mimik und Musik ist stärker dem Zufall unterworfen, denn an-ders als bei den integrierten Musiziersequenzen besteht keine Notwendigkeiteiner narrativen Einbindung des Gesichts. Auch im Vergleich zur separiertenVariante bestehen Unterschiede: Zwar findet hier wie dort die mimisch-musi-kalische Korrelation nur sehr bedingt statt. Doch während dies in der separier-ten Sequenz ein gewollter Effekt ist, der mit Rücksicht auf dramaturgische Er-fordernisse inszeniert wurde, ergibt er sich im dokumentarischen Format so-
104
zusagen von selbst. Er folgt keiner Logik der Narration, sondern ist in seinerAbhängigkeit vom Musiker und von der Frage, ob und wie dieser Musik undEmotionen mimisch ausdrückt, das Resultat vorfilmischer Gegebenheiten, aufdie der Dokumentarist nur bedingten Zugriff hat.
Medial geprägte Sehgewohnheiten
So irritierend sich das Verhältnis von Mimik und Musik im Film präsentierenkann, so wenig handelt es sich dabei um ein filmspezifisches Phänomen. DassÄhnliches auch im Alltag wirksam ist, zeigt der Bericht eines Musikkritikersüber einen Auftritt der Geigerin Anne-Sophie Mutter und des Pianisten Lam-bert Orkis.16 Ausgehend von der Feststellung, dass sich die beiden mit ihremProgramm «einen Abstecher in den Bereich der leichten Muse» gönnen, kom-mentiert der Autor die «spielerischen ‹Unarten›» in Mutters Interpretation(den ausgiebigen Einsatz des «glissando»), die der Künstlerin offenkundigSpass gemacht hätten, was im Vortrag mehrfach zu hören gewesen sei. Er fährtfort: «Zu hören, nicht zu sehen, denn sie interpretierte diese schmeichlerische,rührselige und larmoyante Musik stets mit tief-ernstem Gesicht, als wäre esBeethovens Kreutzersonate.»
Lässt man das Gönnerhafte der Kritik und die Geringschätzung so ge-nannt leichter Musik beiseite, dann bleibt nicht nur das Unbehagen des Autorsüber das Auseinanderdriften von mimischem und musikalischem Ausdruck.Es bleibt auch, dass er dies als ein Manko begreift, das er nicht bei sich selbstsucht, sondern der Künstlerin vorwirft. Welchen Gesichtsausdruck er auchimmer zu «larmoyanter» Musik erwartet hätte – interessanter ist die Erwar-tung als solche.
Tatsächlich dürfte es sich dabei um ein medial generiertes Bedürfnis han-deln. Auf die im klassischen Live-Konzert gewonnenen Seherfahrungen kannes jedenfalls kaum zurückgeführt werden. Zum einen ist in herkömmlichenKonzertsälen die Sicht auf die Mimik des Musikers die Ausnahme: Die meistenPlätze sind viel zu weit weg von der Bühne oder liegen in einem ungünstigenWinkel. Zum anderen garantiert selbst Nähe noch lange keinen Zugang zumGesicht, denn nur bestimmte Musiker stehen frontal zum Bühnenrand, wäh-rend gerade Pianistinnen und Pianisten quer zu ihm sitzen und bestenfalls imProfil zu sehen sind.
Dagegen ermöglicht der Film ein weitgehend ungehindertes Schauen:Durch optimale Kamerapositionen und vorteilhafte Lichtsetzung, vor allemdurch das Mittel der Grossaufnahme erscheint das Musikergesicht geschöntund in einer Grösse, die im Alltag keine Analogie besitzt.17 Trotz diesen ideali-sierenden Voraussetzungen erfüllt nicht jeder Film das Bedürfnis nach mi-misch-musikalischer Äquivalenz. Besonders die dokumentarische Konzert-
105
aufzeichnung sperrt sich dagegen, da sie im Verzicht auf schauspielerischeFührung von vorfilmischen Zufällen abhängig ist und eine Übereinstimmungder beiden Ebenen höchstens punktuell bieten kann. Aber auch die separierteMusiziersequenz, die in erster Linie atmosphärische und akustische Bedürf-nisse des Kinopublikums bedient, weist nur geringe oder gar keine Überein-stimmung auf. Demnach wäre die Erwartung der Äquivalenz vor allem auf dieintegrierten Sequenzen zurückzuführen.
Nun sind es gerade diese Sequenzen, in denen die Musik auf ihre traditio-nelle Funktion des affektiven Verdeutlichens reduziert wird und in denen esdarum geht, etwas über den Gefühlshaushalt der musizierenden Figur auszu-sagen. Ob es sich dabei um eine Pianistin, einen Sänger oder überhaupt eineMusikerin handelt, ist letztlich zweitrangig. Wichtiger ist ihr Gesichtsaus-druck: ein mimisches «con intimissimo sentimento», das rasch und zweifelsfreiauf Affektives schliessen lässt, durch ein geeignetes musikalisches Pendant un-terstützt wird und eine empathische Reaktion des Kinopublikums begünstigt.In dokumentarischen Sequenzen dagegen stellt sich solches Einfühlen allen-falls zufällig ein, obschon gelegentlich überraschender und überzeugender alsan den hoch kodierten Stellen des Spielfilms.18 Separierte Sequenzen wiede-rum lösen kaum Empathie aus, was nicht heisst, dass die Konzert-Einlagen ausSong of Love und Frühlingssinfonie missglückt wären; es bedeutet nur, dass dieEmpathie nicht in den Musiziersequenzen, sondern anderswo entsteht.
Vielleicht liegt es am hohen Empathiepegel, dass ausgerechnet die inte-grierten Musiziersequenzen am nachhaltigsten für das Bedürfnis des Publi-kums nach mimisch-musikalischer Äquivalenz in Film und Live-Konzert ver-antwortlich sind. Dass diese Sequenzen am weitesten von den realen Gegeben-heiten des Interpretierens oder den Bedingungen des Konzertierens entferntsind, bleibt ein Widerspruch, der sich am schwierigen Verhältnis zwischenFilm(ern) und Musik(ern) entzündet: Aus musikalischer Sicht ist jedenfallsverständlich, wenn Musikerinnen und Musiker verärgert oder erheitert auf fil-mische Entwürfe dieser Art reagieren – erst recht, wenn sie (schlimmstenfalls)zum Klischee gerinnen in der ehrfurchtsvoll-steinernen Miene von Bach-In-terpreten oder im schmachtenden Blick von Chopin-Darstellern. Aus filmi-scher Sicht wirken solche Momente (bestenfalls) als umsichtig dosierte Auslö-ser emotionalen Tiefgangs und intensiven Mitfühlens.
106
107
Anmerkungen
1 Zu den neueren Auseinandersetzungenmit der Thematik gehören Henry M. Taylor,Rolle des Lebens: Die Filmbiographie als narra-tives System, Marburg 2002; Jürgen Felix (Hg.),Genie und Leidenschaft: Künstlerleben imFilm, St. Augustin 2000; Klaus Kanzog, «‹Wirmachen Musik, da geht euch der Hut hoch!›Zur Definition, zum Spektrum und zur Ge-schichte des deutschen Musikerfilms», in: Mi-chael Schaudig (Hg.), Positionen deutscherFilmgeschichte: 100 Jahre Kinematographie:Strukturen,Diskurse, Kontexte, München 1996,S. 197–240.
2 Mir ist im Bereich des Musikerfilms nureine Ausnahme bekannt: François GirardsThirty-Two Short Films about Glenn Gould(CDN 1993), ein experimentelles Dokudramaüber den kanadischen Pianisten, verlagert denAkt des Musikmachens ganz auf die Tonspur.Im Bild jedoch, und darin besteht die Ausnah-me, wird zu keinem Zeitpunkt Klavier ge-spielt.
3 Michel Chion, La musique au cinéma,Paris 1995, S. 267.
4 Diese Art Gesichtsinszenierung ist längsterprobt. In den Zehnerjahren erwuchs sie ausder fortschreitenden Konventionalisierungnarrativer Verfahren und der daraus hervorge-henden Notwendigkeit, psychologisch plausi-ble Charaktere zu konstruieren. Sie löste diebis dahin übliche Praxis ab, das Gesicht als At-traktion zu inszenieren, die nicht «gelesen»werden musste, sondern über die man sichamüsieren oder vor der man erschrecken soll-te. Vgl. Frank Kessler, «Das Attraktions-Ge-sicht», in: Christa Blümlinger / Karl Sierek(Hgg.), Das Gesicht im Zeitalter des bewegtenBildes, Wien 2002, S. 67–76.
5 Vgl. Richard Dyer, «Film, Musik undGefühl: Ironische Anbindung», übers. vonPhilipp Brunner, in: Matthias Brütsch et al.(Hgg.), Emotionalität und Kino [Arbeitstitel],Marburg [erscheint 2004].
6 Claudia Gorbman, «Filmmusik: Texteund Kontexte», übers. von Wolfram Beyer, in:
Regina Schlagnitweit / Gottfried Schlemmer(Hgg.), Film und Musik, Wien 2001, S. 16.
7 Vgl. Theodor W. Adorno / Hanns Eisler,Komposition für den Film, Hamburg, 1996,insbes. S. 25–28.
8 Musikerfilme legen oft grossen Wert aufden als Attraktion gemeinten Beweis, dass ihreDarstellerinnen und Darsteller das Instrumentwirklich beherrschen. Dahinter verbirgt sichjedoch ein Dilemma: Wenn Emily Watson inHilary and Jackie (Anand Tucker, GB 1998)das Cello richtig handhabt und die Inszenie-rung dies hervorhebt, gefährdet das die Illusi-on genauso, wie wenn Juliette Binoche in Aliceet Martin (André Téchiné, F/E 1998) auf of-fensichtlich unpassende Art mit der Geige um-geht. In beiden Fällen rücken die Schauspiele-rinnen ihre Rollen zeitweilig in den Hinter-grund. Die meisten Filme begnügen sich frei-lich mit visuellen Beweisen; nur in Ausnahmenwie The Piano (Jane Campion, NZ 1993), woHolly Hunter den Klavierpart selber einspiel-te, sind die Darsteller auch zu hören.
9 Mit der Unterscheidung zwischen inte-grierten und separierten Musiziersequenzenlehne ich mich an Jane Feuer an, die dieselbeTrennung für die Gesangs- und Tanznum-mern des amerikanischen Musicals vornimmt.Auch dort entwickeln sich Erstere aus derHandlung heraus (etwa «Singin’ in the Rain»aus dem gleichnamigen Film von Gene Kellyund Stanley Donen, USA 1952), währendLetztere die Handlung sistieren (die Mehrheitder Nummern aus Backstage-Musicals wieCabaret von Bob Fosse, USA 1972). Vgl. JaneFeuer, The Hollywood Musical, London2 1993.
10 Vgl. Taylor (wie Anm. 1), S. 275; ausser-dem Richard Dyer, «Entertainment and Uto-pia», in: ders., Only Entertainment, London1992, S. 17–34.
11 Zu diesen und weiteren Unterschiedenzwischen Dokumentar- und Spielfilm vgl.Christine N. Brinckmann, «Die Rolle der Em-pathie oder: Furcht und Schrecken im Doku-mentarfilm», in: Matthias Brütsch et al.
108
(Hgg.), Emotionalität und Kino [Arbeitstitel],Marburg [erscheint 2004].
12 Dass diese Charakteristika zu den typi-schen eines klassischen Interpreten gehören,ist ablesbar an ihrer wiederkehrenden Ver-wendung in Karikaturen wie Wilhelm Buschs«Der Virtuos», erschienen 1868 in dersatiri-schen Zeitschrift Münchener Bilderbogen.
13 Dieser Eindruck hat aber auch mit Ru-binsteins hohem Alter zu tun und damit, dasssich das mimische Register alter Menschen oftjener raschen und eindeutigen Lektüre wider-setzt, die man bei jüngeren Gesichtern ge-wohnt ist.
14 Ein solches Gefühl von Logik (bei Arge-rich) oder Unstimmigkeit (bei Rubinstein) er-gibt sich freilich nur in Verbindung mit dergleichzeitig gehörten Musik; eine ohne Tonvorgenommene Lektüre der Gesichter würdezu anderen Schlüssen führen.
15 Brinckmann (wie Anm. 11).
16 Thomas Schacher, «Das Konzert zur CD:Duoabend Mutter/Orkis in Zürich», in: NeueZürcher Zeitung, 121, 27. Mai 2003, S. 54.
17 Alain Corneaus Tous les matins du mon-de (F 1991) beginnt mit einer sechsminütigenextremen Grossaufnahme, die das Gesicht desalternden Gambisten Marin Marais (GérardDepardieu) zeigt. Einstellungen dieser Artsind so spektakulär wie problematisch, da einesolche Nähe das heikle Verhältnis zwischender Körperlichkeit des Schauspielers und der-jenigen der von ihm dargestellten Figur inSchieflage versetzen kann: Es sind in erster Li-nie Depardieus Falten, die wir sehen, und we-niger diejenigen Marais’.
18 Vgl. Brinckmann (wie Anm. 11).
!"#$ %&'(&))
'*+,-./01.#0+,-
23,4/+5,.3,6.%1613/3,-.617.(3*+4.+, !"#$%"&' 8.1+,.29::;1+*<+1:
You can tell where black people are at anygiven point in history by our music.
afroamerikanisches Sprichwort1
«Was», fragt der afro-britische Soziologe Stuart Hall in einem Aufsatz, «ist ei-gentlich ‹das Schwarze› in der schwarzen Pop-Kultur»?2 Was qualifiziert einekünstlerische Praxis als schwarz? Hall weist auf bestimmte Eigenheiten derRepräsentation hin, in denen Schwarze, schwarze Gemeinwesen und Traditio-nen erscheinen und in der populären Kultur dargestellt werden: Zu den spezi-fischen Figuren und Repertoires – egal, wie deformiert, vereinnahmt oder un-authentisch sie sein mögen – zählt er neben der Expressivität, der Betonung desVerbalen sowie der reichen Produktion von Gegenerzählungen vor allem dieMusikalität und den metaphorischen Gebrauch des musikalischen Vokabu-lars. Hier habe die schwarze Populärkultur, selbst innerhalb der gemischten,widersprüchlichen und mythischen Formen der populären Mainstream-Kul-tur, Elemente eines anderen Diskurses an die Oberfläche gebracht – andere Le-bensformen, andere Traditionen der Repräsentation. Herausgedrängt aus derlogozentrischen Welt hätten die Menschen der schwarzen Diaspora zudem dieTiefenstruktur ihres kulturellen Lebens in der Musik gefunden. Damit einhergeht laut Hall, dass in der populären schwarzen Kultur Stil selbst zum Subjektdes Geschehens geworden ist und mit dem Körper oft so umgegangen wird, alssei er das einzige kulturelle Kapital.
Gleichwohl ist Schwarzsein für Hall, der in den Fünfzigerjahren als jungerMann aus Jamaika nach England gekommen war, keine frei wählbare und auchkeine aus sich selbst heraus gewachsene Identität. Identität ergibt sich nichtquasi naturwüchsig aus der kulturellen Zugehörigkeit zu einer bestimmtenGruppe, Identität leitet sich erst mal vielmehr aus dem ab, was man nicht ist.Man ist schwarz, weil man nicht weiss ist. Identität bedeutet daher vor allem,von anderen als anderer identifiziert zu werden. Sie ist eine Zuschreibung, dieman nicht selbst bestimmt. In einem zweiten Schritt umfasst Identität dannden Prozess, sich innerhalb dieser Positionierung eine eigene Position zu
109
schaffen – sich zu identifizieren. Entscheidend ist für Hall, diesen Identifika-tionsprozess als einen offenen zu begreifen, der Positionen hervorbringt, dienicht zeitlos gültig sind, aber doch von Dauer sein können. So wie «schwarzeIdentität» nicht als vollendete historische Tatsache zu verstehen ist, die erst da-nach durch neue kulturelle Praktiken repräsentiert wird, sondern als eine, diesich stetig und unaufhörlich in Produktion befindet, und sich innerhalb, nichtausserhalb der Repräsentation konstituiert, so besteht das Schwarzsein als po-litische Identität für Hall darin, Identität in der Differenz zu leben, anzuerken-nen, dass alle aus vielen sozialen Identitäten, nicht aus einer einzigen zusam-mengesetzt sind. Deshalb plädiert er nachdrücklich dafür, die Aufmerksam-keit auf die Verschiedenheit schwarzer Erfahrung zu legen, auch weil es in derschwarzen populären Kultur – da von den afrikanischen Ursprüngen wie denBedingungen der Diaspora gleichzeitig und gleichermassen beeinflusst – über-haupt keine reinen Formen gebe. Immer seien diese Produkt einer partiellenSynchronisierung, eines Zusammenfliessens von mehr als einer kulturellenTradition und des Aushandelns dominanter und subordinierter Positionen.Der Signifikant «schwarz» im Begriff «schwarze populäre Kultur» repräsen-tiert also das Zeichen der Differenz innerhalb dieser Kultur. Wenn Hall die zu-geschriebene schwarze Andersartigkeit bekämpft und für eine Politik des Kul-turellen und der Identität eintritt, in der die gemeinsamen Erfahrungen undnicht die Vorfahren betont werden, so tut er dies aus Überzeugung, dass eineschwarze Essenz gar nicht existiert.
Hall schlägt vor, den Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Ge-genwart als imaginäre Rekonstruktion zu verstehen, und dies trifft insbeson-dere auf den Film zu.
I have been trying to speak of identity as constituted, not outside but within repre-sentation; and hence of cinema, not as a second-order mirror held up to reflectwhat already exists, but as a form of representation which is able to constitute us asnew kinds of subjects, and thereby enable us to discover who we are. Communities[…] are to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style inwhich they are imagined. This is the vocation of a modern Caribbean cinema: byallowing us to see and recognize the different parts and histories of ourselves, toconstruct those points of identification, those positionalities we call «a culturalidentity».3
Wenn also, wie Hall behauptet, die Tiefenstruktur des kulturellen Lebens derschwarzen Diaspora in der Musik zu finden ist und sich deren Kino – von Hallin diesem spezifischen Fall «karibisches Kino» genannt4 – das eigene Bild imeigenen Style immer wieder neu imaginiert, dann ist anzunehmen, dass dieMusik dabei eine gewichtige Rolle einnimmt, mitunter gar selbst die tiefereStruktur des Films verkörpert.
110
Als Beispiel soll Michael Schultz’ Car Wash (USA 1976) dienen, eine selt-same Hybride aus Mainstream- und Independent-Kino, die verschiedeneIdentitäten zulässt – in einer spielerisch-parodistischen, durchaus cleveren, je-doch zugleich bewusst stereotypisierenden, populären und widersprüchlichenArt, und deren Form, Bewegung und Gefühlslandschaft komplett von derMusik diktiert sind.5 Richard Dyer spricht gar von einem schwarzen Musical.6
Narration, Charaktere und Dialoge in Car Wash sind um die Disco-Radiosta-tion KGYS herum gruppiert, welche die Autowaschanlage in Los Angeles be-schallt, deren mehrheitlich schwarzes Personal wir einen Tag lang begleiten.Mit einer Ausnahme sind die musikalischen Nummern – um Dyers Musical-Idee aufzunehmen – diegetisch zuordenbar: Entweder stammt die Musik ausdem Radio, oder sie wird von den Charakteren gespielt, beispielsweise wennFloyd und Lloyd den anderen ihren Show-Akt mit Gesang und Stepptanz vor-führen oder wenn Duane/Abdullah für sich in der Mittagspause Saxofonspielt. Es ist jedoch nicht die diegetische Motivation der Nummern, die fürDyer Car Wash von einem «weissen» Musical unterscheidet – vielmehr liegtdie Differenz in der Bedeutung der Nummern für die Narration und dem Stel-lenwert, den die Musik im Leben der Charaktere einnimmt. Die im Musicaldes klassischen Hollywood vorherrschende Dialektik von Narration undNummer, von Zwang und Befreiung, fehlt, gerade Letztere scheint nicht mög-lich. Hier werden die «realen» Probleme des Alltags in der imaginierten Welt,den Nummern, keineswegs in ihr Gegenteil verkehrt. Hier steht der von Ent-behrungen geprägten Welt keine idealisierte gegenüber. Der Nachdruck aufdem Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, fehlt gänz-lich. Insofern ist die Musik in Car Wash nicht Trägerin einer Utopie, sonderndient den Charakteren vielmehr als spielerisches Mittel zur Alltagsgestaltungoder Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Sie können– wannimmer dies nötig ist, wann immer sie wollen – stets auf die Musik zurückgrei-fen. Mit dem Abtauchen in die und dem Wiederauftauchen aus der Musik istnicht die stereotype Konstruktion schwarzer Musikalität gemeint («AlleSchwarzen haben den Rhythmus im Blut»), vielmehr der aktive Umgang mitder Musik. Dies verbindet die Menschen ebenso, wie sie durch die Musik selbstverbunden werden. Was wiederum durchaus eine gesellschaftspolitische Notehat. Dass dabei eine Radiostation das musikalische Zentrum einnimmt, ergibtfür einen schwarzen Film ebenfalls Sinn. Wie Nelson George schreibt:
Radio has historically been so intimately connected with the consciousness ofblacks that it remained their primary source of entertainment and information wellinto the age of television. Even in today’s VCR- and CD-filled era, black radioplays a huge role in shaping black taste and opinion – when it remembers its blackaudience.7
111
In seinem Aufsatz «Repetition as a Figure of Black Culture»8 argumentiertJames A. Snead, dass die europäisch geprägte Kultur dazu tendiert, Linearitätzu betonen, Wiederholung und Zirkularität hingegen zu verschleiern. In derschwarzen Kultur hätten Letztere jedoch einen festen Platz: «In European cul-ture, repetition must be seen to be not just circulation and flow but accumulati-on and growth. In black culture, the thing (the ritual, the dance, the beat) is‹there for you to pick it up when you come back to get it›.»9 Es ist genau diesesPrinzip, das Car Wash strukturiert. Anders als im klassischen Hollywood-Musical sind die Wiederholungen in Form von Reprisen keineswegs speziell inden Vordergrund gerückt, etwa um eine Veränderung in der Narration anzu-zeigen oder um das Signal zum Schluss der Show zu geben, wenn in einemMedley die vorangegangenen Nummern im grossen Finale nochmals ange-spielt werden, um letztlich in einer Zusammenführung aller Paare zu enden.Vielmehr folgen die Wiederholungen in Car Wash einem weitaus weniger for-malen Prinzip: Sie sind nicht laufend mit Getöse angezeigt, sie kommen ein-fach dauernd vor. In Car Wash gilt die Disco-Dance-Radiostation KGYS alsthe thing: Sie ist ununterbrochen auf Sendung – wenngleich wir sie nicht im-mer hören, so sind wir uns dessen sicher –, mitunter wird dieselbe Musik, wer-den dieselben Sprüche wiederholt. JB, der erste der DJs, spricht gar davon, dassdie Musik nicht einfach Hintergrundmusik ist, sondern dass sie vielmehr inden Köpfen der Zuhörer rumspukt: «The JB is here, rappin’ in your ear / TheJB’s not on your radio / Your radio’s not really on.»
Die Figuren des Films bedienen sich des thing und lassen es wieder liegen.Genau so verfährt auch die Narration. Einmal tauchen die Charaktere förm-lich in den Soundtrack ein: Mr. B, der weisse Besitzer der Waschanlage, be-schwert sich bei der weissen Kassiererin Marsha über die Musik: «You’d thinkjust once they’d wanna hear Frank Sinatra, Perry Como.» Von Marsha ermun-tert, sucht er schliesslich einen Radiosender mit Musik nach seinem Gusto. DieReaktion der schwarzen Arbeiter: Erst lauter Protest, danach arbeiten sie un-vermittelt in Zeitlupe weiter. Die Musik erfüllt also für sie auch die Funktion,die Maschine am Laufen zu halten: Fehlt die richtige Musik, dann leidet dietägliche Arbeit. Umgekehrt bewegt sich in der Szene, in der das Titelstück erst-mals erklingt, die gesamte Belegschaft beim Arbeiten im Takt zur Musik:Floyd und Lloyd üben ihre Kabarettschritte, während sie die Dampfspritzeführen; Hippo schüttelt seinen Wabbelkörper und Lindy seinen Hintern,während sie sich in den Wagen lehnen, um Staub zu saugen; Geronimo wieder-um tanzt mit dem Lappen in der Hand um den Wagen herum einen Boogie.Auf diese Form der Bricolage,10 bei der alltägliche Gegenstände zu Teilen derPerformance werden, wird im Abspann zugespitzt Bezug genommen: Der Ra-dio-DJ stellt alle Arbeiter als Mitglieder einer Musikgruppe vor, wobei die Ar-beitsutensilien direkt als Instrumente präsentiert werden: «Dig the players onthe session: blowing on steam guns, Floyd and Lloyd – Darrow Igus and De
112
Wayne Jessie; sucking it up on the vacuum, Hippo – James Spinks – and Lindy– Antonio Fargas.»
Die Musik dient den Figuren in Car Wash auch als Vermittlerin von Ge-fühlen. Als beispielsweise die Prostituierte Marlene einen vermeintlichenFreund anruft, flüstert sie parallel zum eben im Radio laufenden Stück dessenText («I’m gonna die, Baby, my whole world stops») und antizipiert so denweiteren Verlauf – der so genannte Freund hat ihr eine falsche Nummer gege-ben. TC, der die Radiosendungen am aufmerksamsten verfolgt (weil er bei ei-nem Erkenn-die-Melodie-Wettbewerb Freikarten für ein Konzert gewinnenwill, um Mona auszuführen, die Serviererin des gegenüberliegenden Restau-rants), nutzt einmal die Liedzeilen von I Wanna Get Next to You, um seinenSchwarm zu überzeugen: Indem er den Text synchron zum Song spricht, be-dient er sich des thing, um seine Gefühle auszudrücken und um sich sein Datezu sichern.
Wie komplex Car Wash die Musik für die Zwecke der Narration nutzt,zeigt sich anhand von I Wanna Get Next to You sehr deutlich. TC beschwörtzu dessen Klängen Mona, Hippo starrt dabei sehnsüchtig Marlene an, währendCharlene den Koffer ihres Freundes Scruggs aus dem Wagen wirft und dieKassierin Marsha sich für ihr Date mit dem Kunden Kenny bereitmacht. Sindall diese Leute durch den sehnsüchtigen Soul-Song verbunden, so unterschei-den sich die jeweiligen Verhältnisse stark: Während die Romanze von TC undMona dem Geist des Stücks entspricht, so hat Hippo für eine Affäre mit Marle-ne zu bezahlen. Charlene wiederum weist Scruggs zurück, und die Beziehungvon Marsha zu Kenny bleibt offen: Wir hören zwar ein Hupgeräusch, als siedie Waschanlage verlässt, was vermuten lässt, dass er auf sie wartet, aber wir se-hen nicht, wie sie zu Kenny ins Auto steigt. Bild und Musik unterstützen sichgegenseitig, wenn wir zu den Liedzeilen «Dreams of you and I go sailing by»Marlenes Beine mit Hippos Augen sehen und sie seinen Blick zu «wheneveryour eyes meet mine» erwidert, bevor sie sich zu «you’re so good» verächtlichabwendet. Als es weiter heisst «… and girl, you make me feel so …», zoomt dieKamera auf Hippo, der nach dem «so» genüsslich in einen Hamburger beisst.Bild und Musik sind derart zusammengeschnitten, dass die Gefühle der Cha-raktere ebenso direkt wie mehrdeutig an die Musik gebunden sind. Die Ver-bindung ist zugleich buchstäblich (Blickkontakt und Hunger sind zusammenvisualisiert), expressiv (die Intensität von Hippos Verlangen), ironisch (Ro-mantisieren der Klient-Prostituierten-Beziehung seinerseits) und wider-sprüchlich (ihre Verachtung versus das Hymnisch-Anhimmelnde des Liedes).Solch verschiedenartiges Zusammenspiel von Ton und Bild zieht sich konse-quent durch den ganzen Film.
In der zuvor erwähnten Car Wash-Sequenz etwa entsprechen Tempo undPhrasierung der Musik exakt den Aktionen im Bild – jedem Wechsel in derMusik folgt ein Bildschnitt –, und wenn es gegen Ende des Stücks zum instru-
113
mentalen Zwischenteil kommt, als TC durch eine Windschutzscheibe Monaerblickt, so lässt sich das aufreizend-funkige Bassspiel ebenso direkt TCs Ge-fühlslandschaft zuordnen wie der Umstand, dass Monas Gang – mit TCs Au-gen gesehen – leicht verlangsamt gezeigt ist und auch dadurch besonders auf-reizend wirkt. Das Lied Put Your Money Where Your Mouth Is wiederum be-gleitet Hippo, der ohne Worte sein geliebtes Radio für die Liebesdienste vonMarlene hergibt, Irwin, der den Arbeitern Mao vorliest, Mr. B, der sich beiMarsha beklagt, dass die Geschäfte nicht gut laufen, sowie die Konfrontationzwischen Lindy und Abdullah, wobei Lindy Letzteren mit den Worten «Is theonly thing you’re good at shooting off your mouth?» provoziert – dies sind al-les Variationen von unterschiedlich gelagerten Geld-Beziehungen oder von«billiger» Rede – «talk is cheap» heisst es im Song einmal, durch Bläser promi-nent markiert. Zig Zag wird eingeführt als Lied «für alle Surfer da draussen,von Malibu bis Newport Beach», begleitet dann aber bloss Calvin beim Skate-boarden – bis er, parallel zur Klimax der Musik, vom Brett fällt.11
Auch das Schwatzen der KGYS-Moderatoren ist immer wieder mit demBild verzahnt. Etwa wenn der schwergewichtige Hippo morgens mit seinemkleinen Moped zur Waschanlage tuckert, während der Moderator von kalo-rienarmen Substituten erzählt. Oder wenn Goody sich an Chuko für dessenStreich an Marsha rächt – die Schelte hat nämlich er eingefangen –, indem er inChukos Sandwich Tabascoschoten stopft, wird der folgende Song am Radioeingeleitet mit «Let’s see if this goodie is hot enough for you».
Sowohl für die Charaktere wie für den Film ist KGYS ständiger Bezugs-punkt. Die repetitive Struktur suggeriert eine Zirkularität, die auch viele dernarrativen Fäden charakterisiert. Während mehrere Figuren keine erzähleri-sche Entwicklung durchmachen, so präsentieren sich die Dinge für jene, beidenen eine solche auszumachen ist, am Ende gleich wie am Anfang: Loretta,die sich Justin zurück an die Schule wünscht, bricht zwar erst mit ihm, kommtaber am Ende doch zurück; die Prostituierte Marlene hofft, durch Joe ihr ge-genwärtiges Leben hinter sich lassen zu können, ist zum Schluss jedoch so ein-sam wie zuvor; Irwin, der sich unbedingt mit den Arbeitern identifizieren will,wird schliesslich in die Fussstapfen des Vaters treten; dem ehemaligen HäftlingLonnie, von Mr. B mit dem Öffnen und Abschliessen der Waschanlage be-traut, wird, als er am Ende das Gespräch mit seinem Chef sucht, einmal mehrbeschieden, dass der Zeitpunkt gerade ungünstig sei. Andere Erzählfäden en-den ungelöst oder zwiespältig: Wird das Vortanzen, zu dem sich Floyd undLloyd am Abend verabschieden, den Durchbruch des Duos bringen? WirdKenny für Marsha da sein? Werden TC und Mona am gemeinsamen Konzertzusammenfinden, und wenn ja, wieso sollte die Beziehung diesmal von dauer-hafterer Natur sein – schliesslich gingen sie schon früher miteinander aus?Wieso sollte Mr. B sein Versprechen diesmal halten? Die tatsächlichen Verän-derungen sind nur negativ: Hippo ist seinen geliebten Radio los; Scruggs ver-
114
schwindet allein mit dem Koffer, den Charlene ihm vor die Füsse geworfenhat; Abdullah ist gefeuert und wird, als er am Ende aus Rache die Tageseinnah-men der Waschanlage stehlen will, von Lonnie dabei überrascht.
Im Kontext der schwarzen Literatur schlägt Blyden Jackson vor, dass in«the typical Negro novel, after all the sound and fury dies, one finds thingssubstantially as they were when all the commotion began».12 Solch zeitlicheZirkularität ist laut Jackson ausserdem mit der räumlichen Gebundenheit inden afroamerikanischen Erzählungen verknüpft: «All Negro fiction tends toconceive of its physical world as a sharp dichotomy, with the ghetto as its cen-tral figure and its symbolic truth, and with all else comprising a non-ghettowhich throws into high relief the ghetto itself as the fundamental fact of life forNegroes as a group.»13 In anderen Worten: Schwarze können ihre Situationnicht verändern. Dies gilt auch für Car Wash. Wir sehen Figuren, wie sieabends nach ihrer Arbeit die Waschanlage verlassen, aber wir wissen, dass sieanderntags wieder hier stehen; dank Lonnie wird vielleicht auch Abdullah zu-rückkommen können. Die Kunden der Waschanlage dagegen halten nur zwi-schendurch auf dem Weg vom einen Ort zum andern, und sie sind alle weiss.14
Der Film zieht, um auf Halls Bemerkung bezüglich der ausgeprägten Kör-perkultur der schwarzen Diaspora zurückzukommen, auch auf einer anderenEbene eine explizite Trennlinie zwischen Weiss und Schwarz: Während Weis-se mit Körperausscheidungen nicht umgehen können, begegnen ihnenSchwarze gelassen. Der Weisse Scruggs hat einen einzigen One-Night-Stand,und schon juckt sein Penis – Geronimo gibt ihm wortreich Rat. Miss BeverlyHills schafft es gerade rechtzeitig anzuhalten, bevor ihr Sohn den Wagen voll-kotzen könnte; kaum hat sie das Auto in der Waschanlage reinigen lassen undsich über einen kleinen Flecken auf der Tür lauthals beschwert, übergibt sichder Sohnemann doch noch. Der Mann, den TC und Hippo fälschlicherweisefür den verrückten Soda-Flaschen-Bomber halten, von dem im Radio die gan-ze Zeit die Rede ist, braucht seine Flasche, wie sich herausstellt, lediglich füreine Urinprobe – als die Pulle nach einer turbulenten Verfolgungsjagd auf denBoden fällt und zerspringt, sagt Charlie zu Lonnie nur: «I just don’t under-stand white folks.» Marlene wiederum entgegnet Miss Beverly Hills, als diesesich über das billige Parfüm auf dem WC beschwert: «It’s supposed to smell,lady, it’s a toilet!» Diese symbolische Opposition zwischen Schwarzen undWeissen meint zweierlei: Erstens, dass Schwarze in Kontakt mit ihrem Körperstehen und Weisse diesbezüglich verklemmt sind. Zweitens aber auch:Schwarze sind nichts mehr als ihr Körper. So wie die musikalischen Nummernnicht den Alltag suspendieren, die Probleme der Figuren nicht lösen und dieErfahrungen der Musik zu keinen fundamentalen Veränderungen der Situati-on führen, so hilft auch das Motiv der Körperausscheidungen mit, dass CarWash auf narrativer wie symbolischer Ebene zugleich Zirkularität und Still-stand, Kontinuität und Repetition suggeriert: Der ständigen Wiederkehr des
115
Themas steht der Status quo entgegen. Was wir sehen, sind Variationen des im-mer Gleichen.
Car Wash steht keineswegs alleine da, wenn es um den Gebrauch des thinggeht. Der Film ist nur ein besonders konsequentes Beispiel dafür. Als frühesExempel lässt sich etwa Dudley Murphys Kurzfilm St. Louis Blues (USA 1929)anführen. Zur Promotion der gleichnamigen Schallplatte gedacht, ist St. LouisBlues der einzige Film der schwarzen Jazzgrösse Bessie Smith, und im Grundehandelt es sich um einen 17 Minuten langen Vorläufer des Videoclips. Erzähltwird die Geschichte von Bessie, die ihren treulosen Ehemann Jimmy in denArmen einer anderen Frau erwischt. Nach einem kurzen Handgemenge wirftBessie die Frau hinaus und bittet Jimmy, doch bei ihr zu bleiben. Trotzdemverlässt er Bessie, worauf diese, am Boden kniend und ein Glas Gin in derHand, ihren St.-Louis-Blues singt. «My man has got a heart like a rock …»Nach einem Schnitt (via Schwarzblende) sitzt sie singend in einem Nachtklubam Tresen, ein Glas Gin in der Hand. Eine Band begleitet den Song, und Gästestimmen mit ein, geben den Chor zum Solo, wobei unklar bleibt, ob Bessie fürdie andern eine Show gibt oder ob sie sich einfach ihre Sorgen vom Leib singt,ob sie also die Jazzsängerin Bessie Smith oder schlicht die verlassene Bessie ist.Der Song endet, als Jimmy den Klub betritt, vermutlich Tage, vielleicht auchnur Stunden oder aber gar Monate, nachdem er sie verlassen hat. Es kommt zurkurzen Wiedervereinigung, doch nachdem er Bessie bestohlen und sich erneutaus dem Staub gemacht hat, nimmt sie das Lied wieder auf, in Grossaufnahmeund aus dem Off begleitet von einem Chor. Das Lied ist das, was immer da ist,sowohl für Bessie (Smith) als auch für den Chor im Film und für das Kinopub-likum. Indem klare Raum- und Zeitkoordinaten verwischt werden – betontwird der endlose Kreislauf vom Missbrauch der Liebe –, konstruiert der Filmsowohl den Blues wie Bessie als Star und die schwarze Kultur als zyklisch ge-prägt.15
In House Party (Reginald Hudlin, USA 1990) ist Hip-Hop- und Funk-Musik jederzeit verfügbar. Alle für den Film zentralen jungen schwarzen Män-ner sind imstande, einen Rap zu improvisieren, wann immer es nötig ist. Sodrücken Kid und Play an einer Party ihre Freundschaft durch Rivalität imRappen aus. Kid, der später für kurze Zeit im Gefängnis landet, hält seine Zel-lengenossen mit einem Rap davon ab, ihn zu vergewaltigen. Darin unterschei-det sich der Film von «weissen» Musicals, wo die Charaktere zwar ebenfalls ineinem Song aufgehen, dies aber kein immer wiederkehrendes Moment in ih-rem kulturellen Leben darstellt. Wenn die Jungs in House Party aus Freund-schaft oder zur Verteidigung rappen, dann arbeiten sie mit der Musik, die sieandauernd hören.
Das Eingetauchtsein in die Musik, die enge Verbindung der Menschen zurMusik, deren Verfügungsgewalt über die Musik kann sich auch auf einer ab-strakten Ebene äussern, so zum Beispiel, wenn sich House Party plötzlicher
116
Musik-Schnipsel bedient, die nicht in der Diegese verortbar sind, aber eindeu-tig dem kulturellen Modus der Charaktere entsprechende Gefühle ausdrü-cken. Als Kid einmal von der Schule nach Hause kommt – begleitet von einemHip-Hop-Beat – und im Briefkasten tastend nachschaut, ob die Direktion sei-nem Vater bereits eine Notiz wegen seiner Pausenschlägerei hat zukommenlassen, wird Kids rhythmisch-hektische Suchbewegung mit der Hand von ei-nem typischen Funk-Gitarrenriff simuliert – es ist dem ständig gegenwärtigenHip-Hop-Stück entwachsen und markiert zugleich dessen Ende. Denn als Kiddie Haustür öffnet, beginnt ein anderes Regime, «seine» Musik muss in denHintergrund treten. Die Alten sind nämlich mehr für Soul, wie ein RunningGag des Films betont: In jeder Wohnung läuft, schauen die älteren Semesterfern, dieselbe TV-Werbung für ein Best-of-Soul-Album. Während die Jungendurch Funk und Rap verbunden sind, gehört der Elterngeneration der Soul.Die kulturelle Identität der Menschen wird durch Musik bestimmt.
Wie lebendig Musik in diesem Universum mitunter sein kann, zeigen zweiandere Beispiele aus House Party: Wenn sich der P-Funk-Musiker GeorgeClinton (Funkadelic, Parliament) in einer kleinen Nebenrolle als DJ an einemmittelständischen Gartenfest verdingt und Platten aus dem Koffer zupft mitder Ankündigung «here’s another dusty one for your dusties», um unvermit-telt Staub von der Platte zu blasen, bevor er die Nadel aufs Vinyl setzt, oderwenn die Jugendlichen an ihrer Party zu Plays Rap den Chor «Da roof is onfire. We don’t need no water. Let the motherfucker burn» geben, während sichböse Jungs daran machen, das Haus anzuzünden, dann sind dies nicht nurschöne Beispiele für das so genannte Signifyin(g),16 bei der die Musik dieFunktion von Kommentar oder Dialog übernimmt. Die Musik wird auf leichteArt sehr ernst genommen und kann Dinge bewirken.
Letztlich gelten aber auch für St. Louis Blues und House Party BlydenJacksons Ideen von der Gleichzeitigkeit von Zirkularität und Stillstand sowievon Kontinuität und Repetition: In St. Louis Blues wird suggeriert, dass Bessieimmer wieder zu ihrem Mann zurückkehrt. In House Party trifft Kid zwar dieEntscheidung, Sidney Sharane vorzuziehen, aber der Kreislauf Partyfeiern –Vom-Vater-mit-dem-Gürtel-geschlagen-Werden, weil er zu spät nach Hausekommt, bleibt bestehen. Eine Vision von Veränderung existiert in allen er-wähnten Filmen nicht, und wenn, dann bleibt sie uneingelöste Fantasie. Wäh-rend von Dingen erzählt wird, die unveränderbar sind, weist der repetitive Ge-brauch der Musik doch darauf hin, dass die Dinge fortwährend in Bewegungbleiben. Ein spannungsgeladenes Paradox. Das in einem anderen Film, SpikeLees Do the Right Thing (USA 1989), in eine Eskalation mündet. Radio Ra-heem, eine der zentralen Figuren, ist immer mit seinem Ghettoblaster zu se-hen, aus dem immer dieselbe Musik dröhnt: Fight the Power von Public Ene-my. Im Unterschied zu Mister Señor Love Daddy, dessen Radio eine ähnlicheFunktion einnimmt wie KGYS in Car Wash und der eine grosse Bandbreite
117
118
traditioneller wie aktueller schwarzer Musik spielt, ist Radio Raheem einzigauf seine Band und sein Stück fokussiert. Er nutzt die Musik zur Konstruktionseiner Identität So fordert er die Latin hörenden Puertoricaner erfolgreichzum Ghettoblaster-Duell heraus und weigert sich, seine Musik in Sals Pizzerialeiser zu drehen. Was zum finalen Streit führt, bei dem Radio Raheem stirbt –für seine Musik, für deren Promotion, dafür, was Musik für seine Identität be-deutet.
Anmerkungen
1 Zitiert in Nelson George, The Death ofRhythm & Blues, New York 1988, S. xvi.
2 Stuart Hall, «What Is This ‹Black› inBlack Popular Culture?», in: Gina Dent (Hg.),Black Popular Culture: A Project by MicheleWallace, Seattle 1992, S. 21–33. Ü. d. Vf.
3 Stuart Hall, Cultural Identity and Cine-matic Representation, in: Houston Baker, Jr. /Manthia Diawara / Ruth Lindeborg (Hgg.),Black British Cultural Studies: A Reader, Chi-cago 1996, S. 221.
4 Explizite Filme erwähnt Hall nicht, zuvermuten ist, dass er vor allem vom so genanntunabhängigen schwarzen Kino spricht, vonFilmemachern, die ihre Kunst mit politischemund kulturellem Engagement verknüpfen. Je-denfalls interessiert ihn am «Caribbean cine-ma» sowie an den «emerging cinemas ofAfro-Caribbean blacks in the ‹diasporas› ofthe West» hauptsächlich deren Impetus, kul-turelle Identität und die Praxis der Repräsen-tation zur Disposition zu stellen. Gleichwohlbetrifft sein Wunsch nach einem Kino, dasplurale Identitäten zulässt, das schwarze Kinogenerell. Ebd., S. 210. – Zum schwarzen Filmexistiert nach wie vor verhältnismässig we-nig (befriedigende) Theorie. Entweder tretenKonzeptualisierung und Analyse hinter dieBeschreibung individueller Strategien zurück,oder es werden Passepartout-Definitionen er-
stellt, gemäss denen ein Film «schwarz» ist, so-bald ein schwarzer Produzent, Regisseur,Schreiber oder Schauspieler involviert ist oderdas Werk ein schwarzes Publikum ansprichtoder von der Erfahrung schwarzen Lebens er-zählt (siehe z. B. Thomas Cripps, Black Filmas Genre (Bloomington/London 1979, S. 3).Gladstone Yearwood wiederum begreift inBlack Cinema Aesthetics: Issues in Indepen-dent Black Filmmaking (Ohio 1982) das«black cinema» als ein Kino der Differenz undzwar unter dem Aspekt der Rekodierung dervon der Filmindustrie perpetuierten Stan-dards. In jüngerer Zeit ist das alte Konzept derRepräsentation (Kampf um Zugang zum Sys-tem der Repräsentation und der Angriff aufdie marginalisierenden, stereotypisierendenund fetischisierenden Darstellungen Schwar-zer mittels eines «positiven» Gegenbildes) ei-nem diskursiveren Verständnis gewichen. Soerlaubt es Stuart Halls Emphase auf der Politikder Repräsentation immerhin, unterschiedli-che Strategien des afroamerikanischen Kinosund seiner kritischen Rezeption epistemologischeinzuordnen. Was bleibt, ist die Unmöglich-keit, «blackness» essenzialistisch-ontologischzu definieren. Das «black» in «black cinema»ist weniger deklarative Selbstbezeichnung, esist vielmehr Definition der gesellschaftlichenMehrheit, der die Hautfarbe der Filmemacherals verbindendes Merkmal zur Prägung des ge-neralisierenden Begriffs genügt.
119
5 Als Car Wash 1976 vom Multi Universalproduziert wurde, war die Blaxploitation-Welle längst am Abebben. Zwar führt DariusJames den Film in seinem Standardwerk That’sBlaxploitation! Roots of the Baadasssss ’Tude(Rated X by an All-Whyte Jury) (New York1995) noch als Vertreter des Genres (S. 127),nimmt man jedoch die Formel des gemeinhinals Modell für Blaxploitation geltenden SweetSweetback’s Baadasssss Song (Melvin Van Pee-bles, USA 1970) zum Mass – ein hoch sexuali-sierter Schwarzer beantwortet Gewalt mit Ge-gengewalt und besiegt ein korruptes weissesEstablishment –, wäre Car Wash eindeutignicht Blaxploitation zuzuordnen. Gleichwohlist Car Wash von Blaxploitation nicht ganzloszulösen. Auch dieser Film lässt sich alsidentitätsstiftendes B-Kino bezeichnen. Auchdieser Film zielt auf ein junges, urbanes, (vorallem männliches) schwarzes Publikum,macht jedoch zugleich Angebote an eine weis-se Zuseherschaft (zwar keine Gewalt und nurmässig Sex, aber viel Style und Musik). Auchdieser Film spielt in einer schwarzen neighbor-hood in einer Inner City (hier: L. A.). Auchdieser Film funktioniert über eine bestimmteKörperpolitik und als sinnliche Kombinationvon Bild und Musik. Zudem spielt Car Washauf ironische Art mit Stereotypen von Blax-ploitation: TC etwa trägt einen mustergültigenAfro und träumt davon, der erste schwarze Su-perheld zu sein. Der Schauspieler AntonioFargas wiederum, der in vielen Blaxploitation-Filmen den Kleinganoven gegeben hat, dessenScheitern von vorneherein klar scheint, deraber immer noch versucht, seine Würde zu be-halten, verkörpert hier – ebenfalls mit sehr vielWürde – die tuntige Lindy.
Wenn Phyllis R. Klotman und Gloria J.Gibson Regisseur Michael Schultz zu denHollywoodianern unter den schwarzen Regis-seuren zählen (Dictionnaire de 36 cinéastesnoirs américains, in: Mark Reid et al. (Hgg.),Le cinéma noir américain, Préfaces de MelvinVan Peebles et Michel Fabre, CinémActionNo. 46, 1988. S. 185–192, v. a. S. 187.), so hatdies erstens damit zu tun, dass Schultz schonfrüh wenig Berührungsängste zum (weissen)Establishment und zum Populären gezeigt hat– Schultz war 1969 der erste schwarze Regis-seur am Broadway (Does a Tiger Wear a Neck-tie?, für den Tony nominiert) und drehte auchmehrere Episoden für TV-Serien wie Barretta
und The Rockford Files –, zweitens, dass ersich konventionalisierten Hollywood-Erzähl-mustern nie verschlossen hat. Gleichwohl hatSchultz innerhalb dieses Rahmens schwarzeRollenmuster und Bilder immer wieder hin-terfragt.
6 Richard Dyer, «Is Car Wash a Musical?»,in: Manthia Diawara (Hg.), Black AmericanCinema, New York / London 1993. S. 93–106.
7 George (wie Anm. 1), S. xv.
8 James A. Snead, «Repetition as a Figureof Black Culture», in: Henry Louis Gates, Jr.(Hg.), Black Literature and Literary Theory,New York / London 1984. S. 59–79.
9 Snead 1984, S. 67.
10 Zur Technik der Bricolage vgl. Jane Feu-er, The Hollywood Musical, London2 1993,S. 3–7.
11 Was insofern Sinn ergibt, als wir die Sze-ne aus Irwins Blickwinkel sehen und die Mu-sik den Puls der Aktion aufnimmt, zugleichaber Irwins Assoziationen widerspiegelt: Ge-meinsam mit Irwin antizipieren wir so CalvinsSturz.
12 Blyden Jackson, «The Negro’s Image ofHis Universe as Reflected in His Fiction» in:ders., The Waiting Years: Essays on AmericanNegro Literature, Baton Rouge 1976. S. 92–102. (Erstveröffentlichung 1960, Zitat aufS. 100.)
13 Ebd, S. 95.
14 Abgesehen vom dubiosen Prediger Dad-dy Rich und seiner Entourage, die durch ihreauf Geld basierende Religion aus dem schwar-zen Ghetto gefunden haben. Dass im Zusam-menhang mit Daddy Rich das einzige Mal einemusikalische Nummer den Konventionen desklassischen Hollywood-Musicals entspricht,indem (ohne dass es durch die Handlungzwingend motiviert wäre) ein äusserer Reizdie Figuren zum Musizieren und Singen ani-miert, ergibt insofern Sinn, als Richs Ambitionder weissen Lebenswelt gilt.
120
15 Die Liste schwarzer Musikerinnen undMusiker, die in Filmen – als zumeist tragendeFigur – auftreten, um ihre eigenen Lieder zusingen, ist lang. Neben Bessie Smith wären un-ter anderen zu nennen: Curtis Mayfield in Su-perfly (Gordon Parks, USA 1972); Jimmy Cliffin The Harder They Come (Perry Henzell, Ja-maika 1973); Run-DMC, Kurtis Blow undSheila E. in Krush Groove (Michael Schultz,USA 1985), Kid’n’Play, George Clinton undFull Force in House Party (Reginald Hudlin,USA 1990), Nathaniel Hall (Jungle Brothers)in Livin’ Large (Michael Schultz, USA 1992).Dabei werden die Stars meist eingeführt alsTeil der fiktiven «community», aus der sie bis-weilen heraustreten und zur Starperson wer-den, ehe sie sich wieder in die «community»einfügen.
16 Der spezifische Gebrauch des Englischendes schwarzen Amerika basiert auf dem Miss-trauen gegenüber dessen Bedeutung, und ent-sprechend weicht die vertikale Signifikationeinem horizontalen Signifyin(g), das das Deh-nen, Parodieren, Infragestellen von sprachli-chen Zeichen vor allem in sozialen Situationenunter Männern in den Mittelpunkt derschwarzen Folklore stellt. Entscheidend ist beider figurativen und implikativen Rede des Sig-nifyin(g), dass stets das ganze Diskursuniver-sum mitgedacht wird. Denn die scheinbare Be-deutung der Äusserung unterscheidet sich vonder eigentlichen; sie spielt bloss auf die tat-sächliche Bedeutung an. Siehe dazu HenryLouis Gates, Jr., The Signifying Monkey: ATheory of African-American Literary Criti-cism, New York / Oxford 1988.
!"# $%&'(
)*+*,-*,*+./+-012/034456-*,*+
73+89-4:8;3,,*<=3+:*+>*+/-?/;3+2*@2/>*-26*+A<<-<01*,
*4*B2,3+-<01*,/CD<-B
Wie schnell sich Begriffe entwerten, vermag immer wieder zu überraschen:1999, zum ersten Club-Transmediale-Festival ,1 galt «DJ» (Discjockey) als einBegriff, dessen man sich in Katalogtexten gerne bediente, schwang darin dochein guter Teil des musikalischen Aufbruchs der frühen Neunzigerjahre mit –samt der sozialen und politischen Implikationen. Heute, kaum mehr als vierJahre später, ist der DJ als Protagonist einer meist einfallslos ritualisierten Pra-xis entwertet, die sich, eingebettet in ökonomische Verwertungszwänge, inden allnächtlichen Partystereotypen der Clubs vollzieht. Nicht, dass die DJsvöllig aus den Programmen der Festivals und der auf das Experimentelle set-zenden Clubs verschwunden wären. Nur auf der Begriffsebene werden sie vonjedem verschwiegen, der etwas auf die Fortschrittlichkeit seiner Programmge-staltung hält. Man betont jetzt lieber die Live-Performance, die als Zentrumder abendlichen Choreografie in keinem Programm fehlen darf. Der DJ ist nunbeinahe wieder das, was er im Rock-Business von jeher war: Er sorgt für Ein-stimmung vor dem Konzert und für die Verlängerung des Abends danach.Und setzt so den Rahmen für die für jeden Veranstalter lebensnotwendigenUmsätze an der Bar.
Dem gerade ein paar Jahre alten Begriff des «VJ» (Videojockey)2 ergeht esnicht anders. Noch zum Club Transmediale 2002 gilt er als begehrlicher Flucht-punkt eines medialen Entwicklungshorizontes. Bereits im folgenden Jahr be-schreibt er eine Praxis, die durch Gesichtspunkte der Ökonomie, der Unterhal-tungsfunktion und der Produktion von popkultureller Differenz weitgehenddeterminiert zu sein scheint. So sehr, dass die Bildproduzenten diese Praxis voneiner als gehaltvoller betrachteten künstlerischen Entwicklungsarbeit unter-scheiden. Entgegen der landläufigen Verwendung des Begriffs für jede Art dervisuellen Begleitung von Musik gilt er vielen Produzenten lediglich noch als Be-zeichnung eines ästhetischen Formats, das auf die mehr oder weniger kommer-zielle Party oder das bühnenzentrierte (Rock-)Konzert zugeschnitten ist.
Die neuen Möglichkeiten digitaler Technologien dagegen reaktivieren ge-genwärtig die Idee einer audiovisuellen Musik, wie sie vor allem in den kon-
121
struktivistischen Avantgarden des ersten Drittels des vorigen Jahrhundertsformuliert wurde. Leistungsstarke Laptops samt entsprechender Software er-schliessen als universelle Produktions- und Performance-Instrumente neueMöglichkeiten der Echtzeit-Prozessierung von Klängen und Bildern. Dadurchrückt im Kontext der elektronischen Musik die akustische und visuelle Live-Performance in das Zentrum des Interesses. Die Kopplung von optischen undakustischen Ereignissen als Ausdruck einer direkten physikalischen Äquiva-lenzbeziehung sowie die Interaktion eines Performers mit generativen Software-Applikationen, bei denen im Code implementierte Entwicklungsprinzipienselbsttätig Klänge und/oder Bilder erzeugen, löst das Collagieren und Mani-pulieren vorgefertigter Sequenzen ab, die eigentlichen Techniken von DJ-ingund VJ-ing. Dementsprechend lassen sich die Protagonisten dieser Kunstfor-men nicht mehr eindeutig als Musiker oder visuelle Künstler einordnen. Als«Videomusiker» respektive «Videomusikerin» verkörpern sie nicht ohneRückgriff auf historische Vorbilder hybride Identitäten aus Musiker, Gestalte-rin, Darsteller, Wissenschaftlerin und Programmierer.
VJ
Es ist somit kein Zufall, dass DJ-ing und VJ-ing dieselbe Umwertung erfahren.Der zeitliche Abstand dieser Umwertung entspricht demjenigen, den techni-sche Neuerungen auf dem Gebiet der Audiosoftware den entsprechendenbildgebenden Software-Applikationen voraushaben. Letztere sind technischschwieriger umzusetzen, da sie grössere Datenmengen erzeugen und dahermehr Rechenleistung benötigen. Zudem gibt es in der akademischen Musiktra-dition eine besondere Affinität zur Mathematik, die die frühzeitige Entwick-lung von Computertechnologie zur Musikproduktion begünstigt hat. DieGleichsetzung von DJ-ing und VJ-ing als äquivalente künstlerische Tätigkei-ten allerdings, wie sie die Ähnlichkeit der Begriffe nahe legt, trifft nur dort zu,wo beide auf ihre Funktion der akustischen oder visuellen Stimulation derClubbesucher beschränkt werden, sich also auf einzelne Dienstleistungen re-duzieren, deren kunstvolle Koordination das Funktionsgebilde Club erst sorichtig in Schwung bringt. Dem VJ-ing sein künstlerisches Potenzial über eineinnovative Form des visuellen Designs hinaus abzusprechen, ist dennoch einevorschnelle Folgerung. Denn der ästhetische Kern des VJ-ing liegt gerade inder undefinierten Stellung zwischen Design und Kunst, zwischen Stimulationund kritisch-ironischer Beschreibung des eigenen sozialen und immer auchpopkulturell überformten Umfeldes.
Formal liegt die Gemeinsamkeit von VJ-ing und DJ-ing darin, aus vielenunterschiedlichen Sequenzen oder Tracks einen neuen, in sich zusammenhän-genden, kontinuierlichen Strom der Bilder oder Klänge zu erzeugen. Abhän-
122
gig von der technologischen Ausstattung verfügen VJs dabei über ein unter-schiedlich ausdifferenziertes Repertoire zur Überlagerung und Bearbeitungvorgefertigter Bildsequenzen in Echtzeit. Es ermöglicht ihnen, musikalischeElemente aufzugreifen und so Synästhesien und Synchronizitäten zu erzeugenoder Kontrapunkte zur Musik zu setzen. Erlaubt der verfügbare technologi-sche Standard nur wenige Echtzeit-Prozesse, ist es umso wichtiger, die Bildse-quenzen in der Vorproduktion bereits von ihrer Struktur her (Rhythmik, Län-ge, Informationsdichte, Stimmung und so weiter) auf bestimmte Musikstileund Situationen zuzuschneiden. Dabei kommt eine umfangreiche Palette visu-eller Gestaltungsmittel zum Einsatz, die gegenständliche Aufnahmen, FoundFootage, Info-Grafiken und visuelle Samples sowie synthetisch erzeugte ab-strakte Zeichen, Formen, Texturen und Strukturen überlagern.
VJs benutzen selbst produziertes Material. Auch wenn sie offensichtlichauf Samplingtechniken zurückgreifen und sich etwa in den Archiven der Un-terhaltungsindustrie bedienen, interpretieren sie das Material durch ihre er-hebliche Bearbeitung neu. Zudem wird das Fremdmaterial unterschiedlichverwendet. Spielt der DJ meist Stücke, die auch tatsächlich für diesen Zweckproduziert wurden, so dekontextualisiert der VJ das Material, das für andereZusammenhänge wie Werbung, Fernsehen, Kino oder Wissenschaft erstelltwurde, indem er es entgegen dem ursprünglichen Zweck verwendet. Für denVJ existieren keine speziell für seine Arbeit zugeschnittenen, der Schallplatteoder CD in der Musik entsprechenden Produkte. Er kann nicht auf die Pro-duktion anderer VJs oder Videoproduzenten zurückgreifen, die ihm ihre Ar-beit frei oder als kommerzielles Format zur Verfügung stellen.
VJ-ing ist eine performative Kunstform, die ohne das Bezugssystem derMusik nicht existieren kann. Charakteristisch für VJs ist jedoch, dass sie unab-hängig von Musik und Musikern produzieren. Ton- und Bildkünstler befin-den sich also nicht in einem gemeinsamen konzeptionellen Zusammenhang,sondern treffen nur zu einzelnen Performances spontan aufeinander. Dahererarbeiten sich VJs meist ein Repertoire an Bildern, das sich auf bestimmte mu-sikalische Stile oder noch allgemeiner auf Identität und Lebensentwürfe einesbestimmten Clubpublikums oder einer spezifischen Szene bezieht. VJ-ing isteher eine künstlerische Praxis, die das sozio-politische Klima eines Clubs undseines Umfeldes und dessen ästhetische Strategien spiegelt, als eine Kunstform,die eine formal-strukturelle Auseinandersetzung mit der Musik sucht. VJ-ingfunktioniert in diesem Sinne am besten im Zusammenspiel mit Musik, die sichweniger mit Fragen der Organisation des Tons beschäftigt als mit den Implika-tionen von Image, Identität und Repräsentation innerhalb eines popkulturel-len Bezugssystems.
Eine viel beachtete Qualität des VJ-ing liegt darin, ähnlich dem kommer-ziellen Musikvideo die Palette der formalen Gestaltungsmittel gegenüber demherkömmlichen Erzählkino radikal erweitert zu haben. VJ-ing hat so im Sinne
123
des von Lev Manovich be-schriebenen Digital Cine-ma,3 bei dem sich maleri-sche und zeichnerischeTechniken mit fotografi-schen Aufnahmen verbin-den, zu einer weit offenerverfassten Konzeption deskinematografischen Rau-mes gefunden. In dessenZentrum steht nicht mehrdie fotografische Wiederga-be der Realität vor dem Ka-
meraobjektiv. Vielmehr ist die aufgezeichnete Realität nur noch ein Sonderfallinnerhalb des viel umfangreicheren Möglichkeitsspektrums der Kinematogra-fie. Entscheidend für Manovichs Auffassung von Digital Cinema und eine wei-tere Stärke des VJ-ing ist das Aufbrechen der zeitlichen Linearität der in denBildern erzeugten Narrationen. Das geschieht, indem Loop- und Hypertext-strukturen verwendet werden. Diese Form der Narration entspricht der ver-teilten und sprunghaften Aufmerksamkeit des Clubpublikums. Eines der wie-derkehrenden Themen ist dabei die Auseinandersetzung mit den urbanen Le-bensweisen der Szenen, die sich um Clubkultur und Musikstil bilden. Einanderes Themenfeld sind Erfahrungen der medialen Umwelt: Darstellungenvon Krieg, Sexualität, Globalisierung in TV, Werbung, Film und Computer-spielen. In VJ-Performances überlagern sich Bilder des Politischen, der Dissi-denz und Auflehnung, mit Bildern von Sexualität, Identität und Style. Die In-tegration technischer Prozesse in alle Lebensbereiche und die Konfrontationmit einer technologischen Ästhetik bilden einen dritten Themenkreis. DieStadt mit ihrem überbordenden Strom von Bewegungen und Zeichen, die zu-gleich technische Apparatur und Lebensraum, ein komplexes logistisches Sy-stem und ein soziales Gefüge ist, führt diese Themen als alltägliche Erfahrungzusammen. Sie steht als Quelle und Ziel dieser Bilder oftmals im Zentrum derbeim VJ-ing entworfenen Erzählungen. In diesem Sinne bündeln sich imVJ-ing Vorläufer experimenteller Bewegtbildgestaltung von den frühen kine-matografischen Versuchen wie Laterna magica oder Kinetoskop über die vie-len Strömungen des Experimentalfilms, der visuellen Musik und des Musik-films, des Trickfilms, der Videokunst seit den Sechzigerjahren bis hin zu Com-puteranimationen, Computerspielen und aktueller Medienkunst.
Ein Beispiel für solche Narrationen ist das LosLogos-Projekt des Schwei-zer Grafiker- und VJ-Kollektivs Büro Destruct4 (Abb. 1). Es beschäftigt sichmit dem Verschwinden der Vielfalt eigenwilliger und nur lokal bekannter Lo-gos und Schriftzüge, die den urbanen Raum prägen und zunehmend von den
124
Abb. 1 Büro Destruct, Screenshot LosLogos, 2003.
übermächtigen Markenzeichen welt-weit operierender Konzerne ver-drängt werden. Das Projekt basiertauf einer Internet-Plattform, der Be-sucher neues Material in Form digita-ler Fotografien zuführen können. Diegesammelten Bildmaterialien werdenvon Büro Destruct in VJ-Performan-ces zusammen mit weiteren Bildernurbaner Landschaften und selbst ent-worfenen, fiktiven Logos verwendet,die wiederum ironische Bezüge zuMarkenlogos herstellen. Dadurchentsteht eine Art Globalisierungskritik auf der Ebene der Zeichen: Die eigeneZeichenproduktion wird im Sinne der Verwirrung der globalen Zeichen alssubversive Handlung kenntlich gemacht.
Der niederländische Künstler Arno Coenen5 wählt in seinen VJ-Sets undVideoclips, die seine ansonsten skulpturalen Arbeiten fortsetzten, einen ande-ren Blickwinkel: In fast ausschliesslich 3-D gerenderten, leuchtfarbigen Ani-mationen betreibt er eine Art Skatologie des «Euro-Trash» – des konsumindu-striellen Lebensstils und der Ästhetik des nordwesteuropäischen Industrie-und Dienstleistungsproletariats (Abb. 2). Sein Untersuchungsfeld affirmie-rend, operiert er dabei hart an den Grenzen von Kitsch und Geschmack. Teilssarkastische Persiflage, teils eine die eigene Sympathie nicht verhehlendeÜberhöhung, formuliert er die bastardisierte Form einer Volkskunst des Digi-talen. Sie zitiert Pornokommerz, Computerspiel-Ikonen, Popstar-Verehrung,Sportidole, Rausch- und Konsumgewohnheiten in deutlichen Motiven und er-zählt so von einer dichotomischen Welterfahrung, die kollektiv zwischenwertkonservativer Schollenverbundenheit und dem ortlosen Halluzinieren inden Medien hin- und herpendelt.
Die Praxis des VJ-ing zeigt Parallelen zu Design und Mode. Viele der Pro-tagonisten haben eine Ausbildung in Grafik- oder Mediendesign absolviert.Sie arbeiten an einer persönlichen Wiedergabe der Wahrnehmungen und Er-fahrungen des modernen urbanen Subjekts. Dabei finden vielfache Image-transfers statt. Die Bilder sollen stimulieren. Sie dienen der Selbstvergewisse-rung und Selbststilisierung ähnlich wie die mit Slogans oder Icons bedrucktenT-Shirts. Beides sind Kommunikationsmedien, die bestimmte Haltungen inihre Umwelt projizieren.
125
Abb. 2: Arno Coenen, 2003.
Videomusik
Für den offenen Austausch zwischen Akademie und Subkultur, wie er sichderzeit in den Programmen von Clubs, Labels und mehr noch bei Musik- undMedienkunst-Festivals zeigt, ist die Rolle der Universalmaschine Computernicht hoch genug einzuschätzen. Mit dem Laptop entwickelt sich nicht nureine neue musikalische und visuelle Ästhetik, sondern es hält eine bis dato nurin der akademischen Kunstmusik gebräuchliche Form der AufführungspraxisEinzug in die Sub- und Popkultur. Die Laptop-Performance, bei der dieKünstler jede theatralische Inszenierung und körperliche Präsenz bis auf einunvermeidliches Minimum zurücknehmen, gleicht mehr dem sachlichen Öf-fentlichmachen eines wissenschaftlichen Forschungsergebnisses als der in Popund Rock üblichen Bühnenshow. Dieses bewusste Zurückhalten von Identifi-kationsangeboten und visuellen Reizen führt im Kontext der Clubkultur zu ei-ner ambivalenten Position des Performers: Er findet sich plötzlich an einerScharnierstelle wieder, die sich in Richtung der beiden kulturellen Felder Popund Wissenschaft als anschlussfähig erweist. Die Laptop-Performance radika-lisiert gegenüber dem DJ-Set nochmals den Bedarf an visueller Kompensation,beispielsweise durch Videoprojektionen. Gleichzeitig aber zeigt sie ein verrin-gertes Interesse an der Produktion popkultureller Imagetransfers und rücktzunehmend Abstraktion und Fragen nach der internen Organisation des musi-kalischen oder visuellen Materials in den Mittelpunkt. Die Bildproduktion imZusammenspiel mit zeitgenössischer elektronischer Musik teilt sich demnachin zwei prinzipiell verschiedene Ansätze: hier der Ausgleich der visuellen Ab-senz des Performers, indem eine Ersatzaura erzeugt wird, und dort die Inter-aktion von Bild und Ton durch physikalisch-technische bzw. strukturelleÄquivalenz.6 Darin spiegelt sich das polare Verhältnis von Popkultur undAkademie: Die akademische Kunstmusik konzentriert sich grösstenteils aufdie internen Beziehungen zwischen verschiedenen Parametern des musikali-schen Materials, während für die Popkultur die Positionierung innerhalb eineskontextuellen Referenzsystems zentral ist und damit die Beziehung zwischendem Kunstwerk und Teilaspekten seiner sozialen, politischen oder ästheti-schen Umgebung. Dementsprechend gelingt beim VJ-ing die Korrespondenzder Bilder mit der Musik durch das gemeinsame Sich-Beziehen auf einen bei-den äusserlichen Kontext. Bei den interessantesten audiovisuellen Projektengelingt diese Korrespondenz dagegen durch den Bezug auf beiden inhärenteGrössen wie Struktur und Materialität. Wie so oft findet sich in der künstleri-schen Praxis eine Bandbreite an Übergängen zwischen diesen Polen.
Es ist wiederum der Laptop, der auf praktischer Ebene eine neue qualitati-ve Beziehung zwischen Akustik und Optik ermöglicht, von der aus das Zu-sammenspiel von Musik und Bild neu gedacht werden kann: Bild und Ton er-schliessen sich nicht mehr als Dialog unterschiedlicher Medienformate wie
126
noch bei der Kombination von VJ und DJ, sondern auf der Grundlage eineseinheitlichen Codes als Manifestationen eines Medienkontinuums, in dem jedeArt von Information mit prinzipiell identischen Prozessen bearbeitet wird.
Dass dieses Kontinuum in der physikalischen Theorie und der analogenElektronik im Ansatz bereits beschrieben war, zeigt die Performance FourierTanzformation II des Berliner Projektes Miko Mikona7 (Abb. 3 und 4). Siegibt die im besten Sinne anschauliche Demonstration eines simultanen, analoggekoppelten Prozesses, bei dem Bild und Ton gemeinsam als mediale Einheiterzeugt werden. Die manuelle Überlagerung von unterschiedlichen Rasterfo-lien auf einem Overheadprojektor durch zwei Performer erzeugt Interferenz-muster, die durch Kameras abgetastet werden. Deren elektromagnetischeBildsignale wiederum werden von analogen elektronischen Schaltungen trans-formiert und als Tonsignal ausgegeben. Die sich wandelnden Bildmuster füh-ren so zur Modifikation des Klangs, während sie gleichzeitig das Prinzip derFrequenzmodulation – eine Grundlage elektronischer Ton- und Bilderzeu-gung – makroskopisch sichtbar machen. Ein umgekehrter Prozess findet sichbei den Arbeiten von Carsten Nicolai.8 Bei seinen audiovisuellen Live-Per-formances wird das Tonsignal durch eine bilderzeugende Software analysiert,die dessen Charakteristik zur Echtzeitmodifikation von minimalistischen, ab-strakten Bildelementen einer Videoprojektion verwendet. So werden Bewe-gung, Grössenverhältnis, Geschwindigkeit oder Farbigkeit der visuellen Ob-jekte zu grafischen Repräsentationen des Klangs.
Diese Praxis hat kunstgeschichtlich wenige Vorläufer, entspricht aber we-sentlichen Ideen und Theorien, die innerhalb der konstruktivistischen Bewe-gungen der Zwanzigerjahre entworfen wurden. Auf Grund der beschränktentechnischen Entwicklung konnten sie damals nur ansatzweise experimentellerprobt werden. Bereits die in den Zwanzigerjahren unter anderem vom Phy-siker Walter Brinkmann entwickelte Optophonetik stellte grundlegendeÜberlegungen zur physikalischen Gemeinsamkeit von optischen und akusti-schen Phänomenen an. Auch Lászlo Moholy-Nagy beschäftigte sich einge-hend am Bauhaus mit dieser Thematik. Brinkmann beschrieb 1926 den Ansatz,
127
Abb. 3 und 4 Miko Mikona, Fourier Tanzformation II, 2003.
«die Optik als nur ein Spezialgebiet der Elektrizitätslehre zu betrachten undmöglichst alle Dinge elektrodynamisch zu erklären».9 Auf diese Weise wollteer eine Farbe-Ton-Rhythmus-Beziehung zwischen Bild und Musik nicht aufder Grundlage subjektiver Empfindungen, sondern auf material-immanentenphysikalisch-technischen Faktoren gründen. «Praktische Möglichkeiten einerpositiven Lösung des Problems würden zum Beispiel gegeben sein, wenn esgelänge, Licht und Schall von ihren Trägern – Äther beziehungsweise Luft –unabhängig zu machen oder ausserdem elektrische Wellen zu Trägern für bei-de gemeinsam zu bestimmen.»10 Brinkmann entwickelte ein optisches Mikro-fon, das – beispielsweise im Optophon des Dadaisten Raoul Haussmann –Lichtintensitäten über eine Selenzelle in Spannungsimpulse umwandelte unddaraus direkt Töne synthetisierte. Brinkmann zufolge ergab sich so erstmalseine logische und notwendige Beziehung zwischen Licht und Ton. Diese ver-anlasste Moholy-Nagy festzustellen, dass es somit nicht mehr zur «Darstel-lung» von gedachten oder gesehenen Inhalten käme, sondern zur Gestaltungvon Inhalten aus den Mitteln selbst. Worin er die Erfüllung der seit Beginn des20. Jahrhunderts verfolgten Idee einer «Absoluten Gestaltung» sah, die nichtmehr Umwelt abbilden, sondern im elementaren Sinn schöpferisch tätig seinwill. In dieser Absoluten Kunst gibt es keinen Inhalt mehr, auf den zu verwei-sen wäre. Die Form ist zugleich der Inhalt. Gedanke und Material werden de-ckungsgleich, ohne dabei auf etwas über sich hinaus verweisen zu wollen. Mitder Einführung des Licht-Ton-Verfahrens um 1930 erschloss sich auch im fil-mischen Medium diese direkte physikalische Äquivalenzbeziehung von Optikund Akustik. Insbesondere Oskar Fischinger experimentierte mit der gleich-zeitigen Synthese von Bild und Ton durch manuell gezeichnete Lichtton-Spu-ren. Fischinger verkörpert mit diesen Arbeiten prototypisch den audiovisuel-len-Musiker, der zwei Entwicklungsstränge zusammenführt: «Optisch er-zeugter synthetischer Ton ist der Vorläufer des synthetischen elektronischenTons, genauso wie der handgemachte abstrakte Film der Vorläufer des maschi-nell erzeugten elektronischen Computerfilms ist.»
Brinkmann hatte mit seinen Erfindungen bereits die Möglichkeiten dersich entwickelnden elektronischen Technik vorausgesehen, die jegliche senso-risch erfassbaren Daten gleichsam als kontinuierliche elektromagnetischeWellen unterschiedlicher Frequenz zusammenfasst. Damit hatte er zwar imPrinzip ebenso ein Charakteristikum des digitalen Computers beschrieben,der jede Information als diskontinuierliche Zahlenwerte eines einzigen binä-ren Codes darstellt, allerdings ohne es in seiner ganzen Konsequenz formulie-ren zu können. Denn der Hardware seines «optischen Mikrofons» war nocheine bestimmte Transformationsregel inhärent, nach der die Spannungsimpul-se in Klänge gewandelt wurden, während im Computer jede Art der Informa-tion beliebig auf eine andere abgebildet werden kann und die Regel, nach derdies geschieht, zugleich auch jederzeit neu gesetzt werden kann. Jegliches Sig-
128
nal kann zur Steuerung oder Erzeugung anderer Signale verwendet werden.Erst durch eine spezifische Weise der Zuordnung und Interpretation der Sig-nale entsteht eine qualitativ interessante Beziehung. Der Laptop ist, so bese-hen, eine universelle Switchbox, die den künstlerischen Prozess in die Pro-grammierung von generativen Systemen verlagert. Deren Output wird vomKünstler nur noch strukturell und nicht im Detail kontrolliert. Das visuelleoder akustische Material liegt bei diesen Herangehensweisen nicht mehr alsbearbeitete und gespeicherte Information vor, sondern existiert nur in derForm von Entwicklungsprinzipien und Transformationsregeln, nach denen esin Echtzeit erzeugt und modifiziert wird.
In der Arbeit Micro Maps der französischen Videomusikerin Cécile Babio-le12 analysiert ein Programm die optische Dichte eines digitalisierten Bildaus-schnittes – beispielsweise eines Fotos – und übersetzt diese Information in einHöhenrelief, das auf eine planare Gitterstruktur abgebildet wird (etwa Abb. 5und 6). Babiole erstellte das Programm mit der sowohl für die Bild- als auchTonerzeugung einsetzbaren grafischen Programmierumgebung Max/Jitter.13
Es entsteht eine Art elektrische Landschaft, die sich mit der Wahl des Bildaus-schnitts permanent verändert, während sich gleichzeitig die gesamte Gitter-ebene in einem dreidimensionalen Koordinatensystem bewegt. Die Performe-rin kann dabei über einen Midi-Controller vielfältige Parameter kontrollieren,die Auflösungsvermögen, Bewegung oder Art der visuellen Repräsentationsteuern wie zum Beispiel Polygongitter, Punkt- und Linienraster, Balkendia-gramm oder Fasern. Immer aber werden die bewussten Handlungen derKünstlerin überlagert von der nicht präzise voraussagbaren Datenextraktion,die das Programm selbsttätig an dem eingegebenen Fotomaterial vollzieht. Dasquasi mikroskopische Eindringen in den Datenkörper eines Bildes und die da-raus erzeugte molekular anmutende Textur ergibt im Zusammenspiel mit denmakroskopischen, von der Künstlerin direkt beeinflussten Faktoren wie Be-wegungsrichtungen und Abbildungsmassstab die spannungsvolle visuelleEntsprechung einer ebenso an der Materialität des Sounds orientierten Musik.Dabei finden Bilder und Musik ihre Korrespondenz nicht wie bei gekoppelten
129
Abb. 5 und 6 Cécile Babiole, Micro Maps, 2003.
Bild-Ton-Systemen in direkten Synchronizitäten, sondern durch eine struktu-relle Äquivalenz.
Die Analyse der physikalisch-technischen Konstitution von Klang undBild rückt deren Materialität ins Zentrum. Materielle Textur und Struktur tre-ten dabei mit der kompositorischen Entwicklung des Stückes in ein Span-nungsverhältnis. Die Beschaffenheit des Materials erschliesst Zusammenhän-ge. Wenn Bild und Ton rein synthetischen Ursprungs sind, verweisen diese alsleere Zeichen nur noch auf die Apparatur selbst und damit auf die Informa-tionsverarbeitung, aus der sie hervorgehen. Wenn das audiovisuelle DuoReMi14 aus Wien durch provozierte Systemabstürze von Computern erzeugteabstrakte Bilder verwendet, die in ihrer Bewegung an das Zeilenlaufen einesdesynchronisierten Monitors erinnern, dann kommt darin die grundlegendeFunktionsweise unseres Sehsinnes zum Ausdruck. In einer Ästhetik des Appa-rativen wird gleichzeitig auch der Computer als ein Medium hinterfragt, dasunablässig illusionistische und manipulative Bilder in Kenntnis genau dieserFunktionsweise produziert. In diesen Versuchen, das Realität synthetisierendePotenzial technischer Medien zu dekonstruieren, wird das Verhältnis des Sub-jekts zu einer zunehmend technisch konstituierten Umwelt neu bestimmt.
Das zeigt sich insbesondere in generativen Ansätzen, die die Kontrolle vonBild und Ton in einer einzigen Geste vereinen. Scribbling Waves von CécileBabiole oder das Codespace-Projekt des Schweizer Künstler Jasch15 (Abb. 7und 8) benutzen dabei Interfaces wie Midi-Controller, Infrarot-Sensoren oderDatenhandschuh, um durch Handgesten mit dem Programmcode zu inter-agieren und so Bild und Ton simultan zu erzeugen. Die Unschärfe der Bewe-gungskoordination trifft dabei auf die Präzision der sie interpretierenden Soft-ware. Deren Autonomie liegt in der Art und Weise, wie sie die extrahiertenDaten in visuelle oder akustische Ereignisse transformiert und / oder mit Zu-fallsgeneratoren etwa kombiniert. Die Geste des Performers schliesst sich somit der Eigentätigkeit der Maschine zu einem integrierten, wenn auch instabi-
130
Abb. 7 und 8 jasch, codespace1 und codespace3, 2002.
len Systemkreis zusammen, in dem sich eine ganz eigene und in dieser Formnur durch das technische Medium mögliche «Wahrnehmungsweise» zeigt.
Die Möglichkeit, die ablaufenden Prozesse eines Computers optisch un-mittelbar zu kontrollieren, erlaubt neue grafische Interfaces. Den Pariser Soft-warekünstler Antoine Schmitt führt das zu neuartigen Kompositionsprinzi-pien. Bei Schmitts Performance The Nanomachine ist das Bild zugleich das In-terface, das durch Interaktion und Bewegung die Musik hervorbringt (Abb. 9und 10).16 Autonome Programmeinheiten – im Computer erzeugte kinetischeKlangmaschinen – werden dabei für das Publikum nachvollziehbar auf demProjektionsschirm zu bewegten, grafischen Raumensembles und gleichzeitigzu einer akustischen Komposition zusammengefügt. So lässt sich für den Be-trachter/Hörer nicht mehr bestimmen, ob die visuelle Komposition die Folgeeines auf das Musikalische oder ob die Musik das Ergebnis eines auf das kine-matografische Gesamtbild zielenden Entscheidungsprozesses ist. Dadurch istzumindest auf kompositorischer Ebene die endgültige Enthierarchisierungvon Ton und Bild gegeben – auch wenn es der verfügbare Stand der Technolo-gie in der derzeitigen Aufführungspraxis nicht erlaubt, visuell und akustischgleichermassen perfekt Räumlichkeit zu erzeugen. Die weitere Annäherungvon Bild und Ton auch in diesem Feld wird die Entwicklungsrichtung derkommenden Jahre sein.
131
Abb. 9 und 10 Antoine Schmitt, The Nanomachine - Performance at clubtransmediale.03, 2003.
132
Anmerkungen
1 Club Transmediale – International Festi-val for Digital Music and Related Visual ArtsBerlin, http://www.clubtransmediale.de. In-ternet 13.11.2003.
2 Der Begriff VJ wird sowohl als Bezeich-nung für die Moderatoren von Musiksendernwie Viva und MTV verwendet als auch für alldiejenigen, die Musikaufführungen durch pro-jizierte Bilder visualisieren. Im Folgendenwird VJ ausschliesslich in seiner letzteren Be-deutung behandelt. Dazu finden sich zahlrei-che Foren im Internet, wie beispielsweise:
http://www.vjforums.com. Internet13.11.2003.http://www.vjs.net/. Internet 13.11.2003.http://groups.yahoo.com/group/eyecandy/.
Internet 13.11.2003.http://www.pimp.rel.nl/. Internet 13.11.2003.
3 Lev Manovich, What Is Digital Cinema?,http://manovich.net/text/digital-cinema.html.Internet 13.11.2003.
4 http://www.loslogos.org und http://www.burodestruct.net. Internet 13.11.2003.
5 http://www.solidrocketboosters.com. In-ternet 13.11.2003.
6 Der US-amerikanische Computermusi-ker Kim Cascone hat die ambivalente Positiondes Laptop-Performers ausführlich beschrie-ben.Kim Cascone, LAPTOP MUSIC – Coun-terfeiting Aura in the Age of Infinite Repro-duction, Parachute (107) – Electrosounds,Montreal, 2002.
7 http://www.zuviel.tv/mikomikona.html.Internet 13.11.2003
8 http://noton.raster-noton.de/. Internet13.11.2003.
http://www.eigen-art.com/Kuenstlerseiten/KuenstlerseiteCN/index_CN_ENBiographie. html. Internet 13.11.2003.
9 Walter Brinkmann, in: Lászlo Moholy-Nagy, Malerei Fotografie Film, Berlin 1926, S.20f., zitiert nach Peter Stasny, in: HilmarHoffmann / Walter Schobert (Hgg.), Sound &Vision – Musikvideo und Filmkunst, Frankfurta/M. 1993, S. 116f.
10 Ebd.
11 Peter Weibel, Von der visuellen Musikzum Musikvideo, in: Peter Weibel / VeruschkaBody (Hgg.), Clip, Klapp, Bum – Von der visu-ellen Musik zum Musikvideo, Köln 1987, S.103.
12 http://www.cycling74.com. Internet 13.11.2003.
13 http://www.babiole.net/. Internet 13.11.2003.
14 http://remi.mur.at/. Internet 13.11.2003.
15 http://www.kat.ch/jasch/. Internet 13.11.2003.
16 Nanomachine Performance: http://www.gratin.org/as/txts/nanomachine.html. Inter-net 13.11.2003.
Nanoensembles: http://www.gratin.org/as/nanos/. Internet 13.11.2003.
!"#$ %&'()*(
!"#$%&'()&*+,-&./0)#1 +,-.
2#+3/)#1&405"+&.676/ /012,-3
4/5,-
Andres umstrich das Euter von Rea, den Geruch von Gras, Heu und Kuhmistin der Nase. Obwohl die Türe zum Stall weit offen stand und nicht ein einzigesKippfenster zu war, blieb es drückend schwül. Mit etwas Holzwolle säuberteer die Zitzen, bevor Strahl um Strahl warmer Milch den Boden des Eimers klei-ner werden liess. Während er sich vorstellte, was er heute Abend anziehenwürde, warf sein Vater eine Gabel Gras nach der andern in die Futterkrippe.Da Andres vergessen hatte, Rea den Schwanz hochzubinden, klatschte sie ihmdiesen mitten ins Gesicht, als er in Gedanken war. Überall krabbelten Fliegenund Bremsen und machten das Vieh verrückt. Im weissen Seelein, das nun denGrund des Eimers bedeckte, schwammen zwei Insekten um ihr Leben. Andresrichtete eine Zitze auf die Schwimmer. – Aus dem mit Plastikfolie verkleidetenKofferradio (dünne Kuhscheisse erzielt eine beträchtliche Reichweite) falset-tierten die Bee Gees You Should Be Dancing. Gern wäre Andres der Aufforde-rung nachgekommen. Er setzte die Melkmaschine an, bevor er doch mitsin-gend durch den Stallgang tanzte. Plötzlich wehklagte das Guggerziitli aus demRadio, dann auch noch Dr Schacher Seppli: Der Vater hatte von DRS 3 aufDRS 1 gedreht. Groll stieg in ihm hoch, gegen die unmusikalischen Eltern undgegen sein Schicksal.
Die eineinhalb Stunden, bis es neunzehn Uhr schlug und er saubere Klei-dung anzulegen hatte, weil er die Milch in die Dorfkäserei bringen musste,schienen ihm wie meistens wenigstens drei Stunden lang. Als er endlich aus derDusche stieg und in seine Ausgehkeider schlüpfen durfte, war es halb acht. Be-vor man sich im Konstanzer Blue Bell, der besten Disco ennet der Grenze, traf,ging Andres gewöhnlich ins Kino, ins Scala oder ins Roxy. Das Gloria hatteeine Weile brutale Eastern gezeigt, die ihn in Bann schlugen, aber nur wenigeausser ihm, so dass das Gloria schliesslich Pornofilme zeigte wie schon diezwei kleinsten Säle des Roxy.
Seit er vor drei Jahren Saturday Night Fever und Thank God It’s Fridaygesehen hatte, hörte er auf seinem billigen Lenco-Plattenspieler nur noch Dis-
133
co, obwohl er als Punk herumlief. Der Polyester-Look von John Travolta warnichts für ihn. Andres war dafür nicht hübsch genug. Seine Clique aus der Dis-co, fast ausnahmslos Secondos, deckte sich sogar mit feinen Sachen aus Zür-cher In-Boutiquen ein. Er kannte die Namen dieser Boutiquen nicht, doch sieklangen wie Versprechen einer besseren Welt: Jet Set, Fiorucci, Nicaragua,Blondino. Salva und Umberto trugen im Ausgang Pullover, die mehrere hun-dert Franken kosteten. Andres’ Punk-Bekanntschaften hatten für solche Ex-zesse des Konsums bloss Verachtung übrig, genauso wie für Discomusik. An-dres aber liebte die Musik der Schwarzen. Sein absolutes Lieblingsstück ausSaturday Night Fever war Disco Inferno von den Trammps. Wenn Lord Ba-ker, der jamaikanische DJ des Blue Bell, das Blaulicht und die Polizeisirene inGang setzte und die ersten Takte des infernalischen Songs aus den Boxenwummerten, hielt ihn nichts mehr von der Tanzfläche zurück. Dann tauchteAndres in eine andere Welt, in der er keine Probleme hatte mit Trigonometrieund Physik oder Chemie und in der keine Kühe muhten und alles vollschissen.Er fühlte sich wie Tony Manero und war für zwei, drei Minuten der Disco-King. Punk hatte eigentlich nichts in der Disco verloren, nur Ça plane pourmoi von Plastic Bertrand. Andres war auch ein Disco-Punk. Zuerst Disco,dann Punk. Vielleicht sah er deshalb wie ein Clown aus. Vom Rücken seinerLederjacke lächelte auf einer echten Autogrammkarte «Herzlichst Ihre Anne-liese Rothenberger». Er hatte eine Transparentfolie über die Rothenberger ge-klebt. Kein Mensch verstand, warum er eine aufgetakelte ZDF-Fernsehdiva inLeder trug. Andere Punks hatten die UK Subs, die Sex Pistols, Anarchy inSwitzerland oder Fuck the System. Seine Patentante nahm es ihm übel, dass erFrau Rothenberger der Gesellschaft von Stickern und Sicherheitsnadeln aus-setzte, wo sie doch so schön singen konnte. Und die Secondos hatten ebensowenig für eine Operettensängerin übrig wie die Punks, doch war Andres einUnikum in ihren Augen, fast ein Maskottchen. Ihn störte es nicht, wenn sieüber ihn lachten. Er provozierte zwar zu gerne, noch lieber bot er indes Anlasszu freundlicher Belustigung.
Kurz vor acht stand er vor den Schaukästen des Roxy und betrachtete dieAushangfotos der aktuellen Filme. Eine späte Blondine, bestimmt schon inden Sechzigern, reichte ihm geistesabwesend die Eintrittskarte für Grease. ImFernsehen hatte Andres einige Filmausschnitte gesehen, die nichts Gutes erah-nen liessen, aber der Film war schlimmer als seine Befürchtungen. Es mochtezutreffen, dass John Travolta ziemlich affig wirkte als Italo-Amerikaner Tonyin Saturday Night Fever, aber die Musik und seine Moves waren cool. Hinge-gen als öliger Danny mit dieser pinkfarbenen Olivia Newton-John? Und danntröteten sie auch noch im Duett «You’re the One That I Want ... u-hu-huuu».Im Kino waren keine Teddys, die erklärten Feinde der Punks. In Konstanz gabes so gut wie keine Teddys, nur ein paar vereinzelte Skinheads. Als das High-school-Musical aus war, machte sich Andres auf in Richtung Blue Bell. Die
134
Disco hatte draussen keinen Türsteher postiert, aber wenn man auf die Klingeldrückte, wurde einem geöffnet. Andres kannte man, obwohl er nicht viel aus-zugeben imstande war. Franca sass schon an der Bar, mit Mauro und dessenBruder. Baci, Küsschen, links, rechts, links. Gerade trat Gloria zu ihnen, eineSchweizerin, die so gross war wie ein Model und befreundet mit Salvatore. Siehatte in Zürich im High Life den Videoclip La vie en rose von Grace Jones ge-sehen. Grace war die Göttin der Clique. Verglichen mit ihr war Franca, die nurknapp über einsfünfzig mass, ein Zwerg. Gloria war einsachtzig, ohne High-heels. Sie fand ihre Lippen zu dünn und malte den Mund mit einem dunklenKonturenstift grösser. Alle glaubten, dass Gloria das Zeug zum Model hatte.Manchmal ging sie mit Salva nach Zürich ins Panthera oder eben ins High Life.Dort sei es fantastisch, berichteten die beiden. Andres war noch nie abends inZürich gewesen, aber der lebhafte Verkehr und die vielen Läden hatten ihn be-eindruckt. Konstanz war viel kleiner, doch auch hier liess das Fremde seinHerz schneller schlagen. – Jäh elektrisiert von der Gitarre Nile Rogers’, glittAndres vom Barhocker und brachte sich auf dem Dancefloor zur Musik vonLe Freak in eine günstige Position. Danach spielte Lord Baker A Fifth of Beet-hoven von Walter Murphy. Tädädädä! Und schon tanzten sie alle selbstverges-sen um ihn herum.
135
!"#$%#$ &%'"(%) * +,%-+#')+ ./&#%"'%)
01234567897:2;7<
=7>?:@ABC>78.;:>4
$A28D6C?127?8E748F3B24;:>483?8'7A;456456G73H7>8F3B27?
Gibt es in der Schweiz Filmstars? Sicherlich gibt es Filmstars aus der Schweiz:Ursula Andress etwa, auch wenn die Berner Blondine ausserhalb der Schweizkaum als Bernerin wahrgenommen wird (man hält sie für eine Schwedin, wieAnita Ekberg, neben der sie in La dolce vita ihren ersten Auftritt hatte), oderMaximilian und Maria Schell, die als Wiener gelten, aber des Schweizerdeut-schen mächtig sind. Ferner sollte man Marthe Keller nicht vergessen, die Basle-rin, die nach Deutschland auszog, in Frankreich zum Star wurde und Mitte derSiebzigerjahre auch einige Hauptrollen in Hollywood-Filmen übernahm.Aber Filmstars in der Schweiz? Es gab sie, solange es ein populäres Kino gabund regelmässig einheimische Spielfilme produziert wurden. Anne-MarieBlanc und Heinrich Gretler etwa, Inkarnationen des republikanischen Geisteszur Zeit der geistigen Landesverteidigung, oder später Hannes Schmidhauser,der Mehrfach-Star, der auf der Leinwand vom Knecht zum Pächter aufstiegund nebenher als Fussballspieler auf der linken Abwehrseite für GC und dieNationalmannschaft die Räume eng machte.1 Wie aber steht es um Stars in derSchweiz, seit der Neue Schweizer Film den alten ablöste? Wie wir im Folgen-den darlegen möchten, treten Filmstars in der Deutschschweiz auf, wenn dreiBedingungen erfüllt sind: Das Kino muss mit anderen Medien verschaltet wer-den; der Film muss einem bestimmten Genre angehören, nämlich einer spezi-fisch helvetischen Spielart der Komödie; und die Darsteller und ihre Rollenmüssen spezifischen regionalen Bedürfnissen entsprechen, wozu unter ande-rem gehört, dass sie Dialekt sprechen.
Berufschancen für Filmstars in der Schweiz
Filmstars sind Schauspieler, die populär genug sind, um das Publikum alleinkraft ihres Namens ins Kino zu locken. Aus ökonomischer Sicht ist ein Star einSchauspieler, dessen Teilnahme die Finanzierung eines Filmprojektes sichert.2
136
Stars sind zudem Schauspieler, über deren Privatleben ein öffentlicher Diskursgeführt wird, ein Phänomen, das in den USA erstmals um 1914 auftritt, als dieFilmschauspieler in Hollywood sesshaft werden und einen medienwirksamenLebensstil mit Villen, teuren Autos und schicken Yachten entwickeln.3 Starssind «strukturierte Polysemien», wie Richard Dyer sagt, Images oder Vorstel-lungsbilder, die sich aus Texten und Bildern aus Filmen, aus dem Fernsehenund der illustrierten Presse zusammensetzen.4 Die Berichterstattung über Pri-vatleben und Lebensstil macht das ausserfilmische Image aus, während das in-nerfilmische Image aus dem Zusammenspiel von Rollenbild der Figur unddem Personenbild des Schauspielers besteht, das man aus seinen früheren Rol-len und aus der Berichterstattung über sein Privatleben gewonnen hat. ZurFunktion von Stars gehört, dass sie zugleich konsumierbare Produkte sind undKonsumenten produzieren. Das Publikum bezahlt, um sie zu sehen, und lässtsich von ihnen anleiten, Produkte zu kaufen, die sie konsumieren. Schliesslichrepräsentieren Stars Identitätsvorstellungen und gesellschaftliche Machtver-hältnisse.5 Wofür beispielsweise James Dean steht, wissen auch Leute, die kei-nen seiner Filme gesehen haben.6
Filmschauspieler, über deren Privatleben ein öffentlicher Diskurs geführtwird, die Konsumidole sind und zudem über die Popularität verfügen, einemFilm alleine durch ihren Auftritt in der Hauptrolle zum Erfolg zu verhelfen:Einem solchen Profil entsprachen in der Schweiz in den letzten dreissig Jahrenvor allem Emil Steinberger, Walter Roderer und Viktor Giacobbo. Mit Vorbe-halten könnte man die Liste auch noch um Beat Schlatter und Patrick Frey er-gänzen, die mit Katzendiebe und Komiker jeweils rund 150 000 Eintritte imKino verzeichnen konnten. Ferner muss man auch Bruno Ganz und MathiasGnädinger mit in Betracht ziehen. Ganz wirkte in den Achtzigerjahren in einerReihe von Schweizer Filmen mit, ist aber ein internationaler Schauspielstar,der hauptsächlich für die Bühne arbeitet.7 Gnädinger spielte zwischen 1988und 1994 fast jedes Jahr eine Hauptrolle in Schweizer Kinofilmen, von deneneinige, wie Xavier Kollers Flüchtlingsdrama Reise der Hoffnung (CH 1991),mehr als 100 000 Zuschauer verzeichnen konnten. In den letzten Jahren gehör-te Gnädinger zu den beliebtesten Darstellern der TV-Spielfilm-Eigenproduk-tionen von SF DRS.8 Nach einer Unterscheidung von Richard Maltby sindGanz und Gnädinger aber eher «actor stars» als «image stars», also Schauspie-ler, deren Berühmtheit primär auf ihren schauspielerischen Fähigkeiten grün-det und weniger auf einer öffentlichen Darstellung ihres Privatlebens (auchwenn Gnädinger bisweilen Boulevardjournalisten für eine «home story» emp-fängt). Auf jeden Fall aber umfasst die Liste der Deutschschweizer Stars fastausnahmslos Namen von Männern. Man darf sich fragen, weshalb nach An-ne-Marie Blanc keine Frauen dazugekommen sind.
Filmstars sind Steinberger, Roderer und Giacobbo zunächst im ökonomi-schen Sinn. Schweizermacher von Rolf Lyssy aus dem Jahr 1978, die Geschich-
137
te vom Fremdenpolizisten, der sich in eine Frau verliebt, die er eigentlich über-wachen und überprüfen sollte, sahen allein in der Schweiz nahezu eine MillionMenschen. Ernstfall in Havanna, die Komödie über den schusseligen Schwei-zer Botschaftsangestellten, der auf Kuba gute Dienste leistet, bis die Welt amRand eines Atomkriegs steht, schauten sich 2001 immerhin 300 000 Zuschaueran. Und schliesslich der Volksschauspieler Walter Roderer, über dessen Werkeman nicht so gerne spricht, wenn es um den Schweizer Film geht, vielleicht,weil sie nicht mit Staatsgeldern finanziert wurden und ihnen auch sonst dieBindung zum übrigen Filmschaffen der Schweiz fehlt. Ein Schweizer namensNötzli von 1988, die Geschichte eines Buchhalters, der in zwielichtige Gesell-schaft gerät, fand 600 000 Zuschauer im Kino; Der doppelte Nötzli, das Sequelvon 1990, immerhin noch knapp 300 000. In der Deutschschweiz gelten solcheEintrittszahlen auch für einen amerikanischen Film als gut.9
Walter Roderer
Die Anfänge von Walter Roderers Laufbahn reichen zurück bis in den altenSchweizer Film. 1920 geboren, debütierte er 1956 in Kurt Frühs Oberstadt-gass, bevor er mit seinem zweiten Film, Karl Suters Mustergatte von 1959, soetwas wie die Rolle seines Lebens fand. Roderer spielte in den folgenden Jah-ren in vier weiteren Filmen mit, in Der Herr mit der schwarzen Melone (KarlSuter, CH 1960; der Debütfilm von Bruno Ganz), Der 42. Himmel (Kurt Früh,CH 1962), Ferien vom ich (Hans Grimm, D 1963) und in Un milliard dans lebillard (Nicola Gessner, CH 1965). Hauptberuflich betätigte er sich danach alsVolksschauspieler, genauer: als Kleinunternehmer, der mit einer Tourneetrup-pe und einer Bühnenfassung von Der Mustergatte durch die Lande zog. In denSiebzigerjahren war er im Kino nur zweimal zu sehen, in Ein Käfer auf Extra-tour (Rudolf Zehetgruber, D 1973) und Das verrückteste Auto der Welt (Ru-dolf Zehetgruber, D 1975), zwei europäischen Nachfolgeprodukten der er-folgreichen «Herbie der Käfer»-Filme aus dem Hause Disney, in denen Rode-rer an der Seite seiner langjährigen Partnerin Ruth Jecklin seine Standardrolledes linkischen Schweizer Biedermanns spielte. Roderers Image war längst ge-festigt, als er in den Siebzigerjahren die Rolle des Konsumentenwerbers inTV-Spots für Hero und Mitsubishi übernahm. Man erinnert sich an den Slo-gan: «Leise, kraftvoll, Mitsubishi». Das Image, das die Kampagne dem Autoverlieh, steht mit dem Roderers in enger Verbindung. «Heimlifeiss» lautet einSchweizerdeutscher Ausdruck, der mit dem Hochdeutschen «durchtrieben»nicht hinreichend genau übersetzt ist. Heimlifeisse unterschätzt man; im tiefs-ten Innern sind sie aber harmlos und rechtschaffen. Auf Roderer trifft der Aus-druck ebenso zu wie auf den Mitsubishi, so wie der Volksschauspieler ihn unsnäher zu bringen versuchte. Roderers Image wurde durch seine Werbeauftritte
138
zu einem Kapital, das er in den beiden Nötzli-Filmen gewinnbringend anzule-gen verstand. Die Drehbücher zu beiden Filmen schrieb der Star selbst; derHeimlifeisse kennt sich selbst am besten.
Emil Steinberger
Emil Steinberger war in erster Linie Kabarettist, und seine Kunstform war derhalbe Dialog. Man hörte seinen Figuren beim Sprechen zu; die Antworten desGegenübers hörte man mit, weil der gesprochene Teil des Dialogs sie impli-zierte. Ein raffiniertes Dispositiv, auch weil es dem Publikum eine doppelteRolle anbot. Man beteiligte sich als Hörer an der Arbeit des Künstlers, indemman die Leerstellen des Dialogs ausfüllte. Zugleich befand man sich in der Po-sition des Lauschers, des akustischen Voyeurs: Im öffentlichen Raum stellt dasBelauschen von Gesprächen, wie Emil sie in seinen Nummern inszenierte, eineTransgression dar. Emil schuf für seine Figuren feingliedrige sprachliche Phy-siognomien und entwarf eine ganze Galerie von Biedermännern und kleinenAngestellten. Harmlos waren Steinbergers Figuren nie. Ihre Macken ergabenein Panoptikum kleiner Laster und Gemeinheiten. Steinbergers Medium warzunächst die Kleinkunstbühne, die bald durch Säle und schliesslich durch Hal-len abgelöst wurde; ferner die Schallplatte – er setzte mehr als eine halbe Milli-on davon ab – und schliesslich auch das Fernsehen. Seine Figuren sprachen Lu-zerner Dialekt, so wie Roderers Biedermann an seinem Ostschweizer Dialektzu erkennen war. Steinberger verstand es aber, seine Texte zu übersetzen. Esgab Emil auf Hochdeutsch, der solchen Zuspruch fand, dass die Schweizer Il-lustrierte titeln konnte: «Emil erobert Deutschland»; die deutschen Kritikerverglichen ihn gar mit Buster Keaton und Charlie Chaplin. Ferner gab es Emilauf Französisch oder vielmehr Emil, der «français fédéral» sprach, das radebre-chende Bundesfranzösisch, mit dem sich Deutschschweizer mit ihren West-schweizer «compatriotes» verständigen. Bundesfranzösisch machte Emil auchin der Westschweiz zum Star, eine singuläre Leistung, die vorher und nachherkeinem seiner Berufskollegen gelang. Sonst vermögen nur Sportstars wie Ja-kob Kuhn das Land in geniessender Anhängerschaft zu einen. Zum Zeitpunktseines Kinodebüts war Emil Steinberger der populärste Komiker deutscherSprache neben dem Deutschen Otto Waalkes, der später ebenfalls Filme dreh-te. Emils Starstatus erkannte man daran, dass sein Privatleben und selbst seineKonsumgewohnheiten in der Boulevardpresse verhandelt wurden. Leser derSchweizer Illustrierten wussten beispielsweise, dass Emil auf dem Höhepunktseines Erfolgs sein BMW-3.0-CS-Sportcoupé (Neupreis CHF 43 000.- im Jahr1973) gegen einen noch schickeren Rover einttauschte.
139
Viktor Giacobbo
Giacobbos Anfänge liegen ebenfalls auf der Kleinkunstbühne.10 Über seineHeimatstadt Winterthur hinaus bekannt wurde er durch Fernsehauftritte, ins-besondere durch seine Shows «Viktors Programm» (1990–1994) und «ViktorsSpätprogramm» (1995–2002). Giacobbo verstand sich vor allem auf Politiker-parodien, schuf aber auch Figuren, die bestimmte Haltungen und gesellschaft-liche Gruppen typisierten: den Macho Harry Hasler etwa, der mit seinemBrustpelz, seinem über die Wangen heruntergezogenen Schnauzbart und sei-ner weissen Lederjacke an einen Zuhälter erinnerte und einen weissen Chevro-let Corvette fuhr, oder den dauerbekifften Gammler Fredi Hinz. Zudem wa-ren in Giacobbos Sendung regelmässig Politiker zu Gast, die er mit vermeint-lich arglosen Fragen aufs Glatteis führte. Als Harry Hasler spielte Giacobbo1996 den Saletti-Rap auf CD ein und stiess damit in die Schweizer Radiohitpa-rade vor. Ferner trat er in der Öffentlichkeit bisweilen in den Masken seiner Fi-guren auf. Als Harry Hasler eröffnete Giacobbo das Zürifest 1998. Offenbarreagierten Passanten auf die Figur so, als hätten sie mit einer realen Person zutun, eine Haltung, die man sonst am ehesten noch bei Besuchern von Disney-land antrifft, wenn sie das erste Mal Mickey Mouse gegenübertreten.
Filmstars und KMU
Schaut man die Boulevardpresse der letzten drei Jahrzehnte durch, so stelltman fest, dass eine Gruppe von Prominenten viel Aufmerksamkeit auf sichzieht, deren Profil ein spezifisch schweizerisches ist: die Unternehmer-Stars.Einer «home story» würdig sind nicht nur Athleten und Unterhaltungskünst-ler, sondern auch Menschen, die sich um die Prosperität des Landes verdientgemacht haben. Besonders beliebt sind Unternehmer, die ihren Aufstieg auseigener Kraft schafften, Arbeitsplätze schufen und sich als «patrons» umsWohlergehen ihrer Angestellten kümmern. Erfolgreiche Klein- und Mittelun-ternehmer sind auch Roderer, Steinberger und Giacobbo. Roderer leitete seineigenes Tourneetheater, Steinberger betrieb in Luzern ein Kleintheater undmehrere Arthouse-Kinos, und Giacobbo übernahm 2000 gemeinsam mit eini-gen Geschäftspartnern das Casino-Theater in Winterthur und wandelte es ineine Kleinkunstbühne um. Als Unterhaltungskünstler und KMU in Personal-union qualifizieren sich Roderer, Steinberger und Giacobbo nach den Regelndes Starsystems der Schweizer Boulevardmedien gleich doppelt als Stars: Bril-lierte Hannes Schmidhauser noch simultan in den Sparten Kunst und Sport,glänzen sie als Unternehmer ebenso wie als Unterhalter.
140
Vom Fernsehen zum Film
Gemeinsam ist Roderer, Steinberger und Giacobbo ferner, dass sie bereits inanderen Medien populär und erfolgreich waren, als sie Filmstars wurden: aufder Bühne, vor allem aber im Fernsehen. Man kann aus einem Vergleich derdrei Fälle durchaus den Schluss ziehen, dass die wichtigste Voraussetzung fürFilmstartum in der Schweiz in den Zeiten nach dem Niedergang des klassi-schen populären Kinos das Fernsehen ist.
Das gilt so auch für andere europäische Länder vergleichbarer Grösse. InBelgien traten die Fernsehkomiker Gaston Berghmans und Leo Martin mehr-fach in Kinokomödien auf, die zu Kassenschlagern wurden: 600 000 oder700 000 Zuschauer für einheimische Filme sind im knapp fünf Millionen Ein-wohner zählenden flämischen Teil Belgiens auch in den Neunzigerjahren kei-ne Seltenheit.11 In Holland feierten in den letzten Jahren Teenager-Komödienmit Sitcom-Stars aus dem Fernsehen im Kino grosse Erfolge,12 und in Öster-reich finden, ähnlich wie in der Schweiz, TV-Kabarettisten immer wieder Zu-spruch beim Kinopublikum. Für das amerikanische Kino gilt nach wie vor,dass Fernsehstars sich im Kino nur schwer durchsetzen können. Bruce Willis,vor seinem Durchbruch als Actionheld in Die Hard (John McTiernan, USA1988) Star der TV-Serie Moonlighting, ist eine der Ausnahmen ebenso wie derehemalige Fernsehdoktor George Clooney. In kleineren europäischen Län-dern hingegen gilt: Wollen Filmproduzenten Hauptrollen mit Schauspielernbesetzen, die auch nur ansatzweise über Anziehungskraft verfügen, dann müs-sen sie ihr Personal beim Fernsehen rekrutieren.
Andere Versuche der Verschaltung von Mediensystemen sind auch in derSchweiz unternommen worden: So besetzte Simon Aeby in seiner Gotthelf-Adaption Das Fähnlein der sieben Aufrechten von 2001 die männliche Haupt-rolle mit dem Snowboard-Champion Fabien Rohrer und die weibliche mit derSängerin Kisha. An den Kinoerfolg der Fernsehberühmtheiten reichten derSportstar und der Popstar aber bei weitem nicht heran.13
Die staatstragend-staatskritische Komödie
Die Verschaltung des Kinos mit dem Fernsehen bildet für das Filmstartum inder Schweiz (und in anderen kleineren europäischen Ländern) eine notwendi-ge, aber noch keine hinreichende Bedingung. Wie die zitierten Beispiele nahelegen, kommt als weitere Bedingung das Genre des Films hinzu. Tatsächlicheignet sich offenbar nur die Komödie für den Personaltransfer vom Bildschirmauf die Leinwand.
Die belgischen Fernsehkomiker Berghmans und Martin wählten dieschlichte Variante und spielten ihre populären Fernsehfiguren auch im Kino.
141
Auch im Fall von Viktor Giacobbo hätte man sich eine solche Lösung vorstel-len können: einen Harry-Hasler-Kinofilm. Giacobbo wählte den schwierige-ren Weg und spielte eine eigenständige Figur, die in den neunzig Minuten desFilms eine veritable Entwicklung durchmacht und sich vom verklemmten undunaufrichtigen Neurotiker zum heldenhaften Kämpfer für die eigene Freiheitund die Würde seiner Mitstreiterinnen (einer kubanischen Prostituierten undeiner Schweizer Journalistin) wandelt. Sicherlich eine kluge Entscheidung: Fi-guren wie Harry Hasler und Fredi Hinz eignen sich für Nummern; einen gan-zen Film tragen können sie nicht. Nach dem gleichen Prinzip waren schonEmil Steinberger und Rolf Lyssy vorgegangen: Nicht eine der Figuren, dieman aus Emils Nummern kannte, war der Held seines Films, sondern eine ei-genständige Figur mit einer eigenen Geschichte.
Auffällig ist nun, wie parallel die Entwicklung der Helden in Schweizer-macher und Ernstfall in Havanna verläuft. Wie Giacobbo in Ernstfall spieltSteinberger in Schweizermacher einen Vertreter des Staates, in diesem Fall ei-nen Polizeibeamten. Wie Giacobbos Figur durchläuft Steinbergers Fremden-polizist eine Entwicklung vom pedantischen Ekel zum sympathischen Hel-den. In beiden Fällen ist es die Liebe, die den Spiesser zum Mann reifen lässt.Die Gemeinsamkeiten sind so augenfällig, dass man versucht ist, von einerFormel zu sprechen, die Steinberger und Regisseur Rolf Lyssy entwickeltenund die Giacobbo und seine Mitarbeiter zumindest genau studierten. Insider-wissen darf man voraussetzen: Immerhin zählte Ruth Waldburger, die Produ-zentin von Ernstfall in Havanna, in Schweizermacher zu den Statisten, dieEmils stotternden Peugeot 505 anschoben.
Es wäre nun aber gänzlich verfehlt, Giacobbo mangelnde Originalität vor-zuwerfen. Falls er das erfolgreiche Vorbild tatsächlich studierte, dann hat erdamit nur jenen Prozess in Gang gebracht, aus dem populäre Filmgenres ent-stehen. Western und Musical wurden nicht aus dem Kopf eines Regisseursgeboren. Sie bildeten sich im Verlauf eines langwierigen Analyseprozesses er-folgreicher Filme heraus, bei dem Produzenten jene Elemente, die sie für aus-schlaggebend für den Erfolg hielten, einer variierenden Zweitverwertung zu-führten. Aus dieser analytischen Kombinatorik gingen mit der Zeit bestimmteFormeln hervor: die Genres.14
Wenn aber Schweizermacher und Ernstfall in Havanna dem gleichenGenre angehören, wie lässt sich dieses näher charakterisieren? Beide Filmesind, wie erwähnt, der Struktur nach romantische Komödien, in deren Verlaufsich zwei, die sich abstossen sollten, schliesslich lieben lernen. Ferner handeltes sich um Satiren, die staatliche Institutionen kritisieren. Schweizermachermokiert sich über die Fremdenpolizei, Ernstfall in Havanna über das Aussen-ministerium und die Tradition der guten diplomatischen Dienste. Beide Filmestellen den Übereifer ihrer Hauptfiguren bloss; in beiden Filmen zeigt sichaber bald, dass die fleissigen Beamten im Herzen gut und rein sind. Man könn-
142
te sagen, dass beides staatskritische Satiren sind, in denen die Schweizer sichüber sich selbst lustig machen, sich am Ende aber auch wieder mit sich selbstversöhnen. Weil es sich im Ansatz um staatskritische Satiren handelt, nichtaber im Ergebnis, könnte man hinzufügen, dass sowohl Schweizermacher alsauch Ernstfall in Havanna dem Genre der «staatstragend-staatskritischen Sa-tire» angehören. Es handelt sich um ein spezifisch schweizerisches Genre, demsich noch weitere Beispiele aus der jüngeren Filmproduktion des Landes zu-rechnen lassen. Beresina, Daniel Schmids Komödie über einen imaginärenStaatsstreich in der Schweiz, wurde im August 1999 am Filmfestival von Lo-carno im Beisein der Bundesräte Leuenberger und Dreifuss uraufgeführt undfand deren Beifall ebenso wie später den von über 130 000 Kinobesuchern, unddas auch ohne die Zugkraft eines populären Komikers.
Eine mögliche Erfolgsformel für den Schweizer Kinokassenschlager lautetdemnach wie folgt: Man suche die Verschaltung des Kinos mit dem Fernsehenund besetze einen populären Fernsehkomiker als Hauptdarsteller in einerstaatstragend-staatskritischen Satire. Dass den Produzenten eine solche For-mel geläufig ist, zeigte 2003 die Rekrutenschul-Komödie Achtung, fertig,Charlie! (Mike Eschmann), produziert von Lukas Hobi, die bei Drucklegungdieses Artikels gerade auf dem Weg war, Schweizermacher als erfolgreichstenSchweizer Film aller Zeiten abzulösen. Die staatliche Institution, über die derFilm sich zunächst lustig macht: das Militär. Der Fernsehkomiker, der in derRolle des anfänglich unerträglichen Repräsentanten der Armee auftritt: MarcoRima als Oberst und Schulkommandant, ein Kabarettist und Komiker und wieEmil Steinberger ausgestattet mit dem zusätzlichen Vorteil, auch in Deutsch-land bekannt zu sein. An der Besetzung der weiblichen Hauptrolle lässt sichzudem feststellen, dass die staatstragend-staatskritische Komödie derzeit ei-nen aktiven Genrebildungsprozess durchläuft. Bei Schweizermacher kam Sil-via Jost zum Einsatz, später als Protagonistin der umstrittenen Serie Motelauch ein Fernsehstar, zum Zeitpunkt des Drehs aber vor allem als Bühnen-schauspielerin bekannt. In Ernstfall in Havanna ging die Hauptrolle an SabinaSchneebeli, dem Fernsehpublikum aus der Serie Die Direktorin bekannt. Lu-kas Hobi nun besetzte die weibliche Hauptrolle in Achtung, fertig, Charlie!mit Melanie Winiger, einer ehemaligen Miss Schweiz. Zur Verschaltung desKinos mit dem Fernsehen kommt in diesem Fall also noch die Verschaltungmit der Prominentenmaschinerie der Miss-Wahlen. In der Schweiz liegt dasnahe, geniessen Miss-Wahlen hierzulande doch einen ausserordentlich hohenStellenwert, einen sehr viel höheren als beispielsweise in Deutschland.
143
Im Orbit nahe der Heimat: Deutschschweizer Stars alsvernakuläre Stars
Von Tom Cruise unterscheidet Steinberger, Roderer und Giacobbo nicht nur,dass sie ihre Popularität in anderen Medien erwarben. Ihr Startum unterliegtauch zeitlichen und räumlichen Einschränkungen. Tom Cruise ist seit 1986und Top Gun ein Star, also seit nahezu zwanzig Jahren, und das weltweit.Schon Emil Steinbergers zweitem Film Kassettenliebe (Rolf Lyssy, CH 1982)hingegen blieb der grosse Erfolg versagt, ebenso wie später Kaiser und eineNacht (Markus Fischer, CH 1985). Roderers Kino-Comeback beschränktesich auf die beiden Nötzli-Filme. Giacobbo hat den ersten Schritt getan; einzweiter Film soll in Arbeit sein. Es fehlt dem Starappeal der Schweizer Film-stars aber nicht nur an Nachhaltigkeit, sondern auch an geografischer Reich-weite, erstreckt er sich doch in der Regel nur auf die Deutschschweiz.15
Gleichwohl steht ausser Frage, dass die Schauspieler, um die es hier geht, in ih-rem «moment of glory» alle Kriterien des Startums erfüllen: Sie locken dieLeute ins Kino, ihr Privatleben ist Gegenstand öffentlicher Diskurse, sie erfül-len eine Funktion als Konsumvorbilder usw.
Wie aber lässt sich die Eigenheit des Schweizer Filmstars oder überhauptdes Filmstars unter Produktionsbedingungen, wie sie in kleinen europäischenLändern vorherrschen, positiv bestimmen? Unser Vorschlag lautet, in diesemZusammenhang von vernakulären Stars zu sprechen. Miriam Hansen hat fürdas Hollywood-Kino den vermeintlich paradoxen Begriff des «vernacular mo-dernism» geprägt und den Hollywood-Film als «global vernacular», als globa-len Dialekt beschrieben.16 Paradox mutet der Begriff des «vernacular moder-nism» an, weil Modernismus gemeinhin mit Konzepten wie Rationalität, Uni-versalität und Überwindung traditioneller Bindungen assoziiert wird,wohingegen der Begriff des Vernakulären regionale Eigenheiten bezeichnet,die sich der Universalisierung gerade widersetzen. Hollywood-Stars und dieFilme, in denen sie auftreten, sprechen ein «global vernacular», einen globalenDialekt, weil sie nicht einfach nur amerikanische Werte und Sichtweisen ver-mitteln, sondern für verschiedene Leute Verschiedenes sind. So tendieren dä-nische Kinder, die mit Disney-Comics aufwachsen, nach Auskunft von Re-zeptionsforschern dazu, Donald Duck für eine dänische Ente zu halten.17
Vernakuläre Stars hingegen brechen nicht von Hollywood aus auf, um dieWelt zu erobern. Vielmehr beschreiben sie eine ungleich erdnähere Umlauf-bahn. Sie sind Filmschauspieler, die als Stars funktionieren und im Orbit derFilmstars Aufnahme finden, aber nur vorübergehend und nur mit einer be-stimmten Region als Ausgangs- und Bezugsbasis. Die Region kann ein ganzesLand sein, wie die Schweiz im Fall von Emil Steinberger, oder auch nur eineSprachregion, wie die Deutschschweiz im Fall von Giacobbo und Roderer undder flämische Teil Belgiens im Fall von Gaston Berghmans und Leo Martin.
144
Wir haben uns bei der Auswahl der Beispiele auf Schauspieler beschränkt, de-ren Filme nach Massgabe der durchschnittlichen Einspielergebnisse auf demregionalen Markt, dem sie entstammen, als Hits gelten können. Man könnteden Kreis auch noch enger ziehen und eine Szenenberühmtheit wie Max Rüd-linger unter dem Gesichtspunkt des vernakulären Startums betrachten, den ac-teur fétiche von Clemens Klopfenstein und zweifellos wichtigsten Filmstar derletzten zwanzig Jahre in der Stadt Bern.18 Eine solche Betrachtung würde sichauch deshalb anbieten, weil Klopfenstein zuletzt auf seine Weise ebenfalls aufdie Logik der Starproduktion vertraute, die wir eben skizzierten. Mit DieGemmi – ein Übergang (CH 1994) und Das Schweigen der Männer (CH 1997)bemühte er sich um eine Verschaltung des Kinos mit dem System der Popmu-sik, besetzte er doch in beiden Filmen Rüdlinger gemeinsam mit Mundartro-cker Polo Hofer als Komikerduo oder vielmehr als tragikomisches Duo vonMännlichkeits-Performern.19
Problematische Männlichkeit
Vernakulär sind die Stars regionaler Herkunft nicht zuletzt, weil sie den Di-alekt oder die Sprache ihrer Basisregion sprechen (Ostschweizer Dialekt imFall von Roderer, Luzerner im Fall von Steinberger, Winterthurer im Fall vonGiacobbo; man könnte auch noch den imitierten Thurgauer Dialekt von Har-ry Hasler anführen). Vernakulär sind sie aber in erster Linie, weil sie bestimm-te Anliegen, die für ihre Herkunftsregion spezifisch sind, auf der höheren sym-bolischen Ebene des Massenmediums Film zum Ausdruck bringen. Die Gele-genheit, sich unter die grossen, globalen Stars einzureihen und dort ihre Arbeitals Stars zu tun, erhalten sie, weil die spezifischen regionalen Bedürfnisse, diesie artikulieren, von den globalen Stars nicht abgedeckt werden: so zum Bei-spiel das regelmässig wiederkehrende Bedürfnis der Schweizer nach staatstra-gender Kritik am Staat. Zudem repräsentieren Steinberger, Roderer und Gia-cobbo in ihren Filmrollen unterschiedliche Aspekte einer problematischenMännlichkeit, die man, von Woody Allen einmal abgesehen, bei amerikani-schen Filmstars so nicht findet und letztlich auch bei französischen nicht. Ro-derer würde man kaum als Vertreter einer hegemonialen heterosexuellenMännlichkeit einstufen; eher kennzeichnet den Werbeträger für Dosengemüseund Freund der Hausfrau eine gewisse «queerness». Giacobbo wiederum wirftdas Problem der Männlichkeit schon in seinen Fernseharbeiten mit der Figurdes triebhaften, politisch unkorrekten Macho Harry Hasler auf, zu dem sichder Botschaftssekretär aus Ernstfall in Havanna verhält wie Dr. Jekyll zu Mr.Hyde – oder wie die verklemmte Hälfte von Roderers doppeltem Nötzli zurtriebhaften. In die Reihe dieser Figurationen problematischer Männlichkeitpassen natürlich auch Max Rüdlinger und, auf seine Weise, Polo Hofer. Die
145
146
Szenarien, die dem Deutschschweizer Fernsehkomiker zum Ruhm des Film-stars verhelfen, sind demnach hochspezifisch. Das erfolgreichste lautet: Männ-liche Vertreter des Staates durchleben eine Staats- und Männlichkeitskrise,und die Liebe bringt Staat und Mann wieder ins Lot. Genau mit solchen Szena-rien besetzen vernakuläre Stars Nischen in transnational aktiven Starsystemenund ergänzen diese um Angebote, die bestimmten regionalen Bedürfnissenentgegenkommen.
Man könnte die Dynamik des vernakulären Stars auch in ein Bild fassen(oder vielmehr ins Bild eines Bildes): Wenn sich ein solcher Star vorüberge-hend im Orbit der dauerhaften Weltstars festsetzt, dann ist das ein wenig so,als wäre es einem ganz gewöhnlichen Menschen gelungen, sich auf einemSchnappschuss mit einem Hollywood-Star in den selben Bildrahmen zu drän-gen. Nur ist beim Betrachten des Fotos für einen kurzen, aber bedeutsamenMoment nicht mehr ganz klar, wer denn nun wer ist.
Anmerkungen
1 Zu Gretler vgl. die Studie von CarolineWeber, «Ein Held wider Willen: Der StarHeinrich Gretler im Schweizerfilm von 1938–1944», in: Vinzenz Hediger et al. (Hgg.),Home Stories: Neue Studien zu Film und Kinoin der Schweiz, Marburg 2001, S. 209–217.
2 Ob ein Star die Finanzierung sichert,hängt davon ab, wie erfolgreich seine letztensechs Filme waren. Tom Cruise beispielsweisehat in den letzten knapp zehn Jahren mit jedemseiner grossen Filme am ersten Wochenendemehr als 30 Millionen Dollar eingespielt (PaulThomas Andersons Magnolia und KubricksEyes Wide Shut waren Abstecher in denKunstfilm und zählen nicht so richtig: SolcheProjekte sind gut fürs Image, aber nicht für dieBilanz). Damit steht Cruise an der Spitze der«A-List», einer kleinen Gruppe von Super-stars, die das Publikum ins Kino zu locken ver-mögen, ganz egal, worum es in dem Film gehtund welchem Genre er zuzurechnen ist. ImJargon der Industrie spricht man auch von«bankable stars», Stars, mit denen man zur
Bank gehen kann und jeden Kredit kriegt. Die«A-List» umfasst offenbar immer nur sechsoder sieben Namen. Vgl. Leonard Klady, «StarPower Still Fuels H’wood Hits, Gallup Sez»,Variety (25. Juli 1994), S. 1 und 75.
3 Richard De Cordova, «The Emergence ofthe Star System in America», in: ChristineGledhill (Hg.), Stardom: Industry of Desire,London 1991, S. 17–29.
4 Richard Dyer, Stars, London 1979, S. 72.
5 Richard Dyer, Heavenly Bodies: FilmStars and Society, New York 1982, S. 8.
6 Vgl. Hans-Jürgen Wulff, «Deanophilie:Bemerkungen zu einem Idol im Wandel derZeiten», in: Kinoschriften: Jahrbuch der Ge-sellschaft für Filmtheorie 2, 1990, S. 7–31.
7 Bruno Ganz spielte eine seiner erstenFilmrollen in Kurt Frühs Es Dach überemChopf (CH 1961) und war der Hauptdarsteller
147
von Kurt Gloors Der Erfinder (CH 1980),Alain Tanners Dans la ville blanche (CH/F/P1983) und Villi Hermanns Bankomatt (CH1989) sowie zuletzt von Pane e tulipani (I/CH2000), einer italienischen Produktion, die inder Schweiz als einheimischer Film eingestuftwurde. Pane e tulipani war mit rund 350 000Zuschauern ein Hit.
8 Mathias Gnädinger hatte seine erstewichtige Filmrolle in Markus Imhoofs DasBoot ist voll von 1981. Es folgten Der Gemein-depräsident (Bernhard Giger, CH 1983), derAll-Star-Film Klassezämekunft (Walo Deu-ber, CH 1988), Leo Sonnyboy (Markus Imbo-den, CH 1989), Bingo (Markus Imboden, CH1990), Der Berg (Markus Imhoof, CH 1990)und Reise der Hoffnung (Xavier Koller, CH1991). Zu Gnädingers Fernsehfilmen zählenLieber Brad (Lutz Konermann, CH 2001),Spital in Angst (Michael Steiner, CH 2001),Big Deal (Markus Fischer, CH 2002) sowieSternenberg (Christoph Schaub, CH 2003).
9 Ein vergleichbares Phänomen hat dasFilmschaffen der Westschweiz nicht vorzu-weisen. François Simon und Jean-Luc Bideauprägten die Filme von Tanner und Goretta; dieZugkraft der Deutschschweizer Filmkomikererreichten sie nicht. Wenn in WestschweizerFilmen Stars auftreten, kommen diese in derRegel aus Frankreich, und WestschweizerSchauspieler werden ohnehin dem französi-schen Film zugerechnet, wenn sie es zu Star-status bringen. Beispiele sind François SimonsVater, Michel Simon, oder zuletzt auch der ge-bürtige Lausanner Vincent Perez.
10 Für eine detaillierte Biografie vgl.www.viktorgiacobbo.ch.
11 Philippe Meers, «From Black Box to Sil-ver Screen: Television Celebrities and FilmPerformance in Belgium 1980–2000», Vortragan der Popular European Cinema Conference4: Stars in Stockholm, 11. Juli 2003.
12 Sonia DeLeeuw, «TV Celebrities as FilmStars in Minor European Countries: Case Stu-
dy: The Netherlands», Vortrag an der PopularEuropean Cinema Conference 4: Stars inStockholm, 11. Juli 2003.
13 Ferner gilt es festzuhalten, dass das Fern-sehen seinerseits andere Medien abgelöst hat.Alfred Rasser beispielsweise war Kabarettist,Theater- und Filmschauspieler und eine Ra-dioberühmtheit, bevor er seine grössten Kino-erfolge realisierte: HD Soldat Läppli (CH1959) und das Sequel Demokrat Läppli (CH1961), bei denen der Basler Komiker auchselbst Regie führte. Schaggi Streuli, ein andererBasler, war ebenfalls ein Radiostar.
14 Rick Altman, Film/Genre, London 1999.
15 Ähnliches gilt auch für Gaston Bergh-mans und Leo Martin, die nur im flämischenTeil von Belgien bekannt sind, obwohl die be-nachbarten Niederländer sie problemlos ver-stehen können.
16 Miriam Bratu Hansen, «The Mass Pro-duction of the Senses: Classical Cinema asVernacular Modernism», in: Christine Gled-hill, Linda Williams (Hgg.), Reinventing FilmStudies, New York, S. 332–350.
17 Janet Wasko et al., Dazzled by Disney?The Global Disney Audiences Project, London2001, S. 329 ff.
18 Gemeinsam mit Christine Lauterburgbildete Rüdlinger zudem vorübergehend einStar-Paar: als Bogart und Bacall vom Bären-graben, wenn man so will. Ihr wichtigster undschönster gemeinsamer Film ist KlopfensteinsDer Ruf der Sibylla (CH 1984).
19 Klopfensteins Fetischismus fand insbe-sondere unter Filmschulabgängern Nachah-mer, die Max Rüdlinger in den letzten Jahrengerne in ihren Kurzfilmen einsetzten. In Ach-tung, fertig, Charlie! spielt Rüdlinger zudemeine kleine Nebenrolle als General der Schwei-zer Armee.
!"#$ %!$&"!
'()*+,-./0+(,+0123(134,+35678,(9
"(13-.,(1(2,+3:,2
Filmkonservierung und Filmrestaurierung stehen in einer engen wechselseiti-gen Beziehung: Das eine ergibt ohne das andere keinen Sinn. In diesem Aufsatzbeschäftige ich mich dennoch fast ausschliesslich mit der Restaurierung, ge-nauer: mit der Filmrestaurierung in der Schweiz. Ich beschränke mich zudemauf den Kinofilm und auf die Bearbeitung des Bildes und werde also weder dieProblematik der Tonspur noch jene der Amateurfilme anschneiden. Ich be-schränke mich auch auf die fotochemischen Methoden der Restaurierung, diedigitalen berücksichtige ich hier nicht.1 Und schliesslich gehe ich davon aus,dass das Spektakel Kino in einem Saal, auf einer Leinwand und vor einem Pub-likum stattfindet: Der Film «lebt» nämlich nur während der Projektion.
Wann ist ein Film gesichert?
Von jedem Film sollte es mindestens ein gutes Konservierungselement undeine spielbare Vorführkopie geben. Nur so ist das Werk sowohl heute proji-zierbar als auch für die Zukunft gesichert, das heisst weiterhin in seiner ur-sprünglichen Form benutzbar. Um dies langfristig zu gewährleisten, sollteidealerweise folgendes Paket vorliegen:
• ein Konservierungselement, das kühl und trocken eingelagert wird (in denKulturgut-Lagerräumen der Cinémathèque suisse herrschen zum Beispiel 5± 2 ºC und 35 ± 5% relative Luftfeuchtigkeit, was neuen Filmen eine Le-benserwartung von mehr als vier Jahrhunderten verspricht),
• ein Negativ, von dem bei Bedarf neue Vorführkopien gezogen werden kön-nen, ohne das Konservierungselement zu gefährden,
• eine spielbare Kopie, die der unausweichlichen Abnutzung durch die Pro-jektion im Saal und durch Sichtung auf dem Bearbeitungstisch ausgesetztist.
All dies kann gegenwärtig in der Schweiz nur gewährleistet werden, wenn alsAusgangsmaterial Negative zur Verfügung stehen. Wenn es aber nur ein Posi-
148
tiv gibt (meist eine einstige Vorführkopie), dann muss aus Spargründen dasDuplikat-Negativ nicht nur für die Herstellung von Vorführkopien, sondernauch als Konservierungselement dienen. Weder Cinémathèque noch Memori-av haben bis anhin eine Regelung für dieses so genannte Sicherungspaket ge-funden.
Die Filme sollten unter optimalen Bedingungen eingelagert werden, undimmer wenn die natürlich Zersetzung des Trägers und/oder der Schicht einenFilm gefährdet, muss er auf neues Material umkopiert werden. Für Spielfilmeherrscht darüber meist Konsens. Obwohl viele Leute meinen, dass im Doku-mentarfilm der Informationsgehalt in der Regel über der formalen Gestaltungstehe, bleibt es ein festes Ziel, auch den Dokumentarfilm für die Zukunft zu si-chern. Angebote, die versprechen, Filme auf VHS oder DVD zu «retten», sindperfid, vor allem weil gewisse Anbieter die Originale zerstören oder unter derHand weiterverkaufen.
Vom Nitro-Berg zum Essig-Syndrom
Von Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der Fünfzigerjahre war Nitrofilm,ein mit Salpetersäure verestertes Zellulose-Trägermaterial, als Kinofilm in Ge-brauch. Dieses Material ist zwar äusserst durchsichtig und sehr geschmeidig,aber es ist vom Zeitpunkt seiner Herstellung an in Autokatalyse begriffen undextrem feuergefährlich. Die Restaurationsarbeiten müssen also so schnell wiemöglich in Angriff genommen werden.
In zahlreichen ausländischen Archiven und Sammlungen warten zudemnoch weitere Filme schweizerischer Herkunft auf ihre Sicherung. Einige da-von sind in den Katalogen aufgeführt und bekannt, andere warten auf eine kla-re Identifizierung und gelten in der Schweiz sogar als verschollen. So konntenwir zum Beispiel Le cirque de la mort (Arena des Todes, Alfred Lind, 1918) inRom und Das Wolkenphänomen von Maloja (Arnold Fanck, D 1925) in Wienfinden. Heute liegen beide restauriert vor. Sie sind somit dem Forscher wiederleicht zugänglich und stehen für Kinovorführungen oder Fernsehausstrahlun-gen zur Verfügung.
Die begrenzten Mittel verpflichten zu einer besonders kritischer Auswahlvon Titeln, die bearbeitet werden können. Die Cinémathèque hat allerdingsdabei keinen so grossen Spielraum, wie oft angenommen wird. Nur bei weni-gen der festgestellten Zersetzungsfälle kann sofort mit der überfälligen Kon-servierungsaktion begonnen werden. Im fortgeschrittenen Stadium der Zer-setzung kann aber eine Verzögerung von wenigen Monaten bereits den Total-verlust des Werkes oder des Dokumentes bedeuten. Die für Umkopierungenzur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und der zu bearbeitende Nitro-Berg stehen nach wie vor in einem krassen Missverhältnis. Die Rettung der Ni-
149
trofilme geht viel langsamer, als es fachlich erforderlich wäre. In den letztenJahren standen der Cinémathèque jährlich etwa 300’000 Franken via Memori-av vom Bund zur Verfügung (ohne Personalkosten, Beschaffung und Unter-halt von Geräten sowie Baumassnahmen). Um die «Helvetica» aus dem Ni-tro-Berg abzubauen, der heute in der Cinémathèque lagert, wären aber etwa8,7 Millionen Franken nötig. Und neue Sparmassnahmen zeichnen sich ab!
Um die hohe Feuergefahr zu bändigen, wurde Anfang der Fünfzigerjahreder Nitrofilm vom Acetatfilm, einem mit Essigsäure verestertem Zellulose-Trägermaterial, abgelöst. Dieser Filmträger galt als länger haltbar, doch auchAcetatfilm zersetzt sich autokatalytisch und setzt Essigsäure frei. Der Prozessist inzwischen näher untersucht worden, und wegen des stechenden Geruchsspricht man vom so genannten Essig-Syndrom. Doch der Schwierigkeitennicht genug: Ein weiteres gravierendes Problem ist die Verfärbung der Farbfil-me, die mittels substraktiven Farbverfahren hergestellt wurden. Deswegen istes ebenfalls dringend, die Umkopierungen der frühen Acetatfilme aus denFünfziger- und Sechzigerjahren einzuplanen.
Im Ausland ist alles besser
Als ich 1998 an der Cinémathèque suisse die Verantwortung für Filmkonser-vierung und -Restaurierung übernommen habe, wurde von verschiedenen Sei-ten Druck auf mich ausgeübt, die Laborarbeiten ins Ausland zu vergeben, ent-weder an das Labor Haghefilm in Amsterdam oder an das Labor L’ImmagineRitrovata in Bologna. Es war nicht einfach, die Position zu vertreten, dass auchSchweizer Werke in der Lage sind, in das Geschäft der professionellen Film-restaurierung einzusteigen. Gut vier Jahre später ist festzuhalten, dass alle Ar-beiten zufriedenstellend in der Schweiz ausgeführt werden können, was dieZusammenarbeit erheblich erleichtert. Die Cinémathèque arbeitet heute mitEgli Film in Zürich und Schwarz Film in Ostermundigen. Zudem ist der finan-zielle Aufwand auch nicht viel höher, wenn man die zusätzlichen Kosten fürSpedition und Zollgebühren einberechnet, die nun wegfallen.
Im Jahre 1999 war die Zeit endlich reif dafür, an der Cinémathèque ein ar-chiveigenes Restaurierungsatelier einzurichten, in dem Filme professionell be-arbeitet werden können. Die minimalsten Anforderungen bezüglich Ausrü-stung und Gesundheitsschutz konnten erfüllt und seitdem stetig ausgebautwerden, trotz den äusserst beschränkten finanziellen Mitteln der Institution.Besonders schwierige Aufträge führen meine Kollegin Carole Delessert undich in enger Zusammenarbeit mit dem Filmrestaurator Hermann Wetter inGenf aus, der die beste Umkopiermaschine der Schweiz besitzt, mit der auchschwer beschädigte Filme bearbeitet werden können. So konnten in den letz-ten fünf Jahren rund 200 Werke und Dokumente für die Nachwelt gesichert
150
151
werden.2 Das ist allerdings nur ein Bruchteil dessen, was gemacht werdenmüsste. Obwohl mit der Professionalisierung der Filmrestaurierungen wichti-ge Fortschritte erzielt wurden, dürfen wir uns nicht auf den Lorbeeren ausru-hen: Ein langer Weg liegt noch vor uns.
Fast ebenso wichtig wie die Restaurierung und Konservierung der Filmeist die Dokumentation der Arbeitsprozesse. Dazu wurden neue Formulareentworfen, die es ermöglichen, alle getätigten Eingriffe und gefassten Ent-scheide transparent zu dokumentieren. Für Studierende der Fachhochschulen,die sich der Konservierung und Restaurierung widmen, und für Kollegen ausdem Ausland, die sich mit unseren Methoden auseinander setzen wollen, bie-ten wir Praktika an. Nur dank dem regen Austausch von Erfahrungen undKenntnissen mit zahlreichen ausländischen Kollegen konnten wir den heuti-gen Qualitätsstandard erreichen.3
Das jährlich stattfindende Festival Le Giornate del Cinema Muto von Saci-le (Pordenone) hat 2002 dem Schweizer Stummfilm eine Retrospektive gewid-met. Das war für uns eine willkommene Gelegenheit, die geleistete Arbeit ei-nem breiten Fachpublikum zur Bewertung vorzulegen. Es wurden insgesamt44 Titel gezeigt (Spielfilme, Dokumentarfilme und Aktualitäten), deren Kata-logeinträge im Internet einzusehen sind.4 Zu diesem Ereignis wurde auch einSammelband aufgelegt, der den heutigen Stand der Kenntnisse zum SchweizerStummfilm zusammenfasst.5 Der Erfolg war so gross, dass uns nun auch ande-re europäische Filminstitute Restaurierungsarbeiten anvertrauen.6
Anmerkungen
1 Die beste Darlegung des heutigen Standesder Kenntnisse ist: Paul Read / Mark-PaulMeyer, Restoration of Motion Picture Film,Oxford 2000.
2 Listen von restaurierten Filmen findetman im Internet, auf der Website von Memori-av: www.memoriav.ch/fr/home/film/projets/f-tirages-liste9398.htm, www.memoriav.ch/fr/home/film/projets/f-tirages-liste99.htm,www.memoriav.ch/fr/home/film/projets/f-tirages-liste2000.htm, www.memoriav.ch/fr/home/film/projets/f-cj-liste2000.htm undwww.memoriav.ch/fr/home/film/projets/f-cj-liste2002.htm, besucht am 31.8.2003.
3 Wir hatten auch die Möglichkeit, die Uni-versitätsforschung im Gebiet der Restaurierungzu unterstützen. Siehe: Patrick Streule, Digital
Image Based Restoration of Optical MovieSound Tracks, Diplomarbeit ETHZ 1999.
4 http://www.cinetecadelfriuli.org/gcm/previous_editions/edizione2002/Swiss_Cinema.html, besucht am 31.8.2003.
5 Rémy Pithon (Hg.), Cinema suisse muet:Lumières et ombres, Lausanne 2002.
6 So haben wir zum Beispiel für Det Dans-ke Filminstitut, das dänische Filmarchiv,Hædslens Hule (Die Schreckenshöhle, Kai VanDer Aakuhle, DK 1917) restauriert. Es handeltsich dabei um die einzige heute fragmentarischerhaltene Episode – die vierte und letzte – desSerials Nattens Datter (Die Tochter der Nacht)mit Emilie Sannom.
!"#$%& &'((#%
)*+,-.*/*-01+2034.,*//+567
81./*609:;15<056=0=4.0-.*/*2:;4034.2/16=
Mit Martin Schaub, der am 14. Juni 2003 nach längerer Krankheit gestorben ist,hat die Schweizer Filmpublizistik einen ihrer profiliertesten Autoren verloren.Nachrufe sind erschienen, die seine Biografie gewürdigt und seine Arbeitenbeschrieben haben: geboren 1937, Germanist mit einer Dissertation zu Kleist,NZZ-Journalist und ab 1968 Redaktor beim Tages-Anzeiger in Zürich, Mitbe-gründer und Mitgestalter von dessen Magazin, selber Filmessayist, scharfsich-tiger Autor in Sachen Film und Fotografie und als solcher auch die treibendeKraft in der Rettung und Umwandlung der Quartalszeitschrift Cinema in einJahrbuch. Schon beim Notieren dieser Zeilen merke ich, wie wenig man Mar-tin Schaub mit dem Auflisten seiner Aktivitäten gerecht wird: Es waren viele,und zum Erstaunlichsten gehörte, wie ernsthaft er sie alle betrieben hat. Keinweiteres Nachrufen also, eher ein Nachdenken über das, was er unter seinemHandwerk verstand, und darüber, dass bei seinem Handwerk der Kopf be-nutzt werden durfte. Keine Selbstverständlichkeit mehr.
«Er konnte wie das leibhaftige schlechte Gewissen vor einem stehen», hatDieter Bachmann notiert und damit etwas Entscheidendes beschrieben: Mar-tin Schaub konnte ganz schön pingelig sein, denn er liebte die Sprache und diePräzision des Ausdrucks, der in und mit ihr möglich war. Er bohrte nach undliess kaum etwas einfach so stehen. Im heute vorwiegend an Schnelligkeit,Quoten und Oberfläche interessierten Medienbetrieb hätte es Schaub mit sei-ner Sorgfalt schwer. Er war einer, der es genau haben wollte, und dies aus ei-nem simplen Grund: weil er neugierig war. Und weil er wusste, dass Wissenohne Begreifen wenig Sinn macht. Und dass man erst begreifen kann, wennman mehr weiss als das, was gerade notwendig wäre.
Wenn er einen Text schrieb oder redigierte, dann nahm er ihn kritisch le-send wieder auseinander, prüfte seine Wörter und Sätze auf Stichhaltigkeit,stellte, wo sie ihm zu wenig klar, zu wenig präzise schienen, Rückfragen. Ernahm sich Zeit. Und über das Beharren auf Exaktheit fanden die von ihm redi-gierten Texte zu mehr Klarheit, konnte man als Schreibender lernen, sich sel-ber und das Geschriebene eben immer wieder in Frage zu stellen. Martin wuss-te enorm viel, und dennoch wollte er von Gewissheiten im Umgang mit künst-
152
lerischem Ausdruck nichts wissen. Auch der journalistische Ansatz verlangteGenauigkeit und Respekt. Viele Schreibkräfte arbeiten heute auf der Basis vonVideos, auch Filmstudierende kennen Filme vorwiegend ab Konserve. DassUngenauigkeit allein schon aufgrund des Betrachtens miniaturisierter Bildereine Folge ist, liegt auf der Hand.
Aus den frühen Siebzigerjahren habe ich ein A4-Blatt aufbewahrt, auf demMartin Schaub die «Methoden der Filmkritik» zusammengefasst hatte. Profes-sionell betriebene Auseinandersetzung mit Filmen war für ihn keine Ge-schmacks- oder Launensache, Kritik ist eine ernsthafte Arbeit und im bestenFall selber ein schöpferischer Akt, indem sie aufnimmt, sich einfühlt, zu ver-stehen versucht, weiterdenkt, vertieft und dabei erst noch lesenswert formu-liert. Kritik verdient diesen Namen erst dann und taugt etwas, wenn sie überKriterien verfügt und nachvollziehbar geführt wird. Davon ist wenig mehr ge-blieben. Beliebigkeit und Austauschbarkeit haben sich breit gemacht, und dieWorthülsen, mit denen Einzelne spielen, halten oft nicht einmal einer ober-flächlichen Betrachtung stand, zu offensichtlich ist ihre Leere, bloss liegt sieda, die fehlende Kompetenz.
Raum für eine würdige kritische Auseinandersetzung bieten aber auch nurnoch wenige Medien; das, was man über Jahrzehnte hinweg unter«Kritik» ver-standen hat, kann kaum noch gepflegt werden. Ob nicht die Kritikfähigen un-ter den Schreibenden es wieder einmal neu einfordern müssten? Landauf, land-ab sind Wochenendbeilagen auf Animationsprosa und Punkteverteilen ange-legt. Sie können gar keine kritischen Texte enthalten, in denen eine nachvoll-ziehbare Auseinandersetzung geführt wird. Sie können es schon gar nichtmehr bei kleineren Filmen, bei denen die Cinéphilen in deutschen oder italie-nischen Städten glücklich wären, wenn man sie überhaupt in einem Kino zu se-hen bekäme. Viele Medien haben sich der Reflexion entzogen und bieten Pro-duktepräsentation in kauffreudigem Umfeld. Da wird auch unübersehbar, fürwie dumm und geistig beschränkt diese Medien ihr eigenes Publikum halten.
Martin Schaub war ein Filmliebhaber, der viel und gerne ins Kino ging,deroffen war selbst für verschlossene und verquere Formen, für den auch dasAnalysieren der Gründe eines Scheiterns aufschlussreich sein konnte, der dieLeinwand zunächst und zuerst einmal als Begegnungsort verstand für den ei-genen Geist mit dem eines anderen. Industrieprodukte interessierten ihn we-nig, er suchte nach den unterschiedlichen Handschriften, die auf dem Planetenauszumachen waren und plädierte «für eine offene Filmkritik». Das hiess fürihn, man soll Filme nicht messen, man soll sie zu verstehen suchen, und dazuwürden drei Schritte notwendig sein: erstens das persönliche Erlebnis, zwei-tens der Kommentar zu einem Film und drittens seine Interpretation.
Für Schaub war das subjektive Erleben im Kinosaal der erste Schritt, demdie Objektivierung folgen musste: «Nacheinander werden die Charakteristi-ken eines Werkes erläutert und beschrieben. Ein Ganzes wird in seine Be-
153
standteile zerlegt und fast naturwissenschaftlich genau betrachtet.» Auch hiermachte er deutlich, dass es in der Kritik bei aller Subjektivität – entsprechendeKenntnis vorausgesetzt – eine Objektivierbarkeit gibt. Kommt der dritte undletzte Schritt, die Synthese, die Interpretation des subjektiven und des objekti-ven Filmerfahrens. Das Ganze soll einen Sinn bekommen, soll zusammenge-hen – oder eben nicht. «Die Interpretation», so Schaub, «ist dann nicht die ‹rei-ne Wahrheit›. Sie ist eine Wahrheit, die umso verbindlicher wird, je gewissen-hafter wir die ersten beiden Schritte getan haben.»
Heute bleiben viele beim ersten Schritt stehen und begnügen sich mit Fest-stellungen, die mehr über die Schreibkraft aussagen als über das zu vermitteln-de Werk. Im Filmbereich ist der Journalismus zu einem Jekami verkommen,bei dem zu viele unbelastet von Sachkenntnis, von historischem, geografi-schem, gesellschaftlichem oder kulturellemWissen und bar jeglicher Passiondie angelieferten Pressetexte umschreiben. Ohne Problem kann dann auch je-mand im Solde eines Kinobetreibers für dessen Programmheft schreiben undweiteres Textmaterial Redaktionen verkaufen. Im Gegensatz zur Literatur-,zur Kunst- oder zur Musikkritik scheint man an die Filmkritik kaum nochAn-forderungen zu stellen. Die Honorare sind schlecht, die Zeit, die zur Verfü-gung steht, ist knapp, der Platz beschränkt, und die Politik der meisten Medienlautet ohnehin Wellenreiten: über das schreiben, worüber alle anderen auchschreiben.
Martin Schaub arbeitete in einer Zeit, in der ein Kritiker Akzente setzenkonnte und wollte, dem Unbekannten mit dem Gewicht seines Namens zu Be-kanntheit verhalf. Er hat das im Bereich des Autorenkinos für eine lange Reihevon Filmschaffenden getan, er hat es insbesondere auch für den SchweizerFilm getan, den er mit grossem Wohlwollen schreibend begleitete. Heute legenim Filmbereich nicht mehr die Medien, sondern die Kulturindustrie die Inhal-te der Medien fest, ihre Konzerne choreografieren global die Releases. Das ge-lingt ihnen auch an Orten, an denen die Medienbetriebe eigentlich noch unab-hängig wären. Als Aussenstehender fragt man sich, was der Reiz daran seinkann, das zu machen, was alle andern auch tun, etwa seitenweise über Rand-themen eines Industrieprodukts zu berichten, meist ohne Überprüfung dervon der Industrie gestreuten Fakten. Schaub versuchte etwas anderes, und erhat viele Leserinnen und Leser damit geprägt und zu wacherem Sehen ani-miert: Er nahm einen Film wahr und verstand es als eine seiner Aufgaben, überdiese Wahrnehmung kraft seiner Erfahrung und Kompetenz öffentlich nach-zudenken. Das Urteil war ihm unwichtig, über die Däumchen-hoch-Däum-chen-runter-Mentalität lachte er. Wichtig war ihm der Weg zum Urteil, unddass dieser Weg nachvollziehbar blieb. Wichtig war ihm, dass die Leute insKino gehen und übers Kino die Welt anders wahrnehmen, dass es über den re-gen Kinobesuch auch die unterschiedlichsten Filme zu sehen gibt, nicht nur anFestivals. Zu seinem Verständnis von Filmkritik gehörte eben auch ein politi-
154
sches Bewusstsein dessen, was man selber macht und was mit einem gemachtwerden kann.
Das Entscheidende bei seiner Art von Filmkritik war schliesslich wohldies, dass ich als Leser oder Leserin Entscheidungsgrundlagen für einen Film-besuch hatte und Angebote zur Vertiefung des Erlebnisses danach. Also nicht:Gehe hin oder gehe nicht hin; vielmehr: Was erwartet dich und wie kann einerdamit umgehen. Das hiess für Martin Schaub nicht, dass er schlechte Filme gutreden wollte, aber dass er den Anspruch hatte, sich ernsthaft mit jedem einzel-nen Film in einer ihm und seinem Platz im Kinoangebot angemessenen Formauseinander zu setzen. Offenheit eben auch gegenüber dem Unvollendeten,Entdeckungsfreude und Passion für die Dunkelkammer, in der wir immer wie-der von neuem erleuchtet werden.
155
!"#$"% &'("%#"'
()*+,-./012+341+,514/.0163,
7(8946:
2+34;0+/<16=,1()*/460>
Nie hat der dänische Film derart direkt und eindringlich sein Publikum ange-sprochen wie in diesen Jahren – und nie ist die einheimische Bevölkerung vorden Kinokassen so lange Schlange gestanden, um dänische Filme zu sehen.Der inländische Marktanteil lag in den letzten fünf Jahren stets zwischen 27und 30 Prozent. In Europa kann nur Frankreich eine ähnlich starke Stellungdes einheimischen Filmschaffens im eigenen Land behaupten. Seit Mitte derNeunzigerjahre schreibt der dänische Film eine vielbeachtete nationale undinternationale Erfolgsgeschichte, und man muss weit zurückblicken, um inden Jahren 1910–1915 eine einheimische Produktion zu finden, die damitkonkurrieren kann. Damals war die heute noch existierende Nordisk FilmKompagni die zweitgrösste Produktiongesellschaft der Welt. Die DäninAsta Nielsen (1883–1972) wurde zum ersten europäischen Filmstar: Sie de-bütierte in Afgrunden (The Abyss, Urban Gad, 1910), in einem jener eroti-schen Melodramen, die Dänemark in der Stummfilmzeit in die ganze Weltexportierte.
Intime Alltagsschilderungen
Susanne Bier war mit ihrer romantischen Komödie Den eneste Ene (The Oneand Only, 1999) eine der Wegbereiterinnen für den aktuellen Publikumserfolgdes dänischen Films: Für den Film zahlten 800 000 Däninnen und Dänen Ein-tritt – bei einer Gesamtbevölkerung von gut 5 Millionen Menschen. Wie diesesWerk waren eine Reihe der Kassenschlager der letzten Jahre intime Alltagser-zählungen von Frauen und Männern Ende dreissig, die in der Grossstadt lebenund sich ihren Weg durch verschiedene Formen von Midlifecrisis suchen. DieFilme präsentieren sich als Mischung aus Komödie und Drama und nützen diebesten Instrumente jedes Genres, um die Rolle der Familie in der dänischenGesellschaft zu sezieren.
156
Kritische Stimmen haben bemängelt, dass sich die dänischen Produktio-nen der letzten Jahre sehr ähnlich geworden sind. Aber wenn Annette K. Ole-sens Små ulykker (Minor Mishaps, 2002), Jesper W. Nielsens Okay (2002) undSusanne Biers Elsker dig for evigt (Open Hearts, 2002) einander gleichen, dannweil sie alle eine grosse Begabung für engagierte und humoristische Schilde-rungen des Alltagslebens zeigen.
Nicht alle neuen Produktionen passen jedoch in dieses Muster der intim-romantischen Komödie oder des Dramas. Eines der herausragenden Werkevon 2003 ist Per Flyes Arven (Inheritance), ein konzentriert gestaltetes undvon beeindruckenden Schauspielleistungen getragenes Drama, das die Spielre-geln in einem kapitalistischen System zu entlarven versucht: Als der Fabrik-direktor Selbstmord begeht, wird der Sohn der Familie von seinem Restaurantin Frankreich in seine Heimat geholt, um den Familienbetrieb zu retten. Erwilligt nur zögerlich ein und muss einen hohen persönlichen Preis für seineHilfsbereitschaft bezahlen. Arven ist das zweite Werk einer Trilogie, die sichdem dänischen Klassensystem gewidmet hat. Das erste, Bænken (The Bench,2000), handelt von einem ehemaligen Koch mit schwerwiegenden Alkohol-problemen, der versucht, den seit Jahren abgebrochenen Kontakt zu Tochterund Enkelkind wieder aufzunehmen. Auch Bænken ist bei Publikum und Kri-tik im Inland auf Begeisterung gestossen. Wogegen er ausserhalb der Landes-grenzen vor allem mit Verwunderung aufgenommen wurde, gilt doch Däne-mark als ein sozial sehr homogenes Land, in dem «wenige zu viel und die We-nigsten zu wenig» haben, wie es in einem populären Vaterlandslied heisst.
«Dogma»-Ästhetik
Ein Reihe von Filmen der letzten Jahre wurden gemäss den «Dogma»-Regelngedreht (siehe www.dogma95.dk) oder zumindest davon inspiriert. Die wich-tigsten Punkte in diesem Regelwerk – alle Aufnahmen «on location» ohne Zu-hilfenahme von mitgebrachten Requisiten; nur die am Drehort vorhandenenLichtquellen einsetzen; ausschliesslich Handkamera – haben den Filmen eineeigenwillige und markante Prägung gegeben. Trotzdem lässt sich nicht sagen,dass ein durchgehender visueller Stil die «Dogma»-Werke verbinden würde.Die aufgestellten Regeln machen es einfach, eine Masse von Material zu belich-ten, aber dessen Bearbeitung verfährt nicht nach bestimmten gestalterischenPrinzipien, durch die sich alle Filme angleichen würden. In den ersten «Dog-ma»-Filmen, Festen (1998) von Thomas Vinterberg und Idioterne (1998) vonLars von Trier, wurde das neue Regelwerk im Zusammenspiel mit Erzählungund Figurenzeichnungen genial ausgenützt. Einige der folgenden Produktio-nen wären sicherlich auch mit einer konventionellen Filmsprache sehr gut an-gekommen. Zweifellos aber hat «Dogma» kreative Freiheiten geschaffen für
157
Filmschaffende, die sich eingeengt fühlten vom schwerfälligen und umständli-chen Produktionsapparat. Daraus resultierte eine Serie von international er-folgreichen Werken, darunter Lone Scherfigs Italiensk for begyndere (Italianfor Beginners, 2000) und Elsker dig for evigt (Open Hearts, 2002) von SusanneBier.
Von Trier und Zentropa
Lars von Trier stritt sich während mehrerer Jahre mit Bille August um die Rol-le des international bekanntesten dänischen Regisseurs. Gewonnen hat vorläu-fig Lars von Trier, der auch eine grosse Inspirationsquelle für die jüngerenFilmschaffenden darstellt. Er besitzt die Produktionsgesellschaft ZentropaEntertainments zusammen mit dem schillernden, Zigarren rauchenden Produ-zenten Peter Aalbæk Jensen, der nicht davor zurückschreckt, nackt am Swim-mingpool zu posieren oder fingierte Konflikte rund um seine Filmprojekte zukreieren, wenn öffentliche Beachtung und Medienpräsenz gefordert sind. ImVerbund mit der Produzentin Vibeke Windeløv und dem Produzenten Ib Tar-dini haben von Trier und Aalbæk Jensen in der «Filmstadt» Hvidovre südlichvon Kopenhagen ein einzigartiges kreatives Klima geschaffen.
Mit seinem jüngsten Film, Dogville (2003), scheint Lars von Trier die me-lodramatische Linie von Breaking the Waves (1996) und Dancer in the Dark(2000) weiterzuverfolgen: Im Mittelpunkt steht wiederum eine Märtyrerin.Allerdings setzt er sich mittlerweile wie in den frühen «Dogma»-Tagen wiederstrenge gestalterische Regeln und Begrenzungen. Die Handlung konzentriertsich in Dogville zwar ausschliesslich auf eine Kleinstadt im amerikanischenTeil der Rocky Mountains, wurde jedoch nur in Studiodekorationen aufge-nommen, wo die verschiedenen Häuser lediglich mit Kreidezeichen auf demBoden kenntlich gemacht waren. So ist Dogville nicht zuletzt zu einer faszinie-renden Studie Brecht’scher Verfremdungseffekte geworden.
Drehbuchentwicklung im Fokus
Die dänische Filmschule, welche weltweit einen sehr guten Ruf geniesst, hatzweifellos einen wesentlichen Anteil an der gegenwärtigen Erfolgsgeschichte.Der Leiter der Drehbuchabteilung, Mogens Rukow, wurde zum Mentor eini-ger der herausragenden Jungregisseure wie Lars von Trier und Thomas Vinter-berg. Er war beteiligt an der Drehbuchentwicklung der «Dogma»-Filme Fes-ten und En kærlighedshistorie (Kira’s Reason – A Love Story, 2001), ein fein-fühliges, beklemmendes Ehedrama. Rukow arbeitete auch am Drehbuch fürVinterbergs letztes, englischsprachiges Werk, It’s All About Love (2003) mit
158
Joaquin Phoenix und Claire Danes in den Hauptrollen. Die prätentiöse Lie-besgeschichte wurde in Dänemark von der Kritik wohlwollend aufgenommen,verkaufte sich aber miserabel an den Kinokassen und muss heute schlichtwegals Fiasko betrachtet werden; das metaphysische Pathos des Films kam wederin Dänemark noch im Ausland beim Publikum an. Mogens Rukow wird auchals Drehbuchautor in den Credits von Christopher Boes Reconstruction (2003)aufgeführt, welcher 2003 in Cannes die Camera d’or für das beste Erstlings-werk gewann. «All is construction, all is film. And it hurts», heisst es in derVoice-over mit einer typischen Formulierung Rukows. Was immer man vomambitiösen Reconstruction hält, der in seiner «kühlen» Ästhetik stark an denfrühen Lars von Trier erinnert – der 29-jährige Boe wird ganz sicher wieder aufsich aufmerksam machen.
Der Regisseur und Drehbuchautor Anders Thomas Jensen ist derzeit das«Wunderkind» des dänischen Films. Der emsige Dreissigjährige hat das Skriptgeschrieben und auch gleich selber die Regie geführt bei den zwei schwarzenKomödien Blinkende lygter (Flickering Lights, 2000) und De grønne slagtere(The Green Butchers, 2003), die in Dänemark hohe Zuschauerzahlen verzeich-neten, aber kaum Zugang zu ausländischen Festivals fanden. Jensen ist auchMitverfasser von Drehbüchern zu einigen Erfolgsfilmen anderer Regisseure,etwa zu Jannik Johansens Rembrandt (2003), Susanne Biers Open Heart,Søren Kragh-Jacobsens Mifunes sidste sang (Mifune, 1999) und Lone ScherfigsWilbur begår selvmord (Wilbur Wants to Kill Himself, 2002). Erwähnenswertist auch, dass er vor den Spielfilmen an drei Kurzfilmen beteiligt war – Ernst oglyset (Ernst & The Light, 1996), Wolfgang (1998) und Valgaften (ElectionNight, 1998), die alle für den Oscar nominiert wurden, wobei Letztgenanntersogar einen Oscar in der «Live-Action-Kategorie» gewann. Wie der anderezurzeit tonangebende Drehbuchautor, Kim Fupz Aakeson (Okay, Små Ulyk-ker), ist Jensen ein Meister der wirklichkeitsnahen und eindringlichen Dialogeund der Schilderung von Mikro-Konflikten.
Nehmt die Kindheit ernst
Seit 1982 ist durch das dänische Filmgesetz gesichert, dass mindestens 25 Pro-zent der staatlichen Fördermittel an den Kinder- und Jugendfilm gehen. Dasführte in den Achtziger- und Neunzigerjahren sozusagen zu einem goldenenZeitalter dieser Produktionen, die auch international grosse Resonanz fanden.Die Kinderfilme begegneten den Kleinen gewissermassen auf Augenhöhe inihrer vertrauten Lebenswelt und entsprachen ihrem Bedürfniss, die Umweltunter ihren spezifischen Bedingungen zu erfahren.
Der Kinderfilm hat nicht zuletzt die Funktion eines inoffiziellen Ge-wächshauses für den Erwachsenenfilm übernommen. So hat Bille August,
159
zweifacher Gewinner der Palme d’or in Cannes mit Pelle Erobreren (Pelle theConqueror, 1987) und Den gode vilje (The Best Intentions,1991), seine Karrie-re mit herausragenden Kinder- und Jugendfilmen wie Tro, håb og kærlighed(Twist and Shout, 1984), Zappa (1983) und Busters verden (In the World ofBuster, 1984) begonnen. Thomas Vinterberg gelang mit dem Novellen-FilmDrengen der gik baglæns (The Boy Who Walked Backwards, 1993) einer derschönsten dänischen Kinderfilme überhaupt, und Søren Kragh-Jacobsen istebenfalls über die Landesgrenzen hinaus bekannt für seine feinfühligen Werkefür Kinder und Jugendliche, darunter Skyggen af Emma (Emma’s Shadow,1988) und der Klassiker Gummi Tarzan (Rubber Tarzan, 1981).
Im Gegenzug zum Erfolg des dänischen Erwachsenenfilms, der im Verlau-fe der Neunzigerjahre den Druck auf die Filmschaffenden stetig erhöhte, im-mer wieder neue Kassenrekorde zu brechen, wurde das Kinderpublikum zuse-hends vernachlässigt. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden oft für mehr oderweniger blöde Familienkomödien eingesetzt, die gewiss viele Menschen in dieKinos lockten, deren erzählerische Universen aber weit entfernt vom Kinder-alltag liegen. In den letzten Jahren haben die Kinderfilme zudem die Tendenz,abenteuerlicher und trendiger als die Kinder selbst zu werden. So sagte meinachtjähriger Sohn letzthin nach dem Besuch eines neuen Kinder-Familien-films: «Ein toller Film, aber die Geschichte war sehr klein.» Daneben warenaber auch einzelne anspruchsvollere Produktionen zu sehen, etwa Natasha Ar-tys Mirakel (Miracle, 2000), Hans Fabian Wullenwebers Klatretøsen (CatchThat Girl, 2002) und En som Hodder (Someone Like Hodder, 2003) von Hen-rik Ruben Genz.
Dänisch in Englisch
Seit Ende der Achtzigerjahre ist der Begriff «Koproduktion» zur Zauberfor-mel geworden, welche die Geldschränke in den nordischen Ländern sowie imübrigen Europa zu öffnen vermochte und damit eine zusätzliche Finanzie-rungsquelle für dänische Spielfilme bot. Die Einrichtungen Eurimages undNordisk Film- & TV-Fond (welche Koproduktionen zwischen den fünf nor-dischen Ländern fördert) waren der Grund dafür, dass sich die einheimischenProduzenten und das staatliche Filminstitut (Det Danske Filminstitut) überdie Landesgrenzen hinaus orientierten. Mittlerweile ist Dänemark hinsichtlichder internationalen Zusammenarbeit eines der engagiertesten Länder Europas.
Vor 1989 musste das Kulturministerium jeweils eine Ausnahmegenehmi-gung erteilen, wenn für einen Film staatliche Unterstützung beantragt wurde,der in einer anderen Sprache als Dänisch gedreht werden sollte. Lars von Trierserster Spielfilm, Forbrydelsens element (The Element of Crime, 1984), mussteaus Gründen der geografischen Situierung und der erzählerischen Glaubwür-
160
digkeit in Englisch gedreht werden. Nachdem akzeptiert worden war, dasszwei ausländische Schauspieler die Hauptrollen besetzen, war Det DanskeFilminstitut, das die Anträge auf staatliche Finanzierung bearbeitet, zunächstnicht bereit, deren Zahl auf vier zu erhöhen. Nachdem trotzdem eingewilligtworden war, verlangte man aber eine Nachsynchronisation in dänischer Spra-che, welche der Regisseur verweigerte. Schliesslich wurde das Werk erst amTag vor der Vorführung im Hauptwettbewerb am Festival in Cannes offiziellals dänische Produktion anerkannt.
Dänische Filmschaffende haben mit wechselndem Erfolg versucht, eng-lischsprachige Filme zu lancieren. Abgesehen von Lars von Triers internatio-nalen Autorenfilmen und den Grossproduktionen The House of the Spirits(1993) und Smilla’s Sense of Snow (1997) von Bille August gibt es kaum eng-lischsprachige Filme aus Dänemark, die ein grosses in- und ausländisches Pub-likum erreicht hätten. Keine der erfolgreichen Filmemacherinnen und Filme-macher wie Thomas Vinterberg, Lone Scherfig, Søren Kragh-Jacobsen undNicolas Winding Refn, die ihre letzten Werke in Englisch gedreht haben,konnten damit zufriedenstellende Zuschauerzahlen erreichen. Am besten liefnoch Scherfigs Wilbur begår selvmord (Wilbur Wants to Kill Himself), der inSchottland gedreht wurde und in den dänischen Kinos immerhin 170 000 Kar-ten verkaufte. Was allerdings weit von den sagenhaften 800 000 Eintritten ent-fernt ist, die sie mit Italiensk for begyndere (Italian for Beginners) verzeichnenkonnte. Vinterbergs It’s All About Love (2003), dessen Produktionskostengleich zehn Mal höher waren als jene von Festen, wurde nur von 51 000 Dänin-nen und Dänen gesehen – Festen hatte 404 000 Eintritte verbucht. Kragh-Ja-cobsens letzter Film, Skagerak (2003), der ebenfalls in Schottland gedreht wur-de, kam nur auf 35 000 bezahlte Eintritte in Dänemark, obwohl der dänischeStar Iben Hjejle in der Hauptrolle lockte. Dagegen wurde sein «Dogma»-FilmMifunes sidste sang (Mifune) von 351 000 Menschen gesehen. Nicolas WindingRefn fand noch einen grossen Publikumszuspruch mit seinen wirklichkeitsna-hen Grossstadtgeschichten Pusher (1996) und Bleeder (1999). Sein englisch-sprachiger Fear X (2003) mit John Turturro wurde jedoch vom dänischen Ki-nopublikum verschmäht.
Im Grossen und Ganzen verlieren die dänischen Filme in Englisch oft ihrespezifische Prägung. Das Publikum vermisst die filmischen Angebote sprach-licher, kultureller und geografischer Identifikation. Viele Filmschaffende wol-len ins Ausland, um mit internationalen Partnern zu arbeiten, aber das däni-sche Publikum bevorzugt die lokalen Geschichten der lokalen Geschichtener-zähler.
Übersetzung: Jan Sahli
161
162
!"#$#%&'(")*+,(-),(").&'/(#0("
1"2,34$#2+)566575668
Natalie Böhler (nat), Laura Daniel (ld), Flavia Giorgetta (fg),Marcy Goldberg (mg), Veronika Grob (vg), Sabine Hensel (sh),
Martina Huber (mh), Francesco Laratta (fl),Eva Moser (em), Doris Senn (ds),
Redaktion: Laura Daniel
Abkürzungen bei den Filmdaten
9:;<=>?;<@A*. ;B*CD:E
!" #"$ $%# &"'(%#
«Stier» ist im Schweizerdeutschen auch einAdjektiv, das sich in etwa mit «engstirnig»,«dickköpfig» oder «langweilig» übersetzenlässt. Dass Stiere und Stierkämpfe im Lebendes Walliser Bergbauern Adrien wichtig sind,lässt dann auch Rückschlüsse ziehen auf denCharakter der Hauptfigur aus Amiguets Ausud des nuages. Das Wallis, eine südwestlicheAlpenregion der Schweiz, zeichnet sich land-schaftlich durch schluchtenartig enge Tälerund schroffe Felshänge aus – das Klischee,dass die Mentalität der Einwohner die Land-schaft spiegelt, liegt hier nahe. Auf den erstenBlick entsprechen Adrien und seine Bekann-ten diesem Klischee voll und ganz: Zwischen-menschliches findet vor allem an Jassabenden
und bei Stierkampf- und Schwingerfestenstatt, und auch hier nur indirekt. Man hält sichan Bekanntes, Traditionelles, spricht ungernüber persönliche Anliegen, zu viel ausgespro-chene Nähe löst Unbehagen aus.
Die zweite Bedeutung von «stier» – pleitesein – trifft hingegen nicht zu: Die Jasskassevon Adrien und seiner Männerrunde ist voll.Mit dem Geld will sich das Grüppchen eineReise mit der transsibirischen Eisenbahn nachChina gönnen: Hier tritt der überraschendePlot Point des Films in Kraft. Wie sich die Fi-guren dabei anstellen, wird zur Befindlich-keitsstudie und harten Probe von Heimatver-bundenen, die sich in die Fremde wagen:Schon in Genf krebst einer zurück und schicktals Stellvertretung seinen jungen Neffen. InBerlin werden die Nashörner im Zoo mit Wal-liser Rind verglichen; die derbe Bergkluft wirdauch im eleganten Zugabteil nicht gewechselt,
P: ProduktionB: Drehbuch oder DrehvorlageR: RealisationK: KameraT: TonL: LichtS: SchnittAus: Ausstattung, BautenM: Musik
D: DarstellerInnenV: Verleih in der SchweizW: Weltrechte16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mmS/w: schwarzweiss
Werden andere Angaben gemacht, sind sie ent-weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.
und noch in Moskau bevorzugt man zumFrühstück die mitgebrachte Aprikosenkonfi-türe: So gewagt die Reise und so exotisch dasReiseziel sein mögen, die Heimat kann mannicht abschütteln. Deshalb kehrt einer nachdem andern in die Schweiz zurück, bis Adriendie Reise schliesslich allein fortsetzt. Was hier-bei Anlass zu Komik oder auch Tragik bietenwürde, verpufft allerdings oft in der Lakonikder Erzählung; zu distanziert sind die Figuren,als dass sie einem emotional nahe treten könn-ten. Ihre Verstocktheit und die Isolation be-einträchtigen die Wirkung des Films, obwohloder weil sie dessen Thema sind, und die Sehn-sucht der Figuren nach dem Anderswo wieauch ihre Auseinandersetzungen mit dem Zu-hause verlieren an Dringlichkeit.
Yunnan, die chinesische Region «südlichder Wolken», erscheint schliesslich wie einEcho des Wallis – auch hier gibt es hohe Berge,diesig-verhangene Wälder und Stierkämpfe.Adrien fühlt sich instinktiv wohl und schüttetsein Herz einer Chinesin aus, die zwar nurBahnhof versteht, aber geduldig zuhört, bissich Adriens Seele reingewaschen hat, weil ersein Schweigen bricht und ein über Jahrzehntegehütetes Geheimnis loswird. Die Schwierig-keit des Films – die Fremdheit und der Mangelan Empathie gegenüber Adrien, der aus seinerUnzugänglichkeit und seinem Schweigen re-sultiert, – lösen sich hier versöhnlich auf. DieEntdeckung des Eigenen im Fremden wirdspät, aber wirksam greifbar. (nat)
P: Bernard Lang AG (Zürich) 2003, Native(Paris). B: Jean-François Amiguet, AnneGonthier, R: Jean-François Amiguet. K: Hu-gues Ryffel. T: François Musy. S: Valérie Loi-seleux. M: Stimmhorn, Laurence Revey. D:Bernard Verley, François Morel, MauriceAufair, Jean-Lux Borgeat.35 mm, Farbe, 80 Minuten, Französisch.
9:;<=.EF1G;<: H?A<
)'*# *+ ,"&$%#-""# ./% (0&*%
-01203*4"%5
Wenn wir es nicht schon wüssten – Mais imBundeshuus öffnete uns definitiv die Augen:Die Politik ist kein Quell der Lauterkeit, die
Politiker keine Waisenknaben. Hohe Ziele rin-gen da mit knallharten Eigeninteressen. EthischeGrundsätze messen sich mit wirtschaftlicherProfitgier. Ein Spiel mit Fouls und Handicaps,mit Solovorstössen und Defensivblockaden,mit Überraschungsangriffen und Zufallstref-fern. Vorzugsweise glauben wir, dass unserekleine Modelldemokratie frei von solchenMauscheleien sei. Doch nun hat Jean-StéphaneBron den eidgenössischen Parlamentsalltagunter die Lupe genommen und gibt an einemBeispiel ernüchternden Einblick.
Das Zentrum von Mais im Bundeshuus –der «Mais» steht dialektal für «Aufruhr,Lärm», aber auch für die gentechnisch verän-derte Pflanze par excellence – bildet eine parla-mentarische Kommission, die sich über einJahr lang der gesetzlichen Reglementierungder Gentechnologie annimmt: der berühmt-berüchtigten Gen-Lex. Bron verzichtet aufAktenstudium und trockene Faktenvermitt-lung – und weil die Verhandlungen hinter ge-schlossener Tür stattfinden, bleibt ihm (unduns) auch die hoh(l)e Politrhetorik erspart.Die Kamera steht vor der ominösen Tür mitdem Schild «Kommission – darf nicht gestörtwerden», wo Bron geduldig auf die Rauch-und Kaffeepausen, auf die Zeiten vor und nachden Sitzungen wartet. Dann also, wenn dieVolksvertreterInnen Dampf ablassen, der Ka-mera insgeheim den nächsten Schachzug an-vertrauen oder wortlos ihrer Enttäuschung intiefen Zügen an der Zigarette Ausdruck verlei-hen. Da werden jovial Schultern geklopft,Bündnisse mit Augenzwinkern besiegelt, Re-sultate via Handy erörtert, Köpfe zusammen-gesteckt und Strategien ersonnen. Da schlies-sen Freund und Feind kurzfristige Bündnisse,da wird Druck ausgeübt und werden Ideolo-gien über Bord gekippt.
Die «Helden» dieser Politposse sind diegrüne Biobäurin Maya Graf, der Wissen-
163
164
schaftler Jacques Neirinck (CVP), die rote Ge-meindepräsidentin Liliane Chappuis, derSVPler und Bauer Sepp Kunz sowie der engmit der Pharmaindustrie liierte Johannes Ran-degger (FDP). Es ist unglaublich, was Bronmittels der kleinen Interaktionen dieser Figu-ren über das Funktionieren von Politik ver-mitteln kann. Unvoreingenommen, mit wa-chem Blick für die kleinen Gesten und offe-nem Ohr für die geheimsten Gedanken derPolitikerInnen verweist er augenzwinkerndauf die grossen Zusammenhänge – ein Kön-nen, das er auch schon in seinem amüsantenFilm über eine Autofahrschule (La bonne con-duite, 1999) unter Beweis stellte. Die in Maisim Bundeshuus geschickt eingeflochtenen mu-sikalischen Bezüge zum Italowestern (Musik:Christian Garcia) bauen nebst der verhand-lungstechnischen Suspense eine subtile Kli-max bis zur Abstimmung im Plenum auf. Hierwird uns ein Showdown in 32 Artikeln gebo-ten, der so manchem Krimi an Spannung undunvorhersehbaren Wendungen das Wasserreichen kann. (ds)
P: Ciné Manufacture (Lausanne), SRG SSRidée suisse 2003. B, R: Jean-Stéphane Bron. K:Eric Stitzel. T: Luc Yersin. S: Karine Sudan. M:Christian Garcia. V: Vega (Zürich). W: CinéManufacture (Lausanne).Video/35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizer-deutsch, Französisch, Deutsch (deutsche,französische Untertitel).
9A;!*B I:BB:?
6'7*8' 67'88*9
«Dieser Strand ist ein Sarg, ein europäischerSarg.» Ito Jimenez Dominguez starrt ins Meerhinaus, ihre Stimme verrät Bitterkeit: «Mor-gens kommen sie in Scharen hierher, um sichzu amüsieren – drei Stunden zuvor aber ist andiesem Strand ein Mensch gestorben.»
Das südspanische Tarifa, beliebte Ferien-destination und Surferparadies, wird tagsübervon flanierenden und badenden Touristen be-völkert. Nachts aber zeigt es ein vollkommenanderes Gesicht: Zehntausende Immigrantenaus Afrika versuchen jährlich illegal das Meerzwischen Marokko und Spanien zu durchque-
ren. Ihr Ziel: eine Zukunft in Europa. Vorwie-gend junge Männer, aber auch Frauen undKinder wagen sich auf einfachen Gummiboo-ten ins zum Teil stürmende Meer hinaus. Hun-derte werden aber niemals spanischen Bodenbetreten; wegen des hohen Wellengangs stür-zen sie ins Wasser und ertrinken.
Seit dem 1. November 1988, als zum al-lerersten Mal Flüchtlinge ertranken, es waren18 Menschen, wiederholt sich die Tragödieunentwegt. Damals berichtete die Zeitungausgiebig – mittlerweile ist eine solche Nach-richt nichts Neues. Der Alltag ist in Tarifavon den andauernden Immigrationsströmen,dem allzeit gegenwärtigen Leid und Tod ge-prägt.
Wie geht die Lokalbevölkerung mit die-sem Elend um? Dieser Frage geht der Doku-mentarfilmer Joakim Demmer nach. Er lässtdie Küstenwachen, Mitarbeiter diverser Hilfs-organisationen, einen Journalisten und einenBestattungsunternehmer zu Wort kommen.Betroffen teilen sie ihre Ohnmacht, ihre Wut,ihre Bitterkeit und Traurigkeit mit.
Konsequent aber weicht Tarifa Trafficden eigentlichen Protagonisten, den Flüchtlin-gen, aus. Man sieht sie zwar, in einem überfüll-ten Gummiboot, durch das Wasser watend,zwischen den Dünen kauernd – vollkommendurchnässt, zitternd und offensichtlich unterSchock, doch die illegalen Immigranten blei-ben, so wie sie in der europäischen Öffentlich-keit auch wahrgenommen werden, tragischeSchicksale ohne Namen. Das konzeptuelleAusklammern ihrer Perspektive birgt un-glücklicherweise die Gefahr, die Problematikder illegalen Immigration auf einen Haufengestrandete Leichen zu reduzieren.
Dennoch wird Demmer dem Anspruchgerecht, sich den Betroffenen auf rücksichts-volle und teilnehmende Art zu nähern unddies auch formal überzeugend umzusetzen.Der trauernde Mustafa, der aus Italien ange-reist ist, um die Leiche seines Bruders zurückin die Heimat Marokko zu führen, wird durchdie Scheiben eines Cafés gefilmt; er sitzt,raucht und wartet auf das Bestattungsauto(mit der sarkastisch anmutenden Aufschrift:«24 Stunden Service»). Mustafa spricht ausdem Off, seine Stimme schafft eine Intimität,die dem schwierigen Inhalt gerecht wird, wäh-rend die gewählte Bildeinstellung unaufdring-lich und doch präsent wirkt.
165
Mit Tarifa Traffic ist Joakim Demmer einstiller, nachdenklicher Dokumentarfilm ge-lungen, der sich trotz tragischer Thematik ei-ner äusserst klaren, gar ästhetischen Bildspra-che verpflichtet und inhaltlich an den SpielfilmClandestins des Regisseurduos Chouinard/Wadimoff aus dem Jahre 1997 anknüpft. (fl)
P: Dschoint Ventschr Filmproduktion AG(Zürich), Deutsche Film- und Fernsehakade-mie Berlin (Berlin), ZDF/3sat 2003. R: JoakimDemmer, Brenda Osterwalder. K: Hoyte vanHoytema. T: Daniel Iribarren. S: Joakim Dem-mer, Ingrid Landmesser, Natali Barrey. M:Matthias Trippner. V, W: Dschoint Ventschr(Zürich).Video, Farbe, 60 Minuten, Spanisch, Marok-kanisch (englische Untertitel).
?*@G;?I I*<IA
!7'(:&; 1% 7:+'& $% )'3*##%
Im Winter 1941 flüchteten die SchriftstellerLouis Aragon und Elsa Triolet aus dem be-setzten Teil Frankreichs nach Nizza, um dortihre Arbeit in der Résistance fortzusetzen. Zudieser Zeit wohnte in Nizza der grosse MalerHenri Matisse, der sich trotz fortschreitendemAlter in einer intensiven Schaffensperiode be-fand. Aus der Begegnung des Schriftstellerpaa-res mit dem Maler entstanden eine tiefeFreundschaft und ein reger intellektuellerAustausch. Aragon beschloss, ein Buch überMatisse zu schreiben. Sein Henri Matisse, ro-man konnte er aber erst 1971 vollenden, kurznach Elsas Tod (Matisse war 1954 gestorben).
Mit seiner Mischung aus Kunstkritik undAutobiografie, Aufsätzen und Gedichten bil-det Henri Matisse, roman eine ideale Vorlagefür Richard Dindo, der bereits in vielen seinerfrüheren Dokumentarfilme Betrachtungenzum künstlerischen Prozess und zum Bezugzwischen Leben und Werk, Wort und Bild an-stellte. Insofern ist Aragon, le roman de Matisseeine konsequente Fortsetzung seiner früherenArbeit mit Künstlerbiografien wie Naive Ma-ler in der Ostschweiz (1972), Max Frisch JournalI–III (1981), Arthur Rimbaud, eine Biogra-phie (1990) oder Charlotte Salomon, «Lebenoder Theater?» (1992), um nur einige Beispiele
zu nennen. Auch die Figur des engagiertenSchriftstellers Aragon erinnert an andere vonDindo porträtierten Autoren wie etwa JeanGenet (Genet in Chatila, 2000) und BreytenBreytenbach (Augenblicke im Paradies, 1996).
Über die Stoffwahl hinaus greift Dindo inAragon, le roman de Matisse auch auf Strate-gien zurück, die uns aus seinen früheren Fil-men vertraut sind: etwa die Rückkehr an dieOrte, wo seine Protagonisten wohnten und ar-beiteten oder der Einsatz von langen Zitatenaus dem Buch, gelesen aus dem Off. Doch indiesem Film scheint sein Handwerk eine neuemeisterhafte Ebene erreicht zu haben. DieFilmbilder – vor allem die langen Fahrtendurch die regnerischen Strassen Nizzas imWinter und die üppigen Farben der Gärten –sind von der gleichen leuchtenden Schönheitwie die sinnlichen Tableaus von Matisse. Einemeisterhafte Montage verdichtet Bilder undTöne zu einer filmischen Lektüre von Gemäl-den, Buch und authentischen Schauplätzen.
Der Film demonstriert jene Kraft des Do-kumentarfilms als Medium der Analyse, die da-rin besteht, dass er alle anderen Künste in sichumfassen kann. Beklagte sich Aragon über dieSchwierigkeit, Matisses Kunst mittels Sprachezu beschreiben, fängt Dindo souverän das gan-ze Universum des Malers und des Schriftstel-lers ein: die Gemälde, die Texte, die Orte, an de-nen sie entstanden sind, ebenso wie die histori-schen und politischen Hintergründe. Zu deninteressantesten Passagen des Films gehören dieMontage-Sequenzen, in denen Dindo Originalund Darstellung vergleicht – wie etwa MatissesPorträts von Aragon und Triolet, welche mitFotos der beiden kontrastiert und mit den Aus-sagen von Aragon kommentiert werden. (mg)
P: Lea Produktion (Zürich) 2003. B,R,K,T: Ri-chard Dindo. S: Rainer Trinkler, Richard Din-do. M: César Franck, Valentin Silvestrov. V,W: Lea Produktion (Zürich).Beta SP, Farbe, 52 Minuten, Französisch.
?*@G;?I I*<IA
<* :12*$:; &* =%7$>&
«Damit historische Ereignisse nicht in Verges-senheit geraten, muss man von ihnen erzäh-
166
len.» Der lakonische Satz, der eigentlich alsMotto für Richard Dindos gesamtes Schaffender letzten dreissig Jahre stehen könnte,stammt aus seinem neusten DokumentarfilmNi olvido, ni perdón. Die Geschichte, die hiervor dem Vergessen gerettet werden soll, istdiejenige der Niederschlagung der 68er-Bewe-gung Mexikos, eine Geschichte, die schon da-mals zu wenig bekannt wurde, als sie sich zu-trug.
Im Zentrum des Films steht das Massakervon Tlatelolco. In diesem Vorort von Mexi-ko-City wurde am 2. Oktober dem bewegtenSommer des Jahres 1968 ein blutiges Ende ge-setzt. Als Studierende und andere Protestie-rende sich auf der Plaza de las Tres Culturasversammelten, um gewaltlos für ihre Bürger-rechte zu demonstrieren, eröffneten Soldatendas Feuer. Rund 300 Menschen starben in derSchiesserei, weitere wurden verhaftet und ge-foltert. Zwölf Tage später konnte Premiermi-nister Diaz Ordaz in seiner nun wieder ruhi-gen Hauptstadt die Olympischen Sommer-spiele eröffnen.
Wie der Film zeigt, ist es heute unbe-streitbar, dass Diaz Ordaz die gewaltsameAuflösung der Protestbewegung befahl. SeineRegierung allerdings behauptete, die Demons-trierenden hätten zuerst Gewalt angewendet;diese Unwahrheit wurde von den damaligenZeitungen kolportiert und ging damit in dieoffizielle Geschichtsschreibung ein. DindosFilm verfolgt also ein doppeltes Ziel: Er willnicht nur an die Geschehnisse erinnern, er willauch die offizielle Geschichte einer fälligenKorrektur unterziehen.
In Dindos Rekonstruktion der Ereignissespielen die Aussagen von Augenzeugen diewichtigste Rolle. Er lässt Überlebende desMassakers – unter ihnen eine ehemalige Stu-dentenführerin – zum Schauplatz des Gesche-hens zurückkehren, um dort ihren Erinnerun-gen Ausdruck zu geben. Diskret setzt Dindokurze Ausschnitte aus Archivmaterial ein, umdie Stimmung dieser Erzählungen assoziativzu untermalen; die bildhaften und bewegen-den Aussagen der Überlebenden selber über-treffen an Anschaulichkeit jede nachträglicheIllustration. Konkrete Details aus ihren Schil-derungen stimmen auf bedrückende Weise mitdem bis heute fast unveränderten Platz über-ein; es ist, als ob die damaligen Ereignisse gera-de erst passiert wären.
Die Frage, inwiefern Geschichte in dieAktualität zurückgeholt werden kann – einDauerthema Dindos – erkundet er auch durchden Einsatz weiterer Elemente. Auszüge ausdem Spielfilm Rojo amanecer (1989) von JorgeFons sowie aus der Bühnenarbeit einer Truppejunger Schauspieler zeigen, wie die damaligeGewalt durch eine künstlerische Dramatisie-rung der Ereignisse analysiert werden kann.Zudem wird die Bedeutung der Tlatelolco-Geschichte für weitere Generationen und fürdie mexikanische Gesellschaft überhauptdurch Begegnungen mit jungen Leuten undKindern erforscht. Der Gesamteindruck, dender Film hinterlässt, ist ein gemischter: dennGleichgültigkeit, Desinformation und Dro-hungen von rechts gefährden das Erinnerungs-projekt. (mg)
P: Lea Produktion (Zürich) 2003. B, R: Ri-chard Dindo. K: Peter Indergand. T: MartinWitz. S: Rainer M. Trinkler. V: Filmcoopi (Zü-rich). W: Lea Produktion (Zürich).35 mm, Farbe, 86 Minuten, Spanisch.
?AH* :<CJ:?
?1:@* A $%7 (%#3:-1%&%
B9-'33%&
Maestro, ein verschmähter Orchestermusiker,beschwört in einer schrecklichen Sturmnachteine böse Macht herauf. Mit ihrer Hilfe will ereine so schöne Musik kreieren, dass die Weltihr nicht widerstehen kann und damit sein Ge-nie endlich erkennt. Ohne es zu merken, wirder von der ominösen Macht selbst instrumen-talisiert: Diese begehrt nichts weniger als dieHerrschaft über die Welt.
Zusammen mit einer liebesbedürftigenRatte schafft Maestro eine Maschine, eigent-lich eine Art Hochleistungs-Licht-Staubsau-ger, mit der er die Schatten von MusikerInnenstiehlt und sich so sein persönliches Orchesterzusammenstellt. Es sind nämlich die Schatten– oder wie Globi einiges später erklärt, die See-len –, mit deren Hilfe sich Musik machen lässt.Diejenigen, die ihres Schattens beraubt wur-den, sind folglich nicht mehr in der Lage zumusizieren. So auch Benji, ein junger Rockgi-tarrist, dessen Freundin Lucinda ihm unter al-
167
len Umständen helfen will und ihn zur Polizeibringt. Da Benji nach dem Verlust seinesSchattens nicht einmal mehr fähig ist, seinerGitarre hawaiianische Klänge zu entlocken,sondern nur noch schauerliches Geschrumme,wird er von der hawaiibegeisterten Polizeiin-spektorin abgewiesen. Wenigstens begegnenBenji und Lucinda auf dem Polizeiposten demErfindervogel Globi, mit dessen Hilfe sie nunBenjis Schatten zurückerobern wollen.
Als Maestro noch Globis Virtual-Reali-ty-Ei stiehlt, bleibt ihnen nichts anderes übrig,als dem Bösewicht in Begleitung seines Robo-ter-Eis Squidney in sein unterirdischesOpernhaus zu folgen. Weil Globi sich demWillen des Maestros nicht beugt, befreit er alleanderen MusikerInnenschatten und den Mae-stro aus den Fängen der dunklen Macht. Mae-stro wird von Lucinda und Benji kurzerhandin ihre Band aufgenommen, und auch die Poli-zeipräsidentin bleibt nicht alleine: Sie findet inder Ratte endlich einen Partner für ihreTraumreise nach Hawaii.
Die MacherInnen des ersten Globifilmswollen viel: Wie es sich im Schweizer Filmheute vielerorts zeigt (z. B. in Achtung, fertig,Charlie!), wird auch hier ambitiös versucht,eine Verbindung zwischen Eigentümlichemund Globalem zu schaffen. Die seit siebzigJahren bekannte und beliebte Figur Globitrifft auf Virtual Reality, Manga-Ästhetikund High-Concept-Marketing. Leiderscheint der Film mehr Wert auf Globi-Attri-bute als auf die Figur selbst zu legen: So wirdder Film vor allem von seinem Soundtrack ge-tragen, der, obwohl er zweifelsohne gut ist,weite Strecken des Films – wollte man es böseformulieren – geradezu zukleistert. Auchwenn der moderne Look des Films zum Teilsehr ansprechend ausgefallen ist und die ver-schärfte Funktion der Musik mit dem Argu-ment, bei Globi – der gestohlene Schattenhandle es sich eben um einen Film über Musi-kerInnen und Musik, teilweise legitimiertwerden kann, bleibt einiges, das es hier zu-sammenzuhalten gibt: Es treffen der traditio-nelle Zeichenstil der Globibände auf manga-ähnliche Figuren, die lustigen Gehilfen undGeräte Globis auf das düstere Schattenreichdes Maestros, globitypische, witzige Dialogeauf eine irrwitzige Story, deren Ausgangwohl nicht nur die erwachsenen Zuschaue-rInnen nicht befriedigen wird.
Der streckenweise an ein animiertes Mu-sikvideo erinnernde Film wirkt dann am stärks-ten, wenn der Globi-Sprecher Walter AndreasMüller die Figur durch amüsante Globi-Phra-sen zum Leben erweckt oder wenn die Ratte,gesprochen von der Musikerin Medea Nadjavon Ah, mit ihren Intermezzi etwas Schwung indie Sache bringt. Auch finden sich im Film im-mer wieder witzige Details, die zum Schmun-zeln anregen, etwa wenn in Maestros düsteremOrchester u. a. Hendrix, Joplin und Parker aufdie Opernsängerin Pavalotti treffen. (ld)
P: Fama Film (Zürich), Motion Works (Halle),Iris Productions (Luxemburg), Impuls HomeEntertainement (Cham), SF DRS 2003. B: Pe-ter Lawrence, Angela Stascheid. R: Robi Eng-ler. K: Peter Weller. T: Ronny Schreinzler. S:Susan Born. Aus: Takashi Masunaga. M:Medea Nadja von Ah, Lunik, Boris Blank,Roman Glaser, Michael Wernli. D: Jaël,Wanda Vyslovzilova, Walter Andreas Müller,Medea Nadja von Ah, Phillippe Roussel,Birgit Steinegger. V: Fama Film (Zürich). W:Iris Productions (Luxemburg).35 mm, Farbe, 72 Minuten, Schweizerdeutsch.
B*!: :.@GB;<<
!9-3"&(; 8%73*(; C-'71*%D
Achtung, fertig, Charlie! ist der erste schweizeri-sche Versuch einer Teenager-Rezept-Komödie,die den Spagat zwischen helvetischer Eigentüm-lichkeit und amerikanischen Vorbildern dieserArt – wie etwa American Pie – probt.
Antonio Carrera wird just an jenem Tag,der gemeinhin als der schönste Tag im Leben
168
eines Liebenden bezeichnet wird – seinemHochzeitstag –, quasi vom Traualtar wegzwangsrekrutiert: Antonio hat es dummer-weise versäumt, seinem Marschbefehl Folgezu leisten. Nun wird er vor versammelterHochzeitsgesellschaft seiner Braut Laura ent-rissen und landet auf dem Kasernenareal, woihn eine bunt gemischte Füsilierkompanie undder leicht sadistische Korporal Weiss erwar-ten. Da weder Diskussionen noch Verweige-rung und Ungehorsam dazu führen, dass Car-rera zurück zu seiner Braut gelassen wird,greift er zu Plan B. Plan B, wie Bluntschi, be-ruht auf der Erkenntnis, dass erstens RekrutinMichelle Bluntschi die uneheliche Tochter desHauptmanns Reiker ist und zweitens Sex inder Kaserne strengstens verboten ist, worausCarrera mit Hilfe von Rekrut Weber zu fol-gern vermag, dass in der Kombination beiderElemente des Problems Lösung liegt. Carrerabraucht also bloss Bluntschi zu verführen, umaus der RS zu fliegen. So irrwitzig der Plan, sovorhersehbar seine Folgen: Bluntschi undCarrera werden nicht nur zu Sexualpartnern,sondern zu einem Liebespaar. Der Umstand,dass Vater Moretti sein Textilfabrik-Imperi-um mit Hilfe der Mafia aufgebaut hat, verleihtdem Liebeskummer der verlassenen Lauraeine zusätzliche Brisanz: Sie scheut keine Mit-tel, um sich an Antonio zu rächen.
Bevor Achtung, fertig, Charlie! in denSchweizer Kinos anlaufen konnte, wurden be-reits hitzige Debatten über Sinn und Unsinndieses Projekts geführt. Das i-Tüpfelchen die-ses Diskurses war dann die offizielle Distan-zierung des VBS, des Bundesamtes für Vertei-digung und Sport, vom Film. Aufgrund einigerexpliziter Szenen sowie der allgemeinen Ver-ulkung des Schweizer Militärs wollte das VBSdie dem Film einst bewilligte Unterstützungentsagen. Für diejenigen, die sich den Film an-sehen, mutet es ziemlich seltsam an, dass erAnstoss derartigen Ärgernisses werden konn-te. Achtung, fertig, Charlie! macht sich zwarlustig übers Militär, ist in seiner Botschaft aberüberaus militärfreundlich. Am Schluss desFilms siegt nicht nur die Liebe, sondern es tri-umphieren die Füsiliere über die Grenadiere,Teamgeist über Individualität und Kiffertum.Das Ende ist mit so vielen Paaren gespickt,dass man sich glatt ins Molière’sche Theaterzurückversetzt wähnt, sogar geheiratet wirddann doch noch.
Nach Exklusiv stellt die Luzerner Pro-duktionsfirma Zodiac Pictures mit Achtung,fertig, Charlie! ein weiteres handwerklich soli-des, publikumsorientiertes Projekt auf die Bei-ne, dem es weder an einem vermarktbarenSoundtrack noch an prominenten Hauptdar-stellerInnen fehlt. Filme wie Achtung, fertig,Charlie! sind durchaus einige Experimentewert, schade nur, dass die Hauptrolle mit ei-nem derartig begrenzten Schauspieltalent be-setzt wurde. Vielleicht hätten auch die Herrenvom VBS mehr gelacht, wenn Michael Koch esfertig gebracht hätte, während des ganzenFilms mehr als drei verschiedene Gesichtsaus-drücke zu Gute zu geben. Ebenfalls eher selt-sam ist die Performance von Mike Müller, demman den Mafioso genauso wenig abnimmt wieAegerter und Koch die Seconda resp. den Se-condo. Eine eher angenehme Überraschunghingegen bietet die ehemalige Miss SchweizMelanie Winiger. (ld)
P: Lukas Hobi, Zodiac Pictures (Luzern) 2003.B: Michael Sauter, David Keller. R: MikeEschmann. K: Roli Schmid. T: Hugo Poletti. S:Michael Schaerer. M: Manuel Stagars, Gott-hard, Core22, Lovebugs, Mia Aegerter. D: Mi-chael Koch, Melanie Winiger, Marco Rima,Mia Aegerter, Martin Rapold, Mike Müller. V:Buena Vista International (Schweiz). W: Tele-pool (Zürich).35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.
*.;H:JJ: >;K:L
/%# 2:13*(%"7#
Es sei eine Mühsal mit den Trickfilmen, sagtIsabelle Favez in einem Interview auf derHGKZ-DVD Jubläum – Jubilee. Der Staub,der immer wieder Platz zwischen Folie undGlas findet, die ewige Zeichnerei: Bis wenigeKader aufgenommen werden können, vergehteine Ewigkeit. Anderseits müsse sie nicht ban-gen, dass Schauspieler nicht kommen, und mitderen Marotten muss sich Favez auch nicht ab-finden. Diese zeichnet sie ihren Figuren ein.Ein bisschen spinnen sie schon, die Vögel aufden Telefonleitungen, die Trapezkünstlereben. Der Film beginnt mit dem Blick aus derUnschärfe auf das drohende Unheil: die Katze,
169
die tagein, tagaus dem Gezwitscher lauschenund auf ihre Beute warten wird. Über ihr fei-ern die Vögel Hochzeit, und auf das frisch ver-mählte Paar regnet es Raupen. Die grösste bil-det die Hochzeitstorte, welche die Liebendennoch genüsslich picken. Doch ihre Sicht aufRaupen als blosse Kalorienlieferanten ändertsich, als der Storch ihr Liebesnest überfliegt,ohne ein Ei abzusetzen. In eben diesem Nestfindet das Paar als Kuckucksei eine Raupe, diees flugs adoptiert. Auch wenn die Gemeindesich von den Raupeneltern abwendet und derStorch schliesslich doch seine Rollerbladesbremst und ein Ei offeriert: Das Findelkindwird zum Wunschkind und von den Vogelel-tern gegen alle verteidigt. Dennoch schnapptsich einer die Raupe. Als die Vögel beginnenmit ihr «Fangen» zu spielen, kommt auch dieKatze endlich zum lang ersehnten Mahl. Alsdie mittlerweile fette Raupe einem neuen Paar
als Torte dienen soll, entpuppt sie sich alsSchmetterling und entschwebt.
In satten Farben und präzisen Strichenzeichnet Isabelle Favez eine tierisch menschli-che Geschichte vom Fressen und Gefressen-werden, dem Ausbrechen aus diesem Zyklusund dessen Konsequenzen. Die Unverhofft-heit und Schönheit des Schmetterlings recht-fertigen den Einsatz des aussergewöhnlichenPaars für die Raupe, die ihnen normalerweiseals Nahrung dienen würde, auch wenn sie amSchluss selbst dran glauben müssen. Die Naturkann grausam sein, aber auch überraschend.Dass Les voltigeurs ein leichter Film ist, ver-dankt er neben seiner Farbenpracht und dentypisierten Figuren der französischen BandBratsch: Mit den präzisen Geräuschen von Pe-ter Bräker versteht sie es, die Stimmungen zuverstärken und den Tieren Stimmen zu verlei-hen. Die Vogelgemeinde motzt dissonant überihre zwei abweichenden Mitglieder, und auch
wenn tragische Stellen durch langsame, melan-cholische Klarinettenklänge betont werden,findet die Musik am Schluss wieder zu einemgewissen Tempo und zu der Leichtigkeit, dieletzten Endes und trotz aller (Natur-)Widrig-keiten in Les voltigeurs auch ein Vogellebenauszumachen scheint. (fg)
P: Swiss Effects (Zürich) 2002. R, B, Animati-on: Isabelle Favez. M: Bratsch. T: Peter Brä-ker. V: Swiss Effects (Zürich). W: Swiss ShortFilm Agency (Lausanne).35 mm, Farbe, 6 Minuten, ohne Dialog.
!"#$ %&$'(')
!"#$%&$'
Eines Morgens im November findet MarianneBrunner ihre elfjährige Tochter Yvonne erfro-ren im Pool ihres Gartens, ausgerechnet diesenhatte das Mädchen sich sehnlichst gewünscht.In einer Rückblende erzählt Luki Frieden, wiees zu diesem tragischen Ereignis kommenkonnte.
Die Familie Brunner ist eine typischeSchweizer Familie. Sie lebt in einem Einfami-lienhaus einer ruhigen Wohnsiedlung inThun. Der Vater Paul ist Angestellter einergrossen Versicherungsgesellschaft, die Mut-ter Marianne Hausfrau. Der Alltag der Fami-lie scheint ruhig und geordnet. Mit der Zeitwird deutlich, dass sich die Eltern nach undnach voneinander entfernt haben und je län-ger, je mehr auch die Träume ihrer Tochternicht mehr verstehen. Hinter der scheinbarruhigen, geordneten Fassade zeichnen sichKonflikte ab.
Als Marianne über zwei Millionen Fran-ken im Lotto gewinnt, gerät die Familie ausden Fugen. Paul kommt mit der neuen finan-ziellen Selbstbestimmung seiner Frau nurschwer klar. Als er schliesslich noch seinenArbeitsplatz verliert, gerät er in eine Sinnkri-se. Marianne verführt Andy, den Nachbars-sohn im Teenager-Alter, und plant mit ihrerbesten Freundin Simone eine Reise nach Ar-gentinien. Yvonne, deren grösster Traum eineReise nach Los Angeles ist, da dort ihre Brief-freundin Jennifer wohnt, findet Zufluchtbeim jungen Nachbarn, den alle nur Iceman
170
nennen. Er teilt ihre Sehnsucht nach der Reisein die USA.
Der Film erzählt langsam, arbeitet mit ru-higen Bildern und langen Einstellungen. Da-durch erhält er eine gewisse Langatmigkeit, diees einem manchmal schwer macht, in der Ge-schichte zu bleiben. Gewisse Charaktere er-scheinen ein wenig oberflächlich. Novemberstreift viele Themen, ohne eines wirklich zuvertiefen. Die einsetzende Pubertät von Yvon-ne, ihr Interesse an allem Amerikanischen,stösst vor allem beim Vater auf Unverständnisund Desinteresse, es kommt zu Auseinander-setzungen mit der Tochter. Gleichzeitig ver-sinken die Eltern immer mehr in Gleichgültig-keit. Sexualität wird zum Problem, einesNachts vergreift Paul sich an seiner Frau, ge-nau genommen vergewaltigt er sie. Doch dieFamilie verharrt in ihrer Sprachlosigkeit. AuchIceman scheint nicht glücklich zu sein mit sei-nem Leben. Er wohnt in einer Art Garage, inder sich die Jugendlichen aus der Nachbar-schaft treffen, kiffen und über ihre familiärenProbleme sprechen.
Allen Figuren gemeinsam ist die Sehn-sucht nach einem anderen Leben, sie sind je-doch zu sehr in den Alltag eingebunden, alsdass ihnen ein Wechsel gelingen könnte. Ein-zig Iceman erfüllt sich seinen Traum. Er wirddie Reise nach New York antreten, zu einemFreund, den er seit vielen Jahren nicht mehrgesehen hat. In der letzten Nacht vor seinerAbreise feiern die Freunde Abschied, es isteine kalte Nacht, der erste Schnee fällt, amnächsten Morgen wird Yvonne erfroren imPool liegen.
(em)
P: CARAC Film AG (Bern) 2003. B: LukiFrieden, James Nathan, Jasmine Hoch. R:Luki Frieden. K: Frank Blau. T: KurtEggmann. S: Christof Schertenleib. M: Retovon Siebenthal, Ray Wilko, Reto Burrell, Dra-ven. D: Muriel Rieben, Charlotte Heinimann,Max Rüdlinger, Lilian Naef, Oscar Bingisser,Elias Arens, Martin Rapold, Nina Iseli. V, W:CARAC Film AG (Bern).35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch(deutsche, französische Untertitel).
C:A?C:. C;@GAE
)'73-' !7(%7*9- A
C:&2%7#'3*:& &:93"7&%
Martha Argerich ist Pianistin mit Haut und Haa-ren. Die Argentinierin, die 1965 in Warschauden «Chopin Concours» gewann und so einebeeindruckende Weltkarriere startete, unterhältsich nachts in einer Hotellobby mit RegisseurGeorges Gachot. Die hochbegabte und interna-tional geachtete Künstlerin gilt als impulsiv,schwierig im Umgang und exzentrisch – dem inZürich lebenden Filmmacher jedoch hat sie ver-traut und eine filmische Begegnung zugelassen.
Durch die einstündige Dokumentationführt das Interview beziehungsweise derdurch wenige Fragen unterbrochene Mono-log. Argerich erzählt aus ihrer Kindheit, sprichtüber ihren Lehrer, den Wiener Friedrich Gul-da, dem sie mit 13 Jahren nach Europa folgte.Er habe den grössten Einfluss auf ihre Personausgeübt, stellt die Künstlerin rückblickendfest; ihre Faszination für den Österreicher istnach wie vor ungebrochen. Ihm habe sie auchdie Entdeckung des musikalischen Humors zuverdanken: Gulda habe nämlich dieses in derklassischen Musik allzu oft vernachlässigteElement, das in zahlreichen Kompositionenunentdeckt schlummert, zu wecken gewusst.
Konsequent aber weigert sich Martha Ar-gerich, über Privates zu reden. Es sei grässlich,bemerkt sie am Anfang des «Nachtgesprächs»über eine «Big Brother»-Sendung am TV, wieman erpicht sei, das eigene Privatleben in allerÖffentlichkeit einfach so auszubreiten. Daraufverzichte sie gerne.
Dennoch mangelt es dem Dokumentar-film keineswegs an Intimität. Die reduziertenfilmischen Mittel verleihen den Aufnahmengar einen unmittelbaren, persönlichen Zu-gang. In Gedanken bei «ihren» Komponistenredet die Pianistin wie über echte Beziehun-gen. Es geht um Liebe, Sympathie, gar Eifer-sucht. Beethoven, Chopin, Debussy, Ravelund Bach stehen ihr emotional sehr nahe. Alsseien sie Freunde, ja gar Liebhaber, spricht dieKünstlerin über ihre Temperamente, über ih-ren Geschmack. Prokofjew zum Beispiel mei-ne es gut mit ihr, er habe ihr auch nie einenStreich gespielt. Mit Schumann aber, habe siedas Gefühl, verbinde sie noch mehr – Argerichdenkt laut über Seelenverwandtschaft nach.
171
Die Kamera begleitet die Pianistin zuhau-se beim Proben, im Konzertsaal und in derTonhalle Zürich. Konzertmitschnitte sowieTonaufnahmen aus dem Archiv ergänzen undvervollständigen das Porträt der Künstlerin,das behutsam ihr sprunghaftes und spontanesErzählen gliedert. Ausgezeichnet geschnittenund stimmig aufgebaut, eröffnet der Doku-mentarfilm nicht nur die künstlerischen Di-mensionen der Martha Argerich, sondern ver-mag es, sich der geheimnisvollen Künstlerinauch persönlich zu nähern.
Martha Argerich – Conversation nocturnegehen Porträts über die Komponisten RodionShchedrin, Claude Debussy oder die Mezzosop-ranistin Grace Bumbry voraus. Georges Ga-chots Filmschaffen hat sich seiner Leidenschaft,der klassischen Musik, verschrieben. Mit grosserAffinität gelingt es ihm, klassische Musik unddie MusikerInnen, die sich dieser Musik ver-pflichtet haben, in Bilder zu übersetzen. (fl)
P: George Gachot (Zürich), Idéale Audience(Paris), Arte France, BR 2002. B, R: GeorgeGachot. K: Matthias Kälin, Milivoj Ivkovic. T:Toine Mertens, Alfred Benz, Martin Hertel,Dieter Meyer, Luc Yersin. S: Ruth Schläpfer.V: George Gachot (Zürich). W: Idéale Au-dience International (Paris).Digital-Beta-Video, Farbe, 57 Minuten, Fran-zösisch, Englisch, Deutsch (französische,deutsche Untertitel).
JD!: C;..:?
E7%+$# /'&$
Eine «Innerschweizer Saga» nennt Luke Gas-ser Fremds Land – ein Historiendrama wie be-reits sein Debütfilm Baschis Vergeltung(2000). Der Regisseur – der auch für Dreh-
buch, Musik und Koproduktion zuständigwar und selbst die Hauptrolle spielt – arbeitetemit derselben Crew, vor allem denselben«Charaktergrind», die schon in seinem Erst-ling für authentisches Kolorit sorgten.
Fremds Land beginnt mit einer dünnenRahmengeschichte, in der eine junge Frau aufein Bündel Briefe und die Bleistiftskizze einesTrappers stösst und damit eine Reise in dieVergangenheit initiiert. Die Lektüre der Brief-schaft lässt die illustre Geschichte des Inner-schweizer Knechts David (Luke Gasser) le-bendig werden. Dieser wird um 1810 für dieTruppen Napoleons zwangsrekrutiert und de-sertiert während des Russlandfeldzugs. Zu-rück in seiner Heimat, findet er seine Liebsteanderweitig liiert, und im Dorf etablieren sichnach dem frischen Wind der FranzösischenRevolution wieder die alten Machtverhältnis-se: Knecht soll Knecht bleiben, wettert derPfarrer von der Kanzel. David wird bei derWilderei ertappt und erschiesst einen Wider-sacher. Damit ist definitiv der Zeitpunkt fürdie Auswanderung gekommen, mit der erschon seit geraumer Zeit liebäugelt. In Ameri-ka wird er zum freien Mann und zum Trapper– nicht ohne sich hie und da mit Wehmut derHeimat zu erinnern.
Mit viel sozialhistorischer Kenntnis hatGasser in dieser fiktionalen Biografie ver-sucht, zwei grossen Ereignissen der SchweizerGeschichte – Beresina und der Emigrations-welle nach Amerika – ein Gesicht zu geben.Nur: Hierzulande müssen solche aufwändigenZeitreisen immer etwas einfacher gestricktwerden – was bei Gassers Lowbudget-Pro-duktion leider nur allzu häufig sichtbar wird.Da stapfen zwei Bilderbuchsöldner durch dieverschneiten Innerschweizer Wälder und tunso, als wären sie in der russischen Steppe. Dawird mit viel pyrotechnischem Aufwand eineSchlacht inszeniert, die im Effekt verhallt. Dawird viel theatralisch erzählt und wenig At-mosphärisches geschaffen.
Sicher spürt man in jedem Pixel des aufVideo gedrehten und auf 35 mm gefaztenFilms den Enthusiasmus der Mitwirkenden,und sicher gibt es auch Gelungenes – verein-zelte darstellerische Leistungen oder mitunterdas Zusammenfügen von Bild und Musik.Doch zu oft – vor allem wenn die Landschaftins Spiel kommt – agieren die Figuren wie voreiner grossen, spannungslosen Kulisse. Die
172
heimatliche Natur und Bergwelt verweigertden erhofften symbolischen Mehrwert. Daranändert auch der Setting-Wechsel nach Ameri-ka nichts: Trapper David steht ebenso verlorenin der legendären Wildwest-Einöde wie dieVorzeige-Indianer, die seinen Weg kreuzen.Überhaupt wirkt die amerikanische Episodewie ein blasser, zu lang geratener Epilog nachdem Action-reichen, mit Flashbacks unterleg-ten und verschachtelten Hauptteil des Films.So bleibts beim (wenn auch ehrenvollen) Ver-such, dem grossen Gestus des Historienfilmsmit kleinen Mitteln auf den Leib zu rücken.
(ds)
P: Filmwerk.ch (Glattbrugg), Silvertrain(Kögiswil) 2002. B, R: Luke Gasser. K: RogerBrülisauer. T: Tino Erni, Sascha Klement. S:Reinhart Steiner. M: Luke Gasser. Kostüme:Antonia Zumstein, Denver Rohner. D: LukeGasser, Bruno Gasser, Karisa Meyer, GingerWagner. V: Frenetic (Zürich). W: Filmwerk.ch(Glattbrugg), Silvertrain (Kögiswil).Video/35 mm, Farbe, 108 Minuten, Schwei-zerdeutsch, Französisch, Englisch.
>?:I:?*@ CA<.:EG
)*##*:& %& %&8%7
1942 machte sich ein Sonderzug mit 250Schweizer Ärzten, Krankenschwestern undRettungshelfern auf den Weg an die Ostfront.Die sich freiwillig Gemeldeten glaubten, aneiner rein humanitären Aktion des RotenKreuzes teilzunehmen. In Russland ange-kommen, mussten sie realisieren, dass ihreMission in Wahrheit eine diplomatische Ge-ste gegenüber dem Naziregime war. Obwohlihnen in der Schweiz versichert worden war,es gelte PatientInnen aus beiden Lagern, so-wohl Russen als auch Deutsche, zu behan-deln, durften sie sich, an der Front angekom-men, nur um die Deutschen kümmern. Be-folgten sie diese Anweisungen nicht, wurdensie gemassregelt.
Frédéric Gonseth besuchte die Überle-benden dieser Mission und befragte sie zu ih-ren Erlebnissen an der Front. Erstaunlicher-weise haben fast alle der Befragten ihre Erfah-rungen genaustens dokumentiert. Die meis-
ten führten Tagebuch, einige brachten sogarFotos und Filmaufnahmen heim. Zusammen-gesetzt aus Talking-Head-Aufnahmen ausden Interviews und Archivmaterial, führtGonseths Film zurück in ein dunkles Kapitelder europäischen Geschichte und offenbartdamit die schier unglaublichen Grausamkei-ten dieses Krieges. Auch wenn die gezeigten
Bilder die erzählten Erfahrungen der Medizi-nerInnen widerspiegeln – die Ärzte berich-ten, wie sie tagein, tagaus aufgrund der be-grenzten Zeit und Mittel oft nur Beine ampu-tieren mussten –, muten sie zum Teil etwasgar reisserisch an, wenn z. B. durch einen mu-sikalischen Spannungsbogen dann tatsächlicheine Beinamputation eingeführt wird und dieZuschauerInnen die ganze Prozedur mitanse-hen müssen.
Einige der Befragten berichten von Kon-zentrations- und Gefangenenlagern; ihre Er-zählungen über das Gesehene sind nur schwerzu ertragen. Eindrücklich ist, wie viele der Be-fragten bis zu den Dreharbeiten mit nieman-dem über ihre Erlebnisse gesprochen hatten –beim Interview mit Gonseth sprudelt es nurnoch so aus ihnen heraus, als müssten sie sichdiese Last endlich von der Seele reden.
Sowohl Erzählungen als auch Bilder vonder Front hinterlassen einen grossen Ein-druck, es sind aber jene Szenen, in denen einigevon ihrer Rückkehr in die Schweiz erzählen,und was ihnen hier widerfahren ist, welchehaften bleiben: wie jener Arzt, dem die Lizenzentzogen wurde, weil er nicht aufhören wollte,die Schweizer Bevölkerung mit Diavorträgenüber die Konzentrationslager zu informieren.Diejenigen, die sich an die Schweizer Regie-rung wandten, wurden trotz Fotos und genau-esten Dokumentationen mit dem Kommentar
173
abgespiesen, diese Geschichten seien nichtglaubwürdig.
Vor Wut und Entsetzen kommen einemWaadtländer Arzt noch heute die Tränen, wenner von dem zu Ehren ihrer Rückkehr veranstal-teten Bankett spricht, an dem jeder/jede nebeneiner prominenten politischen Persönlichkeitsitzen durfte: Sein Banknachbar wusste ihmnichts Besseres zu erzählen, als wie schrecklichdie Butterknappheit in Bern doch sei.
Mission en enfer ist eine äusserst sehens-werte, zugleich packende als auch erschüttern-de Dokumentation über die Widersprüche derSchweizer Politik im Zweiten Weltkrieg. (ld)
P: Frédéric Gonseth Productions (Lausanne),TSR, Almaz Film Productions (Lausanne)2003. B, R, K, S: Frédéric Gonseth. T: Catheri-ne Azad. M: Michel Hostettler. V: Filmcoopi(Zürich). W: 10 Francs (Paris).35 mm, Farbe, 120 Minuten, Französisch,Deutsch, Russisch, Polnisch (französischeUntertitel).
B;EEG*;. KA< CD<E:<
F*% GH(#3%& "&$ ,%#3%& *+
/'&$%
Das Schwingen – gemeinhin «Hosenlupf» ge-nannt – stellt wohl das urschweizerischsteKampfritual dar. Seine Tradition lässt sich bisins 13. Jahrhundert zurückverfolgen – und bisheute hat es sich eine Art Urtümlichkeit zu be-wahren vermocht. Dazu gehören die zwilche-nen Schwinghosen, die Munis und Lorbeer-kränze für die Sieger oder das Verbot vonWerbung per Reglement – sei es auf dem Wett-kampfareal, sei es auf der Bekleidung. Erkorenwerden «die Wägsten» (die, die was Rechtesauf die «Waage» bringen; durchaus auch imübertragenen Sinn) und die «Besten» im Rah-men von Schwingfesten, die noch heute teil-weise auf idyllischen Alpweiden durchgeführtwerden. Sieger ist, wer dem Gegner die beidenSchulterblätter ins Sägemehl drückt.
Der Dokumentarfilmer Matthias vonGunten wendet sich nach seinen Erkundungendes Ursprungs des Menschen (Ein Zufall imParadies, 1999) und des Universums (BigBang, 1993) (wieder) den ureigenen Sitten und
Bräuchen zu. Er tut dies am Beispiel von zweiSchwingern – dem 26-jährigen MuotathalerHeinz Suter und dem 28-jährigen AppenzellerThomas Sutter –, die sich beide auf das Eidge-nössische Schwingerfest 2001 in Nyon vorbe-reiten. Thomas ist amtierender Schwingerkö-nig; Heinz fehlt einzig noch «das Eidgenössi-sche» in seinem Palmarès.
Der Film begleitet die beiden Protagonis-ten bei ihren Wettkampfvorbereitungen undan Schwingfesten und setzt die währschaftenMannsbilder immer wieder in extremenGrossaufnahmen ins Bild. Angehörige, Trai-ner und Therapeutin geben Auskunft über ihreSchützlinge. Wir lernen Griffe kennen und dasschnörkellose Kampfritual, das aus Begrüs-sung, dem Griff an die Schwinghose und ei-nem meist blitzschnellen und entscheidendenLupf besteht. Als schöne Schlussgeste putztder Sieger dem Unterlegenen das Sägemehlvom Rücken.
Von Gunten konstruiert die Erzählsträn-ge in wettkämpferischer Klimax auf das grosseKräftemessen hin. Als Kontrapunkt dazuwirkt einerseits die Musik der Gruppe Stimm-horn, die mit Büchel, Obertonstimme undBandoneon dem Film einen mythisch-urchi-gen, aber auch etwas melancholischen Grund-ton verleiht. Andererseits widerspricht derAusgang des Films dem klassischen Winner-Loser-Modell: Thomas wie Heinz erleidenSportverletzungen, die ihre Leistungenschmerzlich einschränken. Keiner wird denersehnten Titel erlangen, beide müssen mitEnttäuschung und Niederlage fertig werden.
Ohne idyllisierende Verklärung porträ-tiert Die Wägsten und Besten im Lande eineKampfart, die sich wohltuend ferngehalten hatvon den Auswüchsen des heutigen Hochleis-tungssports. Dabei wird weder folklorisierendeStimmigkeit beschworen noch das Auseinan-derklaffen von moderner Schweiz und tradi-tionellem Wettkampf. Die beiden Protagonis-ten zeigt der Film als zwei erstaunlich sanfte,zurückhaltende Persönlichkeiten, zwei mo-derne Athleten, die Sport nicht zuletzt auch alsLebensschule auffassen – nicht mehr und nichtweniger. (ds)
P: MVG Filmproduktion (Zürich), SRG/SSRidée suisse 2003. B, R: Matthias von Gunten.K: Pio Corradi, Stéphane Kuthy, Men Lareida,Matthias von Gunten. T: Jens Rövekamp, Pat-
174
rick Becker, Ruedi Gyger. S: Matthias vonGunten, Myriam Flury. M: Stimmhorn – Bal-thasar Streiff, Christian Zehnder. V: Frenetic(Zürich). W: MVG Filmproduktion (Zürich).Video/35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizer-deutsch.
.E:>;< G;D1E
I1*#'@%3- JK@1%7LM:## A
F%+ 6:$ *&# ?%#*9-3 #%-%&
Verneinung, Zorn, Verhandeln, Depressionund schliesslich Akzeptanz: Dies sind die fünfPhasen, die ein Sterbender nach Meinung derberühmten Sterbeforscherin Elisabeth Küb-ler-Ross durchleben muss. Eine Ironie desSchicksals ist es, dass die Schweizer Ärztin, diesich so sehr für die Enttabuisierung von Ster-ben und Tod eingesetzt hat, nun selbst nichtmit dem Leben abschliessen kann. Mittlerwei-le lebt Kübler-Ross zurückgezogen in der
Wüste von Arizona und hat ihre Beerdigungbereits minutiös geplant. Von Steven Spielbergjedenfalls hat sie die Erlaubnis, dass sie von«E.T.»-Luftballons in den Himmel begleitetwerden darf, wo sie hofft, Mahatma Gandhiund C. G. Jung zu treffen.
Der Filmemacher Stefan Haupt hat dieinzwischen 76-jährige Elisabeth Kübler-Rossin ihrer einsamen Klause in der Wüste besucht.Nach mehreren Schlaganfällen ist sie zwarbettlägrig, doch immer noch eine wache,schlagfertige Gesprächspartnerin. Haupts Do-kumentarfilm Elisabeth Kübler-Ross – DemTod ins Gesicht sehen zeichnet feinfühlig dasPorträt der willensstarken Amerikaschweize-rin, die viel in Bewegung setzte und doch nichtganz kritiklos als Heldin gefeiert werden darf.
Ihren widersprüchlichen Werdegang zeigt derFilm in einer üppigen Montage aus persönli-chen Gesprächen, diversen Interviews mitVerwandten, Freunden und Kollegen, Archiv-materialien und privaten Fotos. Kombiniertwird diese Spurensuche mit einer fiktiven Fei-ermahls-Szene, die sowohl Taufe, Hochzeits-fest oder Totenmahl sein könnte.
Der Schweizer Regisseur, der 2002 fürsein Spielfilmdebüt Utopia Blues den Schwei-zer Filmpreis bekommen hat, beschäftigte sichschon in seinem Dokumentarfilm I’m Just aSimple Person mit einer Schweizer Auswande-rin. Nun richtet er die Kamera auf das Lebenvon Elisabeth Kübler-Ross, die 1926 als Dril-lingskind in Zürich geboren wurde, gegen denWillen ihrer Eltern Medizin studierte und ih-rem Ehemann schliesslich nach Amerikafolgte. In ihrer Arbeit setzte sich Kübler-Rossdafür ein, dass den Todkranken ein Stück ihrerAutonomie zurückgegeben wird. Ihr Buch OnDeath and Dying (Interviews mit Sterbenden)fiel in den späten Sechzigerjahren auf frucht-baren Boden und verschaffte der Autorin einegrosse Anhängerschaft und internationalenRuhm. Die Schattenseite davon war, dass sichihre eigene Familie vernachlässigt fühlte undihre Ehe schliesslich zerbrach. Doch auch mitihrer engagierten Arbeit machte sich ElisabethKübler-Ross nicht nur Freunde. Sie beschäf-tigte sich mehr und mehr auch mit dem Lebennach dem Tod und glitt in die Esoterik ab.
Elisabeth Kübler-Ross’ grosse Verdiens-te zum Umgang mit dem Tabuthema Tod sindjedoch unbestritten, und ihre Thesen zumSterben werden immer noch auf der ganzenWelt zitiert. Stefan Haupts Dokumentarfilmbringt uns die eigenwillige Frau ohne kriti-schen Kommentar näher und klammert dochdie Widersprüche ihres Werks nicht aus. DasThema Sterben geht uns alle an, darum ist auchder grosse Erfolg des Dokumentarfilms keineÜberraschung. Selbst Hollywood soll sichmittlerweile für die Amerikaschweizerin in-teressieren; eine fiktionalisierte Verfilmungihres Lebens ist geplant. (vg)
P: Fontana Film (Zürich) 2003. B, R: StefanHaupt. K: Christian Davi, Jann Erne, PatrickLindenmaier. T: Thomas Thümena, MartinWitz. S: Dieter Lengacher. M: Klaus Wiese Pe-ter Landis. V: Frenetic Films (Zürich). W: FirstHand Films (Zürich).
175
35 mm, s/w und Farbe, 98 Minuten, Schwei-zerdeutsch, Deutsch, Englisch (deutsche Un-tertitel).
.E:K:< G;M:.
)%N%7#
Schon ihr Name drückt schweizerisches Mit-telmass aus: Die Meyers wollen auf keinen Fallauffallen. Das Dekor deutet auf die Fünfziger-jahre hin, das Paar ist in den Sechzigern. JederTag verläuft gleich und vor allem synchron mitden Nachbarn: Ernst Meyer schreitet gleich-zeitig wie all seine Nachbarn vom Reihenein-familienhaus zum Volvo, einer nach dem an-deren schlägt die Autotüre zu und fährt zurArbeit. Während die Männer das Geld verdie-nen, gehen die Frauen ihren Haushaltspflich-ten nach: Eine nach der anderen trottet mitdem Einkaufswagen aus dem Bild. Änderungschleicht sich in das Leben des Paars, als einesTages nur noch Rauschen aus dem Radio zuhören ist: Die einen Augenblick Zeit raubendeIrritation bewirkt, dass Ernst nicht nur zu spätaus der Wohnung tritt – in die nachbarloseLeere –, sondern auch noch ohne Pausenstulle.Plötzlich trinkt er «eifach so» keinen Oran-gensaft zum Frühstück, was seine Frau ver-dutzt hinnimmt. Als er aber auch noch blau-machen will, um mit den Nachbarn aufs Landzu fahren, erkennt Edna ihren Ernst nicht wie-der. Einige Irritationen später lässt aber auchsie sich ein auf die Spontaneitäten des Lebens,was nicht nur ihrem Sexualleben, sondernauch ihren Lachfalten (und denjenigen desPublikums) gut tut.
In seinem Diplomfilm für den Studienbe-reich Film/Video an der HGKZ entwickeltSteven Hayes ein präzises Timing: Nicht nurstimmt die zum Teil aufwändige Choreogra-fie, auch sind die Lacher gekonnt gesetzt. DerFilm, der Parallelen zu Jacques Tati und seinenGegenüberstellungen von Automatisierungund Menschlichkeit aufweist, besticht ausser-dem durch die stimmige Ausstattung und dieKameraarbeit (der Kameramann Till Brink-mann schloss mit diesem und einem weiterenDiplomfilm ebenfalls sein Studium an derHGKZ ab), die Details ins Zentrum zu rückenweiss. So beginnt der Film mit der Sicht durch
eine Filterkaffeekanne, die − einmal wieder-holt − prägnant den täglichen Trott versinn-bildlicht.
Meyers wurde am Filmfestival von Lo-carno 2003 in der Sektion «Pardi di domani»gezeigt, wo er dem Publikum lautes Gelächterentlockte und den Action Light Award ge-wann. (fg)
P: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-rich (Zürich) 2003. B, R: Steven Hayes. K: TillBrinkmann. M, T: Michele Andina. S: SusannaHübscher, Steven Hayes. Ausstattung: Simo-ne Piller. Kostüme: Maggie Zogg. D: AliceBrüngger, Urs Bihler, Yvonne Kupper, EnzoScanzi. V, W: Hochschule für Gestaltung undKunst Zürich (Zürich).16 mm / 35 mm, Farbe, 12 Minuten, Schwei-zerdeutsch.
EGAB;. G:..
!11%# O*7$ ("3
Anfang der Neunzigerjahre begrüsste der far-benfrohe Slogan «Alles wird gut» die Zugrei-senden in Zürich. Die besetzte KulturfabrikWohlgroth, an deren Fassade die Wörterprangten, wurde längst abgerissen, und derZürcher Kreis 5 hat mit Platzspitz und Letteneine traurige internationale Berühmtheit er-langt. Zwar ist die Drogenproblematik heutenicht mehr ganz so augenfällig, doch gibt esimmer noch genug Junkies und damit Ange-hörige, die sich mit der Suchtproblematik aus-einander setzen müssen, ohne dabei die Hoff-nung zu verlieren. Genau darum geht es imFernsehfilm Alles wird gut von Thomas Hess.
Herbert Müller, Vater der drogensüchti-gen Isabelle, will verzweifelt daran glauben,dass sich alles zum Guten wenden wird. Nacheinem Entzug kommt die 19-Jährige zurücknach Hause, um wieder festen Boden unter dieFüsse zu kriegen. Isabelle interessiert sich al-lerdings wenig für das Elektronikgeschäft ih-res Vaters, wo sie arbeiten soll: Sie will Rock-sängerin werden. Eines Nachts plündert sie dieGeschäftskasse und landet wieder auf der Gasse.
Während sich die Mutter von Sozialar-beitern und einer Selbsthilfegruppe beratenlässt, macht sich der Vater auf, seine Tochter
176
im Zürcher Langstrassenquartier zu suchen.Er ist überzeugt, dass Isabelles Kollege Osmanetwas mit dem Rückfall seiner Tochter zu tunhat. Ein Bekannter vom Kegelverein machtihm den Vorschlag, ein paar rechtsextremeSchläger anzuheuern, um herauszufinden, wosich Isabelle aufhält. Doch diese prügeln Os-man ins Koma, ohne etwas in Erfahrung zubringen. Nun hat Herbert nicht nur die Poli-zei, sondern auch die Schläger am Hals, dievon ihm ein Alibi für die Tatzeit verlangen.
Thomas Hess hat 1999 mit Einladung aufdem Lande seinen Abschlussfilm an derHochschule für Gestaltung und Kunst vorge-legt. Danach wirkte er als Ko-Autor von Si-mon Aebys Das Fähnlein der sieben Aufrech-ten, bevor er mit Alles wird gut seinen erstenSpielfilm realisierte. Er hat sich viel vorge-nommen: Das subtile Drogendrama wandeltsich nämlich in einen veritablen Krimi. Über-zeugend ist die Schilderung von Isabelles El-ternhaus, in dem Vater und Mutter sich ent-fremden angesichts der Frage, was der richtigeUmgang mit der süchtigen Tochter ist. Alleswird gut ist vor allem das Porträt eines ver-zweifelten Vaters, auch dank Herbert Leiser(bekannt aus den Filmen Xavier Kollers), derdiese Rolle mit grosser Intensität spielt. Nebenihm gibt Anne-Marie Kuster die Mutter, unddie Neuentdeckung Türkân Yavas, die geradeihre Schauspielausbildung abgeschlossen hat,spielt die drogensüchtige Tochter. Erwäh-nenswert ist Pierre Mennels raffinierte Kame-raführung: Oft werden die dunklen, schwerenBilder von wenigen Lichtquellen beleuchtet.Der Film endet in einer furiosen Schlussse-quenz, in der Michael Finger, Träger desSchweizer Filmpreises 2002, als bösartig über-drehter Neonazi auf seinem Opfer durch dennasskalten Wald reitet. (vg)
P: Kontraproduktion (Zürich), SF DRS 2003.B, R: Thomas Hess. K: Pierre Mennel. T:Christian Beusch. S: Markus Welter. M: Adri-an Frutiger. D: Herbert Leiser, Türkân Yavas,Anne-Marie Kuster, Roberto Guerra, MichaelFinger, Walter Hess, Siegfried W. Kernen. W:Kontraproduktion (Zürich).Digital-Beta-Video, Farbe, 88 Minuten,Schweizerdeutsch.
.D.;<<; GNH.@G:?
J%*# PH&$1* A Q%* B9-:((*
Ein Remake des tschechischen Kitsch-Klassi-kers Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)hätte es werden sollen. Doch der Diplomfilmder HGKZ-Studentin Susanna Hübschernahm bald andere Wendungen. Schon mit ih-rer Entscheidung, selber die Hauptrolle zuspielen und einen Prinzen zu suchen, stelltedie Filmemacherin die Konventionen des Mär-chens auf den Kopf. Daraus entstand eine Rei-he von verspielten, teils selbstreflexiven Sze-nen, in denen Inszenierung und Autobiografieverschmelzen und die Suche nach dem Heldenfür den Film auch zur Suche nach dem Prinzenfürs Leben wird.
Immer wieder also werden Fiktion undNichtfiktion nebeneinander gestellt oder mit-einander vermischt. Vor theatralischen Mär-chenkulissen nimmt Hübscher Castings mitverschiedenen Kandidaten für die Rolle desPrinzens auf. Bald sitzt sie selber vor denFernsehkameras der Sendung «Swiss Date»des Lokalsenders TeleZüri, wo sie Bewerbereiner ganz anderen Art angeboten bekommt.Vor dem Prager Schloss begegnet sie demHauptdarsteller von Drei Haselnüsse fürAschenbrödel und stellt ihm Fragen überRuhm und Liebe. In Italien besucht sie dieEhefrau eines richtigen Prinzen – Spross derköniglichen Familien Italiens und Jugosla-wiens – und befragt sie über ihr Glück. Eineweitere Frau stellt ihren königlichen Partnervor: den selbst ernannten «Reggae-King» LeeScratch Perry. Über Liebe und Glück disku-tiert sie dann auch mit zwei wichtigen Perso-nen aus ihrem eigenen Leben: einer gutenFreundin und Hübschers eigener Mutter.Zwischendurch werden immer wieder Zitat-ausschnitte aus Drei Haselnüsse für Aschen-brödel eingeflochten. All diese heterogenenElemente werden durch eine raffinierte Kame-ra- und Schnittarbeit zusammengehalten. Inden von Hübschers Filmteam gedrehten Sze-nen wird mit der Bilderbuch-Ästhetik destschechischen Spielfilms gespielt. Jump-Cutsverbinden diverse Orte und Zeiten und tragenzur zauberhaften Erzählstimmung bei.
Statt einer Märchen-Verfilmung liefertHübscher eine vielschichtige und witzige Be-trachtung über den Mythos des Märchenprin-
177
zen und – in erster Linie – über die Frauen, dievon ihm träumen. Sucht Hübscher am Anfangvon Keis Händli – kei Schoggi einen Darstellerfür die Rolle des Prinzen und später einenPartner im richtigen Leben, gelingt es ihrschliesslich, die Frage des Glücks von der Vor-stellung der ewigen Liebe zu trennen. Dass amEnde des Films kein Prinz auf dem weissenPferd auftaucht, sondern die Regisseurinselbstbewusst auf ihrem Schimmel davonrei-tet, ist nur die logische Konsequenz von Hüb-schers Nachforschungen, die trotz aller Ernst-haftigkeit immer eine ironische Distanz zumThema wahren. Denn wie sie bald merkt – undwie es im Titel angekündigt wird –, hält sie ihrGlück in den eigenen Händen. Eine Botschaft,die dank der verspielten Machart des Filmskeineswegs didaktisch, sondern geradezu er-frischend wirkt. (mg)
P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-rich), 2002. B, R: Susanna Hübscher. K: Mi-chael Saxer. T: Matthias Huser. S: Ram Say. M:Ramon Orza. D: Pavel Travnicek, ElisabethHübscher, Adriano Chieffo. V, W: Hochschu-le für Gestaltung und Kunst (Zürich).35 mm, Farbe, 28 Minuten, Schweizerdeutsch,Englisch, Französisch, Italienisch, Tsche-chisch (deutsche Untertitel).
.E:>;< 9OC:?
CN7*11 37*883
Cyrill ist 35, neugierig und weltoffen, manch-mal gestresst, oft strahlend, und Cyrill hat Tri-somie 21, auch Down-Syndrom genannt. Die-se Behinderung wird in den von Cyrill geführ-ten Interviews nicht ausgeschlachtet, sondernerlaubt im Gegenteil subtile Einsichten in diePersönlichkeiten der Befragten. Manchmal be-treten, manchmal übertrieben zuvorkom-
mend, aber erstaunlich oft völlig natürlich ge-hen die Prominenten mit Cyrill um, einem In-terviewer, der kein Blatt vor den Mund nimmtund gerade durch seine fehlende Ehrfurcht er-frischend wirkt. Der Langspielfilm basiert aufvier für SF DRS realisierten Interviews, denender Regisseur Stefan Jäger zwei neue hinzufügthat.
Cyrill trifft die Alte Dame der Schau-spielkunst Anne-Marie Blanc, die ihm von derum einiges ruhigeren Vergangenheit vor-schwärmt. Die Ruhe, die der Einsiedler AbtMartin Werlen im Gespräch ausstrahlt, wirktsich beim Rundgang durch die Bibliothek mitihren Schätzen auch auf Cyrill aus, er scheintweniger quirlig und mehr in sich gewandt.Moritz Leuenberger zeigt ihm das Bundes-haus, doch Cyrill interessiert sich mehr fürden Kopierer als für den damaligen Bundes-präsidenten. Leuenberger wirkt fahrig und im-mer ungeduldiger im Gespräch, als Einzigerder Befragten scheint er im Korsett seiner Rol-le gefangen zu bleiben. Dies macht deutlich,was die Stärke der Treffen zwischen Leuten,die täglich im Scheinwerferlicht stehen, unddem geistig behinderten Cyrill ausmacht: Mitneuen Fragen und einer anderen Sichtweisekonfrontiert, öffnen sich die Schweizer Be-rühmtheiten mehr als sonst, auch wenn Cyrillmit seinen Fragen manchmal aufs Glatteisschlittert. Martin Schenkel freut sich über dieAblenkung während der langen Wartezeitenzwischen seinen Aufnahmen für Lüthi undBlanc, doch die Frage nach seiner Krankheit istihm zu intim. Kurz nach Kinostart von Cyrilltrifft starb der Schauspieler und Sänger viel zujung.
Die grösste Nähe entsteht – so zumindestder Eindruck auf der Leinwand – zwischenCyrill und Reto Pavoni. Der Eishockey-Goa-lie ging mit Cyrill in den Kindergarten, hattedanach aber keinen Kontakt mehr zu ihm.Beim Wiedersehen erinnern sie sich an ge-meinsame Busfahrten, und Pavoni nimmt Cy-rill mit in den ungeliebten Fitnessraum, wosich beide abstrampeln. Im Gespräch stets un-befangen, antwortet Pavoni nicht nur, sonderninteressiert sich seinerseits für Cyrill.
Nachdem das Ausgangsmaterial für dieFernsehfassungen neu gesichtet worden war,wurde der Kinofilm assoziativ geschnitten, wasmanchmal stimmige Übergänge schafft, zumTeil die Interviews aber unnötig unterbricht.
178
Zusammengehalten werden die Teile durchCyrills Reise durch die Schweiz (an der Expotrifft er die Clownin Gardi Hutter), die ihnschliesslich aufs Rütli führt. Doch diese Inter-view-Zusammenstellung zeigt weniger ein Bildder Schweiz als ein allgemeines Bild derMenschheit und Menschlichkeit. Seine Erfah-rung bei der Theatergruppe Hora manifestiertsich in Cyrills Talent, sich zu inszenieren, unddoch bleibt bei ihm immer seine wahre (Frage-)Absicht sichtbar, und er vertuscht oftmals auchnicht Ungeduld und Irritation, was glückli-cherweise nicht aus dem Film geschnitten wur-de. Man wünschte sich öfters solch hartnäckige,solch menschliche Interviewer. (fg)
P: handsUP! (Meggen), SF DRS (Zürich) 2002.R, B, S, K: Stefan Jäger. K: Stefan Runge. T: Pa-vol Jan Jasovsky. M: Angelo Berardi. D: CyrillGehriger, Moritz Leuenberger, Reto Pavoni,Martin Schenkel, Gardi Hutter, Martin Wer-len, Anne-Marie Blanc. V, W: Filmcoopi Zü-rich.Mini-DV/35 mm, Farbe, 84 Minuten, Schwei-zerdeutsch (deutsche Untertitel).
:I*EG 9DI
F*%3%7 M:3-
Der 1998 verstorbene Schweizer KünstlerDieter Roth muss ein unerträglicher Menschgewesen sein. So befahl er seiner isländischenEhefrau Sigridur Björnsdottir als Erstes, sämt-liche Kleider und Bücher wegzuwerfen, dadiese nicht seinem Geschmack entsprachen.Dem künstlerischen Weggefährten Arnulf
Rainer pinkelte er auf den Teppich und zer-schnitt und übermalte ihm die Werke in so ge-nannten Malduellen. Ständig stritt sich derKünstler mit seinen diversen Galeristen. Neu-gierige Journalisten kanzelte er mit den Wor-ten «Hier herrscht Dieter Roth» ab. Die un-zähligen Anekdoten über den egozentrischenMisanthropen garantieren den hohen Unter-haltungswert von Edith Juds Porträtfilm Die-ter Roth.
Im neuen Basler Schaulager gab es imSommer 2003 die erste grosse Retrospektivevon Dieter Roth zu sehen. Auf Initiative derDirektorin Theodora Vischer realisierte EdithJud das Künstlerporträt dazu. Angesichts derMaterialfülle entschied sich die Filmemache-rin, die fürs Fernsehen schon diverse kürzereKünstlerporträts realisiert hat, für einenabendfüllenden Dokumentarfilm. Sie reiste andie verschiedenen Orte, an denen Roth gelebthatte, und befragte Geliebte, Galeristen,Freunde, künstlerische Weggefährten und dieFamilie. Roths Sohn Björn, der auch dessenhinterlassenes Werk weiter betreut, führt da-bei quasi als Leitfigur durch das Leben seinesVaters. Im Zentrum des filmischen Porträtsstehen aber diverse originale Filmaufnahmenvon Freunden und Familie, Aufnahmen vonöffentlichen Auftritten sowie Ausschnitte ausdiversen Kunstvideos.
Gerade beim vielfältigen AktionskünstlerDieter Roth, der sich mit Malerei, Skulpturen,Design, Grafik, Video und Perfomance befass-te, ist es wohl unmöglich, die berühmte Trenn-linie zwischen Werk und Person zu ziehen. Sofliessen im Juds Dokumentarfilm Dieter Rothbiografische und thematische Aspekte zusam-men. Die Filmemacherin hat sich dabei, wie sieselbst sagt, auf die Themen Transformationund Vergänglichkeit konzentriert, die wohlden Kern von Roths Kunst ausmachen. DasEnfant terrible pfiff auf ein bürgerlichesKunstverständnis: Nicht einen ewigen Wertsuchte er in seinen Werken, sondern dieSchönheit des Zerfalls. Der faszinierende Ego-mane liebte es, mit anderen Künstlern zusam-menzuarbeiten und sich durch die gegenseitigeHerausforderung befruchten zu lassen, dochwar er auch ein melancholischer Einzelgänger,der an sich selbst und seinem Alkoholismuszerbrach. Am berührendsten zeigt sich dies inden «Soloalben», in denen sich Roth als alten,einsamen Mann in ganz alltäglichen Szenen
179
selbst filmte. Zu seinem Wiener GaleristenKurt Kalb soll er einmal gesagt haben, dass eram liebsten gar nicht mehr weiterleben möch-te, aber sich jetzt noch eine Zeit lang anschaue,wie das gehe. Nur in Island, wohin er immerwieder zurückkehrte, hat der rastlose Künstlerscheinbar so etwas wie eine Heimat gefunden.In Pio Corradis wunderschönen Bildern vonder kargen isländischen Landschaft vermeintman denn auch die organisch zerfallenen Re-liefs von Roths berühmten Schokoladen- undSchimmelbildern wiederzuentdecken. (vg)
P: Reck Filmproduktion (Zürich) 2003. B, R:Edith Jud. K: Pio Corradi. T: Martin Witz,Olivier JeanRichard. S: Loredana Cristelli. M:Dieter Roth. V: Look Now! (Zürich). W: ReckFilmproduktion GmbH (Zürich).35 mm, Farbe, 118 Minuten, Englisch,Deutsch (deutsche, englische Untertitel).
1*:??: !A?;J<*!
F'# 1%3R3% S%7#3%9Q
Als literarische Vorlage für Pierre KoralniksSpielfilm Das letzte Versteck dient der RomanDie Reise der Schriftstellerin Ida Fink. DenSpielfilm leiten einige dokumentarische Auf-nahmen der in Tel Aviv lebenden Autorin ein.«Das, was ich erzähle, ist ganz, ganz wahr. Na-türlich handelt es sich um eine persönlicheWahrheit, die nur einem selbst gehört», be-richtet Fink über ihre literarisch verarbeiteteGeschichte. Dieser für einen Spielfilm eher un-gewöhnliche Einstieg stellt eine Würdigungder Autorin dar und weist zugleich auf die his-torische Authentizität der Charaktere in Dasletzte Versteck hin.
Eva, die gerne studieren möchte und da-von träumt, Schriftstellerin zu werden, undihre Schwester Irene, die hingegen lieber beimVater bleiben will, um sich zur Ärztin ausbil-den zu lassen, sind 18, beziehungsweise 20 Jah-re alt und plötzlich ganz auf sich alleine ge-stellt. Ihr Vater, ein jüdischer Arzt, schickt sieals Zwangsarbeiterinnen nach Deutschland.Zu diesem Zeitpunkt – im polnischen Zbaraz,im Herbst 1942 – scheint «das letzte Ver-steck», um dem Genozid zu entkommen, die«Höhle des Löwen» zu sein. So irren die zwei
als Katarzyna und Elzbieta und mit gefälsch-ten Dokumenten durch das von Krieg gepräg-te Land in Richtung Deutschland.
Die Reise der beiden Schwestern führt siezunächst in das Arbeitslager einer Maschinen-fabrik im Ruhrgebiet. Die Arbeit ist hart –doch die Schwestern halten zusammen undmimen die frommen polnischen Bauernmäd-chen; die heilige Maria als Anhänger um denHals, falten sie jeden Abend vor dem Einschla-
fen die Hände zum Gebet. Doch das Gerücht,Jüdinnen seien unter den jungen Polinnen ver-steckt, hält hartnäckig an. Eva und Irene müs-sen fliehen. Bei Weinbauern am Rhein findensie Arbeit. Auf dem Gut beschäftigt die Fami-lie auch einen jungen Polen, in den Eva sichverliebt; ihre Liebe wird erwidert. Doch auchdieser Aufenthalt erfährt ein abruptes Ende –ebenso Evas Liebe.
Schliesslich – auf einem Rheindampferkurz vor der Schweizer Grenze – verspottenNationalsozialisten die zwei polnischen Ser-viertöchter als «kulturlos». Eva lässt sich dasnicht gefallen, setzt sich ans Klavier und spieltausgezeichnet – zeitgleich fliegt ein Flugzeugder Alliierten tief über den Dampfer hinwegund beginnt, auf die nationalsozialistische Ta-felgesellschaft zu schiessen. Evas Musik be-gleitet diesen Angriff und kündet wie auch dieSchüsse das Ende ihrer Odyssee an.
Der Film fokussiert besonders auf diepsychologische Belastung eines solch gefährli-chen Versteckspiels. Sich in falsche Identitätenhineinzulügen und in ständiger Angst zu le-ben, treibt die jungen Frauen an den Rand derVerzweiflung. Sie kämpfen gegen Depressio-nen, Angstzustände und Resignation an. Dochimmer wieder fängt sie ihre innige Schwes-ternliebe auf, gibt ihnen Kraft, all das durchzu-stehen.
180
Die Geschichte schreitet mit beachtli-chem Tempo voran – entsprechend müssensich einige NebendarstellerInnen mit teilsfragmentarischen Charakteren zufrieden ge-ben. Die Figuren Eva und Irene hingegen sindäusserst prägnant, gut und bewegend gespielt.Johanna Vokalek spielt ergreifend natürlich,während Agnieska Piwowarska durch eineausdrucksstarke Mimik besticht. Das letzteVersteck überzeugt durch eine sorgfältige undsolide Machart. (fl)
P: Tag/Traum Produktion (Köln), WDR, SFDRS, Arte 2003. B: Christoph Busch. R: PierreKoralnik. K: Grzegorz Kedierski. T: PeterSchumacher. S: Corina Dietz, Matthias Meyer.M: Serge Franklin. A: Alexander Scherer. D:Johanna Vokalek, Agnieska Piwowarska,Cosma Shiva Hagen, Katja Studt. V, W: Tag/Traum Produktion (Köln).35 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch.
1:E:? J*:@GE*
P'&# *+ ?1K9Q A
F7%* S%7#"9-%; $'# M'"9-%&
1:#R"O%7$%&
Peter Liechti ist überzeugt, dass es zwei mögli-che Interpretationen des Grimm’schen Mär-chens Hans im Glück gibt: In der einen ist dergeschäftsuntüchtige Wanderer einfach ein nai-ver Trottel, in der anderen erreicht er eine ArtGlückszustand, in dem es ihm gelingt, allenBallast abzuwerfen. Peter Liechti wollte dasLaster des Rauchens loswerden. Und so zogder Filmemacher dreimal von Zürich gegen St.Gallen, um auf der Wanderschaft die Suchtnach dem Glimmstängel zu bekämpfen: zuFuss und allein, nikotinfrei, mit DV-Kameraund Tagebuch im Reisegepäck. Die Wege vari-ieren, nicht jedoch das Ziel: Liechti wandertjedes Mal in Richtung seiner Heimatstadt St.Gallen; dorthin, wo alles angefangen hat.
Von seinen drei Reisen kehrte er mit 150Stunden Videomaterial und 90 Seiten Tage-buch zurück. In monatelanger Montagearbeitim Schnittraum mit der Cutterin Tania Stöck-lin entstand daraus das bebilderte TagebuchHans im Glück – Drei Versuche das Rauchenloszuwerden. Aus Liechtis einsamen Pilger-
fahrten ist aber kein Anti-Raucher-Film ge-worden, sondern vielmehr ein filmischerEssay über die Gratwanderung zwischenFremdsein und Dazugehören und eine lie-benswürdige Auseinandersetzung mit dem ei-genen gebrochenen Verhältnis zur Heimatre-gion Ostschweiz. Mit vom Entzug geschärftenBlick fängt Liechti erstaunliche Details undKuriositäten des Alltags ein. Er begegnet demKobold von Steinegg mit dessen Sau Mäxli,dem Hobbyfilmer Alois Haas, einem anony-men Laiensänger auf dem Fahrrad, beobachtetFolklorefeste und Höhenfeuer, macht Besu-che bei seinen Eltern, im Altersheim und aufder Krebsstation eines Spitals. Das Wandern,das Liechti auch «Vor-sich-hin-Schweizern»nennt, wird zur Begegnung mit der Heimatund damit auch zur Auseinandersetzung mitsich selbst. Den Stimmungsschwankungen, dieder Rauch-Entzug auslöst, kann er sich trotz-dem nicht entziehen. Mit feiner Ironie be-schreibt Liechti im Tagebuch zum Beispiel sei-ne Wut gegen alle, die behaupten, es sei toll, ei-nen Berg zu besteigen, nur um am nächstenWandertag die Landschaft um ihn herum alsumso lieblicher zu schildern. Nicht zuletzt istaber Hans im Glück auch eine Reflexion überdas Filmemachen selbst, was etwa klar wird,wenn Liechti vor einer Eisenbahnbrücke flu-chend in der Kälte ausharrt, um auf den nächs-ten Zug zu warten. Das unspektakuläre Bildaber, dass er schliesslich schiesst, entsprichtüberhaupt nicht seinen Erwartungen.
Der Schauspieler Hanspeter Müllerspricht die geistreichen, manchmal witzigen,manchmal traurigen, aber immer sehr präzisenpersönlichen Auszüge aus dem Reisetagebuch,die den Bildern unterlegt sind und die PeterLiechti auch als «Hyperventilieren der Gedan-ken» bezeichnet. Der Regisseur, bekannt vorallem durch das Porträt des St. Galler Aktions-künstlers Roman Signer (Signers Koffer, 1995)
181
und den Spielfilm Marthas Garten (1997), istmit dem sehr persönlichen, assoziativen Film-essay ein kühnes Wagnis eingegangen. Mankönnte an dem Film denn auch einiges kritisie-ren, etwa dass die letzte Reise zerfleddert oderdass die eingeflochtenen Bilder aus Namibiawenig Sinn machen, wenn man nicht weiss,dass Liechti zeitgleich am Film Namibia Cros-sing arbeitete. Doch schliesslich sind es Liech-tis ganz persönliche Assoziationen, denen wirzuschauen. Und zwar mit grossem Vergnügen.
(vg)
P: Liechti Filmproduktion (Zürich), SF DRS2003. B, R, K: Peter Liechti. T: Dieter Leng-acher. S: Tania Stöcklin. M: Norbert Moslang.V: Look Now! (Zürich).DV und DVCam, Super 8, 35 mm, Farbe, 90Minuten, Deutsch, Schweizerdeutsch (deut-sche, englische Untertitel).
;<<; JD*>
/*331% ?*71 ,1"%
Little Girl Blue ist in technischer Hinsicht einNovum: Es ist der erste Schweizer Spielfilm,der im High-Definition-Format (HD) gedrehtwurde. Die Realisierung erfolgte in Zusam-menarbeit mit der Hochschule für Gestaltungund Kunst Zürich im Rahmen des interdiszi-plinären Projekts «Digitales Kino». Ziel dieserForschung ist es, die Vorteile des neuen Ver-fahrens zu testen; einerseits ist das Material so-wohl film- als auch fernsehkompatibel, ande-rerseits lassen sich digitale Daten leichter kon-servieren. Visuell fallen eine besonders grosseTiefenschärfe sowie farbintensive, leichtkünstlich wirkende Bilder auf.
Dieser Film übers Erwachsenwerden istAnna Luifs erster Langspielfilm – eine logische
Fortsetzung ihrer bisherigen Arbeit. Bereits inihrem viel beachteten und mehrfach ausge-zeichneten Kurzfilm Summertime (1999) ginges um ein junges Mädchen, das mit der erstenVerliebtheit hadert. Den Schwerpunkt setzt dieRegisseurin jeweils auf die Entwicklung derProtagonistin und ihre Familienverhältnisse.Ebenfalls beiden Filmen eigen sind eine klarstrukturierte Handlung, ein geometrischer Bild-aufbau, eine eher statische Inszenierung sowiedas Setting einer modernen Vorstadtsiedlung.
Da sich beim Filmen in HD harte Kon-traste ergeben – diese führen zur speziellen flä-chigen Ästhetik –, verlangt das Format nacheiner begrenzten Farbwahl. In Little Girl Bluedominieren verschiedene Blautöne, welche dieHauptperson Sandra (Muriel Neukom) cha-rakterisieren: Das Zimmer und die Kleidungdes Teenagers sind knallblau. Das musikali-sche Leitmotiv des Films ist der Song BlueMoon, den Sandra im Vorspann als Playbacksingt: Das «Blue» steht auch für die melancho-lischen Momente, die sie durchlebt.
Die Geschichte handelt von einer schüch-ternen 14-Jährigen, die sich am neuen Wohn-ort behaupten muss. Bevor sie mit Mike (An-dreas Eberle), in den sie verliebt ist, zusam-menkommt, muss Sandra diverse Schwierig-keiten überwinden. Dabei steht dem Mädchensein eigener Vater im Weg: Ausgerechnet mitMikes Mutter hat er eine Affäre. Um ihremSchwarm die Sache zu verheimlichen, ver-strickt sich Sandra immer mehr in Widersprü-che, bis sich Mike enttäuscht von ihr abwen-det. Was die Lage für Sandra nicht gerade er-leichtert, ist die Tussi Nadja (Marina Guerrini,die Hauptdarstellerin von Summertime), dieMike für sich gewinnen will.
Während es für die Jugendlichen einHappyend gibt, bleibt ungewiss, ob die zweierwachsenen Paare wieder zueinander findenwerden. Die Story überzeugt dort, wo dieÄngste, Hoffnungen und Gefühle der Teen-ager im Mittelpunkt stehen: Mit viel Gespürfür die Jugendlichen zeichnet die Filmemache-rin ein realistisches Szenario, das eigene bitter-süsse Erinnerungen weckt. Die Figuren derEltern hingegen wirken holzschnittartig; ihreMotivationen und Emotionen sind oft nichtnachvollziehbar. Die Tatsache, dass viele Sze-nen wunderschön schlicht daherkommen,tröstet jedoch über die eher schwache Charak-terisierung der älteren Generation hinweg.
182
Mutig auch die Wahl der Sprache: Über weiteStrecken hören sich die schweizerdeutschenDialoge durchaus lebensecht an. Little GirlBlue macht Lust auf weitere Filme von AnnaLuif. (sh)
P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-rich) 2003. B: Anna Luif, Micha Lewinsky. R:Anna Luif. K: Eeva Fleig. T: Jens Rövekamp.S: Myrjam Flury. Aus: Georg Bringolf. M:Balz Bachmann. D: Muriel Neukom, AndreasEberle, Marina Guerrini, Bernarda Reich-muth, Sabine Berg, Mark Kuhn, Michel Veïlau. a. V: Filmcoopi (Zürich). W: DschointVentschr Filmproduktion (Zürich).HD, 35 mm, Farbe, 82 Minuten, Schweizer-deutsch (englische, französische Untertitel).
?AJ> JM..M 3+, IAB*<*PD: ?DH
B9-7%*@%& (%(%& $%& 6:$
Ursula Corbin hat eine Organisation ins Le-ben gerufen, welche Brieffreundschaften mitHäftlingen in US-amerikanischen Gefängnis-sen vermittelt. Corbin selbst korrespondiertebisher mit sieben Häftlingen, zwei von ihnenwurden in den letzten Jahren hingerichtet. Wirbegleiten sie während eines Besuches in der te-xanischen Hochsicherheitsanstalt PolunskyUnit in Livingston und verfolgen das Engage-ment einer viel gereisten und lebenserfahrenenGeschäftsfrau und Mutter, die unermüdlichmit Briefen, Besuchen, kleinen Geldbeträgenund Geschenken die Lebensumstände derHäftlinge zu verbessern versucht. Das Augen-merk des Films richtet sich auf den aktuellenBriefwechsel mit Steven Moody, der wegenMordes verurteilt wurde und in Isolationshaftauf seine Hinrichtung wartet.
Zusammen mit Amnesty Internationalsetzte sich Corbin jahrelang vergeblich fürÄnderungen im amerikanischen Strafvollzugein; heute gibt sie sich damit zufrieden, dassdie Betroffenen durch sie etwas Menschlich-keit spüren können. Gleichzeitig ist es ihr einAnliegen, in der Öffentlichkeit den Diskursüber die Problematik der Todesstrafe auf-rechtzuerhalten.
Lyssy und Rub geht es nun nicht darum,den Fall Moody kriminalistisch aufzuarbeiten
oder die – auf zweifelhafte Zeugenaussagenberuhende – Inhaftierung in Frage zu stellen.Stattdessen werden Moodys Lebensumständebeschrieben und an seinem Beispiel Unge-reimtheiten innerhalb des US-Justizsystemssowie die harten Haftbedingungen kritischhinterfragt.
Wenn ein spannender Dokumentarfilmaus Beiträgen von bestenfalls eloquenten Per-sonen besteht, die etwas Relevantes zu einerGeschichte beitragen können, dann liegt dieSchwäche von Schreiben gegen den Tod in derbegrenzten Auswahl der interviewten Perso-nen. Der für das Sendegefäss DOK desSchweizer Fernsehens produzierte Film kon-zentriert sich auf seine Protagonistin, aber vonden Menschen aus ihrem persönlichen Umfelderfahren wir nicht viel mehr, als dass sie Cor-bins Ansichten über die Todesstrafe teilen undihr Engagement unterstützen. An einigen Stel-len fühlt man sich als ZuschauerIn zu einseitigund unpointiert informiert, beispielsweisewährend des Gesprächs mit Moodys Mutter,das hauptsächlich aus Phrasen und Wehklagenüber ihre eigene Gesundheit besteht. Die Auf-nahmen von Corbins alltäglichen Verrichtun-gen erscheinen eher wie Verlegenheitslösungenund sind vielfach von inhaltlich unmotiviertenKamera- und Zoombewegungen geprägt.
Schreiben gegen den Tod löst durchausGedanken aus über die Selbstverständlichkei-ten des eigenen Lebens in der Freiheit, ist aberleider nicht mehr als eine durchschnittlicheTV-Reportage, die zwischen gut gemeintemEngagement und Gemeinplätzen schwankt.
(mh)
P: Rose-Marie Schneider, Doc ProductionsGmbH (Zürich), SF DRS, SRG SSR idée suis-se, Arte 2002. B: Dominique Rub. R: Rolf Lys-sy. K: Elia Lyssy. T: Sandra Blumati. S: RainerM. Trinkler. M: Roland Van Straaten, CurtisLee Ervin. V, W: Doc Productions GmbH(Zürich).Digital-Beta-Video, Farbe, 56 Minuten,Deutsch/ Englisch (deutsche Untertitel).
183
?AH:?EA B;?E*<:L
T#9'7
Die Fussballshorts und das Trikot schlotternum seinen mageren Körper, das Tor und selbstder Ball scheinen riesig, und dennoch ist Oscarder Held auf dem Trainingsplatz des FC Dieti-kon. Trotz den Punkten, die er für seinen Clubholt, bleibt aber die Melancholie in den Augendes Zehnjährigen sichtbar: Schmerzlich ver-misst er denjenigen Zuschauer, der ihm amwichtigsten ist – seinen eigenen Vater. AndereVäter sind zuhauf vorhanden; die einen (italie-nischen) feuern inbrünstig und frenetisch ihrenNachwuchs an und zeigen mehr Elan als Trai-ner und Mannschaft zusammen. Die andern(Schweizer) Väter sitzen lethargisch auf der Zu-schauerbank, sind aber immerhin anwesend.Oscars Papa hingegen erscheint kaum zu seinenSternstunden; wenn, dann nur, um ihm wort-karg nach dem Spiel saubere Wäsche zu brin-gen, und dies selbstverständlich auch nur imAuftrag der Mutter. Die Wunde sitzt tief undbegleitet Oscar durch seine Jugend- und Fuss-ballerzeit. Dabei hat er sonst schon um Aner-kennung zu ringen: Als spanischer Secondo inden frühen Achtzigerjahren, vor den Zeiten desLatino-Schicks, ist das Leben inmitten der vor-wiegend schweizerischen Jugend einer ZürcherVorortsgemeinde nicht gerade rosig.
Jahre später: Oscar, mittlerweile erwach-sen und Vater eines kleinen Fussballers, sitztneben seinem Vater auf der Zuschauertribüneund erinnert sich an seine glorreichen, abertraurigen Stunden auf dem Rasen. Beim Brat-wurstholen verpasst er das Tor seines Sohnesund wird deshalb von seinem Vater zünftig ge-rügt; ausserdem sei Ketchup zur Bratwurst jawohl das Letzte. Unerwarteterweise kommt esdann doch noch zur späten, lakonischen undtröstlichen Versöhnung zwischen Vater, Sohnund der Vergangenheit – bei Bratwurst undFussball, wie es sich für eine rechte Männerge-schichte gehört.
Roberto Martinez, ehemaliger Hobby-fussballspieler und spanischer Secondo ausDietikon, hat mit seinem Diplomfilm an derHGK Zürich ein kleines, feines Glanzstückgeschaffen. Ein nahezu perfektes Timing imBild- und Tonschnitt – Grundvoraussetzungjeder guten Komödie – und knappe, treffendpointierte Dialoge machen aus Oscar eine hu-
morvolle, leichtfüssige und herzliche Betrach-tung eines eigentlich sehr komplexen Themas:dem Hunger nach elterlicher Anerkennung.Spanische Machismo-Klischees werden iro-nisch aufs Korn genommen: Zu den Fussball-szenen in Zeitraffer gesellt sich eine schrum-mende Flamenco-Gitarre, und die Diskussionum Ketchup oder Senf lässt die Männer in ih-rer ganzen Verletzlichkeit erscheinen. DerMoment der Versöhnung ist, wie so oft, einfa-cher und zugleich banaler, als man aufgrundjahrelanger Zweifel meint. (nat)
P: Hochschule für Gestaltung und Kunst undSchweizer Fernsehen DRS (Zürich) 2003. B,R: Roberto Martinez. K: Marcell Erdélyi. T:Fritz Rickenbacher. S: Arne Hector. M: Crim-son Sinclair, Carlos Vega. D: Domenico Peco-raio, Andres Algar, Thaer Al Temimi, NicolaMastroberadino. V, W: Hochschule für Ge-staltung und Kunst (Zürich).35 mm, Farbe, 8 Minuten, Schweizerdeutsch,Spanisch.
:J*.;H:EG BQ?EA<
U9- -*%## B'@*&' B=*%17%*&
Einer der letzten Sätze in Spielreins Tagebuchlautet: «Ich war auch einmal ein Mensch.» Vorallem war sie eine Pionierin: Carl Gustav Jungbehandelte 1904 die 19-Jährige in der KlinikBurghölzli als erste Patientin mit SigmundFreuds Methode der Psychoanalyse. Nach derGenesung von ihrer Hysterie – die Diagnoseist heute zweifelhaft – studierte die jüdischeRussin Medizin in Zürich, wurde eine der ers-ten Psychoanalytikerinnen und wirkte, auchhier Wegbereiterin, als Kinderpsychologin.
184
Spielreins Arbeit «Die Destruktion als Ursa-che des Werdens» nahm Erkenntnisse vorweg,die Freud Jahre später in seiner Schrift «Jen-seits des Lustprinzips» verwendete.
Zwischen der Wissenschafterin undC. G. Jung entstand eine schwierige Liebesbe-ziehung, in deren Verlauf beide in BriefenFreuds Rat suchten. Aus diesem Dreiecksver-hältnis ging Spielrein als Verliererin hervor.Obwohl er anfangs ihre Gefühle erwiderte,wies Jung die junge Frau zurück, weil er einenSkandal fürchtete und seine Ehe nicht gefähr-den wollte. Während Freud durch die Affäredas Phänomen der Gegenübertragung ent-deckte, fand Spielreins Schmerz Ausdruck inihren Überlegungen zum Todestrieb. Ihr wei-teres Leben verlief unruhig: Nach verschiede-nen Stationen kehrte sie, inzwischen verheira-tet und von Krisen geplagt, nach Russland zu-rück, wo sie 1942 mit ihren beiden Töchternvon den Nazis erschossen wurde.
Dank Elisabeth Márton, einer in Schwe-den lebenden Deutschen, gelangt dieses be-merkenswerte Schicksal nun aus der Versen-kung an die Oberfläche. Basierend auf Spiel-reins Tagebüchern und Briefen, die 1977 inGenf auftauchten, skizziert die Filmemacherinden Weg einer Frau zwischen Forschung undFamilie, zwischen Jung und Freud, bei derenZwist sie erfolglos vermittelte. Entstanden istein Dokumentarfilm, der alte Fotos sowieZeitzeugnisse integriert, durch nachgestellteSzenen aber auch Elemente des Spielfilms ent-hält. Per Voice-over werden Passagen aus demQuellenmaterial rezitiert. Diese Collagespricht für sich; sie wird nur mit wenigenKommentaren ergänzt. Die Montage verbin-det die Teile assoziativ – in Anlehnung an psy-choanalytische Aufarbeitung – zu einem at-mosphärischen Ganzen.
Die visuelle Ebene betört mit poetischenSchwarzweissbildern; Eva Österberg als Sabi-na besitzt viel Ausdruckskraft. Die grobkörni-gen, braunstichigen Szenen im Burghölzli wir-ken zwar bedrückend, aber auch klischeehaft:Spielrein zerreisst ein Kissen, starrt mit aufge-rissenen Augen vor sich hin oder irrt durch dieGänge. Die eindrücklichen Bilder setzen wohldie Anfänge der Psychoanalyse in ein neuesLicht, Spielreins Seelenlandschaft allerdingskönnen sie uns nur ansatzweise vermitteln.Márton legt das Schwergewicht auf die Spra-che als Ausdrucksform des Ich, bedient sich
doch auch das Verfahren Talking Cure, einTeil von Spielreins Behandlung, der Sprache,um sich innerer Antriebe bewusst zu werden.
Mit Ich hiess Sabina Spielrein hat die Re-gisseurin, die selbst Psychologie studiert hat,eine Hommage an eine herausragende Persön-lichkeit geschaffen und sie endlich aus der Ver-gessenheit befreit. (sh)
P: Idé-Film Felixson AG (Schweden, Schweiz)2002. B: Elisabeth Márton, Signe Mähler, Yo-lande Knobel. R: Elisabeth Márton. K: RobertNordström, Sergej Jurisdizki. S: YolandeKnobel. M: Vladimir Dikanski. D: Eva Öster-berg, Lasse Almebäck, Mercedez Csampai. V:Look Now.35 mm, Digital-Beta-Video, Farbe, 90 Minu-ten, Deutsch (englische Untertitel).
>?FIF?*@ B:?BADI
/V%#9'1*%7
Rachel ist 15 und verliebt. Das Treppenhauswird für sie zum Ort des Geschehens. Am Tagmuss sie es, als Tochter des Hausmeisterehe-paars, putzen, aber am Abend trifft sie Hervé.Im Treppenhaus erleben sie ihre ersten Küsseund Zärtlichkeiten, manchmal liest er ihr aus
Nietzsches Also sprach Zarathustra vor. Baldaber wird das Treppenhaus für sie zu eng unddie Sehnsucht nach einem ungestörten Ort im-mer grösser; so schlägt Hervé Rachel einesNachts vor, mit ihm für ein Wochenende in dieNormandie auszubrechen. Alles ist organi-siert, und Rachel wartet um vier Uhr morgensim Treppenhaus, wie sie es mit Hervé verein-bart hat, doch er erscheint nicht. Anstatt in derNormandie verbringt sie das Wochenende in
185
der Wohnung der jungen Lehrerin von Hervé,die zufälligerweise im gleichen Wohnblockwie Rachel lebt und die Rachel an jenem Mor-gen weinend im Treppenhaus vorfindet. IhrerFreundin Jess erzählt Rachel die Geschichtevom ersten Mal, so wie sie es sich erträumt hät-te. Auf die Frage, ob sie mir Hervé zusammen-bleiben wird, sagt Rachel: «Non, je préfèregarder le souvenir comme ça, pure.»
Mermoud erzählt die Geschichte von Ra-chel und Hervé mit Sorgfalt. Mit wenigenWorten und Bildern wird so viel gesagt undgezeigt, dass sich das Publikum in die Teen-agerfiguren hineinversetzen kann. Schöne Bil-der tragen zum Charme des Kurzfilms bei. Be-merkenswert ist die Einheit des Ortes, die vonMermoud konsequent eingehalten wird: DasTreppenhaus wird immer wieder von Neuemin einer anderen Kadrage eingefangen. Mer-moud schafft es, diesen Raum lebendig zu ma-chen, ihn mit Geschichten und Erinnerungenzu füllen. Die Not der Teenager, die nur diesengemeinsamen Raum haben, und die darausentstehende Spannung treiben die Geschichtevorwärts, in der sonst nur wenig vor sich geht.Die Reaktionen und Interaktionen der Teen-ager in L’escalier sind gut beobachtet und sub-til umgesetzt. Sowohl kompositorisch als auchschauspielerisch kann L’escalier nur gelobtwerden, allerdings wäre ein bisschen mehrWagnis zu begrüssen. Der Film bleibt trotz-dem eine feine, kleine Geschichte. (ld)
P: FCA Films, (Ventôme) / Tabo Tabo Films(Paris) 2002. B, R: Frédéric Mermoud. K: Tho-mas Hardmeier. T: Julien Sicart, Bruno Rei-land. S: Sarah Anderson. D: Nina Meurisse,Clément Van den Bergh, Stéphanie Sokolinski,Camille Japy. W: Tabo Tabo Films (Paris).35 mm, Farbe, 22 Minuten, Französisch.
!"#$%&' &()$%
!"#$%&'$(
Schenglet ist ein elektronisches Visum-Arm-band, das jeder Einwanderer während seinesAufenthalts in Europa am Handgelenk oderwahlweise auch am Fussgelenk tragen muss.Nach drei Monaten läuft das Visum ab undSchenglet wird, sofern man ein gültiges Rück-
flugticket hat, entfernt. Sollte die Ausreisefristignoriert werden, greift Schenglet selbst zu an-deren Massnahmen. Eine Woche nach Ablaufdes Visums erklingt ein Alarmsignal; wird die-ses ignoriert, injiziert Schenglet Angst auslö-sende Mittel und Penthatol. Sollte trotz der in-jizierten Dosis Widerstand geleistet werden,wird der/die Schenglet-TrägerIn aufgrundthermischen Drucks automatisch mit einerKennnummer versehen, die eine neue Einreisein den Schengen-Raum zu einem späterenZeitpunkt verunmöglicht. Sollte die eingereis-te Person weiterhin Widerstand leisten undgar versuchen Schenglet manuell zu entfernen,muss mit gravierenden physischen Verletzun-gen gerechnet werden, z. B. wird die Hand ab-gehackt.
Verpackt in einem technisch brillantenWerbefilm, unterlegt mit einer gleichermas-sen freundlichen als auch anonymen Voi-ce-over, illustriert Nègre eine Horror-Ein-wanderungspolitik der Zukunft. Nègres Ani-mationsfilm ähnelt in vielerlei Hinsicht denInstruktionsfilmen in Flugzeugen. JeneÄsthetik wird instrumentalisiert, um die Ge-fahr einer fortschreitenden Überwachungs-politik scharfsinnig und pointiert zu demon-tieren. Je weiter fortgeschritten der Film,desto unbehaglicher wird es den Zuschaue-rInnen und desto unbehaglicher wirkt auchdie gewählte, uns bekannte Form der Präsen-tation. Der Film entlarvt sich nach und nachals Satire.
Schenglet wurde als technisches Gerät ander Ecole d’Ingénieurs de Genève entworfen,dann an realen Trägern gefilmt und in derPostproduktion derartig umgestaltet, dass derFilm seinen virtuellen Charakter erhielt. MitHilfe von Computeranimation wurden dievirtualisierten Figuren, samt Schenglet, vor ei-nem Collage-artigen Hintergrund platziert.
186
Gerahmt ist der Film von zwei Aufnahmen, indenen ein Schwarzafrikaner von einer imDunklen stehenden Menge beobachtet wird.Die Angst ist ihm ins Gesicht geschrieben.Den Schlusssatz bildet der eingeblendete Arti-kel 13.1 der Menschenrechtserklärung:«Everyone has the right to freedom of move-ment and residence within the borders of eachstate.» (ld)
P: Bord Cadre Film (Genève) 2002. B: LaurentNègre, Zoltan Horvath. R: Laurent Nègre. K:Pascal Montjovent. T: Kuleni Berhanu. S: Lau-rent Nègre. M: KMA. D: Taye Berhanu, DianePalma, Herve Dafe, Kuleni Berhanu, MikeMoundou. V,W: Bord Cadre Film (Genève).Video, Farbe, 7 Minuten, Französisch (engli-sche Untertitel).
9N?C <:D:<.@GR;<I:?
E7K-%7 :$%7 #=H3%7
Das Sterben markiert den Übergang vom Le-ben in den Tod. Jeder Mensch wird irgend-wann damit konfrontiert. Während der Tod inunserer Kulturgeschichte häufig Erwähnungfindet, ist der Vorgang des Sterbens nach wievor ein Tabu. Jürg Neuenschwander widmetsich im Dokumentarfilm Früher oder spätergenau diesem Thema. Er porträtiert Personenaus seiner Heimat, dem Emmental, die in ho-hem Alter am Ende ihres Lebens angelangtsind oder die sterben, bevor sie erwachsenoder alt werden können.
Zwillinge werden tot geboren, ein ande-res Baby stirbt kurz nach der Geburt. EinTeenager siecht, unheilbar krebskrank, mitChemotherapie noch ein Jahr dahin; ein40-jähriger Mann mit derselben Diagnosestirbt ohne Behandlung nach sechs Monaten.Eine Frau und ein Mann sterben altersbedingt.In den sieben Beispielen, die aufzeigen, wieverschieden das Sterben vor sich geht, lässtNeuenschwander auch Familienangehörigeoder Partner zu Wort kommen. Folgendes Zi-tat stellt er an den Anfang seines Dokumentar-films: «Mit Sterbenden habe ich angefangen.Mit Hinterbliebenen habe ich aufgehört. Allewussten, dass wir den Film nie gemeinsam se-hen werden.»
In ruhigen, schlichten Bildern und langenEinstellungen, in denen die Kamera oft ganznah an die Menschen herangeht, ohne auf-dringlich zu wirken, die aber auch der StilleRaum lassen, begleitet Neuenschwander dieSterbenden in ihrer letzten Lebensphase. Wirnehmen Anteil an Alltagshandlungen, an Mo-menten der Hoffnung oder Gelassenheit, er-fahren von Ängsten, Verzweiflung, Hilflosig-keit. Die genauen, respektvollen Beobachtun-gen machen betroffen; sie weisen darauf hin,wie wertvoll es ist, beim Sterben nicht allein zusein und in Würde gehen zu dürfen. Anderer-seits verschweigen sie nicht, wie unbedeutenddie letzten Stunden eines Lebens sein könnenoder wie schwer es für Hinterbliebene ist, denTod einer geliebten Person zu akzeptieren.Untermalt wird die von den Bildern vermittel-te Stimmung von Musikkompositionen, dienie zu sehr in den Vordergrund treten.
Als Gegenpol zu unserem Umgang mitsterblichen Überresten integriert der Filme-macher Szenen eines tibetischen Totenrituals.Während wir die Toten kremieren, begrabenund Abdankungsfeiern abhalten, werden Ver-storbene in Tibet zerhackt und den Fischenverfüttert. Für jedes vergangene Leben wirddort eine neue Gebetsfahne an Ästen aufge-hängt. Hierzulande gibt es Arbeit für Sarg-tischler, Totengräber und Bestattungsinstitu-te, in Tibet beten Mönche für die Seele derVerstorbenen und werden von den Hinterblie-benen dafür entlöhnt. Bereits in früheren Wer-ken hat sich Neuenschwander mit den beidenKulturen auseinander gesetzt: Shigatse (1990)erzählt von der tibetischen Medizin, in Kräu-ter und Kräfte (1995) werden Naturheiler ausdem Emmental vorgestellt.
Dieser aufwühlende Dokumentarfilmzwingt uns, den Blick nicht abzuwenden unduns mit unserer eigenen Vergänglichkeit zubefassen. Denn gehen müssen wir alle, früheroder später. (sh)
P: Carac-Film AG, Container-Film AG(Schweiz, Tibet) 2003. B: Jürg Neuenschwan-der, Nicolas Broccard. R: Jürg Neuenschwan-der. K: Philippe Cordey. T: Ingrid Städeli. S:Regina Bärtschi. M: David Gattiker. V: Film-coopi Zürich AG. W: Carac-Film AG, Contai-ner-Film AG.35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch,Tibetisch (deutsche Untertitel)
187
B;?@ AEE*!:?
WXY )*%3%
Eines Morgens findet Peter seine Freundin Ju-lie tot in der Badewanne. Sie war während derletzten Jahre immer tiefer in die Tabletten-sucht geraten, ohne dass Peter dies mitbekom-men hätte. Er war viel zu beschäftigt mit sei-nem Computer und dem Knacken geheimerZugangsdaten. Wie in Trance ruft er einenKrankenwagen, verlässt die Wohnung mit sei-nem Laptop und steigt in einen Zug ein. Aufder Reise vernichtet er die ZIP-Karte seinesMobiltelefons. Eher zufällig landet er in Köln,wo er sich durchschlägt, indem er in fremdenWohnungen ein Schattendasein führt. All-mählich nistet er sich in drei verschiedenenWohnungen ein und beginnt mit deren Be-wohnerInnen Kontakt aufzunehmen. Selbst-verständlich reagieren diese nicht unbedingterfreut auf den Eindringling. Auf wundersameWeise aber entwickeln sich Beziehungen, diefür alle Beteiligten eine Bereicherung darstel-len. Peter findet einen Weg, sich anderen Men-schen gegenüber zu öffnen und in Dialog mitihnen zu treten. Seinem ersten Gastgeber,Schrader, hilft er beim Schreiben eines Manu-skripts, für den Zweiten kocht er wunderbareMenüs oder spielt mit dem ewig EinsamenSchach, und mit Paula kommuniziert er überZitate aus Büchern. Diese Rückkehr zurMenschlichkeit hilft ihm, seinen Schmerz, diezurückkehrenden Erinnerungen und seineSchuldgefühle zu meistern.
Nicht nur schafft es der Schweizer Regis-seur Marc Ottiker, mit seinem Film 1/2 Mieteeine Story zu erzählen, die durch ihre Einzigar-tigkeit besticht, sondern er vermag auch durchihre Gestaltung zu berühren. Selten werden aufder Leinwand Figuren gezeigt und Dialoge ge-sprochen, die mit so viel Liebe zum Detail ge-staltet worden sind. Sie sind liebenswürdig undverschroben zugleich, vor allem scheinen alleauf die eine oder anderer Art einsam zu sein.Wenn wir beobachten können, wie Paula nachdem Benutzen des Toasters routiniert die Krü-mel mit dem Handstaubsauger entfernt odernichts Besseres zu tun weiss, als dem neuen Lo-ver von gegenüber nach der ersten Liebesnachtdie Wohnung zu putzen, erfahren wir über sol-che Bilder innert weniger Sekunden sehr vielüber diese Figur: Sie berührt uns.
In einer Parallelmontage werden mit kla-ren, schlichten Bildern die Geschichten vonPeter und den Wohnungsinhabern erzählt, bissie sich auch im Bild begegnen. Nur manchmalüberrascht der Film mit stilistischen Spielerei-en wie einem in vier Teile geteilten Split-Screen, in dem z. B. das Eindringen Peters ineine Wohnung zeitversetzt gezeigt und somitverkürzt wird. Der Ton ist funktional gehaltenohne überflüssige Geräusche, oftmals herrschtStille. Die Figuren und deren Wahrnehmun-gen bleiben im Vordergrund. Musik wirdsparsam eingesetzt, oft nur Gitarre, und erin-nert stellenweise an die frühen Filme des Mit-produzenten Wim Wenders wie Paris, Texas.
Einfühlsam und witzig dokumentiert Ot-tiker Peters Entwicklung vom egozentrischenComputerfreak zum Helfer in Not undschliesslich zum guten Mensch von Köln, dernun auch sich selbst zu erkennen beginnt. Ot-tikers Film ist eine echte Bereicherung für dendeutschsprachigen Film. (ld)
P: Road Movies Factory GmbH (Köln) 2002.B: Marc Ottiker. R: Marc Ottiker. K: StefanRunge. T: Ralf Hamann. S: Achim Seidel. M:Stefan Giuliani. D: Stefan Kampwirth, DorisSchretzmayer, Natascha Bub, Sven Pippig. W,V: Road Movies Factory GmbH (Köln).35 mm, Farbe, 92 Minuten, Deutsch (englischeUntertitel).
M;SJ 1;?*.G
,%* Z'7*#-
«Bei Parish»: Mit diesen Worten meldeten sichdie Kindermädchen im Elternhaus der Regis-seurin jeweils am Telefon. Sie selbst übernahmals Kind diese Gewohnheit – «bis mir», so
188
schreibt sie in einem Text zu ihrem Film, «ei-nes Tages klar wurde, dass ich selbst eine Pa-rish bin». Mit ihrem Diplomfilm an der Hoch-schule für Gestaltung und Kunst Zürich unter-nimmt Yaël Parish eine dokumentarische Ex-pedition in die eigene Familiengeschichte, diegeprägt ist von der Scheidung der Eltern: DerVater verliess die Familie, als Yaël und ihrebeiden Brüder noch im Kindesalter waren.
Bei Parish spürt den Verletzungen nach,die dieser Einschnitt bei den Familienmitglie-dern hinterliess: In Einzelinterviews und ge-meinsam am Esstisch erzählen die Mutter unddie mittlerweile erwachsenen Brüder von ih-ren Erinnerungen. Dabei gehen die Stellung-nahmen und die Haltungen frappant auseinan-der: Die Mutter interpretiert eine Kinder-zeichnung der Regisseurin als Indiz einerglücklichen Kindheit – farbenfroh zeigt es dieFamilie vereint vor einem Haus im Grünen,umgeben von Tieren und Blumen –; die analy-tische Distanz, mit der sie spricht, steht jedochin seltsamem Gegensatz zu dieser Deutung.Die Risse in den Beziehungen brechen immermehr auf, als die Brüder erzählen: Der eine re-det mit manchmal sarkastischer Offenheit vonden Unfähigkeiten und Problemen der Eltern,der andere wirkt eher depressiv und kann sich,wie traumatisiert, an vieles schlichtweg nichtmehr erinnern. Der Vater in Australien sagt, erwünsche sich mehr Begegnungen mit seinenSöhnen. Durch das verwackelte Bild der Vi-deokonferenz erscheint er dabei entfernt undfremd, als lebe er auf einem andern Planeten.So entsteht mosaikartig die Geschichte einergescheiterten Ehe und einer zerbrochenen Fa-milie. Ergänzt wird sie durch Gespräche miteiner Reihe ehemaliger Kindermädchen, dieals Aussenstehende die Zerwürfnisse kom-mentieren. Durch diese Seitenblicke erfahrenwir von den schwierigen Lebensumständen:Die Mutter ist polnisch-schweizerische Jüdin,der Vater Australier, zu den kulturellen Diffe-renzen kommen charakterliche. Beide arbeitenganztags, für Familie und Beziehung bleibtwenig Zeit. Ihr Wohnort, Guntershausen, istein Schweizer Dorf, in dem die Stille fast er-drückend wirkt: Hier gibt es nicht viel Platzfürs Anderssein.
Das wichtigste Gestaltungsmittel desFilms ist die sorgfältige Montage, welche dieverschiedenen Standpunkte und Empfindun-gen miteinander konfrontiert und zuweilen
krasse Widersprüche aufzeigt, die manchmalin ihrer Pointiertheit durchaus amüsant sind.Meist aber machen die Unvereinbarkeit undUnversöhnlichkeit der verschiedenen Empfin-dungen betroffen. Zurück bleibt nach demFilm eine Trauer um die schmerzlich vermissteNähe und Nestwärme, um eine kindliche Un-beschwertheit und um den Verlust eines Da-heims. (nat)
P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-rich) 2003. B, R: Yaël Parish. K: ChristineMunz. T: Bettina Tenchio. S: Gion-Reto Killi-as, Yaël Parish. V, W: Hochschule für Gestal-tung und Kunst (Zürich).Digital-Beta-Video, Farbe, 33 Minuten,Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch, Hebrä-isch.
1;AJA 1AJA<*
S*'((*: ' )*#3%7@*'&9:
Paolo Poloni, Zürcher mit italienischem Pass,bezeichnet sich selbst als «Auslanditaliener».Er wurde als Sohn italienischer Eltern in Lu-zern geboren, hat sich nie um einen SchweizerPass bemüht, fühlt sich jedoch nicht als Italie-ner, und der Begriff «Secondo» sei « für jeman-den ab 40 leicht pathetisch». Viaggio a Mister-bianco entstand, wie Poloni sagt, aus einemGefühl der Pflicht: Die Reise sei nötig gewe-sen, um mit Italien endlich ins Reine zu kom-men, um ein für allemal Klarheit zu finden inder Frage, ob das Land für ihn eine Lebensper-spektive darstelle. Eine andere treibende Kraftsei die Neugier gewesen: Wie sieht Italien ab-seits bekannter Routen aus, im Winter?
Das einzige Kriterium sei gewesen, so un-voreingenommen wie möglich zu reisen. Sichtreiben zu lassen, ist das Prinzip des Films, derweniger ein Essay ist als ein Roadmovie; wasihn bewegt und trägt, ist vordergründig nichtso sehr ein Nachdenken als vielmehr ein Beob-achten. Wer zu sehr nach einem roten Fadensucht, nach einer metaphorischen Ebene, einerintellektuellen Übersteigerung, sucht verge-bens; statt ums Einordnen der Reiseerlebnissein Gedankenstränge geht es Poloni um denÜberraschungseffekt und die Zufallsbegeg-nungen, die die nächste Wegmarke bereithält.
189
Gewisse kritische Stimmen warfen dem Filmdeshalb Unentschlossenheit, Beliebigkeit vor– was vielleicht auch von Mühe zeugt, mit derOffenheit umzugehen, die sowohl die Reise alsauch den Film kennzeichnet und beider Reizgerade ausmacht.
Der Weg soll irgendwie nach Süden füh-ren, so Polonis Prämisse, ohne geplante Rou-te und vor allem per Autostopp; an einzelnenOrten macht er so lange Halt, wie es ihm seineNeugier gebietet. Wie Kapitel oder Kurzge-schichten reihen sich die Erlebnisse aneinan-der. Von diesem Film erzählt es sich fast auto-matisch in Anekdotenform: Afrikaner, die inMailand die Piazza vor einer Kirche besetzen,um auf ihre Wohnungsnot hinzuweisen. Derphilosophierende Rasta-Briefträger in derToskana, der sich im Ort überhaupt nichtauskennt und die Briefkästen alle erst suchenmuss. Seine Mutter, die meint, statt dreierKinder hätte sie besser drei Spaziergänge ge-macht. Die Fischer in Anzio bei Rom, dieHeimatlosen und Junkies in Neapel, das klei-ne Nest in der Basilicata, wo alle auswandernwollen ausser ein unglaublich verliebtesHochzeitspaar. Italien – von Mitteleuropäernund Intellektuellen hochgejubelt, die manch-mal den Anschein machen, Italien besser zukennen als die Italiener selbst – erscheint hierals fremdes, unerwartet facettenreiches, grau-blau getöntes Land und entspricht überhauptnicht den Klischees aus Filmen und Postkar-ten. Kein sonnengetränktes Lungomare, kei-ne gestikulierenden, schwarzgelocktenSchönheiten, weder Gelati, Sonnenbrillennoch Handys kommen vor; es herrscht derAlltag, abwechselnd spannend, öde oderleicht verrückt, weil der Film eine Art All-tagsdokumentation in Reinform ist. Diesekombiniert er zugleich mit einer narratologi-schen Instanz: Der Ich-Kommentar des Rei-senden wurde von Poloni geschrieben undvon einem Schauspieler gesprochen. Dadurcherhält der Kommentar eine gewollte Künst-lichkeit, es entsteht «eine Nacherzählung, alswäre der Film eine Fiktion».
Schliesslich, in Misterbianco bei Catania,trifft der Reisende auf Wunder. Es schneit inSizilien, und der Bürgermeister höchstpersön-lich kehrt mit dem Besen das Trottoir. Hierfindet Poloni zu seinem Fazit: Bei der Antwortauf die Frage, wie sich Unterwegssein undVerweilen ablösen sollen und wo dies ge-
schieht, gibt es keine Regeln ausser die, dem ei-genen Instinkt zu folgen. (nat)
P: El rayo x Filmprojekte (Zürich) 2003. R, K,T: Paolo Poloni. S: Paolo Poloni, Nicola Bel-lucci. M: Gianni Coscia. V: Xenix Film (Zü-rich). W: El rayo x Filmprojekte (Zürich).35 mm, Farbe, 87 Minuten, Deutsch, Italie-nisch.
!"#"$ $"%&'"()*&'
!"#$ %&'( )('$*(+
In einer kritischen Würdigung des Fernseh-films Haus ohne Fenster muss als Erstes dieschauspielerische Leistung von EstherGemsch erwähnt werden. Die als ehrgeizigeWitwe Lisbeth Rohner aus der SchweizerSchoggi-Soap Lüthi und Blanc bekannte Ac-trice spielt hier ihre erste Hauptrolle mit Bra-vour und Überzeugungskraft. Dabei ist die Fi-gur der einst selbstsicheren Renate, die Hilfebei einem betrügerischen Therapeuten suchtund plötzlich nahe am psychischen Abgrundsteht, sicher nicht einfach darzustellen. Auchdie Nebenrollen in Peter Reichenbachs Psy-choanalysedrama sind äusserst originell be-setzt: Neben Esther Gemsch sind darin RobertHunger-Bühler von Marthalers Schauspiel-haus-Ensemble als schmieriger Therapeut,Karin Baal, Star des deutschen Nachkriegs-films, als Renates hilflose Mutter und MaxBertsch, Kriminalkommissar aus der RTL-Se-rie Im Namen des Gesetzes, als Renates Ex-Freund zu sehen.
Die Geschichte verbindet die Problemeder Übertragungsliebe mit denjenigen des psy-chotherapeutischen Missbrauchs und wandeltsich schliesslich zum regelrechten Gerechtig-keits- und Befreiungsdrama. Die erfolgreicheUnternehmerin Renate Schaller kommt nichtüber den Suizid ihrer Schwester Franziskahinweg. Als auch noch ihre Beziehung in dieBrüche geht, wendet sie sich an Franziskasehemaligen Therapeuten Sebastian Frey undmeint dort den Trost zu finden, den sie gesuchthat. Die emotionale Abhängigkeit wandeltsich zur vermeintlichen Liebe, doch die Regelndes Arzt-Patientin-Verhältnisses werden ver-letzt, als sich Frey auf ein sexuelles Abenteuer
190
mit ihr einlässt. Renates Liebe steigert sich zurObsession. Als sie entdeckt, dass Frey auchmit anderen Patientinnen intimen Umgangpflegt, stürzt sie in eine tiefe Krise und in einelebensgefährliche Depression, von der sie sichin einer Klinik langsam erholt. Nur zögerlichkann sie sich aus ihrer Abhängigkeit befreienund sich von ihrer Phantasiewelt verabschie-den. Aus Franziskas Abschiedsbrief, den ihrdie Mutter schliesslich zeigt, erfährt sie, dassauch ihre Schwester in Frey verliebt war. Undnun schafft sie es, sich aufzuraffen und gegenden missbräuchlichen Therapeuten vorzugehen.
Die Drehbuchautorin Christa Capaulund der Regisseur Peter Reichenbach habensich für einen Fernsehfilm einen reichlichkomplexen und schweren Stoff vorgenom-men. Und so bleibt schliesslich auch das Ge-fühl, dass in Haus ohne Fenster zu viel Dramain 90 Minuten verpackt werden wollte. DieGeschichte ist jedoch elegant und zügig insze-niert. Reichenbach ist Mitbegründer von C-Films und war jahrelang als Produzent tätig,bevor er 1999 mit dem TV-Movie Das Mäd-chen aus der Fremde als Regisseur debütierte.Auch dieses wurde schon von Christa Capaulmitverfasst, die auch das Buch von StefanHaupts Fernsehfilm Moritz (2003) schrieb.C-Films produziert ebenfalls die TV-Soap Lü-thi und Blanc und realisierte in der Reihe«Fernsehfilm SF DRS» bereits das Drama Toddurch Entlassung und die beiden KomödienBig Deal und Füür oder Flamme. (vg)
P: C-Films (Zürich), SF DRS, WDR 2003. B:Christa Capaul. R: Peter Reichenbach. K: Fe-lix von Muralt. T: Patrick Becker. S: Beat Len-herr. M: Benjamin Fueter. D: Esther Gemsch,Robert Hunger-Bühler, Karin Baal, MaxGertsch, Delia Mayer, Sara Capretti, BabettArens, Meret Hottinger. W: C-Films (Zürich).Digital-Beta-Video, Farbe, 88 Minuten,Schweizerdeutsch.
IAB*<*PD: I: ?*K;L
)%*& <'+% *#3 ,'9-
Potsdam, 1747: Der greise Johann SebastianBach fährt in einer ruckeligen Kutsche überFeld und Wiesen zur Taufe seines Enkels und
jüngsten «Strümpelchens» der Bach-Dynastie.Gleichzeitig liegt der junge preussische KönigFriedrich – launig und musikbesessen – unterden Schröpfgläsern, deren Klang ihn zu einemkleinen musikalischen Thema inspiriert. Alsder König von der Ankunft des Komponistenerfährt, fordert er ihn heraus und verlangt vonihm – vom Tonmotiv ausgehend – eine sechs-stimmige Fuge. Bach ist hin- und hergerissen:Einerseits will er sich keinem Potentaten mehrverpflichten; andererseits lässt ihn die verfüh-rerische Melodie nicht mehr los. In der Wocheseines Aufenthalts entsteht nicht nur seinWerk Das musikalische Opfer – in einer ArtDominoeffekt treten verborgene Ambitionenund Frustrationen an die Oberfläche und las-sen ein faszinierendes Drama entstehen.
Ausgehend von einer historisch verbürg-ten Tatsache – der Begegnung zwischen demMaestro und dem den schönen Künsten zuge-wandten Friedrich dem Grossen –, lässt unsDominique de Rivaz in die Zeit des Barockseintauchen. Jegliche Bedenken seien ausge-räumt: Die Regisseurin, die schon mit ihremaussergewöhnlichen Kurzfilm Jour de bain(1994) auf sich aufmerksam machte, liefertkeinen «Kostümfilm» in ungeknitterter Hoch-glanzästhetik, sondern ein kleines, synästheti-sches Schmuckstück an geschichtlicher Aufar-
beitung und Fiktion (Szenenbild: LotharHoller). Das schummrige Dunkel der Nacht,erleuchtet einzig von den dumpfen Licht-punkten der Kerzen, der Schweiss, die gepu-derten, teils zotteligen Perücken, die Kleider,die sich mit dem Schmutz der Strassen vollsaugen, der Klang der Musik, die – noch un-konservierbar – ein kostbares Privileg der we-nigen Begabten und Begüterten war: All dieslässt sich in Mein Name ist Bach sinnlich nach-empfinden.
191
Und damit nicht genug: Er lässt uns dieTragik des grossen Musikers nachvollziehen,der mit dem Verdikt leben muss, bald zu er-blinden. Er führt aus, was es heisst, als BachsSohn im Schatten des grossen Vaters zu leben:sei es Friedemann – dem ersten unabhängigenMusiker der Neuzeit – oder Emanuel, der mitFrau und Kind eine gesicherte Stellung amHof vorzieht. Mein Name ist Bach lässt aberauch das Drama eines Königs auferstehen, dervom autoritären Vater kujoniert wurde undnun seine Umgebung tyrannisiert – seien esseine männlichen Liebhaber oder die freiheits-liebende Schwester.
All dies inszeniert Rivaz mit erstaunli-cher Leichtigkeit und feinem Humor. Dieserfindet sich auch in den Kostüminterpretatio-nen Vivienne Westwoods wieder. Oder in denamüsanten Abstechern ins Experimentelle:etwa wenn Friedrich und Bach mit dem Dro-medar durch eine Dünenlandschaft reiten,wenn ein grossformatiges Bühnenbild mittenin der Wiese das neu erbaute Schloss Sanssoucizeigt oder wenn König und Musiker sich aufeinem Dachboden bei einer Jamsession ver-gnügen (Musik: Frédéric Devreese) – libertäreVerfremdungen, die den historischen Stoff zueinem Leckerbissen machen. (ds)
P: Twenty Twenty Vision (Berlin), PandoraFilms (Köln), CAB Productions (Lausanne)2003. B: Dominique de Rivaz, Jean-Luc Bour-geois, Leo Raat. R: Dominique de Rivaz. K:Ciro Cappellari. T: Ingrid Städeli, Hugo Po-letti. S: Isabel Meier. Aus: Lothar Holler. Kos-tüme: Vivienne Westwood, Friederike vonWedel-Parlon, Regina Tiedeken, Britta Krähe.M: Frédéric Devreese. D: Vadim Glowna, Jür-gen Vogel, Karoline Herfurth, Anatole Taub-mann, Paul Herwig. W: Bavaria Film Interna-tional (Geiselgasteig).35 mm, Farbe, 97 Minuten, Deutsch.
1;.@;J: ?A@;?I
[& :90'& $% @10
Im zwölfminütigen Kurzfilm Un océan de bléführt die Schauspielerin Pascale Rocard zumersten Mal Regie. Protagonistinnen ihrer stim-mungsvollen Geschichte, die auf einer Novelle
Eric Holders basiert, sind zwei Frauen: eineblonde Sängerin und eine rothaarige Hausfrau.Die Freundinnen haben sich lange nicht mehrgesehen; nun trinken sie gemeinsam Tee, tau-schen vielsagende Blicke und entscheiden sichschliesslich, einen kurzen Spaziergang zu un-ternehmen. Sie scheinen ein Geheimnis zu tei-len.
Lachend rennen sie durch ein reifes Wei-zenfeld – die Abendsonne lässt das Getreidegolden aufleuchten. Unter einem Baum sit-zend, gesteht die Sängerin der Freundin ihreungebrochene Liebe. Mit 16 liebten sie sichunter diesem Baum – diese Erinnerung beglei-tet die Sängerin jeden Tag. Seitdem hat sie nie-manden mehr so lieben können. Weinend hörtihr die Freundin zu; sie ist glücklich verheira-tet und Mutter zweier Kinder.
Die Sonne geht allmählich unter. Ge-meinsam schauen sie den Sonnenuntergang an– langsam weicht das goldene Licht aus ihren
Gesichtern. Der Abschied naht; schweigendkehren sie zum Landhaus zurück. Die Sänge-rin verspricht lächelnd, ihre Freundin in Zu-kunft wieder zu besuchen. Im Abendrot fährtsie schliesslich davon.
Rocards Kurzfilm ist atmosphärisch sehrdicht. Die Regisseurin bedient sich geschicktder Emotionalität und Stimmung von Farbe,Drehort und Musik. Der Farbe Gold kommteine metaphorische Qualität zu: Das Gold desWeizenfeldes, des Schmuckes oder derAbendsonne steht für das Aufleben einer Erin-nerung an das gemeinsame «Goldene Zeitalterder Liebe». Musikalisch fällt vor allem die Ab-schiedszene auf; das gefühlsschwere Lied wur-de von François Bernheim komponiert, vonPascale Rocard getextet und von AlexandraGonin, die im Kurzfilm die Sängerin spielt, in-terpretiert. Das Ende der Geschichte wird soauf raffinierte Weise musikalisch aufgefangen
192
und in seiner sentimentalen Stimmung ver-stärkt.
Un océan de blé besticht durch eine zarteBildsprache, die viel Raum für Suggestives of-fen lässt und gleichzeitig Unausgesprochenesin Frage stellt. Inwiefern bleiben uns verflos-sene Liebschaften erhalten? Kann die Erinne-rung Gefühle konservieren? Steht uns im Lau-fe eines Lebens eine einzig wahre Liebe zu?
Zu Beginn des Kurzfilms hält die Sänge-rin in ihrem Auto vor einer Verzweigung an.Nach einem kurzen Augenblick fährt sie wie-der los, folgt der linken Strasse. Eine solch all-tägliche Entscheidung mag unwichtig erschei-nen, doch sie weist darauf hin: Der Weg zu-rück in die Vergangenheit bleibt verwehrt –man kann sich der Erinnerung hingeben oderergeben. Es ist eine Frage der Fahrtrichtung.
(fl)
P: Espace Production (Verbier), Fanny DorianProductions, TSR 2002. R: Pascale Rocard. K:Pascal Moal. T: Christophe Giovanoni. S: Em-manuelle Nobecourt. M: François Bernheim.A: Yan Arlaud, Kay Devanthey. D: AlexandraGonin, Sheila O’Connor. V, W: Espace Pro-duction (Verbier).35 mm, Farbe, 12 Minuten, Französisch
JD!;. .@GB*I
F*% RO%*3% Z-'#%
Ein ehemaliges Kloster im thurgauischenKalchrain beherbergt mitten in einer ländli-chen Idylle eine Arbeitserziehungsanstalt(AEA) für junge Kriminelle, in die auch dasProjekt «Suchtgruppe», kurz PSG, eingeglie-dert ist. Die mindestens dreimonatige Thera-pie hat zum Ziel, abhängige, straffällige Ju-
gendliche auf ein drogen- und deliktfreies Le-ben ausserhalb der Anstalt vorzubereiten.Rund um die Uhr kümmert sich ein fünfköpfi-ges Betreuungsteam um die sieben Adoleszen-ten, die von einer auffällig ähnlichen kriminel-len Karriere berichten: Diebstähle, Erpressungwie auch Gewaltdelikte und Drogenkonsumgehörten zum Alltag der jungen Männer.
Besonders aufmerksam begleitet der Do-kumentarfilmer Lukas Schmid die Geschichtedes 18-jährigen Robert Rappacinski. Rappa,wie ihn seine Altersgenossen zu nennen pfle-gen, ist drogenabhängig und versucht mitzwanghaftem Lügen die Therapiephase durch-zustehen. In unzähligen, äusserst intensivenGruppendiskussionen mit den Betreuern undden weiteren sechs Jugendlichen wird Rappajedoch stets mit der Wahrheit konfrontiert.Schmids Kamera nähert sich ihm, wie auch denübrigen Jugendlichen, auf ausgesprochensachte, rücksichtsvolle Weise und frei jeglicherWertung. Das Vertrauen der Anstaltsbewoh-ner ist dem jungen Dokumentarfilmer so si-cher; es grenzt gar an Komplizenschaft. Wie indem Falle, als er Martin in den bewilligtenachtstündigen Urlaub nach Winterthur beglei-tet und beim Reinschmuggeln halluzinogenerPilze, versteckt zwischen den Salamischeibeneines unauffälligen Sandwichs, in die Erzie-hungsanstalt filmt.
Die Kamera – bei konfrontativen Gesprä-chen stets auf den Gesichtern verharrend –fängt Augenblicke zwischen trister Resignati-on und vehementer Auflehnung ein. Wie zumBeispiel, als Marco bei Rappas Einweisung indas Isolationszimmer die Frage stellt, wozueine solche Strafe gut sein soll. Frustrierenddie Antwort: Das Betreuungsteam habe dasnicht entschieden; es sei einfach so – zu denverärgerten und hilflosen Gesichtern der Ju-gendlichen gesellen sich diejenigen der Betreu-er, irritiert und ratlos.
Als roter Faden der handwerklich solidenund eindrücklichen Dokumentation dientRappas Geschichte; seine Person bestreitet so-wohl die Anfangs- als auch Endszene. Einemeindeutigen Schluss aber verweigert sich Diezweite Phase: Nach der dreimonatigen Thera-pie muss Robert Rappacinski vor prüfenderAnstaltsleitung gestehen: «Ich muess … ichbliib nomol drü Mönät.» Mit diesem Satz, fak-tisch das Schlusswort, knüpft Schmid ge-schickt an den Anfang an. Dieses Ende stimmt
193
nachdenklich – man verweilt in Gedanken beiRobert und den andern Anstaltsbewohnern.
Lukas Schmid gelingt es mit seinem ers-ten langen Dokumentarfilm (und zugleichVordiplomfilm an der Filmakademie Ba-den-Württemberg), nicht nur den Alltag vonsieben ehemals kriminellen Jugendlichen in ei-ner Erziehungsanstalt einzufangen, sondernzugleich die entwicklungspsychologischenHerausforderungen dieses Alters, wie Identi-tätssuche, Behaupten der eigenen Persönlich-keit, Lust an Grenzerfahrungen, Sozialisationund Integration, zu dokumentieren. (fl)
P: Filmakademie Baden-Württemberg, TomStreuber (Ludwigsburg), Lukas Schmid (Rüti-hof) 2003. B, R: Lukas Schmid. K: LukasSchmid. T: Lukas Schmid. S: Roland Muigg.M: Gentle Rain, Topdeal 2004. V: Luxor (Ber-lin). W: Filmakademie Baden-Württemberg(Ludwigsburg).Video, Farbe, 87 Minuten, Deutsch, Schwei-zerdeutsch (deutsche Untertitel).
I;<*:J .@GR:*L:?
BQ*&-%'$ !33*3"$%
Entstanden im Grossbritannien der Sechziger-jahre des letzten Jahrhunderts, entwickeltensich die Skinheads von einem Zusammen-schluss Jugendlicher aus dem Arbeitermilieuzu einer weltumspannenden Bewegung mittausenden von Mitgliedern. In ihren Anfängenwaren sie, ähnlich wie die Punks, nichts ande-res als eine Jugendszene, die sich mit ihrerKleidung, vor allem aber mit ihrer Musik – Skaund Reggae – von der bürgerlichen Welt derErwachsenen abgrenzen wollte. Erst Ende derSiebzigerjahre spaltete sich der rechte Flügelvon der ursprünglichen Szene ab und formier-te sich neu in der «Blood and Honour»-Bewe-gung. Seither prägen diese rechtsradikalen,rassistischen Skins das landläufige Bild derSkinheads.
Skinhead Attitude räumt auf mit diesemVorurteil. Wie Schweizer zu Beginn seinesDokumentarfilms aus dem Off ankündigt, istes ihm ein Anliegen das Bild zu korrigieren,das auch er in seinem Film Skin or Die (1998)bestätigte, und so zeichnet er hier das Bild ei-
ner mehrheitlich friedlichen Jugendbewegung.Die junge Carole, eine französische linke Skin-head, reist durch verschiedene europäischeLänder, in die USA und nach Kanada und trifftdort Gleichgesinnte. In zahlreichen Interviewserzählen die Skins von ihren Erfahrungen, vonKämpfen mit rechten Skins, von ihrer Musikund ihren Überzeugungen. Vereinzelt kom-men auch rechtsradikale Skinheads zu Wort.Sie bestätigen das Klischee des rassistischen,gewaltbereiten Schlägers. Diese Gegenüber-stellung fällt streckenweise ein wenig einseitigaus. Viele Rechtsradikale, vor allem in Europa,wagten sich nicht vor die Kamera. In den USAdann das umgekehrte Bild. Linke Skins fürch-teten die Rache der rechten Szene, die in Ame-rika äusserst radikal und gewalttätig ist undsowohl dem Ku-Klux-Clan als auch der ArianNation nahe steht.
Skinhead Attitude lässt in erster Linie dieMenschen erzählen. Seltene Off-Kommentareerklären höchstens gewisse Begriffe, erläuternZusammenhänge und führen unaufdringlichdurch die Geschichte. So erhält man einen di-rekten, unreflektierten Einblick in diese Szene.Eine grosse Rolle spielt, wie in jeder Jugendbe-wegung, die Musik als Stifterin von Identitätund Zusammengehörigkeit. Diverse Amateur-aufnahmen von Konzerten hinterlegen die Er-zählungen und verstärken den Eindruck derAuthentizität.
Der Film lässt dem Betrachter genügendRaum für einen anderen Einblick. Er schauthinter die Schlagzeilen von marodierendenSkinheadgangs, ohne diese Tatsache zu ver-schweigen oder zu beschönigen. (em)
P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-rich) 2003. B, R: Daniel Schweizer. K: DenisJutzeler, Daniel Schweizer. T: Henri Maikoff.
194
S: Katrin Plüss. M: Laurel Aitken. V, W: Looknow! (Zürich).35 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch, Eng-lisch, Deutsch (französische, deutsche Unter-titel).
.E:>;< .@GR*:E:?E
F'# !1=-:7&
Wenn das Auge über nebelverhangene Bergeund glitzernde Seen streift und dazu der kehli-ge, sanft vibrierende Klang ins Ohr dringt, fälltes auch den Folklore-Widerständigstenschwer, sich seiner Faszination zu entziehen.Das Alphorn – so ist es verbürgt – ging auchunseren Ahnen unter die Haut. Im 18. Jahr-hundert war das Alphornblasen den SchweizerSöldnern verboten, weil es unter den Eidge-nossen Heimweh auslöste und sie in die Deser-tion oder den Freitod trieb. Das änderte aller-dings nichts daran, dass das Instrument undseine Musik vor 200 Jahren praktisch ausge-
storben waren. Noch vor Entstehung desSchweizer Nationalstaats erklärte man es des-halb zum Inbegriff der Älplerkultur und liesses an Unspunnenfesten Wiederauferstehungfeiern. Erfolgreich, wie man heute feststellenkann.
Stefan Schwieterts Das Alphorn widmetsich nur am Rand der Geschichte und demMythos des zum Nationalsymbol avanciertenInstruments. Im Zentrum stehen dafür Musi-ker, die das Spannungsfeld der einheimischenAlphornszene repräsentieren. So etwa Hans-Jürg Sommer, einer der wichtigsten Alphorn-spieler und -komponisten. Auf ihn geht dasStück «Moosruef» zurück, ein Klassiker, derunter der Ächtung des schweizerischen Jo-delverbands steht. Dieses weltweit einzige
Gremium, das die landeseigene Volksmusikzu reglementieren sucht, wirft Sommer dasFalschspielen und das Sich-in-Szene-Setzenauf Kosten der Tradition vor. Quer in denOhren liegt der Jury vor allem der alphorn-charakteristische Naturton b (der schon frü-her von der Kirche als «teuflisches Intervall»verboten wurde). Er gibt Sommers Stückendas Urig-Melancholische – im Gegensatz zuden glatten Harmonien konfektionierterLändlermusik.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten erforschtHans Kennel die hiesige Musiktradition undverbindet sie mit dem Jazz. Nicht nur brachteer das Alphorn ans Festival in Montreux, ertritt auch mit traditionellen Büchel-Spielernwie Vater und Sohn Trütsch aus dem Muotataloder den jodelnden Geschwistern Schönbäch-ler auf. Auch diese widerstreben der verordne-ten Ästhetisierung der Volksmusik und musi-zieren untemperiert mit Naturtönen. Für Balt-hasar Streiff wiederum ist das Alphornschlichtweg ein «Phänomen». Dessen Be-schränkung auf rund ein Dutzend Töne emp-findet er als kreativen Anreiz. Er verbindetStimme und Instrument und experimentiertmit dem Raum. Dies zeigt auch der Film sehrschön: etwa wenn Streiffs Gruppe «hornroh»mit periskopähnlichen Hörnern unter der Au-tobahnbrücke spielt. Oder sie ihre Instrumen-te auf den Rolltreppen des Zürcher Haupt-bahnhofs in Szene setzen.
Am anderen Ende der Skala steht als Ver-treter der «echten» Folklore – und durchaussympathisches Original – Urs Pattschneider.Schade, dass sein Porträt als letztes in der Rei-he etwas viel Gewicht erhält und dadurch –Pattschneider ist eifriger Befürworter des Jo-delverbands – die «Unbotmässigkeiten» der«Wilden» zu relativieren scheint. Gedacht wares wohl – wie der Besuch in der Alphornfabrik– als humoriger Einschub. Man hätte sich aberauch vorstellen können, dass der Film sich aufdie innovativen Musiker beschränkt und ihrenKreationen mehr Raum gewährt hätte. Des-senungeachtet bietet Das Alphorn – als dritterMusikfilm Schwieterts (nach A Tickle in theHeart, 1996, und El acordeón del diablo, 2000)– einen äusserst anregenden Einblick in eineunvermutet dynamische Musikszene. (ds)
P: Neapel Film (Therwil), SF DRS 2003. B, R:Stefan Schwietert. K: Pio Corradi. T: Benedikt
195
Fruttiger. S: Isabel Meier. M: Hans-Jürg Som-mer. W: Neapel Film (Therwil).Video/35 mm, Farbe, 76 Minuten, Schweizer-deutsch (deutsche Untertitel).
.E*<; R:?:<>:J.
)%*%7 )'7*1N&
Die übergewichtige Coiffeuse Marilyn Meierist unglücklich: Lustlos schneidet sie der spär-lichen Kundschaft die Haare und lässt sich vonihrem verheirateten Liebhaber, dem Gemein-depräsidenten, leere Versprechungen machen.Zwar möchte ihr Angestellter Hans-Georgden Salon auf Vordermann bringen und machtihr einen Heiratsantrag, doch Marilyn träumtvon der grossen Karriere als Sängerin. Allesändert sich, als sie an der Geburtstagsfeier ih-res geliebten Gemeindepräsidenten betrunkenein peinliches Ständchen singt. Ein anwesen-der Musikproduzent aus Zürich lädt Marilynnämlich daraufhin in sein Studio ein, und Ha-lil, der türkische Kellner vom Rössli, der mitseinem Keyboard als Alleinunterhalter auf-tritt, beginnt mit ihr zu proben. Ihr gemeinsa-mes Ziel ist es, in der bekannten Schlagersen-dung «Musik mit Herz» aufzutreten.
Regisseurin Stina Werenfels, die mit ih-rem Kurzfilm Pastry, Pain and Politics Kritikund Publikum gleichermassen begeisterte und1999 dafür den Schweizer Filmpreis erhielt,konnte mit Meier Marilyn in der Reihe «Fern-sehfilm SF DRS» ihren ersten langen Spielfilmrealisieren. Mit der Drehbuchautorin PetraVolpe hat sie ein schräges Märchen über diegrossen Träume kleiner Leute geschaffen, dassich leichthändig mit Heuchelei, schweizeri-schem Kleinstadtmief und, wie schon in Pa-stry, Pain and Politics, mit dem Zusammenle-ben verschiedener Kulturen befasst. Mit MeierMarilyn beweist Stina Werenfels einmal mehrihr Gespür für Schweizer Befindlichkeit, ohnedass die präzise Milieustudie die Figuren je
entblössen würde. Viel Prominenz aus Thea-ter, Film und Fernsehen hat sie dabei unter-stützt. In der Hauptrolle ist die Theaterschau-spielerin Bettina Stucky zu sehen. Stucky istEnsemblemitglied des Zürcher Schauspielhau-ses und wurde 2002 mit dem Alfred-Kerr-Preis als beste Nachwuchsdarstellerin ausge-zeichnet. Für Meier Marilyn hat Bettina Stu-cky das erste Mal die Theaterbretter gegen dieLeinwand eingetauscht, und man schliesst ihrevoluminöse Figur – trotz ihrem Hang zuschlechtem Geschmack – sofort ins Herz. Anihrer Seite ist der hagere Pablo Aguilar zu se-hen, der seine Schauspielausbildung in Argen-tinien gemacht hat und schon in diversenSchweizer Kurzfilmen zu sehen war. Das un-gleiche Duo intoniert die eingängigen Songsder Bündner Sängerin Corin Curschellas, diezu richtigen Ohrwürmern werden. In promi-nenten Nebenrollen treten der zweifacheAdolf-Grimme-Preisträger Stefan Kurt, MaxRüdlinger und die letztes Jahr verstorbene Sy-bille Courvoisier auf. Als fesche Serviertoch-ter ist die Quiz-Moderatorin Susanne Kunz zusehen, und in Cameo-Autritten machen selbstdie Schlagersängerin Paola und Fernsehdirek-tor Peter Schellenberg Meier Marilyn ihreAufwartung.
Trotz dem etwas harzigen Einstieg ent-wickelt sich Meier Marilyn zu einer vergnügli-chen und liebenswürdig schrägen Komödie,wie man sie in diesem Land selten zu sehen be-kommt. (vg)
P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-rich), SF DRS 2003. B: Petra Volpe. R: StinaWerenfels. K: Eeva Fleig. T: Hugo Poletti. S:Markus Welter. M: Corin Curschellas, Dome-nico Ferrari. D: Bettina Stucky, Stefan Kurt,Pablo Aguilar, Max Rüdlinger, Ursula Ander-matt, Sibylle Courvoisier, Thomas Rohner,Tamara Sedmak, Susanne Kunz. W: DschointVentschr Filmproduktion (Zürich).Super-16-mm, Farbe, 86 Minuten, Schweizer-deutsch.
!"#$%&#'"()*+&&%&#"&$#'"()*%&
,%-.%* '&$%*-%&, geb. 1953, Programme Editor für Det Danske Filminstitut,Redaktionsmitglied der Filmzeitschrift Kosmorama. Redaktor und Autor u.a.von: Ib Bondebjerg / Jesper Andersen / Peter Schepelern: Dansk Film 1972–97, Kopenhagen 1997./%() 01"21&&, geb. 1970, ist Historiker und Filmwissenschaftler und arbeitetals Sportredaktor bei der WochenZeitung sowie als freier Journalist mitSchwerpunkten Musik und Film. Lebt in Zürich.31(14+% 0564%*, geb.1973 in Bangkok. Studium der Filmwissenschaft, Germa-nistik und Philosophie. Mitarbeit bei Filmprojekten und für das Filmpodiumder Stadt Zürich. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit 2002.76+4+.. 0*"&&%*, geb. 1971, Studium der Germanistik, Filmwissenschaft sowieder Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Assistent und Lehrbeauftragter am Se-minar für Filmwissenschaft der Universität Zürich.81"*1 91&+%4, geb. 1978, studiert Germanistik, Filmwissenschaft und Philoso-phie an der Universität Zürich. Seit 2002 Mitglied der CINEMA-Redaktion.Lebt und arbeitet in Zürich.:%*%( ;*&-(, geb. 1966, promovierte Kunsthistorikerin. Redaktorin für Kultur& Design bei Hochparterre. Schreibt über Design, Grafik und zeitgenössischeKunst. Seit 1999 Mitglied der CINEMA-Redaktion. Lebt und arbeitet in Zü-rich.01*<1*1 =4>?@+A%*, geb. 1957, hat die Tonspuren von mehr als 30 Spielfilmengestaltet. Dozentin zu Theorie und Praxis der Filmgestaltung, Autorin vonSound Design – Die virtuelle Klangwelt des Films, Oberassistentin am Institutfür Medienwissenschaften der Universität Basel mit einem Habilitationspro-jekt zu Visual Effects.=41B+1 C+)*A%((1, geb. 1973, Studium der Filmwissenschaft, Anglistik undVolkswirtschaft. Lebt in Zürich und arbeitet als wissenschaftliche Assistentinim Studienbereich Film an der HGK Zürich sowie als Korrektorin und Über-setzerin. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit 2001.:1*?D C)4$<%*A, geb. 1969, Studium der Filmwissenschaft, Semiotik und Phi-losophie, University of Toronto und York University (Kanada). Wohnt seit1996 in Zürich. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: Dokumentarfilm, Schwei-zer Film.E%*)&+@1 C*)<, geb. 1971, Studium der Literaturwissenschaften, arbeitet alsFilmredaktorin bei SF DRS. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit 2002.
196
E+&F%&F G%$+A%*, geb. 1969, Dr. phil., Oberassistent am Seminar für Filmwis-senschaft der Universität Zürich und bei Gelegenheit Filmkritiker für dieNeue Zürcher Zeitung. Langjährige Erfahrung als Filmjournalist für Boule-vardmedien. Interviews u.a. mit Catherine Deneuve, Mel Gibson, Sharon Sto-ne, Woody Allen, Julia Roberts, Kate Winslet, Bruce Willis, Samuel L. Jack-son, Kevin Costner, Dennis Hopper, Roman Polanski, Martin Scorsese, DavidLynch, Oliver Stone, Wim Wenders, Jerry Bruckheimer und Daniel Schmid.H1<+&% G%&-%4, geb. 1972, Studium der Anglistik, Filmwissenschaft und Euro-päischen Volksliteratur. Sie lebt in Zürich und arbeitet als Korrektorin.:1*(+&1 G"<%*, geb. 1971, wohnt und arbeitet in Zürich. Studiert auf demzweiten Bildungsweg an Geschichte und Filmwissenschaft herum.I6*+-(+1& ,"&A%&, geb. 1973, Filmjournalist, lebt in Zürich. Studium der italie-nischen Sprach- und Literaturwissenschaft, Geschichte und Filmwissenschaft.Lizentiatsarbeit über den Neorealismus als Reaktion auf den Faschismus.=4)*+1& J%44%*, geb. 1976, ist Kulturwissenschaftler und arbeitet als Filmjourna-list für den Tages-Anzeiger./%() J*)2%*, geb. 1963, Konservator-Restaurator SKR, war von 1998 bis 2003an der Cinémathèque suisse für Katalog, Konservierung und Restaurierungder Filmbestände verantwortlich. Heute ist er freischaffend tätig, unter ande-rem für SF DRS und weiterhin für die Cinémathèque.=*1&?%-?) 81*1((1, geb. 1977, studiert Publizistik, Italienische Literaturwis-senschaft und Philosophie an der Universität Zürich. Lebt und arbeitet alsKulturjournalist in Zürich.'&$*%1- :1"*%*, geb. 1976. Studium der Publizistikwissenschaft, Filmwissen-schaft und Soziologie. Seit 2001 redaktioneller Mitarbeiter der Neuen ZürcherZeitung. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit 2003.:1((6+1- :+?6%4, geb. 1969, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Collegium Hel-veticum der ETH Zürich. Studierte Philosophie und Filmwissenschaft an derUniversität Zürich. Er ist als freier Publizist und Kurator tätig und arbeitet an ei-ner Dissertation zur Kulturphilosophie des Scheiterns bei PD Dr. Ursula Pia Jauch.;B1 :)-%*, geb. 1976, studiert Geschichte, Politologie und Publizistik an derUniversität Zürich. War längere Zeit für StarTV als Cutterin der MovieNews-Redaktion tätig. Lebt und arbeitet in Zürich.,1& /)64K, geb. 1975, Studium der visuellen Kommunikation an der Hochschu-le der Künste Berlin bei Maria Vedder und seit 2000 bei Joachim Sauter. Seit1998 mit Projekten und Mixed Media-Installationen an Ausstellungen undFestivals vertreten; Co-Kuratorium des Festivals Club Transmediale seit 1999.Lebt und arbeitet in Berlin.L14(%* /"AA4%, Publizist, Kinoleiter und Direktor der Stiftung trigon-film, dieherausragende Filme aus Afrika, Asien und Lateinamerika verleiht. Er hatwährend zwanzig Jahren als Filmkritiker gearbeitet und diverse Bücher veröf-fentlicht.
197
,1& H164+, geb. 1967, Studium der Filmwissenschaft und der Kunstgeschichte inZürich und Berlin. 2003 Promotion über Filmwerk und Theorie von LászlóMoholy-Nagy. Dozent für Kunst- und Filmgeschichte. Seit 1998 Mitglied derCINEMA-Redaktion, lebt in Zürich.'4%M1&$*1 H?6&%+$%*, geb. 1968, Dr. phil., wissenschaftliche Assistentin am Se-minar für Filmwissenschaft der Freien Universität Berlin. Herausgeberin u. a.von Bollywood. Das indische Kino und die Schweiz sowie Autorin der Mono-graphie Die Stars sind wir. Heimkino als filmische Praxis in der Schweiz derDreissigerjahre (Marburg 2004).9)*+- H%&&, geb. 1957, Filmjournalistin u.a., in Zürich.:+*N12 H(1"<, geb. 1969, studierte Fotografie an der Hochschule für Gestal-tung und Kunst Zürich, lebt und arbeitet in Zürich und Berlin.O6)21- O)$%, geb. 1962, Studium der Visuellen Kommunikation, Germanistikund Etudes Cinématographiques in Hamburg und Paris. Lebt in Hamburg alsFilmemacher und freier Publizist. Herausgeber u. a. von Chris Marker– Film-essayist (München 1997), Dziga Vertov – Tagebücher/Arbeitshefte (Konstanz1999).,>*A !<+&$%&, geb. 1959, im Jahr von Der Tiger von Eschnapur und Der Froschmit der Maske. Lebt und arbeitet seit langem in Zürich.
198