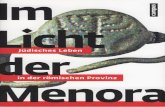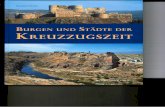Das Spiel mit den Blitzen. Funktionen der antiken Götterwelt für die populäre Gegenwartsliteratur
-
Upload
rwth-aachen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Das Spiel mit den Blitzen. Funktionen der antiken Götterwelt für die populäre Gegenwartsliteratur
Das Spiel mit den Blitzen – Funktionen der antiken Götterwelt für die Gegenwartsliteratur1
Jörg Fündling
Prolog: Die Gottesnot der filmenden und schreibenden Zunft2
Wir leben in einer Welt ohne Mythen, so erzählt uns die Wissenschaft allermöglichen Disziplinen; wir leben in einer Welt voller Mythen, so will es zu-mindest die Unterhaltungsindustrie, die den „Mythos Titanic“ ebenso pflegtwie den „Mythos Bernsteinzimmer“ und sich um das entsetzte Aufstöhnenaus jeder Fachrichtung weiter nicht kümmert. Begriffe prallen aufeinander.Offensichtlich verstehen ‚wir‘ und ‚die‘ unter einem Mythos zweierlei. An-gesichts der Definitionenvielfalt der Geistes- und Kulturwissenschaften istdas Bild leicht noch verwirrender zu gestalten.3
1 Für unerwartete Materiallieferungen und das Ertragen meiner anschließendenBegeisterung danke ich Wibke Westermeyer (Braunschweig). Christoph Michels(Aachen) war ein stets williges Opfer für fachmännische Trivialdiskussionen;hilfreiche Kommentare steuerte Jens Bartels (Bonn und Zürich) bei.
2 Die Prägung „Gottesnot“ verdanken wir natürlich dem berühmten Porträt der„geistliche[n] Unruhe“ Abrahams durch Thomas Mann, Joseph und seine Brüder(1933 [1983]), 12 („Vorspiel: Höllenfahrt“, 1) – einschlägig schon wegen der er-klärten Absicht, „den Mythus“ in Aufhebung aller zeitlichen Zwänge und Le-bensgrenzen als „Fest der Erzählung“ aufzurufen, „daß er sich abspiele in ge-nauer Gegenwart!“ (ebd. 52).
3 Die interdisziplinäre Minimalkonsens-Definition des Mythos als „traditionelle[r]Erzählung von kollektiver Bedeutsamkeit“ hat ihre Tücken. Zu den Definitions-lücken F. Graf, in: Graf/Zgoll/Hazenbos 2000, 633f. – noch zu ergänzen um denpersönlichen, weder aitiologischen noch kosmo-/theogonischen Mythos zurSelbstlegitimation in konkreten Situationen. So begründet der „Mustermythos“Iulian. or. 7 (Gegen den Kyniker Herakleios), 227C-234C von 362 n. Chr., wieso Juliannicht wieder Heide geworden ist, sondern es seit seiner Kindheit nie aufgehörthabe zu sein ... und verteidigt zugleich den Gebrauch selbsterfundener Mythenin der Philosophie (vgl. Rosen 2006, 354-69). Auf eine arbeitsfähige Definitionverzichtet – wegen der zu kleinen Schnittmengen zwischen den Disziplinen –Wansing 2001. Bezeichnenderweise fehlt „Mythos“ als Lemma in der Konzeptionvon O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hgg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Histo-risches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. (8 Bde.) Stuttgart 1972-
48 Jörg Fündling
Wo liegen die Unterschiede? Und – für Wissenschaftler immer einewichtige Frage – wer hat recht? Schon ein flüchtiger Blick auf den mitSpannung erwarteten Film über einen Mythos im antiken und modernenSinn, den Mythos Troja, gibt erste Hinweise, wo die Bruchlinien verlaufenkönnten, die uns zu interessieren haben; anders formuliert: wo sich derSpalt auftut, in den die Intention und die Funktion klassisch-antiker My-then verschwunden sind. Wolfgang Petersens Troja hat bekanntlich dasKunststück fertiggebracht, einen Trojanischen Krieg ohne Götter zu insze-nieren. So ganz revolutionär ist dieser Unsinn nicht: Bereits Kirk Douglas inDie Fahrten des Odysseus (Ulisse), produziert vom gut katholischen Dino deLaurentiis, besiegte 1954 zwar Polyphem unter dem unvermeidlichen Eti-kett, der Kyklop sei ein Sohn des Poseidon ... aber als handelnde Figurenoder selbst als Stimmen im Ohr des Helden traten die Götter eben nicht auf,eine blassgrün angeleuchtete Kirke und zweimaliges Donnergrollen vordem Kampf mit den Freiern ausgenommen. Schrifttafeln zu Anfang undEnde räumten jeden noch verbleibenden Polytheismusverdacht aus.4 Filme
1997; auch vor der Renaissance des Begriffs wäre für beide angesprochenen Fel-der einiges zusammenzutragen gewesen. Exzellent M. Erdbeer in: Erdbeer/Graf2001, 636-642 – klare Grenzziehungen zu Religion/Ritus und Magie; Referat desFeindbildes Mythos 638f. Vgl. auch Graf ebd. mit dem deutungshistorischen Teil.Die antike Begrifflichkeit erschließen jetzt Schmitz/Zanella/Heydasch-Lehmann2013; vgl. v. a. 472f. zur spätantik-christlichen Bedeutungsverschiebung, die inder negativen Konnotation endet. – Moderne Mythenrezeption, v. a. alltagstaug-lich: einleitend M. Baumbach, in: Guthmüller/Baumbach 2001, 632-635. In denhier näher behandelten Fällen ergibt sich nicht unbedingt die dort geschilderteEskapismusfunktion „aus der aufgeklärten Zeit“ (ebd. 635); der Götterapparathilft etwa im Fall von Gods Behaving Badly eher dabei, das Leiden am aufgeklärtSein zu zelebrieren und tapfer wegzulächeln.
4 Kirke: grün angeleuchtet Ulisse (56:40-58:43 der Verführungsszene; Cinema Co-lossal DVD Edition, GTIN: 4020974153874) und von hautfarben zu grünlich-bleichwechselnd beim Angebot der Unsterblichkeit, das in die Totenschau übergeht(1:08:15-1:13:37); nach einem nicht so unheimlichen Intermezzo in der Grottemit den Schweinen (59:25-1:03.25) tritt sie zur Abwechslung auch bleich vorihren grünlichen Dienerinnen (1:05:15-1:06:17) oder solo beim Schiffsuntergangauf (1:06:35-1:07:58). Texttafeln: Zum Auftakt wird versichert: (01:52-02:07)„Questa è una storia di Dei e di Eroi mitici. È la storia di un mondo favoloso nelquale la realtà e il soprannaturale si confondono e gli uomini e le divinitàlottano fra loro. [...]“ Die Endtafel (1:36:59-1:37:23) verkündet: „Oggia la reggia diUlisse, i massi di Polifemo, il sorriso di Penelope, gli incanti di Circe ... tutto giaceconfuso nella medesima polvere. Ma l’immortalità che l’Eroe rifiutò da una Dea,
Das Spiel mit den Blitzen 49
der jüngsten Zeit verfahren in Todesnähe zwar immer noch gern mystisch,halten sich aber agnostisch-bedeckt.5
Das Problem betrifft, wie Petersens Fall zeigt, nicht nur Produzenten,die es sich nicht mit dem Vatikan Pius’ XII. verderben wollten; es ist grund-sätzlicher Natur. Die antiken Stoffe sind für Moderne unwiderstehlich, aberungeheuer sperrig. Ein moderner Skeptiker oder postchristlicher Atheisthat dasselbe Problem, das seine entfernten Vorfahren, die Kirchenväter,mit der antiken Bildung hatten: die Mythen lassen sich wunderbar erzählenund weiterdichten, doch die Götter kommen überall mit hinein. ChristophRansmayrs Die letzte Welt, randvoll mit Anverwandlungen von Ovids Meta-morphosen, nahm die Verwandlungen gern, aber ließ deren unsterbliche Ur-heber links liegen – das Schicksal des ausgegrenzten Dichters und die Fragemoderner Identität waren viel wichtiger. Außerdem mag die Befreiung derMythen aus dem Urheberrecht einem postmodernen Autor als Selbstwertvorgekommen sein. Es gibt die Götter noch – irgendwo – in Christa WolfsKassandra und Medea, aber als psychische Realitäten; nicht mehr als Glau-bensartikel, die nirgendwo in die Handlung eingreifen, sind sie in Inge Mer-kels Penelope-Roman Eine ganz gewöhnliche Ehe, deren allernuminoseste Sze-
un Poeta gliela offrì più tardi. E il canto di Omero aleggia per sempre nel mondoconsacrato dal genio greco come da un sorriso di Dio.“ Das buchstäblich letzteWort bei der Interpretation des paganen Kunstwerks schlechthin behält also derMonotheismus! Zur Hexenfarbe Grün vgl. nur die Auftritte Margaret Hamiltonsals Wicked Witch of the West in Victor Flemings The Wizard of Oz (1938).
5 In Ridley Scotts Gladiator (Single DVD Edition, GTIN: 5050582069242) befiehlteine Stimme den sterbenden Maximus (Russell Crowe) zu seiner Familie heim,als sein Heldenwerk vollbracht ist – aber es wäre nicht möglich, daraus eineübernatürliche Macht zu konstruieren. In die Sterbeszene in der Arena (2:17:08-2:21:11) sind die schon aus der bisherigen Handlung bekannten idyllisch-schmerzhaften Traumbilder von Maximus’ Wiedersehen mit Frau und Kind ein-geschnitten; es ist Lucilla (Connie Nielsen) überlassen, ihm mit den Worten „Goto them“ (2:19:09) das Sterben zu erlauben und die Erfüllung zu konstatieren:„You’re home.“ (2:09:57) Die guten Wünsche der Freunde (und Zuschauer) unddie subjektive Wahrnehmung des Sterbenden berühren sich, was natürlich nochkein transzendentes Erlösungsversprechen ergibt: „home“ kann der Tod ebensosein wie eine bessere Welt. Mit demselben dramatischen Kniff, ins Makabre ge-zogen, würzte schon Heinrich Mann 1903 die nicht besonders gelungene Sterbe-szene der Romanheldin seiner Dekadenzphase: „Tochter Björn Björnsides, steigeauf gen Himmel!“ schreit vor der Tür der ahnungslose Vikar, während eineHermes-Vision sie in Empfang nimmt (Die Göttinnen. III (1903 [1987]), VI, 261).
50 Jörg Fündling
ne, eine große Hexerei, sich bei näherem Hinsehen als Zitat des nicht ganzernstzunehmenden Liebeszaubers aus Thomas Manns Joseph und seineBrüder erweist.6
Gibt es denn keine Romane, in denen die Götter sich so benehmen dür-fen, wie sie es in den Geschichten bekanntlich immer getan haben? In derernstzunehmenden Literatur der letzten Jahrzehnte gibt es genau einen mirbekannten und schon sehr betagten Fall, Wolf von Niebelschütz’ Der blaueKammerherr („Galanter Roman in vier Bänden“), eine völlig anachronisti-sche Synthese von Rokoko, Mittelmeeratmosphäre und der Annahme, dassdie Götter nach wie vor eingreifen und ihren Mutwillen treiben, aber amliebsten in Verkleidung. So kommt es zur Konstellation, dass die charmantePrinzessin Danae sich weigert, Zeus als goldenen Regen zu empfangen, unddadurch ihr Inselreich in eine Krise von mehreren hundert Seiten stürzt.Das Buch fand von Anfang an wenig Zuspruch (höflich gesagt, ist es ein Ge-heimtip); Niebelschütz kombinierte ein langsam und genussvoll auserzähl-tes Stück Entwicklungsroman mit einem Fantasy-Szenario und einer tiefenSehnsucht nach der Zeit, als man sich noch in Ehren duellierte, die Männernicht so langweilig angezogen waren, die Sprache geschliffen, vieldeutigund reich an Bindestrichen war, die erotische Spannung schließlich allge-genwärtig, weil nicht so leicht auszuleben. Und auch die NiebelschützschenGötter sind letzten Endes anscheinend einem Opernlibretto entstiegen – amehesten einem ungeschriebenen aus der Werkstatt Hofmannsthal & Strauss– und schämen sich, das zu sein, was sie sind.7
1. Eine Prise Mythos, reichlich Dekadenz – Antikes bei Suzanne Collins
Zunächst ein ebenso erfolgreiches wie repräsentatives Probestück aus demZentrum der Erfolgsliteratur. Antike Anleihen sind selbstredend nicht anantike Stoffe oder Personen gebunden – in Suzanne Collins’ Trilogie Die Tri-bute von Panem (The Hunger Games), mittlerweile eine Punktlandung aufLeinwand und DVD, dringen sie in ein rund ein halbes Jahrhundert altesGenre vor, den postapokalyptischen Entwicklungsroman für Teenager undjunge Erwachsene. Wo die Vorgänger mal zu Fantasy-, mal zu Science-Fic-
6 Chr. Ransmayr, Die letzte Welt (1988 [1991]); Chr. Wolf, Kassandra (1983); dies., Me-dea. Stimmen (1996 [2008]); I. Merkel, Eine ganz gewöhnliche Ehe (1987 [1989]); zumKapitel „Wendehals“ (142-152) vgl. Th. Mann, Joseph in Ägypten (1936 [1983]),563-575 (Siebentes Hauptstück: Die Grube; „Die Hündin“).
7 W. v. Niebelschütz, Der blaue Kammerherr (1949 [1998]).
Das Spiel mit den Blitzen 51
tion-Elementen griffen, operiert Collins mit der Ästhetik des Actionfilms –die bereits das Buchcover prägt – und mischt in das SF-Szenario eine PriseAntike.8
Die Reihe nutzt unverkennbar das Motiv des alljährlichen Menschenop-fers an eine Bestie (hier das Monster Sensationslust) aus dem Theseusmy-thos und lässt Jugendliche paarweise in den sicheren Tod gehen – auf dieseGrundidee gepfropft wird jedoch der ganze Gehalt des populären Erinne-rungsorts „Römische Dekadenz“, angereichert um Trends der Gegenwart,die genau dadurch natürlich ins Zwielicht gesetzt werden sollen. Das Lese-publikum wird ans Kolosseum denken, nicht an den Minotaurus. Panem istder Staatsname des USA-Nachfolgers in dieser Dystopie, dessen circenses einmedial inszeniertes Gladiatorenspektakel in künstlichen Wildnissen sind,das nur eine(n) Überlebende(n) kennt.9 In seiner rein parasitären Haupt-
8 S. Collins, HG (2008 [2009]); CF (2009); MJ (2010). Erster Teil verfilmt als The Hun-ger Games (2010), Produktion: Nina Jacobson/Jon Kilik, Regie: Gary Ross; geplantist eine Filmtetralogie unter Zweiteilung der letzten Romanvorlage. Zur Ahnen-reihe der als Jugendromane konzipierten Hunger Games-Trilogie gehört unteranderem John Christophers Tripods-Reihe (deutsch Die dreibeinigen Monster, inNeuauflagen Die dreibeinigen Herrscher): The White Mountains (1967); The City ofGold and Lead (1968); The Pool of Fire (1968). In ihr war die Rolle der gnadenlosenUnterdrücker mit inhumaner Ästhetik lediglich an chloratmende Aliens dele-giert, deren (todgeweihte) männliche Sklaven sowie (sofort getötete und präpa-rierte) weibliche Sammelstücke (vgl. The White Mountains, Kapitel 8 „The Pyra-mid of Beauty“) aus Sport- und Schönheitswettbewerben hervorgehen. Hierwird allerdings, wie es der Autor öfter tat (vgl. seine Sword of the Spirits-Trilogie:The Prince in Waiting (1970); Beyond the Burning Lands (1971); The Sword of the Spi-rits (1972)), auf die Kollision mittelalterlicher Gesellschaftsformen mit ‚magi-scher‘ Technik abgestellt, nicht auf Arbeiterelend und ‚Sitten wie im alten Rom‘,so explizit Christophers Vorwort zur ‚35th Anniversary Edition‘ 2003: „a medie-val world threatened and dominated by monstrous futuristic machines.“ (TheWhite Mountains 1967 [2003], ix.) Collins spendiert der zynischen Zentralgewaltim ‚Capitol‘ immerhin Kraftfelder (HG 99 Kap. 6 vgl. CF 243 Kap. 14), „mutta-tions“ (‚mutation‘ gekreuzt mit ‚mutt‘, „Köter“) genannte Tierarten als biologi-sche Waffen (HG 224f. Kap. 14), Strahlenpistolen mit Solargenerator (CF 178 Kap.10) und eine ganze Liste schon wieder vergessener High-Tech-Waffensysteme(MJ 152f. Kap. 9). Die Mischung aus Stilelementen ganz unterschiedlicher Litera-turgenres trägt wesentlich zum gegenwärtigen Vordringen ehemaliger Sparten-und Nischenliteraturen in die Bestsellerlisten bei; vgl. dazu Britt 2012 undspeziell zur Kinder- und Jugendbuchliteratur Craig 2006.
9 Der ausdrückliche Verweis auf panem et circenses (Iuv. sat. 10,81) fällt sehr spät
52 Jörg Fündling
stadt voll des hedonistischen Wohllebens, kurz „The Capitol“ genannt, istSchönheitschirurgie an der Tagesordnung; auf Festen gehört es zum gutenTon, sich diskret zu übergeben, um anschließend weiteressen zu können(das berühmte Vomitorium-Motiv, das in unserer bulimischen Gegenwarteinen Nerv trifft) – und für die Einwohner der unterjochten, am Rand desHungertodes gehaltenen Industrie- und Agrarregionen gibt es Zusatzver-pflegung gegen tesserae (ein Reflex der stadtrömischen Nahrungsvertei-lungen in später Republik und Prinzipat), aber nur um den Preis kumulativsteigender Zusatzchancen, in die Arena geschickt zu werden – wie die Be-zeichnung „tribute“ schon verrät, als Zeichen der Abhängigkeit und Unter-werfung.10 Um diese jährlich neugebauten Kampforte herum verdichtensich die assoziativen Rom-Bezüge: Wie in so mancher Sportreportage istvon „Katakomben“ der Arenen die Rede, Ausrüstungsgegenstände erbeutendie Mitspielenden zu Spielbeginn aus einem Füllhorn, während ihr Einzugins Trainingszentrum auf Quadrigen erfolgt, deren Pferde die Lenkarbeitgleich miterledigen – ohne spieltechnische Bedeutung, also rein der Rom-Evokation zuliebe.11
Das Inventar der teils sprechenden Namen setzt eine weniger spezifi-sche Klassik-Duftmarke; alle Mitglieder der dekadent-skrupellosen Füh-rungsschicht bis hin zum eiskalten Präsidenten Snow beziehen ihre Vorna-men aus dem Repertoire von Römer-Allgemeinwissen und Shakespeare-
(MJ 260 f. Kap. 16) als Chiffre für die Einstellung der medial und materiell gesät-tigten Bevölkerung im ‚Capitol‘.
10 Junge Gladiatoren als „tributes“, ausgelost im Alter zwischen 12 und 18 („rea-ping“: HG 15 (Kap. 1)) als Strafe für den Aufstand der 13 Distrikte, von denenzwölf noch bestehen: HG 21 (Kap. 1). Panem, die postapokalyptischen USA, re-giert vom ‚Capitol‘ aus: HG 7 vgl. 21 (Kap. 1); das Capitol „in a place once calledthe Rockies“: HG 50 (Kap. 3). Tesserae: HG 15f. (Kap. 1). Die Hauptstädter mit ih-ren „capricious fashion trends“ (CF 42 Kap. 3), „oddly dressed people with bizar-re hair and painted faces“ (HG 72 Kap. 4), setzen auf Epilation und Make-up auchfür Männer (HG 75. 77 Kap. 5), Schönheitschirurgie (HG 150f. Kap. 9) und allerleials „freakish“ bewertete Körpermodifikationen (CF 60 Kap. 4). Brechmittel imschicken Glas, „vomiting for the pleasure of filling their bellies again and again“:CF 97f. Kap. 6; zur modernen Obsession mit den vomitiven Römern vgl. Fündling2004, 69f. mit Anm. 29. – Ein antikisierendes Signalwort ist auch „Avox“ als Ter-minus technicus für strafweise ihrer Stimme Beraubte (HG 94f. Kap. 6).
11 Arenatourismus, „rewatch the Games, tour the catacombs“: HG 175 Kap. 10; Waf-fen und Ausrüstung aus „the Cornucopia“: HG 179 Kap. 11. Quadrigen: HG 82-86Kap. 5.
Das Spiel mit den Blitzen 53
Dramen, genauso aber die berechnende Gegen-Präsidentin Coin im Rebel-lendistrikt 13.12 Ihre teils einsilbigen, teils Bigotterie andeutenden Nachna-men suggerieren dagegen eher die WASP-Eliten der Ostküste oder vielleichtfundamentalistische Sekten – wozu sich ein Hauch Sklavenhalteratmosphä-re gesellt, da der von Schwarzen bevölkerte Agrardistrikt 11 außer mit tota-litären Wachtürmen auch mit einer Verwaltungsvilla im Plantagenstil gar-niert ist.13 Die Religion glänzt ansonsten durch Abwesenheit.
In der gewaltdurchzogenen Panem-Welt wird also ein antik-mythischesAusgangsmotiv fast völlig überwuchert von einem modern mythisiertenZug aus der antiken Realität – und berührt die Fixpunkte des US-amerika-nischen Geschichtsbewusstseins wie den heroisierten Kampf der 13 Grün-derkolonien gegen die ferne Monarchie … oder das tiefverwurzelte Miss-trauen gegenüber jedem Zentralismus der Bundesregierung und dem Wa-shingtoner Establishment, auch jenseits konservativer Kreise. Tatsächlicherschöpft sich die Struktur, die Collins uns von ihrer Zukunftswelt sehenlässt, beinahe in diesen umfunktionierten Vorgaben, und gerade sie verlei-hen – jenseits der Action- und Thriller-Elemente – dem Szenario seineSchlagkraft, einschließlich seiner Kritik an der gnadenlosen Verwertung
12 Romanisierende Vornamen: Präsidentin „Alma Coin“ aus Distrikt 13 (MJ 11 Kap.1; hier stand sicher der eigentlich spanische Vorname Pate) agiert gegen denMachthaber „Coriolanus Snow“ (MJ 200 Kap. 12). Der Talkmaster Caesar Flicker-man (HG 150 Kap. 9) steht neben dem Spielemoderator Claudius Templesmith(HG 178 Kap. 10), dem Nervenarzt „Dr Aurelius“ (MJ 410 Kap. 25), dem „Head Ga-memaker“ Seneca Crane (CF 24 Kap. 2) und seinem Nachfolger „Plutarch Hea-vensbee“ (CF 99f. Kap. 6) samt Assistentin „Fulvia Cardew“ (MJ 11 Kap. 1) oderdem „Head Peacekeeper“ von Distrikt 12, „Romulus Thread“ (MJ 7 Kap. 1). Dieprivilegierten Untertanen im Sektor 2 haben ebenfalls Namen wie „Cato“ (HG220 Kap. 13), „Brutus“ (CF 230 Kap. 14) und, besonders interessant, „Enobaria“(CF 270 Kap. 16). Hier hat Collins eindeutig die Personenliste aus ShakespearesAntony and Cleopatra geplündert, wo Cn. Domitius Ahenobarbus (cos. 32 v. Chr.)als „Enobarbus“ figuriert, Shakespeares lateinischer Plutarch-Ausgabe entspre-chend. Allein im Designer- und Makeupteam von Katniss begegnen wir „Venia“(frei erfunden, wie es scheint), „Octavia“, „Flavius“ und „Cinna“ (HG 74f. Kap. 5);später assistieren ihr noch die Regisseurin „Cressida“, der Regieassistent „Mes-salla“ (MJ 101 Kap. 7; hier steht ziemlich sicher der Schurke aus Lew Wallace,Ben-Hur (1880) Pate) sowie die Kameraleute Castor und Pollux (MJ 122 Kap. 8).
13 Distrikt 11: CF 67 Kap. 4-87 Kap. 5. Auspeitschungen gibt es auch (CF 129-138 Kap.8), komplett mit Galgen und Pranger (155 Kap. 9 und 182 Kap. 11 versehentlich„stockades“ („Palisade“/„Pferch, Militärgefängnis“) statt „stocks“ genannt).
54 Jörg Fündling
des Individuums, das entweder Arbeitssklave oder ästhetisch aufgearbeite-tes, marktfähiges Kunstprodukt ist. (Wobei die unfreiwillige Selbstironienatürlich nicht ausbleibt, diese Kritik in so mehrheitsfähiger, marktgän-giger Weise vorgetragen zu sehen, die mal zur Identifikation mit Katniss,der Modeikone, einlädt, mal mit Katniss, der unbesiegbaren Überlebens-maschine.)14 Auf jeden Fall aber begegnen wir nichts als menschengemach-ten Problemen in einer von Menschen verwüsteten und verfremdeten Welt.Immanenter geht es nicht.
2. Amy Myers: Aphrodite, übernehmen Sie!
Hat die Gegenwart ein so großes Problem mit den Göttern, dass sie garnicht mehr zu finden sind? Keineswegs – wir dürfen nur nicht zu wähle-risch bei der Suche sein. Einige Fälle, vorwiegend aus der populären Litera-tur, stellen Brut- und Rückzugsgebiete unterschiedlicher Größe dar – Wer-ke, deren Autoren uns freundlicherweise mit reichlich Hinweisen versor-gen, wie genau sie die sperrige griechisch-römische Götterwelt mundge-recht und gegenwartstauglich gemacht haben. Wie Plinius der Ältere gernesagte: Kein Buch ist so schlecht, dass sich nichts daraus lernen ließe, und esgibt deutlich schlimmere Vertreter als die unseren.15
Fall Nr. 1, der mit Abstand einfachste, stammt bereits aus dem Jahr 1996:Die Götter als Mitspieler in einem Krimi – und eine Göttin als Ermittlerin.Aphrodite’s Trojan Horse von Amy Myers ist eine Ich-Erzählung der unwider-stehlichen, raffinierten, aber nicht besonders scharfsinnigen Aphrodite, derdie Verbannung in den Hades droht, weil sie verdächtig ist, Zeus einen Don-nerkeil gestohlen zu haben, mit dem zu allem Unglück ein Mord begangenworden ist. In der Unterwelt gibt es keinen guten Kosmetiker und der Sexist langweilig, also strengt die Göttin sich an, verdächtigt auf 25 Druckseitenreihenweise Personen am Tatort Troja, von denen die meisten schon einmalnähere Kontakte zur Ermittlerin hatten, wenn sie nicht gerade (wie Aeneas)in direkter Verwandtschaft mit ihr stehen. Das schmälert vielleicht trotzAutopsie die Objektivität der Ermittlung, aber keineswegs das solide Eigen-
14 Zur Ambivalenz vgl. nur HG 145f. Kap. 9, wo die Freude am spektakulären Hel-dinnendress und die Anklage der tödlichen Unterhaltungsgesellschaft Hand inHand gehen; allerdings wird der Heldin Katniss das Vergnügen an schillerndenAuftritten über alle drei Bände hin konsequent ausgetrieben.
15 [...] dicere enim solebat nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte prodesset(Plin. ep. 3,5,10).
Das Spiel mit den Blitzen 55
interesse, den richtigen Täter zu finden. Allen männlichen Zeugen wird zu-verlässig der Kopf verdreht. Zu guter Letzt stolpert Aphrodite, als es bereitseng wird, natürlich über die richtige Lösung, auch wenn sie mit ihren mu-schelgleichen Ohren, unvergleichlichen Knien und einer langen erotischenTo-do-Liste eigentlich stärker beschäftigt war – wenigstens sie selber isthinterher fest überzeugt, dass die Gerüchte, sie habe kein Hirn im Kopf„just because I’m beautiful, and loving, and kind“, widerlegt sind.16
Was ist der Reiz gerade dieser Krimi-Parodie? Neben den mutwillig her-beigeführten Kollisionen zwischen Olymp und genretypischen Zutaten zumeinen die Sprache voller homerischer Floskeln und O-Anreden, die sich soherrlich mit den niederen Motiven von Menschen und Göttern beißt (aus-gerechnet der fromme Aeneas wehklagt mit Serien von „Ay me, alack“usw.; natürlich ist er der Schurke);17 im wenn nicht hellen, dann zumindestrespektlosen Köpfchen der unsterblichen Erzählerin läuft der passendeKommentar mit. Zum anderen haben wir die undurchsichtigen Beziehun-gen zwischen Griechen und Troern, ein ergiebiges Thema: Freund undFeind verschwimmen, fest steht nur der schlechte Ausgang. In der Wolf-schen Kassandra findet sich das auch, aber die wahrscheinliche Anregung istShakespeares Troilus and Cressida, randvoll mit schäbig sich verhaltenden„Helden“ rund um das Liebespaar; das verlogene, notorisch untreue Hausdes Priamos, dessen Mitglieder unsere vielgeplagte Göttin selbst im Bettnoch belügen und sich nicht einmal über den Kriegsausgang groß den Kopfzerbrechen – „bevor [Troja] fällt“, meint der gottgeleitete Seher Helenos,„wollen wir vielleicht noch ...?“18
16 Donnerkeil: ATH 2; Standortnachteile des Hades: ebd. 3 (Friseure); 11 (Männer-auswahl). Autopsie: durch den Götterarzt Paieon (ebd. 4f. irrig „Paean“ in Ver-wechslung mit dem Aspekt Apollons), inklusive Fachjargon (ebd. 5: „‚There’s noevidence of thunderbolt blackening to his air passages [...]‘“. Gründliches Selbst-gefühl: ATH 1 („my splendid hyacinth-blue orbs“), 2 („my golden body [...] myshell-like ears“), 4 („my wondrous breasts“) und, entsprechend dem Charakterder Protagonistin, passim. „just because ...“: ebd. 3.
17 Konventionen: etwa Alibis und Zeitangaben (ATH 19: „You can’t have been atyour bowmakers for two hours. Helen left the trysting place at four o’sundial[...]”) oder der klassische Vortrag des richtigen Tathergangs durch die Detekti-vin (ebd. 23f.). Epitheta: z. B. ebd. 4 „quoth the Queen of the Sour Grapes, PallasAthene“; 17 „Paris of the once golden skin, Helenus of the slim sexy body“. „Ay,[sic] me, alack“: ATH 6.
18 Das Mordopfer Marmedes, „Chief of Staff to Diomedes“ (ATH 12), hat sich für sei-
56 Jörg Fündling
Drittens sorgen aber gerade die Götter selbst für den komischen Effekt,und zwar, indem sie sich völlig eposgerecht verhalten, in nur leicht moder-nisierter Sprache. Alles, was sie ausmacht, ist da: Egoismus, das Austobenjeder kleinen Laune, das Erwarten unbedingten Respekts, Rachsucht ... undAphrodite als zickiges Supermodel durch die Handlung stöckeln zu lassenist da nur logisch. Sie hat zwar nichts unter Kontrolle, aber dafür die ganzeepisch-heroische Männerwelt um den Finger gewickelt – der ihr als Aufpas-ser zugeteilte Ares blamiert sich umgehend, als sie ihm zuhaucht: „Möch-test du mich in Ketten legen?“ „Mach’ ich sonst eigentlich nicht, jedenfallsnicht beim ersten Mal“, stottert der olympische Macho; wir dürfen einekundige Vorausdeutung auf das misslungene Rendezvous des Pärchens ver-muten, das Hephaistos’ goldenes Netz in ein unfreiwilliges Fesselspielchenverwandelte.19
Noch logischer ist es, den Spaß nach 25 Seiten zu beenden, denn an die-ser Stelle haben wir begriffen, weswegen Platon gern Homer und Hesiod ex-emplarisch durch Ausschluss aus seiner Idealpolis bestraft hätte, weil sieRufmord an den Göttern und Heroen begangen haben – der rabiate, sadisti-sche Zeus der Ilias ist nie wieder ganz in Vergessenheit geraten, nicht ein-mal durch den erhabenen, moralischen Zeus der Odyssee.20 Die Göttin derLiebe, die Helena ins Bett des Paris kommandiert, weil sie für den goldenenApfel auch über zehn Jahre später noch prompte Lieferung schuldet, ist inein Großstadtluder direkt übersetzbar – Leser können sich mit so einerHauptfigur nur auf Zeit identifizieren; „rein menschlich“, wie das immer soschön heißt, ist so etwas nicht einmal probeweise und im Roman als höhereMacht zu empfinden. Über die Willkür, die darin liegt, aus Prestige- undUnterhaltungsgründen Troja zu vernichten und im Gegenzug die Verwüs-
ne Affäre mit Helena regelmäßig nach Troia geschlichen (ebd. 12-14), Anchisesspioniert umgekehrt im griechischen Lager (ebd. 15f.). Helenos: „‚Before it does[sc. fall],‘ he offered enticingly, his hand resuming its delightful movements,‚how about ...‘“ (ebd. 18).
19 Ares: „ ‘Do you wish to chain me?‘ I asked in a low seductive voice. He turnedred. ‘I don’t, usually, not the first time’, he stuttered.“ (ATH 4) Das goldene Netz:Hom. Od. 8, 266-366.
20 Platon: Politeia (2,) 377d-378d; vgl. (10,) 600d; 606e. Die Zensur der Dichtung:2,377d-3,398b; 10,595a-608b macht geradezu tabula rasa für Platons eigenen My-thos vom Lohn der Gerechten – in der Schule auch gern für seine eigenen Schrif-ten und alles, was ihnen am nächsten verwandt ist: Nomoi 7,810b-812a – zu denGöttermythen abschätzig 10,886b-d.
Das Spiel mit den Blitzen 57
tung weiterer Städte ins Auge zu fassen, sind schon Bücher geschriebenworden – wie sie auf uns wirkt, demonstriert dieser unterhaltsame kleineKrimi sehr schön. Er setzt im Komischen da an, wo sich die Ilias selbst eintodernstes Aufbäumen leistet, als Aphrodite ihren Spielball Helena zu Parisbefiehlt und die Kriegsursache, einen Moment lang ihrer Verfallenheit anden Entführer entkommen, es wagt, der Göttin kaum verschlüsselt ent-gegenzuschleudern: „Dann geh doch selber zu ihm“, natürlich ins Bett.21
Umsonst, versteht sich, denn gegen Götter kann man nicht kämpfen.Helena wird wieder so hörig sein wie zuvor, Paris sein Vergnügen weiterhinbekommen, und was ausgerechnet Homer gepackt hat, mit diesen Versenan den Rand der Gotteslästerung zu gehen, bleibt sein Geheimnis.
Es trifft sich, dass im gleichen Band auch der Gründungsmythos Roms,der Brudermord des Romulus, vertreten ist – und dort sucht man die Göttervergebens. Dass Mars der Vater des Täters (und des Opfers) sein soll, glaubtdoch niemand, dass Jupiter den alternden Romulus zu sich entrückt habe,noch weniger ... und so erklärt uns die Autorin dieser Impression, keine ge-ringere als Lindsey Davis, den möglichen zweiten Mord durch die Blume alsRacheakt für den ersten.22 Hier sind wir schon einige Stufen weiter: der mo-derne Pessimismus, was die Niedrigkeit menschlicher Motive angeht, über-trägt sich notwendigerweise in eine Abwesenheit der Götter, die niemandauch nur verbal bemüht. Alle Akteure sind allein auf der Bühne.
3. Marie Phillips: Wir bekommen die Götter, die wir nötig haben
Wenn jemand aber diesen modernen Pessimismus einmal mit der Annahmekombinieren würde, es gäbe trotz allem Götter, was käme dabei heraus?Vielleicht eine Komödie, vielleicht auch eine Farce, die am Ende in etwasanderes umkippt. Das führt uns zu Gods Behaving Badly von Marie Phillips.Der Roman von 2007 beginnt mit einem verschärften Fall von Euhemeris-mus, oder so sieht es zumindest anfangs aus. Die wichtigsten Olympier sindnach London umgezogen (der Rest ist „scattered around the globe“), weildort die Grundstücke so billig waren; leider war das vor dem Großen Feuervon 1666, was heutzutage den Lebensstandard dieser besonderen Familieetwas drückt. Hephaistos (alias „Heppy“) hält mit Müh und Not das brö-
21 Ausgehend von Xenophanes’ berühmter Homerkritik (fr. 11 Diels-Kranz). Helenagegen Aphrodite: Hom. Il. 3,406-409.
22 L. Davis, Investigating the Silvius Boys (1995 [1996]). Romulus’ gewaltsamer Tod:vgl. Liv. 1,16,4: discerptum a senatoribus.
58 Jörg Fündling
ckelnde Haus intakt, Artemis verdient ihr Geld mit Dogwalking in den Grün-anlagen, nippt in ihrer Freizeit Ambrosia vor der Flimmerkiste und siehtKampf der Titanen, Aphrodite hauptsächlich mit Telefonsex. Athene ist imAnlagegeschäft und hat sich eine furchtbare Sachbearbeitersprache ange-wöhnt, während Apollon die ihm verbliebene Prophetie als Hauptpersoneiner billigen Fernsehshow ausschlachtet und Frauen, die ihn abblitzenlassen, in Bäume verwandelt. (Die Australierin Kate, die bei Goldman Sachsarbeitet, wird sinnigerweise ein Eukalyptus – der Roman ist deutlich älterals die Bankenkrise von 2009, es handelt sich also nicht um gerechtegöttliche Vergeltung.) Zeus hat das Familienschlafzimmer seit Jahren nichtmehr verlassen. Richtig gut geht es eigentlich nur Dionysos (ihm gehört einNachtclub). Und dann ist da noch Eros, das schwarze Schaf der Familie –dieser charakterlose Lump hat sich doch tatsächlich einer christlichenErweckungsgemeinde angeschlossen und leidet unter schweren Schuldge-fühlen. Allein Ares zettelt – aber als Non-Profit-Unternehmen – nach wievor sehr erfolgreich Kriege an.23
Was ist nur los mit diesen Göttern? Sie nähren in der Tat wortwörtlich„von Opfersteuern und Gebetshauch ihre Majestät“, heutzutage also darbensie, weil seit langer Zeit so gut wie niemand mehr an sie glaubt. Damals inRom gab es noch reichlich Orgien, aber eine neue Zeit brach an, und jetztfehlt die Basis. 24
Nach dem heutzutage bekanntesten Propagator können wir ruhig vomTerry-Pratchett-Prinzip sprechen: Eine Gottheit ist effektiv genauso mäch-tig, wie sie Glauben findet, und zwar buchstäblich, nicht im übertragenenSinn.25 Das bringt die sehr mäßig geglückte Haupthandlung in Gang: Als
23 Götter „scattered ...“: GBB 205f.; Grundstücke, „Heppy“: ebd. 7. Artemis’ Feier-abend: 120. Aphrodite: 23f.; 50; Athene: 11f.; 110-113; 118-120. Apollons Show:31-35; 43; Kate, der Baum: ebd. 1-4. Zeus: 121-126. Dionysos: 102-107. FrommerEros: 24-26; 35-37; 67-69. Ares: 12 vgl. 10; 120f.
24 „Opfersteuern ...“: J. W. Goethe, „Prometheus“ (1774? [1981]), V. 26f. Glaubens-verlust: GBB 62; 251; 269. Auf der Saalburg verbrannten die Mitarbeiter Ende der1990er Jahre vor dem fiktiven, extrem unschmeichelhaften Kaiserbild im Fah-nenheiligtum ein paar Weihrauchkörner, als der Raum fertig renoviert war;Nutzeffekte sind nicht verbürgt. (Mündliche Mitteilung Margot Klee an die Li-mes-Exkursion des Seminars für Alte Geschichte der Universität Bonn 1998.) Or-gien: GBB 67.
25 Formuliert in T. Pratchett, Small Gods (1992 [1993]), z. B. 11: „Because what godsneed is belief, and what humans want is gods.“ (Pratchett, selbst Atheist, würde
Das Spiel mit den Blitzen 59
Apollon fröhlich weitersündigt und dabei seinen Eid bei Styx verletzt, denallein die Götter fürchten, kostet ihn dies den Rest seiner verbliebenenKraft – und die Sonne erlischt. Womit sich uns enthüllt, dass die Götter, soerbärmlich sie sich benehmen, trotz allem eine reale Verbindung zudiversen Naturkräften bewahrt haben. Kein Verhältnis der Bedeutung derGötter besteht dagegen zu ihrer Persönlichkeit (Athene als administrativesBüromäuschen, das niemand versteht) oder ihrem – schäbigen, dysfunktio-nalen – Lebensstil. Die Götter karikieren unsere Gesellschaft, die Gesell-schaft karikiert sie: platt ausgedrückt würde sich in dieser Weltdeutungjemand wiederfinden, der die Welt überwiegend für Chaos hält und dasverbleibende Minimum an Plan und Ordnung aus methodischem Pessimis-mus in den Zuständigkeitsbereich irgendwelcher Nichtskönner fallen lässt.Aber damit muss man sich – zumindest in diesem Buch – eben abfinden.26
Alternativen gibt es nicht, wie mit einigen antichristlichen Spitzen ver-deutlicht wird. Jesus ist tot und in der Unterwelt, wenn er nicht da wäre,dann wäre er ja wie alle anderen ein Gespenst geworden ... falls sein Lebengemäß den Evangelien kein PR-Gag gewesen sei, halte er sich zweifellosganz still, um keine verärgerten Mit-Toten auf sich aufmerksam zu machen,meint Artemis, die Vernünftige unter den Göttern, und distanziert sich vonder religiösen Konkurrenz, um bei der agnostischen Hauptperson Neil eineChance auf Glaubwürdigkeit zu haben.27 In der Figur des weichgespült fun-
natürlich nie behaupten, die Menschen bräuchten Götter.) Wiederholt ebd. 190:„‘[...] Do you know how gods get power?’ ‘By people believing in them,’ saidBrutha.“ Zum theologischen Konzept Rüster 2003; Clute 2004 (freundlicher Hin-weis von Martin Lindner). Die sozusagen physikalisch messbare „Glaubenskraft“ist ein deutlich älteres Thema der phantastischen Literatur; sie begegnet in sehrmaterialistischem Sinn etwa in A. E. van Vogt, The Book of Ptath (1947): Menschenkönnen dadurch mit quasigöttlichen Fähigkeiten arbeiten, dass ihre Anhänger –vor allem Anhängerinnen – sich auf Gebetsstäbe konzentrieren, die als Sammel-antennen für diese „Gebetsenergie“ dienen.
26 Apollon und die Sonne: GBB 198. Styx: Hom. Il. 15,37f.; Hom. Od. 5,185f. Ob siesterben können? „Der große Pan ist tot!“ kommt bei Rick Riordan vor (PJ 1, 189),vgl. Plut. de def. or. 17 = Mor. 219 a-d, aber nicht hier bei Phillips; Demeterzumindest befürchtet ihren Tod (GBB 80f.). Die implizite ‚Chaostheorie‘ verbin-det Phillips – wie der Tonfall, den sie anzuschlagen versucht – mit DouglasAdams’ The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy (1979 [1995]), zu dessen Paradestellendie Aussage gehört „that the entire multi-dimensional infinity of the Universe isalmost certainly being run by a bunch of maniacs.“ (140 Kap. 31)
27 Jesus: GBB 66-68; Alice ist taufschein-anglikanische Gelegenheitskirchgängerin
60 Jörg Fündling
damentalistischen Eros steckt offensichtlich die Anklage, das Christentumhabe der wahren Liebe den Rest gegeben; das Pärchen Alice und Neil rettetanscheinend ihre Indifferenz vor diesem schrecklichen Kältetod – vor derobligatorischen Unterwelt aber keineswegs. Gibt es da nicht noch ein paarandere Weltreligionen? Darüber redet die Autorin lieber nicht.28
Die Rettung der Menschheit beruht nun darauf, dass die Götter – die an-deren sind mit ihrem Kräfteschwund dicht hinter dem Sonnengott – umge-hend gestärkt werden, also Glauben finden. Praktischerweise bestand Apol-lons letzte Freveltat darin, das gehemmte, ärmliche, der Leserschaft nach-drücklich ans Herz gelegte Liebespaar auseinanderzubringen, indem erZeus’ Zorn (und dessen Blitze) auf die Heldin Alice lenkte, weil sie ihn abge-wiesen hat. Jetzt zieht ihr Liebster Neil in die Unterwelt – die uns lang und
(ebd. 155), ihr Freund Neil „not a big fan of religious stories“ (173). Artemis ver-sichert ihm, anders zu sein als „all those so-called religious people who are justpeddling lies and false comfort“ (175). Nicht zufällig ist Großbritannien dasLand, in dem es einerseits multireligiöse Weihnachtskarten, andererseits spezi-fische Debatten um und gegen das Zeigen christlicher Symbolik in der Öffent-lichkeit gibt (etwa bei British Airways und im Pflegebereich; vgl. N. N. (dpa) 2013).Eine als Vorgehen gegen nichtchristliche Religionen – speziell Islamfeindlich-keit – interpretierbare Globalkritik ist dagegen angesichts der Vielfalt an Bevöl-kerungsgruppen aus dem Commonwealth und den einstigen Kolonien stark ta-buisiert, anders als etwa im kontinentalen ‚Kopftuchstreit‘ oder auch unternordamerikanischen Atheisten. So machen eher ‚missionarische‘ Atheisten seit2008 zwar Werbung auf Londoner Bussen, beschränken sich aber gleichzeitig aufeine Aussage, die aus dem Fundus von Monty Python genommen sein könnte:„There is probably no God. So just relax and enjoy your life.“ (VGl. http://en.wi-kipedia.org/wiki/Atheist_Bus_Campaign; letzter Zugriff 03.04.2013). Zum Hin-tergrund des an 1914 zerbrochenen, protestantisch grundierten englischen„Moralismus“ des 19. Jh. Matthews 2009 [2012], 655-666; 681-688.
28 Zur Vorstellung der Antike als einer Blütezeit körperlich wie seelisch erfüllterLiebe ist die Quellenlage ernüchternd, aber das hat Projektionen noch nie imWeg gestanden, auch wenn sie einander gegenseitig ausschließen: vgl. nur A. C.Swinburnes Antikenphantasien wie „Anactoria“, „Faustine“ oder „Dolores“, indenen eine weniger idyllische Sorte Eros regiert. – Die Verbindlichkeit des anti-ken Unterweltmodells für die von Zeus erschlagene Alice (GBB 138-146; 155-158;177-183 usw.) ist übrigens ein interessanter Unterschied zu Terry Pratchetts li-beraler Scheibenwelt, wo im Jenseits bekanntlich jedem genau das passiert, waser zu Lebzeiten erwartet hat. Vgl. Mort (1987 [1988]), 117: “[... E]VERYONE GETS WHAT
THEY THINK IS COMING TO THEM. IT’S SO MUCH NEATER THAT WAY. [...] I EXPECT IT ALL WORKS OUT
PROPERLY IN THE END.”
Das Spiel mit den Blitzen 61
breit ausgemalt wird –, soll sich als wahrer Held erweisen und tut es natür-lich auch auf seine liebenswert ungeschickte, entwaffnende Art. Auf demTrafalgar Square wird eine beunruhigte Masse zu Zeugen einer richtigenAuferstehung, genauer, der Wiederverkörperung eines Geistes (den Zeusselbst erst aus Dummheit zum Geist gemacht hat); die Leute glauben es, daswiederum verjüngt die Götter schlagartig, sie wecken Apollon, die Sonnekehrt zurück und der mehr oder weniger kirchlichen Hochzeit steht nichtsmehr im Wege.29
Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass ein Buch, in dem es sarkastischzugeht, nicht in den Kitsch abgleiten kann – aber das ist nicht unsere Frage-stellung, auch nicht, wie traurig es um die Menschheit steht, wenn sie sichausschließlich an Machtdemonstrationen orientieren sollte. Was drücktsich in den Phillips-Göttern aus? Sie repräsentieren Fundamentalkräfte derNatur wie der menschlichen Empfindungen oder Gemütszustände; durchihr bloßes Dasein in anthropomorpher Gestalt halten sie irgendwie die Na-tur aufrecht, lassen die Sonne aufgehen und so weiter.30 Das hat objektiv ge-sehen – samt der Immoralität – etwas Wahnhaftes, und bloß weil die aufden Hund gekommenen Himmelsbewohner durch die Ereignisse Oberwass-er erhalten, dürfen wir nicht darauf hoffen, sie würden sich in der Buchrea-lität künftig verantwortlicher verhalten, da sie ihre Allmachtsphantasiennun wieder ausleben können.
Der Versuch, mit der metaphysischen Einsamkeit Witze zu machen,lässt es am Ende unentschieden, ob wir mehr unter der Ab- oder Anwesen-heit von etwas Transzendentem leiden würden. Mit der Möglichkeit, klareVerhältnisse zu schaffen, wird kurz gespielt, dann wird sie beiseite gewor-fen – der Epilog weicht der Frage aus, wie es jetzt weitergeht mit der Welt,er serviert einen Komödienschluss im Boulevardstil. Hinter jeder Komödiesteht aber ein Bündel Ängste und eine Möglichkeit, die Welt könnte tra-gisch ausgehen. Es ist vielleicht typisch deutsch, die Sinnfrage an ein soleichtes wie ausweichend geschriebenes Buch zu stellen. Was ist der Mehr-wert dieser Götter?
29 Apollons Betrug und der Tod für Alice: GBB 125f., 132; Neil in der Unterwelt: ebd.208-259; Trafalgar Square: 262-274; Hochzeitspläne: 275-277.
30 „There’s a god for everything“ (206) wird nur behauptet, nicht entfaltet.
62 Jörg Fündling
4. Intermezzo: Ernste Literatur und ihr Liebäugeln mit dem Heidentum
Eine klarere Antwort bieten uns da zwei literarische Schwergewichte. JohnBanville führt uns in The Infinities von 2009 eine Wirklichkeit vor, in derHermes ohne weiteres als Erzähler auftreten kann – als nicht ganz glaub-würdiger, denn eventuell ist die Götterstimme auch nur ein innererMonolog der im Sterben liegenden menschlichen Hauptperson, und nochdazu befinden wir uns in einem Paralleluniversum, in dem die „kalte Kern-fusion“ kein Wissenschaftsschwindel ist, sondern das Ende aller Energiesor-gen, wo die Post in England vom Haus Thurn und Taxis zugestellt wird,Schweden ständig Kriege führt, Goethe ein vergessener Dichter ist und woCesare Borgia als „peacemaker and patron of the natural sciences and arts“in dankbarer Erinnerung bleibt.31
Was identisch und unverrückbar bleibt, ist der mythische Kernbestand,soweit Hermes sich im Beisein der Leser (etwas sentimental) zurückerin-nert. Auch die Götter dieser Was-wäre-wenn-Realität sind völlig wie im Le-xikon und bekennen sich sogar – in Maßen – zum Henotheismus, ohne sichdadurch von Rivalitäten untereinander (also in sich) abhalten zu lassen.Epikur hatte übrigens recht: Sie residieren in den Zwischenräumen der un-endlichen Vielzahl von Welten. Und die Kreationisten haben ebenfallsrecht: Sämtliche Fossilien sind ebenso eine von den Göttern gelegte falscheFährte wie die kosmische Hintergrundstrahlung und die Dunkle Materie –alles dazu da, um den Menschen die schmerzliche Einsicht zu ersparen, dassPrometheus ihn aus Lehm erschaffen hat.32
31 Borgia: Inf 219; Post: ebd. 5, Goethe: 161, Schweden: 162; die Evolutionstheoriewird statt Charles Darwin nun dem wissenschaftshistorischen ‚Verlierer‘, sei-nem Freund Alfred Russel Wallace zugeschrieben (90). Kalte Fusion: ein Neben-produkt der physikalischen „Brahma hypothesis“ (164) des im Sterben liegen-den – und mit Namenssymbolik überfrachteten – Adam Godley; sie hat unter an-derem die Wiedereinführung der Dampflokomotive bewirkt: 95. Ein Nest wei-terer Unterschiede zu unserer Realität ebd. 171. – Zur problematischen Frage,wer jeweils erzählt und wieso, Eoghan Smith, „The Melancholy Gods“. Dublin Re-view of Books vom 18.2.2010; http://www.drb.ie/more_details/10-02-18/The_Me-lancholy_Gods.aspx (eingesehen 20.8.2012).
32 Henotheismus: „we are all one even in our separateness – and when I use theword ‚father‘, say, or ‚him‘, or, for that matter, ‚me‘, I do so only for conveni-ence.“ (Inf 145) Unmittelbar darauf lästert Hermes über Pan ... Kreationismus:ebd. 16: „So that the mud men [...] might think themselves the lords of creation.“Intermundien: „For us, the deathless ones, there is [...] only the infinite here,
Das Spiel mit den Blitzen 63
Auch anderes ersparen sie ihm, und das ist nicht allein bei Banville derselling point des Polytheismus: Das Dasein des Olymps entlastet die Mensch-heit von jeder Verantwortung für die sehr unzureichende Art, wie sie lebt,und bestätigt die Tragik eines sterblichen Lebens in wünschenswerter Wei-se – man ist Spielball der Götter, mehr Sinn gibt es nicht zu entdecken, alsoverpflichtet der Götterglaube auch zu nichts, gewiss zu keiner Dankbarkeit,aber nicht einmal zum Glauben. (Das mit den Opferpflichten und der noto-rischen Empfindlichkeit der Olympier scheint Hermes entfallen zu sein.)33
Soweit es zu katastrophalen Folgen göttlicher Interventionen in die Men-schenwelt kommt, resultieren sie oft nicht einmal aus Spieltrieb, sondernentstehen – darf man es glauben? – weil einzelnen Götterlieblingen gehol-fen werden sollte; ja bei Herakles haben wir es sogar (sagt Hermes) mit ei-nem Plan zur Abschaffung des Todes zu tun.34
Das scheint die Sache auf den Punkt zu bringen. Wo die Götter bei MariePhillips sozial abgesunken sind, befinden sie sich hier in einem Zustand derDekonstruktion, der ihnen aber immerhin ein dauerndes Mitspielen in derHandlung erlaubt (die zwischen A Midsummer Night’s Dream und Kleists na-
which is a kind of not-here“ (ebd.); abgesehen von der Parallelwelt „there is aninfinity of others just like it that we made“ (15); wie verbindlich eine solcheAussage aus dem Erzählermund des Gottes der Lügner für Autor, Leser und bei-der Primärwirklichkeit ist, verkompliziert das narratologische Grundproblem –kaum ungewollt.
33 Zentral ist Inf 91f.: „We offer you no salvation of the soul, but no damnation,either; no afterlife in which to be bored for all eternity; no parousia, no day ofreckoning and divine retribution, no kingdom of heaven on earth; nothing, infact, except stories, comforting or at least comfortingly reasonable accounts ofhow and why thing are as they are [...] Above all, we would have you acknow-ledge and accept that the nature of your lives is tragic, not because life is cruelor sad [...] but because it is what it is [...] and, above all, because you will die andbe as though you had never been. That is the difference between us and yourmealy-mouthed Saviour, so-called [...]“. Kurz vorher erscheint Jesus unter demEtikett „the pale Galilean“ (Inf 91; eine Prägung von A. C. Swinburne in „Hymn toProserpine“, V. 35), und das, obwohl die christliche Trinität später „our avatar,the triune lord of a later epiphany“ heißt (Inf 260). Die Konkurrenz muss dochnoch schärfer sein, als Hermes zugibt. Auf der menschlichen Seite entsprichtdem verdächtig gut die Überzeugung Adams, seine letzten Gedanken hörten nur„the gods, who do not have it in their power to absolve me“ (ebd. 167).
34 Hilfsversuche: „I tried to do Orpheus a favour, he was so heartsore, but look atthe consequences.“ (Inf 131). Zeus: ebd. 210f.
64 Jörg Fündling
mentlich zitiertem Amphitryon oszilliert), und in so sperrigen Aussagen gip-felt wie: „Only sometimes am I omniscient.“35 Nicht ganz so postmodernfällt dann die Erklärung aus, wieso alle übrigen Gottheiten Zeus in den Armgefallen sind: Wer Hades töten lassen kann (der hier mit dem Tod gleichge-setzt wird), könnte das an anderen Göttern wiederholen, und außerdemwürde die Welt zu klein, wenn alle Menschen unsterblich wären, und eineQual wäre es sowieso. Bei soviel Konventionellem an Antworten fehlen so-gar die kleinen Trostpreise, die Herakles für die Menschheit herausgeholthat: Theseus aus der Unterwelt zu befreien und bei der Wiederholung (alses um die Rückkehr von Admetos zu Alkestis ging) den Tod wenigstens ein-mal so richtig durchzuprügeln.36 Im Fokus steht hier eindeutig nicht die An-gabe von Gründen und letzten Wahrheiten; was zählt, ist die Art Ordnung,die durch Götter zu stiften ist, welche zugleich anwesend und in einen Be-griffsnebel aufgehoben sind – es lässt sich mit und dank ihnen gut vonetwas erzählen, wenn den einen „Götter“ heißt, was dem andern „Unend-lichkeiten“ sind. Worum es eigentlich geht – falls es in Geschichten oder derGeschichte überhaupt um etwas geht – das entgeht den Beteiligten sowieso,denn das definiert ihr Menschsein. Das letzte Wort hat (wie schon beiKleist) das „Ach!“ des Überfordertseins in vielfacher Hinsicht, und BanvillesGötter sind wie geschaffen für eine Welt aus Überforderungen.37
Vollendet deutlich wird dann Philip Roth im Schlüsselabschnitt von TheHuman Stain (2000): Der namengebende „menschliche Makel“, die lebens-notwendige Unreinheit und Unsauberkeit, haftet auch den Olympiern an:
35 Inf 188.36 Entsprechend stellt Hermes den Attentatsplan als göttliche Rache an der
Menschheit hin: Zeus „wished them all [...], all to know what we know, the tor-ment of eternal life“ (Inf 213). Herakles verprügelt Thanatos: Eur. Alc. 843-849;1140-1142.
37 Zu dieser Deutung des Titels Inf 144: „[Adam] sought to cleave exclusively tonumbers, figures, concrete symbols. [...] For me the gods, for him the infinities.“Adams „eternal entities“ seien eben die physikalisch postulierten Kräfte undTeilchensorten, nicht dasselbe wie die ‚echten‘ Gottheiten, aber an deren Stellegerückt (ebd. 145f.). Dabei verstrickt Adam, der Mensch, wie Hermes, der Gott,sich in „the peril of confusing the expression of something with the somethingitself [...] [mistaking] the manifestation for the essence. (ebd. 144) Von den Göt-tern kann man zu allen anderen Schwierigkeiten eben auch nicht adäquat spre-chen – ein theologischer Restbestand.
Das Spiel mit den Blitzen 65
„They’re petty. They quarrel. They fight. They hate. They murder. They fuck.[...] Not the Hebrew God, infinitely alone, infinitely obscure, monomaniacallythe only god there is, was, and always will be, with nothing better to do thanworry about Jews. And not the perfectly desexualized Christian man-god and hisuncontaminated mother and all the guilt and shame that an exquisite unearthli-ness inspires. Instead the Greek Zeus, entangled in adventure, vividly express-ive, capricious, sensual, exuberantly wedded to his own rich existence, anythingbut alone and anything but hidden. Instead the divine stain. A great reality-reflecting religion for Faunia Farley [...] God debauched. God corrupted. A god oflife if there ever was one. God in the image of man.“38
Der Mensch will sich demnach in all seiner Selbstverliebtheit am Himmelwiederfinden, auch wenn sich dabei als Kollateralschaden all seine Unartenebenso vergrößert abbilden: Rückwendung zur Antike als Leben in lädier-tem, aber doch entschlossenem Exhibitionismus. Idealistisch hieß das ein-mal: „Da die Götter menschlicher noch waren, | Waren Menschen göttli-cher.“ Nur hat der Idealismus hier notgedrungen abgedankt und die Bot-schaft nähert sich dem Bittruf Swinburnes an seine lust- und schmerzvolleGegenmadonna Dolores: „Come down and redeem us from virtue, | OurLady of Pain.“ Götter sind auch nur Menschen, alles andere wäre zu bitterfür die eigentlichen Menschen. Mit einem besseren Gott ist zwischen Bezie-hungskrisen und vollem Schreibtisch nicht zu leben.39
5. Christoph Hein: Die oberen Etagen als Parabel fürs Parterre
Fast wie ein Fremdkörper in dieser Serie von Versuchen, das antike Panthe-on mal aggressiv, mal lässig gegen den Gott der monotheistischen Religio-nen auszuspielen, steht Christoph Heins druckfrischer Band Vor der Zeit, derlaut Schutzumschlag „[d]ie neuen Erzählungen der alten Mythen“, jeden-falls Götter- und Heroengeschichten von der Theogonie-Phase bis zum Troja-nischen Krieg episodisch-locker aneinanderreiht, wie von Buchstützen ge-halten durch drei Stücke um Autoritäten und Überlieferer in Sachen My-
38 Ph. Roth, The Human Stain (2000 [2005]), “What Maniac Conceived It?”, 242f. DerProtagonist des Romans, Coleman Silk, ist – insofern zur Nachahmung empfoh-len – klassischer Philologe, bringt seine Mythenkenntnis aber wohldosiert ein.
39 F. Schiller, „Die Götter Griechenlands“ (1788 [1968]), V. 191f. Die Unterschiedezur Position bei Roth liegen nicht zuletzt im Fehlen der Leitworte „schön“,„selig“, „edel“ und „sanft“. „Come down ...“: A. C. Swinburne, „Dolores“ (1866[2000]), V. 279f.
66 Jörg Fündling
thos. Religion als solche ist hier weder Thema noch Problem. Götter undMenschen haben ihre Auftritte, aber meist dürfen sie nicht sich selber spie-len, sondern führen Parabeln auf40 – wie es zum Untergang eines Ur-Matri-archats frei nach der marxistischen Geschichtstheorie kam, das durch vielBehagen an der eigenen Körperlichkeit lockt oder dass der vermeintlicheFluch über die Nymphe Echo, alles nachplappern zu müssen, in derrichtigen Welt Beliebtheit garantiert. Anderswo werden in Gestalt der Ora-kel die Massenmedien, das Marktmonopol (und, sagt sich der kapitalismus-kritische Wunschleser, der Betrug als Wesen der Wirtschaft) geschaffen.Eine zweite Strategie, die obrigkeitliche Selbstbedienung durch Steuern, er-findet der Mundschenk und Lustknabe des Phaiakenkönigs Alkinoos per-sönlich, womit seine Karriere als erster offizieller „Wirtschaftsweiser“ vonGriechenland beginnt. In derselben Linie bewegt sich die mythische Ge-schichte der attischen Demokratie als Serie selbstverliebter „Demagogen“mit Variationen, hinter deren Grellheit alles beim unfreien Alten bleibe.Laut Klappentext spricht hier „der Aufdecker der Schwachstellen der ge-samtdeutschen Entwicklungen“ – was nicht gar.41
Da und dort tut Hein nichts weiter, als den antiken Sinngehalt auszu-buchstabieren, wenn es etwa um die Wahllosigkeit des Begehrens geht, die
40 Nicht allein vom Umfang her steht Franz Kafka sicher in der Ahnenreihe, beson-ders „Das Schweigen der Sirenen“ aus dem dritten Oktavheft und „Poseidon“(1920). Der Gedanke an die Brechtschen Kalendergeschichten liegt nahe, nur lebendie „Geschichten vom Herrn Keuner“ von ihren Antwort- und Aphorismen-Sze-narien, während die antiken Themen („Cäsar und sein Legionär“, „Der verwun-dete Sokrates“, im weiteren Sinn auch „Fragen eines lesenden Arbeiters“) HeinsGrundhaltung affin sind, sich aber im Bereich des Historischen bewegen, dasVorkommen von Atlantis in den „Fragen“ (V. 15) ausgenommen. Brecht zog esnicht sehr zur Mythologie. Ein jüngeres Muster wäre K. Hacker, Morpheus (1998).
41 Matriarchat in einer an Malinowski erinnernden Urfamilie: „Windsbräute undWasserweiber“, VdZ 29-36; der Eingang ist eine Kontrafaktur zum biblischen(ersten) Schöpfungsbericht in Genesis 1,1-2,4a. Vgl. auch „Die Weiber von Xan-thos“, VdZ 158-162, zur männlichen Furcht vor sexueller Aggressivität der Frau.„Echo, die Nymphe“: VdZ 43-45; Apollon übernimmt den Meinungsmarkt: „Väterund Söhne“, VdZ 68-84, besonders 79-81. Der Ökonom als Lustobjekt der Politik:„Der Drosselkönig“, VdZ 118-127, entwickelt aus Hom. Od. 13,8-16. Athen: „DieGeburt der Demokratie“, VdZ 165-168; als Motive begegnen u. a. der „Tag derVereinigung“ (165), wohl Travestie des 3. Oktober, und Misstrauen gegenübermöglichen Implikationen des Gedankens einer wehrhaften Demokratie (185) imLicht der seit 2001 eingeführten und diskutierten Restriktionen.
Das Spiel mit den Blitzen 67
hinter der Vorstellung von Eros als göttlichem Kind steht. Die oft gehörteArgumentation zugunsten des biologischen Todes, so werde die Umwelt ge-schont und „[u]ralte, hilflose und hässliche Menschen“ könnten keineegoistische Gerontokratie auf Kosten der Jüngeren errichten, tröstet nichtmehr als sonst auch – dabei hat Hein sie seinem Zeus in den Mund gelegt,der so etwas wie den aufgeklärten, an seiner eigenen Entbehrlichkeit arbei-tenden Erziehergott darstellt. Sehr treffsicher erfundene Mythen aus denWünschen und Ängsten der Gegenwart sind aber auch dabei; am Fall desgöttlichen Arztes Asklepios erscheint als die schlimmstmögliche ‚Strafe’ derUnterwelt ganz entsprechend den Alltagsängsten unserer Zeit die Demenzals Tod des Bewusstseins bei lebendigem Leib. Auf Kosten ihrer Wirksam-keit vervielfacht ist die Demaskierung des Krieges als Irrsinn in Permanenz.Ähnlich grimmig und gar nicht so weit von Hesiod erscheinen als Spezial-flüche der Menschen des Eisernen Zeitalters die Konsum- und Wachstums-gesellschaft sowie – da wird es ein wenig sehr böotisch-säuerlich – die ge-sellschaftsfeindlichen Lockungen des Internet.42
Ins Grundsätzliche führt das Vorspiel – der Versuch des von HeinrichSchliemann in den Schatten gestellten Troia-Erforschers Frank Calvert, sei-nen eigenen archäologischen Coup zu landen – ebenso wie die beiden ab-schließenden Erzählungen über den Mythographen Apollodoros von Athenund die ‚wahre’ Entstehung der Ilias. Die Wahrheit ist ein Ideal und demzu-folge unerreichbar – dem Zugriff ihrer Freunde entzieht sie sich ebenso wie,was trösten mag, dem ihrer Feinde. Calvert hat die Insel Leuke lokalisiert,wo „nächtens die Götter [...] weilen“, und findet sich unversehens in einerrumänischen Strafkolonie, wo „die neuen Götter“ das Sagen haben – wervon den Himmlischen und von einst reden will, muss über die Mächtigenvon jetzt reden, oder er endet als unbedarfter Antiquar, „der die geläufigen
42 Keine inhaltliche Zutat gegenüber der Antike: „Der dreijährige Eros“, VdZ 46-52.Tod gegen Überalterung: „Hades klagt an“, VdZ 53-63; zum Erzieher Zeus, derwill, „dass der Mensch sich und seine Welt selbst erschafft“ (92) und „in einerfernen Zukunft einen neuen Olymp begründe“ (91), vgl. besonders „Prome-theus“, VdZ 89-98. Asklepios, Demenz: „Auf dem Stuhl des Vergessens“, VdZ 64-67 – das Motiv ist aus der Unterweltfahrt von Theseus und Peirithoos umgear-beitet. Krieg: „Dendritis, genannt Dionysos“, als Anführer einer gewaltberausch-ten Soldatensekte (144-150), Troia als sinnentleerte Materialschlacht: „Die Göt-tin des Vergessens“ (105-115); Odysseus auf eine Killermaschine reduzierte emo-tionaler Kretin: „Die Heimkehr“ (128-138), Die Zeitalter: „Die Eisernen“, VdZ 85-88, vgl. Hes. erg., v. a. 174-201.
68 Jörg Fündling
Verkehrssprachen verachtete“ und nicht weiß, was Sache ist. Somit hat Cal-vert weder die real existierende noch die mythische Insel besucht und kanndies nie mehr korrigieren: Sein Wunsch, dort begraben zu werden, wird ab-geschlagen.43 Apollodoros führt eine einzige Zeile, die seine „für alle Zeitengültige Festschreibung der griechischen Welt“ durch Mehrdeutigkeit ‚ent-stellt’, in eine Art Schreibblockade; den einzigen Ausweg – seine ganzeAutorität zur Diskussion zu stellen – will oder kann er nicht suchen. Nachseinem Tod verkehrt sich das Dilemma ins Gegenteil: Zwar wird das Werkgefeiert, nur kann die dankbare Nachwelt den Autor ebenso wenig festlegenwie dieser einst seine fehlende Zeile ...44
Homer schließlich schreibt hier als Zeitzeuge – doch ist die erste Versi-on seines Auftragswerkes für die „Kombattanten des trojanischen Krieges“zwar „kunstfertig und edel“, aber durch die Benennung nackter Tatsachenunerträglich: „Die wahren Dichter, die großen Sänger, Homer, lass es dir ge-sagt sein, sprechen nicht über Geld, reden nicht von Handel und Geschäf-ten, singen nicht über so niedrige Dinge, nein. Wir Achaier haben allein fürdie Ehre gekämpft.“ Das materialistische Epos wird verbrannt, Homer bes-sert nach. „Sein Lied klang anders, blutiger, trauriger, verzweifelter.“ InKurzform kritisieren die Heroen alles, was Homerleser bis heute an der Iliasirritiert, aber Odysseus ist zufrieden – Hauptsache, die Ehre stehe im Zen-trum, der Rest samt zänkischen Göttern und Griechen werde die eigene To-leranz dokumentieren. Homer, beschenkt und entlassen, gräbt heimlichden „ursprünglichen Gesang“ in Kopie aus; nach diesen Originalrollen wer-
43 Calvert: „Das Paradies der Paradiese“, Hein, VdZ 7-16; „nächtens ...“: 11; „dieneuen Götter“: 15; „der die ...“: 12; Grab: 16.
44 Apollodoros: „Die Bibliotheke des Apollodor“, VdZ 169-178; „für alle ...“: 169; DerAusweg („Ändere dich nach der Maßgabe deines Manuskriptes“: 176) wird demFreund Diodoros in den Mund gelegt – mit hoher Wahrscheinlichkeit steht der„Kollege“ (173) für den Nicht-Zeitgenossen, Historiker und Verfasser einer eige-nen Bibliotheke, Diodoros Siculus, eine Hauptquelle für die authentischen Werkedes Atheners (FGrHist 244; vgl. R. Münzel/Ed. Schwartz, RE I 2 (1894), 2855-2886s. v. Apollodoros 61. Postumes Problem: 178. Hein erzählt mit voller Absicht le-gendenartig und im freien Spiel mit dem Lexikonwissen, nicht allein durch denanachronistischen Diodor: Zweifellos ist ihm bekannt, dass das Apollonios zuge-schriebene Werk kaiserzeitlichen Datums ist und nicht ins mittlere oder späte 2.Jh. v. Chr. gehören kann (einführend: F. Montanari, Apollodoros 7. Der neue Pauly1 (1996), 857-860; T. Scheer, Apollodori bibliotheca, in: O. Schütte (Hg.), MetzlerLexikon der antiken Autoren. Stuttgart/Weimar 1997, 66f.; Cameron 2004, 93-104).Die Mythographen rücken selber ins Mythische ...
Das Spiel mit den Blitzen 69
de seitdem gefahndet, bis heute vergebens. „Doch sie sind vorhanden, ir-gendwo. Sie sind in der Welt.“ Da die Menschen dies seit langem geahnt ha-ben, ist es Homer offenkundig gelungen, den Urtext der Geschichte „zu ver-stecken und zu retten“; wir bewegen uns in einem Gleichnis, also liegt dasVersteck des Dissidenten am selben Ort wie in der Geschichte der Homerin-terpretation: in den mitgelieferten Sperrigkeiten. Von dort geht wieder undwieder die nie vollständig greifbare Wahrheit aus, der Ruf der Tatsachen.Die Subversion steckt in der Unmöglichkeit, ‚glatteʻ Geschichte(n) zuschreiben, der Idealismus kommt mit eingebauten Runzeln zur Welt – undharmlose Schriftsteller, so die Selbsttröstung Christoph Heins, gibt es defi-nitionsgemäß sogar im Wohlstand nicht. Der Weg zu den Göttern ist jeden-falls der falsche Weg, wenn er nicht bei den Menschen anfängt und endet.Ein Eigenwert jenseits der Denkhilfe geht ihnen ab.45
6. Rick Riordan: Alles, was wichtig ist, ist in Gefahr
Nirgendwo treten die Gottheiten der Antike zum Ausgleich so massiv undsichtbar auf wie im letzten Fall – dem Romanzyklus um Percy Jackson, dernach der fünfteiligen Ursprungsserie tief in einer Fortsetzung mit neuenHelden und unerhörten Gefahren steckt. Diese Götter sollte man besserernst nehmen, denn alles ist voll von Göttern, wie der Philosoph es richtigsagt – und alles ist voll von Monstern.46
In der Hauptrolle agiert Percy, genauer: Perseus Jackson, ein hoffnungs-loser Fall von ADHS, für den seine alleinerziehende Mutter Schule um Schu-le ausfindig macht, bis eines Tages – natürlich unter lebensgefährlichenUmständen – die Wahrheit herauskommt. Der verantwortungslose Vater istkein anderer als Poseidon, Percy entpuppt sich damit als erstes Kind eines
45 Homer: „Das erste Buch Homers“, VdZ 179-187. „Kombattanten: ...“: 179: „kunst-fertig ...“: 181; „Die wahren ...“:, Bücherverbrennung: 182; „blutiger ...“, Homer-kritik: 183f.; Odysseus reicht es: 184-186. Homer nimmt den „ursprünglichen Ge-sang“: 186; „Doch sie sind ...“: 187; „zu verstecken ...“: 186. Versehentlich gerätdie Odyssee aus dem Blick, die zwar Bestandteil des ersten Entwurfes ist (180),aber in „die vierundzwanzig neuen Gesänge“ (183) nicht einberechnet ist.Manchmal schläft Homer ... wie beim Betiteln von Herakles als Titan (37).
46 Nach PJ 1-5 hat Rick Riordan inzwischen, ohne Pause im Jahresrhythmus, HO 1-3fertiggestellt und arbeitet parallel am Kane-Zyklus mit unabhängigen Hand-lungsträgern und ägyptischen Motiven. Angekündigt für 2013 ist in ‚olympi-scher‘ Hinsicht The House of Hades, aus strukturellen wie kommerziellen Gründenist mindestens noch ein fünfter Band zu erwarten.
70 Jörg Fündling
der großen drei Olympier (Zeus, Poseidon, Hades) seit Jahren, bringt dasMächtegleichgewicht sofort durcheinander und gerät in den Verdacht, erhätte Zeus – eine ganz unverbrauchte Idee – einen Donnerkeil gestohlen.Ein weltweiter Konflikt droht, der Kampf der Titanen steht an, seine frischerschlagene Mutter muss Percy als guter Sohn auch noch schnell aus derUnterwelt retten, und dabei kann ihm niemand helfen als Grover, ein be-dingt brauchbarer Jungsatyr, und Annabeth, eine kratzbürstige TochterAthenes. (Warum Athenes? Weil es nie genug mutige und intelligente Mäd-chen geben kann, also zum Kuckuck mit den mythologischen Vorgaben.)47
Wenn es gut geht, wird die Welt gerettet und sie kommen nach dem Tod insElysium, das wie ein Villenviertel wirkt – wer das dreimal schafft und sichfreiwillig zwischendurch zur Wiedergeburt meldet, erhält als Dauerwohn-sitz die Inseln der Seligen, ein Urlaubsparadies.48
Lassen wir die Anklänge an den Disney-Hercules, lassen wir auch den klu-gen Lehrer im Rollstuhl, bei dem es sich diesmal nicht um Patrick Stewartals guten Geist der X-Men handelt, sondern um den Zentauren Chiron, dersein nichtmenschliches Chassis tarnen muss.49 Nach Mythen war gefragt
47 Percy = Perseus: PJ 1, 68 Kap. 5; Vaterschaft: ebd. 126 Kap. 8; Blitz und Problemder Großen Drei: 135-137 Kap. 9 vgl. 113f. Kap. 8. Grover: 42f. Kap. 3; Annabeth:95 Kap. 7. Eine Erklärung, wie die jungfräuliche Göttin Nachwuchs zeugen kann,wird erst spät und ziemlich vage nachgereicht: Annabeth sei wie ihre Halbge-schwister ein „brainchild“ (PJ 4, 186 Kap. 2) – angedeutet wird, die Geburtsum-stände seien unappetitlich (ebd.), was z. B. auf den ‚Kaiserschnitt‘ mit einer Axtpassen würde, nach dem Athene aus Zeus’ Haupt entsprang.
48 Inseln: „That’s what it’s all about ... That’s the place for heroes.“ (PJ 1,302) Das istkein neukapitalistisches Leistungsdenken, sondern beste klassische Bildung,nämlich ein Zitat aus Pindars 2. Olympischer Ode: „so viele es aber vermochten,dreimal [...] fern ganz von Unrecht zu halten die Seele, ziehen hinauf den Zeus-weg zum Kronosturm: dort umarmen die Insel der Seligen ozeanische Lüfte ...“(Pind. Ol. 2, 68-73).
49 Chiron: PJ 1, 73f. Bei der Verfilmung ist den Ausstattern die Parallele so wenigentgangen, dass Chiron (Pierce Brosnan) bei seinem Auftritt als Rollstuhlinsassein Chris Columbus’ Percy Jackson (2010) ein Jackett trägt, dessen Schnitt demDreiteiler von Professor Xavier (Patrick Stewart) in X-Men (Regie: Bryan Singer,2000; Special DVD Edition, GTIN: 4010232006981) auffällig ähnelt (erste halbnaheEinstellungen: 8:10; 8:55; prägend erst in der Szene in Xaviers Direktorzimmer(23:55-26:09) – Chiron-Brosnan hat seine Krawatte allerdings gelockert und be-vorzugt anders als die optisch verwandte Mentorgestalt ungekämmtes Tuch undgedeckte Farben (verschiedene Einstellungen zwischen 10:01 und 14:18). KeinZufall ist auch die Produktion des Percy-Films durch 20th Century-Fox, die
Das Spiel mit den Blitzen 71
und nach den Göttern. Hieß es nicht, heutzutage entstünden keine Mythenmehr? Seltsamerweise erweist sich das Gegenteil, wenn wir den Begriff lo-ckerer verwenden. Rick Riordan ist kein Platon und kein Kaiser Julian, aberer hat den einen oder anderen Kunst- oder Mustermythos in seinen Eröff-nungsband gesteckt. Es beginnt mit einer Erklärung für das Scheitern seinesHelden an unserer Alltagswelt. Percy leidet an ADHS – wie nicht zufälligauch der Sohn des Autors.50 Die ‚Ursache‘ dieses Zustandes besteht schlichtdarin, dass er ein Held ist. Heroen werden mit superschnellen Reaktions-zeiten geboren, deshalb sind sie für normalsterbliche Augen so zapplig, undihre Leseprobleme erklären sich auch ganz leicht: Klassisches Griechisch istin ihre Gene eingebrannt, folglich geht ihnen alles Übrige schwer ein – ausdramaturgischer Sicht eine perspektivenreiche Schwäche. Ausdrücklich ge-sagt wird zwar nicht, dass alle ADHS-Kinder der Welt das Ergebnis olympi-scher Seitensprünge seien, aber das Tor zu dieser schmeichelhaften Inter-pretation steht einladend weit offen.51
Welterklärung betreibt Riordan unter Bezug auf zentrale Motive undGestalten, die die Welt so gemacht haben, wie sie ist. Vor der Grundsatzfra-ge, ob jemand die Welt überhaupt gemacht hat und wenn ja, wer, biegt dasBuch bewusst ab, kaum nur aus Rücksicht auf die Religiosität der US-ameri-kanischen Mehrheit.52 Die Welt und ihre Einwohner aller Etagen müssenmit ihren Problemen erst einmal selbst zurechtkommen, mag sich auch je-mand für das Ganze verantwortlich fühlen. Schrecklich verantwortungsvollsind die Götter leider nicht – nach guter alter Tradition ist ihr Status jeder-zeit ein Gemetzel wert und ihre illegitimen Kinder verbringen, falls kein
(zusammen mit Marvel Studios) die X-Men in einen der ersten Superhelden-Filme der neuen Welle umgesetzt hatten. Zur Affinität zwischen Superheldenund Riordans Heroen siehe unten S. 77.
50 Mythen: vgl. PJ 1, 67f.: „to explain lightning and seasons and stuff. They’re whatpeople believed before science.“ Zum biographischen Hintergrund Susanne Kin-genstein, „Wenn das der Zeus wüßte. Ist der Nachfolger von „Harry Potter“ end-lich gefunden? Der Texaner Rick Riordan macht jetzt auch in Deutschland Furo-re mit seiner Percy-Jackson-Serie“. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. Feb-ruar 2010; http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E71A4CFEAFDCD42339CB38CCCA4FBBA4F~ATpl~Ecommon~Scontent.html(eingesehen 25.05.2010).
51 ADHS, Reflexe und Altgriechisch: PJ 1, 88 Kap. 6.52 Gottesfrage: „We shan’t deal with the metaphysical.“ (PJ 1, 67) Demnach wären
die Götter interessanterweise keine metaphysischen Wesen, sondern diesseitig.
72 Jörg Fündling
Monster sie umbringt, die meiste Zeit damit, verzweifelt um das flüchtigeInteresse ihres unsterblichen Elternteils zu werben. Das heißt, auch dieNormalsituation der zerfallenen Kernfamilie und die noch viel normaleredes Leidens an der Eltern-Kind-Beziehung werden transzendiert ... auf dieGefahr hin, ein falsches Wort zu verwenden.53
Diese Alltagsnöte werden besser gesagt auf eine höhere Ebene gehoben,in die obere Etage der Götterwelt, die Riordan in unsere Normalwirklichkeiteinzieht – um den Preis, dass auch die Gefahren auf der Suche nach demSinn des Lebens erweitert werden: Prokrustes hat sein Bettengeschäftgleich nebenan, der kleine Horrorladen der Medusa liegt verkehrsgünstigan einer Fernstraße, und der hundertköpfige Typhon, vormals unter dem
53 Schlüsselstelle zur unerfüllbaren Sehnsucht nach intakten Familien ist HO 1,388f. Kap. 35: „The thing about the gods ... well, they don’t hang around.“ ChrisColumbus’ Film (DVD Edition, GTIN: 4010232050106) harmonisiert diese Erfah-rung des Verlassenseins stark: Das Leiden unter der Trennung ist hier beidseitig.Gleich in einer der ersten Szenen meldet sich die Stimme des Vaters in PercysGedanken, und unmittelbar danach sehen wir Poseidon (Kevin McKidd), getarntals Wartender an einer Bushaltestelle, seinen Sohn aus einigem Abstand mitschmerzhafter Intensität beobachten (9:25-9:47). Auch die bungalowartige, mitAbenteuer verheißenden Gegenständen möblierte Hütte in Camp Half-Blood hatder Gott eigens für Percy gebaut und eingerichtet, wie Chiron erklärt (25:15). Imkrönenden Gespräch zwischen Vater und Sohn (Logan Lerman) auf der Tür-schwelle des Götterpalastes verweist Poseidon – wie zuvor Annabeth (AlexandraDaddario) und der hier „allmächtige“ Zeus (Sean Bean) selbst – auf ein Gesetz,das den Göttern Kontakte mit ihren Kindern verbietet ... und von Zeus erlassenwurde, weil Poseidon selbst aus Liebe zu Frau und Kind seine göttlichen Pflich-ten vergaß. Um Percy das mitzuteilen, verkleinert der Meeresgott seine zuvorkolossale Gestalt – in durchsichtiger Symbolik – auf Menschenmaß (1:41:22-1:41:29) und bittet den zornigen Teenager, noch nicht zu gehen. Die Schlüssel-sätze, von elegischer Musik grundiert, lauten: „But I was always watching overyou. Just because you didn’t see me doesn’t mean that I wasn’t there. When youwere troubled I tried to help.“ Percy: „I heard you.“ Poseidon: „I know I’m notthe father you always wanted, but if you ever need me, I’ll be there for you – inyour thoughts and in your dreams. I’ll stand by you, Percy. Always.“ (1:42:25-1:42:59) Ein wortloser Händedruck unter Männern besiegelt den Familienbund,ehe Percy in die Region der Sterblichen und nach Camp Half-Blood zurückkehrt.– Die fundamentale Tragik der Vorlage ist im Drehbuch von Craig Titley damitgestrichen und löst sich in ein zwar schmerzhaftes, aber letztendlich befreitesAkzeptiertsein auf, folgt also den hollywoodtypischen Gleisen des temporärgestörten Vater-Sohn-Verhältnisses.
Das Spiel mit den Blitzen 73
Ätna begraben, droht nunmehr den Mount St. Helens in die Luft zu spren-gen, gar nicht davon zu sprechen, dass für die miserablen Arbeitsbedingun-gen bei Amazon tatsächlich die Amazonen verantwortlich sind (jeder Centwird für die Übernahme der Weltherrschaft gespart). Wunder und Schre-cken des mythischen Mittelmeeres sind als mobile „Sea of Monsters“ insBermudadreieck gewandert, Boreas als Gott des Nordwindes bezieht Quar-tier im Château Frontenac in Québec (aus US-amerikanischer Sicht ist dasSüdende Kanadas schon ungefähr der Nordpol), die Geister der Stürmehausen in der „Windy City“ Chicago und das sprichwörtlich idyllische Colo-rado Springs nimmt den Garten der Götter auf. Die Monster im Leben desHelden sind – auf den Spuren von C. G. Jung, der für die Götter dasselbe be-hauptete – Archetypen und daher leider unzerstörbar, weil eigentlich unin-dividuell.54
Das mit der oberen Etage ist aber ganz wörtlich zu nehmen, und hierkreiert Riordan einen weiteren ‚richtigen‘ Mythos. Wozu brauchen wir Göt-ter? Aus Texas kommt die Antwort: Die olympischen Götter sind der Inbe-griff der westlichen Zivilisation, „a collective consciousness that has burnedbright for thousands of years.“ Es wird einen Olymp geben und es wird Göt-ter geben, solange irgendwo auf diesem Planeten ein Mensch lebt, der Trä-ger dieser Zivilisation ist – „Kulturkreis“ hätten wir vor Jahrzehnten wohlgesagt. Nie hätte man gedacht, in dieses Bild auch noch die Symbolik derAufklärung eingehen zu sehen, aber so ist es. Der Olymp, so erfahren wir, isteine Art Wanderpokal. Er schwebt immer dort, wo die Flamme der westli-chen Kultur am hellsten brennt: „The gods move with the heart of theWest.“ In Griechenland – über Griechenland – war er natürlich, aber auch inRom, in Frankreich, Spanien, jahrhundertelang in Großbritannien und, manhöre, sogar in Deutschland. Sollte der Westen jemals ganz und gar fallen,
54 Mythos und Märchen als Reservoir von Archetypen – das macht ein Fass ohneBoden auf ... Urbilder der Seele oder okkulte Realitäten? Medusa: Betreiberinvon Tante Ems Gartenzwergemporium an einer Landstraße (PJ 1, 171-187 Kap.11); wer den Lotophagen im unwiderstehlichen „Lotus Casino“ von Las Vegasentrinnt, wo die Zeit an den einarmigen Banditen im Flug vergeht (PJ 1,257-265Kap. 16), landet in „Crusty’s Water Bed Palace“ in Los Angeles (PJ 1,277-282 Kap.17, der Anklang an Krusty den Clown aus The Simpsons ist kaum zufällig). Ty-phon: PJ 1, 182 Kap. 11. Amazonen hinter amazon.com: HO 2, Kap. 30. Bermu-dadreieck: Schauplatz von PJ 2; Chicago: HO 1, 225 Kap. 20; Boreas: ebd. 198f. Kap.18 (Frontenac wird nicht explizit genannt, aber eindeutig beschrieben); Colora-do Springs: PJ 4, 263 Kap. 15 (nicht vertieft).
74 Jörg Fündling
wird die Welt in „Dunkelheit und Chaos“ zurückstürzen und der Menschnur noch wie vor Zeiten das Objekt der Quälereien durch die grausamen Ti-tanen sein. „No one knows how long the Age of the West will last, Percy. [...]All we can do, child, is follow our destiny.”55
Wo das Feuer heutzutage brennt, das versteht sich von selbst: in der un-bestritten führenden Nation des Westens. Wenn wir uns den USA nähern,wird es interessant; mit New York als Heimatsitz war fast zu rechnen – aberwo genau? Über der Freiheitsstatue? Nein, den Olymp erreicht man, wennman den imaginären 600. Stock des Empire State Building ansteuert, dasnur 102 Etagen hat. Die Götter residieren in einer Skylounge von Stadt imklassisch-griechischen Stil hoch über den Wolken, und die ganze große Art-déco-Nadel, Baujahr 1931, verhält sich dazu wie ein Pförtnerhäuschen. Zeusträgt blaue Nadelstreifen und thront auf schlichtem Platin. Geheimknöpfein gesperrte Stockwerke sind etwas ganz Alltägliches in real existierendenMachtzentralen; wir erkennen auch das Motiv von Bahnsteig 9 ¾ aus HarryPotter wieder, doch die Ausrichtung hat sich geändert. Statt eines geheimenSeitenwegs in eine Welt gleich neben der unseren geht es hier um Aufstieg
55 „[...] a collective consciousness that has burned bright“ – nicht etwa „has beenburning“! – „for thousands of years“: PJ 1, 72; „The gods ...“: ebd. Olymp: „thehome of the gods, the convergence point of their powers“: ebd. Großbritannien:„look at the architecture“ (73). Deutschland: Das Datum bleibt offen. Man könn-te auf die Weimarer Klassik zwischen 1775 und spätestens 1832 raten, aber demkommt die Erwähnung des englischen Klassizismus in die Quere. Wir sollten dasdeutsche Gastspiel der Flamme früher suchen, und so läuft es vermutlich auf dieReformation hinaus, vielleicht schon bei Gutenberg angefangen. (Karl der Großewäre natürlich ein mindestens ebenso würdiger Kandidat und könnte Deutsch-land wie Frankreich abdecken ...) „No one knows ...“: ebd. 155f. Interessanter-weise hat die Filmbearbeitung diese gesamte Handlungsebene und damit auchden Hauptfeind Kronos gestrichen. Es droht ‚nur‘ ein Bruderkrieg von Zeus undPoseidon, der die übrigen Olympier mitreißen würde, und damit eine Serie vonKatastrophen: „Earth would become a battleground. Mountains erupted, earth-quakes, raging fires! The end of life as you know it!“ (27:33-27:40) Das Materiel-le, nicht das Ideelle steht auf dem Spiel. Die für 2013 angekündigte FortsetzungPercy Jackson: Sea of Monsters dürfte insofern ähnlich episodisch wie die erste auf-fallen und kann nur mit der Wiederkehr des trotzig-enttäuschten menschlichenBösewichts Luke operieren; immerhin reicht sie einige Figuren nach, für die imVorgängerfilm kein Platz war (http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Jackson:_Sea_of_Monsters; letzter Zugriff 28.04.2013: unter anderem die aggressiveArestochter Clarisse und Dionysos, der Campleiter ‚Mr. D‘).
Das Spiel mit den Blitzen 75
im wörtlichen Sinn, Aufstieg zur Führungsetage aller Führungsetagen, sofragwürdig die Einzelentscheidungen ihrer Insassen ausfallen mögen (im-merhin geht ihretwegen beinahe die Welt unter, und das ist nur Band 1).56
Haben wir es also mit einer Selbstüberhöhung der Vereinigten Staatenzu tun, ungebrochener imperialer Größe im tollsten Land der Welt, woOlympus Has Fallen als der passende Filmtitel für eine Eroberung des WeißenHauses (Präsident inklusive) durch ein nordkoreanisches Terrorkommandoerscheint? Eben nicht – wenn Riordans Ares als rotgekleideter Biker fürRandale sorgt, lobt er die Gewaltbereitschaft und den leichten Griff zurWaffe, die ihm das Leben hier so erleichtern. Nebenbei sind gerade die Göt-terkinder ihres Lebens nicht sicher in diesem Land, wo einem alles passie-ren kann; emotionale Stiefkinder bleiben sie sowieso, die zu besonderenLeistungen förmlich verdammt sind, um sich zu rechtfertigen. Und dannblicken wir auf das Empire State Building und erinnern uns daran, dass esdas höchste Gebäude der Stadt ist – von 1931 bis 1972 und in jüngster Ver-gangenheit eine Zeitlang wieder. Hat der Olymp bis 2001 womöglich übereiner anderen Stelle geschwebt, an der bis vor kurzem ein Loch klaffte? ObRiordan Hintergedanken hatte, ist nicht sicher zu sagen, aber sein Tor zumOlymp, lange das höchste Gebäude der Welt, ist ein Wolkenkratzer, der sei-nerzeit ebenfalls von einem Flugzeug gerammt wurde – ein Navigationsfeh-ler, kein Anschlag – und der das überlebt hat.57
Percy Jackson – der im Jahr 2005 die literarische Bühne betrat – ist also,so fest und viellagig er in gute alte Klischees gewickelt ist, der versehrte
56 „[O]f course they are now in your United States.“ (PJ 1,73) Dass Dionysos einmalzuviel über die Stränge schlug, hat den USA die zehnjährige Prohibitionszeiteingebracht ... (ebd. 69f.). Griechische Stadt: 336-38 – leider inklusive Werbung,Hephaestus-TV usw.: 338. Nadelstreifen: 339. Der locus classicus in J. K. Rowling,Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997), Kap. 6 „The Journey from PlatformNine and Three Quarters“ – und sein mutmaßlich nächstes Vorbild in C. S. Lewis,The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950 [2004]), Kap. 1 „Lucy Looks Into a War-drobe“ – stehen einander mit ihrer horizontalen Bewegung, die verborgeneWelten eröffnet, ungleich näher.
57 Zu Antoine Fuquas Olympus Has Fallen, einer Art emotionaler Rückkehr zum 11.September, vgl. die offizielle Webstite www.olympusmovie.com (letzter Zugriff26.01.2013). Überlegenheitsgefühl: vgl. „America is now the heart of the flame. Itis the great power of the West.“ (PJ 1, 73 Kap. 5) Ares: „I love this country. Bestplace since Sparta.“ (ebd. 227 Kap. 15) Zur Kollision vom 28. Juli 1945 vgl.http://en.wikipedia.org/wiki/B-25_Empire_State_Building_crash (letzter Zu-griff 25.5.2010) mit Literatur und Foto.
76 Jörg Fündling
Held eines versehrten Amerika, der an seinem Platz in der Welt zweifelt, sowie sein nicht länger unverwundbares Land es tut. Er hat gegenüber der all-täglichen Außenwelt keine Waffen – sogar das Schwert Anaklysmos, das erbekommt, hilft ihm nur gegen Götter und Ungeheuer oder Halbgötter wieseinesgleichen. Sein bester Schutz ist der Nebel („the Mist“) der Nicht-beachtung, der alles Übermenschliche für die Augen Normalsterblicher um-gibt; ansonsten ist er jedem ordinären Messerstecher ausgeliefert. Er hatdas Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts hinter sich, in persönlicher Über-tragung – seine eigene Mutter ist (vorläufig) umgekommen, als sie sich vorMonstern in Sicherheit zu bringen versuchten – und jetzt hat er es miteiner Welt zu tun, die durch seine bloße Anwesenheit aus den Fugen zu ge-raten scheint, die ihm unverdient feindselig gegenübertritt und in der seineSelbstachtung daran gebunden ist, dem Lebensideal gerecht zu werden, daser sich nicht ausgesucht hat. Dafür gibt es in dieser Romanwelt noch dieGötter: für den Kampf um ihre Aufmerksamkeit, die sich in Zerstörung oderin überlebensnötige Bestätigung verwandeln kann. Sie sind gigantische Per-sonifikationen – nicht von Naturkräften, sondern zum einen der doppel-gesichtigen Gesellschaft, in der wir Bürger des Westens leben (mal lieben,mal hassen wir sie, und dass wir Europäer gern unser eigenes Unbehagenbei den Amerikanern abladen, sollte nichts Neues mehr sein), zum andereneiner Batterie menschlicher Grundbedürfnisse, die den Psychologen bes-tens bekannt sind: des Ringens um Individualität mit und gegen die Eltern,deren Fehler mindestens zwischen 12 und 20 so monumental sind wie unserVerlangen nach Anerkennung. Im Schlechten bleiben Elternfiguren meis-tens deutlich länger übermenschliche Wesen als im Guten ... so ist Poseidonein göttlicher Aussteiger, irgendwie ganz cool, aber irgendwie auch ganzverantwortungslos.58
Götter und Heroen sind dem Augenschein nach aber nicht das, was sieeinmal waren. Sie sind übersetzt in jene Sprache, an die wir uns für über-menschliche, aber innerweltliche Kräfte gewöhnt haben – kurz, sie sind Su-perhelden geworden, mit Nischenbegabungen, mit enormen, aber genetischvermittelten und klar umrissenen Fähigkeiten, bedroht von Superschurkenund den enorm regenerationsfähigen Mächten des Bösen, die buchstäblichnicht totzukriegen sind. Ein Held kann sterben, er (oder sie) ist ja bloß ein
58 Schwert: PJ 1, 153 Kap. 10; „Mist“: ebd. 154f.; Tod der Mutter: ebd. 53 Kap. 4. Al-ternativer Poseidon: 340 Kap. 21. Hat sich nie gezeigt: 159 Kap. 10, vgl. 346 Kap.21.
Das Spiel mit den Blitzen 77
Mensch; die Monster hingegen sind so unverwüstlich wie die Gegner einesComputerspiels, nur dass sie sich immer wieder neu von selber laden.59 Per-seus Jackson steht näher am stets verletzlichen Dauer-Teenager Spider-Man als an Perseus, dem Sohn des Zeus und der Danaë. Genau genommenist es natürlich umgekehrt gewesen und der Superheld hat ursprünglich dasErbe des mythischen Heros angetreten, als höheres Wesen, dem Naturtalen-te, riesiger Reichtum und athletische Ausdauer – oder die Nebeneffekte derNaturwissenschaft – seinen Status gegeben haben, aber immer als schlechtintegrierter Außenseiter. Jetzt bedient sich die klassische Antike bei einemGenre, das seinerseits nicht zufällig Konjunktur hat. Seit den Superman-Fil-men sind diese Figuren gleich serienweise auf die Leinwand gewandert undhaben immer mehr an ihrer Rolle gelitten, bis hin zur Diskriminierung in X-Men (und deren Parodie in The Incredibles). Was weniger bekannt ist: Ein Co-mic, der gleich nach dem 11. September entstand – ein Comic fast ohne Dia-loge, aber voller verstörter Zwischenrufe – zeigt die Superhelden des Mar-vel-Verlags, die sich die Frage „Wo wart ihr?“ gefallen lassen müssen, scha-renweise neben Polizisten und Feuerwehrleuten beim Wühlen in den Trüm-mern am Ground Zero.60
In der Nachfolgeserie The Heroes of Olympus ergänzt Riordan dieses Trau-ma der jüngsten Generation um ein viel älteres, die Bürgerkriegserfahrung– die weniger explizit schon zum Ersatz-Kernthema der Kinoversion von2010 aufgestiegen war.61 Parallel zu dem großen Brudermorden von 1861-65, so die Enthüllung, sei ein seit römischen Zeiten schwelender Konfliktneu aufgeflammt: die Zwietracht zwischen jenen Halbgöttern, die vom grie-
59 Monster: „You can dispel them for a while ... But they are primal forces. Chironnames them archetypes. Eventually, they re-form.“ (PJ 1, 86 Kap. 6)
60 Straczynski/Romita, Spider-Man (2001 [2005]).61 Bruderzwist im Kino: vgl. oben Anm. 48. Nord-Süd-Gegensätze sind in Chris Co-
lumbus’ Film auch dadurch angedeutet, dass Percys Beschützer-Satyr Grover alsSchwarzer besetzt ist (Brandon T. Jackson), stereotype ‚Ghettokid‘-Verhaltens-weisen zeigt und von der Reiseetappe Nashville, Tennessee zumindest musika-lisch nichts Gutes erwartet (54:49). In der US-Jugendliteratur ist sprachliche‚Farbenblindheit‘ dagegen derart normativ geworden, dass bereits das Auftreteneindeutig schwarzer Personen potentiell missbilligt werden kann und nicht al-lein kolonial gefärbte Passagen, sondern viele Verweise auf die Hautfarbe über-haupt aus Neuauflagen von Hugh Loftings Dr Dolittle-Geschichten komplett ge-strichen wurden (zu The Voyages of Dr Dolittle (New York 1922, überarbeitete Neu-ausgabe New York 1988) vgl. Dominus 2006).
78 Jörg Fündling
chischen Aspekt der Olympier abstammten, und den eher römisch gefärb-ten. So dramaturgisch geschickt der Rückgriff auf die gern vergesseneWahrheit ist, dass etwa Ares und Mars bei weitem nicht funktions- und be-griffsgleich sind – und auch Gottheiten eine Entwicklungsgeschichte haben–, so banal fällt leider die Verwertung dieser Chance aus: Die römischgesehenen Götter, heißt es kurzum, seien durchweg herber und kriegeri-scher als ihre hellenischen Pendants. Dementsprechend verdammt Riordanalle Heroen italischer Färbung dazu, als Babys ausgesetzt, von der römi-schen Wölfin auf Überlebenswürdigkeit geprüft und anschließend in derMikro-Legionswelt von „Camp Jupiter“ gedrillt zu werden, wo ihnen ge-schwätzige Hausgeister im Hogwarts-Stil, bei denen es sich um Laren han-deln soll, mit Militärerinnerungen in den Ohren liegen und der intrigante„Augur“ Octavian aus den Eingeweiden von Stofftieren die Zukunft liest(weil er offenbar nicht weiß, dass das die Aufgabe eines Haruspex ist).62 Freinach Rosemary Sutcliff hat übrigens auch diese Legion ihren Adler im ho-hen Norden verloren (diesmal in Alaska) ... und gewinnt ihn natürlich zu-rück, ehe der entsprechende Band zu Ende ist. Es ist nicht das erste Mal fürsie, handelt es sich doch um eine Nachfolgeorganisation der legio XII Fulmi-nata, die dasselbe Pech schon im Jüdischen Krieg hatte.63 Alles in allem re-giert das Klischee vom waffenklirrenden, vor Opferbereitschaft platzendenRömer, erweitert um Reminiszenzen, die ausgerechnet zur Legionsatmo-sphäre nicht passen: Alle fünf Kohorten liegen bei Tisch. Wichtiger als dieseStaffage ist die immer wieder eingeschärfte Lektion, nur das Überwindenalter Feindschaften – symbolisiert durch den Austausch der Führungsperso-nen – werde das Überleben der Menschheit sichern können.64
62 Die zwei Heroenfraktionen: HO 1, 549 Kap. 56; römische Persönlichkeitsanteileder Götter, konstitutive Härte: ebd. 105 Kap. 8. Aussetzung bei „Lupa“: ebd. 518Kap. 51; Camp Jupiter: HO 2, 21 Kap. 2 (die benachbarte Zivilsiedlung ist durchein pomerium abgetrennt: ebd. 155 Kap. 13). Laren und „Augur“: ebd. 41-43 Kap. 4(an Vögeln, die für echte Auguren in Frage kämen, fliegen hauptsächlich Adlerherum, die bei den riskanten Kriegsspielen als Luftrettung fungieren).
63 Natürlich angelehnt an R. Sutcliff, The Eagle of the Ninth (1954 [2000]). Erster Ver-lust des Legionsadlers: HO 2, 94 Kap. 8. Dieser ‚erste‘ Verlust beim Rückzug ausJerusalem 66 n. Chr., abgeleitet aus Suet. Vesp. 4, wurde schon von Ritterling1924/25, 1706f. als nicht zwingend bezeichnet; kein neuer Sachstand bei Bert-randy/Rémy 2000.
64 Liegen beim Essen: HO 2, 90 Kap. 8. Austausch: HO 1 versetzt den Anführer der‚römischen‘ Heroen, Jason, nach Camp Half-Blood, während der in diesem Band
Das Spiel mit den Blitzen 79
Die ursprüngliche Leitidee, das Verdammtsein zur Entfaltung der eige-nen Persönlichkeit, bleibt die vitalere. Zu Fuß und fast wehrlos gegen diemenschlichen Gefahren auf seinem Weg kämpft sich Percy Jackson mit derschwachen Hoffnung durch seine Abenteuer, dass der Westen sich allenDrohungen zum Trotz nicht so leicht auslöschen lässt, selbst wenn er per-sönlich scheitern sollte, und dass ein wahrer Held, um seine Versprecheneinzuhalten, mit sich selbst und seinen Idealen in Gestalt der Götter ringenmuss, weil sein Feuer auch immer ein wenig das gestohlene Feuer vomOlymp ist.
Epilog: Das Ringen mit den etwas zu großen Problemen – und die alten Aufbaugegner
Laut Jan Assmann ist ein Mythos „eine fundierende Geschichte, eine Ge-schichte, die erzählt wird, um eine Gegenwart vom Ursprung her zu erhel-len.“65 Auch unsere Zeit lässt sich ein wenig Licht auf ihren Weg ganz gerngefallen, künstliches Licht oder nicht. Zwischenzeitlich war „Mythos“ – undist es noch – im schlechten Sinn eine mit Irrationalität überladene Erzäh-lung, die dringend entmythologisiert gehörte, und im guten das Synonymeiner Geschichte, die schön ist, aber leider zu schön, um wahr zu sein, die
als verschwunden gemeldete Percy Jackson in HO 2 zum Römerlager in Kaliforni-en stößt, beide mit temporärer Gedächtnislöschung.
65 Assmann 1997 [1999], 52. Zum Mythos v. a. 73-83. Bezogen sei er auf „das Gewor-densein der Welt sowie der Mechanismen, Riten und Institutionen, die dafür zusorgen haben, daß sie nicht wieder vergeht“ (ebd. 72), „eine Geschichte, die mansich erzählt, um sich über sich selbst und die Welt zu orientieren, eine Wahrheithöherer Ordnung, die nicht einfach nur stimmt, sondern darüber hinaus auchnoch normative Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt.“ (74) Dabei han-delt es sich entweder um fundierende Geschichte – wie alles so geworden ist,wie es sein sollte – oder aber um kontrapräsentische – wie alles eigentlich wer-den müsste, um so zu sein, wie es einmal war. Mythos und „eigentliche“ Ge-schichte sind insofern im kulturellen Gedächtnis funktionsgleich. Das klammertnotgedrungen eine klassisch-antike Verwendung des Mythosbegriffs für einvorsätzliches Konstrukt zur Situationserklärung aus. Schönes Beispiel für Akti-vierung und Aktualisierung des mythischen Grundstocks im Athen des 6./5. Jh.v. Chr.: Muth 2010, besonders 219: „Die Bedürfnisse der Gegenwart begründetendie Reflexion auf die mythische Vergangenheit und modellierten sie – und dieErinnerung an die Vergangenheit bestärkte die Auseinandersetzung mit denThemen und Wünschen der Gegenwart.“
80 Jörg Fündling
man also nicht oder nicht mehr glauben kann.66 Das Bedürfnis nach Mythenfür den täglichen Gebrauch ist offensichtlich lebendig – wenn nicht alsArbeit, dann als Sich-Abarbeiten am Mythos – und ihre kleinen Wahrheitentrösten auch da, wo man sich an die große Wahrheit nicht heranwagenmöchte.67
Unter anderem liegt dies daran, dass die Götterwelt der klassischen An-tike ins Vorfeld – aber anders als der zitierte Deutungsstreit um den Begriff‚Mythos‘ nicht ins Zentrum – einer der wichtigsten Kontroversen der Ge-
66 Mythos als Unwahrheit und Zug ins Irreale: So noch Schadewaldt 1982 (1990),82-112. Ordnungsbedürfnis und Vergangenheitsbewusstsein Homers erleichternden Weg „aus dem Bereich des Dichterischen und des Mythos in [...] den Bereichder Realität und der Prosa.“ (ebd. 95) Vgl. 24f.: In der Prosa spricht „der Weit-gereiste mit seiner Skepsis“, 24. Zur christlichen Anbahnung dieser Konnotationvgl. Schmitz/Zanella/Heydasch-Lehmann 2013, 472f. mit Lit. „Mythen“ als ab-wertendes Signalwort für vormoderne Denkmuster bis zur ‚Entzauberung derWelt‘: Taylor 2007 [2012], 57. Charakteristisch ist der Disput der Freunde C. S. Le-wis – der Märchenerfinden mit einer Metapher unter Pfeifenrauchern als „brea-thing a lie through silver“ abtat (Tolkien 1947 [1988], 50) und einem Faun dasBuch „Is Man a Myth?“ in die Hand drückte (C. S. Lewis, The Lion, the Witch andthe Wardrobe (1954 [2004]), 116 Kap. 2) – und J. R. R. Tolkien, der Mythos und My-thologie daraufhin durch ein Gedicht („Mythopoeia“) und den 1938 entstande-nen Essay On Fairy-Stories (Tolkien 1947 [1988]) verteidigte, welcher heute durchseine Wiederentdeckung des Begriffs Fantasy weit bekannter ist. (Dazu v. a. 44-52; Tolkiens Definition „the making or glimpsing of Other-worlds“ [40] gehtüber die heute gängige Bedeutung weit hinaus, schränkt sie aber andererseitsebd. 54 durch die Definition für „fairy-story“, grob übersetzt „Märchen“, ein.)Unter scharfer Abkehr von der These, es handle sich bei Mythen um Allegorienfür Naturvorgänge, bekam hier das menschliche Urbedürfnis, zu erfinden undzu erzählen, den Primat zugewiesen (ebd. 25-28): Mythologie und Religion „weresundered long ago and have since groped slowly, through a labyrinth of error,through confusion, back towards re-fusion.“ (28) Im Märchen als seiner ver-meintlichen Schwundstufe, will das heißen, schüttle der Mythos unter anderemdie Last des Polytheismus ab und komme seiner wahren Funktion näher. Deswe-gen seien Märchen mystisch (aufs Übernatürliche gesehen), magisch (als Blickauf die Natur) und Spiegelbild des Menschlichen zugleich, daher auch TolkiensAussage: „History often resembles ‚Mythʻ, because they are ultimately of thesame stuff.” (31) Da er die Daseinsberechtigung des Mythos konsequent an des-sen Affinität zur christlichen Heilsgeschichte bemisst (die berühmte Passage zur„Eukatastrophe“, 62-64) und Geschichte für ihn wesentlich Heilsgeschichte ist(für pragmatisch-exakte Geschichtsschreibung zeigte Tolkien erkennbar wenigInteresse), kann er diese Aussage ohne weiteres treffen.
Das Spiel mit den Blitzen 81
genwart gehört. Die religiöse Dimension des Menschen, die Frage ihrerNotwendigkeit und der Umgang mit ihr eröffnen eine Vielzahl lebenslangerEntscheidungszwänge und Konfliktmöglichkeiten, und zwar desto mehr, jestärker die individuell gewählte Option Verbindlichkeit beansprucht. Star-ke Bindung an eine Religion einerseits und Formen des vorrangig gegen dasChristentum herangewachsenen „ausgrenzenden Humanismus“ der säkula-ren Moderne andererseits provozieren einander nun schon seit Jahrhun-derten. Sie werden aber allesamt durch ein kaum mehr überschaubaresSpektrum von Möglichkeiten in Frage gestellt, „eine pluralistische Welt, inder sich viele Formen des Glaubens und des Unglaubens aneinander reibenund einander daher fragmentieren.“ Die Zurückweisung der Religionschlechthin kann statt militant auch desinteressiert ausfallen, höflich bisleicht ratlos, gelangweilt oder ironisch. Innerhalb der Glaubensgemein-schaften – den militant Säkularen ein Ärgernis, den nicht so vehement Auf-tretenden eine Torheit – ringen Anhänger einer orthodox-systematisiertenReligionsform mit Richtungen, die dem gleichen Glauben anhängen, nichtaber dessen Alltagspraxis befolgen, umgekehrt das Rituelle ohne den Glau-bensinhalt attraktiv finden, sich Distanz zu Einzelpunkten vorbehalten ...und das erfasst noch gar nicht die individuelle Sinnsuche unter dem Vorzei-chen des Spirituellen, die Autoritäten von vornherein ablehnt. JedermannsStein des Anstoßes ist heutzutage immer gleich nebenan.68
67 Etwas säuerlich konzediert von Freud 1911 (1973), 203 an die Adresse C. G. Jungs:„daß die mythenbildenden Kräfte der Menschheit nicht erloschen sind, sondernheute noch in den Neurosen dieselben psychischen Produkte erzeugen wie inden ältesten Zeiten.“
68 Zentral ist Matthews 2009 [2012]; zum „ausgrenzenden Humanismus“ definie-rend 42 (Genese und Selbstsicht: ebd. 414-440). Die polare Spannung zwischenChristentum und dezidiertem Atheismus wird überlagert vom „Nova-Effekt“(507) des existentiellen Unbehagens in mehrfacher Hinsicht (527-541); „einepluralistische ...“: ebd. 889. Die eklektisch-spirituelle Absage als Kennzeichen des„Zeitalter[s] der Authentizität“ (788): ebd. 816. Auch in dieser noch anhaltendenPhase zusätzlicher Komplikation stellt man laut Matthews fest, „daß die zwi-schen vielen verschiedenen Parteien geführte Auseinandersetzung [...] von denbeiden Extrempositionen geprägt wird: von der transzendenten Religion einer-seits und ihrer direkten Leugnung andererseits.“ (45) Vielleicht sollte man voneiner Art Referenzsystem mit praktischen Vorteilen zur eigenen Standortbe-stimmung aller Beteiligten sprechen, das – insbesondere der religiöse Pol – vonFall zu Fall für eine Distanzierung genutzt oder wegen seines generellen Beste-hens auf der Existenz von Sinn und ‚Werten‘ gelobt wird.
82 Jörg Fündling
Die Olympier stehen nicht zuletzt deshalb am Rand der generellen Auf-merksamkeit, weil sie seit weit über einem Jahrtausend für fast niemandeneine ernsthafte Glaubensfrage sind: auch innerhalb der neopaganen Strö-mungen bilden die klassisch-antik orientierten eine sehr überschaubareMinderheit. Genau das macht die Götter aber für so gut wie alle Richtungenund Denkweisen unproblematisch, ja praktisch, wie der Blick in die kleineliterarische Nische gezeigt hat, die sie bevölkern. Für Atheisten, Agnostikerund Religiöse aller Schattierungen sind sie frei handhabbare Denk- undSprachfiguren, hinter denen nichts Gefährliches steckt. Denn göttlich (oderauch teuflisch-dämonisch) sind die Götter nicht mehr. Göttlich ist heutzu-tage das Übernatürliche oder aber die Welt als Ganzes, sie dagegen sindreduziert auf ‚nur‘ übermenschliche Größe. Mehr als eine Riesenversionnormalsterblicher Gefährdungen – im Fall Rick Riordan – oder Absurditäten– wie bei Amy Myers – können sie nicht darstellen, ja gerade ihre völligeUnzulänglichkeit in Existenzfragen wird von ganz unterschiedlichen Auto-ren als Rückversicherung gegen etwaige verbindliche Ansprüche eines All-mächtigen gesehen. Das alte ästhetische Argument, wie attraktiv der alteGötterhimmel war, trifft sich mit einer Art ins Positive gewendetem Feuer-bach, dem Applaus für den Schritt, den Menschen wieder und diesmal ganzbewusst an den Himmel zu projizieren.
Wenn die hier vorgestellten Werke eins gemeinsam haben, dann einengewissen fundamentalen Optimismus. Wo die Götter auftreten, markierensie das Höchstmaß an Problemen, mit denen sich die Menschheit im jeweili-gen literarischen Rahmen konfrontiert sieht. Sie können Verwirrung stif-ten, können das Leben eines Individuums nach wie vor entgleisen lassenoder sogar ganz vernichten ... aber letzten Endes sitzen sie im selben Boot,auch ihnen ist die Welt jedenfalls zu groß, um sie schlicht nach ihremWunsch laufen lassen zu können – oder wenn doch, machen sie sich nichtdie Mühe. Die seltenen literarischen Götter tun ihr Möglichstes, um nichtalle Dimensionen zu sprengen, um sich kleiner und verständlicher als, sa-gen wir, den Treibhauseffekt zu machen. Lassen sie sich einmal nicht be-reitwillig den Donnerkeil des Zeus entreißen, geben sie uns doch eine faireChance, dessen Blitzen auszuweichen ... oder uns nur in Maßen elektrisie-ren zu lassen: gerade genug, um die durchaus übermenschlichen Nöte, einMensch zu sein, auf erträgliche Dimensionen herunterzuspielen, in die wirhineinzuwachsen hoffen. So gesehen leistet der Mythos auch als Rander-scheinung weiterhin, was er schon oft und lange getan hat – er baut einHaus.
Das Spiel mit den Blitzen 83
Bibliographie
Verwendete Literatur der Moderne
Adams, D., The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. London 1979 (zit. nach TheHitch Hiker’s Guide to the Galaxy. A Trilogy in Five Parts. London 1995).
Banville, J., The Infinities. London 2009 (zit. nach TB-Ausg. London 2010 alsInf; dt. Unendlichkeiten. Köln 2012).
Brecht, B., Kalendergeschichten. Berlin 1949 (zit. nach Ausgewählte Werke insechs Bänden. Fünfter Band: Prosa. Frankfurt a. M. 1997, 119-231).
Christopher, J., The White Mountains. London 1967 (zit. nach TB-Ausg. NewYork/London 2003; dt. Dreibeinige Monster auf Erdkurs. Würzburg 1971).
ders., The City of Gold and Lead. London 1968 (dt. Das Geheimnis der dreibeinigenMonster. Würzburg 1972).
ders., The Pool of Fire. London 1968 (dt. Der Untergang der dreibeinigen Monster.Würzburg 1972).
ders., The Prince in Waiting. London 1970.ders., Beyond the Burning Lands. London 1971.ders., The Sword of the Spirits. London 1972 (alle drei Bände dt. als Sammel-
übersetzung Der Fürst von morgen. Ravensburg 1983).Collins, S., The Hunger Games. New York 2008 (zit. nach TB-Ausg. London
2009 als HG).dies., Catching Fire. New York 2009 (zit. nach TB-Ausg. London 2009 als CF).dies., Mockingjay. New York 2010 (zit. nach TB-Ausg. London 2010 als MJ).Davis, L., „Investigating the Silvius Boys“, in: M. Jakubowski (Hg.), No Alibi.
Best of New Crime Writing. London 1995 (zit. nach: M. Ashley (Hg.), Classi-cal Whodunnits. Murder and Mystery from Ancient Greece and Rome. London1996, 25-36).
Goethe, J. W., „Prometheus“ (1774? Zit. nach: Werke. Kommentare und Register(Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hg. E. Trunz.) 1: Gedichte und Epen I.München 121981, 45 vgl. 483-85.
Hacker, K., Morpheus oder der Schnabelschuh. Frankfurt a. M. 1998.Hein, Ch., Vor der Zeit. Korrekturen. Berlin 2013.Kafka, F., „Das Schweigen der Sirenen“ (Drittes Oktavheft, Okt. 1917), zit.
nach: M. Brod (Hg.), Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Pro-sa aus dem Nachlaß. (Werkausgabe in acht Bänden.) Frankfurt a. M. 1983,58f.
ders., „Poseidon“ (1920), zit. nach: M. Brod (Hg.), Beschreibung eines Kampfes.Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaß. (Werkausgabe in acht Bän-den.) Frankfurt a. M. 1983, 73f.
84 Jörg Fündling
Lewis, C. S., The Lion, the Witch and the Wardrobe. London 1950 (zit. nach TheChronicles of Narnia. New York 2004, 104-196).
Mann, H., Die Göttinnen. Die drei Romane der Herzogin von Assy. III: Venus. Mün-chen 1903 (zit. nach Studienausgabe in Einzelbänden, hg. P.-P. Schneider,Frankfurt a. M. 1987).
Mann, Th., Joseph und seine Brüder. Die Geschichten Jaakobs. Berlin 1933 (zit.nach: Joseph und seine Brüder I: Die Geschichten Jaakobs. (FrankfurterAusgabe in Einzelbänden, hg. P. de Mendelssohn.) Frankfurt a. M. 1983).
ders., Joseph und seine Brüder. Joseph in Ägypten. Wien 1936 (zit. nach Josephund seine Brüder III: Joseph in Ägypten. (Frankfurter Ausgabe in Einzelbän-den, hg. P. de Mendelssohn.) Frankfurt a. M. 1983).
Merkel, I., Eine ganz gewöhnliche Ehe. Odysseus und Penelope. Roman. Salz-burg/Wien 1987 (zit. nach TB-Ausg. Frankfurt a. M. 1989).
Myers, A., „Aphrodite’s Trojan Horse”, in: M. Ashley (Hg.), Classical Who-dunnits. Murder and Mystery from Ancient Greece and Rome. London 1996, 1-24 (zit. als ATH).
von Niebelschütz, W., Der blaue Kammerherr. Galanter Roman in vier Bänden.Frankfurt a. M. 1949 (zit. nach TB-Ausg. München 1998).
Pratchett, T., Mort. A Discworld Novel. London 1987 (zit. nach TB-Ausg. Lon-don 1988).
ders., Small Gods. A Discworld Novel. London 1992 (zit. nach TB-Ausg. London1993).
Ransmayr, Ch., Die letzte Welt. Roman. Mit einem Ovidischen Repertoire. Nörd-lingen 1988 (zit. nach TB-Ausg. Frankfurt a. M. 1991).
Riordan, R., Percy Jackson and the Olympians 1: The Lightning Thief. New York2005 (in späteren, v. a. englischen Ausgaben Percy Jackson and the Light-ning Thief; zit. als PJ 1 nach TB-Ausg. New York 2006).
ders., [Percy Jackson and] The Sea of Monsters. New York 2006 (zit. als PJ 2 nachTB-Ausg. London 2007).
ders., [Percy Jackson and] The Titan’s Curse. New York 2007 (zit. als PJ 3 nachTB-Ausg. London 2008).
ders., [Percy Jackson and] The Battle of the Labyrinth. New York 2008 (zit. als PJ4 nach TB-Ausg. London 2009).
ders., [Percy Jackson and] The Last Olympian. New York 2009 (zit. als PJ 5). ders., The Heroes of Olympus. The Lost Hero. New York 2010 (zit. als HO 1 nach
TB-Ausg. New York 2012).ders., The Son of Neptune. New York 2011 (zit. als HO 2 nach TB-Ausg. London
2011).ders., The Mark of Athena. New York 2012 (zit. als HO 3).Roth, Ph., The Human Stain. Boston 2000 (zit. nach TB-Ausg. London 2005).
Das Spiel mit den Blitzen 85
Rowling, J. K., Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London 1997.Schiller, F., „Die Götter Griechenlands“ (Erste Fassung, 1788. Zit. nach Sämt-
liche Werke III: Gedichte. Erzählungen. Übersetzungen. Zürich 1968 (51991),128-133).
Shakespeare, W., Troilus and Cressida. London 1623 [Erstbezeugung 1603] (zit.nach S. Wells/G. Taylor (Hgg.), The Complete Works. Oxford 1988, 715-748).
Straczynski, J. M./Romita jr., J., The Amazing Spider-Man (Dezember 2001),Nachdruck als „Spider-Man [Ohne Titel]“ in: A. Platthaus (Hg.), Spider-Man. (Klassiker der Comic-Literatur 15.) Frankfurt a. M. (FAZ) 2005, 209-232.
Sutcliff, R., The Eagle of the Ninth. London 1954 (zit. nach TB-Ausg. Oxford2000).
Swinburne, A. Ch., „Faustine“ (publ. 1862; zit. nach: K. Haynes (Hg.), Poemsand Ballads & Atalanta in Calydon. Harmondsworth 2000, 86-91 vgl. 341-343).
ders., „Anactoria“ (1866; zit. nach: ebd. 47-55 vgl. 332-334).ders., „Hymn to Proserpine“ (1866; zit. nach: ebd. 55-61 vgl. 334f.).ders., „Dolores (Notre Dame des Sept Douleurs“ (1866, zit. nach: ebd. 122-
136).van Vogt, A. E., The Book of Ptath, Reading. Pa. 1947 (spätere Auflagen teils
unter dem Titel Two Hundred Million A.D. Dt. 200 Millionen Jahre später. Ber-gisch Gladbach 1989).
Wallace, L., Ben-Hur. A Tale of the Christ. New York 1880.Wolf, Ch., Kassandra. Erzählung/Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra.
Frankfurter Poetik-Vorlesung. Frankfurt a. M. 1983.dies., Medea. Stimmen. Roman. Frankfurt a. M. 1996 (zit. nach TB-Ausg. Frank-
furt a. M. 2008).
Darstellungen und journalistische Texte
Assmann, J., Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitätin frühen Hochkulturen. München 1997 (zit. nach TB-Ausgabe München²1999).
Bertrandy, F./Rémy, M., Legio XII Fulminata, in: Y. Le Bohec/C. Wolff (Hgg.),Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 sep-tembre 1998). (2 Bde.) Lyon 2000, 1, 253-258.
Blumenberg, H., Arbeit am Mythos. Frankfurt a. M. ³1984 (zitiert nach TB-Ausg. 2006).
Britt, R., „Genre in the Mainstream: Great Crossover Books of 2011“ (Blo-geintrag vom 3. Januar 2012 in tor.com). http://www.tor.com/blogs/
86 Jörg Fündling
2012/01/genre-in-the-mainstream-great-crossover-books-of-2011 (letz-ter Zugriff 29.4.2013).
Cameron, A., Greek Mythography in the Roman World. Oxford 2004.Clute, J., Coming of Age, in: A. M. Butler/E. James/F. Mendlesohn (Hgg.):
Terry Pratchett: Guilty of Literature. Baltimore 22004, 15-30.Craig, A., „Crossover Books. Time Out“. http://www.amandacraig.com/
pages/childrens-book-reviews/reviews/crossover-books.htm (letzterZugriff 29.4.2013).
Dominus, M., „The Bowdlerization of Dr Dolittle“ (Blogeintrag in „The Uni-verse of Discourse“, 23.1.2006). http://blog.plover.com/book/Dolittle.html (letzter Zugriff 28.4.2013).
Erdbeer, M./Graf, F., Mythos [Rezeption]. DNP 15/1 (2001), 636-648.Freud, S., Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschrie-
benen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) (1911), Nachtrag. Jahrbuchfür psychoanalytische und psychopathologische Forschung 3, 2 (1912), 588-590(zit. nach: Studienausgabe Bd. 7 (hgg. A. Mitscherlich/A. Richards/J. Stra-chey: Zwang, Paranoia und Perversion. Frankfurt a. M. 1973, 201-203).
Fündling, J., Perlen vor die Säue oder Einäugige unter Blinden? Was (Alt-)Historiker an historischen Krimis reizt, in: K. Brodersen (Hg.), CRIMINA.Die Antike im modernen Kriminalroman. Berlin 22009, 49-108.
Graf, F./Zgoll, A./Hazenbos, J. et al., Mythos. DNP 8 (2000), 633-650.Guthmüller, B./Baumbach, M., Mythologie [Rezeption]. DNP 15/1 (2001),
611-636.N. N. (dpa), „Kruzifix-Verbot für Krankenschwester“, Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 15.1.2013; zitiert nach http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/grossbritannien-kruzifix-verbot-fuer-krankenschwester-12025696.html (letzter Zugriff 3.4.2013).
Muth, S., Amphoren, Schalen & Co. – den Mythos vor Augen, in: E. Stein-Hölkeskamp/K.-J. Hölkeskamp (Hgg.), Die griechische Welt. Erinnerungsorteder Antike. München 2010, 202-220.
Ritterling, E., RE XII 1 (1924), 1186-1328; XII 2 (1925), 1329-1829 s. v. Legio.Rosen, K., Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Stuttgart 2006.Rüster, J., The Turtle Moves! Kosmologie und Theologie in den Scheibenweltroma-
nen Terry Pratchetts. Wetzlar 2003.Schadewaldt, W., Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen. Hero-
dot/Thukydides. Tübinger Vorlesungen 2. Frankfurt a. M. 1982 (zit. nach³1990).
Schmitz, Ch./Zanella, F./Heydasch-Lehmann, S., Mythos. RAC Lfg. 196/97(2013), 471-516.
Das Spiel mit den Blitzen 87
Smith, E., „The Melancholy Gods“. Dublin Review of Books vom 18.2.2010;http://www.drb.ie/more_details/10-02-18/The_Melancholy_Gods.aspx(letzter Zugriff 20.8.2012).
Taylor, Ch., Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt a. M. 2009 (zit. nach TB-Ausg.Berlin 2012. Orig. A Secular Age. Cambridge, Mass. 2007).
Tolkien, J. R. R., On Fairy-Stories, in: C. S. Lewis (Hg.), Essays Presented toCharles Williams. London 1947, 38-89 (zit. nach ders., Tree and Leaf, Inclu-ding the Poem Mythopoeia. London ²1988, 9-73).
Wansing, R., „Mythos“, in: N. Pethes/J. Ruchatz (Hgg.), Gedächtnis und Erin-nerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. Reinbek 2001, 392f.