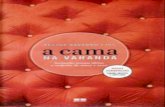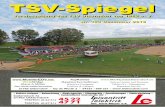Cidade de Deus - eine Analyse des Romans von Paulo Lins und des gleichnamigen Films von Fernando...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Cidade de Deus - eine Analyse des Romans von Paulo Lins und des gleichnamigen Films von Fernando...
Cidade de Deus
Eine Analyse des Romans von Paulo Lins und des gleichnamigen Films von Fernando Meirelles
Miriam Ramírez García
Seminar: La Novela americana del 'boom' y sus versiones filmicas
Abgabedatum: 28.07.2014
2
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................................ 3
2. Das Verhältnis von Literatur und Film ................................................................................................ 4
3. Literaturverfilmung – Adaption – Transformation .............................................................................. 6
4. Analyse des Buches Cidade de Deus von Paulo Lins und seinem Transform Cidade de Deus von Fernando Mereilles .................................................................................................................................. 8
4.1. Struktur und Handlung ................................................................................................................. 9
4.2. Die Erzählinstanz ....................................................................................................................... 12
4.2.1. Die Kamera als Erzählinstanz ............................................................................................. 14
4.3. Personenkonstellation ................................................................................................................. 16
4.4. Der Raum ................................................................................................................................... 17
4.5. Zeit ............................................................................................................................................. 17
4.5.1. Die Montage ........................................................................................................................ 19
4.6. spezifisch filmische Ausdrucksformen ....................................................................................... 20
4.6.1. Beleuchtung und Farbgebung .............................................................................................. 20
4.6.1. Die Tonebene ...................................................................................................................... 21
5. Zusammenfassung und Ausblick ....................................................................................................... 22
6. Bibliographie ..................................................................................................................................... 24
3
1. Einleitung Literatur und F ilm s ind e igenständige K unstformen und s tehen ni cht i n A bhängigkeit
zueinander, daher r ief der B egriff „ Literaturverfilmung“ l ange Zeit Skepsis hervor. B ei
Filmwissenschaftlern war sie wenig geschätzt und wurde als eine „Mischform“ misstrauisch
betrachtet. Diese M einung w ar ei ne S piegelung de s V orurteils s eitens de r
Literaturwissenschaftler, di e de r M einung w aren, dass da s l iterarische W erk in seiner
filmischen Version angeblich verfälscht, sogar v erstümmelt w erden würde. Sie kr itisierten
auch, dass das Original trivialisiert werde. Studien dieser Sichtweise waren daher oftmals ein
wertender Vergleich. Tatsächlich gab es eine enge Verbindung des frühen Kinos zum Theater
und dur ch di e V erwendung be kannter l iterarischer R omanvorlagen e rhoffte m an s ich e inen
Prestigegewinn. Ein weiteres Vorurteil gegenüber Literaturverfilmungen war
„[…] hä ufig a uch di e Vorstellung, da ss das m it symbolischen Z eichen arbeitende
Sprachkunstwerk eine aktive Rezeptionshaltung des Lesers erfordere, während das Bild-
dominierte D arstellungsverfahren de s i konischen Mediums F ilm g rundsätzlich eine
passive Konsumhaltung fördere.“1
„Tatsächlich k ann m an ni cht v on einer K onkurrenz und v on einem Ersatz s prechen,
sondern eher von der Hinzufügung einer ganz neuen Dimension, die die Künste seit der
Renaissance mehr und mehr verloren haben: das Publikum.“
Diese Vorstellung ist weitestgehend überholt, denn die Frage nach dem künstlerischen Niveau
eines W erkes, s ollte ni cht a n da s gewählte M edium, s ondern a n de n s pezifischen U mgang
damit geknüpft sein. Mittlerweile hat s ich das Medium Film als gleichrangig gegenüber der
Literatur etabliert: lite rarische V orlage und f ilmische U msetzung w erden a ls gleichwertig
betrachtet, w obei da s H auptaugenmerk i n de n ne ueren S tudien a uf de m V organg de s
Medientransfers sowie dem Verhältnis zwischen Literatur und Film liegt.
Die A daption eines l iterarischen Textes g ewinnt he utzutage a n B edeutung f ür di e
Interpretation und D okumentation der Rezeptionsgeschichte dieser. Und der Kinofilm leistet
seinen eigenen künstlerischen Beitrag zur Interpretation der Wirklichkeit:
2
Im M ittelpunkt di eser Arbeit s teht di e Frage nach de m Vorgang de r Ü bertragung e ines
literarischen E rzähltextes i n da s M edium F ilm und di e A rt d er Bezugnahme a uf d en
literarischen Ausgangstext. Zu Beginn w ird das V erhältnis z wischen Film und Literatur
1 Bohnenkamp, A.: Vorwort. Literaturverfilmungen als intermediale Herausforderung. In: Ders. (Hrsg.):
Interpretationen. Literaturverfilmungen. Reclam Verlag. Stuttgart. 2005. S. 10 2 Bazin, A: Für ein »unreines« Kino – Ein Plädoyer für die Adaption. In: Gast, W. (Hrsg.): Literaturverfilmung.
C.C.Buchners Verlag. Bamberg. 1993. S. 39
4
beschrieben und di e theoretischen Grundlagen zur Adaption bzw. Transformation dargelegt.
Die H ausarbeit konz entriert s ich in de n a nschließenden K apiteln vornehmlich a uf e ine
formale Analyse des Romans Cidade de Deus von Paulo Lins und de s gleichnamigen Films
von F ernando M eirelles. Hierbei s oll ei n wertender V ergleich be ider W erke ve rmieden
werden. V ielmehr s oll a ufgezeigt w erden, da ss e s a ufgrund de r T hematik de s S toffes
Gemeinsamkeiten gibt, e ine A daption bz w. T ransformation de nnoch dur chaus ein
eigenständiges Werk sein kann.
2. Das Verhältnis von Literatur und Film Jede Kunst ist unabdingbar medial. Der Begriff Medium wird zum einen als Datenträger3 im
materiellen Sinn verstanden und zum ande ren als Z eichensystem. Die Zeichensysteme von
Film und L iteratur unt erscheiden s ich g rundlegend. B estehen s ie b eim F ilm aus de r
Kombination von be wegten B ilden, Tönen und der nonv erbalen S prache de r S chauspieler,
besteht das Zeichensystem der Literatur aus der geschriebenen Sprache. Der Inhalt kann hier
nicht ohne Weiteres vom Medium abgekoppelt werden, d.h. e in Roman ist nicht eins zu eins
in da s M edium F ilm übe rtragbar. D ennoch kön nen be ide M edien i n e inem s ymbiontischen
Verhältnis4
Die E igenschaften des Zeichensystems Sprache bestimmen die E igenschaften von Literatur.
Ein zentrales M erkmal s prachlicher Z eichen ist i hre Linearität. Die A usdrucksseite be steht
aus a ufeinanderfolgenden nicht g leichzeitig über mittelten Zeichen. Der Film im G egensatz
dazu läuft zwar l inear ab, aber eröffnet zeitgleich s tets e inen zweidimensionalen Raum und
überlagert i hn m it e iner T onebene. A ls z weites Merkmal gilt di e A bstraktheit s prachlicher
Schriftzeichen, di e z unächst a uf e in K onzept i m K opf de s Lesers und noc h ni cht a uf ein
konkretes O bjekt de r U mwelt ve rweisen, z.B. be i de r D arstellung von a bstrakten
Zusammenhängen, Verneinungen, W ertungen u nd G egensätzen, die d urch eine di rekte
Benennung ve rdeutlicht w erden könn en.
zu einander gesehen werden.
5
3 Medien s peichern u nd t ransferieren W issen. T echnische M edien h aben d ie F ähigkeit d es M enschen zu r
Sammlung, Ü bertragung und W ahrnehmung von I nformationen e rweitert. Sie unterscheiden s ich nach ihrer materiellen B eschaffenheit s owie i hrem technischen A ufbau u nd p rägen d ie A ufbereitung u nd Erscheinung von W issen. S ie b ewirken s oziale K ommunikation, i ndem s ie K ommunikationssysteme etablieren. (Vgl. Schwab, U.: Erzähltext und Spielfilm. Zur Ästhetik und Analyse der Filmadaption. LIT Verlag. Berlin.2006. S. 2)
4 Als Symbiose wird in den Naturwissenschaften eine für beide vorteilhafte Vergesellschaftung zweier Individuen unterschiedlicher Arten verstanden.
5 Poppe, S.: Visualität in Literatur und Film. Eine medienkomparatistische Untersuchung moderner Erzähltexte und ihrer Verfilmungen. Vandenhoeck und Ruprecht Verlag. 2007
Im literarischen Kontext k ann auf j egliche
Konkretisierung verzichtet werden, der Leser füllt diese Leerstellen in seiner Vorstellung aus.
Bei de r U msetzung in ein Filmbild muss s ich der Regisseur z wangsläufig i mmer s chon
5
entscheiden (vgl. Bohnenkamp). Am auffälligsten ist das bei der Verkörperung literarischer
Figuren, wofür immer ein konkreter Schauspieler bestimmt werden muss. Die Interpretation
des R egisseurs in Form des F ilmbilds e rsetzt zwangsläufig di e V orstellung de s Zuschauers
und f ührt z ur w echselseitigen A bhängigkeit von F remderfahrung und S elbsterfahrung, da s
heißt, di e s ubjektive S icht de s R egisseurs v erbindet s ich m it de r s ubjektiven S icht de s
Rezipienten.6
Das H auptaugenmerk de s F ilms l iegt i m Fotogenen. D ie R olle de s W ortes w ird da bei a ber
nicht a usgeschaltet, s ondern a uf eine a ndere E bene t ransportiert. S o w erden z .B. m eta-
phorische Ausdrücke i m F ilm dur ch di e M ontage e inzelner E instellungen und A ufnahme-
winkel erzeugt.
Als letztes Merkmal sprachlicher Zeichen ist ihre Arbitrarität zu nennen, sprich
der Ausdruck und seine Bedeutung beruhen auf Konventionen.
Der Film e ntsteht i m l etzten D rittel de s 19. J ahrhunderts und m acht de n B ildtransport
möglich. E inzelbilderfahrungen w erden nun du rch d en Informationskontext f ortlaufender
Bilder a bgelöst: „ Im U nterschied z ur Informationsweise de r gedruckten S chrift bi etet di e
Kinematographie andere Informationen in Form realer Abbilder der Umwelt.“ (Schwab: S. 3)
Das in Büchern enthaltene Wissen gilt zwar als gesellschaftlich relevant, doch bietet der Film
als neuer Informationstypus die direkte Repräsentation der Umwelt in bewegten Bildern und
ab dem Ende der 1920er Jahre auch mit Ton. Bewegungen und Ereignisse werden unmittelbar
dokumentiert und die ferne Welt in einer realen Repräsentation näher gebracht (vgl. Schwab).
Schon f rüh be dienten s ich di e F ilmemacher an l iterarischen Vorlagen. D urch di e enge
Verbindung des frühen Kinos zum Theater erwartete man sich einen Prestigegewinn durch die
Verwendung bekannter literarischer Romanvorlagen.
7
Die visuelle Kreation und Ausgestaltung erdachter Räume und F iguren in Literatur und Film
bilden di e V oraussetzung f ür da s E rzählen einer G eschichte. Zustandsbeschreibungen de r
Figuren, R äume und Objekte s ind da bei von z entraler B edeutung - ohne s ie k ann ke ine
Handlung entwickelt werden. Im Roman entsteht der Raum erst in der Vorstellung des Lesers.
Auch die dramaturgische Konstellation haben die literarische und f ilmische
Erzählung gemein. D er R oman s tellt de m F ilm ein B eziehungsgeflecht a us P rotagonisten,
primären und s ekundären Nebenfiguren zur Verfügung. In beiden Medien manifestieren sich
die Charaktere durch inneres und äußeres Handeln und die Interaktion mit anderen Figuren.
6 Vgl. Luhn, U.: Verfilmte Literatur oder Literaturverfilmung? Ein analytischer Vergleich von Fontanes „Effie
Briest“ und der Verfilmung von R. W. Fassbinder. Freie Universität zu Berlin. 1988 7 Vgl. Binder, E./Engel, Ch.: Film und Literatur. Von Liebeleien, Konflikten und langfristigen Beziehungen. In:
Neuhaus, S. (Hrsg.): Literatur im Film. Beispiele einer Medienbeziehung. Königshausen und Neumann. Würzburg. 2008
6
Im Film wird er, interpretiert durch den Regisseur, konkret dargestellt. Nach Poppe dient die
Visualität i n T ext und F ilm de r B edeutungserzeugung und S innvermittlung. Ü ber di e
Beschreibung und D arstellung opt ischer M erkmale und D etails w erden Informationen und
Bedeutungen mitgeteilt (vgl. Poppe).
Traditionell wird das Original, hier der Roman, im Sinne des einen Ursprungs bevorzugt und
der Film i m K onkurrenzverhältnis Film gesehen: Es se i eine „Flut ob erflächlicher, au f da s
Handlungsgerüst de r Vorlagen reduzierter und effektheischend gestalteter Literatur-
verfilmungen.“8
„Der R ezeptionsprozess von L iteraturverfilmungen s teht i n e iner Tradition de r
Hierarchisierung, di e de r Literatur v on v ornherein e inen höhe ren S tellenwert einräumt
und das filmische Medium tendenziell negativ konnotiert.“
Die Literaturverfilmung w ird a ls P lagiat de r hochw ertigen Vorlage
abgewertet, i ndem m an i hr vor wirft, s ie w ürde W erke de r D ichtung de montieren und
plündern, um e ine Image- und N iveausteigerung z u e rzielen. Z ugleich wird aber erwartet,
dass der Film der literarischen Vorlage gerecht wird und gleichzeitig als Film funktioniert.
9
Das V erhältnis z wischen Film und Literatur w urde ne u bestimmt, indem di e
Literaturverfilmung eine funktionale Bedeutung als Interpretation der Vorlage gewinnt, wobei
das Spektrum von der Werktreue bis hin zu freien Adaption reichen kann.
10
3. Literaturverfilmung – Adaption – Transformation
Der Begriff Literaturverfilmung is t de r älteste und herkömmlichste B egriff, der f ür di e
Übertragung einer Geschichte aus dem Medium Buch in das Medium Film gebraucht wird. Er
bezeichnet konkr et, w as de r G egenstand i st, wird aber s tark mit de r V orstellung v on
Werktreue verbunden. Nach Bohnenkamp ist diese Bezeichnung nach wie vor problematisch:
sie is t uns charf, da s ie sich im w eiten Sinne a uf a lle F ilme, die vo rher s chriftlich fixiert
wurden, also auch in Form von Drehbüchern, bezieht. Im engeren Sinne wurde der Begriff für
Filme ve rwendet, in de nen die lite rarische Q uelle ni cht a llein Stofflieferant war, aber ei n
Interesse an der s pezifischen Werk-Gestalt de r Vorlage dur chaus e rkennbar w ar – die
Literarizität de s F ilms b lieb präsent. I n den 198 0er J ahren w urde d as V erhältnis z wischen
8 Schachtgabel, G.: Der Ambivalenzcharakter der Literaturverfilmung. Mit einer Beispielanalyse von Theodor
Fontanes Effie B riest und d essen V erfilmung von R ainer W erner F assbinder. P eter L ang V erlag. Frankfurt am Main. 1984. S. 9
9 Sölkner, M.: Über die Literturverfilmung und ihren ‚künstlerischen‘ Wert. In: Neuhaus, S. (Hrsg.): Literatur im Film. Beispiele einer Medienbeziehung. Königshausen und Neumann Verlag. Würzburg. 2008. S. 52
10 Vgl. Neuhaus, S.: Literatur im Film. Eine Einführung am Beispiel von Gripsholm (2000). In: Ders. (Hrsg.): Literatur i m Film. B eispiele einer M edienbeziehung. K önigshausen und N eumann V erlag. W ürzburg. 2008
7
Literatur und F ilm i n vi elen S tudien ne u be wertet und be ide a ls una bhängige K unstwerke
angesehen. D enn de r V organg de r V erfilmung impliziert e ine V eränderung, s odass s ie a ls
produktiver Prozess untersucht werden sollte. Mit jeder Literaturverfilmung wird schließlich
ein M edienwechsel r ealisiert und s ie s ollte a ls pr oduktive R ezeption e ines A usgangstextes
betrachtet werden (vgl. Bohnenkamp). So wurde der Begriff Adaption eingeführt:
„Unter k inematographischer Adaption w ird e in S pielfilm verstanden, der d ie t ragenden
Charaktere und ihre Konfliktsituation als Bestandteile der Fabel beibehält, die Fabel also
mit ihren wesentlichen Bausteinen reproduziert.“11
„Der Begriff >Transformation< bezeichnet den Umsetzungsvorgang vom einen Medium
in das andere am genauesten und steht innerhalb des deutschen Literatur-Film-Diskurses
für einen innovativen Forschungsansatz.“
Doch haftete auch diesem zu sehr das Merkmal der Abhängigkeit und da mit Werktreue zur
literarischen Vorlage an. So sagte z.B. André Bazin: „Eine gute Adaption [muss] das Original
in s einer S ubstanz na ch W ort un d G eist w iederherstellen könne n“ (Bazin: S . 38) . In d en
1990er J ahren w urde da her der B egriff Transformation für die Ü bertragung e ines
Zeichensystems in ein anderes eingeführt.
12
Die T ransformation beinhaltet im W esentlichen drei S chritte: R ezeption, Interpretation und
Produktion. Innerhalb de r T ransformation i st z wischen E lementen, di e di rekt übe rnommen
werden könn en und E lementen, di e m edienspezifisch s ind und de swegen um gewandelt
werden m üssen, z u unterscheiden. D irekt übe rtragbar s ind F igurenkonstellationen, da s
Handlungsgerüst und Aktionen, die ablaufen und chronologisch eingeordnet werden können –
sie s ind i n be iden M edien g leich und w erden dur ch di e A usdrucksmöglichkeiten de s
jeweiligen Mediums bestimmt und dur ch di e T ransformation um gesetzt: s pezifisch-
Das V erhältnis z wischen T ext und F ilm i st i nnerhalb d es M edienwechsels ve rschieden
ausgeprägt, wobei dieser Wechsel als ein prozesshafter Vorgang verstanden wird und auf der
Übertragung von Konzepten beruht.
„Übersetzung wird ni cht a ls Überführung eines al s i dentisch g edachten Inhalt von der
einen Form in die andere betrachtet, sondern als Antwort, Echo oder Fortsetzung, die das
Original ni cht ersetzen, s ondern ergänzen, w eiterführen u nd w eiter>spielen< w ill.“
(Bohnenkamp: S: 26)
11 Schwab: S. 85 (Unter Fabel ist hier der Plot zu verstehen.) 12 Poppe: S. 91. Jedoch werden die Begriffe Adaption und Transformation häufig synonym verwendet, da sie im
Prinzip den gleichen Vorgang beschreiben.
8
sprachliche A usdrucksformen werden in spezifisch-filmische ( z.B. K amerahandlung und
Montage) ab geändert. Nach P oppe w erden f ünf ve rschiedene T ransformationstypen
unterschieden, deren Übergänge fließend sind. Die stofforientierte Transformation übernimmt
aus dem Text nur die Handlung bzw. das Thema und e s gibt e ine grobe Ähnlichkeit in der
Figuren- und H andlungsgestaltung. Darüber hi naus gibt e s wenige G emeinsamkeiten. D ie
handlungsorientierte Transformation setzt die Story, den Plot und die spezifische Erzählweise
des Textes filmisch um. Für die Verbindung aus Inhalt und Ausdruck des Originals muss ein
filmisches Ä quivalent gefunden w erden; da bei geht es aber ni cht um d ie B ebilderung d es
Ausgangstextes, sondern um die Kreation einer e igenen f ilmischen Gestaltung, die den Stil,
die Aussage und B edeutung des Erzähltextes durch Mittel des neuen Mediums transportiert.
Die interpretierende T ransformation berücksichtigt di e S tory, de n P lot, die E rzählsituation
sowie di e S innstruktur und stilistische B esonderheiten des lite rarischen T extes. Zusätzlich
wird di e T extvorlage i nterpretiert, wodurch e i t iefgehender Bezug z wischen Transform und
Transformation geschaffen wird. Die Interpretation ist pr inzipiell d er g rundlegende S chritt
eines j eden T ransformationsprozesses.13
4. Analyse des Buches Cidade de Deus von Paulo Lins
Als le tzten Typ be schreibt s ie di e freie
Transformation, die sich noch mehr von der Vorlage entfernt, und bei der zwischen Film und
Text dur ch di e V eränderung de s K ontextes, de r H andlung und Figurenkonstellation e ine
große Distanz entsteht (vgl. Poppe).
14
Der R oman Cidade de D eus von P aulo Lins e rschien i m Jahr 1997. In i hm s childert de r
brasilianische Autor und Soziologe die Entwicklung einer Sozialbausiedlung hin zu einer der
berüchtigtsten Favelas in Rio de Janeiro über knapp drei Jahrzehnte hinweg.
und seinem Transform Cidade de Deus von Fernando Mereilles
Die Außenaufnahmen zum Film wurden in verschiedenen Favelas von Rio de Janeiro gedreht.
Um g rößtmögliche A uthentizität zu e rreichen, w urden ke ine pr ofessionellen S chauspieler15
Laut Fernando Meirelles hä lt s ich d er Film in s einer S truktur und dem E rzähltempo ge treu
dem B uch, da di e V orlage s chon f ilmische E lemente e nthält. S o konz entriert s ich di e
Erzählung a uf i hre H andlung und ni cht a uf eine t iefgehende B eschreibung de r C haraktere.
eingesetzt, sondern knapp 200 Laiendarsteller aus den Favelas. Deren Schauspiel basiert auf
Improvisation und Interpretation, die in einem halbjährigen Workshop erarbeitet wurden.
13 Für die Literaturadaption bedeutet die Transformation zugleich einen Informationsverlust und –zugewinn: Sie
ist eine Interpretation ihrer Vorlage. 14 Verwendet wird hier die erste spanisch-sprachige Ausgabe von 2003. 15 abgesehen von den Darstellern der Charaktere Cenourinha und Mané
9
Der Film be hält di e dr eigliedrige S truktur, de n e pisodischen S til, di e di skontinuierliche
Erzählung mit Rückblenden und Vorausdeutungen und die Sprache der Favela bei.16
4.1. Struktur und Handlung
Formal ist der Roman Cidade de Deus in drei Teile gegliedert, die den Namen des jeweiligen
Hauptaktcharakters t ragen und m it de ssen T od e nden. Innerhalb e ines T eils s ind di e
Unterkapitel nur durch Absätze markiert. In La historia de Inferninho wird die Geschichte des
Trio T ierno, b estehend a us Inferninho, T utuca und M artelo e rzählt, di e ha uptsächlich
Überfälle verüben. Vor Beginn der eigentlichen Handlung des ersten Teils, wird von B usca-
Pé und Barbantinho e rzählt, w ie s ie am Fluss sitzen und übe r i hr Leben in A rmut, di e
Hoffnung a uf e in besseres L eben und di e E ntstehung d er S iedlung n achdenken. In di esem
Abschnitt w ird di e G rundhaltung de s R omans de utlich: A ufgrund i hrer H erkunft und de r
immer größer werdenden Schere zwischen Reich und A rm, i st es nicht leicht, nicht auf die
schiefe Bahn z u ge raten, w o s ie doc h s elbst i n f riedlichen M omenten mit de m T od und
Gewalt konf rontiert w erden. Die H andlung e rweist s ich a ls s ehr kom plex. Verschiedene
Erzählfäden ve rknüpfen s ich dur ch die G eschichten der ei nzelnen Figuren. Der E rzähltext
unterliegt im Gegensatz zum Film nicht dem Zwang der Progression und wird immer wieder
durch e pisodische, unko mmentierte Einschübe u nterbrochen w erden. Diese erfolgen s tets
ohne Einleitung seitens des Erzählers. Mit den Haupthandlungssträngen haben diese Episoden
nur das Thema Gewalt gemeinsam. So wird von einem Gangster erzählt, der das Baby seiner
Frau auf brutalste Art und Weise tötet, da er der Überzeugung ist, dass es nicht seins ist. Auch
ein Cearenser wird erwähnt, der seine Frau und deren Liebhaber tötet und begräbt.
Die Ideen für di e Ü berfälle i m er sten T eil w erden aus d er Not de r A rmut he raus geboren.
Inferninho und T utuca f inden a m E nde i hren T od. N ur M artelo ka nn mit s einer F rau de m
Elend entkommen, indem er zum Glauben konvertiert und die Favela verlässt.
La historia de Pardalzinho erzählt die Geschichte von Pardalzinho und seinem besten Freund
Zé Miúdo. Im ersten Teil als Kinder noch auf Überfälle spezialisiert, konzentrieren sie sich im
zweiten auf den Handel mit Drogen. Zé Miúdo erkennt, dass das ganz große Geld darin liegt.
Er plant zusammen mit seinem Partner die Übernahme sämtlicher Drogenläden in der Stadt
Gottes, indem er di e Dealer töt et. Er s teigt z um Chef de r S iedlung auf, der f ast alle Läden
kontrolliert. Dadurch ge ht a uch di e K riminalität i n de r F avela z urück. U m von de r P olizei
ungestört s eine G eschäfte m achen z u könne n, ahndet und ve rbietet Z é M iúdo s ämtliche
16 Almeida, N.: Estudo comparativo entre a Cidade de Deus de Paulo Lins e a Cidade de Deus de Fernando
Meirelles. Faro. 2008. S. 98
10
Verbrechen. D adurch k ehrt ei n w enig R uhe i n Cidade d e D eus ei n und die Erzählung
konzentriert sich auch immer mehr auf andere Handlungsstränge: So z.B. auf die Entwicklung
Busca-Pés und s einer Clique. Sie interessieren sich für Musik, Poesie und s chöne Kleidung.
Mit den Gangstern der Favela stehen sie über ihren Drogenkonsum und Pardalzinho, für den
diese J ugendlichen F reiheit und U nbeschwertheit ve rkörpern, i n V erbindung. A m E nde de s
zweiten T eils e skaliert di e S ituation m it de m T od P ardalzinhos, de n Zé M iúdo ni cht
verkraften ka nn. E r fängt a n, Frauen zu ve rgewaltigen und Leute unt er e inem e rfundenen
Vorwand z u t öten. D ies f ührt i m dr itten T eil la hi storia de Z é M iúdo dazu, da ss s ich Z é
Bonito wegen der Vergewaltigung seiner Freundin, bei der er gezwungen wurde zuzuschauen,
und der Ermordung seines Großvaters und Bruders, an Zé Miúdo rächen will. Anfangs noch
allein auf s einem Rachefeldzug, ve rbündet e r s ich später mit Cenourinha, um Zé Miúdo zu
töten. D adurch w ird e r immer w eiter i n de n S trudel a us G ewalt, Ü berfällen und Drogen
hineingezogen. A m E nde k ann selbst er s ich nicht m ehr da ran erinnern, wie es z u di eser
Gewaltexplosion gekommen war.
Das E nde d es R omans i st in sofern akzentuiert, als da ss di e A bsätze i mmer kür zer und
episodischer w erden, was di e S pannung z um E nde hi n s teigert und di e H andlung
beschleunigt. Nach der E rmordung Z é B onitos mündet die H andlung in e iner S treuung de r
letzten nennenswerten Ereignisse. Zé M iúdo mus s s ich immer s tärker mit a nderen
Drogendealern a useinandersetzen, di e di e Gunst de r S tunde genutzt ha tten und vi ele s einer
Läden übernahmen.
Die filmische Struktur folgt dramatischen Prinzipien zentriert um die Themen Gewalt, Drogen
und Kriminalität, w obei da s H auptaugenmerk de s R egisseurs a uf d er E rzeugung von
Spannung liegt bzw. Stoffe ausgewählt werden, die starke Emotionen provozieren.17
17 „Würde ei ne l iterarische E rzählung Absatz f ür Absatz o der g ar S atz f ür S atz i n ei ne f ilmische E rzählung
überführt, e ntstünde a ls R esultat ein l angatmiges, p ointenloses D urcheinander i n B ildern. D as P rodukt bliebe unverständlich.“ (Schwab: S. 109) Der Transfer der beschriebenen Handlung in einem Erzähltext auf den realen Zeitrahmen eines Films von ca. 90 Minuten, erfordert eine Anpassung der Struktur, indem z.B. Szenen, Nebenhandlungen und Figuren gekürzt werden.
„Da eine
literarische Erzählung nicht immer handlungsintensiv beginnt, kann konkrete Handlung dafür
nach vor n ve rlegt w erden“ (Schwab: S . 104) . Das D rehbuch gibt de r H andlung e inen
filmischen Anfang. Dieser beinhaltet die Problemstellung, wodurch die Aufmerksamkeit des
Zuschauers erregt wird. Dadurch, dass er oftmals in medias res geht, wird das Anwachsen der
dramatischen Spannung g ewährleistet. Der F ilm Ciudad de D ios hält s ich i m G roßen un d
Ganzen an den Aufbau des Romans und fängt zu Beginn des dritten Aktes an, wird dann aber
unterbrochen, um, wie im Roman, den Ursprung des Konflikts zu erzählen. Die vorgegebene
11
Richtung des Films variiert durch Hindernisse, Brechungen und W iederholungen, wobei die
zentralen Ereignisse so ausgewählt und angeordnet werden, dass sich Spannung und Intensität
bis zur dramatischen Lösung hin steigern (vgl. Schwab).
Vor de m B eginn de r eigentlichen H andlung de s e rsten A ktes l iegt da s S etup. B usca-Pé
vermittelt de m Zuschauer auf d em Fußballplatz da s G rundwissen, welches f ür d as
Verständnis der filmischen Erzählung nötig ist. Er stellt die zentralen Personen der Handlung
sowie ihre Absichten und Handlungsmotive vor. Der Erzähler führt den Zuschauer in die Welt
der filmischen Erzählung ein. Das Viertel Ciudad de Dios befindet sich 1968 noch im Aufbau.
Das Trio Ternura, bestehend aus Cabeleira, Alicate und M areco, dem Bruder von Busca-Pé,
verübt Ü berfälle auf G asflaschen-Lieferanten. Anstatt s ich aber al lein an der B eute z u
bereichern, verteilen sie da s G as an die Bewohner de s Viertels. D ie vo rgeführte W elt de r
filmischen Erzählung gerät aus de r Balance al s s ich das T rio auf de r Flucht nach einem
Überfall auf ein Motel trennen m uss. W ährend di eser Nacht ha t A licate e ine Vision und
beschließt, sich vom Gangsterleben abzuwenden. Mareco hilft von da an seinem Vater, einem
Fischverkäufer, bei der Arbeit. Er begegnet dabei Dadinho und Bené, die gerade dabei sind,
ihre B eute a us ve rschiedenen Ü berfällen z u t eilen, und ni mmt i hnen diese ab, w oraufhin
Dadinho ihn erschießt. Cabeleira, der er fahren hat, dass e r und s eine F reunde f ür da s
Massaker i m Mote l verantwortlich gemacht w erden, beschließt z usammen mit s einer
Freundin aus der Stadt Gottes zu verschwinden. Auf der Straße entdeckt ihn die Polizei und
erschießt ihn.
Die K inder vom F ußballplatz de s e rsten A ktes s ind nun z u Jugendlichen he rangewachsen.
Dadinho ne nnt s ich nun Z é P equeño und übe rnimmt zusammen m it B ené de n gesamten
Drogenhandel der Favela. Auch im Film kehrt daraufhin einigermaßen Ruhe in die Siedlung
ein und i m z weiten A kt e ntfaltet s ich di e H aupthandlung und das Beziehungsgeflecht de r
Figuren entwickelt s ich. „ Zwischen P roblem un d Lösung, Ziel und R ealisierung, B edürfnis
und Erfüllung bauen sich nach und nach neue Hindernisse auf, mit der Auswirkung, dass sich
die Handlung kom pliziert“ (Schwab: S . 111) . Gegen Ende d es A ktes kommt z um
Handlungshöhepunkt: dem Tod von Bené. Dieser setzt Ereignisse in Gang, die im dritten Akt
zum Untergang von Zé Pequeño führen.
Der d ritte A kt is t d er d ramaturgisch kür zeste u nd führt i m S inne e iner R ahmung z u de n
Anfangsszenen d es S pielfilms z urück, i n de m di e E reignisse i n s chneller F olge dem E nde
zustreben. D urch ku rze Szenen i ntensiviert s ich da s G eschehen und es wird de r E indruck
erweckt, als v erringerten sich die A bstände z wischen den E reignissen. Die vi suelle
12
Vermittlung ha t hi er V orrang und di e ve rbal-akustische t ritt z urück. K urz vor de r Klimax
kommt es zur letzten Begegnung zwischen Zé Pequeño und Busca-Pé. Bevor Zé Pequeño von
den Z wergen e rschossen w ird, f otografiert Busca-Pé ihn wie e r P olizisten besticht.
Letztendlich entscheidet er sich aber für die Veröffentlichung des toten Favela-Chefs anstatt
für den Beweis korrupter Polizisten, da diese ihm im Gegensatz zu Zé Pequeño noch schaden
können. Damit w ird ein emotionaler A usgleich geschaffen, der dem Z uschauer eine
Erwartungserfüllung oder Auflösung der Anspannung bringt.
4.2. Die Erzählinstanz Die E rzählerinstanz i st da s w ichtigste Gattungsmerkmal epi scher Texte. Neben der
Wiedergabe de s Geschehens, or dnet s ie e s und rafft oder de hnt di e E rzählung i n z eitlicher
Hinsicht. Der Erzähler legt somit auch den Anfangs- und Endpunkt der Geschichte fest: „Mit
der E rzählinstanz w ird i n di e K onstruktion der G eschichte e in ko mmunikativer O rt
eingeschrieben, de r i n unt erschiedlicher Intensität da s G eschehen übe rschaut und
beherrscht.“18
Eine erste Spezifizierung des Erzählers geht danach, ob der Erzähler mit einer erzählten Figur
identisch ist oder nicht. Der heterodiegetische Erzähler im Roman ist nicht an der erzählten
Welt be teiligt und da ran z u e rkennen, da ss d as G eschehen i n d er dr itten P erson, e iner
anonymen Stimme, erzählt wird.
Die Konstruktion und D eutung von Geschehen wird also vom Standpunkt des
Erzählers aus bestimmt, da er ans telle de s T ext-Produzenten di e übe rmittlungs-technische
Aufgabe üb ernimmt. E r ka nn da bei e benso wie d ie G eschichte s elbst B estandteil de r
fiktionalen W irklichkeit s ein. D ie P osition de r E rzählinstanz g egenüber de m e rzählten
Geschehen s owie de r G rad i hrer B eteiligung a n i hm s ind m it e iner R eihe von
Unterscheidungen be stimmbar, w obei da s V erhältnis von E rzähler z u F igur, a lso de r
extradiegetischen Welt zur i ntradiegetischen, im l iterarischen Erzähltext durch drei Aspekte
bestimmt w erden ka nn: hom odiegetisch/heterodiegetisch, pe rsonal/auktorial,
intradiegetisch/extradiegetisch.
19
Zum z weiten i st di e E rzählsituation be schreibbar dur ch di e K onstituenten de s E rzählens:
Person, Perspektive und Modus. Die auktoriale Erzählsituation wird von einem allwissenden
Erzähler be stimmt, der die U mwelt s einer Figuren nicht du rch deren Augen wahrnimmt,
Im Gegensatz dazu ist der Erzähler im Film eine konkrete
Person der Handlung: Busca-Pé. Er ordnet und kommentiert die Filmhandlung.
18 Stenzel, H.: Einführung in die spanische Literatuwissenschaft. J.B. Metzler Verlag. Stuttgart/Weimar. 2.
Auflage . 2005. S. 79 19 Vgl. Gröne, M./v. Kulessa, R./Reiser, F.: Spanische Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Narr Verlag.
Tübingen. 2. Aktualisierte Auflage. 2012. und Stenzel
13
vielmehr hat e r Einblick in alle Figuren und Geschehnisse. Er überblickt die Vergangenheit
und die Zukunft. Desweiteren kommentiert er, erklärt, beschreibt und reflektiert.20
Die Fokalisierung im F ilm is t ni cht deckungsgleich mit de r i n de r Epik, die W ahrnehmung
des P ublikums i st a n di e K amera- und T onaufnahme gebunden. B ei d er externen
Fokalisierung verfolgt der Zuschauer die Handlung als reiner Beobachter und ve rfügt dabei
nur über oberflächliche Informationen. Man begegnet ihr häufig in den Anfangseinstellungen
eines F ilms e ines unbekannten Ortes. Bei de r i nternen Fokalisierung wird de r Zuschauer i n
seiner Wahrnehmung an Erlebnisse der j eweiligen Figur gebunden. Die Kamera folgt dabei
einer ode r i m W echsel m ehreren Figuren. Bei de r N ullfokalisierung weißt de r E rzähler
(Kamera) mehr als die Figuren und vermittelt dem Zuschauer sein Wissen. Im Film wechselt
die Fokalisierung hin und her.
Die F okalisierung gibt a n, w elcher Figur da s Interesse de s E rzählers gilt und s teuert di e
Wahrnehmung de s Lesers sowie seine B edeutungskonstruktion. D urch unt erschiedliche
Fokalisierungen w erden ve rschiedene W ahrnehmungs- und D eutungsmöglichkeiten
konstruiert. Im R oman Ciudad de D ios nimmt di e E rzählinstanz d as G eschehen selbst
uneingeschränkt wahr und ordnet es. Bei der Nullfokalisierung erzählt sie aus der Position der
Übersicht, dass heißt sie weiß mehr als jede Figur wissen kann.
Der Erzähler kann bis zur Abwesenheit hinter die erzählte Geschichte zurücktreten: „Es sind
also verschiedene Grade von Mittelbarkeit möglich, je nachdem wie präsent der Erzähler ist
und w ie s tark er di e Darstellung kontrolliert. Dieser Grad de r M ittelbarkeit h eißt D istanz
[…]“ (Gröne et al.: S. 144). Der Text geht dann in den dramatischen Modus über, wobei die
Mittelbarkeit, dadurch dass es keine Intervention seitens des Erzählers gibt, aufgehoben wird;
er l ässt di e F iguren für s ich sprechen. Anhand de r F igurenrede i st di e D istanz l eicht zu
ermitteln. Die di rekte R ede ohne E inleitung s eitens de s E rzählers e ntspricht de m
dramatischen M odus – sie i st di e unm ittelbarste F orm de r R edewiedergabe. Sie ka nn aber
auch stärker vom Erzähler geleistet werden, wodurch die Distanz wächst. Am größten ist die
Distanz, wenn die F igurenrede „ aus z weiter H and“ w iedergegeben wird, die P räsenz de s
Erzählers also steigt.
Ohne da s e rläuternde und l enkende V erhalten des E rzählers müs sen filmische E reignisse
sinnfällig z ueinander führen. D ichte e rhält di e Erzählung d abei du rch Nebenhandlungen,
sogenannte Subplots, in denen sich die Charaktere offenbaren und die Themen entfalten.
20 Vgl. Eicher, T./Wiemann, V.: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Schöningh Verlag.
Paderborn/München/Wien/Zürich. 3. Auflage. 2001
14
Wie s o eben erläutert, verfügt de r F ilm nor malerweise ni cht übe r e inen personalisierten
Erzähler. Die E rzählaktivität w ird vielmehr a uf me hrere F unktionsträger ve rteilt. Eine
Ausnahme bi ldet die E rzählerstimme a us de m O ff - im F ilm is t e s die S timme de r F igur
Busca-Pé, die s ich erst während der e rsten R ückblende z u W ort m eldet. Als a llwissender
Erzähler ordnet und kommentiert er das Geschehen: „Das da ist Paraíba. Er ist auch berühmt
geworden in unserer Gegend. Aber seine Geschichte ist noch nicht dran.“ Auffällig ist auch,
dass di e H andlung im F ilm im G egensatz z um R oman eng mit de m Leben Busca-Pés
verbunden ist. So wird z.B. die Geschichte von Paraíba, nur erzählt, weil sie den Beginn von
Busca-Pés Leidenschaft für die Fotografie darstellt.
4.2.1. Die Kamera als Erzählinstanz Die Ausdrucksmöglichkeiten der Kamera sind vielfältig: Sie erfasst die Bildinhalte, indem sie
den B lickwinkel w ählt und übe r di e P erspektive, i hre B ewegung und ve rschiedene
Einstellungsgrößen d ie Wahrnehmung de r da rgebotenen Inhalte s teuert. S omit s teht s ie a ls
unmittelbare Instanz z wischen de m Z uschauer und de m F ilmgeschehen und w ird z u e inem
Teil der Erzählinstanz:
„Die Kameraarbeit verdeutlicht als Instrument der Akzentuierung, welche Elemente des
vorgegebenen S toffes für be sonders relevant angesehen w erden und w elche i hnen
gegenüber na ch Meinung de s R ezipienten-Autors i n den H intergrund t reten s ollen,
welchen Figuren diese Instanz nahe ist und von welchen sie sich distanziert oder welche
Relevanz dem Raum und e inzelnen Objekten neben den Figuren und ihren Handlungen
eingeräumt wird; die Kameraarbeit leistet dabei aber gleichzeitig, und zwar ohne diesen
Sachverhalt explizit z u m achen eine V orstrukturierung de r R ezeption, de r s ich de r
Zuschauer nicht entziehen kann […]“21
Die K ameraperspektive w ird durch die K ameraposition und die Blickachse be stimmt.
Zwischen den beiden Extremen Vogel- und Froschperspektive liegt die Normalsicht, bei der
Fernando M eirelles d rehte de n F ilm di rekt i n de n F avelas von R io de J aneiro, w odurch es
aufgrund der Architektur und Infrastruktur schwierig war, Aufnahmen mit Hilfe von Kränen
zu machen. Er ve rwendete ha uptsächlich Handkameras, die be sser f ür A ußenaufnahmen
geeignet s ind, da ke in g roßes E quipment g ebraucht w ird. A ber a uch f ür D ialoge na hm e r
diese i n A nspruch, de nn dur ch di e s ubjektive P erspektive e iner s chwenkenden Kamera als
suchende od er s ich um sehende Kopfbewegung he bt s ie d en V organg de r W ahrnehmung
hervor und lässt die Handlung vor der Kamera realer erscheinen.
21 Mundt, M.: Transformationsanalyse. Methodologische Probleme der Literaturverfilmung. Niemeyer Verlag.
Tübingen. 1994. S. 173
15
sich die Kamera in Augenhöhe mit dem Objekt befindet. In der Vogelperspektive, bei der von
oben he rab gefilmt w ird, werden die O pfer Z é P equeños dargestellt. Dem Z uschauer w ird
Kontrolle über das Geschehen suggeriert, indem er die Position des Schützen einnimmt. Der
Charakter w irkt m achtlos, gefangen oder au ch ang reifbar. Die Froschperspektive be wirkt
genau das Gegenteil. Hier ist die Kamera tiefer positioniert als das Objekt. Die Kamera schaut
dabei von unten zum Objekt hinauf, wodurch es übermächtig und bedrohlich wirkt. Sobald Zé
Pequeño im Film auf jemanden schießt, wird er in der Froschperspektive dargestellt.
Der kleinste funktionale Baustein eines Spielfilms ist die Einstellung der Kamera, die durch
die W ahl e iner be stimmten E instellungsgröße, e ines O bjektivs und des K amerawinkels
charakterisiert i st. D ie E instellungsgröße w ird dur ch di e D istanz der K amera z um
Aufnahmeobjekt b estimmt und e rfüllt a uch b edeutungsrelevante Funktionen. S o g eben
Aufnahmen aus der Ferne (Weitwinkel und Totale) einen räumlichen Überblick und s ituieren
den Zuschauer innerhalb des Geschehens. Mimik und Gestik werden im mittleren Nahbereich
gefilmt, der am s tärksten de r m enschlichen S eherfahrung e ntspricht, w odurch de r
Realitätseindruck verstärkt wird. Hierbei spielen vor allem der Point of view shot und der over
shoulder shot in Dialogszenen eine Rolle. Ersterer präsentiert die Aufnahme aus den Augen
einer a nonymen Figur he raus. Bei s pannenden mimischen Reaktionen wechselt di e
Einstellungsgröße m eist a uf Detail oder Close-Up. Der over s houlder s hot, de r, w ie s ein
Name schon sagt, die Figur A aus der Perspektive eines zuschauenden Dritten zeigt, der Figur
B über die Schulter blickt. In den Dialogszenen des Films verwendet Meirelles hauptsächlich
diese Art der Inszenierung. Als Filé von Zé Pequeño dazu gezwungen wird, einen Jungen der
Zwergengang z u e rschießen, w ird d er Zuschauer da durch i n di e P osition e ines V oyeurs
gedrängt. M an s ieht F ilé und di e a nderen M itglieder von Zé P equeños B ande von hi nten,
wobei da s Bild kur z vor de m S chuss und w ährenddessen ve rschwimmt - so w ird de r
Zuschauer s tets i n gewisser W eise i n di e H andlung i ntegriert. Groß- und Detailaufnahmen
dienen dazu, einen Gegenstand bzw. Detail im Raum oder an einer Figur hervorzuheben und
dadurch z u b eschreiben. „ In d er Groß- und N ahaufnahme is t di e f ilmische Figur f ür de n
Zuschauer als P erson ode r ‚ Mensch‘ s tark fasslich und besonders geeignet al s
Projektionsfläche f ür G edanken und E mpfindungen“ (Schwab: S : 184 ). Auf de r P arty z u
seinem 18. G eburtstag fordert Zé Pequeño die Freundin von M ané zum Tanz auf. Als diese
ablehnt, da s ie i n Begleitung i st, ä ndert s ich di e Einstellung z u e iner G roßaufnahme s eines
Gesichts. D er G esichtsausdruck e iner F igur i n de r G roßaufnahme i st e in M oment hohe n
Wahrheitsgehalts, der d en Zuschauer a ffektiv stimuliert und i hm Z ugang z um Innenleben
gewährt. A uch di e K ette, di e Z é P equeño von s einem S antero be kam, w ird dur ch di ese
16
Einstellung he rvorgehoben und z ur Andeutung s eines T odes als e r M anés F reundin
vergewaltigt und die Kette vorher nicht abnahm, so wie ihm der Santero es gesagt hatte.
4.3. Personenkonstellation Der Leser baut sein Interesse an der Thematik pr imär an den Personen a ls Handlungsträger
und s einer W ahrnehmung di eser a uf. Der l iterarische C harakter i st f est i n da s
Informationsangebot de s E rzähltextes e ingebunden, l öst s ich a ber i m ve rarbeitenden
Bewusstsein des Lesers vom Sprachmaterial und gelangt dadurch zur Eigenexistenz, die sich
nach Abschluss der Lektüre fortsetzt. Die fiktionalen Figuren ziehen die Aufmerksamkeit des
Lesers auf s ich und e rfüllen da mit ve rschiedene F unktionen. E in G rundproblem f ür di e
Analyse von E rzähltexten ist di e T atsache, dass T exte F iguren „nur“ mittels de r S prache
beschreiben und dass Beschreibungen bei noch so großer Detailfülle lückenhaft sind.
Im R oman Ciudad de Dios ist e s s chwer, Haupt- und N ebencharaktere a uszumachen, da
„stattdessen [ …] e in kol lektives S ubjekt i m Zentrum [ der E rzählung s teht]: di e Favela und
ihre Bewohner. Die Protagonisten […] s tehen immer nur abschnittweise im Vordergrund“22
Im Buch w erden knapp 300 Figuren na mentlich ode r anonymisiert genannt, w as i n einem
Film nicht realisierbar wäre, sodass bei der Transformation eines Buches die Figuren selten
direkt übernommen werden. Im Film existieren sie kombiniert weiter. Die Kombination der
Figuren ist da bei e her f unktional a ls e ssentiell mot iviert. Die K onstellation der
widerstreitenden Kräfte, um di e s ich da s D rama e ntfaltet, i st i n de n A nfangsminuten de s
Spielfilms ve rankert. D er K onflikt i st s tets pr äsent, a uch i n P hasen, i n de nen s ich di e
Handlung beruhigt, und er bringt die Wandlung des Protagonisten voran. So beobachtet der
Zuschauer B usca-Pé be i de m V ersuch, a uf di e s chiefe Bahn z u g eraten, w as i hm a ufgrund
Sie werden o ftmals ohne V orstellung e ingeführt ode r i hre G eschichten w erden i n
Rückblenden beleuchtet. Einige überleben nicht einmal drei Seiten. Sie stammen fast alle aus
komplizierten Familienverhältnissen, in denen Alkohol und Gewalt herrscht oder sie schon im
Kleinkind-Alter Geld nach Hause bringen müssen. Die Kriminellen sind vor allem Kinder und
Jugendliche, di e i n de r R egel ni cht da s E rwachsenenalter erreichen. S ie s ind kl eine
Erwachsene von sechs bis zwanzig Jahren, deren Helden die größten Verbrecher der Favelas
sind. S ie be wundern de n R espekt, de r i hnen e ntgegen g ebracht w ird und s treben i hren
Reichtum an (vgl. Almeida). Von den erwachsenen G angstern werden Kinder al s
Drogenkuriere, Späher und Dealer eingesetzt, sodass sie von klein auf mit dem Verbrechen in
Berührung kommen. Nur die wenigsten entkommen diesem Teufelskreis lebendig.
22 Hart
17
seines G ewissens ni cht gelingt. Die K onstellation de r Figuren, di e de n z entralen K onflikt
trägt, bleibt erhalten. Hier: Busca-Pé als Protagonist, Barbantinho als sein bester Freund, Zé
Pequeño a ls A ntagonist/Protagonist und Bené, s ein be ster Freund, a ls d eren G egner: Mané
und Cenouhra. Alle anderen Figuren werden im Film als Statisten nicht namentlich erwähnt
oder kombiniert mit neuen Namen.
4.4. Der Raum Die räumliche Dimension hat im Roman und auch im Film eher eine sekundäre Bedeutung, da
er nur in den Ausschnitten beschrieben bzw. dargestellt wird, die für die Handlung nötig sind.
Ein zu beschreibender Gegenstand bzw. die Umgebung, in der die Figuren agieren, ist meist
in den Kontext eingebettet und w ird durch lokale, temporale und pe rsonale Bezugsetzung in
ein größeres Bezugsfeld gesetzt (vgl. Poppe). Er wird vom Leser als vollständig vorausgesetzt
und während des Lesevorgangs in seiner Vorstellung ergänzt, da der Roman von Paulo Lins
häufig nur Raumausschnitte zeigt.
Die Strukturierung des Raums erfolgt in literarischen Texten primär durch Beschreibungen,
deren Ziel e s is t, dem Empfänger e ine bi ldliche V orstellung d es R aums z u vermitteln. Im
Buch Cidade de Deus werden dem Leser kaum räumliche Orientierungshilfen gegeben. Zwar
werden viele Straßen und Viertel namentlich genannt und man findet sie auch auf der Karte,
dennoch i st e ine r äumliche V orstellung ka um m öglich, da hi er kaum ei ne Beschreibung
stattfindet. Die dadurch entstehenden Leerstellen der fiktionalen Welt gestaltet sich der Leser
durch s eine V orstellungskraft na ch s einem Wirklichkeitsmodell a us. „ In l iterarischen
Erzähltexten mit knappen Raumbeschreibungen oder wenig strukturierten Räumen, dürfte der
„horror va cui“ da zu a nregen, di e P hantasie, des Lesers z u beflügeln“ (Schlickers: S . 89) .
Lediglich die Entwicklung der Siedlung von den Hügeln, die als Weiden genutzt wurden, und
dem G uavenwäldchen ü ber de n B au von kleinen H äusern und S traßen zu einer F avela m it
Mietskasernen, den APs, wird im Roman immer wieder angeschnitten.
Auch i m F ilm von Fernando M eirelles gibt e s ka um Ü berblickseinstellungen zur
Beschreibung des Raums. Anfangs wird gezeigt, wie die Siedlung gebaut - „fernab vom Rio
der H ochglanzkarten“ - und a n d en S trom a ngeschlossen w ird. A uch e rwähnt de r E rzähler
Busca-Pé, dass die Siedlung an die Wasserversorgung angeschlossen werden soll. Doch wirkt
die geebnete Fläche eher öde und verdörrt.
4.5. Zeit Der Roman und der Film umfassen jeweils einen Zeitraum von knapp 3 Jahrzehnten, in denen
sich di e H andlung e ntwickelt. Es ha ndelt s ich hi erbei i m E inzelnen ni cht um e ine
18
chronologische E rzählung, meist w erden gleichzeitig m ehrere H andlungsstränge pa ralleler
oder z eitversetzter E reignisse ve rfolgt, die a bschnittsweise m iteinander ve rbunden s ind.
„Rückblicke und noc h ni cht e inzuordnende V orgriffe bi lden e in P uzzle, da s e rst na ch und
nach ein vollständiges Bild ergibt“23
23 Weis-Bomfim, P.: Afrobrasilianische Literatur – Geschichte, Konzepte, Autoren. Lepê Correia, Cuti, Geni Guimarães, Paulo Lins, Marilene Feline. Brasilienkundeverlag. Mettingen. 2002. S. 147
, wodurch die Spannung gesteigert und Dynamik erzeugt
wird. Im R oman sitzen B usca-Pé und Barbantinho na ch de m V erlassen de s ve rzauberten
Hauses am Fluss und r auchen Marihuana, jeder in seinen eigenen Gedanken versunken. Erst
später erfährt man, was es mit dem verzauberten Haus auf sich hat. Als sich der Fluss rot färbt
vom Blut toter Menschen, deutet der Erzähler in der Handlung voraus:
„Era l a g uerra, que na vegaba en su primera pr emisa. Erigida en soberana de todas l as
horas, venía pa ra l levarse a cua lquiera que es tuviese espe rando, venía pa ra di sparar en
cerebros infantiles, para obligar a una bala perdida a ent rar en cuerpos inocentes y para
hacer que que Zé Bonito corriera, con su jodido corazón latiendo acelerado, por la calle
de Enfrente, con un l eño ardiendo en la mano, para incendiar la casa del asesino de su
hermano.” (CdD: S. 19)
Auch dass Zé Miúdo für den Tod dieser sechs Leichen im Fluss verantwortlich ist, wird erst
einmal elliptisch ausgelassen, um später erwähnt zu werden.
Für die chronologische Progression der Handlung gibt es nur wenige präzise Anhaltspunkte.
Der Bau der S iedlung wird für d as J ahr 1966 f estgesetzt, was wiederum i n Form ei ner
Rückblende in die Erzählung eingebaut wird. Andere konkrete Zeitangaben findet man in den
eingeschobenen Episoden, so zum Beispiel als der Cearenser seine Frau und deren Liebhaber
ermordet und be gräbt. Diese E rzählung w ird i n di e G eschichte von Cosme und S ilva
eingeschoben und findet e inen M onat vor de r E rmordung S ilvas dur ch seinen F reund statt.
Auch innerhalb eines Handlungsstrangs wird das Vergehen von Z eit deutlich gemacht durch
explizite Aussagen, wie z.B.:
„Ya eran más de las dos de la mañana [...]” (CdD: S. 57)
„El sábado de Carnaval [...]” (CdD: S. 105)
„Dos días después, a eso de las diez […]“ (CdD: S. 367)
Da die einzelnen Handlungsstränge parallel verlaufen
19
4.5.1. Die Montage Die M ontage i st als na rratives M ittel di e a bschließende P roduktionsphase und ne ben de r
Kameraarbeit, a ber una bhängig von i hr, von großer Bedeutung für di e Akzentuierung de s
Geschehens im F ilm. Bei de r M ontage be stimmt de r R egisseur üb er di e Länge und
Kombination de r E rzähleinheiten, um e inen E rzählfluss z u e rzeugen, de nn wie i m
literarischen Erzähltext w ird das G eschehen selten chronologisch präsentiert. Entscheidend
für di e küns tlerische Gestaltung i st e ine A uswahl t reffender S chnitt. E in S chnitt i nnerhalb
einer S zene di ent de m E instellungswechsel, s o w ird da durch z .B. i n D ialogszenen di e
Blickrichtung d er G esprächspartner eingehalten, was m an auch Schuss-Gegenschuss-
Verfahren nennt. Trotzdem sind Dialogszenen prinzipiell eher statisch, da der Gesprächsinhalt
zählt. I n e iner S zene w ird of tmals a uch g eschnitten, w enn von e iner g roßen i n e ine kl eine
Einstellungsgröße oder umgekehrt gesprungen wird. Diese Art wird oft dazu genutzt, Zeit zu
kompensieren und verleiht der Einstellung dadurch mehr Spannung und Dynamik. „Bildet der
Raum die primäre Bezugsgröße für die Erzählinstanz Kamera, so bildet die Zeit die primäre
Bezugsgröße für die Erzählinstanz Montage“ (Schwab: S . 161) . Zwischen zwei Szenen, die
durch Auf- und Abblende vone inander abgegrenzt werden24
Rückblende und Vorausblende sind Grundelemente filmischer Strukturbildung und werden im
Film Cidade de Deus häufig eingesetzt. Bei der Rückblende wird die filmische Jetztzeit mit
der V ergangenheit v erbunden, be i de r V orausblende m it d em Zukünftigen.
, oder auch b ei de r Verbindung
von Handlungssträngen gibt es verschiedene Arten der Montage: Das Crosscutting kombiniert
durch schnelle Einstellungswechsel Handlungen, die zeitgleich, aber an verschiedenen Orten
stattfinden. Die Handlungsstränge streben aufeinander zu, wodurch Spannung erzeugt wird. In
Verfolgungsszenen, in denen Verfolger und Verfolgter abwechselnd gezeigt werden, wird oft
zu dieser M ethode gegriffen. Die P arallelmontage w echselt z wischen nicht z eitgleich
stattfindenden S zenen, d eren E reignisse a ber i n Beziehung z ueinander s tehen, hi n und he r.
Bedingt durch den Wechsel, entsteht der Eindruck von Simultaneität.
25
Beim Split Screen wird Gleichzeitigkeit dargestellt, wobei zwei Bildsequenzen neben- oder
untereinander a uf de r Leinwand z u s ehen s ind. A ls B usca-Pé A ngélica z u einer P arty i m
Viertel mitbringt, wird das Bild in zwei Hälften geteilt. Während er sie beruhigen möchte und
ihr sagt, dass di es al le s eine Freunde seien, werden auf der r echten Bildhälfte Bené und Zé
Pequeño gezeigt, wie sie miteinander reden.
Ein Erzähler-
oder Figurenkommentar leitet den Zeitsprung häufig ein.
24 Aufblenden wirken wie das Umblättern von Buchseiten bzw. die Imitation von Kapitelanfängen. 25 Beispiele für Rückblenden werden im Kapitel „Beleuchtung und Farbgebung“ beschrieben.
20
4.6. spezifisch filmische Ausdrucksformen
4.6.1. Beleuchtung und Farbgebung Weitere K omponenten d er Bildkomposition s ind Licht und S chatten s owie di e F arbgebung
des Filmbildes. Nach dem Setup beginnt die Erzählung in brauner Farbe alter Fotografien mit
der Entstehung der Siedlung. Durch die Farbgebung würde auch ohne die Zeitangabe deutlich
werden, dass der Erzähler Busca-Pé hier von einer Zeit erzählt, die relativ lang zurück liegt.
Die Färbung in Sepia wird symbolisch eingesetzt und tritt bei jeder weiteren Rückblende auf;
z.B. als die Freundschaft zwischen Zé Pequeño und Bené im Streit auseinander bricht, werden
beide als Kinder eingeblendet. Auch in der Rückblende, in der die Hintergrundgeschichte von
Bira e rzählt w ird und wie e s d azu ka m, da ss er z um M örder von M ané w urde, s ind die
Filmbilder in Sepia eingefärbt. Die Jugendzeit Busca-Pés, also der zweite Akt, der um 1977
spielt, i st i n e in he lles B lau g etaucht. D ie G ruppenfotos, di e e r a m S trand von s einen
Freunden schießt, inszeniert F ernando Meirelles fast s chon wie ei ne W erbung für E is. Die
Zeit erscheint unbeschwert, voller Lebensfreude. Es wirkt wie die Ruhe vor dem Sturm. Die
Bilder sind lichtdurchflutet, oftmals sogar überbelichtet.
Licht und S chatten s ind s tarke Informationsgeber und e rzielen eine d ramatische W irkung.
Licht de monstriert und e nthüllt, e s ve rmittelt Sicherheit, W ahrheit, T ugend und F reude.
Schatten hi ngegen ve rbirgt und ve rfremdet. Es s ymbolisiert da s B öse, U nbekannte und
erzeugt Angst. Die Fotos, die Busca-Pé von Angelica macht sind in helles Licht getaucht. Er
ist he imlich i n s ie ve rliebt und da s Licht l ässt s ie a uf d en F otos f ür i hn noch s chöner und
begehrenswerter erscheinen.
Das Spiel mit Licht uns Schatten setzt Fernando Meirelles fort. Als Busca-Pé ein Foto von der
Strandclique machen will, kommt Thiago, zu dem Zeitpunkt Angelicas Freund, hinzu. Busca-
Pé i st davon ni cht begeistert und s agt i hm, e r solle s ich e in wenig nach hinten beugen, um
besser auf dem Bild zu erkennen zu sein. Doch genau das Gegenteil wird dadurch erreicht:
Thiago steht nun im Schatten eines Freundes und ist auf dem Foto kaum zu erkennen.
Im dritten Akt setzt sich die Dunkelheit im Filmbild fort. Schon in den anderen beiden Akten
wurden Auseinandersetzungen hauptsächlich im S chatten ausgetragen. Der er ste S treit
zwischen Zé P equeño und C enoura f indet i n e inem dunkl en G ang s tatt, de r nur von e iner
Neonleuchte erhellt wird. Dadurch dass sie aber das Gegenlicht bildet, sind die Gesichter der
Streitenden ka um z u e rkennen. Ausschlaggebend f ür di e f ast dur chgehende D unkelheit i m
dritten T eil i st de r T od B enés, d er Zé P equeño vol lkommen a us d er Fassung b ringt. Zé
21
Pequeño vergewaltigt daraufhin Manés Freundin in einer dunklen Gasse, tötet dessen Bruder
und Onkel, was den Bandenkrieg in Gang setzt, da sich Mané mit Cenoura zusammenschließt.
Die Lichtführung ist auch bestimmend für die narrative Komponente Charakter, indem sie den
mimischen A usdruck e ines S chauspielers i ntensiviert und de ssen E rscheinungsbild
interpretierend mitgestaltet. Nach dem Übergriff auf seine Freundin sitzt Mané in der Küche
seines E lternhauses. S ein G esicht i st r egungslos und s cheint dur ch da s ka lte L icht noc h
bleicher. Die Augenringe sind deutlich zu sehen und er sieht um Jahre gealtert aus. Von dem
„schönen Mané“ ist nichts mehr zu sehen.
4.6.1. Die Tonebene Der T on i st e ine na türliche B egleiterscheinung vi sueller E reignisse. S prache, M usik und
Geräusche bilden die Tonebene eines Films und tragen zur Bedeutungsvermittlung bei.
Musik ha t of tmals e ine übe rleitende F unktion: S ie i st t ragend i n emotional be deutsamen
Passagen ohne Dialog oder dient der dramaturgischen Akzentuierung. Als Cabeleira auf der
Flucht vor der Polizei an Maracanás Tür klopft und zum ersten Mal Berenice begegnet, ist er
wie von Sinnen. In diesem Moment setzt romantische Gitarrenmusik26
Wichtige Momente eines Dialogs werden meist nicht mit Musik oder Geräuschen unterlegt.
Musik be sitzt a uch e ine w irksame vor stellungsbildende K raft; s ie s orgt f ür de n
Spannungsaufbau und i ntensiviert die Dramatik eines Films. Sie neben der Beleuchtung und
Farbgebung für d en A ufbau de r A tmosphäre i n einem F ilm v erantwortlich. S ie z ielt i n de r
Regel auf die emotionale Lenkung des Publikums. Im Booklet des Soundtracks von C iudad
de Dios schreibt Fernando Meirelles selbst: „The idea behind the soundtrack for City of God was
to use music to help differentiate the three different time periods in which the film is set, the 60s, the
early 70s and the late 70s.“ Für die Sechziger Jahre wählten sie traditionellen Samba, der in den
Siebzigern f unkiger w urde, w obei in diesem T eil de s F ilms auch internationale Musik w ie
z.B. „ Kung F u F ighting“ a usgewählt w urde. F ür de n dr itten A kt, de n Bandenkrieg, w urde
„[…] music that is dark and moody but retains it‘s brazilian essence […]“
und hört abrupt wieder
auf als Maracaná ihn aus seinem Tagtraum holt. Das Lied setzt in dem Moment wieder ein als
Cabeleira mit Berenice fliehen will und von Polizisten erschossen wird.
27
Geräusche di enen de r a kustischen U ntermalung de s F ilmambientes und e rhöhen s omit di e
Realitätsillusion des Filmbildes. Sie können aber auch dramaturgisch eingesetzt werden und
bedeutungsrelevante Funktionen a usüben. B usca-Pé, s päter von B eruf Fotograf, s tellt di e
ausgewählt.
26 „Preciso me encontrar“ von Cartola 27 Booklet zum Soundtrack City of God
22
Personen des jeweiligen Geschehens immer mit einem Snapshot vor, wobei stets der Auslöser
eines F otoapparates z u hören i st. E in G eräusch ka nn e in B ild auch ersetzen bz w. a uf eine
Bedeutung verweisen. In der Szene als Paraíba seine Frau lebendig begräbt, sieh man den Akt
des Grabens nicht, sondern hört nur die Geräusche der Schaufel.
Die S prache bi etet de m Z uschauer einen unmittelbaren Zugang z ur Innenwelt de r
dargestellten Person. „Sprache im Film bietet die Möglichkeit, bildlich mehrdeutige Aussagen
zu pr äzisieren und A rgumentations- und E rklärungszusammenhänge ei nsichtig z u machen“
(Schlickers: S: 66). Schwab führt weiterhin an, dass
„der filmische Dialog 4 Hauptfunktionen zu erfüllen [hat]: Er bringt die Plotlinie voran,
enthüllt nicht-sichtbare Anteile eines Charakters, vermittelt expositorische Daten zu den
Charakteren und legt di e ‚Tonlage‘ des Spielfilms f est, die e ine übergeordnete Haltung
zum Gegenstand oder Thema des Spielfilms erkennbar macht.“ (Schwab: S. 117)
Neben der synchron verlaufenden Ton- und Bildspur gibt es auch die Tonebene des „Offs“.
Hierbei is t e ntweder di e Q uelle de s T ons ni cht be stimmbar ode r e r tr itt z eitversetzt zum
Filmbild auf. Im F ilm Cidade de D eus tritt di es ne ben der E rzählerstimme B usca-Pés in
Szenen auf, in denen zu den Bildern ein Dialog zu hören ist, der an einem ganz anderen Ort
stattfindet. E in Beispiel hierfür i st di e S zene, i n de r Zé P equeño und s eine Bande a uf de m
Weg zum „Laden“ sind, um Neguinho das Geschäft abzunehmen. Gleichzeitig hört man aber
das V erkaufsgespräch zwischen N eguinho un d B usca-Pé a us d em O ff. Anstatt di e
Gleichzeitigkeit des Geschehens durch Parallelmontage oder crosscutting darzustellen, greift
der Regisseur hier auf die Tonebene zurück.
5. Zusammenfassung und Ausblick Das Ziel dieser Arbeit war es, beide Medien als eigenständige Werke zu betrachten. Obwohl
in den einzelnen Kapiteln Gemeinsamkeiten herausgearbeitet bzw. aufgezeigt wurde, dass der
Film von Fernando Meirelles e ine gewisse (beabsichtigte, s. Kapitel 4) Werktreue in seiner
Struktur und s einem Inhalt aufweist, soll dies doch nicht zu der Annahme führen, de r Film
wäre ei ne s imple K opie de s R omans. Es w urden s pezifisch-filmische S trategien aufgezeigt
und wie diese bei der Transformation des Romans in den Film verwendet wurden. So ist es
aufgrund der Länge eines Films nie möglich, den gesamten Inhalt werkgetreu wiederzugeben.
Aus dr amaturgischer S icht w äre di es auch ein fataler F ehler, denn das E rgebnis w äre ein
langatmiges, wirres, pointenloses Produkt. Daher wird aus der literarischen Handlung oftmals
eine be stimmte T hematik ausgewählt, die da nn filmisch umgesetzt w ird. Die
23
Figurenkonstellation w ird ve rändert. E s w erden Charaktere w eggelassen, hi nzugefügt ode r
zusammengefasst. D ie T onebene w ird hi nzugefügt und di e A tmosphäre der E rzählung m it
Hilfe der Kameraarbeit, Lichtführung und Raumgestaltung modeliert.
Fernsehen, Videos und Filme s ind w ichtige A spekte de s M edienkonsums vor a llem j unger
Menschen geworden, w as e s not wendig m acht, s ie a uch z u kr itischen Mediennutzern
auszubilden. Das filmische Medium ist mittlerweile eine der Hauptquellen für Informationen
von außen und f ür die Unterhaltung. Dennoch i st Fernsehen aber i mmer auch Inszenierung
und be einflusst da s P ublikum: Mit F ilmen wird me hr S paß assoziiert a ls mit g edruckten
Texten, denn kaum ein anderes Medium stellt Charaktere so menschlich dar. Dies führt zu der
Notwendigkeit, Medienkompetenz auch im Unterricht zu fördern, sodass es seit 2003 e inen
Filmkanon für den Schulunterricht gibt, der die Bedeutung von filmischen Adaptionen bzw.
Transformationen z ur Interpretation l iterarischer T exte und a ls D okumentation i hrer
Rezeptionsgeschichte unterstreicht (vgl. Sölkner):
„Diese bi ldungspolitische E ntscheidung t rägt de r Überzeugung R echnung, dass da s
Erlernen eines bewussten und differenzierten Umgangs mit der >Sprache< der bewegten
Bilder – die sich mehr und mehr zum >Leitmedium< unserer Kultur entwickelt hat – ein
unverzichtbarer B estandteil de r ästhetisch-kulturellen E rziehung s ein s ollte.“
(Bohnenkamp: S. 10)
Desweiteren
„kann die Transformation in e inen Film doch auch […] der Überwindung von Grenzen
und de m T ransport hi n z u e iner ne uen Z ielgruppe g elten un d da s l iterarische
Originalwerk i n e inem an deren soz ialen bz w. kulturellen Raum v erfügbar m achen, i n
dem es sonst nicht wahrgenommen wird.“ (Bohnenkamp: S. 25)
So ist die Ansicht, es bestehe ein Konkurrenzverhältnis zwischen Literatur und F ilm, meines
Erachtens obsolet, da auch ein nicht lesefreudiges Publikum durch eine „Literaturverfilmung“
zur Lektüre de s j eweiligen Buches m otiviert werden ka nn. Um mit den Worten Bazins
abzuschließen:
„[…] entweder gefällt ihnen dieser Film, der ebenso gut wie die meisten anderen ist, oder
aber s ie h aben L ust be kommen, da s M odell k ennen z u l ernen, und d as b edeutet e inen
Gewinn für die Literatur.“ (Bazin: S. 36)
24
6. Bibliographie Almeida, N.: Estudo comparativo entre a Cidade de Deus de Paulo Lins e a Cidade de Deus
de Fernando Meirelles. Faro. 2008. [Download als pdf-Dokument am 30.05.2014]
Bohnenkamp, A.: Vorwort. Literaturverfilmungen als intermediale Herausforderung. In: Ders.
(Hrsg.): Interpretationen. Literaturverfilmungen. Reclam Verlag. Stuttgart. 2005.
Bazin, A : F ür e in »unreines« Kino – Ein P lädoyer f ür di e Adaption. In: G ast, W . ( Hrsg.):
Literaturverfilmung. C.C.Buchners Verlag. Bamberg.
Binder, E ./Engel, C h.: F ilm und Literatur. V on Liebeleien, K onflikten und l angfristigen
Beziehungen. In: N euhaus, S . ( Hrsg.): Literatur i m Film. B eispiele e iner
Medienbeziehung. Königshausen und Neumann. Würzburg. 2008
Gröne, M./v. Kulessa, R./Reiser, F.: Spanische Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Narr
Verlag. Tübingenen. 2. Auflage. 2012
Luhn, U.: V erfilmte Literatur od er Literaturverfilmung? E in analytischer V ergleich von
Fontanes „Effie Briest“ und der Verfilmung von R. W. Fassbinder. Freie Universität zu
Berlin. 1988
Mundt, M .: T ransformationsanalyse. M ethodologische P robleme de r Literaturverfilmung.
Niemeyer Verlag. Tübingen. 1994.
Neuhaus, S.: Literatur im Film. Eine Einführung am Beispiel von Gripsholm (2000). In: Ders.
(Hrsg.): Literatur i m Film. B eispiele e iner Medienbeziehung. K önigshausen und
Neumann Verlag. Würzburg. 2008
Poppe, S .: V isualität i n Literatur und F ilm. E ine m edienkomparatistische U ntersuchung
moderner E rzähltexte und ihrer V erfilmungen. V andenhoeck und R uprecht V erlag.
2007
Schachtgabel, G .: D er A mbivalenzcharakter de r Literaturverfilmung. M it e iner
Beispielanalyse von T heodor Fontanes Effie Briest und de ssen Verfilmung von R ainer
Werner Fassbinder. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main. 1984
Schwab, U .: E rzähltext und S pielfilm. Z ur Ä sthetik und A nalyse d er F ilmadaption. LIT
Verlag. Berlin.2006
25
Sölkner, M.: Über die Literaturverfilmung und i hren ‚künstlerischen‘ Wert. In: Neuhaus, S .
(Hrsg.): Literatur im Film. Beispiele e iner Medienbeziehung. K önigshausen und
Neumann Verlag. Würzburg. 2008
Stenzel, H .: E inführung i n di e s panische Literaturwissenschaft. J .B. M etzler V erlag.
Stuttgart/Weimar. 2. Auflage . 2005
Weis-Bomfim, P.: A frobrasilianische Literatur – Geschichte, Konzepte, A utoren. Lepê
Correia, C uti, G eni G uimarães, P aulo Lins, M arilene F eline. B rasilienkundeverlag.
Mettingen.