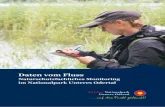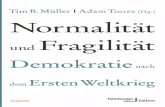Absolutismus oder ‚gute Policey‘? Anmerkungen zu einem Epochenkonzept
Bunte Revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder Modus der autoritären Systemreproduktion
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Bunte Revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder Modus der autoritären Systemreproduktion
Literaturbericht
Zusammenfassung: Die dominante interpretation der „bunten revolutionen“ sieht in ihnen De-mokratisierungsschübe in postsozialistischen Ländern, in denen die transformation in den 1990er Jahren zum Stillstand gekommen war. Sie bietet neoinstitutionalistische Deutungen elektoraler revolutionen, modelliert das Zusammenspiel endogener und exogener Faktoren und gibt empfeh-lungen für die Demokratieförderung. alternativ dazu werden die bunten revolutionen auch als instabilitätskrise und reproduktionsmodus (semi-)autoritärer regime verstanden, womit beiträge zur vergleichenden autoritarismusforschung geleistet werden. Die unterschiedlichen Sichtweisen eröffnen auch unterschiedliche Perspektiven für die postsozialistische regionalforschung.
Schlüsselwörter: Wahlen in autoritären regimes · revolutionen · Demokratisierungsforschung · Postsozialismus · Demokratieförderung
“Colour Revolutions”: Democratic Breakthrough or Authoritarian Regime Reproduction?
Abstract: the bulk of the debate on “colour revolutions” interprets them as instances of demo-cratic breakthrough promoting the democratization of postcommunist “laggards”. it contributes to democratization studies delivering neoinstitutionalist interpretations of electoral revolutions, mod-els of the interplay between international and domestic factors, and implications for democracy assistance. there is, however, an alternative interpretation of the “colour revolutions” as instances of authoritarian regime instability and reproduction. it provides insights into the dynamics of post-Soviet (semi-)authoritarian regimes which are related to the ongoing debate on comparative authoritarianism. the different perspectives on “colour revolutions” also offer various prospects for postcommunist area studies.
Keywords: authoritarian elections · revolutions · Democratization studies · Postcommunism · Democracy assistance
Polit Vierteljahresschr (2010) 51:137–162DOi 10.1007/s11615-010-0009-9
„Bunte Revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder Modus der autoritären Systemreproduktion?
Petra Stykow
Online publiziert: 11.03.2010 © VS-Verlag 2010
Prof. Dr. P. Stykow ()Geschwister-Scholl-institut für Politikwissenschaft, Ludwig-Maximilians-universität München, Oettingenstrasse 67, 80538 München, Deutschlande-Mail: [email protected]
138 P. Stykow
1 Bunte Revolutionen und Große Fragen der Politikwissenschaft
Wie vollzieht sich die Demokratisierung autoritärer regime? Sind evolutionäre oder aber revolutionäre Wege effizienter, empirisch von größerer Relevanz und normativ zu bevor-zugen? Liegen die erfolgsbedingungen in strukturellen Faktoren oder im handeln der Akteure? Können Demokratisierungsprozesse von außen wirksam befördert werden?
Das sind traditionelle Fragen der empirisch-analytischen Systemwechselforschung. entwicklungsschübe für die theoriebildung gingen seit den 1970er Jahren stets von empirischen ereignissen und ihrer regionalwissenschaftlich informierten interpretation aus: Die analyse der re-Demokratisierung autoritärer regime in Lateinamerika und Südeuropa brachte die transition-to-democracy-Schule (diskursbegründend: O′Donnell u. Schmitter 1986) hervor, die eine deutungsstarke alternative zu den bis dahin domi-nierenden strukturalistischen erklärungsansätzen begründete. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus am Ende der 1980er Jahre beflügelte die Konkurrenz der beiden For-schungsprogramme zunächst, bevor die postsozialistischen entwicklungen auch zum Gegenstand neoinstitutionalistischer interpretationen wurden.1
Zu beginn des neuen Jahrtausends waren es „bunte revolutionen“ („Farbrevolutio-nen“, colour revolutions), die neues Material für die Demokratisierungsforschung zur Verfügung stellten. beobachter zählen die „Oktoberrevolution“ (auch „bulldozerrevolu-tion“) in Serbien (2000), die „rosenrevolution“ in Georgien (2003), die „Orange revolu-tion“ in der ukraine (2004), die „tulpenrevolution“ in Kirgistan (2005) dazu, viele auch die (gescheiterte) „Jeansrevolution“ in belarus (2006) und andere ereignisse. Gemein-sam ist ihnen die Mobilisierung protestierender bürger gegen die Fälschung der ergeb-nisse von Wahlen, die weitgehend ohne Blutvergießen verlief und, sofern erfolgreich, Neuwahlen und einen politischen Machtwechsel erzwang.
Die Zahl der bunten revolutionen (br) blieb bis heute überschaubar. Ob sie die Demokratisierung in der postsozialistischen region tatsächlich vorangebracht haben, ist unsicher. Gleichwohl sind sie Gegenstand einer anhaltenden kontroversen Debatte2, die ich im Folgenden systematisch auswerte.3 an ihrem ausgangspunkt stand die Diagnose, die br eröffneten einen neuen Pfad zur liberalen Demokratie, der – zumal dank west-licher unterstützung – vergleichsweise leicht zum erfolg führen würde. theorien der
1 Für Überblicke über die Diskursentwicklung s. Geddes (1999); Grzymala-busse u. Luong (2006); Mahoney (2003).
2 Neben ca. einem Dutzend politikwissenschaftlicher bücher sind bisher weit über 100 aufsätze allein in wichtigen englischsprachigen Fachzeitschriften erschienen, darunter als themen-schwerpunkte in Communist and Post-Communist Studies 2006 (39) 3; Democratization 2009 (16) 4); Demokratizatsiya 2005 (13) 4 und 2007 (15) 1; Journal of Communist Studies and Transition Politics 2007 (23) 1 und 2009 (25) 2/3; Journal of Democracy 2005 (16) 2 und 2009 (19) 1. auch in der russischsprachigen (kaum aber in der deutschen) community wurden die br lebhaft diskutiert (exemplarisch: barsamov 2006; Fisun 2006; Gel′man 2005; Kara-Murza 2005; Pro et Contra 2005 (9) 1).
3 ich bedanke mich bei hubertus buchstein und seinen Doktoranden, insbesondere bei Michael hein, bei ruth Schneider, Katarina bader, Martin brusis, Kevin Köhler, Jana Warkotsch und den beiden anonymen Gutachtern für ihre ideen und Vorschläge zu früheren Versionen des Manuskripts.
139„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
„elektoralen revolution“, welche die Demokratisierungsforschung bereicherten, über-wanden die traditionelle Gegenüberstellung von paktiertem und revolutionärem Wandel sowie von structure und agency, die den Diskurs bis in die jüngste Zeit hinein prägte (abschn. 2). Dieser Deutung steht eine „revisionistische“ interpretation gegenüber, die in den br den ausdruck einer zyklischen reproduktionskrise autoritärer regime sieht, welche bestimmten Formen autoritärer Systeme inhärent ist und per se kein Demokra-tisierungspotential birgt (abschn. 3). auch für ein weiteres theoretisches Problem, die Modellierung des Zusammenhangs endogener und inter- bzw. transnationaler Faktoren in Demokratisierungsprozessen, liefern die br Material, aus dem auch politikpraktische Schlussfolgerungen für die externe Demokratieförderung gezogen werden (abschn. 4). Die bedeutung der Debatte geht damit weit über die Suche nach einer passenden erklä-rung für eine handvoll empirischer ereignisse hinaus. Nicht zuletzt hat sie Folgen für die innerwissenschaftliche entwicklung, denn sie betrifft auch das Verhältnis von com-parative politics und area studies. Die postsowjetische region bietet mit den br nicht nur anknüpfungspunkte für die etablierten democratization studies, sondern auch für die sich gegenwärtig institutionalisierende Subdisziplin der vergleichenden autoritarismus-forschung (abschn. 5).
2 Bunte Revolutionen als Modus des Systemwechsels?
2.1 bunte revolutionen als elektorale revolutionen
Die Gegenstände der hier analysierten Debatte haben sich aufgrund ihrer medialen insze-nierung im öffentlichen bewusstsein als revolutionen verankert. Der dominante politik-wissenschaftliche Diskurs folgt dieser Deutung. Die bunten revolutionen ordnen sich demnach in die Vierte Demokratisierungswelle – seit 1989 – ein (z. b. Wilson 2005) oder verkörpern einen zweiten anlauf in jenen Ländern, in denen der Zusammenbruch des Staatssozialismus in den 1990er Jahren nicht zur Demokratie geführt hatte (bunce u. Wolchik 2006b; Kuzio 2008).
Das elaborierteste Konzept ist Michael McFauls „elektorale revolution“ im Sinne eines democratic breakthrough (2005, 2006, 2007). Die Merkmale des tendenziell universellen Konzepts gewinnt er aus der Generalisierung der ukrainischen Orangen revolution:
„(1) the spark for regime change was a fraudulent national election; (2) the challengers to the incumbents deployed extraconstitutional means to ensure that the formal rules of the political game in the constitution were followed; (3) incumbents and challengers both claimed to possess sovereign authority over the same territory; (4) all of these revolutio-nary situations ended without the massive use of violence by either the state or the oppo-sition; and (5) the conclusion of these electoral revolutions triggered a significant jump in the degree of democracy“ (2007, S. 50).4
� Andere Merkmalskataloge, die davon lediglich im Detail abweichen, finden sich u. a. bei Åslund u. McFaul (2006, S. 2–3); bunce u. Wolchik (2006a, S. 5); thompson u. Kuntz (2004); Kuzio (2006); Fairbanks (2007, S. 53–54).
140 P. Stykow
Damit ordnet McFaul die elektorale revolution zwei distinkten Primärkategorien unter: Einerseits beschreibt er sie als Subtyp eines Transitionsmodus, also als spezifi-schen Übergangspfad von einem autoritären zu einem demokratischen politischen Sys-tem, und schließt damit an die transition-to-democracy-Schule (z. b. huntington 1991; Karl u. Schmitter 1991; colomer 2000) an. andererseits konzipiert er sie als Subtyp der ereignisklasse revolution. Sie vollendet die „friedliche revolution“, die zum Zusam-menbruch des Staatssozialismus und der Sowjetunion an der Wende zu den 1990er Jahren führte (McFaul 2006, S. 190–193). Wie diese zielt sie auf die etablierung von Demokratie und verläuft überwiegend gewaltfrei. ihr anlass – manipulierte Wahlergebnisse ( stolen elections, vgl. thompson u. Kuntz 2004) – ist aber stärker spezifiziert. Sowohl friedli-che als auch elektorale revolutionen unterscheiden sich aufgrund ihrer Konfrontativität ( non-cooperative transitions, McFaul 2002) qualitativ von den elitenpakten, welche der transitionsdiskurs für Lateinamerika und Südeuropa als besonders erfolgversprechend bewertet hatte.
Gleichzeitig treibt das Konzept der elektoralen revolution die erosion des revolu-tionsbegriffs weiter voran, die in der Forschung seit den 1980er Jahren zu beobachten ist. Der Verzicht auf eine reihe von begriffsmerkmalen ermöglichte es, die anzahl der unter-suchungsgegenstände, die zuvor auf eine Handvoll „Große Revolutionen“ beschränkt war, erheblich zu steigern. tendenziell löst sich dabei die ereigniskategorie selbst auf, wie auch die Debatte um die br zeigt. David Lane (2009, S. 117) beispielsweise sieht in ihnen einen neuartigen typus revolutionärer aktivitäten – eine „combination of public protest and coup d′état“, während Valerie Bunce und Sharon Wolchik „elektorale Revo-lutionen“ definieren als „attempts by opposition leaders and citizens to use elections, sometimes in combination with political protests, to defeat illiberal incumbents or their anointed successors; to bring liberal oppositions to power; and to shift their regimes in a decidedly more democratic direction“ (2006b, S. 284).
Zwei der drei Kernmerkmale, die in nahezu jeder gebräuchlichen Definition von Revo-lution5 anzutreffen sind – erhebliche Massenmobilisierung und nicht-institutionalisierte Protestformen – erscheinen in dieser begriffsbestimmung als fakultativ. als revolution gilt vielmehr bereits der Versuch einer demokratisch gesinnten Opposition, autoritär agie-renden amtsinhabern eine Niederlage zu bereiten, wenn dabei „substantial popular invol-vement“ im Sinne von Wählermobilisierung zu beobachten ist (2006b, S. 289).
Der Vorteil einer solchen Konzeptualisierung besteht in der Vergrößerung der Begriffs-extension. Die Zahl der empirischen ereignisse, die bis dahin so klein war, dass ihre theoriefähigkeit durchaus bezweifelt werden konnte, nimmt erheblich zu. im Zeitraum 1996–2006 haben demnach in 40% der postsozialistischen Länder elektorale revolutio-nen stattgefunden. Neben fünf gescheiterten (armenien, zwei Mal aserbaidschan, bela-rus, Kasachstan) zählen bunce/Wolchik acht erfolgreiche regierungs- und Systemwechsel (neben den oben genannten: bulgarien 1996, rumänien 1996, Slowakei 1998, Kroatien 2000). Mehr noch: ihrer auffassung nach fanden solche ereignisse seit der zweiten hälfte
5 Goldstone (2001, S. 142) zählt dazu: „(a) efforts to change the political regime that draw on a competing vision (or visions) of a just order, (b) a notable degree of informal or formal mass mobilization, and (c) efforts to force change through noninstitutionalized actions such as mass demonstrations, protests, strikes, or violence.“
141„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
der 1980er Jahre auch in Äthiopien, togo und Simbabwe, Kamerun, chile, indonesien, der elfenbeinküste, Mexiko, Nicaragua, Peru und auf den Philippinen statt.6 elektorale revolutionen erscheinen aufgrund dieser begriffskonstruktion als ein universeller Modus des Übergangs zur Demokratie in nicht-westlichen Ländern der Gegenwart.
Der Preis für diese Generalisierung des Konzepts erscheint allerdings als zu hoch: Die üblicherweise als kategorial angesehene Grenze zwischen „revolution“ und „(ab-)Wahl einer regierung“ verschwimmt. als Distinktionsmerkmale der ersten gelten lediglich die hochpolarisierte Wahlsituation (als Äquivalent einer revolutionären Situation) sowie die reichweite der Programmpositionen der Wettbewerber. Die amtierende regierung wird als illiberal, die Opposition als liberal identifiziert; sie präsentieren nicht einfach politi-sche, sondern vielmehr systemische alternativen. Mit anderen Worten: Wenn Machteli-ten, die in der Normalpolitik nicht-demokratisch agieren, Wahlen zulassen, und wenn die Opposition daran teilnimmt und gewählt wird, liegt bereits eine Wahlrevolution vor. Dies erscheint als normativ voreingenommen. Empirisch läuft das derart definierte Konzept Gefahr, wertlos zu werden, und analytisch löst es die raison d′être jeglicher Forschung auf, die in revolutionen erklärungsbedürftige ausbrüche aus der Normalpolitik sieht.
2.2 revolutionen friedlicher Demokraten statt ausgehandelter elitepakte
indem br als neuer Demokratisierungspfad unter den bedingungen der Globalisierung konzipiert werden, schließen sie an eine Forschungstradition an, die auf Barrington Moore zurückgeht: er beschreibt drei alternative Pfade in die Moderne, die seiner auffassung nach „historische Stufen“ (1969, S. 476) darstellten, welche jeweils die bedingungen für spätere entwicklungen veränderten. Der Weg der bürgerlich-demokratischen revolution, der in england, Frankreich und den uSa eingeschlagen worden war, sei demnach für alle latecomer verschlossen. in dieser Sichtweise besteht der beitrag der transition-Schule der späten 1980er Jahre darin, mit dem Modus des paktierten, ausgehandelten Übergangs einen Pfad für junge Demokratien in der Nachkriegsära beschrieben zu haben. Die revo-lutionen von 1989 und elektorale revolutionen wiederum könnten dann zwei weitere Stufen im globalen Voranschreiten der Demokratie bedeuten (s. auch hadenius u. teorell 2007; Magaloni 2006, S. 228–239).
bei der Durchsicht der theorieentwicklung in der Demokratisierungsforschung fällt ins auge, dass neue erklärungen dem bisherigen Mainstream stets auch darin widerspra-chen, ob ein evolutionärer oder ein revolutionärer Modus des Systemwechsels zu bevor-zugen sei. So wurde, nachdem Moore den herrschenden modernisierungstheoretischen evolutionismus verworfen hatte (1969, besonders S. 577–581), die revolutionsskeptische argumentationslinie bald wieder aufgegriffen: revolutionen zerstören demnach das gel-tende institutionensystem gewaltsam und setzen einen endlosen Prozess institutionellen experimentierens in Gang, der mit hoher Wahrscheinlichkeit destruktiv verläuft. Sie bergen daher kaum aussichten gerade auf die etablierung von Demokratie als eines auf regelgeltung angewiesenen Systems (Fairbanks 2007, S. 44–47; Skocpol 1986, S. 84–87; Stinchcombe 1999). Der transitionsdiskurs sah sich durch die Verläufe der südeuropäi-
� Erweiterte Aufzählungen finden sich z. B. auch bei Beissinger (2007); D′Anieri (2006); Karat-nycky u. ackerman (2005); thompson u. Kuntz (2004).
142 P. Stykow
schen und lateinamerikanischen Systemwechsel bestätigt, wo revolutionen nirgends zu stabilen Demokratien führten (Karl 1990, S. 8). Pakte zwischen konkurrierenden eliten-faktionen stellten hingegen einen effektiven, weil kompromiss- und konsensorientierten Weg zur Demokratie dar. Sie können als unbeabsichtigtes und kontingentes Nebenpro-dukt der auseinandersetzungen von akteuren entstehen, deren handeln zwar rationali-tätskriterien genügt, nicht aber durch demokratische Normen und Werte angetrieben sein muss (z. b. Przeworski 1992).
in den 1990er Jahren kehrte dann mit theorien der „friedlichen revolution“ 1989 (z. b. McFaul 2002; roeder 1999) eine Sichtweise zurück, welche den Gradualismus der transition-Schule ablehnte, und hier schließen auch die jüngsten Theorien der elektora-len revolution an (Fairbanks 2007). Gleichzeitig vollzieht sich aber eine annäherung an den Transitionsdiskurs, indem Gewaltlosigkeit zum Definitionsmerkmal der Revolution erhoben wird. revolutionäre Wege des Systemwechsels erscheinen nun nicht mehr als ereignisse, welche die existenz von Gesellschaften bedrohen, indem sie anomie und chaos hervorrufen. Die protestierenden Massen lassen sich vielmehr dezidiert vom Stre-ben nach Gewaltfreiheit leiten. Suggeriert wird damit, dass rationale akteure unter den bedingungen der Gegenwart in der Lage seien, den Prozess so zu kontrollieren, dass er dank der Selbstbeschränkung beider Seiten nicht eskaliert.
Deutlich von der transition-Schule grenzt sich die revolutionsperspektive gleichwohl hinsichtlich der akteure des Systemwechsels ab: Während erstere radikal elitenzentriert argumentiert, betont letztere, dass es die mobilisierte bevölkerung ist, welche Demo-kratie einklagt. Demokratisch gesinnte oppositionelle eliten werden als repräsentanten des Volkes konzipiert und gelangen einzig durch dessen revolutionären aufbruch an die Macht. Die eliten werden also der demokratischen Zivilgesellschaft zugeschlagen, die dem autoritären Staat gegenübersteht. Diese Zuordnung begründen die betreffenden autoren7 nicht nur mit dem machtfernen Status, sondern auch mit der ideologie der Opposition: Sie ist definitionsgemäß „demokratisch“, da sie zum gegebenen Zeitpunkt für die Durchführung freier und fairer Wahlen eintritt. Das ist jedoch ein logischer Fehl-schluss. es wäre empirisch zu überprüfen, ob die massenwirksam erhobene Forderung nach Demokratie, zumal wenn sie von mutmaßlich um ihren Sieg betrogenen Akteuren ausgeht, nicht primär auf deren geschickte ausbeutung der prekären Lage der amtsinha-ber zurückgeht – denn diese sind desavouiert, sobald der Verdacht aufkommt, sie hätten die Wahlergebnisse manipuliert, um die von ihnen explizit angestrebte Legitimierung durch die Wähler zu erreichen.
Der Gegensatz zwischen den Diskursen des revolutionären Systemwechsels und der paktierten transition betrifft bei näherem hinsehen also weniger die Gegenpole „revo-lution – Gradualismus“ als die Konzeptualisierung der Schlüsselakteure. Die transition-Schule analysiert den Wettbewerb von eliten um die politische herrschaft, der unter bestimmten bedingungen durch die Festlegung auf demokratische Spielregeln eingehegt wird; eine demokratische Gesinnung der beteiligten ist keine erfolgsbedingung für die einführung von Demokratie. Die dominante Deutung der br hingegen wird von revo-lutionstheorien bestimmt, welche eliten und Gesellschaft einander gegenüberstellen. es
7 So etwa beissinger (2009); bunce u. Wolchik (2006a, b); Fairbanks (2007); McFaul (2005); hingegen argumentieren D′Anieri (2006) und Kudelia (2007) elitenzentriert.
143„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
wird unterstellt, dass Demokratisierung ohne demokratisch gesinnte akteure unmöglich ist. ihre ideologische bindung sei sogar weitaus bedeutungsvoller als das Design der zu schaffenden institutionen (McFaul 2002, S. 225).
2.3 ursachen: akteure und Strukturen
Die transition-Schule hatte mit ihrer Fokussierung auf politische Prozesse, intendiert rationale akteure und deren strategische entscheidungen ein anti-strukturalistisches Forschungsprogramm entwickelt, das sich klar den älteren programmatischen traditio-nen entgegenstellte, welche einen Zusammenhang zwischen Demokratie und sozioöko-nomischer entwicklung (zuerst Lipset 1959) bzw. sozialen Strukturen (zuerst Moore 1969) behaupteten und sie als Vorbedingungen ( preconditions) der Demokratisierung konzeptualisierten.
Gegen ende der 1990er Jahre setzte in der Demokratisierungsforschung eine neue Phase der theorieentwicklung ein. unter rekurs auf den neoinstitutionalistischen ansatz wird nun die interdependenz struktureller und akteurszentrierter erklärungsfaktoren betont, um den voluntaristischen Überschuss des transitionsdiskurses zu überwinden (vgl. Grzymala-busse u. Luong 2006). Damit einher geht die Formulierung zunehmend komplexer ursachen- und Prozesserklärungen, die ältere annahmen der kausalen Linea-rität, Additivität und Unifinalität hinter sich lassen (Munck 2001). auf der Suche nach allgemeinen, aber dennoch spezifizierbaren und erklärungsstarken Modellen nimmt die ambitionierte Demokratisierungsforschung aktuelle methodologische entwicklungen in den comparative politics auf. insbesondere hat sie begonnen, interagierende bedingungs-kombinationen (ragin 1987) und Kausalmechanismen aufzudecken (Kitschelt 2003; hall 2003; tilly 2001). Die postsozialistischen transformationsprozesse liefern wichtiges Material für die methodologische und methodische Verfeinerung des Diskurses, welche auch die integration der regionalwissenschaftlichen Osteuropaforschung in die verglei-chende Politikwissenschaft erleichtert (s. abschn. 5.2).
auch theorien der elektoralen revolution sind durch das bestreben gekennzeichnet, die traditionelle Gegenüberstellung von structure und agency zu überwinden: Strukturfak-toren wird bedeutung eingeräumt, Dreh- und angelpunkt bleibt aber die annahme, dass der Übergang zur Demokratie nicht an bestimmte strukturelle Vorbedingungen gebun-den sei (Silitski 2009, S. 87). in McFauls interpretation beispielsweise werden Struktur-merkmale für den ausbruch einer elektoralen revolution als notwendig konzeptualisiert, innenpolitische agency-Faktoren aber als hinreichend. Situative Machtverschiebungen zwischen den autoritären elementen innerhalb des Staates und den pro-demokratischen elementen innerhalb der Gesellschaft werden anlässlich von Wahlen offenbar. Sie können anhand von sieben Faktoren diagnostiziert werden (McFaul 2007, S. 51–66): Die autori-täre akteurskoalition ist geschwächt, wenn sie (i) im Kontext eines politischen Systems operiert, in dem demokratische Standards nicht erfüllt werden, aber regelmäßig Wahlen stattfinden („kompetitiver Autoritarismus“, s. Abschn. 3.1). Wenn (ii) die Popularität der regierenden eliten gering ist bzw. abnimmt, sind regime dieses typs in ihrer existenz bedroht – um so mehr, wenn (iii) ihre repressionskapazitäten aufgrund einer elitenspal-tung gering sind. ihrerseits ist die pro-demokratische Koalition gestärkt, wenn eine orga-nisierte, vereinte Opposition (iv) sich glaubhaft als politische alternative im Wahlkampf
144 P. Stykow
präsentiert und die Wähler zu mobilisieren versteht, (v) in der Lage ist, den Wahlbetrug schnell und präzise nachzuweisen, (vi) über Zugänge zu unabhängigen Massenmedien verfügt sowie (vii) die postelektorale Mobilisierung der Wähler organisieren kann, wel-che die annullierung des Wahlergebnisses erzwingt. Wahlen können zum anlass bzw. auslöser einer elektoralen revolution werden. Das manipulierte Wahlergebnis ist der focal point für die Lösung des Problems der kollektiven Protestmobilisierung von bür-gern, welche ohnehin mit den regierenden eliten unzufrieden sind (tucker 2007).
Die einzelnen erklärungsfaktoren in diesem Modell sind keineswegs additiv zu ver-stehen, sondern bilden Konfigurationen interagierender Bedingungen. Wenn sie nicht alle vorliegen, kommt es selbst angesichts gefälschter Wahlen nicht zu einer erfolgreichen Massenmobilisierung und zu einem Demokratisierungsschub (McFaul 2007, S. 80), wie das beispiel belarus 2006 zeigt (Marples 2006). Gleichzeitig ist das Modell nicht offen deterministisch. betont wird vielmehr die bedeutung von (Fehl-)Wahrnehmungen: br finden nur statt, wenn die regierenden Eliten ihre eigene Stärke überschätzen (McFaul 2007, S. 80). Wenn sie hingegen die Stärke der Opposition zu hoch ansetzen, agieren sie unnötig repressiv, aber trotzdem effektiv (Marples 2006, S. 363). Falls sie die Lage also richtig einschätzten, so das implizite argument, würden autoritäre eliten ihre Wahlnie-derlage akzeptieren. Der Übergang zur Demokratie vollzöge sich dann auf nicht-revolu-tionärem Wege.
3 Bunte Revolutionen als Modus der autoritären Systemreproduktion?
3.1 bunte revolutionen als eskalation von Nachfolgekrisen
Zur „revolutionären“ interpretation der br gibt es eine, wenn auch vergleichsweise wenig rezipierte, alternative. Sie sprengt den Deutungsrahmen der Systemwechselforschung, indem sie auf die Meistererzählung des Übergangs zur Demokratie verzichtet. Zwar wird die eingeführte bezeichnung beibehalten, aber konzeptionell gehören ereignisse wie die „Orange revolution“ keineswegs in die Kategorie „revolutionen“ oder „Modi des Systemwechsels“. Es handelt sich bei ihnen vielmehr um ein spezifisches Muster der intraelitären auseinandersetzung in semi-autoritären politischen Systemen, in denen die politische Schlüsselposition – die des Präsidenten – neu zu besetzen ist.
Mit der revolutionsinterpretation teilt diese Konzeptualisierung der br die annahme, dass die betreffenden ereignisse charakteristisch für regime in der „Grauzone“ (caro-thers 2002) zwischen Demokratie und Autokratie sind, die häufig als „kompetitive autoritarismen“ (Levitsky u. Way 2002) bezeichnet werden.8 Demokratische Standards werden hier nicht erfüllt, aber im Unterschied zu geschlossenen Autokratien finden regel-mäßig Wahlen statt. Sie können heiß umkämpft sein, und ihr Ausgang ist vorab nicht
8 Die Diskussion um eine angemessene Konzeptbildung für solche Grauzonenregime wird seit über einem Jahrzehnt lebhaft geführt. Für eine Würdigung ihrer wichtigsten beiträge und den Vorschlag einer typologie, die beide root concepts der Debatte aufeinander bezieht und daher auch verminderte Subtypen (wie etwa „defekte Demokratien“ und „kompetitive autokratien“) plausibel voneinander abgrenzen kann, sei auf bogaards (2009) verwiesen.
145„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
völlig sicher. Die regierende elitenfaktion geht zwar meist als Sieger aus ihnen hervor, weil sie den Staat als instrument der herrschaftssicherung instrumentalisieren kann und formal-demokratische institutionen, etwa das Wahlsystem, manipuliert. Sie greift auch in Wahlkämpfe ein, z. b. durch die Kontrolle der medialen berichterstattung, und sie nutzt staatliche ressourcen, um die Opposition mehr oder weniger subtil zu schwächen. Vor massiven Fälschungen der Wahlergebnisse schrecken die Machteliten jedoch meist zurück, da sie mit Gegenwehr der Opposition bzw. der Wähler rechnen müssen. Sie kön-nen Wahlen nicht zur bloßen Farce verkommen lassen, sondern bedürfen ihrer aus Grün-den der herrschaftslegitimation. Das entscheidende Merkmal kompetitiver autokratien ist also die Koexistenz demokratischer basisinstitutionen mit informellen institutionen und Praktiken, die deren demokratische Funktionsweise aushebeln.
Die revisionistische Sicht auf br geht über diese charakteristik konzeptionell noch hinaus. Sie wird durch henry hale (2005, 2006; s. auch Fisun 2006) vertreten, der die informellen Interaktionsmuster der Eliten als wesentliches Regimemerkmal spezifiziert. bunte revolutionen fanden demnach nur dort statt, wo sich ein formal institutionalisier-tes präsidentielles regierungssystem mit einem informellen personalistischen System der Zugangsregulierung zur Macht überlagern. Neben beträchtlichen konstitutionellen Voll-machten stehen dem direkt gewählten Präsidenten auch weitreichende informelle Macht-ressourcen zur Verfügung. Sie beruhen auf ausgedehnten klientelistischen Netzwerken in Politik und Wirtschaft. Politische Macht wird stärker durch die selektive Gewährung von Privilegien an loyale anhänger ausgeübt als vermittels formal institutionalisierter Praktiken oder rechtsstaatlicher instrumente (hale 2005, S. 137–138). es handelt sich also um ein „neopatrimoniales“ regime im Sinne einer Mischform aus bürokratischen und personalistischen Mechanismen der herrschaftsorganisation (bratton u. van de Walle 1997, S. 62); hale bezeichnet es als „patronalen Präsidentialismus“.
Das Konzept des Neopatrimonialismus hat in der entwicklungsländerforschung tra-ditionell eine wichtige rolle gespielt und erlebt gegenwärtig im Zusammenhang mit der wachsenden wissenschaftlichen aufmerksamkeit für autoritäre Systeme eine renais-sance (s. erdmann u. engel 2007).9 als Merkmale neopatrimonialer regime, die in allen nicht-westlichen regionen beschrieben werden, gelten Präsidentialismus, systematischer Klientelismus und die Nutzung von ressourcen des Staates für die politische Legi-
9 es gibt vorerst keinen Konsens darüber, wie die typologie politischer Systeme auf die typologie von Strukturformen der herrschaft im Sinne Max Webers (1980 [1921], Kap. iX) zu beziehen ist, in deren Denkrahmen das Konzept des Neopatrimonialismus als eines hybrids aus patrimo-nialen und legal-rationalen herrschaftsformen entwickelt wurde. Neben systematischen Versu-chen einer kombinatorischen typenbildung (z. b. erdmann u. engel 2007, S. 111–113) gibt es Konzepte, in denen die herrschaftsstruktur als sekundäres regimemerkmal politischer Systeme erscheint, die keine („vollständigen“) Demokratien sind. Oft wird der (hybride) Neopatrimo-nialismus (hybriden) verminderten Subtypen politischer Systeme zugeordnet („kompetitiver Autoritarismus“ bzw. „delegative democracy“ – O′Donnell (1994, S. 59)), oder personalisti-sche herrschaftsstrukturen dienen als typologisches Kriterium für Subtypen autoritärer regime („personalist regime“ – Geddes (1999, S. 121–122); „neopatrimonial regime“ – Snyder (1992)). einige autoren sehen in personalistischen herrschaftsstrukturen aber auch sekundäre regime-merkmale, die prinzipiell in allen typen politischer Systeme anzutreffen sind (brooker 2000, S. 37; hadenius u. teorell 2007, S. 149).
146 P. Stykow
timitätsbeschaffung der Machtelite (bratton u. van der Walle 1997, S. 63–65). in der postsozialistischen region sind regime dieses typs für fast alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion charakteristisch (hale 2006, S. 307), was mit hilfe von Pfadabhängigkeiten erklärt werden kann: es handelt sich um Länder, in denen bereits der Staatssozialismus – seinerseits geprägt durch ein entsprechendes historisches erbe – neopatrimonial geprägt war (Kitschelt et al. 1999, Kap. 1).
Die neopatrimonialen Mechanismen der herrschaftsorganisation stellen sicher, dass die regierenden Eliten selbst formal freie Wahlen regelmäßig gewinnen (North et al. 2007, S. 26–27): anzahl und Spektrum von politischen Organisationen sind reguliert; mindestens die wichtigsten Wettbewerbsteilnehmer sind zwangsläufig Bestandteil der regierenden elitenkoalition. Die Stimmen der bürger können durch Leistungsversprechen gekauft werden, wobei die Machteliten sogenannte „administrative ressourcen“ nutzen können, die ihnen dank ihrer Positionen in Staat und Verwaltung zugänglich sind. instabil wird ein solches regime nur dann, wenn der Präsident als politischer Schlüsselakteur die klientelistische Funktionslogik des Systems nicht (mehr) effizient bedient (Hale 2005, S. 139–143): erst wenn ein personeller Wechsel an der Spitze des Staates absehbar wird und die Nachfolgefrage ungelöst scheint, brechen Spaltungen und rivalitäten der eliten auf, unter umständen in dramatischer Form. Solche Situationen können unverhofft eintre-ten, etwa durch Krankheit, tod oder rasanten Popularitätsverlust des Präsidenten (infolge einer militärischen Niederlage, Wirtschaftskrise o. ä.).
in kompetitiven autokratien aber erwachsen sie zudem mit zyklisch hoher Wahrschein-lichkeit, weil es Wahlen gibt und die amtszeit des Präsidenten konstitutionell beschränkt ist. Falls es dem scheidenden amtsinhaber gelingt, die Loyalität seiner unterstützerkoali-tion auf seinen Wunschnachfolger zu transferieren, lässt sich die Nachfolgefrage zuver-lässig und glaubhaft regeln, ohne dass eine Stabilitätskrise eintritt. Wahlen müssen in diesem Fall lediglich die intraelitäre einigung auf den neuen Präsidenten legitimieren, was üblicherweise (etwa durch manipulative Praktiken im Wahlkampf) gesichert werden kann.
Wenn sich die elitenfaktionen aber nicht auf einen amtsnachfolger einigen können, gewinnen Wahlen über ihre Legitimierungsfunktion hinaus in einer Funktion an Gewicht, die bis dahin latent war – als institution der elitenrekrutierung und -selektion. Das wird gegebenenfalls relevant, wenn die informellen einigungsmechanismen der eliten ver-sagen. in solchen Situationen öffnet sich ein Gelegenheitsfenster für oppositionelle eli-tengruppen: Sie können eventuell Wahlen gewinnen oder sich zumindest als Wahlsieger präsentieren, denen die anerkennung versagt wurde. Gelingt ihnen in dieser Situation die Mobilisierung gesellschaftlicher Unterstützergruppen, finden elektorale Revolutionen statt.
Zusammengefasst heißt das: Wahlen können in Regimen des patronalen Präsidentia-lismus die Funktion der Schumpeterschen „demokratischen Methode“ (Schumpeter 2005 [1947], S. 428) nicht systematisch erfüllen, weil damit das neopatrimoniale Grundprinzip der herrschaftsorganisation – der personalistisch regulierte Zugang zu Machtressourcen – ausgehebelt würde. Sie können sich nur ausnahmsweise und im Nachhinein tatsächlich als institutionen der elitenselektion erweisen: wenn oppositionelle elitenfaktionen mit dem Versuch erfolgreich sind, sich auf diese Funktion zu berufen und dafür öffentliche Akzeptanz finden, die sich in Massenmobilisierung übersetzt.
147„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
3.2 ursachen: Strukturen und Kontingenz
Wiewohl die revisionistische Perspektive nicht in den deterministischen Strukturalismus zurückfällt, betont sie strukturelle ursachen von br weitaus stärker als theorien der elektoralen revolution – pikanterweise, indem sie sich auf die akteurszentrierte tran-sitionsforschung beruft, insbesondere auf das Konzept der elitenkonstellation (higley u. burton 1989; hale 2005, S. 136–137). Demzufolge besteht die Stabilitätsbedingung eines regimes im Konsens seiner eliten über die regeln des politischen Spiels. Damit es instabil wird, ist eine elitenspaltung notwendig. Die Frage ist also, ob es dem patronalen Präsidenten gelingt, die elitenfaktionen an sich zu binden, von deren unterstützung er abhängt. Vermag er die Mechanismen der regimereproduktion zu nutzen, scheitert er, weil er sie nicht beherrscht, oder zerstört er sie gar absichtsvoll (und scheitert womöglich deshalb)?
indem hale die Struktur der elitenkonstellation in bezug zur Funktionslogik von regi-men des patronalen Präsidentialismus setzt, kann er erklären, warum ihre Kompetitivität oszilliert: im Normalmodus scheinen sie geschlossene autokratien zu sein, in denen es keinen politischen Wettbewerb gibt, aber wenn die informelle Position des Präsidenten geschwächt ist oder eine anstehende Nachfolgefrage nicht intraelitär gelöst wurde, wird der politische Prozess hochkompetitiv, bis hin zum revolutionären ausnahmezustand. anders als in der revolutionsinterpretation kommt in diesem Modell weder der Massen-mobilisierung von unten noch den demokratischen Werten der oppositionellen eliten pri-märe oder unabhängige bedeutung für die erklärung der ereignisse zu. entscheidend ist vielmehr, ob die Opposition ihr Problem des kollektiven handelns temporär lösen kann, wenn das ancien régime geschwächt ist (hale 2005, S. 138–143; Way 2008, 2009).
hale hält das eintreten von br letztlich für kontingent.10 ungelöste Nachfolgefragen schaffen lediglich ein zyklisch wiederkehrendes, strukturell bedingtes Möglichkeitsfens-ter für strategische akteure, die ihre chance auf den Zugang zur Macht verbessern wol-len, indem sie gesellschaftliche unterstützung mobilisieren. Damit können sie eventuell den Mangel an anderen ressourcen kompensieren, welche der regierenden elite wich-tige Wettbewerbsvorteile im Wahlkampf verschaffen, insbesondere an „administrativen Ressourcen“. Führt man diesen Gedanken weiter, erschließt sich, dass der Zugriff auf die ressource der Massenmobilisierung prinzipiell auch der regierenden elitengruppe zugänglich ist, die unter umständen anti-revolutionäre Gegenbewegungen organisieren kann (s. abschn. 4.1).
Daher verwundert es nicht, dass br ausnahmeerscheinungen geblieben sind. So zählt hale im postsozialistischen raum nur drei Fälle, nämlich Georgien 2003, die ukraine 2004 und Kirgistan 2005.11 Weitaus häufiger gelang es patronal-präsidentiellen Regimes, eventuell aufgekommene Gruppenrivalitäten intraelitär beizulegen und die Nachfolgere-
10 Way (2008, 2009), der ebenfalls die endogene Funktionslogik autoritärer regime betont, sieht weniger raum für Kontingenz. Für ihn sind zwei Strukturbedingungen entscheidend – die Ver-bindungen mit dem Westen (s. abschn. 4.1) und die herrschaftsorganisation.
11 Die ereignisse in Serbien 2000 (und der Slowakei 1998) sind dieser Sicht zufolge andersartige Phänomene, denn es handelt sich nicht um regime des patronalen Präsidentialismus (hale 2006, S. 307).
148 P. Stykow
gelung durch Wahlen öffentlich zu legitimieren.12 Die alternative („revolutionäre“) inter-pretation diagnostiziert nicht nur eine größere Zahl entsprechender Fälle, sondern hält sie aus theoretischen Gründen auch für wahrscheinlicher.
3.3 implikationen im Vergleich: Demokratisierungschancen
Verhelfen die bunten revolutionen der Demokratie zum Durchbruch? Für theoretiker der elektoralen revolution sind kompetitiv-autoritäre regime inhärent verwundbar, denn die inkongruenz von formal-demokratischen und informellen institutionen unterhöhlt die Legitimität der Machteliten. Sie bildet eine permanente Quelle von instabilität (howard u. roessler 2006). Immer, wenn Wahlen stattfinden, eröffnen sich Chancen für einen Demokratisierungsschub, aber auch die Gefahr eines rückfalls in die geschlossene auto-kratie. Da Wahlen die entscheidung über den ausgang des elitenwettbewerbs formal in die hand der Wähler legen, autoritäre eliten sich aber selbst rekrutieren, kann Sys-temkohärenz nur durch die abschaffung eines der beiden regelsysteme erreicht werden. entsprechend wird die postrevolutionäre annullierung des manipulierten Wahlergeb-nisses mit der etablierung sich selbst verstärkender demokratischer Spielregeln identi-fiziert. Erfolgreiche elektorale Revolutionen setzen Wahlen als wirksamen Mechanismus der Elitenselektion durch; daher konstituieren sie einen spezifischen Demokratisierungs-pfad. Dies erklärt, warum etwa McFaul (2007, S. 50) die nachweisbare Verbesserung der Demokratiequalität zu den Kernmerkmalen einer br zählt. Falls diese später nicht kontinuierlich zunimmt oder gar schwindet, ist die revolution blockiert oder gescheitert, wenn sie nicht gar durch die siegreichen Demokraten verraten wurde.
Während aus dieser Perspektive der Übergang zur Demokratie als erhebung und Selbstermächtigung einer demokratisch gesinnten Gesellschaft und ihrer repräsentanten erscheint, betrachtet der revisionistische Diskurs die Mobilisierung der bevölkerung als eine Ressource der intraelitären Auseinandersetzung. Gewissermaßen im Schatten eines solchen Massenprotests können Verhandlungen, Kompromisse und die Vereinbarung von Spielregeln für die konkurrierenden eliten attraktiv werden, ganz wie die transitions-forschung im Sinne einer „zweitbesten Lösung“ argumentiert hat (Przeworski 1992). Wenn eine bunte revolution ein Kräftepatt produziert, schafft sie die chance für einen Pakt zwischen den eliten über die institutionelle Verteilung von Macht. Ob daraus wirk-lich Demokratie erwächst, ist aber nicht vorherzusagen, und ob die betreffenden akteure Demokraten sind, ist nicht relevant für das ergebnis. Mehr noch: Die eigentümliche Ver-bindung formal-demokratischer institutionen und informeller Praktiken bringt zwar zyk-lisch wiederkehrende Gelegenheiten für Regimekrisen hervor, nicht aber zwangsläufig eine Übergangskrise zur Demokratie. bunte revolutionen zeigen lediglich an, dass die eliten intern keine gewaltfreie Lösung für die Frage gefunden haben, wer der neue inha-ber des politischen Spitzenamtes sein soll. Ob danach also eine Demokratisierung statt-
12 Prominente beispiele dafür sind die beiden amtswechsel von russischen Präsidenten (2000, 2008), der Machtwechsel in aserbaidschan 2003, wo der kranke, aber hinreichend populäre Präsident kurz vor der Wahl zugunsten seines Sohnes retirierte, und die Wahl eines neuen turk-menischen Präsidenten, auf den sich die eliten im Jahre 2007 innerhalb kürzester Frist einigten, nachdem der bisherige amtsinhaber unerwartet verstorben war.
149„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
findet, indiziert weder Erfolg noch Scheitern der Revolution, denn ihre Funktion besteht lediglich darin, die reproduktionskrise des regimes aufzulösen (hale 2005, S. 161; Way 2009, S. 90).
im unterschied zur revolutionären interpretation hält diese Sichtweise die inkongru-enz zwischen formal-demokratischen basisinstitutionen und personalisierten Mustern der eliteninteraktion für eine funktionale eigenschaft neopatrimonialer regime. Sie wird nur dann zum Stabilitätsrisiko, wenn die eliten gespalten sind und gleichzeitig Wahlen anstehen. hale (2006, S. 311–316) entwirft mehrere mögliche Szenarien für die weitere entwicklung nach dem ende elektoraler revolutionen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das regime reproduziert, ohne seinen hybriden charakter zu verlieren (beispiel Georgien). auf klientelistischem Wege lässt sich die neu errungene politische Macht weitaus einfacher stabilisieren als durch die formale institutionalisierung von rechts-staatlichkeit und Demokratie, weil Privilegien (um-)verteilt und Sanktionen angedroht oder abgewendet werden können. Selbst demokratisch gesinnte amtsinhaber könnten gezwungen sein, sich der Wirkungsmächtigkeit informeller institutionen zu beugen, um sich an der Macht zu halten. Möglicherweise gelingt es auch nicht, die elitenspaltung zu überwinden, und dann dauert die regimeinstabilität fort (beispiel Kirgistan). ein drit-tes Szenario führt zur abschaffung von Wahlen und damit des sich zyklisch öffnenden Einfallstors für Instabilität. Das autoritäre System schließt sich; Kongruenz wird zuun-gunsten formal-demokratischer institutionen hergestellt. Falls aber Verrechtlichung und formale institutionalisierung der Zugänge zur politischen Macht gelingen, eröffnet sich eine vierte Option mit unsicheren aussichten einer gradualistischen Demokratisierung infolge eines elitenpakts (beispiel ukraine). Nur dann ist eine postrevolutionäre Demo-kratisierung, und zwar „via revolutionary stalemate“, denkbar (hale 2006, S. 315; s. auch Kubicek 2009).
Diese Schlussfolgerungen sind konsonant mit befunden über neopatrimoniale bzw. personalistische autoritäre regime in anderen Weltregionen: Diese erscheinen zwar über-all als besonders anfällig für revolutionen, aber die chancen ihrer Demokratisierung ste-hen nicht günstig (bratton u. van de Walle 1997, S. 82–89; Geddes 1999; Snyder 1992).
4 Bunte Revolutionen in einer globalisierten Welt
4.1 endogene, exportierte, diffundierte revolutionen?
In der internationalen Öffentlichkeit waren die Bunten Revolutionen auf große Resonanz gestoßen. Während beispielsweise die deutschen Medien sie als autonomes Aufbegeh-ren einer demokratisch gesinnten bevölkerung kommunizierten, wurden sie in russland überwiegend als manifeste (uS-amerikanische, darunter geheimdienstliche) einmi-schungsversuche in innen- und regionalpolitische Prozesse kritisiert. in der uS-Öffent-lichkeit wiederum präsentierte man die BR als Beleg für die Legitimität und Effizienz der Demokratieexport-Politik der bush-administration (beissinger 2006: 1–2).
150 P. Stykow
Westliche Wissenschaftler weisen thesen des revolutionsexports einhellig zurück (herd 2005a, S. 13).13 realistischerweise müsse man anerkennen, dass an den br zu viele Akteure beteiligt waren, als dass man sie von außen hätte koordinieren können; dass diese akteure keine diszipliniert arbeitsteiligen Strategien verfolgten; dass der ein-fluss von Geheimdiensten, Medien und „Polittechnologen“ überschätzt werde und dass weder der Westen noch russland in der postsozialistischen region eine konsistente Poli-tik verträten.
internationale aspekte der br werden mit zunehmendem abstand zu den ereignissen immer stärker zum thematischen Mittelpunkt der Debatte. einerseits geht es darum, den Zusammenhang von endogenen und exogenen Faktoren in Demokratisierungsprozessen der Gegenwart theoretisch befriedigend zu modellieren. andererseits sollen angemessene Strategien der Demokratieförderung formuliert, also praxisrelevante Forschungsergeb-nisse erbracht werden.
Über die Bedeutung internationaler Einflüsse auf die BR herrschen unterschiedliche auffassungen. Viele autoren fassen sie als intervenierende Faktoren. Systematische Differenzen ergeben sich dabei nicht in erster Linie aus den kontroversen bewertungen der ereignisse als Demokratieschub oder aber reproduktionsmodus neopatrimonialer regime. Sie sind vielmehr (meta-)theoretischer Natur. in der theorie der elektoralen revolution McFauls (2007) kommt externen Faktoren nur dann bedeutung zu, wenn nationale Akteure bereit sind, von außen kommende Ideen und Ressourcen aufzuneh-men. Das Gegenstück zu dieser stärker akteurszentrierten interpretation stellt Lucan Ways (2008, 2009) eher strukturalistische Deutung dar: Weil br aus der Funktionslo-gik neopatrimonialer kompetitiv-autoritärer regime erwachsen, zählt in erster Linie die Kapazität des ancien régime. ihre relevanz kann aber durch die geographische Nähe zu Westeuropa ( linkage; vgl. Levitsky u. Way 2006) modifiziert werden, welche Inten-sität und Formen westlicher Einflussnahme auf die postsowjetischen Länder bestimmt. anders als in den ostmittel- und südeuropäischen Nachbarländern der eu, wo keines der postsozialistischen (semi-)autoritären regime die 1990er Jahre überlebte, hing in den low-linkage-Nachfolgestaaten der Sowjetunion die regimestabilität entscheidend von innenpolitischen Faktoren ab (Way 2008, S. 60–62).
Im Gegensatz zu diesen beiden Varianten der Modellierung externer Einflüsse als inter-venierende Faktoren stehen interpretationen, die in elektoralen revolutionen keine unab-hängig voneinander auftretenden und endogen verursachten ereignisse sehen, sondern eine ereigniswelle im Sinne Samuel huntingtons (1991, S. 13–26). ihre Ähnlichkeiten und ihre zeitliche Nähe werden deshalb mit „Diffusion“ als einem transnationalen ein-flussfaktor erklärt, womit die geographische Ausbreitung von neuen Ideen, Institutionen, Politiken, Modellen oder Verhaltensrepertoires innerhalb oder zwischen Ländern gemeint ist (bunce u. Wolchik 2006b, S. 286; vgl. brinks u. coppedge 2006; Kopstein u. reilly 2003). im konkreten Fall geht es um ein komplexes „Modell der elektoralen Demokrati-sierung“, das ein aufeinander bezogenes bündel von Strategien zur Wählermobilisierung, der Organisation einer handlungsfähigen Opposition und der Überwachung des Wahlver-laufs umfasst (bunce u. Wolchik 2006b, S. 294–296; beissinger 2007, S. 261; dagegen
13 in der russischen Politikwissenschaft ist dies umstritten (s. etwa Kara-Murza 2005; herd 2005a, b).
151„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
aber Way 2008). betont wird, dass es sich um zielgerichtet unternommene Modellemu-lation handelt und nicht um einfache ansteckungseffekte durch „herdenverhalten“ oder infolge geographischer Nachbarschaft.
bemerkenswert ist insbesondere Marc beissingers (2002, 2007) ansatz für die analyse von revolutionären, nationalistischen und demokratischen Massenmobilisierungen, die er als „modulare Phänomene“ bezeichnet. er integriert endogene und exogene sowie akteurs-bezogene und strukturelle Faktoren und löst zudem das methodologische Problem, wie erklärungsfaktoren theoretisiert werden können, deren Wirkung nicht konstant ist. bei der Modellemulation übernehmen lokale akteure Strategien und repertoires von Mobilisie-rungsereignissen, die zu früheren Zeitpunkten und an anderen Orten stattgefunden haben, nutzen sie und passen sie den Gegebenheiten an. Voraussetzung dafür ist, dass sie institu-tionelle, historische, kulturelle oder situative Gemeinsamkeiten zwischen den jeweiligen Kontexten wahrnehmen, um analogieschlüsse zu ziehen, und dass sie Lernen aus fremden erfahrungen ( lesson-drawing) für sinnvoll halten. andere akteure, die mit diesem Modell bereits erfolgreich waren, unterstützen sie dabei aus vorwiegend strategischen Gründen.
Die erfolgswahrscheinlichkeit revolutionärer Demokratisierungsversuche hängt aus dieser Sicht weitgehend von ihrer temporalen Verortung in der modularen ereigniskette ab, weil sich dadurch die Wirkung weiterer bedingungen verändert. So siegten die ersten br in Ländern, in denen günstige endogene Struktur- und akteursfaktoren vorlagen. in Ländern mit ungünstigeren strukturellen bedingungen stiegen die chancen der revolu-tionären akteure, wenn sie das erfolgsmodell der early risers übernahmen. bei den late risers wiederum war die reaktion der Machteliten entscheidend: Wären sie demoralisiert gewesen und Forderungen der Opposition entgegengekommen, so hätte die Protestmo-bilisierung ihr Ziel erreicht, wie etwa das historische beispiel der Welle nationalistischer Mobilisierungen zeigt, die seinerzeit zum Zusammenbruch der Sowjetunion geführt hatte (beissinger 2002). Die Welle der bunten revolutionen zu beginn des 21. Jahrhunderts aber versiegte bald, denn auch die eliten lernten aus den erfahrungen der frühen Fälle. Sie unterdrückten die einheimische Opposition mehr oder weniger subtil, versuchten, sie von westlicher unterstützung abzuschneiden, initiierten anti-revolutionäre Gegenbewegungen unter der Jugend und reduzierten die Kompetitivität des politischen Prozesses durch insti-tutionelle reformen.14 Dass sich der Modus der elektoralen Demokratisierung bereits wie-der erschöpft haben könnte, ist demnach eine der kontingent-zwangsläufigen Folgen der modularen Prozessdynamik (beissinger 2007, S. 273; bunce u. Wolchik 2006b, S. 300).
Diese interpretation wirft ein interessantes Licht auf die weiter oben angesprochene Frage nach dem Verhältnis von structure und agency: einerseits steht sie in der tradition der integration beider Faktorengruppen, andererseits betont sie kontextabhängige bedeu-tungsunterschiede. aufgrund einer günstigen Platzierung innerhalb einer ereigniskette kann die modulare Dynamik selbst Länder mit strukturell ungünstigen ausgangsbedin-gungen erfassen. Möglicherweise täuschen sich teilnehmer und beobachter dadurch aber zunächst über fehlende (Vor-)bedingungen der Demokratie hinweg (beissinger 2006, S. 88), die in der postrevolutionären Phase an Gewicht gewinnen.
14 Als exemplarisch dafür kann die russische Innen- und Regionalaußenpolitik in Putins zweiter amtszeit angesehen werden (z. b. ambrosio 2007; blum 2006; etkind u. Shcherbak 2008; hale 2006, S. 318–320; herd 2005a, b; Saari 2009; Schwirtz 2007; Silitski 2005).
152 P. Stykow
4.2 implikationen im Vergleich: Demokratieförderung
Neben der theoriebildung über den Zusammenhang endogener und exogener Demokrati-sierungsfaktoren ermöglichen die br auch einsichten in theorie und Praxis der Demokra-tieförderung, die in den letzten Jahren intensiv geführt wird.15 thomas carothers (2009) unterscheidet dabei zwei unterschiedliche Strategien: Der „politische ansatz“ ( political approach) fokussiert auf ein stark institutionalistisches Demokratiekonzept und auf Demo-kratisierung als konflikthaften Prozess. Deshalb werden in erster Linie politische Schlüs-selinstitutionen – Wahlen, politische Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen – direkt gefördert, zudem häufig anlässlich kritischer Situationen. Der „Entwicklungsan-satz“ ( developmental approach) hingegen beruht auf einem breiteren Demokratiekonzept, das auch Normen wie Gleichheit und Gerechtigkeit einschließt. Demokratisierung wird als gradualistischer Wandlungsprozess verstanden, in dem politische und sozioökonomi-sche entwicklungen ineinandergreifen. Deshalb wird für indirekte Methoden der Demo-kratieförderung plädiert, was erstens Entwicklungshilfe im weiteren Sinne einschließt und zweitens die „technokratische“ unterstützung von Prozessen der Staatsbildung und der good governance betont. Gegenüber der regierung des empfängerlandes sollen part-nerschaftliche beziehungen angestrebt und Konfrontationen vermieden werden. Für die Förderung zivilgesellschaftlicher Organisationen wird der lokalen gegenüber der natio-nalen ebene, sozialen bzw. ökonomischen gegenüber politischen oder watchdog-themen der Vorzug gegeben. Weil sie als universeller gelten, werden eher Menschenrechte als demokratische Werte betont. Dieser ansatz liegt oft den Strategien europäischer akteure zugrunde, während der politische ansatz typisch für die uS-amerikanische Demokratie-förderung ist. Welche Strategie erfolgreicher ist, hängt von den Kontextbedingungen ab.
Das Wirken externer akteure bei der Vorbereitung und Durchführung der br ist ein beispiel für die implementation des politischen ansatzes der democracy assistance (carothers 2009, S. 11–12): Oppositionelle akteure – in erster Linie NGOs – erhielten direkte finanzielle und moralische Unterstützung, Trainings und Beratungen; unabhän-gige Medien und Wahlbeobachter wurden gefördert, um faire Wettbewerbsbedingungen für demokratische akteure zu sichern (z. b. anable 2006; bunce u. Wolchik 2006c; Gal-breath 2009; McFaul 2007; Stewart 2009; Wallander 2005; Wilson 2006). auffällig war das effiziente transnationale Revolutionsmanagement: Eine Gruppe serbischer Aktivis-ten, die ihr Know-how einer politikwissenschaftlich fundierten handlungsanleitung und dem training durch eine uS-amerikanische NGO verdankte16, beriet nach ihrem erfolg gegen Milošević Gleichgesinnte in Georgien und der Ukraine, aber auch in weiteren Län-dern wie albanien, Ägypten, russland und Simbabwe. So entstanden bewegungsorga-nisationen, die sich auf elektorale revolutionen in anderen Ländern bezogen und sich
15 Für einen allgemeinen Überblick über die Diskussion zum thema Demokratieförderung und weitere Nachweise s. burnell (2008); carothers (2006, 2009).
16 Das albert-einstein-institut macht u. a. Gene Sharps „From Dictatorship to Democracy“ allge-mein zugänglich, das erstmals 1993 in thailand publiziert wurde, um Dissidenten aus birma bei der Organisation gewaltfreier Protestaktionen zu unterstützen. eigenen angaben zufolge fördert es den Einsatz gewaltfreier Strategien der Konfliktlösung in mehreren Ländern der Erde (AEI 2008). Kritikern gilt es als instrument der bush-administration und/oder der cia.
153„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
einer verwandten Symbolik und rhetorik bedienten (beissinger 2007, S. 262; bunce u. Wolchik 2006c; hale 2006, S. 316–317; Wilson 2006, S. 27–28).
interessant sind die Schlussfolgerungen aus diesen bestandsaufnahmen: Die anre-gung zweier Freedom-House-repräsentanten (Karatnycky u. ackerman 2005), ange-sichts mehrerer siegreicher elektoraler revolutionen den politischen ansatz bis hin zur aktiven Destabilisierung autoritärer regime zuzuspitzen, bleibt eine einzelmeinung. als Lehre aus den bunten revolutionen folgt eher die empfehlung, auf den developmental approach umzuschwenken. So plädiert McFaul (2007, S. 82–83) beispielsweise für kons-truktive zwischenstaatliche beziehungen zu semi-autoritären regimes. Westliche ent-wicklungshilfe soll anreize setzen, gegenüber der Opposition keine Gewalt anzuwenden. Auch technologische und finanzielle Transfers zur Aufdeckung von Wahlbetrug sowie die Kommunikation internationaler Normen seien geeignete instrumente, weil schwerer zu unterbinden als die direkte unterstützung von oppositionellen Parteien und bewegungen. Der Westen könne damit der autoritären Schließung des politischen Systems entgegen-wirken und Organisationsbestrebungen der Zivilgesellschaft fördern. inzwischen liegen auch erste Studien (z. b. Stewart 2009 m. w. N.) vor, die einen Wandel der Strategien der externen Demokratieförderung nach den br dokumentieren: tatsächlich wird nicht nur eine Zunahme der eingesetzten Mittel, sondern auch eine Schwerpunktverschiebung weg von der Zivilgesellschaft hin zu staatlichen akteuren beobachtet – und damit eine Zurückstellung des Projekts der Demokratisierung.
Strategien der gradualistischen, indirekten Demokratieförderung werden unterschied-lich begründet. eine erste argumentationslinie betont die entscheidende bedeutung endogener Demokratisierungsfaktoren – ob die eliten gespalten seien, die Opposition sich vereinige und der Amtsinhaber unpopulär werde, könne von außen nicht beeinflusst werden (McFaul 2007, S. 81); externe Demokratieförderung sei „only at the margins“ bedeutsam (bunce u. Wolchik 2006b, S. 301). andere autoren greifen traditionelle ein-wände gegen revolutionäre Massenmobilisierungen (s. abschn. 2.2) wieder auf: Der Demokratisierung weitaus abträglicher als eine lediglich zögerliche entwicklung der Zivilgesellschaft sei eine gewaltsam niedergeschlagene revolution (beissinger 2006). Die Gefahr unkontrollierbarer Gewaltausbrüche liegt für hale (2006, S. 320–326) darin, dass nicht nur beobachter und externe akteure, sondern auch die autoritären akteure vor Ort falsche Vorstellungen über die ursachen bunter revolutionen hegen: Sie vermute-ten sie in der vom Westen geförderten Zivilgesellschaft und repressierten diese deshalb. Damit vernichteten sie aber die einzigen akteure, die Massenproteste gegebenenfalls in friedliche bahnen lenken könnten.
Die dritte Gruppe von Argumenten zielt darauf, dass der politische Ansatz ineffizient ist, wenn er gegenüber semi-autoritären regimes angewandt wird, die ihn abwehren. Dieser in den vergangenen Jahren beobachtete backlash against democracy promotion (carothers 2006; Gershman u. allen 2006) erklärt sich demnach zum teil dadurch, dass in den postsowjetischen Ländern auf den political approach gesetzt wurde (z. b. beis-singer 2006; Lane 2009, S. 132; Saari 2009; Stewart 2009, S. 807–808). Der direkte Demokratieexport werde aber als ausländischer interventionsversuch gedeutet. Wenn Menschenrechtsorganisationen sich als dezidiert politische oder gar revolutionäre Organisationen präsentierten und von westlicher Finanzierung abhingen, würden sie unglaubwürdig.
154 P. Stykow
Damit wird die seit Jahren bekannte einsicht in die Notwendigkeit einer kontextsen-sitiven und flexiblen Demokratieförderung konkret vertieft. Das Erkenntnispotential, das in der revisionistischen interpretation von br mit ihrem Fokus auf die Funktions-logik neopatrimonialer kompetitiv-autoritärer regime liegt, wird dabei aber bisher nicht erschlossen. es kann hier nur angedeutet werden: Demokratisierung zielt auf die auf-hebung der inkongruenz zwischen formalen und informellen institutionen, die für diese regime charakteristisch ist und im Normalfall deren Funktionserfüllung ermöglicht – personalistische Mechanismen der herrschaftssicherung werden durch demokratische, unpersönliche, rechtsstaatliche Mechanismen ersetzt. Der political approach stößt hier an seine Grenzen, wenn er einen transfer formal-demokratischer institutionen gegen den Willen der regierenden eliten forciert: unter bedingungen, da der Zugang zur Politik faktisch nicht allen bürgern offen steht, sondern personalistisch reguliert ist, beschränken sich Partizipation, Wettbewerb und Konsensbildung substantiell auf die eliten. Die ein-führung formal-demokratischer Institutionen ändert das nicht zwangsläufig. Die Eliten sind vielmehr in der Lage, sie unter rückgriff auf informelle institutionen zu neutralisie-ren, wenn ihre regelgerechten Wirkungen den Machtinteressen der regierenden Koalition zuwiderlaufen, d. h. die Wirkungsweise der „fremden“ institutionen wird an die Funk-tionslogik des regimes angepasst.
Dies betrifft Wahlen, deren implementation nicht mit der einführung von Demokratie identisch ist (carothers 2002, S. 7–8; s. auch North et al. 2009, S. 137–140), weil sie normalerweise die Funktion der elitenselektion nicht erfüllen, aber auch andere institu-tionen, so etwa die Zivilgesellschaft. akteure, die im ergebnis von br an die regierung kommen, werden unter umständen lediglich andere Organisationen als ihre amtsvor-gänger privilegieren, indem sie ihnen Zugänge zur Politik eröffnen. Dies legt nicht nur die von hale skizzierte Logik der regimereproduktion nahe, sondern scheint sich auch in empirischen analysen zu bestätigen. Dabei zeigt sich, dass sich selbst die westliche Demokratieförderung an die neopatrimoniale Logik angepasst hat: Der bottom-up-ansatz der Förderung zivilgesellschaftlicher Organisationen im Zeitraum vor den br schuf ein Segment privilegierter NGOs mit personalistisch vermitteltem Zugang zu westlicher unterstützung, während andere Gruppen davon ausgeschlossen blieben (Stewart 2009, S. 813–815; exemplarisch für Georgien: Muskhelishvili u. Jorjoliani 2009). Der jüngste Strategiewechsel in der Demokratieförderung erklärt sich deshalb zum teil auch durch den Wechsel ihrer ursprünglichen adressaten auf staatliche Positionen in Staat und Ver-waltung und das Fehlen struktureller Verankerungen in der Zivilgesellschaft (Stewart 2009, S. 815, 817).
5 Zusammenfassung und Ausblick
5.1 bunte revolutionen: Modi der Demokratisierung oder der autoritären reproduktion?
Wie ich gezeigt habe, werden mit den bunten revolutionen die nämlichen empirischen ereignisse gegensätzlich interpretiert – als Modus des demokratischen Durchbruchs oder aber der reproduktion autoritärer Systeme. Die unterschiede erklären sich erstens aus
155„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
einer vortheoretischen entscheidung über das Forschungsinteresse: Die erste Sichtweise richtet ihren Suchfokus auf erfolgversprechende Demokratisierungspfade unter Globa-lisierungsbedingungen, die zweite auf die Funktions- und reproduktionsweise nicht-demokratischer regime. Während sich erstere in die über fünfzigjährige tradition der empirisch-analytischen Systemwechselforschung einschreibt, leistet letztere einen bei-trag zu einer gegenwärtig neu entstehenden politikwissenschaftlichen Subdisziplin, die sich mit der vergleichenden analyse von autokratien befasst.
Zweitens schließen beide Interpretationen partiell an das Forschungsprogramm der tran-sition-to-democracy-Schule an, unterscheiden sich aber danach, welche ihrer angebote sie rezipieren. Die Deutung als elektorale revolutionen distanziert sich von der gradua-listischen, elitistischen und rationalistischen Vorstellung, derzufolge individuelle akteure oder kleine Gruppen ohne normative bindung die Demokratie einführen können, behält aber den Demokratisierungsfokus bei. Die interpretation der br als Modus der regime-reproduktion wiederum gibt letzteren weitgehend auf, betont jedoch die bedeutung von eliten und ihren interaktionen. Der extreme agency-Fokus des transitionsdiskurses wird durch beide interpretationen aufgehoben, wobei die reproduktionskrisen-Deutung struk-turelle Faktoren insgesamt stärker betont als ihre alternative. Gerade sie leistet damit auch einen wichtigen beitrag zur Überwindung zweier angemahnter Desiderate der Demokratisierungsforschung (Grzymala-busse u. Luong 2006, S. 663–664): typus und Kapazität des Staates werden ebenso wie informelle institutionen nicht nur erwähnt, son-dern als zentrale erklärungsfaktoren modelliert.
Dies zeigt sich drittens im konzeptionellen Zugriff der revisionistischen interpreta-tion, die ein hybrides politisches System als „regime des patronalen Präsidentialismus“ beschreibt. aufgrund der neopatrimonialen Muster der herrschaftsorganisation erscheint das jeweilige regime mitunter als geschlossen autoritär, zu bestimmten Zeitpunkten (angesichts einer ungelösten Nachfolgefrage) aber als hochkompetitiv. Wahlen können dabei ausnahmsweise als „demokratische Methode“ der elitenselektion wirken, erfüllen diese Funktion jedoch normalerweise nicht, weil sie von informellen, personalistischen Mechanismen außer Kraft gesetzt werden. Die revolutionäre Interpretation hingegen bestimmt das politische System eher eindimensional als hybrid zwischen Demokratie und autokratie und fragt nicht detailliert nach den Funktionen von Wahlen.
Viertens wird das Potential erfolgreicher br unterschiedlich bewertet: im rahmen der Systemwechselforschung erscheinen sie primär als – entweder auch künftig bedeutungs-voller oder aber bereits wieder erschöpfter – Demokratisierungspfad für latecomer unter den bedingungen der Globalisierung. erfolgreiche bunte revolutionen führen zu einem Demokratisierungsschub, weil sie Wahlen als Methode der elitenselektion installieren und damit gewissermaßen founding elections durchsetzen. Die alternative Perspektive lehnt diese Sicht hingegen ab. Es handele sich vielmehr um einen spezifischen Modus der reproduktion semi-autoritärer Systeme, von dem inhärent keine impulse für eine Demokratisierung ausgehen. Dies könnte nur indirekt der Fall sein, wenn im ergebnis der revolution eine Pattsituation unter den rivalisierenden elitengruppen entstünde, die Pakte zwischen ihnen erzwänge.
Fünftens leisten beide interpretationsweisen beiträge zum Verständnis des Zusam-menhangs zwischen endogenen und exogenen Einflussfaktoren, einem der hochaktuel-
156 P. Stykow
len politikwissenschaftlichen themen nicht nur der Demokratisierungsforschung, und ermöglichen neue einsichten für die Demokratieförderung durch westliche Staaten.
Welche der angebotenen Perspektiven ist fruchtbarer? beide sind konzeptionell und theoretisch hinreichend konsistent, und sie sind durch ähnliche konzeptionelle Deside-rata (s. insbesondere Fn. 8, 9) belastet. Empirisch größere Plausibilität kann, zumindest gegenwärtig und für den postsowjetischen raum, die Deutung als autoritäre reprodukti-onskrise beanspruchen, setzt man den Grad der erreichten Demokratisierung mindestens vier Jahre nach der revolution als Kriterium an. ein demokratischer Durchbruch wird für Serbien konstatiert, ist aber in allen anderen Ländern ausgeblieben, die als unstrit-tige Fälle für br gelten.17 Die auffällige Gegensätzlichkeit der beiden interpretationen wirft zum einen die methodologische Frage auf, ob Massenproteste gegen mutmaßlich gefälschte Wahlergebnisse in nicht-demokratischen Ländern – die auch in jüngster Zeit weltweit zu beobachten sind (z. b. iran 2009) – als Phänomene derselben ereignisklasse angesehen werden können oder nicht. Zum anderen folgen aus der Zuordnung (genauer:Konstruktion) der Fälle ganz offensichtlich unterschiedliche erklärungen und politisch relevante Schlussfolgerungen. insgesamt überrascht es, dass die interpretation der br als autoritäre reproduktionskrise in den letzten beiden Jahren kaum noch auf aufmerk-samkeit gestoßen ist, während die Diskussion über die Ereignisse und ihre Folgen weiter anhält. Damit werden Denkanstöße von beträchtlichem Wert ignoriert.
5.2 Area studies und comparative politics
Abschließend sei auf eine innerwissenschaftliche Dimension der Debatte über die Bunten revolutionen verwiesen: Sie handelt auch von der identitätssuche einer regionalwissen-schaft, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleichermaßen geographisch wie politisch definiert hatte (King 2000). Osteuropaforschung bzw. „Sowjetologie“ war zunächst Kommunismus- und später transformationsforschung. Nach dem Zusammen-bruch des Staatssozialismus wurde die Frage nach ihrer Zukunft und ihrem Verhältnis zu den comparative politics Gegenstand einer intensiven Debatte in der uS-amerikanischen Politikwissenschaft.18 Von zentraler bedeutung waren dabei methodologische Probleme: Stellten die Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika und Ost(mittel)europa gleich-artige Phänomene dar, und waren dekontextualisierte rational-choice-theorien, auf welche die transition-to-democracy-Schule zurückgriff, überhaupt anwendbar? Welche analytische existenzberechtigung können Subdisziplinen beanspruchen, die ihren For-schungsgegenstand geographisch definieren? Immer deutlicher tritt dabei hervor, dass der hintergrund der Diskussion eine Kernfrage der Politikwissenschaft betrifft: Wie können raum-Zeit-bedingungen für das Wirken von Kausalbeziehungen aufgespürt und in eine
17 Differenziert und skeptisch etwa Flikke (2008); Kuzio (2008); Lane (2009); Mitchell (2006); Stewart (2009); tudoroiu (2007).
18 Vgl. die auseinandersetzungen zwischen komparatistischen „transitologen“ und regionalex-perten Mitte der 1990er Jahre (bunce 1998 m. w. N.) und die aktuelle Diskussion um die post-communism studies (z. b. chen u. Sil 2007; King 2000; Pierson 2003). auch in der deutschen Osteuropaforschung fand diese Diskussion einen, allerdings schwächeren, Widerhall (s. meh-rere beiträge in Osteuropa, 1998–1999).
157„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
anspruchsvolle theoriebildung eingehen, die sich von universalistischen Generalisierun-gen entfernt?
Für die Zukunft der Osteuropaforschung zeichnen sich dabei drei Varianten ab: ers-tens wird eine besondere Dynamik der region behauptet, die auf distinkten, systematisch anzutreffenden Kausalmustern beruht – was innerhalb der Vergleichenden Politikwissen-schaft als legitime begründung für eine regional konstruierte analyseeinheit gilt (Main-waring u. Pérez-Liñán 2007). Dies zeigt sich z. B. in der Konzeptualisierung von Spezifika der postkommunistischen transformation als eines multidimensionalen Systemwechsels (z. b. Kuzio 2001; roeder 1999)19, der Modellierung eines eigentümlichen Übergangs-pfads zur Demokratie in Gestalt der „friedlichen revolutionen“ 1989 (z. b. McFaul 2002) und der bedeutung von Leninist legacies (zuerst Jowitt 1992). auch einige beiträge des dominanten Diskurses, in dem bunte revolutionen als Vollendung der Systemwechsel von 1989 gedeutet werden, zielen auf Konzeptbildung im rahmen von postcommunism studies als einer regionalwissenschaft, die gleichwohl in die comparative politics inte-griert ist.
ein zweiter Strang innerhalb des interpretativen Mainstreams der br sprengt den refe-renzrahmen der postsozialistischen region: bunce, die in den 1990er Jahren die eigen-ständigkeit von area studies gegenüber „Komparativisten“ noch vehement verteidigt hatte, konstatiert für die 1990er Jahre nachlassende „regionalität“ (bunce u. Wolchik 2006b, S. 284–285). Dies ist konsonant mit anderen autoren, die für die postsozialistischen Länder einen „return to diversity“ beschreiben und erklären (z. b. Kitschelt 2003; Kopstein u. reilly 2000; Møller u. Skaaning 2009). Wenn die bunten revolutionen also als tenden-ziell globaler Demokratisierungsmodus konzeptualisiert werden, so löst sich die bisherige regionalwissenschaft bezüglich dieses Problems in global vergleichenden democratiza-tion studies auf. Gleichwohl legt diese Sichtweise durchaus Forschungsdesigns mit regio-nal konstruierten Fallgruppen nahe. So wirkt transnationale Diffusion zwischen mehr oder weniger benachbarten Ländern am stärksten (Mainwaring u. Pérez-Liñán 2007).
eine dritte Variante, die in der interpretation der br als Modus der regimereproduk-tion aufscheint, reagiert auf die nachlassende regionalität des postsozialistischen raums zunächst mit der Konstruktion einer Subregion als Gegenstand von area studies: Neo-patrimoniale Regime sind hier nur in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (außer in den baltischen Republiken) zu finden. De facto aber überwindet dieser Diskussionsstrang perspektivisch die bisherige regionale Fokussierung, weil dieser regimetyp auch in anderen Weltregionen zu beobachten ist. Er schließt damit deutlich an die Vergleichende autoritarismusforschung an, die sich innerhalb der comparative politics gegenwärtig als systematische Subdisziplin konstituiert (vgl. Köllner 2008). eines ihrer wichtigsten aktu-ellen themen sind Wahlen in Semi-autokratien und autokratien (z. b. brownlee 2009; Gandhi u. Lust-Okar 2009). Das erkenntnispotential, das der postsowjetische raum – weit über die bunten revolutionen hinaus – birgt, ist aus dieser Perspektive noch kaum erschlossen.
19 Sie knüpft an das transformationstheoretische „Dilemma der Gleichzeitigkeit“ an, betont aber – anders als seinerzeit elster (1990) und Offe (1994) – eher die Simultanität mehrerer langfris-tiger, interagierender und partiell widersprüchlich verlaufender Prozesse als ihr Obstruktions-potential.
158 P. Stykow
Literatur
aei. 2008. albert einstein institution. http://www.aeinstein.org/. Zugegriffen 22. aug. 2009.ambrosio, thomas. 2007. insulating russia from a colour revolution: how the Kremlin resists
regional democratic trends. Democratization 14(3):232–252.Anable, David. 200�. The role of Georgia′s media – and western aid – in the Rose Revolution. The
International Journal of Press/Politics 11(3):7–43.Åslund, Anders, und Michael McFaul. 200�. Introduction: Perspectives on the Orange Revolution.
in Revolution in Orange. The origins of Ukraine′s democratic breakthrough, hrsg. anders Åslund und Michael McFaul, 1–8. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
Barsamov, Vladimir A. 200�. „Cvetnye revoljucii“: Teoretičeskij i prikladnoj aspekty. Sociolo-gičeskie Issledovanija 8:57–66.
beissinger, Mark r. 2002. Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet state. cambridge: cambridge university Press.
beissinger, Mark r. 2006. Promoting democracy: is exporting revolution a constructive strategy? Dissent, Winter 2006, 84–89.
beissinger, Mark r. 2007. Structure and example in modular political phenomena: the diffusion of bulldozer/rose/Orange/tulip revolutions. Perspectives on Politics 5(2):259–276.
beissinger, Mark r. 2009. an interrelated wave. Journal of Democracy 20(1):74–77.Blum, Douglas W. 200�. Russian youth policy: Shaping the nation-state′s future. SAIS Review
26(2):95–108.bogaards, Matthijs. 2009. how to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral
authoritarianism. Democratization 16(2):399–423.bratton, Michael, und Nicolas van de Walle. 1997. Democratic experiments in Africa. Regime tran-
sitions in comparative perspective. cambridge: cambridge university Press.brinks, Daniel, und Michael coppedge. 2006. Diffusion is no illusion: Neighbor emulation in the
third wave of democracy. Comparative Political Studies 39(4):463–489.brooker, Paul. 2000. Non-democratic regimes. Theory, government and politics. houndmills: Mac-
millan Press.brownlee, Jason. 2009. Portents of pluralism: how hybrid regimes affect democratic transitions.
American Journal of Political Science 53(3):515–532.bunce, Valerie. 1998. regional differences in democratization: the east versus the south. Post-
Soviet Affairs 14(3):187–211.bunce, Valerie J., und Sharon L. Wolchik. 2006a. Favorable conditions and electoral revolutions.
Journal of Democracy 17(4):5–18.bunce, Valerie J., und Sharon L. Wolchik. 2006b. international diffusion and postcommunist elec-
toral revolutions. Communist and Post-Communist Studies 39:283–304.bunce, Valerie J., und Sharon L. Wolchik. 2006c. Youth and electoral revolutions in Slovakia, Ser-
bia, and Georgia. SAIS Review 26(2):55–65.burnell, Peter. 2008. From evaluating democracy assistance to appraising democracy promotion.
Political Studies 56(2):414–434.carothers, thomas. 2002. the end of the transition paradigm. Journal of Democracy 13(1):5–21.carothers, thomas. 2006. the backlash against democracy promotion. Foreign Affairs
85(2):55–68.carothers, thomas. 2009. Democracy assistance: Political vs. developmental? Journal of Demo-
cracy 20(1):5–19.chen, cheng, und rudra Sil. 2007. Stretching postcommunism: Diversity, context, and compara-
tive historical analysis. Post-Soviet Affairs 23(4):275–366.colomer, Josep M. 2000. Strategic transitions. Game theory and democratization. baltimore: the
Johns hopkins university Press.
159„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
D′Anieri, Paul. 200�. Explaining the success and failure of post-communist revolutions. Communist and Post-Communist Studies 39:331–350.
elster, Jon. 1990. the necessity and impossibility of simultaneous economic and political reform. in Philosophy of social choice, hrsg. Piotr Ploszajski, 309–316. Warsaw: iFiS Publishers.
erdmann, Gero, und ulf engel. 2007. Neopatrimonialism reconsidered: critical review and elabo-ration of an elusive concept. Commonwealth and Comparative Politics 45(1):95–119.
etkind, alexander, und andrei Shcherbak. 2008. the double monopoly and its technologists: the russian preemptive counterrevolution. Demokratizatsiya 16(3):229–239.
Fairbanks, charles h. 2007. revolution reconsidered. Journal of Democracy 18(1):42–57.Fisun, Aleksandr. 200�. Političeskaja ėkonomija „cvetnych revoljucij“: Neopatriomonial′naja inter-
pretacija. Ojkumena 4(2006):151–184.Flikke, Geir. 2008. Pacts, parties and elite struggle: Ukraine′s troubled post-orange transition.
Europe-Asia Studies 60(3):375–396.Galbreath, David J. 2009. Putting the colour into revolutions? the OSce and civil society in the
post-soviet region. Journal of Communist Studies and Transition Politics 25(2–3):161–180.Gandhi, Jennifer, und ellen Lust-Okar. 2009. elections under authoritarianism. Annual Review of
Political Science 12:403–422.Geddes, barbara. 1999. What do we know about democratization after twenty years? Annual
Review of Political Science 2:115–144.Gel′man, Vladimir. 2005. Uroki ukrainskogo. Polis 1(2005):36–49.Gershman, carl, und Michael allen. 2006. the assault on democracy assistance. Journal of Demo-
cracy 17(2):36–51.Goldstone, Jack a. 2001. toward a fourth generation of revolutionary theory. Annual Review of
Political Science 4:139–187.Grzymala-busse, anna, und Pauline Jones Luong. 2006. Democratization: Post-communist impli-
cations. in The Oxford handbook of political economy, hrsg. barry r. Weingast und Donald a. Wittman, 656–669. Oxford: Oxford university Press.
hadenius, axel, und Jan teorell. 2007. Pathways from authoritarianism. Journal of Democracy 18(1):143–157.
hale, henry e. 2005. regime cycles: Democracy, autocracy, and revolution in post-soviet eurasia. World Politics 58:133–165.
hale, henry e. 2006. Democracy or autocracy on the march? the colored revolutions as normal dynamics of patronal presidentialism. Communist and Post-Communist Studies 39:305–329.
hall, Peter a. 2003. aligning ontology and methodology in comparative research. in Comparative historical analysis in the social sciences, hrsg. James Mahoney und Dietrich rueschemeyer, 373–404. cambridge: cambridge university Press.
herd, Graeme G. 2005a. colorful revolutions and the ciS: „Manufactured“ versus „managed“ democracy? Problems of Post-Communism 52(2):3–18.
herd, Graeme G. 2005b. russia and the „Orange revolution“: response, rhetoric, reality? The Quarterly Journal 2(2):15–28.
higley, John, und Michael burton. 1989. the elite variable in democratic transitions and break-downs. American Sociological Review 54:17–32.
howard, Marc M., und Philip G. roessler. 2006. Liberalizing electoral outcomes in competitive authoritarian regimes. American Journal of Political Science 50(2):365–381.
huntington, Samuel P. 1991. The third wave. Democratization in the late twentieth century. Nor-man: university of Oklahoma Press.
Jowitt, Ken. 1992. the Leninist legacy. in New world disorder: The Leninist extinction, hrsg. Ken Jowitt, 284–305. berkeley: university of california Press.
Kara-Murza, Sergej G. 2005. Ėksport revoljucii. Moskva: algoritm.Karatnycky, adrian, und Peter ackerman. 2005. how freedom is won: From civic resistance to
durable democracy. International Journal of Not-for-Profit Law 7(3):47–59.
160 P. Stykow
Karl, terry L. 1990. Dilemmas of democratization in Latin america. Comparative Politics 23(1):1–21.
Karl, terry L., und Philippe c. Schmitter. 1991. Modes of transition in Latin america, Southern and eastern europe. International Social Science Journal 43(2):269–284.
King, charles. 2000. Post-communism: transition, comparison, and the end of „eastern europe“. World Politics 53(1):143–172.
Kitschelt, herbert. 2003. accounting for postcommunist regime diversity. What counts as a good cause? in Capitalism and democracy in Central and Eastern Europe. Assessing the legacy of communist rule, hrsg. Grzegorz ekiert und Stephen e. hanson, 49–86. cambridge: cam-bridge university Press.
Kitschelt, Herbert, Zdenka Mansfeldova, Radoslaw Markowski, und Gábor Tóka. 1999. Post-com-munist party systems. Competition, representation, and inter-party cooperation. cambridge: cambridge university Press.
Köllner, Patrick. 2008. autoritäre regime – ein Überblick über die jüngere Literatur. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 2(2)351–366.
Kopstein, Jeffrey S., und David a. reilly. 2000. Geographic diffusion and the transformation of the postcommunist world. World Politics 53:1–37.
Kopstein, Jeffrey S., und David a. reilly. 2003. Postcommunist spaces: a political geography approach to explaining postcommunist outcomes. assessing the legacy of communist rule. in Capitalism and democracy in Central and Eastern Europe. Assessing the legacy of communist rule, hrsg. Grzegorz ekiert und Stephen e. hanson, 120–154. cambridge: cambridge uni-versity Press.
Kubicek, Paul. 2009. Problems of post-post-communism: ukraine after the Orange revolution. Democratization 16(2):323–343.
Kudelia, Serhiy. 2007. Revolutionary bargain: The unmaking of Ukraine′s autocracy through pac-ting. Journal of Communist Studies and Transition Politics 23(1):77–100.
Kuzio, taras. 2001. transition in post-communist states: triple or quadruple? Politics 21(3):168–177.
Kuzio, taras. 2006. ukraine is not russia: comparing youth political activism. SAIS Review 26(2):67–83.
Kuzio, Taras. 2008. Democratic breakthroughs and revolutions in five postcommunist countries: comparative perspectives on the fourth wave. Demokratizatsiya 16(1):97–109.
Lane, David. 2009. „coloured revolution“ as a political phenomenon. Journal of Communist Stu-dies and Transition Politics 25(2–3):113–135.
Levitsky, Steven, und Lucan a. Way. 2002. the rise of competitive authoritarianism. Journal of Democracy 13(2):51–65.
Levitsky, Steven, und Lucan a. Way. 2006. Linkage and leverage: how do international factors change domestic balances of power. in Electoral authoritarianism. The dynamics of unfree competition, hrsg. andreas Schedler, 199–216. boulder: rienner.
Lipset, Seymour M. 1959. Political man. Garden city: Doubleday.Magaloni, beatriz. 2006. Voting for autocracy. Hegemonic party survival and its demise in Mexico.
New York: cambridge university Press.Mahoney, James. 2003. Knowledge accumulation in comparative historical research. in Compa-
rative historical analysis in the social sciences, hrsg. James Mahoney und Dietrich ruesche-meyer, 131–174. cambridge: cambridge university Press.
Mainwaring, Scott, und Anibal Pérez-Liñán. 2007. Why regions of the world are important: Regio-nal specificities and region-wide diffusion of democracy. In Regimes and democracy in Latin America: Theories and methods, hrsg. Gerardo L. Munck, 199–230. Oxford: Oxford uni-versity Press.
Marples, David r. 2006. color revolutions: the belarus case. Communist and Post-Communist Studies 39:351–364.
161„bunte revolutionen“ – Durchbruch zur Demokratie oder …
McFaul, Michael. 2002. the fourth wave of democracy and dictatorship: Noncooperative transiti-ons in the postcommunist world. World Politics 54:212–244.
McFaul, Michael. 2005. transitions from postcommunism. Journal of Democracy 16(3):5–19.McFaul, Michael. 2006. conclusion: the Orange revolution in a comparative perspective. in Revo-
lution in orange. The origins of Ukraine′s democratic breakthrough, Hrsg. Anders Åslund und Michael McFaul, 165–195. Washington, Dc: carnegie endowment for international Peace.
McFaul, Michael. 2007. Ukraine imports democracy: External influences on the Orange Revolu-tion. International Security 32(2):45–83.
Mitchell, Lincoln a. 2006. Democracy in Georgia since the rose revolution. Orbis 50(4):669–676.
Møller, Jørgen, und Svend-erik Skaaning. 2009. the three worlds of post-communism: revisiting deep and proximate explanations. Democratization 16(2):298–322.
Moore, barrington. 1969(1966). Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie: Die Rolle der Grundbesitzer und Bauern bei der Entstehung der modernen Welt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Munck, Gerardo L. 2001. the regime question: theory building in democracy studies. World Poli-tics 54(2):119–144.
Muskhelishvili, Marina, und Gia Jorjoliani. 2009. Georgia′s ongoing struggle for a better future continued: Democracy promotion through civil society development. Democratization 16(4):682–708.
North, Douglass c., John J. Wallis, Steven b. Webb und barry r. Weingast. September 2007. Limi-ted access orders in the developing world. a new approach to the problem of development. World bank Policy research Working Paper 4359.
North, Douglass c., John J. Wallis, und barry r. Weingast. 2009. Violence and social orders. A conceptual framework for interpreting recorded human history. cambridge: cambridge uni-versity Press.
O′Donnell, Guillermo. 199�. Delegative democracy. Journal of Democracy 5(1):55–69.O′Donnell, Guillermo, und Philippe C. Schmitter. 198�. Transitions from authoritarian rule: Tenta-
tive conclusions about uncertain democracies. baltimore: Johns hopkins university Press.Offe, claus. 1994. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Demokratisierung, Marktwirtschaft und ter-
ritorialpolitik in Osteuropa. in Der Tunnel am Ende des Lichts. Erkundungen der politischen Transformation im Neuen Osten, hrsg. claus Offe, 57–80. Frankfurt a.M.: campus.
Pierson, Paul. 2003. epilogue: From area studies to contextualized comparisons. in Capitalism and democracy in Central and Eastern Europe. Assessing the legacy of communist rule, hrsg. Grzegorz ekiert und Stephen e. hanson, 353–366. cambridge: cambridge university Press.
Przeworski, adam. 1992. Democracy and the market. Political and economic reforms In Eastern Europe and Latin America. cambridge: cambridge university Press.
ragin, charles c. 1987. The comparative method. Moving beyond qualitative and quantative stra-tegies. berkeley: university of california Press.
roeder, Philip G. 1999. the revolution of 1989: Postcommunism and the social sciences. Slavic Review 58(4):743–755.
Saari, Sinikukka. 2009. european democracy promotion in russia before and after the ‚colour‘ revolutions. Democratization 16(4):732–755.
Schumpeter, Joseph a. 2005 (1947). Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. tübingen: Francke.
Schwirtz, Michael. 2007. Russia′s political youths. Demokratizatsiya 15(1):73–84.Silitski, Vitali. 2005. Preempting democracy: the case of belarus. Journal of Democracy
16(4):83–97.Silitski, Vitali. 2009. What are we trying to explain? Journal of Democracy 20(1):86–89.Skocpol, theda. 1986. the origins of revolutions. in Revolutions. Theoretical, comparative, and
historical studies, hrsg. Jack a. Goldstone, 68–88. San Diego: harcourt brace Jovanovich.
162 P. Stykow
Snyder, richard. 1992. explaining transitions from neopatrimonial dictatorships. Comparative Politics 24(4):379–399.
Stewart, Susan. 2009. the interplay of domestic contexts and external democracy promotion: Les-sons from eastern europe and the South caucasus. Democratization 16(4):804–824.
Stinchcombe, arthur L. 1999. ending revolutions and building new governments. Annual Review of Political Science 2:49–73.
thompson, Mark r., und Philipp Kuntz. 2004. Stolen elections and the „October revolution“ in Serbia. Journal of Democracy 15(4):159–172.
tilly, charles. 2001. Mechanisms in political processes. Annual Review of Political Science 4:21–41.
tucker, Joshua a. 2007. enough! electoral fraud, collective action problems, and post-communist colored revolutions. Perspectives on Politics 5(3):535–551.
tudoroiu, theodor. 2007. rose, orange, and tulip: the failed post-Soviet revolutions. Communist and Post-Communist Studies 40(3):315–342.
Wallander, Celeste A. 2005. Ukraine′s election: The role of one international NGO. International Affairs 51(3):92–103.
Way, Lucan a. 2008. the real causes of the color revolutions. Journal of Democracy 19(3):55–69.Way, Lucan a. 2009. a reply to my critics. Journal of Democracy 20(1):90–97.Weber, Max. 1980 (1921). Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie.
tübingen: Mohr (Siebeck).Wilson, andrew. 2005. Ukraine′s Orange Revolution. New haven: Yale university Press.Wilson, Andrew. 200�. Ukraine′s Orange Revolution, NGOs and the role of the west. Cambridge
Review of International Affairs 19(1):21–32.