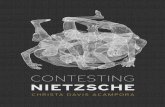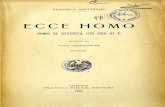Posthuman oder Übermensch. War Nietzsche ein Transhumanist? (2013)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Posthuman oder Übermensch. War Nietzsche ein Transhumanist? (2013)
Michael SkowronPosthuman oder ÜbermenschWar Nietzsche ein Transhumanist?
Zusammenfassung: Die jüngst vor allem im Internet ausgetragene Diskussion um die Frage, ob Nietzsche ein Transhumanist gewesen sei, hat neue Aufmerksamkeit auf Nietzsches Begriff des Übermenschen und sein Verhältnis zum Posthumanen gelenkt. Der Beitrag nimmt kritisch dazu Stellung, indem er Analogien zwischen Er-ziehung und gentechnischer Veränderung des Menschen auch gegen letztere wendet, Selbst-Erziehung an Selbst-Überwindung und die von Transhumanisten ausgeschlos-sene ewige Wiederkunft des Gleichen bindet sowie an die von Nietzsche getroffene Unterscheidung zweier Wege in die Zukunft des Menschen, zum Übermenschen oder zum letzten Menschen, erinnert. Sprachliche Überlegungen zu den in der Rede von diesen „Typen“ verwendeten Epitheta sowie strukturelle Analogien zwischen per-fektionierungs-kritischen Überlegungen bei Michael Sandel und Jürgen Habermas einerseits, Nietzsche andererseits machen ebenfalls deutlich, dass Nietzsche den technologischen Transhumanismus für einen Abweg halten und ihm seinen Weg zum Übermenschen durch Selbstüberwindung entgegenhalten würde.
Schlagwörter: Transhumanismus, Übermensch, Posthuman, Erziehung, Selbstüber-windung, Technik.
Abstract: Recent discussions (especially in the Internet) about the question whether Nietzsche was a Transhumanist or at least a forerunner of the Transhumanist move-ment have drawn new attention to Nietzsche’s concept of the Overhuman and the relation to the Posthuman. The article is taking a critical stance by turning suggested analogies between education and genetic manipulation of humans into an argument against the latter, by relating self-education to self-overcoming and eternal recurrence of the same (which is excluded by Transhumanists), and by reminding of Nietzsche’s distinction between ‘Overhuman’ and ‘last human’ as two different ways to the future. Linguistic analysis of the epitheta used in speaking of the different ‘types’ in ques-tion as well as structural analogies between critical considerations in Michael Sandel and Jürgen Habermas on the one hand, Nietzsche on the other are also evidence that Nietz sche would not have endorsed the technological path to perfection of the human but would emphasize his own way of self-overcoming instead.
Keywords: Transhumanism, Overhuman, Posthuman, Education, Self-Overcoming, Technology.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 256NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 256 21.05.2013 12:43:1321.05.2013 12:43:13
Posthuman oder Übermensch 257
Unter dem Titel des „Transhumanismus“ haben sich eine Reihe von Philosophen und Theore tikern versammelt, die die Möglichkeiten und Konsequenzen einer Transfor-mation, Verbesse rung und Optimierung (enhancement) des Menschen zum Gegen-stand ihrer Überlegungen machen. Das Ziel dieser Transformation des Menschen wäre der „Posthuman“, der entweder als eine neue Spezies oder aber als eine entschiedene Weiterentwicklung des Menschen mit ganz neuen und bisher nicht dagewesenen und noch kaum vorstellbaren Eigenschaften verstanden wird. Entscheidend ist dabei das Mittel, mit dem diese Transformation des Menschen bewerk stelligt werden soll, nämlich die neuen technologischen Möglichkeiten, insbesondere gen technische, die Eingriffe in die leibliche Konstitution des Menschen erlauben und nicht mehr nur bloß therapeutischen Zwecken dienen, sondern gezielte Veränderungen und Verbesserun-gen des Menschen auf biologischer Grundlage herbeiführen sollen.
Nietzsches Überlegungen zum Mittel der Technik sind zwar spärlich und die meisten technologischen Neuerungen des 20. Jahrhunderts waren ihm unbekannt,¹ aber das Ziel dieser Verwandlung des Menschen zum „Posthuman“ scheint einige Gemeinsamkeiten mit Nietz sches „Übermensch“ zu haben, zumindest auf den ersten Blick. War Nietzsche ein „Transhu manist“ oder wenigstens einer von dessen Vorläufern?² Wäre der „Posthuman“ der Transhu manisten ein „Übermensch“ im Sinne Nietzsches? Die Fragen werden unterschied lich beantwortet. Während Nick Bostrom und Michael Hauskeller nur oberflächliche Ähn lichkeiten zwischen Nietz-sche und dem Transhumanismus erkennen, sieht Stefan Lorenz Sorgner tiefgreifende Übereinstimmungen und Max More sogar einen direkten Einfluss auf den Trans-
1 Für Nietzsche waren noch “[d]ie Presse, die Maschine, die Eisenbahn, der Telegraph“ die „Prä-missen“, aus denen schon zu seiner Zeit noch niemand ihre „tausendjährige Conclusion“ zu ziehen gewagt habe (MA II, WS 278). Vgl. Robert E. McGinn, Nietzsche on Technology, in: Journal of the History of Ideas 41.4 (1980), S. 679–691; Ernst Oldemeyer, Leben und Technik. Lebensphilosophische Positionen von Nietzsche zu Plessner, München 2007, S. 19–41.2 Eine erste Phase dieser Diskussion liegt bereits mehrere Jahre zurück und entzündete sich an Peter Sloterdijks Regeln für den Menschenpark, die sich in erster Linie als ein Antwortschreiben an Heidegger verstanden, Nietzsche aber für den „Grundkonflikt der Zukunft […] zwischen Humanis-ten und Superhumanisten, Menschenfreunden und Übermenschenfreunden“ in Anspruch nahmen (Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark, in: Ders., Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, Frankfurt am Main 2001, S. 302–337, S. 325 f.). Die Debatte haben nachgezeichnet Heinz-Ulrich Nen-nen, Philosophie in Echtzeit. Die Sloterdijk–De bat te: Chro nik einer Inszenierung. Über Me ta phern-fol gen ab schät zung, die Kunst des Zu schau ers und die Pathologie der Dis kur se, Würzburg 2003, und Eduardo Mendieta, A Letter on Überhumanismus: Beyond Posthumanism and Transhumanism, in: Stuart Elden (Hg.), Sloterdijk Now, Cambridge 2012, S. 58–76. Dem neuen Lexikon von sich überbie-tenden Humanismen, die Mendieta (S. 60) anführt (Anti-, In-, Post-, Trans-, Neo-, Hyper- / Über-), könnte außer dem Superhumanismus auch noch der Metahumanismus angefügt werden, zu dem Ste-fan Lorenz Sorgner zusammen mit Jaime del Val ein eigenes „Manifest“ verfasst hat (A Metahumanist Manifesto, The Agonist 4.2 (2011), http://www.nietzschecircle.com/AGONIST/2011_08/METAHUMA-NIST_MANIFESTO.pdf).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 257NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 257 21.05.2013 12:43:1321.05.2013 12:43:13
258 Michael Skowron
humanismus, der schwer zu widerlegen ist, nämlich auf seinen eigenen.³ Letzteres könnte jedoch auch ein Missverständnis sein, und die tiefgreifenden Übereinstim-mungen könnten sich bei näherem Hinsehen doch nur als oberflächlich erweisen, wie ich im Folgenden zu zei gen versuche. Ich komme damit zu einem ähnlichen Er-gebnis wie Bostrom und Hauskeller, wenn auch aus ganz anderen Gründen als diese. Denn Bostrom beruft sich auf die Wurzeln des Transhumanismus in der Aufklärung, die Betonung individueller Freiheiten und die hu manistische Sorge für das Wohl aller Menschen, die er Nietzsche gegenüberstellen zu müssen glaubt.⁴ Dies aber sind nicht weniger Missverständnisse Nietzsches als die vorigen.
Im Folgenden schließt sich an eine kurze Berücksichtung der Vorbehalte Bo-stroms zweitens die Behandlung der dadurch angestoßenen Frage nach dem Ver-hältnis von Freiheit, Erziehung und technologischer Veränderung des Menschen an, die zeigt, dass Nietzsches Begriff der Erziehung auch die von Sorgner aufgezeigte „strukturelle Analogie“ zwischen traditioneller Erziehung und gen-technologischen Optimierungsversuchen des Menschen in Mitleidenschaft zieht und Nietzsche daher auch letzteren abschlägig gegenüberstehen würde. „Selbst-Erziehung“ in Nietzsches Sinn ist drittens nicht von „Selbst-Überwindung“ zu trennen, deren Sinn von Trans-humanisten ebenfalls missverstanden wird. Mit diesen „Selbst“-Initiativen lässt sich ein Sinn der ewigen Wiederkunft des Gleichen verbinden, der sie der transhumanis-tischen Ausschaltung dieser Grundkonzeption Nietzsches gegenüber für untrennbar vom Übermenschen erweist. Viertens ist an eine Unterscheidung zu erinnern, die sowohl bei Vertretern als auch Gegnern einer grundlegenden „strukturellen Überein-stimmung“ zwischen Nietzsche und dem Transhumanismus verloren gegangen zu sein scheint: der Unterschied zwischen „Übermensch“ und „letztem Mensch“ als der von Nietzsche ins Auge gefassten „zwei Wege“ in die Zukunft des Menschen, wobei der „höhere Mensch“ eine Art Zwischenstellung im Hinblick auf den gegenwärtigen Menschen einnimmt. Die Ideale des Transhumanismus, wie gesundes, glückliches
3 Nick Bostrom, A History of Transhumanist Thought, 2005, www.nickbostrom.com/papers/history.pdf; Michael Hauskeller, Nietzsche, the Overhuman and the Posthuman: A Reply to Stefan Sorgner, in: Journal of Evolution and Technology 21.2 (2010), S. 5–8, jetpress.org/v21/hauskeller.htm; Stefan Lorenz Sorgner, Nietzsche, the Overhuman, and Transhumanism, in: Journal of Evolution and Techno-logy 20.1 (2009), S. 29–42, jetpress.org/v20/sorgner.htm; Stefan Lorenz Sorgner, Beyond Humanism: Reflections on Trans- and Posthumanism, in: Journal of Evolution and Technology 21.2 (2010), jet-press.org/v21/sorgner.htm; Stefan Lorenz Sorgner, Zarathustra 2.0 and Beyond: Further Remarks on the Complex Relationship between Nietzsche and Transhumanism, in: The Agonist 4.2 (2011), www.nietzschecircle.com/AGONIST/2011_08/ StefanSorgnerFinal.pdf; Max More, The Overhuman in the Transhuman, in: Journal of Evolution and Technology 21.2 (2010), S. 1–4, jetpress.org/v21/more.htm.4 Bostrom, A History of Transhumanist Thought, S. 4. Hauskeller, Nietzsche, the Overhuman and the Posthuman, S. 7) behauptet u. a., der Übermensch Nietzsches könne nur im Singular existieren, ge-trennt von anderen, während Nietzsche ausdrücklich betont: „Es muß v i e l e Übermenschen geben: alle Güte entwickelt sich nur unter seines Gleichen. E i n Gott wäre immer ein Te u f e l !“ (Nachlass 1885, 35[72], KSA 11.541).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 258NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 258 21.05.2013 12:43:1321.05.2013 12:43:13
Posthuman oder Übermensch 259
und möglichst langes, wenn nicht unsterbliches Leben, lassen den angestrebten posthumanen Status eher wie eine Verkörperung des letzten Menschen als des Über-menschen erscheinen. Fünftens macht auch eine sprachliche Analyse der Bedeu-tung der in der Rede über diese Typen von „Menschen“ verwendeten Epitheta (des „Höher“ und „Über“, des „Letzten“ und des „Post“) deutlich, dass der „Übermensch“ einerseits, der „letzte Mensch“ und der „Posthuman“ andererseits verschiedenen Dimensionen angehören, während die „höheren Menschen“ zumindest in die richtige Richtung weisen (5). Schließlich bestätigen sechstens auch strukturelle Analogien zwischen Nietzsche und Gegnern der technologischen Optimierung des Menschen, die Begriffe wie Bescheidenheit, Geschenk und (Un-)Verantwortlichkeit in den Mit-telpunkt stellen, dass Nietzsches Übermensch und der technisch erzeugte Posthuman nicht verwechselt werden sollten (6).
1 AufklärungAuch Nietzsches Philosophie hat Wurzeln in der Aufklärung, wenn auch nicht nur dort, son dern z. B. auch in der Antike. Menschliches, Allzumenschliches (1878), das sich ein Buch für „freie Geister“ nennt, war dem Andenken Voltaires, „einem der grössten Befreier des Geistes“ gewidmet; Nietzsche stellte ihm ein Motto aus Descar-tes’ Diskurs über die Methode voran. Im ersten Hauptstück, das „[v]on den ersten und letzten Dingen“ handelt, heißt es, dass man aus der romantischen Reaktion gegen die Aufklärung einen Fortschritt zu machen habe, indem man auch der Vergangenheit historische Gerechtigkeit angedeihen lasse. Dadurch wer de die historische Betrach-tungsart, welche die Zeit der Aufklärung mit sich gebracht habe und nur auf zukünf-tigen Fortschritt bedacht war, in einem wesentlichen Punkt korrigiert. Nach dieser Korrektur dürfe man „die Fahne der Aufklärung – die Fahne mit den drei Namen: Pe trarca, Erasmus, Voltaire – von Neuem weiter tragen.“ (MA I 26; vgl. M 197)⁵ Die Tra-dition der Aufklärung, die Nietzsche hier beschwört, ist offenbar eine andere als die-jenige Bostroms, der nur Kant und den „English liberal thinker and utilitarian John Stuart Mill“ er wähnt,⁶ von denen Nietzsche in der Tat meist nicht sehr vorteilhaft
5 Vgl. Renate Reschke (Hg.), Nietzsche. Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, Berlin 2004. Der Akzent dieser Weiterführung der Aufklärung liegt nach Josef Simon, Der Begriff der Aufklä-rung bei Kant und Nietzsche, in: ebd., S. 113–122, S. 119 f., dabei darauf, dass Aufklärung für Nietzsche ein Prozess ist, der nicht auf eine Vollendung ausgerichtet sein kann, nicht ans Ende will, „sondern Zeit und Raum lässt für anderes Denken und anderes Fürwahrhalten als das hier und jetzt mögliche und eventuell auch notwendige“, also auch keinen allgemeinen, vorgefertigten Begriff von Aufklä-rung oder Vernunft voraussetzt. Der Begriff der Aufklärung werde bei Nietzsche in der Nachfolge Kants „dialektisch“ (S. 122).6 Bostrom, A History of Transhumanist Thought, S. 4 f.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 259NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 259 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
260 Michael Skowron
sprach, ebensowenig wie vom kategorischen Imperativ und vom Utilitarismus.⁷ Auch die Aufklärung ist keine homoge ne Tradition. Sorgner sieht eine Diskrepanz zwischen Aufklärung und Transhumanis mus zudem darin, dass die Aufklärung ein dualisti-sches Verständnis des Menschen (mit einer vernünftigen unsterblichen Seele und einem materiellen sterblichen Körper) habe, was mit dem naturalistischen Selbstver-ständnis des Transhumanismus und auch Nietzsches unverein bar sei.⁸ Transhuma-nisten vertreten meist keine deontologische Pflichtenethik im Sinne Kants, sondern sind Utilitarier, obwohl More und Sorgner auch eine Tugendethik, wie Nietz sche sie vertritt, mit dem Transhumanismus für vereinbar halten.⁹
Nietzsche hat individuelle Freiheit sicher nicht weniger geschätzt als Transhuma-nisten, aber auch dies wieder in einem anderen Sinne als bei Bostrom, der dies nicht näher ausführt, aber vermutlich an politischen Liberalismus denkt.¹⁰ Nietzsches Begriff von Freiheit führt in das Zentrum von Nietzsches eigenem ‚Transhumanis-mus‘, der jeden einzelnen Menschen und dessen „Wohl“ betrifft, sofern für Nietzsche jeder Mensch ein unverwechselbares Individuum ist, „ein einmaliges Wunder“ (SE 1, KSA 1.337 f.), das es so kein zweites Mal gibt. Die wesentliche Gleichheit der Men-schen besteht für Nietzsche insofern in ihrer Ungleichheit qua Einmaligkeit, die zu erhalten und zu fördern ist.¹¹ Die Einzigkeit jedes Menschen geht jedoch fast unver-meidlich und zunehmend verloren, sobald das Kind geboren ist. Nicht nur die Eltern, sondern auch der Staat und die Gesellschaft betrachten die Kinder mehr oder weniger als ihr Eigentum und erziehen, sozialisieren, beeinflussen und verändern sie in ihrem Sinne.¹² Erziehung und Sozialisation machen den unverwechselbaren Einzelnen zum
7 Vgl. Thomas H. Brobjer, Nietzsche and the „English“. The influence of British and American thin-king on his philosophy, Amherst / New York 2008, S. 193 ff.; Maria Cristina Fornari, Die Entwicklung der Herdenmoral. Nietzsche liest Spencer und Mill, Wiesbaden 2009. Für James Conant, Nietzsche’s Perfectionism: A Reading of Schopenhauer as Educator, in: Richard Schacht (Hg.): Nietzsches’s Post-moralism. Essays on Nietzsche’s Prelude to Philosophy’s Future, Cambridge 2001, S. 181–257, lässt die übliche Textbuch-Gegenüberstellung von Mill und Nietzsche einiges zu wünschen übrig, wenn man gewahr werde, „how any number of passages from On Liberty can be mistaken for ones from SE and vice versa” und wie Mill den Begriff des Utilitarismus umforme (S. 231). Zu Kant und Nietzsche vgl. auch Beatrix Himmelmann (Hg.), Kant und Nietzsche im Widerstreit, Berlin / New York 2005.8 Sorgner, Zarathustra 2.0 and Beyond, S. 28 f.9 Sorgner, Beyond Humanism, S. 8 ff.; Sorgner, Zarathustra 2.0 and Beyond, S. 29 f.10 In Götzen-Dämmerung hebt Nietzsche die Zweideutigkeit liberaler Institutionen hervor, je nach-dem ob für sie noch gekämpft werde, wobei sie die Freiheit in der Tat auf mächtige Weise förderten, oder ob sie erreicht seien, wodurch sie sich in die gründlichsten Schädiger der Freiheit verwandelten und den Menschen zum ‚Herdentier‘ umformten (GD, Streifzüge eines Unzeitgemässen 38).11 Dass die Menschen nicht gleich sind, ist für Zarathustra die Sprache der „Gerechtigkeit“, und gerade seine „Liebe zum Übermenschen“ sei es, die ihn zu der Forderung bewege, dass sie auch nicht gleich werden sollen (Za II, Von den Taranteln, KSA 4.130; vgl. GD, Streifzüge eines Unzeitgemässen 48).12 „Fast in der Wiege giebt man uns schon schwere Worte und Werthe mit: „gut“ und „böse“ – so heisst sich diese Mitgift. Um derenwillen vergiebt man uns, dass wir leben.“ (Za III, Vom Geist der Schwere 2, KSA 4.242)
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 260NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 260 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
Posthuman oder Übermensch 261
„Menschen“, d. h. zu einem Gattungswesen oder ‚Herdentier‘, wie Nietzsche sagt, in dem seine einzigartige Individualität reduziert oder ganz verschwunden ist. Der „Mensch“ aber ist nur ein „blutlose[s] Abstractum […], eine Fiction“ (M 105), wirklich sind nur singuläre, einmalige Einzelwesen. Die Aufgabe ist daher für Nietzsche, diese Einzigartigkeit jedes Einzelnen (wieder) zu entdecken, ihn zu dem werden zu lassen, der er ist, d. h. aus der Allgemeinheit seines Menschseins über dieses herauszufüh-ren und insofern „Über-Mensch“ zu werden. Das Individuelle ist dabei kein Hinder-nis, sondern vielmehr Bedingung und Voraussetzung. Anstatt das Individuelle des Menschen im Allgemein-Werden abzustreifen, sieht Nietzsche in jedem Individuum einen „Versuch, eine h ö h e r e G a t t u n g a l s d e n M e n s c h e n z u e r r e i c h e n , vermöge seiner individuellsten Dinge“. Es komme also darauf an, „dem Menschen seinen Allgemeincharakter immer mehr zu n e h m e n und ihn zu spezialisiren, bis zu einem Grade unverständlicher für die Anderen zu machen (und damit zum Ge-genstand der Erlebnisse, des Staunens, der Belehrung für sie)“, irritierend und faszi-nierend zugleich (Nachlass 1880, 6[158], KSA 9.237). Individuell frei zu werden spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist ein Angelpunkt der Entwicklung, wie Zara-thustras erste Rede von den drei Verwandlungen des Geistes vom Kamel zum Löwen zeigt, findet aber erst dann seine Erfüllung, wenn man sich auch von der mit dieser Befreiung verbundenen Negativität und dem Leiden daran befreit hat und durch die Rückverwandlung zum spielenden Kind eine ‚Welt‘ gewinnt, wie diese Rede ebenfalls zeigt.¹³ ‚Welten‘ aber schließen immer auch andere Menschen und deren ‚Wohl‘ ein.
‚Genetic Engineering‘ vor der Geburt ändert an der Aufgabe der Selbstwerdung im Grunde nichts, sondern verschärft sie nur und macht ihren Anspruch deutlicher. Denn es zeigt, dass wir im Grunde auch nicht einmal die sind, die wir entweder durch das ‚natürliche‘ genetische Roulette oder durch genetisches Design geworden sind. Im Zen-Buddhismus gibt es als Koan (ein paradox klingendes Rätsel, dessen existen-zielle und nicht bloß intellektuelle Auflösung zur Erleuchtung führt) die schöne Frage nach dem „ursprünglichen Gesicht“, d. h. die Frage, wer man war, sogar noch bevor die eigenen Eltern geboren waren. In diesem Sinne kann man Nietzsches Frage nach dem wahren Selbst als Frage nach dem „ursprünglichen Gesicht“ bzw. der „Buddha-Natur“ reformulieren und die Aufgabe, Übermensch zu werden, als diejenige des Zen-Buddhismus, Buddha zu werden.¹⁴
13 Da jeder, der seine Ketten zerbrochen habe, zunächst in sehr verschiedener Weise an der „ K e t -t e n - K r a n k h e i t “ leide, müsse man sich nach der „Emancipation“ auch noch „von dieser Emanci-pation e m a n c i p i r e n ! “ (Nietzsche an Lou von Salomé, Ende August 1882, Nr. 293, KSB 6.247 f.; vgl. MA II, WS 350)14 Vgl. André van der Braak, Nietzsche and Zen. Self-overcoming without a Self, Lanham 2011.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 261NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 261 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
262 Michael Skowron
2 Erziehung, Technologie und BefreiungEiner der Hauptunterschiede zwischen Nietzsche und dem Transhumanismus liegt Transhumanisten zufolge darin, dass jener sein Ziel des Übermenschen durch Erzie-hung, dieser aber durch technologische und gentechnische Veränderungen des Menschen erreichen will.¹⁵ Sorgner sieht zwischen beiden Verfahren jedoch keinen prinzipiellen Unterschied, da eine „strukturelle Analogie“ zwischen ihnen bestehe. In beiden Fällen wollten die Erzieher eine Verbesserung und Steigerung der Betref-fenden bewirken, wobei die in beiden Fällen erzielten Ergebnisse sowohl reversibel als auch irreversibel sein könnten.¹⁶ Nietzsche hätte deshalb sicher keine Einwände gegen technologische Mittel zur Erzeugung des Übermenschen gehabt, auch wenn er dies nicht in Erwägung gezogen habe. Sorgner geht dabei jedoch ebenso wie die Transhumanisten, die den Unterschied betonen, von einem Begriff von „Erziehung“ aus, der von Nietzsche nicht geteilt wird, weil er seine Bildungskritik nicht berück-sichtigt.¹⁷
Bereits in der dritten Unzeitgemässen Betrachtung über Schopenhauer als Erzieher (1874) stellt Nietzsche fest, dass der wahre Erzieher nur ein „Befreier“ sein könne. Das Geheimnis aller Bildung sei es, „nicht künstliche Gliedmaassen, wächserne Nasen, bebrillte Augen“ zu verleihen, da das, was diese Gaben zu geben vermöchten, „nur das Afterbild der Erziehung“ sei, also unecht und falsch,¹⁸ sondern Befreiung zu sein, die beseitigt, was das Wachstum hemmt und gefährdet, und damit zugleich Schutz und Förderung dessen, was sich eigenständig entwickelt (SE 1, KSA 1.341). Da für Nietzsche jeder Mensch ein einzigartiges, unverwechselbares Wesen ist, das es so kein zweites Mal gibt und das deshalb zu allem eine ganz unnachahmbar individuelle
15 Den vor allem moralisch-erzieherischen Sinn des Begriffs der „Züchtung“ bei Nietzsche beto-nen sowohl Henning Ottmann, Philosophie und Politik bei Nietzsche (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 17), 2., verb. u. erw. Aufl., Berlin / New York 1999, S. 262–265, als auch Gerd Schank, „Rasse“ und „Züchtung“ bei Nietzsche (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 44), Berlin / New York 2000, S. 335–410, auch wenn beide auch eine „biologistische Komponente“ des Begriffs einräumen. 16 Vgl. Sorgner, Beyond Humanism, S. 3 ff., und Stefan Lorenz Sorgner, Menschenwürde nach Nietz-sche. Die Geschichte eines Begriffs, Darmstadt 2010, S. 257 ff. S. dazu die Rezensionen von Konrad Ott, Aktuelle theologische, anthropologische und ethische Schlüsse aus Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 40 (2011), S. 445–451, S. 448–451, Yunus Tuncel, in: The Agonist 4.2 (2011), www.nietzschecircle.com/AGONIST/2011_08/Book_Review_ Sorgners.pdf, sowie Greg Whitlock, in: The Journal of Nietzsche Studies 44.1 (2013), www.hunter.cuny.edu/jns/reviews/stefan-lorenz-sorgner-menschenwurde-nach-nietzsche-die-geschichte-eines-begriffes.17 Vgl. Reinhard Löw, Nietzsche. Sophist und Erzieher, Weinheim 1984, bes. S. 147–189, und Christian Niemeyer, Art. Erziehung, in: Christian Niemeyer (Hg.), Nietzsche-Lexikon, 2. Aufl., Darmstadt 2011, S. 99–101.18 Vgl. Art. after, in: Nietzsche Research Group (Nijmegen) unter Leitung von Paul van Tongeren, Gerd Schank und Herman Siemens (Hg.), Nietzsche-Wörterbuch, Bd. 1, Berlin / New York 2004, S. 45–47.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 262NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 262 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
Posthuman oder Übermensch 263
Stellung und Perspektive hat, kann die Aufgabe eines Erziehers nur darin bestehen, dieser Individualität zur Manifestation zu verhelfen. Erziehung im üblichen Sinne kann dem nur hinderlich sein, wenn sie es nicht sogar unmöglich macht, indem sie ein besonderes Wesen in eine allgemeine, fertige und ihm fremde Form zwängt. Dies mag unvermeidlich sein, bedeutet aber, dass die eigentliche Erziehung erst nach dieser ersten Formierung erfolgt und eher eine „Aberziehung“ ist. In der vierten Unzeitge-mässen Betrachtung (1876) verurteilt Nietzsche in Worten, die er auch später noch in der Fröhlichen Wissenschaft (1882/87) zustimmend zitiert, einerseits das Sichverlieren an die „Sittlichkeit des Herkommens“ und den unfreien Menschen als „Schande der Natur“, während er andererseits feststellt, „dass Jeder, der frei werden will, es durch sich selber werden muss, und dass Niemandem die Freiheit als ein Wundergeschenk in den Schooss fällt.“ (WB 11, KSA 1.506 f.; FW 99)
In Der Wanderer und sein Schatten postuliert Nietzsche daher, man solle als Denker nur von „Selbst-Erziehung“ reden, denn die „Jugend-Erziehung durch Andere“ sei „entweder ein Experiment, an einem noch Unerkannten, Unerkennbaren vollzogen, oder eine grundsätzliche Nivellirung, um das neue Wesen, welches es auch sei, den Gewohnheiten und Sitten, welche herrschen, gemäss zu machen: in beiden Fällen also Etwas, das des Denkers unwürdig ist, das Werk der Eltern und Lehrer, welche Einer der verwegenen Ehrlichen [Stendhal] nos ennemis naturels“, also ‚unsere na-türlichen Feinde‘ genannt habe. Wahre Erziehung sei „Selbst-Erziehung“, die erst dann beginne, „wenn man längst, nach der Meinung der Welt, erzogen ist“ und man sich selbst entdecke: „da beginnt die Aufgabe des Denkers, jetzt ist es Zeit, ihn zu Hülfe zu rufen – nicht als einen Erzieher, sondern als einen Selbst-Erzogenen, der Erfahrung hat.“ (MA II, WS 267)
Die von Sorgner geltend gemachte „strukturelle Analogie“ zwischen Erziehung und gen-technologischer Veränderung verkehrt sich damit aus Nietzsches Sicht in ein Argument auch gegen letztere. In beiden Fällen wird ungefragt in die Lebenssphäre eines anderen Wesens eingegriffen, so dass die eigentliche „Selbst-Erziehung“ immer erst nach dieser „Anzüchtung“ als eine Art Wiederentdeckung dessen, was man vor ihr war und ursprünglich ist, stattfinden kann.¹⁹ „Selbst-Erziehung“ ist „Selbst-Über-windung“, nämlich Überwindung desjenigen Selbst, das einem durch Erziehung, So-zialisation und Technik anerzogen oder ungefragt verpasst worden ist. „Werde, der du bist“ heißt immer auch, der zu werden, der man ist, im Unterschied zu dem, den man aus jemandem gemacht hat. Und schon in Schopenhauer als Erzieher bestimmt Nietzsche das wahre Selbst als etwas, das „über“, sogar „unermesslich hoch über dir
19 Nietzsche spricht auch von dem Verhältnis einer ‚zweiten‘ zu einer ‚ersten Natur‘: „So wie man uns jetzt erzieht, bekommen wir zuerst eine z w e i t e N a t u r : und wir haben sie, wenn die Welt uns reif, mündig, brauchbar nennt. Einige Wenige sind Schlangen genug, um diese Haut eines Tages abzustossen: dann, wenn unter ihrer Hülle ihre e r s t e N a t u r reif geworden ist. Bei den Meisten vertrocknet der Keim davon.“ (M 455) Vgl. van der Braak, Nietzsche and Zen, S. 96 ff.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 263NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 263 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
264 Michael Skowron
oder wenigstens über dem, was du gewöhnlich als dein Ich nimmst“, liege (SE 1, KSA 1.340 f.).
Wahre Erziehung als eine Aufwärtsbewegung über sich hinaus spielt auch dort eine Rolle, wo Zarathustra sich selbst als einen „Fischer auf hohen Bergen“ be-schreibt, der „Menschen-Fische“ aus der Tiefe zu sich in die Höhe hinaufziehen will (Za IV, Das Honig-Opfer, KSA 4.297). Dazu ist allerdings unerlässlich, dass Fische anbeißen. Wenn dem Angler die Fische nicht auch von sich aus entgegenkommen, ist seine Bemühung fruchtlos. So verstand Nietzsche alle seine Schriften nach Also sprach Zarathustra als Angelhaken, die zu Also sprach Zarathustra hinaufziehen sollten: „Wenn Nichts sich f i e n g , so liegt die Schuld nicht an mir. D i e F i s c h e f e h l t e n … “ (EH, JGB 1) Genauso wichtig wie die Erziehung ist daher das Prinzip der „Selbstüberwindung“ bzw. des „Willens zur Macht“, der in Also sprach Zarathustra genau in dem Kapitel abgehandelt wird, das „Von der Selbst-Ueberwindung“ handelt.
Das Problem der Erziehung im traditionellen Sinne hat sich heute in einer Weise verschärft, die zu einer totalen Verplanung des Bildungsganges eines Kindes tendiert und „hyperparenting“ genannt wird. Für Michael J. Sandel²⁰ hat dieses „hyperpa-
20 Michael J. Sandel, The Case against Perfection. Ethics in the age of genetic engineering, Cam-bridge 2007, S. 45–62. Vgl. die Besprechung von Christoph Henning, Verbesserung des Menschen: Warum, und in welcher Hinsicht? Sechs Bücher zum Perfektionismus, in: Philosophische Rundschau 56 (2009), S. 111–129, S. 124–129. Henning unterscheidet zwischen moralisch-praktischem und tech-nisch-praktischem Perfektionismus, wobei die normativen Folgen des technischen Perfektionismus allerdings die des moralischen Perfektionismus voraussetzten. Für den moralischen Perfektionis-mus gelte, dass sich zwar eine Person letztlich nur selbst verbessern oder „verwirklichen“ könne, Institutionen jedoch günstige (oder ungünstige und daher kritikwürdige) Rahmenbedingungen für eine günstige Entwicklung zu schaffen in der Lage seien, während der technische Perfektionismus die biologisch-leibliche Optimierung des Menschen mithilfe modernster Technologien anstrebt (S. 112 f.). Wie die Diskussion um den Transhumanismus Nietzsches zeigt, steht Nietzsche an der Schnittstelle zwischen beiden „Perfektionismen“. Zu Nietzsches „moralischem Perfektionismus“ vgl. Conant, Nietzsche’s Perfectionism, zu einer affirmativen Position des technischen Perfektionismus Bernward Gesang, Perfektionierung des Menschen, Berlin / New York 2007, und die Besprechung von Henning dazu (Henning, Verbesserung des Menschen, S. 124–127). Während für Thomas Hurka, Nietzsche: Perfectionist, in: Brian Leiter / Neil Sinhababu (Hg.), Nietzsche and Morality, Oxford 2007, S. 9–31, Conants Interpretation Nietzsche zwar zu einem „writer of banal self-help books” reduziert (S. 19, Anm. 27), ihn aber dennoch als „perfectionist“ und dabei „more stimulating for contemporary moral theorists than any earlier figure in the long line of perfectionist writers on ethics“ (S. 31) ver-steht, findet Vanessa Lemm, Is Nietzsche a Perfectionist? Rawls, Cavell, and the Politics of Culture in Nietzsche’s „Schopenhauer as Educator”, in: Journal of Nietzsche Studies 4 (2007), S. 5–27, S. 9, Conants Kommentar zu Stanley Cavells Nietzsche-Lektüre in James Conant, Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Pefectionism, Chicago 1990, zwar „illuminating”, bestreitet aber, dass Nietzsche ein Perfektionist ist: „Because the term perfectionism privileges the wholeness of the self over the perpetual becoming of the self, it does not grasp the full extent of Nietzsche’s conception of the becoming and overcoming of the individual self.” (S. 18). Daran schei-tert dann wohl auch der Nietzsche von Daniel W. Conway, Nietzsche and the Political, London / New York 1997, zugeschriebene „politische Perfektionismus“ (S. 6 ff.), für den der Übermensch zwar die
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 264NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 264 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
Posthuman oder Übermensch 265
renting“ ebenfalls eine starke Ähnlichkeit mit „genetic engineering“, die jedoch die Probleme des Hyperparenting nur deutlicher ins Licht rücke. Denn das Problem des genetic engineering liegt für Sandel nicht darin, dass die Eltern die Autonomie des Kindes verletzen, da dieses ja auch ohne technischen Eingriff seine genetischen Ei-genschaften nicht frei gewählt haben würde, sondern „in the hubris of the designing parents, in their drive to master the mystery of birth.“²¹ Hyperparenting sei daher wie genetic engineering ein Zeichen von Hybris, die sich über gewisse bisher geltende Schranken hinwegsetzt.
Hybris wird immer an einem Standard gemessen und ist insofern relativ. In Zur Genealogie der Moral nimmt Nietzsche die alten Griechen als Maßstab und stellt fest, dass sich für sie „unser ganzes modernes Sein, soweit es nicht Schwäche, sondern Macht und Machtbewusstsein ist, wie lauter Hybris und Gottlosigkeit“ ausgenommen haben würde:
Hybris ist heute unsre ganze Stellung zur Natur, unsre Natur-Vergewaltigung mit Hülfe der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und Ingenieur-Erfindsamkeit; Hybris ist unsre Stellung zu Gott, will sagen zu irgend einer angeblichen Zweck- und Sittlichkeits-Spinne hinter dem grossen Fangnetz-Gewebe der Ursächlichkeit – wir dürften wie Karl der Kühne im Kampfe mit Ludwig dem Elften sagen „je combats l’universelle araignée“ –; Hybris ist unsre Stellung zu u n s , – denn wir experimentiren mit uns, wie wir es uns mit keinem Thiere erlauben würden, und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf: was liegt uns noch am „Heil“ der Seele! (GM III 9, KSA 5.357)
Hybris ist ein Grundzug der Geschichte, der sich nicht erst in der genetischen Mani-pulation von Menschen, Tieren und Pflanzen zeigt, sondern schon seit langem die Stellung des Menschen gegenüber dem Ganzen des Seienden, Gott, Mensch und Welt betrifft. Sie ist ein Charakteristikum jedes versuchenden und in Frage stellenden Untersuchens und Forschens, jeder echten Philosophie, Wissenschaft und Technik, nicht erst des genetic engineering, das aus dieser geschichtsphilosophischen Per-spektive eher nur wie die Spitze eines Eisberges erscheint.²² Es geht nicht nur um
Antwort auf die grundlegende Frage der Politik: „what ought humankind to become?“ ist (vgl. S. 3, 12, 26), aber die (allzumenschliche) Menschheit nicht transzendiert, sondern ‚nur‘ perfektioniert und daher „any higher human being“ sein kann, dessen „‚private‘ pursuit of self-perfection occasions an enhancement of the species as a whole“, was „perhaps even by a cyborg mechanism“ zu verwirk-lichen ist (S. 25 f.). Für Paul van Tongeren, Nietzsche as ‚Über-Politischer Denker‘, in: Herman W. Sie-mens / Vasti Roodt (Hg.), Nietzsche, Power and Politics, Berlin / New York 2008, S. 69–83, S. 73, ist der Übermensch dagegen nicht die Verkörperung der Perfektion, sondern die Transzendenz des Men-schen, weder politisch noch anti- oder unpolitisch zu verstehen, sondern ‚über-politisch‘.21 Sandel, The Case against Perfection, S. 46. 22 Im Nachlass des Jahres 1883 schreibt Nietzsche: „Gottlos schien es den Älteren von uns und uner-sättlich gierig, in den Eingeweiden der Erde nach Schätzen zu wühlen“ (Nachlass 1882/83, 5[1], KSA 10.208), etwas später ergänzt durch den Zusatz: „nun giebt es neue Unersättliche!“ (Nachlass 1883, 12[21], KSA 10.403) Die neue Unersättlichkeit ergibt sich offenbar daraus, dass mit dem „Tod Gottes“
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 265NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 265 21.05.2013 12:43:1421.05.2013 12:43:14
266 Michael Skowron
das Problem des „genetic engineering“, sondern um das „Engineering“ als solches, dessen Problematik wir nur nicht mehr sehen, weil wir bereits an es gewohnt sind, oder erst wieder sehen, seit sie uns in der globalen Umweltkrise und im genetischen Engineering vor Augen geführt wird. Nietzsche will dabei natürlich nicht das In-Frage-Stellen und Forschen als solches diskreditieren und etwa auf altgriechische Maße zurückzuschrauben, was unmöglich wäre, sondern ihm geht es umgekehrt gerade darum, auch ihm historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, um aus der Reaktion einen Fortschritt zu machen.²³
Mit Martin Heidegger geredet geht es um „die Frage nach der Technik“, die für ihn niemals bloß ein Mittel zur Erreichung von Zwecken ist.²⁴ Schon 1955 in einem Vortrag in Meßkirch²⁵ und dann wieder in einem Fernsehinterview 1969 machte Hei-degger darauf aufmerksam, dass gefährlicher noch als die Atombombe das sei, was sich als „Biophysik“ entwickle, nämlich „daß wir in absehbarer Zeit im Stande sind, den Menschen so zu machen, d. h. rein in seinem organischen Wesen so zu konstruie-ren, wie man ihn braucht: Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und – Dumme. So weit wird es kommen.“ ²⁶ Übermensch und ewige Wiederkehr des Gleichen versteht Heidegger dabei als die beiden zusammengehörigen Konzepte Nietzsches, die dieser ganz neuen Herausforderung der Technik gewachsen sein sollten, denn der bishe-rige Mensch sei es offensichtlich nicht.²⁷ Heidegger selbst empfiehlt einerseits eine „Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt“, die er die „Gelassen-heit zu den Dingen“ nennt, andererseits eine Haltung, „kraft deren wir uns für den in der technischen Welt verborgenen Sinn offen halten,“ die er „die Offenheit für das Geheimnis“ nennt,²⁸ in der sowohl Nietzsches „amor fati“ nachhallt als auch Sandels
auch der Vorwurf und die Schranke der „Gottlosigkeit“ weggefallen ist. Kristian Köchy, Gentechnische Manipulation und die Naturwüchsigkeit des Menschen. Bemerkungen zu Habermas, in: Stefan Lorenz Sorgner / H. James Birx / Nikolaus Knoepffler (Hg.), Eugenik und die Zukunft, Freiburg / München 2006, S. 71–84, wendet kritisch gegen die von Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt am Main 2005, angewandte Unterscheidung von Gemachtem und Gewachsenem, die durch die Gentechnik verwischt werde, ein, dass dies nicht erst ein Spezifikum der Gentechnologie sei, sondern „das grundlegende Merkmal der neuzeitlichen Wis-senschaft überhaupt“ (S. 73) und, wenn nach Heinrich Schipperges im Ursprung der Heilkunde der Eingriff steht (S. 77), noch viel weiter zurückgehe.23 Werner Stegmaier, Nietzsches ‚Genealogie der Moral‘. Werkinterpretation, Darmstadt 1994, S. 179 f.24 Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre, Pfullingen 1962.25 Martin Heidegger, Gelassenheit, Pfullingen 1959, S. 20.26 Richard Wisser (Hg.), Martin Heidegger im Gespräch, Freiburg / München 1970, S. 73.27 Martin Heidegger, Wer ist Nietzsches Zarathustra? in: Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954, S. 97–122. Heidegger hält Nietzsches Versuch jedoch letztendlich für gescheitert, wes-halb er ihn auf seine Weise zu „wiederholen“ sucht. Vgl. Michael Skowron, Nietzsche und Heidegger. Das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main 1987. 28 Heidegger, Gelassenheit, S. 23 f.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 266NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 266 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
Posthuman oder Übermensch 267
„openness to the unbidden“²⁹ vorgebildet scheint. Sowohl bei Heidegger als auch schon bei Nietzsche geht es um die Haltung zu etwas, von dem das genetische En-gineering nur ein kleiner Teil ist und am vorläufigen Ende eines viel umfassenderen Geschehens steht, an dem man nichts ändern wird, wenn sich nicht die grundlegende innere Haltung des Menschen zur Technik ändert. Wenn Heidegger diese Haltung „Gelassenheit“ nennt, die Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur Technik,³⁰ so nennt es Nietzsche das In-und-über-den-Dingen-und-Menschen-Sein, das der „Über-mensch“ verwirklicht, und im Buddhismus würde man von „Non-attachment“ spre-chen.
3 Selbst-Überwindung und ewige Wiederkunft„Selbst-Erziehung“ ist, wie gezeigt, nur als „Selbst-Überwindung“ möglich. Letztere bleibt unterbestimmt, wenn sie nur als das beständige Bestreben „to constantly refine ourselves and to broaden our intellectual horizons“ und als „wish to permanently overcome [ourselves], to become stronger in the various aspects which can get deve-loped in a human being“ verstanden wird.³¹ Selbstüberwindung in diesem Sinne ist nur eine Verlängerung und Steigerung von bereits Bekanntem im Sinne des Höher, Schneller, Weiter, kurz: Perfektionie rung, aber keine neue Stufe, die über der vorhe-rigen liegt, kein Transzendieren. Das transhu manistisch-technologische „Enhance-ment“ ist keine Überwindung, noch weniger „Selbst überwindung“, sondern ganz im Gegenteil „self-preservation, self-assertion, self-advance ment“, wie Babette Babich bemerkt.³² Selbstüberwindung ist dagegen immer relativ zu einem „Selbst“, mit dem man sich identifiziert – es kann das anerzogene soziale, kulturelle, politi sche
29 Sandel, The Case against Perfection, S. 45 f.30 „Wir können die technischen Gegenstände im Gebrauch so nehmen, wie sie genommen werden müssen. Aber wir können diese Gegenstände zugleich auf sich beruhen lassen, als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen angeht. Wir können ‚ja‘ sagen zur unumgänglichen Benützung der technischen Gegenstände, und wir können zugleich ‚nein‘ sagen, insofern wir ihnen verwehren, daß sie uns ausschließlich beanspruchen und so unser Wesen verbiegen, verwirren und zuletzt ver-öden.“ (Heidegger, Gelassenheit, S. 22 f.) Da Heidegger in der künstlichen Herstellung des Lebens und der Genmanipulation einen direkten „Angriff auf das Leben und das Wesen des Menschen“ selbst sieht (S. 20), ist klar, dass er sie mit einem klaren Nein beantwortet. Nicht in Bezug auf Heideggers „Gelassenheit“, sondern auf seine Beiträge zur Philosophie und die Frage nach der Technik, aber auch auf Nietzsche vgl. Babette Babich, Heideggers „Beiträge zur Philosophie“ als Ethik. Phronesis und die Frage nach der Technik im naturwissenschaftlichen Zeitalter, in: Sorgner / Birx / Knoepffler (Hg.), Eugenik und die Zukunft, S. 43–69. 31 Sorgner, Nietzsche, the Overhuman, and Transhumanism, S. 35.32 Babette Babich, Nietzsche’s Post-Human Imperative: On the „All-too-Human“ Dream of Trans-humanism, in: The Agonist 4.2 (2011), S. 24, www.nietzschecircle.com/AGONIST/2011_08/Dream_of_Transhumanism.pdf.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 267NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 267 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
268 Michael Skowron
„Selbst“ einer Volks- oder Rassenzugehörigkeit, des Geschlechts oder des Glaubens sein – und das überwunden wird, bis schließlich kein „Selbst“ mehr übrig bleibt bzw. das „wahre Selbst“ zum Vorschein kommt.
Ein angemessenes Verständnis von „Selbstüberwindung“ ist für das Verständ-nis des Übermenschen entscheidend, weil die „Selbst-Überwindung“ eine „Stufe“ in der (Selbst-) Überwindung des Menschen ist (Nachlass 1884, 27[79], KSA 11.295). Man kann sie sich zunächst an einigen Beispielen Nietzsches selbst veranschaulichen.³³ Der frühe Nietzsche war seinen eigenen Worten zufolge „Einer der corruptesten Wag-nerianer“ (WA 3, KSA 6.16) und, so kann man wohl hinzufügen, auch Schopenhau-erianer, wandelte sich aber zu einem der entschiedensten Anti-Wagnerianer und Anti-Schopenhauerianer und von Wagners Antisemitismus zum Anti-Antisemiten. Nietzsche wurde als Sohn eines protes tantischen Geistlichen geboren und in christ-lichem Geiste erzogen, wandelte sich aber zum Antichristen. Der Antichrist sei „die nothwendige Logik in der Entwicklung eines echten Christen“, in ihm „überwindet sich das Christenthum selbst.“ (Nachlass 1888, 24[1], KSA 13.622) Nietzsche war Deut-scher, aber er war der Meinung, dass gut deutsch sein heiße, sich zu entdeutschen: „Ein g u t e r Deutscher – man verzeihe mir’s, wenn ich es zehnmal wieder hole – ist kein Deutscher mehr.“ (Nachlass 1884, 26[412], KSA 11.261; vgl. 26[395], KSA 11.255; MA II, VM 323)³⁴ Zarathustra ist für Nietzsche nichts anderes als „die Selbstüberwin-dung des Moralisten in seinen Gegensatz“, in ihn selbst, den Immoralisten Nietzsche (EH, Warum ich ein Schicksal bin 3). Der wiederkehrende Zarathustra Nietzsches ist das Gegenteil des historischen Zarathustra/Zoroaster. Selbstüberwindung ist für Nietzsche sogar ein „Gesetz“, „das Gesetz des Lebens, das Gesetz der n o t h w e n -d i g e n „Selbstüberwindung“ im Wesen des Lebens“ (GM III 27, KSA 5.410).³⁵ Aus all diesen Beispielen geht bezüglich des Übermenschen als der „Selbstüberwindung des Menschen“ zumindest dies hervor, dass er zumindest auch das Gegenteil des Men-schen ist und nicht bloß dessen Perfektion sein kann.
Von dieser Selbstüberwindung als Hindurchgehen durch den Gegensatz seiner selbst ist beim genetischen „Enhancement“ nie die Rede, vermutlich weil man annimmt, dass es weder zur Erreichung des Posthuman noch für diesen selbst nötig
33 Nietzsche (er)kannte sich darin selbst: „Meine Selbst-Überwindung ist im Grunde meine stärkste Kraft: ich dachte neulich einmal über mein Leben nach und fand, daß ich gar n i c h t s weiter bisher gethan habe.“ (Nietzsche an Franz Overbeck, 31. Dezember 1882, Nr. 366, KSB 6.314; vgl. Nachlass 1882/83, 4[13], KSA 10.112).34 Nietzsche sah sich nicht nur selber lieber als Pole denn als Deutscher, seit der Übernahme sei-ner Professur in Basel hatte er auch keine deutsche (preußische) Staatsbürgerschaft mehr. Vgl. An-dreas Rupschus, Nietzsche und sein Problem mit den Deutschen, in: Nietzsche-Studien 40 (2011), S. 72–105.35 Vgl. Michael Skowron, Necessary ‚Self-Overcoming‘. Metaphor and Example in Nietzsche and Zarathustra, in: Ders., Nietzsche – Buddha – Zarathustra. Eine West-Ost-Konfiguration, Daegu 2006, S. 49–73; Skowron, Art. Selbstüberwindung, in: Niemeyer (Hg.), Nietzsche-Lexikon, S. 347 f.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 268NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 268 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
Posthuman oder Übermensch 269
ist. Der Übermensch hat sich dagegen wieder selbst zu überwinden, und zwar muss er, wie Zarathustra schon zu Be ginn zeigt und ankündigt, wieder untergehen, unter die Menschen gehen, wieder Mensch werden.³⁶ Mensch und Übermensch sind in den Kreislauf der ewigen Wiederkunft des Glei chen als Gesetz der „ n o t h w e n d i g e n „Selbstüberwindung““ eingebunden und in ihm ‚aufge hoben‘: sowohl der (kleine) Mensch (Za III, Der Genesende 2) als auch der Übermensch kehrt ewig wieder (Nach-lass 1884, 27[23], KSA 11.281). Zu diesen beiden komplementären Auf-, Über- und Un-tergängen des Menschen und des Übermenschen findet sich im Transhu manismus nicht der leiseste Hauch einer Entsprechung, auch weil ihm Nietzsches Gedanke der ewigen Wiederkunft des Gleichen völlig fremd bleibt.
Fortschritt im Sinne der Verbesserung äußerer und innerer, genetischer Lebens-bedin gungen und technologischer Errungenschaften ist nicht schon Fortschritt im Sinne der Selbst überwindung und kann diese nicht ersetzen. Selbstüberwindung be-deutet, dass nur das zu größerer Macht über sich selbst und in dessen Folge vielleicht auch über andere führt, was man aus und durch sich selbst heraus geleistet hat. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne haben „[n]ur die e r g a n g e n e n Gedanken […] Werth.“ (GD, Sprüche und Pfeile 34) Weisheit, die aus dem falschen Munde kommt, wirkt schal. Jeder neue Mensch ist in dieser Weise ein Anfänger, den nur das, was er aus sich selbst heraus geleistet hat, zufrieden und glücklich machen kann. Weder Erziehung noch technologische Verbesserungen können ihm diese Auf gabe abneh-men und glücklicherweise nicht abnehmen, da seine unverwechselbare Individua-lität darauf beruht. Autonomie kann nicht heteronom verordnet oder gelehrt werden, sondern bedarf eines ausdrücklichen, eigenen Willens zur Macht über sich selbst.
Für die meisten Transhumanisten ist Nietzsches Gedanke der ewigen Wiederkunft des Gleichen ein Stein des Anstoßes, auch wenn sie ansonsten Nietzsche mit dem Transhumanis mus für durchaus vereinbar halten. Für More ist die ewige Wiederkunft „the most salient ex ample of a Nietzschean idea alien to transhumanism”, obwohl Nietzsche selbst sie untrennbar vom Übermenschen gehalten habe. Sie sei nicht nur „a bizarre metaphysics in itself“, sondern auch ein Teil von Nietzsches „denial of the idea of progress“, was auf keinen Fall mit dem Transhumanismus vereinbar sei.³⁷ In-wiefern Nietzsche die ewige Wiederkunft für „insepara ble“ vom Konzept des Über-menschen hielt, bleibt unbeantwortet. Mores Vorschlag, dass Nietzsche als Gegner philosophischer Systembildung wohl kaum Einwände gegen das „picking and choo-sing“ der Transhumanisten aus seinen Gedanken gehabt haben würde, erin nert le-
36 Wenn Zarathustra „wieder Mensch werden“ will (Za I, Zarathustra’s Vorrede 1), so kann dies nur heißen, dass er zuvor etwas anderes als „Mensch“ ist, „eine Art Übermensch“. Nicht nur spricht er mit der Sonne wie mit einem ebenbürtigen Partner, mit dem er sich vergleicht und den er sogar segnet, in Ecce homo stellt Nietzsche auch ausdrücklich fest, dass in Zarathustra „in jedem Augenblick der Mensch überwunden, der Begriff „Übermensch“ […] höchste Realität“ geworden sei (EH, Za 6). 37 More, The Overhuman in the Transhuman, S. 1 f.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 269NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 269 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
270 Michael Skowron
diglich an Nietzsches Wort von den schlechtesten Lesern, die er mit „plündernde[n] Sol daten“ vergleicht (MA II, VM 137). Sorgner hält anders als More die ewige Wieder-kunft und den Übermenschen dagegen nicht für untrennbar, sondern glaubt sie ohne Schaden für den Trans humanismus logisch voneinander trennen zu können, so dass man die ewige Wiederkunfts lehre nicht mehr in Betracht ziehen müsse.³⁸
Der Sinn der ewigen Wiederkunft des Gleichen in ihrem Verhältnis zum Übermen-schen ist jedoch vor allem der, dass die Selbstüberwindung des Menschen in jedem Einzelfall immer wieder von Neuem beginnen muss und weder durch Erziehung noch auf technologischem Wege umgangen werden kann. Kann die Wiederkunftslehre also zwar vom „Posthuman“, aber nicht vom „Übermenschen“ getrennt werden, so ist sie in der Tat eines der stärksten Argumente gegen den technologischen Transhumanis-mus. Denn sie schließt ein, dass die zeitlich-evolutionäre Bedeutung des Übermen-schen nur ein Aspekt ist, der durch die räumlich-vertikale Dimension des „Über“ und damit die „Selbstüberwindung“ ergänzt werden muss. Ewigkeit ist keine Zeit mehr und fällt mit dem Augenblick ebenso zusammen wie einmaliges und ewig wieder-kehrendes Leben. Wenn Transhumanisten kein Verständnis für die Zusammengehö-rigkeit von Übermensch und ewiger Wiederkunft haben, so bestätigen sie damit nur den Verdacht, dass der Posthuman kein Übermensch, sondern für Nietzsche eher ein „letzter Mensch“ sein wird, in dem selbst die Möglichkeit der ewigen Wiederkehr der Aufgabe der „Selbst-Überwindung“ beseitigt ist, weil der „Keim“ seiner „ersten Natur“ nicht nur vertrocknet ist, sondern durch gentechnische Manipulation zerstört wurde.
4 Übermensch und letzter MenschSofern „Transhumanismus“ eigentlich nur heißt, dass über den Humanismus und den Menschen hinausgegegangen wird oder werden soll, dass er transzendiert wird, wobei offen bleibt, wohin dieser Überstieg erfolgt und wie er eingeschätzt wird, kann man Nietzsche durchaus als „Transhumanisten“ bezeichnen. Nietzsche unterscheidet sich vom Transhumanismus im engeren Sinne jedoch nicht nur dadurch, dass dieser den Weg zum „Posthuman“ vor allem durch technologische Optimierung des Men-schen erreichen will, Nietzsche den „Übermenschen“ aber durch Selbstüberwindung, sondern auch darin, dass der transhumanistische Weg zum „Posthuman“ Nietzsche gegenüber wie eine Einbahnstraße mit nur einem Ziel erscheint, während es für
38 Sorgner hält auch die Argumente von Paul S. Loeb, Nietzsche’s Transhumanism, in: The Agonist 4.2 (2011), www.nietzschecircle.com/AGONIST/2011_08/Loeb_Nietzsche_Transhumanism.pdf, für die Zusammengehörigkeit von ewiger Wiederkunft und Übermensch (jene ermögliche erst die für den Fortschritt zum Übermenschen erforderliche ‚Macht über die Zeit‘) für unplausibel.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 270NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 270 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
Posthuman oder Übermensch 271
Nietzsche einen doppelten Weg gibt, einen zum „Übermenschen“ und einen anderen zum „letzten Menschen“.³⁹
Beide sind zudem zu zwei weiteren „Typen“ in Beziehung zu setzen, den „höheren Menschen“ einerseits und den „gewöhnlichen“, „wirklichen Menschen“, denen Zara-thustra versichert, dass sie noch genug „Chaos“ in sich hätten, „um einen tanzenden Stern [was man als eine weitere Metapher für den Übermenschen verstehen kann, M.S.] gebären zu können“ (Za I, Zarathustra’s Vorrede 5, KSA 4.19), andererseits. Sie unterscheiden sich vom Übermenschen und letzten Menschen dadurch, dass diese Zukunftsvisionen sind, sie selbst aber nicht, wie sich auch an dem Auftreten von „höheren Menschen“ im vierten Teil von Also sprach Zarathustra zeigt. Setzt man dem-gegenüber den letzten Menschen einfach mit dem gegenwärtigen, wirklichen Men-schen gleich und reduziert diese vier „Typen“ auf nur drei, wie dies auch bei Sorgner geschieht,⁴⁰ so wird der „höhere Mensch“ zu einer Art „Posthuman“, der immer noch zur menschlichen Art gehört, wenn er sie auch in ungeahnter Weise erweitert, der Übermensch“ aber zu einer „neuen Spezies“ oder „Gattung“, einem „Posthuman“ in dem Sinne, dass er sich mit Menschen nicht einmal mehr fortpflanzen kann. Der Post-humane schwankt zwischen diesen beiden Möglichkeiten.⁴¹
Gehen wir dagegen von vier „Typen“ aus und davon, dass der Übermensch ebenso wie der letzte Mensch eine Zukunftsvision ist, deren Voraussetzung wirkliche Menschen sind, so ist es auch denkbar, dass nicht der Übermensch, sondern viel-mehr der letzte Mensch durch technologische Mittel verwirklicht werden könnte. Wie sich bereits zeigte, spricht einiges da für, dass für Nietzsche eher Letzteres der Fall sein würde. Der letzte Mensch, wie ihn Zara thustra beschreibt, hat Eigenschaften, die den transhumanistischen Zielen des Posthumanen, wie glückliches, gesundes und langes, wenn nicht unsterbliches Leben, bisher unerreichte In telligenz und ähnliche Fähigkeiten, die eher an Superman erinnern, nicht unähnlich sind. Er lebt nämlich nicht nur am längsten, sondern er ist auch „klug und weiss Alles, was geschehn ist:
39 Nachlass 1883, 7[21], KSA 10.244; 16[49], KSA 10.514; Nachlass 1886/87, 5[61], KSA 12.208. Dass Nietzsche die Bewegung zum letzten Menschen mit ihrer zunehmenden Nivellierung und Vermittel-mäßigung als mehr oder weniger unvermeidlich ansah, spricht ebenfalls dafür, dass der Übermensch nur durch „Selbst-Initiativen“, die dem entgegenwirken, zu verwirklichen ist. Vgl. Werner Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie. Kontextuelle Interpretation des V. Buchs der Fröhlichen Wis-senschaft, Berlin / Boston 2012, S. 565 ff.40 Sorgner, Menschenwürde, S. 221.41 Sorgner, Menschenwürde S. 221 ff., 255 f. Ist es in einem Nachlassnotat von 1880, wie bereits er-wähnt, eine „ h ö h e r e G a t t u n g a l s d e n M e n s c h e n“, die der Einzelne gerade vermöge „seiner individuellsten Dinge“ erreichen soll (Nachlass 1880, 6[158], KSA 9.237), so nennt Nietzsche später die Frage, „[w]as für ein Typus die Menschheit einmal ablösen wird […], bloße Darwinisten-Ideologie. Als ob je Gattung abgelöst wurde!“ Sein Problem sei vielmehr das „der Rangordnung innerhalb der Gattung Mensch, an deren Vorwärtskommen im Ganzen und Großen“ er nicht glaube (Nachlass 1888, 15[120], KSA 13.481). Dort geht Nietzsche jedoch von einem „Begriff vom Menschen“ aus, den man durch Abstreifen des Individuellen gewinnt, während hier von der biologischen Gattung die Rede ist.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 271NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 271 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
272 Michael Skowron
so hat man kein Ende zu spotten. […] Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüst chen für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit. / „Wir haben das Glück er-funden“ – sagen die letzten Menschen und blinzeln.“ (Za I, Zarathustra’s Vorrede 5, KSA 4.20)⁴² Technische Erfindungen und Verbes serungen des Menschen könnten sehr wohl die Voraussetzungen für diese ‚Erfindung‘ des Glücks bereitstellen, und das Blinzeln als ein Zwinkern mit den Augen nicht nur darauf hin weisen, dass man nicht so genau versteht, sondern auch, dass es gar nicht darauf ankommt, weil alles sowieso nicht ernst zu nehmen ist.⁴³ Der Übermensch andererseits wird von Zara-thustra mit den Metaphern „Blitz“ und „Wahnsinn“⁴⁴ beschrieben, was eher auf ein sehr kurz es und auch nicht gerade an der Klugheit orientiertes Leben deutet. Techno-logische Opti mierungen des Menschen (enhancement) erwarten Verbesserungen wie bei einem Plug-in vor allem „von außen“ und vergessen dabei, dass die wichtigsten, wenn nicht einzigen Verbesse rungen nur von einer „Revolution der Denkart“ (Kant), also nur von innen kommen können.⁴⁵
42 Als Verkleinerungsformen stehen diese „Lüstchen“ einerseits zwar in Beziehung zu der „Lust“, die „Ewigkeit, […] t i e f e , t i e f e E w i g k e i t “ will (Za III, Das andere Tanzlied 3; Za IV, Das Nacht-wandler-Lied 12) und in GD als die tragische Begierde, „die ewige Lust des Werdens s e l b s t z u s e i n“, bestimmt wird (GD, Was ich den Alten verdanke 5), sind aber andererseits von ihr radikal verschieden, weil die „Lüstchen“ der Selbsterhaltung dienen, die „Lust“ des ewigen Werdens dage-gen immer auch den eigenen Untergang, die Selbstüberwindung, einschließt. Jene „Lüstchen“ sind menschlich, diese „Lust“ übermenschlich. Sorgner, Menschenwürde, S. 220 f., deutet die „Lüstchen“ als die Spiele, die der letzte Mensch zur Erholung von der Arbeit braucht, vielleicht im Sinne von „panem et circenses“, obwohl auch die Arbeit für den letzten Menschen nur noch „Unterhaltung“ ist.43 Womit sich doch wiederum eine Annäherung an die Gegenwart ergibt, allerdings ohne auch schon das Leben zu verlängern. Vgl. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, New York 1985.44 „Alle Zeichen des Übermenschlichen erscheinen als Krankheit oder Wahnsinn am Menschen.“ (Nachlass 1882/83, 5[1], KSA 10.217, ebd., 4[171], KSA 10.162) Zu den Metaphern der Metapher des Über-menschen (außer denen des Blitzes und des Wahnsinns auch die des Wassers, Sees, Flusses, Stromes, Meeres) bemerkt Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 585, treffend: „Man soll nicht wissen, was der Übermensch in Wahrheit, jenseits der miteinander verflochtenen, einander über-kreuzenden und sich aneinander brechenden Metaphern ist: Nietzsche zeigt nur die Spielräume, in denen sein Sinn sich bewegt. Eben so erfüllt die Metapher ‚Übermensch‘ ihren Sinn, über jeden fest-gestellten Begriff des Menschen, wo immer es nötig wird, hinauszugehen.“ Die Gegen-Metapher zur Metapher des „Übermenschen“ ist demgemäß der „letzte Mensch“, „die so den Sinn des letzten, end-gültigen, definitiven Begriffs oder kurz: einer allgemeingültigen Definition des Menschen bekommt, die Menschen nötig haben können, um selbst unter sie zu fallen und dadurch ihre zeitweise schwer zu ertragende Individualität loszuwerden“, die ihnen der Gedanke der ewigen Wiederkehr unaus-weichlich auferlegt.45 Enhancement ist für Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frank-furt am Main 2009, S. 530, der aktuelle Schlüsselbegriff für veräußerlichte Steigerungen auf der Linie äußerer Anwendungen, die es für den Einzelnen möglich und wünschenswert erscheinen lassen, „auf sein eigenes Leben wie auf ein äußeres Datum zuzugreifen, ohne daß er sich bequemen müßte, sein Dasein übend zu gestalten. […] Wo der enhancement-Gedanke dominiert, wird die Erhöhung des
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 272NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 272 21.05.2013 12:43:1521.05.2013 12:43:15
Posthuman oder Übermensch 273
Das Problem dieses „Inneren“, seiner Kämpfe und Selbstüberwindungen, liegt vor al lem darin, dass es aus einer Fremdperspektive nicht unmittelbar beobachtet werden kann. Die objektivierende Betrachtung sieht eine andere ewige Wiederkehr des Gleichen, für die jeder Gipfel von heute zur Ebene von morgen wird, so dass es nahe liegt, entweder jeglichen „Fort schritt“ und jede Differenz von Oben und Unten überhaupt zu leugnen oder aber umgekehrt den „Fortschritt“ zum Normalfall zu er-klären, der gar nicht zu bestreiten ist, weil er notwen digerweise sowieso auftritt.⁴⁶ In beiden Fällen sind ein inneres Selbst und „Selbstüberwin dung“ überflüssig. Für Nietzsche gibt es jedoch eine „innere Welt“, die der „äußeren Welt“ der bloßen Kräfte ergänzend zugesprochen werden muss, um überhaupt verständlich zu sein. Der Name für diese „innere Welt“ ist der „Wille zur Macht“, „d. h. als unersättliches Verlan gen nach Bezeigung der Macht; oder Verwendung, Ausübung der Macht, als schöpferischen Trieb“ (Nachlass 1885, 36[31], KSA 11.563), als Wille „zur beständigen Schöpfung oder zur Verwandlung oder zur Selbst-Überwältigung“ (Nachlass 1885, 35[60], KSA 11.538). Mit der Welt des „Inneren“ ist zugleich das „Selbst“ und damit der Wille zur „Selbstüberwindung“ gegeben, der sich in vertikaler Richtung bewegt und eine andere Art der „ewigen Wiederkunft des Gleichen“ bedeutet, die damit eine fundamentale Zweideutigkeit oder besser: inhärente Spannung offenbart.⁴⁷
Leistungsniveaus wie eine Dienstleistung in Anspruch genommen, bei der die Eigenanstrengung des Einzelnen sich auf den Hinzukauf der aktuellsten Prozeduren beschränkt.“46 Vgl. Michael Skowron, Evolution und Wiederkunft. Nietzsche und Darwin zwischen Natur und Kultur, in: Nietzscheforschung 17 (2010), S. 45–64. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, S. 193, spricht im Anschluss an Richard Dawkins und zur Erläuterung von Zarathustras Rede vom Hinauf- und nicht nur Fortpflanzen (Za I, Von Kind und Ehe) vom „Gesetz der Normalisierung des Unwahr-scheinlichen.“47 Diese Spannung zeigt sich sowohl in der bekannten Unterscheidung zwischen einer kosmologisch-wissen schaftlichen und einer anthropologisch-existenziellen Variante dieser „Lehre“, die auch eine „Anti-Lehre“ ist (vgl. Werner Stegmaier, Anti-Lehren. Szene und Lehre in Nietzsches Also sprach Zara-thustra, in: Volker Gerhardt (Hg.), Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra (Klassiker auslegen), Berlin 2000, S. 191–224), als auch in ihrer Fassung als „ex tremste Form des Nihilismus“ (Nachlass 1886/87, 5[71], KSA 12.213) einerseits, „höchste Formel der Beja hung, die überhaupt erreicht werden kann“ (EH, Za 1), andererseits. In der Wiederkunftsformel bleibt zudem, „klar erkennbar, unbe-stimmt, ob sie die wesentliche Unveränderlichkeit alles Geschehens, oder aber ein Grund gesetz der we-sentlichen Veränderung in allem Geschehen formulieren will“. Sie genügt damit einem „Grundgesetz der sprachlichen Metaphorik“ und ist zugleich „eine elementare metaphorische Formel für die Um-wertung aller Werte.“ (Reiner Wiehl, Ressentiment und Reflexion. Versuchung oder Wahrheit eines Theorems von Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 2 (1973), S. 61–90, S. 84 f.) Vgl. Michael Skowron, Zara-thustra-Lehren. Über mensch, Wille zur Macht, Ewige Wiederkunft, in: Nietzsche-Studien 33 (2004), S. 68–89, S. 77–87. Zur „ewigen Wiederkunft/-kehr“ vgl. Michael Skowron, Dionysischer Pantheismus. Nietzsches Lenzer Heide-Text über den europäischen Nihilismus und die ewige Wiederkunft/-kehr, erscheint in: Nietzscheforschung 21 (2013).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 273NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 273 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
274 Michael Skowron
5 „Höher“, „Über“, „Letzter“, „Post“Beachtet man die in der Rede vom Übermenschen, letzten und höheren Menschen sowie dem Posthumanen verwendeten Epitheta, so zeigen sich weitere aufschlussrei-che Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die den Übermenschen sowohl vom letzten Menschen als auch vom Posthumanen trennen. Bereits beim frühen Nietzsche findet sich eine weittragende Bemerkung über die Präposition „über“, die vor allem eine räumlich-vertikale Bedeutung hat:⁴⁸
„Ü b e r d e n D i n g e n “ . – Wer die Präposition „über“ ganz begriffen hat, der hat den Umfang des menschlichen Stolzes und Elends begriffen. Wer ü b e r den Dingen ist, ist nicht i n den Dingen — also nicht einmal i n sich! Das letztere kann sein Stolz sein. (Nachlass 1876, 17[33], KSA 8.303)
Allerdings ist hier noch von einem „ü b e r den Dingen“, nicht von einem ‚über dem Menschen‘ selbst die Rede, obwohl dies insofern eingeschlossen ist, als der Betref-fende „nicht einmal i n sich“ mehr ist. Wer über dem Menschen ist, ist nicht im Menschen, auch nicht einmal in sich selbst. Wo aber ist er dann? In Menschliches, Allzumenschliches spricht Nietzsche von dem Menschen, dem als „der wünschens-wertheste Zustand jenes freie, furchtlose Schweben über Menschen, Sitten, Gesetzen und den herkömmlichen Schätzungen der Dinge“ genügt (MA I 34). Da er als Mensch auch „über Menschen“, sich selbst eingeschlossen, schwebt, ist er sowohl in als auch außer sich.⁴⁹
48 Übersetzungen ins Englische mit der Vorsilbe „over“ (wie „overhuman“) sind daher solchen mit „super“ (wie „superman“) vorzuziehen.49 Man könnte Nietzsches Begriff des „Über“ mit Kants Begriff der Vernunft als einem „höheren“ Vermögen ge genüber dem Verstand (und den Sinnen) in Verbindung bringen, sofern die Vernunft den begrifflichen Bestim mungen des Verstandes gegenüber auf die Vorläufigkeit alles Ansehens von etwas als bestimmt verweist und dadurch auch das Subjekt „über seine Subjektivität, d. h. über den Begriff, das Zugrundeliegende aller Bestim mungen zu sein, hinaus“ führt (Josef Simon, Auf-klärung im Denken Nietzsches, in: Jochen Schmidt (Hg.), Aufklä rung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegen wart, Darmstadt 1989, S. 459–474). Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, dessen Buch man auch als ein Kompendium der „Vertikalspannungen“ mit der ethischen Ur-Maxime: „Du sollst auf die innere Senkrechte achten und prüfen, wie der Zug vom oberen Pol her auf dich wirkt“ (S. 99), lesen kann, bezieht das „Über“ in „Überleben“ (von dem Nietzsche überaus selten spricht) und in „Übermensch“ auf die „wachsen-den Unwahr scheinlichkeiten“ der darwinistischen Evolution, ohne allerdings Nietzsches Kritik des ‚Kampfs ums Dasein‘ oder die ‚Überwindung‘ des Selbst zu berücksichtigen (S. 187, vgl. S. 202 ff.). Das „Überleben“ und die „Über humanisierung“ verkörpern demnach „die Tendenz zum Aufstieg vom Wahrscheinlichen ins weniger Wahr scheinliche“, das dann jedoch wieder normalisiert wird, wobei Sloterdijk eine katapultartig erscheinende „überdurchschnittliche Unwahrscheinlichkeit“ und eine „Bewegung zum Übergewöhnlichen hin“ dennoch nicht abstreiten kann (S. 298 f.). Wenn Sloterdijk in diesem Zusammenhang behauptet, dass der von Nietzsche so genannte „Sklavenaufstand in der
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 274NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 274 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
Posthuman oder Übermensch 275
In Also sprach Zarathustra erhält das „Über“ des Übermenschen jedoch offen-sichtlich auch eine zeitliche Dimension, sofern der Übermensch derjenige ist, der an dem zumindest vorläufigen Ende des Weges vom Tier über den Menschen hinaus steht. Eine der aufschluss reichsten Bestimmungen des Übermenschen, die die räum-liche und zeitliche Bedeutung vereint, besagt, dass dieser sich zum Menschen ver-halten werde wie der Mensch zum Affen. Der Affe ist für den Menschen einerseits „ein Gelächter“, weil er sich weit über ihn hinaus entwickelt hat und er ihn unter sich sieht, aber sein Anblick erweckt andererseits auch „eine schmerzli che Scham“, weil der Mensch sich im Affen zugleich auch wiedererkennt und beide „Nah-Ver-wandte“ sind (Za I, Zarathustra’s Vorrede 3). Genauso wie der Mensch über dem Affen „schwebt“ und ein eigenständiges Leben mit ganz neuen Interessen, Aufgaben und Zielen führt, ist auch der Übermensch ein eigenständiges Wesen mit einer neuen Le-benssphäre und neuen Aufga benbereichen. Im Nachlass vergleicht Nietzsche den Übermenschen mit den Göttern Epikurs, die sich im Grunde nicht um die Menschen kümmern und diese nicht um jene (Nachlass 1883, 7[21], KSA 10.244; Nachlass 1885, 35[73], KSA 11.541; Nachlass 1881/82, 16[8], KSA 9.660). So wie der Mensch „über“ den Wertschätzungen, Interessen, Lebensweisen und Aufgaben des Affen lebt, wird auch der Übermensch „über“ dem Menschen leben. Von einer von Nietzsche ange-strebten Zwei-Klassen-Gesellschaft zu sprechen,⁵⁰ scheint daher genauso abwegig wie von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft in Hinsicht auf Götter und Menschen oder Menschen und Affen zu reden. Nimmt man Nietzsches Lehre von der ewigen Wieder-kunft des Gleichen ernst, so könnte sich zudem die zeitlich-evolutionäre Perspektive der Entwick lung zum Übermenschen als nur partiell und auf den Menschen zuge-schnittenes Hilfsmittel des Verstehens erweisen. Denn ein Hauptproblem der Rede vom Übermenschen ist, dass wir immer (noch) aus der Perspektive des Menschen und dessen Begriffs- und Verständnismög lichkeiten sprechen, die sich aus der Perspek-tive des Übermenschen selbst als falsch, vorläu fig, beschränkt oder unangemessen erweisen könnten. Der Übermensch kann kein Ziel der Wissenschaft sein, da Wissen-
Moral“ im alten Europa niemals stattgefunden habe (S. 204 ff., S. 324), so hat er seine eigenen frü-heren Explikationen in Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt am Main 1983, die auf der Unterscheidung von (plebejischem) Kynismus und (Herren-)Zynismus und ihrem Widerspiel basieren, offenbar vergessen (vgl. insbesondere S. 422 ff., sowie die epochemachende Umkehrung im Subjekt-Objekt-Verhältnis, S. 373 f., S. 639 ff., S. 652 ff.). 50 Sorgner, Beyond Humanism, S. 7; Sorgner, Menschenwürde, S. 227, wobei die Zweiklassengesell-schaft allerdings nur eine „Voraussetzung der Entwicklung hin zum Übermenschen“ sein soll (S. 232). Vgl. dazu insbesondere Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 555–568; Werner Steg-maier, Friedrich Nietzsche zur Einführung, Hamburg 2011, S. 189–194, wonach Nietzsche von Anfang an keine ständische Verfestigung sozialer Klassen wollte, sondern die Einzelnen je nach dem Grad ihrer ‚Geistigkeit‘ die Klassen wechseln können sollten, wodurch „ein Zustand erreicht“ werde, „über den hinaus man nur noch das offene Meer unbestimmter Wünsche sieht.“ (MA I 439) Das „offene Meer“ wird später zu einer Metapher des Übermenschen (vgl. FW 343; Stegmaier, Nietzsches Befrei-ung der Philosophie, S. 114 ff., S. 582–595).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 275NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 275 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
276 Michael Skowron
schaft nur zeigen, aber nicht befehlen und Wege weisen kann (Nachlass 1880, 7[179], KSA 9.354, ebd., 8[98], KSA 9.403), er darf ihr aber auch nicht widersprechen und muss mit ihr kompatibel sein.
Nietzsche macht dementsprechend eine Unterscheidung zwischen dem Esoteri-schen und dem Exoterischen, die wiederum räumlich-vertikale Metaphern gebraucht. Denn das We sentliche dieser Unterscheidung sei nicht, dass der Exoteriker draußen stehe und von außen her, der Esoteriker aber von innen her sehe, schätze, messe und urteile, sondern dass der Exo teriker „von Unten hinauf die Dinge sieht, – der Eso-teriker aber v o n O b e n h e r a b ! “ (JGB 30) Der Esoteriker steht über den Dingen und sich selbst, die Frage kann nur sein: wie hoch? Im Nachlass gibt Nietzsche zwei konkrete Beispiele für diese unterschiedlichen Perspektiven von oben und von unten: „alles ist Wille gegen Willen“ ist exoterisch gesehen, „[e]s giebt gar keinen Willen“ dagegen esoterisch. Der „Causalismus“ ist ebenfalls exoterisch, „[e]s giebt nichts wie Ursache-Wirkung“ dagegen wiederum esoterisch (Nachlass 1886/87, 5[9], KSA 12.187).⁵¹ Esoterisch ist „das philosophische Pathos“, das „die Welt wie von einem Ber ge aus überblickt.“ (WA 1)
Eine vorwiegend räumlich-vertikale Bedeutung hat das „Über“ auch dort, wo Nietz sche in Ecce homo Zarathustra als denjenigen beschreibt, in dem „in jedem Au-genblick der Mensch überwunden, der Begriff „Übermensch“ […] höchste Realität“ geworden sei, weil „in einer unendlichen Ferne […] alles das, was bisher gross am Menschen hiess, u n t e r ihm“ liege (EH, Za 6). Das Vorwort zum Fall Wagner wünscht sich in diesem Sinne ebenfalls „das Auge Z a r a t h u s t r a’ s , ein Auge, das die ganze Thatsache Mensch aus ungeheurer Ferne übersieht, – u n t e r sich sieht …“ (WA, Vorwort) Schon der erste Entwurf der „Grundconception“ des Zarathustra trägt dem-entsprechend die Unterschrift: „„6000 Fuss jen seits von Mensch und Zeit““ (EH, Za 1) bzw. im Nachlass: „6000 Fuss über dem Meere und viel höher über allen menschli-chen Dingen!“ (Nachlass 1881, 11[141], KSA 9.494)⁵² Letzten Endes geht es darum, eine „Höhe und Vogelschau der Betrachtung [zu] gewinnen, wo man begreift, wie Alles so,
51 Vgl. van der Braak, Nietzsche and Zen, S. 162 ff.52 Bill Hibbard, Nietzsche’s Overhuman is an ideal whereas Posthumans will be real, in: Journal of Evolution and Technology 21.2 (2010), S. 9–12, jetpress.org/v21/hibbard.htm, führt das erste Zitat an, das von ‚unendlicher‘ Ferne zwischen Mensch und Übermensch spricht, versteht die Unendlichkeit mathematisch und schließt daraus, dass der Übermensch ein unerreichbares Ideal bleiben müsse, während Posthumans wirklich sein werden. Die beiden anderen Parallel-Stellen, von denen die eine die Unendlichkeit im Sinne von ‚Ungeheuerlichkeit‘ versteht, während die andere von ‚6000 Fuß‘ spricht, sind entweder unbekannt oder bleiben unerwähnt. Nietzsche wollte aber keine neuen Ide-ale (sein Wort dafür war ‚Götzen‘) aufrichten, sondern die alten lernen lassen, wie wacklig sie seien (EH, Vorwort 2). Was den Menschen rechtfertige, sei seine Realität: „Um wie viel mehr werth ist der wirkliche Mensch, verglichen mit irgend einem bloss gewünschten, erträumten, erstunkenen und erlogenen Menschen? mit irgend einem i d e a l e n Menschen?“ (GD, Streifzüge eines Unzeitgemäs-sen 32). Vgl. Reto Winteler, Nietzsches Ideal eines höchsten Typus Mensch und seine „idealistischen“ Fehldeutungen, in: Nietzsche-Studien 39 (2010), S. 455–486.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 276NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 276 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
Posthuman oder Übermensch 277
w i e e s g e h n s o l l t e , auch wirklich geht: wie jede Art von „Unvoll kommenheit“ und das Leiden an ihr mit hinein in die höchste Wünschbarkeit gehört …“ (Nachlass 1887/88, 11[30], KSA 13.17), so dass sich mit dem Gegensatz von Sein und Sollen auch der Wille zur Perfektionierung selbst überwindet.
Der „höhere Mensch“ nimmt eine aufschlussreiche Zwischenstellung ein, sofern er einerseits, wie bereits erwähnt, ein „realer“ Mensch ist und insofern sowohl vom Übermenschen als auch dem letzten Menschen, die einer möglichen Zukunft ange-hören, verschieden ist, andererseits durch die ebenfalls räumlich-vertikale Bedeu-tung des „Höheren“ wie ein Wegweiser zumindest schon in die richtige Richtung (nach „oben“) zeigt.⁵³ Im Gegensatz zur vornehmlich räumlich-vertikalen Bedeutung des „Über“ und des „Höheren“ haben das „Letzte“ des „letzten Menschen“ und das „Post“ des „Posthuman“ vor allem zeitliche Konnotationen. Der „Posthuman“ kommt „nach“ dem Menschen, während nach dem „letzten Menschen“ nichts mehr oder zu-mindest kein anderer Mensch mehr kommt. Der letzte Mensch ist die Ver-endung des Menschen. Da jedoch auch die letzten Menschen erst nach den jetzigen Menschen kommen und nicht mit ihnen gleichzusetzen sind, könnte man sie auch „posthuman“ nennen. Beide folgen einfach dem Lauf der Zeit und schwimmen mit dem Strom, während der Weg zum Übermenschen das Schwimmen gegen den Strom erforderlich macht, um seine Zeit in sich zu überwinden.⁵⁴ Dies wäre heute auch eine Zeit, die sich von (hyper-)erzieherischen und technologischen Veränderungen des Menschen den Post-Menschen verspricht.
6 Strukturelle Analogien (Bescheidenheit, Geschenk, Verantwortung)
Für Michael J. Sandel kann eine Ethik der Autonomie und Gleichheit nicht erklären, was falsch mit genetischem Engineering und (auch liberaler) Eugenik ist.⁵⁵ Denn
53 Wie Nietzsche immer wieder betont, kann man nur nach „oben“ in die Höhe wachsen, indem man zugleich tiefer in der Erde „unten“ Wurzeln fasst. Je höher, desto näher kommen die „Blitze“, die, wie erwähnt, auch eine Metapher des Übermenschen sind. Das ist „das Verhängniss der Höhe“ (FW 371; Za I, Vom Baum am Berge, KSA 4.49; Za III, Der Genesende 2, KSA 4.274; Za IV, Vom höheren Menschen 5) Vgl. Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 455 ff.54 „Was verlangt ein Philosoph am ersten und letzten von sich? Seine Zeit in sich zu überwinden, „zeitlos“ zu werden.“ (WA, Vorwort) Er wird „zeitlos“, aber nicht „raumlos“.55 Für Transhumanisten ist „liberale Eugenik“ (im Gegensatz zu staatlich verordneter und regulier-ter Eugenik wie insbesondere im Dritten Reich) nur ein anderer Name für „genetic engineering“ und folglich „a morally le gitimate way of enhancing human beings“ (Sorgner, Nietzsche, the Overhuman and Transhumanism, S. 35, 37). Dagegen ist selbst für einen so vehementen Gegner eines „eugeni-schen“ Nietzsche als Vorläufer nazistischer Eu genik wie Jean Gayon (der sich dabei vor allem auf
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 277NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 277 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
278 Michael Skowron
wie Sandel kri tisch gegen Habermas’ Die Zukunft der menschlichen Natur einwendet, hätten Kinder auch im Falle, dass sie auf ‚natürli che‘ Weise entstanden und ausgetra-gen worden sind, keinen Einfluss auf ihre genetischen Ei genschaften, und die Gleich-heit, die in der symmetrischen, reziproken Beziehung zwischen Menschen über die Generationen bestehe, werde auch in herkömmlichen Beziehungen zwi schen Eltern und Kindern vielfach verletzt.⁵⁶ Weder sind wir je gefragt worden, ob wir gebo ren werden wollten, noch, welche genetischen Eigenschaften wir gerne hätten, noch, welche Erziehung, Sozialisation und kulturelle Konditionierung wir bevorzugen würden. Und den noch fordert uns Sandel dazu auf, das Leben als ein Geschenk (life as a gift) und im Geiste einer Ethik der Gabe und des Geschenks (ethic of giftedness) zu betrachten, und die darin lie gende Haltung als das stärkste Argument gegen jeg-
Passagen aus Jenseits von Gut und Böse und auf von Nietz sche nicht zur Veröffentlichung vorgesehe-nes und daher stark interpretationsbedürftiges Material aus dem Nach lass, das dennoch als Wille zur Macht von Nietzsches Schwester publiziert wurde, stützt) in den für ihn „bes ten“ Büchern Nietzsches, Also sprach Zarathustra und Zur Genealogie der Moral, das „‚selective thinking‘ […] virtually ab sent. Neither the visionary reflection on the ‚superman‘ nor the radical critiques of morals required the idea of human selection”, d. h. negative oder positive Eugenik (Jean Gayon, Nietzsche and Darwin, in: Jane Maienschein / Michael Ruse (Hg.), Biology and the Foundation of Ethics, Cambridge 1999, S. 154–197, S. 184). Nach Werner Stegmai er, Eugenik und die Zukunft im außermoralischen Sinn: Nietzsches furchtlose Perspektiven, in: Sorgner / Birx / Knoepffler (Hg.), Eugenik und die Zukunft, S. 27–42, ist für Nietzsche jede Eugenik, in der Menschen ande re Menschen nach dem Bild ihrer ei-genen Vorstellungen moralisch gestalten wollen, moralisch verdächtig, un verdächtig dagegen eine ganz individuelle ‚Eugenik‘ ohne eine solche normierende Moral im Hintergrund, wie sie z. B. in jeder Partnerwahl implizit enthalten sei (S. 35 f.). Um rassistische Missverständnisse abzuwehren, be tont Schank, „Rasse“ und „Züchtung“ bei Nietzsche, S. 402 f., dass es Nietzsche mit seinen gesundheits-politischen Vorschlägen um eine „konservative“ Eugenik und „die Beförderung der Gesundheit des Menschen überhaupt“ gegangen sei. Auch für Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, S. 178, gibt es bei Nietzsche keine ‚Eugenik‘, „jedenfalls nicht mehr, als in der Empfehlung einer Partnerwahl bei guter Beleuchtung und intakter Selbstachtung enthalten ist.“ Der ‚Über mensch‘ impliziere „kein biologisches, sondern ein artistisches, um nicht zu sagen: ein akrobatisches Pro gramm.“ Er gehöre jedoch nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangen heit, eine Epoche, „in der sich Menschen einer transzendenten Ursache zuliebe mit den extremsten Mitteln über ihren physischen und psychischen Status erheben wollten“ (S. 204, 307), und erledige sich, wenn man ihn in die Rede von „Vertikalspan-nungen im allgemeinen“ übersetze (S. 700). Damit wird der „Übermensch“ mit seiner beunruhigend räumlich-vertikalen Bedeutung einerseits wieder ganz in die beruhigende zeitliche Dimension zu-rückübersetzt, in der es „normal“ weitergeht, während er andererseits unausgesprochen dann wie-derkehrt, wenn Sloterdijk eine „globale Ko-Immunitätsstruktur“ angesichts der globalen Krise ver-misst (S. 711 ff.) und der Mensch eine „Impfung mit dem Wahnsinn“ (S. 523) vielleicht gut gebrauchen könnte. Denn „wenn der Mensch heit das Ziel noch fehlt, fehlt da nicht auch – sie selber noch?“ (Za I, Von tausend und Einem Ziele).56 Sandel, The Case against Perfection, S. 80 f. Das Fremdbestimmungsargument zieht für Habermas seine Kraft jedoch nicht einfach daraus, dass der Designer „frevelhaft“ nach eigenen Präferenzen eine nicht-revidierbare Weichenstellung für Leben und Identität einer anderen Person vornimmt, sondern dass er dies tut, „ohne auch nur kontrafaktisch deren Einverständnis unterstellen zu dürfen.“ (Haber-mas, Die Zukunft der menschlichen Natur, S. 144).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 278NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 278 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
Posthuman oder Übermensch 279
liche Art von genetischem Engineering und Eugenik zu verstehen. Denn wie Sandel mit Habermas feststellt, werde die menschliche Freiheit so erfahren, dass sie in Ver-bindung mit etwas stehe, dass nicht in menschlicher Ver fügung liege, nenne man es Gott oder Natur, jedenfalls nicht in Beziehung zu einer anderen Person, die uns „entworfen“ hat.⁵⁷ Daher sei mit einer Ethik des Geschenks immer auch eine gewisse Demut und Bescheidenheit (humility) verbunden, die durch genetisches Engineering und Eugenik ebenso erodieren würde wie die Solidarität der Menschen unterein-ander. Nicht erodieren, sondern explodieren würde dagegen die Verantwortlichkeit, da sie umso mehr zunehme, als Entscheidungen für das zukünftige Leben getroffen werden könnten.⁵⁸ Allerdings bleibt auch im Falle des genetischen Designs ein Spiel-raum für das Unvorhergesehene, der sich nicht schließen wird, solange Menschen nicht völlig zu Robotern geworden sind.
Wie bereits im Fall der Erziehung lassen sich auch hier „strukturelle Analogien“ zu Nietzsche feststellen, die wiederum dafür sprechen, dass Nietzsche technologi-schen Mitteln zur Erzeugung des Übermenschen ablehnend gegenübergestanden bzw. sie für unmöglich gehalten haben würde. Analog zu der von Sandel befürworte-ten „ethic of giftedness“, die den letztlich unbegründbaren Charakter des immer so oder so bestimmten Lebens und der Begabungen und Talente eines Menschen in den Vordergrund stellt, ist es für Zarathustra ein „Segnen“ und kein „Lästern“, wenn er lehrt, dass „„über allen Dingen […] der Himmel Zufall [steht], der Himmel Unschuld, der Himmel Ohngefähr, der Himmel Übermuth.““ Der letzte Grund ist glücklicher-weise ein „Ab-grund“, der von der „Knechtschaft unter dem Zwecke“ und einem „ewigen Willen“, der durch die Dinge will, befreit (Za, III, Vor Sonnen-Aufgang, KSA 4.209).⁵⁹ Unsere Autonomie hängt insofern nicht davon ab, ob wir unsere genetischen Eigenschaften gewählt oder nicht gewählt haben, sie ist keine Frage ‚freien Willens‘, sondern ob wir die werden wollen, die wir sind – „die Neuen, die Einmaligen, die Un-vergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden“ (FW 335, KSA 3.563) –, oder nicht.
57 Sandel, The Case against Perfection, S. 81 f.; Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur, S. 101.58 Sandel, The Case against Perfection, S. 85 ff.59 Conant, Nietzsche’s Perfectionism, S. 209 ff., zeigt, wie für Nietzsche eine falsch verstandene Rede von Geschenk, Talent und Begabung einerseits und von entsprechendem Ruhm und Bewunderung der „großen Menschen“ andererseits auch nur dazu dienen kann, dem Anspruch der unvertretba-ren Selbstwerdung dessen, was man selber ist, auszuweichen, indem man sie auf ein unerreichbares hohes Podest stellt und dadurch von sich distanziert. Nietzsches Charakterisierung seiner selbst, z. B. als „lieber noch ein Hanswurst“ denn ein Heiliger (EH, Warum ich ein Schicksal bin 1) und Zarathu-stras „Ekel“ vor der „Münze, mit der / alle Welt bezahlt, / R u h m“ (DD, Ruhm und Ewigkeit 2), sind auch in diesem Licht zu lesen. Ein Erzieher hat seine „Schüler“ immer auch zurückzuweisen und gelegentlich vor den Kopf zu stoßen, damit sie nicht ihm, sondern sich selber folgen (vgl. Conant, Nietzsche’s Perfectionism, S. 196 ff.).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 279NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 279 21.05.2013 12:43:1621.05.2013 12:43:16
280 Michael Skowron
Der Grund dafür, dass wir uns in der Natur so frei und wohl fühlen, liegt für Nietzsche darin, dass es hier „endlich einmal nicht mehr einen Schenkenden und Gebenden“ gebe, kein „gnädiges Gesicht“, dem man zu danken habe und dem man verpflichtet werde, nicht weil die Natur nicht schenkt und gibt, sondern weil sie ein anonymer Schenkender „ohne Gesicht“ und Namen ist, eine Anonymität, die auch durch einen hinter oder in die Natur projizierten Gott als „Schöpfer“ oder „Schen-kenden“ verdorben werde. Denn „nun ist wieder Alles unfrei und beklommen! […] Wenn immer ein Anderer um uns ist, so ist das Beste von Muth und Güte in der Welt unmöglich gemacht.“ (M 464)
Eine schenkende Tugend und Freigebigkeit ohne Erwartung irgendeiner Gegen-gabe ist für Zarathustra die höchste Tugend (Za I, Von der schenkenden Tugend 1).⁶⁰ Ihr Vorbild ist die Sonne, und als Zarathustra nach zehn Jahren Einsamkeit in den Bergen wieder zu den Menschen in die Täler steigt, will er wie sie „verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Thorheit und die Armen wieder einmal ihres Reichthums froh geworden sind.“ (Za I, Zarathustra’s Vorrede 1) Das „Geschenk“, das er den Menschen bringt (Za I, Zarathustra’s Vorrede 2), ist seine Lehre, die den Übermenschen und die ewige Wiederkunft in den Mittelpunkt stellt und die man annehmen oder ablehnen kann. Aber bevor er auch reif für die Lehre der ewigen Wiederkunft wird, muss er noch „demütiger“ werden, denn „[d]ie Demuth hat das härteste Fell.“ (Za II, Die stillste Stunde, KSA 4.188)
Bescheidenheit wird von Nietzsche mit dem Leben als „Zufall“ (auch im Sinne des sen, was einem zugefallen ist) und der Verantwortlichkeit bzw. Unverantwortlich-keit in Ver bindung gebracht, wenn er „wahre Bescheidenheit“ als die „Erkenntniss“ bestimmt, „dass wir nicht unsere eigenen Werke sind“, die auch dem „grossen Geiste“ gezieme, „weil gerade er den Gedanken der völligen Unverantwortlichkeit (auch für das Gute, was er schafft) fassen kann.“ (MA I 588) Sowohl jene Erkenntnis als auch dieser Gedanke findet sich nicht nur beim frühen, sondern auch noch beim späten Nietzsche (Nachlass 1885/86, 2[116], KSA 12.119; GD, Die vier grossen Irrthümer 8). Mit dem Gedanken der „völligen“ Unverantwortlichkeit bringt Nietzsche jedoch zu-gleich auch das Konzept einer „völligen“ Verantwortlichkeit ins Spiel. Während für Sandel die Verantwortlichkeit im gleichen Maße explodiert, wie die Beschei denheit abnimmt, nimmt für Nietzsche die Verantwortlichkeit in dem gleichen Maße zu, in dem auch die Bescheidenheit wächst, weil man dann die Verantwortung immer weniger an scheinbar vorgegebene Instanzen abgeben kann.
Das Leben selbst als „Geschenk“ und nicht als „Zufall“ zu betrachten, würde für Nietzsche nicht nur wieder einen Schenkenden voraussetzen, sondern auch jene schreckliche Weisheit des Silen vergessen lassen, dass es nämlich das Allerbeste sei, nicht geboren zu sein, das Zweitbeste aber, bald zu sterben (GT 3, KSA 1.35), die der
60 Vgl. Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, Berlin / New York 2008, S. 620 ff.; Steg-maier, Friedrich Nietzsche zur Einführung, S. 161 f.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 280NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 280 21.05.2013 12:43:1721.05.2013 12:43:17
Posthuman oder Übermensch 281
tragisch-dionysischen Weisheit als stets zu überwindender Begleiter beigegeben ist und schon der apollinisch-schönen Welt des Scheins der Griechen zugrunde lag. Dieser „schrecklichen Weisheit“ entspricht der „bitterste Tropfen, welchen der Er-kennende schlucken muss, wenn er gewohnt war, in der Verantwortlichkeit und der Pflicht den Adelsbrief seines Menschenthums zu sehen.“ (MA I 107, KSA 2.103) Wie man jenem „Zufall“ am besten mit einem „amor fati“ begegnet, so auch dieser the-oretischen Unverantwortlichkeit an sich und für alle mit einer ganz individuellen, praktisch ausgerichteten und „entgrenzten“ Verantwortlichkeit, die sich nicht mehr (bloß) moralisch, sondern (vor allem auch) weise der nächsten Dinge und Menschen annimmt.⁶¹
Man ist gewohnt, in Nietzsches Übermensch einen Versuch menschlicher Selbst-überhebung und der Hybris zu sehen. Demgegenüber sollte man auch in ihm viel eher einen Ausdruck der Bescheidenheit erkennen,⁶² weil er vor allem nicht mehr ständig von Gott redet und ihn für sich in Anspruch nimmt. „Der Atheismus ist die Folge einer E r h ö h u n g d e s M e n s c h e n : im Grunde ist er schamhafter, tiefer und vor der Fülle des Ganzen bescheidener geworden; er hat seine Rangordnung b e s s e r begriffen.“ (Nachlass 1885, 39[14], KSA 11.625; vgl. AC 14) Vom Übermenschen zu reden bedeutet, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist, dass es auch etwas „über“ ihm gibt, ohne dass dieses „Über“ gleich wieder mit Gott gleichgesetzt wird, von dem man zu wissen beansprucht. Vor allem aber kann er dieses Ziel aus eigenen Kräften ohne Gott oder technische Hilfsmittel erreichen, weshalb es auch in der Ver-
61 Schon 1870 notierte Nietzsche: „Eine Erziehung zur tragischen Erkenntniß setzt also Bestimm-barkeit des Charakters, freie Wahlentschließung usw. voraus — für die Praxis, leugnet aber theore-tisch dieselbe und stellt dies Problem sofort an die Spitze der Erziehung. Wir werden uns immer so benehmen wie wir s i n d und nie wie wir sein sollen.“ (Nachlass 1870, 6[3], KSA 7.130) Später hat Nietzsche allerdings auch die Unterscheidung Theorie – Praxis in Frage gestellt und sie im Begriff der in Fleisch und Blut übergegangenen „Praktik“ aufgehen lassen. Vgl. Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 618 ff.; Silvio Pfeuffer, Die Entgrenzung der Verantwortung. Nietzsche – Dostojews-kij – Levinas (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 56), Berlin / New York 2008; Stegmaier, Friedrich Nietzsche zur Einführung, S. 146 f., 198; Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Phi-losophie, S. 517–520.62 Für Keith Ansell Pearson, The Future is Superhuman: Nietzsche’s Gift, in: The Agonist 4.2 (2011), www.nietzschecircle.com/AGONIST/2011_08/The_Future_is_Superhuman.pdf, ist dies ein meist übersehener Aspekt bei Nietzsche, wie er im Anschluss an Gianni Vattimo feststellt. Nietzsche sei trotz seiner Reputation „a thinker of modesty“ (S. 5). Dies gilt nach Werner Stegmaier, Schicksal Nietzsche? Zu Nietzsches Selbsteinschätzung als Schicksal der Philosophie und der Menschheit (Ecce homo, Warum ich ein Schicksal bin 1), in: Nietzsche-Studien 37 (2008), S. 62–114, S. 69, auch für die letzten Schriften Nietzsches, die, „so sehr ihr Ton erschrecken mag, so größenwahnsinnig sie erscheinen,“ doch ernst zu nehmen seien und deren Ton nur deshalb erschrecken könnte, „weil er aufschrecken sollte aus der in Tausenden von Jahren zur Selbstverständlichkeit gewordenen Inan-spruchnahme göttlicher Maßstäbe“, um sie ins Menschliche, Allzumenschliche zurückzuholen. Vgl. auch Michael Skowron, Nietzsche in Indian Eyes. Muhammad Iqbal, Sri Aurobindo, Bhagwan Shree Rajneesh, in: The Korean Journal of East West Science 9.2 (2006), S. 1–14, S. 2 f.
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 281NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 281 21.05.2013 12:43:1721.05.2013 12:43:17
282 Michael Skowron
gangenheit schon „eine Art Übermensch“ geben konnte (AC 4).⁶³ Der „Übermensch“ ist eines jener Worte der Bescheidenheit des Geistes, die man noch weniger erträgt als die Worte seines Stolzes (Za II, Von den berühmten Weisen, KSA 4.134). Nicht mehr nur ‚in‘ sich, sondern (zugleich oder sukzessive) auch ‚über‘ sich und den Dingen stehen zu können, kann jedoch auch einen neuen Stolz des Geistes begründen, der nicht zuletzt auch Nietzsches Verständnis des Redens und Schreibens betrifft. Denn danach soll man zum einen „nur reden, wo man nicht schweigen darf“, und zum anderen „nur von dem reden, was man ü b e r w u n d e n hat, – alles Andere ist Ge-schwätz“ (MA II, Vorrede 1).
Nietzsche hat vielfach als Anregung für Bewegungen und zahlreiche -ismen ge-golten, bei denen sich bald herausstellte, dass sie sich nur fälschlich oder oberfläch-lich auf ihn beru fen konnten. Der Transhumanismus scheint einer dieser Fälle zu sein, sei es in zustimmender oder auch ablehnender Haltung, da in beiden Fällen, wie gezeigt, Missverständnisse im Spiel sind. Nietzsches Philosophie ist die Philoso-phie Nietzsches, eine von seiner Persönlichkeit durchtränkte Philosophie, die sich in ihrer Individualität allgemeinen Kategorisierungen und Zuschreibungen immer wieder entzieht. Insofern könnte man sie selber eine „übermenschli che“ Philosophie im erläuterten Sinn nennen, deren Interpretation „unendliche“ Perspekti ven eröff-net und daher prinzipiell unabschließbar ist. Man wird deshalb auch nicht erwarten, dass schon alles zu der Frage, ob und inwiefern Nietz sche ein Transhumanist war oder hätte gewesen sein können, gesagt ist, sondern vielleicht sogar hoffen, dass dies nicht der Fall ist, wobei man die Fra ge von der nach den eigenen Motiven und der ethischen Beurteilung des Transhumanismus trennen kann, auch wenn Nietzsche ungewollt und weit voraus einiges dazu beizutragen hat.
63 Auch der Buddhismus ist für Nietzsche eine „ R e l i g i o n d e r S e l b s t e r l ö s u n g “ (M 96).
NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 282NZ42_011_Diskussionen_Skowron.indd 282 21.05.2013 12:43:1721.05.2013 12:43:17