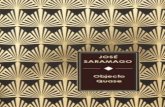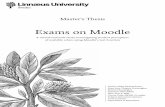Bildwörterbuch der Architektur - Moodle@Unifr
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Bildwörterbuch der Architektur - Moodle@Unifr
BILDWÖRTERBUCHDER ARCHITEKTUR
HANS KOEPFGÜNTHER BINDING
Vierte, überarbeitete Auflage
Mit englischem, französischem,italienischem und spanischem Fachglossar
ALFRED KRÖNER VERLAG STUTTGART
Hans Koepf, Günther BindingBildwörterbuch der Architektur4., überarbeitete AuflageMit englischem, französischem,italienischem und spanischem FachglossarStuttgart: Kröner 2005(Kröners Taschenausgabe; Bd. 194)ISBN Druck: 978-3-520-19404-6ISBN E-Book: 978-3-520-19491-6
Unser gesamtes lieferbares Programm sowie viele weitereInformationen finden Sie unter:www.kroener-verlag.de
Am fremdsprachigen Fachglossar haben mitgearbeitet:
Englisch: Dr. Mechthild Heuser (Kunsthistorikerin, Berlin),Dr. Melissa Thorson Hause (Kunsthistorikerin, Marburg)Französisch: Dipl.-Ing. Marc Jodi (Architekt, Berlin)Dipl.-Ing. Thomas Meyer (Architekt, Berlin)Italienisch: Dipl.-Ing. Susanne Keller (Architektin, Berlin),Dipl.-Ing. Marcello Eusepi (Architekt, Berlin, Rom),Dipl.-Ing. Mario Festa (Architekt, Berlin, Rom),Dipl.-Ing. Stefano Pino (Architekt, Berlin)Spanisch: Valeska Hepp Kuschel (Santiago de Chile), Dipl.-Ing. Blas Berni Ruiz (Architekt, Stuttgart)
© 2005 by Alfred Kröner Verlag, StuttgartDatenkonvertierung E-Book: Alfred Kröner Verlag, Stuttgart
1. Auflage 19682. Auflage 19743. Auflage 19994. Auflage 2005
INHALT
Vorwort zur ersten Auflage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIIVorwort zur dritten Auflage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIIIVorwort zur vierten Auflage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IXAbkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Wörterbuchartikel A�Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Abbildungen von Prototypen der Baukunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Dorischer Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524Ionischer Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526Römischer Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528Römisches Theater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530Altchristliche Basilika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532Romanische Kirchenfassade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534Romanische Emporenbasilika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536Gotische Zweiturmfassade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538Gotische Kathedrale (Grundriß) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540Gotischer Wandaufbau innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542Gotischer Wandaufbau außen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Barocke Kirchenfassade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544Barocke Palastfassade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Fremdsprachige Fachglossare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Englisch-Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Französisch-Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591Italienisch-Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619Spanisch-Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE
Architektur umgibt uns � nicht nur die modernen Zweckbauten derGroßstadt, auch die Tempel und Kirchen, die Burgen und Schlösser derVergangenheit, denen wir auf unseren Reisen begegnen, finden unserInteresse und verdienen unsere Bewunderung.Wer jedoch einmal versucht hat, den Eindruck eines Bauwerkes in Wortezu fassen und das, was er sieht, zu beschreiben, wird rasch feststellenmüssen, daß ihn sein Wortschatz im Stich läßt, vielleicht schon, wenn esum größere Bauteile geht, vielleicht erst, wenn es sich um die Details han-delt.Auch die Architektur, im Sinne dieses Buches als Baukunst im weitestenSinne des Wortes, jedoch nicht als Ingenieurwissenschaft mit ihren Datenund Tabellen verstanden, hat ihre eigene Fachsprache, die aus derNotwendigkeit einer eindeutigen Bezeichnung von Bauteilen entstandenist und die allein mit ihren Begriffsprägungen der praktischen Bedeutungund der historischen Entstehung der Bauteile gerecht wird. Wer sich mitder Architektur befaßt, sei es als Fachmann, als Kunstinteressierter, alsStudierender der Architektur oder als aufgeschlossener Laie, muß dieseSprache beherrschen, oder er wird auf ein tieferes Verständnis der Bau-kunst verzichten müssen, die nicht von der Illusion des schönen Scheinsallein, sondern eher vom realen Sachwissen getragen ist: Erst was manerkennen, benennen, definieren bzw. in seiner Gestalt und Funktionerfassen kann, das sieht man wirklich. Schon in früher Zeit hatten dieNaturvölker den Glauben: Erst wenn ich den Namen eines Gegenstandesweiß, habe ich auch Macht über diesen Gegenstand.Die grundlegende Fach- und Begriffssprache der Baukunst � weniger dieder modernen Statik, zeitlich, räumlich und örtlich verschiedenerSonderbauweisen und der praktischen Bauausführung � in ihrenBestandteilen aus Vergangenheit und Gegenwart zu sammeln, durchAbbildungen zu belegen und in klarer Form zu definieren, ist dieZielsetzung des vorliegenden Wörterbuches.Dieser Aufgabe wird es in doppelter Weise gerecht: Der alphabetischgeordnete Hauptteil bietet die rund 2400 wichtigsten Fachausdrücke mitDefinitionen und � wo erforderlich � bildlichen Darstellungen; er erörtertdie Entwicklungsgeschichte, die Funktion und die Bedeutung der Begriffeund verweist auch auf die mögliche Formenvielfalt innerhalb desselbenAufgabenbereiches.Ein ergänzender Anhang zeigt anhand ausgewählter praktischer Beispielevon Prototypen der Baukunst die Benennung typischer Architektur-formen und Architekturdetails und übersetzt so die optischen Eindrückein eindeutige Sachbegriffe. Mit seiner Hilfe wird auch der zunächst weni-ger mit der Materie Vertraute in die Lage versetzt, die gesuchtenFachausdrücke für einzelne Bauteile zu finden und im alphabetischen Teilzur genaueren Information nachzuschlagen.Der Umfang der Taschenausgabe verlangt eine strenge Konzentration aufdas Wesentliche, größtmögliche Knappheit der Darstellungen und eine
systematische Vereinfachung der Zeichnungen. Auf stilgeschichtlicheDarstellungen wurde bewußt verzichtet, doch lassen zahlreiche zusam-menfassende Tafeln (wie »Kapitellformen«) die formalen Zusam-menhänge optisch deutlich erkennen. Diese Beschränkung erweist sichals besonderer Vorzug: Dem Benutzer des Buches wird das notwendigeGerüst der Fachausdrücke ohne Beiwerk und ohne Wertung dargeboten.Bei der Auswahl der Stichwörter wurde der europäische Raum bevorzugtdargestellt und dabei wiederum auf die Beschreibung der jeweiligenBauformen (wie »Gewölbeformen«) oder baulicher Details (wie»Gesimsformen«) besonderer Wert gelegt, die in der Baukunst längereZeit Verwendung gefunden haben und die deshalb als Prototypen gelten.Verweispfeile (→) führen zu Artikeln, die weitere Aufklärung über dengesuchten Begriff bringen, Pfeile mit Stern (→*) verweisen auf Artikel,bei denen der Begriff abgebildet ist. Die Zusammenfassung technischerund formaler Begriffe zu Sammelkapiteln (wie »Dachkonstruktion«,»Dachdeckung« oder »Dachformen«) hat sich vor allem durch die zuVergleichszwecken nebeneinander gezeichneten Abbildungen sehrbewährt. Beim einzelnen Stichwort (wie »Hängewerk«, »Doppeldach«oder »Walmdach«) findet sich dann nur eine Kurzinformation und derHinweis auf das Sammelkapitel.Anregungen und Unterstützung erhielt der Autor von vielen Seiten. HerrPrivatdozent Dr. Hans Holländer hat mich bei der Abfassung des vorbe-reitenden Stichwortkataloges unterstützt, Herr Dr. Helmut Dingeldeystellte im Anfangsstadium des Werkes seine reiche lexikalische Erfahrungzur Verfügung.Die Abbildungen wurden zum größten Teil für dieses Werk neu gezeich-net, ein Teil wurde aus meinen früheren Werken »Deutsche Baukunst«und »Baukunst in fünf Jahrtausenden« entnommen. Herrn Dipl.-Ing.Roland Schachel danke ich für die Auswahl und die Mitbearbeitung desAbbildungsmaterials, für die Kontrolle der Verweise und das Lesen derKorrektur.
Stuttgart, 1968 Hans Koepf
VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE
Das vielfach bewährte Bildwörterbuch der Architektur von Hans Koepfist seit 30 Jahren das Standardwerk für die Architekturbegriffe und hatsehr erfolgreich zur Vereinheitlichung der Fachterminologie beigetragen.Die Überarbeitung für eine Neuauflage war notwendig geworden, weilinzwischen eine größere Zahl weiterer Fachbegriffe in einschlägigenWerken Verwendung findet und der Bereich des Festungsbaus fehlte. Umden Umfang trotz der deutlichen Vermehrung der Stichworte nicht zusehr anschwellen zu lassen, wurde die Nennung von Bauwerken als
VORWORT VIII
Beispiele, die ohnehin nur höchst beliebig sein kann, gestrichen. DieLiteraturangaben unter den einzelnen Artikeln wurden durch ein aus-führliches Verzeichnis im Anhang ersetzt, das auf Nachschlage- undÜberblickswerke mit weiterführenden Literaturangaben verweist und diewichtigste Literatur zu einzelnen Gebäude- und Bauformen angibt. Ent-standen ist nun ein auf dem neuesten Stand befindliches Fachwörterbuch,das allgemein verbindliche Definitionen bereithält.Die Neubearbeitung gibt außerdem unter den meisten Artikeln die ent-sprechenden englischen, französischen und italienischen Fachbegriffe an.Ein englisch-, französisch- und italienisch-deutsches Fachglossar im An-hang erschließt die Begriffe umgekehrt von der jeweiligen Fremdspracheaus. Ein derart breit angelegtes baugeschichtliches Glossar existiert bishernicht. Die Begriffe sind von Architekten und Kunsthistorikern, oft unterRückgriff auf englische, französische und italienische Fachliteratur,eruiert worden.An meinem Kölner Lehrstuhl habe ich fast 30 Jahre lang das Material füreine verbindliche Fachterminologie gesammelt und publiziert, so war ichdankbar, daß Herr Arno Klemm, Mitinhaber des Alfred Kröner Verlags,mir die Bearbeitung einer Neuauflage des geschätzten Buches meineslangjährigen väterlichen Freundes und Kollegen Hans Koepf anvertrauthat. Zusammen mit Maria Spitz haben Britta Bommert, Hille Helge Kleinund Martina Schönenborn engagiert und sorgfältig die Neuauflage vorbe-reitet. Georg Hehn hat im Verlag mit großer Geduld alle Verweise und Le-genden überprüft. Das Literaturverzeichnis hat Frau Dipl.-BibliothekarinGabriele Abedinizadeh erstellt. Ich danke ihnen dafür ganz besonders,denn nur so konnte ich eine Fachterminologie vorlegen, die das Ergebnismeiner langjährigen Beschäftigung angemessen zugänglich macht.Um eine allgemein verbindliche Fachsprache zu erreichen, ist die aktiveMitarbeit aller Benutzer notwendig; ich bitte deshalb darum, dem VerlagÄnderungsvorschläge, Fehler und Ergänzungen zuzustellen, damit dasBuch lebendig fortgeführt wird und allgemein anerkannt bleibt.
Köln, im Juli 1997 Günther Binding
VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE
Sieben Jahre nach der 3. Auflage kam der Wunsch, neben engl., frz. undital. auch spanische Übersetzungen zu bringen. Dies gab Gelegenheit,einige Korrekturen und Ergänzungen einzubringen, die sich aus derBenutzung und durch freundliche Zuschriften ergeben haben; zudemwurde das Literaturverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht.
Köln, im Mai 2005 Günther Binding
IX VORWORT
ABKÜRZUNGEN
1. Sprachen
2. Allgemeine Abkürzungen
am. amerikanisches Englisch
aram. aramäischdt. deutschengl. englischfrz. französischgr. griechisch
hebr. hebräischit. italienischlat. lateinischmhdt. mittelhochdeutschniederdt. niederdeutschösterr. österreichischsp. spanisch
allg. allgemeinbes. besonders, besondere,besondererbzw. beziehungsweisecm Zentimeterders. derselbed.h. das heißteurop. europäischGesch. GeschichteHl. Heilige(r)Jh. JahrhundertJt. JahrtausendKap. Kapitelkath. katholischKg. Kunstgeschichtema. mittelalterlichMA. Mittelaltermilit. militärischMz. MehrzahlN. Norden
n. Chr. nach Christi Geburto.ä. oder ähnliche(s)O. OstenPl. PluralSg. Singularsog. sogenanntS. Südenu.a. und andere(s), unter
anderemu. dergl. und dergleichenurspr. ursprünglichusw. und so weiterv. Chr. vor Christi Geburtvgl. vergleicheW. Westenz.B. zum Beispielz.T. zum Teilzus. zusammen→ siehe* mit Abbildung
Aasdach, im skandinav. Blockbaugebräuchl. Dachkonstruktion, beider die Dachhaut nur von Pfetten(norweg. Aaser, Åser), nicht vonSparren getragen wird.
Aaskopf, → Bukranion, Nachbil-dung eines Tierschädels als Bau-ornament, bes. an Tempelgebälkenund Sarkophagen (→*Fries). Frz. tête de b�uf, tête de bélier; it. bucra-nio; sp. bucráneo.
Abakus (lat. v. gr. abax: Tisch-platte), meist rechteckige oder qua-drat. Deckplatte, die den oberenAbschluß des → *Kapitells bildet.Der A. der dor. Säule ist ungeglie-dert, der des ion. und korinth.Kapitells durch Hohlkehle undLeiste profiliert, vielfach auch mitBlattwerk oder anderem Ornamentverziert. Beim Kapitell der korinth.Ordnung und beim Komposit-kapitell sind die Seiten des A. kon-kav geschwungen, häufig mit einerBlume oder Rosette in der Mitte(→ Abakusblume). Während der A.in der Baukunst der Antike undden sie nachahmenden Baustilendie Regel ist, tritt in der früh-christl.-byzantin. Baukunst häufigein Kämpferaufsatz an seine Stelle.In der ma. Baukunst kann der A.bes. in der Spätgotik sehr reduziertwerden oder auch ganz entfallen.Bei der sog. protodor. Säule ersetzt
der ungegliederte A. das Kapitell(Abakussäule). Engl. abacus; frz. abaque; it. abaco; sp. ábaco.
Abakusblume, Blume oder Ro-sette in der Mitte jeder der vierkonkav eingezogenen Seiten desAbakus am korinth. und komposi-ten → Kapitell.Engl. abacus flower; frz. rose du tailloir, �ildu tailloir; sp. flor de ábaco.
Abaton (gr. das Unbetretene), 1.Teil eines heiligen Bezirks, der nurvom Priester oder besonders be-rechtigten Laien betreten werdendarf, z.B. im altgr. Kurort Epidau-ros der Raum für Heilungsuchen-de. Auch selten gebrauchte Be-zeichnung für das → *Adyton imgr. Tempel. 2. Der von einer Iko-nostasis abgeschlossene Raum alsAllerheiligstes in orthodoxen Kir-chen. Engl. abaton; it. 1. adito, 2. abaton; sp. ádito.
Abblattung → *Abplattung.
Abbund, Anpassen und Zurecht-legen einer Holzkonstruktion(Fachwerkwand, Balkenlage, Dach-gebinde) durch den Zimmermannauf dem Werk- oder Zimmerplatzdurch Ablängen und Herstellungder erforderlichen Verbindungen,Kennzeichnung durch eingeschla-gene Abbundzeichen (röm. Zahlenoder Buchstaben).
Abdach, niederdt. Bezeichnungfür ein auskragendes Vordach.Engl. roof overhang, projecting roof; frz.toit avancé, appentis; it. pensilina; sp. techoen voladizo.
1 Abdach
Aasdach
Abdachung, das Gefälle bei → Gla-cis, Gelände oder Böschung.Engl. slope, glacis; frz. talus, remblai; it. scar-pa, declivio, pendio; sp. talud.
Abdeckstein, zur Abdeckung vonfreistehenden Mauern als Back-steine (Rollschicht), Dachsteine,Formsteine oder Betonplatten zumSchutz gegen das Eindringen vonNiederschlägen in die Stoßfugendes Mauerwerks.Engl. coping stone; frz. pierre de couvertu-re; it. copertina di pietra; sp. piedra de re-vestimiento.
Abfallrohr, Hohlkörper mit run-dem oder rechteckigem Quer-schnitt aus Holz, Gußeisen oderKeramik zur Abführung von Ab-wasser, auch vom Dach.
Abfasen, abkanten, abgraten, ab-schrägen, im Holz- und Steinbaueine Kante so abarbeiten, daß eineschräge Fläche, die → *Fase, ent-steht, die auch als → Schmiege aus-gebildet sein kann. Engl. chamfer; frz. chanfreiner, biseauter;it. scantonare, smussare, bisellare; sp. cha-flanar, biselar.
Abgeschnürte Vierung, eine →Vierung, die von Bogen auf Mauer-zungen begrenzt wird.
Abgratung, bei → Gratsparren dieAbfasung der oberen Flächen, diedie gleiche Neigung wie die an-schließenden Dachflächen erhaltenmüssen.Engl. bevel, chamfer; frz. délardement, face,facette; sp. bisel.
Abgründung, Abblattung → *Ab-plattung 2.
Abhängling, Hängezapfen, 1.zapfenförmiger, herabhängenderSchlußstein (hängender Schluß-stein) an Rippengewölben bes. inspätgot. Zeit. 2. Knaufförmig her-abhängendes Ende der Hängesäu-len oder Hängeständer, auch beiStuhlsäulen offener Dachstühlesowie Deckenbalken an Renais-sance-Prunkdecken. Engl. pendant; frz. clef pendante; it. chiavedi volta pendente; sp. clave pendiente.
Abkanten → abfasen.
Abkehlen, auskehlen, abarbeiteneiner Kante in Form einer Hohl-kehle (→ *Kehle). Engl. to hollow out, to mould; it. scanalare;sp. ahuecar, acanalar.
Abkragung, Absenker, Gewölbe-rippen aufnehmende Wandvorlagen(→ Dienst) werden auf Konsolen
Abdachung 2
Abhängling1a Knauf 1b Hängender Schlußstein mit Eisenanker beim Zweischichtengewölbe
2 Hängezapfen einer Hängesäule
abgefangen, bes. in Zisterzienser-kirchen, nicht nur zur Aufstellungvon Chorgestühlen, sondern auchum den Wandcharakter des Pfeilerszu wahren.
Abkreuzung, 1. Konstruktion zurgegenseitigen Versteifung von Bal-ken einer Balkenlage durch kreuz-weise angeordnete Latten, sog.Kreuzstaken. 2. Eine Fachwerk-wand mit hölzernen Kreuzstrebenversehen (→ Andreaskreuz).Engl. X-brace; frz. entretoises croisées ausautoir; sp. riostra.
Ablauf, Apophyge, Apothesis, imGegensatz zum → Anlauf konkavkurvierte Vermittlung zwischeneinem vorspringenden oberen undeinem zurücktretenden unterenBauglied.Engl. apophyge; frz. congé d�en haut, apo-phyge; it. guscio superiore; sp. apófige.
Ablaufrinne, Entwässerungsrinnezwischen Dächern, auf Strebe-bogen, im Altertum und MA. in→ *Wasserspeiern, später in → Ab-laufrohren mündend, auch zurEntwässerung von Hofflächen undStraßen. Engl. gutter; frz. dégorgeoir; it. canaletta discarico; sp. canaleta de desagüe.
Ablaufrohr, das an der Hauswandbefestigte, senkrechte Rohr zumAbleiten des Wassers von → *Dach-rinnen.Engl. waste pipe; frz. déchargeoir; it. pluvia-le; sp. caño pluvial.
Abort → *Abtritt.
Aborterker → *Abtritt.
Abplattung, Abblattung, 1. hinterdie Kante eines Balkens oder Brettszurücktretende Fläche. 2. AuchAbgründung, das Abarbeiten derRänder von Füllungsbrettern aufdie Dicke der Nuten, in die sie ein-geschoben werden sollen, z. B. beiTürfüllungen.Engl. flattening; frz. aplatissement; it. 2.sformellatura; sp. allanado.
Absatz, jede Stelle, an der eineEbene endet und eine weiter zu-rück oder höher liegende beginnt,z.B. Rücksprung einer Mauer oderUnterbrechung eines Treppenlaufs(→ Podest). Engl. recess; frz. redent, gradin d�un em-pattement; it. dente, scarpa; sp. descanso.
Abschied → Altenteil.
Abschlag, 1. Wasserablaufvorrich-tung an Mauervorsprüngen oderFensterflügeln, → Kaffgesims, →Wasserschlag. 2. Kleiner Wassergra-ben oder Kanal als Ablaß zur Haus-und Straßenentwässerung.Engl. 1. outlet, vent; frz. 1. décharge; it. 1.gocciolatoio, 2. cunetta; sp. 1. desaguadero,2. cuneta.
3 Abschlag
Abkreuzung 1
Ablauf Anlauf
Abplattung Abgründung
Abschnittsbefestigung, einen be-grenzten Geländesektor deckendeAnlage (→ Abschnittsgraben, → Ab-schnittswall). Engl. fortification of a sector; frz. fortifica-tion de secteur; it. fortificazione di settore;sp. fortificación de un sector.
Abschnittsburg, durch Gräbenoder Mauern in mehrere befestigteAbschnitte mit je einem eigenenHof unterteilte → *Burg.
Abschnittsgraben, Graben zwi-schen den einzelnen Teilen einermehrgliedrigen Wehranlage oderinnerhalb der Umwallung. Frz. fossé de secteur, f. détaché; it. fossato disettore; sp. foso de un sector.
Abschnittswall, Wall, der inner-halb einer Burg oder Festung einenTiefen- oder Seitenabschnitt für ab-schnittsweise Verteidigung bildet. Frz. rempart de secteur; sp. muralla de sector.
Abseite, ältere Bezeichnung fürSeitenschiff oder im Hausbau,auch als Kübbung, Niederlaß, Zu-spang bezeichnet, bei mehrschiffi-gen Innengerüstbauten mit niedri-geren Außenwänden; allgemein Sei-tengang neben einem Hauptraum,auch Nebengebäude oder Neben-flügel an einem Hauptbau.It. navata laterale.
Absenker → Abkragung.
Abside, Apside (mittellat. absida)→ *Apsis.
Abtei, unter der Leitung einesAbts oder einer Äbtissin stehendes→ *Kloster. Engl. abbey; frz. abbaye; it. abazia, abbazia;sp. abadía.
Abtraufe, Ansetztraufe, Schnauze,schmuckloser → *Wasserspeier inForm einer Röhre oder → Ablauf-rinne aus Holz, Stein oder Blech. Engl. eaves; frz. dégouttement, égout; it. doc-cione; sp. gárgola.
Abtreppung, treppen- bzw. stu-fenförmige Ausbildung eines Bau-teils, z.B. → Treppengiebel, → Stu-fenportal.Engl. stepping, benching; it. gradonamento;sp. escalonamiento.
Abtritt, Abort, Latrine, Abzucht,Pervete, Privet, Dansker (lat.secessus), im röm. Reich an Wohn-häusern und Thermen als mehrsit-zige Anlage, im MA. bes. aufBurgen als Erker (Abtritterker)vorkragend, als Anbau, auch zwei-geschossig, als schräge Röhre z.T.durch die Mauer oder durch einenhohlen Pfeiler geführt; in den
Städten ähnl. oder als Sitzbrettzwischen den Häusern; in Klösterneigenes, durch einen Gang mitdem Dormitorium verbundenesGebäude; bei Deutschordensbur-gen in einem gesonderten, über
Abschnittsbefestigung 4
Abtritterker
einem Wasser errichteten Turm(→ *Dansker). In barocken Schlös-sern in kleinen, unauffälligen Ne-benräumen (»Geheimes Gemach«).Die Fäkalien werden auf das mög-lichst abschüssige Gelände, in denGraben, in Straßenrinnen (Abzucht)oder in Latrinengruben abgeleitet,durch natürl. Regenspülung unter-stützt. In einfacher Ausführung imHof über einer Grube oder Mist-haufen als Holzverschlag.Engl. latrine; frz. latrine; it. latrina; sp. letrina.
Abtshaus, Wohnhaus und Reprä-sentationsbau des Abts, auch mitKapelle und Kreuzgang (Abtshof)außerhalb der Klausur eines →*Klosters gelegen. It. casa dell�abate; sp. casa del abate.
Abtshof → Abtshaus.
Abwalmen, an einem Dach stattdes Giebels eine Dachschräge(→ Walm) anbringen (→ *Dach-formen). Engl. to hip a roof.
Abweichstein → Abweiser.
Abweiseblech, Schoßrinne: dasan den Seiten der Dachfenster,Schornsteine und höher reichen-der Mauern, auch in → Dachkeh-len genageltes Blech zum Ableitenvon Regenwasser und Schnee. Engl. baffle plate; frz. fourchette, noquet;it. lamiera di protezione; sp. hojalatería deprotección.
Abweiser, Radabweiser, Abweich-stein, Radstößer, → *Prellstein,Stein oder Eisen zum Schutz derHausecken und Torgewände gegenBeschädigung durch Fahrzeuge. Engl. deflector; it. paracarro; sp. protector.
Abwicklung, zeichner. Aneinan-derreihung von Ansichten einesBaukörpers, Raums, Platzes odereiner Straßenbebauung in Normal-projektion, → Aufriß. Frz. développement, déroulement; it. svi-luppo; sp. desarrollo.
Abzucht → *Abtritt.
Abzugsgraben, Abzugsrinne, 1.auch Künette, Kesselgraben oderSchlitzgraben: in der Grabensohleeines trockenen Festungsgrabensangelegte tiefe Längsrinne, in dersich Oberflächen- und Grund-wasser sammelt. 2. Allgemein einflacher offener Graben, der mitHolz, Steinen u.ä. ausgelegt ist undzum Ableiten des Niederschlags-wassers dient. Engl. trench; frz. 1. cunette, 2. fossé de dé-charge; it. 1. cunetta; sp. 1. cuneta, 2. drenaje.
Abzugskamin, Entlüftungsschacht,durch den die Pulvergase aus über-deckten Räumen einer Festung ab-ziehen können, im Stirnmauerwerkschlotartig oder schräg aufwärtsgeführte Öffnung unter dem Ge-wölbescheitel; heute allgemein zurEntlüftung innenliegender Räume. Engl. chimney flue; frz. cheminée de venti-lation; it. camino di ventilazione; sp. chime-nea de ventilación.
Achse (lat. axis), eine gedachteGerade, die in horizontaler (Längs-oder Quera.) oder vertikaler Rich-tung durch eine Bauanlage, einen
5 Achse
Abwicklung
Baukörper oder Bauteil gezogenwerden kann und als Gestaltungs-und Ordnungsmittel benutzt wird.Engl. axis; frz. axe; it. asse; sp. eje.
Achsenbrechung → Achsennei-gung.
Achsenneigung, Achsenbrechung,Knickung der Mittelachse einesBauwerks. Die A. kann durchRücksichtnahme auf ältere Bau-teile oder Kultstätten oder durchGeländeschwierigkeiten, häufig aberauch durch Meßfehler und Plan-änderungen während der Bauzeitbedingt sein, → *Achse. Engl. axial inclination; it. disassamento;sp. inclinación del eje.
Achteck, das regelmäßige A. (gr.→ Oktogon) ist eine wichtige geo-metr. Figur und wurde bei Zentral-bauten als Grundrißfigur verwen-det. Engl. octagon; frz. octogone; it. ottagono;sp. octógono.
Achtort, Achtspitz, Achtuhr, zwei,einem Kreis einbeschriebene, über-eckgestellte, gleichgroße Quadrate;im MA. als Proportionsschlüsselbenutzt, bes. für Turm-, Pfeiler-und Fialengrundrisse der Gotik.
Achtpaß, Ornamentfigur des got.Maßwerks aus acht Dreiviertel-kreisbogen, die radial um einen Mit-telpunkt angeordnet sind (→ *Paß).
Achtspitz → *Achtort.
Achtuhr → *Achtort.
Ackerbürgerhaus, ein zum bäu-erl. Erwerb ausgestattetes Bürger-
Achsenbrechung 6
Achse a Längsa. b Quera. c Mittela. d Fenstera.
Achsenneigung
haus in einer geschlossenen Ort-schaft/Stadt, geprägt von dem mehroder weniger großen Anteil der fürdie landwirtschaftl. Nutzung not-wendigen Räumlichkeiten.
Acoltello (it.), eine Form des →Pflasters (→ *Ährenwerk 2). It. a spina di pesce; sp. forma de pavimento.
Adelshotel → *Hôtel.
Adelsturm → *Geschlechterturm.
Ädikula, Aedicula (lat. kleinesHaus, Tempelchen), urspr. kleiner,einer Tempelfront ähnl. Aufbauzur Einstellung einer Statue.Danach jede aus Stützgliedern(→ *Säulen, → *Pfeilern, → *Pila-stern) mit Gebälk oder Bogen undeinem Giebel in Dreieck- oderSegmentbogenform bestehendeUmrahmung von Nischen, Porta-len und Fenstern als architekton.Schmuck und Belebung undGliederung großer Mauerflächenam Außenbau und im Innenraum. Engl. aedicula; frz. édicule; it. edicola;sp. edículo.
Ädikulaaltar → *Altarretabel.
Adlerkapitell, ein Kapitell mitvier aufrechtsitzenden oder stür-zenden Adlern an den Ecken, selte-
ner auf den Breitseiten, bes. in derbyzant. und roman. Baukunst ver-wendet. It. capitello figurato con aquile; sp. capiteldecorado con águilas.
Adobe (span.), ungebrannter, luft-getrockneter → Backstein ausLehm, in Spanien und Latein-amerika für Hausbau verwendet. Frz., it. sp. adobe.
Adyton (gr. das Unzugängliche),vereinzelt auch → Abaton genannt,in gr.Tempeln der Raum, in demdas Kultbild steht und der alsAllerheiligstes nur von Priesternoder von bevorrechtigten Laienund nur zu bestimmten Zeitenbetreten werden darf. In einigenTempeln ist das A. ein gegen dieCella geöffnetes, erhöhtes Hinter-gemach, in anderen eine Kammer
7 Adyton
Achtort
Ädikula
inmitten der Cella oder auch nureine Nische an einer Rückwandder Cella; auch kann der → Opis-thodomos als A. gelten. � Auch dieihrer Funktion nach ähnliche Bar-kenkammer (Sekos) ägypt. Tempelwird manchmal A. genannt. Engl. adytum; frz. adyton; it. ádito; sp. ádito.
Aerarium, Schatzhaus zur Aufbe-wahrung des Tempelschatzes, derStaatskasse im antiken Rom oderDokumentenkammer in Rathäu-sern. It. erario; sp. erario.
Aëtoma, Aëtos (gr. das Adlerför-mige, der Adler), selten gebrauchteBezeichnung des Giebels gr. Tem-pel (→ *Tympanon). Engl. aetoma, aetos, pediment; frz. aera-rium; sp. aetoma.
Afterklaue, Achterklaue, → Klaueeines Sparrens, wenn sie auf derHinterseite des Rahmenholzes hin-abgreift, also den Rähm überkämmt.
Agora (gr. Markt), Platz der gr.Stadt, auf dem Versammlungenund Märkte abgehalten wurden,meist rechteckig und von Säu-lenhallen (→ Stoa) umgeben, miteinem oder mehreren Altärenund mit Denkmälern. An oderin der Nähe der A. lagen dasRathaus (→ *Buleuterion) und dasHaus der städt. Behörden (→ Pryta-neion).Engl., frz. agora; it. agorà; sp. ágora.
Agraffe, hoher Keilstein, der zweiSteinschichten miteinander ver-bindet, als Schlußstein eines Bo-gens oft mit einer Maske o. ä. ver-ziert, auch volutenförmig oder alsMedaillon vom Rundbogenschei-tel zum Gebälk überleitend. Engl. agraffe, clasp; frz. agrafe, clef d�arc;sp. ágrafe.
Ägyptischer Saal, Hypostyl, hießnach Vitruv ein in der hellenisti-schen Baukunst vorkommenderdreischiffiger Säulensaal, dessenüberhöhtes Mittelschiff durchFenster zwischen Halbsäulen vorden Oberwänden belichtet wurde(→ *Basilika Querschnitt). Engl. Egyptian hall; frz. salle égyptienne;it. sala egizia; sp. sala egipcia.
Aerarium 8
Adyton (Beispiel: Selinunt, Heratempel E)
Agora
Ägyptisches Kreuz → Antonius-kreuz.
Ähre, ährenförmige Verzierungaus Eisen oder gebranntem Ton aufGiebel- oder Turmspitzen zur Be-tonung der freien Endigung.Engl. herringbone, ear of corn; frz. épi;it. spiga; sp. espiga.
Ährenwerk (lat. opus spicatum),1. eine Art des Mauerverbands, beidem die Steine in zwei überein-anderliegenden Schichten abwech-selnd schräg zu einander gesetztsind (Schrägschar, Stromschicht),so daß ein ährenähnl. (Fischgrat-)Muster entsteht, auch als Aus-gleichschicht bei flachliegendem
Steinmaterial oder im → *Back-steinbau. 2. Die gleiche Anord-nung flach verlegter Steine beimBackstein- → *Pflaster (Acoltello). Engl. 1. herringbone-work; frz. 1. appareilen feuilles de fougère; it. 1. concatenamen-to a spina di pesce, 2. pavimentazione aspina di pesce; sp. aparejo den forma espi-napez.
Ährn → Diele.
Akanthus (gr.-lat.), am Mittelmeersehr verbreitet (acanthus mollis),meist große, buchtig ausgerandeteund an der Spitze leicht eingerollteBlätter in mehr oder weniger stili-sierter Form, ein beliebtes Dekora-tionselement der Baukunst, typischbes. für das korinth.→ *Kapitellund beim → Akroter. Engl. acanthus; frz. acanthe; it., sp. acanto.
9 Akanthus
Ähre
Ährenwerk1 Stromschichten 2 Acoltello
Akanthus
Akanthusfries → *Fries aus fort-laufend gereihtem Akanthus.
Akropolis (gr. Hochstadt), hoch-gelegener, befestigter Stadtteil oder→ Zitadelle einer gr. Stadt, auchwichtiger Kultplatz und Herr-schersitz. Engl. Acropolis; frz. acropole; it. acropoli;sp. acrópolis.
Akroter, Akroterion (gr. höchster,äußerster Teil), bekrönendes Ele-ment auf der Spitze und an denEcken des Giebeldreiecks an gr.und röm. Tempeln, Stelen u.ä. Zu-nächst eine kreisförmige Scheibeaus bemaltem Ton, dann ornamen-tal und plast. reich ausgebildet,meist unter Verwendung pflanzl.Motive (→ *Akanthus, → Palmette),aber auch vollplast. in Form vonVasen, Dreifüßen oder Fabeltieren(Greif, Sphinx), vereinzelt auch von
menschlichen Gestalten. In antiki-sierenden Stilphasen wiederaufge-nommen, auch als Kreuz, → *Obe-lisk oder → Voluten. Engl. acroterion; frz. acrotère; it. acroterio;sp. acrotera.
Alae (Mz. v. lat. ala: Flügel), imröm. → Wohnhaus zwei an dasAtrium beiderseits anschließende
Akanthusfries 10
Akropolis (Beispiel: Athen)
Giebelakroter
und gegen dieses offene Räume,auch für die Schiffe einer Kirchebenutzt. Engl. alae; frz. aile; it. alae; sp. ala.
Alcazaba (arab.-span. Festung),bes. Vorwerk oder Citadella ohneWohnung eines Herrschers, auchbefestigter Stadtteil (mit Wohnung→ Alcazar). Frz.; sp. alcazaba.
Alcazar, Alkazar (arab. alqasr: Pa-last) bewehrtes span. Schloß, dasoft andere Befestigungsanlagenbeherrscht und einem Fürsten alsWohnung dient (ohne Wohnung→ Alcazaba). Engl., frz., it. alcazar; sp. alcázar.
Aleipterion (gr. Salbraum), Raumdes gr. Gymnasions und der röm.→ *Thermen, in dem man sich mitÖl einrieb bzw. vom Einsalber(Aleiptes) einreiben ließ.
Aljimez (span.), eine im muslim.Spanien und in Nordafrika immaur. Stil verwendete Fenster-form, die aus zwei auf einer mittle-ren Säule ruhenden, gleichhohenHufeisenbogen besteht.
Alkoven (span. alcoba, nach arab.al kubbe: das Hohle), durch einegroße Wandöffnung mit demWohnraum verbundener, kleinerfensterloser Nebenraum, in demdas Bett steht. Die aus dem arab.Wohnhaus stammende Anordnungkam über Spanien, wie der Name,seit der Mitte des 17. Jhs. in fastallen europ. Ländern in Gebrauch. Engl. alcove; frz. alcôve; it. alcova; sp. alcoba.
Allerheiligstes, 1. in antiken Tem-peln der abgesonderte Raum für
das Götterbild (→ *Adyton, Sekos).2. In christl. Kirchen der Platz desAltars (→ Sanktuarium), in derorthodoxen Kirche der Raumhinter der → *Ikonostasis, in der→ *Synagoge der Aufbewahrungs-raum für die Thorarollen (→ Ar-che). Engl. sactuary; frz. sanctuaire; it. santuario;sp. santuario.
Almemor (arab. al minbar: dieRedestatt), Bima, erhöhter undumgrenzter Platz des Vorlesers inder Mitte der → *Synagoge, inneuerer Zeit auch an der Ostwandneben dem Hl. Schrein, gelegent-lich auch mit diesem und demPredigtstuhl des Rabbiners zueiner chorartigen Anlage zusam-mengezogen.
Almena (span.-arab. Zinne), eineim arab. und maur. Stil häufig vor-kommende Zinne, die auch aufGotteshäusern als Zierform vor-kommt, → *Zinne.
Almosenhaus, -kammer (lat. al-monarium), Gebäude oder Raumzur Verteilung der Almosen anKlosterarme, zumeist neben derKlosterkirche oder Klosterpfortegelegen. Engl. almonry; frz. aumônerie; it. elemosi-neria; sp. casa de limosnas.
Altan, Altane, Söller, im Gegen-satz zum frei vorkragenden Balkonein bis zum Erdboden mit Säulen,Pfeilern oder Mauern unterbauter,mit einer Brüstung versehener höl-zerner oder steinerner Austritt anoberen Etagen, teilweise in Verbin-dung mit Freitreppen. (Abb. S.12)Engl. balcony, platform, gallery; frz. altane;it. altana, loggia; sp. azotea.
11 Altan
Altar (lat. alta ara: erhöhte Opfer-stätte), 1. entsprechend seinem ur-spr. Zweck, der Darbringung vonTier-, Brand- und Rauchopfern, istder A. der Antike ein steinernerBlock oder eine untermauerteSteinplatte und steht in der Regelim Freien vor der Eingangsseitedes Tempels, doch wurden auchauf Straßen und Plätzen oder inheiligen Hainen A. errichtet. DieEcken der A.platte können als stili-sierte Stierhörner gebildet oderauch mit Voluten und Tierschädeln(→ Bukranion) verziert, der Un-terbau mit Girlanden oder figürl.Reliefs geschmückt sein. In derSpätantike steht der A. häufig aufeinem hohen, von reliefgeschmück-ten Schranken und Säulen umge-benen Stufenunterbau und wird zueinem selbständigen Monumentvon oft beträchtl. Umfang. 2. Derchristl. (kath.) A., als Stätte deseucharist. Mahls gedacht, ist in derRegel aus Stein und besteht aus derA.platte oder Mensa und deren Trä-ger oder Stipes. Dazu kommt imMA. noch eine auf der Mensa oderhinter dem A. angebrachte Schau-wand, das → *Altarretabel, im frü-hen MA. oft auch ein schützenderund schmückender Überbau, das→ *Ziborium. In der altchristlichen→ *Basilika steht der A. vor der→ *Apsis, und zwar häufig übereinem Märtyrergrab. Im MA. rückt
der Haupta. (Hochaltar) in die Ap-sis hinein, während die den Hei-ligen gewidmeten Nebenaltäre anverschiedenen Plätzen der Kirchestehen können. Westl. des Chorsunter dem Triumphbogen stehtder Kreuzaltar. Möglichkeiten fürdie künstler. Ausstattung des A. botzunächst die Altarbekleidung, das→ *Antependium, im späten MA.auch das A.retabel, aus dem sichder → *Flügelaltar entwickelte. For-mal sind vier A.typen zu unter-scheiden: a) Die älteste Form istder Tisch-A., dessen Platte voneiner oder mehreren Stützen (Sti-pes) getragen wird. b) Der Kasten-A. hat im Innern des Unterbausder Mensa einen großen, von au-ßen zugängl. Hohlraum, der die Re-liquie birgt. c) Beim Blockaltar istder Unterbau ein massiver Block,dessen Vorderseite durch Maßwerkoder Bauornamentik geschmücktsein kann. d) Der Sarkophag-A., beidem der Unterbau einen Sarko-phag enthält, kommt erst im 17. Jh.auf, bes. in Süddeutschland undÖsterreich vom Barock bis zumKlassizismus. � Im Gegensatz zurkath. Kirche kennt der Protestan-tismus in jeder Kirche nur einen A.Von den überkommenen A.typenwurde nur der Kasten-A. infolgedes Wegfalls der Reliquienvereh-rung von den Protestanten aufge-geben. Das A.-Retabel, von den Re-formierten von vornherein abge-lehnt, wurde von den Lutherischenin mehr oder weniger veränderterForm noch lange beibehalten. Eineprotestant. Sonderform des 18. Jh.ist der Kanzel-A., bei dem die Kan-zel und gegebenenfalls auch die Or-gel auf einer von Säulen getragenenEmpore über den A. vorkragen. Engl. altar; frz. autel; it. altare; sp. altar.
Altar 12
Altan
13 Altar
Altar
1a Antiker Blocka.1b Antiker A. mit Stufenunterbau2a Tischa.2b Kastena.2c Blocka.2d Sarkophaga.2e Protestant. Kanzela.
Altarantependium → *Antepen-dium.
Altaraufsatz → *Altarretabel.
Altarciborium → *Ziborium.
Altarretabel (lat. retabulum: Rück-wand), jeder Altaraufsatz, im dt.Sprachgebrauch oft schlechthinAltar genannt, eine entweder aufdie Mensa des (kath.) Altars direktaufgesetzte, auf einem Zwischen-stück (Predella) oder hinter diesemauf einem Unterbau stehendeSchauwand, die im MA. aufkam.Das roman. A. aus Stein, Stuckoder Metall ist mit Reliefs, wennaus Holz mit Malereien ge-schmückt. Sein Umriß ist recht-eckig, halbrund oder rechteckigmit halbrunder Erhöhung in derMitte. Die Gotik entwickelt das A.mit bemalten Tafeln und umgibtdiese mit einem architekton. Rah-men, der mit einem Aufbau ausPfeilern, Wimpergen und Fialen(Gesprenge) versehen und durchHinzufügung von Flügeln zu einem→ *Flügelaltar erweitert werdenkann. In Renaissance und Barock istdas hinter dem Altar aufgebaute A.üblich, wobei auf Flügel weitgehendverzichtet und nur das Altarblattgenannte Mittelbild beibehalten
wird, dessen architekton. Umrah-mung in Form einer → *Ädikula(Ädikulaaltar) mit der Architekturdes Chors und des ganzen Kirchen-raums zu einer stilist. und schein-bar konstrukt. Einheit verschmilzt. Engl., frz. retable; it., sp. retablo.
Altarschranken, niedrige Schran-ken aus Stein, Holz oder Metallzur Abgrenzung des den Priesternvorbehaltenen Raums vor demAltar vom übrigen Innern der(kath.) Kirche, hervorgegangen ausden → Cancelli der → *Basilika(→ *Chorschranken). Engl. altar rail; it. cancelli d�altare; sp. rejasde altar.
Altarschrein, hölzerner kastenför-miger Mittelteil eines → *Flügel-altars. Engl. altar chest; frz. coffre d�autel, contre-retable à volets; it. pannello centrale dellancona.
Altarstaffel, Predella, Zwischen-stück zwischen Mensa und Altar-retabel (→ *Flügelaltar). Engl., it. predella; frz. prédelle; sp. predela.
Altarvorsatz → *Antependium.
Altenteil, auch Auszug, Ausgedin-ge, Abnahme, Abschied, Leibzuchtgenannte mehr oder weniger abge-sonderte Räume für die Unter-bringung der Alten im Bauern-haus, auch als Altenteilerhausinnerhalb des Hofs gebaut.
Alter Dienst, dickerer Diensteines → *Bündelpfeilers im Gegen-satz zu dem Jungen Dienst. Engl. principal shaft, archmullion; frz. demi-colonne à grand diamètre; it. semicolonnamaggiore di un piliere; sp. semi columna degran diámetro.
Altarantependium 14
Ma. Altarretabel
Altersheim, als Altersfürsorgezunächst in Form kirchlicher Stif-tungen (Heiliggeist-Spital), dannmeist als kommunale, kirchlicheoder private Anstalten gegründet. Engl. old people�s home; frz. maison deretraite; it. ospizio per i vecchi, gerontoco-mio; sp. asilo de ancianos.
Altis (gr.), Temenos, Peribolos, Be-zeichnung für einen gr. → *Tempel-bezirk. Frz.; sp. altis.
Alvens (lat.), vertieft liegender,ringförmiger Gang zwischen scho-la und Badebassin (alvus) im röm.Bad.
Amalaka, Schmuckmotiv der ind.Baukunst in Form eines flachrun-den, radial gerippten Wulstes oderPolsters. Das A. erscheint sowohlan Säulenkapitellen und als glie-derndes Zwischenstück an Pfei-lern, als auch als krönender Ab-schluß nordind. → *Sikharas undist vielleicht der Frucht des blauenund weißen Lotus nachgebildet.Der vasenförmige Abschluß des A.heißt Kalasa.
Ambitus (lat. Umgang), 1. alter-tüml. Bezeichnung für Chorum-gang. 2. Kreuzgang. 3. Der mehroder weniger schmale freie Raumzwischen den Außenwänden einerKirche und einer diese umgeben-den Mauer oder angrenzendenGebäuden. Frz. ambitus; it. ambito; sp. ámbito.
Ambo (v. gr. ambon: Erhöhung),in der altchristl. und frühma.→ *Basilika ein meist steinernerAufbau mit Lesepult, in der Regelzwei: Evangelien-A. an der Nord-,Epistel-A. an der Südseite der→ *Chorschranken (→ Cancelli).Der Evangelien-A. besteht urspr.aus zwei mehrstufigen Treppennach O. und W., dazwischen einbreiteres Podest, auf dessen Brü-
15 Ambo
Ambitus
Ambo
stung das Pult und östl. neben ihmder steinerne Leuchter für dieOsterkerze angebracht ist. DerEpistel-A. war kleiner und wenigerverziert als der Evangelien-A. undhatte nur eine Treppe. Im späterenMA. wurden die Ambonen demLettner eingebaut oder durch dieKanzel ersetzt. Engl. ambo; frz. ambon; it. ambone; sp. am-bón.
Amborelliputz, Fassadenputz auszwei bis drei Lagen Kalkmörtel mitZement- und Farbzusatz.
Ambulacrum, Ambulatio, 1. Hallezum Spazierengehen an den Gär-ten des röm. Wohnhauses. 2. Halledes Atriums des antiken Hauses. 3.Raum zwischen Cella und Säulen-reihe des Peristyls eines antikenTempels. 4. Ambulatorium → Chor-umgang, → Kreuzgang. Engl. ambulatory; frz. ambulatoire; it. 1.�3.ambulacro, 4. deambulatorio; sp. ambulacro.
Amphiprostylos (gr.), antikerTempel mit Säulen, die an den bei-den Schmalseiten nicht zwischen→ *Anten stehen, → *Tempelfor-men. Engl., frz. amphiprostyle; it. anfiprostilo;sp. anfipróstilo.
Amphithalamus, im gr. und röm.Wohnhaus ein Gemächerpaar, dasan das Schlafzimmer der Herr-schaft stieß oder diesem gegen-überlag und den Eingang zu denArbeits- und Wohnräumen derFrauen bildete und den Mägdenzum Aufenthalt, wohl auch alsSchlafplatz diente. It. anfitalamo; sp. anfitálamo.
Amphitheater (gr.), 1. Theater mitringsum geschlossenen Sitzreihenum eine ellipsenförmige Arena, inder sportl. Wettkämpfe, Tierkämp-fe, Gladiatorenkämpfe, seltenerSchlachten auf Schiffen (→ Nau-machie) stattfanden. Bei den erstenAnlagen waren die Zuschauerrängeauf ansteigendem Gelände entwik-kelt oder durch Aufschüttung vonErdwällen gebildet. Später wurdenbei allen größeren Anlagen dieSubstruktionen im Steinbau er-richtet. Die konzentr. Gänge sindmit Ringtonnen (→ *Gewölbefor-men) überwölbt, radial dazu verlau-fen Stichgänge, die mit Treppen-häusern abwechseln. Die Gängeund Treppen münden an zahlrei-chen Stellen im Zuschauerraum,inmitten der als Sitzplätze dienen-den Stufenanlagen, so daß eine
Amborelliputz 16
Amphitheater
sehr rasche Füllung bzw. Leerungrelativ kleiner Zuschauersektorenerreicht wurde. Die Arena liegt aufGeländehöhe, seltener darunterund war bei größeren Anlagen ganzunterkellert (Gelasse für Tiere).Der zwei-viergeschossige äußereAufbau wurde durch Bogenstellun-gen zwischen rahmenden Säulenbzw. Pilastern in den klass. Ord-nungen (dor., ion., korinth.) gebil-det (→ *Säulenbogenstellung). Dasoberste Geschoß wurde manchmalauch geschlossen ausgebildet. DieA. konnten ganz oder teilweisedurch Sonnensegel abgedeckt wer-den. Diese konnten an Masten auf-gezogen werden, deren Veranke-rung in der oberen Umfassungs-mauer lag. A. mittlerer Größe faß-ten bei einer Ausdehnung von100/130 m zwischen 15000 und25000 Zuschauer. Das größte röm.A. war das Kolosseum mit einerAusdehnung von 156/185m, 527mUmfang und 48 m hohen Umfas-sungswänden. Es konnte 85000Menschen fassen.2. Als A. wird manchmal auch der»amphitheatralisch« angeordneteTeil des Zuschauerraumes moder-ner Theater bezeichnet. Engl. amphitheatre, am. amphitheater;frz. amphithéâtre; it. anfiteatro; sp. anfitea-tro.
Anaktoron (gr. Götterwohnung),weniger gebräuchl. Bezeichnungfür das → *Adyton des gr. Tempels.
Anda (Sanskrit Ei), der kuppelför-mige Oberbau des → *Stupa.
Andreaskreuz, → *Kreuz mitschräg gestellten Balken, benanntnach dem Apostel Andreas, der anein solches Kreuz genagelt worden
sein soll. Die Form des A. findetsich bes. beim Fachwerk als x-för-mige Balkenverstrebung (→ Kreuz-streben, Abkreuzung 2) und zurZierde. Engl. Saint Andrew�s cross; frz. croix deSaint-André; it. croce decussata, croce diSant�Andrea; sp. cruz de San Andrés.
Andron (gr. Männergemach), 1.Speisesaal für Gastmähler im altgr.Wohnhaus. 2. Verbindungsgangzwischen Atrium und Peristyl impompejan.-röm. → *Wohnhaus. Frz. andrôn; it. 1. 2. androne; sp. andrón.
Andronitis (gr.), der zur Straßegelegene Wohnteil für die Männerim gr. → *Wohnhaus, im Unter-schied zur Frauenwohnung (Gynä-keion). Frz., it., sp. andronitis.
Anfallinie, 1. Linie, über der dieKrümmung der Laibung gestelzterBogenformen beginnt. 2. AuchGratanfall, Grat oder Kehle amZusammenstoß einer kleinerenDachfläche an eine größere(→ *Dachausmittlung). Frz. ligne de naissance; it. piano d�impostadi arco sopralzato; sp. linea del vértice.
Anfallspunkt, Punkt, in dem mehrals zwei Dachflächen zusammen-treffen (→ *Dachausmittlung). Frz. point d�appui; it. punto d�incontro dipiù di due falde; sp. punto de encuentro demás de 2 faldones.
Anfänger → Anfangsstein.
Anfangsfuge, an Bogen oder Ge-wölben die Fuge über dem Wider-lager, an der die Wölbung beginnt(→ Bogen I). Frz. joint du sommier; it. fuga del pianod�imposta; sp. junta de imposta.
17 Anfangsfuge
Anfangsstein, Anfänger, Anwöl-ber, der erste Stein eines → *Bogens(I) oder → *Gewölbes (→ Gewöl-beanfänger) über dem Kämpfer(Kämpferstein oder der Kämpfer-linie). Engl. springing stone, springer of arch;frz. sommier; it. concio d�imposta; sp. im-posta superior.
Angel, am Gewände von Türenoder Fenstern sitzende Zapfen, umdie sich die am Tür- bzw. Fenster-flügel befestigten A.-bänder dre-hen. In der Antike saßen die A.meist am Flügel und bewegten sichunten in der steinernen, durchMetalleinlage verstärkten A.pfan-ne, oben im metallenen oder stei-nernen A.ring. Diese Konstruktionist noch heute für schwere Toreüblich. Engl. hinge, pivot; frz. pivot, gond, valet;it. perno, spina; sp. bisagra, pernio.
Angelpfanne → *Angel.
Angelring → *Angel.
Angerdorf, Dorf, dessen durch-laufende Hauptstraße sich zu ei-nem länglichen grünen, baumbe-standenen Platz, Anger, erweitert(→ *Dorfformen 5).
Angriffsapproche → Sappe.
Angstloch, runde oder quadrat.Öffnung im Scheitel des Gewölbesüber dem als Kerker (Verlies) be-nutzten Untergeschoß des → *Berg-frieds. Engl. oubliette; frz. trappe d�oubliette;it. apertura della segreta; sp. abertura su-perior a un calabozo.
Anker, konstruktive Vorrichtungaus Holz oder Eisen zur zugsiche-ren, meist horizontalen Verbin-dung von Bauteilen. 1. Der Bal-ken-A. zur Verankerung von Holz-balken im Mauerwerk, ist meist einam Balken befestigter Eisenstab,dessen in die Mauer eingreifendesEnde, der A.kopf, eine Öse (A.-Auge) hat, durch die ein Quer-stück, der A.splint, gesteckt wird.Sichtbare A.splinte sind an Bautendes MA. und der Renaissance häu-fig ornamental (Zier-A.) oderkreuzförmig (Kreuz-A.) ausgebil-det. 2. Zug-A. dienen zur Siche-rung gegen den Horizontalschub
Anfangsstein 18
Angela mit Stützkegel b mit Angelpfanne
Zieranker (Kreuzanker)
Balkenanker
gemauerter Bögen, Gewölbe oderhölzerner Tonnen, z. B. zwischenden bogentragenden Stützen (Säu-len, Pfeilern) an Vorhallen oderLoggien und als hölzerne → *A.bal-ken von Wand zu Wand in ma.Kirchen und im Fachwerkbau. 3.Ring-A. aus Holz oder Eisen neh-men die bei Kuppel- und Kloster-gewölben entstehenden Ringspan-nungen auf, soweit die Mauerkon-struktion mit ihren Verstrebungennicht genügt.Engl. anchor; frz. ancre; it. tirante; sp. ancla.
Ankerbalken, hölzerner Zuganker(→ *Anker 2) zur Sicherung derWände gegen den Schub desDachwerks oder Gewölbes. Engl. anchor beam; frz. entrait; it. catena (dilegno); sp. tirante de arco.
Ankerkopf → *Anker.
Ankerschließe, Ankerschlüssel →Ankersplint.
Ankersplint, Flacheisen, das durchdie Öse des → *Ankers gestecktwird, häufig ornamental ausgestal-tet. It. bolzone; sp. platillo del anclaje.
Ankerstein, Zungenstein, schwal-benschwanzförmiger oder gekröpf-ter Werkstein, der ineinandergrei-fend eine bes. feste Verbindung desMauerwerks ergibt, daher haupt-sächl. bei Vormauerungen, bei weitausladenden Gesimsen, bei Wider-lagern und Brückenpfeilern ver-wendet. Frz. pierre d�ancrage; it. pietra di ancorag-gio; sp. piedra de anclaje.
Anlauf, 1. konkav kurvierte Ver-mittlung zwischen einem vor-springenden unteren und einemzurücktretenden oberen Bauglied(Apothesis, Apophyge, → *Ablauf).2. Leichte Neigung (Anzug) desSockels bzw. des gequadertenErdgeschosses nach dem Gebäude.3. Kurze Rampe. Engl. 1. apothesis; frz. crue, congé d�en bas,congé renversé, naissance d�un fût, cavet;it. 1. guscio inferiore; sp. 1. apótesis.
Annex, Anbau an ein Gebäudeoder niedrigerer angesetzter Bau-teil (→ Pastophorien). Engl. annexe, am. annex; frz. annexe; it. an-nesso; sp. anexo.
Anrichte, Raum zwischen Kücheund Speisezimmer zur Vorberei-tung der Speisen, als Schrank auchBuffet genannt. Engl. pantry, dressing-room; frz. dressoir,salle de dresse, office; it. office; sp. repostero.
19 Anrichte
Ankerbalken
Ankerstein
Anschieber → Aufschiebling.
Anschlag, bei Türen und Fen-stern ein schmaler, rings um dieMaueröffnung laufender Absatz(Falz), in den der hölzerne Blend-rahmen eingefügt ist; allgemeinauch jede Fläche, gegen die einanderer Teil, z.B. ein Fensterflügeloder Schlagladen schlägt. Engl. rabbet, rebate; frz. languette, battée,feuillure; it. battuta, allg. mazzetta; sp. ranu-ra, batiente, lengüeta.
Anschlitzung, Holzverbindungdurch Schlitz und Breitzapfen zurVerlängerung oder Winkelbildung,häufig auch mit zwei oder mehrSchlitzen bzw. Zapfen. Engl. slit-and-tongue joint; frz. assemblage(emboîtement) par embrèvement (parenfourchement); it. incastro a maschio efemmina; sp. encastre.
Anschluß, der Punkt oder die Flä-che des Zusammentreffens ver-schiedener Baustoffe, Bauteile oderBauelemente. Engl. junction, connexion, am. connection;frz. jonction, adjonction; it. connessione;sp. conexión.
Anschuhung, Verlängerung vonHölzern durch → Anschlitzung,Blatt oder Zapfen.
Anschwellung eines Säulenschafts→ Entasis.
Ansetztraufe, Abtraufe (→ *Was-serspeier).
Ansicht → Aufriß, Riß (→ *Pro-jektion).
Ansitz, Burgsitz, Festes Haus,wehrhaftes Wohngebäude mit oderohne Umfassungsmauer als Sitzeines Adeligen, Vogts oder vonDienstmannen oder zum Schutzvon Grundbesitz erbaut, bes. inSüddeutschland und in den Alpen-ländern. Frz. siège, résidence; it. castelletto; sp. resi-dencia.
Ansteigender Bogen, gleichbe-deutend mit einhüftiger Bogen(→ *Bogenformen). Engl. rampant arch; frz. voûte rampante,voûte montante; it. arco rampante; sp. arcoelevado.
Antarala, offene Vorhalle an ind.Tempeln (→ *Mandapa). Frz. antarala; sp. atrio abierto de templohindú.
Ante (lat.), die vorgezogenen Sei-tenwände der Cella, die die Vor-halle des Antentempels (→ *Tem-
Anschieber 20
Anschlaga, b A. des Blendrahmens am Mauer-
werkc Flügela. am Setzholzd Flügela. mit Schlagleiste
Ante
pelformen) bilden. Die stärkereAusbildung der A.stirn geht zurückauf das altgr. → *Megaron, dessenMauern aus ungebrannten Lehm-ziegeln an der Stirn durch senk-rechte Bohlen geschützt waren.Diese Verstärkung heißt A.pfeilerund wird von einem → *Kapitellbekrönt (→ *A.kapitell). Engl., it., sp. anta; frz. ante.
Antefixa, Antefix (lat. die angena-gelten Dinge), 1. bemalte Plattenaus gebranntem Ton, mit denen anden frühen dor. Tempeln Groß-griechenlands (Süditalien und Sizi-lien) und an etrusk. Tempeln dasGebälk unter dem Traufrand ver-kleidet war. Die Verwendung derA. wurde wahrscheinl. aus demHolzbau übernommen, wo sie dasGebälk gegen Feuchtigkeit schütz-ten (Antepagmenta). 2.→ Stirnzie-gel.Engl. antefix; frz. antéfixe; it. antefissa;sp. antefija.
Antenkapitell, dreiseitig durch-gestalteter oberer Abschluß einesAntenpfeilers. In der dor. Ordnungeinfaches, häufig mit Ornamentenbemaltes Profil (dor. Kyma) und
rechteckige Abakusplatte. In derion. Ordnung Kyma, Astragal, Eck-voluten, Palmetten, Akanthus, auchfigürl. Darstellungen. Das korinth.Akanthus-A. mit konkav ein-schwingendem Abakus. Engl. anta capital; frz. chapiteau d�ante;it. capitello dell�anta; sp. capitel del anta.
Antenpfeiler → *Ante.
Antentempel (lat. templum inantis), die älteste Form des gr. Tem-pels, bestehend aus einem recht-eckigen Raum (Naos, Cella) mitVorhalle (Pronaos). Diese wird ge-bildet aus den verlängerten Seiten-wänden der Cella mit meist zweiSäulen zwischen den Anten. Dop-pel-A. haben auch hinten eineebensolche Vorhalle (Opistho-domos). Da der A. auf das altgr.→ *Megaron zurückgeht, wird erauch Megarontempel genannt(→ *Tempelformen). Engl. temple in antis; frz. temple à antes;it. tempio in antis; sp. templo con anta.
Antepagmenta (gr.), 1. die Gie-belverkleidung eines Holztempelsmit Terrakotten (→ *Antefixa). 2.Die meist aus Stein gehauenen,ornamentierten Türpfosten.
Antependium, (mittellat. Vorhang,vestimentum, pallium, palla, vala-men, altarium oder tabula), Be-kleidung der Unterbauvorderseitedes christl.→ *Altars zu dessenSchmuck. Entweder ein von derMensa herabhängender, kostbarverzierter Stoffbehang oder einekunstreich bearbeitete Tafel (Altar-vorsatz) aus Metall oder Holz.Nach seiner Anbringung an derFrontseite des Altars wird das A.auch Frontale genannt. Mit dem
21 Antependium
Antefixa
Antenkapitell
Wandel der Priesterstellung vonder Rück- zur Vorderseite desAltars trat die Bedeutung der A.zurück. Engl., frz., it. antependium; sp. revestimien-to del altar.
Anteportikus (gr.), die auch Pro-pylon genannte Torhalle vor demEingang in das Atrium der früh-christl. → *Basilika.
Anthemienfries → Anthemion,→ *Fries.
Anthemion (gr. anthos: Blume),1. aus dem Orient stammendesantikes Ornament aus über Ran-ken aufsteigenden Palmetten undLotosblüten. Bes. als gemalter oder
plast. → *Fries in der gr. Baukunstviel verwendet. 2. Die Schneckeam ion. Kapitell, überhaupt jedeSpirale in der Ebene. Engl. anthemion; frz. anthémion; it. ante-mio.
Antichambre (frz.), Vorzimmer,in Schloßbauten des 17. und 18. Jh.oft zwei bis drei hintereinander alsWarte-, Empfangs- oder Boten-zimmer (»antichambrieren«). Engl. antechamber; it. anticamera; sp. ante-cámara.
Antikabinett, großes Zimmerzwischen Salon und Kabinett, auchkleineres Vorgemach. Engl. antecabinet; frz. antichambre; it. anti-gabinetto; sp. antegabinete.
Antiportikus → *Anteportikus.
Antoniuskreuz, Taukreuz, Ägyp-tisches Kreuz, crux commissa,Kreuzform in Gestalt eines T (desgr. Tau), benannt nach dem Ein-siedler Antonius, der in Ägyptenlebte und einen so geformten Stockgetragen haben soll (→ *Kreuz). Engl. Saint Anthony�s cross, Egyptian cross;frz. croix de Saint-Antoine; it. croce di Sant�Antonio, croce antoniana; sp. cruz de SanAntonio.
Antritt, Antrittstufe, die erste, oftbesonders ausgebildete Stufe eines
Anteportikus 22
Antependium (Beispiel: Groß-Komburg)
Anteportikus
Treppenlaufes (→ Treppe), bei höl-zernen Treppen eine Block- oderKlotzstufe (→ *Stufe). Engl. first step, bottom step; it. gradinod�invito; sp. primera grada.
Anuli (lat. Ringe), scharf unter-schnittene Ringe, meist vier, mitüberfallendem Profil am dor. Kapi-tell am unteren Ende des → *Echi-nus (→ *Dorische Ordnung). Engl. annulets; frz. annelets; it. anuli; sp. col-larino.
Anwirteln, eine Säule durch einenWirtel oder Bund (→ *Schaftring)mit der Wand verbinden. Engl. to whorl.
Anwölber, Anfangsstein, Anfän-ger → *Gewölbe. Frz. voussoir de départ, vousseau, claveau;it. concio d�imposta della volta; sp. impostade arco.
Anziegel → Ortziegel, → Dach-deckung.
Anzug, leichte Neigung (→ An-lauf 2).
Äolisches Kapitell, nach der altgr.Küstenlandschaft Äolis im nord-westl. Kleinasien, ihrem Fund-gebiet, benannte Sonder- oder Vor-form des ion. Kapitells aus dem7. Jh. v. Chr. Über einem Kranzherabhängender Blätter (Helices)und einem Blattknauf erheben sichzwei aufwärtsgerichtete Voluten,zwischen denen eine Palmette her-auswächst (→ *Kapitell). Engl. Aeolian capital; frz. chapiteau éolien;it. capitello eolico; sp. capitel eoliano.
Apadana, Apadhana, freistehen-der Repräsentationsbau (Thron-
saal?) in altpers. Palastbezirken, einmeist quadrat. Säulensaal mit Vor-halle(n). Engl., frz., it., sp. apadana.
Apodyterium (gr.-lat.), Ausklei-deraum in röm.→ *Thermen. Engl., frz. apodyterium; it., sp. apoditerio.
Apophyge, Apophysis (gr. das Flie-hen, Fehlen), Anlauf oder → *Ab-lauf. Engl., frz. apophyge; it., sp. apofige.
Apotheke, Speicher, bei den Rö-mern jeder Kaufladen, später nurnoch Arzneimittelverkauf. Engl. chemist�s shop; frz. pharmacie;it., sp. farmacia.
Apothesis, Platz an der Südseiteder Kanzel zur Aufbewahrung derRitualbücher und Gewänder. It. apothesis; sp. apótesis.
Appareil (frz.), 1. Bezeichnungfür Mauerwerk aus Werksteinenoder Quadern, → Mauerverband.2. Rampe, speziell im Innern vonFestungswerken auf den Wallgangzur Heranschaffung von Ge-schützen. Engl. appareille; frz. appareil; it. apparec-chio; sp. aparejo.
23 Appareil
Apadana
Appartement (frz.), eine Gruppezusammengehöriger Zimmer inSchlössern, Hôtels usw.: Wohn-,Vor-, Arbeits-, Schlaf-, Empfangs-oder Audienzzimmer und Kabi-nett. Heute apartment-house undapartment-hotel (Hotel), Kleinwoh-nung. Engl. apartment, flat; frz. appartement,corps de logis; it. appartamento; sp. vivien-da.
Applikation, Ornamentstück, dasauf einen zumeist hölzernenKorpus aufgeleimt wird.
Apside, Abside → *Apsis.
Apsidialkapelle, weniger ge-bräuchl. Bezeichnung für → Chor-kapelle (→ *Chor). Engl. radiating chapel, apsidal chapel;frz. chapelle rayonnante, c. de ch�ur, c.absidiale; sp. capilla absidial.
Apsidiole (lat.), kleine → *Apsis,meist in der Mehrzahl Apsidiolengebrauchte Bezeichnung für dieeiner Apsis oder einem Chorum-gang radial vorgelegten Kapellen,→ Kapellenkranz. Engl. apsidiole; frz. absidiole, abside secon-daire; it. absidiola, picola abside; sp. absidio-la, ábside secundaria.
Apsis, Apside, Abside (gr. Run-dung, Bogen; Mz. Apsiden), inspätröm. Zeit aufgekommene Be-zeichnung für einen halbkreisför-migen, mit einer Halbkuppel über-wölbten Raum, der einem ihmübergeordneten Hauptraum ein-oder angebaut ist und sich meist inseiner vollen Breite und Höhe zudiesem öffnet, zumeist im Osteneiner Kirche mit dem Altar oder alsTeil des → *Chors (→ Konche, →Exedra). Die halbkreisförmige A.
kann gestelzt sein, oder sie hateinen mehr als halbkreisförmigenGrundriß (Hufeisen-A.), sie isthäufig um Mauerdicke oder mehreingezogen und kann durch Mau-erzungen abgeschnürt sein, verein-zelt ist sie außen rechteckig und beiden Byzantinern polygonal um-mantelt. Bei doppelchörigen Anla-gen tritt der Ostapsis eine West-apsis gegenüber. Engl. apse; frz. abside, chevet, tribunald�église; it. abside; sp. ábside.
Apteraltempel, gr. Tempel ohneSäulengang (Pteron) an den Längs-seiten, z.B. Antentempel, Prostylosu. dergl. (→ *Tempelformen).Engl. apteral temple; it. tempio attero;sp. templo aptero.
Aquädukt (lat. aquae ductus: Was-serleitung), in der röm. Kaiserzeitentwickelte Gefällwasserleitung.Durch eine von hohen, oft mehr-
Appartement 24
Apsis
stöckigen Bogenstellungen getra-gene Rinne mit leichtem Gefällekonnte das Gebirgswasser überTäler und Ebenen hinweg in dieStädte fließen. Engl. aqueduct; frz. aqueduc; it. acquedotto;sp. acueducto.
Arabeske (frz.) 1. Islam. Dekora-tion, bestehend aus rein geometr.Formen und stark entnaturalisier-ten Pflanzenranken (Mauresken).2. Aus der hellenist.-röm. Antikestammendes Ornament, das seitder ital. Renaissance A. genanntwird (→ Groteske). Die A. der An-tike, ausgezeichnet durch die plast.,fast naturalist. Auffassung undorganische Bewegung ihres gleich-wohl stilisierten Laub- und Ran-kenwerks, wurde als waagerechterFries oder in senkrechter Anord-nung (symmetr. ausgerichtet) zurDekoration von Pilastern undSockeln verwendet; in stärkererStilisierung und meist in kompak-teren Formen kehrt sie in derbyzant. Kunst wieder. Die it. Früh-renaissance nahm die A. in großemUmfang wieder auf und vonItalien aus fand sie seit etwa 1520Eingang in alle an der Renaissancebeteiligten Länder. Engl. arabesque; frz. arabesques; it., sp. ara-besco.
Aräostylos (v. gr. araios: dünn,licht, und stylos: Säule), »lichtsäu-lig« nennt Vitruv (3. Buch, 3. Kap.)den Tempel, bei dessen Säulen-
stellung das → *Interkolumniumzwischen den Säulen 3½ untereSäulendurchmesser beträgt. It. areostilo; sp. areóstilo.
Arbeitsfuge, Baufuge, die ausarbeitstechn. Gründen Bauteiletrennt. Engl. joint; frz. joint de reprise; it. giunto diripresa; sp. junta de separación.
25 Arbeitsfuge
Aquädukt (Beispiel: Pont du Gard)
2
Arabeske
1 Maureske2 Groteske
1
Arche, Aufbewahrungsort für dieThorarollen in der → *Synagoge. Engl. ark; frz. arche; it., sp. arca.
Architekt (gr. architekton: Erzfü-ger). Der A. versucht, die Umweltmenschl. Bedürfnissen entspre-chend zu ordnen und einzurichtenund den Lebensraum oder seineTeile nach den Regeln der → Bau-kunst zu gestalten (→ Architektur).Der Stand des A. entwickelte sichvom Leiter der Bauleute (Parlier,Polier: Sprecher) zum ausführen-den Baumeister, zum entwerfen-den und theoretisierenden Künst-ler, der mit dem konstruierendenund experimentierenden Ingenieurverantwortl. Planer wird. In zuneh-mendem Maße wurde der A. auchzum Interessenvertreter des Bau-herrn. Als Attribute des A. geltenRichtscheit, Winkel, Lotwaage undZirkel. Engl. architect; frz. architecte; it. architetto;sp. arquitecto.
Architektonik, die in der → Ar-chitekturtheorie erforschten underkannten Gesetze des regelmäßi-gen Aufbaus, danach der gesetzmä-ßige Aufbau (→ Tektonik) einesWerks. Frz. architectonique; it. architettonica;sp. arquitectónico.
Architektur (aus gr.-lat. architectu-ra) ist die Kunstform des Bauens,die Baukunst. Der Begriff wirddaher oft auch für → Baukunst ver-wendet. A. beginnt dort, wo derBauwille über Notwendigkeit undüber Nützlichkeitserwägungen hin-ausgeht. Die absoluten Höhepunk-te der A. erreichen allgemeinenSymbolcharakter: Malbau (Grab-mal, Denkmal usw.) und Kultbau
(Tempel, Kirche usw.) Techn. Ver-vollkommnung ermöglicht dieprägnantere Ausbildung der For-men, die schließlich zu weitgehen-der Festlegung der Einzelheitenführt (z.B. Säulenordnungen). Demganzen Bau dagegen werden wand-lungsfähige Systeme zugrunde ge-legt (z.B. Formen des griech. Tem-pels, gebundenes System u. a.).Außer diesem Prinzip der Einheitin der Vielfalt gibt es das Prinzipder Vielfalt in der Einheit, das trotzgleichbleibender Systematik denDetailreichtum ermöglicht, und da-neben stilistisch weniger ausgepräg-te Formen, denen kein verpflichten-der Formenkanon zugrunde liegt.Die formalistische Behandlung ur-sprüngl. sinnbezogener oder techn.bedingter Details ermöglichte es,diese auch zur Gestaltung nichtentsprechender, ja rein zweckbe-dingter Bauaufgaben zu überneh-men und führte so zum Zerfall derEinheit von Inhalt und Form.Der Stand einer langen Entwick-lung kennzeichnet die heute übli-che Verwendung des Begriffes A.nur noch im Sinne von Aus-schmückung und daher vielfach alsüberflüssig empfundene Zutat.Dagegen blieb der Begriff → Bau-kunst von einer solchen Abwer-tung verschont. Engl., frz. architecture; it. architettura;sp. arquitectura.
Architekturbild, gemalte odergraph. Darstellung einer architek-ton. Schöpfung um ihrer selbstwillen, wobei menschl. Figurenoder landschaftl. Details nur zurBelebung und zur Verdeutlichungder Größenverhältnisse und Tie-fenabstände dienen. Das A. entwik-kelte sich im 17. Jh. in Flandern
Arche 26
und den Niederlanden zu einerselbständigen Gattung, siehe auch→ Vedute. Im 18. Jh. erlebte das A.eine Nachblüte in Italien durchAntonio Canale und seinen NeffenBernardo Belotto gen. Canaletto. Engl. architectural image; it. immagine d�ar-chitettura; sp. imagen de arquitectura.
Architekturdarstellung, die Dar-stellung von Bauwerken, Bauteilenund Innenräumen mit den Mittelnder Malerei und Graphik (→ Archi-tekturbild, → *Architekturmalerei,→ Vedute), als Planzeichnung(→ Bauplan, → *Bauriß) oder in
der Form eines plastischen Mo-dells (→ *Baumodell). Engl. architectural representation, a. des-cription; frz. architectonographie; it. rap-presentazione architettonica; sp. represen-tación arquitectónica.
Architekturkritik, ähnl. der → Ar-chitekturtheorie das Bestreben, dieder Baukunst zugrunde liegendenGesetze zu erkennen und darzule-gen. Jedoch versucht die A. dieUrsachen der Fehlleistungen auf-zudecken. Sie ist vor allem derAusdruck der Auseinandersetzungmit der zeitgenöss. Architektur
27 Architekturkritik
Architekturmalerei (Beispiel: Ingolstadt, Bürgersaal, 18. Jh.)
und wird oft von Architekten be-trieben. Engl. architectural criticism; frz. critiquearchitecturale; it. critica d�architettura;sp. crítica de arquitectura.
Architekturmalerei, gemalte Dar-stellungen von Architektur, d.h.von Gebäuden und Gebäudeteilenzur Dekoration der Wände vonInnenräumen, wobei die Darstel-lung von in Wirklichkeit nicht vor-handenen, zusätzlichen Räumenoder Raumteilen und von gleich-falls illusionist. Fensterausblickenauf Straßen und Nachbarhäuser bes.beliebt waren. Seit der Entdeckungder mathemat. Konstruktion der→ Perspektive in der Frührenais-sance tritt die genaue Wiedergabevon (meist erfundener) Architek-tur mehr und mehr in den Vorder-grund, bis im 16. Jh. das architek-ton. Gebilde das eigentl. Bildthemaoft zur Nebensache werden läßt. Inder Gotik, Renaissance und Barock-zeit wurden die Innenräume, selte-ner Fassaden, von Kirchen, Klösternund Schlössern mit A. geschmückt.(→ Freskomalerei, → *Fassaden-malerei, → Deckenmalerei). (Abb.S.27)Engl. architecture painting; frz. peinturearchitecturale; it. architettura dipinta; sp. ar-quitectura pictória.
Architekturmodell → *Baumo-dell.
Architekturtheorie (gr. theorein:betrachten, überlegen), das Bestre-ben, die der Baukunst zugrunde-liegenden Gesetze aus ihren Haupt-werken zu erkennen und dieGesetze normativ zu erfassen. Dieeinzigen aus der Antike schriftl.überlieferten Versuche einer A.
sind die von dem röm. ArchitektenVitruvius Pollio zur Zeit desAugustus verfaßten »Zehn Bücherüber die Architektur«. Deren Wie-derentdeckung durch einen it.Humanisten im Jahre 1415 (ineiner Abschrift aus dem 9. Jh.) hatwesentl. zur »Wiedergeburt« derAntike in der Renaissancebaukunstbeigetragen und Architekten zuarchitekturtheoretischen Büchernveranlaßt: Leone Battista Albertium 1452, Filarete 1460/64, AndreaPalladio 1570, Sebastiano Serlio1537, Vignola 1542, Philibert De-lorme 1561/65, Wendel Dietterlein1593/94, Joseph Furttenbach 1635,Friedrich Weinbrenner 1810/20,Gottfried Semper 1851. Die A. istdann aufgegangen in die → Archi-tekturkritik. Engl. architectural theory; frz. théorie archi-tecturale; it. teoria dell�architettura; sp. teo-ría de la arquitectura.
Architekturzeichnung → Bau-zeichnung, → *Bauriß, Riß, Bau-plan.
Architrav (gr. archi-: Ober-,Haupt-, und lat. trabs: Balken), inder antiken Baukunst und den vonihr beeinflußten Baustilen der waa-gerechte, den Oberbau tragendeHauptbalken; da er beim gr.Tempel meist auf Säulen ruht,auch Epistyl (gr. auf den Säulen lie-gend) genannt (→ *Säulenord-nungen). Der steinerne A., voneiner Säulenachse zur anderen inBlöcke unterteilt, ist in der → *Do-rischen Ordnung glatt und hatoben eine Abschlußleiste (lat. tae-nie: Band), an der unterhalb kleineLeisten (regulae) mit »Tropfen«(guttae) angebracht sind. Im ion.und korinth. Stil ist der A. durch
Architekturmalerei 28
zwei oder drei übereinanderliegen-de horizontale Streifen (fasciae)von gleicher oder verschiedenderBreite gegliedert und mit einermehrfach unterteilten Leistenbe-krönung versehen � beides eineErinnerung an die übereinanderliegenden Balken des Holzbaus(→ Gebälk).Engl., frz., it. architrave; sp. arquitrabe.
Architraviert sind Einfassungenvon Türen, Fenstern, Nischen u.a.,wenn sie nach Art des Architravesam Rande mit Profilleisten verse-hen oder überhaupt profiliert sind(→ *Archivolte). Engl. trabeated; frz. architravé; it. architra-vato; sp. arquitrabado.
Archivolte (it. archivolto: Ober-,Vorderbogen), 1. der → Faszien-bogen (Vignola), dann die durchkünstlerische Behandlung ausge-zeichnete Stirnseite eines Bogens,von der Antike in die Renaissanceübernommen. 2. Als A. werdenauch die Bogen im → Gewänderoman. und got. Portale bezeich-net, die hier die Fortsetzung derGewändegliederung bilden undhäufig mit Skulpturen (Archivol-tenfiguren) besetzt sind. (Abb. S. 30)Engl. archivolt; frz. archivolte; it. archivolto;sp. arquivolta, dovelaje.
Arcosolium, Arkosol (lat. arcus:Bogen, solium: Sarg), Bogengrab,Loculus, Nischengrab, eine bes. inunterird. Grabanlagen des frühenChristentums häufige Form desWandgrabs, bei dem sich über demkastenförmig in das Gesteins-massiv gehauenen, mit einer fla-chen Platte geschlossenen Grab-trog eine Bogennische wölbt. DasA. war schon im vorderen Orient,dort auch als freistehenderBaldachin (→ *Baldachingrabmal)über einem Sarkophag, gebräuchl.,ehe es im 3. Jh. in den → *Kata-komben Roms Eingang fand. Engl., frz. arcosolium; it. arcosolio; sp. arco-solio.
Arena (lat. Sand), der mit Sandbestreute Kampfplatz im Zentrum
29 Arena
Architrav (Beispiel: Stonehenge)
Architraviert
des röm. → *Amphitheaters, Zirkusund Stadions. Engl., it., sp. arena; frz. arène.
Arkade (mittellat. arcata v. lat.arcus: Bogen), Bogenstellung, d.h.ein auf Stützgliedern (Pfeilern,Säulen) ruhender Bogen. Aucheine fortlaufende Reihe von Bo-genstellungen (Arkatur) wird A.
(doch meist Mz.) genannt, ebensoein Gang, dessen eine Seite vonoffenen Bogenstellungen begrenztwird. Die A. wurde in der Antikebes. von den Römern häufig ver-wendet (Aquädukte, Stadttore u.dergl.), weil der aus Keilsteinenzusammengefügte Rundbogen wei-tere Abstände überbrücken kannund größere Tragfähigkeit besitztals der → *Architrav. Auch in derind. und islam. Baukunst spielt dieA. eine bedeutende Rolle. Diegrößte Bedeutung gewann die A.jedoch im altchristl. und ma. Kir-chenbau: im Zentralbau setzt sieden Mittelraum vom Umgang, inder Basilika das Mittelschiff vonden Seitenschiffen ab, ohne sie opt.und akust. zu trennen. Über denA. verläuft das A.gesims, darübererhebt sich in einer → *Basilika der→ Obergaden. Die Blendarkade(ohne Maueröffnung) dient zurdekorativen Gliederung einerWandfläche. Folgen kleinerer A.werden als Zierform bes. an ro-man. Choranlagen häufig verwen-det (→ Zwerggalerie). A. könnenauch in mehreren Geschossen über-einander angeordnet sein, wobei dieStützabstände in den oberen nied-rigeren Etagen geringer sind. DieZusammenfassung mehrerer A.unter einem Blendbogen und ihrerReihung als Fensteröffnungen(→ *Arkadenfenster) sind nicht nurim Kirchenbau beliebte Variatio-nen des A.motivs. Im Städtebaudient die Öffnung des Erdge-schosses der Häuser nach derStraße durch A. (→ *Laube 2) viel-fach sowohl prakt. als auch ästhet.Zielen. Stützenfolgen mit gerademGebälk heißen → Kolonnade. Engl., frz. arcade; it. arcata; sp. arcada.
Arkade 30
Archivolte 2Bogenlauf
Archivolte 1Stirnbogen
Arkadenbögen, häufig vorkom-mende, aber eigentlich unrichtigeBezeichnung für Arkaden, da derBegriff → *Arkade den des Bogensbeinhaltet. Engl. arcades; frz. arcades, arcs d�arcades;it. arcata; sp. arcos de arcadas.
Arkadenfenster, durch eine fort-laufende Reihe von → *Arkadenunterteiltes Fenster, häufig inKreuzgängen und Königspfalzender roman. Zeit. Engl. arcade window; frz. fenêtre d�arcade;it. polifora; sp. ventanas de la arcada.
Arkadengesims, meist nurschwach hervortretendes waage-rechtes Gesims über der Zone der→ *Arkaden im Inneren ma. Kir-chen, seltener am Außenbau. Engl. arcade cornice; frz. cordon, moulureau-dessus des arcades; sp. cornisa.
Arkadenhof, Laubenhof, Innen-hof mit meist mehrgeschossigenBogenstellungen (→ *Arkade), bes.häufig in Schlössern und repräsen-tativen Bürgerhäusern der Renais-sance. (Abb. S.32)Engl. arcaded court; frz. cour à arcades;it. cortile ad arcate; sp. patio de arcadas.
Arkatur (lat.), die Gesamtheit derArkaden eines Gebäudes oderGebäudeteils, meist → *Arkadengenannt. Engl., frz. arcature; it. arcate; sp. arcatura.
Arkosol → Arcosolium.
Armamentarium → Zeughaus.
Armarium, röm. Schrank für Ge-räte, Wertsachen und Bücher, hoch-rechteckig aus Holz mit einfacheroder doppelten Türen in Biblio-theken, in der Regel als Wand-schränke; im MA. auch Almer oderAlmarium genannt. Seit dem 12.Jh. als Wandschrank bzw. Nischemit Gitter oder Holztüren zur Auf-bewahrung des Allerheiligsten, von
31 Armarium
Arkade
Arkadenfenster
Arkadengesims
Reliquien, liturg. Geräten, meist imChorraum der Kirche, für Bücherauch in der O.-Ecke des Kreuz-gangs neben der Kirchentür. A. wirdauch für den Raum der → *Biblio-thek und → Sakristei gebraucht. Engl. armarium, aumbry, ambry; frz. armoir;it. armadio; sp. armario.
Armbrustscharte, senkrechte,längl. Schießscharte mit waage-rechten oder rundl. oberen undunteren Erweiterungen. Frz. archère, arbalétrière, meurtrière; it. ba-lestriera; sp. barbacana.
Armenhaus, von der Gemeindebereitgestelltes, einfaches Wohn-haus zur dauernden oder zeitwei-sen Beherbergung von armen Fa-milien aus der Gemeinde.
Engl. poorhouse; frz. aumônerie, hôteldieu,charité; it. ospizio; sp. asilo de pobres.
Armierung, die → Bewehrung des→ *Stahlbetons durch Eiseneinla-gen nach stat. Berechnung. Engl. armament; frz. armement, ferraillage,armature; it. armatura; sp. armadura.
Ärn → Diele.
Aron → *Synagoge.
Arsenal (it. arsenale nach arab. arssina�a: Fabrik), Bezeichnung für→ Zeughaus. Engl., frz.; sp. arsenal; it. arsenale.
Artesonado, span. Bezeichnungfür das kunstvolle Täfelwerk maur.Decken und Türen, bestehend aus
Armbrustscharte 32
Arkadenhof (Beispiel: München, Münzhof)
vielen Hölzern, die zu geometr.Mustern mit vertieften Feldern(artesón: Becken) zusammengefügtsind. Engl., frz., it., sp. artesonado.
Artushof, von England ausgehendbes. seit dem 14. Jh. in den Hanse-städten errichtete Versammlungs-häuser der Artusbruderschaften (=Gesellschaften vornehmer Bürger,die sich nach der Tafelrunde dessagenhaften Königs Artus benen-nen). Engl. King Arthur�s Court; frz. maison desmarchands à Dantzig; sp. corte del Rey Ar-turo.
Âsana (Sanskrit: sitzend), altind.Tempeltypus, der über der Cellastatt des → *Sikhara ein flachesKuppeldach oder ein Walmdachhat. Diese Abweichung wird damiterklärt, daß das Kultbild der Celladen Buddha oder Shiva in Yoga-stellung bzw. auf einem Thronesitzend, jedenfalls nicht stehend,darstellte.
Asklepieion (gr.), ein dem Heil-gott Asklepios (Äskulap) geweihtesHeiligtum mit Räumen für denHeilschlaf und für Therapien. Frz. asklépiéion; it. asclepieo; sp. ascle-pieion.
Astragal (gr. astragalos: Sprung-bein, Würfel; die rundl. Fußkno-chen von Lämmern dienten im al-ten Griechenland als Würfel), in dergr. Baukunst ein schmaler, halb-rund profilierter und als Perlen-schnur gebildeter Stab (Perlstab),der die waagerechte Grenzlinie
zwischen Bau- oder Ornament-gliedern betont. An der Säule der→ *Ion. Ordnung bezeichnet derA. die Grenze zwischen Schaftund Kapitell, als Perlstab bildet erdie untere Begrenzung des ion.→ Kyma. Zwischen die einzelnenrunden oder längl. Perlen sindgewöhnlich zwei Plättchen einge-schoben. Engl. astragal; frz. astragale; it. astragalo;sp. astrágalo.
Astrippe, mit Aststümpfen gezier-te Rippe im spätgot. Gewölbebau.Frz. nervure écotée; sp. nervadura adornadacon tocones.
Astwerk, aus knorrigen, mit zahl-reichen Stümpfen besetzten laub-losen Ästen bestehendes Dekora-tionsmotiv der Spätgotik, häufiganstelle von Maßwerk an Baldachi-nen, Taufbecken, Kanzeln, → *Sa-kramentshaus und Kirchenporta-
33 Astwerk
Âsana
Astragal
len, vereinzelt auch an Gewölbe-rippen vorkommend. Engl. branch tracery; frz. bois mort, bran-chage, rameaux; it. intreccio a rami; sp. ra-maje.
Astylos (gr. säulenlos), Bauwerk,bes. Tempel ohne Säulenstellungen.It.; sp. astilo.
Atektonisch, den Regeln der→ Tektonik nicht entsprechend. Engl. atectonic; frz. atectonique; it. atettoni-co; sp. atectónico.
Atelier (artiliara v. lat. ars: Kunst,altfrz. artelier), Werkstatt, insbes.Künstlerwerkstatt; heute auchjeder Raum von bedeutendererGröße und spezieller Beleuchtungfür bes. handwerkliche Tätigkeit. Engl., it. studio; frz.; sp. atelier.
Atlant (it. atlante), aus der it. Re-naissance stammende Bezeichnungfür eine meist überlebensgroßemännl. Gestalt, auch Telamon oderGigant genannt (im Gegensatz zuden weibl. → *Karyatiden), die an-stelle einer tekton. Stütze das Ge-bälk trägt, so benannt nach dem Ti-tanen Atlas der gr. Mythologie, derdas Himmelsgewölbe tragen mußte.A. kommen schon in der Antike alsBauplastik vor und sind bes. häufigam Außenbau und in Innenräumen(Treppenhäusern) des Barocks undan barockisierenden öffentl. undprivaten Bauten des 19. Jh. anzu-treffen. Engl. atlas, telamon; frz.; sp. atlante; it. atlan-te, telamone.
Atrium (lat.), 1. Hauptraum desröm. → *Wohnhauses, in dem inälterer Zeit wohl der Herd stand,weshalb er rauchgeschwärzt (lat.ater) war. Später wurde das Dachüber dem A. mit einer viereckigenÖffnung (Compluvium) versehen,gegen die sich das Dach an den vierSeiten neigte, so daß der Regen(lat. pluvia) in ein darunterliegen-des Bassin, das Impluvium, abfloß.In jüngerer Zeit wurde das Com-pluvium vergrößert und durchSäulen abgestützt. Das A. erhielt soden Charakter einer in der Mitteoffenen Halle und diente als Emp-fangsraum. Die ältere, stützenloseForm des A. wurde nach Vitruv»etrusk.« (A. tuscanicum) genannt,»viersäulig« (A. tetrastylicum),wenn das Compluvium von vierSäulen an den Ecken gestütztwurde, und »korinth.« (A. corinthi-cum), wenn es mehrere Säulenwaren. Im Gegensatz zu dem A.impluviatum mit nach innen ent-wässertem Dach, heißt das A. mit
Astylos 34
Atlant
nach außen entwässertem Dach A.displuviatum. 2. Vorhof der alt-christl. → *Basilika, meist von glei-cher Breite wie diese und ihr im W.vorgelagert, von einer Säulenhalle(Peristyl) umgeben und mit einemBrunnen (Kantharus) für die ri-tuellen Waschungen in der Mitte.Dieser in Rom entwickelte Typus,auch Paradies oder Galilaea ge-nannt, wurde auch im frühen MA.noch beibehalten, verkümmerteaber allmählich zu einer querrecht-eckigen Vorhalle, auf die vielfachder Name Paradies überging. Engl., frz. atrium; it., sp. atrio.
Atriumhaus, röm. Wohnhaus, des-sen Räume um ein → Atrium ange-ordnet sind, vom modernen Ein-familienhaus übernommen. Engl. atrium house; frz. maison à patio,maison à atrium; it. allg. casa a corte, röm.domus; sp. casa con atrio.
Attika (lat. att., athen.), niedrigerAufbau über dem Hauptgesimseines Bauwerks, meist mit einemnach oben abschließenden Gesims
versehen. Die A. kommt in derAntike bes. an röm. Stadttoren und→ *Triumphbogen vor, wo sie zurAnbringung von Inschriften undals Sockel für freiplast. Bildwerkediente. Seit der Renaissance verwen-dete man sie an Kirchen- und Pro-fanbauten vielfach zum Verdeckendes Dachansatzes, während dasBarock ein niedriges Obergeschoß,das A.geschoß (→ *Geschoß), ent-wickelte. Im Klassizismus fehlt ge-wöhnl. das Abschlußgesims der A. Engl. attic; frz. attique; it. attico; sp. ático.
Attikageschoß, an die Stelle einer→ Attika tretendes niedriges Ober-geschoß über dem Hauptgesimsvon Schloßbauten des Barocks,danach auch an mehrgeschossigenstädt. Häusern (→ *Geschoß).Engl. Attic storey, am. Attic story; frz. étageen attique; it. piano attico; sp. piso en ático.
Attische Basis, im 5. Jh. v. Chr. inAttika bzw. Athen entstandeneSonderform der ion. Basis, beste-hend aus einer Hohlkehle (Trochi-lus) zwischen zwei Wülsten (Tori),von denen der obere etwas niedri-ger und weniger ausladend ist alsder untere und manchmal miteinem Riemengeflecht verziert seinkann. Diese Form der Säulenbasiswurde später mit geringen Verän-derungen (→ *Eckzier) bes. von derroman. Baukunst häufig verwendetund auch noch vom Klassizismusbevorzugt. Differenziertere Son-derformen zeigt die → *Basis derkleinasiat. → *ion. Ordnung. Engl. Attic base; frz. base attique; it. baseattica; sp. base ática.
Attisch-ionische Ordnung, inAttika entwickelte Sonderform der→ *Ion. Ordnung, für die im
35 Attisch-ionische Ordnung
Atrium 1a A. tuscanicumb A. tetrastylicumc A. corinthicumd A. impluviatume A. displuviatum
Gegensatz zur kleinasiat.-ion. Ord-nung vor allem der Figurenfries(Zophoros) über dem Gebälk cha-rakteristisch ist. Engl. Attic Ionic order; frz. ordre ionien-attique; it. ordine ionico-attico; sp. órdenionico-ático.
Auditorium, Empfangsraum imKloster, auch Versammlungs- undUnterrichtsraum (→ Brüdersaal),später neben schola für universitä-re Schulen gebraucht, seit 14. Jh. fürzentrale Hörsäle der Universität. Engl. auditorium, lecture hall; frz. audito-rium, auditoire; it., sp. auditorio.
Aufgedoppelte Tür → *Tür.
Aufgehendes Mauerwerk, dasMauerwerk über dem Erdbodenbzw. über dem Fundament. Engl. rising masonry; it. muratura di eleva-zione; sp. muro de elevación.
Aufkammer, bes. im westfäl. Bau-ernhaus übliche, über dem halbeingetieften Keller gelegene Kam-mer mit geringerer lichter Höheals die sonstigen Räume.
Aufkröpfen, der Höhe nach ver-kröpfen, z. B. ein waagerecht lau-fendes Gesims, das durch eineMaueröffnung (Tür, Fenster) un-terbrochen wurde, wird senkrechtnach oben geführt, bis es in ent-sprechender Höhe wieder horizon-tal geführt werden kann (→ *Ver-kröpfung). Engl. lining, covering; frz. louver; it. sfalsa-mento della modanatura.
Auflager, Fläche, auf der ein tra-gendes Bauglied (z.B. Balken) auf-liegt. Bei einem → *Bogen oderGewölbe ist das A. die horizontale
obere Abschlußfläche des Wider-lagers → Anfangsstein. Engl. bearing, support, impost; frz. surfaced�appui, support; it. appoggio; sp. apoyo.
Auflanger (Zusparren), Sparrenfür pultdachartige Seitenschiff-dächer mehrschiffiger Hallenbau-ten; sie legen sich auf die Sparren-enden des Mittelschiffdaches undbesitzen in der Regel eine sichereFußpunktausbildung auf den Au-ßenwänden (im Hausbau auchKübbungssparren). Frz. tas de charge, lit d�attente; sp. hilada.
Aufriß, graph. Darstellung derAußenansicht eines Bauwerks oderder Wandansicht eines Raumes inNormalprojektion (→ Projektion)und meist verkleinertem Maßstab,deren mehrere zur → *Abwicklungvereinigt werden können. Engl. elevation; frz. élévation; it. prospetto;sp. elevación.
Aufsatteln, Aufeinanderfügen vonkonstruktiven Hölzern, Sattelbal-ken, → *Sattelholz.
Aufschiebling, Anschieber, An-schiebling, deckt bei Sparren-dächern das Vorholz, das bei derVersatzung zur Sicherung desSparrenfußes stehen bleibt undgleicht bei genügender Länge denVorsprung für eine einheitl. Dach-fläche aus, seitl. an die Sparren an-genagelt als Anschiebling, Anschie-ber. Engl. firring, sprocket; frz. coyau; sp. ristrel.
Aufsteigestein, Aufstiegstein,Anabathron, Stein, der dem Reiterzum bequemen Aufsteigen auf dasPferd dient, häufig in Tornähe. Frz. montoir; sp. mastador.
Auditorium 36
Auftritt, unterste Stufe einerTreppe, → Antritt.
Auge, 1. kreisrunde Lichtöffnungim Scheitel einer → *Kuppel,gleichbedeutend mit Opaeon. 2.Kleine runde Scheibe im Zentrumder Voluten des Kapitells der Ion.Ordnung. 3. Weniger gebräuchl.für die Öse am Ankerkopf (→ *An-ker 1). 4. Die Lichtspindel einer→ *Wendeltreppe (Treppena.). Engl. eye; frz. �il it. 1.�3. occhio, 4. pozzodi scala elicoidale; sp. ojo.
Aula, (lat. v. gr. aule: Hof), 1. In-nenhof des gr. → *Wohnhauses,dem röm. → *Atrium entspre-chend. 2. In der röm. KaiserzeitBezeichnung für Palast. 3. Daherim frühen MA. oft gleichbedeu-tend mit Pfalz (A. regia). 4. In deraltchristl. Basilika wurde der mitt-lere Teil der Vorhalle, auch der fürdie Laien bestimmte Platz imLanghaus A. genannt. 5. Seit dem16. Jh. ist A. die übliche Bezeich-nung für den Festsaal einer Schuleoder Universität. Engl. great hall; it. aula, sala; sp. aula.
Ausfachung, Verschluß der ein-zelnen Gefache der Fachwerkwanddurch Holzbohlen, Staken mitLehm und Lehmbewurf (→ Aus-stakung), Backsteine oder Bruch-steine. Engl. infill; frz. hourdage; it. tamponamen-to; sp. relleno.
Ausfalltor, Ausfallpforte, Ausgangbei Burgen und Festungen fürAusfälle und Aktionen gegen diegegner. Belagerungsabsichten oderum Hilfe zu holen, häufig vomHaupttor nicht einsehbar gelegen,
teilweise über einen unterird.Gang erreichbar (→ Poterne). Engl. sallyport, postern; frz. sortie de con-tre-attaque, poterne; it. posterla; sp. poter-na.
Ausgedinge → Altenteil.
Ausgeschiedene Vierung → *Vie-rung.
Ausgleichschicht, 1. die oberste,genau waagerechte Schicht desMauerwerks als Auflager für dasTragwerk (Balken u. dergl.). 2. Aus-gleichende waagerechte Zwischen-schicht im Bruchsteinmauerwerk,das bei größerer Höhe mehrere A.haben kann (→ *Mauerwerk 6),um waagerechte Flächen für dasWeitermauern zu gewinnen. Engl. leveling course; frz. assise d�arase; it. 1.corso di livellamento, 2. ricorso; sp. capaniveladora.
Auskehlen, abkehlen → *Kehle.
Auskragung, das Vorspringen ei-nes Bauteils, z.B. eines Erkers, Bal-kons oder ganzen Stockwerks. DieA. kann mittels aus der Wand vor-stehender Balkenköpfe (→ *Fach-
37 Auskragung
Auskragung
werkbau), Kragsteine, Konsolenoder abgetreppter Mauerschichtenbewirkt werden. Engl. jetty, cantilever; frz. encorbellement;it. sporto; sp. saliente.
Auslauf, Überleiten eines Längs-profils in die den vollen Quer-schnitt zeigende Grundform alsSpitze, Rundung usw.
Ausleger → Gerüst.
Auslucht, 1. auch Utlucht, an Re-naissancebauten Niedersachsensein vom Erdboden aufsteigender,meist mehrgeschossiger erkerarti-ger Vorbau an einer oder zu beidenSeiten der Haustüre. 2. Über einemSeitenschiffjoch errichteter Quer-dachgiebel, bes. an got. KirchenOstdeutschlands (Lucht). Engl. bay window; frz. avant-corps à côté del�entrée; it. avancorpo a lato dell�ingresso;sp. volumen sobresaliente del ingresso.
Auslugerker, Eckerker, heißen die→ *Erker an Gebäudeecken (zumUnterschied von den Erkern ander Gebäudewand). Frz. guérite; it. bay window d�angolo; sp.garita.
Ausschrägung, bei Steinbauten desMA. haben die Fensterleibungenhäufig eine A. nach innen, so daßbei dicken Mauern die innere
Fensteröffnung größer ist als dieäußere, wodurch der Lichteinfallvergrößert wird und das Fensteropt. größer erscheint, bes. wenndie A. weiß verputzt ist. Bei sehrdicken Mauern und kleinen Fen-steröffnungen können die Leibun-gen auch nach innen und nachaußen ausgeschrägt sein (→ *Fen-sterschräge). Engl. splay; frz. ébrasement; it. strombatura;sp. alfeizamiento.
Ausschuß, Schießerker, Wehr-erker, hölzerne, erkerartig überkra-gende Maueraufbauten mit Schieß-scharten. Engl. barizan; frz. échauguette; sp. garita.
Außenkanzel, Kanzel an der Au-ßenwand einer Kirche, meist durcheine Tür vom Kircheninneren her,seltener über eine Treppe vonaußen zugängl., zur Predigt undReliquienvorweisung, daher meistan Wallfahrtskirchen. Auch eindem gleichen Zweck dienender
Auslauf 38
Auslucht12
Außenkanzel
offener Altan oder Balkon über ei-nem Kirchenportal wird A. genannt.Engl. exterior pulpit; frz. chaire de prédica-teur en saillie (en encorbellement); it. pul-pito esterno; sp. púlpito externo.
Außenkrypta, eine nicht unter,sondern östl. hinter dem Chor lie-gende halb eingetiefte und nichtüberbaute → Krypta, auch zweige-schossig, zumeist von der Kryptaunter dem Chor aus zugängl. Engl. outer crypt; it. cripta esterna; sp. crip-ta externa.
Außenkuppel, Schutzkuppel,Mantelkuppel, äußere Kuppelscha-le einer mehrschaligen Kuppel. Engl. exterior dome; frz. dôme; it. cupolaesterna; sp. cúpula externa.
Außenmauern (auch Umfas-sungsmauern bzw. -wände), die einBauwerk umschließenden Mauernim Gegensatz zu den Innenwän-den (Trennwänden). Engl. exterior walls; frz. murs extérieurs,remparts e.; it. murature perimetrali; sp. mu-ros exteriores.
Außenputz, Putz an der Außen-seite eines Bauwerks zum Schutzdes Mauerwerks gegen Witterungs-einflüsse. Engl. exterior plaster; frz. enduit externe;it. intonaco esterno; sp. revoque exterior.
Außenrampe, am Äußeren einesBauwerks entlang führende Rampe.Engl. exterior ramp; frz. rampe extérieure;it. rampa esterna; sp. rampa exterior.
Außentreppe, an der Außenfronteines Gebäudes zu den oberenStockwerken emporführende Trep-pe, manchmal auch überdacht. DieGehlinie verläuft parallel zur Haus-
wand im Gegensatz zur Vortreppeoder → Freitreppe. Engl. exterior stairs; frz. escaliers extérieurs;it. scale esterne; sp. escalera exterior.
Außenwerk, zur Sicherung desGlacis von Festungen (→ Ravelin,Redan, Hornwerk), der Kurtinevorgelagert, Teil der Hauptfestung,aber auch jede Verteidigungsanlagevor dem Hauptwall einer → *Fe-stung. Frz. ouvrage extérieur, dehors d�une place;it. opere di fortificazione esterne.
Aussichtstempel, dekoratives Bau-werk auf Anhöhen in größerenParkanlagen. Engl. belvedere; it. gazebo; sp. mirador.
Aussichtsturm, Aussichtswarte,Warte, ein Turm, der eine Fern-sicht, bes. in Stadt- und Waldgebie-ten, ermöglicht. Frz. belvédère; it. torre panoramica; sp. tor-re panorámica.
Ausstakung, Verschluß der Ge-fache im Fachwerkbau, in demzwischen die Horizontalhölzer des
39 Ausstakung
Außentreppe
Gerüsts Stöcke (Staken) in Nuteneingesetzt werden, um die Wei-denruten (Fachgerten) oder Stroh-seile gewunden und mit strohver-mengtem Lehm verkleidet werden. Frz. hourdage de torchis; sp. relleno deadobe.
Austritt, 1. ein kleiner vor einemFenster oder einer Tür angebrach-ter balkonartiger Vorbau. 2. Dasobere Ende eines Treppenlaufs,auch Austritts- oder Podeststufegenannt; sie liegt in der gleichenHöhe mit dem Austrittspodestbzw. dem Geschoßfußboden. Engl. 2. stairhead, top step; frz. 2. palier;it. 1. poggiolo, 2. pedata del pianerottolo;sp. peldaño.
Austrittstufe → Austritt.
Auszug → Altenteil.
Auvergnatischer Querriegel,Bezeichnung für die an roman.
Kirchen der Auvergne (Südfrank-reich) vorkommende starke Her-vorhebung des Querschiffes. Indiesen Fällen besteht das Querhausaus fünf verschieden hohen Teilen:als höchster in der Mitte die kup-pelüberwölbte Vierung, beiderseitsder Vierung und der Breite derSeitenschiffe entsprechend einkurzer, halbtonnengewölbter Armvon der Höhe des Mittelschiffs undje ein niedrigerer äußerer Flügel. Engl. Auvergne-type transept; it. transettotipico dell�Alvernia; sp. traversa tipo Au-vergne.
Avantgarde, im Festungsbau eineArt → Flesche, ein pfeilförmigesAußenwerk auf dem Glacis. It. avanguardia; sp. vanguardia.
Axialität → *Achse.
Axonometrie, Parallelprojektion,Parallelriß, zur Unterscheidung vonder Zentralperspektive auch Paral-lelperspektive genannt (→ *Projek-tion). Engl. axonometric projection; frz. projec-tion axonométrique; it. assonometria;sp. axonometría.
Azulejos, (span. v. arab. azul: blau),vielfarbig gemusterte Fayence-platten, deren Herstellung undVerwendung als Wandfliesen im14. Jh. von den Mauren in Spanieneingeführt wurde (→ Baukeramik). Engl. tile decoration, azulejo; frz. azulejo;it. azulejo, Kachel: piastrella; sp. azulejos.
Austritt 40
Auvergnatischer Querriegel
B
Bâb (arab. Tor), häufige Bezeich-nung für das ma. → Stadttor in denvon den Arabern gegründeten bzw.befestigten Städten Nordafrikas. Esbesteht meist aus einem oder selte-ner zwei, von zwei Türmen mitquadrat. Grundriß flankierten Bo-genportalen, oder aus einem gro-
ßen Haupttor zwischen kleinerenSeitenpforten. Engl. bab; frz. bâb; sp. puerta árabe.
Backenschmiege, Klebeschmie-ge, ein schräger Verschnitt.
Backstein, (lat. later), aus Ton oderLehm geformter Baustein, der zumUnterschied vom luftgetrocknetenB. durch Brennen gehärtet und
41 Backstein
Backsteinbau (Beispiel: Königsberg/Neumark, Rathaus)
wetterfest gemacht ist, meist längs-rechteckiges Format, dessen Größesich aus den jeweiligen techni-schen Gegebenheiten und aus tra-ditionellen Verfahren in den Ver-breitungsgebieten ergibt. Die Farbehängt von der chem. Zusammen-setzung des Rohmaterials und vonder Brenntemperatur ab, auch far-bige Glasuren sind möglich. ZurVerbindung von Backsteinen zuMauern siehe → *Mauerwerk, zurVerwendung als Dachdeckungsiehe → Ziegel. Engl. brick; frz. brique; it. mattone; sp. la-drillo cocido.
Backsteinbau, die Bauweise ausgeschichteten Backsteinen. (Abb.S.41)Engl. brick construction; frz. constructionen briques; it. costruzione in mattoni;sp. construcción de ladrillos.
Badia, 1. (it. v. lat. ecclesia abbatia-lis), Abtei, Abteikirche. 2. AuchBadija, Badiya, Wüstenschloß arab.Kalifen, mit großem Luxus ausge-stattet und hauptsächl. im Frühlingbewohnt. Engl. 1. abbey church, 2. desert palace;frz. badia; it. 1. badia; sp. 1. abadía, 2. palacioárabe en el desierto.
Baldachin, urspr. die Bezeich-nung für kostbaren Seidenstoff ausBaldac = Baghdad. Diese wurdeauf den aus diesem Stoff herge-stellten Prunkhimmel übertragen,wie man ihn über einem Thron,Bett, Bischofsstuhl, Altar, Katafalk,Grabmal (Baldachingrabmal), frei-stehend oder an die Wand gelehnt,anbrachte; auch aus Holz mit
Metallbeschlägen und schließl. seitdem frühen MA. auch aus Stein.Den B. über einem Altar nenntman von vorroman. Zeit bis zurGotik → *Ziborium, in der Renais-sance und im Barock → Taber-nakel. Auch der von vier oder sechsStangen gestützte Traghimmel fürProzessionen mit dem Sanktissi-mum oder Reliquienschrein nennt
Backsteinbau 42
Badia (Beispiel: Mschatta)
Baldachin
man B. In der spätroman. und got.Baukunst werden steinerne, aus-kragende, auch von Konsolen ge-tragene, meist polygonale, kunst-reiche Überdachungen von Figu-ren an Portalen, Pfeilern, Strebe-pfeilern zu deren Schutz und Zierangebracht, die häufig Architektur-formen nachahmen. Engl. baldachin; frz. baldaquin; it. baldac-chino; sp. baldaquín.
Baldachingrabmal → Baldachin. Engl. baldachin-like tomb; it. tomba a bal-dacchino; sp. tumba en baldaquín.
Bälkchendecke → Riemchen-decke.
Balken, in der Baustatik ein hori-zontaler Träger auf zwei oder meh-reren Stützen oder freitragend ein-seitig eingespannt, der bei senk-rechter Belastung ausschließl. senk-rechte Auflagerdrücke erzeugt, imGegensatz zum Bogen und zumGewölbe, bei denen schräge, d.h.zugleich senkrechte und waage-rechte Druckkräfte entstehen. Im
engeren Sinn ist der B. ein Holzvon hochrechteckigem Querschnitt,das vorwiegend zur Überdeckungeines Raums dient. Mehrere zudiesem Zweck in Abständen ne-beneinander verlegte B. bilden dieBalkenlage, die bei großer Längedurch quer zu ihr verlaufende B.(Unterzüge) auf Ständern oderSäulen oder durch Querwändegestützt sein kann. Nach Lage undZweck innerhalb der Balkenlagesind zu unterscheiden: 1. Durch-gehende oder Voll-B., die mit bei-den Enden auf einer Mauer auflie-gen; 2. Grat- und Kehlgrat-B. sinddiagonal angeordnet; 3. Streich-oder Streif-B. liegen neben einerMauer; 4. Giebel- oder Ort-B. lie-gen unmittelbar an oder auf einemAbsatz der Giebelmauer; 5. Stich-B. liegen mit einem Ende aufeinem Deckenb. oder Wechsel mitdem anderen auf der Außenmauer;6. Krag-B. ragen einseitig über eineMauer hinaus; 7. Bund-B. sind dieAbschluß-B. über den Ständern des→ *Fachwerkbaus; 8. Wechsel-B.,auch nur Wechsel genannt, sind anbeiden Enden mit anderen B. ver-zapft, sie werden notwendig, wennkeine Mauerunterstützung mög-lich ist oder eine Befestigungs-
43 Balken
Baldachingrabmal
Balken
möglichkeit an der Decke geschaf-fen werden soll (z.B. Kronleuchter-Wechsel, Treppen-Wechsel). Von ge-ringerer konstruktiver Bedeutungsind die Leer- oder Zwischen-B.,die nur den Fußboden des oberenStockwerks aufzunehmen haben. Engl. beam, baulk, balk; frz. poutre, solive,bau; it. trave; sp. viga.
Balkenanker, → *Anker zur Ver-bindung von Holzbalken und Mau-erwerk. Engl. building clamp, brace; frz. ancred�about, ancre de poutre; it. chiave di testa,dispositivo d�ancoraggio; sp. ancla de viga.
Balkengesims, im Holz- undFachwerkbau ein Gesims, dasdurch Verschalung der vorstehen-den → Balkenköpfe gebildet wird. Engl. stringcourse; frz. cordon d�étage;sp. muldura de viga.
Balkenkopf, das in oder auf einerWand liegende oder über diesehinausragende Ende eines Balkens.Beim → *Fachwerkbau ist dersichtbare B. meist durch Profi-lierung, Schnitzerei und Bemalungverziert, vielfach auch konsolen-artig ausgebildet. Eine Erinnerungan den B. des Holzbaus sind die
→ Triglyphe und der → Zahn-schnitt an gr.Tempeln der → *Dor.und der kleinasiat. → *Ion. Ord-nung. Sind B. verschalt, so entstehtein → *Balkengesims. Engl. head of a beam, beam head, beamend; frz. about de poutre, tablette de pou-tre; it. testa della trave, estremità della trave,geisipodes; sp. cabeza de viga, extremo d. v.
Balkenlage, Gesamtheit aller→ *Balken in einer waagrechtenEbene. Engl. frame of joists, framing, flooring;frz. solivure, empoutrerie, poutrage, pou-traison; it. impalcato delle travi, architrava-tura; sp. envigado.
Balkenriegel, Riegelbalken, Sperr-balken, Klemmbalken, Verschluß-balken, zum Verschließen einesTors dienender Balken; er läuft inseitl. Mauerschlitzen, wird in Mau-erlöcher zurückgeschoben oder istin Klauen eingehängt. It. catenaccio, spranga di legno, chiavaccio;sp. cierre de viga.
Balkenrost, sich überkreuzendeBalken als Unterlage für Funda-mentmauern in sumpfigem odernicht ausreichend tragfähigemBoden; unter Luftabschluß haltbar.
Balkenstein, Kraft- oder Not-stein, als Auflager für Balken undMauerlatten dienender Kragstein(→ *Konsole). Engl. corbel; frz. corbeau; it. mensola di pie-tra; sp. ménsula, modillón.
Balkon (althochdt. balcho: Balken),ein Deckenvorsprung, der einenmeist ungedeckten Austritt trägtund durch eine Brüstung, eineBalustrade oder ein Geländer be-grenzt wird. Der B. war im MA.aus Holz oder Stein und meist
Balkenanker 44
Balkengesims1 Rähm 2 Balkenlage 3 Schwelle
klein und erhielt in der Renais-sance durchwegs größere Abmes-sungen. Er erstreckt sich oft längsder ganzen Hausfront und kannauch als Laufgang um den Bau-körper herumgeführt sein. Noch öf-ter wird der B. im Barock dekorativan Fassaden (Portal-B.), aber auchan Treppenhäusern verwendet. Engl. balcony; frz. balcon; it. balcone; sp. bal-cón.
Ballei, 1. Amtsbezirk des Burgvogts,daher im SpätMA. Bezeichnungfür Burghof. 2. Im Festungsbauein meist halbrundes Außenwerk(→ Bollwerk). Engl. bailiwick; frz. baillie; sp. bailío, bastión.
Ballenblume, oft plast., knospen-ähnl. Ornament in Hohlkehlenvon ma. Portalgewänden und Ge-simsen. Engl. ballflower; sp. ornamento abotonado.
Ballhaus, 1. in der Antike, im MA.und bes. im 17. /18. Jh. in Frank-reich ein zum Ballspiel errichtetesGebäude. 2. Seit dem 19. Jh.gleichbedeutend mit → Tanzhaus,Gesellschaftshaus. Engl. ballroom, dance hall; frz. salle de bal;sp. salón de baile.
Ballistrarium, Balistrarium, kreuz-förmige Schießscharte für Arm-brustschützen. Engl. catapult; it. balestriera cruciforme;sp. ballestera cruciforme.
Ballon-Bauten, für zeitl. begrenz-te Ausstellungen und Sportstättenaus leichter Kunstfaserhülle, diedurch den künstl. hervorgerufenenleichten Überdruck im Innenraumbzw. in der doppelschaligen Hüllegetragen wird und am Boden luft-dicht verankert ist; Zugänge durchLuftschleusen. Kuppelige Formendurch die Hülle bedingt. Engl. balloon-frame buildings, b.-f. con-struction; it. costruzioni pneumatiche;sp. construcciones neumáticas.
Baluarde, mit ausspringendemWinkel versehene, volle oder hohle→ *Bastion mit zwei Facen undzwei Flanken sowie mit offeneroder geschlossener Kehle. Engl. baluard; it. baluardo; sp. baluarte.
Baluster (gr. balaustion: Granat-apfel), ein untersetztes Stützgliedaus Stein oder Holz mit stark pro-filiertem und geschwelltem Schaftvon rechteckigem oder polygona-lem Querschnitt an einer Brüstungoder einem Geländer (→ *Balu-strade). Bei rundem Querschnitt→ Docke. Der B. ist zusammenge-setzt aus Sockel, Schaft, Kragen,Hals und Kapitell. Der Schaft kann
45 Baluster
Balkon
Ballenblume
als Herme, Vase o. ä. ausgebildetsein. Engl. baluster; frz. balustre; it. balaustro;sp. balaústre.
Balustrade (frz. v. it. balaustrata),ein aus → Balustern gebildetesdurchbrochenes Geländer an Trep-pen, Brücken, Balkonen usw. oderals Dachabschluß. Die B., auchDockengeländer genannt, ist dietyp. Form von Geländern undBrüstungen der Renaissance unddes Barocks, oft auch durch Pfeiler(Hauptpfosten) in einzelne Ab-schnitte unterteilt. Engl. balustrade; frz. balustrade, gardefou(balustré); it. balaustrata; sp. balaustrada.
Band, 1. ein waagerechtes, mehroder weniger ausladendes Baugliedvon rechteckigem Querschnitt zurhorizontalen Gliederung, meist inVerbindung mit Hohlkehle, Rund-stab und dergleichen ein Gesims(→ Gesimsformen) bildend. 2. Zim-mermannsmäßige Holzverbindungdurch ein schräg angeordnetesHolz, das als Bohle zur Aufnahmevon Zugkräften angeblattet ist,seltener als Vollholz, das dannzusätzl. Strebefunktion hat (Voll-holz-Band); zumeist als Kopf- oderFußband (→ Schwäbisches Weible).3. Als Beschlagteil bildet das B. denBewegungsbeschlag (Scharnier-band) bei Türen und Fenstern, mit
dessen Hilfe die Flügel bewegt undeingehängt werden,→ *Beschlag. Engl. 1. band, 2. fillet; frz. 1. bande, 2. guet-te, lien; it. 1. fascia, 2. contrattisso, 3. ban-della; sp. 1. listón, 2. cuadral, 3. charnela.
Bandeisen, kaltgewalzter Eisen-stab von geringer Dicke. Der Be-griff wird häufig für das Band anTüren oder Fenstern verwendet(→ Band 3, → *Beschlag). Engl. strip iron; frz. fer spaté, fer en rubans,fer feuillard, in der Schlosserei: méplat, demi-laine; it. bandella; sp. fleje, bisagra.
Bandelwerk, Bandverschlingung,aus lebhaft geschwungenen Band-formen gebildete Dekoration desfrühen 18. Jhs., mitunter von ran-kenähnl. und figürl. Motivendurchsetzt, bes. häufig als Wand-und Deckenstuckaturen. Engl. interlacing; frz. garniture de volutes,entrelacs; it. guarnizione; sp. decoración devolutas.
Bandgeflecht, eine Flechtdekora-tion als Flächenfüllung oder Um-hüllung eines Bauglieds. Engl. interlace; it. intreccio; sp. trenzado deenlaces.
Balustrade 46
Balustrade
Bandelwerk
Bandrippe, Gewölberippe inForm, eines Steinbands mit meistrechteckigem Profil (→ *Rippe). Engl. band moulding, vault rib; frz. nervureà profil rectangulaire; it. costolone a sezio-ne rettangolare; sp. cuaderna de bóveda conperfil rectangular.
Bandverschlingung, wenig ge-bräuchl. Bezeichnung für → Flecht-band, → Flechtwerk oder → *Ban-delwerk (→ *Fries 7). Engl. interlacing; sp. entrelazado.
Bankett, 1. untere Verbreiterungder Fundamentmauer. 2. Absatz ander hinteren Böschung einerBrustwehr zur Aufstellung derSchützen im Festungsbau. Engl. 1. continuous foundation, berm;frz. 1. banquette, embasement; it. 1. risegadi fondazione; sp. 1. embasamiento, 2. ban-queta.
Bankgesims, Fensterbankgesims,→ *Gesims.
Bankgrab, ägypt. → *Grabbau(→ Mastaba).
Banksockel, für die it. Früh-renaissance typ. Ausbildung desGebäudesockels als umlaufendeSteinbank, manchmal auch mitausgebildeter Rückenlehne. It. zoccolo a panchina; sp. zócalo de edificiocon bancos.
Banse, Bansenraum, Tasse, Fach;im süddt. Bare, Barn, Einlage, Öse,Esse, Viertel, in der Schweiz Barge,in Hofscheunen der Lagerraum fürGetreide und Stroh neben derTenne. Engl. barn; frz. las, lassière; sp. granero.
Baptisterium (lat. v. gr. baptiste-rion: Badebassin), Taufkirche, derfrühchristl. Brauch, die Taufe(meist nur Erwachsener) durchvölliges Untertauchen (submersio)oder durch Eintauchen (immersio)
47 Baptisterium
Banksockel
Baptisterium(Beispiel: Ravenna,
B. S. Giovanni in fonte)1 Piscina
des Körpers zu vollziehen, führteschon im 4. Jh. dazu, daß in un-mittelbarer Nähe der bischöfl. Ba-silika eine kleinere Taufkirche er-richtet wurde mit einem meist inden Boden versenkten achteckigenoder kreuzförmigen Wasserbassin(Piscina) in der Mitte, zu dem dreioder sieben Stufen hinabführten.Diese Baptisterien genannten Ka-pellen sind in der Regel Zentral-bauten mit quadrat., häufiger poly-gonalem oder rundem Grundriß,der durch halbrunde oder recht-eckige Anbauten sowie Nischenauch kreuz- oder kleeblattförmigausgebildet sein kann. Bei größe-ren Anlagen ist das Taufbassin oftvon einem inneren Säulenkranzumgeben, auf dem eine Obermau-er mit Kuppel- oder Zeltdachab-schluß und Lichtöffnungen ruht,während der Umgang mit Ton-nen- oder Gratgewölben überdecktist. Seit im hohen MA. die Taufedurch Untertauchen aufgegebenwurde, dient das B. meist allge-meinkirchl. Zwecken. Engl. baptistery; frz. baptistère; it. battistero;sp. baptisterio.
Bär, Querdamm im Graben einerFestung. Engl. ram, rammer, monkey; frz. mouton,bélier, billot de batte; sp. dique transversal.
Baracke, zunächst jede Hütte ausZweigen oder Brettern, provisor.hergerichtete Bretterbude zumWohnen, Lagerhütte, offene Ar-beitsbude bei Steinmetzen undZimmereiplätzen, heute vorgefer-tigte schnell montierte Holzbautenfür Soldaten, Flüchtlinge oder alsLazarett. Engl. hut; frz. baraque; it. baracca; sp. barra-ca.
Barbakane (frz. v. arab. barbacane),1. bei ma. Burgen, Stadtbefesti-gungen und Festungen eine meisthalbkreisförmige, mit Schießschar-ten versehene Vormauer zur Ver-teidigung des Tors oder als Brük-kenkopf (→ *Bastille). 2. Schmale,nach hinten erweiterte Schieß-scharte für Bogenschützen. Engl. barbacan; frz., it. barbacane; sp. barba-cana.
Barbe → Berme.
Barghus, Barghaus, Haubarg,Stelphaus, in den Küstengebietender Nordsee vorkommende Formdes Bauernhauses als große Stall-scheunen mit angehängtem Wohn-teil, niedrigen Außenmauern, ho-hem strohgedecktem Walmdachund relativ kurzem First. KleinereGiebelaufbauten kommen erst beispäteren Beispielen vor.
Barkenkammer, Sekos, das Aller-heiligste im ägypt. → *Tempelbau,ein eigenes Gehäuse, in dem hinter
Bär 48
Barbakane
Barghus
Vorhängen das Götterbild in einermeist goldenen Barke stand. Engl. sanctuary (with sacred bark); sp. san-tuario del templo egipcio.
Barrikade, Hindernis aus ver-schiedenartigem, rasch zusam-mengeworfenem Material oder imFestungsbau eine Sperre, beste-hend aus einem mit spitzenPfählen gespicktem Baum. Engl., frz. barricade; it. barricata; sp. barrica-da.
Basement, Basament, Unterbau,Außenseite des Souterraingeschos-ses oder der Fundamentmauer,heute für das ganze halbeingetiefteUntergeschoß benutzt. Engl. basement; frz. soubassement, em-bassement, embase; it. seminterrato, basa-mento; sp. basamento, sótano.
Basilika (lat. basilica v. gr. basilikestoa: Königshalle), 1. urspr. dasAmtsgebäude des Archon Basileusauf der Agora, dem Markt vonAthen, der die Opfer und religiö-sen Feste zu leiten hatte. Im röm.Reich eine langgestreckte Halle fürMärkte und Gerichtsverhandlun-gen. Im Innern meist durch Säulen-oder Pfeilerstellungen in drei bisfünf Schiffe unterteilt, manchmalauch zweistöckig und mit Empo-ren versehen, an einer Schmalseiteder erhöhte Platz für den Tri-bunen, häufig in einem halbrun-den Ausbau (Tribuna), ihm gegen-über der Haupteingang mit einerniedrigen Vorhalle (Chalcidicum).Das Mittelschiff ist in der Regelbreiter und höher als die Seiten-schiffe und hat in den HochwändenFenster, die über dem Dachansatzder Seitenschiffe liegen (Gaden,Lichtgaden, Obergaden), so daß
auch bei geschlossenen Anlagengenügend Licht in den Raum fällt(→ Ägypt. Saal). 2. Das Christen-tum übernahm mit dem Namenauch die Grundform der B. für dieersten, noch im 4. Jh. errichtetenKirchen, wobei die Herleitung desBautyps verschieden erklärt wird.Das »basilikale Schema« blieb fürdie kirchl. Baukunst des Abend-lands bis zum Ausgang des MA.bestimmend, in der Spätgotik durchdie → *Hallenkirche zeitweise zu-rückgedrängt; sie findet sich auchin Ägypten, Byzanz und Armenien,wurde seit dem 6. Jh. von der→ *Kuppelbasilika verdrängt. � Diefrühchristl. B., meist nach O.gerichtet, ist drei- bis fünfschiffig
49 Basilika
Römische Basilika
und nicht gewölbt. Die Seitenmau-ern des überhöhten Mittelschiffsruhen auf Pfeilern oder Säulen(Pfeiler-B., Säulen-B.), die eingerades Gebälk (Architrav) tragen,meistens aber durch Bogen mitein-ander verbunden sind (→ Arkade),und haben in ihrer obersten Zoneeine Fensterreihe (→ Obergaden).Das Mittelschiff (Navis), urspr.mit Holz flach gedeckt oder mitnach unten offenem Dachstuhl,mündet im O. in die halbrundeApsis (Exedra, Konche) mit demBischofsstuhl (Kathedra) und denSitzen für den Klerus (Presbyteri-um, Bema). Zu beiden Seiten derApsis, unter der sich eine → *Kryp-ta erstrecken kann, befinden sichbei den Basiliken des O. zwei Ne-benräume (→ Pastophorien), die alsAufenthaltsraum für die Kleriker(Diakonikon) und zur Aufbewah-rung der Opfergaben (Prothesis)
dienten. In der Apsis steht, in derFrühzeit meist über einem Mär-tyrergrab, der → Altar. Der Altar-raum (Sanctuarium) ist gegen dasMittelschiff oben meist durcheinen mit dem Bild des Aufer-standenen geschmückten Bogen(Triumphbogen), unten durch die→ *Chorschranken (Cancelli) ab-gegrenzt, die den weit in den vor-deren Teil des Mittelschiffs hinein-ragenden rechteckigen Raum fürden Sängerchor umschließen unddie beiden Ambonen (→ *Ambo)tragen. Der Kirche im W. vorgela-gert war ein viereckiger Hof (Atri-um, Paradies) mit Säulenumgang(Peristyl) und einem Reinigungs-brunnen (→ *Kantharus) in derMitte. Der Hof war von der Straßeaus durch eine kleine Vorhalle(Anteportikus, Propylon) zugäng-lich, der gegenüber man die Kirchemeist durch eine schmale äußere
Basilika 50
a Mittelschiff b Seitenschiffc Obergadend Sanctuarium
(Querschiff)
e Apsis f Kathedrag Presbyteriumh Kryptai Pastophorien
k Altar l Triumphbogenm Cancellin Amboo Atrium
p Peristylr Kantharuss Anteportikust Pronaosu Narthex
Frühchristliche Basilika
51 Basis
Vorhalle, deren Mittelteil auch Au-la genannt wird, und eine innere(Narthex, Galilaea) betrat. � Nochim 4. Jh. wurde in Rom zwischenApsis und Langhaus ein Querschiffeingeschoben, womit die Entwick-lung zur kreuzförmigen B. ange-bahnt war, deren Typus den Kir-chenbau weithin beherrschen sollte.Eine fünfschiffige Basilika, dereninnere Seitenschiffe höher sind alsdie äußeren, wird als Staffelb. be-zeichnet. Sind über den Seiten-schiffen Emporen, so spricht manvon → *Emporenb. In frühchristl.und ma. Zeit wurden auch Kirchenanderer Baugestalt B. genannt. Imspäteren Kirchenrecht ist B. einemit bestimmten Privilegien ausge-stattete Kirche. Engl., it. basilica; frz. basilique; sp. basílica.
Basilikaler Querschnitt, drei-schiffige Kirche mit überhöh-tem, durchfenstertem Obergaden(→ *Basilika). Frz. coupe basilicale; it. impianto basilicale;sp. perfil transversal de una basílica.
Basis (gr. Schritt, Fuß; Mz.: Ba-sen), der ausladende Fuß einerSäule oder eines Pfeilers. Die B.verteilt den Druck der Stütze aufeine größere Fläche und leitet zurFußplatte (Plinthe) über. Der Über-gang von der Senkrechten zurWaagerechten wird durch Profi-lierung der B. mit den einfachenElementen Wulst (Torus) undKehle (Trochilus) ästhet. gemil-dert, wie sie die → att. B. in weithinvorbildl. gewordener Form auf-weist. Während schon die ägypt.Säulen des Alten Reiches ebensowie die kret. teilweise eine B. besit-zen, fehlt sie bei der dor. Säulegrundsätzl. Eine Sonderform in-
nerhalb des gr. Kulturbereichs ent-wickelte die kleinasiat. → *ion.Ordnung. In der Antike und inroman. Zeit wurde vornehml. die→ att. B. verwendet, seit 1100 mitEckzier als kleine Nasen, Sporne,Knollen, Blätter, Köpfchen, Klauen
Figurierte Säulenbasis
attisch ion. kleinasiat. ion.
Frühformen
Basis
oder geometr. Formen. Mit Auf-kommen der Gotik wird die Basisniedriger und steht über die Plin-the vor (Tellerb.). Seit dem 16. Jh.werden die antiken B.formen wie-deraufgenommen. Engl., frz., it., sp. base.
Basrelief (frz. bas-relief ), Flach-relief, → *Relief mit nur geringerräuml. Tiefe.Engl. bas-relief; frz. bas-relief, bassetaille;it. bassorilievo.
Bastei, im Festungsbau ein häufighalbrundes → Bollwerk, ähnl. der→ *Bastion. Engl., frz. bastion; it. bastione; sp. bastión.
Bastide (frz. v. provençal. bastido:ländl. Haus), regelmäßig angelegtekleine befestigte Ansiedlung aufdem Lande, die in Kriegen alsStützpunkt dienen sollte. Engl., frz., it. bastide; sp. bastida.
Bastille (frz.), einem Burg- oderStadttor vorgelagerte, ringförmigeBefestigung mit Türmen, größerals die → *Barbakane und ständigmit einer Truppe besetzt. Engl. bastile, bastille; frz. bastille; it. basti-glia; sp. fortaleza, prisión.
Bastion (frz.), auch Baluarde, seit16. Jh. auch Bastei, urspr. ein ausder Stadtmauer bzw. → Kurtine von
Festungen rund vorspringendesVerteidigungswerk zur Aufstellungvon Geschützen, mit denen einvon mehreren Seiten andringenderFeind beschossen werden konnte.Später wurden die B. an Festungenwinkelförmig (Sternschanzen) soangelegt, daß sie mit zwei Front-linien (Facen) in das Angriffsfeldvorsprangen und mit zwei zurück-gebogenen Linien (Flanken) dasVorfeld, die Gräben und die be-nachbarten B. beherrschten. DerBau von B. wurde in Italien schon
von Francesco di Giorgio Martini,in Deutschland u. a. von AlbrechtDürer (1527) empfohlen und im17. Jh. bes. von dem frz. Festungs-baumeister Vauban vervollkomm-net. B.coupé oder B. en tenaille,eine B. mit einwärts gebrochenerFace. B. détaché, eine vom Haupt-wall durch Graben getrennte B., B.plat, eine B. vor einer geraden Kur-tine. B. plein, eine massive, erdge-füllte B., B. vide, eine B. ohneFüllung. Engl. bastion; frz. bastion; it. bastione;sp. bastión.
Batarden → Bär, ein Querdammim Festungsgraben.
Basrelief 52
Bastille (Beispiel: Paris)
Bastion
Batterie, im Festungsbau eineausgebaute Geschützstellung. Engl. battery; frz. batterie; it. batteria; sp. ba-tería.
Batterieturm, Geschützturm, Ar-tillerieturm, über halbkreis- oderkreisförmigem Grundriß mit Ge-schützen bestückter Wehrbau mitschußfesten Umfassungsmauernund teilweise schußfester Bedek-kung. In der Frühzeit der Feuerwaf-fen (1420�1550) ein hoher Turm,dann eine breit gelagerte, rundeoder hufeisenförmige Bastion; inspäterer Zeit (bis ca. 1860) dient erder Grabenbestreichung, ist Zen-trum eines Umwallungskernwerksoder eines Forts.
Bauabschnitt, der innerhalb zeitl.(Bauperiode) oder räuml. Grenzenfertiggestellte Teil eines Baus. Beigroßen Bauvorhaben, die eine lan-ge Bauzeit erfordern, können vonvornherein bestimmte B. eingeplantsein (Baulos), um das fristgerechteFortschreiten der Bauarbeiten kon-trollieren zu können oder aus wirt-schaftl. und anderen Gründen. Diean ma. Kathedralen erkennbaren B.(→ *Baunaht) sind jedoch häufigdurch unfreiwillige Unterbrechun-gen der Bauarbeiten, wie wirt-schaftlich Schwierigkeiten, Ein-sturzkatastrophen, Krieg, Brändeu.a., entstanden. Engl. zeitl.: building phase, räuml.: b. section;frz. tranche de travaux, étape de construction;it. lotto; sp. etapa, fase de construcción.
Bauachse → *Achse.
Baublock, ein von mehreren Stra-ßen umschlossener, aus zusam-menhängenden Baukörpern beste-hender Komplex. Engl. block (of houses); it. isolato, blocco;sp. manzana, cuadra.
Bauden, einzeln liegende Häuserder Viehbauern in höherer Ge-birgslage. Sie sind entweder stän-dig bewohnt (Winterbauden) odernur im Sommer nach Art derSennhütten (Sommerbauden). Oftin Blockbauweise mit Schindel-dächern errichtet. Neuzeitl. Über-tragung der Bezeichnung auch aufBerggasthöfe. Engl. shed; frz. chalet; sp. cabaña en la mon-taña, refugio.
Bauelement, jedes konstruktivund funktionell selbständige Gliedeines Bauwerks: Mauer oder Wand,Stützen aller Art, Bogen und Ge-wölbe, Dächer, Treppen, Fenster,Türen, aber auch Baumaterial(Stein, Holz, Lehm, Eisen, Beton).Ihre Verwendung hängt von denAnforderungen an ein Bauwerkhinsichtl. Konstruktion, Funktionund Material ab. Engl. (prefabricated) building unit; frz. élé-ment constructif; it. elemento costruttivo;sp. elemento constructivo.
53 Bauelement
Baublock
Bauernhaus, das Haus des Bauern,das als Einhaus die Wohn-, Wirt-schafts-, Vorratsräume und Ställeunter einem Dach vereinigt, aberauch das Wohnhaus eines aus ein-zelnen um einen geschlossenenoder offenen Hof geordneten Ge-bäuden bestehenden Bauernhofsoder Gehöfts. Das B. ist meist einHolzbau, manchmal auch einSteinbau oder Backsteinbau. EineVerbindung von Stein- und Holz-bau ist möglich, entweder ge-schoßweise oder nach Funktionengetrennt (Wohnhaus aus Stein,Wirtschaftsgebäude aus Holz). Dieverschiedenen Landschaften ent-wickelten charakterist. Typen: Das→ *Niedersachsenhaus findet manin Norddeutschland zwischenHolland und der Oder. Südl. liegtzwischen Lothringen und Ost-preußen das Gebiet des mitteldeut-schen → *Gehöfts. Im Elsaß, in derNordschweiz und in Baden-Würt-temberg herrscht das alemann., inBayern, Tirol und Salzburg das bayr.→ *Einhaus vor. Daran schließen inÖsterreich die → *Vierkanthöfe,weiter südl. und östl. die → *Zwie-höfe. Sonderformen sind die→ *Schwarzwaldhäuser, → *Barg-hus (oder Haubarg in Schleswig-Holstein), → *Laubenhäuser und→ *Umgebindehäuser (Ost-deutschland und Nordböhmen)und die → *Rauchstubenhäuser(Kärnten und Steiermark). Engl. farm-house, rustic house; frz. maisonrustique, ferme; it. casa colonica, casa rura-le; sp. casa de campo.
Bauflucht, Flucht, 1. gerade, hori-zontale Begrenzungslinie einesBauwerks. 2. Die von einer Bau-behörde im amtl. Bebauungsplanfestgelegte Linie (B.linie), über die
hinaus ein Grundstück nicht be-baut werden darf. Engl. alignment; frz. alignement; it. allinea-mento; sp. alineación.
Baufuge, 1. → *Baunaht. 2. Fuge,die Bauteile aus zeitl. (→ *Baunaht),arbeitstechn. (→ Bauabschnitt)oder konstruktiven (Dehn- undSetzfuge) Gründen trennt. Engl. joint; frz. joint de construction;it. giunto; sp. unión, junta.
Bauglied, einzelnes, funktionellund formal klar umrissenes Ele-ment einer architekton. Schöpfung(z.B. Bogen, Gebälk, Pfeiler, Säuleu. dergl.). Engl. structural element; it. elemento edili-zio; sp. elemento estructural.
Baugrube, Ausschachtung für einBauwerk oder dessen Fundamente.Das anfallende Material heißtAushub. Engl. building pit; frz. fossé de construc-tion; it. scavo di fondazione; sp. zanja defundación.
Baugruppe, Gruppe von zusam-mengehörenden Gebäuden, die
Bauernhaus 54
Baugruppe
durch ihre Stellung und Größe auf-einander abgestimmt sind (z. B.Hofanlage, Schloßanlage u. dergl.). Engl. building group; it. complesso archi-tettonico; sp. complejo arquitectónico.
Bauhaus, staatl. »Hochschule fürBau und Gestaltung«, von WalterGropius 1919 in Weimar gegründetund 1925 nach Dessau verlegt. DasB. beabsichtigte Form und Kon-struktion wieder miteinander inEinklang zu bringen und führte dieSchüler in theoret. Lehre undprakt. Werkarbeit in die verschie-denen Gebiete handwerkl. und ar-chitekton. Gestaltung ein (Keramik,Metall, Tapeten, Stoffe, Möbel).1928 übernahm Hannes Meyerund 1932 Mies van der Rohe dieLeitung. Das B. wurde wegen sei-ner radikal-modernen Einstellung(»Bauhaus-Stil«) vielfach bewun-dert, aber auch heftig bekämpft.1932 übersiedelte das B. nachBerlin und wurde 1933 geschlos-sen.
Bauhof, städt. Vorratshof für Bau-geräte und Materialien, zugleichZimmerplatz. Engl. timberyard; frz. dépôt de matériel dechantier; it. cantiere edile; sp. almacén demaderas.
Bauhütte, 1. überdachte Werk-stätte der Steinmetzen auf oder beieinem Bauplatz, auch Baubüround Raum für Bauwerkzeug undBaumaterialien. 2. Werkstattver-band der an größeren Bauvorhaben(bes. Kirchen) tätigen Bauleute(fabrica); im MA. eigene Hütten-ordnungen, die seit Mitte des 15.Jhs. kodifiziert sind; auf dem Re-gensburger Steinmetztag 1459 wur-de die Ordnung der Straßburger
Oberhütte für verbindl. erklärt,weitere Oberhütten in Köln, Wienund Bern. Die B. war für die Aus-bildung der Lehrlinge und Meister-knechte zuständig. Die Hütten-leute gehörten nicht den städt.Zünften an. In den Hüttenordnun-gen waren Lehrzeit, Gebühren,Löhne und Sozialleistungen, Rech-te und Pflichten geregelt. Der Hüt-tenmeister leitete die B., er warder Baumeister mit einem Polier.Techn. konstruktive und geometr.Kenntnisse, die zur Konstruktiongotischer Kirchen mangels rech-ner. → Statik notwendig waren,wurden an Meisterknechte in denB. weitergegeben (→ *Bauriß). Engl. mason�s workshop, mason�s guild;frz. loge maçonnique; sp. barraca, gremio delos costructores.
Bauinschrift, außen oder innenan einem Gebäude angebrachte In-schrift, die Hinweise gibt auf denZeitpunkt des Baubeginns und derBauvollendung, über den Bau-herrn, den Stifter, die Funktion desGebäudes usw. Inschriftträger sindmeist Steinplatten, seltener Putz,Tonplatten oder Mosaiken. Engl. building inscription; it. iscrizione diun edificio; sp. inscripción de un edificio.
Baukeramik, zusammenfassendeBezeichnung für die zum Schmuckvon Bauwerken dienenden Erzeug-nisse der Keramik, wie Wand- undFußbodenfliesen, Ornamentplatten,Reliefs und Formsteine. Bereits im14. Jh. v. Chr. wurden in Ägyptenfarbig glasierte Wandfliesen ver-wendet. Auf hoher Stufe stand dieB. in den Ländern am Euphrat, woBabylonier und Assyrer an ihrenMonumentalbauten große farbigeFigurenfriese aus glasierten Zie-
55 Baukeramik
geln anbrachten. Auch die Perserhaben solche Fliesen geschaffen.Bei den Griechen waren an denfrühen, urspr. hölzernen Tempelnvor allem die Trauf- und Giebel-kanten des Dachs mit bemaltenTerrakotten verkleidet, die im 4. Jh.zu plast. Gebilden entwickelt wur-den (→ *Akroterion). Die Etruskerbekleideten das ganze hölzerneTempelgebälk mit verzierten Terra-kotten (→ *Antefixa), und aus Tonbestanden auch First- und Stirn-ziegel und der statuar. Schmuckihrer Tempel. Die hochentwickelteB. der Etrusker wurde von denRömern nur teilweise übernom-men, doch sind bes. aus der frühenKaiserzeit zahlreiche Terrakotta-platten und -reliefs erhalten. Einegroße Rolle spielte die B. in derislam. Baukunst: bunt glasierte,farbenprächtige Fayencefliesen be-kleiden die Innen- und Außen-wände der Moscheen und Grab-bauten des Orients, von Persienüber Vorderasien und Nordafrikabis nach Spanien, von wo die islam.B. auch auf andere europ. Länderwirkte (→ Azulejos). Im MA. warder oberital. und norddt. → Back-steinbau das bedeutendste Gebietder B., die seit dem 13. Jh. Form-steine und glasierte Backsteine als
Schmuck verwendete. Figürl. B.gab es vor allem in Florenz zur Zeitder Renaissance, wo die Familieder Robbia eine Manufaktur fürkeram. Bauschmuck unterhielt. ImBarock ist B. selten, sie wurde erstwieder zu Beginn des 20. Jhs. voneinigen Architekten zum Schmuckihrer Bauten verwendet. Engl. glazed bricks; frz. céramique préfabri-quée; it. ceramica da rivestimento; sp. cerá-micos.
Baukörper, das sich über das Ter-rain erhebende Gesamtvolumeneines Bauwerks, bestimmt von derForm, Struktur, Gruppierung undMaterial und spiegelt zumeist dasinnere Raumgefüge. Engl. volume, building; it. corpo di fabbri-ca; sp. cuerpo, volumen del edificio.
Baukörper 56
Baukeramik (Beispiel: Babylon, Ischtartor)
Baukörpergruppierungen
Baukunst, 1. Gesamtheit des Bau-schaffens, die alle Bauten einesVolks oder einer Epoche um-schließt, sofern diese Werke eineüber die Erfüllung des Zweckshinausgehende künstler. Gestal-tung oder aber einen tieferen gei-stigen Hintergrund haben. 2. Sum-me des Könnens und Wissens, wel-che zum Entwerfen und Errichtenvon künstler. gestalteten Bauwer-ken nötig ist. Hauptthema der B.ist die Gestaltung von → Raumund Körper (→ *Baukörper) unterder Mitwirkung von Licht undFarbe sowie dem zeitl. Ablauf vonEindrücken eines Betrachters. Seitdem 16. Jh. wird B. in gleichem Sin-ne wie → Architektur verwendet. Engl., frz. architecture; it. architettura;sp. arquitectura.
Baulinie → Bauflucht 2.
Baulos → Bauabschnitt.
Baulücke, noch nicht bebauterZwischenraum zwischen zweiHäusern in einer → Bauflucht. Engl. gap site; it. vuoto edilizio; sp. terrenono edificado.
Baumeister, urspr. identisch mit→ Architekt, im MA. unterschie-den als der die Bauerstellung lei-tende und auf der Baustelle mitar-beitende magister operis (Maurer,Steinmetz) im Unterschied zudem mehr theoret. die Ikonologiedes Bauwerks bestimmenden Archi-tekten (Bauherr). Seit dem 19. Jh.hauptsächl. für den Bauleiter undBauunternehmer verwendet, dereine Baufachschule besucht hat. Engl. architect; frz. maître d��uvre, archi-tecte; it. costruttore edile, architetto; sp. jefede obras.
Baumodell, Architekturmodell,plastisch-dreidimensionale Dar-stellung eines Bauwerks oder Teiledavon in Holz, Stein, Gips, Wachsoder Kork in verkleinertem Maß-stab oder von Baudetails in natürl.Größe. In der Regel handelt es sichum Entwurfsmodelle zur Veran-schaulichung eines geplanten, sel-tener um Abbilder eines fertigge-stellten Bauwerks. Daneben gibt esnoch Ideal- bzw. Phantasiemo-delle, wie sie in der sakralen Kunstdes MA. und der Antike vorkom-men (z.B. Sarkophage, Baldachine,Tabernakel, Kultgeräte). Die klei-nen Kirchenmodelle, die man häu-fig auf ma. Darstellungen in Ver-
bindung mit Stiftern oder Heiligenfindet, sind nur selten treue Ab-bilder einer geplanten oder fertig-gestellten Kirche. In der Renais-sance wird das Entwurfsmodell zurRegel. Auch im Barock wurde andem Brauch festgehalten, daß derArchitekt außer zeichner. Ent-würfen auch ein B. zu liefern hatte,wie es heute noch bei Wettbe-werben besonders. städtebaul. Artüblich ist. Modelle von ausgeführ-ten Bauten wurden häufig auch vor
57 Baumodell
Baumodell (Beispiel: Ulm, Münster)
Abbruch eines Gebäudes oder zuLehrzwecken angefertigt. Engl. model; frz. maquette; it. modello,plastico; sp. maqueta.
Baunaht, Baufuge, wird die Stellean einem Bauwerk genannt, an derein älterer und ein jüngerer Teilsich deutl. erkennbar gegeneinan-der absetzen. Man findet solche B.häufig an ma. Anlagen, die in derRegel von O. nach W. gebaut wur-den und bei oft langer Bauzeittechn. und stilist. Unterschiedezwischen den einzelnen Bauab-schnitten aufweisen. It. giunto; sp. unión, junta.
Bauopfer, im Altertum häufig, imMA. noch vereinzelt geübterBrauch, beim Bau eines Hauses,eines Damms, einer Brücke usw. indas Fundament oder unter derSchwelle ein Tier oder auch Gegen-stände einzumauern, um Dämo-nen, Naturgottheiten oder Haus-geister gnädig zu stimmen bzw.Unheil von dem Bau abzuwenden. It. rito propiziatorio; sp. rito propiciatorio.
Bauordnung, Baurecht, Verord-nungen, die den Bauherrn bzw.den Baumeister zwingen, sichbestimmten Regelungen und Vor-schriften zu unterwerfen. Diese
betreffen die Standsicherheit, Kon-struktion, Feuersicherheit, die Bau-linien und Bauwiche, die Zahl undHöhe der Geschosse, die Ausbil-dung der Dächer und der Dach-gesimse (Dachvorsprung) sowieHausvorsprünge (Erker, Kellerhäl-se). Die Überwachung, Genehmi-gung und Abnahme dieser durchVerordnungen und Gesetze örtl.fixierten B. obliegt der Bauaufsicht,d.h. der Gemeindeverwaltung. Inder Antike und im MA. dienten dieB. vorrangig der Stand- und Feuer-sicherheit, Ordnung des Verkehrsund der Be- und Entwässerung. Engl. building code; frz. ordonnances surles constructions; it. regolamento edilizio;sp. reglamento edificio.
Bauornament, allgemein jedesSchmuck- oder Zierglied (Orna-ment) an Werken der Baukunst.Nach ihrer Herkunft lassen sichzwei Gruppen von B. unterschei-den: 1. B., die ausschließl. oderüberwiegend am Bau vorkommen,weil sie struktiven Baugliedernnachgebildet oder aus ihnen entwik-kelt, oder überhaupt am Bau ent-standen sind (z. B. → *Maßwerk).2. B., die auch in anderen Kunst-gattungen (z.B. Buchmalerei, Töp-ferei, Möbelbau, Goldschmiede-und Textilkunst) gebräuchl. sind. �Das B. hat neben der Funktion desSchmückens auch die des Glie-derns, wobei die Schattenwirkungeine wesentl. Rolle spielt. Es istdaher in der Regel plast., häufigauch bemalt (Polychromie) oderaus verschiedenfarbigem Materialin die Fläche eingelegt (→ *Inkru-station). Engl. architectural ornament; frz. ornementarchitectural; it. ornamento (architettoni-co); sp. ornamento arquitectónico.
Baunaht 58
Baunaht
Bauperiode, der Zeitraum, indem ein → Bauabschnitt entstan-den ist. Die B. kann, muß abernicht mit einer Stilepoche zusam-menfallen. So kann z. B. eine got.Kathedrale in mehreren B. entstan-den sein, ohne daß dadurch einStilwechsel eingetreten ist. Ande-rerseits läßt häufig gerade ein Stil-wechsel an ein und demselbenBauwerk erkennen, daß es in zweioder mehreren B. errichtet wurdeund wie lang demnach die Bauzeitinsgesamt gedauert haben muß. Engl. building period; frz. période de con-struction; it. periodo di costruzione; sp. per-íodo arquitectónico.
Bauplan, maßstäbl. Bauzeichnungals Entwurfs- oder Ausführungs-zeichnung bzw. Darstellung einesbestehenden Bauwerks (Bauaufnah-me). Entwurfs- und Ausführungs-
zeichnungen für Bauwerke kom-men im 13. Jh. auf und werden inder Renaissance- und in derBarockzeit die Regel. In der Zeitdes Klassizismus wurden die Bau-pläne oft kunstvoll als Kupfersticheausgeführt bzw. koloriert, währendheute der B. eine reine Konstruk-tionszeichnung ist. Engl. building plan; frz. plan de construc-tion; it. progetto di costruzione; sp. plano deconstrucción.
Bauplastik, die eigens für einBauwerk geschaffene und mit ihmfest verbundene figürl. Skulpturoder Plastik, meist aus Stein, selte-ner aus Holz oder Ton. Sie ist ent-weder rein dekorativ (Masken)oder sie dient außer zum Schmuckauch zur Veranschaulichung vonSinn und Zweck des Bauwerks,wie es bes. bei Kultbauten (Tempel,Kirche) der Fall ist. Die B. kanndem architekton. System völligeingeordnet sein (sowohl formal:z. B. Metopen und Giebelgruppendes gr. Tempels, als auch konstruk-tiv: → *Atlanten und → *Karyati-den), sie kann es aber auch über-schneiden, plast. fortsetzen (Gotik,Barock) oder es geradezu überwu-chern (ind. Tempel). B. gibt es inder entwickelten Steinbaukunstaller Zeiten und Völker. FrüheBeispiele sind die Kolossalskulptu-ren sitzender oder stehender Pha-raonen zwischen den Säulen odervor den Pfeilern ägypt. Tempel-höfe, die geflügelten, menschen-köpfigen Löwen an den Portalenassyr. Paläste, die glasierten Figu-renreliefs, mit denen Babylonierund Perser ihre Torbauten undPaläste schmückten (→ *Baukera-mik), und im ägäischen Kultur-kreis das bekannte Löwentor zu
59 Bauplastik
Arabisches Bauornament (2)
Mykene. In der klass. Antike findetsich B. hauptsächl. in der Formvon Metopenreliefs, Figurenfrie-sen und Giebelskulpturen derTempel, aber auch als mehr oderweniger plast. Reliefs an den Trep-penaufgängen der Prachtaltäre. Mitdem Ende der Antike tritt ein allge-meiner Rückgang der B. ein. In deraltchristl. und byzantin. Kunstkommt sie nur noch vereinzelt vor.Erst im Rahmen der roman. Bau-kunst gewinnt die B. wieder anBedeutung, zunächst in Mittel-und Südfrankreich, wo Fassadenund Portale der Kathedralen mitStatuen und Reliefs reich ge-schmückt werden, während die B.in Deutschland sich außer amPortal vorwiegend im Innern der
Kirchen (z. B. an Chorschranken,Säulenbasen und -kapitellen) ent-wickelt. In der Gotik bleibt dasKirchenportal der Hauptort einergleichsam erzählenden B., die mitGewändestatuen, Archivoltenfigu-ren und Tympanonreliefs Gestal-ten und ganze Szenen der Bibelund christl. Legende wiedergibt. Inder Renaissance geht die kirchl. B.zurück, dafür werden die Fassadenund Portale der Profanbauten (Pa-läste, Schlösser, Rathäuser) mit rei-chem plast. Schmuck ausgestattet.Im Barock kommt die kirchl. B.wieder stärker zur Geltung, vorallem in den Stukkaturen des In-nenraums, aber auch als Portal- undFassadenschmuck, während Atlan-ten und Gebälktragende → *Her-
Bauplastik 60
Bauplastik (Beispiel: Poitiers, Notre Dame)
men beliebte Motive der profanenB. werden. Im Klassizismus undim späteren 19. Jh. geht die engeVerbindung von Plastik und Ar-chitektur verloren, soweit nicht diehistorisierende Nachahmung frü-herer Baustile bei öffentl. Gebäu-den, aber auch bei Villen und städt.Miethäusern zu einer Scheinblüteder B. führte, die bis ins 20. Jh. an-hielt (→ *Baldachin, → *Drolerie). Engl. architectural sculpture; frz. sculpturearchitecturale; it. scultura architettonica;sp. escultura arquitectónica.
Bauplatz, Gelände auf dem ge-baut werden soll, zum Unterschiedvon der → Baustelle, auf der bereitsgebaut wird. Engl. building plot; frz. lieu de construc-tion, emplacement d�un bâtiment; it. areafabbricativa, area fabbricabile; sp. solar, sitiode construcción.
Baurecht → Bauordnung.
Bauriß, Riß, Visierung, Entwurfs-oder Werkzeichnung von Bauwer-ken oder Bauteilen als Grundrißoder Aufriß in einem bestimmtenVerkleinerungsverhältnis (→ Maß-stab), bei kleineren Baugliedern(z.B. Rippenprofile) auch in natürl.Größe. In der Antike wurde nachmaßstablosen Systemskizzen derGrundriß in natürl. Größe auf demGelände bzw. auf dem → Stylobatder Tempel aufgerissen. Seit etwa1200/20 kennen wir 1:1 Risse(Werkzeichnungen, Reißbodenfi-guren) von Baudetails (Basen,Säulen, Gewölbeanfänger, Maß-werk) auf Mauern oder Fußböden,seit 1230/50 auch maßstäbl. ver-kleinerte Grundrisse und Aufrisseauf Pergament und später aufPapier. Seit der Renaissance wur-
den B. allgemeine Regel im Bau-verfahren, im Barock und Klassizis-mus wurden die B. auch koloriert. Engl. plan, construction drawing; frz. épure;it. disegno architettonico; sp. diseño arqui-tectónico.
Baustein, der zum Bauen verwen-dete, natürl. oder künstl. Einzel-stein. Natürl. oder gewachsene B.sind die nicht zugehauenen Bruch-steine von unregelmäßiger Formund die Hau- oder Werksteine, diedurch Behauen in eine regelmäßi-ge Form gebracht sind → Quader.Der meist gebrauchte künstl. B. istder → Backstein (→ *Mauerwerk). Engl. building block; frz. pierre de con-struction, p. à bâtir; it. pietra da costruzio-ne; sp. piedra de construcción.
Baustelle heißt ein → Bauplatz,auf dem bereits gebaut wird. Engl. construction site; frz. chantier; it. can-tiere; sp. obra.
Baustil → Stil.
Bausymbolik, Ikonologie, diesymbol. Bedeutung eines Bauwerksund seiner Teile. Die B. war bes.im ma. Kirchenbau ausgebildet.Auch die Symbolik der Zahlen (die
61 Bausymbolik
Bauriß (Beispiel: Baldachin, Grundriß)
Dreizahl bei Dreifaltigkeitskirchen,das Achteck für kaiserl. Bauten, dasZwölfeck), der Materialien (Edel-steine, Porphyr) und der Farbenspielte bei der B. eine große Rolle. Engl. architectural symbolism; it. simbolo-gia architettonica; sp. simbolismo arquitec-tónico.
Bauteil, größerer, in seiner Er-scheinung vom Hauptbaukörperabgesetzter Teil eines Bauwerks,z.B. Treppenhaus, Flügel, Turm u.dergl. Sp. parte de un edificio
Bauweise, 1. (Bauart) Art des Bau-materials (Stein-, Lehm-, Back-stein- und Holzb.) oder seine Ver-arbeitung (Massiv-, Fachwerk-,Skelett- und Schalenb.). 2. In der
Siedlungsstruktur die Art und Wei-se, wie die Bauwerke einander zu-geordnet sind. Man unterscheidetdabei hauptsächl. die geschlossene,die gemischte und die offene B. Ei-ne geschlossene B. entsteht, wenndie einzelnen Häuser durch eine ge-meinsame Brandmauer verbundensind (Reihenhaus). Bei der offenenB. sind die Baukörper durch denBauwich voneinander getrennt. Beider halboffenen (gemischten) B.sind einzelne Häuser im Sinne dergeschlossenen B. zu Gruppen zu-sammengefaßt, von den anderenGruppen aber nach Art der offenenB. abgesetzt. Neuere B. sind dieBlockb., die eine architekton. ein-heitliche Bebauung für ein vonmehreren Straßen umschlossenesBaugrundstück vorschreibt, unddie Zeilenb., bei der die langge-streckten Bauten zueinander parallelangeordnet sind. Die B. ist meistbehördl. vorgeschrieben (Bebau-ungsplan) oder auch durch örtl.oder landschaftl. Besonderheiten inder Größe, Art und Stellung derBaukörper (ortsübl., heim. B.)unterschieden. Engl. construction method; frz. méthode deconstruction; it. tipologia edilizia; sp. modode construcción.
Bauwerk, allgemein eine an einenfesten Standort gebundene dauer-hafte Baukonstruktion, die unterVerwendung der Mittel der Bau-technik und in Kenntnis der Erfor-dernisse der Baukonstruktion ausverschiedenartigen Baumaterialienentstand. Unter B. versteht mannicht nur Leistungen des Hochbaus(Gebäude), sondern auch Inge-nieurbauten (Brücken) und Tief-bau (Flußbau, Tunnel, Straßenbau). Engl. construction; frz. construction; it. cos-truzione; sp. edificio, construcción.
Bauteil 62
Blockbauweise
Bauweise
offene B. gemischte B.
geschlossene B. Zeilenb.
Bauwich, Abstand eines Gebäudesvon den seitl. Grundstücksgren-zen. Der B. wurde hauptsächl. zurAbleitung des Regenwassers undzur Erhöhung des Feuerschutzesvon den Bauverordnungen vorge-schrieben. Der B. ist nicht bedeu-tungsgleich mit → Baulücke. It. distanza regolamentare; sp. distanciareglamentaria.
Bauzeichnung, Architekturzeich-nung, → Bauplan, → *Baurisse,Visierungen, Entwürfe, → Detailsund Ausführungszeichnungen inverschiedenen Ebenen (Grundriß,Aufriß, Schnitt u. dergl.). Engl. architectural drawing; frz. dessin debâtiment; it. disegno di costruzione; sp. di-seño, dibujo de construcción.
Befestigung, der Verteidigungdienende Geländeverstärkung undAusrüstung von Gebäuden, als stän-dige oder vorübergehende Einrich-tung zur Kampfführung und Ver-sorgung der Kämpfenden (→ *Burg,→ *Festung). Engl., frz. fortification; it. fortification; sp. su-jeción.
Beffroi, Beffroy, frz. Bezeichnungfür → *Belfried.
Beg(h)inenhof, der mit einerMauer umgebene B., auf Belgi-en/Niederlande beschränkt, be-steht aus einer einfachen Kirche,mehreren Häusern, in denen dieNovizen in Einzelzellen wohnen,sowie einer Anzahl von Häusern(Klausen, Eremitagen), in denendie älteren langjährigen Insassen inkleinen Wohnungen mit Gärtchenwohnen, dazu ein Spital für dieKrankenpflege. Im 13.�15. Jh. auchin europ. Ländern verbreitet, dort
kleinere Konventsanlagen oder Ein-zelhäuser in der Stadt verstreut. Engl. Beguine convent; frz. béguinage;it. beghinaggio; sp. beguinaje, beaterio.
Beichtkapelle, anfangs Beicht-kammer oder Beichtzelle, kleinerNebenraum an einer Kirche zu-meist hinter dem Hauptaltar, dervor der Einführung der dreiteiligenGehäuse-Beichtstühle nach demKonzil von Trient 1563 zumBeichten diente, bes. in Südeuropaverbreitet. Engl. chapel for confession; frz. chapelle dela pénitence; it. cappella confessionale;sp. capilla para la confesión.
Beinhaus, auf Kirchhöfen ein klei-ner Anbau neben der Kirche oderauch eine Gruft unter der Kircheoder unter dem → *Karner, um diebeim Graben neuer Gräber aufge-deckten alten Knochen zu lagern. Engl. ossuary, charnelhouse; frz. ossuaire,charnier; it. ossario; sp. osario.
63 Beinhaus
Beischlag
Beischlag, als Sitze ausgebildeteWangen der drei- bis vierstufigenFreitreppe vor dem städt. Wohn-haus in Norddeutschland, Ostsee-raum, Schweiz, Niederlanden, Böh-men, seit Ende des 14. Jhs. ur-kundl. nachgewiesen, im 15. Jh. vollausgebildet mit hohen stelenarti-gen Pfosten an der Stirnseite, zurStraße hin mit Reliefs verziert.(Abb. S.63) Engl. footpath; frz. estrade, perron; it. ter-razzino d�ingresso; sp. escalinata de ingreso.
Bekleidung, 1. Veredelung derOberfläche einer Konstruktiondurch eine nichttragende Material-schicht aus ästhet. Gründen, zurErhöhung der Widerstandsfähig-keit gegen Abnutzung, Verwitte-rung, Feuchte und Brand, oder zurVerbesserung akust. und therm. Ei-genschaften: Anstriche und Schutz-schichten (Putz, Stuck, Estrich),Inkrustationen (Mosaik, Fliesen),Furniere, Tapeten, Täfelungen undSchalungen. 2. Holzverschalungder Laibungen von Türen, Fen-stern u. dergl. Engl. 1. lining, revetment; frz. 1. revête-ment, faux parement, parure; it. 1. rivesti-mento; sp. revestimiento.
Bekrönung, schmückender Auf-bau oder obere Endigung einesBauteils: z. B. Fensterb. (→ *Fen-sterverdachung) und Portalb. (→*Wimperg), → *Baldachin, Sima, →
Stirnziegel, → Attika und → *Balu-strade über dem Hauptgesims (→*Firstb., Firstkamm), → *Akrote-rien, → *Krabben am Giebel, Fia-len an got. Strebepfeilern, Dach-figuren, Turmknauf, → *Ähre, →*Kreuzblume u.a. Engl. crown; frz. couronnement; it. corona-mento; sp. coronamiento.
Beletage (frz. schönes Stockwerk),das Hauptgeschoß eines Gebäudes(→ *Geschoß) mit den Reprä-sentationsräumen, meist über demErdgeschoß. Engl. bel étage; frz. belétage; it. piano nobi-le; sp. piso principal.
Belfried (frz. Beffroi), hoher,schlanker Rathausturm, eingebautoder freistehend in spätma. StädtenFlanderns und Nordwestfrank-
Beischlag 64
Bekleidung 2
Belfried (Beispiel: Brügge, Tuchhalle)
reichs; er verkörpert die Macht derbürgerl. Selbstverwaltung. Fälschl.wird auch der → *Bergfried ma.Burgen B. genannt. Engl. belfry; frz., it. beffroi; sp. torre delayuntamiento.
Bellevue (frz. Schönblick) → Bel-vedere.
Belvedere (it. Schönblick, frz.Bellevue), 1. Aussichtsterrasse aufdem Dach oder im Dachgeschoßvon Wohnhäusern, Villen, Palästenund Schlössern. 2. Architekton.gestalteter Aussichtspunkt in Park-anlagen. 3. Schön gelegenes Lust-schloß, vornehml. der Renaissanceund des Barock. Engl. belvedere, bellevue; frz. bellevue;it. belvedere; sp. terraza, mirador, azotea.
Bema (gr. Stufe, Tritt), Redner-bühne, Richterstuhl, 1. Bezeich-nung für die um eine oder mehrereStufen erhöhte Bühne der Presby-ter in der Apsis der altchristlich-byzantinischen Basilika. 2. In derOstkirche der erhöhte, von derIkonostase abgeschlossene Altar-raum. 3. Auch Almemor, in der→ *Synagoge das erhöhte Lese-pult zur Vorlesung aus der Thora-Rolle. Engl., frz., it. bema; sp. tribuna del orador.
Berchfrit, altertüml. Bezeichnungfür → *Bergfried.
Berg, im Festungsbau eine Be-zeichnung für die Katze, bzw. → Ka-valier, ein Erdaufwurf auf Walloder Bastion zur besseren Bestrei-chung des Vorfelds. Engl. mountain; frz. montagne, mont;it. monte; sp. montaña.
Bergfried, Berchfrit (ma. bercvrit),(1836 von H. Leo eingeführt):hoher, mächtiger, rechteckiger, run-der oder polygonaler Turm der ma.Burg; dient der Repräsentation, alsAusguck und letzte Zuflucht fürdie Burgbewohner; er diente nicht,wie der → *Donjon, zum dauern-den Wohnen, auch wenn er in denoberen Geschossen häufig mit Ka-min und Abtritt ausgestattet war;bei eingezogenem, oberem AufbauButterfaß, bei Rundturm auch Sin-wellturm genannt. HochgelegenerEinstieg, über abwerfbare Holz-leiter oder Holzsteg zugänglich, imUntergeschoß das durch das Angst-loch zugängliche Verließ, von deroberen, von Zinnen gesichertenPlattform zu verteidigen; im spätenMA. mit auskragenden Ecktürmenbereichert. Engl. (castle) keep, donjon; frz. beffroi,donjon; it. belfredo; sp. torre de la fortalezamedieval.
Bergzungenburg oder Sporn-burg, eine auf einer Bergzungegelegene Burg.
Bering, der von Mauern umschlos-sene Bereich einer → *Burg. Engl. ring wall, encoling wall, enceinte;it. area delimitata dalla cinta muraria.
65 Bering
Bergfried (Beispiel: Burg Steinsberg)
Berme, Absatz zum Graben amFuß des Walls oder der Mauer zurVerbreiterung der Verteidigungs-zone, auch Barbe genannt. Engl. berm; frz. berme; it., sp. berma.
Beschlag, Baubeschlag, als Türb.zur Sicherung und Festigkeit alsgeschmiedetes Eisen in der Formflacher Bänder neben dem funktio-nell notwendigen Angelschienenangebracht, zumeist waagerechteBänder mit gespaltenen Enden,später weit ausschwingend undreich verziert. Früheste Belege um1100, frz. Ausbildungen durch Zi-sterzienser in Deutschland undEngland verbreitet; im 15. Jh. dieganze Türfläche überziehend mitRanken, Gitter, Maßwerk usw., seitdem 16. Jh. geringe Bedeutung.Zum B. zählen auch die Schloß-bleche, Griffe, → *Türklopfer und
Schlösser, die bis ins 19. Jh. Gegen-stand künstler. Gestaltung blieben. Engl. armature; frz. ferrure, garniture, ar-mature; it. guarnitura metallica; sp. herraje.
Beschlagwerk, Ornament aussymmetr. angeordneten Bändernund Leisten, häufig durch ange-deutete Nagel- und Nietköpfe be-tont. Als flächenfüllende Orna-
mentform der niederländ. und dt.Spätrenaissance, um 1560 von demniederländ. Architekten JohannVredemann de Vries aus dem→ Rollwerk in Verbindung mit derBand-Maureske entwickelt, zu-nächst an Hausgiebeln, seit 1570 inDeutschland auch als Verzierung anKirchenausstattungsstücken. Nach1610 geht das B. in den sogenann-ten Ohrmuschelstil über (→ Knor-pelwerk). Engl. strapwork; frz. ferrures; it. decorazio-ne che imita lo sbalzo; sp. ornamento conherrajes.
Bestick, im Festungsbau das Profileines Deichs.
Bestiensäule, freistehende Stütze(Säule oder Pfeiler), die mit plast.Darstellungen miteinander kämp-fender Tiere (Löwen, Fabeltiere)bedeckt ist. Die B. kommt nur in
Berme 66
Beschlag einer spätgot. Tür
Beschlagwerk
der roman. Kunst vor, in Frankreichund Italien mehrfach, sonst selten.
Bethaus, ein Gebäude ohne Turmund Glocke, in dem außer Gebetund Predigt keine pfarramtl. Hand-lungen vorgenommen werden,durch Erlasse in der 2. Hälfte des17. Jhs. in kath. Ländern für luther.und andere reformierte Bekennt-nisse genehmigt (Österreich, Schle-sien, Rheinland). Engl. oratory, prayer chapel; sp. oratorio,capilla.
Beton (frz.), Gußmauerwerk, dasbereits den Römern bekannt war(opus caementitium) und das hintereiner Vormauerung als Hinter-füllung, meist aber in oder aufeiner Schalung gegossen wird. B.besteht aus festen Zuschlagstoffenund einem Bindemittel (in derAntike Kalk und hydraulische Bin-
demittel, auch Trass, seit 2. Hälfte19. Jh. Zement), die mit Wasseraufbereitet werden. Je nach der Artund Menge der Zuschlagstoffe undder Bindemittel unterscheidet manverschiedene Arten von B. (Leichtb.oder Schwerb.; Schlackenb., Zel-lenb., Gußb., Kiesb., Hartb.). Eineneue Entwicklung nahm der Betondurch die Verwendung von Rund-eiseneinlagen (Bewehrung) zurAufnahme der Zugspannungen(→ *Stahlb.) und von vorgespann-ten Drähten (Spannb.). Engl. concrete; frz. béton; it. calcestruzzo;sp. hormigón.
Betsaal → Bethaus.
Betsäule, Bildstock, im Freien,bes. an öffentl. Wegen errichtetesreligiöses Wahrzeichen, meist in
67 Betsäule
Bestiensäule (Beispiel: Freising, Domkrypta)
Betsäule
Form einer Säule oder eines Pfei-lers mit einem religiösen Bildwerkin einer Nische, einem tabernakel-ähnl. Aufbau, oder als Bekrönung.Steinerne B., in got. Zeit oft mitarchitekton. Zierrat, finden sichneben solchen aus Holz haupt-sächl. in Franken, Schwaben undin den Alpenländern. Engl. roadside cross, wayside shrine; frz. co-lonne oratoire; it. colonnina votiva; sp. co-lumna votiva.
Bettelordenkirchen, Sammelbe-zeichnung für die von den Bettelor-den, bes. von Franziskanern (Mino-riten, Barfüßer) und Dominikanern(Prediger) seit der Mitte des 13.Jhs. errichteten Kirchen, die inner-halb der got. Kirchenbaukunst eineSondergruppe bilden. Die B. ha-ben kein Querhaus, keine Türme,höchstens einen kleinen Chor-winkelturm oder einen Dachreiter,kein Triforium und meist nur klei-ne Hochschiffenster. Das Strebe-werk ist außen und innen auf dasNotwendigste reduziert, so daß dieGewölbe häufig ohne Verbindungmit den Pfeilern auf Kragsteinenaufsitzen. Auch auf Bauplastik istweitgehend verzichtet, damit nichtsdie Laiengemeinde vom Anhörender Predigt, dem Hauptanliegen derBettelorden, ablenkt. Engl. friars� churches; frz. église des ordresmendiants; it. chiesa degli ordini mendi-canti; sp. iglesias de frailes mendicantes.
Bewehrung, die Armierung des→ *Stahlbetons durch Eiseneinla-gen. Man unterscheidet sog. schlaf-fe B. beim normal auf Biegungbeanspruchten Stahlbeton, vorge-spannte B. beim Spannbeton undDruckb. bei Stützen. Engl. reinforcement; frz. armature, ferrai-lage; it. armatura; sp. armadura metálica.
Biberschwanz, flacher Dachzie-gel, der mittels einer Nase an dieDachlatte gehängt wird, meistrechteckig, am unteren Ende leichtabgerundet oder spitz, seit dem12. Jh. nachgewiesen, bes. in Süd-deutschland verbreitet. → *Dach-deckung. Engl. flat tile, plain t.; frz. tuile plate, t. àcrochet; it. tegola piana a squama; sp. tejaplano, t. castor.
Bibliothek, Raum, in dem Schrift-rollen oder Bücher verwahrt wer-den. In der Antike waren die B.von Alexandria und Pergamon (Per-gament!) weltberühmt. In derAntike reichgestaltete Gebäude, imMA. meist nur ein → Armarium,selten ein eigener Raum im Klo-ster, seit der Renaissance, bes. imBarock aufwendige, zumeist mitumlaufenden Galerien versehenePrunksäle. Mit der Übergabe zuröffentl. Benützung und dem Zu-nehmen der Büchermassen wurdedie Speicher-B. entwickelt, in derLesesaal und Büchermagazine ge-
Bettelordenkirchen 68
Bibliothek: (Beispiel: B. von Stift Altenburg/N.Ö.)
trennt (erstmals 1816 von Leopolddella Santa) und dekorative Bücher-säle nur noch zur Schaustellungkostbarer Unikate eingerichtet sind.Engl. library; frz. bibliothèque, librairie;it., sp. biblioteca.
Bilderkapitell → Figurenkapitell,→ Kapitell.
Bildstock → *Betsäule.
Bima (hebr. Bühne), Almemor,→ *Synagoge, → Bema.
Bindemittel, im Bauwesen zurdauerhaften Verbindung von Bau-materialien pulverförmige mineral.Stoffe (Zement, Kalk, Gips), diemit einer Flüssigkeit, zumeist Was-
ser, zu Mörtel angemacht und auf-grund chem. Vorgänge erhärten:hydraul. B. erhärten auch unterWasser, während nichthydraul. B.nur an der Luft erhärten und auchkeine wasserbeständigen Verbin-dungen bilden. Engl. medium, vehicle, binding agent;frz. agglomérant, glutinant, liaison; it. le-gante; sp. aglomerantes.
Binder, 1. im → *Mauerverbandder mit seiner Schmalseite in derMauerflucht liegende, in die Mau-er »einbindende« Stein, im Gegen-satz zum Läufer, dessen Langseitein der Mauerflucht liegt. 2. Dach-binder beim Dachwerk das dieSparren oder Pfetten aufnehmendeTragwerk, das in großen Abständenzwischen den Leergespärren vor-kommt (Dachbinder, → *Dachkon-struktion). Engl. 1. binding stone, binder; frz. 1. (pierreen) boutisse; it. 1. mattone in chiave, m. ditesta, 2. capriata composta principale; sp. la-drillo en el aparejo de cabeza.
Binderbalken → Bundbalken.
Binderverband, auch Strek-kerverband, im Backsteinbau einnur aus Bindersteinen bestehendes→ *Mauerwerk. It. concatenamento in chiave, c. di testa;sp. trabazón en tizón.
Birnstab, stabartiges Bauglied derGotik (→ *Rippe, Dienst) mit birn-förmigem Querschnitt. Engl. ogee moulding; it. membratura asezione piriforme; sp. moldura seccionadaen forma de pera.
Bischofskirche, Hauptkirche amSitz eines Bischofs. Die B. wirdnach dem in ihr stehenden Bi-
69 Bischofskirche
Bibliothek
(Beispiel: Ephesus, B. des Celsus)
schofsstuhl (gr. kathedra) in Frank-reich, Spanien und England meistKathedrale genannt, während inDeutschland die BezeichnungenDom oder Münster üblicher sind. Engl. cathedral, episcopal church; frz. égliseépiscopale; it. cattedrale; sp. iglesia episco-pal, catedral.
Blankverglasung, durchsichtiger,farbloser Glasverschluß an Fensternim Gegensatz zur Farbverglasung(→ Glasmalerei). Engl. blind glazing; frz. vitrage clair; it. ve-tratura incolore; sp. vidrios transparentes,incoloros.
Blatt, 1. im Holzbau der Ausschnittin zwei Balken oder Sparren zumZweck ihrer Überkreuzung, Ver-längerung oder Eckverbindung inderselben Ebene; der sich ergän-zende Einschnitt des einen Holzes,der das Blatt des anderen auf-nimmt, wird Blattsasse genannt(An-, Ver-, Überblattung, → *Holz-verbindung). 2. Beim got. → Maß-werk spitzbogig abgeschlossenesElement, das hauptsächl. in krumm-linig begrenzte (sphär.) Dreieckeoder Quadrate eingesetzt ist (Dreib.,Vierb., u. dergl.). 3. Flügel einer→ *Tür (Türb.). Engl. leaf; frz. 1. feuille lancéolée, pétale l.,lobe lancéolé; it. 1. incastro ligneo, 2. foglia,3. anta di porta, battente di p.; sp. 1. ensam-bladura, 2. tracería lanceolada.
Blattfries, aus mehr oder wenigerstilisierten Blättern in fortlaufen-der Reihung gebildeter → *Fries(26). Als Bauornament schon in derklass. Antike bes. in der Form derBlattwelle (→ Kyma) viel verwendet,kommt der B., häufig mit Rankendurchsetzt, auch auf unterschnit-tenen Profilen und auf nicht ausla-denden Bändern (Band 1) in der ro-man. und got. Baukunst wieder vor.Engl. vine scroll pattern; frz. feuillage, rin-ceau, frise en feuilles; it. fregio a girali;sp. friso formado por hojas.
Blätterkapitell → Blattkapitell,→ *Kapitell.
Blätterstab → Blattstab.
Blattkapitell, mit stilisierten odernaturgetreu nachgebildeten Blät-tern geschmücktes → *Kapitell. Inder Antike ist das von Akanthus-blättern umgebende Kapitell der ko-rinth. Ordnung die reichste Form.Sie wird in der karoling.-otton.Baukunst übernommen zumeistals Kompositkapitell, in der Roma-nik mit verschiedenen, häufig ab-strahierten Blättern, in der Gotik alsKelchkapitell mit einer oder meh-reren Reihen heim. Blattformen(Eiche, Efeu, Wein, Ahorn u. a.).Renaissance, Barock und Klassizis-mus verwenden wieder die klass.Form des korinth. Kapitells. Engl. leaf capital; frz. chapiteau à feuillage;it. capitello a fogliame; sp. capitel adornadocon hojas.
Blattmaske, menschl. Gesicht, dasin Blätter übergeht oder ganz ausBlättern gebildet ist. Die B. kommtzuerst in der röm. Baukunst alsplast. Schmuckmotiv vor und wur-de von der roman. Baukunst inFrankreich, weniger in Deutsch-
Blankverglasung 70
Blatt 2 Dreiblatt (liegend) Vierblatt (stehend)
land wiederaufgenommen. In derdt. Gotik tritt die B. als Schmuckvon Konsolen und Schlußsteinenhäufig und in ganz verschiedenenVariationen und Zwischenformenauf, während die Renaissance aufden antiken Typus zurückgreift, beidem das Gesicht nur von Blätternumrahmt wird. Engl. foliate mask; frz. masque à feuillage;it. maschera fitomorfa; sp. máscera foliácea.
Blattsasse → Blatt 1.
Blattstab, → *Stab mit Blattdeko-ration. Eine Sonderform, die haupt-sächl. in der Barockzeit vorkommt,ist der Lorbeerstab. Frz. cimaise, rang de feuilleté; it. tondinofitomorfo; sp. barra decorada con hojas.
Blattung → Blatt 1.
Blattwelle, aus Blättern gebil-detes Bauornament der gr. Antike→ Kyma. Engl. tongue and dart, leaf and dart; it. ky-mation; sp. decorado de hojas.
Blattwerk, Laubwerk, Sammelbe-zeichnung für die aus stilisiertenoder naturgetreu nachgebildetenBlättern bestehende Verzierung bes.an → *Friesen (26) (Blattfries), Ge-simsen, Konsolen und → *Kapitel-len (Blattkapitell) der Gotik, in derSpätgotik von wuchernder Fülleu.ndreicher Bewegung, zumeistder heim. Pflanzenwelt entnom-men, oft in Form des sog. Wasser-blatts. Eine engl. Sonderform istdas → Tudorblatt. Die Antike kenntvor allem Akanthusblätter, Wasser-laub (lesb. → Kyma) und Palmette.In der Renaissance und im Barockwieder aufgenommen (→ *Arabes-ke, → Maureske). Engl. foliage; frz. feuillage, rinceau, feuilles;it. fogliame; sp. follaje.
Blattzapfen, ist eine Abart desgeraden Zapfens, die bei dickenHölzern von verschiedener Dickeverwendet wird, wobei das Blattdick genug verbleiben muß, umgegen Absplittern gesichert zu sein. Frz. patte; it. incastro a dente multiplo;sp. espiga con ensambladura gruesa.
Bleiverglasung, häufig farbigeund ornamentale oder figürl. Glas-fenster, deren Glasstücke, seit derRenaissance auch → Butzenschei-ben, durch Bleiruten verbundensind (→ Glasmalerei). Engl. lead glazing; frz. vitrage en plomb;it. vetrata; sp. vidrio ornamento y unido conplomo.
Blendarkade, Blendarkatur, alsGliederung einer Wandfläche auf-gelegte Arkade ohne Zwischenraumzwischen Arkade und Wand, bes. inroman. und got. Zeit angewandt. Engl. blind arcade; frz. arcature aveugle, a.simulée; it. arcata cieca, a. finta; sp. arcadafalsa, a. ciega, a. simulada.
71 Blendarkade
Got. Blattmaske
Blendbogen, ein Bogen, der keineMaueröffnung überbrückt undnicht als konstruktiver Entlastungs-bogen in der Mauerfläche liegt,sondern der geschlossenen Wandnur vorgeblendet, d.h. aufgelegt ist.Der B. ist bes. in der roman. undgot. Baukunst ein beliebtes Mittelzur Wandgliederung. In erweiter-tem Sinne wird der Begriff B. auchfür eine → Blendarkade verwendet. Engl. blind arch, arch feint; frz. arc aveugle,a. en orbe voie, a. feint, faux-arc; it. arcocieco, a. finto; sp. arco en nicho, a. falso, a.ciego, a. simulado.
Blende, 1. flaches, rechteckiges,rundes oder ovales, der Mauer auf-gelegtes architekton. Motiv (Bogen,Arkade, Fenster, Maßwerk) zur Glie-derung und Dekoration der Mau-er. 2. Im Festungsbau (auch Blen-de, Blendung), Deckungsschutzaus Flechtwerk oder Brettern. Engl. blind ornament; frz. brise-soleil, pare-soleil; it. opera cieca, o. finta; sp. 1. orna-mento sobrepuesto, 2. defensa en fuerte.
Blendfassade, Scheinfassade, Fas-sade, die einem andersartigen, meistunschönen oder in seinen Propor-tionen bzw. in seiner Gestaltungästhet. nicht befriedigenden Bau-körper vorgelagert ist. Die B. kanngrößer oder kleiner als der da-hinterliegende Baukörper sein undbraucht dessen Querschnitt (Blend-giebel), Geschoßeinteilung, Fenster-
teilung, Konstruktion und Materialnicht zu übernehmen (→ *Vor-hangfassade). Engl. dead façade; frz. fassade feinte, f. revê-tue, renard; it. facciata cieca; sp. fachadafalsa, f. simulada.
Blendfenster, Fenster, das einerMauer vorgeblendet ist, ohne daßFensteröffnungen dahinterliegen.Auch kann das B. ein relativ niedri-ges Fenster nach unten bzw. nachoben opt. ausweiten. Bei Basilikenohne Triforium können die Fensterüber die geschlossene Mauerflächehinter den Seitenschiffdächern alsB. heruntergezogen sein (bes. häu-fig im Backsteinbau). Seltenerkommt das B. im Innenraum alsWandgliederung vor, wenn äußereAnbauten einen Mauerdurchbruchunmöglich machen. Engl. blind window, blank w.; frz. fenêtreaveugle, fausse-fenêtre; it. finestra cieca, f.finta; sp. ventana falsa, v. simulada.
Blendgiebel, Ziergiebel, 1. zurGliederung der Traufseite einesDachs vorgeblendeter → *Giebel,→ Zwerchgiebel. 2. Giebel einer→ Blendfassade (→ *Blendfenster). Engl. blind gable; frz. faux-pignon; it. fron-tone cieco; sp. frontón falso, f. simulado.
Blendbogen 72
Blendbogen
Blendfassade
Blendladen → *Schartenladen.
Blendmaßwerk, einer nichtdurchbrochenen Mauerfläche (z.B.→ *Giebel) vorgeblendetes →*Maßwerk, häufig in Verbindungmit einem → *Blendfenster oderzur Füllung einer Blende, auch beiHolzvertäfelungen und anderemHolz- und Metallwerk, in derGotik und im 19. Jh. angewandt. Engl. blind tracery; frz. remplage aveugle, r.simulé; it. traforo cieco; sp. tracería falsa, t.simulada.
Blendmauer, eine Füllmauer, de-ren Vormauerung (Blendsteine)
Massivität aus besserem Materialvortäuscht, auch die Vormauerungselbst (→ *Mauerwerk). Engl. dead wall; it. 1. muro a cortina, 2. cor-tina; sp. muro falso, m. simulado.
Blendmauerwerk, Mauerwerk,dessen Kern durch ein wertvolleresbzw. wetterbeständigeres Material(Blendsteine u. dergl.) verblendetist. Engl. facing masonry; it.muratura a cortina;sp. mampostería falsa, m. simulada.
Blendnische, eine Nische, diedurch die Mauerstruktur oderdurch Art und Farbe des Steinma-
73 Blendnische
Blendfenster (Beispiel: Chorin, Zisterzienserkirche)
terials stärker betont wird. Die B.kommt hauptsächl. in spätroman.Zeit vor. Engl. blind niche; frz. niche feinte; it. nic-chia cieca; sp. nicho ciego.
Blendrahmen, fest mit der Mauerverbundener Holzrahmen, an dembei Türen und → Fenstern dieFlügel mit Beschlägen befestigtsind. Engl. door frame, window f.; frz. dormant;it. telaio; sp. marco fijo.
Blendrippe, der Gewölbeflächevor- oder untergelegte Rippe. Engl. wall rib; sp. cuaderna nervio, c. falso,nervio simulado, n. falso.
Blendrosette, Wandgliederung inForm einer Fensterrose ohne Mau-eröffnung (→ *Blendfenster). Engl. blind rosette; it. finto rosone, rosonecieco; sp. roseta falsa, r. simulada.
Blendstein, Verblender, Stein ausbesserem oder schönerem Material,der zum Verkleiden (Verblenden)der Außen- bzw. Ansichtsflächeeiner Mauer aus einfacherem Ma-terial dient (Bekleidung 1). Sokann z. B. eine Lehmziegelmauermit Backstein, eine Backsteinmau-
er mit Werkstein verblendet sein(→ *Mauerwerk). Engl. facing stone; frz. pierre de parement;it. pietra da rivestimento; sp. piedra pararevestir.
Blendtriforium, Gliederung derHochschiffwand zwischen denSeitenschiffarkaden und den Fen-stern in der Form eines → Trifo-riums, aber ohne dahinter liegen-dem Laufgang. Engl. blind triforium; frz. triforium aveugle;it. triforio cieco; sp. triforio falso, t. simulado.
Blendtüre, Wandgliederung, diein der Erscheinung wie eine Türewirkt. Eine B. ist auch die→ *Scheintür der ägypt. Mastaba(→ *Inkrustation). Engl. blind door; frz. porte feinte, fausseporte; it. porta cieca, p. finta; sp. puertafalsa, p. simulada.
Blindboden, der Balkenbelag ausBrettern oder Bälkchen, der unterden eigentl. Bretter-Fußboden ge-legt ist. Engl. dead floor; frz. faux-parquet; it. assito,impalcato; sp. piso falso.
Blindes Fenster, ein vorgetäusch-tes Fenster ohne Öffnung, dasaufgemalt oder mit Spiegeln verse-hen innerhalb des Rahmens einesBlendfensters angeordnet sein kann.B. F. werden dann verwendet,wenn Fassaden oder Innenräumeeinheitl. durch Fensterachsen ge-gliedert werden sollen, obwohleine Maueröffnung nicht möglichist. Auch später vermauerte Fensterkönnen als B. F. ausgebildet sein. Engl. blind window; frz. fenêtre dormante,fausse-fenêtre; it. finestra cieca, f. trompe-l��il; sp. ventana ciega.
Blendrahmen 74
Blendnische
Blindstufe, Setzstufe, senkrechtesBrett, das als Stütze der Trittstufedient. Engl. riser; frz. contremarche; it. alzata dilegno; sp. contrahuella.
Blockaltar, Altar mit massivemUnterbau (→ *Altar 2 c). It. altare a blocco; sp. altar con fundamentomacizo.
Blockbau, bes. in Skandinavien,Rußland und den Alpenländern ver-breitete Art des Holzbaus, bei derdie Wände aus waagerecht aufein-ander geschichteten Balken (Block-hölzern) oder Stämmen (Rundhöl-zern) gebildet und die dabei entste-henden Fugen meist mit Moos,Lehm u. dergl. abgedichtet sind. Anden Ecken sind die Querschnitteder Blockhölzer um die Hälfte inder Höhe versetzt und stehen über.Meist ruht die unterste Lage aufhölzernen oder steinernen Stützenoder auf einer Untermauerung, dievielfach Erdgeschoßhöhe erreichenkann. Auch auf Steinsockel odermit Fachwerkaufbau (→ Umgebin-dehaus). Engl. log construction; frz. construction enbois blindés; it. blockbau, costruzione intronchi d�albero; sp. construcción de tron-cos.
Blockstufe, Klotzstufe, massiveStufe mit rechteckigem Quer-schnitt, die massive Antrittstufeeiner Holztreppe (→ *Stufe). Engl. solid step; frz. marche massive, m.pleine; it. invito massiccio (di scala lignea);sp. peldaño macizo.
Blocktreppe → Treppe aus Block-stufen.
Blockverband, bei Backstein-mauern der in Deutschland nebendem Kreuzverband am meistenverbreitete Mauer-Verband. In denAnsichten wechseln Läufer- undBinderreihen schichtweise regel-mäßig ab. Die Stoßfugen jederzweiten Schicht liegen senkrechtübereinander. → *Mauerwerk. Engl. English bond; frz. appareil dit anglais,assemblage à blocs; it. concatenamento ablocco; sp. trabazón inglés, aparejo i. (sen-cillo, normal).
Blütenkapitell, → Blatt-Kapitell,dessen Kelch mit Blüten ge-schmückt ist. Engl. flower capitel; it. capitello a fiori;sp. capitel adornado con flores.
Bogen, die Überbrückung einerMaueröffnung mit gemauertenSteinen, I. Konstruktion: Alle na-türl. und künstl. Bausteine habeneine höhere Druckfestigkeit, abereine geringere Biegezugfestigkeit,weshalb die Spannweite beim Ar-chitravbau begrenzt ist. Die B.stei-ne dagegen sind zwischen zweiWiderlagern auch auf Druck bean-sprucht, weshalb größere Spann-weiten überbrückt werden kön-nen. Sämtl. auf diesem Prinzipberuhenden Konstruktionen sindechte B. wie z. B. der aus Keilstei-nen konstruierte → *scheitrechte
75 Bogen
Blockbau: Eckausbildung
Sturz. Der → unechte B. kann aucheine b.förmige Begrenzung haben,doch wird er nur durch vorkragen-de Steine mit parallelen Vertikal-fugen gebildet. Es gibt B. aus Keil-steinen mit gleicher Breite der Fu-gen und B. aus rechteckigen Steinen(Backstein) mit Keilfugen. Die Fu-gen müssen stets zum Krümmungs-mittelpunkt gerichtet sein. Der B.-druck auf das Widerlager ist dieResultierende aus dem senkrechtansetzenden Auflagerdruck unddem horizontal wirkenden B.schub,weshalb der Druck schräg nach au-ßen gerichtet ist. Der Unterbau mußaus diesem Grunde kontinuierl.nach unten verstärkt werden, fallsnicht der B. in einer breiterenMauer liegt. Umgekehrt kann derB.schub auch durch zwischen denWiderlagern angeordnete Zuganker(→ *Anker) aufgenommen werden.Die B.linie beginnt in den Kämpfer-punkten. Die Verbindung zwischenden Kämpferpunkten heißt Kämp-ferlinie, die bei gleich hoch liegen-den Kämpferpunkten die Spann-weite (B.weite, lichte Weite) ist. Derhöchste Punkt des B. ist der Schei-tel mit dem Schlußstein. Die B.höhe(Pfeil, Stich) ist der senkrechteAbstand zwischen Kämpferlinieund Scheitel, die dem Verlauf derB.achse entspricht. B.schenkel sinddie B.hälften zwischen Kämpferund Scheitel. Die Fläche zwischender B.linie und der Kämpferlinieist das B.feld, das auch geschlossenund verziert sein kann (→ *Tym-panon). Der erste Stein des B. heißtder B.anfänger, der oberste Stein imScheitel Schlußstein (analog: An-fangsfuge, Scheitelfuge). Die Innen-fläche des B. nennt man B.laibung,die obere (meist übermauerte)
Bogen 76
A = AuflagerdruckA1 = Auflagerdruck (A + L)K = KämpferdruckK1 = Kämpferdruck (A + S)L = AuflastS = SeitenschubZ = Zuganker (2 S)a, a1 = Auflager-Sohlenbreite
A = Anwölber, AnfangssteinH = Haupt, StirnL = LaibungR = RückenS = SchlußsteinW = Widerlagerb = Bogendicket = Bogentiefe
K = KämpferS = Scheitelk = Kämpferhöhep = Pfeil, Stichs = Steigungw = SpannweiteK�K = KämpferlinieK�S = Schenkelb = Bogenfeld
Bogen
Fläche B.rücken. Die B.laibung(B.tiefe) beginnt in Kämpferhöhe.Die vordere Ansichtsfläche des B.heißt B.haupt oder B.stirn, derenHöhe die B.dicke.II. Anwendung: Außer zur Über-spannung von Öffnungen dienenB. zur Entlastung nicht genügendtragfähiger Bauteile (Entlastungsb.),zur Vergrößerung der Standflächeauf schlechtem Baugrund (→ *Erd-bogen), zur Übertragung von Ho-rizontalschub (Schwibb.), zumÜberdecken, Gliedern und Unter-teilen von Innenräumen (Transver-salb.), zur Übertragung von Ge-wölbeschub (→ Strebeb.) und zurGliederung von Wandflächen(Wandb., Blendb.). Die übrigen B.(Schildb., Stirnb., Gratb., Gurtb.,Kreuzb., Diagonalb., Scheidb. u. a.)sind Bestandteile des Gewölbebaus(→ *Gewölbe). Zur formalen Aus-bildung des B. → *B.formen. Engl. arch,bow; frz. arc, courbe; it., sp. arco.
Bogenachsel → Bogenschenkel.
Bogenanfall, unterer Teil des Bo-genschenkels vom Kämpfer (Bo-genanfang) bis zu dem Bereich, indem die Keilsteine sich nur nochdurch die Keilform halten. Engl. spring line; frz. retombée de l�arc;it. reni; sp. arranque del arco.
Bogenanker, Anker zur Siche-rung gegen die Schubwirkungeines Bogens (→ *Anker 2). Frz. tirant d�arc; it. tirante (dell�arco); sp.anclaje, tirante del arco.
Bogenaustragung, Rippenbogen-austragung, Darstellungs- und Kon-struktionsverfahren für das Rippen-system eines Gewölbes, bei demman, im Gegensatz zur Orthogo-
nalprojektion, die Aufrisse allerRippenbogen unverkürzt in derZeichenebene erhält. It. rappresentazione dell�arco in vera forma;sp. plantilla de arco escala.
Bogenbinder, Binder des Bogen-dachs (→ Dachkonstruktion).
Bogenbrücke → *Brücke.
Bogendach, 1.Tonnendach, mitgekrümmtem Umriß (→ *Dach-formen). 2.→ *Dachkonstruktionüber Bogenbindern. Engl. 1. vaulted roof; frz. 1. comble à chev-rons recourbés, toit cintré; it. 1. tetto adarco, 2. tetto centinato; sp. techo arqueado.
Bogenfeld, das von einem Bogenund seiner Kämpferlinie umgrenz-te Feld (→ *Bogen I). Das B. überdem waagerechten Türsturz roman.und got. Kirchenportale wird auch→ *Tympanon genannt, ebenso dasB. an bogenförmigen Giebeln undBekrönungen von Tür- und Por-talumrahmungen der Renaissanceund des Barocks (→ *Lünette); bei-de sind meist mit figürl. Schmuckgefüllt. Ferner kann ein B. untereinem Entlastungsbogen über ei-ner Reihe kleinerer Bogenöffnun-gen auftreten, bes. an Fenstern,Emporen und Triforien der roman.und got. Baukunst. Schließlich kannauch ein Schildbogen (→ *Gewöl-be) unter einem Gewölbe ein B.bilden, wenn die Kämpferliniedurch ein Gesims betont ist. Engl. tympanum; frz. tympan, lunette; it. tim-pano; sp. tímpano.
Bogenfenster, eine → *Fenster-form mit Bogenabschluß. Engl. arched window; frz. fenêtre cintrée, f.arquée; it. finestra centinata; sp. ventanaarqueada.
77 Bogenfenster
Bogenformen, die meisten in derBaukunst angewandten B. sind ausdem Kreis entwickelt oder auch auszwei, drei oder mehreren Kreisbo-genstücken (Kreissegmenten) zu-sammengesetzt. Sie bleiben meistin der Ebene, können aber auch→ Raumbogen sein (Kurven höhe-rer Ordnungen). Die verschiede-nen B. entspringen zumeist forma-len Vorstellungen, doch folgtenbereits die Spitzbogen den kon-struktiven Anforderungen in ho-hem Maße. Dem stat. Kräftever-lauf entsprechen genau nur dieParabelbogen, aber die häufigste B.ist der Halbkreisbogen (Rund-bogen). Soll der Bogen höher alsein Rundbogen sein, so wird ergefußt oder gestelzt, d.h. die Bo-genkrümmung beginnt erst übereiner kurz fortgesetzten Vertikalen.
Gedrückt bzw. überhöht nenntman alle B., deren Stich geringerbzw. größer ist als die halbe Bogen-weite. Eine Sonderform des Rund-bogens ist der Hufeisenbogen, derunten eingezogen ist, da ihm derDreiviertelkreis zugrunde liegt,und der auch zugespitzt vorkom-men kann. Der Korbbogen ist el-lipsenähnl., aber aus Kreisbogen-stücken zusammengesetzt, dagegenentspricht der seltenere Ellipsen-
Bogenformen 78
Bogenformen
1 Parabelbogen2 Halbkreisbogen3 Gestelzter Rundbogen (Stelzbogen)4 Hufeisenbogen5 Korbbogen6 Flachbogen7 Gleichseitiger Spitzbogen8 Gedrückter Spitzbogen9 Überhöhter Spitzbogen,
Lanzettbogen10 Tudorbogen
bogen tatsächl. der Halbellipse.Der Segment-, Flach- oder Stich-bogen nähert sich in seinen Ex-tremen entweder dem Halbkreis-bogen oder dem → *scheitrechtenSturz. Die Bogenmittelpunkte desnormalen gleichseitigen Spitzbo-gens liegen in den Kämpferpunk-ten. Zwischen die Kämpferpunkterücken die Krümmungsmittelpunk-te beim gedrückten Spitzbogen,während sie beim überspitztenLanzettbogen hinaus rücken. DerTudorbogen ist ein flacher Spitz-bogen, der aus vier Kreisbögenzusammengesetzt ist. Der Klee-blatt- oder Dreipaßbogen setzt sichaus drei stark eingezogenen Kreis-bogen zusammen, deren mittlerergrößer oder auch gespitzt seinkann. Wird die Zahl der begleiten-den Kreisbogen erhöht, so entsteht
der Vielpaß-, Zacken- oder Fächer-bogen. Eine Abart des Kleeblatt-bogens ist der Schulter-, Konsol-oder Kragsturzbogen, bei dem dermittlere Kreisbogen durch einenwaagrechten Sturz ersetzt ist unddie beiden seitl. Kreisbogen meistauskragende Konsolsteine sind. Erist also kein echter Bogen (→ Bo-gen I). Die Konvexbogen bestehenaus konvexen und meist auch auskonkaven Bogenteilen. Der Vor-hang- oder Sternbogen ist dieUmkehrung des Kleeblattbogensund wird von konvexen Bogenli-nien begrenzt. Beim Karniesbogen(→ *Karnies) setzen sich die unte-ren konvexen Bogenteile nachoben konkav fort, während beimKiel- oder Sattelbogen, der auchEselsrücken genannt wird, diekonkaven Teile oben konvex fort-
79 Bogenformen
Bogenformen
11 Kleeblattbogen12 Zackenbogen13, 14 Schulterbogen15 Vorhangbogen16 Karniesbogen17 Kielbogen, Eselsrücken18 Schwanenhals, einhüftiger
Korbbogen
gesetzt werden. Die meisten B. tre-ten auch einhüftig oder steigendauf, d.h. die Kämpferpunkte einessolchen Bogens liegen verschiedenhoch. Bes. der steigende Korb-bogen ist häufig anzutreffen undheißt auch Schwanenhals. DieBogenläufe werden häufig an Stirnoder Laibung profiliert oder orna-mentiert und → *Archivolte oderFaszienbogen genannt.
Bogenfries, eine fortlaufende Rei-he von kleinen, der Wand vorge-blendeten Bogen, meist Rundbo-gen, die oft reich profiliert und aufKonsolen gesetzt sind. Der B. wirdhauptsächl. in der roman. Bau-kunst zum Schmuck des Außen-baus (bes. unter Dachgesimsen),aber auch als Wandgliederung imInnern verwendet. Ein der Giebel-linie folgender B. wird »steigenderB.« genannt. Eine bes. im Back-steinbau häufige Variante des B. istder Kreuzb., bei dem die einzelnenBogen einander überkreuzen undjeder eine Konsole überspringt(→ *Fries). Engl. arched frieze; frz. frange festonnée;it. fregio ad architetti; sp. friso arqueado.
Bogengang, auf einer Seite voneiner → *Arkade begrenzter Gang(→ *Laube). Engl. arcade; frz. passage à arcade, portiquevoûte; sp. corredor arqueado.
Bogengrab → Arcosolium.
Bogenhöhe, die Stich- oder Pfeil-höhe eines Bogens ist der senk-rechte Abstand zwischen Kämpfer-linie und Scheitel. Engl. rise of arch; frz. montée, flèche, hau-teur sous clef; it. freccia dell�arco; sp. eleva-ción del arco.
Bogenlauf → *Archivolte (2).
Bogenpfeil, der Abstand von derSehne (Kämpferlinie) des Bogensbis zum Scheitel. Engl. rise, camber (of arch); it. frecciadell�arco; sp. elevación del arco, flecha d. a.
Bogenportal, seit röm. Zeit übli-che Art einfacher Mauerdurchgän-ge. In roman. Zeit ist der Rund-bogen oder der Kleeblattbogen zufinden. Die Bogenstirn wie auchdas Gewände kann mit Reliefsgeschmückt sein, in der Renais-sance profiliert oder rustiziert. DieGotik setzt den Spitzbogen ein, dieSpätgotik den Eselsrücken, Kielbo-gen und Vorhangbogen, in Englandist der Tudorbogen und auch derSchulterbogen vertreten. Das Bo-genfeld kann durch eine Stein-platte (→ *Tympanon) geschlossensein, die im weiteren Verlauf mitReliefschmuck überzogen wird. Inder Gotik wird der Spitzbogen ver-wandt und das Tympanon in Zo-nen gegliedert oder durchfenstert.In der Renaissance und bes. imBarock kann das Bogenfeld alsOberlicht geöffnet und mit reichenSchmiedeeisengittern besetzt sein. Engl. arched portal; it. portale ad arco.
Bogenquaderung, 1. Durchfüh-rung des Fugenschnitts von Bo-gensteinen, wobei spitze Winkelmöglichst vermieden werden sol-len und ein gutes Einbinden derBogensteine in das übrige Mauer-werk gewährleistet werden soll. 2.Betont reliefartige Hervorhebungder Stirnfläche der einzelnen Bo-gensteine (Bosse, Rustika). Engl. rusticated arch; it. 1. sbozzatura, squa-dratura (dei cunei), 2. bugnatura (dell�arco);sp. 1. corte de juntas, 2. realce de las piedras.
Bogenfries 80
Bogenscharte, schmale hoheScharte für Bogenschützen. Frz. archère, meurtrière; sp. tronera paraarqueros.
Bogenschenkel, Bogenachsel,Halbbogen zwischen Kämpfer undScheitel.
Bogensteine, meist keilförmigzugehauene Steine (Keilsteine), ausdenen ein gemauerter → Bogen (I)besteht. Engl. arch stones, voussoirs; frz. claveaux,voussoirs; it. cunei; sp. piedra acuñada delarco.
Bogenstellung → *Arkade.
Bogenstirn → *Bogen.
Bogentiefe, Tiefe der Laibung ei-nes Bogens (→ *Bogen I).
Bogentür, eine Tür mit bogenför-migem Abschluß, → Bogenportal.
Bohle, Diele, Planke, durch grö-ßere Dicke (6�10 cm) tragfähigergestaltetes Brett. Engl. plank, deal; frz. madrier; it. tavolone,pancone; sp. madero, tablón.
Bohlenbalkendecke, Spunddecke,Riemchendecke, Raumüberdek-
kung, bei der breite Bohlen, die ingenutete Balken (Riemen) fassen,einander abwechseln; 14. Jh. bis ins18./19. Jh. üblich. Durch Abfasungund Profilierung sowie Schnitzereiund Malerei zu repräsentativer Wir-kung gesteigert.
Bohlendecke, leicht gewölbteoder flache Decke aus Bohlen, diemit Nut und Feder verbunden sindund an den Seitenwänden in dieNut einer Wandbohle eingreifen. Engl. plank ceiling; frz. plancher en ma-driers; it. solaio a tavoloni; sp. cielo detablones.
Bohlenwand, eine aus Bohlenbestehende Wand zwischen recht-winklig miteinander verbundenemFachwerkgerüst, d.h. → Schwelle,→ Ständer und → Rähm. Die Boh-len sind dicht aneinandergefügt, siebilden die Wandfüllung, seitl. inNuten der Ständer eingeschoben,bes. im süddt. Fachwerkbau des15. /16. Jhs. Engl. plank wall; frz. mur en madriers;it. parete a graticcio tamponata con assicel-le; sp. pared de tablones.
Böhmische Kappe, Böhm. Ge-wölbe, Platzelgewölbe, Stutzkup-pel, im Gegensatz zur Hänge-kuppel, bei der das Grundquadrat
81 Böhmische Kappe
Bogenquaderung
Hängekuppel Böhmische Kappe
des zu überwölbenden Raums demFußkreis einer → *Kuppel einbe-schrieben ist, versteht man untereiner B.K. ein Gewölbe über einerkleineren Fläche als dem Grund-quadrat. Engl. Bohemian vault; frz. calotte bohé-mienne, voûte bohémienne plate; it. volta avela a sesto ribassato; sp. bóveda tebajada debohemia.
Boiserie → Täfelwerk.
Bollwerk, eine mit Bohlen befe-stigte, zumeist runde Erdauf-schüttung als behelfsmäßiges, flan-kierendes, vor dem Hauptwallvorspringendes Verteidigungswerk,danach allgemein eine vorgescho-bene Verteidigungsanlage (→ *Bar-bakane, *Bastille, *Bastion). Engl., frz. bastion; it. bastione, baluardo;sp. bastión.
Bollwerkswinkel, der Winkelzwischen zwei Facen an der Basti-onspünte. Engl. salient angle, salient corner; sp. ángu-lo saliente.
Bonnet (frz.), Erdaufwurf auf Walloder Bastion einer Festung, auchkleines Außenwerk vor Bastions-oder Ravelinpünten. Engl., frz. bonnet; sp. bonete.
Bonnet à prêtre (frz.), → Pfaf-fenmütze, tenailliertes Außenwerkvon Festungen.
Börse, Handelshalle, Gebäude, indem sich Kaufleute regelmäßig zu-sammenfinden, um miteinanderoder durch Vermittlung von Mak-lern Handelsgeschäfte in Warenoder Wertpapieren abzuschließen.Schon in der Antike als Markt-
basilika am Forum, im 13. Jh. bes.in Flandern und Holland in großerForm entwickelt und dann über Eu-ropa verbreitet, unterschiedl. Bau-formen: Gebäude um einen Hof,große palastähnl. Bauten, bes. im19. Jh. Engl. Stock Exchange; frz. bourse; it. borsa;sp. bolsa.
Böschung, Dossierung, die Nei-gung einer Fläche zur Horizon-talebene, schräge Seitenwand einesWalls oder Grabens (→ Escarpe,→ Contrescarpe). Engl. slope, escarp; frz. talus, adossement,pente; it. pendio, scarpata; sp. talud, escarpa.
Boskett (frz., it.), an das → Bro-derieparterre anschließender Gar-tenteil, der aus streng beschnit-tenen, geometr. oder ornamentalangelegten Buchshecken besteht,in Sonderfällen auch als Irrgarten(→ Labyrinth, → *Garten). Engl. bosket; frz. bosquet; it. boschetto;sp. bosquete.
Bosse (mittelhochdt. bozen: schla-gen), 1. die nur roh zugerichtete,daher buckelige Vorderseite bzw.Ansichtsfläche eines Werksteinsoder Quaders (Buckelquader →
Boiserie 82
Bossen
Versatzbossen 1
2
Bossenquader). Die B. diente urspr.wohl dazu, das Abgleiten schwererSteine von den Hebetauen zu ver-hindern (Versatzb.), und kommtbereits in der antiken Mauertech-nik und an altamerikan. Bautenvor. Bes. häufig findet man B.mau-erwerk (B.werk) an Burgen derStauferzeit und an Palastbautender Frührenaissance (→ Rustika,→ *Mauerwerk). 2. Eine nur ange-legte, nicht vollendete Bildhauer-oder Steinmetzenarbeit, z. B. einKapitell, das in unfertigem Zu-stand versetzt wurde. Solche B.-Kapitelle finden sich, oft nebenfertigen, bes. an Bauten des MA. Engl. 1. boss; frz. 1. bosse, bossette; it. 1. bu-gna, 2. bozza; sp. realce rústico de una piedra.
Bossenkapitell → *Bosse (2).
Bossenmauerwerk, Bossenwerk→ *Bosse 1, → *Mauerwerk.
Bossenquader, Buckelquader, anseiner Vorderseite nur roh bear-beiteter Quader oder Werkstein(→ Bosse 1,→ *Mauerwerk). Engl. rusticated stone; frz. pierre rustique;it. bugna rustica; sp. piedra rústica.
Bossieren, einen Werkstein oderQuader an seiner Vorderseite mitdem Zweispitz, Spitzeisen o. ä.grob zuhauen, so daß eine erhabe-ne → *Bosse stehenbleibt, die dannweiter ausgearbeitet wird. Engl. rough-hew, boast; frz. bosser (la pierre);it. bugnare; sp. realzar una piedra.
Boudoir (frz.), ein kleines, derDame des Hauses vorbehaltenesZimmer mit Schreib-, Arbeits-und Sitzmöglichkeit, bes. im Ro-koko üblich. Frz., it. boudoir; sp. pequeño salón.
Bouleuterion → *Buleuterion.
Boulevard (frz.), urspr. das Boll-werk einer Festung, dann bes. inFrankreich gebräuchl. Bezeichnungfür breite Straßen in großen Städ-ten mit prachtvollen Wohn-, Ge-schäfts-, Restaurant- und Theater-bauten; die B. folgen häufig denWallinien der Stadtbefestigung, dienach dem Schleifen als breite Stra-ßen genutzt wurden. Engl., frz., it. boulevard; sp. bulevar.
Brandmauer, Feuermauer, gegenein angebautes Nachbarhaus ge-richtete, nicht durchbrochene Ab-schlußmauer eines Bauwerks, indie keine Holzteile einbinden dür-fen. Auch eine vom Keller bis überdie Dachhaut geführte Mauer in-nerhalb eines Gebäudes, das diesesin einzelne untereinander nur mitbesonderen Sicherheitsvorkehrun-gen verbundene Brandabschnitteunterteilt. Engl. fire wall; frz. mur coupe-feu, m. pare-feu; it. muro tagliafuoco, m. spartifuoco;sp. muro cortafuego.
Brauttür, an größeren ma. Kirchenmeist ein Seitenportal an der Nord-seite, vor dem der Priester dieEheschließung und den Ringwech-sel vornahm, ehe er das Brautpaarin die Kirche führte. Die B. istdaher gewöhnl. überdacht oder miteiner Vorhalle versehen und mitsymbol. Bogenfeld- oder Gewän-deplastik geschmückt. Frz. porte de mariage; it. porta della sposa;sp. porta del matrimonio.
Bresche, Öffnung des Walls oderder Befestigungsmauer durch Ka-nonade oder Minieren. Engl. breach; frz. brèche; it. breccia; sp. brecha.
83 Bresche
Brett, dünnes, breites Holz mitnur geringer Belastbarkeit, vor-nehml. für Verkleidungen verwen-det (→ Bohle). Engl. board; frz. planche; it. asse; sp. tabla.
Brille, Ravelin, dessen Facen vonzwei gestutzten Kontergarden ge-deckt werden; zwischen diesenund der Spitze des Ravelins befin-det sich gelegentl. zusätzl. einReduit (→ *Lünette).
Brisure (frz.), Bruch des Festungs-walls zum Zweck der Flankierung. Frz. brisure; sp. quiebre, articulación.
Broderieparterre (frz. broder: stik-ken), unmittelbar vor dem Schloßgelegener ebener Gartenteil, des-sen Teppichbeete durch geordneteBlumen, seltener Kieselsteine zwi-schen niedrigen Hecken (→ Bos-kett) wie eine Stickerei gemustertsind (→ *Garten). Engl. embroidery green; it. parterre; sp. par-que francés barroco.
Bruchfuge, 1. Fuge, die sich beider lagerhaften Schichtung derSteine, d.h. ihrer natürl. Lagerungentsprechend, ergibt. 2. Fuge, diesich bei zu starker Belastung einesBogens öffnet. Frz. joint de rupture; it. fessurazione dataglio; sp. junta abierta.
Bruchlinie → Dachbruch.
Bruchsteine, natürl. Steine, dieim Gegensatz zu den behauenenWerksteinen so verwendet werden,wie sie roh oder nur wenig bear-beitet aus dem Steinbruch kom-men (→ *Mauerwerk).Engl. quarry stone, rubble; frz. moellon,pierres brutes; it. pietra scapolo; sp. piedrade cantera, bruta y sin labrar.
Bruchsteinmauerwerk → *Mau-erwerk.
Brücke, Bauwerk zur Überleitungvon Verkehrswegen, Straßen (Via-dukt) oder Wasserleitungen (Aquä-dukt) über Geländeeinsenkungen,Gewässer oder andere Verkehrs-wege wie Straßen und Eisenbah-nen, aus Holz, Stein oder Holzund Stein, in neuerer Zeit auch ausStahl, Stahlbeton oder Spannbeton.Die Hauptbestandteile einer B.
Brett 84
Zugbrücke
Eiserne Fachwerk- und Gitterbrücken
sind Fundamente, Stützen, Trag-werk und Oberbau mit B.-Bahn,die in der Mitte meist leicht über-höht ist. Die frei stehenden Stüt-zen werden Pfeiler genannt, wobeiEnd- und Mittelpfeiler bzw. Land-und Flußpfeiler zu unterscheidensind; Bogenb. haben statt derLandpfeiler Widerlager (Land-festen). Die der Strömung zuge-
wandten Seiten der Flußpfeilerheißen Vorköpfe (Wellenbrecher).Holzpfeiler bestehen meist ganzoder im unteren Teil aus verbunde-nen Rammpfählen; hohe, gerüst-artig gezimmerte Pfeiler heißenGerüstpfeiler. Nach dem stat. Sy-stem des Tragwerks unterscheidetman Balkenb. mit balkenartigen(vollwandigen oder kastenartigen)
85 Brücke
Steinerne Bogenbrücke
a Landfeste c Überlaufb Pfeiler (Flußpfeiler) d Vorkopf (Wellenbrecher)
Hölzerne Dachbrücke
Brücke
Eiserne Hängebrücke (Beispiel: London, Albert Bridge)
Hauptträgern, Bogenb. mit bogen-förmigem Haupttragwerk, Hän-geb., deren Bahn unter Ketten- undDrahtseilbündeln usw. hängt, dieüber hohe Pfeiler (Pylone) gespanntund in Fundamenten verankertsind. Urspr. waren B. aus Holz, spä-ter auch aus Natur- und Backsteinund seit Ende des 18. Jhs. zuneh-mend aus Eisen und Beton. Stahlb.,meist aus Fachwerk- oder aus Git-terträgern, aber auch aus Vollwand-trägern konstruiert, können ebensowie die modernen Spannbetonb.größte Entfernungen überspannen.Außer diesen festen B. gibt es be-wegliche, wie Dreh-, Hub-, Zugb.,die auch bei hohem Wasserstandbzw. niedrigen Uferböschungenden Schiffen die Durchfahrt ermög-lichen, während Schiffs- oder Pon-tonb. als behelfsmäßige B. haupt-sächl. militär. Zwecken dienen. Engl. bridge; frz. pont; it. ponte; sp. puente.
Brückenkapelle, meist auf einemvorspringenden Mittelpfeiler stei-nerner Brücken errichtete Kapelle. Engl. bridge chapel; frz. chapelle de pont;it. cappella su ponte; sp. capilla de puente.
Brückenkopf, Schanze oder Be-festigungsanlage auf dem feindsei-tigen Ufer vor einem verteidigtenBrückenübergang; auch allgemeinfür Brückenende (→ *Stadtbefesti-gung).Engl. bridgehead; frz. tête de pont; it. testadi ponte; sp. cabeza de puente.
Brückenpfeiler → *Brücke.
Brückenplatte, Brückenklappe,Brückenbahn, Zugbrücke, die imgehobenen Zustand auch als Ver-schluß des Burg- oder Stadttorsdient. It. ponte levatoio; sp. puente levadizo.
Brückenturm, 1. zur Verteidi-gung einer Brücke errichteter Wehr-turm am Brückenkopf, auf derBrücke selbst oder an der Ring-mauer gelegen (Brückentorturm).Der B. auf einem verstärktenMittelpfeiler der Brücke ermög-
Brückenkapelle 86
Brückenkapelle
Brückenturm
lichte eine abschnittsweise Vertei-digung. 2. Pylon, die turmartigenPfeiler der Hängebrücke. Engl. 1. bridge tower; frz. 1. tour de pont;it. 1. torre del ponte, 2. pilone, pila; sp. 1.torre de puente, 2. pilón.
Brüdersaal, frateria, Fraternei, inZisterzienserklöstern ein im Ost-flügel des Kreuzgangs gelegenerRaum (auditorium iuxta capitu-lum) als Arbeitsraum und für dietägl. Arbeitsverteilung; nach derArbeit kehrte man in den B.
zurück, dort wurden auch dieArbeitsgeräte ausgegeben und auf-bewahrt. Später diente der B. auchals Studiensaal.
Brunnen, urspr. ist der Name B.(Bronnen, Born) und Quelle der-selbe Begriff, erst die neuere Sprach-bildung führt zur Trennung. In derAntike bezeichnet krenä jede Artvon Wasserentnahmestelle, diegefaßt ist und über, nahe oder ent-fernt einer Quelle liegt, unter-schieden vom Brunnen, der ins
87 Brunnen
rechts: ZiehbrunnenLaufbrunnen (Schalenbrunnen)Springbrunnen
links: Laufbrunnen mit got. Turmpyramide
Brunnen
Grundwasser eingetieft ist. B.kommen als Lauf-, Schöpf-, Zieh-oder Springb. vor. Die Grundformist der B.stock (B.pfosten) miteinem B.rohr, aus dem Wasser inden B.trog (B.becken, B.schale)fließt; bei öffentl. B. als Wandb.oder mit reicher architekton. unddekorativer Ausstattung als mehr-etagige Schalenb., architekton. Auf-bauten mit Figuren, bes. im Ba-rock; im Rokoko und Klassizismusauch als hohe Säulen oder Obelis-ke in der Trogmitte. In den Gärtenwurden Springb. und Kaskadenbevorzugt. Auch als Reinigungsb.im Vorhof einer → *Moschee. Engl. spring, well, fountain; frz. puits, fon-taine; it. pozzo, fontana; sp. pozo, fuente.
Brunnenhaus, rundes oder poly-gonales Gebäude über einem Brun-nen, bes. an Kreuzgängen in roman.und got. → *Klöstern. Engl. well house; frz. maisonnette de puits,lavoir; it. pozzo (all�interno del chiostro);sp. casete sobre un pozo.
Brustriegel, im Fachwerkbau Rie-gel in Brüstungshöhe, der bes. alsuntere Begrenzung eines Fenstersdient,→ *Fachwerkbau. Frz. pièce d�appui, entretoise; it. correntedel davanzale; sp. alféizar.
Brüstung, Parapet (frz.), waage-rechte brusthohe Sicherung vonFenster, Terrasse, Balkon aus Stein,Holz oder Eisen, entweder aus Plat-ten oder aus Pfosten mit eingestell-ten Platten, auch aus Mauerwerk,in der Gotik mit Maßwerk, imBarock als → *Balustrade, seitEnde des 17. Jhs. und im 18. Jh. alsschmiedeeiserne Konstruktion. Engl. parapet, shoulder; frz. parapet, épaule-ment; it. parapetto, sponda; sp. parapeto,baranda.
Brüstungsgesims → *Gesims, dasin der Höhe einer Brüstung (meistFensterbrüstung) verläuft. Engl. breast moulding; frz. tablette de fenê-tre; it. cornice marcadavanzale; sp. antepe-cho.
Brustwehr, geböschte Aufschüt-tung oder brusthohe Mauer mitSchießscharten oder → *Zinnenzum Schutz der Verteidiger, bes. alsoberer Abschluß einer Mauer oderWehrplatte, auch als niedriger Wallauf dem Hauptwall einer Festung. Engl. parapet, breastwork; frz. parapet; it. pa-rapetto; sp. parapeto.
Buckelquader, Buckelstein, Bos-senquader, Quader, dessen Vorder-seite nur roh behauen ist unddaher mehr oder weniger starkvorspringt. Um exaktes Versetzenzu ermöglichen, erhalten die B.meist einen schmalen Randschlagmit gerader Kante (→ *Mauer-werk). Engl. rusticated ashlar; frz. pierre rustique;it. bugna rustica; sp. piedra rústica protube-rante.
Bug, Bugband, ältere Bezeichnungfür → Büge. Engl. bow; frz. Kopfband: aisselier; it. picco-lo contraffisso; sp. pequeño contrafijo.
Büge, Bug, Strebe (Vollholz), dieden Balken verriegelt und denÜberhang gegen die Wand ab-stützt, → * Fachwerkbau. Engl. angle brace; frz. lien d�angle, moiseinclinée, bras force; it. contraffisso; sp. con-trafijo.
Bühne, 1. eine erhöhte Fläche, diein einen Raum hineinragt (Po-diumb.). 2. Im → Theater einRaum, der sich zum Zuschauer-
Brunnenhaus 88
raum öffnet. In der Antike wurdedie B. eine eigene Architekturformmit dreitoriger Bühnenrückwand(Skene), auch mit mehrgeschossi-gen Säulenstellungen, Nischen,Arkaden usw., bei den Römern alsStadttore oder Palastfassaden aus-gebildet. Diese Gliederungen wur-den in der Renaissance wieder auf-gegriffen. Sebastiano Serlio entwik-kelte 1508 die Winkelrahmenb.,aus einer breiten Vorder- und einernach hinten ansteigenden schmale-ren Bildb. bestehend, auf der zweimit bemalter Leinwand bespanntestumpfwinklige Winkelrahmenrechts und links und ein nachrückwärts anschließender perspek-tiv. bemalter Prospekt (Palastar-chitektur, Straßenbild) angebrachtwaren. Das elisabethan. Theater inEngland entwickelte dagegen ausder freien Podiumsb. die sog.Shakespeareb. mit Vorder-, Hinter-und Oberb. Auf dem Kontinentsetzte sich die nur von vorne ein-sehbare Guckkastenb. durch, Zu-schauer- und Bühnenhaus sindbaul. getrennt. Die Kulissenb. wur-de von Giovanni Battista Aleotti(Teatro Farnese 1618/19, Parma)eingeführt, seit 1647 sind dieKulissen verschiebbar. Seit Endedes 19. Jhs. gibt es die Drehbühne,bei der in den Bühnenboden einekreisförmige Fläche eingelassen ist,die sektorenartig mit den einzelnenSzenenbildern bebaut ist, die so zudem Zuschauerraum gedreht wer-den können; die Schiebeb. mitBühnenwagen (flache Podien aufRollen) und die Versenkb. sowieDoppelstockb. mit hydraul. bewegl.Bühnenboden. Häufig ist vor derGuckkastenb. eine Vorb. über demOrchestergraben angeordnet als
Erweiterung der B. in den Zu-schauerraum. 3. In Süddeutsch-land volkstüml. Bezeichnung fürden Dachraum (Dachboden) einesHauses. Engl. 1. scaffold, 2. stage; frz. 1. échafaud,plate-forme, 2. scène; it. 2. palcoscenico,proscenio; sp. 1. podio, 2. proscenio, esce-nario.
Bühnengasse, im antiken Theaterder vor der Szene gelegene seitl.Gang zwischen Bühne und halb-kreisförmig angeordneten Zuschau-errängen, als Zu- und Abgang zurSeite der Bühne benutzt. It. parodo; sp. pasillo entre escenario yespectadores.
Bühnenhaus, das die Bühne undAusstattungsräume aufnehmende,zumeist baul. gesondert gestalteteGebäude an einem Theater. Engl. stage house; it. torre scenica; sp. edifi-cio del escenario.
Bukranienfries → Bukranion,→ *Fries.
Bukranion (gr. Rindsschädel), Aas-kopf, dem Schädelskelett der Opfer-tiere nachgebildetes Schmuckmotivan hellenist. und röm. Altären,Grabmälern und Metopen, meistmit Blumen und Bändern verziert.Häufig sind mehrere solcherSchädel nebeneinandergereiht unddurch Girlanden verbunden odermit Rosetten in den Zwischen-räumen zu einem Fries vereinigt,dem Bukranienfries (→ *Fries).Das Motiv wurde in der Renais-sance wieder aufgenommen undauch im Barock noch gelegentl.verwendet. Frz. bucrâne; it. bucranio; sp. bucráneo.
89 Bukranion
Buleuterion, (gr. bouleuterion), dasRathaus der gr. Stadt, im Unter-schied zum Sitz der städt. Beamten(Prytaneion) der Ort für die Voll-versammlungen des Rats (Bulé),meist in der Nähe des Markts(Agora) gelegen. In hellenist. Zeitbestand das B. aus einem Vorhof,den man durch einen Torbau (Pro-pylon) betrat, und dem eigentl.Rathaus, das im Innern halbkreis-förmig ansteigende Sitzstufen wieim Theater (jedoch ohne Bühne),manchmal auch in U-förmiger An-ordnung, besaß. Im Äußern häufigdurch Halbsäulen oder Pfeiler ge-gliedert, hochliegende Fenster. Engl. bouleuterion; frz. bouleutérion; it. bu-leuterio; sp. ayuntamiento griego.
Bund, Verbindungsstelle zweieraufeinandertreffender Wände, z.B.Bundständer in der Hauswand, anden eine Innenwand anschließt.
Bundbalken, Binderbalken, Bund-tram, durchgehender Deckenbal-ken einer Dachbalkenlage, der mitden Sparren einen festen Verbandbildet, → *Fachwerkbau. Engl. top plate; frz. sablière d�étage, Ober-schwelle, Binderbalken: entrait de ferme; sp. vi-ga superior de unión.
Bündelpfeiler, ein Pfeiler, derrundum mit Dreiviertelsäulen vongrößerem und geringerem Durch-messer, sogenannte alte und jungeDienste, besetzt ist; in der Spät-romanik ausgeformt und in derGotik weit verbreitet; teilweise ist
Buleuterion 90
Buleuterion (Beispiel: Milet)A Propylon B Vorhof C Altar
Bündelpfeiler
der Pfeilerkern nicht mehr sicht-bar. Engl. compound pier, bundle pier; frz. pilieren faisceau; it. piliere; sp. pilar de nervios, p.en haz.
Bündelsäule, mehrere (selten drei,zumeist vier oder mehr) zusam-mengestellte Säulen anstelle einerSäule oder eines Pfeilers, auch Säu-lenbündel genannt, nicht jedochidentisch mit → *Bündelpfeiler. Engl. clustered column; frz. faisceau de co-lonnes; it. colonna a fascio (egitto); sp. atadode columnas.
Bundgespärre, Bundsparren, Bin-desparren einer → Dachkonstruk-tion, → Gebinde. Engl. roof truss, coupled rafters; frz. pairede chevrons; it. puntoni di capriata princi-pale composta; sp. armadura de techo.
Bundsäule, 1. fälschl. Bezeich-nung für → Stuhlsäule. 2. Einemittels eines → *Schaftrings mitder Rückwand verbundene Säule. Engl. stud; frz. colonne annelée, c. bandée;it. colonna cerchiata; sp. columna anillada.
Bundschwelle → Schwelle.
Bundständer, Eckpfosten, Ständerin der Fachwerkwand, an den einesenkrecht abgehende Wand (innereScheidewand) anschließt. → *Fach-werkbau. Frz. poteau principal; sp. montante princi-pal.
Bundtram → Bundbalken.
Bundwand, aussteifende und zo-nenbildende Innenwand. Engl. partition; frz. clayonnage, cloison,paroi de charpente; it. tramezzo di irrigidi-mento (in costruzioni a graticcio); sp. tabi-que.
Bundwerk, Ständer-Riegel-Gerüstmit Bretterhinterschalung.
Bungalow (engl. aus hindustan.),leichtes, eingeschossiges Sommer-haus, mit Veranda (urspr. für diebrit. Verwaltungsbeamten in Asien),heute allgemein ein eingeschossi-ges Einfamilienhaus mit Flachdachoder ausgebautem Dachgeschoß. Engl., frz., it., sp. bungalow.
Bunker, betonierter Schutzraumund Kampfstand des 20. Jhs., häu-fig in die Erde eingetieft und auchvon Erde überdeckt. Engl., frz., it., sp. bunker.
Burg, Feste, ein bewohnbarerWehrbau, den eine Person oder ei-ne Gemeinschaft zu ihrem Schutzals ständigen oder zeitweiligenWohnsitz errichtet. Hervorgegan-gen ist sie in Nord- und Osteuropaaus der nur in Notzeiten aufge-suchten, dem Gelände angepaßtenvor- und frühgeschichtl. Flucht-burg und dem mehr oder wenigergeschützten fränk. Herrenhof, inSüd- und Westeuropa, bes. inGallien, Italien und Spanien, ausdem regelmäßigen, von Türmenflankierten röm. Kastell. Für dieeurop. B. lassen sich allgemeineGrundformen erkennen. Nach derLage werden unterschieden: dieHöhenb. auf schwer zugängl. Berg-gipfel mit Rundsicht, als Gipfelb.,Kammb., Spornb. oder Hangb.,und die Niederungsb., zumeist mitWasser umgeben, als Wasserb. oderTurmhügelb. (Motte). Hinsichtl. ih-rer Bauherren unterscheiden sichdie Volks- und die Fluchtb., → *Pfalzund Reichsb., Fürstenb., Grafenb.,Hochadels-(Ritter-), Ministerialen-
91 Burg
oder Dienstmannenb., → *Or-densb., Stadtb. und Kirchenb.Nach der Form gliedern sich die B.in: a) Zentralanlagen: Turmhü-gelb., Hausberg oder Motte; Ring-,Randhaus oder Gadenb. ohneTurm, mit Mittelturm, mit radia-lem Turm, mit mehreren Türmen;Turmb.; quadrat. B. und regelmä-ßig mehreckige Anlagen. b) Axialb.rechteckig mit Zentralturm oderFrontturm, mehreckig mit Front-oder mehreren Türmen; ovale B.mit Mittelturm, mehreren Tür-men oder auch ohne Turm; Schild-mauerb. ohne und mit Frontturmoder zwei flankierenden Front-türmen; keilförmige, mehrgliedri-ge B. als Abschnittsb. Die Ring-mauer, auch Zingel und bei bes.Höhe Mantel genannt, umschließtden B.bering. Ihr vorgelagert istein Wasser- oder Trockengraben.Bei Höhenb. trennt der bes. tiefeund breite Halsgraben die B. vomanschließenden Bergrücken. Zwi-
schen Mauer und Graben kann einAbsatz, die Berme, die Verteidi-gungszone verbreitern. Dem inne-ren Bering vorgelagerte Mauernbilden einen eingeebneten Zwi-schenraum, den Zwinger. Aus derFlucht der Ring- und Zwinger-mauer vorspringende rechteckigeoder runde Türme ermöglicheneine seitl. Bestreichung. Sie sindhäufig zur Innenseite offen (Scha-lentürme). Auf der Mauerkronedient ein → *Wehrgang (Letzte,Rondengang oder Mordgang) mitBrustwehr zum Schutz der Ver-teidiger. Die Brustwehr hat ent-weder → *Schießscharten oder be-steht aus wechselnd rechteckigennicht überdeckten Maueröffnungen(Zinnenfenster, Zinnenscharte)und geschlossenen Mauerstücken(→ *Zinne). Auf den Ecken derRingmauer werden kleine vorge-kragte Türmchen aufgesetzt (Schar-wachtturm, Hochwacht, Pfeffer-büchse, Tourelle). In der Ring-
Burg 92
1 Vorburg2 Halsgraben3 Wehrturm4 Ringmauer (Bering)5 Schildmauer
Höhenburg
mauer und in den Türmen sindSchießscharten so angebracht, daßdas Angriffsfeld von Pfeil- oderArmbrustschützen beherrscht wird.Um das Schießen mit der Arm-brust und später mit Handfeu-erwaffen in einem möglichst gro-ßen Winkel nach den Seiten undnach unten zu gestatten, sind dieschlitzartigen Schießscharten nachinnen oder außen (Schartenmaul)auf beiden Seiten, häufig auchnach unten, erweitert. Über Toren,Eingängen und an Türmen findensich Pechnasen oder Gußerker,kleine auf Kragsteinen oder Konso-len ruhende Erker, die nach untenoffen sind und nach vorne häufigein Spähloch haben. Sie dienen zumHinabschütten von heißem Wasser,Öl oder Pech. Mit den Pechnasenhäufig verwechselt, befinden sichin der Ringmauer über dem
Graben oder am → *BergfriedAborterker (→ *Abtritt). Das Burg-tor wird zunächst als ein einfacherTorbogen mit eisenbeschlagenenHolzflügeln, eingeschlagener Zug-brücke oder Fallgatter gestaltet.Häufiger sind gewölbte Torwege,auch Torhallen. Reichere fortifika-tor. Gestaltung erfährt das Tordann als Zwingertor und als Tor-burg mit flankierenden Türmen.Schließl. bildet sich ein System vonhintereinanderliegenden Torbefesti-gungen und halbkreisförmiger, mitSchießscharten versehener Vormau-er (→ *Barbakane) heraus, die seitdem 15. Jh. vergrößert und mit Tür-men versehen wird (→ *Bastille).Im Belagerungsfall kann ein ver-steckter Ausgang in der Ringmaueroder auch ein kurzer Gang durchMauerdicke und Wall (→ Poterne)für den Ausfall benutzt werden.
93 Burg
Wasserburg (Beispiel: Sully, Loire, 14.�15. Jh.)
Erfordert die Lage der B. einen bes.Schutz auf einer Seite, so wird dortdie Ringmauer dicker und höherausgebaut als Schildmauer, diegleichzeitig die Aufgabe des Berg-frieds übernehmen kann oder auchmit einem Bergfried verbunden ist,der hinter ihr stehen, in sie einge-baut oder seitl. angebaut sein kann.Turmartig vorkragende Ausbauten(Scharwachtturm) können an bei-den Enden der Mauer einen Ab-schluß bilden. Zumeist frei imBurghof, in seiner Mitte oderNähe der angriffsgefährdeten Seitesteht der → *Bergfried, der Haupt-turm der B., der bes. in frz. undengl. B. als mächtiger Wohnturmausgebildet sein kann (→ *Donjon,Keep). Entlang der Ringmauer, mitdieser verbunden oder innen freivorgestellt, nehmen → *Palas und→ Kemenate eine Seite des Burg-hofs ein, häufig mit der → Burg-
kapelle verbunden, die aber auch ineinen Bau eingefügt sein oder freiim Hof stehen kann. Die Nutz-bauten für Gesinde, Wirtschaft undVieh sowie die Küche mit großemKamin, häufig als Fachwerkbauten,sind zumeist an die geschlosseneRingmauer angelehnt, oder siebefinden sich in der Vorburg.Wichtig für jede Höhenb. ist der→ *Brunnen. Bei zu großer Höheoder ungeeigneten Bodenverhält-nissen genügt eine Zisterne, einzumeist unterird. Raum zum Sam-meln von Regenwasser. Engl. castle, bastile, bastille; frz. château,bastille; it. rocca, castello fortificato; sp. cas-tillo fortificado.
Bürgerbauten sind außer denWohnhäusern der Handwerker undder Bürger (→ *Bürgerhaus) vor al-lem die den Gemeinschaftsaufga-ben dienenden öffentl. Gebäude der
Bürgerbauten 94
Bürgerbauten (Beispiel: Köln, Gürzenich, 15. Jh.)
Bürger einer Stadt, wie → *Rathaus,Münze, Zeughaus, Gewandhaus,Schranne, Kornhaus, Bauhof, Spi-tal, Kaufhaus, Ballhaus, Hochzeits-haus, Schauspielhaus u. dergl. Auchdie von den einzelnen Zünftenerrichteten Zunfthäuser gehörenin diese Reihe, ebenso die → *Spei-cher. Engl. civic buildings; it. edifici pubblici;sp. edificios públicos.
Bürgerhaus, Werkstatt-, Wohn-und Geschäftshaus eines Bürgers,in der Regel vom Eigentümer be-wohnt; erst bei der Ausdehnungder Städte, bedingt durch die in-dustrielle Revolution im 19. Jh.,setzt sich das bürgerl. Mietshausdurch. Das B. ist im MA. zumeistvom Kirchenbau sowie vom Pfal-zen- und Burgenbau abhängig unddiesem künstler. untergeordnet. Inder Renaissance und im Barocknimmt das B. eine dem Sakralbauebenbürtige, ja teilweise überlege-ne Stellung ein. Das B. ist nichttypolog., sondern nur soziolog. zubestimmen; die Haustypen undBauformen sind von dem Baupro-gramm, der sozialen Stellung desBauherrn und regionalen Eigen-heiten beeinflußt, das betrifft auchdas Baumaterial Stein, Backstein,Fachwerk oder Blockbau. Das B.hat sich im 12. Jh. aus dem → Bau-ernhaus und aus dem feudalenWohn- und Repräsentationsbau(Wohnturm, Burg, Pfalz) entwik-kelt. Das B. dient dem Bewohnerim Erdgeschoß als Werkstatt, La-den oder Kontor, im Obergeschoßals Wohnbereich und im Dach alsLagerraum; Hintergebäude, dieauch winklig bzw. mit einer Ga-lerie um einen Hof angeordnet
sein können (Süddeutschland,Auvergne, Bretagne), vergrößernnotwendige Flächen. Seit dem spä-ten MA. wohnen in den Neben-und Hintergebäuden außer denFamilienangehörigen des Besitzersauch sog. Inwohner oder Mieter.Außerdem gab es Seelhäuser seitdem 13. Jh. als Vorgänger des neu-zeitl. Miethauses (Köln, Nürnberg,Gent). Das Ackerb. stellt eineKombination zwischen dem jewei-ligen landesüblichen Bauernhausund dem städt. B. dar und dientdem landwirtschaftl. Nebener-werb, ebenso das B. des Winzersmit den erforderl. Nebenräumenund Kellern. Übermächtiges Vor-kragen der Obergeschosse (Über-hang), aufwendige Gestaltungder Erker und den Verkehr behin-derndes Vorstehen von Beischlagund Kellerhalsüberbau wurdendurch Bauordnungen ebenso ein-gedämmt wie die Brandgefahrdurch Ausbau in Stein und Er-setzen der Schindel-, Stroh- undRieddeckung durch Ziegel- undSchieferdeckung. Immer ist einBemühen um Repräsentation zubeobachten. So wird das urspr.traufenständige Haus, bei denschmalen tiefen Bauparzellen nichtnur wegen der einfacheren Balken-überdeckung durch das giebelstän-dige Haus ersetzt, sondern auchwegen der Möglichkeit, den Giebelals hohen Blendgiebel reich gestal-ten zu können. Im 12. Jh. ver-schmelzen die überkommenen feu-dalen Bautypen wie das Turmhaus(arx) auf längsrechteckigem Grund-riß und abschließendem Zinnen-kranz und der drei Geschosse hoheWohnturm (turris) auf annäherndquadrat. Grundriß mit dem Immu-
95 Bürgerhaus
nitätsbau (Kanonikerhäuser, Bi-schofspfalzen), bei dem der längs-rechteckige Baukörper durch eineLängsmauer in zwei unterschiedl.breite Hausteile gegliedert wird(Rheinland, England), hinzu kom-men Arkadenreihen, die vomPfalzen- und Burgenbau übernom-men, aber in Reihung und Wand-bezug geändert werden, und im 13.Jh. Stockgesimse und gestufteBlendgiebel. Die Kombination vonEingang und durch Bogen geöffne-ten Laden-Werkstatt-Raum sowieein in Arkaden geöffnetes Wohn-geschoß darüber ist im späten 12.Jh. ausgebildet (Deutschland, Bur-gund). Die frühesten Fachwerk-häuser haben sich in Deutschlandaus der Mitte des 13. Jhs., in Eng-land und Frankreich erst aus dem
15. Jh. erhalten. Der → *Fachwerk-bau des 14. /15. Jhs. ist in seinerKonstruktion landschaftl. verschie-den, in der räuml. Organisationden Steinhäusern ähnl. Das oberdt.B. in Süd- und Mitteldeutschlandist gekennzeichnet durch eine kon-struktive Teilung in mehrere Räu-me neben- und übereinander. Dasniederdt. B. entwickelte sich ausdem nordwesteurop. Hallenhaus,eine weiträumige Halle (Diele) botRaum für die einzige Feuerstelle,seit dem 15. Jh. baute man an derStraße ein oder zwei Stuben ein,und wegen der hohen Diele konn-ten zusätzl. Hängekammern an denDeckenbalken angebracht werden,dazu → *Beischlag und → *Aus-lucht. In England war das mehrstök-kige Holzhaus üblich. Der Reich-
Bürgerhaus 96
1 Giebelhäuser (niederdt. Typ) 2 Traufenhäuser (oberdt. Typ) 3 Oberdt. Hofhaus
4 Nordwesteuropäisches Hallenhaus(a Diele b Stube c Küche d Kammer e Stall)
Bürgerhaus
tum führte seit dem 15. Jh. zu mehrWohnkomfort und zu reichererFassadengestaltung, die Wohnräu-me wurden vermehrt und beheiz-bar, die Betten standen in → Alko-ven. Vom 15. Jh. bis zum Ende des18. Jhs. wurden die B. oft umge-baut, aufgestockt und erneuert,jedoch behielten sie infolge derengen Bauparzellen in der Stadtihren urspr. Reihenhauscharakterbei; nur die Fassadengestaltungänderte sich entsprechend der Ent-wicklung der Bauformen. Erst im19. Jh. war im Zuge der Entfesti-gung der Städte eine freiere Ent-faltung des Grund- und Aufrissesmöglich. Es entstand die Villa, bes.in den Vorstädten, die in Raumpro-gramm und Gestaltung nicht mehrlandschaftl. gebunden war. Fernersetzte sich im 19. /20. Jh. das städt.→ Miethaus durch als steinernesTraufenhaus mit gleichen Geschoß-höhen und zahlreichen Wohnun-gen auch in Hintergebäuden.
Burgkapelle, privater Andachts-raum einer Burg als selbständigerBaukörper errichtete oder übereinem Burgtor, im Palas, seltenerin einem Bergfried eingebaute Ka-pelle, die häufig mit ihrem Chor-abschluß als Erker (»Chörlein«)über das Mauerwerk vorspringt.Auch zweigeschossige B. kommenmanchmal vor (→ *Doppelkapelle).Engl. fortress chapel, castle c.; it. cappelladel castello; sp. capilla del castillo.
Burgstadt, eine neben einer Burggegründete oder entwickelte Stadt,wirtschaftl. und auch teilweiserechtl. vom Burgherrn abhängig. Engl. fortress town, castle t.; sp. ciudadjunto a un castillo.
Burgsitz, eine kleine Burg desniederen Adels.
Burgstall, ehemaliger Standorteiner verschwundenen Burg.
Burgtor, Zugang zu einer Burg,vielfach ein nahezu selbständigesGebäude mit Tor, Fallgatter undüberwölbtem Torweg. Engl. fortress gate, castle g.; it. porta delcastello; sp. portón del castillo.
Burgus (lat.), von einer kleinenTruppe besetzte Warte an Straßenund Landwehren, meist in der Arteines quadrat., von Wall und Gra-ben umgebenen Wehrturms, vor-rangig in der röm. Provinz, seit derMitte des 2. Jhs. n. Chr. angelegt. Engl. fortress, suburbium; it., sp. burgus.
Burgwarte, Wartturm, ein in derVerteidigungsanlage einer ma. Burgstehender Turm, danach auch häu-fig Bezeichnung für einen vorge-schobenen, meist hochgelegenenWartturm einer ma. Stadt, von demaus die Bewegungen herannahen-der Feinde frühzeitig erkannt wer-den konnten. Engl. watchtower; it. torre di guardia (delcastello); sp. torre de guardia del castillo.
Bürohaus, Bürobauten, Verwal-tungsbau, Verwaltungsgebäude, Ge-bäude für Planung, Veranlassungund Sicherung von Prozeßabläufenin Wirtschaft und Gesellschaft.Grundmaß der räuml. Organisationeines B. ist der Arbeitsplatz mitSchreibtisch, er bestimmt die Ge-bäudestruktur und dadurch weitge-hend die architekton. Erscheinung(Abstand der Fenster, Raumtiefe,Raumhöhe). Die Erschließung derBüroräume erfolgt mit Seitenfluroder mit Mittelflur; durch die
97 Bürohaus
Einrichtung von Großraumbüroskönnen abgetrennte Flure entfal-len. Je nach Organisation, Nutzungund Gebäudegröße sind Aufzüge,künstl. Beleuchtung und Klimati-sierung notwendig; flexible Raum-aufteilung durch versetzbare Zwi-schenwände in Skelettkonstruk-tion, seit den 1960er Jahren auchGroßraumbüros mit freier Vertei-lung der Arbeitsplätze, größere An-passungsfähigkeit an veränderteGruppenbildungen, leichterer Kom-munikationsfluß. Zur Minderungder Grundstückskosten in denStadtzentren, zur Verkürzung derVerkehrswege und aus Repräsen-tationsgründen seit 1925 Entwick-lung zum → Hochhaus, das nach1945 international übliche Bau-form für B. B. wurden zuerst fürdie öffentl. Verwaltung gebaut;bereits in der Antike kannte manspezielle B. (→ Tabularium). Mitden Territorialfürsten entstandenim 16. /17. Jh. Staatskanzleien, Ka-meralämter und Prokuratien, zu-vor waren in den Rathäusern Amts-stuben untergebracht. Mit demweiteren Ausbau der staatl. Ver-waltung entstanden im 19. Jh. spe-zielle Ministerien, die bis 1914 alsrepräsentative monumentale Bau-aufgaben aufgefaßt wurden, da-nach im öffentl.-staatl. wie im pri-vaten Bereich Annäherung derGestaltung. Das private B. entstanddurch die Auflösung der Einheitvon Wohnung, Büro, Werkstatt undWarenlager im Laufe des 17. /18.Jhs. und führte zu dem mit Büro-räumen und Repräsentationsteil mitEmpfangsräumen, Sitzungssälen u.Gastronomie, später Sozialräume. Engl. office building; frz. immeuble de bu-reaux; it. edificio per uffici; sp. edificio paraoficinas.
Burse, das gemeinschaftl. Wohn-haus für Studenten in ma. undfrühneuzeitl. Universitätsstädten,zumeist bestehend aus Aufent-halts- und Wirtschaftsräumen,Bibliothek und Lehrraum (Hör-saal) sowie Schlafräumen.
Bußkapelle, kleine, meist recht-eckige Kapelle an der O-Seite desQuerschiffs (Querhauskapelle) oderChors einer Zisterzienserkirche,bestimmt für die Bußübungen derMönche. Engl. Magdalen Chapel; frz. chapelle expia-toire; it. cappella penitenziale; sp. capilla depenitencia.
Bußzelle, Büßerzelle, in Klösterneiner Kammer für die Bußübun-gen der Mönche, selten einwand-frei bestimmbar. It. cella penitenziale; sp. celda de penitecia.
Busung (gebust, busig), sphäri-sche Ausbauchung des Gewölbes(→ *Gewölbeformen), bes. dieÜberhöhung der Gewölbekappendes Kreuzgewölbes, so daß derSchnittpunkt der Kappen höher alsder Scheitelpunkt der Gurt- undSchildbogen liegt. Die Busung derGewölbekappen vermehrt die Ver-spannung des Gewölbes. B. ist zuunterscheiden vom → Stich. Frz. concavité, convexité; it. rialzo; sp. abol-samiento de la bóveda.
Butterfaß(turm), ein Rundturm,meist ein Bergfried, dessen untererTeil einen wesentl. größeren Um-fang hat als der obere.
Butzenscheiben, kleine, runde,meist grünl. Glasscheiben mit ein-seitiger Verdickung in der Mitte(Butze), mit Bleistegen im Profan-
Burse 98
bau zu Fensterscheiben verbunden(15./16. Jh.) und in ma. Wiederauf-nahme im 19. /20. Jh. Engl. glass roundel, bull�s-eye glass; frz. rondde verre; it. fondi di bottiglia; sp. cristalabombado y emplomado.
Byzantinische Kuppel, geschlos-sene Kugelkuppel oder Kalotte überabgekappter Hängekuppel bzw. fla-chen Pendentifs. Engl. Byzantine dome; frz. coupole byzan-tine; it. cupola bizantina; sp. cúpula bizantina.
C
C siehe auch unter »K« oder »Z«.
Cabane (frz.), kleines Bauern-haus, bes. als Nachbau in Park-anlagen als Pavillon dienend.
Cabinet (frz.) → Kabinett.
Caementitium (lat. Bruchstein)→ Opus.
Cairn, Carn, (gäl.-ir.), frühge-schichtl. Grabmal in Form einespyramidenförmig aufgeschichtetenSteinhaufens, bes. in England undIrland; dort auch Bezeichnung fürebenso gebildete Grenzmäler undWegzeichen.
Caldarium (lat. caldus: warm),Heißbaderaum der röm. → *Ther-men. Auch wird gelegentl. ein war-mes → Gewächshaus so genannt. Frz. caldarium; it., sp. calidario.
Calefactorium (lat. calefacere: er-wärmen), Wärmestuben in ma. Klö-stern, hauptsächl. in Zisterzienser-
klöstern, meist im Nord- bzw.Südflügel der Klausur in der Nähedes Refektoriums und der Küchegelegen und vielfach der einzigeheizbare Raum des Klosters. Erwär-mung durch Luftheizung, im Erd-geschoß unter dem C. eine Heiz-kammer, von deren erhitzten Wän-den die Warmluft durch Kanäle imGewölbe nach oben steigt.
Camarin (span.), kleine Kapelle hinter oder über dem Hochaltarspan. Kirchen, abgeleitet von demdort aufgestellten Heiligenschreinbzw. Reliquienaltar. Engl. camarín; frz., it., sp. camarín.
Campanile → *Kampanile.
Campo Santo (it. heiliges Feld),Friedhof, bes. wenn es sich wie inItalien um eine Anlage von regel-
99 Campo Santo
Calefactorium
mäßigem Grundriß handelt, die vonArkaden umgeben sein kann, meistjedoch nur von mächtigen Mauernfür Wandbestattungen umschlossenist.
Camp retranché (frz.), ein ver-schanztes Truppenlager der frühenNeuzeit. Frz. camp retranché; it. campo trincerato;sp. campo atrincherado.
Canabae (lat. canaba: Baracke),nichtmilitär. Siedlung außerhalbeines röm. → *Castrums oder Mi-litärlagers, die kein Stadtrechthatte; häufig entlang einer Straßeangelegt, aber auch wenig regelmä-ßige Anhäufung von Wohn-, Hand-werks- und Wirtschaftsbauten.
Cancelli (it.), Kanzellen (eigentl.Gitterstab), in Gerichtszimmernund altchristl. Kirchen die Schran-ke, die den für das Publikum bzw.die Laien bestimmten Raum vonder Tribüne bzw. dem Chor (Sank-tuarium) abtrennt (→ *Chorschran-ken), meist aus Stein in durchbro-chener Arbeit. Aus der im 13. Jh.erfolgten Verbindung mit demLesepult (lectorium) entstand der→ *Lettner und aus der Bezeich-nung C. der Name → *Kanzel. Seitder Renaissance wurden die C.und Lettner durch → *Chorgitteraus Eisen oder Messing verdrängt. Engl. cancelli; sp. rejas de altar.
Capilla Mayor (span. Hauptka-pelle), in größeren span. Kirchen derAltarraum im mittleren Teil desChors, vom Chorumgang und demGemeinderaum durch hohe stei-nerne Schranken (→ *Chorschran-ken) getrennt, die meist mit rei-chem plast. Schmuck oder durchPrachtgitter ausgestattet sind.
Capitallinie, die Strecke zwischenBastionspünte und Spitze des Poly-gonwinkels einer → *Festung. Engl. capital; frz. ligne capitale, capitale;sp. línea capital.
Capitolium (lat.), bei den Rö-mern dasselbe, was bei denGriechen Akropolis ist, d.h. Burgund Regierungssitz.
Caponniere (frz.), Kaponniere,Grabenwehr, Koffer, Streichwehr,halb in die Erde eingegrabenes,überdecktes, mit Schießschartenversehenes kleines Werk quer imGraben (volle oder ganze C.) oderan dessen Böschung (Contre-Escarpe-C.) einer Festung, als ge-deckter Gang zur Grabenbestrei-chung.
Carcer (lat.), eigentl. Gefängnis,Käfig für Tiere; im Klosterbau undin Schulen und Universitäten alsArrestlokal, angelegt nach den all-gemeinen Grundsätzen für Ge-fängnisse.
Cardo (lat. Scheidelinie), eineder beiden Hauptachsen des röm.→ *Castrums und röm. Stadtanla-gen, in der Regel nord-südl. ver-laufend (senkrecht dazu → Decu-manus → *Stadtbaukunst).
Carnot-Mauer, freistehende→ Escarpe mit rückwärtigen Ni-schenbogen.
Cascane (frz.), Gewölbe in einemWall oder in einer Bastion imFestungsbau.
Castellum (lat.), kleines röm.Standlager als Garnisonsplatz füreine kleinere Abteilung → *Kastell.
Camp retranché 100
Castrum (lat., meist in der Mz.castra: befestigter Platz, Lager),Standlager röm. Truppen, recht-eckig, mit abgerundeten Ecken,umgeben von Graben, Wall, Pali-saden, einer Mauer mit Türmenund durch die parallel zu denHauptachsen (Cardo, Decumanus)verlaufenden Lagergassen schach-brettartig unterteilt. In der Mittedas Praetorium als Haus des Kom-mandanten, vor diesem im Zug derMauer die Porta Praetoria. DieQuerachse führt von der PortaDextra am Praetorium vorbei zurPorta Sinistra. An der vierten Seiteliegt die Porta Decumana. WeitereGebäude des C. sind das Zeughaus(Armamentarium), das Magazin(Horreum), das Lazarett (Valetu-dinarium) und die Kasernen.
Cavaedium (lat.), allgemeine Be-zeichnung für den Hof eines anti-ken Hauses, sei er als → *Atriumoder → Peristyl gestaltet.
Cavate, Cavete, Kafehte (lat. cava-ta: Höhle), im MA. erhöhter Platzhinter dem Ofen (Hölle), auchtiefe Fensternische in dicken Mau-ern, schließl. auch kleines Gemach,namentl. das kleine Gemach derBurgfrau.
Cavea (lat.), jeder hohle Raum,bes. in den Amphitheatern dertrichterförmige Zuschauerraum,auch bei Theatern mit ansteigen-den Zuschauersitzen.
Cella (lat. Kammer, Zelle), das vonMauern umschlossene Gehäuse imantiken → *Tempelbau mit demGötterbild, bei den Griechen → Na-os, bei den Ägyptern Sekos (→ Bar-kenkammer) genannt. Die C. warfensterlos und empfing ihr Lichtvom Eingang, den man über eineVorhalle (Pronaos) betrat. Bei grö-ßeren Tempeln kann die C. durchSäulenstellungen in mehrere, mei-stens drei Schiffe geteilt sein. Imdor. Tempel waren diese Säulen inder Regel in zwei Geschossen über-einander angeordnet, so daß in denSeitenschiffen Galerien (Hyperoa)angebracht werden konnten. Ander Rückwand der C. war beifrühgr. Tempeln, bes. auf Sizilien,ein kleiner Raum für das Kultbildabgeteilt (→ *Adyton), während derHauptraum für einen Teil des Kultsund bes. zur Aufnahme von Weih-geschenken diente. Bei den großen→ *Hypäthraltempeln war die C.nicht überdeckt, sondern wie einInnenhof ausgebildet. In diesemstand frei das Adyton, selbst in derGestalt eines Tempels. Vor der C.befand sich eine Vorhalle (→ Pro-naos), hinter der C. oft eine Hinter-halle (→ Opisthodomos).
101 Cella
Castrum (Beispiel: Saalburg, Hessen)1 Prätorium2 Porta3 Porta Prätoria
Cellarium (lat.), in ma. Klösternder Speicherraum, häufig kellerar-tig eingetieft im westl. Klausur-flügel gelegen.
Cella trichora → *Dreikonchen-anlage.
Celosia (span.), Fensterabschlußaus durchbrochenem Holz, Steinoder Stuck unter islam. Einfluß inSpanien (→ *Transenna).
Cenaculum, Coenaculum (lat.),Speisezimmer des röm. Wohnhau-ses.
Certosa (it.), Bezeichnung fürein Kloster des Kartäuserordens(→ *Kartause) in Italien.
Chalcidium (lat.), 1. Bezeich-nung für eine wenigstens nacheiner Seite hin offene Säulenhallein gr. Häusern. 2. Nach Vitruv diemit einer Säulenstellung verseheneVorhalle an der Schmalseite einerröm. Basilika.
Chalet (frz.), aus Holz gebauteSchweizer Senn- oder Berghütte,heute jedes Landhaus, das imSchweizer Stil erbaut ist.
Chan, Han (pers. Haus), oriental.Herberge für Pilger und Kara-wanen (→ *Karawanserei).
Chanka, Changah (pers. chan:Haus, gah: Ort), Kloster der Der-wische im Orient, meist in Ver-bindung mit einem Sultansgrabund einer Moschee, in der Anlagesehr verschieden, nur überein-stimmend in den langen Gängenmit den Zellen, die um einen Hofgruppiert sind.
Chapter-house (engl.), in Eng-land ein meist viereckiger oderpolygonaler freistehender Bau, deraußerhalb der Klausur liegt und mitdem Kreuzgang oder auch mit demQuerhaus der Kirche unmittelbardurch einen Gang verbunden ist.Es dient als repräsentativer Raumdem Konvent oder dem Domkapitelzu Sitzungen. 1. Hälfte 12.�15. Jh.
Chattra, Tschattra, Bekrönung desind. → *Stupa.
Chemin couvert (frz.), ein ge-deckter Weg im Festungsbau.
Chemise (frz.), eine Futtermauerim Festungsbau.
Chilani, (→ *Hilani) Palast derHethiter.
Cellarium 102
Chinoiserie Gartenhaus in Pagodenform
Chinoiserie (frz.), Bezeichnungfür die Übernahme bzw. Nachah-mung chines. oder überhaupt ost-asiat. Formen durch die europ.Baukunst und Innenarchitekturdes 17. und 18. Jhs. Chines. Zim-mer gibt es in den meisten Resi-denzen des Barocks und des Ro-kokos mit chines. Lackmalerei undSeidenstickerei, auch in Gärtenund Parks wurden Pavillons undPagoden in chines. Stil errichtet,bei denen man bes. die chines.Dachform nachbildete.
Chor (gr. choros), ist seit karoling.Zeit der für das Chorgebet derGeistl. und Mönche bestimmteRaum vor dem Hochaltar inMönchs-, Stifts- und Domkirchen;erst seit der Mitte des 14. Jhs. wirdgelegentl. das ganze Altarhaus(Sanktuarium, Presbyterium) mit
seinen Nebenräumen Chor ge-nannt und die Bezeichnung auchauf Pfarrkirchen übertragen. In derfrühchristl. Basilika war der Sän-gerchor (schola cantorum) durchniedrige, feste Schranken vom Ge-meinderaum abgesondert. In karo-ling. Zeit erfolgte eine Anhebungdes Sanktuariums um eine odermehrere Stufen (bes. bei vorhan-denen Krypten) und eine Abtren-nung durch → *Chorschranken.Seit dem 13. Jh. werden diese durcheinen → *Lettner ersetzt. Seit karo-ling. Zeit wird zwischen Kirchen-schiff und Apsis ein rechteckigesJoch eingefügt (→ Chorjoch, Vor-chorjoch, Chorquadrat). DiesesJoch gestattet eine mehrräumigeund auch gestaffelte Gestaltung desPresbyteriums. Der C. kann beimVorhandensein eines Querhausesbis in die Vierung vorgezogen wer-
103 Chor
C.quadrat, Quadrum(Beispiel: Braunschweig, Dom)
Polygonc. mit Umgang und Kapellen-kranz (Beispiel: Reims, Kathedrale, 13. Jh.)
C. mit Nebenc. und plattem C.schluß(Beispiel: Hirsau, St. Peter und Paul,
11.Jh.)
Gestaffelte Polygonchöre (Beispiel: Wien, St. Stephan, 14. Jh.)
Chor
den; bei Hirsauer- und Cluniazen-serkirchen reicht er noch um einJoch in das Langhaus hinein (→ cho-rus minor), wo er durch eine Pfei-lerstellung betont wird. Schließl.ging die Bezeichnung C. auch aufden Raum über, in dem die Non-nen am Gottesdienst teilnahmen,zumeist eine Westempore (Non-nenchor). Bei den spätgot. Hallen-kirchen wurde die Trennung zwi-schen C. und Gemeinderaum ver-wischt und schließl. ganz auf den C.verzichtet. Die einfachste Form desChorschlusses ist die → *Apsis, der→ Polygonchor und der → Recht-eckchor, üblich bei Saalkirchen,ebenso bei dreischiffigen Kirchen,deren Seitenschiffe dann geradeenden. Bes. in karoling.-otton. Zeitund dann in Rückbesinnung dar-auf werden in stauf. Zeit im O.wie im W. der Kirche Chöre ange-fügt (→ *Doppelchörige Anlage).Die Entwicklung der Chorformenwird bestimmt aus dem in karo-ling. Zeit erwachsenen Bestreben,die Zahl der Altäre zu vermehrenund die urspr. Abschrankung durchzugeordnete Räume zu ersetzen.Es entstehen der → Dreizellenchor,→ Staffelchor, → Umgangschorund Kleeblatt- oder die → *Drei-konchenanlage. Engl. choir; frz. ch�ur; it., sp. coro.
Choraltar, der im Chorraum ei-ner Bischofs-, Kloster- oder Pfarr-kirche stehende Hauptaltar imUnterschied zu den in den Seiten-kapellen, am Lettner, im Kirchen-schiff usw. aufgestellten Neben-altären. Er ist durch Größe undAusschmückung hervorgehoben. Engl. high altar; frz. maître-autel, autelprincipal; it. Hauptaltar: altare maggiore;sp. altar mayor.
Chorbogen, ein Gurtbogen, dereinen Chor vom Langhaus bzw. derVierung abtrennt (→ Triumphbo-gen 1). Engl. choir arch; it.,sp. arco del coro.
Choregisches Monument (gr. choregos: Chorführer), Denkmal,das zur Erinnerung an einen in den
Choraltar 104
Choregisches Monument(Beispiel: Athen, Lysikratesdenkmal)
gr. Chorwettbewerben errungenenSieg errichtet wurde. Engl. choragic monument; frz. monumentchorégique; it. monumento coregico;sp. monumento corega.
Chorerker → *Chörlein.
Chorflankenturm, ein seitl. derApsis oder des Chors am Übergangzum Chorjoch auf jeder Seite bei-gestellter Turm, zumeist quadrat.,aber auch rund, seit Anfang des 11.Jhs. bekannt, bes. bei den stauf.Kirchen im Rheinland. It., sp. torre al lato del coro.
Chorgestühl, an den beiden Lang-seiten des Chors aufgestellte höl-zerne Sitzreihen für die Geistl. inzwei oder mehreren Reihen aufStufen hintereinander und ge-wöhnl. mit einer hohen, architek-ton. gegliederten Rückwand (Dor-sale) aus Holz, vereinzelt auch ausStein, versehen, die in der Gotikoft von einer Baldachinreihe abge-schlossen wird. Die Sitze (Stallen)haben Armlehnen (Accoudoirs) undsind meist Klappsitze, an deren vor-derem Rand eine Verbreiterung(Miserikordie) als Gesäßstütze beim
Stehen angebracht ist. Die Seiten-wände des C. heißen Wangen. Engl. choir stalls; frz. stalles du ch�ur, bancd��uvre; it. stalli del coro; sp. sillería.
Chorgitter, urspr. ein hohes Git-ter aus Eisen, Bronze oder Messing,das in spätgot. Zeit vielfach dieChorschranken ersetzte. Danach dasseit dem 17. Jh. an die Stelle desLettners getretene Gitter, das denChor gegen W. abschließt und da-bei doch den Durchblick zumHochaltar erlaubt. Bei den sog. per-spektivischen C. der Barockzeit istdie Zeichnung auf einen Flucht-punkt bezogen, wodurch eineRaumillusion entsteht. Engl. choir screen; frz. grille de ch�ur;it. cancellata del coro, grata del c.; sp. rejadel coro.
Chorhaupt, Ostabschluß der Kir-che mit der Stellung des Haupt-altars, entweder halbkreisförmig als→ *Apsis oder rechteckig und po-lygonal als → *Chor, auch mit in-nerem Umgang (→ Chorumgang). Engl. chevet; frz. chef d�apside, chevet; it. tes-tata del coro; sp. ábside.
105 Chorhaupt
Chorgestühl → (M = Misericordie)
Chorgitter(Beispiel: Weingarten Klosterkirche)
Chorhaus → Chorhaupt, → *Apsis,→ *Chor.
Chorjoch, Chorquadrat, Vorchor-joch, Quadrum, seit karoling. Zeitwird zwischen Kirchenschiff undApsis, in der Gotik zwischen Poly-gonchor und Querschiff oder Kir-chenschiff, ein rechteckiges Jocheingefügt. Das C. gestattet einemehrräumige und auch gestaffelteGestaltung des Presbyteriums, desBereichs, in dem sich der Altar-dienst vollzieht. Im 11. Jh. hat dasC. zuweilen eine außerordentl.Länge, wie dann auch bei got.Chören, bes. bei den Bettelorden. Engl. choir bay; it. campata del coro; sp. re-cuadro del coro.
Chorkapelle, Kapelle an einemChorschluß (→ *Scheitelkapelle)oder einem Chorumgang. Die Ge-samtheit der Apsidialkapellen aneinem → *Chor heißt Kapellen-kranz. Engl. choir chapel; frz. chapelle absidiale;it. cappella absidale; sp. capilla absidal.
Chörlein, ein kleiner Altarraum,der im Obergeschoß eines Bau-werks erkerartig aus der Mauer-flucht auskragt und auf Konsolenoder einem Stützpfeiler ruht, ergehört zu einer Hauskapelle in Bur-gen, Pfalzen, Kurien, Patrizierhäu-sern, Rathäusern, aber auch zu sa-kralen Bauten wie Karnern, Klö-stern oder Spitälern. In roman. Zeitist das C. halbrund, in got. Zeitdreiseitig, seit der Spätgotik und inder Renaissance auch rechteckig. Engl., frz. oriel; sp. pequeño altar en plantaalta.
Chornische, kleine runde oderpolygonale, außen kaum in Er-scheinung tretende Nische in derOstmauer einer Kirche oder einesKirchenteils zur Aufnahme einesAltars. Engl. apse; frz. abside; it. abside, apside;sp. ábside.
Chorpolygon, polygonaler Ab-schluß eines → *Chors.
Chorquadrat → *Chorjoch.
Chorscheitelrotunde, ein in derKirchenachse des Chors angebau-ter oder vorgelagerter Rundbau, zu-meist Marien- oder Heilig-Grab-Kapelle, in Burgund, dann im dt.Sprachraum, in Italien und Spa-nien bes. im MA. gebaut. It.; sp. rotonda del coro.
Chorhaus 106
Chörlein(Beispiel: Nürnberg, Sebaldusc., 14. Jh.)
Chorschluß, der Abschluß des→ *Chors. Er kann halbrund, gera-de (»platt«) oder polygonal, d.h. ausmehreren Seiten eines Vielecksgebildet (Chorpolygon, Polygon-chor) und von einem Chorumgangbzw. Chorkapellen (Kapellenkranz,Apsidialkapellen) umgeben sein.Besteht der C. z.B. aus fünf Seiteneines Achtecks, so spricht man voneinem Fünfachtelschluß. Frz. croupe d�église; it. terminazione delcoro; sp. terminación del coro.
Chorschranken, hölzerne odersteinerne Brüstung oder metalle-nes Gitter zwischen Chor und Ge-meinderaum. In den altchristl. Ba-siliken umzogen die C. den Chormeist auf allen Seiten (→ Cancelli).Im MA. waren sie bei dem ein-schiffigen Langchor nur an dessenWestende notwendig; beim Vor-handensein eines Chorumgangswaren sie auch an den Seiten zwi-schen den Pfeilern oder Säulen ein-gefügt. Die C. sind entweder garnicht oder nur in der oberen Hälftedurchbrochen, oft sehr reich archi-
tekton. gegliedert und mit Skulp-tur oder Malerei geschmückt. Siehatten die Aufgabe, den Choruspsallentium mit dem Hochaltarvon den allgemein zugängl. Teilender Kirche abzutrennen und kom-men in Bischofs- und Kloster-kirchen, seit dem Spätmittelalterauch in großen Pfarrkirchen vor.Seit frühchristl. Zeit nachgewiesenals verzierte Marmorplatten zwi-schen wenig höhere Pfosten einge-stellt, in karoling. Zeit verbreitetund in der Romanik zu kompaktenMauern mit Figurenzyklen ausge-formt, in der Gotik auch reichbemalt (→ *Lettner). Engl. choir screen, cancelli; frz. clôture dech�ur, cancel; it. recinto del coro; sp. bar-reras del coro.
Chorturm, Turm über dem Chor-joch oder über dem Rechteckchoroder der Apsis im O. oder W. einerSaalkirche, selten an einer dreischif-figen Basilika über den Nebenchö-ren. Sein Erdgeschoß ist auf einerSeite zum Kirchenraum geöffnetund enthält den Hauptaltar; derTurm dient als Glockenturm. C. ingrößerer Dichte finden sich in ro-man. und got. Zeit zwischen Ober-rhein, Donau und Main, in Thürin-gen, im Elsaß, in Teilen von Frank-reich und Skandinavien. Bes. in Mit-tel- und Unterfranken hält er sichbis ins 18. Jh. (→ Chorflankenturm,→ Chorwinkelturm) (Abb. S.108)Frz. tour de ch�ur; it. 1. torre sovrastante ilcoro, 2. torre al lato del coro; sp. torre sobreel recuadro del coro.
Chorturmkirche, eine Kirche,deren einziger Turm sich über demChor erhebt (→ *Chorturm). Frz. église à tour de ch�ur; it. chiesa contorre sovrastante il coro; sp. iglesia con torrede coro.
107 Chorturmkirche
Chorschranken
a Chorschrankenb Lettnerc Altarschrankend Chorgestühl
Chorumgang, Deambulatorium,Ambulacrum, ambitus, chevet, einum den → *Chor herumlaufenderGang, der durch Weiterführung derSeitenschiffe entsteht, gewöhnl.durch offene Bogenstellungen vomChor geschieden. Er ist häufig voneinem Kapellenkranz umgeben, d.h.von radial angeordneten Chorka-pellen, die nach außen vorspringenund sich nach innen als Altarräumeöffnen. Der C. mit Kapellenkranzwurde zuerst in Frankreich ausge-bildet, wo er schon in karoling. Zeitvorkommt. Über dem C. könnenauch Emporen in gleicher Anord-nung (→ *Emporenumgang) liegen.Urspr. wie die Ringkrypta Prozes-
sionsweg um ein unter dem Altargelegenes Märtyrer- oder Heiligen-grab bzw. Memorienstätte, seit An-fang des 11. Jhs. ausgebildet, häufigbei frz. Kirchen, in Deutschland nurvereinzelt. In der Gotik wurde derC. mit Kapellenkranz fester Be-standteil der Kathedralen. Sonder-formen bei den Pfarrkirchen derHansestädte und bei den Zisterzien-sern, die den C. um den Rechteck-chor führten. In der Spätgotik wirdder Chor mit Umgang zum Hallen-chor weiterentwickelt, die Kapel-len werden flache, nischenartigeRäume oder verschwinden ganz. Engl. ambulatory; frz. déambulatoire; it. de-ambulatorio; sp. deambulatorio.
Chorumgang 108
Chorturm Chorturm über den Nebenchören
Chorus major (lat.), in Hirsauer-oder Cluniazenserkirchen der»größere Chor«, der östl. an den→ Chorus minor anschließt undden Mönchen vorbehalten war.
Chorus minor (lat.), in Kirchender Hirsauer oder der Cluniazen-ser der »kleinere Chor«, der sichanschließend an den → Chorusmajor bis zum ersten Stützenpaardes Langhauses erstreckt. ZurMarkierung der Grenze gegen denGemeinderaum besteht dieses Stüt-zenpaar bei Säulenbasiliken ausPfeilern, auch ist über ihm manch-mal ein Querbogen angeordnet.
Chorwinkelturm, Turm in denWinkeln, die von Chorjoch undQuerhausarmen gebildet werden,bes. im 11.�13. Jh. verbreitet (nichtzu verwechseln mit → Querhaus-winkelturm).
Ciborium → *Ziborium.
Cingulum (lat.) → Ringmauer.
Cippus → *Zippus.
Circus → *Zircus.
City (engl.), vom Namen der In-nenstadt Londons abgeleitete Be-zeichnung für den → Stadtkern,bes. bei Ballung von Geschäfts-und Verwaltungsfunktionen.
Claustrum (lat.) → Kreuzgang,→ *Kloster.
Coemeterium (lat. v. gr. koimete-rion: Schlafkammer), altchristl. Be-gräbnisstätte bes. in den Kata-komben, auch allgemein Friedhof. It. cimitero; sp. cementerio.
Coemetrialkirche, Memoria,Martyria, Kirche auf oder in einem→ Coemeterium, meist nahe oderüber einem Märtyrergrab. Engl. burial church, martyrium; it. chiesacimiteriale; sp. iglesia de cementerio.
College (engl.), wissenschaftl.Körperschaft (Kollegium), bes. dieaus dem MA. stammenden sichselbst verwaltenden Haus- undStudiengemeinschaften von Stu-denten und Dozenten engl. Uni-versitäten. Die Gebäude dieser C.sind meist um mehrere Höfe undum eine Kapelle gruppiert, Haupt-räume sind die Bibliothek und derSpeisesaal, oft gehört ein Park dazu.
Columbarium → *Kolumbarium.
Commodité (frz. Bequemlichkeit),ein architekturtheoret. Begriff des18. Jh., der für den Schloß- undHôtelbau die möglichst sinnvolleund zweckmäßige Anordnung allerHaupt- und Nebenräume, also dieBequemlichkeit des Wohnens überdie Repräsentation stellte. Die C.reformierte die Baukunst vomGrundriß her und ist bereits imSchloß Vaux-le-Vicomte (1657�60)vorweggenommen. Engl., frz., it. commodité; sp. comodidad.
Communicationslinie, Grabenzwischen Außen- und Feldwerkenim Festungsbau.
109 Communicationslinie
Commodité(Beispiel: Benrath, Schloß)
Communs (frz.), die für wirt-schaftl. Zwecke und zur Unterbrin-gung der Dienerschaft bestimm-ten, dem »allgemeinen« Gebrauchdienenden Nebengebäude zu bei-den Seiten des Ehrenhofs frz.Landschlösser und Hôtels des 17.und 18. Jhs., meist niedriger alsdas der Herrschaft vorbehaltene→ *Corps de logis. Engl. wing, dependency; frz. communs;it. communs, ali di servizio; sp. dependencias.
Compluvium (lat.), Öffnung imDach des röm. → *Atriums, darun-ter das → Impluvium.
Concha → Konche.
Confessio (lat.) → Konfessio.
Contregarde (frz.), ein Außen-werk von Bastionsfacen aus zweibis an den Ravelin-Graben verlän-gerten Facen ohne inneren Raum,die mit den Facen des Hauptwalls(Bollwerk, Ravelin usw.) parallellaufen und mit einer Brustwehrversehen sind.
Contrescarpe (frz.), äußere, meistgemauerte Grabenböschung, auchdas Gelände vor der äußeren Gra-benböschung. Engl. counterscarpe; frz. contrescarpe;it. controscarpa; sp. contraescarpa.
Corbel Table (engl.), an normann.Bauten Reihe von Kragsteinen(Corbels) direkt unter dem Trauf-
gesims, verbunden mit dem Bogen(→ Bogenfries).
Cordonstein, Cordongesims,Rundstab als Werksteingesims amoberen Abschluß einer Sockel-schräge oder als Gurtgesims derEscarpe am Fuße der Brustwehr;auch als oberes Abschlußgesimsfreistehender Escarpenmauern. It. cordone; sp. moldura, cordón.
Corona (lat. Kranz), auch Geisongenanntes Kranzgesims der → *Do-rischen Ordnung. Engl., it., sp. corona.
Corps de logis (frz.), Bezeich-nung für das mittlere Hauptgebäu-de, das »Wohnhaus« der Herrschaftfür Wohn- und Repräsentations-zwecke; seit dem Barock enthält esmeist ein repräsentatives Treppen-haus und prunkvolle Festräume. Engl., it., sp. corps de logis.
Cosmatenarbeit, dekorative Mar-moreinlegearbeit unter Verwen-dung von Mosaiksteinen, Glas undGoldauflage in der it. Baukunst des
Communs 110
Corps de Logis(Beispiel: Bruchsal, Schloß)a Corps de Logisb Communs, Flügelc Cour d'honneur
Cosmatenarbeit
12.�14. Jhs., an antike Vorbilder an-knüpfend von den magistri cosma-cini zur höchsten Pracht entfaltet. It. opera cosmatesca; sp. taracea en mármol.
Cottage (engl.), im 19. Jh. ver-breitete Bezeichnung für das klei-nere Einfamilienhaus bes. auf demLande; England war seit dem Endedes 18. Jhs. führend im Bau beque-mer kleiner Landhäuser. C. orné istein künstl. rustikal gestaltetes Land-haus, vorwiegend in engl. Parks desspäten 18. und frühen 19. Jhs. un-ter Verwendung von Strohdächern,Holzverkleidungen und roh be-hauenen Balken.
Couloir (frz.), ein schmaler Ver-bindungsgang zu den Wohnräu-men eines Schlosses für die Be-diensteten, davon übertragen aufden engen Gang hinter den Thea-terlogen.
Cour d�honneur (frz.), der vomCorps de logis und den Commu-nes (Nebenflügeln) dreiseitig um-schlossene »Ehrenhof« eines Ba-rock-Schlosses oder Hôtelbaus, aus-gebildet im frz. Renaissance-Schloß.
Couronnement (frz.), 1. Wall-krone bei Festungen. 2. Bogenfeldeines → *Maßwerks.Engl. coping; frz. couronnement; it. corona-mento.
Courtine (frz.) → Kurtine.
Couvreface (frz.), kleines Außen-werk im Graben (→ Contregarde).
Creneau (frz.), Schießscharte bzw.Zinne auf einer Festungsmauer.Engl. crenel, crenelle, battlement; frz. cré-neau; it. merlo.
Crenelierte Mauer, mit Zinnenbesetzte Mauer. Engl. crenelated wall; frz. mur crénelé;it. muro merlato; sp. muro almenado.
Crescent (engl.), halbmondförmigzurückschwingende Häuserreihe,ein großzügiges städtebaul. Motiv,das weitausgreifend die Landschaftumfaßt.
Crete (frz.), Krone von Wall oderBrustwehr im Festungsbau. Engl. crest, ridge; frz. crête; sp. cresta.
Cryptoporticus (lat.), 1. überbau-ter, zum größten Teil von Wändeneingeschlossener, von außen nichterkennbarer Portikus. 2. Unterir-discher Gang, Kellerkorridor. Engl. cryptoporticus; it. criptoportico; sp. ga-lería subterráneo, corredor s.
Cubiculum (lat. Schlafzimmer),für mehrere Familienmitgliederbestimmte Grabkammer in röm.Katakomben. Engl. cubiculum; it. cubicolo; sp. cubícolo.
Cuneus (lat.) keilförmige Aus-schnitte, in die der Sitzraum im an-tiken Theater und Amphitheatervertikal durch die radial geführtenTreppen geteilt war. In größerenTheatern wurde die Zahl der C.über den horizontalen Umgängendurch eingeschobene Treppen ver-doppelt.
Curia (lat.), Gebäude, in dem derröm. Munizipalsenat seine Sitzun-gen abhielt.
Curtainwall (engl.), → *Vorhang-fassade.
111 Curtainwall
Curtis (lat. Hof, Königshof, Hof-haltung), ma. Wirtschaftshof, viel-leicht befestigt. It. curtis; sp. patio.
Cuvette (frz.), ein kleinerer Gra-ben in der Mitte des Hauptgra-bens, sofern der Festungsgrabentrocken ist. Engl. basin, bowl, tub; frz. cuvette; sp. cubeta.
D
Dach, das D. schließt ein Bauwerknach oben ab und schützt es gegenWitterungseinflüsse. Seine Aus-führung ist abhängig vom Klima,von den Baustoffen, von Form undGröße des zu überdachenden Bau-körpers und von den herrschendenGestaltvorstellungen. In südl. Län-dern ist das Flachd. heimisch, wäh-rend im regenreichen Mittel- undNordeuropa das Steild. vorherrscht,das einen D.raum (D.boden) um-schließt. Dieser kann für Wohn-zwecke ausgebaut sein (D.woh-nung), wobei zu seiner Belichtungund räuml. Ausweitung D.aufbau-ten vonnöten sind, die als stehendeD.fenster, D.erker oder als Zwerch-haus ausgebildet sein können. DasD. besteht aus dem D.werk (Spar-ren- oder Pfettend., → *D.kon-struktion) und der darauf ruhen-den → *D.deckung (D.haut). Dieobere waagerechte Schnittliniezweier ansteigender D.flächen heißtFirst (D.first), ihre untere waage-rechte Begrenzung Traufe (D.trau-fe, Trauflinie, D.fuß). Bilden zweiD.flächen mit ihren Trauflinieneine ausspringende Ecke, so wirdihre Schnittlinie zum Grat; bilden
ihre Trauflinien eine einspringendeEcke, so wird die Schnittlinie derbeiden D.flächen zur Kehle (D.keh-le). Ein Grat, der zwei verschiedenhohe Firstpunkte verbindet, heißtVerfall (Verfallung), wobei derSchnittpunkt Anfallspunkt genanntwird (→ *D.ausmittlung). Denfrontalen Abschluß des D. bildetentweder ein Giebel oder ein Walm(→ *D.formen). Die Begrenzungs-linie der D.flächen am Giebel hei-ßen Ort, bzw. linker und rechterOrt. Engl. roof; frz. toit, comble; it. tetto; sp. teja-do, techo.
Dachabfall → Dachneigung.
Dachaufbauten nennt man alleüber die Grundform des Dachshinausragenden Bauteile (Dach-fenster, Gauben, Dacherker undZwerchhäuser, aber auch Attiken,Balustraden, Ziergiebel, Schornstei-ne) und die vielgestaltigen Aufbau-ten auf Flachdächern, Dachterrassenoder Dachgärten (Aufzugsmaschi-nenhäuser und Stiegenhausmün-dungen, Atelierbauten, Pavillonsund Glashäuser). Auf den Dachter-rassen amerikan. Wolkenkratzergibt es oft kleine luxuriöse Ein-familienhäuser, sog. Penthouses. Engl. lantern; Sp. elementos constructivosdel tejado/techo.
Dachausmittlung heißt die geo-metr. Festlegung einer Dachformund ihrer Schnittlinien (Traufe, Ort,First, Grat, Kehle, Verfallung) überdem gegebenen Grundriß. Sie istdie Grundlage für die konstruktiveAusbildung des Dachs (Werksatz). Frz. composition de toit; it. schema geome-trico della copertura; sp. proyección de untejado.
Curtis 112
Dachbalken, Holzbalken, auf de-nen das Dachwerk aufgeschlagenist, → *Dachkonstruktion. Engl. roof joist, sommer, girder; frz. solivede comble, maître-poutre; it. trave delpiano d�imposta del tetto; sp. viga de techo.
Dachbinder, das die Sparren auf-nehmende Tragwerk einer Dach-konstruktion, das in größeren Ab-ständen zwischen den Leerge-sprängen eingefügt ist; die daraufliegenden Sparren heißen Haupt-sparren, Bindersparren oder Ge-bindesparren; die Gesamtheit derKonstruktion heißt Gebinde bzw.Bundgespärre oder Vollgespärre. Engl. roof frame, r. truss; frz. ferme, maî-tresse-ferme; it. capriata, incavallatura;sp. cabriada de techo.
Dachboden, Dachehre, Dachsöl-ler, Dachraum, 1. der von derDachbalkenlage und den Dachflä-chen begrenzte Raum des Steil-dachs (→ Dach); 2. der Fußbodenüber der Dachbalkenlage. Engl. 1. loft, garret, attic; frz. 1. grenier,combles, soupente; it. 1. soffitta, sottotetto,2. pavimento della soffitta; sp. 1. buhardilla,ático 2. piso sobre las vigas.
Dachbruch, bei → Mansarddä-chern die Neigung der beiden über-einander folgenden Dachflächen. Engl. roof curb, sprocked eaves; frz. brisisd�un toit; sp. pendiente de las aguas de untejado de manserda.
Dachbrücke, überdachte Holz-brücke (→ *Brücken). It. ponte coperto; sp. puente de tejado.
Dachdeckung, die den Abschlußdes Steildachs bildende dichteDachhaut und deren Herstellung.Den Abschluß des → Flachdachsnennt man Dichtung. Die D. kannaus Steinplatten (hauptsächl. imMittelmeergebiet), aus mit Steinenbeschwerten Brettern, aus Moosüber Holzschalung und Birken-rinde (hauptsächl. in Skandina-vien), aus Stroh oder Schilf (meistältere Bauernhäuser), aus Schin-deln, Schieferplatten, Blech oderDichtungsbahnen bestehen. Diezu allen Zeiten gebräuchlichste D.ist jedoch das Ziegeldach mitPlatten aus gebranntem Ton (Dach-ziegel). Ihrer Form nach unter-scheidet man Flach-, Falz- undHohlziegel. Von den Flachziegelnist der Biberschwanz am verbrei-tetsten. Er wird mit einer an seinerUnterseite vorstehenden Nase ineinzelnen Scharen an waagerechtenDachlatten aufgehängt und z.T. an-genagelt, wobei es verschiedeneEindeckungsarten gibt: beim Spließ-dach (Spandach) wird unter jedeseitl. Fuge ein Spließ (Span) ausHolz eingelegt, beim Doppeldachüberdecken die Ziegel einanderum zwei Drittel ihrer Länge undsind seitl. versetzt, beim Kronen-dach (Ritterdach) trägt jede Dach-latte zwei Reihen versetzter Biber-schwänze. Zu den Flachziegelnwerden auch die Krempziegel(Krämpziegel) gerechnet, die aufder einen Langseite rund, auf deranderen kantig aufgekrempt sindund mit diesen Krempen inein-andergreifen. Falzziegel sind allsei-
113 Dachdeckung
t Traufe (Dachfuß) o Ort f First A Anfallspunkt
g Gratk Kehlev Verfallung
(Anfallinie)
Dachausmittlung
Dachdeckung 114
1 Biberschwanz 2 Krämpziegel 3 Falzziegel4 Hohlziegel (Mönch)5 Hohlziegel (Nonne)6 Pfanne7 First-, Gratziegel
8 Spließ-, Spandach9 Doppeldach 10 Kronen-, Ritterdach11 Pfannendach12 Klosterdach13 Dt. Schieferdach mit
Normschablonen
14 Engl. Schieferdach15 Schindeldach16 Blechdach17 Pappedach18 Antikes Dach mit
Stirnziegeln19 Legschindeldach
Dachdeckung
tig mit Falzen und Leisten verse-hen und greifen mit diesen inein-ander. Hohlziegel überdecken ein-ander nur seitl. Zu ihnen gehörendie ~-förmig gekrümmte Pfanne(Dachpfanne) und die »Mönch undNonne« genannten halbzylindri-schen Ziegel (Klosterziegel), die ab-wechselnd mit der Höhlung nachunten und nach oben verlegt wer-den. Auch der Stirnziegel an denTraufkanten von Bauten der Antikeist ein Hohlziegel, ebenso der First-ziegel und Gratziegel, die den Dach-first bzw. einen Dachgrat überdek-ken. Die Dachkehlen und die kur-vierten Dachflächen wurden frühermit kleinen, mitunter gekrümmtenBiberschwänzen gedeckt. Die übereinem Giebel liegenden Dachziegelheißen An- bzw. Ortziegel. BeimSchieferdach werden die Schiefer-platten (Decksteine) auf einer Dach-schalung aus Brettern angenagelt,ebenso meist die hölzernen Schin-deln des Schindeldachs. Legschindelwerden nur durch Steine beschwertund wie die Hohlziegel durch Wind-bretter an den Giebelseiten (Stirn-brett) gegen Windstöße gesichert.Das Blechdach wird mit einzelnenBlechbahnen, die durch Falze mit-einander verbunden sind, überdeckt.Engl. roof covering, roofing; frz. toiture,couverture d�un toit, garniture de comble;it. copertura del tetto; sp. cubierta de tejado.
Dachehre → Dachboden.
Dacherker, aus dem stehenden→ *Dachfenster entwickelter, inder Höhe der Trauflinie aufstei-gender Dachaufbau, dessen Vorder-seite bündig mit der Außenflächedes Gebäudes liegt (→ *Lukarne). Engl. dormer window; frz. lucarne faîtière,vue f.; it. abbaino a veranda; sp. lucarna.
Dachfenster, Öffnung zur Be-leuchtung und Belüftung des Dach-raums. Man unterscheidet liegendeD., die in der geneigten Dachflächeliegen, mit hochstellbaren Klapp-flügeln, und stehende D. (Dach-gaupen, Gauben, Schleppgaube,Dachladen, Dacherker) mit senk-rechter Fensterfläche. Die Fleder-mausgaupe (Froschmaul), bildeteine geschwungene Erhebung inder Dachfläche. Mit senkrechtenSeitenwänden (Dachbacken) ver-sehen ist die Schleppgaupe, derenDach gleichfalls von einer An-hebung der Dachhaut gebildetwird; eine sehr breite Schleppgau-pe, wie z. B. zur Lüftung an Spei-chergebäuden, heißt Hechtfenster.Größere stehende D. mit senkrech-ten Seitenflächen, auch Dachhäus-chen genannt, haben ihr eigenesDach, meist ein Satteldach (z. B.Giebelgaupen), doch kommen auchWalmdächer vor (Zwerchhaus).
115 Dachfenster
Dachfensterliegendes Fledermausgaupe Schleppgaupe Dachhäuschen Dacherker
Nicht nur der Beleuchtung undLüftung, sondern zugleich zurErweiterung des Dachraums die-nen Dachaufbauten, die aus demstehenden D. entwickelt sind, wie→ Dacherker. Engl. dormer (window); frz. lucarne, vue;it. abbaino; sp. lubrera, tragaluz, claraboya.
Dachformen. Die Formen derDächer werden nach der Anord-nung der geneigten Dachflächenbestimmt. Das Flachdach (Ter-rassendach) ist daher eigentl. keineD., da es am Baukörper nicht inErscheinung tritt. Die einfachsteD. ist das Pultdach oder Halbdach,das aus nur einer schräg ansteigen-den Dachfläche besteht; es findetsich bes. über niedrigeren Anbau-ten neben höher geführten Bautei-len, z. B. über den Seitenschiffender Basiliken, über Wehrgängen,Schuppen usw., seltener über selb-ständigen Gebäuden. Wird das Pult-dach um einen Rundbau bzw. überdessen Umgang herumgeführt, soentsteht ein Ringpultdach. Dieverbreitetste D. ist das Satteldachaus zwei gegeneinander ansteigen-den Dachflächen, wobei senkrech-te dreieckige Giebel entstehen,daher auch Giebeldach genannt.Sind mehrere Satteldächer mit ih-ren Längsachsen nebeneinander an-geordnet, wie gelegentl. bei Kirchendie Langschiffdächer, so sprichtman vom Paralleldach. Das beimodernen Fabrik- und Ausstel-lungshallen vorkommende Säge-dach (Sheddach) besteht gleichfallsaus parallel angeordneten Sattel-dächern, deren steiler angeordneteFlächen verglast sind. Wenn beieinem Satteldach beide Giebeldurch je eine weitere Dachfläche
(Walm, Schopf) ersetzt werden,entsteht das Walmdach; ist nur einWalm vorhanden, heißt es Halb-walmdach, wenn nur der obere Teilder Giebel abgewalmt ist, Krüp-pelwalmdach, falls nur am unterenEnde ein Walm ist, Fußwalmdach.Das nach einem frz. Architektendes 17. Jhs. benannte Mansarddachist ein geknicktes Dach mit steile-rer Neigung im unteren und fla-cherer Neigung im oberen Teil.Das Mansarddach ist meist alsWalmdach ausgebildet und kann inseinem unteren, steileren Teil eineDachwohnung (Mansarde) enthal-ten (Mansardendach). Fuß- undKrüppelwalm finden auch beimMansarddach Anwendung. EinDach, dessen First quer zum Firstdes Hauptdaches verläuft, heißtQuerdach (Zwerchdach). Ist dasDach über einen Anbau in Fort-setzung der übrigen Dachflächeherabgezogen, so entsteht einSchleppdach. Dagegen kann einüber die Trauflinie des Hauptdachsvorstehendes Kragdach (Konsol-dach) auch nach diesem zu geneigtsein. Tonnendach heißt ein Dachvon der Form eines Tonnenge-wölbes; meist sind mehrere Ton-nen nebeneinander angeordnet.Eine Sonderform ist das Graben-dach, bei dem die Dachflächen imGegensatz zum Satteldach nachinnen geneigt sind, statt im Firstalso in einer Rinne (Zwischenrin-ne) aneinanderstoßen. Eine neuereDachform ist das → Hängedach,das segelförmig durchhängt und inerster Linie konstruktiv begründetist. Türme mit quadrat. Grundrißkönnen ein Kreuzdach haben, dasaus zwei steilen, einander recht-winklig durchdringenden Sattel-
Dachformen 116
117 Dachformen
Dachformen1 Pultdach2 Ringpultdach 3 Sattel-, Giebeldach4 Paralleldach5 Sheddach6 Walmdach7 Krüppelwalm-, Schopf-
walmdach8 Fußwalmdach
9 Mansardgiebeldach10 Mansardwalmdach 11 Mansarddach mit Schopf12 Mansarddach mit Fußwalm13 Zwerchdach14 Schleppdach15 Kragdach16 Tonnendach (Bogendach)17 Grabendach
18 Kreuzdach19 Rhombendach20 Faltdach21 Pyramidendach22 Kegeldach23 Zwiebeldach24 Glockendach25 Kuppeldach26 Hängedach
dächern besteht und wegen seinervier Giebel auch Kreuzgiebeldachgenannt wird. Steigen über seinenGiebelspitzen Grate zu einer ge-meinsamen Spitze auf, so daß sichdazwischen Rhombenflächen bil-den, so entsteht das Rhomben-oder Rautendach. Sind die Grateüber den Giebelspitzen erhöht undin die einspringenden Winkel Keh-len gelegt, so spricht man vonFaltdach. Als Dach oder Helmeines Turms mit quadrat. Grundrißkommt das einfache Zeltdach vor,bei dem die Dachflächen gleich-mäßig nach oben spitz zulaufenund in einem Firstpunkt enden, sodaß eine pyramidenähnliche D.entsteht (Pyramidendach). Auchein Zeltdach über polygonalemGrundriß und mit demgemäßmehr als vier aufsteigenden Dach-flächen wird als Dachpyramide(weniger genau: Dachhelm) be-zeichnet. Ein Turmdach mit kreis-förmigem Grundriß und rundumaufsteigender Dachfläche ist einKegeldach (Kegelhelm). Turmdä-cher mit geschweifter Kontur wer-den Haubendach (Dachhaube)oder Kuppeldach genannt. Zu denHaubendächern gehören die Wel-sche Haube (Zwiebeldach, seltenerKaiserdach), die unten konvex,oben konkav geschweift ist, unddas umgekehrt geschweifte Glok-kendach.
Dachfuß, Dachtraufe, Trauflinie,→ *Dachausmittlung.
Dachgarten, gärtner. Anlage aufeinem Flachdach, das mit einerErdschicht bedeckt ist, in derPflanzen, Sträucher und Bäumewachsen und das daher bes. stark
konstruiert sein muß. Dagegensind Dachterrassen stets gepflastertund nur durch Kübelpflanzen undBlumenschalen belebt. Engl. roof garden; frz. jardin-terrasse; it. giar-dino pensile; sp. azotea jardín.
Dachgaupe, → Gaube, → *Dach-fenster.
Dachgebälk, Gesamtheit allerDachbalken, → *Dachkonstruktion.Engl. roof timbers; frz. charpente; it. trava-tura del tetto.
Dachgeschoß, Mansarde → *Ge-schoß innerhalb eines Dachs. Engl. attic; frz. étage mansardé; it. soffitta;sp. sotabanco.
Dachgesims, Abschlußgesims zwi-schen Baukörper und Dachkör-per, zu dem es konstruktiv gehört(→ *Gesims, → Dachdeckung). Engl. eaves moulding; frz. corniche supé-rieure, c. principale, c. au pied du toit; it. cor-nicione di gronda; sp. cornisa.
Dachgespärre, das einzelne Spar-renpaar, aber auch das Sparrenwerkals Gesamtheit aller Sparren einesDachs (→ *Dachkonstruktion). Engl. rafters, roof framework; frz. charpentede chevrons, couple de c.; it. 1. coppia dipuntoni, 2. orditura dei puntoni; sp. ma-deramen de cabios de tejado.
Dachgiebel → *Giebel, → *Dach-formen.
Dachhaube, Haubendach, Turm-dach mit meist geschweifter Kon-tur, Sonderformen sind das Zwie-beldach und das Glockendach.(→ *Dachformen). Engl. louver, luthern; frz. toit à coupole, alsDachkappe: lucarne faîtière; sp. cofia de teja-do.
Dachfuß 118
Dachhäuschen, stehendes →*Dachfenster mit eigenem Dach. It. abbaino a casetta; sp. lucarna.
Dachhaut → *Dachdeckung samtLattung oder Schalung. Engl. roof skin; frz. couverture, toiture;it. manto di copertura; sp. cubierta de teja-do.
Dachhelm, Helmdach, ein aufallen Seiten mit geraden Flächennach oben spitz zulaufendes Dach,bes. bei Türmen als Rhombendach,Zeltdach oder Pyramidendach auf-tretend (→ Turmhelm, → *Dach-formen). It. tetto a cuspide piramidale; sp. cúspide detejado.
Dachkamm, Firstkamm → *First-bekrönung. Engl. crest; frz. crête, endossure; it. decora-zione del colmo del tetto; sp. ornamento decumbrera.
Dachkehle, Kehle, Seiler, der ein-springende Winkel, den zwei auf-einanderstoßende Dachflächen bil-den, bzw. die dadurch entstehendeRinne, unter der ein → *Kehlspar-ren liegt (→ *Dachausmittlung). Engl. valley; frz. noue; it. compluvio, con-versa; sp. lima-hoya, garganta de tejado.
Dachkonstruktion, Dachwerk,das aus Holz, Stahl oder Stahlbetonkonstruierte Traggerüst des Dachs,das alle auf das Dach einwirkendeKräfte (durch das Gewicht derDachdeckung und Schnees sowiedurch den Winddruck) aufnimmtund auf die Gebäudewände über-leitet. In der Regel hat die D. dieForm eines gleichschenkligen Drei-ecks, dessen Spitze den First unddessen Fußecken die Traufe bilden.
Der hölzerne Dachstuhl, die ammeisten verwendete D., steht inder Regel auf der horizontalenDachbalkenlage, die auf den Wän-den bzw. Umfassungsmauern desGebäudes aufliegt. Sind die Um-fassungswände noch höher geführtals der Dachboden, so entsteht einKniestock (Drempel). Fußpfetteund Sparren müssen bei dieser Kon-struktion allerdings gegen das Aus-weichen gesichert sein. Dies kanndurch Zangen � paarweise angeord-nete und miteinander verschraubteHorizontalbalken � geschehen,durch die man Sparren in derQuerrichtung miteinander verbin-det. Die schräg ansteigenden Kant-hölzer des Dachwerks heißen Spar-ren und bilden zusammen dasGespärre oder Sparrenwerk. Siesind in Abständen meist paarweiseangeordnet, ruhen unten aufDachbalken und treffen oben imDachfirst zusammen (einfachesSparrendach). Die Ecksparren ei-nes Walmdachs heißen Gratspar-ren. Bei größerer Länge werden dieSparren durch einen sog. Kehlbal-ken, der horizontal von einem Spar-ren zum gegenüberliegenden führt,verbunden (Kehlbalkendach). DieSparren können aber auch durchsog. Pfetten unterstützt werden,die in der Längsrichtung des Dachswaagerecht unter den Sparren derDachflächen entlanglaufen undihrerseits von Wänden oder Säulen(Stuhlsäulen) gestützt werden. Dieoberste, unter dem Dachfirst lie-gende Pfette heißt Firstpfette, diesie stützende Säule Firstsäule. Diefesten Konstruktionen liegen je-doch nicht zwischen jedem Spar-renpaar (Gebinde), sondern wie-derholen sich nur in größeren Ab-
119 Dachkonstruktion
ständen (3�4 m) bei den sog. Bin-dern (Binder 2, Hauptgebinde). DieBalken des Binders heißen Bund-balken, die Säulen Bundsäulen, dieSparren Hauptsparren (Bund-, Bin-dersparren). Die Pfetten ruhen dannauf diesen Bindern und stützen diedazwischenliegenden Sparrenpaare(Leergebinde). Die Querverstei-fung zwischen Säulen, Pfetten undBalken erfolgt durch Kopfbügen(Büge, Kopfbänder) und Streben.Der Längsverband (Windverband)wird durch Rispen (Windrispen)genannte Latten ebenfalls gesi-chert, die unter den Sparren schrägzur Trauflinie befestigt sind. Diedurch senkrechte Säulen gestützteD. wird stehender Dachstuhl ge-nannt. Das Pfettendach wird durchhorizontale Balken (Pfetten) getra-gen, die auf festen Querwändenaufruhen. Tragen anstelle der Quer-
wände Binder die Pfetten, so ent-steht ein Pfettensparrendach, des-sen Dachhaut von Sparren getra-gen wird. Soll die gesamte lichteWeite frei überspannt werden, sowählt man freitragende Binder. EinBogendach wird durch zwei gegen-einander gelehnte, gekrümmte Stre-
Dachkonstruktion 120
Dachkonstruktion
1 Sparrendach2 Pfettendach3 Kehlbalkendach4 Kehlbalkendach mit stehendem Stuhl5 Pfettensparrendach mit stehendem
Stuhl6 Pfettensparrendach mit liegendem
Stuhl7 Sparrendach mit Drempel8 Pfettendach mit Drempel9 Mansarddach mit Sparrenstuhl10 Mansarddach mit Pfettensparrenstuhl11 Schwerterdach12 Bogendach nach D. Gilly13 Welsche Haube (Glockendach)14 Turmdach
ben gebildet. Um den Dachraummöglichst frei zu halten, könnendie Säulen auch schräg gestelltwerden und durch einen Spannrie-gel verspannt sein, wodurch der sog.liegende Dachstuhl entsteht. Eine
ähnl. D. ist das → *Sprengwerk, beidem ein hochliegender, von Stre-ben verspannter Balken (Spannrie-gel) das Hauptkonstruktionsele-ment darstellt. Beim → *Hänge-werk wird der Dachstuhl durch eineoder mehrere von Streben unter-stützte Hängesäulen gebildet; anihnen hängt ein Unterzug (bzw.Überzug), der das Gebälk trägt. EinSchwerterdach besteht aus zweisich überkreuzenden Streben, zwi-schen die verbindende Knaggeneingefügt sind, so daß dem Quer-schnitt eine Holztonne einbeschrie-ben werden kann. Neben diesenklass. D. gibt es eine Reihe moder-ner → *Gitterträger, Nagelbinderund andere meist freitragende Kon-struktionen zur Überspannung grö-ßerer Hallenbauten. Mansarddä-cher sind meist in der Art einesSprengwerks konstruiert. Bei spit-
121 Dachkonstruktion
A AnschüblingAK AndreaskreuzB BugBb BundbalkenD Drempel (Kniestock)FP First-, bzw. FußpfetteFs Firstsäule (Giebelsäule)Hs HängesäuleKb KehlbalkenKS KirchturmspitzeKr KranzMp MittelpfetteP PfetteR RiegelS StrebeSp SparrenSr SpannriegelSt StuhlsäuleW WindrispeZ Zange
zen Turmhelmen sind mehrere ho-rizontale Konstruktionen (Kränze)übereinander geschaltet, auf denendie Gratsparren aufruhen, die un-tereinander durch Streben undAndreaskreuze verspannt sind. Engl. roof construction; frz. système de toit;it. armatura del tetto; sp. construcción detejado.
Dachlatte, Ziegellatte, auf dieDachsparren waagerecht aufgena-gelte schmale Vierkanthölzer, diedie Dachziegel tragen (→ *Dach-deckung). Engl. roof lath, r. batten; frz. latte de toiture;it. corrente, listello del tetto; sp. listón detejado.
Dachluke, eine nur mit einemLaden verschließbare, der Lüftungdienende Dachöffnung; häufig wirdso auch fälschl. ein kleines Dach-fenster (→ Gaube) bezeichnet. Engl. lucarne, skylight; frz. lucarne, fenêtreà tabatière; it. finestrella d�areazione deltetto; sp. lumbrera.
Dachneigung, Dachabfall, Win-kel zwischen der Horizontalen undder Dachfläche. Die D. ist abhän-gig von den Niederschlagsmengenund von der Art der Dachdeckung. Engl. roof pitch; frz. pente de toiture; it. pen-denza del tetto; sp. inclinación de tejado,pendiente d. t.
Dachpappe, als Teerdachpappe1832 von W. A. Lampadius erfun-den (Vorläufer seit Ende 18. Jhs.bekannt), mit Teer durchtränkteund überzogene Rohpappe, einsei-tig oder beidseitig besandet, alsDachhaut auf Holzbretterlagenauch bei ganz flacher Neigungangewandt. Engl. roofing felt; frz. carton bitumé; it. car-tone catramato; sp. alquitranado.
Dachpfanne, ein ~ -förmig ge-schweifter Dachziegel (→ *Dach-deckung). Engl. pantile; frz. panne, tuile en forme de Scouché; it. tegola olandese, tegola fiammi-nga; sp. teja en forma de ~.
Dachpfette, Pfette, horizontal ver-laufender Balken, der die Dach-haut trägt (→ *Dachkonstruktion). Engl. purlin; frz. panne, filière; it. terzera,arcareccio; sp. correa.
Dachplatte, Blei-, Eisen- oderKupferplatten, Steinplatten, sowieaus Zement hergestellte ziegel-oder schieferähnl. Platten zurDachdeckung. Fälschl. auch für→ Biberschwänze gebraucht. Engl. roof slab; frz. tuile cuite plate; it. tego-la piana; sp. plancha para techar.
Dachpyramide, Pyramidendach,Zeltdach, → *Dachformen. Engl. roof pyramid; it. tetto a piramide;sp. tejado pirámide.
Dachraum, der vom Dachgebälkund Dachfläche gebildete Raum.Er liegt meist auf der Dachbal-kenlage und wird als → Dachbodenverwendet. Engl. roof space; frz. grenier; it. soffitta,sottotetto; sp. espacio bajo el techo.
Dachreiter, schlankes, meist höl-zernes Türmchen zur Aufnahmeeiner Glocke oder einer Uhr, dasauf dem Dachfirst zu reiten scheint,tatsächl. aber mittels vier Eckstän-dern auf der Konstruktion desDachwerks fußt. D. sind häufigüber der Vierung angeordnet unddienen als Glockenstuhl. D. ausHolz und Stein, oft mit reichemStrebewerk, gewannen im 13. Jh.bes. Bedeutung bei den im übrigen
Dachlatte 122
turmlosen Kirchen der Zister-zienser und Bettelorden, denennur zwei Glocken gestattet waren,kommen aber auch auf Kathe-dralen vor. Auf Profanbauten (Rat-häusern, Tortürmen, Spitälern)finden sich D. seit dem 15. Jh.,mitunter über einem Giebel (Gie-belreiter) oder in dessen Nähe. Engl. turret; frz. lanternon de la croisée;it. lanternino; sp. linternón.
Dachrinne, zur Dachentwässe-rung aus Holz, Weißblech, Kupfer,Zink, Blei- oder auch Eisenblechgefertigt, entweder am Dachfuß(Traufrinne, Fußrinne, Abrinne)oder in der Dachkehle (Kehl- oderSchoßrinne, Abweiser). Die D.wird durch eiserne, auf die Sparrengenagelte Haken (Rinneneisen,
Dachrinnenhaken) befestigt. DasWasser wird durch Fallrohre oderWasserspeier abgeleitet. D. aus Tonoder Stein waren schon in derAntike gebräuchl. Im N. kommenD. aus Holz oder Blei sowie alsSteinrinnen im Kirchenbau im 12.Jh., an Profanbauten im 13. /14. Jh.auf. Engl. gutter; frz. chéneau, gouttière; it. gron-daia, doccia di gronda, canale di g.; sp. cana-lón.
Dachsattel, die Firsteindeckungbei Schieferdächern mit Blei, beiSchindel- und Strohdächern mitBrettern. Engl. saddle; frz. batière, enfaîteau; it. coper-tina del colmo; sp. cubierta de cumbrera.
Dachschalung, auf die Sparrengenagelte dichte Holzschalung zurAufnahme des Dachdeckungsma-terials, bes. für Schiefer und Dach-pappe. Engl. außen: roof planking, innen: ashlering;frz. außen: planchéiage de comble, innen:plafonnage du toit; it. außen: tavolato ester-no della copertura, innen: tavolato internodella copertura; sp. tablas de revestimientode techo.
Dachschifter → Schifter.
Dachschwelle, waagerechter,rechtwinklig zu den Binderbalkenlaufender und mit diesen ver-kämmter Balken, der am Dachfußangeordnet ist, um den Druck lie-gender Stuhlsäulen auf mehrereBalken zu übertragen oder um denSchub der Sparren aufzunehmen. Engl. pole plate, wall p.; frz. racinal de com-ble, semelle, longrine, panne inférieure;it. banchina di gronda; sp. viga de alero.
Dachsparren → *Dachkonstruk-tion.
123 Dachsparren
Giebelreiter Dachreiter
Dachrinne an hölzernem Dachgesims
Dachsteine, Sammelbezeichnungfür alle zur Dachdeckung ver-wendbaren natürl. und künstl.Steine (Ziegel, Schiefer, Dachplat-ten). Engl. roofing slate; frz. tuile; it. pietre dicopertura; sp. piedras de cobertura.
Dachstuhl, beim Sparren- oderPfettendach die Gesamtheit der par-allel zum First angeordneten Stütz-konstruktionen aus Säulen mitihren zumeist verstrebten Schwel-len und Stuhlrähmen oder Pfetten,die zusammen den Längsverbandeiner → *Dachkonstruktion bil-den; stehender Stuhl, Konstruk-tion mit senkrechter Stellung derStuhlsäulen, entweder in der Mitteunter dem First (einfach stehenderStuhl) oder seitl. symmetr. (dop-pelt stehender Stuhl) oder kombi-niert (mehrfach stehender Stuhl);liegender Stuhl, Konstruktion, beidem die Stuhlsäulen schräg, mitihrem Fußpunkt zu den Außen-wänden angeordnet stehen. Engl. poop, truss; frz. charpente, ferme, faî-tage; it. carpenteria del tetto; sp. entramadode tejado.
Dachterrasse, zu angenehmemAufenthalt ausgestaltetes Flach-dach, oft mit Kübelpflanzen undBlumenschalen belebt und fälschl.→ Dachgarten genannt. Engl. roof terrace; frz. toit-terrasse; it. tettoa terrazza; sp. techo terraza.
Dachtraufe, Traufe, Dachfuß, deruntere, waagerechte Rand einergeneigten Dachfläche, über den dasRegenwasser abtropft (→ *Dach-ausmittlung). Engl. eaves; frz. ligne d�égout, batellement;it. gronda; sp. alero.
Dachwerk, Gesamtheit der →*Dachkonstruktion. Engl. roof frame; frz. charpente de toit; sp.armazón d. tejado, estructura d. t.
Dachwohnung, Mansarde, fürWohnzwecke ausgebauter → Dach-raum. Frz. logement mansardé, galetas; it. apparta-mento del sottotetto; sp. mansarda.
Dachziegel → *Dachdeckung,→ Ziegel.
Dachzinne → *Zinne mit dach-förmigem oberem Abschluß. It. merlo a due spioventi; sp. almena con ter-minación en dos aguas, pináculo c. t. e. d. a.
Dagum, urspr. erhöhte Plattformam oberen Ende des Speisesaals,ferner der Stuhl mit Baldachin, derdort stand, auch für den Baldachinauf Kragsteinen gebraucht. Engl., frz. dais; sp. dosel, doselete, balda-quín.
Dahlmauer → Trockenmauerwerk.
Dansker, Danzker, Danzk, Be-zeichnung unbekannter Herkunftfür den turmähnl. Aufbau bei dt.→ Ordensburgen, in dem dieAbtrittanlagen untergebracht wa-ren. Der D. steht abgesondert über
Dachsteine 124
Dansker
einem Gewässer, einem Flußarmoder Burggraben. Er ist durch ei-nen hochgelegenen, von Bögenoder Stützen getragenen, gedecktenGang mit dem Obergeschoß desBurgkomplexes verbunden.
Daube, gewölbtes Brett für Fässer,Brunnen oder Fallrohre.
Deambulatorium (mittellat.),Chorumgang (→ *Chor) oder→ Kreuzgang.
Dechargemauer (frz.), im Fe-stungsbau eine durch Strebepfeilerund dazwischen gespannte Gewöl-be bzw. Breschebogen verstärkteFuttermauer an der Angriffsseite,bes. der Escarpe. Engl. relieving wall; sp. muralla de descarga.
Decke, der meist waagerechteobere Abschluß eines Raums (Pla-fond). Der opt. Raumabschluß istnicht immer auch konstruktiverRaumabschluß, da D. aus opt.,akust. und wärmetechn. Gründenunter die tatsächl. tragende Ge-schoßd. gehängt sein können. Wirdein Raum in der Höhe unterteilt,so schiebt man eine Zwischend.ein, die begehbar sein kann. Die D.kann aus Holz (Balkend.), Stein,Stahl oder Stahlbeton bestehen. Beider Massivd. ist die D.fläche auseinem homogenen Material z.B. ausdicht gereihten Balken (Dippelbal-kend.) oder aus Stahlbeton kon-struiert. Meist sind aber die D.bal-ken und D.rippen (Rippend.) inAbständen verlegt und mit tragen-den Flächen verbunden, wodurchzwischen den stärkeren ElementenVertiefungen (D.felder, D.fach) ent-stehen. Eine Massivd. ohne Unter-
züge heißt Plattendecke, mit Un-terzügen → *Plattenbalkend. Ver-laufen Balken bzw. Rippen auch inder Querrichtung, so entsteht eineKassettend. → *Kassette. Weitge-spannte D. ruhen auf Unterzügenauf, die selbst wieder von Stützengetragen sein können. Ist eine D.-platte durch eine allseitig schräg an-steigende Verstärkung (Anzug) mitder Stütze verbunden, so entstehteine → *Pilzd. Das mittlere Feld ei-ner D., das von Profilen gerahmt ist,heißt D.spiegel (Spiegeld.). Eine stu-fenförmig nach der Mitte zu anstei-gende D., deren einzelne Flächenhorizontal liegen, heißt Kappd.Der Übergang von der senkrech-ten Wand zur D. kann durch einD.gesims oder durch eine D.kehlevermittelt sein (Voute, dann fälschl.
125 Decke
Decke
a Dippelbalkendeckeb Windelbodenc Balkendecked Fehlbalkendeckee Stahlbetondecke mit Füllkörpernf Stahlbetonrippendecke
auch Spiegelgewölbe genannt). DieD. wird oft durch Stuckatur(Stuckd.) oder auch durch Malerei(→ Deckenmalerei) geschmückt. Engl. ceiling; frz. ciel, plafond; it. soffitto,solaio; sp. cielo.
Deckenfach, Deckenfeld, bei einer→ *Decke mit sichtbaren Balkenund Rippen der Raum zwischenden vortretenden Elementen. Frz. caisson; it. cassettone, lacunare; sp. ar-tesón.
Deckengesims, Gesims am Über-gang der Raumdecke zur Wand,häufig in der Form einer Kehle(→ Deckenkehle) oder eines Pro-fils (Holz, Stuck). It. cornice del soffitto; sp. cornisa del cielo.
Deckenkehle, Voute, konkav ge-rundeter Übergang zwischen Wandund Decke. Frz. grand cavet; it. sguscio del soffitto;sp. caveto.
Deckenmalerei, die Bemalungder Decken oder der Gewölbesakraler und profaner Innenräume.Wie die Wandmalerei, zu der sie alsTeil der farbigen Raumausschmük-kung gehört, war auch die D.schon in der Antike üblich undzwar meist in der Freskotechnik(→ Freskomalerei), die bis in dieNeuzeit vorherrschte. Im MA.waren die flachen Holzdecken unddie Gewölbe mit Ornamenten undabgeteilten Bilderfolgen bemalt.Auch die Kassettendecken derRenaissance wurden mit einzelnenGemälden (oft auf Leinwand) aus-gestattet, wobei die Figuren wie inder Tafelmalerei parallel zur Bild-fläche erschienen. Erst in der illu-sionist. D. des Barocks wurden
durch perspektiv. Verkürzung dieFiguren und Architekturen derDeckengemälde von unten gese-hen dargestellt, so daß die raumab-schließende Funktion der Deckedurch die Malerei aufgehobenwurde und der Betrachter schein-bar in einen Raum jenseits derDecke blickt, in dem sich die dar-gestellten Vorgänge, oft unter ei-nem durch Wolken perspektiv. ver-tieften Himmel, abspielen. Engl. painting on ceiling; frz. peinture deplafond; it. decorazione pittorica del soffit-to; sp. decoración pictorica del cielorraso.
Deckenplatte, im Stahlbetonbauhäufige Deckenkonstruktion, beider zur Aufnahme der Zugbean-spruchung hohe schlanke Balken(Randbalken) entwickelt werden,während das Deckenfeld mit einernur auf Druck beanspruchten unddaher relativ dünnen D. geschlos-sen wird (→ Plattendecke), auch dienach den gleichen Überlegungenkonstruierte, aber mit geringerSpannweite über eine größere An-zahl von Unterzügen durchlaufen-de D. einer → *Plattenbalkendecke.Frz. dalle de plafond, plaque de p.; it. lastradi solaio; sp. losa.
Deckenschalung, Holzverscha-lung unter einer Holzbalkendecke. Frz. plafonnage; it. tavolato del soffitto;sp. revestimiento en madera del cielorraso.
Deckenspiegel, mittleres, von Pro-filen gerahmtes Feld einer → *Dek-ke (Spiegeldecke). It. specchio del soffitto; sp. espejo del cielo.
Deckgesims, horizontales Gesims,das die Fuge am Anschluß zweierverschiedener Bauteile abdeckt. It. cornice coprigiunto orizzontale; sp. cor-nisa cubrejuntas.
Deckenfach 126
Deckleiste, Fugenleiste, flache,meist hölzerne → *Leiste zurÜberdeckung der Anschlußfugezweier Bauteile oder Bauelementeverschiedenen Materials. Frz. couvre-joint; it. listello coprigiunto;sp. cubrejunta, tapajunta.
Deckplatte → Abakus eines→ *Kapitells.
Decumanus (lat. zur Zehntengehörig) hieß die eine, gewöhnl.von O. nach W. verlaufende Haupt-achse des röm. → *Castrums, diesich mit der anderen Achse (Cardo)rechtwinklig überkreuzt. Cardo undD. bilden auch das Straßenkreuzröm. Städte und teilen diese in Vier-tel (Stadtviertel) unter. (→ *Stadt-baukunst).
Deele → Diele.
Defenslinie, im Festungsbau dieStreichlinie von einer Stellung zudem zu bestreichenden Ort, spe-ziell die Verlängerungslinie einerBastionsface bis zum Flanken-winkel der benachbarten Bastion.
Dégagement (frz.), im barockenSchloßbau nach außen nicht sicht-bare Verbindungsgänge und Trep-pen, die die eigentliche Verbindungzwischen den Räumen darstellen.
Dehnfuge, Dehnungsfuge, Bau-fuge, die eine Wärmedehnung ein-zelner Bauteile ermöglichen soll. Engl. expansion joint; frz. joint de dilata-tion; it. giunto di dilatazione; sp. junta dedilatación.
Dekagon (gr.), zehneckiger →*Zentralbau.
Dekastylos (gr. zehnsäulig), Be-zeichnung für eine Tempelformmit zehn Säulen an einer Front. Engl. decastyle; it., sp. decastilo.
Dekor (frz. decor), der figürl. oderornamentale Schmuck keram.Erzeugnisse oder anderer Gegen-stände des Kunsthandwerks undIndustriedesigns, wobei es sichbeim D. im Unterschied zur → De-koration um Einzelmotive handelt. Engl. decor; frz. décor; it. decorazione,ornamento; sp. decorado.
Dekoration (v. lat. decorare:schmücken), die Anwendung von→ Ornament auf einem Orna-mentsträger (Bau, Bild), die Ge-samtheit der »Ausschmückung«von Bauwerken, bes. von Innen-räumen, im Gegensatz zum Orna-ment, das als einzelnes Schmuck-motiv nur ein Teil der D. ist. Engl. decoration; frz. décoration; it. decora-zione; sp. decoración.
Demilune (frz.), im Festungsbauein Außenwerk vor Pünten ausFacen, Flanken und halbmondför-miger Kehle. Engl. demilune; frz. demi-lune; it. mezzalu-na; sp. medialuna.
Denkmal, Monument, 1. das zurErinnerung an eine Person oderein Ereignis errichtete Gedächtnis-mal, von der einfachen Erdauf-schüttung und Steinsetzung biszum architekton. und zum bildner.Kunstwerk. Die frühesten und ver-breitetsten D. sind der → *Grab-bau und das → *Grabdenkmal. Diemeisten der bis in die Gegenwartgebräuchl. D.typen stammen ausder Antike: Pyramide, Obelisk,Rundbau, Tetrapylon, Siegessäule,
127 Denkmal
Triumphbogen, Statue, Reiterd. undLöwend. Das MA. kannte außer-halb des kirchl. Bereichs keine D.für einzelne Personen. Der bron-zene Löwe, den Heinrich der Löwein Braunschweig aufstellen ließ, unddas »Reiterd.« auf dem Marktplatzzu Magdeburg waren ebenso wiedie überlebensgroßen »Rolandsta-tuen« norddt. Städte keine D., son-dern Hoheits- und Rechtszeichen.Auch die berühmten Stifterfigurenim Naumburger Dom können we-gen ihrer architekton. und geistigenBindung an den übergeordnetenZusammenhang der Kirche nichtals D. gelten. Erst die it. Renaissan-ce mit ihrer neuen Wertschätzungder Einzelpersönlichkeit nahm dieantike Überlieferung des freien, fürsich selbst bestehenden D. wiederauf. Im Barock wurde neben dembes. in Frankreich beliebten Tri-umphtor das Reiterd. der bevorzug-te D.typus. Der Frühklassizismusübernahm von antiken D.formenaußer dem Triumphbogen (Berlin,Brandenburger Tor; Paris, Arc deTriomphe) bes. den Rundtempel(→ *Monopteros), der als sog.»Freundschaftstempel« viele Park-anlagen zierte. Der Historismus des19. Jhs. brachte die antiken Tem-peln nachgebildeten »Ruhmes-hallen«, während die allgemeineD.freudigkeit dieser Epoche Städteund Dörfer bes. gern mit bronze-nen Porträtstatuen und -büsten aufsteinernen Sockeln versah. 2. Un-bewegl. und bewegl. Gegenständevon geschichtl. künstler. oder kul-tureller Bedeutung: Baud., Kunstd.,Klangd. (Orgeln, Glocken etc.),Bibliotheken und Sammlungen. Engl., frz. monument; it. monumento ono-rario, monumento commemorativo; sp. mo-numento.
Denkmalkirche, speziell eine Kir-che, die als Denkmal zur Erinne-rung an einen Sieg o. ä. gestiftetwurde, bes. in Rußland ausgebil-det. (Abb. S.130)Engl. memorial church; sp. iglesia conme-morativa.
Detail (frz.), 1. Einzelheit; 2. Bau-zeichnung einer Einzelheit inmöglichst großem Maßstab, z. B.Naturgröße.
Deutsche Säulenordnung, in derälteren Literatur vorkommendeBezeichnung für eine barockeVariante der → *ionischen Ord-nung. Engl. German order; it. ordine tedesco;sp. orden germánico.
Deutsches Band, vornehml. imBacksteinbau des 12. /13. Jhs. ver-breiteter Fries aus übereck gelegtenSteinen (Sägeschicht), deren vor-dere Kante in der Mauerflächeliegt, zumeist in Kombination miteinem parallel verlaufenden Rund-bogenfries. Frz. denticules, frise dentée; it. taglio a den-telli; sp. friso dentado.
Déva kotuva (Götterburg), sin-ghales. Bezeichnung für das ind.Harmika, den würfelförmigen Auf-satz auf dem Anda eines → *Stupa.
Dhvadschastambha (Sanskrit),ind. Stambha (Gedenksäule), derein religiöses Symbol oder einGötterbild trägt.
Diaconicum → Diakonikon.
Diadembogen, sphär. Bogen→ Raumbogen.
129 Diadembogen
Diagonalbogen, Kreuzbogen, imKreuzgewölbe der diagonal verlau-fende gratiggekehlte oder gerippteBogen; er besteht aus zwei Bogen-ästen (→ *Gewölbeformen). Engl. diagonal arch, spherical a., skew a.;frz. Kreuzbogen: arc d�ogive (diagonal); it. ar-co diagonale; sp. arco diagonal.
Diagonalrippe, Kreuzrippe, Ge-wölberippe an einem Diagonal-bogen (→ *Gewölbeformen). Engl. diagonal rib; frz. nervure diagonale;it. costolone diagonale.
Diakonikon, Diaconicum (gr.,lat.), in der altchristl.-oriental. Kir-che der symmetr. zur Prothesissüdl. neben der Apsis (Konche)angeordnete Nebenraum (→ *Ba-silika), der den Diakonen zum Um-kleiden und Vorbereiten des Meß-opfers sowie zur Aufbewahrungder liturg. Geräte und Gewänderdiente. Zunächst in den karoling.
Kirchenbau als → Pastophorienübernommen und allmähl. in der→ Sakristei zu einem Raum ver-einigt. Engl. diaconicon; it. diaconico; sp. diacóni-co.
Diamantierung, kleine, anein-andergereihte, in der Form vonEdelsteinfacetten ausgemeißelteOrnamentform an Baugliedern,auch zu Friesen zusammengefügt,bes. in der Spätromanik, Renais-sance und im Barock. → *Fries. Engl. diamond work; it. ornamentazione apunta di diamante; sp. ornamento cinceladoen forma de diamante.
Diagonalbogen 130
Denkmalkirche (Beispiel: Moskau,Basiliuskathedrale,16. Jh.)
Diamantquader heißen Quader,deren Ansichtsfläche (Bosse) ei-nem geschliffenen Diamanten ähnl.bearbeitet ist. Die D. sind eine Er-findung der it. Renaissance, wur-den nördl. der Alpen bes. zur Fas-sadengliederung (Sockel) verwen-det und kommen auch noch imBarock vor, → Rustika. It. bugnato a punta di diamante; sp. sillarcon realce en forma de diamante.
Diaphane Struktur, das von derGotik angestrebte Strukturprinzip,bei dem die Felder zwischen dentragenden Rippen, Pfeilern undStreben nicht massiv, sonderndurchscheinend (→ Maßwerk, Glas-malerei) oder zweischichtig räum-lich (Zweischichtengewölbe, Blend-maßwerk, Schleierwerk, Trifori-um) geschlossen werden. 1927 vonHans Jantzen eingeführte Bezeich-nung. It. struttura diafana; sp. estructura diáfana.
Diastole (gr.) Schranke zwischenOber- und Unterchor (→ *Chor),an der der Bischof zu den Gläu-bigen sprach. Frz. diastole; sp. diástole.
Diastylos (gr. weitsäulig) wirdnach Vitruv ein Säulentempel ge-nannt, bei dem das → *Interko-lumnium drei untere Säulendurch-messer beträgt.
Diazoma (gr. Gürtel), im Halb-kreis angeordneter, breiterer Um-gang zwischen den Sitzstufen imgriech. → Theaterbau. Engl. diazoma; it. diazoma; sp. diazoma.
Diele, Deele, Ärn, Ährn, Ern, ei-gentl. die ca. 5cm dicke Holzbohle
für Fußboden, Gerüstbau usw., dannder aus Brettern gefügte Zimmer-boden bzw. Hausflur oder Fußbo-den. Im niedersächs. Bauernhaus istdie D. (Däl) der große Mittelraum(Flett), in dem sich die Herdstellebefindet und von der aus die Stall-und Nebenräume bewirtschaftetwerden. Von hier auf das norddt.Bürgerhaus übertragen als Wohn-raum, Werkstatt und Verkaufsraum;später auch ein breiter Flur- undTreppenraum des städt. Bürgerhau-ses; im 19. Jh. ausgedehnt auf Tanz-böden (Tanzdiele) und Speisesäle(Eisdiele). Als vereinfachte »Hall«des engl. Landsitzes wurde die D.bis ins 20. Jh. im Land- und Wohn-haus verwendet und wie in Renais-sance und Barock künstler. ausge-staltet. Engl. Holzbohle: plank, deal, als Raum: hall,vestibule; frz. Holzbohle: planche, madrier,als Raum: vestibule, entrée; it. Holzbohle: ta-vola di pavimento, als Raum: atrio, ingresso,vestibolo; sp. Holzbohle: tabla, madero, alsFußboden: piso, als Raum: vestíbulo.
Dielenfußboden, Holzfußboden,bei dem auf die Deckenbalkenlageca. 5cm dicke Dielen genagelt sind,die entweder stumpf gestoßen odermittels Nut und Feder verbundensind. Engl. wooden flooring; frz. sol planchéié,aire en planches; it. pavimento di tavole, in-tavolato, assito; sp. piso de tablas cepilladas.
131 Dielenfußboden
Diamantquader
Dielenkopf (lat. mutulus), vierek-kige Platte an der Unterseite desGeisons gr. Tempel (→ *Dor. Ord-nung), je eine über jeder Triglypheund Metope, besetzt mit drei Rei-hen von je sechs zylindr. »Tropfen«(lat. guttae), deren Form auf denHolzbau zurückweist (Holznägel). Engl., frz. mutule; it. mutulo; sp. mútula.
Dienst, in der got. Baukunst einaus der schlanken roman. Wand-säule entwickeltes viertel- bis drei-viertelkreisförmiges oder birnen-förmiges, schlankes Säulchen, dasGurte, Rippen oder Archivoltenaufnimmt. Der D. ist in der Regelan einen Pfeilerkern angegliedertoder um ihn herum angeordnet(→ *Bündelpfeiler), oder der Wandvorgelegt, einzeln (Wanddienst)oder mehrere (→ *Dienstbündel).Der D. hat Basis und Kapitell, diein der Entwicklung des got. Stilsimmer kleiner werden und schließl.seit dem 15. Jh. ganz wegfallen.Der D. kann durch Wirtel undverkröpfte Gesimse unterteilt sein;sie steigen gewöhnl. vom Bodenoder von einem Sockel auf, könnenaber auch erst über den Arkaden-kapitellen beginnen. In den Wo-chenrechnungen des Prager Doms1372/78 als »dinst« erwähnt wurdedie Bezeichnung von G. G. Kallen-bach 1843/45 in die Baugeschichteeingeführt (→ *Wandaufbau). Engl. respond, bowtell, boltel; frz. perchecolonnette; it. semicolonna (maggiore) diun piliere, aletta del piliere; sp. caña, co-lumna embebida, c. entregada.
Dienstbündel, die Gesamtheit derDienste an einem Bündelpfeileroder an einer Hochschiffwand(→ Dienst). Frz. faisceau de perches; it. fascio di nerva-ture.
Diglyph (gr. Zweischlitz), eine inder it. Renaissance bes. von Vigno-la entwickelte Abart der → Trigly-phe, bei der dessen seitl. Halb-schlitze fehlen. Engl. diglyph; it., sp. diglifo.
Diokletianisches Fenster, halb-kreisförmiges Fenster, das durchzwei senkrechte Sturzstützen drei-
Dielenkopf 132
Dienstbündel
geteilt wird; erstes Auftreten an denDiokletiansthermen in Rom, daherauch Thermenfenster bezeichnet.Wiederaufnahme im 16. Jh. durchAndrea Palladio. Engl. Diocletian window; it. palladiana;sp. ventana dioclesina.
Dippelbalkendecke, Dippel-baumdecke. Massivdecke aus dichtgereihten verdübelten (»verdippel-ten«) Holzbalken (→ *Decke).
Dipteros (gr.), → *Tempelformmit doppelter Säulenstellung anden Langseiten, bes. im ion. Klein-asien verbreitet. Engl. dipteral temple; frz. diptère; it. dip-tero, dittero; sp. templo díptero.
Dipylon (gr.), mit zwei Durch-gängen versehene Toranlage, häu-fig mit Ecktürmen an antikenStadtmauern, auch als Eingangs-architektur an den Parodoi im gr.Theater oder in Palastanlagen. Engl., frz. dipylon; sp. portada con dos pilo-nes.
Dirnitz → Dürnitz.
Displuviatum, Displuvium (lat.regenabweisend) nennt Vitruv ein→ *Atrium (atrium d.) mit nachaußen geneigtem Dach, so daß dasRegenwasser statt in das Implu-vium nach außen abfließt.
Distylos in Antis, in der antikenArchitektur ein Tempel mit zweiSäulen zwischen den vorgezoge-nen → *Anten.
Divergenz (lat. auseinanderlau-fend), Bauteile oder Baugruppen(Wände eines Raumes oder Flächeneines Baukörpers, Fluchten einer
Straße) laufen häufig auseinander(divergieren), um ein Bauwerk ausder perspektiv. Einengung zu befrei-en oder um die Perspektive aufzu-heben. Engl., frz. divergence; it. divergenza; sp. di-vergencia.
Docke (von mhdt. tocke: Bündel,Knäuel, Walze), 1. kurzes, gewell-tes oder geschweiftes Säulchen mitrundem Querschnitt, durch Hand-griff verbunden als Geländer oder→ *Balustrade; 2. die Wangen(→ Wange 1) am Kirchen- oder→ *Chorgestühl). Engl. 1. baluster; frz. 1. balustre, parclose;it. 1. balaustro, 2. bamboccio sul divisoriodegli stalli; sp. 1. balaustrada, zanca.
Dodekastylos (gr.), Tempelformmit zwölfsäuliger Giebelfront. Engl. dodecastyle; frz. dodécastyle; it. dode-castilo.
Doldenkapitell, Blütenkapitell,weitausladendes → *Kapitell mitgeöffneten Blütenblättern, im Ge-gensatz zum geschlossenen → Knos-penkapitell.
Dollen, verdeckt liegendes, stab-förmiges Verbindungsmittel zurunverschiebl. Verbindung von sichkreuzenden und aufeinanderlie-genden Hölzern (Dübel, Holz-nagel). Engl. thole; frz. tolet; sp. tolete, escálamo.
Dolmen (kelt. Steintisch), vorge-schichtl. → Grabbau aus meist vier
133 Dolmen
Dolmen
bis sechs aufrecht stehenden unbe-hauenen Felsblöcken mit einemebensolchen als Deckstein darüber(Megalithbau), urspr. mit Erdeüberdeckt. Engl., frz., it., sp. dolmen.
Dom (lat. domus), im 6. /7. Jh. dasWohn- und Verwaltungshaus desBischofs (domus episcopalis), da-von auf das collegium canonico-rum, das Domkapitel, übertragen;im 12. /13. Jh. setzten die Kanoni-ker ihrem Namen de domo zu; sobedeutet Dom eigentl. das Stifts-kapitel, nicht der Bischof; heutewerden allgemein Bischofskirchenals Dom bezeichnet, in Süd-deutschland → Münster, in Frank-reich Kathedrale genannt. Engl. dome, cathedral; frz. dôme, cathédra-le; it. duomo; sp. catedral.
Domikalgewölbe, kuppelartigüberhöhte (gebuste) → *Gewölbe-form mit Diagonal- und Scheitel-rippen, die hauptsächl. in der spät-rom. Baukunst Südwestfrankreichs(Angers) und Westfalens vor-kommt. Engl. domical vault; frz. voûte domicale;it. volta domicale; sp. bóveda con cúpula.
Donjon (frz. v. lat. domus domina-tionis: Haus der Herrschaft), 1.auch → Keep, ein befestigter,mächtiger, rechteckiger oder run-der Wohnturm, mit Wehrnischen,Wehrgängen, Treppensystem, Kam-mern und auch Kapelle, der Wirt-schaftsfunktionen vereint und bes.in der Frühzeit des MA. die dau-ernd bewohnte Residenz desBurgherrn war. Der D. entwickeltesich wohl eher aus der einfachenTurmburg als aus der Turmhügel-burg normann. Prägung (→ Motte)
in Frankreich Anfang 11. Jh., inEngland nach der Invasion Wil-helm des Eroberers 1066, auch imNormannenreich Süditalien undin dt. Pfalzen und Burgen des 11.Jhs., unter frz. Einfluß seit demspäten 12. Jh. auch in Spanien undOstmitteleuropa. Der Bau von D.läuft im 14. Jh. aus.2. Im Festungsbau wird ein Kano-nenturm D. genannt, auch für dasKernwerk (Reduit) benutzt. Engl., frz. donjon; it. dongione, mastio,maschio; sp. torreón habitable fortificado.
Donnerbesen, im niederdt. Back-steinbau vorkommendes Orna-ment in Form eines aufwärts ge-richteten Besens, das nach demVolksglauben das Haus gegen Un-gewitter schützen sollte.
Doppelantentempel → Anten-tempel, → *Tempelformen.
Doppelarkade, Zwillingsarkade,zwei Arkaden, die durch einen siegemeinsam überspannenden Blend-bogen oder sichtbaren Entlastungs-bogen zu einer Einheit zusammen-faßt (→ gekuppelt) sind. Frz. arcade géminée; it. arcata doppia;sp. arcada doble.
Dom 134
Donjon
Doppelchörige Anlage, Kirchemit einem Ost- und einem West-chor, oft auch zusammen mit einerVerdoppelung des Querhauses, seitetwa 800 bis zur Spätromanik bes.in Deutschland vorkommend. DieSchaffung eines zweiten Choreskann durch Aufnahme eines neuenKirchenpatrons, eines Heiligen-grabs oder andere Gründe bedingtsein. Engl. double choir; frz. église à double che-vet, é. à double abside; it. impianto basilica-le a due cori; sp. iglesia con dos coros.
Doppeldach → *Dachdeckung.
Doppelfenster, → *Fenster mitzwei parallel hintereinander ge-schalteten Flügeln als Wärme-isolierung. Engl. double window; frz. fenêtre double;it. finestra con controfinestra, doppiafinestra; sp. dobleventana, contravidriera.
Doppelgewölbe, Doppelschalen-kuppel, ein Gewölbe mit vonein-
ander getrennten Innen- und Au-ßenschalen (→ Kuppel). Engl. double vault; frz. voûte double; it. voltaa doppia calotta; sp. bóveda de capas separa-das.
Doppelkapelle, bei Pfalzen undBurgen des MA. zwei übereinan-derliegende Kapellen, meist durcheine mittlere Öffnung miteinanderverbunden, jede mit einem eigenenEingang versehen. Die obere Kapel-le, vereinzelt mit Empore, war fürdie Herrschaft und ihr Gefolge, dieuntere für das Gesinde oder alsGrablege bestimmt. Häufigste Formder D. ist die Vierstützen-D. mitgeöffnetem Mitteljoch; eine andereGruppe bilden die ein- oder mehr-räumigen Rechteckbauten mit mitt-lerer Öffnung, 11.�12. Jh. im dt.Sprachraum. (Abb. S.136)Engl. two-storey chapel; frz. chapelle à deuxdoubles étages; it. cappella ad ambienti sov-rapposti; sp. capillas superpuestas.
Doppelkirche, zwei meist neben-einander, manchmal auch achsialhintereinander liegende Kirchen,bes. in frühchristl. und karoling.Zeit. Engl. two-storey church; frz. église à deuxétages; it. chiesa doppia; sp. iglesias contiguas.
Doppelkloster, Kloster, das auseinem Männer- und Frauenklosterbesteht. Engl. double monastary; frz. monasteriumduplex; sp. monasterio dúplice.
Doppelpilaster, zwei unmittelbarnebeneinander stehende und durchGesimse oder Wandgliederungaufeinander bezogene → Pilaster.→ *Pfeiler. Engl. coupled pilaster, double pilaster;frz. pilastre double; it pilastro binato;sp. pilastra doble, pilastras acopladas.
135 Doppelpilaster
Doppelchörige Anlage(Beispiel: Hildesheim, St. Michael,
11. Jh.)
Doppelschalenkuppel, ein kup-pelförmiges → Doppelgewölbe,dessen innere (untere) und äußere(obere) Schale konstruktiv durchStege miteinander verbunden seinkönnen, meist aber aus ästhet.Gründen getrennt sind, wobei die
innere Schale den Innenraum nachoben abschließt, die äußere die Ge-samtwirkung des Bauwerks nachaußen wesentl. mitbestimmt. Engl. double shell dome; frz. coupolecoquedouble; it. cupola a doppia calotta.
Doppelschifter → Schifter, dermit beiden Enden an einen Grat-oder Kehlsparren anfällt. Engl. double jack rafter; frz. empanon dou-ble; sp. coble cuartón.
Doppelstreben → Andreaskreuz.
Doppeltempel, zwei Gottheitengeweihter Tempel, der entweder inForm zweier Tempel nebeneinan-der steht oder mit den Cella-Schmalseiten aneinanderstoßendzu einem Großtempel verbundenist. Engl. temple with twin sanctuaries; frz.temple double; it. tempio doppio; sp. tem-plo doble.
Doppelschalenkuppel 136
(Beispiel: Paris, S. Chapelle, 13. Jh.)
(Beispiel: Landsberg, D., 13. Jh.)
Doppelkapelle
(Beispiel: Kom-Ombo)
Doppeltempel
Doppel-T-Träger, das für denneuzeitl. Stahlbau wichtigste Pro-fil, seit 1835/47 in Gebrauch, 1849erstmalig in einem Haus zu Parisals Deckenträger eingesetzt, alsmaterialsparendes statisch günsti-ges Trägerprofil. Engl. I-beam, H-beam, I-girder, H-girder;frz. poutre gemelle; it. trave a doppia T;sp. viga doble T.
Doppeltür, 1. → *Tür mit zwei ingeringem Abstand hintereinanderangeordneten Türblättern zurSchalldämmung oder Wärmeiso-lierung. 2. Aufgedoppelte → *Türmit zweischichtiger Holzkonstruk-tion. 3. Ungenau für Zweiflügel-tür, eine → *Tür mit relativ breiter,von zwei Türflügeln verschlosse-ner Öffnung. Engl. 1. double door; frz. 1. double porte,contre-p.; it. 1. controporta, 2. doppiaporta, 3. p. a due ante, p. a due battenti; sp.1. contrapuerta, 3. puerta de dos hojas.
Doppelturmfassade, flankiertmit ihren beiden Türmen den indas Mittelschiff führenden westl.Haupteingang; der Giebel des Mit-telschiffs kann sichtbar in dieVorderflucht der Türme vorgezo-gen oder durch einen horizontalschließenden Vorbau verdeckt sein.In der 2. Hälfte des 11. Jhs. ausWestwerken entwickelt, in Ober-italien und Frankreich verbreitet,in Süddeutschland und in derNormandie vorhanden, im 12. Jh.von den frz. Kathedralen über-nommen und in der Hochgotikweitergeführt. Frz. façade à deux tours; it. facciata a duetorri; sp. fachada de dos torres.
Doppelwürfelkapitell, Würfel-kapitell mit je zwei nebeneinander-liegenden Halbkreisbogen an jederder vier Seitenflächen (→ *Kapi-tell). Engl. double cushion capital; frz. chapiteaucubique divisé; it. capitello scanalato; sp. ca-pitel cúbico doble, c. c. dividido.
Dorf, eine Häufung ländl. Einzel-siedlungen (Bauernhäuser, Gehöf-te, Höfe) mitsamt allen zugehören-den Ländereien (Dorfflur, Dorf-mark, Feldmark), deren Bewohnerin der Mehrzahl Landwirtschaftbetreiben. Die Erscheinungsformdes D. kann sehr vielgestaltig sein(→ *Dorfformen) und ist außervon geograph. und wirtschaftl.Voraussetzungen auch vom sozia-len Aufbau der Dorfgemeinde ab-hängig. Engl. village; frz. village, hameau; it. villag-gio; sp. aldea, pueblo.
Dorfformen. Nach der Anord-nung der Gehöfte bzw. Häuserunterscheidet man folgende D.:
137 Dorfformen
(Beispiel: Rom, Venus und Roma)
1. Das Haufendorf, wenn umeinen Hauptplatz gruppiert auchPlatzdorf genannt, ist die lockersteder D. Die Gehöfte stehen ohnebestimmten Grundplan und ohneregelmäßige Frontstellung beiein-ander. Eine Abart oder auch Vor-form ist der aus nur wenigenGehöften bestehende Weiler. 2. Die geschlossenste D. ist der ausdem Wehr- und Schutzbedürfnisder Siedler entstandene Rundling(Runddorf), urspr. von einer Hek-ke umgeben, bei dem die Häusermit der Giebelseite um einen run-den, nur an einer Seite zugängl.Platz stehen. 3. Reihendörfer (Kettendörfer)sind: a) in Marschgebieten dasMarschhufendorf, dessen Häuseran der Innenseite eines Deiches
aufgereiht sind, während die zuden einzelnen Höfen gehörigenHufen sich senkrecht zum Deichhinter den Häusern erstrecken, b)das Waldhufendorf, meist inGebirgsgegenden oder -tälern, beidem die Gehöfte längs eines Bachsoder einer Talstraße liegen, dieHufen in langen parallelen Streifenbis in den Gebirgswald hinaufrei-chen. 4. Das Straßendorf mit einem ver-hältnismäßig kurzen Straßenzug,zu dessen beiden Seiten die Ge-höfte liegen. 5. Das Angerdorf, indessen Mitte sich die durchlaufen-de Straße zu einem breiten läng-lichen Anger erweitert, an dem dieHäuser liegen. Eine Vorform desAngerdorfs ist das sich um einenPlatz gruppierende Platzdorf.
Dorfformen 138
Dorfformen
1 Haufendorf1a Weiler2 Rundling
3 Waldhufendorf4 Straßendorf5 Angerdorf
Dorische Ordnung, älteste dergr. Ordnungen, im 7. Jh. im gr.Mutterland entstanden, später auchin Unteritalien und Sizilien (Ma-gna Graecia = Großgriechenland)weiterentwickelt, benannt nachden Dorern, einem der Haupt-stämme Altgriechenlands. In derD. O. ist das Fundament (Stereo-bat) des Tempels im Erdboden ver-borgen. Über das Bodenniveauhebt den Tempel ein meist dreistu-figer, aus Quadern gefügter Unter-bau (Krepis, Krepidoma) empor.Auf seiner oberen Fläche (Stylo-bat), zu der bei größeren Tempelneine aus kleineren Zwischenstufengebildete Treppe oder eine Rampehinaufführt, erheben sich dieWände und Säulen. Die Wand derCella besteht aus Quadern, dienicht durch Mörtel, sondern durchMetallklammern oder Dübel mit-einander verbunden sind. DieBlöcke der unteren Lage (Ortho-
staten) haben die doppelte Höheund Länge der übrigen Quader, diebei kleineren Tempeln in einfachenLäuferschichten angeordnet sind,während bei großen Tempeln bzw.dickeren Mauern Binder mit ge-doppelten Läufern abwechseln. DieSäulen stehen, ohne Basis, unmit-telbar auf dem Stylobat. Der mit16�20 vertikalen Furchen (Kannelu-ren) versehene Säulenschaft ist nachoben verjüngt und zeigt eine deutl.Schwellung (→ Entasis). Am obe-ren Ende des Säulenschaftes, dermeist aus mehreren, miteinanderverdübelten Trommeln zusammen-gesetzt ist, markiert eine rundum-laufende Einkerbung den Beginndes Säulenhalses (Hypotrachelion).Dieser ist aus demselben Block wiedas Kapitell gearbeitet und durchmehrere Riemchen oder Ringe(Anuli) mit überfallendem Profilabgeschlossen, nur an frühen Säu-len durch einen Blattkranz. Dar-
139 Dorische Ordnung
1 Krepis2 Rampe 3 Säulen 4 Gebälk
5 Dach 6 Cellawand 7 Tympanon 8 Firstakroterion
9 Eckakroterion 10 Interkolumnium11 Eckinterkolumnium
Dorische Ordnung
über folgt das Kapitell, das aus dembauchig ausladenden → *Echinusund der quadrat. Deckplatte (Aba-kus) besteht; am → *Antenkapitelltritt an die Stelle des Echinus ein→ *Kyma. Die Ausladung des Echi-nus und die Verjüngung des Säu-lenschaftes sind in der Frühzeitstärker als in der klass. Zeit, auchsind die frühen Säulen gedrunge-ner und die Zwischenräume zwi-schen ihnen (→ *Interkolumnium)enger. Das Gebälk beginnt mit demEpistyl (Architrav), dem aus meh-reren nebeneinander angeordnetenBlöcken bestehenden Steinbalken,
der horizontal auf den Säulen ruhtund die feste, einheitl. Grundlagefür den weiteren Oberbau ist. DasEpistyl wird oben von einer vor-springenden Leiste (Taenia) abge-schlossen, an deren sichtbarer Un-terfläche über jeder Säulenmitteund jedem Säulenzwischenraumkleine Leisten (Regulae) mit sechsTropfen (Guttae) an der Unterseiteangebracht sind. Die nächste hori-zontale Gebälkzone ist der Trigly-phenfries (Triglyphon), so genanntnach den ihn vertikal unterteilen-den Dreischlitzplatten (Triglyphen),die in der Säulenachse und in der
Dorische Ordnung 140
1 Säulenschaft 2 Kanneluren3 Kerbe4 Hals5 Anuli6 Echinus7 Abakus8 Architrav9 Taeniae10 Regulae11 Guttae 12 Fries13 Triglyphe 14 Metope15 Geison 16 Mutuli 17 Guttae18 Sima19 Wasserspeier20 Stirnziegel
Dorische Ordnung
Mitte des Interkolumniums liegen(→ *Triglyphenkonflikt). Die etwaquadrat. Felder zwischen ihnen hei-ßen Metopen und sind oft mit fi-gürl. Reliefs geschmückt. Als obe-rer Abschluß des Gebälks folgt überdem Triglyphon ein ringsumlaufen-des, weitausladendes Gesims, dasGeison oder Kranzgesims (Korona).Seine unterschnittene, etwas nachunten geneigte Untersicht trägtüber jeder Triglyphe und jeder Me-tope an viereckigen Hängeplatten(Mutuli, → Dielenköpfe) drei Rei-hen von sechs »Tropfen«. Über demGeison folgt eine aufgebogeneRinnleiste (Sima), die den Regenaufnimmt und durch meist als Lö-wenköpfe gebildete Wasserspeierabführt. Das dreieckige Giebelfeld(→ *Tympanon, Aëtoma) an derVorder- und Rückseite des Tem-pels wird an den Schrägseiten voneinem Schräggeison begrenzt, überdem in der Regel als Schmuck einebemalte Sima mit löwenköpfigenWasserspeiern am Ende angebrachtist. Die Spitze und die beiden seitl.Endpunkte des Giebels sind durchaufrechtstehende plast. Gebildeornamentaler oder figürl. Art, die→ *Akroterien, bes. betont. � Schonbei der D.O. spielt die Polychromieeine wesentl. Rolle, bes. die Bema-lung der Einzelglieder des Gebälksteils mit einfarbigem Anstrich, teilsmit mehrfarbigen Ornamenten. Sowerden die vertikal zusammenge-hörigen Glieder (Triglyphen, Regu-lae, Mutuli) meist dunkelblau, diehorizontal verlaufenden Glieder(die obere Abschlußleiste des Epi-styls und die Unterseite des Gei-sons zwischen den Tropfenplatten)kräftig rot gefärbt, während dieTropfen gelb oder in einer anderen
hellen Farbe gehalten sind. DieMetopen blieben weiß, außer wennsie mit Skulpturen geschmückt wa-ren, die ein farbiger Hintergrund(rot oder blau) stärker hervortretenließ (→ *Polychromie). Engl. Doric order; frz. ordre dorique; it. or-dine dorico; sp. orden dórico.
Dorisches Kapitell, bestehendaus runden Polstern (Echinus) undquadrat. Deckplatte (Abakus); cha-rakterist. Element der → *dori-schen Ordnung. Die frühen D. K.sind weitausladend, bei den späte-ren schrumpft der Echinus zueinem umgekehrt flachen Kegel-stumpf zusammen. Frz. chapiteau dorique; it. capitello dorico;sp. capitel dórico.
Dorische Säule → *DorischeOrdnung.
Dorment, Gang vor den Zelleneines Klosters, danach auch Be-zeichnung für das → *Dormito-rium.
Dormitorium, Dorment (lat. dor-mire: schlafen), urspr. jedes Schlaf-gemach, dann Schlafsaal der Mön-che, meist im Obergeschoß desöstl. Klosterflügels, auch die Ge-
141 Dormitorium
1 Architrav 2 Abakus 3 Echinus4 Anuli
5 Hypotrachelion 6 Scamillus7 Schaft mit
Kanneluren
Dorisches Kapitell
samtheit der späteren Einzelzellenund somit der entsprechende Klo-sterflügel. Engl. dormitory; it., sp. dormitorio.
Dornse, Döns, niederdt. für Stu-be, Zimmer; in den Burgen =Dürnitz, beheizter Aufenthalts-raum (→ Kemenate). Sp. habitación.
Dorsale (lat. dorsum: Rücken), dieRückwand des → *Chorgestühls,architekton. gegliedert und oft mitBaldachinen und reichem Ge-sprenge, Fialen, Wimpergen oderTabernakeln mit Figuren; auch inStein monumental gestaltet undmit der Architektur verbunden. Engl. back; frz. dorsal; it. dorsale, schienale;sp. muro posterior del sitial del coro.
Dosdane, zur Ableitung des Re-gen- und Schmelzwassers dienen-de, dachartige Übermauerung desGewölberückens bei größeren, mitErdauflage versehenen Festungs-bauten; die Wasserableitung erfolgtdurch Fallschächte oder Wasser-speier.
Dossierung → Böschung.
Doxale (mittellat.), vielleicht vonder liturg. Lobpreisung (Doxo-logie) abgeleiteter Begriff, mit demim MA. der Lettner, seltener dasChorgitter, später aber auch dieSängertribüne und die Orgelem-pore bezeichnet wurden. Engl. rood screen, r. loft; it. grata di canto-ria; sp. plataforma alta, tribuna para coro yórgano.
Draperie (frz.), dekorative Stoff-behänge, bereits in der Antike zurAusschmückung von kultischenund profanen Innenräumen be-nutzt, in frühchristl. und ma. Zeitan Altären und Kirchenwändenverwendet, erlangt die D. in denFest- und Theaterdekorationen des17. /18. Jhs. große Bedeutung,schließl. aus Frankreich kommendals Innendekoration (u. a. Fenster-vorhänge) und bei Möbeln bisEnde 18. Jh.; Ende des 19. Jhs. als→ Portière wiederaufgenommen. Engl. drapery; frz. draperie; it. drapperia;sp. drapeado.
Dravidha (ind.), über der Cellaeines ind. Tempels aufgebauterTurm (→ *Sikhara) von achtecki-gem Grundriß.
Drehbrücke → Brücke.
Drehbühne, eine drehbare, mehr-teilige Bühne, die raschen Szenen-wechsel ermöglicht. Die D. kannals Drehscheibe bei Bedarf auf denBühnenboden aufgelegt werdenoder aber als Drehzylinderbühneständig eingebaut sein. Engl. revolving stage; frz. scène tournante;it. palcoscenico girevole, scena girevole;sp. escenario giratorio.
Dornse 142
Dormitorium (Beispiel: Blaubeuren)
Drehtür, eine um eine mittlereAchse bewegl. → *Tür mit dreioder vier im Winkel angeordnetenBlättern (z.B. Außentüren bei Ho-tels). Engl. revolving door; frz. porte à tambour,p. tournante; it. porta girevole; sp. puertagiratoria.
Dreiapsidenanlage, dreischiffigeBasilika ohne Querhaus, bei derMittelschiff und Seitenschiffe je ineiner Apsis enden, bes. in Italienund Süddeutschland in der Roma-nik. Engl. triconch apse; frz. église triabsidiale;it. impianto triabsidale; sp. iglesia triabsidal.
Dreiapsidenchor, ungenaue Be-zeichnung für → Dreiapsiden-anlage, → Dreiapsidensaal. Engl. triapsidial choir; frz. chevet triabsidial;it. coro triabsidato; sp. coro triabsidal.
Dreiapsidensaal, Saalkirche mitdrei fast gleich großen Apsiden ander Ostmauer, im 8.�10. Jh. bes. inGraubünden/Schweiz verbreitet,sonst selten. Engl. triapsidial hall; frz. salle triabsidiale;it. aula triabsidata; sp. sala triabsidal.
Dreiblatt, aus drei gleich großenSpitzbogen bestehende Einzelfigurdes got. Maßwerks (→ *Blatt 2). Engl. trefoil; frz. trèfle, tierce-feuille; it. tri-foglio; sp. trifolio, trébol.
Dreibogen, 1. → Drillingsbogen,2. → Triforium, 3. → *Blatt.
Dreieckverband, die einfachsteGrundfigur einer Fachwerkwandzur Herstellung ihrer Stand-festigkeit (→ Band, → Strebe). Engl. diagonal bracing; frz. treillis triangu-laire; sp. trabazón triangular.
Dreifaltigkeitskirchen, der hl.Dreifaltigkeit geweihte, meist aufein Dreieck oder einen Dreipaßaufgebaute Zentralbauten, bes. inder Barockzeit vorkommend. Engl. Trinity church; frz. église de la Trinité;it. chiesa della trinità; sp. iglesias de la Tri-nidad.
Dreifensterhaus, städt. Wohn-haus mit dreifenstriger Straßen-front von etwa 5m Länge, in Mit-tel- und Westeuropa vorherrschend.Frz. maison à triplet; sp. casa con trente detres ventanas.
Dreiflügelanlage (Triklinium 2),Grundrißform des barocken Schloß-baues mit einem Hauptgebäude
143 Dreiflügelanlage
Dreifaltigkeitskirchen (Beispiel: Kappel bei Waldsassen 17. Jh.)
(→ *Corps de Logis) und zweimeist kürzeren Seitenflügeln, die ei-nen offenen Hof (Ehrenhof, Courd�honneur) U-förmig umfassen. Engl. three-winged complex; sp. complejode tres alas.
Dreigelenkbogen, an beiden Auf-lagern und im Scheitelpunkt mitbewegl. Gelenken versehener Bo-gen, der statisch bestimmt ist, d.h.,daß die Zerlegung der Gesamt-resultierenden aller angreifendenKräfte in die beiden Kämpfer-drücke eindeutig wird. Engl. three-hinged arch; frz. arc à trois ro-tules; it. arco a tre cerniere; sp. arco de tresbisagras.
Dreikantleisten, Dreieckleisten,Holzleisten von dreieckigem Quer-schnitt, die bei Fachwerkwänden,Holzzargen usw. an das Holzwerkgenagelt werden, um einen dichtenAnschluß zwischen Holz und Aus-fachung bzw. Mauerwerk zu erzie-len. Engl. triangular fillet; frz. latte triangulaire;it. listello a sezione triangolare; sp. listonestriangulares.
Dreikonchenanlage, Kirche mitdrei etwa gleichgroßen, halbrun-den oder polygonalen Konchen(Trikonchos, Trichorum, Cella tri-
chora), die im Gegensatz zumDreiapsidenchor (→ *Chor) nachdrei Richtungen weisen, so daßsich ein zentralisierender Abschlußin der Form eines regelmäßigenKleeblattes ergibt, meist als Choran Basiliken, aber auch als Kapellemit wesentl. kleinerem Rechteck-saal. D. kommen vereinzelt auchmit einem um alle Konchen her-umgeführten Umgang vor. Engl. triconch (church); frz. église à plantrichonque; it. triconco; sp. iglesia dispuestaen tres conchas.
Dreipaß, aus drei Kreisbogen zu-sammengesetzte Figur als roman.Fenster oder got. Maßwerkfigur inder Art eines Kleeblatts (→ *Paß).Nicht zu verwechseln mit Drei-blatt (→ *Blatt). Engl. trefoil; frz. trilobe, trèfle; it. trilobo;sp. ornamento trilobulado.
Dreigelenkbogen 144
Dreikonchenanlage
Dreipaß
Dreipaßbogen, Kleeblattbogen,→ *Bogenformen.
Dreischeibenhochhaus, aus dreischmalen, hohen Bauteilen beste-hendes Bürohaus, in den 50erJahren des 20. Jhs. entwickelt.
Dreischlitz, Verdeutschung von→ Triglyphe (→ *Dorische Ord-nung). Engl. triglyph; frz. triglyphe; it. triglifo;sp. tríglifo.
Dreischneuß, aus drei in einemKreis angeordneten → Fischblasenbestehende Figur des Maßwerks(→ *Schneuß). Frz. trèfle flamboyant; it. traforo a triplavescica di pesce; sp. tracería vesicular triple.
Dreiseithof, reguläre Hofanlage,bei dem auf drei Seiten Gebäude(Wohnstallhaus, Stall oder Schup-pen, Scheune oder in Norddt.Wohnhaus, Stall, Scheune) stehen;die vierte Seite schließt ein Zaunmit Tor (geschlossener D.), odersie bleibt offen (offener D.).
Dreisitz, Levitenstuhl, ein drei-oder fünfgeteilter Sitz, der mittlereerhöht, aus Stein oder Holz, ineiner Wandnische oder vor derWand auf der Epistelseite (Süd-seite) des Chores, seitl. des Altarszum Sitzen der Celebranten undder Diakone während des Gloriaund Credo der feierl. Messe. D. inder Gotik mit Wimpergen undMaßwerk reich geschmückt. InDom, Kollegiats- und Kloster-kirchen wird er hervorgehobenerBestandteil des Chorgestühls, bes.im Barock in prunkvoller Aus-gestaltung. Engl. sedile; frz. gradins, strotére; it. cattedratripla, seggio triplo; sp. escaño triple.
Dreispänner, Typ eines mehrge-schossigen → Miethauses, bei demin jedem Geschoß drei Wohnun-gen am Treppenhaus angeordnetsind (→ *Sternhaus).
Dreistrahl, Rippendreistrahl, voneinem Kämpferpunkt ausgehendewinkelteilende Rippe, z. B. zwi-schen Gurt- und Schildrippe, dienicht zum Gewölbescheitel auf-steigt, sondern sich mit einer ent-sprechenden Rippe meist in ei-nem Schlußstein oder in einer Ver-bindungsrippe trifft und so einedreieckige Gewölbekappe bildet(→ Dreistrahlgewölbe). Engl. triradial ribs; sp. cuaderna triradiada.
Dreistrahlgewölbe, Rippendrei-strahlgewölbe, dreikappiges Ge-wölbe, in dem der → Dreistrahlverwendet wird, zumeist über eindreieckiges Joch (Chorumgang),schon im frühen MA. als Grat-dreistrahlgewölbe zum Schließendreieckiger Wölbfelder verwendet.In der Spätgotik als Rippendrei-strahlgewölbe Grundform derDeckenwölbung.
Dreiturmgruppe, besteht aus ei-nem mächtigen mehrgeschossigenWestturm, der von zwei schmale-ren, oft rund oder vieleckig, beglei-tet wird. Vorkommen hauptsächl.auf das nw. Europa beschränkt, im10. Jh. an sächs. Damenstiftskir-chen entstanden als Entwicklungaus dem → *Westwerk; die Erd-geschoßhalle kann einen Westchoraufnehmen; in der 1. Hälfte des 12.Jhs. weite Verbreitung, im späteren12. Jh. aufgegeben. Engl. group of three towers; sp. grupo detres torres.
145 Dreiturmgruppe
Dreiviertelsäule, eine nur zueinem kleinen Teil in die rückwär-tige Mauer oder Pfeilerkern einge-bundene Säule. Engl. engaged column; frz. colonne enga-gée, c. de trois quarts; it. colonna a tre quar-ti di cerchio; sp. columna entregada, c. em-bebida.
Dreiviertelstab, ein → Rundstabmit dreiviertelkreisförmigem Quer-schnitt. Engl. three-quarter round; frz. moulure entrois quarts de rond; it. modanatura a trequarti di cerchio; sp. moldura con perfil detres cuartos de círculo.
Dreizellenchor, an die Saalkircheoder das Vorchorjoch der drei-schiffigen Basilika werden recht-eckige Räume (→ Pastophorien,Secretarium) seitl. angefügt; dernördl. Raum (Prothesis) dient zurVorbereitung des Meßopfers, dersüdl. Raum (Diakonikon) zur Auf-bewahrung der liturg. Gewänderund Geräte; auch dienen sie zurAufbewahrung von Reliquien, alsGrablege oder als Privatkapellen.Nachdem sich in karoling. Zeit dieeinfachere röm. Liturgie durch-setzt, die die Vormesse und den In-troitus der gallikan. Liturgie aufgibt,verlieren sich die Pastophorien undwerden durch die einseitig an denChor angefügte → Sakristei (Al-maria, Almer, Treskammer) ersetzt. Frz. ch�ur à trois niches; sp. coro con tresnichos.
Drempel, Kniestock, niedrige,nur etwa kniehohe Wand über derobersten Deckenbalkenlage; der D.entsteht bei der Verwendung derHochrähmzimmerung mit Anker-balken und in der Geschoßbau-weise. Frz. montant, jambette; sp. jabalcón.
Drillingsbogen, drei Bogen untereinem übergreifenden größerenBogen (Drillingsfenster, Drillings-arkade). Frz. arcature ternée, triplet d�arc; it. arco tri-plo; sp. arco triple.
Drillingsfenster, ein durch zweiMittelsäulen oder -pfeiler unter-teiltes Fenster oder drei Fenster,die durch einen übergreifendenBogen, Blendbogen oder Entla-stungsbogen, zusammengeschlos-sen sind. D. kommen vor allem inKreuzgängen der roman. und früh-got. Epoche vor (→ *Fensterfor-men). Frz. fenêtre tiercée, f. triplet; it. trifora;sp. ventana triple.
Drolerie, (frz. drôle: scherzhaft)im MA. eine in dekorativem Zu-sammenhang benutzte grotesk-phantast. oder satir. Darstellung wie
Dreiviertelsäule 146
Drolerie(Beispiel: Millstatt, Kreuzgang)
Gaukler, Spieler, Narren, Musikan-ten, Tiere, Fabel- und Mischwe-sen, einzeln oder zu Gruppen, bes.an roman. und got. Kapitellen,Konsolen und Schlußsteinen sowiebes. an den Miserikordien der got.Chorgestühle. It. drolerie; sp. elemento decorativo grotes-co.
Dromos (gr. Lauf, Gang), Zu-gangsweg zu den ganz oder teil-weise unterird. angelegten antikenKammer- und Kuppelgräbern. Frz., it., sp. dromos.
Drudenfuß → *Pentagramm.
Dübel, Dollen, Bauelemente ausHolz (Holzd.), Metall (Metalld.,Dollen), seltener aus Stein (Steind.),die dazu dienen, Bauteile (Balken,Unterzüge, Steine, Gesimse u.dergl.) gegen seitl. Verschieben, Kip-pen oder Verkanten zu schützen. ImHolzbau kommen vornehmlichHartholzd. vor, die auch prisma-tisch oder schwalbenschwanzför-mig sein können und oft nochdurch Verschraubungen verstärktwerden. Im Steinbau werden meistsenkrecht stehende Metalld. (Dol-len) verwendet. Engl. peg, dowel; frz. cheville, goujon, fen-ton; it. tassello; sp. tarugo.
Durchfahrthaus, ein Mittellängs-dielenhaus, bei dem die Wagendurch das Tor auf die Diele einfah-ren und auf der anderen Seite wie-der hinausfahren können, bes. beiScheunen, als Durchgangsdielen-haus allgemein eine junge Bau-ernhausform, jedoch früher schonin den Elbmarschen und auf Feh-marn. Wohnräume und selbst dieKüche liegen in den Seitenschif-fen, die erweitert werden könnendurch seitl. Anbauten. Engl. passageway building; sp. edificio tran-sitable.
Durchhaus, Kaufmannshaus mitein oder mehreren hintereinander-liegenden schmalen Höfen einesvon zwei Straßen berührten Grund-stücks, die miteinander durchDurchfahrten verbunden warenund damit das Durchfahren ohneWendemanöver gestatteten. Im 15.Jh. entstanden und im 17./18. Jh. zupalaisartigen Formen entwickelt,vielfältige Hofgestaltung durchGalerien, Portale, Treppenanlagen.Ende des 19. Jhs. im städt. Miet-hausbau mit Hinterhofbebauungenwiederaufgenommen.
Durchlaufträger, Eisenträger oderBalken, die über mehr als zweiAuflager ungestoßen durchlaufen;seit dem frühen MA. bei Dachbin-derbalken und Deckenbalken mitauskragenden belasteten Endenangewandt, da so die Durchbie-gung weitgespannter Balken redu-ziert werden kann (→ Überhang). Engl. continuous beam, c. girder; frz. pou-tre continue; it. trave continua; sp. viga con-tinua.
Durchlichtetes Triforium, → Tri-forium, dessen Rückwand durch-
147 Durchlichtetes Triforium
Dübela Holzdübel b Metalldübel
fenstert ist, so daß die Fensterzonebis auf die Seitenschiffgewölbeheruntergezogen scheint; mögl.durch die Abwalmung der Sei-tenschiffdächer. Seit ca. 1225/30 inMittelfrankreich ausgebildet undvon dort verbreitet. Engl. lighted triforium; it. triforio finestra-to; sp. triforio transparentado.
Durchschuß, ausgleichende undfestigende Backsteinschicht inBruchstein- oder Tuffmauerwerk,bes. bei byzantin. Bauten. It. ricorso laterizio; sp. capa de ladrillos pararefuerzo.
Dürnitz (slaw. dwornitza, turnitza:Feuerstätte), Bezeichnung für einenheizbaren Raum oder eine Halleeiner → *Burg (→ Kemenate). Frz. chambre à feu; sp. habitación calefac-cionada.
E
Echancrute (frz.), Crochet,schmaler Durchgang zwischen Tra-verse und Glacis. Frz. échancrure.
Echinus (gr. echinos: Igel, Seeigel),Polster, der wulstartige, im Quer-schnitt kreisförmige Teil des dor.Kapitells, der zwischen der Deck-platte (Abacus) und dem Säu-lenschaft vermittelt (→ *DorischeOrdnung) mit Ringen (Anuli) anseiner unteren Kante. In der Früh-zeit stark bauchig und weit ausla-dend, erscheint der E. in der klass.Form gestraffter und erstarrt in dernachklass. Zeit fast zum Kegel-stumpf. Sp. equino.
Eckblatt, blattförmige → *Eckzier.
Eckkamm, im Holzbau hakenför-mige Ecküberblattung, auch schwal-benschwanzförmige Ausarbeitungdes Hakens, hierdurch wird einAusweichen des Holzes nach bei-den Richtungen verhindert. Derverdeckte E. ist so gearbeitet, daßkein Hirnholz sichtbar ist. Engl. corner cogged joint; frz. assemblaged�angle; it. giunzione a denti angolare;sp. ensamblaje angular.
Eckklaue, klauenförmige → *Eck-zier. Engl. griffe, spur; frz. griffe, patte de base.
Eckknolle, knollenförmige →*Eckzier. Engl. griffe, spur; it. spirone, unghie d�an-golo.
Eckkonflikt → *Triglyphenkon-flikt.
Eckkontraktion, Verringerungdes Eckinterkolumniums. Die E.tritt am dor. Tempel als Folge des→ *Triglyphenkonfliktes auf. Beiden anderen Säulenordnungen tritt
Durchschuß 148
Echinus
manchmal eine E. (meist über zweiInterkolumnien) als opt. Korrekturauf. Engl. angle contraction; it. contrazioneangolare; sp. contracción angular.
Eckpilaster, an einer Ecke ange-brachter → Pilaster mit zwei An-sichtsflächen. Engl. corner construction; frz. pilastre d�an-gle; it. parasta angolare; sp. pilastra angular.
Eckpfosten → Bundständer.
Eckquader, grob oder glatt behau-ene Werksteine an Gebäudeeckenmit wechselweiser Überlagerungder Schmal- und Breitseiten, zu-nächst zur Kantenfestigung beiBruchsteinmauern, später auch ar-chitekton. Gestaltungsmittel. Engl. quoin; it. concio comune, conciod�angolo; sp. piedra angular.
Eckrisalit → *Risalit.
Ecksporn → *Eckzier.
Ecktrichter, Verdeutschung von→ *Trompe.
Ecküberblattung, Verbindung vonzwei im rechten Winkel zusam-menstoßenden Balken mit Hilfedes → Blatts. Die häufigsten For-men sind die gerade E., die E. mitschrägem Schnitt und die haken-förmige E. mit Schwalbenschwanz;die E. kann auch auf Gehrunggeschnitten werden. Frz. entaillage d�angle à mi-bois; it. incastrod�angolo; sp. ensamble angular a mediamadera.
Eckverband, 1. im Mauerwerkdie wechselweise Einbindung derMauersteine an der Gebäudeecke
(→ Eckquader). 2. Im Holzbau fürliegende Hölzer, Schwellen, Rähmusw. durch Schlitzung, Blattung,Kämmung Verbindung der an derEcke im rechten Winkel hergestell-ten Verbindung.Engl. 1. edge bond, corner b.; frz. 1. assem-blage angulaire, chaîne d�encoignure; it. 1.concatenamento d�angolo, 2. giunto ango-lare; sp. trabazón angular, cadena angular.
Eckzier, Ecksporn, blatt-, knollen-oder spornähnl. Verzierung an denvier Zwickeln, die auf der quadrat.Fußplatte (Plinthe) einer Säuleinfolge der Kreisform der Basisentstehen. Das E. kommt in vielenVariationen hauptsächl. in der ro-man. und frühgot. Baukunst vor.An seine Stelle können bes. in derRomanik auch kleine Fabelwesen,z. T. mit Menschenköpfen, treten. Frz. oreillon, crossette, griffe; it. decorazio-ne d�angolo protezionale; sp. decoraciónangular.
149 Eckzier
Eckzier
Ehrenbogen → *Triumphbogen.
Ehrenhof → Cour d�honneur(→ *Corps de Logis).
Ehrenmal, → Denkmal oder Ge-denkstein, auch architekton. Anla-ge zum Gedächtnis an die Gefalle-nen. Engl. war memorial, cenotaph; frz. mémo-rial, monument aux victimes de la guerre;it. monumento, mausoleo, cenotafio; sp. ce-notafio, monumento conmemorativo a loscaídos.
Ehrenpforte → Ehrentor.
Ehrensäule, Denkmal in Form ei-ner Säule, schon im gr. Delphi undin spätröm. Zeit bekannt, in neue-rer Zeit nachgeahmt (→ *Triumph-bogen). Engl. column monument; frz. colonned�honneur; it. colonna onoraria; sp. monu-mento en forma de columna.
Ehrentor, ein für kurze Zeit beiFestlichkeiten errichtetes Tor imZuge der Feststraße, aus Holz mitStoffen, Fahnen, Blumen und Em-blemen geschmückt, im Unter-schied zu den dauerhaft aus Steinerrichteten → *Triumphbogen. Engl. gate of honor; frz. porte d�honneur;sp. puerta de honor.
Eierstab, konvexe Zierleiste auswechselnd senkrecht stehenden, ei-förmigen und pfeilspitzartigen Ge-bilden, unten und auch oben voneiner Perlschnur (→ *Astragal) ab-geschlossen, in der röm. Architek-tur und in der Renaissance bevor-zugtes Schmuckglied (→ *Kyma).Engl. egg and dart (pattern); frz. goudron àoves, fusarolle, ionisches Kymation: cymaiseionique; it. fusarola, fusaiola; sp. molduraconvexa ornamental.
Eigenbefestigung, feste Höfeoder Wohntürme in frühma. Städ-ten Deutschlands und Oberita-liens, mit deren Errichtung feudaleGrundherren neben der Burg desStadtherrn ihre Macht dokumen-tierten und festigten; Standorte anwichtigen Punkten, bes. an Märk-ten und Hauptdurchgangsstraßen.
Eigenkirche, im frühen MA. eineKirche, die als Lehen ihrem weltl.Stifter und Grundherrn unter-stand, der auch die Geistlichen fürsie ernannte.
Einblendung, Säule in nischenar-tiger Wandvertiefung.
Ehrenbogen 150
Eingeblendete Säule
Eingezogene Strebepfeiler nenntman Strebepfeiler, die in ihremunteren Teil oder in voller Höhe inden Innenraum einbezogen sindund Rechtecknischen (→ Einsatz-kapellen) umschließen. Frz. contrefort intérieur, pilier d�arcbou-tant; sp. pilar de arbotante.
Einhälsung, Einhalsung, Schlitz(oder natürl. Gabelung) am oberenEnde einer Stütze zur Aufnahmeeines waagerechten, für das Ein-passen im Querschnitt reduziertenHolzes oder eines im vollen Quer-schnitt belassenen Holzes (dannregional auch Schale). Engl. bridle joint; frz. assemblage parenfourchement en T; sp. ensamblaje porencabriamiento en T.
Einhäuptig, häuptig, wird einMauerwerk genannt, das gegen dasErdreich stößt und deshalb nur aneiner Seite sichtbar ist (→ Haupt 1).
Einhaus, Bezeichnung für einBauernhaus, das alle seine Funk-tionen unter einem Dach vereinigt,im Gegensatz zum Gehöft, dasWohnhaus, Ställe und Scheuerunterscheidet. Das E. kommt bes.im alemann. und bayr. Gebiet vor(→ *Schwarzwaldhaus, → *Barg-hus, → *Niedersachsenhaus).
Einhüftig, 1. ein Bogen oder Ge-wölbe, bei dem die korrespondie-renden Kämpferpunkte nicht inderselben Höhe liegen (→ *Bogen-
formen), 2. einbündig, ein Gebäu-de mit Flur, an dem nur einseitigRäume liegen. Engl. rampant; it. rampante; sp. rampante.
Einlaßpforte, die in einem gro-ßen Torflügel angebrachte kleineTür für Fußgänger. Engl. wicket; frz. guichet; it. portello; sp. por-tezuela de entrada.
Einliegerwohnung, in Sied-lungshäusern meist im Oberge-schoß oder bei Hangbebauung imUntergeschoß angeordnete kleine,aber selbständige Wohnung, dievom Hauseigentümer an einenEinlieger vermietet wird.
Einödhof, im Allgäu und in Tirolder bäuerl. Einzelhof, vorwiegendfür die Rinderzucht bestimmt.
Einreiber-Verschluß, bei einflügl.Fenstern, bzw. mit festem Mit-telpfosten Fensterverschluß aus ei-ner Flacheisen-Zunge, die an einerwaagerecht drehbaren Welle mitDrehknauf (Olive) befestigt istund in ein am gegenüberliegendenFutterrahmen oder Fensterpfostenangebrachtes Schließblech eingreift.Engl. entering catch, casement fastener;frz. tourniquet intérieur; it. saliscendi;sp. cerradura de torniquete embebido.
Einsatzkapellen, als Kapellen die-nende rechteckige oder trapezför-mige Räume, die zwischen einge-zogenen Strebepfeilern liegen undhauptsächl. in der Spätgotik vor-kommen (→ Wandpfeilerkirche). Engl. side chapel, lateral c.; frz. chapellelatérale; sp. capilla lateral.
Einschub, Bretter oder Schwarten,die als Einschubdecke oder Fehl-
151 Einschub
Einhaus (bayr. Typus)
boden in die Balken einer → Holz-balkendecke eingeschoben werden. Engl. false ceiling, sound floor; frz. lan-guette; it. assito inferiore; sp. lengüeta.
Einschubleiste, an die Deckenbal-ken angenagelte Leisten als Auf-lager für die zwischen die Balkengelegten Bretter bzw. Schwarten(→ Holzbalkendecke). Frz. entrevous, couchis; it. listello daincasso; sp. listel de interposición.
Einturmfassade, ein zumeist qua-drat., selten runder Turm axial vordem Mittelschiff einer Basilika,Hallen- oder Saalkirche. Der Turmenthält den Eingang oder eine Ein-gangshalle im Erdgeschoß, häufigeine Empore oder Kapelle im Ober-geschoß; ohne W.-Eingang kann erals W.-Chor dienen. Die frühestenE. finden sich Ende des 11. Jhs.,bes. bei den Pfarrkirchen der Gotikbeliebt. It. facciata a torre; sp. fachada de torre.
Einziehung, Verengung des Quer-schnittes, bezogen auf die Längs-achse. So kann z.B. der Chor einerKirche gegenüber dem breiterenLanghaus »eingezogen« sein. Engl. hollow, recess; frz. gorge; sp. estrecha-miento.
Eisbrecher, keilförmiger Vorbaueines Brückenpfeilers, stromauf-wärts gerichtet, als Schutz gegenTreibeis. Engl. ice apron; frz. souillard, briseglace,avant-bec, éperon; it. rompighiaccio;sp. rompehielos.
Eisenbeton, veraltete Bezeich-nung für → *Stahlbeton. Engl. reinforced concrete; frz. béton armé;it. cemento armato; sp. hormigón armado.
Eisenschuh, gußeiserne Hüllezum Schutz des Hirnholzes beiPfählen, Streben usw. Frz. sabot; sp. envoltura de fierro fundido.
Ellipsenbogen, ein Bogen, dessenKrümmung aus einer in der Längs-richtung halbierten Ellipse besteht(→ *Bogenformen). Im Gewölbe-bau kommt der E. vor allem alsDiagonalbogen des Kreuzgewölbesüber rechteckigem Grundriß vor. Engl. elliptical arch; frz. arc en ellipse;it. arco ellittico; sp. arco elíptico.
Elliptisches Gewölbe, Gewölbeüber dem Grundriß einer Ellipse,hauptsächl. im böhm. und fränk.Barock vorkommend. Engl. elliptical vault; frz. voûte en ellipse;it. volta ellittica; sp. bóveda elíptica.
Emblem (gr. emblema: das Ein-gesetzte), in der gr. Antike meistsinnbildl. Verzierung (Ziselierung)an Kunstwerken aus Metall, danachallgemein Bezeichnung für ein zurDekoration verwendetes Symbolgegenständl. Art (z.B. Krone, Palm-zweig, Schwert u.a.). → Trophäe 2. Engl. emblem; frz. emblème; it., sp. emble-ma.
Embrasure (frz.), eine Schieß-scharte im Festungsbau. Engl., frz. embrasure; it. cannoniera; sp. tro-nera, cañonera.
Empfangsgebäude, der die Stra-ße mit den Zügen verbindendehochbautechnische Teil des Bahn-hofs, 1850 mit den notwendigen
Einschubleiste 152
Einziehung
Räumen definiert, seit 1893 nachEinführung der Fahrkartenprüfungmit abgesperrten Bahnsteigen.Fahrkartenschalter und Gepäckab-fertigung liegen rechts vom Ein-gang, in der Mitte die Sperre undlinks Warteräume. Zur Raumüber-deckung dienten wie bei denBahnsteigen Tragkonstruktionenaus Eisen und Stahl. Die Front derE. folgte zumeist histor. Stilen, bes.Romanik und Renaissance, erstnach dem 1. Weltkrieg kommenhier zögernd moderne Gestaltun-gen auf. Engl. reception building; frz. bâtimentd�accueil; it. fabricato viaggiatori; sp. edifi-cio de recepción.
Empfangszimmer, oder Salon,ein zum Gäste-Empfang bestimm-tes Zimmer in größeren Wohnun-gen, bes. im 19. Jh., nach dem 1.Weltkrieg seltener oder in größerenWohnungen als Musikzimmer ge-nutzt. Engl. parlour, am. parlor; frz. salle de récep-tion; it. salotto; sp. sala de recepción.
Empore, ein galerie- oder altan-ähnl. Einbau, der sich zu einem In-nenraum öffnet, häufig über demSeitenschiff (→ *Emporenbasilika)oder über dem Chorumgang, überdem Umgang von Zentralbauten inW.-werken oder im W. des Mittel-schiffs oder Saals (→ *Nonnene.,→ *Orgele.). Man unterscheidetnach der Konstruktion offene undgedeckte E. Die offenen E. werdenbei Saalkirchen bevorzugt; sieruhen auf Stützen, zumeist ausHolz, oder sind freitragend derWand angefügt. Die gedeckten E.zumeist über Seitenschiffen habenFlachdecke oder Gewölbe und öff-nen sich zum Kirchenraum in fen-
sterartigen Mauerdurchbrüchenoder Bogenstellungen auf Säulenoder Pfeilern oder in großen über-greifenden Bögen. Die geschlosse-nen E. sind zum Hauptraum nurmit vergitterten oder verglastenWänden geöffnet. Unechte E.:Öffnung in den Dachboden überdem Seitenschiff; halbechte E.: Öff-nungen in ein Drempelgeschoß;Scheine.: emporenartige Arkaden-öffnungen zum Seitenschiff, des-sen Gewölbe über den Öffnungenliegt, es fehlt also der Boden. Engl. gallery, choir loft; frz. tribune, galeriehaute; it. matroneo, galleria superiore;sp. tribuna, galería alta, coro alto.
Emporenbasilika, Basilika mit→ Emporen über den Seitenschif-fen. Im frühchristl. Kirchenbau,bes. in Kleinasien und Nordafrika,sowie in der byzantin. Baukunstsind Emporen häufig, im Abend-land zunächst selten. In Mittel-frankreich und Auvergne um 1000tonnengewölbte E.; England und
153 Emporenbasilika
Emporenbasilika(Beispiel: Saloniki, Demetriusbasilika)
Normandie haben in der 2. Hälftedes 11. Jhs. E. mit offenem Dach-werk und kreuzgewölbten Empo-ren über den Seitenschiffen. Diekonstruktive Bedeutung der Em-pore beim Gewölbebau als ein denGewölbeschub entlastendes undstützendes Element veranlaßte im12. Jh. die got. Baukunst in Mittel-frankreich, die Emporen über denSeitenschiffen anzuwenden. Mitder Ausbildung des got. Strebesy-stems endet die E., wird jedochüber den Einsatzkapellen beibehal-ten und in den Barock übernom-men; sie gewinnt ganz bes. Bedeu-tung in den Predigtkirchen unddem Kirchenbau des Protestantis-mus. Frz. basilique à tribunes; it. basilica conmatronei; sp. basílica con tribunas.
Emporenhalle, Hallenkirche mitEmporen, vornehmlich über → Ein-satzkapellen spätgotischer Hallen-kirchen.Frz. église à tribunes; it. chiesa a sala conmatronei; sp. iglesia con tribunas.
Emporenumgang, → Emporen,die über den Seitenschiffen, imQuerhaus und Chor auf einheitl.Höhe und untereinander verbun-den herumgeführt sind. Engl. gallery; it. galleria del coro; sp. galeríade tribunas.
Enceinte (frz.), Umwallungslinieder Festung mit allen Einzelwer-ken. Engl. enceinte, circumvallation; frz. en-ceinte; it. cinta; sp. línea de circunvalación.
En délit, in der neueren Literaturzur Gotik eingeführte frz. Bezeich-nung für einen Stein, meist einvorgeblendeter Säulenschaft oderDienst, der »entgegen seiner Bet-tung« vertikal gestellt ist, d.h. seinedurch Sedimentierung entstande-ne Schichtung. Die E.-Technik warseit dem Chor von Saint-Denis beiParis (1140) bis ins 13. Jh. weit ver-breitet (in Deutschland bes. durchdie Zisterzienser) und läuft dannaus. Die E.-Schäfte werden durchBasis, Kapitell, Schaftring undBinder mit dem Mauerwerk ver-bunden.
Enfilade (frz. Auffädelung, Auf-reihung), eine Zimmerflucht, beider die Türen an einer Achse lie-gen, so daß bei geöffneten Türeneine Durchsicht vom ersten biszum letzten Zimmer mögl. ist. DieE., in die auch ein in der Mitte lie-gender Saal einbezogen sein kann,ist typ. für Schlösser, Hôtels undandere repräsentative Profanbau-
Emporenhalle 154
Emporenhalle(Beispiel: Mailand, S. Ambrogio)
Emporenumgang
ten des Barocks und wurde inFrankreich entwickelt. Engl., it., sp. enfilade.
Engen, ma. für die Räume einesRathauses.
Englischer Garten, auch Land-schaftsgarten genannt; ein künstl.angelegter, aber der Natur weitge-hend nachgebildeter Park, derunter dem Einfluß der Romantikim 18. Jh. in England entstand und1790�1815 in Europa beliebt war.Hauptelemente der Anlage warenaußer Nutzung natürl. Geländege-gebenheiten geschlungene Wegeund natürl. und künstl. Ruinen,Tempel, Pavillons, Plastiken, auchmit landwirtschaftl. genutztenFlächen und Bauten. Engl. English landscape garden; frz. jardinanglais; it. giardino all�inglese; sp. jardíninglés.
Englischer Verband → Mauer-werk, bei dem auf eine Binder-schicht mehrere Läuferschichtenfolgen. Engl. English bond; frz. appareil dit anglais;it. concatenamento inglese; sp. trabazóninglés.
Engobe (frz.), dünner Überzugauf Waren der Fein- und Grob-keramik, der aus Tonschlicker mit
Brennfarbe besteht und einen an-ders- oder mißfarbigen Scherbenverdeckt. Das Schwinden von Mas-se, Schlicker und Glasur muß auf-einander abgestimmt sein, da sonstdie E. Risse bildet oder abblättert.Die Technik stammt aus Vorderasi-en und verbreitete sich mit dem Is-lam nach Europa. Heute wird E. inder Bautechnik bes. auf Dachzie-geln angewandt. Engl., frz.; sp. engobe; it. ingobbio.
Engsäulig → Pyknostylos, → *In-terkolumnium.
Entasis (gr. Anspannung), nachVitruv die leichte Schwellung desnach oben verjüngten Säulenschaf-tes der gr. Säulen, die kurz unter-halb der Schaftmitte am stärkstenist. Die E. verleiht der Säule als tra-gender Stütze den Eindruck von ge-spannter Kraft und findet sich auchin der Romanik und in den auf dieAntike zurückgehenden Baustilen(Renaissance, Barock, Klassizismus)in mehr oder weniger ausgeprägterForm (→ *Dorische Ordnung,→ *Ionische Ordnung, → *Säule). Engl. swell; frz. enflure, renflement; it. ri-gonfiamento, accrescimento; sp. éntasis.
Entlastungsbogen, im Unter-schied zu dem einer Mauer aufge-legten → *Blendbogen ein in derMauer liegender, gemauerter, kon-struktiver Bogen zur Lastabtragungüber einer Maueröffnung (Fenster,Tür). Engl. discharging arch, relieving a.; frz. arcde décharge, a. en renfort, remenée; it. arcodi scarico; sp. arco de descarga.
Entlastungsträger sind Träger,die einen anderen Träger entlasten. Frz. poutre de décharge; it. trave di scarico;sp. viga de descarga.
155 Entlastungsträger
Enfilade (Beispiel:Wien, Palais Schwarzenberg)
Entrelacs (frz.), Ornamentfor-men, denen ein fortlaufendes Band-geflecht oder Geschlinge zugrundeliegt: reine Bandornamente wie→ Flechtband, → Mäander oder→ *Beschlagwerk mit den darausabgeleiteten Formen und alle vege-tabilen fortlaufenden Ornament-friese, die von fortlaufenden Bän-dern oder bandartigen Gebildendurchzogen sind. → *Fries. It. intrecci; sp. almocárabe.
Entresol (frz.), Mezzanin, niedri-ges Zwischengeschoß (→ *Ge-schoß).
Enveloppe (frz.), schmales Au-ßenwerk in einem breiten Haupt-graben der Festung oder an derenContrecarpe, auch die Wall-Gra-ben-Umfassungslinie und der Man-telwall.
Epaulement (frz.), halbe Bastionan Kron- und Horn-Werken vonFestungen. Engl. retaining wall, breast w.; sp. muro decontención.
Episkenion (gr.), nach Vitruv Be-zeichnung für das obere Stockwerkdes Bühnenhauses (Skene) im gr.→ Theaterbau.
Epistelambo → Epistelpult.
Epistelpult (lat. epistula: Brief,Zuschrift), das auf dem oberen Brü-stungsrand des Ambo oder Lettneraufsitzende Lesepult aus Stein,Holz oder Messing zum Verlesender Epistel, seit der Gotik auch alsStehpult auf der → Epistelseite. Engl. epistle desk; frz. épîtrier; it. leggiodell�epistola; sp. pupitre de lectura de epísto-las.
Epistelseite, bei Blickrichtung aufden Altar die rechte (bei der üb-lichen Ostung die südl.) Seite, ander der Priester beim Meßopfer dieEpistel liest, wo urspr. der rechte,weniger verzierte Ambo stand, dannauch die südl. Kirchenseite, die we-gen der im MA. üblichen Platzein-teilung auch Männerseite genanntwurde (→ Evangelienseite). Engl. epistle-side; frz. épistyle, côté del�Epître; it. lato epistolae, epistola; sp. ladodel evangelio.
Epistylion, Epistyl (gr.), Architraveines Tempels (→ Gebälk). Engl. epistyle; it. epistilio; sp. epistilo, arqui-trabe.
Epitaph (gr.), Gedächtnisinschriftmit Namen und Todesdatum als
Entrelacs 156
Entlastungsdreieck EntlastungsbogenEntlastung
Gedächtnismal, das nicht an derBegräbnisstätte des Toten, sondernin oder an einer Kirche aufgehängtoder aufgestellt ist und sich da-durch vom Grabmal unterscheidet.Beginnend im 14. Jh. und bis zumBarock unterschiedl., z.T. reiche
formale Gestaltung: Wand- undTafelbilder, Bronzereliefs, Mes-singplatten, freistehende Figuren-gruppen, auch Glasgemälde undWandteppiche, bis zum Wappen-E.des 18. Jhs. Engl. epitaph; frz. épitaphe; it. epitaffio;sp. epitafio.
Epithitis (gr.), Rinnleiste auf derPlatte des antiken Giebelgesimes(→ Sima).
Epitrachelium (gr.), Hypotra-chelion, Säulenhals (→ *Echinus,→ *Dorische Ordnung).
Erdbogen, Gegen-, Grundbogen,umgekehrter, mit dem Scheitelnach unten gerichteter Bogen zurgegenseitigen Verspannung derFundamentpfeiler und zur gleich-mäßigen Verteilung der Auflast aufschlechtem Baugrund (→ Bogen II). Engl. retaining-arch; frz. arc de fondation;it. arco rovescio; sp. arco invertido decimientos.
Erdgeschoß, Parterre, das ersteGeschoß eines Gebäudes, dessenFußboden nicht unter dem Stra-ßenniveau liegt. Engl. ground-floor; frz. rez-de-chaussée;it. pianterreno, piano terreno; sp. plantabaja.
157 Erdgeschoß
Epitaph (1585)
Erdbogen (Beispiel: Rom, Brücke des Fabricius, 62 v. Chr.)
Erdhügelburg → Motte.
Eremitage (frz. Einsiedelei), Gar-ten- oder Lustschloß in ländl. Ab-geschiedenheit für zurückgezoge-nes Leben in Einsamkeit und Na-turverbundenheit, häufig mit Strohgedeckt, auch in Felsen gearbeitet,seit Mitte des 18. Jhs. im Barockverbreitet, bes. im → EnglischenGarten. Frz. éremitage; sp. ermita.
Erker, ein- oder mehrgeschossiger,geschlossener, polygonaler, halb-runder oder rechteckiger Vorbauaus Stein, Holz oder Fachwerk ander Fassade oder Ecke (Ecke.) einesGebäudes, der im Gegensatz zum→ *Altan in einem oberen Ge-schoß frei auskragt, auf profiliertenoder reich verzierten Konsolenoder auf einer Säule ruht. Der E.erweitert einen dahinter liegendenRaum, führt diesem mehr Lichtzu, dient als Auslug und zurGliederung und Belebung vonFassaden mit städtebaul. Wirkung,seit dem 13. Jh. nachweisbar, seit derSpätgotik bis zum Ende des 19. Jhs.
Erdhügelburg 158
Erker
Eremitage (Beispiel Bayreuth)
beliebt. Nicht als E. zu bezeichnensind die sakralen Zwecken dienen-den → *Chörlein an Kapellen. Engl. oriel, alcove, balcony; frz. encorbelle-ment, partie en saillie; it. bay window,sporto, bow-window, bovindo; sp. salidizoen forma de torrecilla.
Erkerfenster, Fenster eines Erkers,im Gegensatz zum → *Fenster-erker. Engl. oriel; frz. fenêtre en saillie; it. finestradel bay window; sp. ventana de mirador.
Erkertürmchen, Erker, der turm-artig in die Dachzone eines Ge-bäudes hochgeführt ist und eineneigenen Dachhelm hat. Engl. bartizan; frz. tour en saillie; il. baywindow a torretta; sp. salidizo en forma detorrecilla.
Ern, Eren, Ärn → Diele.
Erscheinungsfenster, Fensterzwischen dem Palast und demersten Hof eines ägypt. Toten-tempels des Neuen Reiches (The-ben, Ramesseum und Theben,Medinet Habu). Am E. zeigte sichder Pharao, um sich von der imHof versammelten Menge huldi-gen zu lassen (→ *Grabtempel).
Escarpe (frz.), geböschte odersenkrechte Mauer der Umwallungauf der Innenseite des Grabens(→ Contrescarpe). Engl. escape, apophyge; frz. escape; sp. es-carpa.
Escarpenerker → Sentinelle.
Escarpengalerie (frz.), unter denGewölben einer Eskarpen- oderBreschemauer entlangführendeGalerie für die Grabenbestrei-chung im Festungsbau. Engl. escarp gallery.
Eschif (frz.), kleines flankierendesFestungswerk, das die Zugänge zueinem Tor verteidigt und von demman einen Graben bestreichen kann.
Eselsrücken, im unteren Teil desBogenscheitels konvex, im oberenTeil konkav geschwungener, ge-schweifter Spitzbogen, eine in derHochgotik bes. in England beliebteForm (→ *Bogenformen). Engl. ogee arch; frz. dos d�âne, arc en acco-lade; it. arco a schiena d�asino; sp. arcoconopial.
Eselstreppe, in Windung anstei-gende Rampe, auch in Türmen(→ Eselsturm). Frz. escalier vis St. Gilles, rampe carrossable.
Eselsturm, Bezeichnung für Tür-me an roman. Domen, in denenstatt einer Wendeltreppe eine ge-wendelte Rampe emporführt, aufder das Baumaterial von Eseln hin-aufgetragen wurde. Nach Aufkom-men des Baukrans erübrigte sichdie Anlage von »Eselstreppen« inTürmen. Frz. tour à rampe carrossable; sp. torre conrampa tipo caracol.
159 Eselsturm
Erkertürmchen(Beispiel: Freiburg, Kaufhaus, 16. Jh.)
Eskarpe → Escarpe.
Espagnolette-Verschluß, Dreh-stangen-Verschluß für Fenster, be-steht aus einer senkrechten dreh-baren Stange, die mit Hülsen aufder inneren Schlagleiste befestigtist; die Drehstange ist in der Mittemit einem Ruder verbunden, dasin geschlossenem Zustand in ei-nem auf dem Rahmholz des zwei-ten Fensterflügels befindlichenSchließhaken greift; die Enden derStange sind hakenförmig ausge-schmiedet und legen sich beimSchließen hinter den Dorn. Frz. fermeture à espagnolette; it. spagno-letta; sp. cerramiento a la españoleta.
Esplanade (span.-frz., v. lat. pla-nus: eben), 1. künstl. eingeebnetefreie Zone, in Festungen zwischenZitadelle und Stadt, Glacis. 2. Bes.breite Straße, die meist bei einerStadterweiterung an Stelle der Be-festigung angelegt wurde. Engl., frz. esplanade; it. spianata; sp. expla-nada.
Esse, Herd- und Rauchabzug, spä-ter freistehender Rauchabzug gro-ßer Feuerungsanlagen. Engl. chimney; frz. cheminée; it. camino,fumaiuolo; sp. chimenea.
Estípíte, ein nach unten verjüng-ter Pilaster.
Estrade (frz., span. estrado v. lat.stratum: Unterlage), um eine odermehrere Stufen erhöhter Teil desFußbodens, z. B. in einer Fenster-nische, einem Erker oder Saal, zurAufnahme eines bevorzugten Sit-zes (Sessel, Thron). Frz., it estrade; sp. estrado.
Estrich (gr.-mittellat. astricus:Pflaster), fugenloser Fußboden ausweich aufgetragenem Lehm, As-phalt oder Mörtel. Dieser bestehtaus verschiedenen Zuschlagstoffenund Zement, Gips, Kalk oder an-deren Bindemitteln (Steinholz,Terrazzo, Zemente, Gipse). Engl. plaster or stone floor, pavement;frz. pavé, chape, aire; it. massetto; sp. pavi-mento.
Etage (frz.), Wohn- und Nutz-ebene im Geschoß- und Stock-werkbau. Engl. floor, story; frz. étage; it. piano;sp. piso, planta.
Etoile (frz.) → Sternschanze.
Eustylos (gr. schönsäulig), nachVitruv eine Säulenstellung der hel-lenist. Zeit, bei der das → *Inter-kolumnium 2¼, das der beidenmittleren Säulen aber 3 untereSäulendurchmesser beträgt.
Euthynterie (gr. euthenteria: Steu-erlager), oberste geglättete undausgeglichene, aus dem Boden
Eskarpe 160
Estrade
ragende Kante des Quaderfunda-ments (Stereobat) des griech. Tem-pels, Unterlage für die Krepis. Engl., it. euthynteria.
Evangelienseite, bei Blickrich-tung auf den Altar die linke, beider üblichen Ostung die nördl.Seite, an der von dem dort stehen-den → *Ambo die Evangelien ver-lesen werden; wegen der im MA.üblichen Platzeinteilung auch Frau-enseite genannt (→ Epistelseite). Engl. gospel-side; frz. côté de l�évangile;it. lato evangelii; sp. lado de los evangelios.
Exedra (gr. abgelegener Sitz),1. urspr. eine halbrunde oder recht-eckige Nische mit erhöhten Sitz-plätzen in antiken Wohnhäusern,Säulengängen und an öffentl.Plätzen, 2. dann auf die → *Apsisder christl. Kirche übertragen und3. schließl. auf jede Nische oderhalbkreisförmigen Abschluß einesauch profanen Raums, → Konche;auch für mehr oder weniger frei-stehende Annexräume an Kirchen. Engl.; sp. exedra; frz. exèdre; it. esedra.
Exonarthex (gr.), Esonarthex, dasHerumführen der Emporen um diewestl. Schmalseite führte bei byzan-tin. Kirchen des MA. zur Entste-hung eines inneren (Enonarthex)und eines äußeren, dem Kirchen-raum vorgelagerten E. (→ Narthex).Engl., frz. exonarthex; it. esonartece; sp. nár-tex exterior.
F
Face (frz. Gesicht), Gesichtslinie,dem Vorfeld zugewandte Linie ei-ner Befestigungsanlage, bes. die
Frontseiten der winkelförmigenBastion, die an der → Pünte zu-sammenstoßen.
Facette, abgeschrägter, rauten-förmiger Rand eines rustiziertenSteins (Rustika). Engl. facet; frz. facette; it. faccetta; sp. faceta.
Fach, Abstand oder Raum zwi-schen zwei Gebinden; vorrangigim niederdt. Hallenhaus (nicht zuverwechseln mit → Gefach).
Fächerbogen, Vielpaß- oder Zak-kenbogen, aus mehreren fächerför-mig angeordneten Kreisbogen be-stehender Bogen, bes. in der islam.und spätroman. Baukunst. Frz. arc polylobé; it. arco polilobo; sp. arcoen abanico.
Fächerfenster, in der spätroman.Baukunst vorkommende → *Fen-sterform mit verengtem unteremTeil und einer oberen Verbreite-rung, die mit einem Fächerbogenschließt, bes. im Rheinland. Engl. fan-shaped window; frz. fenêtre enéventail, it. finestra poliloba; sp. ventana enabanico.
Fächergewölbe, Strahlengewölbe,Palmengewölbe, in der engl. Spät-gotik beliebte, auch in den Bautendes Deutschen Ordens vorkom-mende → *Gewölbeform, derenRippen fächerförmig von einemStützpunkt ausstrahlen. Engl. fan vault; frz. voûte en éventail, v. ànervures rayonnantes; it. volta a ventaglio;sp. bóveda en abanico.
Fächerrosette, beliebtes Zier-motiv an Fachwerkbauten der dt.Renaissance in Form einer Halb-kreisscheibe, die mit einer halben
161 Fächerrosette
Rosette bzw. mit einer verschie-denfarbigen, fächerartig gefaltetenInnengliederung gefüllt ist und diemeist in der Zone der Fußstrebenvorkommt; erstmals um 1530 imHarzgebiet nachgewiesen. Engl. rosette; frz. demi-rosace en éventail;sp. roseta en abanico.
Fachgerten, ca. 2,5cm dicke Holz-stäbe oder Weidenruten, mit denenmit Fachholz ausgestakte Wandge-fache im Fachwerkbau ausgefloch-ten werden und auf die der mitStroh vermengte Lehm aufgetragenwird.
Fachwerkbau, Holzskelettbau-weise aus senkrechten (→ Ständer,→ Stiel), waagerechten (→ Schwel-le, → Rähm, → Riegel) und schrä-gen (→ Strebe, → Band, → Schwer-tung) Balken, deren Gefache durchverschiedene Baustoffe (Holzboh-len und Flechtwerk mit Lehmbe-wurf, Backsteine, Bruchsteine) ge-schlossen sind.Die Grundschwelle liegt auf demBoden oder dem Sockel auf; die imStockwerkbau auf der Deckenbal-kenlage ruhende Schwelle wirdSaumschwelle genannt. Der Rah-men oder Rähm bildet den oberenWandabschluß. Die tragenden Stän-der heißen an den Hausecken Eck-ständer, am Anschluß von innerenScheidewänden Bundständer undin der Wand Zwischenständer. Die
nicht tragenden und deshalb dün-nen Stiele tragen Gefache undbegrenzen Fenster und Türen. Diehorizontalen, in Ständer und Stielegezapften Riegel teilen die Gefacheund schließen als Sturz-, Fenster-oder Türriegel die Wandöffnungnach oben und als Brustriegel dieFenster nach unten ab. Die Brust-riegel können auch als durchlau-fende, vorgeblattete Riegel oderBrustschwertungen ausgebildetsein. Nach Aufgabe der aussteifen-den Bohlenwände und mit Beginndes mehrgeschossigen Hausbausim 13. Jh. waren zur Versteifungder Wandkonstruktion Schräghöl-zer notwendig (Dreieckverbandgegen Verschiebung), entweder involler Holzdicke und eingezapft alsStreben oder als Bänder aus Boh-len oder auch angeblattete Vollhöl-zer oder als lange Schwertungenschräg über mehr als zwei kon-struktive Hölzer geblattet und anden Enden schwalbenschwanzför-mig angeblattet; das Band und dieSchwertung nehmen Zugkräfte,die Strebe Druckkräfte und dasangeblattete Vollholz-Band Zug-und Druckkräfte auf.Die Grund- und Stockschwellesowie der Rähm werden an denKreuzungsstellen überblattet, ver-kämmt oder verschlitzt und bildenso einen Schwellen- oder Rähm-kranz. Saumschwellen werden zurSicherung der Balkenlage mit demBalken durch Verkämmung verbun-den. Die Anstückung der Schwelleerfolgt häufig durch schräge Ha-kenblätter. Die Ständer sind inSchwelle und Rähm eingezapftoder angeblattet oder auch beidesmittels eines Blattzapfens oderSchwebeblatts. Wenn die Ständer
Fachgerten 162
Fächerrosette
durch mehrere Geschosse reichen,werden die Deckenbalken in dieStänder eingezapft, auch mitdurchgestecktem Zapfen und Zap-fenschloß, oder angeblattet, dazuals Auflager aus dem Vollholz desStänders ausgearbeitete Konsolen.Schon bei den ältesten erhaltenenHäusern aus dem 13./14. Jh. findetsich diese Konstruktionsweise inVerbindung mit stockwerkbilden-den Elementen bes. an der Haus-front, wo vorkragende Stockwerk-fassaden vor das eigentl. Gerüst ge-hängt werden.Im Verlauf des 15. Jhs. tritt die Ein-zelverstrebung der Ständer aufund verdrängt die über mehrerekonstruktive Hölzer reichendenSchwertungen, die zumeist auchgeschoßübergreifend waren, aufdie Seitenwände. Im Rhein-Main-Gebiet und in Südwestdeutschlandkommen überkreuzende Fußbän-
der oder Streben auf, in Südwest-deutschland getrennte Kopf- undFußbänder als »schwäbisches Weibl«und seit 1540 in Hessen und imRhein-Main-Moselgebiet dreivier-telhohe Fußstreben und Kopfwin-kelhölzer als »Mann«. Insgesamt giltdie Verblattung als bevorzugt ma.,die Zapfung als eher frühneuzeitl.Verbindungsart der konstruktivenHölzer. In Südwestdeutschlandwaren die zurückliegend eingenu-teten Bohlenwände als Wohn-stuben außen ebenfalls mit Lehmverkleidet. Die Deckenbalkenköp-fe können als dekorative Zierglie-der vor die Bauflucht vorspringenund zu Trägern der oberen vorsprin-genden Fachwerkwand werden; jenach dem Ausladungsgrad (Über-hang) werden dann reich verzierte→ Bügen (Streben) oder → Knag-
163 Fachwerkbau
Fachwerk(Beispiel: Esslingen, Altes Rathaus)
1 Schwelle2 Ständer3 Deckenbalken4 Balkenkopf5 Knagge6 Rähm, Rahmen,
Oberschwelle7 Riegel
(Brustriegel)8 Strebe
9 Gefach10 Windbrett11 Sparren12 Aufschiebling13 Dachschwelle,
Saumschwelle14 Sparrenschwelle15 Kopfband,
Kopfstrebe16 Mauerlatte
gen (Winkelhölzer) zur weiterenUnterstützung und Verriegelungder Balken eingezapft. Bei Quer-richtung der Balkenlage überneh-men → Stichbalken, die an einemEnde mit dem letzten Deckenbal-ken zumeist schwalbenschwanz-förmig verbunden sind, die Auf-gabe. Bei mehrseitigem Überhangwird an der Hausecke der Grat-stichbalken erforderl., der zumeistwie die Decken- und Stichbalkenvon Bügen- oder Knaggen unter-stützt wird, so daß an der EckeBügen- oder Knaggenbündel aus-gebildet werden, die in denEckständer eingezapft sind. Engl. half-timbered construction; frz. con-struction en colombage; it. costruzione atraliccio; sp. construcción de entramado.
Fachwerkbinder, → *Dachkon-struktion oder -binder aus stabför-migen Elementen, die vom Holz-bau auf Eisen und Stahl übertragenwurden, als ebenes oder räuml.Fachwerk konstruiert und nichtausgefacht. Engl. trussed beam; frz. poutre à treillis;it. trave reticolare; sp. cercha de entramado.
Falchion (engl. Pallasch), ein vier-blättriges Gebilde, bei dem einemPaß ein kielbogiges Blatt gegenüber
steht, während die beiden seitl.Blätter gespitzt langgezogen undimmer gekrümmt sind. Bes. imengl. Curvilinear-Maßwerk 1. Hälf-te des 14. Jhs. vorkommend.
Falladen, Laden zum Verschlußeiner Maueröffnung (Fenster), derim Gegensatz zum horizontal be-wegten Schiebeladen vertikal be-wegt wird (→ *Fensterladen). Frz. trappe, abattant; it. imposta scorrevoleverticale; sp. postigo deslizante vertical.
Fallgatter, Fallgitter, starkes Holz-gatter aus unten zugespitzten, eisen-beschlagenen Pfählen und Quer-balken, zum Sperren von Burg-,Stadt- oder Festungstoren. Das F.ist über dem Tor an Ketten aufge-hängt und seitl. in Mauerschlitzen
Fachwerkbinder 164
Falchion
Fallgatter
geführt und konnte bei Belagerun-gen mit einer Winde rasch her-untergelassen werden. Engl. portcullis, herse; frz. herse, sarrasine;it. saracinesca; sp. rastillo.
Fallrohr, Abfallrohr, zur Entwäs-serung der Dachfläche an dieDachrinne angeschlossene Röhrezur Ableitung des Wassers. Engl. channel, gutter; frz. chenal, descented�eaux pluviales, canon; it. pluviale; sp. ca-nal descendente de aguas pluviales.
Falltür, eine waagrecht liegende,beim Schließen in den Fußbodeneinfallende Tür, bes. für Keller-und Bodentreppen. Engl. trap door, valve; frz.trappe, valvule;it. botola; sp. puerta caediza.
Falscher Bogen, → unechter Bo-gen, → Falsches Gewölbe.
Falsches Gewölbe, → *unechtesGewölbe, horizontal aufgeschich-tete Steinlagen, bei denen diejeweils folgende Schicht über diedarunterbefindl. auskragt und, zu-meist ohne Mörtelbindung, einunechtes Gewölbe erzeugt, bes. beivor- und frühgeschichtl. Bautenim Mittelmeerraum. Engl. false vault; it. pseudovolta; sp. bóvedafalsa.
Faltbrücke, eine bewegl. Brücke,deren Tragwerk gefaltet werdenkann, um großen Schiffen dieDurchfahrt frei zu geben. It. ponte levatoio; sp. puente plegable.
Faltdach, Turmdach mit gefalteterOberfläche (→ *Dachformen).
Faltenkapitell, Sonderform eines→ *Kapitells mit abwechselnd nach
oben bzw. unten gerichteten, gefal-teten Teilen, bes. bei anglonor-mann. Bauten der Romanik. Engl. invected capital; frz. chapiteau go-dronné.
Faltkuppel, eine Kuppelform mitnach außen konvex vorsprin-gender, »gefalteter« Oberfläche, inder armen. und islam. Baukunst(→ *Kuppel). It. cupola a costoloni; sp. cúpula plegada.
Falttür, eine in einzelne gegenein-ander klappende Elemente unter-teilte → *Tür. Engl. folding door; frz. porte en accordéon(pliante); it. porta a soffietto, p. a fisarmoni-ca, p. a libro; sp. puerta plegable.
Faltwand, eine aus einzelnen Ele-menten bestehende, zusammen-klappbare Zwischenwand, die zurVerbindung zweier Räume geöff-net werden kann. Engl. folding partition; frz. cloison pliante(en accordéon); it. parete a soffietto; sp. ta-bique plagable.
Faltwerk, 1. räuml. Tragwerk ausStahlbeton, Spannbeton oder Stahl-blech, das aus starren, ebenen Ein-zelplatten zusammengesetzt ist,bes. für weitgespannte Hallendä-cher verwendet. 2. Faltenförmiges,
165 Faltwerk
Faltwerk an einem türk. Kuppelbau
flächenfüllendes Schnitzornamentan Möbeln der Spätgotik und Re-naissance; auch im Innenausbauverwendet. Engl. folds, linenfold, drapery; frz. servietterepliée, parchemin plié, structure de formeprismatique; it. intaglio a pergamena, sal-vietta piegata, fregio scolpo a pieghe; sp. 1.estructura plegable, 2. decoración tallada enpliegues.
Falz, Verbindung durch Übergriffverschiedener Elemente, Tafelnoder Bahnen des gleichen Mate-rials. Aus Blech kann die hakenför-mig ineinandergreifende Verbin-dung liegend oder stehend (Stehf.)angeordnet sein, bei Fenstern undTüren sind Rahmen und Flügeldurch einen oder mehrere Fälze,winkelförmige, rückspringendeAusarbeitung einer Kante, mitein-ander verbunden (→ *Anschlag). Frz. feuillure, onglet, repli, agrafe; it. allg.:piega, in der Klempnerei: aggraffatura, in derTischlerei: battuta; sp. rebajo, ensambladura.
Falzziegel, mit Falzen und Leistenineinandergreifende Dachziegel(→ *Dachdeckung). Engl. interlocking tile; frz. tuile à onglet,brique à rainure, tuile en auge; it. tegolamarsigliese; sp. teja de encaje.
Fanghof → Torzwinger.
Farbige Architektur → *Poly-chromie.
Farm (engl.), Pachtgut, übertragenauf jedes Landgut, stammt aus demAngelsächsischen, wo der Pacht-zins urspr. in Lebensmitteln (fear-me) entrichtet wurde. Engl. farmhouse; frz. ferme; it. fattoria;sp. granja, hacienda.
Fasanerie, ein zur Fasanenzuchteingerichteter Garten mit demWohnhaus des Fasanenmeistersund mit dem damit verbundenenStall. Engl. pheasant-house; frz. faisanderie; it. fa-gianiera; sp. faisanería.
Fasche, bei Tür- und Fensteröff-nungen eine rahmenartige Ein-fassung aus Putz, Holz oder Stein,die vor oder hinter die Wandflächetritt und glatt oder gegliedert ist,zumeist nur die vortretende Um-rahmung aus Putz. Frz. naissance d�enduit; it. fascia (di porta odi finestra); sp. borde revestido de abertu-ras.
Faschine, Reisigbündel zur Grün-dung von Bauwerken oder Schan-zen in sumpfigem Gelände oderzur Herstellung von Festungs-bauten als selbständige Schanzen. Engl. fascine, fagot; frz. fascine, faisceau;it. fascina; sp. fajina.
Fasciae → Faszien (→ *ionischeOrdnung).
Fase, durch Abfasen (Abkanten)entstandene schmale Fläche anstel-le der Kante. Engl. chamfer; frz. chanfrein; it. smusso,smussatura, bisello; sp. chaflanado.
Falz 166
Falza Schlagfalz c liegender Einfachfalzb Glasfalz d liegender Doppelfalz
e stehender Falz
Fase
Fassade (nach it. facciata v. lat. fa-cies: Gesicht), die Hauptansichts-seite (Schauseite) eines Gebäudes,auf die die ganze Gestaltung kon-zentriert ist, in der Regel dieHaupteingangsseite, bei Kirchendaher meist die Eingangsfront imWesten. Gewöhnl. zeigt die F. dieinnere Gliederung bzw. den Quer-schnitt des hinter ihr liegendenBaukörpers (z.B. bei roman. Basili-ken, got. Kathedralen und Palästender Renaissance und Barockzeit),sie kann aber auch für sich kompo-niert sein und weder in den Ab-
messungen noch im Querschnittdem zugehörigen Bau entsprechen.Das klass. Land prunkvoller Kir-chenfassaden ist Italien, wo zu demarchitekton. und bauplast. Schmuckhäufig noch der Farbwechsel desGesteins hinzutritt und die F. meistgrößer als der Raumquerschnitt(→ *Blendfassade) ist, selten klei-ner. Häufig ist die F. durch einenoder durch mehrere Türme betont(→ *Turmfassade, Doppelturmfas-sade, Zweiturmfassade). Im Zei-chen der Gegenreformation wurdeauch nördl. der Alpen auf pompö-
167 Fassade
1 Petit Palais, Kirche, 12. Jh. 2 Orvieto, Dom, 14. Jh.
4 Florenz, Pal. Rucellai, 15. Jh.3 Venedig, S. Giorgio Magg., 16. Jh.
Fassade
se Kirchenfassaden bes. Wert ge-legt, vor allem bei den weithinsichtbaren Klosterkirchen des süd-dt. Barock. Bei Profanbauten kön-nen die städtebaul. oder landschaftl.wirksamen Seiten durch bes. Her-vorhebung der F. gekennzeichnetsein. Portale und Portalvorbauten,Fenstergruppierungen, Säulenord-nungen oder → *Kolossalordnung,Arkaden, Erker, Freitreppen u. der-gl. sind die Kompositionselemente.Auch die → *Giebel können durchbes. Gliederung od. Bekrönunghervorgehoben sein. Außerdemkann die Fassade durch kostbareresSteinmaterial, durch → *Inkrusta-
tion, Putz, Sgraffito, Stuck od. Fres-komalerei geschmückt werden. Engl., frz. façade; it. facciata; sp. fachada.
Fassadenabwicklung, → *Ab-wicklung der Schauseiten einesBauwerkes oder mehrerer neben-einanderstehender Bauten (Stra-ßenzug, Platzwand). Engl. façade development; sp. desarrollo dela fachada.
Fassadenmalerei, die bes. inOberitalien, in der Schweiz und inSüddeutschland verbreitete Bema-lung von Fassaden mit architek-ton. (Architekturmalerei) und fi-
Fassadenabwicklung 168
Fassadenmalerei(Beispiel: Basel,Haus zum Tanz,Entwurf von Holbein d. J., 1520)
gürl. Motiven, auch mit ganzenSzenen religiösen und histor. In-halts (→ *Polychromie). Engl. façade painting, decorative painting;frz. peinturage de façade; it. decorazionepittorica della facciata; sp. decoración pictó-rica de la fachada.
Fassadenturm, ein an oder in derFront eines Bauwerks stehenderTurm, bei Kirchen meist dieWestfassade (→ *Turmfassade). Engl. façade tower; frz. tour de façade;it. torre della facciata; sp. torre de la fachada.
Faszien (lat. fasciae: Binden) hei-ßen die drei, seltener zwei überein-ander liegenden, von unten nachoben leicht vorspringenden Strei-fen, die den Architrav der → *Ioni-schen und der Korinthischen Ord-nung waagerecht unterteilen, auchauf Bogenstirn → Faszienbogen. Engl., it. fascia; frz. fasces; sp. banda dearquitrabe.
Faszienbogen, mit Faszien archi-travierter Bogen, je nach der Zahlder Faszien können die toskanische(mit einer), die dorische (mitzwei), die ionische und die korin-thische Archivolte (mit drei) F.unterschieden werden. In der An-tike, an antikisierenden Bauten derRomanik und in der Renaissanceangewandt. → *Archivolte. Frz. arc à fasces, a. à moulures; it. arco conarchivolto a fascia; sp. arco con bandas dearquitrabe.
Fauces (it.), enger Eingangsraumvor dem Vestibül eines röm. Hauses.
Faulturm, Hungerturm, als Ker-ker dienender Turm (→ *Berg-fried). Frz. oubliette, cachot, vade in pace; sp. torrecalabozo.
Fayence (frz., doch im Franz.heute faience geschrieben), nachder Stadt Faenza, einem der erstenit. Herstellungsorte der F., benann-tes Erzeugnis aus gebranntemTon, das mit einer meist weißenund mit Scharffeuerfarben bemal-ten Glasur aus Zinn oder Bleiüberschmolzen ist. Das Verfahrenwurde schon im Altertum von denÄgyptern, Babyloniern und Assy-rern für ihre → *Baukeramik ange-wandt, gelangte durch Vermittlungder Araber im 14. Jh. nach Europa(→ Azulejos) und findet noch heu-te als Wandschmuck und Baude-koration, vor allem aber im Kunst-gewerbe vielseitige Verwendung(→ Fliesen). Engl. faience; frz. faïence; it. faenza; sp. lozade Fayenza.
Feder, schmale Leiste als Verbin-dung zweier genuteter Bretter oderBohlen, oder einseitig an dieseangearbeitet (→ *Holzverbindun-gen). Engl. spring; frz.ressort, lanquette; it. lin-guetta; sp. lengüeta.
Fehlbalken, bei empfindl. Stuck-decken zwischen die den Fuß-boden tragenden Balken eingefüg-ter Zwischenbalken, an dem nur dieDeckenunterschicht aufgehängt ist. Frz. lambourde de plafond; sp. travesañosdel piso entablonado.
Fehlboden, Faulboden, auf Lei-sten oder in Nuten zwischen dieDeckenbalken gelegte Bretter zurAufnahme der Lehmschüttung(→ Holzbalkendecke). Engl. false ceiling, sound floor; frz. faux-plancher; it. assito inferiore del solaio;sp. falso cielorraso.
169 Fehlboden
Feinputz, → Putz, der auf einemUnterputz aufgetragen wird undeine feinkörnige Struktur derZuschlagstoffe aufweist. Engl. finishing coat, final c., stucco, am. ex-terior plaster; frz. enduit de finition; it. stabi-lura, ultima mano d�intonaco, velo; sp. en-lucido, estucado fino.
Feld, viereckige, polygonale oderkrummlinig umrahmte Fläche anWänden, Decken oder Gewölben. Engl. bay, panel; frz. pan, caisson, panneau;it. pannello; sp. recuadro, panel.
Feldbrand, Backsteine, die in Feld-öfen (Meiler) gewöhnl. ungleich-mäßig gebrannt und nicht genaumaßhaltig sind.
Felderdecke, eine → *Decke mitdurch vortretende Balken oderdurch Stuckprofile gebildeter Fel-derteilung an der Untersicht. Son-derformen sind die Kassettendecke(→ *Kassette) und die Spiegeldek-ke. Engl. coffered ceiling; frz. plafond à cais-sons; it. soffitto a scomparti; sp. cielorrasoartesonado.
Felderfries, ein → Fries aus vier-eckigen, meist quadrat. Vertiefun-gen, der bes. unter den Zwerg-galerien rhein. Dome der Spätro-manik vorkommt (→ Plattenfries). It. fregio a riquadri; sp. firso artesonado.
Feldkapelle, kleine Kapelle anFeldwegen, von niederen kirchl.Rang für Privatgottesdienst und zuprivater Andacht, Ziel von Pro-zessionen, Wallfahrten von lokalerBedeutung und Verehrung hl. Bil-der. Engl. field church; frz. chapelle, églisechampêtre; sp. capilla de campo.
Feldschanze, Feldwerk, kleinereVerteidigungsanlage im Rahmen ei-ner befestigten Stellung von zusam-menhängenden Linien oder voneinzelnen Werken, ähnl. Grundriß-formen wie die permanenten Fe-stungen. Engl. fieldwork; frz. fortin, ouvrage de cam-pagne; it. fortino; sp. fortín de campo.
Feldscheune, im freien Felde er-richtete, meist allseitig offeneScheune zum Bergen der Ernteunter Dach. Die Konstruktion ausHolzbindern mit flachgeneigtemDach, eingegrabenen Pfosten oderauf gemauerten Fundamenten ru-hende Ständer. Geschlossene F.mit Wänden aus waagerechter odersenkrechter Stülpschalung. Engl. barn; frz. grange extérieure; sp. gra-nero.
Feldstein, Klaub-, Lese-, Hand-,Rollstein, vom Boden geleseneoder aus geringer Tiefe gehobeneSteine, nicht aber in Steinbrüchengebrochen, auch Findlinge (Vlint-,Waldstein), kristalline Geschiebeder 2. und 3. Eiszeit von Skandina-vien in Bewegung gesetzt und imnördl. Mittel- und Osteuropaabgelagert. Engl. rubble; frz. roche erratique; it. Find-ling: masso erratico; sp. piedra rupeste.
Feldsteinbau, Mauerwerk, Rau-mauerwerk aus unbearbeiteten oderzersprengten → Feldsteinen oderKieselsteinen, beim Dorfkirchen-und Stadtmauerbau angewandt,meist in Schalenbauweise mit Mör-telbindung; zum Abgleichen vonFeldsteinmauerschichten konntenBacksteine dienen, daraus auchFriese, Gesimse, Fenster- und Por-taleinfassungen. Die frühesten Kir-
Feinputz 170
chen aus dem 8. /9. Jh. in Holstein,Niederrhein, Schweiz, Bodenseeund Oberitalien. Die große Masseder nordeurop. F. gehört dem 12.und 13. Jh. an, vereinzelt im 14./15.Jh., dann wieder in der 2. Hälftedes 18. Jhs. Im Profanbau fürWehrbauten, Burgen und Garten-mauern durch alle Jahrhunderteseit röm. Zeit. Engl. rubble masonry; frz. construction enroche erratique; it. costruzione in pietre dicampo; sp. mampostería en piedra rupeste.
Felsenburg, auf einem Felsenerrichtete Burg, deren Räume teil-weise in anstehenden Felsen einge-hauen sind. Engl. rock fortress; it. rocca.
Felsengrab, als Stollen in den Felsgetriebenes Grab (→ *Grabbau). Engl. rock-cut tomb; frz. tombeaux creusésdans le roc; it. tomba rupestre; sp. tumparupeste.
Felsenkirche, → *Höhlenkirche,in den anstehenden Fels hineinge-hauene Kirche aus frühchristl.Zeit, hauptsächl. in Kappadozien imSüdosten Kleinasiens verbreitet. Engl. rock-cut church; frz. église rupestre;it. chiesa rupestre; sp. iglesia rupeste.
Felsenkloster, Felsenvihara, Höh-lenkloster, in den natürl. Fels ge-hauenes buddhist. Kloster (Vi-hara), hauptsächl. in Mittel- undSüdindien. It. convento rupestre; sp. convento rupeste.
Felsentempel, Tempel, der ent-weder als Höhlung in den Felsenhineingetrieben ist (→ *Höhlen-tempel), oder aus einem Felsblockherausgehauen wurde, wie bes. inder ind. Baukunst. Engl. rock-cut temple, cave t.; it. tempiorupestre; sp. templo rupeste.
Felsenvihara → *Felsenkloster.
Fenestella (lat.), überwiegendrechteckige, aber auch reicher ge-staltete Öffnung zu einem im all-gemeinen nicht oder nur einge-schränkt zugängl. Ort, an demHeiligenreliquien geborgen sind,um direkten oder indirekten Kon-takt mit diesen zu ermöglichenund sie zugleich zu schützen.
171 Fenestella
Felsenkloster(Beispiel: Santschi, Tempel 45)
Felsentempel(Beispiel: Ellura, Kailasanatha-Tempel,
8. Jh.)
Entstanden im Zusammenhangmit der kult. Märtyrerverehrunggegen Mitte des 3. Jhs. und bis ins19. Jh. angelegt. Frz., it., sp. fenestella.
Fenster (lat. fenestra) sind Mauer-öffnungen zur Belichtung undBelüftung der Innenräume. IhreGröße, Form (→ *F.formen), Lageund Gruppierung in der Mauer-fläche ist von großer Wichtigkeitfür die äußere Erscheinung eines
Bauwerkes (→ *Fassade) und durchdie Art der Lichtführung von ent-scheidender Bedeutung für dieWirkung der Innenräume (tiefesoder hohes Licht, Atelierlicht, Kel-lerlukenlicht, Deckenlicht usw.).Die F.öffnung wird oben durchden geraden F.sturz oder durcheinen Bogen (Laibungsbogen), un-ten durch die waagerechte, nachaußen meist abgeschrägte Sohl-bank und seitl. durch die F.laibungoder durch das schräg eingeschnit-
Fenster 172
1 Sturz2 Sohlbank 3 F.Laibung4 Brüstung mit Nische5 F.Brett6 F.Einfassung7 F.Flügel8 Anschlag
9 F.Stock10 F.Band 11 Schlagleiste12 Schenkel13 Glasfalz14 Sprosse15 Wetterschenkel
(Wasserschenkel)
16 Drehflügel17 Wendeflügel18 Kippflügel19 Klappflügel20 Schwingflügel21 Hebefenster22 Senkfenster23 Schiebefenster
Zweiteiliges Doppelfenster Bezeichnung der Fensterflügel:
Fenster
tene, auch profilierte F.gewände(→ *F.schräge) begrenzt. Die lichteÖffnung eines F. heißt F.fläche.Die Wand zwischen Fußboden undF.sohlbank, auf der das F.brett(Simsbrett) aufliegt, heißt F.brü-stung. Sie ist meist dünner als dieAußenmauer, so daß bei großerMauerdicke eine F.nische entsteht.Außen kann die F.öffnung voneiner vorspringenden Rahmung(F.einfassung) umgeben und voneinem vorstehenden Bogen (F.bo-gen) oder Giebel (F.giebel) über-dacht (→ *F.verdachung) sein. Rei-chere Formen nennt man F.bekrö-nung. Die F.öffnung kann durchbewegl. F.läden und F.flügel oderdurch fixe F.scheiben geschlossenwerden. Läden und Flügel könnendirekt am Mauerwerk angeschlagenwerden, sind aber meist an einemfest mit dem Mauerwerk verbun-denen F.stock (der als Blendrah-men, bzw. als Zarge ausgebildet seinkann) bewegl. durch Bänder befe-stigt. Der F.rahmen kann in der Brei-te durch einen oder mehrere F.pfo-sten (Setzhölzer), in der Höhe durchein Querholz (Kämpfer), unterteiltwerden, die zusammen das F.kreuz(Kreuzstock) bilden. Das Setzholzkann fehlen, wenn die Flügel gegen-einanderschlagen und zur Abdek-kung des → *Falzes mit einerSchlagleiste versehen sind. DieF.flügel lassen sich nach innen odernach außen öffnen und sind aus vierSchenkeln zusammengesetzt. Inihre Glasfälze sind die Scheiben ein-gekittet. Große Flügel sind häufigdurch Sprossen in Felder geteilt.Der untere Schenkel nach innenaufgehender Außenflügel ist miteiner nach außen ausladendenWassernase versehen (Wetterschen-kel). Außer den einfachen F. gibt es
noch Doppelf., die durch parallelhintereinander angeordnete Flügelgeschlossen sind und Verbundf.,deren parallele Flügel gemeinsamangeschlagen und mit einem einzi-gen Handgriff zu öffnen sind.Nach der Art ihrer Beweglichkeitunterscheidet man Dreh- und Wen-de-, Kipp-, Klapp- und Schwing-flügel-, sowie Schiebe-, Hebe- undSenkf. Der Beweglichkeit und derFeststellung der Flügel dienen dieBeschläge, Bänder und Reiber oderTriebe. Zu ihnen zählen auch diesog. Scheinhaken, eiserne Winkel,die ein Verziehen der rechtwinkeli-gen Flügel verhindern sollen, unddie Spreizstangen (F.haken), diedem Offenhalten der F. dienen. Engl. window; frz. fenêtre; it. finestra;sp. ventana.
Fensterachse, falls die Mittelach-sen von Fenstern in mehrerenGeschossen übereinander liegen,spricht man von F. Die Fassade er-hält dadurch eine starke vertikaleBindung, so daß man eine Fassadenicht nur nach Geschossen, son-dern auch nach F. (→ *Achsen)charakterisieren kann. Engl. window axis; frz. axe de fenêtre;it. asse della finestra; sp. eje de la ventana.
Fensteranschlag, bei Fenstern einim Gewände angebrachter, um dieFensteröffnung herumlaufenderFalz, in dem das Fensterfutterbefestigt wird. Engl. back fillet, window rabbet; frz. feuillurede fenêtre; it. mazzetta della finestra; sp. al-féizar.
Fensterarkaden, die bogenüber-spannten Teilöffnungen eines →*Arkadenfensters. Engl. window arcades; frz. arcade de fenê-tres; sp. arcadas de ventana.
173 Fensterarkaden
Fensterausschrägung → *Fen-sterschräge.
Fensterband, 1.Teil des Beschla-ges eines Fensters (→ Band 3). 2.Eine Reihe mehrerer unmittelbarnebeneinander liegender Fenster(→ *Fensterformen). Engl. 2. ribbon window; frz. 2. fenêtre enlongueur, fenêtres en bande, fenêtres conti-nues; it. 1. bandella, 2. finestra a nastro;sp. 1. parte de la bisagra de una ventana,2. ventanas entrelazadas.
Fensterbank, 1. Sohlbank, untereBegrenzung des → *Fensters; 2.Sitzbank in einer → Fensternische. Engl. window sill, w. ledge; frz. appui fenê-tre, rebord de f.; it. davanzale; sp. solera,repisa.
Fensterbankgesims, Bankgesims,Sohlbankgesims → *Gesims, →*Fensterbank. Engl. window sill cornice, sill course; frz.encorbellement de fenêtre; it. cornice mar-cadavanzale, c. del davanzale; sp. moldurade la solera, m. de la repisa.
Fensterbekrönung, außen überdem Fenstersturz angebrachte oftsehr freie Schmuckform, deren Vor-läufer Fensterbogen und → *Fen-sterverdachung waren. It. coronamento della finestra; sp. ornamen-to de dintel de ventana.
Fensterbogen, 1. der obere Ab-schluß eines Bogenfensters. 2. Ander Außenwand über einem Fen-ster angeordneter vorspringenderBogen (→ *Fensterverdachung). 3.Entlastungsbogen in der Mauerüber dem Fenstersturz. Engl. 1. arch of a window; frz. 1. arc d�unefenêtre; it. 1. arco della finestra, 2. frontonead arco di finestra, 3. sordino della finestra;sp. arco de ventana.
Fensterbrett, innere Abdeckungder Brüstung eines → *Fensters. Engl. window sill; frz. accoudoir, planched�appui; it. davanzale (interno); sp. apoyo deventana.
Fensterbrüstung, die Mauer zwi-schen Fußboden und Fensterbrett(→ *Fenster). Engl. apron wall; frz. parapet, appui; it. para-petto della finestra; sp. antepecho.
Fenstereinfassung, äußere, dieFensteröffnung rahmende Zier-glieder, oft von einer → *Fen-sterverdachung bekrönt und untenmeist vom Fensterbankgesims ab-geschlossen (→ *Fenster). Engl. casement; frz. chambranle de fenêtre;it. inquadratura della finestra; sp. molduraexterior de ventana.
Fenstererker, nur in der Höheder Fensterzone, nicht in der des
Fensterausschrägung 174
Fensterbanka Fensterbankgesims (Sohlbankgesims)
Fenstererker
ganzen Stockwerks vorspringenderErker. Der F. kommt auch im Fach-werkbau vor, wo er durch Verdop-pelung des Brustriegels und desSturzriegels unter und über derFensteröffnung gewonnen wird. Frz. fenêtre en saillie, f. en corniche; it. fi-nestra sporgente; sp. ventana-mirador.
Fensterfläche, die von Sohlbank,Sturz bzw. Bogen und Gewändebegrenzte Fläche der lichten Fen-steröffnung. Engl. windowpane; frz. surface vitrée; it. su-perficie della finestra; sp. superficie de ven-tana.
Fensterflügel, der zum Unter-schied vom Fensterladen meist ver-glaste bewegl. Teil des Verschlussesder Fensteröffnung (→ *Fenster). Engl. sash; frz. battant de fenêtre; it. batten-te della finestra; sp. hoja, batiente.
Fensterformen, nach der Formder Fensteröffnung unterscheidetman Rechteckfenster, Bogenfen-ster, die nach den → *Bogenformender oberen Abschlüsse benanntwerden (Rundbogenfenster, Fä-cherfenster, Kleeblattfenster, Lan-zettfenster usw.) und → *Rundfen-ster, die kreisrunden Umriß habenund nach ihrer Unterteilung Och-senauge, Radfenster oder Fensterro-se heißen. Eine Sonderform ist dasind. Lotosfenster. → *Blendfenstersind Fenster ohne Maueröffnung.Beim Giebel- und beim Segment-fenster ist die Bezeichnung von derForm der → *Fensterverdachungabgeleitet. Wohnhausfenster sindfast durchweg rechteckig, vorwie-gend liegend oder quadratähnl.Hochrechteckige Fenster über-nahm man von den Palästen, derenFenster wie bei Kirchen, wegen
großer Raumhöhen zunächst über-einander angeordnet und schließ-lich zu schmalen hochgezogenenF. vereint wurden. Bei horizontalerGruppierung erhält man zwei-oder mehrteilige Fenster, die durchmehrere Flügel geschlossen wer-den, aber nur durch Pfosten unter-teilt sind, und gekuppelte oderGruppenfenster. Das sind mehreredurch Pfeiler oder Säulen getrenn-te, aber zu Gruppen zusammenge-rückte Fenster (Zwillings- od. Dril-lingsfenster), mit Überfangbogen(Blendbogen) gekuppeltes Fenstergenannt. Eine fortlaufende Reihevon Fenstern wird Fensterband ge-nannt. Sonderform → *Fenstertür.
175 Fensterformen
Fensterformen
a zweiteiliges Fensterb dreiteiliges Fensterc gekuppeltes Fenster
(Zwillingsfenster)d Drillingsfenstere Fensterbandf Fächerfensterg Schlüssellochfenster
Fenstergesims, 1. ausladendes→ *Gesims in der Höhe einerFensterbank an der Außenwandeines Gebäudes. 2. Eine Form der→ *Fensterverdachung, die seit derital. Renaissance meist nur noch alsMittel zur Belebung von Fassadendurch Schattenwirkung angewen-det wird. It. 1. cornice marcadavanzale, 2. frontonedella finestra; sp. moldura, cornisa.
Fenstergewände → Gewände,schräg eingeschnittene, seitl. Be-grenzung eines → *Fensters inMauerdicke. Engl. jambstone; frz. lancis; it. sguinci dellafinestra; sp. jambas.
Fenstergiebel, (→ Fenstergesims2) vorspringender Dreiecks- oderSegmentgiebel über einem Fenster,urspr. zur Entlastung und vielleichtauch als Regenschutz gedacht,dann nur noch dekorativ ange-wandt, bes. zur Fassadengliederungan Palastbauten der it. Renaissance(→ *Fensterverdachung). Engl. frontal, fronton; it. fron-tone della finestra; sp. fron-tón sobre la ventana.
Fenstergitter, in oder vor der Fen-steröffnung angebrachtes schmie-deeisernes Gitter, manchmal in sei-nem unteren Teil nach außen
schwingend (Fensterkorb), damitman beim Hinauslehnen nichtbehindert ist. Das F. ist oft verziertund bes. an seinem oberen Endereich ausgeschmückt. Engl. window grating; frz. treillis, grillefenêtre, barreaux de f.; it. inferriata (dellafinestra); sp. rejas de ventanas.
Fensterhaken, Spreizstange zumFesthalten nach außen aufgehenderFensterflügel oder -läden. Engl. window stay; frz. crochet tempête defenêtre; sp. pestillo.
Fensterkorb, ausladender untererTeil eines → *Fenstergitters. Engl. window grille, w. grating; frz. fenêtreà l�espagnole, étançon, châssis d�osier; it. in-ferriata inginocchiata; sp. rejas de ventanassobresalientes.
Fensterkreuz, die von Setzholzund Querholz gebildete Teilungeines → Fensters, → Kreuzstock. Engl. cross window; frz. croix de croisée;it. croce della finestra; sp. crucero de vent-ana.
Fensterladen, der aus Holz, selte-ner aus Metall konstruierte äußere(seltener der innere) Verschlußeines Fensters. Die F. können als→ Klappladen, Faltladen, → Falla-den, → Schiebeladen oder → Roll-laden ausgebildet sein. Die Klapp-läden waren früher oft bemalt,manchmal auch mit fixen oder mitbewegl. Jalousien ausgestattet. Engl. (window-)shutter; frz. contrevent,volet, persienne; it. imposta; sp. postigo,persiana.
Fenstergesims 176
Fenstergitter
FensterladenKlapp-, Falt-, Fall-, Schiebe-, Rolladen
Fensterlaibung, Fensterleibung,seitl. Begrenzung eines → *Fen-sters im Inneren eines Raumes. Engl. embrasure, rabbet; frz. mur d�ébrase-ment, embrasure en tableau; it. stipe dellafinestra; sp. derrame.
Fenstermaßwerk → *Maßwerk.
Fensternische, Nische, die hintereiner dünneren Brüstungsmauereines → *Fensters bei größererMauerdicke entsteht. Engl. embrasure, window recess, fenestella;frz. échancrure de fenêtre; it. vano finestra,nicchia della f.; sp. nicho de ventana.
Fensteröffnung, Fensterfläche,Fensterlichte, lichte Öffnung eines→ *Fensters. Engl. window opening; frz. embrasure,ébrasement; it. apertura finestra, luce della f.
Fensterpfosten, Setzholz, senk-rechte Gliederung eines → *Fen-sters. Engl. mullion; frz. poteau d�huisserie, mon-tant de croisée, meneau vertical; it. mon-tante di finestra; sp. entreventana.
Fensterrahmen, fest mit der Mau-er verbundener Teil des → *Fen-sters, Fensterstock, an dem dieFlügel befestigt sind. Engl. window frame; frz. cadre (de fenêtre);it. telaio della finestra, impannata; sp. mar-co, bastidor.
Fensterrose, Rosenfenster, Rose,ein Rundfenster, dessen Lichte mitStein- oder Holzwerk in radialeroder konzentr. Anordnung gefülltist, seit Ende des 14. Jhs. als Rosebenannt. Vorstufen der F. findensich seit 1130/40 in Frankreich, zu-nächst als → Radfenster, → Loch-scheibenfenster oder → Plattenmaß-werk; erst mit dem Aufkommen
des Maßwerks gibt es seit 1220 dieeigentl. F., bis vorrangig konzentr.Lanzetten das Grundgerüst bilden.F. finden sich als bestimmendeGliederung an W.- und Quer-hausfassaden got. Kirchen bes. inFrankreich und Deutschland, ver-einzelt auch in England und an denvon Frankreich beeinflußten Kir-chen in Spanien und Italien. → Ka-tharinenrad. Engl. rose window; frz. rose de fenêtre;it. rosone; sp. rosetón.
Fensterscheibe, das mit Spiel-raum in den Fensterrahmen einge-paßte Fensterglas. Engl. pane; frz. carreau de vitre, panneau dev.; it. vetro (della finestra), lastra di v. (per lafinestra); sp. vidrio, cristal.
Fensterschenkel, die einzelnenTeile, aus denen der Fensterrah-men (Futter- und Flügelrahmen)zusammengesetzt ist. Frz. reverseau, jet d�eau; it. profili (di fi-nestra); sp. perfils de ventana.
Fensterschräge. Um bei relativkleinen Fensteröffnungen in dik-ken Mauern den Lichteinfall zuvergrößern oder das Fenster opt.größer erscheinen zu lassen, wer-
177 Fensterschräge
Fensterschräge
den die Fenstereinschnitte nachinnen, meist auch nach außenschräg geführt. It. strombatura della finestra; sp. derramede la ventana.
Fenstersohlbank, → Sohlbank,→ *Fenster.
Fenstersprossen → *Fenster.
Fensterstock, fest mit dem Mau-erwerk verbundener Rahmen eines→ *Fensters. Engl. window jamb; frz. jambage, huisserie,poteau de fenêtre; it. telaio fisso di finestra.
Fenstersturz, oberer waagerech-ter Abschluß eines → *Fensters alsBalken, Stein oder scheitrechterBogen. Engl. lintel; frz. linteau; it. architrave dellafinestra; sp. dintel.
Fenstertritt, bei hohen Fenster-brüstungen innen vor dem Fensteroder in der Fensternische ange-brachte Stufen. Frz. banquette; it. gradino nel vano dellafinestra; sp. resalto.
Fenstertür, »französisches Fen-ster«, eine bes. in Frankreich anzu-treffende Zwischenform von Fen-
ster und Tür, ein bis zum Bodenoder fast bis zum Boden reichen-des, hochrechteckiges Fenster. Liegtdie F. in einem Obergeschoß, er-hält sie als Brüstung ein meist vorder Fassade liegendes Gitter. Engl. glass door, French window; frz. porte-fenêtre; it. porta finestra; sp. puerta-ventana.
Fensterverdachung, Fensterbe-krönung, vorspringendes Baugliedüber einer Fensteröffnung an derAußenwand, urspr. zur Entlastungund vielleicht als Regenschutz,meist aber rein dekorativ angewen-det (→ Fenstergesims 2, → Fenster-giebel, → *Wimperg). Frz. corniche de fenêtre, entablement defenêtre; it. frontone di finestra; sp. cornisade ventana.
Fensterverschluß, besteht ausFensterrahmen und lichtdurchläs-sigem Abschluß: Marienglas, Glim-mer, Leinwand, Papier, Haut undGlas. Engl. window lock; frz. verrou de fenêtre;sp. cerrojo de ventana.
Fenstersohlbank 178
Fenstertür
Fensterverdachung(Beispiel: Florenz, Palazzo Uguccioni,
16. Jh.)
Fernsehturm, → *Turm, der einenFernsehsendemast trägt und oftauch als Aussichtsturm (manchmalmit Restaurant) dient. Engl. television tower; frz. tour de télévi-sion; it. torre della televisione; sp. torre de latelevisión.
Feste → *Burg.
Feston (frz., nach it. festone), De-korationsmotiv in Form einesbogenförmig durchhängenden Ge-windes aus Laub, Blumen, Früch-ten, oft mit flatternden Bändernan den beiden Enden oder mitBändern kreuzweise umwunden.Urspr. natürl. Schmuck an Altärenund Gebäuden, wurde das F. schonin der Antike in Stein nachgebildetund später, bes. in der Renaissanceund im Klassizismus, auch inStuck, Holz oder Metall ausgeführtoder nur aufgemalt. Engl. festoon; it. festone; sp. festón.
Festung, Veste, ein ausschließl. zuVerteidigungszwecken errichteterWehrbau, der zumeist aus mehre-ren untergeordneten Anlagen be-steht und in Form und Ausbildungvon der Entwicklung der Feuer-waffen abhängig ist. Die F. wirddurch einen aufgeschütteten Wallund davor ausgehobenen Grabengesichert. Die Außenseite der ge-böschten (dossierten) Umwallung(→ Escarpe) ist zumeist bis zurGrabensohle gemauert, ebenso dieGegenseite des Grabens (→ Con-
trescarpe). In breiten Gräben oderan der Böschung der Escarpe kön-nen halb in die Erde eingegrabene,überdeckte und mit Schießschar-ten versehene kleine Erdwerke, dieCaponnièren, angelegt werden,oder die Enveloppes als schmaleAußenwerke im Graben oder ander Contrescarpe. Hinter der Es-carpe mit ihrer Abdeckung (Cor-donstein) liegt ein Bankett für dieSchützen und der gedeckte Roden-gang, darunter häufig Kasematten,überwölbte und zusätzl. durch Erd-aufschüttung geschützte, teilweisemehrgeschossige Räume zur Un-terbringung von Besatzungen,Kanonen und Munition. Den obe-ren Abschluß bilden erhöhte Platt-formen (Kavaliere) zu Beobach-tungszwecken und zur Aufstellungvon Kanonen. Um die Annähe-rung des Feindes zu erschweren undihn mit seinen schweren Schuß-waffen möglichst auf Distanz zuhalten, wird ein leicht abfallendesunbebautes Gelände, das Vorfeldoder Glacis, angelegt. ZwischenGlacis und Contrescarpe liegt zu-meist ein gedeckter Gang. Um je-den Teil der F.mauer mit Feuer-waffen bestreichen zu können,werden Wall und Graben so gebro-chen, daß man von dem vorsprin-genden Teil, den Bastionen, denanschließenden Mauer abschnitt(Kurtine) schützen kann. Aus urspr.runden Bastionen entwickelt sichüber winkelförmige die Anlagemit zwei spitz zulaufenden Facen(Frontlinien) und eingezogenenFlanken (it. Befestigung). So ent-steht zunächst ein Typ mit vorste-henden Eckbastionen (bastionier-ter Grundriß), später der sternför-mige mit einspringenden Winkel
179 Festung
Feston
(tenaillierter Grundriß), der im frz.Festungsbau durch stärkere Be-tonung der Bastionen variiert wird(Vauban 1633�1707). Die it. Befesti-gungsweise mit den spitzwinkligenBastionen verändert der Straßbur-ger Daniel Speck 1589, indem er
den von Albrecht Dürer 1527 ent-wickelten kasemattierten Wall mitkleinen Caponnièren auf die Ba-stion überträgt, 90° für den aus-springenden Winkel wählt und dieBollwerke vergrößert. Zur besse-ren Sicherung des Glacis und der
Festung 180
Festung, Grundriß(a) Glacis; (b) gedeckter Gang; (c) Contrescarpe; (d) einfache Tenaille; (e) doppelteTenaille; (f) Hornwerk; (g) gedeckter Gang; (h) Graben; (i) Ravelin oder Redan; (k) HalberMond oder Flesche; (l) Kronwerk; (m) doppelte Tenaille; (n) Contregarde; (o) Lünetteoder Bastion; (p) Lünette mit gerundeten Flanken; (q) Escarpe; (r) Wall mit Brustwehr;(s) Brücke
Angriffsbauten
(1)Angriffsgräben (2)Kommunikationslinie(3)Batterien (4)Stellungen zur
Grabenverteidigung (5)Sappe (6)Mine
inneren Umwehrung können Au-ßenwerke verschiedener Gruppenangelegt werden, die, der Kurtinevorgelagert, Teile der Hauptf. sindund mit dieser sowie untereinan-der durch schmale, gegen Beschußgeschützte Gänge (gedeckter Weg)verbunden sind. Sie werden gebil-det aus zwei → Facen (Frontlinien)und können mit Flanken an dieKurtine angebunden sein.I. Offene Schanzen: 1. Schulter-wehr als gerade Linie mit Seiten-deckung durch stumpf angesetzteFlügel. 2. Zange oder Tanille alseinspringender Winkel aus zweiFacen. 3. → Redan oder Flesche(aus Halbmond) als ausspringen-der Winkel aus zwei Facen; inetwas größere Form Ravelin ge-nannt, dem Contregarden, zweiparallel zum Hauptwall verlaufen-de Facen, vorgelagert sein können.4. → Lünette, auch Brille oderdetachierte Bastion genannt, ist einRavelin mit kurzen eingezogenenFlanken, durch einen gedecktenGang mit der Festung verbunden.5. Offene Polygonalschanze oderoffene Redoute ist z. B. aus fünfSeiten eines Achtecks gebildet.II. Halboffene Schanzen mit Flan-kierung: 1. Einfache Tenaille(Scheer- oder Zangenwinkel), mitdivergierenden Flanken als Pfaf-fenmütze, mit konvergierendenFlanken als Schwalbenschwanzoder mit angesetzten Schultern zurFlankierung als geschulterte Zan-ge. 2. Doppelte Tenaille mit zweieinspringenden und dazwischeneinem ausspringenden Winkel mitoder ohne Schultern. 3. Tenaillon,ein Ravelin mit zwei halbenContregarden (vor jeder Face ei-ne), die einen eingehenden Winkel
181 Festung
Fest
ung,
Sch
nitt
dur
ch d
ie U
mw
ehru
ng(A
B)
Bau
hori
zont
; (a
cde)
Gra
ben;
(ac
) E
scar
pe;
(a)
Cor
dons
tein
; (b
) A
nzug
; (c
) M
auer
fuß;
(de
) C
ontr
esca
rpe;
(fg
) St
rebe
pfei
ler
oder
Bre
chbo
gen;
(h)
Ron
deng
ang;
(i)
Ban
kett
; (m
no)
Bru
stw
ehr
auf
dem
Wal
l; (r
o) B
anke
tt; (
kl)
Stüc
kban
k; (
tu)
Gla
cis;
(rs
) ge
deck
ter
Weg
; (nw
) A
ufzu
g =
Höh
e de
s W
erke
süb
er d
er G
rabe
nsoh
le;(
pq)
Ban
kett
; (tu
x) G
laci
s co
upé;
(v)
Feue
rlin
ie.
bilden und durch einen Redanoder ein anderes Außenwerk ge-deckt sind. 4. Geschulterter Redanmit drei ausspringenden Winkeln,von denen der mittlere der längsteist. 5. → Hornwerk, zwei halbeBollwerke sind in der Front miteiner → Kurtine verbunden undmit zwei langen parallelen Flügelnan eine Kehle des Festungswerksangeschlossen. 6. → Kronwerk ent-spricht dem Hornwerk, jedoch istdie Kurtine in der Mitte durch eine→ Lünette unterbrochen, die mitder Spitze vor die halben → Boll-werke vorsteht. Um das bes. ge-fährdete Tor zusätzl. zu schützen,wird eine ringförmige Befestigung(Bastille) mit Türmen in Weiter-entwicklung der Barbakane vorge-legt oder ein kleineres flankieren-des Werk (Eschif), das die Zugängezum Tor verteidigt und den Gra-ben bestreicht, oder ein runder dik-ker Turm bzw. eine halbkreisförmi-ge → Bastion (Rondell) angelegt. Engl. fortress; frz. forteresse; it. fortezza,bastita; sp. fuerte.
Feuermauer → Brandmauer.
Feuertempel, durch Stützen un-terteilter, meist quadrat. Baukörperder altiran. Baukunst.
Feuertreppe, eiserne Nottreppe,meist außerhalb des Baukörpers. Engl. fire escape; frz. escalier de secours,escalier d�incendie; it. scala di emergenza,scala antincendio; sp. escalera de emergen-cia, e. de escape.
Fiale (altfrz. fillale: Töchterchen),typ. architekton. Zierform der Go-tik, eine schlanke, spitze Pyramide,die bes. häufig als Bekrönung vonStrebepfeilern und (paarweise) als
seitl. Begrenzung von Wimpergenauftritt. Der untere Teil der F., ihrmeist vier- oder achtseitiger »Leib«,ist in der Regel mit Maßwerk ver-ziert und über jeder Seite miteinem Giebel versehen (mit durch-brochenem Leib → Tabernakel-F.).Darüber erhebt sich der pyrami-denförmige Helm oder »Riese«,der an den Kanten meist mitKrabben besetzt und von einerKreuzblume bekrönt ist. Engl. pinnacle, it. guglia, pinnacolo; sp. pi-náculo.
Figurenfries, Zophoros → *Fries,der mit figürl. Darstellungen ge-schmückt ist, meist über dem Ge-bälk der attisch → *ionischen Ord-nung antiker Tempel. Engl. figural frieze; frz. frise animée; it. fre-gio istoriato; sp. friso con figuras.
Feuermauer 182
Fiale
A Fiale B Wimperga Leib
b Helm, Riesec Kreuzblumed Krabbe
Figurenkapitell, Bilderkapitell,→ *Kapitell, an dem Figuren vonMenschen, Tieren oder Fabelwe-sen erscheinen, oft zu ganzen Sze-nen vereint. Das F. kommt schonin der Spätantike vor, hat sich abererst in der roman. Baukunst bes.Frankreichs voll entwickelt. Engl. figural capital; frz. chapiteau figuré;it. capitello istoriato; sp. capitel con figuras.
Figurierter Verband, ein Mauer-verband, bei dem die Steine in geo-metr. Figuren angeordnet sind. Engl. opus figuratum; frz. voûte ornée defigures; sp. muro adornado geométrica-mente.
Figuriertes Gewölbe, ein Gewöl-be, bei dem die Rippen geometr.Figuren bilden, bei Stern- undNetzgewölben der Spätgotik. It. volta cellulare; sp. bóveda con adornadosgeométricos.
Filigran (it. filigrana, aus lat.filum: Faden und granum: Korn),Schmuckstück aus dünnem, kunst-voll gebogenem Gold- oder Silber-draht mit angeschmolzenen bzw.aufgelöteten Körnchen. Der Be-griff wird vielfach auf jedes ähnl.feingliedrige Zierwerk angewen-det, in der Baukunst z. B. auf dasgot. Maßwerk. Engl. filigree; it., sp. filigrana.
Findling, errat. Block, durch Glet-scher der Eiszeit fortgetragenerGesteinsblock mit abgeschliffenerOberfläche. F. finden sich haupt-sächl. in Norddeutschland, wo siewegen ihrer Härte gern zu Funda-menten und im Bruchsteinmauer-werk verwendet werden. Engl. boulder; frz. bloc erratique; it. massoerratico; sp. bloque errático.
Firmarie (lat. firmare: körperl.und geistig stärken, kräftigen),Krankenstube auf Ordensburgen(→ Infirmarie). It. infermerìa; sp. enfermería de un monas-terio.
First, Dachfirst, die obere, meistwaagerechte Schnittlinie zweiergeneigter Dachflächen (→ *Dach-ausmittlung). Engl. ridge, top; frz.faîte; it. colmo, linea dicolmo; sp. cumbrera, caballete.
Firstbaum → Firstpfette.
Firstbekrönung, Firstkamm, bes.im MA. häufige, auf dem Dachfirstentlanglaufende Verzierung ausStein oder Blei, die kammartig ge-sägt (Firstkamm, Dachkamm) undgitterartig durchbrochen sein kann(Firstgitter). F. kommen auch anReliquienschreinen und Sarkopha-gen, die Werken der Architekturnachgebildet sind, vor. Frz. endossure, crête, faîteau; it. decorazio-ne del colmo; sp. ornamento de una cum-brera.
Firstblume → *Kreuzblume.
Firstgitter → Firstbekrönung.
Firstkamm → *Firstbekrönung.
Firstpfette, bei Pfettendächern zurUnterstützung der → Rofen unterdem First angeordnete Pfette, dievon Säulen oder Stühlen gestützt
183 Firstpfette
Firstbekrönung
wird (veraltet Firstbaum). → *Dach-konstruktion. Engl. ridge purlin; frz. panne faîtère; it. col-mareccio; sp. correa de cumbrera.
Firstsäule, das die Firstpfettestützende freistehende Kantholz(→ *Dachkonstruktion). Engl. king post; frz. poinçon (de faîte);it. montante di sostegno del colmareccio;sp. pendolón.
Firstsäulenbau, Firstständerbau,in seiner Grundform ein zwei-schiffiger Bau, dessen Firstpfettevon einer durch die ganze Höhedes Hauses gehenden Firstsäule(Firstständer) getragen wird; aufder Firstpfette liegen die → Rofen,die ihren unteren Halt auf Fuß-pfetten finden, die zugleich meistals Rähm dienen. F. findet sich vonder W.-Eifel über das mittlereRheingebiet bis in den südwest-deutschen Raum, W.-Oberbayernund N.-Schweiz; früheste datierteBauten aus dem 15. Jh.
Firstständer, in der Giebelwandoder im Gebinde stehender, vomGrund bis zur Firstpfette reichen-der Ständer (→ Spitzsäule); derDachf. wird vom Binderbalkenabgefangen, der Unterf. reicht vomGrund bis zum Hahnenbalkenknapp unter dem First. Engl. continuous post from ground toridge; frz. poteau de fond; sp. poste contí-nuo desde la base hasta el caballete del teja.
Firstverzierung → *Firstbekrö-nung.
Firstziegel, Hohlziegel zum Ab-decken des Dachfirstes (→ Dach-deckung). Engl. ridge tile, crest t.; frz. tuile faîtière, t. enfaîteau; it. (tegola di) colmo; sp. teja de cum-brera.
Fischblase, → *Schneuß, ein imspätgot. → *Maßwerk häufig vor-kommendes Ornamentmotiv, dasdem Umriß der Schwimmblase derFische ähnelt. Die F. kann auch S-förmig geschwungen und in Grup-pen angeordnet sein. Die F. in ei-nem Kreis zusammengestellt, erge-ben z.B. eine Wirbelform, den sog.Dreischneuß. In der frz. und engl.Spätgotik ist die geschwungene F.in die Länge gezogen, so daß sieeher einer Flamme gleicht, weshalbin Frankreich die ganze Spätgotik»Style flamboyant« (geflammterStil) genannt wird (→ Flambo-yant). Frz. vessie de poisson, c�ur allongé; it. ves-cica di pesce; sp. ornamento en forma devejiga pez.
Fischgrat, Fischgrätenverband, ei-ne Art des Mauerverbandes, → *Äh-renwerk. Engl. herring bone; frz. arête de poisson;it. spina di pesce, Fischgratverband: concate-namento a spina di pesce; sp. espina de pez(trabazón o aparejo).
Flachbogen, Stichbogen, Seg-mentbogen, eine Bogenkonstruk-tion, deren Kreismittelpunkt unter-halb der Kämpferlinie liegt; der Pfeilbeträgt im allgemeinen 1/6 �1/12Spannweite. → *Bogenformen. Engl. segmental arch, flat a.; it. arco scemo,a. a sesto ribassato; sp. arco rebajado.
Flachdach, ein Dach ohne odermit sehr geringer Neigung, das alsbegehbares Terrassendach oderauch als Dachgarten ausgestaltet seinkann. Die tragende Unterkonstruk-tion ist meist mit der oberstenGeschoßdecke identisch. Engl. flat roof; frz. toit plat; it. tetto piano;sp. tejado plano.
Firstsäule 184
Flächentragwerk, ein ebenesoder gekrümmtes, stat. zweidi-mensional in Längs- und Quer-richtung wirksames Tragwerk ausStahlbeton oder Kunststoff zurstützenden Überspannung großerFlächen bei geringen Konstruk-tionshöhen. Frz. surface porteuse; it. struttura portantebidimensionale; sp. estructura resistentebidimensional.
Flachkuppel, eine Kuppel, derenWölbung von einem Kugelab-schnitt (Kalotte), nicht von einerHalbkugel gebildet wird, so daß ihrPfeil (Stich) geringer als der Halb-messer ist (→ *Kuppel). Engl. flat dome; frz. coupole aplatie, c. sur-baissée; it. cupola a sesto ribassato; sp. cú-pula aplanada.
Flachrelief, Basrelief, plast. Kom-position, die sich schwach über demHintergrund erhebt (→ *Relief). Engl. bas relief, low r.; frz. bas-relief; it. bas-sorilievo; sp. bajo relieve.
Flachschicht, hauptsächl. bei derPflasterung von Fußböden ge-brauchte Bezeichnung für dasVerlegen der Backsteine auf ihrerBreitseite (Gegensatz: hochkant). It. (pavimento con mattoni disposti) dipiatto; sp. pavimento con ladrillos dispues-tos por su lado plano.
Flachtonne, Tonnengewölbe mitsegmentbogenförmigem Quer-schnitt (→ *Gewölbeformen). Engl. flat barrel vault; it. volta a botte ribas-sata; sp. bóveda rebajada.
Flachziegel, → Biberschwanz und→ Kremper der → Dachdeckung. Engl. flat tile; frz. tuile plate; sp. teja plana.
Flamboyant (frz. flammend, ge-flammt), → *Maßwerk der spätgot.Baukunst in Frankreich und Eng-land, Flowing tracery, die vonder dort als Flamme gedeuteten→ Fischblase bes. starken Ge-brauch macht. Engl. flamboyant style; frz. style flambo-yant; it. fiammeggiante; sp. estilo gótico fla-mígero.
Flammenstil, wenig gebräuchl.Verdeutschung von → Flamboyant.
Flanke, Seitenfläche einer → *Ba-stion zwischen Face und Kurtine. Engl. flank; frz. flanc; it. fianco; sp. flanco.
Flanschen, waagerechte Elementeeines Profilträgers (T-Träger), diedurch einen → *Steg verbundenwerden. Engl. flange; frz. bourrelet, Rohrflansch:bride; it. ala; sp. planchas de un perfil.
Flechtband, bandförmiges Orna-ment aus einem oder mehrerenStreifen, die sich in sich oder mit-einander verschlingen, wahrschein-lich aus der Flechttechnik entwik-kelt. Das F. kommt bereits in vor-geschichtl. Zeit als Ziermotiv vor,wird in der Antike gern als Rand-verzierung (z. B. von röm. Mosa-ikfußböden) verwendet und trittin der Holz- und Steinarchitekturdes MA. hauptsächl. an Balken,→ *Friesen, Bändern, Gesimsenund Kapitellen auf (→ *Fries 7). Engl. interlace; frz. entrelacs, nattes, treillis;it. fascia intrecciata, bordo intrecciato;sp. almocárabe.
Flechtrippe, vom Gewölbekämp-fer ausgehende, zur Transversal-bzw. Scheitelrippe aufsteigendeNebenrippe, meist in der Art eines
185 Flechtrippe
sich überlagernden Rippendrei-strahls als Flechtrippengewölbe.
Flechtwand, frühgeschichtl. bisma. Wandkonstruktion aus Pfäh-len, Spaltbohlen oder Staken, zwi-schen die Weidenruten geflochtensind, die mit Lehm beworfen wer-den (→ Flechtwerk).
Flechtwerk, 1. Weidenruten, diezwischen die Staken eines Fach-werk-Gefachs geflochten und mitStrohlehm beworfen werden, dar-auf Lehmglattstrich und Kamm-strich zur Haftung des Lehms oderKalkputzes. 2. Flächenfüllung einesBauelements mit → Flechtband-Ornamentik, bes. an Kapitellenund Friesen (→ Flechtwand). Engl. 1. wicker, latticework; frz. 1. clayon-nage; it. 1. intrecciatura, graticciata, tralic-cio, 2. ornamento a intreccio; sp. armazónentretejido de mimbre con adobe.
Fledermausdachfenster, Fleder-mausgaube, Dachfenster mit senk-rechter Stirnwand, deren obereBegrenzung bogenförmig ausge-bildet ist und die Dachdeckung derGaube ohne Kehlenbildung stetigin die Dachfläche übergeht, bes.für Biberschwanz-, Schiefer- undStrohdeckung geeignet. Engl. eyebrow window; it. abbaino a cuffia,abbaino ricurvo; sp. buhardilla arqueada.
Fledermausgaube, Froschmaul,→ *Dachfenster.
Flesche, Verteidigungswerk in derForm eines ausspringenden Win-kels, am Glacisfuß oder vorgescho-ben, oft durch einen doppelten→ Koffer mit dem Glacis verbun-den (→ Redan, → Ravelin).
Flett → Diele.
Fliehburg, Fluchtburg, mit Wäl-len, Palisaden oder Mauern befe-stigter Bezirk in vor- und frühge-schichtl. Zeit, der in Kriegszeitenvon der Bevölkerung des umlie-genden Gebietes als Zufluchtsortaufgesucht wurde (oppidum). ImMA. erfüllten die → *Wehrkirchendenselben Zweck. Eine in Spurenerhaltene F. wird irrtüml. vielfachals Heuneburg, Hünenburg, Rö-mer- und Schwedenschanze be-zeichnet.
Fliesen (mittelniederdt. vlise ausmhd. vlins: Steinstück), vier- odermehreckige Platten zum Bekleidenvon Wänden und Fußböden, meistaus gebranntem oder auch ausgesintertem Ton. Farbige F. warenschon im alten Orient (Babylon,Assur) bekannt und wurden imislam. Osten das bevorzugte Deko-rationsmittel für Außenwändesakraler und profaner Monumen-talbauten, während der span.-mau-rische Westen ihre Verwendung aufInnenräume beschränkte (→ Azu-lejos). Die Bemalung der einzelnenF. mittels Zinnschmelz wurde imganzen MA. betrieben; berühmtsind die pers. Wandf. des 13. Jh. ingepreßtem Relief mit farbigen Ara-besken und Tierdekor. Im Abend-land kommt im 12. Jh. in Kirchenund Klöstern der Fußbodenbelag
Flechtwand 186
Fliehburg
aus zuerst unglasierten roten odergelbl. Tonplatten mit eingeritztemoder eingepreßtem Muster auf, diespäter auch mit einer Bleiglasurüberzogen wurden. Mit der Aus-breitung der → Fayence unter it.Einfluß im 15. Jh. wurde dieseTechnik auch nördl. der Alpen zurHerstellung farbiger Wandf. ange-wandt, von denen die im 17. u. 18.Jh. in der niederländ. Stadt Delfterzeugten »Delfter Kacheln« bes.geschätzt wurden (→ *Baukera-mik). Engl. tiles; frz. carrelages, carreaux; it. pias-trelle, mattonelle; sp. azulejo, ladrillo.
Flötz, süddt. Bezeichnung für denHausflur, bes. in Bauernhäusern,der dielenartig ausgeweitet seinkann.
Flowing tracery (engl.), »fließen-des Maßwerk« wird die im späterenDecorated style der engl. Gotik an-gewandte Form des → *Maßwerksgenannt, die sich von der vorausge-gangenen durch bewegtere Linien-führung im Sinne des → Flambo-yant unterscheidet. It. traforo serpeggiante; sp. tracería ondeante.
Flucht, 1. gerade Linie (F.linie), diemehrere Gebäude oder Bauteilenach einer Seite hin begrenzt undals → Bauflucht behördl. vorge-schrieben sein kann. 2. Eine Folgevon Zimmern, die geradlinig hin-tereinanderliegen, d.h. an einerAchse aufgereiht sind (Zimmer-flucht, → *Enfilade). 3. Genau ge-radliniger Verlauf einer Mauer, diedazu »ab«- oder »eingefluchtet«wurde, so daß sie fluchtet.Frz. affleurement; it. 1. allineamento edili-zio, 2. fuga di stanze, infilata di s.; sp. 1. ali-neación, emparejamiento de edificios.
Fluchtburg → Fliehburg.
Fluchtlinie, seit dem F.-gesetzvon 1875 werden in den Städtenund ländl. Ortschaften dem öf-fentl. Bedürfnis entsprechend undunter Berücksichtigung des Ver-kehrs, der Feuersicherheit und öf-fentl. Gesundheit sowie des Orts-und Landschaftsbildes entwederfür einzelne Straßen oder Plätzeoder Teile davon, auch für größereGrundflächen F. festgesetzt, die dieBebaubarkeit des Grundstücksbegrenzen (→ Bauflucht). Engl. building line, baseline; frz. aligne-ment; it. allineamento; sp. alineamiento.
Fluchtpunkt → *Perspektive.
Flügel, 1. Baukörper, die an einenHauptbau anschließen, oft paar-weise, auch im Winkel angeordnetund baul. wie funktionell diesemuntergeordnet. Hauptsächl. beim→ Cour d�honneur eines Barock-schlosses. 2. Die bewegl. Teile bei→ *Türen und → *Fenstern oderan einem → *F.altar. Engl. wing; frz. 1. aile, 2. battant; it. 1. ala,2. anta, battente; sp. ala de edificio.
Flügelaltar, hauptsächl. von derdt. Gotik entwickelte Form des→ *Altarretabels. Der F. bestehtaus einem feststehenden, meisthölzernen Mittelteil, dem Altar-schrein, an dem rechts und linksbewegl. Flügel aus Holz ange-bracht sind. Schrein und Flügelsind mit geschnitzten (Schnitz-altar) oder gemalten Darstellungenversehen, doch sind die Flügel anihrer Außenseite meist nur bemalt,so daß der F., wenn er geschlossenist, nur Gemälde zeigt. Statt des ei-nen Flügelpaares kann der Schrein
187 Flügelaltar
auch mehrere Flügel haben, waseinen mehrfachen Wandel derAnsichten ermöglicht (Wandel-altar). Im 15. Jh. und später wirdder F. mit einem Untersatz in derBreite des Schreins versehen, derPredella oder Altarstaffel, die meistauch mit geschnitzten oder gemal-ten Darstellungen ausgestattet istund in der Mitte ein Gehäuse zurAufnahme des Hostienbehältershaben kann. In der Spätgotik erhältder Schrein vielfach einen hohen,turmartigen Aufbau, das Gespren-ge, ein Gebilde aus zierl. unddünnen Architekturgliedern, auchmit geschnitzten Figuren besetzt. Engl. winged altarpiece; frz. retable à volets;it. ancona ad ante, mehrflügeliger Altar: polit-tico; sp. altar con alas, retablo c. a.
Flughafen, bestehend aus dem F.-Gebäude (Abfertigungsgebäude),Kontrollturm, Hangar und Roll-feld. Das F.-Gebäude, zwischenRollfeld und öffentl. Verkehrsraumgelegen, dient der Versorgung derPassagiere und soll diese zum Flug-zeug leiten, entweder zu Fuß undmit dem Bus zum Flugzeug, oderüber Flugsteige, Fingerdocks undSatellitenflugsteige, die unter-schiedl. erreicht werden können. Engl. airport; frz. aéroport; it. aeroporto;sp. aeropuerto.
Flugsparrendreieck → Freige-spärre, → Schwebegiebel.
Flur → Hausflur.
Flußpfeiler, Zwischenpfeiler ei-ner → *Brücke im Gegensatz zumLandpfeiler. Engl. river pier; sp. cepa de un puente, pilard. u. p.
Flüstergewölbe, Flüstergalerie,Bezeichnung für einen überwölb-ten Raum, in dem an einer Stellegeflüsterte Worte durch Reflexionan einer entfernten Stelle deutl. ver-nehmbar sind, während sie im üb-rigen Raum nicht und aus derNähe kaum gehört werden. DieseErscheinung kann zufällig seinoder auf einer raffiniert ausgeklü-gelten Planung beruhen (meistellipt. Raumbegrenzungen, Spre-cher und Hörer in den Brenn-punkten). Engl. whispering gallery, w. dome; sp. bóve-da de murmullo.
Flughafen 188
Gotischer Flügelaltar
a Schrein b Flügel
c Predellad Gesprenge
Fondaco (it.), Warenniederlage,Herberge und Gasthof der ausländ.Kaufleute, zuerst in Syrien und im12. Jh. in Sizilien, später auch inVenedig, Kontinentaleuropa, bes.Spanien und Vorderer Orient. Frz. fondaco; sp. albergue de comerciantes.
Formstein, natürl. oder künstl.Stein (Backstein, Ziegel, Beton),der in eine bes. Form gebracht ist,weil er als Bogenstein, für Gesims-profile, Kämpfer, Schlußstein und inder modernen Architektur zur Fas-sadenverkleidung gebraucht wird. Engl. moulded brick, shaped b.; frz. briquemoulurée, b. profilée; it. Backstein: lateriziomodellato in forma, mattone di forma spe-ciale, Naturstein: pietra lavorata, concio;sp. ladrillo modeado, l. formado.
Fort (frz. fest, stark), kleine selb-ständige Festungsanlage, deren meh-rere einer Festung bzw. → *Stadt-befestigung als Gürtelforts (deta-chierte Forts) vorgeschoben seinkönnen. Sehr kleine F. wurden im19. Jh. Fortins genannt. Engl. fort, fortress; it. forte; sp. fuerte, for-taleza.
Forum (lat.), ein meist viereckigerPlatz der röm. Stadt, der wie die gr.→ *Agora als Marktplatz und Ver-sammlungsort diente und an demdie öffentl. Gebäude lagen. Wäh-rend kleinere Städte nur einenMarktplatz hatten, gab es in Romund anderen Städten mehrere Fo-ra (Rindermarkt, Gemüsemarkt,Fischmarkt u. a.) in verschiedenen
189 Forum
A Basilika B ApollontempelC JupitertempelD Markt (Macellum)E Heiligtum der LarenF Halle der EumachiaG BogenH Forum
(Beispiel: Pompeji)
J TrajanstempelK TrajanssäuleL Basilika UlpiaM TrajansforumN Augustusforum
O CaesarforumP NervaforumQ Basilika AemiliaR Forum Pacis
(Beispiel: Rom, Kaiserfora)
Forum
Stadtvierteln. Zum eigentl. Mittel-punkt des polit. und religiösenLebens in Rom aber wurde dasForum Romanum zwischen Kapi-tol und Palatin, das bis in die legen-däre Gründungszeit Roms zurück-reichende Erinnerungsstätten barg.Auf ihm und an seinem Rand wur-den im Laufe der Zeit mehrereTempel, Basiliken, Markthallen undTriumphbogen errichtet. Als derPlatz schließl. nicht mehr ausreich-te, wurden von einigen Kaisern(Caesar, Augustus, Nerva, Trajan)neue Fora, die sog. »Kaiserfora«,angelegt, die mit ihren wiederumzahlreichen öffentl. Gebäuden je-doch im Unterschied zum F. Ro-manum eine straffe achsiale Glie-derung aufweisen. In Anlehnungan das röm. F. wurden auch inByzanz versch. Fora errichtet. Engl. forum; it., sp. foro.
Foyer, eigentl. Feuerherd, übertra-gen auf Heizraum und schließl. aufeinen Raum, in dem man sich er-wärmt, so der Vorraum bei densonst ungeheizten Theatern, heuteallgemein der repräsentativ gestal-tete Vorraum von Versammlungs-sälen. Engl. foyer, lobby, entrance hall; frz. foyer;it. foyer, atrio, im Theater: ridotto; sp. salónde descanso, foyer.
Französische Ordnung (Frz. Säu-lenordnung), von dem frz. Baumei-ster und Architekturtheoretiker derRenaissance, Philibert Delorme,erfundene und zuerst praktizierteManier, die Säulenschäfte mit brei-ten Rustikaringen zu gliedern odersie aus verschieden ornamentiertenTrommeln zusammenzusetzen. Engl. French order; frz. ordre français;it. ordine francese; sp. orden francés.
Französischer Garten, in der 2.Hälfte des 17. Jhs. aus dem it.Gartenstil entwickelte Parkanlage,die sich allgemein in Europa ver-breitete, bis sie im Laufe des 18.Jhs. vom → Englischen Gartenabgelöst wurde. In Verlängerungder Schloßachse lag die Haupt-achse des Gartens als ein vonHecken gesäumter Weg; Wasser-läufe, Rasenstreifen dienten derGeländegliederung, Taxuspyrami-den und Fontänen der reichen Ver-zierung; künstl. Ausstattung einesnach baul. Grundsätzen axial ge-gliederten Geländes in engster Be-ziehung zur Architektur, vor demSchloß eine Terrasse, dann dieParterres: Parterre de broderie ausFiguren, die Stickmustern ähnl.sahen; Parterre de compartiment,das durch zwei Achsen in vier glei-che Stücke geteilt war; Parterre àl�anglaise, Parterre de pièces cou-pées mit Blumenbeeten und Par-terre d�eau, aus einer regelmäßigenAnordnung von Wasserflächen undFontänen bestehend. Engl. French garden; frz. jardin français;it. giardino (alla) francese; sp. jardín francés.
Französische Säulenordnung→ Französische Ordnung.
Französisches Fenster → *Fen-stertür.
Fraternei (lat. frater: Bruder)→ Brüdersaal.
Frauenseite, die für die Frauenwährend des Gottesdienstes zumSitzen bestimmte nördl. Seite desKirchenschiffs. Engl. Gospel side; frz. côté de l�Evangile;sp. lado norte de la nave central de una igle-sia.
Foyer 190
Freigespärre, giebelseitig frei vordie Giebelwand gesetztes Sparren-paar; es wird am Fuß häufig durcheinen auf dem vorkragenden Rähmliegenden, in sich unverrückbarenDreiecksverband (in der SchweizFlugsparrendreieck genannt, auchSparrenknecht) gehalten und ruhtim oberen Bereich auf vorkragendenKonstruktionshölzern (im Rhein-land auch Schwebegiebel genannt). Engl. jettied truss; frz. ferme débordante;sp. envigado reforzado, maderamen r.
Freitragende Treppe, Treppe,deren Stufen an einem Ende in dasMauerwerk des Treppenhauses festeingemauert sind, während das an-dere Ende frei schwebt, aus natürl.oder künstl. Steinen, Eisen oderStahlbeton. Engl. cantilevered staircase; frz. escalier sus-pendu à jour central; it. scala con gradini asbalzo; sp. escalera con gradas en voladizo.
Freitragende Wand, leichte Schei-dewand, die keiner Unterstützungdurch Wände, Pfeiler oder Bogenbedarf. Engl. cantilevered wall; frz. mur autopor-tant; it. divisorio autoportante; sp. muroautoportante.
Freitreppe, offene Treppenanlage,die zum erhöhten Erdgeschoß oder1. Obergeschoß eines Gebäudesempor führt, im Unterschied zur→ Außentreppe senkrecht auf denEingang zuführend. Bereits imAltertum waren monumentale F.ein wichtiges baukünstler. Gestal-tungsmittel zu Burganlagen, Propy-läen, Tempel; im MA. vor Kirchen,seit der Renaissance an Rathäu-sern, Schlössern und Bürgerhäu-sern (→ *Beischlag). Engl. open stair, outside s., exterior s.;frz. perron; it. scalinata, scalea; sp. escalinata.
Freskomalerei, Malerei mit inWasser angeriebenen kalkbeständi-gen Farben auf frischem (it. fres-co), kurz vorher aufgetragenemKalkputz. Die Farben dringen indie nasse Putzschicht ein und blei-ben nach dem Trocknen unlösl.mit ihr verbunden. Da bei dieserTechnik das einmal Begonnenenoch am gleichen Tag vollendetsein muß, werden große Freskenabschnittsweise ausgeführt, was ei-ne genaue Vorplanung des Ganzenerfordert. Als Hilfsmittel hierzudienen Kartons mit Vorzeichnun-gen in der Größe des Originals,deren Umrisse auf die Wand über-tragen werden. F. kannten bereitsdie Ägypter, Babylonier und Grie-chen, die Etrusker und vor allemdie Römer. Im MA. wurden ganzeKirchen in Freskotechnik ausge-malt, manchmal in Verbindung mit→ Seccomalerei. Einen bedeuten-den Aufschwung nahm die F. in derRenaissance, bes. in Italien, wo fastalle großen Maler auch Fresken ge-schaffen haben. Sie erreichte ihrenHöhepunkt in der Deckenmalereides Barocks (→ Decken-, → Wand-,→ *Architekturmalerei, → *Fassa-denmalerei). Engl. fresco painting; frz. peinture à fresque;it. affresco; sp. pintura mural, fresco.
Friedhof, Totenacker, Gottesacker,Kirchhof, Begräbnisplatz und Stät-te der Totenverehrung, urspr. au-ßerhalb der Siedlungen; die Chri-sten bestatteten neben Kirchenund Kapellen, in Rom auch in den→ *Katakomben. Im MA. grund-sätzl. an der Pfarrkirche gelegenund von einer Mauer umgeben, imspäteren MA. auch getrennt; zuBeginn des 20. Jhs. parkähnl. Zen-
191 Friedhof
tralfriedhöfe am Großstadtrand, alsSonderform der → Camposanto. Engl. cemetery; frz. cimetière; it. cimitero,camposanto; sp. cementerio.
Fries, in der Baukunst allgemeinjeder glatte schmale Streifen zurAbgrenzung oder Teilung von Flä-chen, im bes. der waagerechte glatteoder ornamentierte Streifen (Or-namentf.) am oberen Rand einerWandfläche. Beim antiken Tempelheißt F. der unter dem Kranzge-sims des Daches entlanglaufendeStreifen, der am dorischen Tempel(→ *Dor. Ordnung) aus Triglyphenund Metopen zusammengesetzt(Triglyphenf.), bei der → *Ion. u.Korinth. Ordnung ein ungeteiltes,mit Figurenreliefs besetztes Ele-ment ist (Figurenf., Zophoros, so-wie der aus Stierschädeln gebildeteBukranienf.). Von den gemaltenoder plast. Ornamentfriesen derAntike sind die am häufigsten vor-kommenden das → Kymation, derAkanthusf., der aus Palmetten undVoluten bestehende Palmettenf.,das aus Palmetten und Lotosblütenzusammengesetzte → Anthemionund der → Mäander, der in gerun-deter Form, sich überschlagendenWogen ähnl., »laufender Hund«genannt wird. Eine nicht mehr reinantike Sonderform ist der Zangenf.bzw. das Flechtband. Das MA. hateine Fülle von F.formen hervorge-bracht, vorwiegend von abstrakt
stereometr. Bildung, wie den Rau-tenf., den Diamantf., den ausschachbrettartig angeordneten, vor-und zurückspringenden Elementenbestehenden Würfel- oder Schach-brettf. und den mit letzterem ver-wandten Rollen- und den Schup-penf. Erfindungen der normann.Kunst sind ferner der Zickzackf.,der Zinnenf., Scheibenf. und Ku-gelf., die häufig an Bogen vorkom-men. Hauptsächl. auf normann.Bauten beschränkt sind auch derPlattenf. und der Kugelf.; seltenereF.formen sind der Hundszahn unddas Wolkenornament. Eine sägeför-mige Struktur hat der Sägezahnf.,während das → Dt. Band bzw. derZahnf. aus übereckstehenden Back-steinen besteht. Der aus Rundbo-gen zusammengesetzte → Bogen-fries kommt in der roman. Bau-kunst bes. häufig vor, während dermit ihm kaum verwandte Kreuzbo-genf. mehr der normann. und islam.Baukunst zugehört. Die Gotik ent-wickelte neben dem Spitzbogenf.hauptsächl. Blatt- und Laubwerkf.und aus Maßwerk gebildete F.Beliebt war auch der Lilienf., deraus Spitzbogen (oft mit Maßwerk)besteht und anstelle der Konsolenlilienähnl. Endigungen besitzt. DieRenaissance verwendete im Wesent-lichen die antiken F., wenn auch inmannigfaltigen Variationen. Engl. frieze; frz. frise, plate-bande; it. fregio;sp. friso.
Fries 192
1 Bukranienf., Aaskopf
2 Akanthusf.3 Anthemienf.4 Mäander5 Laufender Hund6 Zangenf.7 Flechtband,
Entrelac
8 Rautenf.9 Diamantierung 10 Würfelf.,
Schachbrettf.11 Rollenf.12 Schuppenf.13 Figurenf.14 Zickzackf.15 Zinnenf.
16 Scheibenf.17 Kugelf.18 Plattenf., Felderf.19 Hundszahn20 Wolkenornament21 Sägezahnf.22 Deutsches Band,
Zahnf.23 Rundbogenf.
24 Kreuzbogenf.25 Spitzbogenf.26 Blattwerkf.27 Lilienf.28 Palmettenf.
Frigidarium (lat. frigidus: kalt),Raum für kalte Bäder in den röm.→ *Thermen.
Front, 1. Vorderansicht (→ *Fassa-de) eines Baus, aber auch als Rück-oder Seitenf. 2. Im Festungsbaujede Seite einer vieleckigen Fe-stung, die eine Kampfeinheit bil-det, da ihre Anlagen sich gegensei-tig bestreichen können. Engl. 1. façade, front; frz.1. façade, face; it. 1.facciata, fronte, 2. fronte; sp. elevación, fa-chada, frente.
Frontale (lat.), andere Bezeich-nung für → *Antependium, dieVerkleidung an der Frontseite einesAltars. Engl. antependium, frontal; it. antepen-dium, paliotto; sp. revestimiento frontal delaltar.
Frontalperspektive, eine → *Per-spektive, deren einziger Flucht-punkt dem betrachtenden Augegegenüber in der Bildmitte liegt. Engl. frontal perspective; frz. perspectivecentrale; it. prospettiva frontale; sp. per-spectiva frontal.
Frontispiz (frz. frontispice: Vorder-oder Hauptansicht), Frontgiebel,Giebeldreieck über dem Mittel-risalit eines Gebäudes (→ *Risalit),auch über Türen und Fenstern, oftauch mit dem im Franz. dafürgebräuchl. Wort als Fronton be-zeichnet. Engl. frontispiece; it. frontespizio; sp. fron-tispicio, frontón.
Fronton (frz.) → *Frontispiz.
Froschmaul, Fledermausgaupe→ *Dachfenster.
Froschperspektive, eine → *Per-spektive mit tiefliegendem Hori-zont (waagerechte Blickrichtung)oder mit nach oben gerichtetemBlick. Engl. worm�s-eye view; frz. perspective à rasde terre; it. prospettiva dal basso; sp. per-spectiva a ras de tierra.
Fuchs, gemauerter Verbindungs-kanal zwischen Heizkessel undSchornstein. Engl. smoke flue; frz. carneau; it. condottodel fumo (tra focolare e fumaiolo); sp. con-ducto del humo.
Fuge, 1. der hohle oder mit einemBinde- oder Dichtungsmittel ge-füllte Raum zwischen zwei anein-anderliegenden Elementen glei-chen oder verschiedenen Mate-rials, auch die sichtbare Grenzliniezwischen ihnen. Die waagerechteF. im Mauerwerk (Mauerverband)heißt Lagerf., die senkrechte Stoßf.Eine F. ohne Mörtel heißt Luftf.(Trockenf.). Füllt der Mörtel die F.
Frigidarium 194
Frontispiz(Beispiel: Münster, Schloß, 18. Jh.)
nur teilweise aus, so daß sie an derAnsichtsfläche der Mauer hohlerscheint, so spricht man von offe-ner F. → Anfangsf., → Bruchf.,Keilf. und Scheitelf. 2. Bauf., eineF., die Bauteile aus arbeitstechn.und konstruktiven Gründen trennt(Arbeitsf., Dehnf., Setzf.). Engl., frz. joint; it. giunto; sp. junta, juntu-ra.
Füllbrett, Windbrett, ein Brett,das den Zwischenraum zwischenden Balkenköpfen einer Decken-balkenlage im niedersächs. Fach-werkbau füllt. Engl. panel board; frz. panneau.
Füllholz, 1. zumeist profiliertes,zwischen den Balkenköpfen ober-halb des Rähms zum Verschluß derDeckenfüllung an der Außenwandeingesetztes Holz, auch als Brettvorkommend. 2. Zwischen zweiWechselhölzern eingfügtes Holz(→ Wechsel). Engl. filler; frz. pièce de remplissage; sp. ma-dero de relleno.
Füllmauer, eine Mauer, die zwi-schen regelmäßig gemauertenAnsichtsflächen (Blendmauer) mitBruchsteinen oder Mörtel aufge-füllt ist (→ *Mauerwerk). Frz. mur de remplage; it. muro a sacco;sp. muro de relleno.
Füllung, bei Türen, Wandverklei-dungen, Möbeln, Decken u. dergl.die meist aus dünnerem Holzbestehende Fläche, die von einemdickeren Rahmen umgeben wird,in dem Nuten zur Aufnahme deram Rande manchmal in der Holz-dicke verringerten (→ *Abplattung2, Abgründung) F. angebracht sind.Bei der überschobenen F. ist die
Dicke der F. gleich oder annäherndgleich der Dicke des Rahmens. Engl. panel; frz. panneau (de remplissage),pan; it. pannello; sp. relleno.
Fundament (lat. das Gegründe-te), Bankett, Grundmauer, ist dieGesamtheit des Unterbaus einesGebäudes. Bei nichtunterkellertenBauwerken muß die F.mauer(Grundmauer) immer bis in frost-freie Tiefe heruntergeführt werden.Von einer Tiefgründung sprichtman, wenn das F. wegen einesschlechten Baugrundes in größereTiefe heruntergeführt werden muß.Daneben kommt die Flachgrün-dung vor, bei der die F.breite so großsein muß, daß die zulässige Bean-spruchung der Baugrundpressungnicht überschritten wird. Falls dieF.breite wesentl. größer ist als dasMauerwerk, so kann das F. einmaloder mehrfach abgetreppt werden,doch darf der Winkel der Druck-verteilung nicht geringer als 45°angenommen werden. Bei schlech-tem Baugrund wird oft die Pfahl-rostgründung verwendet. Auch
195 Fundament
Füllungoben: überschobene Füllungunten: Rahmen und Füllung
können armierte F.platten sowie→ *Erdbogen bzw. umgekehrteGewölbe unter dem Baukörper an-geordnet sein. Engl. foundation; frz. fondations; it. fonda-zione, Pl. fondamenta; sp. fundación, cimi-ento.
Fundamentbogen, Spannbogen,Spanner, unter der Erdgleiche lie-gender Bogen in der Fundament-mauer zur Überspannung von Bo-denstörungen (Brunnen, Morast,Klüfte) oder zur Einsparung vonBaumaterial, nicht zu verwechselnmit → *Erdbogen. Engl. foundation arch; frz. arc de fondation;it. barulla; sp. arco de fundación.
Fünfblatt, eine aus fünf gleich-großen Spitzbogen bestehende Fi-gur des got. Maßwerks (→ Blatt 2). Engl. cinquefoil; frz. cinq-feuille, quinte-feuille, pentagone lobé; it. pentafoglio;sp. rosetón de cinco hojas.
Fünfpaß, Figur des got. Maßwerksaus fünf gleichgroßen Kreisteilen,die in oder um einen Kreis ange-ordnet sind (→ *Paß). Engl. cinquefoil; frz. quintefeuille; it. penta-lobo; sp. rosetón de cinco lóbulos.
Funkturm → Fernsehturm.
Furniere (frz. fournir: mit etwasversehen, aus ahd. frumjan: ver-schaffen, vollenden), dünne Blätter(0,3�8 mm) aus edlen Hölzernzum Bekleiden von Möbeln ausweniger wertvollem Holz. Das ein-zelne Furnier, durch Schneiden,Sägen, Hobeln oder Schälen ge-wonnen, wird auf die aufgerauhteUnterlage (Blindholz) aufgeleimt. Engl. veneer; frz. placage, contre-placage,feuille de placage; it. impiallacciatura;sp. hoja de madera.
Fußband, → Band zwischen Stän-der und Schwelle im → *Fachwerk-bau, das am Fußpunkt einen Drei-ecksverband herstellt. Engl. foot brace; frz. lien de base; it. piccolocontraffisso di piede; sp. unión pie derecho-solera.
Fußboden, gegen Verschleiß undAbnutzung widerstandsfähigeSchicht als untere Begrenzung desRaums, eine zum Betreten be-stimmte Fläche, insbes. der begeh-bare Belag von Geschoßdecken inInnenräumen, bestehend aus Na-tursteinplatten in Mörtel verlegt,Backsteinen oder Tonfliesen, Est-
Fundamentbogen 196
1 Fundamentkörper (Beton)2 Kellermauerwerk3 Horizontalisolierung (Dichtungsbahn)4 Sockelplatte5 Traufpflaster6 Hinterfüllung7 Vertikalisolierung (Anstrich)
Fundament
Flachgründung
rich oder Mosaik sowie Holzf. alsDielenf., Tafelf., Riemchenf. undParkettf., selten Eisen- oder Glas-platten. Engl. floor, flooring; frz. sol, plancher, aire;it. pavimento; sp. piso, suelo.
Fußgesims, Sockelgesims, Gesimsals unterer Abschluß einer Wandauch über einem Sockel (→ *Ge-sims). Engl. base moulding; frz. moulure de labase; it. cornice del basamento; sp. molduradel zócalo.
Fußleiste, etwa 10cm hohe Holz-leiste zur Deckung der Fuge zwi-schen Wand und Fußboden undzum Schutz der Wand beimBodenreinigen (Scheuerleiste). Engl. skirting board, baseboard; frz. anté-bois, plinthe; it. battiscopa, zoccolo; sp. guar-dapolvo, listón del zócalo, tabla d. z.
Fußpfette, → Pfette, die Fußpunktder Rofen oder Sparren abstützt,kann häufig zugleich den → Rähmder Fachwerkwand bilden. Engl. inferior purlin; frz. panne sablière, p.inférieuere; it. arcareccio inferiore; sp. cor-rea inferior.
Fußstrebe, → Strebe zwischenStänder und Schwelle im Fach-werkbau zur Dreiecksversteifung. Engl. strut, foot brace; frz. jambette, gous-set; it. piccolo contraffisso di piede; sp. pén-dola.
Fußwalm, im Gegensatz zumKrüppelwalm Abwalmung an derunteren Seite eines Giebels. InOstasien → Irimoyadach genannt(→ Dachformen). Frz. comble à demi-croupe, c. à croupe boî-teuse; sp. copete.
Fußwinkelholz → Winkelholz.
Futter, die in einer Öffnung ange-brachte innere Verkleidung, bes. alshölzerner Futterrahmen bei Türenund Fenstern. Engl. lining, sheath; frz. doublure, fourrure;it. fodera dell� imbotte; sp. forro, relleno.
Futtermauer, gemauerte Beklei-dung, z. B. einer Böschung, zumSchutz gegen das Abstürzen vonFelsmassen, im Unterschied zur→ Stützmauer gegen Erdmassen. Engl. retaining-wall, countermure; frz. con-tre-mur, mur de chemise; it. muro di rives-timento, m. di protezione; sp. muro derevestimiento.
Futterstufe → Setzstufe.
G
Gaden, 1. Fensterzone im oberenTeil des Mittelschiffs einer → *Ba-silika (→ Obergaden). 2. Einräu-miges Bauwerk zur Aufbewahrungvon Vorräten, dann auch Kaufla-den als Holzbude, auch bescheide-nes Wohnhaus, schließl. wehrhafteVorratsbauten, die auch als Zu-fluchtstätte bei Bauernhöfen die-nen. 3. Stockwerk, eigentl. Gega-deme als Reihe von Gemächern. Frz. étage clair, clairevoie; it. claristorio;sp. 1. claristorio, 2. almacén familiar 3. piso.
Gadenburg, eine als Wehrspeicherausgeformte Burg als Zuflucht fürdie Bewohner umliegender Bauern-gehöfte.
Galerie (frz.), langer, gedeckter,einseitig offener Gang. 1. Als Lauf-gang an einer Fassade, auch als Zier-form (→ Zwergg.). 2. Langge-
197 Galerie
streckter, einseitig belichteter Ver-bindungsgang in einem Schloß,auch zum Aufhängen von Bilderngenutzt, übertragen allgemein aufSammlungsräume, insbes. für Ge-mälde (Museum). 3. Emporen-oder Balkonreihe in Theatern. 4.Vorgekragter Laufgang im nord.und alpenländ. Blockbau, von denaus den Außen- und Zwischenwän-den herausstehenden Blockbalken,im Fachwerkbau von den verlän-gerten Deckenbalken getragen. DieBrüstung war urspr. verbrettertoder als Balusterreihe ausgebildet.5. Im Festungsbau ein Minengang.6. Im Städtebau glasgedeckte öf-fentl. Ladenstraßen, jedoch meistals Passage bezeichnet. 7. Seitl. of-fene überwölbte oder mit Stahlbe-tonplatte abgedeckte Überbauungvon Gebirgsstraßen zum Schutzgegen Lawinen und Steinschlag. Engl. gallery; frz. galerie; it. galleria; sp. gale-ría.
Galilaea, Vorkirche, Narthex, auchVorhof, Atrium, → *Paradies, um-mauerter, auch mit Säulengängenreicher gestalteter Vorhof vor ei-nem Kircheneingang, zumeist imW., wo sich die Ungetauften auf-halten durften, aber auch für Bü-ßer. Schon zu den frühesten röm.Basiliken gehörig und im Verlaufedes MA. seltener. Engl. galilee; frz. galilée; it., sp. galilea.
Ganerbenburg, von mehrerenFamilien (Ganerben) bewohnte,mehrgliedrige → *Burg, zumeistmit getrennter innerer Verteidi-gungsmöglichkeit und gemeinsa-mer äußerer Umwehrung. Engl. coparcenary castle.
Gang, 1. schmaler Verkehrsraumzwischen den einzelnen Räumeneines Geschosses, im Gebäude-inneren Korridor oder Flur, an derFront gelegen und manchmal seitl.offen Laubeng. genannt. 2. Städte-baul. schmaler Verbindungswegohne Fahrverkehr. Engl. 1. corridor, 2. passage; frz. 1. corridor,couloir, 2. passage; it. 1. corridoio, 2. pas-saggio pedonale; sp. corredor, pasadizo.
Ganggrab, stollenförmig in denFelsen bzw. in das Erdreich vorge-triebener → *Grabbau, der haupt-sächl. in Ägypten (Neues Reich)vorkommt. Der meist nach untenabfallende Gang kann durch Quer-ausweitungen gegliedert sein undendigt in einer Grabkammer. Engl. megalithic tomb; frz. allée couverte;sp. sepulcro megalítico.
Ganzbalken → Hauptbalken.
Ganzholz, ein Balken, der aus ei-nem vollen, unzertrennten Baum-
Galilaea 198
Galerie 2
stamm geschnitten ist, so daß derKern des Holzes in der Mitte desBalkenquerschnitts liegt. Frz. bois de brin, b. à section entière; it. Voll-holz: legname in tronco scortecciato; sp. vi-ga tronco.
Garbha-Griha (ind. Mutterleib),Inneres der Cella des ind. Tempels(Tempelbau 5), in der ein Lingamals Symbol der Zeugung stand(→ *Mandapa).
Garderobe (frz.), Kleiderkammer,Kleiderablageraum. Engl. wardrobe, study; frz. garde-robe, ves-tiaire; it. guardaroba; sp. guardarropas.
Garten, nach der Einfriedung mitGerten (Stangenzaun) benannter,künstl. bepflanzter und gepflegterBereich, der durch Wege, Stütz-mauern, Treppen, Terrassen undWasserbassins vielfältig gestaltetwerden kann. Der G. steht vor al-lem auch in der modernen Bau-kunst zur Wohnung in enger Be-ziehung, so daß der G. Ergänzungund Erweiterung der Wohnungwerden kann: Terrassen, Sitzplätze,überdeckte Lauben und → *G.-
häuser. Schon in Ägypten öffnetesich die Vorhalle des → *Wohn-hauses gegen einen G., in dessenMitte oft ein Bassin lag. Bes. ent-wickelt war die G.kunst in Meso-potamien (Hängende Gärten derSemiramis in Babylon), wo diekünstl. Bewässerung die Voraus-setzung der G.anlage war. Pracht-volle Parkanlagen umgaben auchdie Paläste der Achämeniden, de-ren Kanäle auf die ArchitekturBezug nahmen. Auch die Griechenund die Römer kannten prachtvol-le G.anlagen mit Bassins, Kolonna-den, Zierarchitektur, Plastik. DenG. des Islams liegt ebenso wie denma. G. die Vorstellung vom Para-dies zugrunde, doch herrschte imMA. der Nutzg. bzw. Arzneimit-telg. vor. Neu belebt wurde dieG.kunst in der Renaissance, derenG. meist regelmäßig um ein Zen-trum (Bassin, Gartenpalast) ange-legt war. In der Barockzeit erhältder G. (Park) gesteigerte Bedeutungund wird eng auf die Architekturdes Schlosses bezogen. Die Teileder G. sind symmetr. um eine Mit-telachse (Weg, Allee, Kanal) ange-
199 Garten
(Beispiel: Babylon, Hängende Gärten der Semiramis)
Garten
ordnet und gegen das Schloß deut-lich gesteigert (Tapis Vert, → Bos-kett, → Broderieparterre). Späterherrschte der → engl. G. vor, derähnl. dem ostasiat. G. eine lockere,natürl., maler. Gestaltung anstrebt,also den Gegensatz zum strenggeometr. Renaissance- und Ba-rockg. hervorkehrt. Dem Interessean seltenen Pflanzen entsprechenAlpeng. (Alpinum) und Botani-scher G., die durch → *Orangerienfür nicht winterharte Pflanzenergänzt werden. Seit dem 19. Jh.wechselt die Vorliebe zwischengeometr. und maler. bzw. asym-
metr. G.anlagen. Bedeutend istauch die G.kunst des islam. Kul-turbereiches, dessen mit Wasser-spielen versehene Gärten meistdurch Aquädukte versorgt sind.Eine hochentwickelte G.kunst hatJapan, dessen Gärten verkleinertenAusschnitten der Landschaft glei-chen oder symbol. der Meditationdienen (Steing.). Engl. garden; frz. jardin; it. giardino; sp. jardín.
Gartenhaus, kleines Gebäude, daszunächst zur Unterbringung vonGartengeräten gedacht war, ineinem Garten. Das G., das später
Gartenhaus 200
(Beispiel: Hannover, Herrenhausen)
(Beispiel: München, Nymphenburg)
auch als Gartensaal zum Schutzgegen die Witterung oder für einfa-che Wohnzwecke errichtet wurde,ist in der Barockzeit oft von diffe-renzierter Gestalt und bedeutenderGröße. Es kann dann als → Belve-dere, → Aussichtstempel, als Tee-pavillon oder → *Lustschloß (Fa-vorite, Mon Bijou, → *Eremitage,Fantaisie, Mon Repos, Bagatelleu. a.) am Abschluß einer Garten-anlage stehen. Sonderformen neh-men dem damaligen Zeitgeschmackentsprechend auch ostasiat. Formenan (Pagode, Chinesisches Haus).Größere Anlagen von G., die oftnoch mit Flügeln oder mit im Kreisgeschlossenen Anbauten (»Zirkel«)versehen sein können, nennt manmanchmal auch → *Orangerie(→ *Chinoiserie). Engl. summerhouse; frz. pavillon, maisonde jardin; it. padiglione; sp. pabellón.
Gartenlaube, ein aus Dach,Stütz- und Gitterwerk bestehendesGebäude zum Sitzen, es kann auchauf der dem Winde zugekehrtenSeite geschlossen sein. Engl. arbour, am. arbor; frz. berceau, ton-nelle; it. pergola; sp. glorieta.
Gartensaal, in barocken Schloß-anlagen ein ebenerdig gelegenerund durch Türen zum Garten hingeöffneter Saal.
Gartenstadt, »eine planmäßig ge-staltete Siedlung auf wohlfeilemGelände, das dauernd in einer ArtObereigentum der Gemeinschafterhalten wird, derart, daß jedeSpekulation mit dem Grund undBoden dauernd unmöglich ist. Sieist ein neuer Stadttypus, der einedurchgreifende Wohnungsreformermöglicht, für Industrie undHandwerk vorteilhafte Produk-tionsbedingungen gewährleistetund einen großen Teil seines Ge-bietes dauernd dem Garten- undAckerbau sichert.« (Howard) Dieinternationale G.-Bewegung gehtzurück auf Ebenezer Howard,Garden-Cities of to-morrow, Lon-don 1898; 1899 engl. G.-Gesell-schaft gegründet, 1903 Gelände fürLetchworth, 50 km von London,erworben für 30 000 Einwohner,1928 wohnten jedoch nur 14 000dort. In Deutschland wird 1902die »Deutsche Gartenstadt-Gesell-schaft« gegründet, die ab 1907Hellerau bei Dresden baut; 1914bestehen 30 deutsche G.- undGartenwohnstädte. Engl. garden city; frz. cité-jardin; it. cittàgiardino; sp. ciudad jardín.
Gartentheater, Heckentheater,ein Naturtheater in barocken Gar-tenanlagen, dessen Bühne meistvon kulissenartig angeordnetenHecken gebildet und mit allegori-schen Figuren geschmückt ist, aberauch aus einer romantischen Ruineoder aus einer Grotte bestehenkann. (Abb. S.202)
201 Gartentheater
Gartenhaus
Gasthaus, Gasthof, Herberge, Hos-piz, Hotel, Fremdenheim, Haus zurgewerbl. Beherbergung und Verpfle-gung von Gästen im Unterschiedzur Gaststätte, wo Gäste nur ver-pflegt werden. Das G. besteht auseinem Gastraum mit Theke, auchzusätzl. weitere Speiseräume, undzumeist im Obergeschoß Gästezim-mer, mit mehr als 20 Betten heuteals → Hotel bezeichnet. Die Zunah-me von Handel und Verkehr führ-te zur Bildung größerer G. in Städ-ten und an Landstraßen. So entstan-den Seefahrtshäuser der Hanse,Posthalterstationen seit 16. Jh.; ver-einzelte Beispiele sind seit dem15. Jh. erhalten. Die Bautypen sindim 15. /16. Jh. denen der Gilde- u.Innungshäuser ähnl. Im 17. /18. Jh.nahmen sie unter frz. Einfluß dieForm von adeligen Stadtpalais an,bis sie im 19. Jh. einen eigenständi-gen Typ ausbildeten. Der jüngsteTyp ist das Motel, ein häufig abgele-genes Hotel für Autofahrer. → *Ka-rawanserei. Engl. restaurant, inn, tavern; frz. auberge,hôtel, hôtellerie; it. osteria, trattoria, locan-da; sp. posada, hostería.
Gaststätte, Gastwirtschaft, Wirts-haus, Restaurant, Räumlichkeitenzur gewerbmäßigen Bewirtung vonGästen, zu Geselligkeit und zurUnterhaltung im Unterschied zudem auch teilweise fälschl. Gast-wirtschaft genannten → Gasthaus,das auch die Gäste beherbergt. DieG. besteht in der Grundausstattungaus einer Küche und einem Gast-raum. Erst seit dem späten MA.entwickelten sich aus dem Gast-haus wieder Tavernen oder Wein-stuben, Ausschanklokale der Brau-ereien, Ratskeller, Zunfthäuser,Schenken von Kirchen und Klö-stern, Markt-, Hof- und Gerichts-schenken. Die Bevölkerungszu-nahme und die Verkehrsentwick-lung führten im 19./20. Jh. zu einerVielfalt neuartiger Betriebe im G.-Gewerbe: Selbstbedienungsg., Au-tomatenrestaurants, Snackbars miteinem hohen Grad von Rationa-lisierung; aber auch Spezialitäteng. Engl. public house; frz. restaurant; it. risto-rante; sp. restaurante.
Gatter, kreuzweise Anordnungvon zwei Reihen unter sich paral-
Gasthaus 202
Gartentheater
leler Stäbe, die auch verziert seinkönnen, als Tor- oder Grundstücks-verschluß. Engl. grate, lattice; frz. treillis, treillage,châssis; it. recinto, steccato; sp. enrejado.
Gaube, Gaupe, Dachgaube, urspr.fränk. Dialektausdruck eines klei-nen, in Querrichtung auf demDach sitzenden Aufbaus mit senk-rechter Fensteröffnung, entwederals stehende G., bei der die Fen-steröffnung höher als breit ist, oderals liegende G., bei der die Fenster-öffnung breiter als hoch ist. G. mitrunder oder ovaler Öffnung (Och-senauge, frz. �il-de-b�uf) kom-men bes. im Barock vor. Nach derArt ihres Dachs werden unterschie-den Giebelg. mit Satteldach, Walmg.mit Walmdach und Schleppg. mitflachem Schleppdach, auch mit all-mähl. bogenförmig angehobenemSchleppdach als Fledermausg. � Zuunterscheiden von der → *Lukarne(Zwerchhaus). → *Dachfenster. Engl. dormer window; frz. lucarne; it. ab-baino; sp. buhardilla.
Gebälk, Gesamtheit der → *Balkeneiner Deckenkonstruktion (Bal-kenlage) oder einer → *Dachkon-struktion (Dachg.). In der antikenArchitektur die Gesamtheit vonBalken (Architrav, Epistylion), Fries(→ *Dorische Ordnung, → *Ioni-sche Ordnung, → *KorinthischeOrdnung, → Toskanische Ord-nung) und Kranzgesims (Geison,Konsolgesims), urspr. eine Holz-konstruktion, die aber schonfrüh mit Terrakotten ummantelt(→ *Antefixa) oder durch Stein-balken ersetzt wurde. Engl. timber framing, trabeation, entabla-ture; frz. empoutrerie, entablement, pou-trage, poutraison; it. travatura, ossatura dilegno, impalcatura, trabeazione; sp. evigado.
Gebäude, ein sich über die Erdeerhebendes und Räume umschlie-ßendes → Bauwerk. Engl. building, edifice; frz. bâtiment, édifice;it. edificio, costruzione; sp. edificio, con-strucción en altura.
Gebinde, 1. Wandgebinde, kon-struktive Einheit aus tragenden,sich gegenüberstehenden Ständernund sie verbindenden Querbalken(Binderbalken). 2. Dachgebinde,Binderbalken und Sparrenpaar ei-ner Dachkonstruktion; beim Voll-
203 Gebinde
Gebundenes System
a Vierung
gebinde bzw. Dachbinder wird daszugehörige Sparrenpaar als Binder-gespärre, beim Leer- bzw. Freige-binde als Leer-, Füll- oder Zwi-schengespärre bezeichnet. Engl. 2. truss, poop; frz. 2. (Schieferdach)rangée d�ardoises; it. 2. coppia di puntoni,capriata; sp. madeja, atado, anclaje.
Gebück, dicht verwachsene Sträu-cher und Hecken als Annähe-rungshindernis.
Gebundenes System, ein qua-drat., auf das Vierungsquadrat zu-rückgehender Schematismus, derdem gesamten Grundriß einer ge-wölbten roman. Basilika zugrundeliegt: einem quadratischen Mit-telschiffjoch entsprechen in denbeiden Seitenschiffen je zwei qua-dratische Joche von halber Seiten-länge. Diese Ausbildung ist durchdie → *Gewölbeform bedingt: alleGurt- und Schildbogen könnenhalbkreisförmig ausgebildet wer-den. (Abb. S.203)Engl. ad quadratum; frz. plan basilical,système lié (roman); it. impianto a moduloquadrato; sp. sistema entramado.
Geburtshaus, Mammisi, vorägypt. Tempeln der Spätzeit (Den-dera, Edfu) am Eingang des Tem-pelbezirks errichtetes Gebäude, indem das göttl. Kind der Liebesgöt-tin Hathor geboren wurde. Das G.besteht meist aus mehreren Räu-men und einer Vorhalle mit seitl.Treppen. Hier waren Darstellun-gen des Gottes Bes zu finden. Dieübrigen Seiten waren von Säulengerahmt, zwischen die Schrankenmit Reliefdarstellungen (Vereh-rung der Hathor und des Götter-kindes durch Pharaonen) in halberHöhe der Stützen eingefügt waren. Engl. birthplace; frz. maison natale; it. luogodi nasca; sp. casa natal.
Gefach, im Fachwerkbau das vonHölzern (Ständer, Stiel, Riegel)umschlossene Feld der Außen-wand, das durch Ausfachung, Fen-ster oder Tür geschlossen wird. Engl. compartment; frz. pan; it. scomparti-mento; sp. compartimento del entramado.
Gefängnis, ein verschließbarerRaum im Rathaus oder → Ge-richtsgebäude, seit dem 19. Jh.
Gebück 204
Geburtshaus
eigene, z.T. mehrflügelige Anlagenmit abschließender Mauer.
Gefangener Raum, ein nur durcheinen anderen Raum, also nichtvom Flur zugängl. Raum. Engl. dead space; sp. cuarto sin salida direc-ta.
Gefüge, 1. hauskundl. für kultur-geschichtl. Analyse eines Gebäu-des. 2. Technisch für die konstruk-tive Gesamtheit eines Hauses. 3.Konstruktiv für Einzelheiten derHolzkonstruktion (auch Gefüge-knoten). Engl. structure; frz. appareil, grainure, tex-ture; it. commettitura; sp. 3. estructura damadera.
Gefußt → gestelzt.
Gehöft, Gruppierung von verschie-denen Baukörpern, hauptsächl. beilandwirtschaftl. Gebäuden, die nachihren Funktionen � Wohnhaus,Stall, Scheune � differenziert undmeist U-förmig um einen Hofgruppiert sind. Die wichtigstenG.formen des → Bauernhauses sinddas mitteldt. und das fränk. G., diejedoch in verschiedenen Variantenvorkommen, wobei Wohnteil undStall manchmal auch in einem
Baukörper liegen können. An derStraßenfront ist meist ein kleineresTor für die Bewohner neben einergrößeren Wageneinfahrt angeord-net. Eine Sonderform des G. ist der→ *Vierkanthof (hauptsächl. inÖsterreich). Engl. farm, farmstead; frz. métairie, ferme;it. fattoria, masseria, podere; sp. granja.
Gehrung, Verbindung von zwei Balken, Bohlen oder Brettern(Rahmen), die (meist unter 45°)schräg aneinanderstoßen, so daßdie Gehrlinie durch die Winkel-halbierende gebildet wird. Je nachder Profilierung des Rahmensspricht man von einer Gratg. bzw.Winkelg. Engl. mitre, am. miter; frz. onglet, biais,biaisement; it. quartabuono; sp. esviaje,inglete.
Geisipodes, gr. für → Zahnschnitt.
205 Geisipodes
Mitteldeutsches Gehöfta Wohnung b Stall c Scheune d Schuppen e Altenteil
Gehrunga Winkelgehrung b Gratgehrung
Geison (gr.), Corona, eigentl.Schutzdach, Wetterdach, Saum, bes.das Kranzgesims (corona) des Ge-bälks antiker Tempel entlang derTraufe; das die Giebelschräge (Ort-gang) begleitende G. wird Schrägg.oder Ortganggesims genannt. DasG. kragt über das Triglyphon amdor. Tempel und über den Friesoder den Zahnschnitt (Geisipodes)des ion. Tempels vor, ist meist pro-filiert und bildet mit der Sima denoberen Abschluß des Gebälks. Dasdor. G. zeigt an der Unterseite inregelmäßigen Abständen Hänge-plättchen (→ Mutuli), die mit Trop-fen (→ Guttae) besetzt sind. Dasion. G. ist ein konkav unterschnitt-tenes Gesims mit einer flachenWassernase, im übrigen glatt be-lassen, → *Dorische Ordnung. Engl. frz., it., sp. geison.
Gekuppelt, unmittelbar neben-einanderliegende und einander be-tont zugeordnete Bauelemente(Säulen, Träger, Fenster, Portaleoder dergl.). Um eine engere Ver-bindung herzustellen, wird beim g.Fenster (Zwillingsfenster, Doppel-arkade) oder Portal meist der ver-bindende Mittelpfosten leichter
ausgebildet als die normale Ge-wänderahmung (→ *Fensterfor-men, → *Drolerie, → *Kolonnade).Engl. coupled; frz. couplé, groupé, accou-plé; it. gemino, accoppiato, binato; sp. acop-lado, emparejado.
Geländer, Abschluß in Brü-stungshöhe (→ Brüstung) aus Stein,Holz oder Metall an → *Treppen,Terrassen, Balkonen, Altanen u.dergl., urspr. ein Stangen- oderLattenzaun. Das G. kann massivsein, ist aber gewöhnl. durchbro-chen und in einzelne Pfosten, Stä-be, Baluster (→ *Balustrade) unter-teilt, die oben von einem G.holm(→ Handlauf) abgeschlossen wer-den. Bei längeren G. werden diedünnen Stäbe oft in bestimmtenAbständen durch einen Haupt-pfosten verstärkt. Engl. railing; frz. garde-corps, balustrade;it. parapetto, ringhiera; sp. barandilla.
Gelaß, ein in Kellern oder aufDachböden durch eine leichteWand abgesonderter Raum zurAufbewahrung von Holz, Kohlenusw., dann jeder kleine Raum. It. carbonaia, legnaia; sp. leñera , carbonera,espacio pequeño.
Gelenk, 1. Verbindungselementzwischen zwei verschieden gerich-teten Bau- oder Raumteilen. 2.
Geison 206
Gekuppelte Fenster mit gekuppeltenSäulen (Ansicht und Schnitt)
Geländera Hauptpfosten b Handlauf (Holm)
Frei bewegl. Verbindung verschie-dener Konstruktionsteile (zum Un-terschied vom starren → *Knoten). Engl. hinge, link; frz. charnière, articula-tion; it. cerniera; sp. articulación.
Gelenkbogen, ein bogenförmiggekrümmtes Tragwerk mit jeeinem Gelenk an den beidenKämpferpunkten. Der G. ist daseinfachste, statisch unbestimmtgelagerte Fachwerksystem. EinTragwerk mit je einem Gelenk anden beiden Kämpferpunkten undeinem dritten am Scheitel heißtDreig., er ist statisch bestimmt, beiBrücken und großen Hallen ver-wendet. Engl. hinged arch; frz. (poutre en) arc arti-culé; it. arco a cerniere; sp. arco articulado.
Gelenkrahmen, ein → Rahmenmit eingespannten Auflagern, derdurch den Einbau eines beliebigangeordneten Gelenkes für jedeseingespannte Auflager wieder stat.bestimmbar wird. Engl. hinged frame; frz. cadre articulé; it. te-laio incernierato; sp. marco articulado.
Gemach, eigentl. bequem, ruhig,dann jeder abgesonderte Raum,bes. ein kleinerer Wohnraum. Engl. room, chamber; frz. chambre, salle(d�un palais); it. stanza, camera; sp. apo-sento.
Gemeindehaus, 1. Gebäude, indem eine Dorfgemeinde ihre Ver-sammlungen abhält, darin ein gro-ßer Saal, ein Sitzungszimmer fürden Gemeinderat, einige Schreib-zimmer und ein Archiv, vergleich-bar mit einem → *Rathaus, auchmit Gefängnis und Armenwoh-nungen. 2. Eine Verbindung mitder Kirche erstmals 1875/76 inStraßburg von E. Salomon gebau-tes Gebäude mit Saal, Sakristei,Sitzungszimmern für Aufgabender religiösen Gemeinde. Engl. 1. community center, 2. parish hall;frz. 1. maison communale, 2. maison pa-roissiale; it. 1. casa comunale, 2. casa par-rocchiale; sp. casa de la comuna.
Gerader Stoß, dient zur waage-rechten und senkrechten Verlän-gerung von Hölzern in einfachsterWeise. Der Endquerschnitt verläuftsenkrecht zur Längsachse. GegenVerschieben sind g. S. durch Klam-mern u.ä. zu sichern. Engl. butt joint; frz. joint droit; it. giunturasemplice diretta; sp. unión de tope.
Gerichtsgebäude, Gebäude, indem Gericht gesprochen wird. ImAltertum wurde anfängl. unterfreiem Himmel Gericht gehalten,später wurden die gedeckten, fürden Handel errichteten Hallen(Basiliken) als Gerichtsstätten be-nutzt: in der an den längsrechtecki-gen Raum anschließenden Konche,einer im Fußboden erhöhten, halb-kreisförmigen Nische, befindet sichdas Tribunal, der Platz für denRichter und seine Beisitzer. Erst imZusammenhang mit dem wirt-schaftl. Aufschwung und der polit.Bedeutung der Städte entstandenfür die Pflege der GerichtsbarkeitRäume in den Rathäusern, → Ge-
207 Gerichtsgebäude
1 Gelenk zwischen Baukörpern
2 Fußgelenk eines Rahmens
fängnis, dazu auch Gerichtstürme.Die Gerichtshallen waren häufigals offene Lauben gebaut; bei feh-lendem Rathaus auch als offenerHolzanbau an Kirchen (→ Gerichts-laube). Der Gerichtsraum war imSpät-MA. mit reichem Gestühl fürdie Vorsitzenden und Schöffenausgestattet, verzierte Schrankengrenzten den Raum für das Pu-blikum ab. Mit fortschreitenderRechtspflege stellte sich im 19. Jh.das Bedürfnis nach eigenen, denGerichtsverfahren angepaßten Ge-richtsgebäuden heraus. Engl. courthouse; frz. hôtel de justice, tri-bunal; it. palazzo di giustizia, tribunale;sp. tribunales de justicia.
Gerichtslaube, im MA. zumeisthölzerne Anbauten an der Kirche(wenn kein Rathaus vorhandenwar) oder am Rathaus, auch Be-zeichnung für den Sitzungssaal imRathaus (z. B. G. im LüneburgerRathaus 15. /16. Jh.) (→ Gerichts-gebäude). Sp. edificación junto a la iglesia, e. j. al ayun-tamiento.
Gerippebau → Skelettbau.
Gerkammer, ältere dt. Bezeich-nung für → Sakristei.
Gerüst, 1. hölzerne Vorrichtung(heute aus Metall), auf der dieBauleute bei der Arbeit stehen; dieeinzelnen Arbeitsböden werdenüber Leitern oder Laufschrägenerreicht. a) Standg. oder Stangeng.aus senkrecht oder wenig schräggestellten Rüststangen oder Rüst-bäumen, an denen in etwa 1,50 mAbstand waagerecht, parallel zurMauer die Streichstangen oderBarren gebunden sind, auf denen
die Netzriegel liegen, die die Lauf-bohlen aufnehmen; bei nur einerReihe von Rüstbäumen liegen dieNetzriegel in viereckigen Mauer-löchern (Rüstlöchern, → Gerüst-löchern). b) Beim Bockg. liegendie Bohlen auf Holzböcken auf. c)Auslegerg. oder fliegendes G., Aus-leger werden in geeigneten Ab-ständen quer auf die Mauer gelegt,außen und innen etwa gleich über-stehend und mit Bügen abgestrebt,oder durch einige Mauerschichtenbelastet; auf den Auslegern liegendie Bohlen; beim Abrüsten werdendie Ausleger abgesägt oder ent-fernt, es verbleiben die Gerüst-löcher. d) Hängeböden an Seil-schlaufen werden nur selten und zuReparaturen verwendet. 2. Gesamt-heit der konstruktiven Hölzer beieinem Holzgebäude. Engl. 1. scaffold, 2. framework; frz. 1. écha-faudage, échafaud; it. 1. impalcatura, pon-teggio, 2. ossatura di legno; sp. andamio.
Gerüstbretter, mindestens 3,5 cmdicke Laufbohlen, die bei → Gerü-sten die waagerechte begehbare La-ge bilden; sie liegen auf denAuslegern, Netzriegeln oder Bök-ken auf. Engl. scaffold boards; frz. planche d�écha-faudage; it. tavole da ponte, palanche; sp. ta-blas de andamiaje.
Gerüstlöcher, ½ Stein tiefe Aus-sparrung im Mauerwerk als Auf-lage für die Netzriegel des → Ge-rüsts. Engl. putlog holes; sp. hueco para anclar elandamio.
Geschlechterturm, Wohnturmdes Adels in einer Stadt. Der Ein-gang lag oft wie beim Bergfriedhoch, als Abschluß findet man
Gerichtslaube 208
häufig → *Zinnen. G. kommenhauptsächl. in Italien vor und sindim dt. MA. selten. Eine dem G.ähnl. Zwischenform von Palas undBergfried kommt auch bei der→ *Burg vor, in Frankreich meist→ *Donjon genannt. Engl. family tower, tower house; it. torregentilizia; sp. torre habitada por la noblezaen ciudades italianas.
Geschoß, ein durch Decken be-grenzter Ausschnitt eines Gebäu-des. Bei der Zählung der G. wirddas Erdgeschoß (Parterre) mitge-rechnet, nicht dagegen das Kel-lerg. (Unterg.) und das Dachg. ImSprachgebrauch wird auch derurspr. aus dem Holzbau stammen-de Begriff des Stockwerks (»Stock«)analog verwendet,wobei aber dieZählung der Stockwerke erst mitdem G. über dem Erdg. (1. Oberg.= 1. Stock) beginnt. Ein niedrigesZwischeng. heißt Entresol oder
Mezzanin, das Hauptg. eines grö-ßeren Gebäudes Beletage oder Pia-no nobile. Die G.teilung wird auchan der Fassade sichtbar (→ *Ge-sims). Oft wird das Erdg. durchseine Gestaltung (z.B. Rustika) zumSockelg., bes. bei der Kolossalord-nung. Attikag. heißt ein über demHauptgesims liegendes, niedrige-res Oberg. bes. an barocken Schlös-sern und mehrgeschossigen städt.Häusern. Engl. story, stage; frz. étage; it. piano; sp. piso.
Geschoßbau, 1. im Massivbau imUnterschied zum Flachbau einmehrgeschossiger Bau, der ab zehnGeschosse als Hochhaus bezeich-net wird. 2. Im Fachwerkbau imUnterschied zum → Stockwerk-bau ein mehretagiges Gebäude, des-sen Ständerkonstruktion von derSchwelle bis zur Traufe durchgehtund in das die einzelnen Etageneingehängt bzw. eingespannt sind. Engl. multi-storey building, am. multistory;frz. bâtiment à étages, bâtiment à niveaux;sp. edificio en altura, construcción en a.
209 Geschoßbau
Geschlechterturm
Geschoß
1 Unterg. (Keller)2 Erdg. (Sockelg.)3 1. Oberg., (Halbg.)4 2. Oberg., (Hauptg.)5 3. Oberg., Dachg.
(Mansarde bzw. Attikag.)
Geschoßhöhe, das Maß von derFußbodenoberkante eines → *Ge-schosses bis zur Fußbodenober-kante des nächsten. Engl. storey height; frz. hauteur d�étage;it. interpiano; sp. altura de piso.
Geschützturm, zumeist rundeTürme mit dicken Mauern zurAufstellung von Geschützen seitdem 15. Jh., mit großen Schieß-scharten und gewölbten Kanonen-ständen (→ *Bastion). Engl. gun turret; frz. tourelle; it. torretta;sp. atalaya, torre de acecho.
Gesims, Sims, ein meist horizon-tales Bauelement, das eine Au-ßenwand in einzelne Abschnittegliedert. Die Grundform der G.sind vorspringende Platten mitwaagerechter Begrenzung, die aberauch schräge Abdeckflächen haben(Schrägg.) oder manchmal unter-schnitten sind (Kaffg., Wasser-schlag). G. können an ihrer Unter-seite durch wulstartige Zierformen
(→ *Kyma, → *Astragal) ge-schmückt oder durch Konsolen(→ Konsolgesims) unterstützt sein.Je nach Lage unterscheidet manSockel- oder Fußg. an einem Un-terbau, Gurt- bzw. Stockwerksg.(Kordong.), Fensterbankg. und dasabschließende Dachg. (Hauptg.,Schlußg.). Eine Sonderform desDachg. ist das beim Tempel- undPalastbau vorkommende, starkausladende Kranzg., das konstruk-tiv noch zur Außenwand gehörtund meist als Konsolg. ausgebildetist (→ *G.formen). Das Giebelg.läuft schräg entlang der Giebel-linie. Als Kehlg. bezeichnet mandas unterhalb einer Deckenkehle(Voute) verlaufende G., aber auchdie gesimsartige Ausbildung desDachbruchs eines Mansarddachs.Bei Verschalung vorstehenderBalkenköpfe entsteht das Balken-gesims. Engl. cornice, moulding, am. molding;frz. corniche, moulure; it. cornice, moda-natura; sp. moldura, cornisa.
Geschoßhöhe 210
Gesims
1 Fußg., Sockelg. 2 Gurtg., Stockwerkg., Kordong.3 Fensterbankg., Sohlbankg. 4 Kranzg. 5 Giebelg.
Gesimsformen, die Hauptgesimse(Dachgesims), seltener die Gurt-gesimse, sind bei größeren und dif-ferenzierteren Baukörpern oft weit-ausladend und meist durch zu-sätzl. Schmuckelemente (→ *Kyma,→ Band 1, Rund- und Birnstäbe)belebt. Unter der Abdeckplattekönnen Hohlkehlen, → *Friese,Konsolen und Reliefstreifen ange-ordnet sein (Unterglieder).
Gespärre, Sparrenwerk, Gesamt-heit der Sparren einer → *Dach-konstruktion (→ *Werksatz). Engl. rafters; frz. chevronnée, charpente deschevrons; it. ossatura inclinata del tetto;sp. encabriado de cubierta.
Gesprenge, feingliedriger holzge-schnitzter Aufbau aus Baldachinen,Fialen und Laubwerk über demRetabel eines → *Flügelaltars. DasG. ist charakterist. für spätgot.Altarschreine und übertrifft in vie-len Fällen den Altarschrein anHöhe. Oft sind auch Skulpturenim G. zu finden. Engl. crest; it. coronamento dell�ancona;sp. cimera (crista, crestón, quimera).
Gesprengte Decke, hölzerneDecke, deren Mitte einen Pfeiloder Stich hat, also »gewölbt« ist. Engl. broken ceiling; frz. interrompu; sp. cie-lorraso quebrado.
Gesprengter Giebel → Spreng-giebel. Engl. broken gable; it. frontone ad arcospezzato; sp. frontón quebrado.
Gestelzt, gefußt, ist ein Bogenoder Gewölbe, dessen Krümmungerst oberhalb einer über demKämpfergesims beginnenden Verti-kalen aufsteigt (→ *Bogenformen). Engl. stilted; frz. exhaussé, surélevé; it. a sestorialzato, sopralzato; sp. bóveda sobre elevada.
Getäfel → Täfelwerk.
Gewächshaus, Glashaus, dasPflanzen vor den Einflüssen derWitterung zu schützen hat. DerFußboden des G. liegt meist unterdem Gelände. Das G. wird vonGlasfenstern abgedeckt. Eine Son-derform des G. ist die → *Oran-gerie, die in den Schloßgärten derBarockzeit zur Überwinterung vonPflanzen diente. Engl. greenhouse; frz. serre; it. serra; sp. in-vernadero.
Gewände, die schräg geführteMauerfläche (Laibung) seitl. einesFensters (→ *Fensterschräge) oderPortals. Das G. kann profiliertsein (Stab, Hohlkehle), manchmalstehen in den Abtreppungen desG. auch Säulen oder Skulpturen(→ Stufenportal). Engl. jamb; frz. jambage, jambe, jambette;it. stipite; sp. jamba.
211 Gewände
Gesimsformen1 Dachgesims 2, 3 gotisches Kaffgesims mit Wasserschlag
4 Kranzgesims (röm. Konsolgesims)
Gewandhaus, Tuchhalle, seit demMA. in den Hauptorten der Tuch-weberei errichtetes und oft reichausgestaltetes Zunfthaus der Tuch-macher mit Stapel-, Verkaufs- undGesellschaftsräumen, bes. in denflandr. Städten, aber auch in Braun-schweig, Leipzig u.a. Engl. drapers� guild, cloth hall; frz. hallesaux draps; it. emporio di stoffe; sp. sala delgremio de los fabricantes de tela.
Gewölbe, krummflächiger obererAbschluß eines Raumes. Konstruk-tion: Das G. besteht in der Regelaus Steinen, die sich zwischenWiderlagern verspannen (echtesG.). In frühester Zeit wurde das G.allerdings durch Vorkragen einzel-ner horizontaler Steinschichtengebildet (→ *unechtes G.). Auchkönnen die Schichten eines Ge-wölbes schräg an eine Stirnmauerangelehnt sein. Meist wird das G.über einem später wieder entfern-ten Lehrgerüst aus Holz aufgebaut,falls es nicht direkt auf einerSchalung gegossen wird (Gußg.).Die Fugen zwischen den Steinensind auf den G.mittelpunkt gerich-tet. Die Bezeichnungen der einzel-
nen Teile des G. sind ähnlich wiebeim Bogen (→ *Bogen I). Der er-ste Stein des G. heißt G.anfänger,der oberste Schlußstein, seineHöhe über dem Kämpfer ist diePfeil- oder Stichhöhe. Die Unter-sicht des G. heißt G.fläche (G.lai-bung). Die Dicke der G.schalenennt man G.dicke, die obere Seiteeines G. ist der G.rücken. Ist dasBogenfeld eines G. offen, so ent-steht ein offenes G., dessen vorde-re Ansichtsfläche der Stirnbogen ist.Ist das Bogenfeld mit einer Mauer(Stirn-, Schildmauer) verschlos-sen, so entsteht das geschlosseneG. Schneiden in ein G. andereWölbungen ein, deren Scheitelquer zum Scheitel des Hauptg.verlaufen (Stichkappen), so ist dieFläche des Hauptg. von der Stich-kappe durch den G.kranz (Kap-penkranz) getrennt. Die Kanten,die durch die Überschneidung ver-schiedener G.flächen an der Lai-bung entstehen, nennt man Grate.Das G. übt an den Widerlagerneinen Schub aus, der im Inneren
Gewandhaus 212
Gewölbe1 Offenes Gewölbe mit stehen-
den Scharen2 Gußgewölbe mit Gerüst3 Geschlossenes Gewölbe mit lie-
genden Scharen4 Gewölbe mit Stichkappe
a Stirnbogen b Aufkeilung c Schildmauerd Schlußstein e Gewölbe-
anfänger f Widerlager
g Gewölbekranzh Kämpferliniei Gratj Gewölbe-
laibungk Gewölbe-
rücken
durch → *Anker aufgenommenwerden kann. Der schräg nach un-ten gerichtete G.druck auf dieG.widerlager ist die Resultierendeaus Auflagerdruck und G.schubund wird durch Strebemauernoder Strebepfeiler aufgenommen(→ *Bogen, → *Strebewerk). ZurVerringerung des G.gewichtes wur-den manchmal Hohlkörper aus Ton(Töpfe) eingegossen oder Kasset-ten ausgespart. Als Teilg. bezeichnetman die eingeschnittenen Zwickeleines G. (Stichkappen), hauptsächl.aber die zum G. überleitenden Ele-mente (→ Pendentif, → *Trompe). Engl. vault; frz. voûte; it. volta; sp. bóveda.
Gewölbeachse, ist die gedachteLinie unterhalb des Scheitels inKämpferhöhe. Engl. vault axis; frz. axe d�une voûte; it. assedella volta; sp. eje de una bóveda.
Gewölbeanfänger, Anwölber,Anfangstein, der erste zur Krüm-mung überleitende Stein über demKämpfer eines → *Gewölbes. Engl. vault springer; frz. voussoir de départd�une voûte; it. cuneo d�imposta della volta;sp. dovela de arranque de una bóveda, im-poste d. a. d. u. b.
Gewölbeanker → *Anker.
Gewölbefeld, → *Joch, Travée,Grundfläche eines Gewölbeab-schnitts, der durch Stützen, Gurt-
und Scheidbogen als vollständigesEinzelelement eines größeren Ge-wölbesystems ausgeschieden ist. Engl. bay; it. campata di volta; sp. vano, en-trepaño, recuadro, crugía, intercolumniode una bóveda
Gewölbeformen. Die einfachstenG. sind die Tonnengewölbe mithalbkreisförmigem Querschnitt(Rundtonne), die Halbtonne mitViertelkreisquerschnitt (Einhüfti-ges Gewölbe, Horng.), die Flach-tonne mit segmentbogenförmigemQuerschnitt, die Parabeltonne mitparabol. Querschnitt und die Spitz-tonne mit Spitzbogenquerschnitt.Die dem Kämpfer zugeordnetenTeile der Gewölbeschale heißenbeim Tonnengewölbe Wangen, dieder Öffnung nächsten Kappen.Steigende Tonnen sind Tonnenge-wölbe mit steigendem Scheitel.Eine Ringtonne hat eine im Grund-riß kreisförmig verlaufende Schei-tellinie. Eine steigende Ringtonnewird als Spiral-, Spindel- oderSchneckengewölbe bezeichnet (z.B.Unterbau von Wendeltreppen).Tonnengewölbe können oben undunten durch Gurtbogen verstärktsein (Obergurt, Untergurt). DerScheitel einer Längstonne läuftparallel zur Längsachse des Raums,der einer Quertonne im rechtenWinkel dazu. Längs- und Querton-nen können auch beim selben Bau-werk vorkommen. Beim Verschnittzweier gleich hoher Tonnengewölbeentsteht das Kreuzgewölbe (Kreuz-kappengewölbe), das man sich auchaus der Verbindung von vier Kap-pen (Kreuzkappen, → Gewölbe-kappen) entstanden denken kann.Die Gewölbeflächen eines Kreuz-gewölbes (Kreuzgratgewölbe) ver-schneiden sich in Graten (Kreuzbo-
213 Gewölbeformen
Gewölbefeld1 Pfeiler 2 Gurtbogen3 Scheidbogen (bei Hallenkirche, sonst
Schildbogen)
Gewölbeformen 214
1 Ringtonne 2 Halbtonne
(Horngewölbe) 3 Flachtonne4 Parabeltonne5 Spitztonne6 Steigende Tonne7 Ringtonne8 Schneckengewölbe9 Längstonne mit
Quertonnen10 Kappen und Wangen
11 Kreuzgewölbe (Kreuzkappengewölbe)
12 Busung13 Dreistrahlgewölbe14 Klostergewölbe15 Muldengewölbe16 Spiegelgewölbe17 Kegelgewölbe18 Fächergewölbe19 Netzgewölbe20 Sterngewölbe21 Zellengewölbe22 Stalaktitengewölbe
Gewölbeformen
gen, Diagonalbogen), deren Grund-rißprojektion Diagonalen des Ge-wölbefelds sind. Der Gurtbogentrennt die Gewölbefelder desselbenSchiffs, während der Scheidbogenquer zum Gurtbogen verläuft unddie nebeneinanderliegenden Ge-wölbefelder zwischen den einzel-nen Schiffen abtrennt. Ist der Schei-telpunkt eines Kreuzgewölbes hö-her als die Scheitel der Gurt- undWandbogen (Schildbogen), so ent-steht eine Busung, die auch beianderen G. vorkommen kann. Sindverschieden lange Seiten einesRechtecks zu überwölben, so kannder Halbkreisbogen über der kürze-ren Seite auch gestelzt werden(Stelzbogen), um die Scheitelhöhedes Halbkreisbogens über der län-geren Seite zu erreichen. Drei Kap-pen über dreieckigem Grundriß er-geben ein Dreistrahlgewölbe. DasKlostergewölbe ist dagegen aus-schließl. aus Wangen zusammenge-setzt, die auf den Umfassungsmau-
ern polygonaler Bauten aufruhen.Im Gegensatz zu der formal ver-wandten → *Kuppel sind die Wan-gen des Klostergewölbes durch Gra-te voneinander getrennt. Das Mul-dengewölbe kann man sich auseinem Tonnengewölbe entstandenvorstellen, dessen Schmalseitendurch Wangen geschlossen sind.Muldengewölbe mit einer ebenenFläche anstelle des Scheitels heißenSpiegelgewölbe. Ein Kegelgewölbeentwickelt sich über einem kreis-runden Grundriß bei dreieckigemQuerschnitt. Gewölbe, bei denenim Verlauf der Grate tragende→ *Rippen angeordnet sind, heißenRippengewölbe. Anstelle des Kreuz-gratgewölbes entsteht so das Kreuz-rippengewölbe, bei dem die Rippendie Gewölbeschale tragen. Ist einKreuzrippengewölbe in der Quer-richtung durch ein vom Kämpferzum Schlußstein gehendes Rippen-paar unterteilt, so entsteht ein sechs-teiliges Gewölbe. Besitzt die Längs-
215 Gewölbeformen
achse auch eine Scheitelrippe, sospricht man vom achtteiligen Ge-wölbe. Eine Sonderform des acht-teiligen Gewölbes mit starker Bu-sung ist das Domikalgewölbe, dasjedoch meist kuppelförmig ausge-bildet ist (auch Rippenkuppel). EinSegelgewölbe (Schirmgewölbe) isteine Rippenkuppel (→ Kuppel) mitsegelartig geblähten Kappen zwi-schen den Rippen. Beim Fächer-gewölbe (Strahlengewölbe, Palmen-gewölbe) strahlen zahlreiche Rippenvon der Stütze bzw. vom Scheitelaus. Das Sterngewölbe setzt sich ausDreistrahlgewölben oder Rautenzusammen, die zentral um einenSchlußstein gruppiert sind. Seltenerist eine Stütze der Mittelpunkt dessternförmigen Gewölbegefüges. EinNetzgewölbe besteht aus mehre-ren parallel verlaufenden Rippen,teilweise aus Rippengabeln, so daßQuadrate, Rechtecke oder Rautenentstehen (Rautengewölbe), dieaneinandergereiht sind. Ist dieReihung auch in der Grundrißpro-jektion kurviert, so entsteht die→ *gewundene Reihung (Kur-vatur). Die reichen Figurationenspäter Rippengewölbe haben imallgemeinen keine tragende Funk-tion mehr, sondern sind rein deko-rativ der Gewölbeschale unterlegt(Stuckrippen). Zweischichtige Ge-wölbe haben unter der figuriertenGewölbeschale noch eine von die-ser losgelöste, nichttragende Rip-penfiguration. Sind die Gewölbe-flächen beim Netz- bzw. Sternge-wölbe prismat. vertieft und dieGrate (ohne hervortretende Rip-pen) scharfkantig gebildet, so ent-steht ein Zellengewölbe. Eine Son-derform ist das Tropfsteingebildennachgebildete Stalaktitengewölbeder islam. Baukunst.
Gewölbehöhe, Stich, Pfeil, Höheeines Gewölbes, gemessen als senk-rechter Abstand zwischen Kämp-ferebene und Schlußstein. Engl. vault rise; frz. hauteur de voûte; it. frec-cia della volta; sp. altura de una bóveda.
Gewölbekappe, eines der vierTeilstücke des Kreuzgewölbes, dasaus gleich hohen, rechtwinkeligüberkreuzten Tonnen (→ *Gewöl-beformen) entsteht. SenkrechteEinschnitte in ein Tonnengewölbenennt man Stichkappen. Aus ein-zelnen Kappen können auch ganzeGewölbe gebildet werden, so nenntman aneinandergereihte Tonnen-segmente → Preußische Kappen.Der → *Böhmischen Kappe liegtein Kugelausschnitt zugrunde. Engl. sectroid; frz. chape, lunette, canton devoûte; it. unghia; sp. corona de una bóveda.
Gewölberippe → *Rippe.
Gewölbeschale, die massive Kon-struktion einer Wölbung. Engl. vaulting, pendentive; sp. construcciónmasiva de una bóveda.
Gewölbezwickel, überleitendeElemente,die zwischen dem qua-drat. Grundriß des Unterbaus unddem Fußkreis einer → *Kuppel,eines Domikalgewölbes oder demPolygon eines Klostergewölbes ver-mitteln (→ *Trompen, → Penden-tifs). Engl. spandrel; frz. reins de voûte, penden-tif; it. pennacchio; sp. pechina.
Gewundene Reihung, Kurvatur,im Grundriß kurvenförmige Aus-
Gewölbehöhe 216
Gewölbekappe(Preußische Kappe)
bildung von Gewölberippen. Inder spätgot. Baukunst vor allem inBöhmen, Mähren und Österreichvorkommend.Frz. courbe, courbure.
Gezogene Stufe, eine nach be-stimmter Gesetzmäßigkeit verzo-gene Stufe, die den allmähl. Über-gang vom geraden zum gebogenenTreppenlauf herstellt (→ *Treppe). Engl. drawn step; frz. marche balancée, m.gironnée, m. dansante; sp. peldaño balance-ado.
Ghat (ind.), Uferterrasse mit Frei-treppen an ind. Flüssen.
Ghetto, Straße oder Viertel alsStadtteil, der den Juden zugewie-sen wurde, bis sie den Bürgerngleichgestellt waren. Der Name G.taucht 1526 erstmals in Venedigauf, wo die Juden in dem nebeneiner Kanonengießerei gelegenenGeto nuovo lebten. In Deutsch-land entstanden Judenviertel, dieauch durch Mauern und Toreabgeschlossen waren, erst seit demEnde des 13. Jhs. Engl., frz., it., sp. ghetto.
Giebel, Abschluß eines Satteldachs,auch Bekrönung eines Fensters(Fensterverdachung, Fensterg.), ei-ner → *Ädikula oder eines anderenBauteils. Der G. kann dreieckig,
segmentbogenförmig, abgetreppt(Treppeng., Staffelg., Stufengiebel)oder der Dachform entsprechendin mehreren Winkeln gebrochen
217 Giebel
Gewundene Reihung
Gesprengter und verkröpfter Giebel
Maßwerkgiebel(Beispiel: Prenzlau, Marienkirche, 14. Jh.)
Geschweifter Knickgiebel
Giebel
(Knickg.) oder kurvenförmig aus-gebildet sein. In der Antike trägt dasG.feld (→ *Tympanon) bauplast.Schmuck und wird von → *Akro-terien bekrönt. In der Gotik wirdder G. durch Maßwerk oder Blen-den gegliedert und von Wasser-speiern oder Fialen gerahmt. Seitder Renaissance werden G. mit Vo-luten geschmückt (→ *Voluteng.).Die Mitte eines G. ist (bes. in derBarockzeit) manchmal nicht ge-schlossen (»gesprengter« G., Seg-mentg.). Der G. über dem Mittel-risalit eines Gebäudes heißt Frontg.oder → *Frontispiz. Als Blendg.oder Zierg. werden auch G. be-zeichnet, denen kein Dachquer-schnitt entspricht. Engl. gable; frz. pignon, fronton, faîte;it. frontone, cimasa; sp. frontón.
Giebelähre, eiserne Turmendi-gung in Ährenform (→ *Ähre). Frz. épi de pignon; it. spiga del frontone;sp. espigón de un frontón.
Giebelbalken, Ortbalken, ein→ *Balken, der entlang der Giebel-mauer verläuft. Engl. rooftree, top beam; frz. poutre depignon; sp. cumbrera, viga superior.
Giebelblume, Firstblume, pflanzl.Ornament, das den oberen Ab-schluß got. Fialen, Wimperge undTurmpyramiden bildet (→ *Kreuz-blume). Frz. crosse, fleuron; it. fiore del frontone;sp. florón.
Giebelbogen, ein »Bogen«, der auszwei schräg aneinander gelegtenSteinen besteht. Obwohl er vonzwei Geraden gebildet wird, erfüllter konstruktiv die Voraussetzungeneines echten Bogens. Engl. triangular arch; frz. arc en mitre;sp. arco en mitra.
Giebeldach, ein Satteldach, dasmit Giebeln abschließt (→ *Dach-formen), bes. dann so bezeichnet,wenn die Haupt- oder Straßen-
Giebelähre 218
Treppengiebel(Beispiel: Münster, Rathaus, 14. Jh.)
Giebelbogen
front den Giebel zeigt (im Unter-schied zum Traufendach). Engl. gable roof, double-pitch r.; frz. toit àpignon; it. tetto a due spioventi, t. a schienad�asino, t. a doppia falda, t. a capanna; sp. te-cho a dos aguas.
Giebelfeld, die Fläche eines Gie-bels. Der Ausdruck wird haupt-sächl. für das → *Tympanon desantiken Tempels verwendet. Engl. tympanum, pediment; frz. tympan;it. timpano; sp. tímpano.
Giebelgaupe → Gaube.
Giebelgebänk, Bezeichnung für→ *Wimperg.
Giebelgesims, Ortgesims, → *Ge-sims, das die Giebelschräge beglei-tet (→ Geison). Engl. gable moulding; frz. corniche de niveau;it. cornice del frontone; sp. cornisamento.
Giebelhaus, Haus mit einemSatteldach, dessen → *Giebel dieHauptfront bildet (im Unterschiedzum Traufenhaus). → *Bürgerhaus. Engl. gable(d) house; frz. maison à pignon;it. casa con tetto a due spioventi, c. a duefalde; sp. casa a dos aguas.
Giebelreiter, → *Dachreiter übereinem Giebel. Der G. kommthauptsächl. bei städt. Profanbauten(Rathäuser u. dergl.) vor. Engl. acroterion; sp. acrotera.
Giebelsäule, in der Giebelwandliegende Stuhlsäule einer → Dach-konstruktion. Engl. gable post; frz. sous-faîte; sp. columnade un frontón.
Giebelschulter, ein am Fuß mas-siver Giebel vorkragender Mauer-teil, gegen den das Traufgesims läuft
und der den untersten Dachlattenan ihren äußeren Enden ein festesAuflager bietet. Seit der Romanikverbreitet.
Giebelturm, Turm, der über ei-nem Giebel aufsteigt und im Ge-gensatz zum Giebelreiter bedeu-tendere Dimensionen hat. Engl. gable tower; sp. torre sobre un frontón.
Giebelzier, bes. beim Bauernhausdie Fortsetzung der Giebelbretteram Ortgang bei Riet- und Stroh-dächern; sie sind meist am Firstgekreuzt und überstehend, auchdurch einen senkrechten Giebel-pfahl (Wendeknüppel, Geck, Front-spieß genannt) verstärkt. Orna-mentaler oder bildner. Schmuck,häufig silhouettenhaft ausgesägt. Engl. gable ornament; sp. ornamento de unfrontón.
Gigant (gr.-lat. gigas), nach der gr.Mythologie die riesenhaften Söhneder Gaia. In der Baukunst verwen-det man G. (ähnl. den → *Atlan-ten) als figürl. architekton. Stütz-glieder. (Abb. S.220)Engl. giant; frz. gigant; it., sp. gigante.
219 Gigant
Giebelturm
Gildehaus → Zunfthaus.
Girlande (frz. guirlande), → *Fe-ston.
Gitter, Stabwerk aus Holz-, Ei-sen- oder Bronze-Stäben, die ineiner Fläche liegen und sich ent-weder überkreuzen oder neben-einander angeordnet sind. G. die-nen als licht- und luftdurchlässigeAbschlüsse vor Tür- und Fenster-öffnungen, als Einfriedungen undBrüstungen. Die Form der G. istmannigfaltig, bes. bei Schmiede-eisen-G.; Grundform sind Flach-,Rund- oder Vierkantstäbe. Engl. grate, screen, lattice, trellis; frz. grille,treillis, écran; it. grata, gelosia, inferriata;sp. reja, enrejado.
Gitterfries, ein Fries, der imnorddt. Backsteinbau des 12. /13.Jhs. aus sich kreuzenden, vorste-henden, schmalkantigen Backstein-folgen gebildet ist. Engl. lattice; sp. friso de mampostería.
Gittersteine, ein gitterartig durch-brochen gearbeiteter Mauersteinaus Ton oder Kalksand; der vor-handene Luftraum dient der Wär-medämmung. Frz. bloc perforé en treillis; it. mattoni fora-ti; sp. bloque perforado en entramados.
Gitterträger, Träger aus einanderüberkreuzenden Stäben, die ver-nietet sind. G. kommen hauptsäch-lich als Brücken- und Dachkon-struktionen vor. Engl. lattice girder, l. truss, bar joist;frz. poutre en treillis; it. trave a traliccio, t.reticolare; sp. viga entramada, v. de celosía,v. en barras.
Glacis (frz.), auch Abdachung, alsfreies Schußfeld angelegte, feind-wärts flach geneigte Aufschüttungvor dem äußeren Grabenrand einerFestung, zuweilen von Vorwerkengeschützt und mit Annäherungs-hindernissen ausgerüstet. Engl., frz.; sp. glacis; it. spalto.
Glasbaustein, hohle Gußglaskör-per, die durch Mörtel miteinanderverbunden werden. Engl. glass brick, glass block; frz. brique deverre; it. mattone di vetro; sp. ladrillo devidrio.
Gildehaus 220
Giganten(Beispiel: Agrigent, Zeustempel)
Gitterträger
Glasbetonstein, Baustein, auseinem Betonrahmen mit meist festeingekitteter Glasscheibe beste-hend.
Glasdach, mit Glas eingedecktesund meist von einem Stahl- oderStahlbetonskelett getragenes Dach.G. können als Satteldächer, Kup-peln oder Tonnen ausgebildet seinund werden hauptsächl. für Aus-stellungshallen, Fabrikhallen, Ge-wächshäuser u. dergl. verwendet.Eine Sonderform des G. ist dasSheddach. Engl. glass roof; frz. toit en verre, toit vitré;it. copertura di vetro; sp. techo de vidrio.
Glashaus, in der Art der → Ge-wächshäuser (Orangerien) errich-tete Bauten, meist als Stahlskelettmit Glasfüllungen und Glasdach.G. wurden seit der Mitte des 19.Jhs. vor allem für Ausstellungenerrichtet. Sie gelten infolge derNeuartigkeit des Materials und derFunktion als Vorläufer neuzeitl.Baugestaltung. Engl. glass house; frz. maison de verre,serre; it. serra; sp. casa de vidrio.
Glasmalerei, eine Bildkomposi-tion, die zunächst aus farbigenGlasstücken mit Bleiruten zusam-mengesetzt war, während später dieFarben aufgeschmolzen wurden.Durch die Entwicklung der got. Ar-chitektur wurde die G. oft bestim-
mend für Bauformen (Maßwerk-fenster, → Fensterrose). In der Re-naissance wurde die G. bedeutungs-los und geriet in der durch Freskengeschmückten Barockbaukunst ganzin Vergessenheit. Im modernen Kir-chenbau wird sie wieder eingesetzt.Engl. stained glass; frz. peinture sur verre;it. pittura su vetro; sp. pintura en vidrio.
Glastür, Türflügel, dessen Holz-oder Stahlrahmen mit Glasschei-ben gefüllt ist. Heute werden viel-fach G. verwendet, die ganz ausGlas bestehen (→ *Tür). Engl. glass door; frz. porte vitrée; it. portavetrata; sp. puerta de vidrio.
Glasziegel, Glaspfanne, Dachzie-gel aus Glas zur Belichtung einesDachbodens. Der G. hat die Formnormaler Dachziegel, um genau imVerband eingesetzt werden zu kön-nen. Engl. glass tile, g. brick, g. block; frz. tuile(émaillé) de verre; it. tegola di vetro; sp. tejade vidrio.
Gliederpfeiler, Rundpfeiler mitvier vorgelegten Diensten, umlau-fendem Sockel und Kranzkapitell(Kämpferkapitell), um 1230 ent-standen, Vorstufe zum → Bündel-pfeiler (fälschl. kantonierter Pfeilergenannt). Sp. pilar articulado.
Glockendach, → *Dachform, dieoben konvex, unten konkav aus-schwingt und hauptsächl. bei Turm-bekrönungen vorkommt. Engl. bell roof; frz. coupole campanulée,toit en cloche; it. tetto a campana; sp. techoacampanado.
Glockengiebel, Giebelaufbau miteiner oder mehreren Öffnungen,
221 Glockengiebel
Glasbetonsteine
in denen Glocken aufgehängt sind.G. kommen an kleineren Kirchenund Kapellen vor und sind meistselbst mit einem Giebel abge-schlossen. Engl. bell gable, b. cot; frz. cloche arcade;it. campanile a vela; sp. frontón acampanado.
Glockenkapitell, → Kapitell, daswie eine Glocke oben konvex undunten konkav ist. Das G. kommt inder ägypt. Baukunst vor (→ *Säu-le). Frz. chapiteau campaniforme, chapiteaucampanulé; sp. capitel acampanado.
Glockenstuhl, Gerüst mit starkenVerstrebungen, an dem dieGlocken in einem Turm aufge-hängt sind. Engl. bell cage; frz. clocheton, cage de clo-cher; it. incastellatura della campana; sp. ar-mazón que sostiene la campana.
Glockenstupa, Sonderform eines→ *Stupas mit glockenförmig ge-schwungener Kontur. Engl. bell stupa; it. stupa a campana; sp. stu-pa acampanada.
Glockenturm, jeder Turm, in demGlocken an einem Glockenstuhlaufgehängt sind, bes. der freiste-hende G. (→ *Kampanile). Engl. bell tower, steeple, belfry; frz. clocher,campanile, beffroy; it. campanile, torrecampanaria; sp. campanil, campanario.
Glyptothek (gr.), Skulpturen-sammlung. Engl. glyptotheca; frz. glyptothèque; it. glit-toteca; sp. gliptoteca.
Goldene Halle, hölzerne Tempel-halle mit Buddhabild in China.Der Eingang liegt stets an derBreitseite, die Statuen stehen er-höht auf einem Sockel an derRückwand, manchmal umschreit-
Glockenkapitell 222
Glockengiebel
Goldene Halle(Beispiel: Wu-T'ai-Shan, Shansi, Halle des
Hsien-Tung-sse, 15./16. Jh.)
bar Rücken an Rücken. Konstruk-tiv ist die G. H. ein Holzstän-derbau mit reichen Dachformen. Engl. golden hall; sp. sala de templo budista.
Goldener Schnitt, harmon. Tei-lung einer Strecke in einen kleine-ren und einen größeren Abschnitt,wobei sich der größere Teil zur Ge-samtlänge wie der kleinere Teil zumgrößeren Teil verhält. b:a=c:b. DerG. S. wird oft zur harmon. Propor-tionierung von Bauwerken und de-ren Teilen angewandt (→ Propor-tion). Engl. golden section; frz. nombre d�or, sec-tion d�or; it. sezione aurea; sp. sección áurea.
Gopura, Gopuram (ind.), Torbaueines südind. → *Tempelbezirkes,meist von einem hohen Stufenauf-bau gekrönt. So hat der innere Tem-pelbezirk von Madura vier G., dieachsial auf vier größere G. des äu-ßeren Tempelbezirkes bezogen sind.
Gosse, längs einer Fahrbahn ange-ordnete, gepflasterte, offene Ab-zugsrinne (Rinnstein). Engl. gutter, drain; frz. caniveau, ruisseau derue, rigole de pavé; it. cunetta, zanella,canale, chiusino; sp. arollo de la calle, acequia.
Gotischer Verband, PolnischerVerband, → *Mauerwerk aus Back-steinen, ähnlich dem MärkischenVerband, bei dem in jeder Schichtregelmäßig Läufer und Binderabwechseln, so daß die Binder mit-ten auf den Läufern der unterenSchicht liegen. Engl. Gothic bond; frz. appareil en besace;it. concatenamento gotico; sp. aparejo góti-co, trabazón g., aparejo en alforjas.
Gottesacker → Friedhof.
Grabbau, G. der vor- und frühge-schichtl. Zeit sind Hügelgräber,Hühnengräber mit Steinkammernund → *Dolmen. Auch kreisförmi-ge Steinsetzungen können eineGrabstelle umgeben. Im AltenReich Ägyptens errichtete manrechteckige G. mit geböschten
223 Grabbau
Goldener SchnittBD : AB = AB : BFAB : (BD � AB) = BF : (AB � BF)BD � AB = BD � DF = BF = BEAB�BF = AB � BE = AEAB : BE = BE : AEa : b = b : c
RömischesTurmgrab in Hermel/Syrien
Mastaba
Grabbau
Außenflächen (Bankgrab, → Masta-ba), die oft mehrere Räume ent-hielten. Mehrere Mastabas aufein-ander ergeben die Stufenmastaba.Die gewaltigsten G. des Alten Rei-ches sind die → *Pyramiden, diesich über quadrat. Grundriß entwik-keln und unter einem Neigungs-winkel von 51° geböscht sind. ImMittleren und Neuen Reich be-stattete man die Toten in → Gang-gräbern (Felsengräber). Im achä-menid. Persien errichtete manSarkophage auf einem Stufenun-terbau und → Felsengräber. Auchim südwestl. Kleinasien (Lydien,Lykien) war der G. in Form vonFels- und → Turmgräbern hoch ent-
wickelt. Dabei wurden den FelsenFassadenreliefs vorgeblendet. Auchdie Griechen errichteten in Klein-asien bedeutende G. (→ *Mauso-leum). In Mykenae entstandenneben Schachtgräbern bedeutende→ *Kuppelgräber. In Italien errich-teten die Etrusker zahlreiche G.unterschiedl. Form, teils als Fels-
Grabbau 224
Ganggrab
Grabmal der Cäcilia Metella in Rom
Lykisches Felsengrab (Fassade und Schnitt)
Grab des Kyrus in Pasargadae
gräber, als unterird. Grabkammernmit Nischen (→ *Hypogäum) odermehrere Kammern mit darüberlie-genden Grabhügeln. Etrusk. G.(→ Tumulus) wirkten dann auf dieröm. Baukunst ein, die bes. in derKaiserzeit beachtl. G. entwickelte.Daneben gab es in Rom unterird.Räume mit zahlreichen Nischenfür die Aschenurnen (→ *Kolum-barium). In der spätröm. Zeit ent-standen auch G. in der Form einesZentralbaues, die im GrabmalTheoderichs einen späten Nach-läufer fanden. Auch ägypt. Vorbil-der wurden imitiert. In frühchristl.Zeit entstanden noch G. ähnl. Art.Turmähnl. G. mit oberem Pyrami-denabschluß entstanden in spätan-tiker Zeit in Nordafrika, → Fels-gräber mit prachtvollen Fassadenin Petra. Im MA. nimmt die Bedeu-tung des G. ab, die → Grabkapellenund → *Karner sind ohne bes. ar-chitekton. Rang (Gruft, → *Krypta).Erst in der Renaissance gewann derG. wieder größere Bedeutung. Inder islam. Welt kommen vor allemin Indien und Persien beachtlicheG. vor. Die türk. Sultane und Wesi-re errichteten größere G. (→ *Tür-be), manchmal bei den von ihnengestifteten Moscheen (→ *Grab-moschee). In Indien → *Stupa. Engl. sepulchral building, tomb construc-tion; frz. ouvrage sépulcral; it. costruzionefuneraria; sp. construcción de sepulcro, c.de tumba.
Grabdenkmal, Kenotaph, imGegensatz zum raumschaffenden→ *Grabbau ist das G. lediglich einErinnerungsmal an einen Toten.Doch sind die Übergänge fließend.Reicher geschmückte Formen sindeinem Sarg (→ *Sarkophag, ohneBestattung: → Kenotaph) oder der
225 Grabdenkmal
ma. Grabstein eines Bischofs
Grabdenkmal
griechische Stele
Liegestatt für einen Toten (→ Tum-ba) nachgebildet. Eine Sonderformist das → Heilige Grab. Das G.kann ferner in der Form einer Säu-le, einer aufrecht stehenden (→ Ste-le) oder liegenden Platte (Grab-platte) oder als eine in die Wandeingelassene Platte (→ *Epitaph)ausgebildet sein. Die Tumben kön-nen wie die Sarkophage einen archi-tekton. Überbau (→ *Baldachin,→ *Baldachingrabmal) haben unddurch Plastik geschmückt sein.Griechen und Römer stellten ihreG. oft an Straßen auf. Im MA. fin-den wir G. hauptsächl. im Innerender Kirchen und Kapellen, manch-mal auch in der Form eines → *Ni-schengrabes, das auch an der Au-ßenwand einer Kirche vorkommenkann. In der Renaissance und inder Barockzeit wurden aufwendi-gere G. mit zahlreichen Skulptu-ren, Putten und allegor. Gestaltengeschaffen.Engl. sepulchral monument; frz. monu-ment funéraire, m. sépulcral; it. monumen-to funerario, m. sepolcrale; sp. monumentofunerario, M. del sepulcro, m. de tumbas.
Graben, in den gewachsenen Bo-den eingegrabene, langgestreckte,
künstl. Vertiefung, mit U-förmi-gem Querschnitt Sohlg., mit V-för-migem Querschnitt Spitzg.; Halsg.zumeist trockener, breiter Sohlg.,der eine Burg vom anschließendenBergrücken trennt. Große, schiff-bare Gräben heißen Kanäle, schma-le, flache G. werden Rinnen ge-nannt. Engl. ditch, drain, trench; frz. fossé, tran-chée; it. fossa, fossato; sp. excavaciones,fosa.
Grabendach → *Dachformen.
Gräberstadt, Totenstadt (gr. Ne-kropole) ist ein Friedhof mit archi-tekton. gestalteten Gräbern odermit → *Grabbauten, die oft nochgruppiert oder um größere Grab-bauten regelmäßig angeordnet sind.G. kommen hauptsächl. bei denÄgyptern, aber auch bei den Mos-lems vor. Auch die Etrusker legtenihre Totenstädte um Straßen undWege geordnet an (→ *Gräber-straße). Engl. necropolis; it. necropoli; sp. necrópolis.
Gräberstraße. Der alte etrusk.Brauch, Tote in → *Grabbautenbzw. unter → Grabdenkmälern zu
Graben 226
Gräberstraße (Beispiel: Pompeji)
bestatten, die an beiden Seiteneiner Straße aufgereiht sind, wurdespäter auch von den Römern inähnl. Form übernommen. Engl. cemetery street; sp. calle entre sepul-cros.
Grabkapelle, Kapelle, meist in un-mittelbarer Nähe einer Kirche, inder Bischöfe oder Adelige beigesetztsind (im Gegensatz zum → *Kar-ner, dem Beinhaus mit darüberlie-gender Kapelle). Engl. funerary chapel, mortuary c.; frz. cha-pelle funéraire, c. sépulcrale; it. cappellafuneraria, c. sepolcrale, c. mortuaria; sp. ca-pilla funeraria, c. mortuoria.
Grabmonument → *Grabdenk-mal.
Grabmoschee, eine → *Moschee,die am Grabe eines hohen islam.Würdenträgers errichtet ist. Daseigentl. Grab ist in der Regel ineinem eigenen → Grabbau (türk.→ *Türbe), die Moschee nur ange-baut. Die G. tragen meist den Na-men des Toten. (Abb. S.229)Engl. sepulchral mosque; it. tomba moschea;sp. mezquita funeraria.
Grabtempel, Totentempel, einTempel im alten Ägypten, der demTotenopferkult des Pharao diente.Im Alten Reich besteht der G. auseinem Taltempel, dem von diesemzum G. führenden Aufweg unddem eigentl. G. vor der → *Pyra-mide. Im Neuen Reich gleicht sich
227 Grabtempel
Gräberstadt(Beispiel: Gizeh/Ägypten)
der G. den anderen Tempelanlagenan (Pylon, Hof, Vorhalle, Quersaal,Allerheiligstes mit Kammern). Engl. funerary temple; it. tempio sepolcrale;sp. templo funerario.
Grabzippus, → *Zippus, eiförmi-ger Aufsatz auf etrusk. Kistengrä-bern oder Grabhügeln. It. cippo funerario, c. sepolcrale; sp. cipo fu-nerario.
Gracht, in holländ. Städten einZweigkanal, der vom Hafen insStadtinnere führt. Im Unterschiedzum norddt. Fleet wendet die Rand-bebauung ihre Fassade der G. zu. Engl. ditch, drain, canal; frz. canal, gracht; it.canale, naviglio; sp. canal de desagüe, foso,zanja de drenaje
Grangie, Scheune, Wirtschaftshof,Vorwerk, bes. von Zisterzienser-klöstern. Engl. grange, barn; frz. grange; it. granaio,fienile, grangia, grancia; sp. granero.
Grat, 1. die Schnittkante zweierDachflächen mit ausspringendemWinkel (→ *Dachausmittlung). 2.Kante zwischen zwei einanderüberschneidenden Flächen eines→ *Gewölbes. Engl. arris; frz. arête, crête; it. 1. linea di dis-pluvio, 2. spigolo all�incrocio delle volte;sp. arista.
Gratbalken, Kehlbalken, der dia-gonal auf die Ecke zulaufende Bal-ken einer Balkenlage und in dendie übrigen Balken eingezapft wer-den, vorrangig bei Dachbalkenla-gen; besser ist die Anordnung eines→ Gratstichbalkens. Engl. arris beam; frz. coyer, poutre faîtière;sp. viga cumbrera.
Gratbogen, die Schnittkurve zwi-schen zwei einander überschnei-denden Gewölbeflächen (→ *Ge-wölbe). Engl. cross springer, transverse rib; frz. croi-sée d�ogive, arc arêtier; it. arco d�incrociodelle volte; sp. imposta cruzada, ojiva c.
Grabzippus 228
A erster HofB zweiter Hof mit
Osirispfeilern
C SäulensaalD Erscheinungs-
fenster
Grabtempel(Beispiel: Gizeh, G. des Chefren)A Taltempel B Aufweg C Grabtempel
(Beispiel: Theben, Ramesseum)
Gratgewölbe, mit Graten verse-henes Gewölbe, wie das Kreuzgrat-und das Zellengewölbe. Engl. arris vault, groin v.; frz. voûte d�arêtes;sp. bóveda con aristas.
Gratleiste, Leiste mit zwei spitz-winkligen Kanten, die in eine ent-sprechend ausgebildete Nut vonBrettern quer zu deren Faserrich-tung eingeschoben werden, um sieabzusperren, d.h. Verziehungen zuverhindern; sie wird nicht einge-leimt, damit die Bretter in derQuerrichtung arbeiten, d.h. sichausdehnen und schwinden kön-nen. Engl. arris fillet; frz. tasseau d�arêtier; sp. lis-tón de cuña.
Gratschifter, Sparren, der an ei-nem → Gratsparren angeschiftet ist.Engl. (hip jack) rafter; frz. empanon d�arête,arêtier; it. falso puntone di displuvio; sp. ca-brio empalmado a la limatesa.
Gratsparren, der den Grat unter-stützende, diagonal von der aus-springenden Ecke einer Traufezum First verlaufende Sparren ei-nes Walmdaches (→ Dachkonstruk-
tion), dessen Oberfläche zwei, denbeiden Dachflächen entsprechen-de, Neigungsflächen hat, derenWinkel nach außen weist (imGegensatz dazu → *Kehlsparren). Engl. hip-rafter, arris rafter; frz. chevrond�arêtier, érestier; it. cantonale, puntoned�angolo; sp. limatesa, cabrio de l., par d. l.
Gratstichbalken → Balken.
Gratziegel, Dachziegel, mit demdie Grate eines Daches gedecktsind (→ *Dachdeckung). Engl. hip tile, ridge t.; frz. tuile faîtière;it. tegola di cantonale; sp. teja de cumbrera.
Grede, Greden, Freitreppe am Pa-las einer Burg. Frz. perron de palas, perron d�un châteaufort; sp. escalinata, gradería de un castillo.
Griechische Säulenordnungen→ *Säulenordnungen. Engl. Greek order; frz. ordre grec; it. ordinearchitettonico greco; sp. orden arquitectó-nico griego.
Griechisches Kreuz, im Gegen-satz zum lat. → *Kreuz eine Formdes Kreuzes mit gleich langen
229 Griechisches Kreuz
Grabmoschee(Beispiel: Bischapur/Indien, Grabmal des Adil Schah, 17. Jh.)
Armen, die als Grundrißfigur vie-ler → *Zentralbauten erscheint. Engl. Greek cross; frz. croix grecque; it. cro-ce greca; sp. cruz griega.
Groteske (it.), aus der hellenist.-röm. Antike stammende Dekora-tion (→ *Arabeske 2). Engl. grotesque; it. grottesca; sp. grotesca.
Grotte (it. grotta), künstl. errichte-te Höhle, die in der Garten-architektur der Renaissance undder Barockzeit eine große Rollespielt. Manchmal wurde auch die→ Sala terrena barocker Schlössermit G.werk zur G. ausgestaltet. Engl. grotto; frz. grotte; it. grotta; sp. gruta.
Grottensäule, Stütze aus rohemGestein, die mit Muscheln,Schnecken u. dergl. geschmückt ist.Frz. colonne grotesque; sp. columna grutes-ca.
Grubenhaus, eine Dachhütte, zu-meist viereckig und einräumig, de-ren Fußboden in die Erde eingetieftist, in german. und frühma. Zeit alsWohn- und Wirtschaftsbauten be-nutzt, selten größer als 4×4m.Sp. casa cueva.
Gruft, Grube und Grab, zumeistgemauerte in den Boden der Kir-che oder eines Friedhofs eingetief-tes Behältnis, um ein oder mehrereSärge aufzunehmen, bes. seit demBarock ausgebildet. Engl. vault, tomb, grave; frz. caveau, tom-beau, tombe; it. tomba, sepolcro, cripta;sp. fosa, sepulcro, tumba.
Grundbogen, umgekehrter, mitdem Scheitel zum Erdreich gerich-teter Bogen (→ *Erdbogen). It. arco rovescio; sp. arco cóncavo.
Grundriß, waagerechter Schnittdurch ein Bauwerk bzw. dessenGeschosse (→ *Projektion) etwa inBrusthöhe. Engl. ground plan; frz. plan horizontal;it. pianta, proiezione orizzontale; sp. plantade un diseño.
Grundschwelle, Grundbalken,auf Boden oder Sockelmauer lie-gende Schwelle bei Fachwerk-oder Blockbauwänden. Engl. groundsill; frz. sablière; it. trave disoglia; sp. solera inferior.
Grundstein, erster Stein, der oftin feierl. Form mit Beigabe vonUrkunden und Münzen bei Bau-beginn gelegt wird. Er kann im Fun-dament vermauert oder sichtbar(manchmal als Eckstein) angeord-net sein. Engl. foundation stone, cornerstone;frz. pierre fondamentale; it. la prima pietra;sp. piedra fundamental.
Grünling, ungebrannter, luftge-trockneter Backstein aus Lehm,auch Patze genannt.
Gruppentriforium, → Triforium,bei dem die zumeist unter Blend-bogen oder Blendgiebel gekuppel-ten Zwillings- oder Drillingsar-kaden in die Mauer eingeschnittensind, in der Normandie ausgebil-det und mit der Kathedrale vonAmiens um 1240 und deren Ein-fluß verbreitet.
Guadrone (it.), vom ion. → Kyma(Eierstab) abgeleitete, stark ausge-bauchte Verzierung der it. Renais-sance.
Guckkastenbühne, Bühne mitarchitekton. gerahmter Bühnen-öffnung, die das Bühnenbild be-
Groteske 230
grenzt und sowohl die völlige Ab-schließung des Bühnenhauses vomZuschauerraum, als auch eine illu-sionist. Ausgestaltung des Bühnen-bilds (→ Soffitte 2, → *Theaterbau)ermöglicht. Die Zone zwischen G.und Zuschauerraum ist das Pro-szenium. Engl. picture frame stage; it. palcoscenicocon boccascena; sp. escenario enmarcado.
Gulfhaus, Gulf, Golf, heißt in denBauernhäusern der Marsch derTeil der Diele, in dem das Heugestapelt wird, während an denLängsseiten das Großvieh seineStände hat; daraus haben sich inden Küstengebieten der Nordseeriesige Stallscheunen mit ange-hängtem Wohnteil entwickelt, seitdem 16. Jh. aufgekommen im Zu-sammenhang mit marktorientier-ten Großbetrieben. Der Kern desHauses ist der Gulf, der aus vierHochständern besteht, die durchAnkerbalken gesichert sind. DerGulf hat keine Decke, sondern istein zum Dach freier Stapelraum.
Gurtbogen, Gurt, der quer zurLängsachse eines → *Gewölbes ver-laufende konstruktive oder glie-dernde Bogen. Er kommt haupt-sächl. beim Tonnengewölbe undbeim Kreuzgewölbe vor (→ *Ge-wölbeformen) und kann sichtbar ander Gewölbelaibung (Untergurt)oder am Gewölberücken (Ober-gurt) vortreten. Engl. transverse arch, arc doubleau; frz. arc-doubleau; it. arcone trasversale; sp. arcoapuntado, arco toral.
Gurtgesims, Kordongesims. Stock-werksgesims → *Gesims. Engl. stringcourse, belt course; frz. larmier,couronne, coupe-larmes; it. cornice marca-piano; sp. moldura acordonada, plinto,goterón, corona, corta lágrimas,.
Gurtrippe, Rippen anstelle derGurtbogen, im Unterschied zuden Kreuz- oder Diagonalrippen. Engl. ridge rib; frz. nervure médiane; it. ner-vatura trasversale di volta; sp. nervadura me-diana, n. transversal.
Gußerker → Pechnase.
Gußgewölbe, auf Schalung ge-gossenes → *Gewölbe (→ *Topfge-wölbe). Engl. cast vaulting, rubble vault; frz. voûtecoulée; it. volta colata, v. gettata; sp. bóvedamoldeada, b. vaciada.
Gußmauerwerk, → *Mauerwerk,das zwischen Schalungen gegossenwird oder bei größeren Mauer-stücken durch Ausgießen des Zwi-schenraumes zweier gemauerterWände entsteht. Die G.technik(opus incertum) war bereits denRömern bekannt und wurde eben-so wie das Gußgewölbe häufig aus-geführt. Die Gußmasse war ein mitSteinbrocken durchmischter Mör-tel, der als Vorläufer des modernenBetons gelten kann. Engl. opus caementicium; frz. muragecoulé, maçonnerie en coulis; it. opera cola-ta, muratura c.; sp. muralla moldeada, m.vaciada.
Guttae (lat.), tropfenartige Gebil-de der → *Dorischen Ordnung, diein drei Gruppen zu sechs Tropfenan den Mutuli (Dielenköpfe) undaußerdem sechs G. in einer Reiheunter den Regulae angebracht sind. Engl. guttae; it. gocce; sp. gota.
231 Guttae
Obergurt Untergurt
Gymnasion (gr. gymnos: nackt),Schule mit Laufbahnen, Bädern undHörsälen, die auch mit einer Rin-gerschule (Palästra) verbunden seinkann, für die körperl. Ausbildungder Knaben, Epheben und Jüng-linge. Ein G. mit mehreren terras-senförmig angelegten Stadien lagz.B. am Stadtrand von Priene. Einegroße G.anlage mit mehreren Audi-torien ist z.T. noch neben dem De-meterbezirk in Pergamon erhalten.
Gynäkeion, Gynaikeion (gr.) 1.Frauengemach des gr. → Wohn-hauses im Gegensatz zum Wohn-teil der Männer (Andronitis). 2.Für die Frauen reservierter Raumeiner Kirche, bes. Empore. Engl. gynaeceum; frz. gynécée; it., sp. gineceo.
H
Hagioskop (gr.), kleine fensterar-tige Öffnungen in der Südmauerdes Kirchenschiffs oder Chors, dieden Blick auf den Altar von außenerlauben. Engl. hagioscope, squint; sp. abertura quepermite mirar el altar desde afuera.
Hahnebaum, Helmstange, Kai-serstiel, senkrechter Mittelständereines Helmdachs, in den die Grat-sparren eingelassen sind und derden Turmknauf (Turmhahn) trägt. Engl. broach post; frz. poinçon, pivot cen-tral; it. monaco centrale; sp. pivote central.
Gymnasion 232
a Stadionb Ephebeum
c Frigidariumd Tepidarium
e Exedra
Gymnasion (Beispiel: Ephesus)
Hahnenbalken → Kehlbalken.
Hakenbalken, kurzes, waagerech-tes, eine Vorkragung tragendesHolz, das im Unterschied zum→ Stichbalken nicht mit einemBalken verbunden ist, sondern ineinen Ständerkopf des darunterbefindl. Geschosses eingezapft odereingehälst ist und von einer Knag-ge gestützt wird. Dadurch kann dieStockwerkschwelle in der Höhe derBalkenlage liegen.
Hakenblatt, zimmermannsmäßi-ge Holzverbindung von Kanthöl-zern, die in derselben Ebene liegen,bes. zwischen Strebe oder Bandund Ständer im Fachwerkbau. Zuunterscheiden ist das gerade unddas schräge H. je nach dem Winkeldes Rücksprungs am Übergang derbeiden Hölzer. Frz. moraillon à amberons, anberonnière,écart à croc; it. giunto a mezzo legno conrisalto, g. a dardo di Giove, g. di Gibilterra;sp. ensamble a media madera con tacón.
Hakenstein, Stein mit hakenför-mig verzahnten Stoßfugen, die denBau eines Bogens ohne Lehrgerüstermöglichen und das Durchhän-gen eines → scheitrechten Sturzesverhindern sollen. Frz. claveau engrené à crossette; it. conciocon angoli sventrati; sp. piedra de gancho.
Halbdach → Pultdach.
Halbfirst, First eines → Pultdachs.
Halbgeschoß, Mezzanin (→ *Ge-schoß).
Halbholz, kantiges Bauholz, dasdurch einmalige Zertrennung desStamms gewonnen wird. Engl. half-timber; frz. demi-rondin, boismi-plat; it. legname mezzo tondo; sp. me-dio rodón.
Halbkreisbogen, Rundbogen(→ *Bogenformen).
Halbkuppel, eine → *Kuppel mitviertelkreisförmigem Querschnittüber halbkreisförmigem Grundriß.Die H. wird oft zur Überwölbungvon Apsiden oder halbrunden Ni-schen verwandt (→ *Basilika). Engl. semidome; frz. hémisphère; it. semi-catino, semicupola; sp. semicúpula.
Halbmond → Ravelin.
Halbschlitz, abgeschrägte Eckeder Triglyphe bei der → *Dori-schen Ordnung.
Halbtonne, Tonnengewölbe mitviertelkreisförmigem Querschnitt(→ *Gewölbeformen). Engl. half-tunnel vault; it. volta a mezzabotte; sp. bóveda en cañón semisesgada.
Halbwalmdach, Dach, das nuran einer Frontseite abgewalmt ist(→ Dachformen). Engl. roof pitched at one end; frz. toit endemi-croupe, comble à croupe faîtière;sp. techo semisesgado.
Halle, ein geräumiger, meist öf-fentl. Bau oder Raum. 1. Ein offe-ner oder halboffener Bau, ur-sprüngl. zum Schutz vor Regenoder Sonne (→ Stoa, Wandelhalle,Vorh.), bisweilen auch geschlossen
233 Halle
Scheitrechter Sturz mit Hakensteinen
(Rathaush., Markth., Bahnhofsh.).2. Eine weite Raumform, die nurüber eingestellte Stützen gedecktwerden konnte und nur durch dieAußenfronten belichtet wurde(Säulenh., → *H.kirche). 3. DerHauptraum des nordwesteurop.Wohnhauses (→ Diele, → Saal)wird in England hall genannt, da-nach auch Hotelh. Engl. hall; frz. hall(e) de réception, halld�accueil; it., sp. sala, hall.
Hallenchor, mehrschiffiger →*Chor mit gleicher oder annä-hernd gleicher Höhe der einzelnenSchiffe, jedoch ohne selbständigeBelichtung des Mittelschiffs. Engl. hall choir; frz. ch�ur-halle; sp. corocon naves.
Hallenkirche, mehrschiffige Kir-chenanlage mit gleicher oder annä-hernd gleicher Höhe (→ *Staffel-halle) der einzelnen Schiffe, jedochohne selbständige Belichtung desMittelschiffs. Engl. hall church; frz. église-halle; it. chiesaa sala, chiesa a salone; sp. iglesia con naves.
Hallenkrypta, mehrschiffige→ *Krypta mit gleichhohen Ge-wölben, urspr. ein kleiner Raumvor der Confessio, der ausgeweitethäufig über vier Stützen (Vier-stützenkrypta) eingewölbt wurde.Seit dem beginnenden 11. Jh. fin-det man dreischiffige, mehrjochigeSäulenhallen. Die H. kann sichauch unter die Vierung, die Quer-hausarme oder ein Stück unter dasMittelschiff erstrecken. Kombina-tionen aus H. und Ringkrypta bil-den vielfältige und teilweise kom-plizierte Raumfolgen. Die H. hatteihren Höhepunkt im 11. /12. Jh. Engl. undercroft; it. cripta a sala; sp. criptacon naves.
Hallenlanghaus, Langhaus einer→ *Hallenkirche. Engl. hall nave; sp. nave central de una igle-sia.
Hallenquerhaus, ausladendes,mehrschiffiges Querhaus einer→ *Hallenkirche. Engl. hall transept; sp. crucero de una igle-sia con varias naves.
Hallenchor 234
(Beispiel: Zwettl/NÖ, Stiftskirche)
(Beispiel: Salzburg, Franziskanerkirche15. Jh.)
Hallenchor
Hals, Teil des Säulenschafts un-mittelbar unter dem Kapitell, dergegen den darunterliegenden Säu-lenschaft durch einen Ring abge-schlossen sein kann und manchmalauch eingezogen ist (→ *Echinus,→ *Römisch-dorische Ordnung). Engl. neck; frz. gorge; it. collarino; sp. cuello.
Halsgraben, Graben vor der Ring-mauer einer → Burg. Engl. (fortress) moat; frz. fossé, gorge; it. fos-sato; sp. foso alrededor de una fortaleza.
Halsring, bei der → ToskanischenOrdnung ein Ring am oberenEnde des Säulenschafts unter demSäulenhals (→ *Säulenordnungen).Engl. necking, neck moulding; frz. collier;it. collare; sp. collar toscano.
Hammam (arab. hamman: heißmachen), Badeanlage der Türken,meist in Form eines kuppelüber-wölbten Zentralbaus oder einerganzen Gruppe von zum Teil sym-metr. oder paarweise angeordne-ten Kuppelbauten. Die Traditionder röm. Thermen lebt im H. wei-ter, wobei auch die Fußboden-heizung (→ *Hypokausten) über-nommen wurde, falls das H. nicht
von einer Thermalquelle gespeistwurde. Einer der Haupträume istder Schwitzraum (Harara). Engl., frz. hammam; it. hamman; sp. bañoturco.
Han, Chan (pers. Haus), im Ori-ent Bezeichnung für die Herberge(→ *Karawanserei) an einer Kara-wanenstraße hauptsächl. in derTürkei und in Persien. Die Räumesind meist zweigeschossig um ei-nen Hof gruppiert.
235 Han
Hallenkirche
(Beispiel: Schneeberg/Sa., St. Maria und Wolfgang)
(Beispiel: Danzig, St. Marien)
Hammam
Handlauf, Griffleiste, Holm, derHand angepaßte Abschlußleiste ei-nes → *Geländers. Engl. handrail; frz. main-courante; it. cor-rimano, mancorrente; sp. pasamano.
Handwerkerhaus, Sonderformdes → *Bürgerhauses, die denBedürfnissen eines Handwerksbe-triebs, vor allem der Lagerhaltung,angepaßt ist. So sind die Häuserder Gerber und der Färber oft aneinem Flußlauf zusammengefaßtund haben diesem zugewandt offe-ne Lauben bzw. einen Dachraummit langgestreckten mehrgeschos-
sigen Schleppgaupen und breitenÖffnungen im Dachgiebel. Engl. craftman�s house; frz. maison d�arti-san; it. casa artigiana; sp. taller de artesanía.
Hangar (lat.), an einer Langseiteoffener Schuppen, insbes. Flug-zeughallen. Engl., frz.; sp. hangar; it. hangar, aviorimessa.
Hängebalken → *Hängewerk.
Hängeboden, ein Zwischenbo-den, der unterhalb der Deckenbal-ken angehängt wird und durch denin einem hohen Raum ein obererniedrigerer Raum abgetrennt wird,als Schlafraum für Knechte oder alsAblage, bis ins 19. Jh. auch inStadthäusern vorhanden. Engl. suspended floor; frz. soupente; sp. en-trepiso colgante, e. suspendido.
Hängebrücke → *Brücke.
Hängedach, Seildach, durchhän-gendes Dach, dessen Konstruk-tionsteile nur auf Zug beanspruchtwerden. Daher ist die stützenfreieÜberdeckung großer Spannwei-ten mit geringem Aufwand mög-lich. Gleichzeitig entsteht darunterein Raum mit von den Rändernzur Mitte abnehmender Höhe(→ *Dachformen). Engl. suspended roof; frz. toit suspendu;it. tetto sospesa, copertura s.; sp. techo col-gante.
Hängeeisen → *Hängewerk.
Hängekammer, in die Diele einesnorddt. → *Bürgerhauses einge-hängte Kammer.
Hängekuppel, Stutzkuppel, imGegensatz zur → *Böhmischen
Handlauf 236
ma. Handwerkerhausa Werkstatt b Küche
Kappe, deren überwölbte Flächekleiner als das Grundquadrat einerzu ergänzenden größeren Kuppelist, wird bei der Hängekuppel dasGrundquadrat in den Fußkreis ei-ner Kuppel einbeschrieben, so daßvier Kalotten entfallen. Entferntman die Scheitelkalotte, so verblei-ben vier Pendentifs (→ *Kuppel). Engl. sail vault; it. volta a vela; sp. cúpula daapoyo.
Hängeplatte, Dielenkopf, Mutu-lus der → *Dorischen Ordnung. Frz. coupole pendante; it. mutulo; sp. mú-tula.
Hängesäule → *Hängewerk. Engl. joggle post, king post; it. monaco;sp. pilar colgante.
Hänge-Sprengwerk, Tragwerkaus einer von zwei Sprengstrebenunterstützten Hängesäule, an derein Spannbalken hängt; doppeltesH.-S. mit zwei Hängesäulen undSpannriegeln dazwischen. Engl. hanging truss (frame); frz. clef pen-dante; sp. envigado colgante.
Hängeständer, dem auskragendenDeckenbalken vorgezapfter oderangeblatteter und in einem Hän-gezapfen frei endender Ständer beiStockwerkfassaden eines Geschoß-baus (Hängepfosten).
Hängewerk, Tragwerk, bei demein Spannriegel von oben herdurch eine in der Mitte aufgestell-te Säule (Hängesäule), die zu denbeiden Auflagern durch Hänge-streben abgestrebt ist, gehaltenwird (einfaches Hängewerk); dasdoppelte Hängewerk weist zwei,das mehrfache mehrere Hänge-säulen auf, wobei jeweils zwischen
zwei Hängesäulen ein Spannriegelangeordnet ist (→ *Sprengwerk). Engl. hanging truss (frame); frz. ferme enarbalète, armature à clefs pendantes; it. ca-priata, incavallatura; sp. armazón colgante.
Hängezapfen, Abhängling, zap-fenförmig herunterhängender Teilam unteren Ende eines Hän-geständers (→ Hängewerk, → *Ab-hängling 2). It. chiave pendente; sp. tarugo colgante.
Hängezwickel, Pendentif, sphär.Dreieck zur Überleitung vom qua-drat. Grundriß zum Fußkreis einer→ *Kuppel. It. pennacchio sferico; sp. pechina.
Haram (arab.), Betsaal, Innenraumeiner Moschee.
Harara (arab.), Schwitzraum eines→ *Hammam.
Harem (arab.), den Frauen vorbe-haltener und für Fremde unzu-gängl. Teil des Wohnhauses imislam. Kulturbereich. Engl., frz., it. harem; sp. harén.
Hartbrandziegel → Klinker.
Hathorsäule, Sistrumsäule, ägypt.Säule mit einem Hathoraufsatzoder mit einem Hathorkapitell(→ *Kapitell, → *Geburtshaus). Frz. colonne hathorique; it. colonna atorica;sp. columna egipcia hathórica.
237 Hathorsäule
a Hängebalken b Hängesäule c Strebe
d Spannriegele Hängeeisenf Unterzug
Doppeltes Hängewerk
Hathortempel, ein der ägypt. Lie-besgöttin Hathor geweihter Tem-pel, meist mit Hathorsäulen. DasHauptheiligtum der Hathor war inDendera. Frz. temple d�Hathor; it. tempio atorico;sp. templo consagrado a Hathor, diosa egip-cia del amor.
Haubarg → *Barghus.
Haubendach, welsche Haube(→ Dachformen).
Haufendorf → *Dorfformen.
Haupt, 1. bei → *Bogen, → Mau-erwerk u. dergl. die sichtbare Au-ßenseite, im Gegensatz zum Lager.Die Vorderseite heißt Vorh. oderStirn, die Rückseite Hinterh. 2.Riese, der Helm der → *Fiale. Frz. 1. face, surface extérieure; it. 1. faccia,2. gigante; sp. cara superficie exterior.
Hauptbalken, Ganzbalken, ein→ *Balken, der ohne Zwischen-stützen durch die ganze Gebäu-detiefe geht. Engl. main girder, architrave; frz. poutremaîtresse, p. principale; it. trave maestra;sp. viga principal.
Hauptgebinde, Binder (→ Binder2) einer → Dachkonstruktion. It. capriata principale, incavallatura p.; sp. an-claje principal.
Hauptgeschoß, Beletage, Pianonobile (→ *Geschoß). Engl. main story; frz. étage principal, bel-étage; it. piano nobile; sp. piso principal.
Hauptgesims, Abschlußgesims ei-nes Baukörpers (→ *Gesims). Engl. entablature; frz. entablement; it. cor-nicione; sp. moldura principal.
Häuptig, auch einhäuptig, Mauermit nur einer sichtbaren Außen-fläche (→ Haupt 1).
Hauptpfosten, tragender Pfosteneiner → *Balustrade oder eines→ *Geländers, auf dem meist derHandlauf ruht. Frz. poteau principal; it. pilastrino principa-le; sp. poste principal.
Hauptportal, wichtigstes Portal,meist in der Achse einer Fassade. Frz. portail central; it. portale principale;sp. portal principal.
Hauptschiff, das Mittelschiffmehrschiffiger Räume (→ *Schiff). Frz. nef centrale; it. navata centrale; sp. navecentral.
Hauptsparren, Bundsparren, Bin-dersparren, Sparren am Bindereiner → Dachkonstruktion. Engl. principal rafter; frz. maître-chevron;it. puntone principale; sp. cabio principal,par p.
Haus, ein Gebäude, das im allge-meinen Menschen als Wohnung(→ *Wohnh., → *Bürgerh., → Bau-ernh.), aber auch anderen Auf-gaben dient (→ *Rath., → *Kaufh.,→ Warenh., → Zeugh., → Zunfth.,→ *Gartenh., → Gasth. u. a.) undder Aufgabe entsprechend verschie-dene Formen haben kann. Nachder Stellung der H. zueinander undim Siedlungsraum unterscheidetman z.B. Reihenh., Doppelh., frei-stehendes H. (→ *Bauweise), nachseiner Höhe Flachbau, Geschoß-bau, Hochh., nach der Form desBaukörpers Rundh., Megaronh.,Hofh., → *Terrassenh., Turmh.,Punkth., Sternh., Giebelh., Trau-fenh., nach dem Material und der
Hathortempel 238
Konstruktion Holzh., Steinh., Fach-werkh. usw. Engl. house; frz. maison; it., sp. casa.
Hausbaum, der vertikale Haupt-pfosten, der das Gebälk ma. Wohn-häuser trägt.
Hausberg → Motte.
Hausflur, Flur, Vorraum zwischendem Hauseingang und dem Trep-penhaus, in Stockwerkswohnun-gen zwischen Wohnungstür undden einzelnen Zimmern. Engl. entrance-hall; frz. vestibule; it. vesti-bolo, corridoio; sp. vestíbulo, corredor dedistribución.
Hauskapelle, private Kapelle einesBürger- oder Patrizierhauses, diemeist in einem Obergeschoß liegt.Sie springt manchmal in einempolygonalen → *Chörlein (Kapel-lenerker) über die Außenwand vor. Engl. private chapel; frz. chapelle particu-lière; it. cappella privata, c. domestica;sp. capilla privada.
Hausmarke, Hauszeichen, figürl.oder geometr. Symbol zur Kenn-zeichnung eines Hauses, frühermeist am Schlußstein der Eingangs-tür angebracht. Nach der H. wur-den früher die Häuser benannt(Hausname, z. B. »zum Schwa-nen«), auch wenn es keine Gast-häuser waren. Die H. ersetzte diemoderne Ordnungsnummer. Frz. marque de maison, enseigne de m.;it. marchio di casata; sp. destintivo de unacasa.
Haustein, Werkstein, jeder stein-metzmäßig mehr oder wenigerbearbeitete Naturstein, im Gegen-satz zum Bruch- und Feldstein,
wird als Quader oder Profilsteinunter Verwendung von Mörtel zuMauern zusammengefügt. Je nachMaterial und Lage im Steinbruchsind H. unterschiedl. belastbar undwitterungsbeständig. Sie wurden inden verschiedenen Zeiten und Ge-genden unterschiedl. angewandt:während in der Antike, seit dem 5.Jh. v. Chr., der H. reichliche Ver-wendung fand, ging die Bear-beitungstechnik nördl. der Alpenwährend der Völkerwanderung ver-loren und wurde erst im 10./11. Jh.nach und nach wieder allgemeineingeführt und seitdem unter-schiedl. bevorzugt. Engl. ashlar; frz. m�llon d�appareil, pierrede taille, p. de façonné; it. concio, pietratagliata; sp. piedra de cantera labrada cua-drada.
Hausurne, in frühen Kulturenverwendete Aschenurnen zeigen,ähnl. wie die Sarkophage, oft Nach-bildungen der damals üblichenHausformen. Die H. ermöglichenwertvolle Rückschlüsse auf denAufbau und das Aussehen dergleichzeitigen Wohnhäuser. It. urna cineraria a forma di casa; sp. urnadoméstica.
239 Hausurne
Etruskische Hausurne
Hebefenster, Sonderform des→ Schiebefensters, dessen bewegl.Flügel gegen einen meist festste-henden oberen Teil gehoben undfestgestellt wird (→ *Fenster). Engl. lifting window; frz. fenêtre à lever;it. finestra a scorrimento verticale; sp. ven-tana tipo guillotina.
Hebetür, 1. meist auf Terrassenoder Balkone führende Außentür,die beim Öffnen einige Zentimeterangehoben wird, weil sie geschlos-sen auf einer höheren Schwelleaufsitzt. 2. Tür, die durch Anhebendes Blatts geöffnet wird (meist beiGaragentoren oder dergl.). Engl. 2. lifting door; frz. 2. porte à lever;it. 2. porta a ribalta; sp. portón levadizo.
Hechtfenster, sehr breite Schlepp-gaupe (→ Dachfenster).
Heiliges Grab, Kenotaph Christi,in zwei verschiedenen Formenvorkommend: 1. Eine Rotundeoder ein Polygon (vor allem inFrankreich) als Nachbildung derGrabeskirche in Jerusalem. 2. Eine→ Tumba (→ *Grabdenkmal) mitdem Leichnam Christi und denFrauen mit Salbgefäßen, manch-mal auch mit Grabwächtern. Engl. Holy Sepulchre; frz. Saint-Sépulcre;it. Santo Sepolcro; sp. santo sepulcro.
Hekal (aram.), Altarraum des salo-mon. Tempels in Jerusalem, auchder Altarraum einer kopt. (ägypt.)Kirche.
Hekatompedon (gr. hundertFuß), Tempelcella, die hundert Fußlang ist.
Helikes (lat.), in einer Volute(Helix) endende Stengel, die aus
geriefelten Blatthülsen (Caulicu-lus) zwischen den Akanthusblät-tern des korinth. Kapitells heraus-wachsen und die Ecken des Abakusstützen. Engl. helix, scroll; it. elice; sp. hélice.
Helm, Helmdach, Dachhelm,Turmhelm, spitze Dachform überpolygonalem Grundriß. AlsH.dach (Dachh.) meist eine Zim-mermannskonstruktion mit → Kai-serstiel, als Turmh. eher massivoder durchbrochen im Steinbau,wobei die Grenzen der Termi-nologie allerdings fließend sind. Engl. timbre; frz. timbre, Turmhelm: flèche,aiguille; it. cuspide, Helmdach: tetto a cuspi-de; sp. remate de cumbrera.
Helmstange → Hahnebaum, Kai-serstiel. Engl. broach post; frz. barre du gouvernail,pivot central; it. monaco centrale; sp. astacentral, espiga c.
Hephaisteion (gr.), ein dem GottHephaistos geweihtes Heiligtum.
Heraion (gr.), der Göttin Herageweihtes Heiligtum.
Herberge, Gasthaus, im Orient→ *Karawanserei, Han, Chan. Engl. inn, hostel; frz. auberge; it. locanda,ostello, albergo; sp. albergue.
Hebefenster 240
(Beispiel: Jerusalem, SalomonischerTempel)
Hekal
Herme (gr.), Bildwerk mit demKopf urspr. des Gottes Hermes oderauch dem ganzen Oberkörper, dersich nach unten in einen verjüng-ten Pfeiler fortsetzt (H.pfeiler).H.pfeiler wurden bes. in der Ba-rockzeit gerne als figürl. Gebälk-träger verwendet. Engl. herm; it. erma;sp. escultura del diosHermes.
Hermenpilaster, ein sich nachunten verjüngender Pilaster, deroben mit einer Figur oder einemKapitell abschließt. It. pilastro ad erma; sp. pilastra de Hermes.
Heroon (gr.), Kultplatz (seltenerein Kulttempel) eines Halbgottes(Heros).
Herrenchor, 1. Teil des Chors, indem die Mitglieder der weltl.Domkapitel und der Kollegiatska-pitel den Chordienst und das Chor-gebet vornehmen. 2. In Zisterzien-serkirchen der an den Stufen zumPresbyterium beginnende und sichvon hier westl. erstreckende, fürdie Konventualen bestimmte Teilder Klosterkirche, dem sich weiternach W. der Chor der Novizen undLaienbrüder anschließt.
Hesarbaf (pers.), dekoratives Back-steinmuster der islam. Baukunst,das durch Senkrecht- und Waag-rechtstellen der Ziegelsteine erreichtwird. Das gleiche Muster kommtauch in Stuck oder in Holz vor.
Hexastylos (gr.), Tempel mitsechs Säulen an der Frontseite(→ *Tempelformen). Engl. hexastyle; it. esastilo; sp. templo grie-go de seis columnas.
Hieratikon (gr.), der erhöhteRaum für die Priester in gr.-ortho-doxen Kirchen, gleichbedeutendmit → Bema. It. bema; sp. sala de sacerdotes de iglesiaortodoxa.
Hilani (assyr. bit hillani), charakte-rist. Form eines hethit. Palasts mitoffener Vorhalle zwischen turm-ähnl. Seitenteilen, also mit einervoll entwickelten Fassade.
Hintermauerung, die Ausmau-erung der Hohlräume hinter einervorgeblendeten Schale aus besse-rem Material, auch das Ausfüllendes Hohlraums zwischen der Ge-wölbeschale und dem aufgehendenMauerwerk. Engl. spandrel, backing; frz. maçonnerie deremplissage; it. muratura di ridosso, m. diriempimento; sp. mompostería de relleno.
241 Hintermauerung
Herme
Hilani (Beispiel:Sendschirli)
Hippodamisches System, dernach dem gr. Städtebauer Hippo-damos von Milet (5. Jh. v. Chr.)benannte regelmäßige Stadtplanmit etwa gleich großen rechtwink-ligen Baublöcken, die von regel-mäßigen Parallelstraßen entgegender alten regellosen Bauweise undim Unterschied zur röm. mit beton-ten Hauptachsen umgeben sind,vielleicht erstmalig bei dem nach479 v. Chr. erfolgten Wiederaufbauvon Milet angewandt und dann aufspätere Städtegründungen vongroßem Einfluß. Engl. Hippodamian system; frz. systèmehippodamique; it. sistema ippodamico;sp. sistema ipodámico.
Hippodrom (gr.), für Pferde- undWagenrennen in einem Tal oderam Fuß eines Hügels angelegteRennbahn im antiken Griechen-land. An den Langseiten und aneiner abgerundeten Schmalseitezogen sich die stufenförmig anstei-genden, unbedachten Zuschauer-plätze hin, während die zweitegerade abgestufte Schmalseite vonden Ablaufplätzen eingenommenwurde. In der Mittelachse derRennbahn waren zwei Wende-säulen (metae) im Abstand vonzwei Stadien (769 m) aufgestellt,die von den Gespannen oderReitern mehrfach umkreist werdenmußten. Im antiken Rom wurde
eine Art Gartenanlage H. genannt,während der → *Zircus an dieStelle des gr. H. trat. Engl., frz. hippodrome; it. ippodromo; sp. hi-pódromo.
Hochaltar → *Altar.
Hochbau, 1. jener Bereich desBauwesens, der sich hauptsächl.mit der Herstellung von Gebäudenbeschäftigt (Gegensatz: Tiefbau).Eine klare Scheidung in Hoch-und Tiefbau ist kaum möglich. 2.Ein sich über die Erde erhebendes,Nutzräume enthaltendes Bauwerk(Gebäude). Engl. 1. superstructure, above-ground con-struction; frz. 1. construction en surface,superstructure; it. 1. edilizia, costruzione difabbricati, c. di soprassuolo; sp. construc-ción en altura.
Hochhaus, allgemein ein Haus mitmehr als fünf Geschossen, in den80er Jahren des 19. Jhs. in denUSA entwickelt für Bürohäuser(House-Insurance-Gebäude in Chi-cago ab 1883 von W. L. Lenneygebaut); in Europa erst nach 1918immer als Bürohaus, seltener fürWohnhäuser, Hotels und Kranken-häuser, diese vermehrt erst seit den1950er Jahren. Stahlrahmen- undStahlbetonkonstruktionen mit ver-tikaler Erschließung durch Fahr-stühle. Das H. ist entweder als
Hippodamisches System 242
Hippodrom
Turm- bzw. Punkth. auf annäherndquadrat. Grundriß oder als Schei-benh. bis zu 300m Länge gestaltet.Durch H.bebauung wird dieStadtsilhouette geprägt. Engl. skyscraper; frz. maison élevée, gratte-ciel; it. edificio multipiano, grattacielo;sp. edificio alto, rascacielos.
Hochparterre, ein Erdgeschoß,dessen Fußboden beträchtl. überdem Gelände liegt, zumeist übereinem → Souterrain. Frz. rez-de-chaussée surélevé; it. piano rial-zato, piano terra r.; sp. planta baja elevada.
Hochrähmzimmerung, Hoch-rähmkonstruktion → Oberrähm-verzimmerung.
Hochrelief, im Gegensatz zumFlachrelief zeigt das H. eine nahe-zu vollplast. Ausbildung der Dar-stellung, die aber noch immer mitdem Hintergrund verbunden bleibt(→ *Relief). Engl. high relief; frz. haut-relief; it. altorilie-vo; sp. alto relieve.
Hochschiffwand → Obergaden.
Hochwacht, Schauinsland, Lug-insland, Lugaus, als Beobachtungs-posten dienendes schlankes Türm-chen auf einer Warte; zu unter-scheiden vom → Scharwachtturm. Engl. barbacan, watch turret; frz. grandecrue; sp. pequeña torre de vigilancia.
Hochzeitshaus → Tanzhaus in ma.Städten. Engl. wedding house; sp. casa para celebrarmatrimonios, c. p. c. bodas.
Hof, 1. Ringsum oder an mehre-ren Seiten von Gebäuden, Gebäu-deteilen oder Mauern umschlosse-ner Freiraum. Der H. kann in-
nerhalb eines Gebäudes (Innenh.,→ *Atrium), vor oder hinter einemgrößeren Gebäude liegen (Vorh.,Hinterh.). Ist der Vorh. an der Ein-gangsseite offen, so spricht manvon Straßenh., beim Barockschloßvon Ehrenhof (→ *Corps de logis).Je nach Art der Gestaltung unter-scheidet man den → *Arkaden-oder Laubenh., den Säulenh. (→ Pe-ristylh.), den Brunnenh. oder Gar-tenh. Der Lichth. ist oft durch einGlasdach geschlossen. Nach seinerVerwendung unterscheidet manWohnh., Wirtschaftsh., Tournierh.,Klosterh. 2. Das → Bauernhauswird allgemein auch Bauernh.genannt, selbst wenn es keineeigentl. H.anlage hat. Eine Sonder-form des Bauernh. ist der rings umeinen H. angelegte → *Vierkanth.(→ *Gehöft). Engl. yard, court; frz. cour; it. corte, cortile;sp. patio interior.
Höhenburg, auf einer Anhöhegelegene → *Burg.
Hoher Mantel → Schildmauer.
Hohe Wand, bei einem Pultdachdie Wand, gegen die das Dach ge-lehnt ist. Engl. high wall; frz.mur haut, m. en hau-teur; sp. muro alto de apoyo a la techumbrede un agua.
Hohlblockstein, großformatigerMauerstein aus einer Betonmi-schung mit Ziegelsplitt, Schlackeoder Bims, der zur Verringerungdes Gewichts und zur Erhöhungder Wärmedämmung Hohlräumehat. In den 1920er Jahren entwik-kelt und nach 1945 weit verbreitet. Engl. hollow block; frz. bloc creux, briquecreuse; it. blocco forato; sp. ladrillo hueco,rasilla.
243 Hohlblockstein
Höhlenkirche, Felsenkirche, inden Felsen gehauene Kirche. Engl. cave church, rock-cut c.; it. chiesarupestre; sp. iglesia rupestre.
Höhlentempel, in den Felsen ge-hauener Tempel, hauptsächl. inÄgypten und in Indien (→ *Fel-sentempel, → *Tschaityahalle). Engl. cave temple, rock-cut t.; it. tempiorupestre; sp. templo rupestre.
Hohlfuge, Fuge, bei der der Mör-tel hiner die Vorderkante der Stei-ne zurücktritt, so daß die einzelnenSteine in der Ansicht scharf her-vortreten. Frz. joint creux; sp. junta abierta, j. hueca.
Hohlkehle, konkaves Zierprofil alswaagerechtes oder senkrechtes Bau-glied, meist gerade, aber auch ge-bogene Linienführung. Profilquer-schnitt aus einem Kreis- bzw.Ellipsensegment. Die H. ist zu-meist Teil eines Gesimses (Kaff-gesims), einer Säulenbasis, auchbei rechtwinklig zusammensto-ßenden Flächen benutzt, auch angot. Portal- und Fensterlaibungen.→ *Gesimsformen. Engl. concave mould, am. concave mold;frz. moulure concave; it. scanalatura, cavet-to, scozia; sp. mediacaña, caveto, garganta.
Hohlmauerwerk → Mauerwerkmit Hohlräumen im Gegensatzzum Vollmauerwerk. Engl. hollow masonry; frz.mur à doubleparoi, double mur; it. muratura a cassavuo-ta, m. a intercapedire.
Hohlpfanne → Hohlziegel.
Hohlspindel, der im Innern einersich frei tragenden Wendeltreppeentstehende Zylinderhohlkörper. Engl. round well; frz. creux d�escalier en co-limaçon; it. pozzo di scala elicoidale; sp. hue-co interior que forma una escalera caracol.
Hohltreppe → *Wendeltreppemit offener Spindel.
Hohlziegel, Hohlpfanne, 1. derLänge nach gebogene Dachziegelder → *Dachdeckung, also die
Höhlenkirche 244
Höhlenkirche(Beispiel: Göreme, Karanlik Kilise,
11. Jh.)
Höhlentempel(Beispiel: Abu Simbel, TempelRamses� II.)
halbzylindrischen First- und Grat-ziegel, die Mönch- und Nonne-Ziegel und die wellenförmigenDachpfannen. 2. Falsche Bezeich-nung für → Gittersteine aus Ton. Engl. hollow brick; frz. brique creuse, tuilec.; it. mattone forato; sp. teja árabe, t. decanal, t. hueca.
Holländischer Verband → *Mau-erwerk, bei dem auf jede Binder-schicht eine Schicht folgt, bei derLäufer und Binder regelmäßigabwechseln. Engl. English cross bond; frz. appareil hol-landais; it. concatenamento olandese, c.fiammingo; sp. trabazón holandesa.
Holm, Griffstange, → Handlauf,dickeres Holz, in das Stäbe (→ *Ge-länder) oder Sprossen (Leiter) ein-greifen (→ *Treppe). Engl. cross beam, transom; frz. quille,chape, lisse, travon, chapeau; sp. travesaño.
Holzbalkendecke, mit Zwischen-räumen verlegte Balken, die mitZwischendecken geschlossen wer-den, entweder als Windelboden, beidem mit Strohlehm umwickelteStakhölzer in Nuten an den Balken-seiten eingeschoben werden, oderals Einschubdecke, bei der auf die anden Balkenseiten genagelten Leistender Einschub oder Fehlboden (Bret-ter, Schwarten, Gipsdielen) gelegtwerden, darauf Lehm, Sand oderSchlacke als Schall- und Wärme-schutz. Bei H. wird die Deckenun-tersicht entweder verputzt oder ver-schalt oder die Balken bleiben sicht-bar. Bei verputzten H. wird an dieBalkenunterseite ein Putzträger(Rohrgeflecht, Leichtbauplatten,Drahtgewebe) genagelt und verputzt.Engl. wood-beam ceiling; frz. plafond enpoutre caisson; it. soffitto di travi di legno;sp. cielorraso con vigas de madera.
Holzbau, der ma. H. wird nachkonstruktiven Merkmalen in Mas-sivbau und Skelettbau geschieden.Im Massivbau kennen wir in denAlpenländern und in Nordosteu-ropa den → *Blockbau oder Schrot-bau, bei dem liegende, behaueneoder unbehauene Hölzer zu tra-genden Wänden geschichtet sindund durch mehr oder weniger kom-plizierte Holzverbindungen zu-sammengehalten werden; in Nord-und Mitteleuropa kennen wir den→ Palisadenbau, bei dem eingegra-bene Hölzer, und den → *Ständer-bau und → Stabbau, bei dem aufSchwellen aufgesetzte senkrechteHölzer die tragende Wand bilden.Beim Skelettbau besteht das tra-gende Gerüst aus untereinanderverbundenen, senkrechten, waage-rechten und schrägen Hölzern; dievon ihnen eingeschlossenen Ge-fache sind beim → Ständerbohlen-bau mit aussteifenden Holzbohlenund im → *Fachwerkbau mit fle-xiblem Material (lehmbeworfe-nes Flechtwerk, Mauerwerk ausBruch- oder Backstein) geschlos-sen. Die beim südwestdt. H. anzu-treffende Mischbauweise bezeugtdie enge Verwandtschaft zwischenStänderbohlenwand und Fach-werkwand. In den europ. Land-schaften, in denen langwüchsigeNadelhölzer, vor allem Lärche undFichte, vorherrschen, entwickeltsich der Blockbau; der Fachwerk-bau hingegen in den Landschaftenmit überwiegendem Laubholz-vorkommen. Engl. timber-work, wooden structure;frz. construction en bois; it. carpenteria, cos-truzione in legno; sp. construcción de ma-dera.
Holzbrücke → *Brücke.
245 Holzbrücke
Holzdübel → *Dübel.
Holznagel, im Fachwerkbau zurVerbindung von Hölzern (bes.Blatt- und Zapfenverbindungen)in vorgebohrte Löcher stramm ein-getriebene zylindr. oder prismat.,stumpf zugespitzte Holzstifte aushartem, zäh-last. Holz (Ahorn,Salweide). Der aus der Holzflächevorstehende Kopf bleibt stehen,um bei Trocknungsschwund einNachtreiben zu ermöglichen. Engl. (wooden) pin, stake, plug; frz. chevillede bois, it. chiodo di legno, cavicchio; sp. ta-rugo de madera.
Holzpflaster, aus Hart- oderWeichhölzern bestehendes Pflaster,das mit der Hirnholzfläche nachoben verlegt wird und sich durchStaubfreiheit, schwache Geräusch-bildung und hohe Beanspruchbar-keit auszeichnet, als Straßenpflasteroder für Innenräume (Turmhallen,Schulen usw.) verwandt. Engl. wood (-block) paving; frz. pavé enbois, pavage en b.; it. pavimento di bloc-chetti di legno; sp. pavimento de madera.
Holzverbindungen, technischeGrundlage der Holzkonstruktionim Holzbau. H. dienen zur zim-
Holzdübel 246
Tischlermäßig
Winkelverbindungen:1 Verzinkung (offene) 2 Gehrung
Verbreiterungen:3 gerader Stoß4 Gratspundung5 halbe Spundung6 Nut und Feder
7 eingeschobene Feder8 Einschubleiste bündig9 Einschubleiste mit Nut auf Grat
ZimmermannsmäßigVerstärkungen:
10 Verschränkung11 Verzahnung12 Verdübelung13 Verdübelung mit Zahndübeln
Holzverbindungen
mermannstechnischen Verlänge-rung (Stoß, Blatt), Verbreiterung(Spundung, Nut und Feder), Ver-dickung (Verdübeln, Verzahnen,Verschränken), Winkelverbindungin einer Ebene (Stoß auf Gehrung,Blatt, Zapfen, Versatzung, Verzin-kung) und Winkelverbindung nichtin einer Ebene (Kamm, Seitenzap-fen, Klaue), auch mittels bes. Befe-stigungsmittel (Leim, Dübel, Me-tallelemente wie Schrauben, Nägel,Klammern). Im ingenieurmäßigenHolzbau werden die einzelnenKonstruktionsglieder an Knoten-
punkten zusammengeführt unddort bei geringeren Belastungendurch berechnete Nagelungen odereinfache Bolzen mit breiten Un-terlegscheiben verbunden. Bei weitgespannten Konstruktionen mithohen Belastungen in den Verbin-dungsstellen wird die Sicherheitgegen Abscheren außer der Verbol-zung durch eingepreßte Dübeloder durch Verleimung der Verbin-dungsstellen erreicht. Frz. assemblage de bois; it. collegamentodel legno; sp. ensambladura, ensamblaje,ensamble.
247 Holzverbindungen
Verlängerungen:14 Aufpfropfung mit Kreuzzapfen15 Aufpfropfung mit eisernem Dorn16 englische Aufpfropfung17 Stoß mit verkeilter Hakenlasche18 gerades Blatt mit schiefem Stoß19 schiefes Blatt20 gerades Heckenblatt mit Keilen
Kreuzungen:21 Überschneidung22 Überblattung
23 einfacher Kamm24 Verklauung
Abzweigungen:25 einfaches Blatt26 Weihschwanzblatt27 Schwalbenschwanzblatt28 schiefe Brüstung mit Rast29 Schlitzzapfen30 Scherzapfen31 einfacher Versatz32 Fersenversatz
Horizontalbogen → *scheitrech-ter Sturz, scheitrechter Bogen.
Horizontalschub, nach außen ge-richteter Schub, horizontale Kom-ponente des schräg nach untengerichteten Kämpferdrucks einesBogens, eines Gewölbes oder einerDachkonstruktion, der durch an-schließendes Mauerwerk (→ *Stre-bewerk), Zugbalken, oder Zugan-ker (→ *Anker) aufgenommen wird.Engl. horizontal thrust; frz. poussée latérale,p. horizontale; it. spinta orizzontale; sp. em-puje horizontal.
Hornbogen, ansteigende einhüf-tige (halbe) → *Gewölbeform.
Hornkonsole, Konsole, deren un-tere Endigung hornförmig umge-bogen ist. Die H. kommt meist un-ter Diensten und Gewölberippen,bes. in Zisterzienserklöstern, vor.
Hornwerk, zur Sicherung desGlacis angelegtes, mit der Kurtinedurch lange, parallele Flügel ver-bundenes, hornförmiges (zwei hal-be Bollwerke mit Kurtine verbun-den) Außenwerk (Ravelin, Redan);ein gekröntes Hornwerk ist einHornwerk mit vorgelagertemKronwerk.
Horreum, röm. Speicher-, Maga-zin- oder Lagergebäude für Warenaller Art, zumeist aber Kornspei-cher für öffentl., militär. oder pri-vate Zwecke zur Sicherung derKornversorgung der Städte undder Truppe. Zumeist lagen dieGebäude (cellae) an drei oder vierSeiten um einen mittleren Fluroder Hof, bei größeren Anlagenmit einem Säulen- oder Stützen-umgang, auch zweistöckig.
Hosenscharte, Doppelscharte,Zwillingsscharte, für verschiedeneWaffen geeignete Schießscharte mitzwei schräg geführten Scharten-röhren und einem gemeinsamenScharteneingang.
Hospital (lat. hospes: der Gast),Hospiz, Spital, Krankenhaus, Al-tersheim, auch Herberge in Städ-ten und Klöstern, entweder alsHerberge der Klöster und Stiftemit Infirmerie nur für Kloster-insassen, bürgerl. H. der Stadt oderprivater Stifter, häufig als Pfründ-nerhaus bezeichnet, Pilger- undFremdenhospitäler (Elendsherber-gen, → Hospize), Armen- und Seel-häuser (Gotteshäuser) und schließ-lich Leprosien- und Pesthäuser füransteckende Kranke, zumeist vorder Stadt. Den Mittelpunkt bildeteim MA. zunächst eine große nichtunterteilte Halle. Später wurdeninnerhalb der Halle Kojen einge-baut, die oben offen sind. Engl.; sp. hospital; frz. hôpital; it. ospedale.
Hospiz (lat.), urspr. Bezeichnungfür ein → Gasthaus, das von Mön-chen in einsamen Gegenden oderneben Klöstern für Reisende oderPilger zur Beherbergung einge-
Horizontalbogen 248
ma. Hospital
richtet wurde, neuerdings gleich-bedeutend mit Herberge, Pension,auch Hotel kirchl. Organisationen,schließl. synonym mit → Hospital. Engl., frz. hospice; it. ospizio; sp. hospicio,hospedería.
Hotel (frz. v. lat. hospitale), → Gast-haus mit mehr als 20 Betten, klei-nere Anlagen werden Gasthof oderPension genannt. Das Aufkommendes H. steht in Verbindung mit derEntwicklung des Reiseverkehrs.Im MA. → Herberge, dann Gast-hof, seit dem 19. Jh. repräsentativeBauten in der Nähe von Bahnhö-fen und Schiffanlegestellen mit zu-sätzl. Einrichtungen wie Gesell-schaftsräume, Schreib-, Lese- undSpielzimmer, die Zimmer sindheute zumeist mit Bad und WCversehen. H. auch außerhalb derStädte gelegen und für längereAufenthalte.
Hôtel (frz.), Adelshof, seit dem 17.Jh. in Frankreich Stadthaus derAdeligen oder Absteige für Mön-che eines Klosters (→ Pfleghof); einCorps de logis bildet mit schmä-leren Flügeln einen Hof, der zurStraße hin von einer Mauer, einemGitter oder einem Wirtschaftsbaumit mittlerem Eingangstor abge-schlossen ist. Dann allgemein fürpalastartige Gebäude: H. de ville(Rathaus), H.-Dieu (Kranken-haus), → Hotel. Sp. edificio palaciego.
Hourdidecke, massive Deckeohne Eiseneinlagen, bei der geradeoder gebogene Hourdis (Decken-hohlsteinplatten aus gebranntemTon) dicht nebeneinander zwischenI-Träger ohne Unterschalung ver-legt werden. Die Auffüllung bis zurTrägeroberkante geschieht in Ma-ger- oder Leichtbeton. Zunächst inFrankreich u. Italien, seit etwa 1880auch in Deutschland hergestellt. Engl. hollow clay block floor; frz. plancher àhourdis; it. solaio a tavelloni curvi; sp. cie-lorraso curvo tipo hourdi.
Howeträger, ein zwei- odermehrteiliges Ständerfachwerk, beidem sich die aus Holz bestehendenSchrägstützen mittels bes. Stemm-klötze oder Schuhe stumpf gegendie hölzernen Gurte stemmen; dieKreuzstreben sind auf Druck bean-sprucht, durch lotrechte Hänge-stangen mit Schraubengewindekann der H. künstl. angespannt wer-den, um ein Durchhängen zu ver-meiden. In den USA seit 1840 häu-fig angewandt, in Europa bis zum1. Weltkrieg, bes. für den Brük-kenbau. Frz. poutre droite Type How; sp. viga tipoHowe.
Hti, Ti, Tee (birmes.), Bezeich-nung für den schirmförmigen Ab-schluß eines → *Stupa.
Hubbrücke, Hebebrücke (→ Brük-ke).
Hufeisenbogen, unten verengter,meist anschwellender Rund- oderSpitzbogen, bes. in der islam. Bau-kunst Spaniens und Nordafrikas seitdem 9., in Vorderasien seit dem 4.Jh.nachweisbar (→*Bogenformen).Engl. horseshoe arch; frz. arc en fer à cheval,arc outrepassé; it. arco a ferro di cavallo;sp. arco árabe, a. herradura.
249 Hufeisenbogen
Hotel(Beispiel: Paris, Hotel Soubise, 18. Jh.)
Hügelburg → Motte.
Hundszahn, Ornament der engl.Frühgotik aus einer Reihe vierzak-kiger Sternchen, die auf der Spitzestehen und pyramidenförmig auf-liegen, dazwischen auch Blattfor-men zur Bereicherung von Profi-lierungen, bes. von Gesimsen undFriesen. Engl. dogtooth ornament; it. dente di cane;sp. adorno diente de perro.
Hurde, Hurdengalerie, auf ausge-kragten Balken oder Konsolen lie-gender hölzerner → *Wehrgangmit Senkscharten an Wehrmauernund Türmen des MA. Frz. hourd; it. incastellatura; sp. tribuna.
Hütte, 1. ein mit einfachsten Mit-teln ausgeführter und bedeckterSchutzbau als Zufluchtsstätte, pri-mitiver Wohnbau oder Lager. 2. AlsKurzform gebräuchl. Bezeichnungdes Gebäudes bzw. eines Werks derErz- und Glasveredelung. 3. ImBes. die Bauhütte, urspr. der über-deckte Arbeitsplatz der Stein-metzen an einer Großbaustelle,dann allgemein die Bauverwaltungals Gebäude und Organisation. Engl. hut, cabin, lodge, shed; frz. hutte,loge, échoppe; it. capanna, casupola; sp. ca-baña.
Hypäthraltempel, Hypäthros (gr.unter freiem Himmel), Tempel, des-sen Cella nicht überdeckt ist. Diese
von Vitruv überlieferte Tempelformist nur bei größeren Bauten ohneinnere Stützenstellungen verständl.,deren lichte Spannweite der Cellazu groß war, um mit den damalsbekannten Zimmermannskonstruk-tionen überdeckt zu werden. Engl. hypethral temple; frz. temple hypêtre;it. tempio ipetro, t. ipetrale; sp. templo ipetral.
Hypogäum (gr. unter der Erde),unterird. Grabbau. Bekannt sindHypogäen der Etrusker in Italien,die aus einer Hauptkammer mitNebenkammern oder aus verschie-denen Grabkammern bestehen kön-nen. Engl. hypogeum; frz. hypogée; it. ipogeo;sp. hipogeo.
Hypokausten, Hypocaustum (gr.-lat.), Fußbodenheizung der röm.→ Thermen, vornehmer Wohn-häuser, Villen und Paläste, haupt-sächl. in den kälteren Provinzendes Imperiums. Die Anlage bestehtaus einem kleineren Heizraum(Praefurnium) am äußeren Randdes zu beheizenden Raums, dessenBoden auf 2�3 Fuß hohen Back-steinpfeilern steht, zwischen denen
Hügelburg 250
Hypäthraltempel (Beispiel: Didyma, Apollotempel) A Adyton
Hypogäum
die Warmluft zirkuliert und denBoden erwärmt. Mit der Boden-heizung kann eine Wandheizungverbunden sein, wobei die Warm-luft in senkrechten Tonkanälen(Tubuli, Zubuli) aufsteigt. Fehlendie Zubuli, so wird die Warmluftüber Schornsteine abgeleitet. ImMA. wurde diese Warmlufthei-zung noch bei Klosterbauten ange-wandt (→ *Calefactorium), dieTürken verwandten sie bei ihrenBädern (→ *Hammam). Engl. hypocaustum; frz. hypocauste; it., sp.ipocausto.
Hyposkenion (gr.), Unterbühneim gr. → Theaterbau.
Hypostyl (gr.), Innenraum (selte-ner Vorhalle) mit Säulen. NachVitruv eine Säulenhalle mit belich-tetem Mittelschiff (→ ägyptischerSaal). Engl. hypostyle hall; frz. hypostyle; it. ipo-stilo; sp. hipóstilo.
Hypotrachelion, Epitrachelium(gr., lat.), Hals am Kapitell. AlsVerbindung zwischen Schaft undKapitell ist das H. meist mit demKapitell aus einem Block gearbei-tet. Ist der Schaft kanneliert, so istzumeist auch das H. mit Kanne-
luren versehen. Das an der dor.Säule meist durch die Anuli unddurch eine Rille umgrenzte H. istan der dor. Ante häufig durch Pro-filbänder hervorgehoben. In der ion.Ordnung als ornamental durchge-staltetes Band, in der korinth.Ordnung häufig durch ein Astragalgekennzeichnet. Im 5. Jh. v. Chr.seltener, in der hellenist. und röm.Baukunst häufiger. Engl. hypotrachelum; it. ipotrachelio; sp. epi-traquelión.
I
Idealplan, Planung eines Bau-werks nach rein ästhet. Gesichts-punkten, aber so, daß eine Verwirk-lichung nicht ausgeschlossen ist. Engl. ideal plan; frz. plan idéal; it. pianta ide-ale; sp. plan(o) ideal.
Idealstadt, Planung einer Stadtnach ästhet., geometr. und orna-mentalen Prinzipien, wobei auchnoch religiöse Vorstellungen mit-sprechen können. Sie ist schwerabzugrenzen gegen die regelmäßigangelegte (»gegründete«) Stadt(→ *Stadtbaukunst). Der Gedankeder I. wird in der Renaissancezeitdurch Filaretes Werk Sforzinda neubelebt, das eine I. mit radialen Stra-ßen und einer sternförmigen Um-rißkontur propagiert, die an die Stel-le Mailands treten sollte. I.pläneentwickelten auch die ItalienerFrancesco di Giorgio, Peruzzi, Mag-gi und Scamozzi. Realisiert wurdeallerdings nur das Projekt von Pal-ma Nuova bei Udine. In Deutsch-land ist ein I.entwurf von AlbrechtDürer aus dem Jahre 1527 bekannt,
251 Idealstadt
HypokaustenA Ziegelpfeiler B Tubuli, Zubuli
der einen quadrat. Schloßbau imZentrum einer quadrat. Stadt vor-sieht. Der Straßburger DanielSpeckle sah 1589 das I.problemunter dem Gewichtswinkel desFestungsbaus (Architectura vonFestungen), während HeinrichSchickhardt 1599 ein I.projekt in
Freudenstadt realisieren konnte,das nach dem Mühlbrettschemaangelegt wurde. 1650 entwickelteJoseph Furttenbach d. J. in derSchrift »Gewerb-Statt-Gebäw« ei-nen langgestreckten polygonalenGrundriß mit Sternschanzenbe-festigung, in dessen MittelpunktSchule, Kirche, Rathaus und Zeug-haus angeordnet sind. In Frankreichhaben Ducerceau und JacquesPerret I.projekte entworfen, letzte-rer eine polygonale, sternförmigeStadt mit einer kleineren, ebenfallssternförmigen Zitadelle als Kopf.Dieses Planbild kehrt beim Aufbauvon Mannheim wieder, hat aber imGegensatz zu Perrets I. keine radi-ale Straßenführung, sondern einSchachbrettsystem rechtwinkeligerStraßenkreuzungen. Auch die Ba-rockstadt fußt noch auf der Ideeder I., wofür Karlsruhe mit seinemZirkel, der Stadt und Park gleichar-tig bestimmt, das hervorragendsteBeispiel ist. Engl. ideal city; frz. ville idéale; it. cittá ide-ale; sp. ciudad ideal.
Ikonostasis, Ikonostase, (gr.) Bil-derwand zwischen Altar- und Ge-meinderaum einer orthodoxenKirche, mit einer oder drei Türen,neben und über denen sich inmehreren Rängen Ikonen befin-den. Die Haupttür mit Vorhang,der während des Gottesdienstesauf- und zugezogen wird, führt indas Allerheiligste, die Nebentürenin kult. Nebenräume (→ Prothesis,→ Diakonikon). Die geschlosseneBilderwand hat sich erst im Verlaufdes MA. im griech.-byzantin. Raumentwickelt aus der Altarschranke,die aus einer Säulenstellung mitGebälk und Brüstungsplatten be-stand und durch Vorhänge, Gitter
Ikonostasis 252
Idealstadt
(Beispiel: Freudenstadt, um 1600)
(Beispiel: Mannheim, 17. Jh.)
(Beispiel: Karlsruhe, 18. Jh.)
oder Bilder verschließbar war. Im16. Jh. begann man, die I. mit rei-chen Schnitzereien auszustatten,die im 17. /18. Jh. in Rußland, aufdem Balkan und in den Athosklö-stern die Bilder (Ikonen) in ihrerWirkung hinter die prunkvolleAusbildung des Rahmenwerks zu-rücktreten ließen. Engl. iconostasis; frz. iconostase; it. icono-stasi; sp. iconostasio.
Imaret, islam. Armenspeisehausfür bedürftige Schüler und Stu-denten, das als Stiftung bei Mo-scheen und Medresen als langge-streckter, eingeschossiger, schmuck-loser Bau angelegt wird; seit dem14. Jh. bekannt. Sp. comedor para estudiantes necesitados.
Imbrex (lat.), mit der konkavenSeite nach oben verlegter Hohlzie-
253 Imbrex
Ikonostasis
gel, Nonne (→ Mönch- und Non-nendach). → *Dachdeckung. Engl. imbrex; it. embrice; sp. forma de col-car tejas árabes, f. d. c. t. huecas, f. d. c. t. decanal.
Immunitätsbau, innerhalb einerKloster-, Stifts- oder Bischofs-Im-munität errichtetes Gebäude, bes.die Wohngebäude der Kanoniker.
Impluvium (lat.), Bassin zurAufnahme des Regenwassers im→ *Atrium des röm. Hauses.
Industriebau, Gesamtheit derGebäude eines Industrieunterneh-mens: die für die reinen Produk-tionsvorgänge bestimmten Gebäu-de, Montage- und Lagerhallen,Forschungslabors, Verwaltungsbau-ten und Bauten für soziale Einrich-tungen. Anordnung und Ausstat-tung müssen den rationellen undfunktionellen Anforderungen desIndustrieunternehmens gerechtwerden. Sie haben sich seit der in-dustriellen Revolution in Englandseit dem Ende des 18. Jhs. und inden übrigen Industrieländern seitdem 19. Jh. als eigenständige An-lagen für die maschinell betriebeneProduktion entwickelt (Spinn-maschine 1775, Dampfmaschine1785), zunächst einfache Hallen-bauten, aber auch monumentaleFrontausbildung in Anlehnung anSchloßfassaden u.ä. und unter An-wendung histor. Formen. DieHallen selbst in Holzfachwerk,Gußeisen, Stahlskelettbau in An-lehnung an die Ausstellungs- undBahnhofshallen entweder als großeebenerdige Hallen, oder auch alsGeschoßbau, seit 1908 funktionelleGestaltung, seit den 1920er Jahreninternational verbreitet, eine Füllevon Bautypen, Gestaltungs- und
Konstruktionsweisen abhängig vondem Produktionsablauf und zeitl.Baustilströmungen. Engl. industrial building; frz. constructionindustrielle; it. costruzioni industriali;sp. construcción industrial.
Infirmarie, Infirmaria, Kranken-haus (Hospital) in einem Klosterfür kranke Mönche (→ Firmarie). Engl. infirmary; frz. infirmerie; it. infermeria;sp. enfermería u hospital de un monasterio.
Inkrustation (lat.), Bekleidungaus verschiedenfarbigen Blendstei-nen von Wänden und Fassaden, dieoft in Anlehnung an konstruktiveVorbilder rein ornamental ange-bracht sind (Bauornament). Be-kannt sind die → *Cosmatenar-
Immunitätsbau 254
(Beispiel: Lorsch, Torhalle, 8. Jh.)
Inkrustation
(Beispiel: Florenz, S. Miniato al Monte,12. Jh.)
beiten sowie die I. an Bauten derProtorenaissance in Italien. Engl., frz. incrustation; it. incrostazione;sp. incrustación.
Inkubationsraum, Raum für denTempelschlaf in antiken Heilbä-dern.
Innenmauern, Innenwände, sinddie Mauern im Inneren eines Bau-werks im Gegensatz zu den Au-ßenmauern (Umfassungsmauern).Man unterscheidet Mittelmauer,Trennmauern und Zwischenwän-de. Engl. inner walls, interior walls; frz. mursintérieures; it. muri interni; sp. muros inter-medios, m. interiores.
Insula (lat.), 1. ein rings von Stra-ßen eingeschlossener Häuserblockin der antiken Stadt. 2. Gegen Endeder röm. Republik die Bezeich-nung für ein aus mehreren Woh-nungen bestehendes Mietshaus, imErdgeschoß mit Laden oder Werk-statt, darüber drei bis sechs Ge-schosse.
Intarsia (lat.-it.), Marketerie, Ein-legearbeit aus verschiedenfarbigenHolzfurnieren, die zu ornamenta-len oder figürl. Mustern zusam-mengesetzt werden. Dabei könnenauch andere Materialien (Stein,Elfenbein, Perlmutt usw.) Verwen-dung finden. Frz. intarse; it. intarsio; sp. trabajo de mar-quetería.
Interkolumnium (lat.), Säulen-abstand, gemessen von Säulen-achse zu Säulenachse. Das Verhält-nis des Säulendurchmessers zum I.ist mitbestimmend für die Wir-kung der Architektur. Je nach dem
Verhältnis von I. zu unterem Säu-lendurchmesser (gleich zwei Mo-duli) unterscheidet Vitruv verschie-dene Proportionen: dichtsäulig(→ pyknostylos, engsäulig), weit-säulig (→ diastylos), schönsäulig(→ eustylos), lichtsäulig (→ aräo-stylos), gedehnt (→ systylos). Engl. intercolumniation; it. intercolunnio;sp. intercolumnio, espacio entre dos co-lumnas.
Ionische Ordnung, etwa gleich-zeitig mit der → *Dorischen Ord-nung im ionischen Gebiet ausge-bildete Säulenordnung im antikengr. Tempelbau, die ein tekton. Ge-rüst mit abstrahierten vegetabili-schen Schmuckformen verbindet,wobei oriental. Einflüsse verarbei-tet werden (äolisches Volutenka-pitell des 6. Jhs. v. Chr.). In derEntwicklung sind zu unterschei-den die urspr. kleinasiat. I. O., deratt. Mischstil und der hellenist.Spätstil. Die I. O. besitzt einen grö-ßeren Variantenreichtum als diedor. Ordnung. Auf dem Funda-
255 Ionische Ordnung
Interkolumnium1 pyknostylos3 eustylos
2 systylos4 diastylos
5 aräostylos (u. D.=unterer Durchmesser)
ment (Stereobat) mit der oberenGeländeausgleichschicht (Euthyn-teria) wie in der dor. Ordnungerhebt sich ein Stufenbau, der imkleinasiat. Stil zwischen wenigenflachen Stufen und vielen hohenStufen schwankt. An Stelle desDreistufenbaus kann ein Podiumtreten mit einer Freitreppe in derBreite der Eingangsseite. Auf derobersten Schicht des Unterbaus(Stylobat) stehen die Säulen mitihrer Basis aus mehreren Scheiben,flachen Trommeln mit schwellen-dem oder eingezogenem Profil(Torus oder → Trochilus), beidehorizontal geriefelt oder glatt, auchmit Blattkränzen an Stelle desTorus, schließl. allgemein eine Ver-bindung von quadrat. Platte (Plin-the), doppeltem Trochilus undgeriefeltem Torus. Die Umrissedes Profils sind niemals Kreisbö-gen, sondern straffere Linien, dieihre Krümmung am oberen Endesteigern. Der Säulenschaft läuft zurBasis mit Plättchen und Rundstabab, der Antenschaft nur mit demPlättchen. Der Säulenschaft, urspr.mit sehr vielen schmalen Riefelun-gen (Kanneluren) ohne Steg verse-hen, hat deren später in der Regel24, die durch schmale Stege von-einander getrennt sind. Die Riefe-lungen sind tiefer als im Dor. undendigen im unteren und oberenAblauf mit Halbkreisbögen. Obereund untere Schaftenden weisenzuweilen bes. Schmuck auf: figürl.Plastik unten und reich ornamen-tierte Halsbänder oben. Über demmeist als Perlstab ausgebildetenRundstab des oberen Schaftablaufssetzt das Kapitell mit einem Polster(Echinos) auf, das wie ein Sattel-holz in der Längsrichtung über denSchaft vorspringt und sich dann
einrollt. Die spiralige Einrollung mitihren Schnecken (Voluten) um-gibt das oft mit einer Rosette ge-schmückte Auge. Vereinzelt wird dieganze Volutenscheibe zur Rosette.Zunächst ist das Polster auf denLangseiten konvex, später konkav(canalis); die trommelartigenSchmalseiten, urspr. glatt, werdenspäter mehrfach eingeschnürt, auchmit Schuppen oder Blättern ge-schmückt. An den Ecksäulen stoßendie Frontseiten rechtwinklig zu-sammen und die Eckvolute biegtdiagonal um. Die Seitenpolster sto-ßen in der inneren Ecke ohne Lö-sung mit Verschneidung zusammen.Der folgerichtige weitere Schritt,dem Kapitell an allen Seiten Schnek-ken zu geben und diese alle an denEcken unter 45° herauszudrehen,wird im att. Mischstil und imHellenismus öfter getan. Das be-deutet Annäherung an das korinth.Kapitell. Den oberen Abschluß desion. Kapitells bildet eine dünneviereckige Abakusplatte, die Wellen-profil mit Blattmustern (lesbischesKyma) ziert. Bei der Ante bestehtdas Kapitell an der Frontseite ausdrei Blattreihen mit Plinthe, seitl.aus drei Schnecken oder daraus ab-geleiteten Gebilden. Die Höhe derganzen Säule beträgt in der klass.Zeit 10 untere Durchmesser, die äl-teren Säulen sind zum Teil erhebl.schlanker. Auf den Säulen liegt derArchitrav, in drei, auch zwei Hori-zontalstreifen (Fascien) gegliedert,die nach oben immer weiter vor-springen. Ein Abschluß aus Perlstabund Eierstab gibt diesem Baugliedseine Selbständigkeit gegenüber derdarauffolgenden Decke. Die Deckebesteht aus dem kräftigen Zahn-schnitt (Geisipodes), der ebenfallseinen oberen Abschluß durch ein
Ionische Ordnung 256
ähnl. Kymation wie der Architraverhält (Kranzgesims, Geison). DieTraufleiste, Sima, im wasserspeien-den Löwenköpfen von engemRhythmus schließt das Gebälk ab.Das Ornament der Sima ist einRankengebilde, während die Gie-belsima, der die Speier fehlen, mitReihungen verschiedener Palmet-ten geschmückt ist. Der att. Misch-stil (seit 5. Jh. v. Chr.) unterschei-det sich vor allem durch den Friesim Gebälk (→ dorische Ordnung)an Stelle des Zahnschnitts. Mitdem Wachsen des Gebälks werdendie Säulen dicker, also gedrunge-ner. Als att. Sonderform für die Ba-sis entsteht eine Kombination vonTorus, Trochilus und Torus ohnePlinthe. Im Kapitell fällt die Mäch-tigkeit der Schnecken auf. DerSpätstil (ionisch-attische Ordnung)bietet eine Vereinigung aller Moti-ve � so von Figurenfries und Zahn-schnitt. An Stelle des Figurenfriesesbegegnet öfter ein Bukranienfries.Die Säulen sind auch hier gedrun-
gener als im klass. Stil. Es ist diesdie Weise, die von Vitruv überliefertwird (→ *Säulenordnung). Engl. Ionic order; frz. ordre ionique; it. or-dine ionico; sp. orden iónico.
257 Ionische Ordnung
1 Schaft mit Kanneluren
2 Volute (Eckform)3 Echinus mit Eierstab4 Kanalis 5 Abakus
6 Faszien7 Eierstab und
Perlstab8 Zahnschnitt9 Sima mit
Wasserspeiern
Ionische Ordnung � Attischer TypusIonische Ordnung �
Kleinasiatischer Typus 1 Stereobat 2 Basis3 Schaft mit
Kanneluren4 Volute (Eckform)5 Volute (Normalform)6 Hals 7 Epistyl (Architrav)
8 Faszien9 Astragal und
Blattwelle10 Zophoros11 Geison12 Sima13 Tympanon14 Akroterion
Irimoya-Dach, Dach des japan.Hauses oder Tempels von stark ge-schwungener Kontur in der Grund-form eines Fußwalms (→ Dachfor-men).
Isometrie, axonometr. Darstellungeines Objekts ohne Verkürzungen,meist so, daß die Kontur desEinheitswürfels die Form desregelmäßigen Sechsecks annimmt(→ *Projektion). Engl. isometric projection; frz. isométrie;it. isometria; sp. isometría, proyección iso-métrica.
J
Jagdschloß, ein nicht zum ständi-gen Wohnen eingerichtetes Schloßfür vorübergehenden Aufenthalt inhäufig besuchten Jagdrevieren, häu-fig kleinere zentralisierte Anlagenmit einer größeren Zahl von regel-mäßigen Appartements mit einemgemeinschaftl. Saal, auch recht klei-ne Anlagen ohne Nebengebäude seitder Renaissance, im Barock im Zen-trum von sternförmig angelegtenSchneisen, Wegen und von Pavil-lons umgeben; Innendekorationnach einem auf die Jagd bezogenenikonograph. Programm; im 19. Jh.durch romantisierende Neugotikauf unregelmäßigem Grundriß ma-ler. gestaltet. Ende des 19. Jhs. trittan die Stelle des J. die Jagdhütte. Engl. hunting castle; frz. château de chasse;it. castelletto di caccia; sp. pabellón de caza.
Jagdzapfen, zusätzl. abgeschrägterZapfen zum nachträgl. Einbau vonVerstrebungshölzern (→ Schleif-zapfen). Frz. tenon à chasse; it. tenone obliquo; sp. es-piga oblicua.
Jalousie (frz.), Sonnenschutzvor-hang aus schmalen Lamellen, diean Schnüren geführt heraufgezo-gen und um ihre eigene Achsegedreht werden können. Engl. jalousie,Venetian blind; it. veneziana;sp. celosía, persiana.
Joch, bezeichnet in der Baukunstden zwischen zwei Hauptstütz-punkten einer Baukonstruktionbefindl. Bauabschnitt (Brückenj.,Gewölbej.), bei Zimmerleutenjedes waagerechte Holz auf zweisenkrechten Hölzern. Im Gewöl-bebau der einem Gewölbefeld ent-sprechende Raumteil auf vier Stüt-zen innerhalb einer Folge gleichar-tiger Gewölbeabschnitte, die inRichtung der Längsachse gezähltwerden, oft durch Gurtbogen vonden auf der Hauptachse angren-zenden Gewölbej. oder in einerHallenkirche durch Scheidbogenvon den Seitenschiffen getrennt. Engl. bay; frz. travée; it. campata; sp. través.
Joch, römisches, → Tabularium-motiv.
Judenbad → Mikwe.
Junger Dienst, weniger betonter,dünnerer Dienst eines → *Bündel-pfeilers im Gegensatz zum AltenDienst. It. aletta del piliere; sp. columna delgadaembebida.
Jupitersäule, säulenförmiges Mo-nument der Römer, das mit einer
Irimoya-Dach 258
Joch
Statue des Gottes Jupiter gekröntwar. Frz. colonne de Jupiter; it. colonna di Gio-ve; sp. columna de Júpiter.
K
K siehe auch unter »C«.
Kabinett, kleines Gemach, Ne-benzimmer; abgeschlossenes Be-sprechungszimmer und Arbeits-raum eines Fürsten oder Ministers;Spielzimmer, Raum zur Aufbe-wahrung von Sammlungen undBildern (K.stück). Engl., frz. cabinet; it. gabinetto; sp. gabinete.
Kachel, urspr. alle Produkte ausgebranntem Ton, eigentl. aber nurdie Erzeugnisse aus poröser Masseim Unterschied zur dicht gebrann-ten → Fliese. Heute allgemein nurdie außen glasierte K. zur Beklei-dung von Öfen, entweder flach(Flachk.) oder gemuldet (Napfk.),glasiert oder matt. Seit dem 9. Jh.nachgewiesen, seit dem 13. Jh. weitverbreitet. Engl. tile; frz. carreau; it. coccia, piastrella(di maiolica); sp. azulejo.
Kafehte → Cavate.
Kaffenster, Kappfenster, Dach-luke, die von einem Hohlziegel(Kaffziegel) mit halbkreisförmigerÖffnung überdeckt wird. Engl. dormer window; it. finestra a lunetta;sp. ventana de medio ojo, v. d. medio punto.
Kaffgesims, Kaffsims, Gesims aneinem Absatz, der Kaffung, bes. angot. Strebepfeilern, aber auch als
Stock- oder Sohlbankgesims, dasdie Mauer horizontal gliedert(Gurtgesims) und über den Stre-bepfeilern verkröpft ist. → *Ge-simsformen. Engl. drip moulding, weathering; sp. decli-ve de derrame, moldura cortagoteras.
Kaffziegel, Kappziegel, Dachziegelmit hohlem Aufsatz, dessen vorde-re Öffnung als → Kaffenster be-zeichnet wird. Engl. cat�s-head tile; frz. tuile en oreille dechat; sp. teja oreja de gato.
Kaiserdom, moderne Bezeichnungfür Kirchenbauten des 11.�13. Jhs.,die durch große Abmessungen undprächtigen Schmuck zu symbol-haften Repräsentanten der imperia-len Macht wurden.
Kaiserfora → *Forum.
Kaiserpfalz, falsche Bezeichnungfür die königl. → *Pfalzen.
259 Kaiserpfalz
Kaiserdom(Beispiel: Speyer, Dom, Ostansicht)
Kaiserstiel, Hahnebaum, Helm-stange, mittlere Stuhlsäule einesZelt- oder Helmdachs (→ *Dach-konstruktion). It. monaco centrale; sp. espiga central.
Kalasa (ind.), vasenförmiger Auf-satz eines Amalaka ind. Tempel-türme (→ *Sikhara).
Kalathos (gr.), Blattkelch des Ka-pitells der → *Korinth. Ordnung(→ Kapitell). Engl. kalathos, calathus; frz. calathus; it. ca-lato; sp. calato.
Kälberauge, eine dem Eierstabähnl. Verzierung am Wulstkörper(Echinus) eines Kapitells, haupt-sächl. in der Barockzeit vorkom-mend.
Kälberzähne, abgerundete Bal-kenköpfe eines Zahnschnitts derkleinasiat. → Ionischen Ordnung. Frz. denticule, clochette, larme; sp. dentí-culos.
Kalotte (frz.), Kugelabschnitt,dessen → Pfeil geringer als derHalbmesser ist (→ Kuppel). Engl., frz. calotte; it. calotta; sp. calota, lu-quete, caquete.
Kamin, offene Feuerstelle in einernischenartigen, mit einem Schorn-stein verbundenen Maueröffnung,oft mit vorkragenden Seitenwan-gen, Sturz und schräger Verda-chung (Mantel, Schurz, Rauch-fang); auch volkstüml., unrichtigeBezeichnung für den Schornstein.Die Beheizung des Raums erfolgtnicht durch eine Heizfläche, son-dern durch die strahlende Wärmedes offenen Feuers. Seit karoling.Zeit (St. Galler Klosterplan um
830) als Eckkamin nachgewiesen,in stauf. Zeit mit reich verziertenWangen und in der Spätgotik undRenaissance in den Schlössern bes.reich dekorierte K. als beherr-schendes Element in der Raum-gestaltung. Engl. chimney; frz. cheminée; it. caminetto,camino; sp. chimenea.
Kaminaufsatz → Schornsteinauf-satz, Abdeckplatte oder Abschluß-rohr am oberen Ende eines Schorn-steins (Kaminkopf, Schornstein-kopf). Engl. mantelpiece; it. mitra del camino, cap-pella del c., cresta del c.; sp. caperuza de lachimenea, sombrerete giratorio.
Kamm, Verbindung zweier über-einanderliegender Hölzer, indemder an der Unterseite des obenliegenden Holzes ausgeschnitteneK. in die auf der Oberseite desunteren Balkens entsprechend ein-geschnittene Sasse eingreift. Vor-nehml. zur Verbindung sich kreu-zender, nicht in einer Ebene lie-gender Balken. Je nach Grundformist zu unterscheiden: der einfachegerade oder Seitenk. und der dop-pelte oder Mittelk.; einen Über-gang zur Verblattung bildet der
Kaiserstiel 260
a Feuerstelle (Herd) b Rauchklappec Rauchsammlerd Schornstein
e Kaminsims f Haube g Wange
Kamin
ganze Kamm oder Blattk., fernerder Weißschwanz- und der Schwal-benschwanzk. und der Kreuzk.(→ *Holzverbindungen). Engl. comb; frz. came, camme; it. incastroad addentellato; sp. encastre de madera.
Kammer (lat. camera, camara, vongr. kamera), urspr. die gewölbteDecke, dann jeder überwölbteRaum, bes. Schatzk., auch Sakri-stei, später jedes Gemach, schließl.der kleine Schlafraum in einemWohnhaus. Engl. chamber; frz. chambre; it. camera;sp. cámara.
Kammertor, Toranlage, die aufbeiden Seiten von Toren geschlos-sen ist, wodurch ein Raum ent-steht, in dem der eingedrungeneGegner festgehalten werden kann(Fanghof, Torzwinger).
Kammziegel, verzierter Firstzie-gel, mit dem der Firstkamm gebil-det wird. Engl. crest tile; frz. tuile de crête; it. tegola dicolmo decorata; sp. teja decorada de cum-brera.
Kampanile (it. campana: Glocke),Campanile, freistehender Glocken-turm, bes. in Italien seit dem 6. Jh.bis in die Renaissance vorkom-mend, in Deutschland erstmaligauf dem St. Galler Klosterplan um830, dann im 12. /13. Jh. selten, inder russ. Architektur Kolokolnjagenannt, im modernen Kirchenbauhäufig wiederaufgenommen. Engl., frz., it. campanile; sp. campanil.
Kämpfer, 1. Zone, an der dieKrümmung eines → *Bogens (K.-stein) oder eines → *Gewölbesbeginnt und an der die Lasten eines
Bogens bzw. eines Gewölbes vomaufgehenden Mauerwerk aufge-nommen werden. 2. Querholz zurUnterteilung eines → *Fensters(einer Tür), das zusätzl. mit demSetzholz das Fensterkreuz bildet. Engl. 1. impost, abutment; frz. 1. imposte,coussinet; it. 1. imposta (dell�arco o dellavolta), 2. traverso della finestra; sp. 1. im-posta, 2. travesaño de ventana.
Kämpferaufsatz, Kämpferblock,würfelähnl., meist trapezoider Auf-satz über einem Kapitell, haupt-sächl. bei frühchristl.-byzantin. undkaroling.-otton. Kirchen vorkom-
261 Kämpferaufsatz
Kampanile (Beispiel: Florenz, Dom)
mend. Der K. ist als verkümmerterRest eines entfallenden Gebälks zuverstehen. Er wird im Laufe derEntwicklung geschmückt und im-mer mehr dem Kapitell angeglichen.It. pulvino; sp. aditamento sobre un capitel.
Kämpfergesims, ein Gesims inder Zone eines Kämpfers. Frz. imposte à ornements; it. cornice d�im-posta; sp. cornisa de imposta, moldura d. i.
Kämpferhöhe, Höhe des Kämp-fers über dem Fußboden. Engl. impost level; frz. hauteur d�imposte;it. altezza d�imposta; sp. altura de arranque,a. d. imposta.
Kämpferholz, bei Fenstern waa-gerechtes Querholz, das beidseitigim Rahmen befestigt ist und dieFensteröffnung in der Höhe unter-teilt. Bei Türen mit Oberlicht wird
das waagerechte Rahmenstück auchals K. oder Losholz bezeichnet. Engl. wooden transom; frz. traverse defenêtre, croisillon de croisée; it. traversodella finestra; sp. montante de la ventana,travesaño d. l. v.
Kämpferlinie, 1. Verbindungsliniezwischen den Kämpfern eines Bo-gens oder Gewölbes. 2. Grenzliniezwischen aufgehendem Mauer-werk und Gewölbelaibung. Engl. springing line, chord; frz. naissance,corde, ligne d�imposte; it. linea d�imposta;sp. línea de arranque, l. d. imposte.
Kämpferstein, 1. der erste Steinüber dem Kämpfer eines → *Bo-gens oder → *Gewölbes (Anfangs-stein, Anfänger, Anwölber). 2. Stei-nerne Ausführung eines Fenster-kämpfers (→ Kämpfer 1). Engl. springer; frz. sommier, coussinet;it. pietra di spalla, concio d�imposta; sp. ladri-llo/piedra de arranque/imposta.
Kandel, in Hessen und Nieder-sachsen Bezeichnung für → *Dach-rinne. Frz. canneler; it. doccia di gronda, canale dig.; grondaia; sp. canalón de tejado.
Kandelaber (lat. candelabrum),Kerzenhalter aus Metall, Holz oderStein, oft monumental mit reich(auch figürl.) dekoriertem Schaft.Bei antiken K. hat der Fuß oft dieForm eines Dreifußes. Engl. candelabrum; frz. candélabre; it, sp. can-delabro.
Kanephore (gr. Korbträgerin),andere Bezeichnung für Kore bzw.→ *Karyatide. Engl. canephora; frz. canéphore; it. canefo-ra; sp. canéfora.
Kannelierung → Kanneluren.
Kämpfergesims 262
ByzantinischesKorbkapitell mitKämpferaufsatz
Kämpfergesims
Kanneluren (gr.-lat. canna: Rohr),senkrechte konkave Rillen amSchaft eines Stützgliedes der klass.Ordnungen. Die K. können scharf-kantig aneinanderstoßen (→ *Do-rische Ordnung) oder durch Stegevoneinander getrennt sein (→ *Io-nische Ordnung). Bei spätantikenOrdnungen können die K. imunteren Teil des Schafts mit sog.→ *Pfeifen gefüllt sein (→ *Kapi-tell). Engl. fluting; frz. cannelures; it. scanalatura;sp. estrías, acanaladuras.
Kantenblume, Kriechblume →*Krabbe.
Kantenschlag → Randschlag(→ *Bosse 1).
Kantharus (gr.-lat.), Reinigungs-brunnen im Atrium frühchristl.Basiliken, nach dem Vorbild orien-tal. Hofbrunnen und der Zierbrun-nen im Peristyl des röm. Hausesmehr oder weniger reich ausgebil-det. Sp. cántaro, fuente.
Kantoniert → *Pfeiler und Mau-ern, die an den abgefasten Kantenvon Halbsäulen oder Dreiviertel-säulen gerahmt werden. Fälschl.gebraucht für den got. gegliedertenPfeiler (→ Gliederpfeiler). Engl. cantoned; frz. cantonné; it. accantona-to; sp. cantonado.
Kanzel (lat. cancelli: Gitter,Schranke), erhöhter, hervorragen-der und abgesonderter Standortbes. für den Prediger, den Lehreroder den Richter. Die K. ist in derchristl. Kirche aus den Vorformenvon → *Ambo bzw. → *Lettnerhervorgegangen. Isolierte K. kom-men erst seit dem 13. Jh. vor. DieK. kann von einer oder mehrerenStützen (K.fuß) getragen sein, dieauch figürl. ausgebildet sein kön-nen (K.träger). So werden die Säu-len der K. von S. Andrea in Pistojavon Atlanten und Löwen, die K. imDom zu Pisa von Christus, Eccle-sia, Evangelisten und den Tugen-den gestützt. Bekannt ist die Kan-zel von Ravello, deren Stützen vonzahlreichen schreitenden Löwengetragen werden. Über dem K.fußfolgt meist ein kelchförmiges Zwi-schenelement, der K.korb. Die
263 Kanzel
Antike Kandelaber
Kantharus mit Baldachin
Brüstung des K.korbs ist oft durchReliefs und Bauplastik verziert.Der Zugang zum erhöht liegendenK.korb erfolgt über die K.treppe,die oft ein reich geschmücktes Ge-länder besitzt. Den oberen Ab-schluß bildet ein K.deckel (Schall-deckel), der einen reichen Aufbautragen kann. So besteht der K.dek-kel im Ulmer Münster aus einerzweiten K. mit K.treppe für denhimml. Prediger. In der Barockzeitkommen Sonderformen von K. inder Form eines Segelschiffs oderFischerboots u.ä. vor. Der K. kannauch ein gegenüberliegendes K.pen-dant als symmetr. Ergänzung ent-sprechen. Eine Sonderform ist die→ *Außenk. vor allem bei Wall-fahrtskirchen. Engl. pulpit; frz. chaire; it. pulpito; sp. púl-pito.
Kanzelaltar, um 1890 als Be-zeichnung für die in protestant.Kirchen übliche Verbindung vonKanzel und → *Altar eingeführt;die Kanzel befindet sich senkrechtüber dem Altar, entweder mit die-sem unmittelbar verbunden oderfreischwebend über dem Altar inder Wand verankert. Die Hauptver-
breitungsgebiete sind Mittel- undNorddeutschland, 1580�1660 rechtselten, nach 1660 häufiger, seit1700 allgemein verbreitet, um 1850fast völlig aufgegeben, 1890�1918noch einmal von großer Bedeutung(Wiesbadener Programm 1891). Engl. pulpit altar; it. altare-pulpito; sp. altardel púlpito.
Kanzeldeckel, Schalldeckel (→*Kanzel).
Kanzelfuß → *Kanzel.
Kanzelhaus, Wohnhaus mit vor-gekragten Laubengängen (»Kan-zeln«) in den oberen Etagen. Engl. pulpit house; it. casa a ballatoio; sp. ca-sa con púlpitos.
Kanzelkorb → *Kanzel.
Kapelle (lat. capella: kleiner Man-tel), urspr. der Raum, in dem derMantel (capa) des Hl. Martin vonTours im fränk. Königspalast inParis aufbewahrt und verehrt wur-de. Die Bezeichnung ging dann aufandere kleinere Bet- und An-dachtsräume sowie kleinere Kir-chen ohne Pfarrechte über, für bes.Zwecke als Tauf-, Grab-, Burg-,Votiv-, Friedhofsk. oder als An-oder Einbauten, Einsatzk. zwi-schen eingezogenen Strebepfei-lern, Chork., Scheitelk. als Ostk.eines K.kranzes am Chorumgang(auch Lady Chapel), K.nischen inder Mauerdicke. Engl. chapel; frz. chapelle; it. cappella; sp. ca-pilla.
Kapellenerker → *Chörlein.
Kapellenkranz, radial auf einenMittelpunkt bezogene Kapellen, an
Kanzelaltar 264
Gotische Kanzel
einem halbrunden oder polygona-len → *Chor bzw. Chorumgang. Engl. radiating chapels; frz. chappelles ray-onnantes; it. corona di cappelle absidali;sp. capillas dispuestas en forma radial.
Kapitelhaus (engl.), ChapterHouse, rechteckiger oder polygo-naler, mit dem Kreuzgang oderQuerhaus einer engl. Kathedraledurch einen Stichgang verbunde-ner, freistehender Bau, der im Ge-gensatz zum Kapitelsaal der Klösternicht innerhalb der Klausur liegt.Das K. dient für die Sitzungen desDomkapitels. Die Entwicklungdes K. beginnt in der 1. Hälfte des12. Jhs. und ist auf England be-schränkt. Zentralbauten, acht-,zehn- oder zwölfeckig, häufig übereiner Mittelstütze gewölbt, verein-zelt mit Untergeschoß; dem recht-eckigen K. kann ein apsidialer oderpolygonaler Abschluß hinzugefügtsein. Frz. maison capitulaire; it. capitolo; sp. casacapitular.
Kapitell (lat. capitulum bzw. capi-tellum: Köpfchen), ausladendesKopfstück einer Stütze. Das K. ver-mittelt formal zwischen Stütze und
Last. Man kann das K. aus demSattelholz, formal auch durch Ab-straktion von Naturformen, wiez. B. der Blattkrone eines Baums,entstanden denken. Außerdem gibtes eine Fülle von figürl. und vonstereometr. Möglichkeiten, das K.als Übergang zwischen dem run-den Säulenschaft und der meist qua-drat. Abdeckplatte zu formen. AufNaturformen gehen die Blüten-und Blattk. zurück Die ägypt. Bau-kunst hat Blütenk. nach den Vorbil-dern von Lotos, Papyros und Lilieentwickelt, wobei man geschlosse-ne Knospenk. und offene Doldenk.unterscheidet. Zu den Blattk. ge-hört das ägypt. Palmenk., das ver-einfacht auch noch in hellenist. Zeitauftritt. Die wichtigste Form desBlattk. ist das korinth. K., bei demzwei Akanthusblattkränze über-einander angeordnet sind, und dieEcken durch je zwei diagonal ge-stellte Voluten gebildet werden. Daskorinth. K. blieb � wenn auch vari-iert � als Grundform das ganze MA.über erhalten. In der roman. Epo-che wurde das Blattwerk meist stili-siert und abstrahiert. Erst in der frü-hen Gotik nimmt es als Knospenk.wieder klarere Formen an. In derklass. Gotik entwickelt sich oft na-türl. Blattwerk teilweise mit Blütendurchsetzt um den K.kelch. Das ion.K. ist ein Volutenk. Zwischen ei-nem Wulstkörper, der mit einemplast. Eierstab dekoriert ist, und demprofilierten Abakus liegt der beider-seits eingerollte Volutenkörper. Dasion. K. macht in der Entwicklungeinen Wandel durch und kommtvereinfacht und verändert noch inder frühchristl. und in der ma.Baukunst vor. Verwandt mit demion. K. ist das aeol. K. mit zwei auf-
265 Kapitell
Kapitelhaus(Beispiel: Lincoln, Kathedrale)
267 Kapitell
1 Lotosknospenk.2 Papyrus-
knospenk. 3 Blüten-
(Dolden-)K. 4 Lilie 5 Palmenk. 6 Korinthisches
K. (Vorstufe) 7 Korinthisches
K. (klass.)
8 Korinthisches K. (mittelalt.)
9 Knospenk. 10 Blattk. 11 Ionisches K. 12 Ionisches K.
(mittelalt.) 13 Äolisches K. 14 Kompositk. 15 Figurenk. 16 Persisches K.
17 Hathork. 18 Dorisches K. 19 Toskanisches K. 20 Kelchk.21 Trapezk. 22 Korbk. 23 Würfelk. 24 Doppelwürfelk.25 Pfeifenk. 26 Faltenk. 27 Stalaktitenk.
Kapitell
steigenden Voluten über einemhängenden Blattkranz. Das röm.Kompositk. zeigt die Voluten undden Wulstträger des ion. über demBlattkranz des korinth. K. Figu-rierte K. gibt es vereinzelt bereits inder Spätantike, vor allem aber imMA. Man erkennt hier entwederan den Ecken des K. oder in derMitte der K.flächen Köpfe vonTieren (Adlerk.) oder Menschenoder auch ganze, manchmal mit-einander verknotete Körper. Auchganze Szenen (Christi Geburt,Flucht nach Ägypten) werden � vorallem in der frz. Romanik � am K.abgewickelt (Bilderk.). Es gibt auchVerbindungen von Blatt-, Voluten-und figürl. K. (Kompositk.). EineSonderform mit zwei Stierleibernals dem Sattelholz entsprechendemOberteil ist das K. der pers. Säule(Stierk.). Darunter folgen außer-dem je zwei aufsteigende Voluten-paare an den vier Seiten über zweiBlattkränzen. Das ägypt. sog. Ha-thork. ist oftmals nur ein Block-aufsatz (Sistrum) mit den Gesich-tern der Göttin Hathor über einemK., doch gibt es auch Hathork., diean vier Seiten des K.kelchs Ha-thorbilder zeigen. Das wichtigstestereometr. K. ist das dor. K. miteinem Polster (→ *Echinus). Denoberen Abschluß bildet die qua-drat. Platte (Abakus). Formal ver-wandt sind das K. der kret. Säuleund das der toskan. Säule. Eineeinfache Überleitung von der run-den Grundfläche des Säulenschaftszum quadrat. Abakus bildet nebendem Kelchk. und dem verwandtenTellerk., das mit mehreren über-einanderliegenden Scheiben ab-schließt, das Trapezk. mit abge-schrägten Ecken, wodurch vier
trapezförmige Ansichtsflächen zwi-schen spitz nach oben zulaufendenDreieckszwickeln entstehen. Eineähnliche, nicht kantige Überlei-tung zeigt das Korbk. Die weitausklarste stereometr. Form liegt demum 1015 entwickelten Würfelk. zu-grunde. Bei diesem wird der K.kör-per aus einer auf dem Säulenschaftruhenden Kugel gebildet, von derder eingeschriebene Würfel Seg-mente abschneidet, so daß vier An-sichtsflächen entstehen, die glattoder verziert sein können. Das sog.Doppelwürfelk. zeigt in jeder An-sichtsfläche zweimal die Form desWürfelk. Ausgesprochene Sonder-formen sind das oben verjüngteund unten geschweifte Glockenk.,das Pfeifen-, das Falten- und dasStalaktitenk., letztere in der islam.Baukunst. Bei komplizierterenStützen (Pfeiler mit Säulenvorla-gen, Bündelpfeiler u. dergl.) kön-nen K.additionen vorkommen,wobei je nach Art der Stütze halbeK., Viertelk. und K.ausschnitte zueiner größeren Einheit zusammen-geschlossen sind (Kranzk., Kämp-ferk.). Engl. capital; frz. chapiteau; it. capitello;sp. capitel.
Kapitelsaal, Raum in einem→ *Kloster, meist im Ostflügel derKlausur, in dem Weisungen an dieMönche erteilt und Kapitel aus derKlosterregel verlesen wurden; auchVersammlungsraum eines Domka-pitels. Der K. ist eine einräumige,zweischiffige oder über vier Stützengewölbte Halle, die zum Kreuz-gang durch das von offenen Arka-den auf jeder Seite begleitete Portalgeöffnet ist. Engl. chapter room; frz. salle capitulaire;it. sala capitolare; sp. sala capitular.
Kapitelsaal 268
Kapitol, Hügel in Rom mit denHaupttempeln der Stadt, danachspäter allgemeine Bezeichnung fürden Haupttempelbezirk einer röm.Stadt. Der kapitolin. Hügel trugspäter die Gebäude der Stadtverwal-tung (Senatorenpalast). Deshalbheißen oft auch die Regierungs-bezirke der Städte bes. im engl.Kultur- u. Einflußbereich K. Engl. Capitol; frz. capitole; it. campidoglio;sp. capitolio.
Kappdecke, nach der Raummittezu treppenartig ansteigende Deckeaus Brettern.
Kappe → Gewölbekappe (→ *Ge-wölbeformen).
Kappfenster → Kaffenster.
Kappgesims, Kaffgesims (→ *Ge-simsformen).
Karawanserei (pers.-arab. Kara-wan serail), Chan, Han, Konak, anKarawanenstraßen gelegene Her-berge, bei der die Unterkunftsräu-me regelmäßig um einen Hof grup-piert sind. Engl. caravanserai, caravansary; frz. caravan-sérail; it. caravanserraglio; sp. caravanseral-lo, caravanera.
Karner (lat. carnarium) Beinhaus,Ossarium, Kalvarium, eine meistzweigeschossige Friedhofskapelle.Der K. ist meist ein Zentralbau mitkleiner Ostapsis. Im Untergeschoßwerden ausgegrabene Gebeine auf-bewahrt, im Obergeschoß ist einAltarraum für Totenmessen. Bes.monumentale K. stammen ausspätroman. Zeit. In der Gotik gibtes auch kleinere K. als langgestreck-te Kapellen, die meist dem Hl. Mi-chael geweiht sind. Engl. charnel house; it. (cappella dell�) ossa-rio; sp. osario, capilla de cementerio.
Karnies (span. cornisa), Glocken-leiste, Leiste mit S-förmiger Kon-tur, die aus einem konvexen (Stab)
269 Karnies
Karawanserei(Beispiel: Aminabad, Persien)
Karner
Steigendes Karnies1 bekrönend 2 stützend
Fallendes Karnies3 auslaufend 4 fußend
und einem konkaven Element(Kehle) zusammengesetzt ist. Manunterscheidet steigendes und fal-lendes K. Engl. cyma; it. gola; sp. cornisa.
Karniesrinne, Rinnleiste des gr.Tempels in Karniesform. Engl. cymatium; sp. listel acanalado de lagola, l. a. d. l. cimacio.
Kartause, Kartäuserkloster. DieMönche wohnen nach Art der Ere-miten in einzelnen kleinen Häu-sern, die nur durch den Kreuzgangmit der Kirche verbunden sind. Engl. charter-house; frz. chartreuse; it. cer-tosa; sp. cartuja.
Kartusche (frz. cartouche: Rolle),hauptsächl. in der Barockzeit vor-kommender und aus Rollwerk,Knorpelwerk oder Rocaille gebil-deter Zierrahmen für Wappen, In-schriften u. dergl. Engl., frz. cartouche; it. cartiglio, cartella,cartoccio; sp. cartucho.
Karwan, Zeughaus auf Ordensrit-terburgen.
Karyatide (gr. Tänzerinnen ausKaryä), Kore, Kanephore, Mäd-chengestalt mit korb- oder polster-
förmigem Kopfputz, die anstelletekton. Stützen ein Gebälk trägt. K.kommen bereits an den Schatzhäu-sern von Delphi vor. Das bekann-teste Bauwerk mit K. ist die Koren-halle des Erechtheions auf derAkropolis von Athen (→ *Schatz-haus). Gegenstück zum → *Atlant. Engl. caryatid; frz. caryatide; it. cariatide;sp. cariátide.
Kasematte, gegen Beschuß durchErdaufschüttung gesicherte, über-wölbte, teilweise mehrgeschossigeRäume in der Umwehrung vonFestungen, Forts und Zitadellen mitSchießscharten, auch mit erhöhterPlattform (Kavaliere) zur Aufstel-lung von Geschützen. Die K. ka-
Karniesrinne 270
Kartause(Beispiel: Mauerbach)
Karyatide
Kartusche mit Rollwerk
men mit der Einführung der Artil-lerie seit dem Ende des MA. auf,sie dienten als Mannschaftsunter-künfte, Magazine und Munitions-lager. Bautechn. unterscheiden siesich nach ihrer Anordnung imSystem der Befestigungen. Die Wi-derlager der Gewölbe konntengleichzeitig die Außenmauern derFestung bilden (Parallelk.), oder siekonnten senkrecht zu ihr stehen(Perpendikulark.), letztere hatteden Vorteil, daß die Zerstörung der
Außenmauer noch nicht den Ein-sturz des Gewölbes bewirkte. DieK. diente seit dem 18. Jh. häufig alsStaatsgefängnis. Engl., frz. casemate; it. casamatta; sp. casa-mata.
Kaserne, seit dem 17. Jh. Bezeich-nung für Truppenunterkünfte. Inder röm. Kaiserzeit in den Stand-lagern an den Grenzen des Imperi-ums als zweigeschossige, langge-streckte, massive Baracken mitEinzelräumen für jeweils wenigeSoldaten, mit vorgelegter Galerie;dazu Stabsgebäude (Praetorium)und Vorratsbauten. Aus dem MA.sind keine speziellen Truppenun-terkünfte bekannt, wenn man nichtdie Lager der Normannen und dieBefestigungen gegen die Norman-nen dazu rechnen will. Erst in Ide-alentwürfen der Renaissance fürFestungsstädte waren besondereBauten für die Landsknechtstrup-pen entlang der Wälle vorgesehen.Im 17. Jh. beginnt der Bau von K.in den Residenzstädten für die neueingeführten stehenden Heere:dreigeschossige Anlagen ohne Flu-re mit schmalen Treppenhäusern,dazu Offiziershäuser, Stabsgebäu-de, Stallungen, Wirtschaftsgebäu-de, Wachhäuser und Paradeplätze.Im 19. Jh. langgestreckte Unter-künfte mit pavillonartigen Kopf-bauten, Schlafsäle für 20�150Mann. Im 20. Jh. Mittelflur mitStuben für je 4�12 Mann. Engl. barracks; frz. caserne; it. caserma;sp. cuartel.
Kasino (it. casino: kleines Haus),Gesellschaftshaus, Versammlungs-haus, mit Tanz-, Konzert- undSpeisesälen, ein dem allgemeinenVergnügen gewidmetes Gebäude,
271 Kasino
Kasematten
entweder als kleines Landhaus in-mitten eines Gartens in der it. Re-naissance oder in Kurorten undKasernen (für Offiziere). Engl., frz., it; sp. casino.
Kaskade (it. cascare: fallen), künstl.abgetreppter Wasserfall, haupt-sächl. in Parkanlagen der Renais-sance und des Barocks. Engl., frz. cascade; it. cascata; sp. cascada.
Kassette (frz. cassette: Kästchen),vertieftes Feld in einer Decke(K.decke, → Felderdecke), in einerBogenlaibung oder in einem Ge-wölbe. Die K. entsteht aus der
Konstruktion der Balkendeckebzw. des Gewölbes mit Verstär-kungsgurten durch Verspannungmit Querträgern. Zwischen dentragenden Elementen bleibt die K.als Vertiefung. Das K.feld wirdmeist von Zierleisten, Karniesen,Kymatien u. dergl. gerahmt undmit Ornamenten, Rosetten, Ge-mälden oder Reliefs geschmückt. Engl. coffer, lacunar; frz. cassette; it. casset-tone, lacunare; sp. cuadrícula de artesonado.
Kastell (lat. castellum), befestigteAnlage in der Art einer Burg odereines Schlosses. Bei den Römernein befestigtes Standlager an denGrenzen (→ *Castrum). Engl. fort, castellum; frz. castel; it. castello;sp. castillo, ciudadela.
Kasten, zumeist zweigeschossiger,freistehender Speicherbau des süd-dt. Bauernhofs.
Kastenaltar, Altar mit Hohlraumim Unterbau der Mensa (→ *Altar2 b). Engl. box altar; it. altare a cofano; sp. altarahuecado en la base.
Kaskade 272
Kaskade
KassetteKassettendecke an einem ionischenTempel, Untersicht.
Kastengesims, Holzgesims in ka-stenartiger Konstruktion, das erfor-derlich wird, wenn der untereRand eines Dachs höher liegt alsdie Unterkante der Balkenlage;dabei werden die Balkenköpfe und→ Aufschieblinge mit teilweise reichprofilierten Brettern verkleidet. It. mantovana; sp. moldura de madera tipocajón.
Kastenrinne, auf dem Hauptge-sims stehende Dachrinne mitrechteckigem (kastenförmigem)Querschnitt. Engl. box gutter; frz. chéneau; it. grondaia asezione rettangolare; sp. canalón de cortetransversal rectangular.
Kastentriforium → Triforium,dessen Rückwand nicht mehr aufder Mauer über den Arkaden steht,sondern auf den Seitenschiffge-wölben bzw. auf einem der Mauerüber den Seitenschiffen vorgeleg-ten Entlastungsbogen ruht.
Katafalk (lat. catafalcium: Schau-gerüst), Unterbau des Sarges bei derLeichenfeier, bes. in der Barockzeitprächtig geschmückt. Engl., frz. catafalque; it., sp. catafalco.
Katakombe (gr.), Arenarium,Coemeterium, unterird. Grabanla-ge, die bei den Etruskern und seitder röm. Antike, bes. in frühchristl.Zeit in Rom und Umgebung, aufSizilien, Neapel und auf dem Bal-kan angelegt wurde. Die Bezeich-nung K. (spätlat. catacumba) wur-de vom Beinamen der K. des Hl.Sebastian bei Rom (Coemeteriumad catacumbas) auf alle unterird.Grabanlagen übertragen, die seitdem 16. Jh. in Rom erforscht wur-den. Der altchristl. Name für K. istCoemeterium. Die K. besteht auseinem Vorraum, von dem ein Sy-stem von Gängen abgeht, in derenWänden die Beisetzung in meistmehrfach übereinander eingehaue-nen Grabnischen (Loculusgrab,Kolumbarium) erfolgte, die durchSteinplatten mit dem Namen desToten verschlossen wurden. DieGrabnische kann auch architekton.gegliedert sein (→ Arcosolium).Die Gänge können sich zu großenKammern (Cubiculum) auswei-ten. Blütezeit in Rom war das 2.�4.Jh. n. Chr., in Neapel 1.�10. Jh. Im4. Jh. wurden die K. zu Stätten derMärtyrerverehrung. Bedeutendsind die Wandmalereien als Über-reste spätantiker-frühchristl. Bild-kunst. Engl. catacomb; frz. catacombes; it. cata-comba; sp. catacumba.
273 Katakombe
Kastell(Beispiel: Castel del Monte)
Katakomben(Querschnitt mit Nischengräbern)
Kate, Kotten, niederdt. Bezeich-nung für Tagelöhnerhaus oder dasHaus eines landarmen Kleinbau-ern, besteht aus einer Hütte odereinem kleinen Haus mit Platz fürKleintierhaltung. Engl. (tied) cottage; it. casa colonica; sp. ca-baña.
Katharinenrad, mit Bezug auf dasMarterwerkzeug der Hl. Katharinavon Alexandrien Bezeichnung fürdie Radfenster (→ Fensterrose) anroman. und frühgot. Kirchen.(Fälschl. auch auf die maßwerkge-füllten Fensterrosen übertragen.)Das K. kann durch aufsteigendeund herabfallende Figuren an derAußenkante als Glücksrad inter-pretiert sein. Das früheste Rad-fenster, zugleich auch Glücksrad,findet sich 1130/40 in Beauvais. Engl. wheel-window, Catherine wheel;frz. roue de Sainte-Cathérine, fenêtre rayon-nante de Sainte-Cathérine; it. finestra arosone; sp. ventana radiada de Santa Cata-lina, ventana con rosetón.
Kathedra (gr.), Stuhl des Bischofs,in der frühchristl. Basilika imScheitel der Apsis erhöht, über Stu-fen erreichbar. Engl. cathedra; it. cattedra; sp. cátedra.
Kathedrale (gr.), in England,Frankreich und Spanien üblicheBezeichnung für jede bischöfl.Hauptkirche (Kathedra = Bischofs-stuhl). In Deutschland wird die K.als Dom oder Münster bezeichnet.Mit einer K. ist ein Kapitel vonChorherren oder Kanonikern ver-bunden, die im Chor ihren Sitzhaben (Chorgestühl). Engl. cathedral; frz. cathédrale; it. cattedrale;sp. catedral.
Katholikon (gr.), Hauptkirche desgr.-orthodoxen Klosters, meist eineKuppelbasilika. Engl. katholikon, catholicon; sp. catolicón.
Katze → Kavalier.
Kaufhaus, Kaufhalle, städt. Ge-bäude, häufig in Verbindung mitdem Rathaus, mit großen Hallenzum Auslegen und festen Gewöl-ben zum Speichern der Waren. Gro-ße Städte errichteten für wichtigeLebensmittel wie Fleisch (Fleisch-halle) oder für das Hauptproduktihrer Wirtschaft (Tuchhalle, He-ringshaus) ein- oder mehrgeschos-sige K. Im 14. Jh. begann der Bauvon K. für Lagerung, Verzollungund Großverkauf der Waren durch-reisender Kaufleute (Stapelrecht),bestehend aus ein- oder dreischif-figen Innenräumen mit verschließ-baren Bretterverschlägen. Im 17.�19. Jh. war die Zusammenfassungvon selbständigen, in Pacht verge-benen Läden zu einem großen,architekton. eindrucksvoll gestalte-ten K. üblich. Seit der Mitte des 19.Jhs. wurden die spezialisierten La-dengeschäfte zu privaten mehrstök-kigen K. für begrenzte Warengrup-pen (Stoffe, Konfektion, Haushalts-waren, Möbel); häufig um einen
Kate 274
Kathedra
zentralen Lichthof. Gleichzeitig ent-standen in England und Frankreichumfangreiche mehrgeschossige→ Warenhäuser, die das Prinzip derSpezialisierung aufhoben. Nachdem 2. Weltkrieg bildeten sich frei-stehende K., bes. für Lebensmittel,als weitgespannte Hallenkon-struktionen (Kaufhallen) heraus. Engl. warehouse, store; frz. (grand) maga-sin; it. emporio, grande magazzino; sp. tien-da, almacén.
Kavalier, Katze, erhöhte Platt-form auf dem Wall oder den Ka-sematten der Festungen zur Beob-achtung und zum Aufstellen vonKanonen, als Erdaufschüttung mitBrustwehr. Engl., frz. cavalier; it. cavaliere; sp. caballero,fortificación sobre la casamata.
Kavalierriß, nach den Kavalieren,den erhöhten Aussichtspunktenvon Befestigungsanlagen, benannteschief-axonometrische Darstellung(Schrägriß) eines Objektes bei be-liebiger Blickrichtung, wobei zumUnterschied vom Militärriß dieTiefenmaße vor dem Aufriß aufge-tragen werden. Der K. wird manch-mal auch ungenau Kavalierper-spektive genannt (→ *Projektion). Engl. cavalier projection, c. perspective;it. assonometria cavaliera; sp. perspectivacaballera.
Keep (engl.), Hauptturm der engl.Burg, der dem → *Bergfried ent-spricht, jedoch wie der frz. → *Don-jon zum dauernden Wohnen ein-gerichtet ist. Seit der EroberungEnglands 1066 durch den Nor-mannen Wilhelm eingeführt, häu-fig auf einer → Motte. Zumeistüber rechteckigem Grundriß mitdicken Mauern, in denen Wehr-nischen, Treppen und Abtritte ein-gefügt sind. Die Außenmauern wer-den durch Lisenen oder halbrundeVorlagen gegliedert oder die Eckenrisalitartig betont. Im Innern wirdder K. durch Längsmauern zweige-teilt und durch Zu- oder Einbaueiner Kapelle bereichert. Im Un-tergeschoß, das nur vom 1. Ober-geschoß zugängl. ist, befinden sichLager- und Mannschaftsräume.Über einen hochgelegenen Ein-gang erreicht man durch einenWachraum, häufig in einem An-bau, das 1. Obergeschoß mit demgroßen, beheizbaren Saal. Im 2.Obergeschoß liegen ebenfalls Säleund die Kapelle, im 3. Oberge-schoß Schlafräume, darüber dieWehrplatte. Seit der Mitte des 12.Jhs. entstehen auch runde K.,daneben Sonderformen. Die Maßesind durchschnittl. bis zu 15×25mbei 30m Höhe. It. torrione, maschio (di castello); sp. torreón.
Kegeldach → *Dachformen,→ *Trulli.
Kegelgewölbe, Gewölbe überkreisförmigem Grundriß bei dreiek-kigem Querschnitt (→ *Gewölbe-formen). Engl. conical vault; it. volta conica; sp. bóve-da cónica.
Kegelstumpfkapitell, ähnl. dem→ Trapezkapitell.
275 Kegelstumpfkapitell
Kaufhaus(Beispiel: Konstanz, »Konzilsgebäude«)
Kehlbalken, Balken in einemSparrenpaar, der bei größerer Spar-renlänge zur Unterstützung undVerbindung der Sparren dient. Erist mit den Sparren verblattet oderverzapft und in jedem Gespärreangeordnet. Der oberste, durchkeinen Boden belastete K. heißtauch Hahnenbalken oder Spitz-balken. → *Dachkonstruktion. Engl. collar beam; frz. petit entrait, seconde., e. supérieur; it. controcatena; sp. falsotirante, viga de lima-hoya.
Kehle, 1. Hohlkehle, konkavesProfil, der kleinere Winkelbereich,der beim linearen Zusammenstoßzweier Flächen entsteht, die nichtin einer Ebene liegen. 2. Dachk.,Seiler, Rinne, Schnittlinie zweiergegeneinandergeneigter Dachflä-chen, die mit ihrer Trauflinie eineeinspringende Ecke bilden. 3.Durchdringungslinie der Kappenbei einem Klostergewölbe. 4. Voute,Kehlgesims, ausgekehlter Über-gang zwischen Wand und Decke. 5.Rückwärtiger offener Abschnittvon Bastion oder Ravelin. Engl. 1. channel, groove; frz. 1. noulet, 5.gorge; it. 1. linea di compluvio, conversa, 2.scozia, scanalatura, cavetto, modanaturaconcava, 3. unghia; sp. 1. lima-hoya.
Kehlgesims, 1. → Gesims, daseine Wand unter der Deckenkehle(Voute) abschließt (→ Kehle 4).2. Gesims am Bruch der verschie-den geneigten Dachflächen einesMansarddachs (→ *Dachformen). Engl. concave molding; sp. moldura cóncava.
Kehlleiste → *Leiste zwischenWand und Decke.
Kehlrinne, Rinne in der → Dach-kehle (→ *Dachausmittlung).
Kehlsparren, die zur Unterstüt-zung einer Dachkehle angeordne-ten Sparren, die an ihrer Oberseiteder Dachneigung entsprechend aus-gekehlt werden. Die Schiftsparrenwerden seitl. an die K. angenagelt.Behalten die K. ihren rechtwinkli-gen Querschnitt, so müssen dieSchiftsparren auf die K. als sog.Reitersparren mit Klauen aufge-setzt werden. Engl. valley rafter; frz. noulet-chevron;it. puntone d�impluvio; sp. cabio de lima-hoya, par d. l.
Kehlstichbalken, der unter einerDachkehle angeordnete Stichbalkender Dachbalkenlage, der zur Auf-nahme des Fußes eines Kehlspar-rens dient. Frz. petit entrait, retroussé; sp. viga embro-chalada a la viga de lima-hoya.
Keilfuge, keilförmig ausgebildeteFuge bei der Wölbung (→ Bogen I)mit rechteckigen Steinen (Back-steinbau). Engl. wedge joint; frz. joint cunéiforme; it. fu-ga cuneiforme; sp. juntura en forma de cuña.
Keilstein, keilförmiger Stein fürden Bau von Bogen oder Gewölben.Engl. wedge; frz. claveau, coin en pierre;it. cuneo; sp. ladrillo acuñado para bóvedas.
Kehlbalken 276
Kehle 2
a Gratsparrenb Kehlsparrenc SchiftsparrenKehlsparren
Keilstufe → *Stufe mit keilförmi-gem Querschnitt. Die Untersichtmehrerer K. ist nicht abgetreppt wiebei Blockstufen, sondern schrägdem Treppenlauf folgend. Engl. spandrel step; frz. marche balancée,m. gironnée; it. gradino a sezione trapezoi-dale; sp. grada con corte acuñatado.
Kelchblockkapitell, Kelchwür-felkapitell, eine aus Kelchkapitellund Würfelkapitell kombinierteForm, die bes. in stauf. Zeit allge-mein verbreitet war (→ *Kapitell).Beim K. wird zumeist der Kapitell-körper vollständig von Ornamen-ten überdeckt.
Kelchkapitell, Kapitell von kelch-artiger Form, bes. häufig in derGotik, teilweise mit vegetabilenOrnamenten geschmückt, die aberden Kelchgrund wirksam lassen(→ *Kapitell). Engl. bell capital, basket c., orbel c.; frz. cha-piteau à tambour; it. capitello a calice; sp. ca-pitel en cáliz.
Keller (lat. cellarium: Speisekam-mer), ein ganz oder teilweise unterdem Erdboden liegender Raum, dermeist von einer massiven Deckeoder von einem Gewölbe abge-schlossen wird. Der Zugang zumK. bzw. K.geschoß (→ *Geschoß)liegt entweder im Gebäude (K.trep-pe) oder außerhalb (→ *K.hals). Engl. cellar, basement; frz. cave, caveau;it. cantina; sp. sótano.
Kellerhals, eine Kellertreppe, dievon außerhalb des Gebäudes inden Keller hineinführt, so daß sichim Gelände ein Einschnitt ergibt.Der im Haus liegende Teil des K.kann durch eine steigende Tonneüberwölbt sein.
Kemenate (lat.), Dürnitz, Dornse,heizbares Wohngemach (speziellFrauengemach) in einer Burg. Engl. bower; it. camminata; sp. aposentopara las mujeres en una fortaleza.
Kenotaph (gr.), → *Grabdenkmalfür einen an anderer Stelle beige-setzten Toten. Engl. cenotaph; frz. cénotaphe; it., sp. ceno-tafio.
Kerbschnitt, Keilschnitt, Orna-ment, dessen Kerben scharfkantiganeinandergrenzen, seit prähistor.Zeit bekannt, im 2. Jh. n. Chr. aufprovinzialröm. Steindenkmälernund in der Völkerwanderungskunstangewandt, bes. bei roman. undgot. Steinmetzarbeiten verbreitet. Engl. chip carving; frz. encoche; it. intaglio;sp. entalladura.
Kerbzinne, Schwalbenschwanz-zinne, Ghibellinenzinne, Zinne mitdreieckigem, geradlinig oder ge-schwungen geführtem Einschnittzum Auflegen von Schußwaffen.→ *Zinne. Engl. notched crenellation; it. merlo ghi-bellino; sp. entalladura de almena.
Kerker (lat. carcer), Gefängnis,zumeist eine einräumige Arrest-zelle in Burgen, Rathäusern oderKlöstern, für kurzen oder längerenAufenthalt von Gefangenen. Engl. prison, dungeon; frz. cachot, geôle;it. carcere, prigione; sp. calabozo, mazmorra.
277 Kerker
Kellerhals
Kerkides (gr.), bei den radialangeordneten Treppen beidseitigbegrenzte Sektoren eines antiken→ Theaters (→ *Theaterbau). Engl. kerkis; it. kerkides; sp. cavea.
Kernwerk, inneres Verteidigungs-werk einer Festung (→ Reduit). Engl. core; sp. central de defensa de unafortaleza.
Kessel, ausgebaute Mörserstel-lung, auch kleines Verteidigungs-werk auf der → Contrescarpe. Engl. cauldron; frz. chaudron, chaudière;sp. caldera.
Kesselgewölbe, über runderGrundfläche errichtetes Gewölbemit einer Gewölbelinie in Form ei-ner flachen Halbellipse, ähnlicheinem Kuppelgewölbe. Engl. depressed domical vault; frz. culde-four; it. volta a bacino, v. a catino; sp. bóve-da tubular.
Kesselgraben → Abzugsgraben.
Kettendorf, Reihendorf (→ *Dorf-formen 3).
Kielbogen, Karniesbogen, Schot-tischer Bogen, ein Spitzbogen mitgeschweiften Schenkeln, die im un-teren Teil konkav, im oberen Teilkonvex geschwungen sind, d.h. dieMittelpunkte der zwei unterenKreisbogen liegen innerhalb, dieder zwei oberen außerhalb des Bo-genfeldes. Fallen die beiden Mit-telpunkte der unteren Kreise ineinem Punkt zusammen, so ent-steht die geläufige Form des K., lie-gen sie auseinander, wodurch derBogen eine gedrücktere Form er-hält, spricht man eher von → Esels-rücken oder Sattelbogen. Der um
1300 aufkommende K. war bes. inEngland ein beliebtes Motiv derSpätgotik (Perpendicular style).→ *Bogenformen. Engl. ogee arch; frz. (arc en) accolade; it. ar-co a chiglia; sp. arco de carena.
Kiosk (pers.), viereckiges oder run-des Gartenzelt auf Säulen, auch ausHolz oder Stein, nach vorn offen,an den Seiten mit Gitterwerk ge-schlossen, freistehend oder ange-baut, oft auch in Form eines Erkersmit geschweiftem Dach. Häufig imZentrum eines Gartens gelegen,auf künstl. Hügeln oder an Tei-chen, durch islam. Einfluß in Eu-ropa verbreitet. In der GegenwartBezeichnung für einen kleinenZweckbau ähnl. Gestalt (Zeitungs-k., Verkaufsstände). Frz. kiosque; it. chiosco; sp. kiosco.
Kippfenster → *Fenster, dessenFlügel (Kippflügel) um die unterewaagrechte Achse kippbar ist. Frz. fenêtre tombante intérieure, f. à souf-flet; it. finestra a vasistas; sp. ventana de bás-cula.
Kirchenbauten, dem Gottesdienstbzw. der Kultausübung verschiede-ner christl. Religionsgemeinschaf-
Kerkides 278
Kiosk(Beispiel: Isfahan, Hescht Bihischt)
ten dienende Gebäude. Man un-terscheidet je nach dem Rang derKirche Bischofskirchen, → Pfarr-kirchen, Filialkirchen, → *Kloster-kirchen, → Stiftskirchen, → Kolle-giatkirchen, → *Wallfahrtskirchen,Memorialkirchen, Coemeterialkir-chen, → *Denkmalkirchen, Spital-kirchen u. dergl. Baul. unterschei-det man um einen Mittelpunktentwickelte → *Zentralbauten undnach einer Hauptachse ausgerich-tete Langbauten. Diese können ein-schiffige Säle und Predigträume(manchmal mit Emporen) odermehrschiffige → *Basiliken bzw.→ *Hallenkirchen, auch mit Quer-schiff und → *Chor sein. Prozes-sionskirchen (hauptsächl. in Böh-men und Mähren) sind Wallfahrts-kirchen, deren Hauptraum durchzwei Umgänge mit der hinter demChor isoliert liegenden Gnadenka-pelle verbunden ist. Zwei neben-oder hintereinander liegende Kir-chen nennt man Doppelkirchen,eine befestigte Kirche Wehrkirche.Kleinere christl. K. werden → Kapel-len genannt. Sie dienen oft einemSonderzweck als → Hauskapellen,→ *Doppelkapellen, → Burgkapel-len, → *Baptisterien, Pfalzkapellen(→ *Pfalz), → *Karner, → Grabka-pellen. Nach der inneren Eintei-lung bilden → Emporenkirchen(hauptsächl. bei Nonnenkirchen),→ Oratorien und → *Krypten(Unterkirche) Teile von K. Einekonstruktive Sonderform ist die→ *Stabkirche. Engl. church buildings; it. costruzioni dichiese; sp. edificios para comunidades reli-giosas.
Kirchenburg → Wehrkirche.
Kirchhof → Friedhof.
Kirttistambha (ind. »Ruhmessäu-le«), das Ehrentor einer brahman.Tempelanlage, das auf die → Tora-nas zurückgeht.
Klangarkade → Schallöffnung.
Klappfenster, → *Fenster, dessenFlügel (Klappflügel) um die oberewaagrechte Achse drehbar sind. Engl. top-hinged window; frz. fenêtre àrabattement; it. finestra a ribalta; sp. ventanade báscula, v. giratoria.
Klappladen, Laden zum Ver-schluß einer Maueröffnung (Fen-ster, → *Fensterladen), der (im Un-terschied zum Klappfenster) umeine meist senkrechte Achse aufge-klappt werden kann. Engl. folding shutter; frz. volet pliant;it. imposta a battente; sp. postigo plegable.
Klaue, zimmermannsmäßige Ver-bindung zweier Hölzer, von denendas eine schräg gegen zwei Lang-seiten des anderen zumeist waage-rechten Holzes gesetzt ist; bes. zurVerbindung von Sparren und Pfet-ten. Bei der einfachsten Form derK. erhält der Sparren ledigl. einenrechtwinkligen Ausschnitt; eineandere Form ist das sog. »Verbre-chen« der Pfetten (Brechung derBalkenkante), um den Balken we-niger zu schwächen und beim Ab-binden die Lage der Sparren fest-zulegen. Aufklauungen werden inder Regel durch Sparrennägel gesi-chert (→ *Holzverbindung). Engl. triangular notch, spur, griffe; frz. patte,Aufklauung: chevronnage; it. incastro adenti; sp. encastre tipo garra.
Klauenstein, hakenförmiger Qua-der als Balkenauflage (Konsolen)oder als Führung (z.B. für Fallgat-ter an Burgtoren).
279 Klauenstein
Klause (lat. clusa), clausa, recluso-rium, Recluse, 1. ma. Bezeichnungfür Wegesperren in Gebirgstälern,meist an Territorialgrenzen. 2. Ein-siedelei, stets mit einer Kapelle oderdergl. verbunden. 3. Klosterzelle,Raum für den Mönch oder dieNonne, im Laufe des MA. durchAbteilung der Liegestatt im Dor-mitorium durch hölzerne Trenn-wände und seit dem 15. Jh. auchdurch Türen mit Guckloch ver-schlossen. Bei den Kartäusern liegtseit der Mitte des 12. Jhs. die K. alsEinzelgebäude an einem Kreuzgang.Engl. cell, hermitage; it. eremo, cella; sp. celda.
Klausur (lat. clausura: Verschluß,Einschließung), der nur den Mön-chen und Nonnen zugängl. Teildes → *Klosters. Engl. cloister; it. clausura; sp. parte de unclaustro.
Kleeblattbogen, Dreipaßbogen,→ *Bogenformen. Engl. trefoil arch; frz. arc tréflé, a. trilobé;it. arco a trifoglio; sp. arco trebolado, a. tri-lobulado.
Kleeblattchor → *Dreikonchen-anlage.
Kleeblattfenster, Fenster, das voneinem Kleeblattbogen abgeschlos-sen ist (→ *Fensterbank). Engl. trefoil window; frz. fenêtre tréflée;it. finestra trilobata, f. a trifoglio; sp. ventanatrebolada, v. trilobulada.
Kleinasiatisch-ionische Ord-nung, Sonderform der → *Ioni-schen Ordnung, die hauptsächl. inKleinasien vorkommt (→ *Säulen-ordnungen). Engl. Asiatic Ionic order; frz. ordre ioniqued�Asie Mineure; it. ordine architettonicoionico-asiatico; sp. orden arquitectónicoiónico asiático.
Klemmbalken, Sperrbalken amTor, der in seitl. Maueraussparun-gen eingeklemmt wird. Frz. fléau, poutre de verrouillage; it. spran-ga di legno, catenaccio, chiavaccio; sp. vigade cierre.
Klinke, das um einen Stift drehba-re Metall- oder Holzstück, dasTür- und Fensterflügel dadurchfeststellt, daß es beim Schließenhinter einen Klinkhaken fällt unddaher auch Fallklinke genannt wird.Engl. door handle, latch; frz. poignée; it. ma-niglia; sp. picaporte.
Klinker, bis zur Sinterung ge-brannter Backstein (Sinterzeug),der dunkelrot bis blauschwarz, bes.druckfest und nur wenig hygro-skop. ist. Engl. clinker; frz. clincker; it. klinker; sp. la-drillo holandés, l. vitreo.
Klosett (lat. clausus: verschlossen),eine erst um die Mitte des 19. Jhs.im Deutschen eingebürgerte Be-zeichnung für den Abort (→ *Ab-tritt), der sich im späteren 19. Jh.zum WC (water closet) entwickelthat. Engl. lavatory, toilet; frz. toilettes, cabinets,water-closet; it. gabinetto, watercloset; sp. in-odoro.
Kloster (lat.), abgeschlossene An-lage (claustrum, monasterium) fürMönchs- und Nonnengemein-schaften, besteht aus der Kircheund den anschließenden, meist imGeviert um den Kreuzgang liegen-den Bauten des Konvents (Klau-sur), die Laien verschlossen blei-ben, und einem Wirtschaftsbe-reich. Das Zentrum des K. ist der→ Kreuzgang, ein auf vier Seitenvon einem Gang (Ambitus) umge-
Klause 280
bener, rechteckiger Hof, zumeistsüdl., aber auch nördl., seltenerwestl. oder östl. der Kirche gele-gen. Der Kreuzgang dient häufig derSepultur (Bestattungsort, Mortua-rium) und verbindet die zur Klau-sur des K. gehörenden Gemein-schaftsräume und Zellen; er istmeist gewölbt und in Arkaden übereiner Brüstung zum Hof geöffnet,der als Garten angelegt ist und inder Mitte einen Brunnen habenkann. Der an der Kirche gelegeneFlügel ist vereinzelt auch zwei-schiffig, da er als Kapitelsaal undfür feierl. Handlungen (z. B. Fuß-waschung) genutzt werden kann.Die offenen Arkaden werden inder Spätgotik mit Maßwerk undGlasfenstern geschlossen und imBarock durch Fenster ersetzt. An
dem Kreuzgang liegt im Ostflügelder → Kapitelsaal, der normaler-weise quadrat., über vier Säulen ge-wölbt und zum Kreuzgang in rei-chen Arkaden geöffnet ist. An engl.Kathedralen ist er als rechteckigeroder polygonaler, freistehender Bauausgebildet, mit dem Kreuzgangdurch einen Stichgang verbunden(Chapter House → *Kapitelhaus).An den Kapitelsaal schließt in Zi-sterzienserk. das Parlatorium, derSprechraum, und das Auditoriuman, in dem der Prior den Mönchendie Arbeit und die Arbeitsgerätezuweist, in den die Mönche vonder Außenarbeit zurückkehren undder als Arbeits- und Studienraumdient. Zumeist über diesem Ost-flügel befindet sich das → *Dormi-torium als mehrschiffiger Schlaf-
281 Kloster
(Beispiel: St. GallenRekonstruktion)
(Beispiel: Klosterbruck, M. 18. Jh.)
Kloster
raum oder mit Zellen an einemGang (→ Dorment) mit direkterTreppenverbindung in das Quer-schiff der Kirche. In dem der Kir-che abgewandten Flügel liegt das→ Refektorium, der häufig zwei-schiffige Speiseraum (in Deutsch-ordensburgen → *Remter genannt),die Küche und das Calefactorium(Wärmestube). Der westl. Flügelbeherbergt Vorratsräume, Keller(Cellarium) und die Kleiderkam-mer (Vestiarium). Das runde oderpolygonale → Brunnenhaus unddie Tonsurkapelle liegen zumeistan der Innenseite des Kreuzgangsgegenüber dem Refektorium. Nichtan den Kreuzgang angeschlossensind das Wohn- und Repräsenta-tionshaus des Abts, das Noviziat,die → Infirmarie (Hospital) und
die Pforte mit dem Empfangsraumfür Gäste (Auditorium). Die K.an-lagen sind häufig mit Mauern,Türmen und Toren abgeschlossen,die auch mit Verteidigungseinrich-tungen versehen sein können. Engl. monastery; frz. monastère; it. monas-tero; sp. convento, monasterio.
Klostergewölbe, Haubengewölbe,→ *Gewölbe, das von mehrerenGewölbewangen gebildet wird, dieals dreieckige Ausschnitte aus einerZylinderfläche mit geradlinigemAnsatz sowie Kehlen an Laibungund Scheitelpunkt gebildet sind.Das K. ist zu verstehen als dasErgebnis der Durchdringung gleichhoher Tonnen, deren Gewölbefußerhalten bleibt. Die Grundflächedes K. kann quadrat., rechteckig,dreieckig und häufig polygonalsein. In röm. Kaiserpalästen nach-weisbar, in karoling., aber auch inanderen ma. Kirchen bes. bei Zen-tralbauten und über Vierungen. Engl. cloister vault, domical vault; frz. voûtecloisonnée, voûte en arc de cloître; it. voltaa padiglione; sp. bóveda de claustro.
Klosterkirche, Münster, die imGegensatz zu der gr. K. (»Katho-likon«) meist langgestreckte Kircheeines Klosters, die in der Regel ander Nordseite des Kreuzgangs liegt.Sie folgt den jeweiligen Stiltenden-zen, fällt aber auch bei manchenOrden durch Besonderheiten auf.So verwenden Hirsauer und Clu-niazenser manchmal einen recht-eckigen Schluß des → *Chors undvermeiden Westchöre und Krypten.Die Zisterzienser verwenden eben-falls manchmal einen Rechteck-schluß, den sie in einigen Fällendurch Kapellen (Bußkapellen) er-weitern, die in der Regel auch am
Klostergewölbe 282
(Beispiel: Gebweiler,Dominikanerkloster)
A Kreuzgang B SakristeiC KapitelsaalD ParlatoriumE Calefactorium
Kloster (Beispiel: Maulbronn, 12.�13. Jh.)F HerrenrefektoriumG BrunnenhausH LaienrefektoriumJ Lettner
Ostende des Querhauses liegen.Der Mönchschor ist in vielen K.durch einen → *Lettner vom Lai-enschiff getrennt. Die Zisterzien-serkirchen sind ebenso wie die Kir-chen der Bettelorden (Franziskaner,Dominikaner) bis auf kleine höl-zerne Dachreiter turmlos, die Bet-telordenskirchen auch meist ohneQuerhaus und im Langhaus oftflachgedeckt. In der Barockzeit un-terscheidet sich der Typ der K.nicht mehr wesentl. von der Er-scheinungsform anderer Kirchen-bauten. Engl. monastic church; frz. église conven-tuelle; it. chiesa conventuale; sp. iglesia con-ventual, i. monástica.
Klosterziegel, Mönch und Non-ne, eine → *Dachdeckung aus zwei-erlei verschieden geformten Hohl-ziegeln. Engl. Spanish tile; frz. tuile mâle; it. coppo,tegola romana; sp. teja española.
Klotzstufe, Blockstufe, massive→ *Stufe mit rechteckigem Quer-schnitt. Engl. solid step; frz. marche pleine; it. gradi-no a sezione rettangolare; sp. peldaño macizo.
Knagge, in Ständer und Balken-kopf eingezapftes Winkelholz senk-recht zur Wand, das die Balken ver-riegelt und die Vorkragung gegendie Wand konsolenartig abstützt.Die K. ist ähnlich der → Büge,jedoch ein dreieckiges Vollholz undkeine Strebe (→ Fachwerkbau). Engl. dog, brace; frz. chantignole, Aufschieb-ling: gousset; it. mensola di legno, beccatel-lo; sp. egión (ejión).
Knauf, knopf- und kugelförmigesEnde eines Gegenstands, z. B. K.einer Turmspitze, einer Säule (un-genau für Kapitell), eines Türgriffs,→ *Abhängling u. dergl. Engl. capital, knob; frz. chapiteau, tête bou-chon; it. pomo; sp. capitel, piedra de coro-na.
Knickdach → Mansarddach.
Knickgiebel → *Giebel mit ge-brochenen Begrenzungen, z.B. beieinem Mansarddach. It. frontone angoloso.
Kniestock, Drempel → *Dach-konstruktion.
283 Kniestock
Klosterkirche
(Beispiel: Lübeck, Minoritenkirche, M. 14. Jh.)(Beispiel: Istanbul, Pantokratorkirche)
(Beispiel: Cluny, Abteikirche, 3. Periode)
Knolle, Bezeichnung für eineSpielart der → Eckzier, für dieKnospe eines Kapitells (Knospen-kapitell) oder für eine → *Krabbe. Engl. knob, knot; frz. bouton, crochet; it. fo-glia angolare; sp. bollón, botón, capullo delcapitel.
Knorpelwerk, Dekoration (ähnl.dem → *Ohrmuschelwerk) ausknorpelähnl. Elementen, haupt-sächl. der dt. Renaissance im spä-ten 16. und im 17. Jh., manchmalvon naturalist. Formen (Fratzen)durchsetzt. Engl. Renaissance scrollwork; frz. cartilage;sp. adorno de volutas.
Knorre, seltene Bezeichnung füreine knollenförmige Giebelblume. Engl. knot, knurl; frz. crochet en pierre;sp. florón adornado con capullos.
Knospenkapitell, Knollenkapi-tell, ein Kelch- oder Kelchblock-kapitell, das mit plast. volutenarti-gen Knospenstengel geziert ist, bes.in der Spätromanik und Frühgotikhäufig (→ *Kapitell). Engl. bud capital; frz. chapiteau à crochets,c. à bourgeons; it. capitello a ganci, c. a un-cini; sp. capitel adornado con capullos.
Knoten, Knotenpunkt, 1. unbe-wegl. Verbindung von Konstruk-tionselementen (Holz, Stahl oderKombination verschiedener Mate-
rialien) im Gegensatz zum bewegl.Gelenk (→ Gelenk 2). 2. Ver-bindung verschiedener Verkehrs-ströme (Verkehrsk.). Engl. 1. knot, node, junction; frz. n�ud;it. 1. nodo strutturale, 2. nodo stradale;sp. 1. nudo estructural, 2. nodo vial.
Knotensäule, gekuppelte oderVierlingssäulen, deren Schäfte inder Mitte miteinander verknotetsind (→ *Säule). Engl. knotted column; it. colonne ofitiche;sp. columna anudada.
Koffer, oben offene → Caponnièrezur Kommunikation zwischenHaupt- und Außenwerken, nichtgedeckt, zu beiden Seiten mit gla-cisförmiger Brustwehr zum Schutzgegen Flankenfeuer versehen.Engl. box, trunk; frz. coffre; sp. cofre.
Knolle 284
1a Stahlrohrknoten
Knoten
2 Kreuzungsfreier Autobahnknoten
1b Knoten mit höl-zernem Dachwerk
(Hängewerk)
H HängesäuleK KopfbandP PfetteSP Sparren
(Bundsparren)
SR SpannriegelST StrebeZ Zange
Koilanaglyph (gr.), eingetieftes,versenktes Relief, bei dem dieZwischenflächen nicht abgearbei-tet sind, sondern stehen bleiben(→ *Relief). Sp. relieve hundido.
Koinobion (gr.), frühe Bezeich-nung für Kloster im koptischenund gr.-orthodoxen Bereich. It.; sp. cenobio.
Kollegiatkirche, Kollegienkirche,Kirche eines Kollegiums, einer Kle-rikergemeinschaft, die sich auf we-nigen Stiftspfründen (Stiftskirche)neben der Seelsorge bes. der Aus-bildung des Klerikernachwuchseswidmete.
Kolonnade (frz. colonne: Säule),Folge von Säulen mit Architrav zurGliederung von Fassaden und Rah-mung von Platzanlagen und Stra-
ßen im Gegensatz zu → *Arkaden(Bogenreihungen); die K. kann aufeiner oder beiden Seiten auf Säulenruhen. In der Antike, im hellenist.Griechenland und in Italien warenfast alle Tempel, Theater, Thermenund Atrien mit K. versehen; imBarock, Rokoko und Klassizismusreichl. angewandt. Engl., frz. colonnade; it. colonnato; sp. co-lumnata.
Kolossalordnung, Säulen oderPilaster, die samt ihrem Sockelmehrere Geschosse einer Fassadezusammenfassen, entwickelt vonAndrea Palladio im Villenbau derSpätrenaissance und weitergeführtim Barock und im Palladianismus. Engl. colossal order; frz. ordre colossal; it. or-dine colossale, o. gigante; sp. orden colosal.
Kolosseum, Colosseum, Bezeich-nung für das große → *Amphithea-ter in Rom (→ *Säulenbogenstel-lung). Engl. colosseum; frz. colossé; it. colosseo;sp. coliseo.
Kolumbarium (lat. columbarium:Taubenhaus), spätröm. meist un-terird. Grabkammer mit mehrerenübereinander angeordneten Reihenkleiner Nischen zur Aufstellung
285 Kolumbarium
Kolonnade mit gekuppelten Säulen
Kolossalordnung(Beispiel:Vicenza, Palazzo Valmarana,
Palladio)
von Aschenurnen. Solche Anlagenaus dem 1. Jh. n. Chr., von denenin Rom mehrere erhalten sind,konnten bis zu 1000 Urnen auf-nehmen und dienten hauptsächl.zur Beisetzung der Asche vonUnbemittelten (Sklaven, Freigelas-sene). Die weißen Stuckwände sindhäufig mit dekorativen Wand-malereien geschmückt. Engl., frz. columbarium; it. colombario;sp. columbario.
Kommende → Komturei.
Kompositkapitell (lat. composi-tum: zusammengesetzt), aus ver-schiedenen, urspr. nicht zusam-mengehörenden Teilen bestehen-des → *Kapitell. Bekannt vor allemdas in der röm. Baukunst vorkom-mende K., das aus Teilen des ion.und des korinth. Kapitells zusam-mengesetzt ist und bei Antikenbe-
zug späterer Stile wieder aufkommt.Die kleinen Stengelvoluten deskorinth. Kapitells werden durchgroße Voluten über Eierstab desion. Kapitells ersetzt, die jedochdiagonal gestellt die Ecken allan-sichtig betonen. Engl. compose capital; frz. chapiteau com-posite; it. capitello composito; sp. capitelcompuesto.
Kompositordnung, → *Säulen-ordnung mit einem → Komposit-kapitell, aber auch aus Teilen ver-schiedener klassischer Ordnungenzusammengesetzte Ordnung mitvariierten Elementen in Gebälk,Fries und Gesims, bes. in der röm.Baukunst vorkommend. Engl. compose order; frz. ordre composite;it. ordine architettonico composito; sp. or-den compuesto.
Komturei, Kommende, ein odermehrere Ordenshäuser bzw. einOrdensgebiet, bes. des Johanniter-und Deutschritterordens, die einemKomtur zur Verwaltung unterste-hen, zumeist bescheidene, aber re-präsentative Steingebäude mit an-gegliedertem Wirtschaftsbetrieb. Engl. commandery; frz. commanderie;sp. comandancia.
Konak (türk.), urspr. Gasthof undHerberge (Han, → *Karawanserei),dann Regierungspalast einer türk.Stadt.
Konche (gr.-lat. concha: Muschel),halbrunder Anraum mit Halbkup-pel wie → *Apsis, jedoch ohneAltar, auch an profanen Räumen(→ Dreikonchenanlage). Engl. conch; frz. conque; it. conca (absida-le); sp. concha.
Kommende 286
Kolumbarium
Konfessio (lat. Bekenntnis), 1. inaltchristl. und frühma. Kircheneine Vorkammer vor dem unterdem Altare liegenden Grab einesMärtyrers oder Blutzeugen (Con-fessor). Die K. sollte den Gläubi-gen die Annäherung an das Graboder dessen Berührung mit späterals Reliquien verehrten Gegenstän-den ermöglichen, wozu in der Wandzwischen K. und Grab eine Öff-nung war. In karoling. Zeit führteman um das Grab im Halbkreiseinen Gang herum, der über Trep-pen als Zugang zur K. diente. 2.Auch der Hohlraum im Kastenal-tar (→ Altar 2) über einem Hei-ligengrab diente als K. 3. Vielfachwird auch eine mit einem Heili-gengrab ausgestattete → Krypta alsK. bezeichnet. Engl. confessio; it. confessione; sp. confe-sionario, antesala a la tumba de un mártir.
Königsgalerie, Folge von Statuenin einer Galerie, in Nischen oderunter Baldachinen. Die K. bildetden oberen Abschluß einer got.Kathedralfassade in Frankreich,kann aber auch über der Portalzo-ne angeordnet sein, sie diente ab1220 als dominierendes, horizon-tales Gestaltungselement. Ob dieBezeichnung von den königl. Vor-fahren Christi oder von den frz.Königen kommt, ist ungewiß. Engl. gallery of kings; frz. galerie des Rois;it. galleria dei re; sp. galería real.
Königshalle, german. Fürstenhal-le mit Lauben an den beiden Stirn-seiten. Die Eingänge lagen in derMitte der Langseiten und warenüber Freitreppen erreichbar, da dieHalle im Obergeschoß lag. Urspr.Holzbauten sind nicht erhalten.Der Typ der K. lebt noch im→ *Palas späterer → Pfalzen fort. (Abb. S.288)Engl. royal hall; it. sala reale; sp. sala real.
Königshof, eine königl. Hofhal-tung, urspr. ein Wirtschaftshof in
287 Königshof
a Konfessiob Märtyrergrabc Umgang
(Ringkrypta)
Konfessio
Königsgalerie
königl. Besitz (curtis regis oderregalis). In karol.-otton. Zeit alsVersorgungsstützpunkte der könig-lichen Hofhaltung im ganzen Reichverstreut. Sie umfaßten Wohn- undWirtschaftsgebäude, auch eine Ka-pelle, dazu Obstgarten und Fisch-teiche. Der K. war unbefestigt,konnte aber auch befestigt sein, bes.in Hessen, Thüringen und Sach-sen. Sie waren mit Pfalzen verbun-den und gingen später auch in denBesitz der Kirche über. Engl. royal court; frz. cour impériale; it. cor-te reale; sp. corte real.
Königspfalz → *Pfalz.
Konsolbogen → Schulterbogen.
Konsole (frz.), vorspringendesTragelement, im Steinbau ein Krag-stein (Kraft-, Not- oder Balken-stein), auf dem ein Bogen, einGesims (K.gesims), Skulpturen,Balken, Balkone, Erker, Dienste,Gewölbeanfänger u. dergl. ruhen.Eine nur zur Unterstützung vonDiensten und Gewölbeanfängern
vorkommende Sonderform sinddie Hornkonsolen (→ *Anker-stein). Engl. console, corbel; frz. console, corbeau;it. mensola, modiglione; sp. consola, mén-sula, cartela.
Konsolgesims, Konsolgeison, aus-ladendes Gesims, meist Kranz-gesims (→ *Gesimsformen) alsAbschluß eines Gebäudes. DieDeckplatte wird dabei von Konso-len gestützt. K. findet man haupt-sächl. an röm. Tempeln und anPalastbauten der it. Renaissance. Engl. console cornice; it. cornicione conmensole; sp. cornisa con ménsula, moldurac. m.
Kontor (lat. computare: berech-nen), eigentl. Rechenstube, allge-mein Geschäftszimmer eines Kauf-manns, gleichbedeutend mit Büro,auch Bezeichnung für Handels-niederlassungen (Kontorhaus), z.B.der dt. Hanse im Ausland. Engl. counting house, trading post; frz. bu-reau, comptoir; it. ufficio; sp. oficina conta-ble.
Konvent (lat. convenire: zusam-menkommen), urspr. Versamm-lung von Klerikern und Theo-logen, dann auch von Studentenund Parlamentariern. Baugeschicht-lich die Bezeichnung für die Ge-meinschaft der Vollmönche (Kon-
Königspfalz 288
Königshalle (Beispiel: Oviedo, westgot. Königshalle um 750)
Konsole
ventualen) eines Klosters, die nacheiner Ordensregel zusammenle-ben. Diesem Gemeinschaftslebendienen vor allem die Räume derKlausur (→ *Kloster): zunächst warder an der Kirche gelegene Kreuz-gangflügel Versammlungsort desK., dann wurde dafür der Kapitel-saal im Ostflügel des Kreuzgangsausgebildet (frühester Nachweis 2.Hälfte 11. Jh. in Canterbury). AlsK.haus wird der Trakt des Klostersoder der Deutschordensburg be-zeichnet, in dem der → Kapitelsaalliegt. Engl. convent; frz. couvent; it. convento;sp. convento, monasterio.
Konvergenz (lat. zusammenlau-fend), Gegensatz zur → Divergenz.Die Begrenzungen eines Raumes,eines Platzes oder einer Straßenähern einander in Wirklichkeit(ähnlich der Perspektive in der opt.Erscheinung) und verstärken dieWirkung der Perspektive, wodurchGegenstände und Gebäude imZielpunkt einer K. weiter entfernt
erscheinen. Die K. wird oft beiBarockbauten (Rom, Vatikan, ScalaRegia), im Städtebau und in derGartenkunst angewandt.
Kopf, bei Keilsteinen die breitereSeite. Bei Werksteinen und Back-steinen die Ansichtsfläche eines→ Binders (→ Binder 1). Engl. head; frz. tête; it. testa, capo; sp. cabe-za.
Kopfband, im Fachwerkbau dieangeblattete Bohle zwischen Stän-der und Rähm (→ Band). → *Fach-werkbau. Engl. strut; it. contraffisso; sp. tornapunta,cuadral.
Kopfstrebe, im Fachwerkbau diezwischen Ständer und Rahmen ge-zapfte → Strebe. Engl. top plate; frz. contre fiche; it. contra-ffisso; sp. diagonal.
Kopfwinkelholz → Mann.
Korbbogen → *Bogenformen.
289 Korbbogen
Konvergenz(Beispiel: Rom, Vatikan,Scala Regia, Bernini)
Korbgitter → *Fenstergitter.
Korbkapitell, Form des → *Ka-pitells, die korb- bzw. kesselartigvom runden Säulenauflager zumquadrat. Abakus überleitet. Das K.kommt hauptsächl. in der frühby-zantin. Baukunst vor. Es ist meistmit Flechtwerk, seltener mit figürl.Darstellungen versehen. Engl. basket capital; frz. chapiteau corbeille;it. capitello a cesto; sp. capitel con forma decanasto.
Kordongesims, Gurtgesims (→*Gesims).
Kore (gr. Jungfrau), Kanephore→ *Karyatide.
Korinthische Ordnung, Sonder-form der (kleinasiat.) → *Ioni-schen Ordnung, die sich von letz-terer hauptsächl. durch die Formdes korinth. → *Kapitells unter-scheidet. Dieses hat einen Blatt-kelch (Kalathos), bestehend aus 16→ *Akanthus-(Bärenklau-)blät-tern, deren acht einen unterenKranz bilden, während die übrigenacht höher ansteigen. Aus demBlattkranz entwickeln sich acht Vo-lutenpaare, die an den Ecken bzw.in der Mitte einer jeden Ansichts-fläche angeordnet sind. Die über-stehenden Eckvoluten tragen diekonkav eingezogene Abdeckplatte(Abakus), in deren Seitenmitte jeeine Blume (Abakusblume) sitzt.Die (im Gegensatz zum ion. Kapi-tell) gleichartige Ausführung allerAnsichtsflächen sicherte dem ko-rinth. Kapitell bald allgemeine Ver-breitung, vor allem in der prunk-liebenden, spätröm. Baukunst. Inder röm. Baukunst tritt an die Stel-le des Zahnschnitts der kleinasiat.-
ion. Ordnung das Konsolgesims.Zwischen den weitausladendenKonsolen sind in der Untersichtdes Gesimses Kassetten mit Blu-
Korbgitter 290
1 Krepidoma 2 Basis 3 Schaft4 Kapitell5 Epistyl
(Architrav)
6 Fries7 Zahnschnitt8 Geison9 Sima10 Tympanon11 Akroterion
Korinthische Ordnung
men oder Rosetten eingefügt. Fallsein Fries vorhanden ist, kann dieserauch wie bei der att.-ion. Ordnungmit Emblemen (Bukranien), Waf-fen u. dergl. dekoriert sein. Engl. Corinthian order; frz. ordre corin-thien; it. ordine corinzio; sp. orden corintio.
Kornhaus, städt. Speicherhaus fürKorn; außer den eigentl. Lager-und Speicherräumen muß ein K.noch einen Saal zur Abhaltung derGetreidebörse, einige Kontore undVerwaltungsräume enthalten. Engl. grain silo; frz. grenier; it. granaio;sp. granero, silo.
Korridor (it. corridore: Laufgang),Gang zwischen zwei Zimmer-fluchten oder Verbindungsgang imInneren eines Gebäudes. Engl. corridor; frz. corridor, couloir; it. cor-ridoio; sp. corredor, pasillo.
Kotierte Projektion, graph. Dar-stellung eines Objekts, wobeidie Höhenentwicklung über demGrundriß durch in diesen eingetra-gene Höhenkoten (Maßzahlen)festgehalten wird, z. B. bei Land-karten (→ *Projektion). Eine Art derK. P. liegt den Plandarstellungender Gotik zugrunde (→ *Bauriß). Frz. projection à cotes; it. proiezione quo-tata; sp. proyección acotada.
Kraal, afrikanisches Dorf, meist inder Form eines Rundlings. Engl. craal, kraal; it. kraal; sp. poblado afri-cano, corral.
Krabbe, Kantenblume, Knolle, got.Kriechblume an den Kanten von→ *Fialen, Wimperggiebeln, Turm-pyramiden u. dergl. Engl. crocket; frz. crochet, crosse; it. gatto-ne, foglia rampante; sp. capullo rastrera queadorna un borde, flor r. q. a. u. b.
Kraftstein, Not- oder Balken-stein, ein Kragstein als Auflager fürMauerlatte oder Balken (→ *Kon-sole, → *Ankerstein). Engl. (stone) corbel, console; it. mensola,beccatello; sp. modillón de piedra, ménsula.
Kragbalken, über eine Mauer hin-ausragender Balken. Engl. cantilevered beam; frz. poutre en por-te à faux; it. trave a sbalzo; sp. viga en salien-te, v. e. voladizo.
Kragbogen → unechter Bogen ausKragsteinen (→ *Unechtes Gewöl-be). Engl. cantilevered arch; frz. arc à joints hori-zontaux, a. en encorbellement, faux arc; it.arco fittizio; sp. arco en saliente, a. e. voladizo.
Kragdach, Konsoldach, auskra-gendes und nur an einer Seiteeingespanntes Dach, hauptsächl.über Rampen, Freitreppen u. dergl.(→ *Dachformen). Engl. cantilevered roof; frz. toit en encor-bellement, t. en porte à faux, t. en saillie;it. pensilina, tetto a sbalzo; sp. cubierta ensaliente, c. e. voladizo.
Kragstein, Kraft-, Not-, Balken-stein, auskragender Stein, der eineLast aufnehmen kann (→ *Kon-sole, → *Ankerstein). Engl. bracket, corbel; frz. corbeau; it. becca-tello, mensola di pietra, modiglione; sp.ménsula, zapata.
Kragsturzbogen, auf zwei viertel-kreisförmigen Kragsteinen ruhen-
291 Kragsturzbogen
Krabbe
der gerader Sturz, also kein echterBogen. Engl. shouldered arch; frz. linteau surcoussinets; sp. arco sobre almohadillas.
Kragträger, Konsolträger, frei aus-kragender Träger, der nur an einemEnde eingespannt ist (→ *Auskra-gung). Engl. cantilevered girder; frz. poutre en porteà faux; it. trave a sbalzo; sp. viga en saliente,v. e. voladizo.
Krämpziegel → *Dachdeckung,→ Kremper. Sp. tejas a reborde.
Krankenhaus, → *Hospital, Spi-tal, Gebäude zur medizin. Versor-gung und Heilung von Kranken.Die ersten K. des Abendlandes ent-stehen im frühen MA. als kirchl.Einrichtungen, entweder auf Ini-tiative des Diözesanbischofs in derStadt (→ Hospital) oder im An-schluß an ein Kloster (→ Infir-marie). Der St. Galler Klosterplanum 830 enthält einen K.bereichmit eigener Kapelle, einem Arzt-haus und einem Arzneikräuter-garten. Im 13. Jh. beginnen nebenden Mönchsorden (Hospitaliter,Hippolytbrüder) und Ritterorden(Deutscher Orden, Kreuzherren,Johanniter) auch Städte, Spitäler zubauen, deren Aufgabe neben derKrankenpflege auch die Versor-gung von Armen und Invaliden ist.Diese zumeist Heilig-Geist-Spitalgenannten K. waren Ausdruck derstädt. Wohlfahrtspolitik und zu-gleich große Bauobjekte. Ende des12. Jhs. entstehen weit vor denToren der Stadt Siechenhäuser alsneuer K.typ. Die Hospitäler zeigenallgemein eine einfache baul. Or-ganisation: der großräumige, un-
unterteilte, zumeist auf Holz-stützen flachgedeckte Krankensaalsteht mit der Hospitalkirche inunmittelbarer räuml. Verbindung.Erst im SpätMA. werden die Räu-me mehr differenziert und die sichentwickelnden Holzunterteilun-gen des Krankensaals zu festenRaumbildungen geführt. Es ent-stehen vielteilige Baugruppen umarchitekton. gestaltete Höfe. Nochim 18. Jh. sind die K. im wesentl.nur Bettenhäuser mit bescheide-nen Behandlungsräumen. Erst im19. Jh. entwickelt sich das K. zueinem selbständigen, differenzier-ten Gebäudetyp, vor allem dasPavillonsystem wird bevorzugt,wegen Unwirtschaftlichkeit ersetztdurch das Trabantensystem mitblockartigem Hauptbau und selb-ständigen Abteilungen in Pavillon-art; beim Kammersystem hängenmehrere Bettenflügel mit derenniedrigen Behandlungstrakten aneiner verbindenden Poliklinik. BeimBlocksystem liegen die Bettenhäu-ser in einer Reihe nebeneinander,Behandlungs- und Wirtschaftstrak-te sind ihnen rechtwinklig zugeord-net. In den 1930er Jahren werdenzunehmend Kompaktanlagen invielgeschossiger Bauweise bevor-zugt, bei denen die Bettenstationhorizontal dem Behandlungsbe-reich zugeordnet ist. Immer stärkerwird der diagnost. Bereich des K.ausgebaut. Engl. hospital, infirmary; frz. hôpital; it. os-pedale; sp. hospital.
Kranz, 1. Gewölbe-, Kappenkranz,selbständig gemauerter Gewölbe-bogen zwischen der Gewölbeflächeund einer in diese einschneiden-den Stichkappe (→ *Gewölbe). 2.
Kragträger 292
Bei Turmhelmen die horizontaleBalkenkonstruktion (→ *Dachkon-struktion). Engl. wreath, garland; frz. couronne; sp. co-rona.
Kranzgesims → *Gesims.
Kratzputz → Sgrafitto.
Krematorium (lat. cremare: ver-brennen), Gebäude für die Ein-äscherung, die im Gegensatz zurhistor. Leichenverbrennung aufScheiterhaufen nicht auf kult. Vor-stellungen, sondern auf hygien.und ökonom. Gründe zurückgeht.Das erste dt. K. wurde 1878 inGotha in Betrieb genommen. DasK. besteht aus der Feierhalle unddem Verbrennungsraum, dazu Auf-bahrungs-, Warte- und Personal-
räume. Die Feierhalle bestimmtdie architekton. Erscheinung. Engl. crematorium; frz. crématorium; it., sp.crematorio.
Kreml, Verteidigungs- und Ver-waltungszentrum ma. russ. Städte.An erhöhter Stelle oder in einemFlußdreieck errichtet, mit Erdwäl-len oder Holz-Erde-Mauern, spä-ter mit Steinmauern und Türmenumgeben. Im K. befanden sichFürstenhof, Kirchen, Klöster undVerwaltungsbauten. Im 18. Jh. ver-loren die K.anlagen ihre strateg.Bedeutung. Engl.; sp. kremlin; frz. Kremlin; it. cremlino.
Kremper, Krämpziegel, Fittig-ziegel, im Querschnitt die Formeiner ~ mit Nase auf der Unter-seite, die konkave Seite wird durch
293 Kremper
1 Griechisches Kreuz 2 Lateinisches Kreuz 3 Andreaskreuz4 Antoniuskreuz (Taukreuz)5 Ankerkreuz6 Malteserkreuz
7 Henkelkreuz, ägyptisches Kreuz8 Doppelkreuz9 Päpstliches Kreuz10 Patriarchenkreuz11 Russisches Kreuz 12 Wiederkreuz
Kreuze
die konvexe des nebenliegendenZiegels überdeckt. Auch mit Stegauf der einen und konkaverAufbiegung auf der anderen Seiteversehen. Seit dem 12. Jh. nachge-wiesen, entwickelt aus der Mönch-,Nonne- und Leistenziegeldek-kung. → *Dachdeckung. Engl. flap tile; frz. tuile à bord retroussé;it. tegola coppo-canale; sp. teja a reborde, t.de encastre.
Krepidoma, Krepis, Stereobat(gr.), Stufenunterbau und Funda-ment eines antiken Bauwerks, vorallem des Tempels (→ Tempelbau,→ *Dorische Ordnung). Engl. crepidoma; it. crepidine; sp. estereó-bato.
Kretische Säule → *Säule mitnach unten verjüngtem, hölzer-nem Schaft, polsterähnl. Kapitellund Abakus. Engl. Cretan column; frz. colonne crétoise;it. colonna cretese; sp. columna cretense.
Kreuz, für die Baukunst wichtigeKreuzformen sind: gr. K. mitgleich langen Armen (Zentralbau),lat. K. mit längerem Hauptarm (Kir-chengrundriß), Antoniusk. als T-förmiges Gebilde (Kirchengrundrißmeist aber mit Apsis), Andreask. alsX-förmiges Gebilde, Hakenk. beim→ Mäander. (Abb. S. 293)Engl. cross; frz. croix; it. croce; sp. cruz.
Kreuzaltar → *Altar der Gemein-de, der in Klosterkirchen, Stifts-kirchen oder Kathedralen westl. desChors unter dem Triumphbogensteht, häufig mit dem → Lettnerverbunden.
Kreuzanker → *Anker, dessenSplint kreuzförmig ausgebildet ist.
Kreuzarme, Kreuzflügel, unge-naue Bezeichnung der Querhaus-arme (→ *Querhaus) zu beidenSeiten der Vierung einer Kirche. Engl. transept arms; frz. croisillon, aile detransept; it. bracci del transetto; sp. alas decrucero, brasos d. c.
Kreuzband, eisernes Band inKreuzform als Beschlag von Tür-und Fensterflügeln. Engl. cross stay, saltier-cross-bar; frz. ferrureen croix; it. bandella a croce; sp. herraje encruz.
Kreuzblume, First-, Giebelblumein Grund- und Aufriß kreuzförmi-ges, stilisiertes Blattgebilde, auchzweifach übereinander, als Bekrö-nung von → *Fialen, Wimpergen,Turmpyramiden u. dergl., bes. inder Gotik. Engl. crop, finial; frz. crosse, fleuron; it. fio-re cruciforme; sp. pináculo, florón.
Krepidoma 294
Kreuzblume
Kreuzbogen, Diagonalbogen einesGewölbes (→ *Gewölbeformen). Engl. cross springer, groin arch; frz. croiséed�ogive; it. ogiva, arco diagonale; sp. arcoojival.
Kreuzbogenfries → *Fries auseinzelnen einander überschneiden-den Bogen. Engl. interlacing arches; frz. frise en arca-tures intersectées; it. fregio ad architettiintrecciati; sp. friso de arcos ojivales, arcosentrelazados.
Kreuzdach, Kreuzgiebeldach,Dach, das aus einander rechtwink-lig überkreuzenden Satteldächernüber quadrat. Grundriß besteht, bes.auf Türmen (→ *Dachformen). It. tetto a crociera; sp. techo en cruz.
Kreuzfahrerburg, Burg derKreuzfahrer in Palästina. Engl. crusader�s castle; frz. château des tem-pliers; it. castello crociato; sp. castillo de loscruzados.
Kreuzflügel → Kreuzarme.
Kreuzgang (Ambitus), um denRechteckhof einer Klausur ange-legter, flachgedeckter oder gewölb-ter Gang, in dem Prozessionen miteinem Kreuz abgehalten wurden.Der K. bildet mit der Kirche dasKernstück eines → *Klosters. Engl. cloister; frz. cloître, clôture; it. chios-tro; sp. claustro.
Kreuzgewölbe, Kreuzkappenge-wölbe, Gewölbe, das durch Ver-schneiden zweier gleich hoher Ton-nengewölbe entsteht (→ *Gewöl-beformen). Engl. cross vault; frz. voûte d�arêtes, v. croisée;it. volta a crociera; sp. bóveda cruciforme.
Kreuzgiebeldach, Kreuzdach(→ *Dachformen).
Kreuzgratgewölbe, ein → Kreuz-gewölbe, dessen Kappen in Gratenzusammenstoßen. Engl. groin vault; frz. voûte d�arêtes; it. voltaa crociera; sp. bóveda con aristas en cruz.
Kreuzholz, 1. Bauholz, das durchkreuzweise geführte Schnitte ausdem Ganzholz gewonnen wird. 2.→ Riemchendecke. Engl. diagonal struts, St. Andrew�s cross;frz. bois croisé; sp. maderas cruzadas.
Kreuzkappe, Kappe eines Kreuz-gewölbes (→ *Gewölbeformen). It. unghia, vela; sp. cubertura de una bóve-da en cruz.
Kreuzkappengewölbe → *Ge-wölbeformen.
Kreuzkuppelkirche, kuppelüber-deckte Kirche über dem Grundrißvon der Form eines gr. Kreuzes.Der nicht einheitl. definierte Be-griff wird sowohl für Kirchen mit
295 Kreuzkuppelkirche
Kreuzkuppelkirche(Beispiel: Périgueux, S. Front, 12. Jh.)
fünf Kuppeln (drei Kuppeln in je-der Achse), als auch für Kirchen mitmittlerer Hauptkuppel und vierbzw. mehreren Eckkuppeln in derDiagonale zwischen den tonnenge-wölbten Kreuzarmen angewendet.Der letztgenannte Typ bildet denAusgangspunkt für die osteurop.Kirchenbaukunst. Sp. iglesia con cúpulas cruzadas.
Kreuzpfeiler → *Pfeiler vonkreuzförmigem Grundriß, meistan Knotenpunkten von Mauern(Vierungspfeiler u. dergl.). Engl. cruciform pier; frz. pilier en forme decroix; it. pilastro cruciforme, p. a croce;sp. pilar cruciforme.
Kreuzrippe, Diagonalrippe einesKreuzrippengewölbes im Unter-schied zu den Gurtrippen bzw.Gurtbogen. Engl. cross rib; frz. ogive, nervure de croi-sée; it. nervatura della crociera; sp. nerviodiagonal de bóveda de cruceriía.
Kreuzrippengewölbe, Kreuzge-wölbe mit unterlegten Rippen(→ *Gewölbeformen). Engl. ribbed vault; frz. voûte à croisée d�ogi-ves; it. volta a crociera a nervature, volta acrociera a costoloni; sp. bóveda con nerviosen cruz.
Kreuzstaken, kreuzweise ange-ordnete Latten zur gegenseitigenVersteifung (→ *Abkreuzung) vonBalken einer Balkenlage. Engl. contrefiches en croix, croix de Saint-André; it. sbadacchio a croce; sp. puntalesen cruz.
Kreuzstock, Fensterstock mitKämpferholz und Pfosten, die einFensterkreuz bilden (→ Fenster). Frz. fiche diagonale; it. crociera della fi-nestra; sp. cruz de ventana.
Kreuzstrebe, in einer Fachwerk-wand (→ *Fachwerk) sich über-kreuzende, hölzerne Streben (→ An-dreaskreuz). Engl. diagonal strut; it. diagonali di rinfor-zo; sp. diagonales de refuerzo.
Kreuzverband → *Mauerwerk,bei dem zu beiden Seiten der Mit-telachse eines Läufers ein Binderangeordnet ist. Engl. cross bond; frz. contre-fiches en croix;it. concatenamento a croce; sp. trabazóncruzada.
Kriechblume, Kantenblume, →*Krabbe.
Krone, obere Fläche von → *Mau-ern, Wällen u. dergl. Engl. crown; frz. couronne; it. corona; sp. co-rona.
Kronendach, Ritterdach, →*Dachdeckung, bei der jede Dach-latte zwei Reihen versetzter Biber-schwänze trägt. Engl. high-pitched roof; frz. toit couronné,toit en cavalier; it. tetto a corona; sp. tejadode corona.
Kronwerk, Kronenwerk, großehalboffene Schanze als Außen-werk, die dem Hornwerk ent-spricht, jedoch mit mittlerer, vor-stehender Lünette, d.h. ein Werk,dessen Stirnseite aus zwei bastio-nierten Fronten, zwei geradenFronten und einer mittleren Spitz-bastion besteht und das seitl. etwasenkrecht gegen die Hauptumwal-lung laufende Flügel hat. Frz. ouvrage couronné; sp. trabajo u obracoronada.
Kröpfen → *Verkröpfung.
Kreuzpfeiler 296
Kropfkante, vorstehender Grateines verkröpften kantigen Bau-elementes (→ *Verkröpfung). It. nervatura a gomito; sp. canto acodado.
Kropfleiste, Zierleiste (meist Kymaoder Viertelstab) unter einem Gei-son (→ Ionische Ordnung). Frz. gueule redressée; sp. listón acodado.
Kröpfling, Krümmling, gewun-denes Verbindungsstück zweierTreppenwangen (→ *Treppe). Engl. string wreath; frz. claveau à crosette;sp. curva del ojo de escalera.
Kropfstein, Bogenstein mit ver-zahnten Fugenflächen. Die Ver-zahnung kann hakenförmig sein(→ *Hakenstein), nimmt aber inder islam. Baukunst oft auch rei-chere Profilierungen an.
Kröpfung → *Verkröpfung.
Krümmling → Kröpfling.
Krüppelwalmdach, Dach, beidem nur der obere Teil des Giebelsabgewalmt ist (→ *Dachformen). Engl. half hip roof; frz. toit à demicroupe,toit à croupe boiteuse; it. tetto a falde spez-zate; sp. recho de cuatro aguas.
Krypta (gr. überdeckter Gang),Gruft, gewölbter Raum unter demChor der Kirche, aus unterirdi-schen Grab- und Reliquienkapel-len (→ *Konfessio), über denen der
297 Krypta
Krypta (Stollenkrypta)(Beispiel: Steinbach/Odenwald,
Einhardsbasilika, 9. Jh.)
Hallenkrypta
Altar errichtet war, hervorgegan-gen; zunächst ein gewölbter Gang(→ Stollenk.), der Apsis folgendauch ringförmig (Ringk.), spätermehrschiffig (→ Hallenk.); auchaußerhalb des Kirchengrundrissesals Außenk. Im MA. wird auch einNeben- oder Eingangsraum, bes.das gewölbte Untergeschoß von→ *Westwerken, oder ein Neben-chor als K. bezeichnet. Die K. bil-det in der Regel einen Bestandteilder Kirchenanlage; sie ist als Raumunter dem Ort der Eucharistie einwichtiger Bedeutungsträger derzentralen Idee von Tod und Auf-erstehung. Die K. ist eine Syntheseaus verschiedenartigen vor- undfrühchristl. Kult- und Bautraditio-nen, die seit dem frühen MA.durch den Märtyrer-, Reliquien-und Grabkult der röm. Kirchevorwiegend in Mitteleuropa zu-stande kam. Die Überbauung derHeiligengräber durch Kirchen seitkonstantin. Zeit erbrachte in viel-fältiger Weise räuml. und kult. Zu-sammenhänge von Gemeindegot-tesdienst, Märtyrerverehrung undPilgerverkehr. Die im späten 6. Jh.auftretenden Bauformen und ihreEntwicklung � die Anfänge liegenim 5. Jh. in Nordafrika und Spa-nien � sind nördl. und südl. der Al-pen ähnl. Engl. crypt; frz. crypte; it., sp. cripta.
Kübbung → Abseite.
Kudu (ind.), Tschaityagiebel, Gie-bel einer → *Tschaityahalle.
Kuf, Kuff, ein statt auf Schalungauf einer Kufe, einem bewegl., jededer zur Längsachse parallelen Stein-scharen unterstützenden Lehrholz,
gemauertes Tonnengewölbe ist »aufKuf gemauert«. Sp. cimbra, cintra.
Kugelfries → *Fries.
Kugelgewölbe → *Kuppel.
Kugelhaus, Haus in Kugelform,das zum ersten Mal als Idealent-wurf von Claude Nicolas Ledouxfür ein Flurwächterhaus auftritt(1806). Engl. spherical house; frz. maison sphéri-que; it. edificio sferico; sp. edificio esférico.
Kugelkappe, Kalotte, Kugelab-schnitt, dessen Pfeil geringer alsder Halbmesser ist (→ Kuppel). Engl. spherical calotte; frz. coupole aplatie,calotte; it. calotta sferica.
Kumbha (ind.), ausgebauchtesElement einer indischen Säule, dasmanchmal ein Kapitell trägt.
Künette → Abzugsgraben.
Kübbung 298
Auf Kuf gemauertes Gewölbe
Kugelhaus. Entwurf für einFlurwächterhaus von C.N. Ledoux
Kuppel, Gewölbe- und Dachform,deren Mantelfläche in der Regelein Kugelabschnitt ist. Die der K.adäquate Grundrißfigur ist derKreis, doch können verschiedenar-tige Grundrisse mit K. überwölbtwerden. Bei einem quadratischenGrundriß kann der Fußkreis der K.umschrieben werden, wobei dieüberstehenden Segmente entfallen(→ Hängek.). Ist die zu überwöl-bende Fläche kleiner als das Grund-quadrat, so entsteht eine → *Böhm.Kappe (Stutzkuppel). Als Flachk.
(Stichkugelgewölbe) bezeichnetman eine K.form, deren Wölbungvon einem Kugelabschnitt (Kalot-te) und nicht von einer Halbkugelgebildet wird, so daß ihr Stichgeringer als der Halbmesser ist.Eine → Halbk. (Konche) hat vier-telkreisförmigen Querschnitt überhalbkreisförmigem Grundriß. EineSpitzk. ist eine K. mit spitzbogigemQuerschnitt, eine Zwiebelk. hatzwiebelförmigen Querschnitt, eine→ Faltkuppel hat einen gefaltetenRücken, d.h. nach außen konvex
299 Kuppel
1 Kuppel auf Tambour2 Hängekuppel 3 Böhmische Kappe
(Stutzkuppel)4 Flachkuppel5 Halbkuppel (Konche)6 Spitzkuppel
7 Zwiebelkuppel8 Faltkuppel9 Schalenkuppel10 Hohlkörperkuppel11 Rippenkuppel12 Kassettenkuppel
Kuppel
13 Systemskizze: a Tambour b Kuppelc Laterne
d Opäum (Auge)e Pendentiff Trompe
vorspringende Teile zwischen tie-fen Furchen. Eine Ellipsenk. isteine K. über ellipt. Grundriß. AlsÜberleitung vom Quadrat zu einereingeschriebenen K. kann manPendentifs oder Trompen verwen-den. → Pendentifs sind Eckzwickelin der Form sphär. Dreiecke, alsoKugelausschnitte, die seitl. durchzwei Viertelkreise und oben durchein Viertel des Fußkreises der K.begrenzt sind. → *Trompen sindTrichternischen, also halbe Hohl-kegel, deren Spitzen in den Eckendes umgeschriebenen Quadrates
liegen. Eine klare Überleitung istdies jedoch nicht, weshalb sichTrompen auch besser dazu eignen,von einem Quadrat zu einem acht-eckigen Klostergewölbe überzulei-ten. Will man eine K. über denUnterbau hinausheben, so kannman ein zylindr. Zwischenstück(Tambour, Trommel) einschieben.K. sind die typ. Gewölbeformen fürquadrat. und kreisrunde → *Zen-tralbauten. Letztere können anzwei, drei oder vier (Vierkonchen-anlage) Seiten halbkuppelüber-wölbte Nischen haben, deren Schei-tel den Fußkreis der K. berühren.Diese rahmenden Halbkreisni-schen können selbst wieder vonkleineren radialen Halbkreisni-schen begleitet sein. Bei Langbau-ten mit Querhaus können K. überder Vierung, manchmal aber auchüber quadratischen Teilräumen desLanghauses (→ *K.basilika), desChors und des Querhauses vor-kommen. Eine Sonderform dieserArt ist die → *Kreuzk.kirche. Es istauch mögl., K. in beliebiger Zahlneben- bzw. hintereinander zu rei-hen und dazwischen Stützen anzu-ordnen. Auch eine Reihung vonEllipsenk. ist mögl., wobei aller-dings zwischen den K. tiefe Ein-schnitte (Zwickel) entstehen. Diekonstruktiv einfachsten K. sindnach dem Prinzip des → *unechtenGewölbes mit horizontalen Lager-fugen errichtet. Konzentr. Ringe,die nach oben zu immer kleinerwerden, überlagern einander. DerQuerschnitt ist bienenkorbförmigoder einer Spitzk. angenähert. Beider echten K. sind sämtl. Fugen aufden Krümmungsmittelpunkt ge-richtet. Die K. kann massiv gemau-ert, aber auch als Rippenk. mit fül-lenden Kappen ausgeführt sein.
Kuppel 300
(Beispiel: Neresheim, Klosterkirche 2. H. 18. Jh.)
(Beispiel: Todi, S. Maria dellaConsolazione, 16. Jh.)
Sind diese Kappen segelförmig ge-bläht, so spricht man von einem Se-gelgewölbe (Schirmgewölbe). Sinddie Rippen untereinander in derHorizontalen durch Stege ver-spannt, so entsteht eine Kassettenk.Aus konstruktiven, aber auch ausformalen Gründen kann die K.zweischalig ausgebildet sein, wobeidie innere Schale stärker ausge-führt und mit der äußeren Schale(Schutzk.) durch Stege verbundenist. Zur Entlastung können auchHohlkörper in die K.schale einge-baut sein. Die Belichtung der K.bereitet einige Schwierigkeiten, da(bes. bei Spitzk.) die Gewölbeflä-che und vor allem der Scheitel imDunkel liegen. Die K. kann durchTambourfenster, durch Fenster imK.fuß (hauptsächl. bei den Rippenk.der Byzantiner), durch Fenster inder K.schale und durch Öffnungdes K.scheitels (Opaeum, Auge,Nabel) belichtet werden. Über derScheitelöffnung ist meist eine wei-tere kleine Tambourk. (Laterne) auf-gebaut. Verschiedene dieser Mög-lichkeiten können auch zusammenangewandt werden. Engl. cupola, dome; frz. coupole, dôme;it. cupola; sp. cúpula.
Kuppelbasilika, 1. Basilika, de-ren Mittelschiff aus einer Folgevon Kuppeln besteht (Sonderform:→ *Kreuzkuppelkirche). 2. Basilikamit einer Kuppel über der Vierung. Engl. 2. domed basilica, dome-shaped b.;frz. 2. basilique à coupole; it. 1. basilica connavata a cupole, 2. b. con cupola; sp. 2. basí-lica con cúpula.
Kuppeldach, Haubendach, Dach-haube, Dach mit geschweifterKontur (→ *Dachformen). In derind. Baukunst ein abgestuftes Dach
mit verschiedenen kleinen Kup-peln (→ *Ratha). Engl. domed roof; frz. toit à coupole; it. tet-to a cupola; sp. cubierta en cúpula.
Kuppeldachhaus, Urform desHauses mit einer oder mehrerenvon Kuppeln überwölbten Zellen(→ *Trulli).
Kuppelgrab, Grabbau aus einerdurch einen Dromos zugängl.Spitzkuppel (ein unechtes Gewöl-be) und einer kleineren Grab-kammer. Die ganze Anlage war miteinem Erdhügel überdeckt. Engl. tholos tomb; it. tomba a cupola;sp. tumba en cúpula.
Kurie (lat.), Wohnung eines Ka-nonikers oder Stiftsherrn, zumeist
301 Kurie
Kuppelbasilika
Kuppelgrab(Beispiel: Mykenae, sog. Schatzhaus des
Atreus)
Einzelhäuser im Immunitätsbezirkum die Kirche. Engl., it. curia; frz. curie; sp. curia.
Kurtine (frz.), der Wall zwischenden Bastionen einer Festung, davordie Außenwerke. Engl. curtain; frz. courtine; it., sp. cortina.
Kurvatur, 1. kaum merkl., jedochfür die baul. Erscheinung wichtigeKrümmung der Horizontalen ein-zelner Bauteile (Stylobat, Gebälkusw.) des antiken Tempels. 2.Kurvenförmige Grundrißprojek-tionen von Gewölberippen, haupt-sächlich in der spätesten Gotik(→ *Gewundene Reihung). Engl. curvature; frz. courbure; it., sp. curva-tura.
Kyma, Kymation (gr.: Welle), kon-kav oder konvex ausgebildete Stäbe(Blattwellen) als Abschlußleistezwischen einzelnen Bauelementen.Das dor. K. ist eine unterschnitte-ne, sonst aber nicht profilierteLeiste, die mit abstrahierten Blatt-gebilden bemalt ist. Das ion. K.zeigt plast. ovale Gebilde (Eier-stab), die durch schmale Hohlstegegetrennt sind. Ob dies auch eine
Abstraktion von Blattformen seinsoll, ist umstritten. Das lesb. K.besteht aus einer Folge von Herz-blättern des Wasserlaubs mit da-zwischenliegenden senkrechten Stä-ben. Sein Profil ist konkav-konvex.Spätere Kymatien sind mit Akan-thus, Palmetten und Medaillonsgeschmückte Viertelstäbe. Engl.cyma; frz. cyma, moulure; it. cyma,kymation, cimasa; sp. cimacio, gola.
Kymation → Kyma.
L
Labyrinth (gr.), wahrscheinl. Hausder Doppelaxt (labrys) und somitBezeichnung für den Palast zu
Kurtine 302
Kymaa dorisch b ionisch c lesbisch
Labyrinth(Beispiel: Knossos, Palast)
Labyrinth in der Kathedrale von Chartres
Knossos, später allgemein für einGebäude mit unübersichtl. Grund-riß. In der Gotik sind L. im Fußbo-den mancher Kathedralen einge-meißelt. In der Barockzeit bezeich-net man ein Boskett mit verwickel-ter Wegführung zwischen denHecken als L. (Irrgarten). Engl. labyrinth; frz. labyrinthe; it. labirinto;sp. laberinto.
Laconicum (lat.), saunaartigesLuftschwitzbad, gehört wie dasDampfschwitzbad zu den Badean-lagen hellinist. Zeit, zu den röm.Thermen und zu den Gymnasien.Die Räume sollten nach Vitruvrunden Grundriß und eine Kuppelmit einer Öffnung darin haben.
Lacunar (lat.), vertieftes Feld einerKassettendecke (→ *Kassette).
Laden, 1. Verschluß eines Fensters(→ *Fensterl.). 2. Verkaufsraum.Der Name kommt vom urspr.Verschluß des Verkaufsstands mitmeist horizontal geteilten L., des-sen unterer L. als Verkaufstisch, derobere als Schutz gegen Sonne undRegen diente (→ Ladenbauten). Engl. 1. shutter, 2. shop; frz. 1. volet, con-trevent; it. 1. imposta, 2. negozio; sp. 1. pos-tigo, 2. negocio.
Ladenbauten, Einrichtung desEinzelhandels. Aus dem Verlegender Werkstätten in Hintergebäudeentwickelte sich der aus dem Ver-kaufstisch hervorgegangene → La-den als selbständige Raumeinheitzunächst im Erdgeschoß der Wohn-häuser, entsprechend schon in derröm. Antike. Seit dem 18. Jh. ent-standen überwölbte Ladenreihen,sog. »Gewölbe«, in einer repräsen-tativen Architektur entweder alsMarktbauten oder an städtebaul.
bevorzugten Standorten, häufigmit vorgelegten Kolonnaden, im19. Jh. als glasgedeckte Passagen.Seit der Mitte des 19. Jhs. wurdendie L. zur Straße hin geöffnetdurch Gußeisenstützen und größe-re Schaufenster; in den 1920erJahren kam es zur Auflösung derAußenwand. Steigende Ansprücheim 20. Jh. führten zu immer rei-cheren Innenausstattungen, schließ-lich nach 1945 zum Selbstbedie-nungsladen und damit zur Aufgabeder Ladentheke. Engl. shop buildings; sp. locales comercia-les.
Ladenpassage → Ladenbauten.
Ladenzeile, aneinandergefügte→ Ladenbauten.
Lady Chapel, der Maria geweih-te und nach außen vorstehende→ *Scheitelkapelle am Ostende ei-ner engl. Kathedrale.
Lageplan, Grundrißzeichnung instark verkleinertem Maßstab (meistunter 1:500), auf der die Lage einesBauwerks in seiner Umgebungdargestellt ist. Im L. werden dieGrenzen eines Grundstücks, dieNachbargrundstücke bzw. Gebäu-de und die angrenzenden Straßenund Plätze dargestellt. Engl. site plan; frz. plan de situation, tracégénéral; it. planimetria; sp. plano general deubicación.
Lager, 1. Auflager. 2. L.flächen vonSteinen, wobei das untere L. dasharte L., das obere das weiche L. ge-nannt wird. Gegensatz: das Haupt,d.h. die Stirnfläche der einzelnenSteine des Mauerwerks (→ *Mau-erwerk). 3. Verschanztes, von Grä-
303 Lager
ben, Wällen usw. umschlossenesStand- oder Marschlager bzw. Re-fugium. Engl. 1., 2. bed, seam, 3. camp; frz. 1. appui,2. couche, gisement, lit, 3. camp; it. 1. ap-poggio, 2. fascia, piatto; sp. 1. apoyo, 2. base,3. campamento.
Lagerbauten → *Speicher.
Lagerfuge, waagrechte → Fuge imMauerverband, die sich im Bogenals Radialfuge bis zur Vertikalenerhebt. Engl. bed joint, bed course; frz. joint de lit,joint d�assise; it. giunto orizzontale, g. diposa.
Lagerhaftes Mauerwerk, lager-haft nennt man Bruchsteine, wennsie zwei platte Seiten haben unddaher gut zum Vermauern ge-braucht werden können. Bei L. M.sind infolge der Lagerhaftigkeit derBruchsteine alle Lagerfugen annä-hernd waagerecht. Engl. coursed masonry; it. muratura in pie-tra sbozzata; sp. mampostería en piedra decantera lisa.
Lagerhaus → *Speicher.
Lagerholz, in der Regel 10 × 10bis 10×12cm dickes Kantholz, dasbei massiven Decken zur Auf-lagerung und Befestigung eineshölzernen Fußbodenbelags anstelleeiner Balkenlage, im Abstand vonca. 80cm, angeordnet wird. Engl. floor batten; frz. bois gisant; it. travet-to, travicello; sp. madera escuadrada, cuartón.
Laibung, Leibung, oft schräg ver-laufende Begrenzung (Gewände)einer Maueröffnung bei → *Bo-gen, → *Fenstern, Portalen u. dergl.Engl. jamb; frz. embrasure; it. imbotte; sp.jamba.
Laibungsbogen, innerer Ab-schlußbogen über einer Fensterni-sche (→ *Estrade). Engl. back arch; frz. arrière-voussure; sp. ca-pialzado.
Laienaltar, in Stifts- und Klo-sterkirchen der meist freistehendan der Westseite des Lettners ange-ordnete → Altar. Engl. lay altar, rood a.; it. altare davanti altramezzo; sp. altar secular.
Laienrefektorium, → Refekto-rium der Laienbrüder in einem→ *Kloster des Zisterzienserordens.
Laienschiff, Platz für die Ge-meinde im Langhaus einer Kircheim Gegensatz zum Priester- bzw.Mönchschor, im MA. durch Chor-schranken oder Lettner, späterdurch Gitter abgetrennt. It. navata per il pubblico; sp. nave secular.
Lambrequin (frz.), zackenförmigoder geschweift ausgeschnittenerQuerbehang mit Quasten ausStoff, Metall oder Holz, bes. häufigim Barock in Architektur, Plastikund Kunstgewerbe, auch als L.bo-gen oder gelappter Bogen die Formder Stoffbordüre imitierend. Frz. lambrequin; it. lambrecchini.
Lambris (frz.), Bezeichnung fürHolz-, Marmor- oder Stuckver-kleidungen auf dem Sockel vonInnenwandflächen. Frz. lambris; it. lambrì; sp. revestimiento dezócalo interior.
Lamellenbau, in Holz-, Stahl-oder Aluminiumblech ausgeführte,»netzartige«, »bogenförmige«, »bin-derlose« Tragwerke bis zu 30 mSpannweite. Die einzelnen Lamel-
Lagerbauten 304
len, die das Netzwerk bilden, beste-hen aus gleichen, hochkant gestell-ten Bohlenhölzern oder Blechen,die serienweise hergestellt werden.Der Aufbau des Dachs, der vonden Seiten zur Mitte erfolgt, bedarfnur eines leichten Gewichts; der L.kann ohne großen Arbeitsaufwandund ohne Werkstoffverlust abge-baut und andernorts wieder aufge-stellt werden. Frz. construction en lamelles; sp. construc-ción en láminas.
Landhaus → Villa.
Landpfeiler, Landfeste, bei Bo-genbrücken (→ *Brücke) der amUfer stehende Endpfeiler einerBrücke. Engl. land pier; it. pila in golena; sp. soporteen seco de puente en bóveda.
Landwehr, letze, vorgeschobeneSperre (Mauern, Gräben, Wälle,Gebück, Palisade) zur Sicherungeines Gebiets. Engl. militia, yeomanry; frz. landwehr; it.fortificazione confinaria; sp. fortificacióndefensiva.
Langbau, Longitudinalbau, imGegensatz zum Zentralbau einBauwerk, bei dem die Längsachsedominiert. Engl. structure built on the axial principle;frz. construction longitudinale; it. edificio apianta longudinale; sp. construcción deplanta longitudinal.
Langhaus, Teil der Kirche zwi-schen Fassade bzw. Westbau undQuerhaus bzw. Chor. Engl. nave; frz. nef centrale; vaisseau c.;it. navata centrale; sp. nave central.
Längsachse → *Achse.
Längsoval, ungenau für eine El-lipse, deren längere Achse sich mitder Hauptachse eines Raums deckt,im Gegensatz zu Queroval. Engl. longitudinal oval; it. pianta a ovalelongitudinale; sp. planta de óvalo longitudi-nal.
Längsverband, Windverband beimSparrendach durch Windrispen,beim Kehlbalkendach durch Räh-me, beim Pfettendach durch Pfet-ten hergestellt. Zur Verstärkung desLängsverbands werden zwischenden Pfetten bzw. Rähmen und densie tragenden Stielen Kopfbänderoder Streben angeordnet. Engl. horizontal (longitudinal) bracing,it. controventatura (di falda del tetto); sp. tra-bazón longitudinal.
305 Längsverband
Queroval (Beispiel: Rom, S. Andrea al Quirinale)
Längsoval (Beispiel: Salzburg, Dreifaltigkeitskirche)
Längswandbauweise, das in derVergangenheit übliche konstrukti-ve Prinzip des Hausbaus im Gegen-satz zur Querwandbauweise. DieGeschoßdecken des Hauses wer-den auf die äußeren und ein oderzwei innere Längswände aufgela-gert, dadurch bleiben die Giebel-wände unbelastet und könnengroße Fenster- und Türöffnungenerhalten, bes. bei aufgelösten Fron-ten der Patrizierhäuser der Gotikund Renaissance. Engl. longudinal wall construction; frz. con-struction en murs longitudinaux; sp. con-strucción en muros longitudinales.
Lang- und Kurzwerk, in derengl. Baukunst die Eckquader des→ *Mauerwerks (Turm), die ab-wechselnd mit der längeren bzw.kürzeren Seite einbinden. Engl. long-and-short-work; frz. assemblageen longueur; sp. ensamble combinado.
Lanzettbogen → *Bogenformen.
Lanzettfenster, schlankes Fen-ster mit überhöhtem Spitzbogen-abschluß (→ Lanzettbogen), bes. inder engl. Frühgotik häufig in Grup-pen angewandt. Engl. lancet window; frz. fenêtre en lan-cette; it. finestra (ad arco) lanceolato, f. ogi-vale; sp. ventana lanceolada.
Lararium (lat.), im röm. Hauseine Nische für die tägl. Verehrung
der Lares, Penates, des Genius,aber auch anderer Götter; das L.hatte seinen Platz im Atrium amHerd, im städt. Haus in der Kücheoder im Schlafzimmer. Engl. lararium; frz. laraire; it., sp. larario.
Lasche, ein leistenartiges Holz-oder Metallstück, das zur Ver-bindung über einen Stoß genagelt,genietet oder geschraubt wird. Engl. fish plate; frz. entamure; it. listellocoprigiunto; sp. cubrejunta.
Lateinisches Kreuz, im Gegen-satz zum gr. → *Kreuz eine Form,deren senkrechter Arm länger istals der Querarm. Das L. K. bildetdie Grundfigur vieler Langbauten. Engl. Latin cross; frz. croix latine; it. crocelatina; sp. cruz latina.
Laterne (lat. lanterna: Lampe),in der Baukunst ein lichteinlassen-der Aufsatz über einer Decken-bzw. Gewölbeöffnung, meist überder Scheitelöffnung (Auge) einer→ *Kuppel oder eines Klosterge-wölbes. Engl. lantern; frz. lanterne; it. lanterna;sp. linterna.
Latrine (lat. latrina: Kloake), diemit Wasserspülung eingerichteteAbtrittsgrube, d.h. der mit der Kloa-kengrube unmittelbar verbundene→ *Abtritt. Engl. latrina, latrine; frz. latrines; it. latrina;sp. letrina.
Latte, schmaler, dünner Holz-streifen als Dachlatte (2,5 × 5,0 �3,0 × 6,0 cm) zur Aufhängung derZiegel, Spalierlatte (2,5 × 2,0 cm)oder Putzträger. Engl. lath; frz. latte; it. listello, corrente,cantinella; sp. listón.
Längswandbauweise 306
Lang- und Kurzwerk
Laube, 1. kleines Gartenhaus inleichter Holzkonstruktion. 2. Halle(z. B. Gerichtslaube), gewölbterBogengang oder Halle auf Pfeilernoder Säulen an der Front eines Ge-bäudes (Loggia), auch im Hof(L.hof), auch zweigeschossig. DieL. können bei unmittelbar anein-andergebauten Häusern an derStraßenfront auch durchlaufendangeordnet sein. 3. → Loge. Engl. 1. arbour, bower, 2. porch, portico,arcade; frz. 1. maisonnette de jardin, 2.arcades; it. 1. frascato, 2. loggiato, 3. palco;sp. 1. pabellón, glorieta, 2. porche, galería,corredor exterior, 3. palco.
Laubengang → Laube 2, → *Lau-benganghaus.
Laubenganghaus, Haus, dessenGeschoßwohnungen nur über ei-nen Laubengang zugängl. sind. It. casa a ballatoio; sp. edificio con corredo-res exteriores.
Laubenhaus, Typ eines ostdt.Bauernhauses mit Laube an Gie-bel- oder Traufseite, hauptsächl. imOder- und Warthegebiet sowie inOstpreußen vorkommend. Engl. garden house; frz. maison à arcades;sp. tipo de granja con galerías.
Laubkapitell, got. Kelchkapitellmit → Laubwerk oder Blattwerk. Engl. foliated capital; it. capitello a fogliami;sp. capitel lobulado.
307 Laubkapitell
Laube 2 (Beispiel: Bruck/Mur, Kornmesserhaus, um 1500)
Laubenganghaus
Laubenhaus
Laubwerk, → Blattwerk, haupt-sächl. an → *Friesen (Blattfries, Ky-mation) und → Kapitellen (Blatt-kapitell). Engl. foliage; frz. feuillage, rinceau; it. orna-mento a fogliame; sp. ornamento de follaje.
Lauf, eine ununterbrochene Stu-fenfolge zwischen zwei Geschos-sen oder zwei Podesten einer Trep-pe (→ *Treppenformen), minde-stens drei Stufen, mit oder ohneRichtungsänderung, gebogen, ge-wendelt oder versetzt. Engl. flight; frz. volée (d�escalier); it. rampa;sp. huella de escalera.
Laufender Hund, laufende Welle,ein fortlaufendes gr. Ornament,das im Gegensatz zum eckig gebro-chenen → Mäander abstrahierten,sich überschlagenden Wasserwo-gen gleicht (→ Fries). Engl. running dog, Vitruvian scroll; frz.méandre, bandes de vagues; it. can cor-rente; sp. meandro.
Läufer, im → *Mauerwerk der mitseiner Langseite parallel zur Mau-erflucht liegende Stein, im Gegen-satz zum → Binder, dessen kurzeSeite (Stirn, Haupt) in der Mauer-fläche liegt. Engl. runner; frz. paneresse, meule cou-rante; it. mattone di fascia; sp. soga, hilada.
Läuferverband, Längsverband,ein nur aus → Läufern bestehendes→ *Mauerwerk. Engl. stretcher bond, longudinal b.; frz. ap-pareil en paneresses; it. concatenamento acortina, c. di fascia; sp. trabazón de hiladas.
Laufgang, Gang in der Mauer-dicke, auf einem Mauerrückenoder auf vorkragenden Konsolen inden oberen Teilen der Fassade(→ *Galerie) oder im Obergaden
einer Kirche (→ *Triforium). DerL. verdankt seine Entstehung derseit dem 11. Jh. im Kirchenbau derNormannen beginnenden Ten-denz zur Auflösung und Gliede-rung der Wand. Engl. gallery, wall passage; frz. galerie, pas-sage; it. galleria, passaggio; sp. galería, pasaje.
Lavabo (lat.), symbol. Hände-waschung in der hl. Messe nachder Opferung nach dem An-fangswort des bei ihr zu betendenPsalmes 25 »Lavabo inter innocen-tes �«. Im späteren MA. wird eineNische (piscina) in der Wand ne-ben der Epistelseite des Altars mitEinrichtung für diese Händewa-schung sowie auch für die zweiteAusspülung des Kelches nach derKommunion geschaffen. Das kannauch in der Sakristei erfolgen, wosich bes. in der Renaissance und imBarock recht große und reich gestal-tete Einrichtungen für die Hände-waschung vor der hl. Messe finden,die dann auch als Lavabo benutztwerden. Das L. kann auch nebeneiner → Piscina angeordnet sein. Engl., frz., it. lavabo; sp. lavamanos.
Lavatorium (lat.), Lavacrum,Waschbecken, bes. → Brunnenhausim Klosterkreuzgang (→ Lavabo,Piscina). Engl., frz. lavatory; it. lavatorium; sp. lavatorio.
Lawra, (gr. Straße), Laura, Be-zeichnung für ein gr. Mönchs-kloster, bei dem die Zellen um eingemeinsames Zentrum gruppiertsind; hauptsächl. in Rußland vor-kommend und dort als Bezeich-nung für verschiedene Klöster ver-wendet. Engl. lavra; frz. laure, lavra; it. laura, lavra;sp. laura.
Laubwerk 308
Leergespärre, Leergebinde, beiDachkonstruktionen die Gespärre,die ledigl. aus den Sparren gebildetwerden und die, im Gegensatz zuden Bundgespärren (Haupt- oderVollgebinden), keine Stuhlsäulen,Kehlbalken usw. enthalten, derenDreieck also leer ist. Engl. intermediate rafters; frz. ferme deremplage, couple de r.; sp. cabio intermedio.
Lehmbau(weise), mit ungebrann-tem Lehm im Unterschied zum→ Backsteinbau. Dem Lehm wirdgehäckseltes Stroh o.ä. beigemengt,um eine erhöhte Festigkeit zu er-reichen (→ Lehmstampfbau, Lehm-patzenbau, Lehmwellenbau, Lehm-fachwerk). Engl. mud walling; frz. construction enterre glaise; it. costruzione in argilla; sp. con-strucción en arcilla.
Lehmfachwerk, Holzfachwerk,dessen Gefache mit Lehmsteinenausgesetzt oder als Lehmwickel-stakung mit Strohlehmwickeln aus-gestakt werden. Die Stakhölzer be-stehen aus Rundknüppeln oderLatten, die mit Strohlehm umwik-kelt und in fettem Lehmbrei ausge-rollt werden bis zu einer Dicke von15 cm. Die Gefache werden mitFlechtwerk aus Holzstöcken aus-gefüllt und von beiden Seiten mitStrohlehm beworfen. Frz. construction en treillis de bousillage;it. costruzione a traliccio tamponata conargilla; sp. construcción con entramado enarcilla.
Lehmpatzenbau, Ausführungvon Lehmmauern aus luftgetrock-neten Lehmsteinen (Lehmpatzen),die in der Regel 20 × 20 × 30 cmoder größer messen. Als Bindemit-tel zwischen den Patzen dient dün-ner Lehm. Die Herstellung der
Lehmpatzen erfolgt entweder durchEinstampfen naturfeuchten toni-gen Lehms in entsprechende Holz-formen, oder es werden Hand-strichformen verwendet, wobei derLehm mit Wasser angemacht undmit Häcksel, Heidekraut u.ä. ver-setzt wird. Nach drei bis sechsWochen Trockenzeit sind die Stei-ne gebrauchsfertig. Frz. construction en briques en limon, c. deglaise; it. costruzione in mattoni d�argilla;sp. construcción con ladrillos de arcilla.
Lehmputz, mit Häcksel gemisch-ter Lehm zur Dichtung des dieGefache eines Fachwerkbaus aus-füllenden Flechtwerks (Staken).Zum Schutz gegen Witterung wirder gekalkt. Zu diesem Zwecke wirddie Oberfläche künstl. mit einemKamm oder Pferdestriegel aufge-rauht, wodurch eigenartige Orna-mente entstehen. Auch bei Lehm-bauten wird vielfach Putz ausdünnem Lehm verwendet, der mitSpreu, Haaren oder Fasern versetztist. Er wird als Außenputz mit Kalk-milch überschlämmt; der Überzugist häufig zu erneuern. Als Innen-putz ist L. weit verbreitet gewesen. Engl. mud plaster; frz. enduit en argile; it. in-tonaco d�argilla; sp. estuco de arcilla.
Lehmstampfbau, zwischen eineHolzschalung eingestampfter Lehm;die Schalung wird je nach demFortschreiten der Arbeiten ver-setzt. Engl. rammed loam construction; frz. con-struction en pisé; it. costruzione in argillacompressa; sp. construcción con arcilla api-sanada.
Lehmtenne, festgestampfterLehmboden entweder in der Scheu-ne oder in Hofnähe zum Dreschen
309 Lehmtenne
des Korns oder als Fußboden inBauernhäusern und frühen Holz-kirchen. Frz. cabane de bauge, c. de bousillage; it. bat-tuto, terra battuta; sp. piso de arcilla.
Lehmwellenbau, älteste und ein-fachste Lehmbauweise; eine Mi-schung von Lehm und unge-schnittenem Stroh, Ginster oderHeidekraut wird mit Mistgabelnzu einer Mauer zunächst breiteraufgeschichtet, als die Mauer end-gültig werden soll. Nach demSetzen wird sie dann innen undaußen schichtweise mit dem Spa-ten abgestochen. Frz. construction en torchis; sp. construc-ción con adobes.
Lehre, allgemein jede Vorrichtung,durch die eine beabsichtigte Formerreicht werden soll (→ *Lehrge-rüst, Schablone). Engl. Blechlehre: gauge, calibre, am. caliber;frz. in der Schlosserei: calibre, Schweißlehre: ga-barit, positionneur, Musterlehre: cherche;it. Lehrbrett, Werkzeug: sagoma, dima, Mu-ster: modello, campione; sp. plantilla.
Lehrgerüst, hölzernes Hilfsgerüstzum Bau eines Gewölbes oder ei-nes Bogens. Engl. centering; frz. armement de voûte,charpente de v., Rippengestell: canevas decintre; it. centinatura; sp. cimbra, cintra.
Lehrgespärre, 1. Sparrenpaar, ge-gen das die Grat- und Kehlbalkengeschiftet werden. 2. Das als Mu-ster für die anderen dienende, zu-erst verzimmerte, auf der Zulagevorgelegte Sparrenpaar. Engl. falsework; frz. chevrons directeurs,arêtiers; it. 1. capriata maestra, 2. capriatacampione; sp. cabriada maestra.
Leib, bei Säulen der senkrechteSchaft unter dem Kapitell und bei→ *Fialen der untere Teil. Frz. corps, fût; it. fusto; sp. fuste.
Leiste, stabartiges, oft profiliertesElement aus Holz, Metall oderdergl., das eine Fuge verdeckt(Deckl.), Bretter konstruktiv ver-bindet (Einschubl.), zwischen Fuß-boden und Wand (→ *Sockell.→ Fußl.) bzw. Wand und Decke(Kehll.) eingefügt ist. Engl. moulding, am. molding; frz. listel, lis-teau; it. lista, listello; sp. listón.
Leistenziegel, platter, an beidenLangseiten mit schmalen Leistenoder Stegen versehener Dachziegel(tegula), deren Stöße mit einemHohlziegel (imbrex) überdecktwerden. Im röm. Reich nachVorstufen in Griechenland (6. Jh. v.Chr.) verbreitet, im frühen MA.nördl. der Alpen weiterverwendet. Engl. lip; it. embrice; sp. tejuela de listones.
Lehmwellenbau 310
k KeileLehrgerüst für einen Bogen
Leiste1 Deckleiste 2 Einschubleiste
3 Sockel-(Fuß-)leiste4 Kehlleiste
Lesche (gr.), Versammlungshallein einem Säulengang (→ Stoa). Engl. lesche; sp. sala de reunión en un peri-stilo.
Lesegang, in Benediktiner- undZisterzienserklöstern ein zumeistder Kirche zugewandter Flügel desKreuzgangs, in dem Vorlesungenaus den Kirchenvätern, der Or-densregel usw. abgehalten wurdenstatt im Kapitelsaal.
Lesepult, hohes Pult, das an dieStelle der Ambone teils alsEpistelpult, teils als Evangelien-pult, teils als Bestandteil der Kanzelund des Lettners trat. Engl. lectern; frz. pupitre, letteron; it. leg-gio; sp. pupitre de lectura.
Lettner (lat. lectorium, lectionarium,1261 lettener = Lesepult), über-mannshohe, durchbrochene undmeist gegliederte Mauer (Schran-kenl.), mit Kanzel (Kanzell.) oderräumlich (Hallenl.) in Kloster- undStiftskirchen, selten in Pfarrkir-chen, zwischen dem Chor derMönche und Geistlichen und demLaienraum, mit zwei Durchgängenund einer über Treppen vom Chorzugänglichen Bühne (Doxal) zurVerlesung von Epistel und Evan-gelium an Festtagen, zur Reliqui-enweisung, der Ablaßverkündung,für Proklamationen oder zurAufstellung von Chören. L. tretenan die Stelle der cancelli (Chor-schranken). Vor dem L. stand dervornehml. dem hl. Kreuz geweihteLaienaltar; in seltenen Fällen sindAltäre auf der erhöhten L.bühnebekannt. Bes. die L. des 13. Jhs.trugen ein umfangreiches plasti-sches Bildprogramm, das sich vor-wiegend auf den Kreuzaltar bezog.
Später trat die ornamentaleGestaltung in den Vordergrund.Die meist zwischen den westl.Vierungspfeilern stehenden L. wur-den nur selten, z. B. bei einigenKlosterkirchen, ins Langhaus vor-geschoben. Das Verbreitungsgebietbeschränkt sich auf West- undMitteleuropa, in Italien nur selten.Im Verlaufe der Spätgotik wurdeder L. immer mehr durchbrochen,im 16. Jh. weitgehend aufgelöst undim Barock durch Chorgitter ersetzt.Engl. rood screen; frz. jubé; it. pontile;sp. muro articulado que separa el coro deltrascoro.
Letze, selten gebrauchter Begrifffür → *Wehrgang.
Leuchtturm, Feuerturm, turmar-tiger Bau an der Küste oder imMeer, der oben in seinem Kuppel-raum (Lampenraum) eine starkeLichtquelle (Leuchtfeuer) trägtund dessen erhöhte Lage einegroße Sichtweite (bei 20 m Höheca. 25 km) gewährleistet. Der L.wird aus Backsteinen mit Klinker-verblendung, Werksteinen, Betonoder Eisen errichtet, heute zumeistmit rundem Querschnitt. Im In-
311 Leuchtturm
Gotischer Lettner
nern ist er durch Zwischendeckenin einzelne, durch Innentreppenmiteinander verbundene Räumeunterteilt: Kraftmaschine, Vorrats-räume, Wohnraum des L.wärters,im Kuppelraum die Beleuchtungs-vorrichtungen und darauf der Flag-genstock. Die Beleuchtungseinrich-tungen bestehen aus der Lichtquelle(Petroleumlampen, Azetylenglüh-licht, elektr. Bogen- oder hochker-zige Glühlampen) und den opti-schen Einrichtungen (Blenden, Pa-rabolspiegel, Gürtellinsen), die dasvon der Lichtquelle ausgestrahlteLicht sammeln und als dichtesLichtbündel in die vorherbestimmteRichtung aussenden. Der bekannte-ste L. war 300/279 v. Chr. von So-stratos von Knidos auf der InselPharos vor Alexandria errichtet wor-den. Techn. Verbesserungen wurdenerst 1791 durch die Einführung desparabol. Hohlspiegels erreicht. Engl. light house; frz. phare; it., sp. faro.
Levitenstuhl → Dreisitz.
Lichte, Lichtes, Lichtmaß, im Lich-ten, die Öffnung eines Fensters,einer Tür, die inneren Maße einesRaums, die Entfernung zwischenzwei Pfeilern oder Gewänden,zwischen Fußboden und Decke. Frz. vide; it. luce; sp. vano.
Lichte Maße, die freien Abständezweier einander entsprechendenBauteile (lichte Weite und lichteHöhe einer Maueröffnung, einesDurchganges). Die lichte Höheeines Raumes ist die Raumhöhezwischen Fußbodenober- und Dek-kenunterkante. Frz. Innenmaß: largeur, dimension intérieure,lichte Höhe: hauteur du jour; it. misureinterne; sp. dimensiones interiores.
Lichtgaden, Gaden, → Oberga-den, oberer, durch Fenster belich-teter Teil (Gaden) des Mittelschiffseiner → *Basilika. Engl. clerestory; frz. claire-voie, cléristère;it. claristorio; sp. sobretecho con ventanaslaterales.
Lichthof, ein meist von einemGlasdach überdeckter Hof in ei-nem Gebäude. Engl. atrium; frz. patio, arrière-cour; it. cor-tile con copertura di vetri, c. a lucernario;sp. patio interior con techo de vidrio.
Lichtschacht, → *Schacht zurBelichtung von Räumen unter demErdboden oder innerhalb einesBaukörpers. Engl. light well, l. shaft; frz. rayère, bouchede lumière; it. pozzo di luce, tromba a vetri,gabbia a v.; sp. ducto de luz.
Lichtspindel, Schneckenauge,Treppenauge, offene Spindel einer→ *Wendeltreppe. Engl. round (staircase) well; frz. fût creux;it. pozzo di scala elicoidale; sp. pozo de unaescalera de caracol.
Liegender Dachstuhl → *Dach-konstruktion.
Lierne (frz.), Zwischenrippe imFächer- und Netzgewölbe, dieweder von einem Kämpfer noch
Levitenstuhl 312
Lichthof
von einem zentralen Schlußsteinausgeht. Engl. lierne rib; frz., it. lierne; sp. aristasecundaria, nervio s.
Lingam (ind.), Linga, pfahlähnl.Gebilde als Zeugungssymbol inder → Garbha Griha des ind. Tem-pels (→ *Mandapa).
Lisene (frz. lisière: Rand), schwachvortretende, senkrechte, im Mau-erverband gemauerte Mauervor-lage, selten mit Basis und kleinemKämpfer (im Unterschied zum→ Pilaster ohne Kapitell), häufigdurch Blendbogen oder Bogenfriesverbunden. In der Romanik bevor-zugtes Mittel zur Wandgliederung. Engl. lesene; frz. lisière; it. lesena; sp. refuer-zo de pilar.
Lithokollete (gr.), Einlegearbeitin verschiedenfarbigem Steinmate-rial.
Liwan (arab. el Iwan), zum Hofgeöffnete, überwölbte Haupthalledes arab. → *Wohnhauses. Der L.kommt auch in der Mittelachse dervier Hofseiten einer → *Medresevor.
Loculus (lat.), Arcosolium, → *Ni-schengrab zur Aufnahme von Be-stattungen in den → *Katakomben.
Loge (frz.), nur zum Innenraumgeöffnete Empore für Besucher inKirchen, Sälen und vor allem im→ *Theaterbau. Engl. loge, box; frz. loge; it., sp. palco.
Loggia (it.), offene → *Laube bzw.Säulenhalle eines Bauwerks, ver-einzelt auch als selbständige offeneSäulenhalle an it. Plätzen. In derRegel tritt die L. nicht über dieBauflucht hervor. RepräsentativeL. finden sich an Palästen seit derit. Renaissance häufig, im 19. /20.Jh. auch an Krankenhäusern undHotels, aber auch im Wohnbau. Engl., frz., it. loggia; sp. logia.
Lohstein, got. Gewölbestein ausgebranntem Ton (Backstein), bes.leicht durch Beimengung von Ger-berlohe, die durch den Brenn-vorgang zerstört wird und dadurchHohlräume entstehen läßt. Engl. perforated brick; frz. brique tanisée;it. pietra artificialmente porosa; sp. ladrilloartificialmente poroso.
Longitudinalbau → Langbau.
Lopatka (russ.), lisenenartigeWandgliederung mit Kämpfer undmeist ohne Basis, oft auf Konsolen.Sie dient dem Fassadenschmuckslaw. Steinbauten, entwickelt aus
313 Lopatka
Lisene (Beispiel: Maursmünster,Klosterkirche, 12. Jh.)
dem ostslaw. Blockbau, wo sie alssenkrechte Bohle zum Schutz derHirnhölzer dient. Engl. lopatka; sp. estructura mural rusa.
Lotosfenster, ind. Fensterform.
Lotossäule, ägypt. → Säule miteinem Lotoskapitell, auch alsBündelsäule (→ Kapitell). Engl. lotus column; frz. colonne en lotus;sp. columna loto.
Lucht (→ *Auslucht 2), hauptsächl.in Norddeutschland vorkommen-der Begriff für einen Giebel übereinem Joch des Kirchenschiffs(→ Zwerchgiebel).
Luftschacht, → *Schacht zurBelüftung von Räumen, die durchFenster nicht oder nur ungenü-gend belüftet werden können. Engl. ventilating shaft; frz. conduite de ven-tilation; it. pozzo di ventilazione; sp. con-ducto de ventilación.
Luginsland → Wachtturm.
Lukarne (frz.), Zwerchhaus,Zwerghaus, Luchte, ein über einerFassade aufsteigender, im Unter-schied zur → Gaube nicht zurückge-setzter Dachaufbau mit einemZwerchdach, einem quer zumHauptdach verlaufenden First undhäufig reich im Umriß gestaltetenGiebel (Zwerchgiebel); im frz.Profanbau des 13.�17. Jhs. sehr ver-breitet und von dort bes. auf Re-naissance- und Barockschlösser Eu-ropas ausgestrahlt, bedingt durchdie spätma. Gewohnheit, die gro-ßen Dachräume der Schlösser undPalais für Wohnzwecke zu nutzenund die großen Säle im oberstenGeschoß anzuordnen und in den
Dachraum auszudehnen. Die L.wird dann mit dem unter ihr be-findl. Fenster zusammengezogenund durchstößt dabei das Dach-gesims, daraus entstehen zusam-mengebundene Fensterachsen, dieim reichgestalteten Zwerchgiebelder L. ihren bekrönenden Ab-schluß finden. In der 2. Hälfte des17. Jhs. wird die L. durch die→ Mansarde abgelöst. Engl., frz. lucarne; sp. lucarna.
Luke, durch Klappe (Holzladen)zu verschließende Luftöffnungoder Fenster ohne Glas. Engl. hatch, eyelet; frz. écoutille, �illet;it. finestrino; sp. tragaluz, claraboya, esco-tilla.
Lünette (frz. lunette: kleinerMond), 1. kleineres, gerahmtes,teilweise dekoriertes Bogenfeldüber Türen und Fenstern, das imUnterschied zum → *Tympanonnicht eingetieft, sondern auf dieRahmung aufgesetzt ist, bes. in derRenaissance und im Barock an-gewandt. 2. Halbrunde Fenster biszu kleinen halbkreisförmigen→ *Dachfenstern (→ Froschmaul).3. Auch Brille, aus zwei Facen undzwei kurz eingezogenen Flankenbestehendes, vorgerücktes Werk,das durch einen gedeckten Gangmit der Festung verbunden ist,einer Bastion ähnl., entweder als
Lotosfenster 314
Lukarnen oderZwerchhäuser. Renaissance
Teil einer Reihe von Außenwerkenvor dem Hauptgraben oder einWerk auf dem Glacis oder in wech-selndem Abstand vor dem Glacisgelegen, bisweilen mit einer Pali-sade oder einer krenelierten Mauerversehen. Engl., frz. lunette; it. lunetta; sp. luneto.
Lustschloß, Lusthaus, als Garten-haus in der Gartenkunst der Re-naissance aufkommend, diente dasL. zunächst zur Aufnahme desGartensaals, in Italien zu einemeigenen Bautyp mit umfangrei-chem Raumprogramm ausgebildet(→ Villa), im 2. Drittel des 16. Jhs.nördl. der Alpen zum anspruchs-
vollen ausgedehnten L. in fürstl.Gärten verfeinert, in der weiterenEntwicklung unter it. EinflußSchwerpunkt des Gartens und mitdiesem in enger Verbindung als einnur zu vorübergehendem Aufent-halt im Sommer eingerichtetes re-präsentatives Gebäude. Im 18. Jh.unter frz. Einfluß zu höchsterEleganz und Vollkommenheit ge-kommen (Maison de plaisance)und auf Europa ausstrahlend zu-meist als eingeschossiger Bau umden beherrschenden Gartensaalangelegt. Unter dem Einfluß derAufklärung wird die Einheit vonGarten und L. zurückgedrängt,und es entstehen die Gartenhäuser(→ Belvedere). Engl. pleasure palace; frz. château de plai-sance; it. residenza estiva, castello di cam-pagna; sp. residencia estival, palacio derecreo.
M
Mäander (gr. nach dem vielge-wundenen kleinasiat. Fluß Maian-dros), fortlaufendes Ornament mitrechtwinkliger Richtungsänderung.Der M. ist hauptsächl. Bestandteilantiker → *Friese. Falls die Höhen-teilung zwischen den waagerech-ten Linien eine gerade Zahl vonZwischenräumen ergibt, sprichtman von einem att. M., bei ungera-der Zahl von einem kleinasiat.Wenn M.formen überlagert sind,ergibt sich im Kern des Ornamentsdie Grundform des Hakenkreuzes.Eine kurvierte Sonderform des M.ist der → Laufende Hund. Engl. meander, Greek key; frz. méandre,bande à la grecque; it., sp. meandro.
315 Mäander
Lünette
Lustschloß(Beispiel: München, Nymphenburg,
Amalienburg)
1 Hundekammer 2 Toilette 3 Kabinett4 Schlafzimmer
5 Saal6 Zimmer7 Kabinett8 Küche
Macellum (lat.), Markthalle(hauptsächl. für Fleisch) einer röm.Stadt.
Magazin (frz.), Vorratshaus, Lager-raum, bes. für Bücher, auch Laden. Engl. magazine, ware-house; frz. entrepôt;it. magazzino, fondaco; sp. almacén, depósito.
Mammisi, → *Geburtshaus, ägypt.Tempel der Spätzeit.
Mandapa (ind.), Halle vor demKultsymbol (Lingam) eines ind.Tempels.
Mandara, Maq�ad (arab.), Emp-fangshalle des Hausherrn im arab.Wohnhaus, hauptsächl. in Ägypten.
Manier (it.), 1. Begriff der it.Kunsttheorie des 14.�18. Jhs. füreinen individuellen Stil oder eineEpoche. 2. In der Festungsbau-kunst durch waffentechn. und takt.Erfordernisse bestimmte Ausbil-dung einheitl. Befestigungen desbastionären Systems. Engl. manner; frz. manière; it. maniera;sp. 1. estilo, 2. desarrollo del sistema de ba-luartes, d. d. s. d. bastiones.
Mann, im Fachwerkbau ein Stän-der, in den je zwei sich überschnei-dende Kopf- und Fußstreben bzw.dreiviertelhohe Fußstreben undKopfwinkelhölzer eingreifen.
Männerseite, der südl. Teil derKirche, in dem die männl. Gemein-demitglieder während des Gottes-dienstes sitzen als Folge der imFrühchristentum und im MA. üb-lichen Geschlechtertrennung, vonder sich noch Reste bis ins 20. Jh.erhalten haben (→ Epistelseite).Engl. epistle-side; frz. côté de l�épître; it. latodegli uomini; sp. lado de la epístola.
Mannsloch, Schlupfpforte, Na-delöhr, in einem Torflügel ange-brachter Durchlaß für Fußgänger. Engl. sallyport; frz. trou d�homme, poternede secours; it. portello; sp. poterna.
Manor House (engl.), unbefestig-tes, mittelgroßes engl. Landhausdes späten MA., in der Neuzeit all-gemein auf engl. Herrenhäuserund Gutshöfe angewandt. Frz. manoir; it. maniero; sp. tipo de casa decampo Inglés.
Mansarddach (frz.), gebrochenesDach, ein Sattel-, Walm-, Pult-oder Zeltdach mit gebrochenenDachflächen (Dachbruch), so daßim Querschnitt jede Dachflächeeinen nach außen gehenden Knickaufweist. Diese → *Dachform, dienach dem frz. Architekten FrançoisMansart benannt ist, aber schon vorihm durch de Clagny ausgeführtwurde, war entwickelt worden, umim unteren Teil des Dachs nochWohnräume einrichten zu können.Für die Ausführung des M. gibt esverschiedene Konstruktionsformen:Kehlbalken- und Pfettendach mit
Macellum 316
Mandapa (Beispiel: Aihole, Lad-Khan-Tempel)a Lingam b Nandin
c Mandapa d Antarala
stehendem oder liegendem Stuhl.Das M. hat sich im Laufe des 17.Jhs. in Frankreich verbreitet, da esim Gegensatz zu dem bis dahin üb-lichen Dachausbau durch → *Lu-karnen eine bessere Ausnutzungdes Dachraums ermöglicht, im18. /19. Jh. allgemein beim Miets-haus im Interesse größerer Renta-bilität verwandt. Engl. mansard roof; frz. comble à la Man-sart; it. tetto a mansarda, techo de la man-sarda.
Mansarde (frz.), ein zu Wohn-zwecken ausgebautes Dachgeschoß,abgeleitet vom → Mansarddach,seit dem 18. Jh. aber allgemeinerBegriff für jedes zu Wohnzweckenausgebaute Dachgeschoß. Engl. attic; frz. mansarde; it., sp. mansarda.
Mantel, Enveloppe, Kette inein-andergreifender Schanzen und Wer-ke zur Sicherung des Hauptwallseiner Festung, oft als tenaillierteEnveloppe ausgebildet. Engl. mantel; frz. manteau; sp. protecciónenvolvente de una muralla.
Mantelmauer, Mantel, HoherMantel, in Höhe und Dicke voneiner gewöhnl. Ringmauer unter-schiedene Schutzmauer, die ent-weder die Hauptburg oder Teiledavon ganz oder teilweise umgibt.Im Gegensatz zur → Schildmauerist die M. nicht als selbständigesVerteidigungswerk eingerichtet. Engl. sheathed wall; sp. muro envolventecircular.
Maq�ad, Makad, Mandara (arab.),Empfangsraum am Vorhof des arab.Wohnhauses, vor allem in Ägypten,in Säulenarkaden geöffnet, ent-spricht dem syr. → Liwan.
Maqsura (arab.), ursprüngl. derBetplatz des Kalifen vor dem Mih-rab einer Moschee. Allgemein auchjeder abgeschlossene Betplatz derMoschee, besonders die durch Git-ter abgetrennten Räume für Frau-en und Schulen.
Marienglas, Fensterverschluß ausGipsspat, ein wasserhaltiger, schwe-felsaurer Kalk in blättriger Kristall-gestalt; er läßt sich leicht in Blätt-chen von beliebiger Dicke spalten,ist farblos und lichtdurchlässig. M.wurde von den Römern und By-zantinern, später im Ostkirchen-bereich und vereinzelt im europ.MA. an Stelle des Fensterglases ver-wandt. Engl. mica, selenite; frz. gypse cristallin, g.en fer de lance; it. mica, selenite; sp. yesocristalino, mica, espejuelo.
Marienkapelle, eine der HeiligenJungfrau Maria geweihte Kapelleim O. des Chors, in England → La-dy Chapel genannt, in Frankreichals Scheitelkapelle eines Chorum-gangs. Engl. Lady chapel; frz. chapelle de la(Sainte) Vierge; it. cappella della madonna,c. della Vergine; sp. capilla de la SantaVirgen.
Marketerie, Marqueterie (frz.),Intarsia, Holzeinlegearbeit aus ver-schiedenfarbigen Edelholzfurnie-ren. Engl. marquetry; frz. marquet(e)rie, mar-quetage, marqueture; sp. marquetería.
Märkischer Verband, PolnischerVerband, → Mauerwerk, ähnl. demGotischen Verband. Engl. flying (monk) bond, Yorkshire bond;it. concatenamento polacco; sp. trabazónpolaca.
317 Märkischer Verband
Markise (frz. marquise: leinenesSonnendach), aufrollbares Son-nendach aus Stoff über Fenstern,Balkonen u. dergl. angebracht. Engl. sun blind, awning; frz., it. marquise;sp. marquesina, toldo, cenefa, persiana.
Markthalle, im Unterschied zu→ *Kaufhaus, → Warenhaus und→ Laden Bezeichnung sowohl füreinen offenen als auch für einengeschlossenen Hallenbau für denGroß- und Einzelhandel. Im 5. /4.Jh. v. Chr. in Griechenland aufoder an der Agora erste gedeckteM. zum Schutz vor Regen undSonne, oft durch Säulenreihen inSchiffe geteilte Hallen mit Pult-oder Satteldach, an einer Langseitedurch eine Säulenreihe geöffnetund an der anderen mit einer fen-sterdurchbrochenen Wand verse-hen, vor der sich zellenartige kleineLäden aneinander reihten. In anti-ken röm. Städten wird die amForum gelegene Basilika zu Markt-und Gerichtszwecken benutzt, da-neben in Großstädten M. für spe-zielle Waren, bes. Fisch. Im MA.dient teilweise das Erdgeschoß desRathauses als M.; erst nach 1500entstehen in Italien und Frankreichmehrschiffige Hallen als gedeckteMärkte. Im 19. Jh. bauen die Städtezur Versorgung der schnell wach-senden Bevölkerung mehrere Zen-tralm. für den Groß- und Einzel-handel, bes. für landwirtschaftl.Produkte (Gemüse-Großm.). Engl. market hall; frz. halle, marché cou-vert; it. mercato coperto; sp. mercado cen-tral cubierto.
Marktplatz, Markt, → *Platz, aufdem der Markt abgehalten wird,meist der Hauptplatz einer Stadtmit dem Rathaus. Im alten Grie-
chenland hieß der M. → *Agora,im röm. Reich → *Forum. Engl. marketplace; frz. place du marché;it. piazza del mercato; sp. plaza del mercado.
Marschhufendorf, Reihendorf,dessen Häuser am Rand einesDeichs aufgestellt sind (→ Dorf-formen).
Marstall, Pferdestallung mit allemZubehör, zumeist zu einem Schloßgehörig. Seit der Renaissance wirdder M. zu einer anspruchsvollenAufgabe, kann dem Schloßkomplexeingegliedert sein und bildet dannentweder einen Flügel des Schlos-ses oder wird in den Wirtschaftshofeinbezogen. Es gibt aber auch selb-ständige, einfache, langgestreckteBaukörper oder Drei- oder Vier-flügelanlagen. Häufig wird dem M.eine Reitbahn angeschlossen. ImBarock wird der M. zu einer wich-tigen Bauaufgabe und unter demEinfluß des Schloßbaus oft festl.überhöht. Der in die Schloßanlageeinbezogene M. kann bis zumarchitekton. Gegenpol des Schlos-ses gesteigert sein. Im späten 18.und im 19. Jh. setzt sich der ge-schlossene M.hof durch, im spätenHistorismus werden wieder barok-ke Lösungen aufgenommen. Engl. (royal) stables, mews; frz. écurie;it. scuderia; sp. caballeriza.
Martelloturm, am Meerufer zurVerhinderung feindl. Landungenerrichteter, mit mehreren Kanonenbesetzter, runder, dicker, gewölbterTurm.
Martyrium (lat.), Martyrion, Me-moria, Coemeterialkirche, ein Bau-werk, das an einem Ort entsteht,der zur Erinnerung an einen Hl.
Markise 318
oder durch eine Reliquie ausge-zeichnet ist. Erste bedeutendere M.durch Konstantin den Großen aufden verehrten Stätten des Hl. Lan-des errichtet, unterschiedl. Bauty-pen, häufig mit zentralisierenderTendenz, jeweils auf das Grab oderden Hl. Ort bezogen, mit derÜberführung der Reliquien in all-gemeine Kirchen oder Umwand-lung in Kloster- oder Stiftskirchenendet die urspr. Bedeutung derfrühchristl. M. Engl. martyrium; frz. martyre; it., sp. marti-rio.
Maschikuli (frz.), Wort orientali-schen Ursprungs, durch die Kreuz-züge in den Westen gebracht, Aus-gußöffnungen für Pech und Schwe-fel zwischen den Konsolen desvorkragenden → *Wehrgangs einesSchlosses oder einer Burg (Pech-nasenkranz). Die M. sind bes. inFrankreich oft für die Erscheinungma. Wehrbauten von architekton.Bedeutung. Engl. machicolation; frz. mâchicoulis,assommoir, moucharaby; sp. matacán.
Maskaron (frz.), Fratzengesicht,phantast. oder groteske Maske alsSchlußstein von Gewölben, Tür-oder Fensterbogen, an Kapitellen,Konsolen und Möbeln. Im MA.,der Renaissance und bes. im Ba-rock finden sich sowohl Masken(in Fortführung antiker Tradition)wie M., wobei die Grenzen flie-ßend sind. Engl., frz. mascaron; it. mascherone; sp. mas-carón.
Massivbau, Bauweise, bei welcherTragfunktion und Raumabschlußgleicherweise von einer homoge-nen Konstruktion übernommen
werden (im Gegensatz zum → Ske-lettbau). Engl. solid building; frz. ouvrage maçonné;it. costruzione a muratura portante; sp. con-strucción sólida.
Massivdecke, aus homogenemMaterial bestehende → *Decke.Man unterscheidet Dippelbalken-decken aus Holz und Platten-,Plattenbalken- und Rippendeckenaus Stahlbeton, sowie eine Reihevon Sonderkonstruktionen. Engl. solid ceiling; frz. plancher ininflam-mable; it. solaio pieno; sp. cubierta sólida,techo macizo.
Maßstab, Angabe der Größe einerDarstellung im Verhältnis zurwirklichen Größe. Eine Darstel-lung im M. 1 : 1 heißt Naturdetailbzw. Darstellung in natürlicherGröße. Meist sind die M. jedochstark verkleinert, z. B. Lagepläne1 : 5000, 1 : 2500, 1 : 1000, 1 : 500,1:250 u.a., Bauzeichnungen 1:200,1 : 100, 1 : 50 sowie Details 1 : 25,1:20, 1 :10, 1 :5 und 1:2.
Maßwerk, »gemessenes Werk«,geometr. konstruiertes Bauorna-ment zur Aufteilung des über derKämpferlinie gelegenen Bogen-felds (Couronnement) von Fen-stern, später auch zur Gliederungvon Wandflächen (Blendm., Schlei-erwerk) und für Brüstungen. M.entsteht im beginnenden 13. Jh.aus der Zusammenziehung eng-gruppierter Fenster unter einemBlendbogen, zunächst als → Plat-tenm. Das mit dem profiliertenFenstergewände eine Einheit bil-dende M. besteht aus senkrechten,profilierten, auch mit Rundstaboder schlanken Säulchen besetztenStäben (Stabwerk) und aus dem M.
319 Maßwerk
oberhalb der Kämpferlinie, das ausKreisformen und später aus geo-metr. Figuren zusammengesetzt ist.An den Chorkapellen der ReimserKathedrale von 1211�1227 findetsich das erste echte M.; einumgreifender Spitzbogen wird vonzwei Spitzbogen auf Säulchenunterteilt, deren Scheitel, auf kur-zer Strecke mit ihm verschmolzen,einen → *Sechspaß im Kreis tra-gen. Die Fenster können auchdurch die Stäbe in zwei, drei, vieroder mehr Bahnen geteilt sein,wobei die Stäbe in ihrer Dicke un-terschieden sind in die mittig tei-lenden alten Stäbe oder Hauptstä-be und in die dünneren jungenStäbe oder Nebenstäbe. Das ei-gentl., den Spitzbogen füllende M.wird in der Gotik allgemein mit
Kreisen und Dreiviertelkreisen(Paß) oder Blättern (spitzbogig ab-geschlossenes Element) hauptsäch-lich in krummlinig begrenzten,sphärischen Dreiecken oder Qua-draten ausgesetzt. Die eine Spitzebildenden Stöße der Pässe könnenin verdickten, häufig dreiblättrigenNasen auslaufen.In der zweiten Stufe zu Beginn des14. Jhs. wird die Grundkonstruk-tion linienhafter, freier. Wiederumin Frankreich entwickelt, entstehteine Gitterstruktur: ein sphär. Drei-eck auf den Scheiteln dreier Spitz-bogen, selbst wieder in drei sphär.Dreiecke gespalten, welche spitz-bogige Dreipässe lückenlos um-schließen. Dem Spitzbogen angegl.sphär. Drei- und Vierecke sowiespitzblättrige Drei- und Vierpässe
Maßwerk 320
1 zweibahniges Maßwerk2 zweibahniges Maßwerk mit
liegendem Sechspaß
3 reiche M.formulierung4 französ. M. (Flamboyant)5 engl. M.
Maßwerk
sind ihre Leitformen. Hierzu kom-men strahlenartige Gebilde alsVierstrahl in Frankreich, als Drei-strahl in Deutschland. Aus demArchitekturglied wird ein Orna-ment. In England werden in dieserZeit Wellenlinien, Zwickelblasen,Dreipässe mit lanzettförmiger Zu-spitzung, Kielbogen und kompli-zierte, netzartige Verflechtungenüblich (flowing tracery). In derdritten Stufe seit dem letzten Vier-tel des 14. Jhs. wird in Frankreichdas M. züngelnd-bewegt (Flambo-yant). In England erstarren dieWellenbewegungen (PerpendicularStyle); ein senkrecht-waagerechtesGitter fängt als Grundmuster diehängenden Tropfen und Nasenein, hinzu kommt ein Rautenorna-ment, das aus der Durchdringungzweier Spitzbogen, gleich der Kreu-zung paralleler Bogen, entsteht.Daneben finden sich Fenster, die inFortführung der dichtgestellten be-stehen (Supermullion). In Deutsch-land wird das M. mit reicher Erfin-dungsgabe zu vielgestaltigen For-men geführt. Die ruhige Strahlungwird zur Rotation. Als neue Gestaltkommt das → Schneuß auf, eineArt Fischblase, die durch Zusam-menbiegen der geraden Schenkeleines Spitzbogens entsteht; dreiSchneuße, in einem Kreis zusam-mengestellt, ergeben eine Wirbel-form, das Dreischneuß; zweiSchneuße können auch zusam-menwachsen, wobei sich die Mit-tellamelle auflöst. Auch vierblättri-ge Gebilde, Falchion, kommen vor,bei denen einem Paß ein keilbogi-ges Blatt gegenübersteht und diebeiden seitlichen Blätter gespitztlanggezogen und gekrümmt sind,oder ein Mehrpaß, bei dem eingegenüberstehendes Paar gerundet
und das andere kielbogig gespitztist (Soufflet).Der gleichen Entwicklung unter-liegen die großen Rosen der Kir-chenfronten: aus den zunächst run-den Lochscheibenfenstern entwik-keln sich geometr. Kreisgebilde, diedann strahlenförmig und schließ-lich netzartig überspannt werden. Engl. tracery; frz. réseau, tracé géométrique,broderie en pierre; it. traforo; sp. tracería,trazado geométrico.
Maßwerkbrücke, durchbroche-ner und mit Maßwerk geschmück-ter Strebebogen. Engl. tracery bridge; frz. arcade de voléed�arc-boutant; it. arco rampante ornato atraforo; sp. puente de tracería.
Maßwerkgewölbe, in Maßwerk-formen gebildetes Netzgewölbe,bes. in der engl. Spätgotik (Perpen-dicular Style). Engl. tracery vault; frz. voûte de remplage;sp. bóveda de tracería.
Mast, stat. gesehen ein senkrechtstehender, entweder am Fußpunktbiegefest eingespannter oder durchseitl. Seilzüge (Pardunen) gegenKnicken oder Abkippen gesicher-ter Stab. Der eingespannte hoheM. erhält eine den Biegebeanspru-chungen angepaßte, sich verjün-gende Form; der abgespannte M.,z. B. ein Sendemast, ist bewegl.aufgelagert und hat über die ganzeHöhe den gleichen Querschnitt.In der Architektur wurde der M.als konstruktives Element seit derFrühzeit für die Pfostenbauweisein Holz verwendet, später imEisengußbau, bei Gitterkonstruk-tionen und seit 1920 im Stahlbe-ton. → *Stabkirche. Engl. mast, pole, post; frz. mât, poteau,support, pylône; sp. mástil, palo.
321 Mast
Mastaba (arab.), ägypt. Bankgrab,insbesondere im Alten Reich. DieM. sind rechteckige geböschte Bau-körper, die oft mehrere Kammernenthalten. In der letzten Kammerist eine → *Scheintür (Blendtür)mit der Statue des Toten. Von hierführt ein versperrter Schacht zuder eigentl. unterird. Grabkammer,dem Serdab, in der Statuen desToten standen (→ *Grabbau).
Matroneum (lat.), für den spätan-tiken Matronenkult errichtetes,kleines Gebäude. Engl., frz. matroneum; it. matroneo; sp. lu-gar consagrado a las matronas.
Mauer (lat. murus), aus Lehm,luftgetrockneten oder gebranntenBacksteinen, Beton, Werksteinenund anderen natürl. oder künstl.Gesteinen errichtete, massive Kon-struktion. Die Standfläche der M.wird M.sohle, ihr oberer AbschlußM.krone genannt, die sichtbareSchmalseite heißt Haupt, die DickeM.dicke und die Richtung Flucht.Je nach der Lage einer M. im Bau-werk unterscheidet man Grund-und Fundamentm., Sockelm., Um-fassungsm., Außenm., Innenm. u.dergl. Tragm. dienen im Gegensatzzu den nichttragenden Zwischen-wänden zur Aufnahme der Decken-last. Brandm. (Feuerm.), in die keinHolzwerk einbinden darf, schützengegen das Übergreifen von Feuerauf anschließende Bauten oderBauteile. Eine Stütz- oder Futterm.verhindert das Abrutschen oder Ab-stürzen von Erdreich, Felsen usw.,eine Staumauer (Staudamm) dientzum Aufstauen von Wasser, die Stre-bemauer als Widerlager gegen Ge-wölbeschub. Eine Mantelm. um-gibt eine Burgstelle. Eine Blendm.
täuscht M.werk aus besserem Ma-terial vor (Füllm.), ein M.mantelumgibt Konstruktionen oder Bau-teile aus anderem Material (Holz,Stahl) zu deren Schutz, eine Vor-mauerung dient der Verstärkungeiner M. Engl. wall; frz. mur; it., sp. muro.
Maueranker → *Ankerstein.
Mauerblenden → Blende (→ *Li-sene).
Mauerhaken, Eisenhaken zumBefestigen von Putzlatten u. dergl.an einer Mauer. Engl. wall hook, spike; frz. crochet de mur,ancre, crampon; it. gancio da muro; sp. gan-cho para muro.
Mauerkrone, der obere Abschlußeiner → *Mauer. Engl.wall crown, crest; frz. couronne de rem-part, c. murale; it. dorso del muro; sp. coro-na del muro.
Mauerlatte, auf einer Mauerkro-ne befindl. Langholz als Auflagerund Druckausgleich einer Balken-lage; die Balken werden darauf auf-gekämmt oder aufgedollt. Engl.wall plate; frz. filet de mur; it. correntedi testa; sp. listón de muro.
Mastaba 322
a Mauerflucht b Sohle c Mauerdicke
d Haupte Krone
Mauer
Mauerring, Bering, Ringmauer,Stadtmauer, Umfassungsmauer ei-ner befestigten Stadt (→ *Stadtbe-festigung). Engl. enclosing wall, circumvallation; frz. en-ceinte; it. cinta muraria; sp. muro de cir-cunvalación.
Mauersohle, Standfläche einer→ *Mauer. It. suola del muro; sp. planta de un muro.
Mauerwerk (lat. opus), aus natürl.oder künstl. Steinen aufgesetzte,massive Konstruktion (→ Mauer),nach der Verwendung des Binde-mittels unterschieden in: 1. Trok-kenm. ohne Bindemittel bei frü-hen oder primitiven Bauten als Be-grenzung von Höfen und Gärten,als Futtermauer oder meist in Formeiner geböschten Mauer als Stütz-mauer gegen Erddruck. 2. Lehmm.mit Lehm als Bindemittel bei pri-mitiven oder nördl. der Alpen gele-genen, frühen (bis 9. /10. Jh.) Bau-ten oder als Fundament, wobei derLehm als Sperre gegen aufsteigen-de Bodenfeuchtigkeit dient. 3.Mörtelm. mit Kalk, Traß oder Ze-ment als Bindemittel, das mit Sandoder Ziegelsplitt gemagert wird.Nach dem Steinmaterial, der Bear-beitung und der Versatztechnik(Mauerverband) wird das M. un-terteilt in:1. M. aus natürl. Stein (opus itali-cum):a) Bruchsteinm. (opus antiquum,incertum), die Steine werden ver-wandt, wie sie aus dem Steinbruchkommen, und der Raum zwischenden zwei Mauerschalen wird mit ei-nem Gemisch aus Bruchsteinbrok-ken und Gußmörtel (opus implec-tum) ausgefüllt. In verschiedenenArbeitshöhen (nach ca. 1,50�2,00 m)
werden waagerechte Ausgleichsfu-gen eingehalten. Um mit flachenBruchsteinen höhere Schichten zuerreichen, werden die Steine schräggestellt; zum Ausgleich des so vor-handenen Schubs wird die nächsteSchicht in Gegenrichtung gelegt,so entsteht ein ähren- oder fisch-grätförmiges Bild (opus spicatum);diese Technik wird bes. in derFrühzeit angewandt, findet sichaber durchgehend bis ins 16./17. Jh.b) Feldsteinm. wird aus Lesestei-nen vom Feld oder aus Flüssen beifrühen Bauten oder in Gegenden,die fern von Steinbrüchen liegen,verwandt.c) Hausteinm. besteht aus Bruch-steinen, deren Kanten mit demHammer grob beschlagen werden,nördl. der Alpen im 9. Jh. aufkom-mend und bei bedeutenden Bauvor-haben verwandt, um waagerechteLagerfugen und durchgehende, aberwechselnde Schichthöhen zu erhal-ten. Zum Hausteinm. rechnet mandas in der Antike verwandte Zyklo-pen- oder Polygonalm. (opus silice-um), bei dem die Steindimensionausgenützt wird, aber glatte Kantenabgearbeitet werden, denen dienächsten Steine angeglichen wer-den.d) Quaderm. (opus romanum) wirdaus steinmetzmäßig bearbeiteten(→ Steinbearbeitung) Natursteinen(Werksteinen) gemauert, derenFront (Kopf), Lager und Stöße je-weils rechtwinklig zueinander ste-hen und eine glatte Vorderansichtbilden: in gleich hohen Schichten(opus isodomum), in wechselndenSchichthöhen (opus pseudoisodo-mum) oder aus quadrat. Steinen(opus quadratum), (Quaderm.).Der Quaderspiegel kann auch alsBosse (Rohform) vor dem Rand-
323 Mauerwerk
schlag vorstehen als Rustikam.(opus rusticum), als Buckelquader-oder Bossenm.; seit frühstauf. Zeitbei Pfalzen und Burgen bes. be-liebt, wird die → *Bosse um 1200immer mehr kissen- oder polster-
artig abgespitzt (Polsterm.), bis sieum 1250 nur noch gering vorstehtund langsam aufgegeben wird. Erstdie it. Renaissance entdeckt denästhet. Reiz und verwendet Rusti-kam. bes. an Palazzi in der röm. Art
Mauerwerk 324
1 Läuferverband2 Binderverband3 Rollschicht4 Sägeverband
5 Blockverband6 Kreuzverband7 Got. Verband8 Holländ. Verband
Steinverbände:9 Opus Isidomum10 Opus Pseudoisidomum
Figurierter Verband:11 Netzverband (Opus Reticulatum)
im Gußmauerwerk
Mauerverband
Backsteinverbände:
mit glatter Fläche und schräger Ab-kantung oder mit Facettenschnitt(Diamantenquader).2. M. aus gemischten Materialien:a) Verblendm. (opus reticulatum),ein Gußm., das mit pyramiden-förmig zugeschnittenen Natur-oder Backsteinen mit der quadrat.Grundseite nach außen verblendetist, die Steine binden in das Gußm.ein, die Fugen laufen diagonal. Seit55 v. Chr. in Rom nachweisbar, imröm. Reich verbreitet und im west-fränk. Reich bis Ende des 8. Jhs.fortgeführt. Davon zu unterschei-den ist die → *Inkrustation, einVerkleiden des rohen Mauerkör-pers mit verschiedenfarbigen Plat-ten aus edleren Materialien wieStein, Marmor, Ton (opus sectile,opus segmentum) oder mit Putz(opus arenatum, opus tectorium)und Stuck (opus album, opuscoronarium, opus marmoratum).b) Steinfachwerk (opus gallicum),eine nicht häufige Verbindung vonwaagerecht liegenden und senk-recht stehenden, langformatigen,steinmetzmäßig bearbeiteten Stei-nen und Gefachfüllungen aus Feld-oder Tuffsteinen. c) Schichtm.(opus mixtum) mit wechselndenQuader- und Backsteinlagen.3. M. aus Guß- und Stampfmasseaus Kalk oder Traß mit Kies oderStein- bzw. Ziegelsplitt als Zu-schlagstoffe wird als Beton (opuscaementicium) entweder zwischenzwei Holzschalungen, die nachdem Abbindeprozeß wieder ent-fernt werden, oder auf einen Bo-den oder in einen Fundamentgra-ben (opus fusile) oder zwischenzwei Steinschalen als Füllwerk(opus emplectum) gegossen.4. M. aus gebrannten oder unge-brannten künstl. Steinen, Back-
steine (opus latericium), Kalksand-steine u. a., bestehend aus Binder,deren Schmalseite, und Läufer, de-ren Langseite in der Mauerfluchtliegen. Die Anordnung in einerSchicht (Schar) und die Ordnungvon Schicht zu Schicht ist derMauerverband. Bei einer Rollscharliegen die hochkant gestellten Bin-der rechtwinklig zur Mauerflucht,bei einer Schränkschicht unter ei-nem Winkel von 45�60°, bei einerStrom und Sägeschicht entspre-chend, jedoch flachliegend. DieFugen zwischen den nebeneinan-der liegenden Steinen einer Schichtheißen Stoßfugen, zwischen zweiaufeinanderfolgenden SchichtenLagerfugen. Im M. sind alle Steinebzw. vertikale Fugen (Fugenschnitt)nach bestimmten Regeln schicht-weise (Schar) gegeneinander ver-setzt und bilden Zweck- und Zier-verbände, die aber zumeist nur beikünstl. Steinen (Backstein) ein-heitl. vorkommen. 1. Zweckverbän-de: Läufer (Schornstein)verbandmit Läufern in jeder Schicht; Bin-der(Strecker)verband mit Bindernin jeder Schicht; Blockverband mitregelmäßigem Wechsel von Binder-und Läuferschichten, über denStoßfugen der Läuferschichten lie-gen jeweils die Mittelachsen vonBindersteinen; Kreuzverband mitabwechselnd Binder- und Läufer-schichten, die Stoßfugen einerLäuferschicht sind jedoch gegen-über denen der nächsten Läufer-schicht um einen halben Stein ver-setzt. 2. Zierverbände: Got. (poln.)Verband, auch Mönchsverband ge-nannt, aus Läuferschichten, die allein einem bestimmten Wechsel mitBindern durchsetzt sind, jeweilsnach zwei Läufern folgt ein Binder,dabei können die Stoßfugen einer
325 Mauerwerk
Mauerwerk 326
1 Bruchsteinm.2 Quaderm.3 Backsteinm. mit Ort- (Lang- und
Kurzwerk) und Sockelquadern4 Ziegelm. mit Werksteinvormauerung
(Schnitt)5 Gußm. hinter Vormauerung: Füllmauer
(Schnitt)
6 Feldsteinm. mit Ortsteinen und Ausgleichsschichten: Schichtmauer-werk
7 Polygonalm.8 Bossenm.9 Rustikam.: Opus Rusticum10 Polsterm.11 Zyklopenm.
Mauerwerk
Schicht mit denen der übernäch-sten übereinstimmen oder die Bin-der einer Schicht können gegenüberden Bindern der folgenden Schichtum einen halben Binderkopf ver-setzt sein; Märk. Verband aus wech-selnd zwei Läufern und einem Bin-der in der einen und ein Läufer undein Binder in der nächsten Schicht;Holländ. Verband aus einer Binder-schicht und einer Binder-Läufer-Schicht; Strom(Festungs)verbandbei bes. dicken Mauern im Fe-stungs- oder Brückenbau in Block-oder Kreuzverband, wobei die Bin-derköpfe übereck gestellt sind,d.h. im Innern wechseln normaleSchichten mit Schichten, derenSteine unter 45�60° zur Mauer-flucht liegen; Figurierter Verband,häufig als Ähren- oder Fischgrä-tenverband, ornamentaler Verbandohne konstruktive Funktion.In den einzelnen Zeiten und Län-dern wurden die verschiedenen Ar-ten von M. unterschiedl. ange-wandt. Während der Quaderbau fürdas MA. bezeichnend ist und Back-stein erst um 1160 allgemein ver-breitet in steinarmen Gegendenbes. Norddeutschlands angewandtwurde und im späteren MA. denQuaderbau verdrängte, wählte dieRenaissance vorrangig Quader undBossenquader als wandverkleiden-de Sichtfläche, während im Barockder Putz- und Stuckbau vorherr-schend wurde. Der Historismus be-nutzte Quader und Backstein so-wie Putz für die Oberflächenbe-handlung des M., bis im 20. Jh.Beton, Putz und moderne Stahl-,Glas- und Kunststoffmaterialienbei Großbauten vorherrschen. Engl.masonry; frz. (ouvrage de) maçonne-rie, murrage, muraillement; it. opera mura-ria, muratura; sp. mampostería.
Mauerziegel, moderne Bezeich-nung für Backsteine, die regionalin jüngerer Zeit auch → Ziegel ge-nannt werden. Es sind die als Mau-ersteine verwendeten, aus Ton,Lehm oder tonigen Massen mitoder ohne Zusatz von anderenStoffen (Sand, Ziegelmehl, Asche)geformten und bei 800�1000 °Cgebrannten, quaderförmigen Bau-elemente von genormtem Format(Länge: 24,0 cm, Breite: 11,5, 17,5oder 24,0 cm, Höhe: 5,2 bis 23,8,meist 7,1 cm). Nach Art und Formunterscheidet man Vollziegel undLochziegel. Engl. brick; frz. brique de mur; it. mattone;sp. ladrillo.
Mauerzunge, aus der Mauer-flucht vorspringendes, kurzes Mau-erstück (→ *Mauer). It. sporgenza del muro; sp. lengüeta demuro.
Maulscharte, Horizontalschartemit runden und eckigen Öffnun-gen.
Maureske (frz.), streng stilisiertes,lineares Pflanzenornament (→ *Ara-beske ist im Vergleich dazu natura-listischer), aus hellinist. Formen,auch in der islam. Kunst, bes. aberin der Renaissance seit 1530 aufge-nommen und bis 1550 weit ver-breitet als ein gleichmäßig dieFläche überspannendes Linienspiel,ein ununterbrochener kreisenderBewegungsfluß. Engl. arabesque; frz. mauresque, moresque;it. arabesco moresco; sp. morisco.
Mausoleum, Name des Grabmalsdes Königs Mausollos von Halikar-nass (gest. 352), wohl von Pytheoserbaut und von den Bildhauern
327 Mausoleum
Skopas, Bryaxis und Leochares de-koriert. Das M., das in der Formauf lyk. Grabbauten, wie das Lö-wenmonument von Knidos unddas Nereidenmonument von Xan-thos zurückgeht, hat einen hohenUnterbau mit einem mehrstufigenSockel, darüber die eigentl., vonSäulenstellungen umgebene Grab-kammer mit einem Pyramiden-dach und bekrönender Quadriga.Das zu den Weltwundern zählendeM. wurde später zu einem Begriff,der für jeden monumentalerenGrabbau verwandt wurde. Engl. mausoleum; frz. mausolée; it., sp. mau-soleo.
Medaillon (frz.), in der Baukunstkreisförmiges Schmuckglied mitFlachrelief in Stuck, Terrakotta u.dergl., meist zum Schmuck einerWandfläche, eines Deckenfelds, ei-ner Lünette oder eines Pendentifs. Engl. medaillon; frz. médaillon; it. meda-glione; sp. medallón.
Medina (arab.), Name der Altstadtarab. Städte in Nordafrika.
Medrese (arab.), islam. Rechts- undTraditionsschule, in der sakralenArchitektur des Islam der bedeu-tendste Bautyp. Vorläufer warenPflegestätten sunnit. Orthodoxie;unter Mahmud von Ghazna (gest.1030) entstand die erste offizielleM., unter den Seldschuken erhieltdie M. den Charakter einer staatl.Einrichtung, bes. unter dem WesirNizam al-Muk (1018�1092). DasHauptelement in der Bauform derM. ist der → Liwan; um einen qua-drat. oder rechteckigen Hof liegenin zweigeschossiger Anordnungdie Wohnzellen der Lehrer undSchüler, alle vier Hoffronten wer-den in der Mitte durch einenLiwan gegliedert und axial betont.Der dem Eingangstor gegenüber-liegende Hauptliwan enthält denMihrab. Ähnl. waren pers. → *Kara-wansereien angelegt. Sehr schnellbreitet sich die M. über Arabien,Nordafrika und Spanien aus. M.wurden häufig neben großen Mo-scheen errichtet und mit dieserhäufig vermischt, denn die M. war
Medaillon 328
Mausoleum(Beispiel: Halikarnass, Grab des Königs
Mausollos)
Medrese(Beispiel: Samarkand, Schir Dar Medrese)
mit Mihrab und Mimbar ausge-stattet und wurde für Freitagsgot-tesdienste benutzt. Durch die M.wurde die Entwicklung der großenoffenen Hofmoschee zur Zeit derSeldschukenherrschaft in den ostis-lam. Ländern maßgebl. beeinflußt,es entstand die »Moscheenm.«Normalerweise beschränkt sichdie äußere Ausschmückung derM. auf die Torfassaden, im Innernauf glasierte Fliesen und Fayencen. Engl. madrasah, madrassa; frz. médressé;it. madrasa; sp. escuela árabe.
Megalith-Bauten, Bauten derSteinzeit, meist Grabbauten, Hüh-nengräber, → *Dolmen, → Menhi-re, Trilithen (→ *Architrav). Engl. megalith buildings; frz. bâtiments Me-galiths, monuments mégalithiques; it. cos-truzioni megalitiche; sp. construccionesmegalíticas.
Megaron (gr.), Urgestalt des gr.Hauses und Palasts, dann auch desTempels, Haupthalle mit Herd,davor meist eine Vorhalle zwischenAnten. Die Entstehung des gr. M.ist umstritten. Während der Bron-zezeit war das M. über den gesam-ten ägäischen Raum verbreitet. Diemit flachem Dach rekonstruiertenBauten hatten zunächst eine vonHolzpfosten gestützte Vorhalle,dann mit Antenmauern. Das Mate-rial ist Holz, Bruchstein und luft-getrocknete Backsteine. Als monu-mentaler Hauptbau wurde das M.in myken. Burganlagen übernom-men. M.artige Kultbauten zeigenTonmodelle des 8. Jhs. v. Chr., mitdem Säulenkranz der Ringhalle um-geben bildet das M. den Grundtypdes gr. → *Tempelbaus, danebenbleibt es für kleinere Kultbautenund Schatzhäuser in seiner Grund-
form bestehen; hier durch Ele-mente des Tempelbaus bereichertund ausgeschmückt. Engl., it. megaron; frz.; sp. mégaron.
Megarontempel, → Antentempel(→ *Tempelformen).
Mehrspänner, Mehrfamilien-wohnhaus mit mehr als zwei Woh-nungen an jedem Treppenpodest.Wegen der Baukostenverringerungdurch höhere Ausnutzung des Trep-penhauses war der M. im Miets-hausbau in der 2. Hälfte des 19. Jhs.weit verbreitet. Die Reformbewe-gung im Wohnungsbau um 1900und in den 1920er Jahren begün-stigte den Zweispänner als optima-len Haustyp.
Meisterzeichen, Steinmetzzei-chen eines leitenden Meisters derörtlichen → Bauhütte, das im Un-terschied zu gewöhnlichen →*Steinmetzzeichen meist in einemSchild angebracht ist. Engl. mason�s mark; frz. signature de con-tremaître; it. monogramma di mastro scal-pellino; sp. marca del maestro de obra.
329 Meisterzeichen
Megaron
Meisterzeichendes Peter vonKoblenz
Memoria (lat.), Memorialkirche,eine zur Erinnerung an einen Mär-tyrer oder Hl. erbaute christl. Kir-che mit Grab oder Reliquien, bes.in frühchristl. Zeit über Märtyrer-gräbern auf röm. Friedhöfen alsZentralbau, Basilika oder Saalkir-che. Auch als Kirche für eine Herr-scherfamilie oder einen Herrscher;im weitesten Sinne der größte Teildes histor. Kirchenbaus außerPfarrkirchen (→ Coemeterialkir-che, Martyrion). Engl. burial church; frz. mémorial, monu-ment; it. memoria; sp. iglesia conmemorati-va.
Memorialbau, in Antike undfrühchristl. Zeit Bauwerk zur Erin-nerung an einen Heroen, Heiligen,Märtyrer (Memoria) oder Herr-scher. Ist dieser dort beigesetzt, sospricht man von einem → *Mau-soleum, sonst vom → Kenotaph. Engl. memorial builing; frz. monumentcommémoratif; it. edificio commemorati-vo; sp. construcción conmemorativa.
Menhir (kelt. men: Stein, hir:lang), aufrecht stehende, steinerneStele, oft von gewaltigen Dimen-sionen (bis 20m Höhe), Teil früh-geschichtl. kelt. Kultanlagen in derBretagne (Megalithbau). Engl., frz., it., sp. menhir.
Mensa, Platte eines Altars (→ *Al-tar 2).
Messebauten, Messehallen, zurDurchführung von Handelsmessenund seit dem 19. Jh. von Muster-messen als große, in Stahl, Eisen-beton oder freitragender Holzkon-struktion errichtete, großräumigeHallen mit guter Zu- und Ein-fahrtsmöglichkeit. Im SpätMA.
entstanden erste überdachte, auchmehrgeschossige M. wie diegleichzeitigen → *Kaufhäuser, abererst mit der wachsenden Bedeu-tung von Mustermessen werden zuBeginn des 20. Jhs. größere M.errichtet, die nach dem 1. Welt-krieg in den 1920er Jahren zahlrei-che bedeutende Neubauten erhiel-ten. Die Entwicklung der Technikmit ihrem Angebot an schwerenund umfangreichen Mustern ver-änderte die urspr. aus abgeschlos-senen Kabinen beiderseits vonMittelgängen in mehreren Ge-schossen bestehenden M. zu groß-räumigen, möglichst stützenlosenHallenkonstruktionen. Engl. exhibition halls; frz. bâtiment(s) defoire; it. palazzi per esposizioni, edifici fie-ristici.
Meta (lat.), eine meist kegelförmi-ge Zielmarke, bes. die Spitzsäule anbeiden Enden der Spina des röm.→ *Zircus. Engl., frz., it., sp. meta.
Metope (gr. Zwischenfeld), annä-hernd quadrat., häufig reliefiertesFeld zwischen zwei → Triglyphenam Fries des Tempels der → *Dor.Ordnung, urspr. eine Holztafel,die die Öffnung zwischen den Tri-glyphen verschloß, im 7. Jh. v. Chr.als bemalte Tontafeln, seit der 2.Hälfte des 7. Jhs. mit der Entwick-lung des Steinbaus in Stein umge-setzt und als Relief gestaltet. Im 5.Jh. v. Chr. wird die urspr. Rahmungbis auf die obere Abschlußleisteaufgegeben bis hin zu raumillusio-nist. Vertiefung des Reliefgrundesin hellenist. Zeit. Seit dem 4. Jh. v.Chr. und in röm. Zeit sind die M.und Triglyphen zu einem ornamen-talen Band geschrumpft und zei-
Memoria 330
gen nur noch Schilde, Rosettenu.ä., aber keine Reliefs mehr. Engl. metope; frz. métope; it. metopa; sp. mé-topa.
Mezzanin (it.), Entresol, Halb-oder Zwischengeschoß, meist überdem Erdgeschoß, oft auch unterdem Kranzgesims, enthält unterge-ordnete Räume, häufig die Räumeder Dienerschaft. Vor allem in derSchloßarchitektur des Barock undKlassizismus ein beliebtes Gestal-tungsmittel aus funktionellenGründen und wegen der Propor-tionen, → *Geschoß. Engl., frz. mezzanine, entresol; it. mezzani-no, piano ammezzato; sp. entrepiso.
Michaelskapelle, Kapelle aufBerghöhen, in Westtürmen und→ *Westwerken, als Torkapelleoder als Kapelle im Obergeschoßeines Karners, dem Hl. Michaelgeweiht als kämpfer. Schutzpatrongegen Feinde, die vom W. erwartetwurden, und als Totengeleiter. Engl. St. Michael�s chapel; frz. chapelle deSaint-Michel; it. cappella di San Michele;sp. capilla de San Miguel.
Miethaus, Zinshaus, ein privatesoder der öffentl. Hand gehörendesHaus, dessen meist in Geschossengelegene Wohnungen vermietetwerden. M. (in negativem Sinne»Mietskasernen«, »Zinskasernen«)gab es bereits im antiken Rom. DieWohnungen in den Geschossenkönnen direkt am Stiegenhaus an-geordnet sein (Zweispänner, Drei-spänner, Vierspänner, → *Stern-haus) oder an langen, innen oderaußen liegenden Gängen (→ *Lau-benganghaus). Engl. tenement house, rental housing;frz. maison de rapport; it. casa d�affito; sp. casade arriendo.
Migalet, quadrat., dicke Türmeder Moschee, die auf einerPlattform einen kleinen, schlankenAufsatz mit Spitzdach oder Kuppeltragen. Sp. torres gruesas de una mezquita.
Mihrab (arab.), kleine Gebetsni-sche, die die Richtung nach Mekka(Kibla, Qibla) weisen muß, gegen-über dem Eingang einer Moschee.Aus diesem Grunde sind zwar alleMoscheen einheitl. nach Mekkagerichtet, jedoch nach ihrer geo-graph. Lage verschieden »orien-tiert«. Der M. ist oft durch einStalaktitengewölbe abgeschlossenund die Wände mit bunten → Azu-lejos bekleidet. Sp. mihrab, nicho de las plegarias.
331 Mihrab
Mihrab mit Stalaktitengewölbe
Mikwe (hebr.), Judenbad, jüd. ri-tuelle Reinigungsstätte. Im AltenTestament werden bei bes. Anläs-sen oder bei Unreinheit im Sinnevon 3. Mos. 14 und 15 von Perso-nen und Sachen Reinigungsbäderin Regen- oder Grundwasser vor-geschrieben. Früher meistens na-türl. Gewässer in der Nähe einerSynagoge, seit dem MA. überwie-gen künstl. angelegte Judenbäder.Das Judenbad des dt. MA. ist stetsein zum Grundwasserspiegel hin-abführender Schacht mit kompli-zierten Treppenführungen, häufigkunstvoll ausgestattet mit Säulen,Friesen und Inkrustationen. Dieletzten in Gebrauch befindlichenJudenbäder Deutschlands wurdenim 19. Jh. geschlossen. Engl. mikvah; sp. baño ritual judío.
Militärriß, eine schief-axonometr.Darstellung (Schrägriß) eines Ob-jekts bei beliebiger Blickrichtung,wobei zum Unterschied vomKavalierriß die Höhenmaße überdem Grundriß aufgetragen wer-
den. Der M. wird manchmal auchungenau Militärperspektive ge-nannt (→ *Projektion). Frz. projection axonométrique; it. assono-metria cavaliera militare; sp. proyecciónaxonométrica.
Mimbar (arab.), Minbar, hölzer-ner oder steinerner, oft kunstvollausgestatteter Predigtstuhl in einerMoschee rechts neben dem Mih-rab an der → Quiblawand. Urspr.tragbar, zweistufig, aus Holz, dannmit mehreren Stufen und festemStandort, seit dem 8. Jh. als reinePredigtkanzel in allen Freitags-moscheen vorhanden. Allgemeinbesteht der M. aus einer Treppemit reich verzierten Dreieckswan-gen; durch einen Torrahmen (mitund ohne Tür) gelangt man übereine mehrstufige Treppe auf einePlattform, die mit einem Baldachinbekrönt ist. Engl., it. minbar; frz. mimbar; sp. mimbar,púlpito.
Minar, Minarett (arab. manara:Leuchtturm), Turm für den Gebets-rufer (Muezzin) einer Moschee. InNordafrika und Spanien ist das M.meist ein quadrat. Turm mit rei-cher Ornamentdekoration undschlankem Aufsatz (→ Migalet). Inder ind.-islam. Baukunst findenwir Bündelpfeilern ähnl. M., in dertürk. nadelschlanke Türme, dienur eine oder zwei Wendeltreppenenthalten, die zu einem oder meh-reren Umgängen führt. Gewöhnl.hat eine Moschee ein M., doch ha-ben bedeutendere Anlagen zwei,vier oder sechs M. Nur das Hei-ligtum in Mekka hat sieben M.(→ *Moschee). Frz. minar; it. minareto; sp. minarete.
Mikwe 332
Mimbar
Mine, Minengang, Stollen zurUntergrabung von Wehrbauten,um diese zum Einsturz zu bringen,häufig mit Sprengkammern. Diezur Verteidigung bestimmten Con-tre- oder Gegenminen haben zu ih-rer Verbindung gemauerte Galerien(M.galerien). In ihren Einzelheitensind die M. verzweigte und derFestungsanlage angepaßte Gänge. Engl., frz. mine; it., sp. mina.
Miserikordie (lat. misericordia:Erbarmen), konsolartiger Unter-
bau am Klappsitz eines → *Chor-gestühls, der den stehenden Mön-chen als Gesäßstütze dient. Engl. misericord, miserere; frz. miséricor-de; it., sp. misericordia.
Mithräum, Kultstätte des iran.Weltheilands und Erlösers Mithras,der am 25. Dezember von einerJungfrau geboren und mit demSonnengott gleichgesetzt wurde. In-folge der auffallenden Analogien zurchristl. Religion wurden christl.Kultstätten oft über einem M.errichtet. Bes. verbreitet waren M.in den röm. Provinzen. It. mitreo; sp. lugar de culto al dios Mitra.
Mittelrisalit, → *Risalit in derMitte eines Baukörpers. Frz. avant-corps central, médian; it. risaltocentrale, avancorpo c.; sp. arimez central,salidizo, resalto.
Mittelstütze, ein Stützglied (Pfei-ler, Säule u. dergl.), das in der Mit-te eines Raumes (oft eines Zen-tralraumes) oder in der Mittelachsesteht. Eine Folge von M. kommtbei zweischiffigen Hallenbauten(Hallenkirchen, Schloßsäle, Refek-torien, → *Remter usw.) vor. (Abb.S.334)
333 Mittelstütze
Minar1 nordafrikanisch-maurisch (Migalet)2 ägyptisch 3 türkisch
Mithraeum (Beispiel: Carnuntum, drittes M.)
Modell (it.) → *Baumodell.
Modul (lat.), Verhältnismaß derantiken Formenlehre, als dessenEinheit der halbe untere Säulen-durchmesser dient, der wieder in30 Partes (Minuten) unterteiltwerden kann. Die Höhe, Breite,Weite und Ausladung antiker Bau-teile wurde in M. bzw. Partes ange-geben (→ *Proportion). Engl., frz. module; it. modulo; sp. módulo.
Modulor, eine auf dem GoldenenSchnitt beruhende und auf denstehenden Menschen mit erhobe-ner Hand bezogene Proportionsska-la Le Corbusiers mit zwei auf dieKörpergröße von 1,83 und 1,75 mabgestimmten Reihen. It. modulor; sp. escala de proporciones deLe Corbusier.
Mole (it.), Schutzdamm als Wel-lenbrecher vor Häfen. Engl. mole, jetty; frz. môle, jetée; it., sp. mo-lo.
Monasterium (lat.) → Kloster.
Mönchschor, der den Mönchenvorbehaltene Teil einer Klosterkir-che, durch Chorschranken, Lettneroder Gitter vom Laienraum abge-schlossen. Engl. monks� choir; frz. ch�ur des moines;it. coro dei monaci; sp. coro de los monjes.
Mönchsgang, schmaler Gang inder Mauerdicke im Chorbereicheiner Kirche.
Mönch- und Nonnendach, Klo-sterdach, volkstümliche, 1294 fürLübeck schon belegte Bezeichnungfür ein Hohlziegeldach, bei dem dienebeneinander auf Dachlatten mitder konkaven Seite nach oben ver-legten Hohlziegel (Nonne, im-brex) von umgekehrt über derenStöße gelegten Hohlziegel (Mönch)
Modell 334
Mittelstütze(Beispiel: Wolgast/Greifswald,
St. Gertrud, 15. Jh.)
27 = 43 = 70 = 86 = 113 = 140 = 183 = 226
Modulor von Le Corbusier
Mönchschor1 Schiff 2 Chor 3 Mönchschor
+ 16 + 27 + 16 + 27 + 27 +16+27 +16+27
abgedeckt werden. Im MA. häufigverwendet. → *Dachdeckung. Frz. toiture en tuiles mâles et femelles; it. tet-to a coppi, t. a canali; sp. tejado de claustrocon teja árabe.
Moniereisen, Moniergewebe, ver-zinktes oder rohes Drahtgewebemit ca. 10 cm großen Quadraten,das als Bewehrung bei BetonVerwendung findet, erfunden vondem frz. Gärtner Franz Monier(1823�1906). Engl. reinforcement steel; frz. acier d�arma-ture, a. à béton; it. armatura (per calcestruz-zo); sp. acero de armadura.
Monolith (gr. ein Stein), Bauteiloder Bauwerk aus einem einzigenStein (Säule, Menhir, Pfeiler,Obelisk u.a.)
Monopteros (gr.), offener Säulen-Rundtempel, als Gartenpavillongenutzt. Rundtempel, dessen Dachunter Auslassung der Cella alleinvon einem Säulenkranz getragenwird, im antiken Griechenland alsSchirmdächer über Kultstatuen undGrabmälern, in röm. Zeit auch alskleine Tempel, tritt in der Renais-sance erstmalig als Gartenpavillonauf; die eigentl. Verbreitung setztum 1720 in England ein und greiftum 1760 auf den Kontinent über,wo der M. bis etwa 1825 in unter-schiedl. Nutzung in Gärten Ver-wendung findet und um 1900 kurzwieder auflebt. Engl. monopteral temple; frz. temple mo-noptère; it. monoptero; sp. monóptero.
Montagebau, Bauverfahren mitin Fabriken oder Werkstätten vor-gefertigten Bauelementen. Die Vor-fertigung kann auf handwerkl.Grundlage erfolgen (z. B. ma. undfrühneuzeitl. Fachwerkbau, Dach-werk), von größerer Bedeutungaber erst mit dem Übergang zumindustriellen Bauen. Um 1900Entwicklung einer Bauweise mitHolztafeln, die für Einfamilien-häuser bis in die 1950er Jahre üb-lich war. Mit der Einführung desGußeisens entstanden um 1850/60in England vielgliedrige Fassadenfür den Export in die Kolonien.Stahlskelettbau sowie Stahlbetonmit Füllelementen bis zur heuti-gen Vorhang-Fassade aus Metalloder Glas sind M.; Großplatten-und Großblockbauweise entstan-den schon vor 1914 in den USA, inEuropa in den 1920er Jahren. Heu-te für Wohn- und Industriebau inunterschiedl. Materialien und M.-Verfahren angewandt. → Platten-bauweise. Engl. dry construction; frz. bâtiment préfa-briqué; it. prefabbricazione; sp. construc-ción prefabricada.
Monument (lat.), großes Mahn-,Ehren-, → *Denkmal oder ein bes.ausgezeichnetes Bauwerk; allge-mein ein Zeugnis der Vergangen-heit. Monumental = denkmalartigoder Bezeichnung für eine groß-formatige, repräsentative Gestal-tungsweise.
Mordgang → *Wehrgang.
Mörtel (lat. mortarium), Mischungvon Sand, Zement (bzw. Kalk,Gips, Lehm etc.) und Wasser ineinem bestimmten Verhältnis alsBindemittel eines Steinverbands
335 Mörtel
Monopteros
(Mauerverband). Man unterschei-det nach der Art des BindemittelsKalkm., Gipsm., Lehmm. und Ze-mentm. Luftm. erhärten nur ander Luft, während hydraul. M.(Wasserm.) auch unter Wasser er-härten. Engl. mortar; frz. mortier; it. malta, calcina;sp. mortero.
Mortuarium (lat.), Sepultur, Be-stattungsort, hauptsächl. der Kreuz-gang in Klöstern oder ein mit die-sem verbundener Bauteil. Frz. sépulture; sp. sepultura.
Mosaik (it.), aus kleinen bunten,künstl. oder natürl. Steinen oderaus Glas (Smalten) in ein Mörtel-bett gesetzte geometr. Muster undBilder. Darstellungen, die bereitsin der Antike (meist als Wand- undFußbodenschmuck, opus alexan-drinum, opus musivum, opus sec-tile) verwandt wurden. In der früh-christl. und in der byzant. Epochewurden vor allem Wände undGewölbe mit M. geschmückt. Engl. mosaic; frz. mosaïque; it., sp. mosaico.
Moschee, Mesdjid, Masdschid,Mesqita (arab.), ursprüngl. nur einBetsaal mit anschließendem Hof.Der als → Quersaal errichteteRaum (Haram) ist meist als Pfei-ler- oder Säulenhalle (Hypostyl)ausgebildet. Das in der kürzerenAchse liegende Mittelschiff ist oftbreiter und von einer oder meh-reren Kuppeln überdeckt. Es weistin die Mekka-Richtung (Kibla,Qibla), die durch eine flache Ge-betsnische (→ *Mihrab) in der ab-schließenden Qiblawand gekenn-zeichnet ist. Davor kann derumschrankte Betplatz des Kalifen(Maqsura) liegen. Neben dem Mih-
rab steht der Predigtstuhl (→ *Mim-bar). Der Vorhof ist von Arkaden(Riwaqs) umgeben. In seiner Mittesteht der Reinigungsbrunnen. DieM. hat einen Turm (manchmalauch mehrere) für den Gebetsrufer(→ *Minar, Minarett). Der monu-mentale Toreingang pers. M. heißt→ *Pischtak. Die frühen Formender M. sind analog den Feldlagern
Mortuarium 336
Moschee
(Beispiel: Córdoba, Spanien, 8.�10. Jh.)
(Beispiel: Brussa, Ulu Cami, um 1400)
abgeordnet und heißen deshalbauch Lager- bzw. Soldatenm. Spä-ter kommt nach dem Haupt-gebetstag (Freitag) auch der NameFreitagsm. auf. Die *Grabm. ist beieinem Kalifen-, Sultans- oder Für-stengrab errichtet, doch ist dasMausoleum (türk. Türbe) nie di-rekt in der M., sondern in einemeigenen Gebäude untergebracht.In der türk.-osman. Baukunst wur-den die M. in Weiterentwicklungälterer byzant. Vorbilder als kostba-re Kuppelbauten ausgeführt. Andie türk. M. sind meist noch Stif-
tungen (Wakif) mit Armenküchen,Spitälern u. dergl. angeschlossen.Dadurch wird der Gesamtkomplexbeträchtl. erweitert. Eine Sonder-form der M. ist die → *Medrese. Engl. mosque; frz. mosquée; it. moschea;sp. mezquita.
Motel, Sonderform des Hotels, diedas Abstellen des eigenen Autos inunmittelbarer Nähe des Hotel-zimmers gestattet. Entstanden inden 1930er Jahren in den USA,zumeist ein-, seltener zweigeschos-siger Gästeteil, der mit dem offe-
337 Motel
(Beispiel: Istanbul, Suleiman Moschee, 16. Jh.)
nen oder gedeckten Auto-Abstell-platz eine Einheit bildet. M. liegenvorzugsweise in der Nähe vonAutobahnen und Fernverkehrs-straßen. Engl., frz., it., sp. motel.
Motte (frz.), Erdhügelburg, Haus-berg, natürl. oder häufig künstl.aufgeschütteter Hügel, zumeist inder Ebene und von Wassergräbenund Palisaden umgeben, daraufrunder oder eckiger Turm oderTurmhaus in Holz oder Stein,wohl nicht ohne Verarbeitung spät-röm. Vorbilder denkbar, seit dem10./11. Jh. in Nordfrankreich, Eng-land, Norddeutschland und Skan-dinavien nachweisbar. Hauptzeit12. Jh., bis ins 15. Jh. gebaut. Engl., frz. motte; it. motta; sp. mota.
Mudejar (span. mudjelat: unter-worfen), Vermischung maur. mitgot. Stilelementen bzw. Renais-sanceformen in Spanien.
Muldendecke, eine mit Rabitzverdeckte und vollständig verputz-te Holzbalkendecke, deren Flächemuldenförmig gebildet und wiebei der Spiegeldecke durch Kehl-profile zur Wand überleitet.
Muldengewölbe, über rechtecki-gem Grundriß gespannte Spitzton-ne, die von zwei Schmalseiten hervon je einer rund- oder spitzbogi-gen Wange angeschnitten wird,eine Art → Klostergewölbe. → *Ge-wölbe. Engl. through vault; frz. voûte en baquet, v.à trompe; it. volta a botte con testate di pa-diglione; sp. bóveda en artesa.
Mullion (engl.), Fortsetzung desStabs im Couronnement bis zum
Fensterbogen eines Maßwerkfen-sters im Perpendicular Style. Frz. meneau (vertical); sp. montante.
Münster (lat. monasterium: Kloster,Münster, Dom), urspr. jedes Klo-ster, dann auch für andere, größereKirchen (→ Bischofskirche) be-nutzte Bezeichnung. Engl. minster; frz. cathédrale; it. duomo;sp. catedral.
Münze, Gebäude oder Raum fürdie Münzaufsicht und Prägung. Engl. mint; frz. hôtel de la monnaie; it. zec-ca; sp. casa de moneda.
Muqarnas, Mukarnas (arab.), zel-lenartiges Schmuckglied der islam.Baukunst, aus Holz, Stein oderStuck, das verschiedenartige stereo-metr. Gebilde verbindet (→ Sta-laktit, → Stalaktitenkuppel, → Sta-laktitenportal, → *Gewölbeformen).
Muristan (pers.), Hospital, in derislam. Baukunst meist um einenHof gelegen und mit der Moscheeoder mit dem Mausoleum desStifters verbunden.
Muschelgewölbe, der Koncheähnl. halbkuppeliges Gewölbe, beidem jedoch der Wölbverband nichtringförmig, sondern radial von derMitte des Gewölbefußes ausge-hend, angelegt ist. Engl. shell vault; frz. voûte en conche; it. se-micatino conchiliforme; sp. bóveda en con-cha.
Muschelwerk, aus muschelähnl.Formen gebildete Dekoration, diebereits in der Spätrenaissance auf-trat und im Rokoko stilbildendwurde (→ *Rocaille). Engl. rocaille; frz. rocaille, rocaillage, co-quilles; it. decorazione conchiliforme; sp. de-coración conchiforme.
Motte 338
Muschrabije (arab.), Holzgitter inden Fenstern des arab. Hauses.
Museum (gr.-lat.), ein den Musengeweihter Raum, im 16. Jh. Stu-dierzimmer, im 17. Jh. ein Gebäu-de zur Aufbewahrung von Kunst-schätzen, Bildwerken (Glyptothek),Gemälden (Pinakothek) und natur-wissenschaftlichen Gegenständen.Hervorgegangen aus den Schatz-kammern in antiken Tempeln, inKirchen und privaten Sammlun-gen mächtiger Familien. Fürstenlegten in der Barockzeit Galerienan, während eigentl. Museen erstin klassizist. Zeit entstehen. Engl. museum; frz. musée; it., sp. museo.
Musivische Arbeit, Einlegear-beit aus Steinen oder Glasstücken(→ Mosaik) oder aus zurechtge-schnittenen und eingefaßten Glas-scherben. Frz. travail mussif, �uvre m.; it. lavoromusivo, opera musiva; sp. trabajo musivo.
Muster, meist im endlosen Rap-port flächenfüllende Verzierung,der keine andere als schmückendeFunktion zugrunde liegt. Engl. pattern, standard, sample, specimen;frz. dessin, décor; it. trama, ornamento a mo-tivi ripetuti; sp. ornamento sólo decorativo.
Mutulus (lat.), Dielenkopf, recht-eckige Steinplatte an der Unter-seite des Geisons an gr. Tempelnder → *Dor. Ordnung, jeweilsüber der Metope und Triglyphe, ander Unterseite mit drei Reihen vonje sechs runden Tropfen (Guttae)besetzt, deren Form auf den Holz-bau (Holznägel) zurückweist.
N
Nabel, Opäum, seltene Bezeich-nung für das Auge einer → *Kup-pel. Engl. nave, opaion, eye; frz. ombilic; it. om-belico, occhio della cupola; sp. ombligo, ojode la cúpula.
Nagara (ind.), → *Sikhara, überder Cella eines ind. Tempels aufge-bauter Turm mit einem dem Qua-drat angenäherten Grundriß.
Nagelbinder, Bretterbinder, des-sen in verschiedenen Ebenen lie-gende Elemente durch Nagelungverbunden sind. Engl. nailed roof framing; frz. ferme clouée,charpente clouée; sp. maderamen de clavos.
Nagelkopf, Verzierung mit → Dia-mantierung, hauptsächl. in derroman. Ornamentik. Engl. nailhead; frz. tête de clou, t. conjura-toire, pointe de diamante; it. ornamento acapoccia; sp. cabeza de clavo, punta de dia-mante.
Naiskos (gr.), kleiner Tempel,meist ein Antentempel oder → Pro-stylos, als Kultbildschrein im nichtüberdeckten → Sekos von → *Hy-päthraltempeln oder als sog. Schatz-haus. Engl., frz., it., sp. naiskos.
Naos (gr.), Cella eines gr. Tempels(→ *Tempelformen, → *Tempel-bau 1).
Narthex (gr.), die mit Hürden ausRohrgeflecht (narthex = schilfrohr-ähnl. Pflanze, heute Ferula commu-nis genannt) eingefaßte Rennbahn,schließlich der für Leichenfeste
339 Narthex
angelegte Vorplatz vor Mausoleen,danach die vergitterte Vorhalle derBasilika, die anfangs genau dieForm des Geheges am antikenHippodrom und des Grabvorplat-zes hatte, d.h. an beiden Endenhalbkreisförmig geschlossen war.Sie diente den Büßern und Kate-chumenen zum Aufenthalt (Gali-läa, → *Atrium). In der klass. by-zantin. Baukunst besitzt der N.meist die Form eines schmalenQuerriegels von derselben Breitewie das Kirchenschiff, mit dem erdurch Türen oder Bogenstellun-gen verbunden ist. Befindet sichdavor noch ein weiterer, zumeistdurch Bogenstellungen geöffneterVorraum, so unterscheidet manzwischen einem äußeren Exo-N.und einem inneren Eso-N., derhäufig mit Nebenkuppeln verse-hen ist. Die Bauform wurde ver-einzelt auch im W. übernommen.→ *Basilika. Engl., frz. narthex; it. nartece; sp. nártex.
Nase, 1. vorspringende Spitze derPaßformen des got. → *Maßwerks.2.→ Wassernase. 3. Vorsprung ander Unterseite des Dachziegels, mitdem der Ziegel an die Dachlattengehängt wird (→ *Dachdeckung). Engl. crocket, knob; frz. point, crochet;it. nasello, sporto; sp. gancho, tope.
Naumachie (gr.), mit Wassergefüllte Kampfbahn der Römer, inder Bootskämpfe und Seeschlach-ten stattfanden. Manche Zirkusan-lagen und Amphitheater konntenauch als N. benutzt werden. Engl. naumachy; frz. naumachie; it. nauma-chia; sp. naumaquia.
Nebenapsis, eine als Abschluß derSeitenschiffe neben der Hauptap-
sis bestehende, zumeist kleinere→ *Apsis. Engl. side apse, apsidiole; it. absidiola, absi-de laterale; sp. ábside lateral.
Nebenchor → *Chor.
Neidkopf, meist als Fratze ausge-bildet, aus Holz oder Stein anGiebel, Mauer oder Tür einesHauses oder eines Tores als Ab-wehrzauber angebracht. Engl. apotropaic image; frz. tête conjura-toire; it. maschera apotropaica; sp. máscaraapotropaica.
Nekropole (gr.), Bezeichnung fürein antikes Gräberfeld, das vorwie-gend zu Siedlungen gehört, in derRegel aber abgesondert liegt. Ar-chitekton. repräsentativ ausgestal-tet waren die Königsn. im altorien-tal. und ägypt. Bereich. In der gr.und röm. Antike lagen die N. vorder Stadt an Ausfallstraßen, dievon Grabbauten gesäumt waren(→ *Gräberstadt). Engl. necropolis; frz. nécropole; it. necropo-li; sp. necrópolis.
Netzgewölbe, eine → *Gewölbe-form der späten Gotik mit ma-schenartig überkreuzten Rippen,zwischen denen rautenförmigeFelder entstehen (→ Rautengewöl-be, Schwingrippengewölbe). Engl. reticulated vault, net v.; frz. voûte réti-culée; it. volta reticolare; sp. bóveda reticular.
Netzriegel → Gerüst.
Niederburg, → *Burg in derEbene, meist Wasserburg.
Niedersachsenhaus, Sonderformdes niederdt. Bauernhauses. DasN. ist ein Einhaus, das in West-falen, am Niederrhein, in Nord-
Nase 340
hessen und Hannover verbreitet ist.Bezeichnend für die Form ist diebreite mittlere Längsdiele, die sichmit einem großen Tor an derGiebelseite öffnet. Zu beiden Sei-ten der Diele (Dreschtenne) sindschmale Nebenräume (Kübbun-gen) für das Vieh. Am durch Quer-arme erweiterten Ende der Diele(Flett) liegt der Herd und dahinterschließen die Kammern des Wohn-teils an. Zwei Pfostenpaare tragendas Gebälk, auf dem das Dachruht. Die Außenerscheinung wirddurch engmaschiges Fachwerk ge-kennzeichnet.
Nische, einseitig offene, halbrun-de, rechteckige oder polygonaleAussparung in einer Mauer, diedurch einen Bogen (Nischenbo-gen) überdeckt sein kann. Sie kanntechn. bedingt sein (Fenstern.,Türn.) und ist meist sehr flach,manchmal aber auch eine Auswei-tung des Raums (Exedra, Kon-che,→ *Estrade). Engl., frz. niche; it. nicchia; sp. nicho.
Nischengrab, Loculus, ein ineiner Nische liegendes Wandgrab,bes. in unterirdischen Grabanlagen(→ *Katakomben). Das in einerrechteckigen Nische liegende N.heißt Mensagrab, das N. in einer Bo-gennische → Arcosolium (Arkosol).Engl.; sp. loculus; frz. arcosolium, enfeu;it. loculo.
Nonne, Klosterziegel in Form vonMönch und Nonne (→ *Dachdek-kung, → *Ziegel). Engl. nun; frz. tuile femelle; it. coppo;sp. teja canalón.
Nonnenempore, Nonnenchor,Emporenraum, Empore in Da-menstifts- und Nonnenklosterkir-chen, die der Abschirmung derNonnen von den übrigen Teilneh-mern am Gottesdienst diente, meistmit Altar, Orgel und Chorgestühl.Die N. lag meist im W., seltenerauch über den Seitenschiffen oderin einem Querhausarm. Die N.kann bühnenartig über Säulenstel-lungen weit in das Mittelschiffhineingezogen werden oder aufden Westbau beschränkt bleiben. Engl. nun�s gallery; frz. tribune de reli-gieuse; it. matroneo delle monache; sp. corode las monjas, galería d. l. m.
341 Nonnenempore
1 Diele mit Kübbungen2 Flett mit Herd 4 Kammer3 Stube mit Ofen 5 Alkoven
NiedersachsenhausNischengrab
Arcosolium Mensagrab
Nonnenempore (Beispiel: Gernrode,Nonnenstiftskirche, 10. Jh.)
Normalprojektion, Normalriß,winkel- und längentreue Darstel-lung (→ *Projektion) eines Objek-tes. Zur vollständigen Darstellungsind mindestens drei Normalrissenotwendig (Grundriß, Aufriß,Seitenriß; Kreuzriß). Engl. normal projection; frz. projectiongénérale; it. proiezione ortogonale; sp. pro-yección general, p. normal.
Notstein, Kraft- oder Balkenstein,ein Kragstein als Auflager für Bal-ken oder Mauerlatten (→ *Kon-sole). Engl. stone corbel, console; frz. corbeau;it. mensola di pietra; sp. modillón.
Nottreppe, eine Treppe, oft ausEisen, die nur im Notfall benütztwird und innerhalb oder außerhalbdes Baukörpers liegen kann. Engl. emergency stairs; frz. escalier desecours; it. scala di emergenza, s. di sicu-rezza; sp. escalera de emergencia.
Noviziat (lat.), der Bereich desKlosters, in dem die Novizen woh-nen, bes. ausgebildet auf dem St.Galler Klosterplan um 830. Frz. noviciat; it. noviziato; sp. noviciado.
Nurage, Nuraghe, mehrgeschos-siger Steinbau in Kegelform ausvorgeschichtlicher Zeit (unechtesGewölbe), hauptsächl. in Sardi-nien vorkommend. Eine Sonder-form sind die Talayoten auf denBalearen. Ähnl. bis heute in Süd-italien errichtete Wohnbauten hei-ßen → *Trulli. Engl., frz. nuraghe; it. nuraghi; sp. construc-ción prehistórica de piedra.
Nut, eine rillenartige Vertiefung.Als → *Holzverbindung (Nut undFeder) eine Aussparung am Stoß(Schmalseite) eines Bretts, diemeist ein Drittel der Brettdickebreit ist und in die die Feder ein-greift. Engl. groove, slot, mortice; frz. rainure;it. scanalatura, femmina; sp. ranura, acana-ladura.
Nymphaeum (gr.), Kultplatz derNymphen, urspr. über einer Quel-le, später aber hauptsächl. an derMündung einer Wasserleitung inder Stadt. In der hellenist. und röm.Kunst sind Nymphaeen mehrge-schossige Säulenarchitekturen, vordenen Wasserbassins liegen, auch
Normalprojektion 342
Nymphäum(Beispiel: Aspendos)
tempelähnl. Anlagen oder Zentral-bauten, Blickfang an wichtigenPlätzen oder Straßenecken. Im 16.Jh. in Rom wiederaufgenommenund über Europa verbreitet, alsNymphenbäder in die dt. Lust-schloßparks übernommen, in der2. Hälfte des 18. Jhs. im Land-schaftsgarten von bes. Bedeutung. Engl. nymphaeum; frz. nymphée; it. ninfeo;sp. lugar consagrado a las ninfas.
O
Obelisk (gr. kleiner Spieß), qua-drat., nach oben leicht verjüngterund von einer kleinen Pyramideabgeschlossener Steinpfeiler (Mo-nolith), oft mit Hieroglyphen be-schriftet. Der O. der Ägypter istKultsymbol des Sonnengottes undkommt in Sonnenheiligtümern undzu beiden Seiten des Tempeltors,des Pylons vor. Die O. haben oftbeachtl. Ausmaße (bis 30m Höhe)und waren auch bei den Römernund Byzantinern beliebt, die echteO. aus Ägypten holten. Der Bau-kunst des Barock und des Klassizis-mus war der O. ebenfalls bekannt. Engl. obelisk; frz. obélisque; it., sp. obelisco.
Oberbühne, Teil der Bühne überdem Bühnenausschnitt. Da hierdie aufziehbaren Teile des Bühnen-bilds hängen (Schnürboden), mußdie O. höher sein als der Bühnen-ausschnitt und erscheint daheraußen als Bühnenturm den ganzen→ Theaterbau beherrschend.
Obergaden, 1. Gaden, Lichtgaden,der über die Seitenschiffdächer er-höhte obere Teil (Obergadenwand)des Mittelschiffs einer → *Basilika,in dem die Hochschiffenster (Ober-gadenfenster) liegen. 2. Nach allenSeiten ausladender hölzerner Auf-bau auf Bergfrieden mit der Woh-nung des Türmers. Engl. clerestory; frz. étage clair, clairevoie;it. claristorio; sp. claraboya.
Obergeschoß → *Geschoß.
Obergurt, 1. verstärkender →*Gurtbogen am Gewölberücken(im Gegensatz zum Untergurt, deran der Gewölbelaibung vortritt). 2.Bei Fachwerkträgern der oberedurchlaufende Stabzug im Unter-schied zum Untergurt. Engl. top boom; it. arco estradossato di unavolta; sp. larguero superior.
Oberkirche → *Doppelkapelle.
Oberlichte, 1. in der Decke liegen-de Fensteröffnung, die Oberlichteinläßt. Schon in ägypt. Tempelnkommt neben Obergadenfensterndie O. vor. Sie hat sich bes. in derArchitektur bei Ausstellungs- undIndustriebauten bewährt (→ *Licht-hof). Eine Sonderform der O. istdie ringförmige Öffnung (Auge,Opäum, Nabel) im Scheitel einerKuppel. 2. Seltener für Fenster, dieim obersten Teil der Umfassungs-
343 Oberlichte
Obelisk
wände eines Raums oder über demFensterkämpfer angebracht sindund hohes Seitenlicht geben. Engl. 1. skylight, fanlight; frz. 1. jour d�enhaut, lanterneau, imposte; it. 1. lucernario;sp. claraboya, tragaluz.
Oberrähmverzimmerung,Hochrähmzimmerung, Verbin-dung des Bundbalkens (häufig alsAnkerbalken ausgebildet) unter-halb des Wandrähms mit den Stän-dern, während die Sparren direktauf dem Wandrähm aufruhen undmit diesem verzimmert sind, bes.bei norddt. Ständerbauten vorkom-mend.
Oberzug, im Gegensatz zu dem→ Unterzug eines Gebälks bzw.einer Massivdecke ein Träger, derüber der Decke liegt, bes. bei Aus-stellungs-, Sport- und Werkhallen. Engl. outer garments; frz. partie inférieure;it. trave estradossata; sp. viga exterior.
Observatorium, Sternwarte, einfestes Bauwerk mit in der Regelstationär aufgestellten Instrumen-ten zur astronom., geophysikal.oder metereolog. Beobachtung.Neuzeitl. O., seit dem 18. Jh. auchSternwarte genannt, haben in derRegel drehbare Kuppeln von 3�45mDurchmesser mit verschließbarenKuppelspalten. Die Geschichte derO. geht in die Frühgeschichte zu-rück, bes. Ausbildung erfuhren dieO. bei den Arabern im 9./10. Jh., inEuropa kommen O. erst Ende des15. Jhs. auf (1471 in Nürnberg).Mit Erfindung des Fernrohrs ent-wickelten sich im 17.�19. Jh. zahl-reiche O. bis hin zu den Riesen-teleskopen des 20. Jhs. Engl. observatory; frz. observatoire; it. os-servatorio; sp. observatorio.
Ochsenauge, kleines, ovales Fen-ster (als Rundfenster → Okulus),das in einer Wand (über Türenhäufig), in Kuppeln (bes. im Tam-bour) und auch als Dachgaube Ver-wendung findet, bes. in der Archi-tektur des 17. /18. Jhs. Engl. bull�s-eye; frz. �il-de-b�uf; it. occhiodi bue, finestra orbicolare; sp. ojo de buey.
Ochsenschädel, → Bukranion,aus skelettierten Ochsenschädeln(oder Stier) bestehender → *Frieseines röm. Tempels. Frz. bucrane; it. (fregio a) bucranio, teschiodi bue; sp. friso bucráneo.
Odeion, Odeon, Odeum (gr.),Konzerthaus vor allem der gr. undröm. Antike. In der Grundanlagedem röm. Theater verwandt, jedochmanchmal ganz oder teilweise über-deckt. Im 19. Jh. in Anspielung aufdas gr. Theater Bezeichnung füreinen Konzertsaal. Sp. odeón.
Offene Bauweise, → *Bauweisemit einzelnen durch Bauwiche von-einander getrennten Baukörpern. Engl. open construction; frz. constructiondiscontinue; sp. construcción abierta.
Offenes Gewölbe, → *Gewölbeohne Stirnmauer.
Ogive (frz.), Rippe.
Ohr, 1. oben seitl. überstehenderTeil von Tür- und Fensterumrah-mungen. 2. Festungsohr, an dieFace eines Werkes oder einer Ba-stion am Schulterpunkt sich an-schließende, durch Zurückziehungeines Teils der Flanke gebildetebogen- oder kastenförmig vorsprin-gende Schulter zur Deckung der
Oberrähmverzimmerung 344
Flanke und zur Grabenbestrei-chung (→ Ohrenbastion). Engl. ear, auricle; frz. oreille, oreillon, lu-nette; it. orecchio; sp. 1. resalto de un mar-co, 2. luneta.
Ohrenbastion, zur Deckung derFlanken mit → Ohren (2) versehe-ne Bastion.
Ohrmuschelwerk (Ohrmuschel-stil), im 17. Jh. hauptsächl. in dengerman. Ländern vorkommendepflanzenähnl. Dekoration, die anKnorpel (Knorpelwerk) bzw. Ohr-muscheln erinnert.
Oktastylos (gr.), Tempel mit achtSäulen an der Front (→ *Tempel-formen). Engl. octastyle; it. octastilo; sp. templo conocho columnas frontales.
Oktogon (gr.), Achteck, → *Zen-tralbau über dem Grundriß einesregelmäßigen Achtecks. Engl. octagon; frz. octogone; it. ottagono;sp. octógono.
Okulus (lat.), kleines Rundfenster;als ovales Fenster → Ochsenauge. Engl., frz. oculus; it. oculo; sp. ojo de buey.
Olive, der zur Betätigung von Fen-sterverschlüssen häufig gebrauch-te, olivenförmige Drehknauf, d.h.
ein Handgriff, mit dem die zumÖffnen und Schließen erforderl.Drehung des Gestänges oder desFallriegels ausgeführt wird. Engl. olive; frz. (bouton en) olive; it., sp. oli-va.
Olympieion (gr.), eine dem Zeus(Olympios; Jupiter) geweihte Tem-pelanlage.
Opäum, Opaion, Auge, seltenerNebel, kreisrunde Lichtöffnungim Scheitel einer → *Kuppel. Engl. opaion; frz. �il de dome, o. de coupo-le; it. opaion; sp. ojo de cúpula.
Opernhaus → *Theaterbau.
Opisthodomos (gr. Hinterhaus),die der Vorhalle (Pronaos) entspre-chende Halle zwischen den Antender Cellarückseite des Doppelan-tentempels (→ *Tempelformen).
Oppidum, 1. Türme zu beidenSeiten der Ablaufstände (Carceres)eines röm. → Zirkus. 2. BefestigterPlatz, der in Kriegszeiten als Zu-
345 Oppidum
Fensterrahmung mit Ohren
Ohrmuschelwerk
fluchtsstätte (Fliehburg) aufge-sucht wurde. Frz. oppidum; it. oppido; sp. 1. barrera delcirco, 2. recito fortificado.
Opus � (lat.), Werk, Sammelbe-griff für fast alle Arbeitstechnikender röm. Antike. 1. VerschiedeneArten des antiken → Mauerwerkstragen diese Bezeichnung, so o.latericium (Ziegelbau), o. italicum(Steinbau), o. romanum (Quader-bau), o. antiquum bzw. o. incertum(Bruchsteinbau), o. rusticum (Ru-stika), o. mixtum (gemischtes Mau-erwerk), o. caementitium bzw. o.fusile (Gußmauerwerk), o. emplec-tum (Füllmauerwerk) und o. re-vinctum (Mauerwerk mit Eisen-klammern). 2. Verschiedene Artenantiken → *Mauerwerks, wie o.gallicum bzw. o. diamictum (Läu-ferverband), o. isodomum (gleicheSchichthöhen) bzw. o. pseudoisodo-mum (verschiedene Schichthöhen),o. quadratum (quadrat. Steine), o.figuratum (figurierter Verband), o.reticulatum (Netzverband) und o.spicatum (→ *Ährenwerk). 3. Ver-schiedene Putz- bzw. Stuckarten,
wie o. albarium, o. arenatum, o. tec-torium, o. album, o. coronariumbzw. o. marmoratum. 4. Verschie-dene Mosaik- und Plattenverklei-dungen, wie o. musivum, o. ale-xandrinum, o. vermiculatum undo. sectile. 5. Verschiedene Fußbo-denarten, wie o. signinum und o.tesselatum. 6. Verschiedene Gewöl-bearten, wie o. ogivale (Rippen-gewölbe). 7. Zimmermannsarbeit(o. fabrile) und andere Technikenwie o. anaglyphicum (Flachrelief).
Orangerie (frz.), eigentlich Ge-wächshaus für nicht winterhartePflanzen (Palmenhaus) in barok-ken Parkanlagen, allgemein eben-erdiges barockes Gartenhaus mitgroßen Fenstertüren, meist amEnde der Mittelachse eines Parks.
Oratorium (lat.), in der Baukunsteine gegen den Hauptraum meistdurch Fenster abgeschlosseneEmpore im Chor (seltener imLanghaus) einer Kirche. Das O.war für bes. Kirchenbesucher(Kaiser, Fürsten, Ortsherrschaftusw.) bestimmt. Im weiteren Sinneein Betsaal.
Opus 346
Barocke Orangerie
Orchestergraben, der meist ver-senkte Raum des Orchesters vorder Bühnenrampe (→ Theaterbau).Engl. orchestra pit; frz. fosse d�orchestre;it. (buca dell�)orchestra; sp. foso de la or-questa.
Orchestra (gr.), der kreisförmigeTanzplatz im Zentrum des gr.Theaters (→ *Theaterbau), späterauch der vor der Bühnenwand(Scene) gelegene Platz für denChor.
Ordensburg, Klosterburg desDeutschen Ritterordens vor allemin Preußen und im Baltikum (Son-derform der Burg). Die meist ausBacksteinen errichteten O. zeich-nen sich durch ihre geometr. Re-gelmäßigkeit und durch starke Be-festigung aus. Die Kirche ist dabeivon geringerer architekton. Bedeu-tung als die Hauptsäle (Remter).Den Auftakt bildet meist eine Vor-burg für die Ritterheere. Eine Be-sonderheit der O. ist der → *Dans-ker. Engl. castle of (Teutonic etc.) order; frz. cou-vent-forteresse; sp. castillo de una orden re-ligiosa.
Ordnung → *Säulenordnungen.
Orgelempore, Empore für dieOrgel, urspr. nicht über dem West-eingang, sondern an den Hoch-schiffwänden des Langhauses an-gebracht. Erst in der Barockzeit, alsdie Orgel monumental in das Lang-haus eingefügt wurde (Orgelpro-
347 Orgelempore
Ordensburg (Beispiel: Neidenburg /Ostpreußen, 14. Jh.)
a Remter b Kapelle
Orgelempore
spekt), wurden eigens O. (»Orgel-chor«) erbaut. Sie wurden späterallgemein und auch in ältere Kir-chen ohne ursprüngl. Westemporeeingefügt. Engl. organ loft; frz. tribune d�orgue; it. can-toria; sp. tribuna del órgano.
Orientierung, Ausrichtung einerBauachse nach Osten (→ Ostung). Engl., frz. orientation; it. orientamento;sp. orientación.
Orillon, Bollwerksrohr, vordererTeil der Flanke, durch den derzurückgezogene Teil gedeckt wird. Engl. orillion; frz. orillon.
Ornament (lat. ornare: ordnen,rüsten, schmücken), das einzelneMotiv einer Verzierung. Die Funk-tion des O. ist es, einen Gegenstandzu schmücken und zu gliedern so-wie seine Teile opt. gegeneinanderabzusetzen. Es greift dabei im all-gemeinen nicht in den Aufbau deszu schmückenden Objekts ein, son-dern begleitet ihn nur. Das O. hatdie Tendenz, sich auf alle Werkeder gleichen Zeit im ganzen Kul-turbereich auszudehnen, obwohl esursprüngl. nur für eine bestimmteKunstgattung (z. B. → *Bauorna-ment) gedacht war. Hauptformendes O. sind das konstruierbare geo-metr. O. und das vegetabil. oderPflanzeno., das alle Grade von na-turgetreuer Nachbildung bis zurvölligen Abstraktion aufweisenkann. Eine Sonderform ist dasTierornament. Das O. ist eine Ur-form künstler. Ausdrucks, doch istdie Fähigkeit, O. zu erfinden, inmanchen Epochen schwächer. Engl. ornament; frz. ornement; it., sp. orna-mento.
Ort, Spitze, Ecke, Ende, Randeines Gebäudes, bes. Begrenzungs-linien der Dachflächen am Giebel(linker und rechter Ort). Engl. place, spot, site; frz. endroit, place,lieu; it. luogo, posto, sito; sp. lugar, sitio.
Ortbalken, → *Balken, der un-mittelbar an die Giebelmauer an-schließt. Frz. poutre de pignon; sp. aguilón.
Ortgang, als Abschluß der Dach-deckung am Giebel in der Ebeneeines Giebelsparrens verlaufendesBrett. Engl. verge; frz. rive, r. de toiture, r. depignon; it. asse di frontone, tavola di f.;sp. tapacán.
Orthostat (gr.), unterste Schichtdes aufgehenden Mauerwerks ei-nes Gebäudes, die aus größerenund manchmal hochkant gestelltenSteinen besteht, beim gr. → Tem-pelbau die Schicht über dem Mau-erfuß, die den Sockel der Cella bil-det und von einer Abdeckplatteabgeschlossen ist. In der BaukunstMesopotamiens und der Hethiterwaren nur die O. aus Stein undmeist mit Reliefs geschmückt. Engl. orthostat; frz. orthostate; it. ortostata;sp. sócalo de la cella.
Ortziegel, Anziegel, Dachziegelam Giebel (Ort, → Dachdeckung). Engl. verge roof (-ing); frz. tuile de pignon,t. de rive; it. tegola di bordo; sp. teja de agui-lón, caballete.
Orientierung 348
Orthostaten
Osirispfeiler, Pfeiler, an dessenStirnseite Osiris plast. dargestelltwar. O. kommen im Neuen ReichÄgyptens vor (Totentempel Ram-ses� II. »Ramesseum« und Toten-tempel Ramses� III. in Theben-Medinet Habu). Sie stehen meistan der dem Königspalast gegenüber-liegenden Seite des ersten Tempel-hofs. Engl. Osiris pillar; frz. pilier osirique; sp. pi-lar de Osiris.
Ossarium, Ossuarium → *Karner.
Ostung, Orientierung, Ausrich-tung der Bauachse einer Kirchenach O. Kultbauten wurden viel-fach nach allgemeinen Regeln aus-gerichtet: gr. Tempel haben Portalund Vorhalle im O. (Morgensonnebeleuchtet das Götterbild), christl.Kirchen sind nach dem HeiligenLand oder meist nach O. (Sonnen-
aufgang), Moscheen nach Mekkagerichtet. In späteren Zeiten wur-den diese Regeln meist von denStandorteigenschaften oder ande-ren Bezugssystemen (Städtebau)verdrängt. Frz. orientation; it. il volgere a oriente;sp. orientación al este.
Oval (lat. ovalis), eirund, oft un-richtig für ellipt. verwendet. Sp. ovalado.
P
Pagode (prakrit.), aus dem → *Stu-pa der buddhististischen BaukunstOstasiens weiterentwickelter Stock-werksbau auf quadrat. oder poly-gonalem Grundriß. Die meist un-gerade Zahl der Stockwerke beträgtzwischen drei und neun. Die oft ge-
349 Pagode
Osirispfeiler(Beispiel:Theben-Medinet Habu,
Totentempel Ramses' III.)
Oval EllipsePagode
(Beispiel: Kyoto, Ishiyama-Dera-Tahoto)
schwungenen und manchmal auchmit Glocken besetzten Dächerspringen weit vor. Die P. ist einumschreitbares Heiligtum und kannisoliert, aber auch in Verbindungmit anderen Bauten einer bud-dhist. Tempelanlage stehen. DerBegriff P. wird auch für turmähnl.Bauten ind. bzw. hinterind. Tempelverwandt.
P�ai-lou (chines.), Ehrentor vorFeststraßen oder Tempelanlagen inChina mit mehreren Durchgängenund nach der Mitte zu gestaffeltenDächern.
Palais (frz.) → Palast (→ *Hôtel).
Palas (lat. palatium), Wohn- bzw.Saalbau für die Herrschaft einer→ Burg oder → *Pfalz.
Palast (lat. palatium), der Begriffwird heute allgemein für Königs-oder Fürstensitze, aber auch füröffentl. Gebäude oder für monu-mentale städt. Wohnhäuser, die nurvon einer Familie bewohnt werden(Palais, Palazzo), verwandt. DerName ist von den röm. Kaiserbau-ten abgeleitet, die auf dem Palatinstanden. Engl. palace; frz. palais; it. palazzo; sp. palacio.
Palastkapelle, Kapelle in einemPalast, hauptsächl. in den → *Pfal-zen (→ Pfalzkapelle), Königsschlös-sern und Renaissancepalästen. Engl. palace chapel; frz. chapelle de palais;it. cappella palatina; sp. capilla del palacio.
P'ai-lou 350
P�ai-Lou
Palas (Beispiel: Goslar, Pfalz)
Palästra (gr.), Ringerschule bzw.Kampfstätte im antiken Griechen-land, oft in Verbindung mit einemGymnasium. Die P. hat meist einenPeristylhof und anschließend Salb-und Waschräume (→ *Thermen).
Palazzo (it.) → *Palast.
Palisade (lat.-frz.), Befestigung ausnebeneinander eingeschlagenenPfählen (Schanzpfahlreihe), dieoben zugespitzt sind. Schon beiröm. Standlagern, Fliehburgen,Motten usw. verwandt und dannbei ma. Burgen und Stadtbefesti-gungen längs der Böschungsober-kante der Umwallung angebracht.
Palisadenbau, Wandkonstruktionaus nebeneinander eingegrabenenHölzern, die zugleich das Dach tra-gen; die Hölzer sind häufig Spalt-bohlen. Eine frühgeschichtl. Kon-struktionsweise, die sich in Nord-europa bis ins MA. erhalten hat. Engl. palisade; frz. palissade; it. costruzionea palizzata; sp. construcción de empalizada.
Palladio-Motiv, Serliana, bereitsvon Serlio entwickelte und von Pal-ladio (Basilika in Vicenza) weiter-entwickelte Komposition in derSpätrenaissance: Verbindung einesmittleren, breiteren Bogens mitzwei schmäleren Seitenöffnungen,die von einem Gebälk in Höhe desBogenkämpfers abgeschlossen sind.(Abb. S.352) Engl. Serlian motif; frz. baie serlienne; it. ser-liana; sp. composición desarrollada porSerlio y Palladio.
351 Palladio-Motiv
Römischer Palast(Beispiel: Spalato, Diokletianspalast)
A KaiserwohnungB Porta Aurea (Goldenes Tor)C Porta Argentea (Silbernes Tor)D Porta Ferrea (Ehernes Tor)E Vestibül der KaiserwohnungF Tempel G Mausoleum
Arabischer Palast(Beispiel: Mschatta, Winterlager, um 720)A HauptportalB TorgangC Vorhof
D HaupthofE FürstenhalleF Kuppelsaal
Italienischer Stadtpalast des 15. Jh.(Beispiel: Siena, Palazzo Piccolomini)
Palmengewölbe, Fächergewölbe,Strahlengewölbe, Gewölbe mit vomAuflager fächerförmig ausgehen-den Rippen, hauptsächl. in der engl.Gotik vorkommend (→ *Gewölbe-formen). Engl. palm vault; frz. voûte palmiforme;it. volta a ventaglio; sp. bóveda palmiforme.
Palmenhaus, Gewächshaus fürnicht winterharte Pflanzen einerParkanlage (→ *Orangerie). Frz. palmarium; it. serra delle palme; sp. in-vernadero para palmeras.
Palmensäule, Säule der ägypt.Baukunst mit einem Palmblatt-kapitell (→ *Kapitell). Engl. palmiform column; frz. colonne pal-miforme; it. colonna palmiforme, c. a pal-ma; sp. columna palmiforme.
Palmette (frz.), symmetr. Ab-straktion eines Palmenwipfels alsGrundform der Ornamentik. DieP. kann einzeln vorkommen (z. B.Bekrönung von Stelen, → *Grab-denkmal), wird aber meist wieder-holt (→ *Fries, → Anthemion). Die
P. kommt bereits in der babylon.Kunst vor. Sie tritt meist in Ver-bindung mit Voluten auf. Engl., frz. palmette; it. palmetta; sp. palmeta.
Palmettenfries → *Fries aus fort-laufend gereihten Palmetten. Engl. palmette fries; frz. frise de palmettes;it. fregio a palmetta; sp. friso de palmetas.
Paneel (neulat., niederländ.), höl-zerne Wandbekleidung, die auseinzelnen Feldern zusammenge-setzt sein kann und meist in Brust-höhe abschließt. Engl. panel, pannel, wainscot; frz. panneau;it. pannello; sp. panel.
Pantheon (lat.), gemeinschaftl.Tempel für alle zwölf olymp. Göt-ter, bes. in der röm. Antike.
Pantscharam (ind.), modellartigverkleinerte Nachbildung von Pa-villons an den verschiedenen Stock-werksecken an einem → *Ratha,Gopuram bzw. Vimana.
Papyrusbündelsäule, ägyptische→ *Säule, die aus gebündeltenStengeln der Papyruspflanze ent-standen zu denken ist. It. colonna egizia.
Papyrussäule, ägypt. → *Säule,die nach dem Vorbild der Papy-ruspflanze ausgebildet wurde. IhrSchaft ist unten eingezogen undwächst aus Kelchblättern heraus(→ *Kapitell). Engl. papyrus column; frz. colonne papyri-forme; it. colonna papiriforme; sp. columnapapiroforme.
Parabelbogen, Bogen in Parabel-form (→ Bogenformen). Der demstat. Kräfteverlauf genau entspre-
Palmengewölbe 352
Palladiomotiv(Beispiel:Vicenza, Basilika von Palladio,
16. Jh.)
chende P. wird vor allem in neuererZeit häufig verwendet. Engl. parabolic arch; frz. arc (à trace) para-bolique, a. de parabole; it. arco parabolico;sp. arco parabólico.
Paradezimmer, im Hauptteil ei-nes Schlosses oder im Hauptge-schoß eines herrschaftl. Hausesgelegene Zimmer, die reich ausge-staltet sind und aus Audienz-, Ge-sellschaftszimmern und Sälen be-stehen. It. stanze di rappresentanza; sp. salón de gala.
Paradies (gr. paradeisos: Garten),Bezeichnung für den GottesgartenEden und die Ziergärten oriental.Fürsten, seit dem 6. Jh. n. Chr.gleichbedeutend mit → *Atrium.Im 8. /9. Jh. ist die Bezeichnung P.für Atrium durch den Liber Pon-tificalis und den Klosterplan vonSt. Gallen bezeugt. Zusätzl. zumAtrium werden aber auch die drei-schiffigen Vorkirchen der burgund.Cluniazenserkirchen und die drei-teiligen, ein Joch tiefen Vorhallender Zisterzienserkirchen sowieähnl. Vorhallen an Domen, die li-turg. Prozessionen und als Grab-lege dienen, P. genannt, auch alsGaliläa oder Narthex bezeichnet.Das zugehörige Westportal derKirchen wird auch P.pforte genannt.Engl. paradise; frz. paradisus; it. paradiso;sp. paraíso, átrio.
Paradroma (gr.), Gang, Durch-gang, auch an der Palästra angebau-ter Wandelgang; großer Eingang ei-nes gr. Theaters.
Paraflanc (frz.), im FestungsbauSchulterwehr, Seitentraverse, Flan-kenwehr, im Graben oder an denSchultern einer offenen Schanze. Frz. paraflane; sp. defensas en una trin-chera.
Paralleldach, mehrere nebenein-ander angeordnete Satteldächerüber einem einzigen Baukörper(→ *Dachformen). Frz. toit parallèle; sp. serie de tejados a dosaguas.
Parallelrippengewölbe, Gewölbemit paarweise gleichlaufenden Rip-pen (Parallelrippen), gehört als Un-tergruppe zu den → Netzgewöl-ben. Engl. parallel ribbed vault; it. volta reticola-re a nervature binate; sp. bóveda nervada enparalelo.
Parapet (frz.), Brüstung oderBrustwehr.
Paraskene (gr.), parascenion, pa-rascenium, hinterer Teil der Bühneim gr. → *Theaterbau, auch dieSeitentüren der Skene oder die Ein-gänge in die Orchestra rechts undlinks unmittelbar vor der Bühne,damit im röm.Theaterbau zugleichdie seitl. Begrenzung der Bühne.
Paravent (frz.), Windschirm, alsFensterladen seitlich vor den Fen-stern, auch an Betten, Kaminenusw. als Wandschirm. Engl., frz. paravent; it. paravento; sp. biom-bo, pantalla.
353 Paravent
Paradies(Beispiel: Maria Laach, Klosterkirche,
12. Jh.)
a Paradies
Park (lat.), ein oft eingezäuntes,größeres Gebiet mit Wald und Wie-sen, das primär nicht landwirtschaft-lich genutzt wird, sondern der Frei-zeitgestaltung dient. Der Übergangzum → Garten ist strukturell undin den örtl. Anlagen fließend. Derheutige P. geht auf die it. Spätre-naissance zurück, deren architek-ton. gestalteten Villengärten baum-bestandene Teile enthielten, die vonSchneisen geradlinig durchzogenwaren und Volièren, Brunnen undTeiche enthielten. Im frz. Gartendes 16. Jhs. wurde unter »parc« einvon Mauern umgebenes Terrainverstanden, das meist an den geo-metr. gegliederten Garten anschloß;dieser »parc« enthielt Waldpartien,Obstplantagen, Weingärten, Wie-sen, Weiher und Tiergehege. DerPark enthält jedoch nie Gebäude,sondern nur geometr. gestalteteWegführungen, so daß er nicht zureigentl. Architektur gehört. Engl. park; frz. parc; it. parco; sp. parque.
Parkett (frz.), 1. der ebenerdigeRaum vor der Bühne, auf den dasParterre folgt (→ Theaterbau). 2.Fußboden, der mit Holztafeln be-legt ist. Auf einem Blindboden, deraus rauhen Brettern besteht undauf Balken oder auf ein Fußboden-lager aufgenagelt ist (heute Estrich),wird der eigentl. P.boden verlegt,der aus Tafeln (Tafelp.) oder ausRiemen (Riemenp. oder Schiffsp.)besteht; werden nur Stäbe anein-andergefügt, spricht man von Stab-fußboden, nicht von P.; nach demVerlegen wird die Oberfläche ge-schliffen (abgezogen) und gewachst,heute mit Kunstharzlacken versie-gelt. P. findet sich hauptsächl. inbarocken Schlössern, seit dem spä-ten 19. Jh. auch in Bürgerwohnun-
gen. 3. Bis ins 16. Jh. verwandteBezeichnung für ebene Blumen-beete, bes. vor Schloßanlagen. Engl., frz. 2. parquet; it. 1. prime file dellaplatea, 2. parquet; sp. 1. platea, 2. parquet,taracea.
Parkhaus, Hochgarage, Bauwerkzum Abstellen von Fahrzeugen inverschiedenen Geschossen, diedurch Aufzüge, Rampen oder Wen-delrampen miteinander verbundensind. Engl. parking garage; frz. garage à étages;it. autosilo; sp. edificio de estacionamientos.
Parlatorium (lat.), Sprechraum ineinem Zisterzienserkloster.
Parodoi (gr. Mz. v. parodos:Zugang), seitl. Zugänge zwischenSkene und Zuschauerreihen beimantiken → *Theaterbau.
Park 354
Parkett
Parkhaus
a Wendelrampe
Parterre (frz.), 1. Erdgeschoß(→ *Geschoß). 2. Ebener Teil desZuschauerraums eines Theatershinter den Sitzreihen des Parketts.3. → Broderiep., ebene Gartenflä-che mit Teppichbeeten im Barock-garten (→ *Garten), häufig mit geo-metr. Figuren vor der Gartenseitedes Schlosses. Engl. 1. ground floor, 2. rear stalls, am. par-quet; frz. 1. rez-de-chaussée, 2. parterre;it. 1. pian terreno, 2., 3. parterre; sp. 1. plan-ta baja, 2. butacas posteriores, 3. pradobaroco.
Parzelle (frz.), vom Katasteramtvermessene Grundstückseinheit,die numeriert und im Grundbucheingetragen wird. Engl. parcel, lot; frz. parcelle (de terrain);it. parcella; sp. parcela.
Paß, ein Kreisbogen, der durch→ Nasen getrennt und zu mehre-ren einem Kreis eingefügt ist: lie-gender (unten eine Nase) oder ste-hender (unten ein P.) Drei- oderVierp., auch Fünf-, Sechs- oderVielp.; bes. in der Spätromanik alsRundfenstergliederung und im got.Maßwerk vorkommend (→ Souf-flet, → Blatt). Engl. foil, lobe; frz. lobe; it. lobo; sp. lóbulo.
Passage (frz.), Durchgang zwi-schen Höfen oder zwischen bzw.unter Bauwerken (Unterführung),der mit Läden ausgestattet seinkann.
Pastophorien (gr.), zusammen-fassender Begriff für Diakonikon
(Ankleideraum der Priester, Sakri-stei) und Prothesis (Aufbewah-rungsort für Geräte) am Ostendeder Seitenschiffe einer frühchristl.→ *Basilika.
Patio (span.), Wohnhof eines span.Hauses (→ Wohnhaus).
Patrizierhaus, Wohnhaus von ur-spr. dem niederen Adel zugehöri-gen Patriziern, später auch das vonKaufleuten oder Ratsherren einerStadt. Das P. war meist ein Stein-haus (»Burg«) und zeichnete sich ge-genüber den Bürgerhäusern durchdifferenziertere Gestaltung und rei-chere Ausbildung aus. Engl. patrician house; frz. maison patri-cienne; it. casa patrizia; sp. casa patricia.
Patronatsloge, Kirchstuhl oderGestühl (Herrschaftsstuhl, Her-renbank) als Platz für die Vertreterder weltl. Gewalt in protestant. Kir-chen, in Funktion und Bedeutungden ma. Herrschaftsemporen ver-
355 Patronatsloge
Sechspaß (stehend)
Patrizierhaus(Beispiel: Nürnberg, Nassauerhaus)
wandt. Bevorzugt wird die Anord-nung gegenüber dem Altar oderder Kanzel oder in deren Nähe,zumeist als eigener Anbau, der sichim Obergeschoß zum Kirchen-raum öffnet, oder als hölzernerEinbau im Kirchenschiff oder alsTeil einer Empore. Die Anordnungist sowohl bei nachträgl. Einbau alsauch bei Gesamtplanungen gleich.Im 17. Jh. bis Anfang des 19. Jhs.wurde die P. künstler. gestaltet, vorallem in den Dorfkirchen.
Pavillon (frz.), kleiner, freistehen-der (Gartenp.) oder mit einemSchloß durch eine Galerie oderunmittelbar verbundener Baukör-per. Der P. ist vom Gesamtbaukör-per eines Barockschlosses durchein eigenes Dach klarer abgetrenntals der → *Risalit, doch sind dieBegriffe (Eckp., Eckrisalit) nichtimmer klar zu trennen. Engl. pavilion; frz. pavillon; it. padiglione;sp. pabellón.
Pavillonsystem, ein Anlagesy-stem aus mehreren isolierten odernur lose verbundenen Baukörpern,bes. bei Schulen oder Krankenhäu-sern häufig angewandt. Frz. système de pavillons; it. disposizione apadiglioni; sp. sistema de pabellones.
Pavimentum (lat.), antiker Fuß-bodenbelag aus bunten Platten(opus alexandrinum).
Pechnase, Gußerker, kleiner, er-kerartiger Vorbau mit Bodenöff-nung an den Außenseiten vonBurg- oder Stadtmauern, an Tor-bauten, selten an Wohnbauten undan Bergfrieden, wie bei Gußlöchern(Wurfscharten) zum Ausgießen vonheißen Flüssigkeiten (Wasser, Öl,Pech, Teer) gegen angreifende Fein-de. Häufig werden → *Abtritte mitP. verwechselt, deren Einbautenund Bodenöffnung aber ihre Nut-zung erkennen lassen. Die P. istwahrscheinl. vom Orient über Süd-frankreich im 13. Jh. allgemein inEuropa verbreitet worden. Die frz.Wehrbauten bevorzugten eine fort-laufende und zusammenhängendeAnordnung als vorspringende Ga-lerie auf Konsolen (→ Maschikuli). Engl. machicolation; frz. bretèche, mâchi-coulis; it. bertesca, piombatoia, naso, ca-doia; sp. matacán.
Pendant (frz.), Gegenstück zurWahrung der Symmetrie. Pendantssind in barocken Kirchen gegen-über der Kanzel, als Aufbautenüber Taufsteinen oder als kleineOrgeln errichtet (Kanzelp.). Auchstädtebaul. P. sind keine Seltenheit. Engl., frz., it. pendant; sp. pendiente.
Pavillon 356
Pavillona Dachp. b Eckp.
Pavillonsystema Hauptgebäude b Pavillon
Pendelstütze, Pendelpfeiler, Stütz-glied mit Kopf- und Fußgelenk, dasentsprechend den Bewegungen desgetragenen Bauteils pendelt, in mo-derner Konstruktion mit Kugelzap-fenlager oder Walzenlager, in histo-rischer Konstruktion als Ständerohne Verstrebung auf den Bodengestellt.Engl. hinged column, rocker c.; frz. appuipendulaire; it. biella; sp. apoyo pendular.
Pendeltür, Schwingflügeltür,→ *Tür mit zwei nach innen undaußen ausschwingenden (pendeln-den) Türblättern. Engl. swinging door; frz. porte battante, p.va-et-vient; it. porta a vento (a due batten-ti); sp. puerta de vaivén.
Pendentif (frz.), Hängezwickel,Eckzwickel oder Teilgewölbe, einsphär. Dreieck zur Überleitung vomquadrat. Grundriß des Unterbauszum Fußkreis der → *Kuppel. DasP. wird von drei Viertelkreisbogenbegrenzt, von denen der oberehorizontale den vierten Teil desFußkreises der Kuppel bildet. Engl. pendentive; frz. pendentif; it. pen-nacchio sferico; sp. pechina.
Penetrale (lat.), Penetralia, Adyton,selten gebrauchter Begriff für denhinteren Teil eines Tempels mit demGötterbild, auch für Fürstengruft.
Pentagramm (gr.), Drudenfuß,aus dem Fünfeck entwickelte, stern-förmige und in sich geschlosseneSymbolfigur. Engl. pentagram; frz. pentagramme; it. pen-tagramma; sp. pentagrama.
Pentastylos (gr.), seltene → Tem-pelform mit fünf Säulen an derFrontseite.
Penthouse (engl. Wetterschutz-dach), ein bungalowartiger Dach-aufbau auf einem Wolkenkratzer,der eine Luxuswohnung enthält. Engl., it., sp. penthouse; frz. bâtiment enappentis, construction hors-toit.
Pergola (it.), Rankgerüst, nichtüberdeckter Laubengang in einerGartenanlage. Die auf Stützen lie-genden Unterzüge tragen ein Ge-bälk, das von Pflanzen umrankt ist. Engl., frz., it. pergola; sp. pérgola.
Peribolos (gr.), Temenos, der ei-nen Tempel umgebende, oft durchSäulenhallen begrenzte Bezirk(→ *Tempelbezirk).
Peridromos (gr.), der Umgangzwischen dem Säulenkranz undder Cellawand über dem Pteron desantiken Tempels (→ *Tempelbau).
Peripteraltempel → Peripteros.
Peripteros (gr.), Peripteraltempel,Tempel mit einer von einem Um-gang (Pteron) umgebenen Cella(→ *Tempelformen).
Peristyl (gr.), die einen Hof um-gebende Säulenhalle. Das P. kannden Hof eines → *Wohnhauses,aber auch einen Tempelhof rahmen(Peribolos) oder den Vorhof (Atri-um) einer altchristl.→ *Basilika. Engl. peristyle; frz. péristyle; it. peristilio;sp. peristilo.
357 Peristyl
Pentagramm
Peristylhof, von einem → Peristylumgebener Hof (→ *Atrium).
Perlstab → *Astragal, aus rundenoder längl. Perlen und dazwischen-liegenden Scheiben gebildeter Stab,der den Abschluß des ion. → Kymabildet (→ *Stab). Engl. bead and reel, chaplet; frz. fusarolle;it. fusarola, fusaiola; sp. moldura de cuentas.
Perpendicular style (engl.), Son-derform des → *Maßwerks derSpätgotik mit starker vertikaler Be-tonung. Frz. gothique perpendiculaire; it. stile per-pendicolare; sp. estilo perpendicular.
Perpendikulärgewölbe, Gewöl-be, dessen Widerlagsmauern senk-recht zu den Außenmauern des Ge-bäudes anlaufen. Beim Kasemat-tenbau das bevorzugte Gewölbe,weil die Zerstörung der Umfas-sungsmauern nicht den Einsturzdes Gebäudes zur Folge hat, andersals beim Parallelgewölbe, dessenWiderlagsmauern mit den Außen-mauern identisch sind. Engl. Perpendicular vault; fan v.; frz. voûteperpendiculaire; sp. bóveda perpendicular.
Perron (frz.), langgestreckte, nie-drige Terrasse, → *Beischlag voreinem erhöhten Parterre, auch ent-lang von Eisenbahnschienen aufBahnhöfen (Bahnsteig). Engl., frz. perron; sp. escalinata.
Persische Säule, Säule der altpers.(achämenid.) Baukunst mit glok-kenförmiger, von einem Blattkranzumgebener Basis, hohem kannelier-tem Schaft und einem → *Kapitellmit Stierköpfen über Blattkränzenund vier ansteigenden Volutenpaa-ren. Engl. Persian column; frz. colonne perse;it. colonna persiana; sp. columna persa.
Perspektive (lat.), bes. bildwirksa-me zeichnerische Darstellung einesaus endl. Entfernung betrachtetenObjekts auf Grund der seit der Re-naissance entwickelten und wis-senschaftl. begründeten Beobach-tungen. Alle in die Tiefe laufendenhorizontalen Parallelen treffen sichin einem Fluchtpunkt in der Höhedes betrachtenden Auges (Hori-zont). Die Fluchtpunkte aller ge-neigten Parallelen liegen darunteroder darüber. Eine P. mit hochlie-gendem Horizont bezeichnet manals Vogelp. (Vogelschau), eine P. mittiefliegendem Horizont als Froschp.Ist die Blickrichtung nicht wiegewöhnl. waagerecht, sondern ge-gen die Horizontale geneigt, solaufen auch die Vertikalen zu ei-nem Fluchtpunkt zusammen. Auchin solchen Fällen spricht man vonVogelp. (Vogelschau) oder vonFroschp., wenn das betrachtendeAuge hoch bzw. tief angenommenwird. Eine häufig verwandte P. istdie Frontalp., bei der nur ein Flucht-punkt dem betrachtenden Augegegenüber in der Bildmitte liegt.Alle diese Arten der P. sind Zen-tralprojektionen und werden auchZentralp. genannt, zum Unter-schied von der auch Parallelp.genannten Parallelprojektion (Axo-nometrie, → *Projektion). Sie ent-sprechen nur annähernd der opt.Wahrnehmung, der die Binoku-larp. und perspektiv. Darstellungenauf gekrümmten Bildflächen näherzu kommen versuchen. In der Bau-kunst zeigt sich die bewußte An-wendung der P. im konvergentenund im divergenten Verlauf ge-wöhnl. paralleler Linien. Angestrebtwird die Verstärkung der perspek-tiv. Wirkung durch Konvergenzund ihre Aufhebung durch Di-
Peristylhof 358
vergenz. Die Theaterp. versucht,die räuml. Wirkung eines verhält-nismäßig flachen Bühnenbildes zuverstärken, wobei von möglichstallen Blickrichtungen ein ähnl.Eindruck gewahrt bleiben soll. Engl. perspective; frz. perspective spéculati-ve; it. prospettiva; sp. perspectiva.
Pervete → *Abtritt.
Pesel (mhdt.), Dornse, niederdt.Bezeichnung für Stube, bes. dieunbeheizte »gute Stube«, Prunk-stube im Wohnteil des niedersächs.Bauernhauses im 17.�19. Jh. Engl. (unheated) parlour, am. parlor; sp. salaostentosa.
Pfaffenmütze, 1. tenailliertes Au-ßenwerk, d.h. Doppelscheren mitFlügeln (→ Tenaille). 2. → Kloster-gewölbe mit Kehlen im Gewölbe-anfall, die sich jedoch im Übergangzur bekrönenden Kalotte verlieren.
Pfahl → Pfosten.
359 Pfahl
a Perspektive Konstruktion (aus dem Grundriß)
b Froschsperspektive (Konstruktion mit Hilfe der Diagonalen)
c Vogelschau mit waagrechter Blickrichtung (2 Fluchtpunkte)
d Vogelschau mit geneigter Blickrichtung (3 Fluchtpunkte)
e Frontalperspektive
A' Grundriß des AugpunktesA" Aufriß des Augpunktesh Horizontd DistanzkreisF1, F2 Fluchtpunkte aller Parallelen zu
den waagrechten WürfelkantenF3, F5 Fluchtpunkte aller Parallelen zu
den Diagonalen der DeckflächeF4 Fluchtpunkt aller Parallelen zur
Würfeldiagonale
Divergenz
Perspektive
Pfahlbau, 1. auf Pfählen gegrün-dete Bauten (Pfahlgründung) beischlechtem Baugrund. 2. Der Pfahl-bau kommt bereits in vorge-schichtl. Zeit und bei primitivenKulturvölkern der Gegenwart vorund wurde sowohl bei Vorrats- alsauch bei Wohngebäuden ange-wandt, um diese vor Tieren zuschützen, vielleicht auch zur Ver-teidigung. P. stehen daher auch oftin flachen Ufergewässern. Engl. pile work, p. construction; frz. palafitte,construction lacustre; it. palafitta; sp. pala-fito.
Pfalz (lat. palatium), königl. oderbischöfl. Verwaltungssitz, zumeistbefestigt. Die P. hat im frühen undhohen MA. mehrere Aufgaben: siebesorgt als Wirtschaftshof die Hof-haltung des in seinem weitenReich herumziehenden, nicht ineiner festen Residenz herrschen-
den fränk. Königs, ist Mittelpunktder Verwaltung für den umliegen-den Reichsbesitz und dient alsStätte der Jurisdiktion; hier werdenauf Synoden und Reichsversamm-lungen Gesetze erlassen und Privi-legien ausgesprochen. Nicht zu-letzt ist die P. eine symbol. undbaukünstler. Darstellung der dt.Königsmacht. Seit otton. Zeit wirddiese Bauform zugleich mit einemTeil der P.-Funktionen auch vonBischöfen übernommen. Mit denvon Karl dem Großen errichteten
Pfahlbau 360
Pfahlbau
Karolingische Pfalz um 800,Pfalzkapelle und Königshalle (Aularegia) rahmen Unterkunfts-,Repräsentations- undWirtschaftsbauten ein (aus: W. Koch,Baustilkunde, S. 294; nach einemModell von L. Hugot, 1970).
P. beginnt der künstler. Ausbau.Seit der Mitte des 13. Jhs. bildensich für den König feste Residen-zen aus. Die P. werden veräußert,meist an die Bürger der benachbar-ten Städte. Nur die Bischofsp. blei-ben in ihrer Funktion bestehen,werden aber den gewandeltenWohnansprüchen angepaßt. Fürdas Bauprogramm der P. gibt eskeine Grundregeln; je nach Ort,Zeit und Bauherr werden sehr un-terschiedl. Anlagen geschaffen. DieP. besteht gewöhnl. aus einemmehrschiffigen, ein- bis dreige-schossigen Saalbau (aula regia), ei-nem oder mehreren Wohnbauten,einer Toranlage, zuweilen aucheinem Bergfried und Wirtschafts-gebäuden, die auch getrennt liegenkönnen (curtis). Zu jeder P. gehörteine Kapelle, zumeist freistehendim Hof, seltener an den Palas ange-baut oder über der Torhalle ein-gerichtet; in der Nachfolge derAachener P.kapelle erscheint sie alsoktogonaler Zentralbau oder alsSaalkirche, aber auch als Doppel-kapelle, die noch zusätzl. mit West-empore im Obergeschoß ausge-stattet sein kann. Die Gesamtan-lage ist von Mauern und Gräbengeschützt. Die P. gleicht weitge-hend den größeren Burgen vonGrafen oder Ministerialen, bes. instauf. Zeit, anfangs in Streulageoder in achsialer Anordnung, dannals Randhausburg. Eine gesonderteGruppe bilden nach 1233 diekönigl. P. und Burgen Friedrichs II.in Süditalien. Sie stellen eine Syn-these von röm. Kastelltyp und zi-sterziens. Wölbungstechnik darund entwickeln Sonderformen. Engl. imperial palace; frz. palais impérial;it. residenza imperale; sp. palacio imperial.
Pfalzkapelle → Pfalz.
Pfannendach → *Dachdeckungmit S-förmig gekrümmten Dach-ziegeln (Dachpfannen). Engl. pantiled roof; frz. toit en pannes;it. tetto di tegole fiamminghe; sp. techo detejas acanalonadas.
Pfarrkirche, Kirche für die Seel-sorge eines zugeordneten Spren-gels mit dem Recht, die Sakramen-te zu spenden: Taufe, Abendmahl,Firmung, Beichte, Ehe, letzteÖlung und Bestattung auf dem umdie Kirche gelegenen Friedhof. DieP. ist gekennzeichnet durch verein-fachte Raumwirkung und geringe-re Raumvielfalt und künstler. Ge-staltung, wenn auch örtl. und zeitl.verschieden bewußte Rezeptionenvon Bischofs-, Kloster- und Stifts-kirchen zu beobachten sind. Engl. parish church; frz. église paroissiale;it. parrocchia; sp. iglesia parroquial.
Pfefferbüchse → Scharwacht-turm.
Pfeife, Verstäbung, kleiner Rund-stab, hauptsächl. am Säulenschaft,
361 Pfeife
Pfeifen an einem kannelierten Säulenschaft
aber auch am → *Kapitell (→ P.ka-pitell) vorkommend und manch-mal den unteren Teil der Kannelie-rung einer Säule füllend.Engl. pipe; frz. godron, pipe; it. rudente;sp. gallón.
Pfeifenkapitell, seltene Form ei-nes → *Kapitells, bestehend aus ge-bündelten und unten verjüngtenKegelstümpfen (Pfeifen). Engl. scalloped capital; frz. chapiteau avecgodrons; it. capitello rudentato, c. scanala-to; sp. capitel con gallones.
Pfeil, Stich, senkrechter Abstandzwischen Kämpferlinie und Scheiteleines → *Bogens und eines → Ge-wölbes. Engl. rise, camber; frz. montée, flèche, hau-teur sous clef; it. freccia, monta; sp. montea.
Pfeiler, Stütze aus Mauerwerkzwischen Öffnungen (Arkaden,Türen, Fenstern u. dergleichen) mitrechteckigem, quadrat. oder poly-gonalem Querschnitt, auch rund(jedoch keine Verjüngung und keinKapitell wie bei der Säule). Der P.kann Basis, muß Kämpfer haben(sonst Mauerrest). Je nach Lage undAusbildung eines P. spricht manvon Freip., Wandp., Eckp., Kreuzp.und bei der Bündelung verschiede-ner Dienste und Vorlagen von ei-nem Bündelp.; der Strebep. dientzur Aufnahme des schräg gerichte-ten Gewölbeschubs (→ *Strebe-werk). Dem P. können Halbsäulenu. dergl. vorgelegt sein (P.vorlage).→ Gliederpfeiler. Engl. pillar, pier; frz. pilier, pile; it. pilastro,pila, pilone; sp. pilar, machón, poste.
Pfeifenkapitell 362
5 Kreuzpfeiler6 Rundpfeiler7 Pfeiler mit Pfeilervorlagen (Gliederpfeiler)8 Pfeiler mit Kantendiensten
1 Freipfeiler2 Wandpfeiler3 Eckpfeiler4 Doppelwandpfeiler
Pfeiler
Pfeilerbasilika, Basilika, derenHochschiffwände von Pfeilern ge-tragen werden (im Gegensatz zurSäulenbasilika). Engl. pier basilica; frz. basilique à piliers;sp. basílica construída con pilares.
Pfeilervorlage, Halbsäule, Halb-pfeiler (Wandpfeiler), Pilaster u.dergl., einem → *Pfeiler zur Ver-stärkung oder Gliederung vorge-legt. Engl. pier buttress; frz. pilastre; sp. contra-fuerte para pilastras.
Pfeilhöhe, Pfeil, Stich eines→ *Bogens, bezogen auf die Kämp-ferlinie, oder einer Krümmung,bezogen auf die Sehne. Engl. rise, camber, height of camber; it. frec-cia, monta, saetta; sp. altura de la montea.
Pferdeköpfe, Zierrat an der Gie-belspitze des niedersächs. Bauern-hauses. It. teste di cavallo; sp. cabezas de caballo.
Pfette, parallel zum First verlau-fende Hölzer, die beim Pfettendachauf Querwänden aufruhen und dieDachhaut tragen, beim Pfetten-sparrendach als Firstp., Fußp. undMittelp. auf Stuhlsäulen, Zangenoder Binderbalken aufruhen und
die Sparren unterstützen (→ *Dach-konstruktion). Engl. purlin; frz. panne; it. corrente, terzera,arcareccio; sp. correa.
Pfettendach → Pfette (→ *Dach-konstruktion).
Pflaster, Befestigung der Erd-oberfläche oder des Fußbodens mitim Verband verlegten Platten, Stei-nen (P.steine), Backsteinen (Klin-ker), Holzstöcken oder Betonstei-nen. Engl. pavement; frz. pavé; it. pavimentazio-ne; sp. pavimento.
Pfleghof, Stadthaus eines auswär-tigen Klosters, das als Absteige-quartier für Abt und Mönche,hauptsächl. aber als Stapelplatz fürHandelsgüter des Klosters diente.
Pforte (lat. porta), kleines Tor,meist für den Klostereingang ge-brauchte Bezeichnung. Engl. gateway, postern; frz. porte, portillon;it. portone, porta, portale; sp. portal, portón.
Pfosten (Pfahl), eine in den Boden(P.loch) eingelassene und gegenSeitendruck verankerte Stütze ausHolz oder Metall, Hauptkonstruk-tionselement des frühgeschichtl.Hauses, dessen Wände aus Flecht-
363 Pfosten
Pfleghof(Beispiel: Tübingen,Bebenhäuser Hof)
werk zwischen P. bestanden. Auchbei Fenstern und Türen werdendie senkrechten Seitenbegrenzungs-hölzer P. genannt. Falsch ist esjedoch, → Ständer, → Stiele oder→ Säulen im → Fachwerkbau als P.zu bezeichnen, da ihnen die Bo-deneinspannung fehlt. Engl. post; frz. poste, poteau, montant; it. pa-lo, montante, ritto; sp. poste.
Phra Chedi, Prachedi (hinter-ind.), zylindr. Turmaufbau hinter-ind. Tempel, der aus dem Glok-kenstupa weiterentwickelt ist.
Phraprang (hinterind.), Turm hin-terind. Tempelanlagen mit polygo-nalem Grundriß.
Piano Nobile (it.), Beletage,Hauptgeschoß eines größeren Ge-bäudes (→ *Geschoß).
Piedestal (frz.), → *Postament,sockelartiger Unterbau meist einesStützglieds. Engl.; sp. pedestal; frz. piédestal; it. piedis-tallo.
Pilaster (lat.), Wandpfeiler mitBasis und Kapitell, meist auch mitKämpfer, oder zu definieren alseine der Wand vorgelegte Halbsäu-le mit »rechteckigem Schaft« (beiAlberti »columna quadrangula«).Der P. ist abzuleiten aus der Antikeund weist auch zumeist antikisie-rende Kapitelle auf. Sein »Schaft«kann kanneliert sein, seltener nachunten verjüngt, bes. in Spanien(→ Estipite). Die Vorstufe des P. istin der → *Ante des gr. Tempels zuvermuten. Die dekorative Einbe-ziehung der Säulenordnungen indie röm. Architektur zog eineumfassende Verwendung des P.
nach sich. Im MA. finden sich P. inallen antike Vorbilder aufnehmen-den Bauten. Seit der Renaissancemit ihrer allgemeinen Wiederauf-nahme der röm. Bauformen gehörtder P. mehr oder weniger regelhaftausgebildet bis zum Ende des 19.Jhs. zu den wichtigsten Gliede-rungsmitteln der repräsentativenArchitektur. Bes. in der frz. Ar-chitekturtheorie des 17. /18. Jhs.wurde dem P. von der Rangfolgeder Architekturglieder der Platzzwischen Säule und Lisene miteinem genau festgelegten Aus-druckswert zugemessen. Engl. pilaster; frz. pilastre; it. parasta, semi-pilastro; sp. pilastra.
Pilzdecke, Stahlbetonplatte ohneUnterzüge, die mit ihren oben pilz-förmig verbreiterten Stützen (»Pilz-säulen«) biegesteif verbunden ist. Engl. mushroom floor; frz. plancher cham-pignon; it. solaio a fungo; sp. techo macizosobre soportes con forma de hongo.
Pilzkapitell, eine otton. Sonder-form des frühma. Kapitells, einerumgedrehten Basis ähnelnder Ro-tationskörper, der als Bossenformdes korinth. Kapitells gedeutet wer-den kann, 950 bis 2. Hälfte des 11.Jhs. in Sachsen und im Nieder-rhein-Maasgebiet auftretend. It. capitello a fungo; sp. capitel con forma dehongo.
Pilzstütze, »Pilzsäule« → *Pilz-decke. Engl. mushroom column; frz. colonnechampignon; it. pilastro a fungo; sp. sopor-te con forma de hongo.
Phra Chedi 364
Pilzdecke
Pinakel (lat.), Ziersäule, auch Fiale,Obelisk. Engl. pinnacle; frz. pinacle; it. pinnacolo;sp. pináculo.
Pinakothek (gr.), Gemäldegalerie.
Pinienzapfen, bekrönendesSchmuckelement, hauptsächl. alsKnauf über dem Zeltdach einesRundtempels. Engl. pine cone; frz. pomme de pin; it. pi-gna; sp. ornamento en forma de piña.
Pischtak (pers.), monumentalerToreingang der pers. → Moschee,eine manchmal von → *Minarenüberragte, hohe Fassade mit spitz-bogiger Portalnische.
Piscina (lat.), 1. Schwimmbassinin den röm. → Thermen. 2. Tauf-becken des → *Baptisteriums. 3.Becken mit Ausguß für liturg. Wa-
schungen, meist an der südl. Chor-oder Sakristeiwand.
Pisébau(weise), Piséebau, Lehm-stampfbau, Aufführung von Mau-ern und ganzen Gebäuden aus Er-de oder Lehm. Engl. cob construction; frz. bâtiment enpisé; sp. construcción en adobe.
Plafond (frz.), flache Decke. Sp. cielorraso.
Plänergewölbe, ein falsches Ge-wölbe aus unbehauenen, in Mörtelgebetteten Steinen (Pläner = inPlatten brechender Bruchstein). Engl. ragwork vault; it. falsa volta; sp. bóve-da falsa.
Planetarium (lat.), mechan. Mo-dell des Sonnensystems, vielfachBestandteil astronom. Kunstuhren,seit dem späten 17. Jh. in bedeu-tender Größe geschaffen und auchin repräsentativen Gebäuden unter-gebracht, häufig in Verbindung miteinem → Observatorium. Das P.enthält in der Regel neben demKuppelsaal als Hauptraum undNebenanlagen meist einen Vor-tragssaal und Arbeitsräume. Engl. planetarium; frz. planétarium; it., sp.planetario.
365 Planetarium
Pinienzapfen
Pischtak (Beispiel: Isfahan, Sultan Hussein Medrese, 18. Jh.)
Planriß → *Bauriß einer Bauhütteder Gotik.
Platereske (span.), dem Kunstge-werbe (bes. der Goldschmiede-kunst) entspringende Schmuck-form der span. Baukunst, maur. undgot. beeinflußt und zeitl. zwischenGotik und Renaissance liegend.
Plattbollwerk, Bastion vor einergeraden Courtine.
Platte, tafelförmiges, meist recht-eckiges Bauelement geringer Dik-ke, in der Baukunst formal alsZwischenglied (Plinthe, Abakus),Hängep. (Mutulus), Abdeckp., alsWand- oder Fußbodenbekleidung(Wand- oder Fußbodenp.), in derBaukeramik Fliese genannt (→ Azu-lejos), oder im Stahlbetonbau kon-struktiv als Fundamentp., Decken-oder Dachp., Wandp. (Scheibe). Engl. plate; frz. dalle, carreau; it. lastra,piastra, piastrella; sp. plancha, panel, losa.
Plattenbalkendecke, Massivdek-ke aus Stahlbeton. Die an der Un-tersicht vortretenden Balken und
die quer darüber verlegte Decken-platte (Deckenplatte 2) bilden einestat. Einheit. Werden schlankereBalken (Rippen) in geringeren Ab-ständen angeordnet, spricht manvon Rippendecke. Frz. plancher de poutres en T; it. solaio pie-no su travi di c.c.a.; sp. cubierta de losa convigas T.
Plattenbauweise, industrielleMontagebauweise, serienmäßigeHerstellung von Gebäuden ausgroßformatigen Wand-, Decken-,Treppen- und Dachfertigteilen, vor-nehml. im Wohnungsbau. Die Ele-mente werden mit fertigen Sicht-flächen, eingebauten Türen undFenstern sowie Installationen in derFabrik vorgefertigt, zur Baustelletransportiert und montiert. AlsWerkstoffe dienen alle am Bau ver-wendeten Materialien, bes. Holzund Beton als Voll-, Hohlraum-,Rippen- und Kassettenplatten mitwärmedämmenden Schichten. Um1850 wurden in England gußeiser-ne Häuser aus großformatigen Ele-menten geschaffen, in Deutschlandseit den 1890er Jahren aus Holz, zuAnfang des 20. Jhs. in den USAvoll ausgebildet, hat die P. in den1920er Jahren weite Verbreitunggefunden. Nach dem 2. Weltkriegwurde die P. wiederaufgenommen,bes. seit der Mitte der 50er Jahre inder DDR. Engl. panel construction; it. prefabbricazio-ne ad elementi piani; sp. construcción conpaneles prefabricados.
Plattendecke, Massivdecke ohneUnterzüge (→ *Plattenbalkendecke,Deckenplatte 1). Engl. slab and beam floor; frz. plancher endalles, p. de poutres; it. solaio a soletta dic.c.a. piena; sp. cubierta de losa sin soportes.
Planriß 366
a Plattendecke b Plattenbalkendecke c Rippendecke
Plattenfries → *Fries, der aus ei-ner Folge von Platten besteht, bes.unter niederrhein. Zwerggaleriender Romanik. Frz. frise en panneaux; it. fregio a riquadri,f. a pannelli; sp. friso en paneles.
Plattenmaßwerk, zwei spitzbogi-ge Lanzettfenster mit Okulus dar-über öffnen ähnlich wie beim Loch-scheibenfenster eine unter einemÜberfangbogen zurückgestufte glat-te Mauerfläche (Chartres), in dieaußen flächig das Glas eingesetztist.
Plattenziegel, gleichbedeutendmit → Biberschwanz. Engl. flat tile; frz. tuile plate; sp. teja plana.
Platz, wichtigstes Raumelementder→ *Stadtbaukunst. Der P. diententweder wirtschaftl. Zwecken(Marktp.), Volksversammlungenoder festl. Aufzügen (Rathausp.,Corso), oder reiner Repräsentationund dem Zweck, Monumental-bauten besser in Erscheinung tre-ten zu lassen. Die geschlossenen P.der Antike und des MA. waren nieVerkehrsflächen im heutigen Sin-ne, sie lagen abseits des Verkehrs(→ *Agora, → *Forum). Seit derRenaissance und dem Barock wirdder P. immer öfter in den Dienstrepräsentativer und monumentalerAufgaben gestellt. P. werden vorden wichtigsten Bauwerken derStadt, um diese aus angemessenerEntfernung betrachten zu können,oder an durch Denkmäler beton-ten Schnittpunkten weitläufigerAchsen angelegt. Mit der Zunah-me des modernen Individualver-kehrs entstand der Verkehrsp. (Ver-kehrsknotenpunkt, → *Knoten 2)
367 Platz
Marktplatz (Beispiel: Nürnberg)a Rathaus c Schöner Brunnenb Kirche d Marktstände
Rathausplatz (Beispiel: Florenz, Piazzadella Signoria)
a Palazzo Vecchio b Uffizien c Loggiadei Lanzi d Brunnen e Denkmal
Festplatz (Beispiel: Siena, Piazza del Campo)
a Rathaus b Brunnen
und mit der aufgelockerten Bebau-ung ging der Sinn für den geschlos-senen P.raum weitgehend verloren. Engl., frz. place; it. piazza; sp. plaza.
Platzdorf, Dorf, das sich um ei-nen Platz gruppiert. Sonderfälle sindder Rundling und das Angerdorf(→ *Dorfformen).
Platzelgewölbe, andere Bezeich-nung für → *Böhmische Kappe. Engl. surbased spherical vault; frz. voûte ànappes, v. à bohémienne plate; it. volta avela a sesto ribassato; sp. bóveda bohemiaplana.
Pliestergeflecht, als Putzträgerfür Holz- und Eisenteile, die mitStrohlehm beworfen und mit einemverzinkten Drahtgeflecht so über-spannt werden, daß auch die Fugenüberdeckt sind. Urspr. aus dünnen,schmalen oder breiteren auf Gratkannelierten Latten (Pliesterlatten)bestehend und anstelle der Beroh-rung beim Deckenputz verwandt.
Plinthe (gr.), quadrat. Unterlags-platte als Teil der → *Basis einesStützglieds. Engl. plinth; frz. plinthe; it., sp. plinto.
Podest (neulat.), Treppenabsatzam Beginn oder am Ende einesTreppenlaufes bzw. zwischen denTreppenläufen, meist an der Stelledes Richtungswechsels (→ *Trep-penformen). Engl. landing (of staircase); frz. palier,repos; it. pianerottolo; sp. descanso.
Podesttreppe, Treppe mit einemoder mehreren Podesten (→ *Trep-penformen). Engl. staircase with landing; frz. escalier àrepos; it. scala a più rampe per piano; sp. es-calera con uno o más descansos.
Podium (gr.), erhöhter Unterbau(z. B. für Bauwerke, Schaustellun-gen etc.).
Platzdorf 368
Platz im Straßenraster
Sternplatz
Architekturplatz, dreiseitig einheitlichumbaut, gegen das Meer offen (Beispiel:
Lissabon) a Denkmal
Podiumtempel, Tempel auf ei-nem hohen Unterbau (Podium)mit einer Freitreppe an der Front.Der P. kommt hauptsächl. in derröm. Baukunst vor. Engl. podium temple; frz. temple à podium;it. tempio su podio; sp. templo sobre podio.
Point de vue (frz.), Blickpunkt.Architekton. Blickfang in einerStraßen- oder Gartenachse.
Pokuna (ind.), architekton. ge-rahmtes Wasserbassin für rituelleWaschungen in Indien.
Polnischer Verband, Got. Ver-band, → *Mauerwerk, ähnl. demMärk. Verband. Engl. Polish bond; frz. appareil polonais;it. concatenamento polacco; sp. trabazón po-laca.
Polster, der → *Echinus des dor.Kapitells, auch das dem Echinusvergleichbare Element unter demVolutenkörper des ion. → *Kapitells.Engl. cushion, upholstery; frz. coussin, cous-sinet, balustre, oreille; it. echino; sp. equino.
Polsterquader, Quader mit pol-sterförmig ausgebildeter Bosse(→ *Mauerwerk). Engl. chamfered stone, c. rustication;frz. pierre de coussin, corps de c.; it. bugnaarrotondata, b. a cuscino; sp. chaflán.
Polychromie (gr.), Verschieden-farbigkeit. Die P. der Architekturkann durch Bemalung oder durch
verschiedenfarbiges Baumaterialbzw. verschiedenfarbigen Putz er-reicht werden. Die Farbe spielt inder Architektur eine heute meistunterschätzte Rolle. Sie wurde meistgliedernd (strukturbetonend), aberauch rein ornamental (symbol.),später dekorativ oder maler., illu-sionist. und letztlich auch psycho-log. angewandt. Die altägypt. Ar-chitektur war innen und außen buntbemalt (die Kapitelle als Nachbil-dungen von Bäumen, Pflanzen undBlüten, die Decken als Nachbil-dungen des Himmelblaus, oft mitgoldenen Sternen). Die gr. Tempelwaren ebenso grellbunt bemalt wiedie Plastik, wodurch manche struk-turelle Besonderheiten, die heutenur noch schwach erscheinen (Tri-glyphen) oder glatt sind (Echinus)urspr. stark differenziert waren(→Dorische Ordnung). Auch durchverschiedenartiges Material ver-suchte man bereits seit dem Alter-tum die Architekturformen zu dif-
369 Polychromie
Podiumtempel(Beispiel: Rom, Tempel der Fortuna
Virilis, 1. Jh. v. Chr.)
Point de vue
ferenzieren. Bei Innenräumen vorallem der Backsteingotik werden ar-chitekton. Gliederungen und Nach-bildungen von Architekturformenin Freskomalerei angebracht. Erstdie Renaissance schuf, bes. in Süd-deutschland und in der Schweiz,bemalte Zierfassaden (→ *Fassaden-malerei). Außerdem findet man de-korative Nachbildungen von Werk-steinfassaden durch → Sgraffito anBackstein- und Fachwerkbauten.Die Barockzeit brachte gemalteScheinarchitekturen an Fassadenund vor allem in Innenräumen, wo-bei manchmal auch Raumerweite-
rungen durch illusionist. Tiefenwir-kungen angestrebt wurden. Nachder Ablehnung der Farbe durchden Klassizismus gewann die P. im19. Jh. erneute Bedeutung. Die mo-derne Baukunst verwendet die bun-ten Farben neben weiß und schwarz(unbunte Farben) vorwiegend imKontrast zur Materialwirkung. Engl. polychromy; frz. polychromie; it. po-licromia; sp. policromía.
Polygon (gr.), Vieleck.
Polygonal (gr.), vieleckig.
Polygonalmauerwerk, → *Mau-erwerk, dessen Ansichtsfläche auspolygonalen Steinen besteht. Engl. polygonal masonry; frz. maçonneriepolygonale; it. opera poligonale; sp. mam-postería poligonal.
Polygonalsystem, Befestigungs-system mit Trennung von Fern-und Nahverteidigung. Das P. ver-zichtet auf die Längsflankierungentlang des Walls und die Bre-chung der Wallinien und ist auf dieniedrige Flankierung aus Kasemat-ten und Grabenwehren angewie-sen. Engl. polygonal system; frz. système poly-gonal; it. sistema poligonale; sp. sistema de-fensivo poligonal.
Polygonchor, besteht aus mehre-ren Seiten eines beliebigen Viel-ecks und wird bestimmt durch dasVerhältnis der Seitenzahl zum je-weiligen zu ergänzenden Polygon:z. B. 5/10 Schluß; häufig schließtder P. an einen mehrjochigen Vor-chor an. Der P. kann auch zentrali-sierenden Charakter erhalten, rechtzahlreich an got. Kirchen, bes. inSpanien im späten 15. und 16. Jh.,im süddt. und frz. Barock und
Polygon 370
Wechsel von verschiedenfarbigemMaterial
Bemalung (Dor. Kapitell)
Polychromie
schließlich vereinzelt im 19. Jh.→ *Chor. Engl. polygonal choir; frz. ch�ur polygo-nal; it. coro poligonale; sp. coro poligonal.
Polystyl (gr.), vielsäulig.
Pontonbrücke, Schiffsbrücke,→ Brücke auf verankerten Schiffenoder Schwimmkörpern (Pontons). Engl. pontoon bridge; frz. pont de bateaux,p. de pontons; it. ponte di barconi, p. suchiatte; sp. puente de pontones.
Porta (lat. Tor), Bezeichnung fürdie Torbauten des röm. Kastells(→ *Castrum). Diese befanden sichjeweils an den beiden Endpunktender sich kreuzenden Hauptstraßendes Lagers (castrum), der via prae-toria und der via principalis: P.praetoria an der dem Feind zuge-kehrten Front, P. decumana an derRückseite des Castrums, P. (princi-palis) sinistra links (von der Feind-seite gesehen) und P. (principalis)dextra rechts an der querverlaufen-den Achse, dem Cardo. In der Re-gel sind es zweiflügelige Tore, dieentweder aus der Mauerflucht nachinnen gezogen waren oder durchzwei vorspringende Türme flan-kiert waren, auch als Doppeltoremit außen Fallgatter und innenFlügeltor, dazwischen lag das Pro-pugnaculum.
Portal (lat.), monumentales Tor,meist mit bes. architekton. Rah-mung, wie Gewände, → *Archivol-ten (2), Tympanon, → *Wimperge,Atlanten, Karyatiden, Dreiecksgie-bel, Segmentgiebel, Pilaster, Wand-säulen (→ *Säulenp., Stufenp.),Bauplastik (Säulenfigurenp.), Bau-keramik u. dergl. Das P. kann beigrößerer Breite durch einen Mit-telpfosten (Trumeau-Pfeiler) ge-
teilt sein, auch können zwei oderdrei Öffnungen zu einem P. zu-sammengefaßt werden. Manchmalwird das P. durch einen Vorbau(P.vorhalle) oder einen bekrönen-den Baldachin (P.baldachin) ge-schützt. Manchmal ist es ein eige-ner Baukörper von oft beträchtl.Ausmaßen (→ Torbau, → *Pylon,→ *Propylon). Man unterscheidetHaupt- und Seitenp. Engl.; sp. portal; frz. portail; it. portale.
Porta Praetoria (lat.), dem Prae-torium gegenüberliegendes Tor ei-nes röm. → *Castrums.
Porta sancta (lat.), eine nur inJubeljahren geöffnete heilige Tür.Das Vorbild von Babylon (Eteme-nanki) wurde später in Rom (St.Peter) übernommen.
Portière (frz.), Türvorhang, Endedes 19. Jhs. aus der → Draperieentwickelt. Engl. portiere; frz. portière; sp. antepuerta.
Portikus (lat.), eine von Säulen(Säulenp.), seltener von Pfeilerngetragene Vorhalle vor der Haupt-front eines Gebäudes. Bes. häufigkommt die P. in der klassizist. Ar-chitektur vor. Auch eine Säulen-halle mit geschlossener Rückwand(ähnlich der Stoa). Engl., it. portico; frz. portique; sp. pórtico.
371 Portikus
Portikus (Beispiel: Rom, Pantheon)
Postament (lat.), Piedestal, Un-terbau, in der Baukunst meist Sok-kel von Stützgliedern oder Statuen. Engl. pedestal, base; frz. piédestal; it. basa-mento; sp. pedestal, base.
Postamt → Posthof.
Posthof, Stationsgebäude zumPferdewechseln und zur Über-nachtung der Boten und Reisenden.Schon im röm. Reich organisiert,dann durch die Fürsten Thurn undTaxis seit Anfang des 16. Jhs. syste-mat. errichtet. Sie umfaßten Stallun-gen, Beherbergungsräume, Dienst-räume und eine Postmeisterwoh-nung. Repräsentative Gebäude seitdem 18. Jh., zumeist in klassizist.Formen. In der 2. Hälfte des 19. Jhs.entstand das nur der Abfertigungs-organisation dienende Postamt. Frz. station de poste; it. stazione di posta;sp. Estación de Correo.
Postica (lat.), hinterer Teil einesröm.→ Wohnhauses.
Poterne (frz.), versteckter Ausgangin der Mauer einer Burg oder Fe-stung, auch mit einem kurzen Gangdurch Mauerdicke oder Wall, tun-nelartig ausgebildet, der bei einemfeindl. Angriff einen schnellenRückzug in den Schutz der Befesti-gungsmauern oder einen Ausfall ge-
gen die Belagerer ermögl. sollte.Schon in kleinasiat. Festungen vor-handen und durchgehend bis zumFestungsbau des 17./18. Jhs. genutzt.Engl. sally-port, postern; frz. poterne de se-cours; it. postierla, posterla, pusterla; sp. po-terna.
Prachedi → Phra Chedi.
Praefurnium (lat.), Heizraum bei→ Hypokausten.
Prälatur (lat.), Amtswohnungeines Prälaten (höherer geistl. Wür-denträger). Engl. prelature; frz. prélature; it. residenzaprelatizia; sp. prelatura, residencia del prelado.
Prang, Prasat (hinterind.), Tempelin Hinterind., dessen Cella auf ei-nem Stufenberg steht.
Postament 372
Postamenteiner Säule
(Beispiel: Angkor Thom, Baksei-Chang-Krang)
Prang
Prasat → *Prang.
Prätorium (lat.), Haus des Prae-tors in einem röm. → *Castrum.
Predella (it.), Altarstaffel, der aufder Mensa aufsitzende Sockel einesAltarretabels oder des Schreins ei-nes → *Flügelaltars, meist mit Male-reien oder Bildwerken geschmücktoder als Reliquienbehälter. Engl., it. predella; frz. prédelle; sp. predela.
Prellstein, Abweichstein, Abwei-ser, Radabweiser, Radstößer, Steinzum Schutz der Hausecken oderPortallaibungen gegen Beschädi-gung durch Fahrzeuge. Engl. kerb(stone), guardstone; frz. boute-roue, butoir; it. paracarro; sp. guardacantón.
Presbyterium (gr.), für die Prie-ster vorbehaltener Raumteil der Kir-che im Bereich des Hauptaltars, inKlosterkirchen durch Chorschran-ken, Lettner oder Chorgitter vomLaienraum geschieden. Auf derNordseite des P. befand sich das→ *Sakramentshaus, auf der Süd-seite der Levitenstuhl, → Dreisitz(→ Chor).
Preußische Kappe, tonnenseg-mentförmige → *Gewölbekappezwischen Trägern. Engl. Prussian vault; frz. voûtin à la prus-sienne; it. voltina a sesto ribassato; sp. bove-dilla prusiana.
Principia (lat.), im röm. Lager derStandort der Zelte des Feldherrn,Legaten und Tribunen, dann dasfeste Hauptgebäude eines röm.Castrums.
Priorat (lat.), Kloster unter Lei-tung eines Priors, abhängig vomMutterkloster. Engl. priory; frz. priorat; it., sp. priorato.
Privet → *Abtritt.
Prodomus (lat.), Vorhaus, Vorhal-le des röm. Hauses.
Profanbau, ein Gebäude ohnekult. Bestimmung. Engl. secular building; frz. ouvrage profane;it. edificio profano; sp. edificio profano, e.secular.
Profil (it.), 1. Querschnitt einesBauelements (Gewände, → *Rip-pe, → *Gesims u. dergl.), zusam-mengesetzt aus Vor- oder Rück-sprung, Hohlkehle, Stab oder dergl. 2. Längsschnitt (Längsp.)bzw. Querschnitt (Querp.) einerStraße oder eines Geländes. Engl. profile; frz. profil; it. profilo; sp. perfil.
Profilträger, ein aus Steg undFlanschen als T-, Doppel-T- oderU-Profil gebildeter Metallträger(→ Träger), dessen Ausbildung diebei freier Raumüberspannung auf-tretenden Zug- und Druckkräftematerialsparend aufnimmt. Engl. steel section, s. girder; frz. poutre lami-né, p. profilé; it. profilato; sp. viga perfilada.
373 Profilträger
Prellstein
Querprofil
Längsprofil
Projektion, Riß, Darstellung, An-sicht eines Objekts durch Projizie-ren auf eine Bildebene (Zeichen-fläche). Die einfachste P. ist derNormalriß (Normalp.). Um einObjekt vollständig darzustellen,sind mindestens drei Normalrisseerforderlich (Grundriß, Aufriß,Seitenriß). Normalrisse sind win-keltreu und längentreu, geben aberkeine so anschaul. Bilder wie Pa-rallelrisse (Parallelp., Axonometri-en). Die normale Axonometrie istim allgemeinen nicht winkeltreuund wird zur Verbesserung derBildwirkung häufig mit verkürztenTiefenmaßen gezeichnet. Der Ein-heitswürfel, der im Normalriß alsQuadrat erscheint, erscheint in dernormalen Axonometrie schiefwin-kelig, jedoch mit parallelen Kanten.Sind alle seine Kanten gleich lang(isometr.) dargestellt und ist seinscheinbarer Umriß ein regelmäßi-ges Sechseck, so nennt man dieDarstellung Isometrie. Ist einenach hinten weisende Kante desEinheitswürfels verkürzt (dimetr.)dargestellt, heißt die Darstellungallgemeine dimetr. Axonometrie,bei der bes. bildwirksame Annah-men genormt sind (Genormte di-metr. Axonometrie). Die schiefeAxonometrie entsteht aus Grund-oder Aufriß bei frei angenomme-ner Blickrichtung (Schrägriß oderfrontale Axonometrie): die Tiefen-maße des Kavalierrisses werden vordem Aufriß aufgetragen, die Hö-henmaße des Militärrisses werdenüber dem Grundriß aufgetragen.Allgemeine schiefe Axonometrienund normale Axonometrien kön-nen auch trimetr. angenommenwerden, d.h. alle Richtungen er-scheinen in einem besonderen Ver-kürzungsmaßstab. Die Parallelp.
Projektion 374
a NormalrisseGrundriß, Aufriß, Seitenriß und drei Kreuzrisse
b kotierte Projektionc isometrische Axonometrie, »Isometrie«d dimetrische Axonometriee trimetrische Axonometrief isometrischer Militärrißg isometrischer Kavalierriß
ProjektionDarstellungen des Würfels mit der
Seitenlänge 1
werden oft zur Unterscheidungvon der Zentralp. (Zentralperspek-tive, → *Perspektive) Parallelper-spektive genannt. Hinsichtl. der fürdie eindeutige Darstellung notwen-digen Anzahl von Bildern sprichtman von Eintafelp. (Perspektiven,Parallelrisse, → Kotierte P.), Zwei-tafelp. und Dreitafelp. (Normal-risse). Die kotierte P. ist eine durchHöhenmaße ergänzte Grundriß-darstellung und wird hauptsächl.bei Geländedarstellungen (Landkar-ten) angewandt. Eine Sonderformder kotierten P. sind die → *Bau-risse der Gotik, bei denen Grund-risse aus verschiedenen Höhen-lagen in einer P. vereinigt werden. Engl., frz. projection; it. proiezione; sp. pro-yección.
Pronaos, Vorhalle der Cella (Naos)des gr. Tempels (→ *Tempelfor-men).
Proportion (lat.), Vergleich derMaßverhältnisse (Höhe:Breite:Tie-fe) von Bauteilen in bezug auf dasGanze. In Antike und Renaissanceging man vom unteren Säulenhalb-messer (Modul) aus und brachtealle Bauteile einer Säulenordnungin ein Verhältnis von Vielfachenbzw. Bruchteilen derselben. Dochließ sich nie eine feste Norm(Kanon) bilden, weil sich die Ver-hältnisse im Laufe der Entwick-lung verändern. Im MA. ging manauf einfache Grundfiguren, Kreis,Quadrat (Quadratur), Dreieck (Tri-angulation), zurück, d.h. P.systeme,die auch vermessungstechn. be-dingt waren. Auch der → *GoldeneSchnitt bildet eine Grundlage fürdie P., doch wurde seine Bedeu-tung oft überschätzt. Immer wie-der galten auch die Verhältnisse des
375 Proportion
Proportion1 Antiker Modul 2 Ma. Quadratur
3 und 4 Ma. Triangulation
menschl. Körpers vorbildl., zuletztim → *Modulor. Engl. proportion, ratio; frz. proportion;it. proporzione; sp. proporción.
Proportionsschlüssel, geometr.Grundfigur, aus der die Maßver-hältnisse eines Bauwerks entnom-men werden können (→ *Achtort,Quadratur, Triangulation). Engl. proportional scheme, p. key; it. ma-trice geometrica; sp. llave de proporciones,esquema d. p.
Propstei (lat.), Wohnsitz einesPropstes, Kloster unter der Leitungeines Propstes, abhängig vom Mut-terkloster. Engl. provostship; frz. prieuré; it. prepositu-ra; sp. residencia del preboste.
Propugnaculum (lat.), vorgescho-benes Verteidigungswerk, auch derRaum zwischen innerem Flügeltorund äußerem Fallgatter bei röm.Kammertoren. Im MA. Fanghof(→ *Torzwinger). Engl. bulwark, rampart; it. propugnacolo;sp. propugnáculo.
Propylon (gr.), Propyläen, Torbaueines meist von hohen Mauernumschlossenen gr. Tempelbezirks(Temenos). Das P. hat meist eineoder mehrere Türen, eine größereäußere und eine kleinere innereVorhalle. Ähnl. Formen wurden inder Renaissance und bes. im Klas-sizismus aufgegriffen. Bei früh-christl. → *Basiliken wird auch der→ *Anteportikus P., bei antikenChalcidikum genannt.
Proscenium (lat.), 1. erhöhte Büh-ne vor der Scenae frons und zwi-schen den Paraskenien beim röm.→ *Theaterbau. 2. Vorbühne, der
Teil der Bühne des modernenTheaterbaus zwischen Vorhangund Rampe bzw. Orchestergraben. Engl., frz. proscenium; it., sp. proscenio.
Proskenion (gr.) → Proscenium.
Prostas (gr.), Prostasis, Vorhalledes gr. → *Wohnhauses, dem Pro-naos des Tempels vergleichbar, dermanchmal ebenfalls P. genanntwird.
Prostylos, Tempel mit einer denPronaos umschließenden Säulen-vorhalle an der Frontseite (→ *Tem-pelformen).
Proportionsschlüssel 376
Propylon(Beispiel: Athen, Akropolis, Propyläen)
A Äußere WestvorhalleB Innere Ostvorhalle
Proszenium → Proscenium.
Prothesis (gr.), Oblationarium,urspr. ein Tisch neben dem Altarfür die Opfergaben, dann auch klei-ner Raum auf der Evangelienseitenördl. neben dem Chor zur Vorbe-reitung des Meßopfers (→ Diako-nikon), besonders in orthodoxenKirchen mit reichen Ausmalungenversehen.Frz. prothèse; sp. prótesis.
Protodorische Säule, Stütze überregelmäßig vieleckigem Grundrißmit Abakus als Kapitell (Abakus-säule). Sie tritt im Neuen ReichÄgyptens auf und gilt formal alsVorstufe der dor. → *Säule. Engl. proto-Doric column; frz. colonne pro-todorique; it. colonna protodorica; sp. co-lumna protodórica.
Prytaneion (gr.), Amtshaus einergr. Stadt.
Pseudobasilika (gr.) → *Staffel-halle.
Pseudodipteros (gr. falscher Dip-teros), 1. Tempel mit Wandsäulen(Pseudoperipteros) und umgeben-dem Säulenkranz. 2. Tempel mitdoppeltbreitem Pteron, jedochohne die innere Stützenreihe einesDipteros (→ *Tempelformen).
Pseudoperipteros (gr. falscherPeripteros), Tempel mit Wand-säulen anstelle eines Säulenkranzes(→ *Tempelformen).
Pseudoprostylos (gr. falscherProstylos), Tempel mit Wand-säulen anstelle der Säulen an denStirnseiten (→ *Tempelformen).
Pteron (gr.), Pteroma, Fläche zwi-schen Cella und Säulenkranz desgr. Tempels (→ *Tempelbau, Peri-dromos).
Pueblo (span.), Indianersiedlungim S. der Vereinigten Staaten vonAmerika. Der P. besteht aus zahl-reichen (bis zu 500) neben- u. über-einanderliegenden Wohnelementen.
Pulpitum (lat.), 1. Rednertribüne,Kanzel. 2. Mittelteil des Pro-sceniums eines antiken Theaters(→ Theaterbau).
Pultdach, Halbdach, halbes Sat-teldach, das manchmal an eine hö-here Mauer anschließt (→ *Dach-formen). Engl. single-pitch roof, lean-to r.; frz. com-ble à potence, c. en appentis, toit adossé;it. tetto ad una falda; sp. techo adosado.
Pulvinus (lat.), Kissen, Seitenrolledes ion. Kapitells, deren vordereAnsicht die Volute bildet. Engl., frz. pulvinus; it. pulvino; sp. rollo la-teral del capitel iónico.
Punkthaus → Turmhaus, Hoch-haus über einem dem Quadratangenäherten Grundriß. Engl. point block building; frz. bâtiment con-centré; it. edificio a scala centrale; sp. edifi-cio tipo torre.
Pünte, Point, Bollwerkspunkt,Spitze zwischen den beiden Facen,Scheitelpunkt des ausspringendenWinkels einer Flesche oder Ba-stionspitze.
Putz, Mörtelüberzug als Außenp.oder Innenp. (Stuck), Deckenp.oder Wandp. vorkommend. EineSonderform des Innenp. ist der
377 Putz
→ Stucco lustro. Auf den Unterp.folgt der Oberp. (Feinp.). Je nachden Beimengungen unterscheidetman Zementp., Kalkp. und Gipsp.Edelp. ist eine Mischung aus bes.ausgewählten Grundstoffen, eben-so der Steinp. Mehrere farbigeP.schichten sind Voraussetzung fürdas Sgraffito (Kratzp.). Die Römernannten ihre verschiedenen P.-bzw. Stuckarten opus albarium,opus arenatum, opus tectorium,opus album und opus coronariumbzw. marmoratum. Engl. plaster, stucco; frz. enduit, chemise,crépi; it. intonaco, coperta; sp. estuco.
Putzarchitektur, landschaftl. be-grenzte Ausbildung der Oberflächeder Bauwerke in Putz als klimat.bedingter Schutzüberzug überBacksteinmauerwerk oder auchFachwerk. Die P. variierte oft dieArchitekturformen des Steinbausund entwickelte als eigene materi-algerechte Schmuckform das plast.und frei modellierte Stuckwerk(→ Stuckatur) und das flächige undfarbige → Sgraffito. Vor allem inSüddeutschland tritt häufig → *Fas-sadenmalerei auf. Engl. stucco architecture; sp. arquitecturaen estuco.
Putzhaut, der Putzüberzug einerMauer oder Wand. Im MA. war dieP. meist nur wenige mm dick undnicht mit der Latte geebnet, son-dern folgte den Unebenheiten desMauerwerks. Engl. plaster coat, stucco c.; frz. surfaced�enduit; it. strato di intonaco; sp. capa deestuco.
Putzträger, Rohrmatten, Draht-ziegelgewebe, Holzlatten u. dergl.zur Erhöhung der Putzhaftung an
glatten Materialien (Beton, Metall,Holz u.a.), auch frei aufgehängt fürScheindecken (Rabitzdecken). Engl. lath (-ing); frz. support d�enduit;sp. soporte de estuco.
Pyatthat (hinterind.), Turmauf-bau mit ungerader Geschoßanzahl(bis sieben), der sich in Hinterin-dien über der Cella eines Tempels,über einer Kapelle oder über einemThronsaal erhebt.
Pyknostylos (gr. dichtsäulig),enge Säulenstellung, bei der das→ *Interkolumnium 1½ unterenSäulendurchmessern entspricht.
Pylon (gr.), 1.Torbau des ägypt.Tempels mit zwei turmähnl., ge-böschten Bauten, in deren Schlit-zen Fahnenmasten aufgestellt wer-den. Im Innern des P. sind Trep-pen, die Fronten waren oft mitReliefs geschmückt. 2. Pfeilertür-me einer Hängebrücke, an denendas Tragwerk aufgehängt wird(→ *Brücke).
Pyramide (ägypt.-gr.), Grabbautenägypt. Pharaonen. Über quadrat.Grundfläche errichteter Baukörpermit unter einem Neigungswinkelvon rund 50° allseitig geböschtenOberflächen. Die P. ist wohl ausder Mastaba, Stufenmastaba und
Putzarchitektur 378
Pylon(Beispiel: Edfu, Horustempel)
Stufenp. entstanden. Die Abtrep-pung einer Stufenp. ist jedochnicht durch Aufstockung, sonderndurch Ummantelung zu erklären.Eine Sonderform ist die Knickp.mit gebrochenem Neigungswinkel.In Ägypten sind alle Formen der P.Pharaonengräber. Dagegen tragendie Stufenp. Babyloniens (→ *Zik-kurat, Stufenberg) Hochtempel,die wie die Tempel auf den Stu-fenbergen Altamerikas meist zurBeobachtung von Himmelskör-pern (Sonnenp., Mondp.) dienten.Auf → *Stufenbergen stehen aucheinige Tempel (→ *Prang) in Hin-terindien. Engl. pyramid; frz. pyramide; it. piramide;sp. pirámide.
Pyramidendach, Zeltdach, Dachin Pyramidenform (→ *Dachfor-men). Engl. pyramid roof; frz. comble pyramidal,toit p.; it. tetto a piramide; sp. techo pirami-dal.
Q
Qa�a (arab.), Ka�a, Grundform desarab. Hauses mit zusammengefaß-tem Hof und Liwan, öfter T-för-mig ausgebildet. Sie kann als Vor-bild für Moscheen gedient haben.
Qamriya (arab.), Fensterfüllungder islam. Baukunst Ägyptens ausmeist geometr. durchbrochenen
379 Qamriya
Knickpyramide
Stufenpyramide(Beispiel: Sakkara,
Grabanlage des Djoser)
Pyramide (Beispiel: Abusir,Pyramide des Sehure)
Qamriya
Gipsplatten, in deren Öffnungenbunte Gläser eingesetzt sind.
Qasr (arab. nach lat. castrum), Kasr,Schloß (→ Alkazar).
Qatai (arab.), Katai, befestigterBezirk einer arab. Stadt mit Mo-schee oder Palast als Zentrum.
Qibla (arab.), Kibla, die nachMekka weisende Richtung (Gebets-richtung) der Hauptachse einerMoschee, die durch die Gebets-nische (→ *Mihrab) gekennzeich-net ist.
Qiblawand, flache Abschlußwandgegenüber dem Haupteingang ei-ner Moschee. Frz. mur qibla; it. parete della qibla; sp. pa-red frente a la entrada de una mezquita.
Quader (lat.), Hau- oder Werk-stein in regelmäßiger Form mitmeist glatten, parallelen Flächen,deren Spiegel (Fläche) von einem1,5�4,0cm breiten Randschlag um-geben ist. Sonderformen mit un-ebener Sichtfläche sind → Bos-senq. oder → Rustika (Spiegelweitgehend unbehauen, Randschlagmeist vorhanden, opus rusticum),→ Buckelq. (Spiegel roh behauen,buckelförmig vorstehend), → *Dia-mantq. (Spiegel einem Facetten-schliff ähnl. vorstehend) (→ Stein-bearbeitung, → *Steinmetzzeichen,→ *Mauerwerk). Engl. ashlar, cut stone; frz. pierre carrée,carreau; it. concio squadrato; sp. pieda detalla, sillar.
Quadermauerwerk, → *Mauer-werk aus Quadersteinen.
Quaderputz → Quadrierung.
Quadratisches Schema, Grund-rißeinteilung einer Basilika derroman. Zeit, für die das Vierungs-quadrat die Einheit ist und dasQuerhaus wie das Langhaus beigleicher Breite ein Vielfaches desVierungsquadrates bilden (→ *Ge-bundenes System). It. impianto a modulo quadrato; sp. esque-ma de módulos cuadrados.
Quadratur, Proportionsschlüsselzur Bestimmung der Maßver-hältnisse von Bauteilen unterein-ander und in Bezug auf das Ganze(→ *Proportion). Engl., it. quadratura; frz. quadrature; sp. cua-dratura.
Quadrierung, Nachahmung desAussehens eines Quaderbaus durchZiehen von Scheinfugen im Putz(Quaderputz) oder durch Bema-lung. Frz. carroyage; sp. cuadrícula.
Quadrifrons (lat.), ein vierseitigerTriumphbogen (→ *Tetrapylon).
Quadriga (lat.), Viergespann,bronzenes Gespann mit vier Pfer-den vor einem Streitwagen. Die Q.war oft auf einem → *Triumph-bogen angebracht, doch sind nurdie vier Pferde einer einzigen Q.aus der Antike erhalten (heute überdem Eingang von S. Marco in Ve-nedig). Eine Q. aus klassizist. Zeitbefindet sich z. B. auf dem Bran-denburger Tor zu Berlin.
Quadriportikus (lat.), ein auf vierSeiten von einer Portikus umgebe-nes → *Atrium.
Quadrum → Chorjoch, → *Chor.
Qasr 380
Qubba (arab.), Kuppel, auch islam.Grabbau mit Kuppel.
Querachse → *Achse.
Querdach, Zwerchdach, Dach mitquer zum First des Hauptdachs ver-laufendem First (→ *Dachformen,→ *Auslucht). Engl. transverse roof; frz. toit transversal,comble t.; sp. techo transversal.
Quergurt, Querbogen, Transver-salbogen, quer zur Längsachse einesRaumes gespannter Entlastungs-bogen (→ *Gurtbogen), → *Gewöl-befeld. Engl. transverse arch; frz. arc doubleautransversal; it. arcone transversale; sp. arcotransversal.
Querhaus, Querschiff, quer zumLanghaus verlaufender Bauteil. Beider frühchristl. Basilika eine seitl.Ausweitung am Ostende des Lang-
hauses, die nicht immer gleichbreit bzw. gleich hoch wie diesessein muß und an die unmittelbardie Apsis anschließt. Bei roman.Kirchen folgt auf das Q. oft nochein Chorjoch, wodurch der Grund-riß kreuzförmig wird (Kreuzarme,Kreuzflügel, Transepte). Die Durch-dringung von Langhaus und gleich-hohem Q. ergibt (bei gleichenBreiten) das Vierungsquadrat einesQuerschiffs. Bei → *Doppelchöri-gen Anlagen können bes. in otton.Zeit auch zwei Q. vorkommen.Den Q.flügeln können halbrundeoder polygonale Konchen alsNord- und Südabschluß angefügtsein (→ *Dreikonchenanlage). Engl., frz. transept; it. transetto; sp. crucero.
Querhausapside, Apsis an denOstseiten der Querhausarme. Siekönnen auch gestaffelt sein, wobeider Chor mit der Hauptapsis amweitesten nach O. vorstößt. Bei Zi-sterzienserbauten sind die Q. meistkleine Rechtecknischen, die un-mittelbar nebeneinander liegen. Engl. transept apse; frz. apside de transept;it. abside del transetto; sp. ábside de cru-cero.
Querhausarm, Kreuzarm, Kreuz-flügel, Transept, Teil des Querhau-ses seitl. des Vierungsquadrats.Beim quadrat. Schema (→ Gebun-denes System) hat der Q. die Grö-ße des Vierungsquadrats, so daßdas Querhaus drei Quadrate um-schließt. Engl. transept arm; frz. aile de transept, brasde t., croisillon; it. braccio del transetto;sp. brazo de crucero.
Querhausfront, Stirnfläche einesQuerhausarms. Bei dreischiffigenQuerhausanlagen werden vor allem
381 Querhausfront
Querhaus1 Querhaus an einer frühchristlichen
Basilika2 Seitliche Erweiterung des Langhauses3 Durchdringung von Lang- und
Querhaus sowie Chorjoch (Quadrum) in ausgeschiedener Vierung
in der frz. Gotik reiche Fassadenausgebildet, die ähnl. der Westfas-sade gegliedert sind.
Querhausturm, runder oder poly-gonaler Turm an der nördl. undsüdl. Stirnmauer des Querhauses. Engl. transept tower; frz. tour de transept;it. torre del transetto; sp. torre de crucero.
Querhauswinkelturm, Turmüber dem östl. oder westl. Joch desSeitenschiffs vor dem östl. oderwestl. Querhaus.
Querriegel, bes. betont ausgebil-detes Querschiff roman. Kirchenin der Auvergne (→ *auvergnat.Querriegel).
Quersaal, Querraum, Saal, dessenlängere Achse quer zur Hauptachseverläuft z. B. die Säulensäle ägypt.Tempel (→ *Tempelbau) und islam.→ *Moscheen, german. → *Kö-nigshallen, → *Thermen u. dergl. Engl. transverse hall; frz. salle transversale;it. sala transversale; sp. sala transversal.
Querschiff → *Querhaus, dessenDecke die gleiche Höhe wie dasMittelschiff hat.
Quertonne, Tonnengewölbe, des-sen Scheitellinie � im Gegensatz zurLängstonne � quer zur Hauptachseeines Raums verläuft (→ *Gewöl-beformen). Engl. transverse barrel vault; frz. voûte trans-versal; it. volta a botte disposta traversal-mente; sp. bóveda transversal.
Querverband, Konstruktion desDachgerüsts zwischen jedem Spar-renpaar.
R
Rabitzgewebe, Drahtgewebe ausverzinktem Eisendraht von 10�12 mm Dicke und 2 cm Maschen-weite, das in Holz- oderEisenrahmen verspannt und durchEisenstäbe versteift werden kann.Dieses Gerippe wird mit Kalk-,Gips- oder Zementmörtel bewor-fen. Rabitzkonstruktionen eignensich bes. zu freitragenden, leichtenScheidewänden und nachträgl.eingezogenen Decken. Engl. wire lathing; it. rete portaintonaco;sp. textura sistema Rabitz.
Rabitzgewölbe, -decke, Gewölbebzw. Decke aus → Rabitzgewebemit Mörtelwurf. Engl. wire plaster ceiling; frz. voûte Rabitz,plafond Rabitz; it. volta (v. soffittatura)Rabitz; sp. bóveda y cielo sistema Rabitz.
Radabweiser, Radstößer, Ab-weichstein, Abweiser → *Prellstein. Engl. fender pole, spur stone; frz. chasse-roue; it. paracarro (di porta carraia), p. amuro; sp. guarda ruedas.
Radfenster, → *Rundfenster mitspeichenartiger Unterteilung, dieals Vorform des Maßwerks be-zeichnet werden kann. Engl. wheel window; frz. rose du bras, rouede Saint-Cathérine; it. rosone; sp. ventanatipo rueda.
Radial, von einem Zentrum aus-gehend, z.B. Kapellen eines Kapel-lenkranzes (→ *Chor) oder Stra-ßensystem einer → *Idealstadt. Engl., frz.; sp. radial; it. radiale.
Radialstadt, eine Stadt, der einSystem radial von einem Zentrumausstrahlender Straßen zugrunde-
Querhausturm 382
liegt (→ *Idealstadt). Seit dem En-de des 19. Jhs. ist die durch Ring-und Gürtelstraßen ergänzte R.Modell einer funktionellen Gliede-rung des Stadtkörpers. Engl. radial city; frz. ville radiale; it. cittáradiale; sp. ciudad radial.
Radkan (pers.), zylindr. Grabturmmit Kegeldach.
Radstößer, Abweiser, Radabwei-ser → *Prellstein.
Rähm, horizontales, auf Ständeroder Stuhlsäulen (Stuhlr., regionalauch Pfette) aufgezapftes, längsver-bindendes und die Wand oben ab-schließendes Holz; Oberr.-, Hochr.-und Unterrähmkonstruktion sindZimmerungsarbeiten, bei denensich das R. oberhalb, mit Abstandoberhalb bzw. unterhalb der Balken-lage befindet (→ *Fachwerkbau). Engl. head, rail; frz. sablière supérieure;it. trave (di edificio a ossatura lignea); sp. ca-rrera.
Rähmbau, veraltete Bezeichnungfür Stockwerkbau (→ *Fachwerk-bau).
Rahmen, 1. rahmenförmig ge-knicktes Tragwerk aus Holz, Stahloder Stahlbeton, dessen Knick-punkte biegesteif ausgebildet sind.R. mit eingespannten Auflagernkönnen durch den Einbau vonGelenken stat. bestimmbar werden(→ *Gelenk 2); 2. R. und Füllung(→ *Füllung). Engl. frame; frz. cadre; it. 1. telaio, 2. cor-nice, intelaiatura; sp. 1. marco, 2. bastidor.
Rahmen- und -Füllungstür, →*Tür aus Rahmen und Füllungen(Zweifüllungstür, Dreifüllungstür).Engl. paneled door; frz. porte à panneaux;it. porta specchiata; sp. puerta con marco yentrepaños.
Rampe, schräg ansteigende Zu-fahrt oder Zugang (schiefe Ebene)zu einem erhöhten Platz, einerTerrasse oder einem Bauwerk. Mo-numentale Rampen kommen beiägypt. → *Terrassentempeln; beiassyr. Palästen und Zikkurats vor.Beim Bau der Pyramiden verwen-dete man R. zum Materialtrans-port. R. mit gewendeltem Laufnennt man Wendelrampen (Wen-deltürme: Samarra → *Spiralturm,→ *Minar). Engl. ramp; frz. rampe (d�accès); it., sp. rampa.
Randhausburg, Burg, bei der dieRückseite des Gebäudes die Funk-tion der Ringmauer übernimmtoder bei der die Häuser an diedurchgehende Ringmauer ange-baut sind und mit ihr eine baul.Einheit bilden. Eine R. war infrühstauf. Zeit eine vollentwickelteBurganlage, die sich u. a. in Eng-land häufig findet.
Randschlag, Kantenschlag, ge-naue Zurichtung der Kanten einesQuadersteins. Engl. recessed margin; frz. refend; it. bordodel concio; sp. corte del borde.
Rapport, regelmäßige Wiederkehrderselben Form eines Musters, z.B.bei Friesen, Tapeten oder Geweben.Engl. repetition; frz. rapport; it. rapporto;sp. repetición regular de un modelo.
Rapputz, einmaliges Bewerfender Wandfläche mit Mörtel mittels
383 Rapputz
Rahmen
einer Kelle (Kellenputz), mit wel-cher der R. auch notdürftig geglät-tet wird. R. wird in Kellern undDachräumen, aber auch zweilagigam Außenbau verwandt. Frz. enduit fouetté; it. intonaco rustico, ar-riccio; sp. enlucido áspero.
Raster, rechtwinkeliges Liniennetzals Ordnungsschema des → Skelett-baus. Die Stützen des Skelettbaussind im Grundriß auf die Kreu-zungspunkte des R. (R.punkte)bezogen. Ein enger R. liegt derAnordnung nur einer Öffnungzwischen den tragenden Stützenzugrunde, ein weiter R. der Anord-nung mehrerer durch nichttragen-de Stützen getrennter Öffnungenzwischen den tragenden Stützen. Engl. screen, grid; frz. trame; it. reticolo (diriferimento); sp. retículo.
Rasthaus, an Autobahnen gelege-nes Restaurant, das im Gegensatzzum Motel keine Herberge ist. Engl. motorway restaurant, rest stop;frz. aire de service principale; it. autogrill,posto di ristoro; sp. restaurante de carretera.
Ratha (ind.), Rath, kleiner, demGötterwagen nachgebildeter Stein-tempel, der meist monolith. ausdem Felsen gehauen und manch-mal mit Rädern geschmückt ist(Mamallapuram).
Rathaus, städt. Verwaltungsgebäu-de; im Obergeschoß Ratssitzungs-zimmer mit den Engen (Sektions-zimmer) und einigen Schreibstüb-
Raster 384
Enger Raster Weiter Raster
Ratha(Beispiel: Mamallapuram, Dharmaradscha
Rath, 7. Jh.)Rathaus
(Beispiel: Augsburg, Rathaus)
chen, außerdem ein großer Festsaal;im Erdgeschoß geräumige, häufiggewölbte Hallen für Verkaufstischeund Lohnschreiber, dazu Wach-und Arrestlokale; seit dem 19. Jh.Vermehrung der Räume bis hin zumodernen Bürogebäuden. Engl. town hall; frz. hôtel de ville; it. muni-cipio, palazzo municipale; sp. municipalidad.
Rauchfang, Kutte, Schurz, Herd-mantel, untere, trichterförmige Aus-weitung des → *Schornsteins überoffenen Herden, → *Kaminen usw.Der R. überdeckt den ganzenHerd, damit der Rauch vollständigabgeführt wird. Als Rauchmantelist der R. fester Bestandteil desKamins. Mit dem offenen Herd-feuer ist auch der R. im 19. Jh. ausden Wohnhäusern verschwunden.Ein Nachklang ist die Dunstab-zugshaube über dem Herd moder-ner Einbauküchen. Engl. mantel, chimney hood; frz. hotte,manteau de cheminée; it. cappa del camino;sp. campana de la chimenea.
Rauchfangholz, Mantelbaum,Schurzholz, das zum Tragen einesgemauerten Rauchfangs bestimm-te horizontale Holz, entweder inmächtige Mauern eingespannt oderdurch bes. hierzu ausgeführte mas-sive Pfeiler, auch durch Knaggen
(Rauchfangträger, Mantelknagge)unterstützt. Das R. ist in der Regelgegen die Steigungslinie des Rauch-fangs abgeschrägt. Engl. manteltree; frz. poutre de hotte; it. ar-chitrave del camino, cornice del c.; sp. vigade la campana de la chimenea.
Rauchloch, in einfachen Wohn-hütten und Rauchhäusern eine Öff-nung im Dach, die zum Abziehendes Rauchs über der offenen Feu-erstelle dient. Engl. opaion, eye; sp. abertura para la salidadel humo.
Rauchstubenhaus, bes. in derSteiermark und in Kärnten, aberz.T. auch im östl. Deutschland ver-breiteter Typ des Bauernhauses, des-sen Herdstelle keinen Rauchfanghat, so daß der Rauch durch kleineLuken im Gebälk der »schwarzenKüche« entweicht. Ursprüngl. warnur eine Feuerstelle, die als Herd u.Ofen zugleich diente, vorhanden. Engl. smokeroom house; frz. (maison de)fumior; sp. casa de campo con cocina sincampana.
385 Rauchstubenhaus
Rathaus(Beispiel: Bremen, Rathaus)
A Kammer B DienstleutstubeC Laube
D AbortE KachelstubeF Rauchstube
Kärntner Rauchstubenhaus
1 Rauchstubenofen 2 Herd 3 Kachelofen
Rauhputz, Putz mit rauher Ober-fläche durch Verwendung grobkör-niger Zuschlagstoffe oder auchdurch spätere künstl. Aufrauhung(Spritz- oder Graupelputz, Besen-putz). Der R. dient meist als Un-terputz (Anwurf), auf dem derFeinputz aufgetragen wird. Engl. roughcast plaster; frz. crépi, crépis-sure; it. intonaco rustico; sp. enlucido áspero.
Raum, in der Baukunst ein vonBaukörpern oder von Oberflächenraumbildender Konstruktionen(z.B. von Wänden) begrenzter unddadurch sinnl. wahrnehmbarer Teilim Innern eines Baukörpers oderumgrenzt von verschiedenen Bau-körpern eines städtebaul. Gefüges.Der R. wird in seiner Wirkungdurch die Eigenschaften seiner Be-grenzungen und durch deren Ver-hältnis zueinander und zum Men-schen wesentl. bestimmt und seineGestaltung ist neben der des Bau-körpers das eigentl. Thema allenbaukünstler. Schaffens. Der ge-schlossene R. (Innenraum) kanndurch Durchlöchern oder Ent-fernen einer oder mehrerer seinerUmschließungen in den offenenR. übergehen (Hof, Platz; R. mitGlaswand). Dem uralten Bestre-ben, den geschlossenen R. durchEntmaterialisierung seiner Begren-zungen (Mosaik, Malerei, Glasma-lerei) zu erweitern, steht die mo-derne Tendenz zum unbegrenztenR. gegenüber (Auskleidung mitSpiegeln, Glaswände). Engl. space; frz. espace; it. spazio; sp. recin-to, cuarto.
Raumbogen, Verschnittkurvenverschieden gekrümmter Flächen(Kurven höherer Ordnungen). Inder Baukunst treten sie stets beim
Verschnitt verschiedener Gewölbeauf. Als bewußte Ausdrucksformverwendet die Spätgotik kurvierteGewölberippen (→ *GewundeneReihung), das Barock kompli-zierteste Kuppelverschneidungen(→ *Kuppel) und den ausgebauch-ten Fassaden folgende oder aus derFassadenfläche herausgedrehte Dia-dembogen, bes. an Portalen. Frz. arc d�une pénétration (de voûte); it. arcod�intersezione all�incrocio fra volte; sp. arcode intersección y ensamble cruzado.
Raumbühne, die vom Zuschau-erraum nicht abgetrennte, sondernmit diesem zu einer Einheit ver-bundene Bühne eines modernenTheaters, die den Kontakt zwi-schen Bühnengeschehen und Zu-schauer verstärken soll (→ *Thea-terbau). It. palco a tre fronti; sp. escenario modernounido a la sala de espectadores.
Räumliches Tragwerk, Kon-struktion aus Holz oder Stahl,deren Tragelemente sich entspre-chend dem Kräfteverlauf räuml. inder Längs-, Quer- und Diagonal-richtung erstrecken. Engl. space frame, spatial structure; frz. struc-ture spatiale, s. tridimensionnelle; it. strut-tura portante reticolare spaziale; sp. estruc-tura espacial, e. tridimensional.
Raute, geometr. Figur in Formeines schiefwinkligen Parallelo-gramms mit gleichen Seitenlängen.Die R. tritt als Dekoration in Rei-hung als Band (→ Rautenfries)oder flächenfüllend auf. Engl. lozenge; frz. losange, rhombe; it. lo-sanga, rombo; sp. losange, rombo.
Rautendach, → *Dachform, de-ren Dachfläche in Form von vier
Rauhputz 386
Rhomben (Rauten) zwischen vierGiebeln den Abschluß bildet. Engl. lozenge roof; it. tetto a falde romboi-dali; sp. techo romboidal.
Rautenfries, → *Fries von abstraktgeometr. Bildung, deren Grund-element Rauten sind. Bes. in dernormann. und roman. Baukunst. Engl. lozenge fret; frz. frise de losanges;it. fregio a losanghe; sp. friso romboidal.
Rautengewölbe, Netzgewölbeder spätgot. Baukunst, dessen Par-allelrippen in der Grundrißpro-jektion Rauten bilden (→ *Gewöl-beformen). Engl. net vault; frz. voûte réticulée; it. voltanervata a proiezioni romboidali; sp. bóvedaromboidal.
Ravelin (frz.), zur Sicherung desGlacis der Kurtine vorgelegtes Au-ßenwerk in Form eines Halb-monds, ab Mitte des 16. Jhs. auchdrei- oder fünfeckig; die Facensind zu den Schulterpunkten desBollwerks gezogen, die Kehlen desR. liegen an der Contrescarpe. Einekleinere Anlage nennt man → Re-dan oder → Flesche. Engl., frz. ravelin; it. rivellino; sp. revellín.
Rayon (frz.), Zone um die Festungmit baul. Beschränkungen, bzw.Bauverbot. Frz. rayon; sp. zona restringida de una for-tificación.
Rayonnant (frz. strahlend), strah-lenförmiges → *Maßwerk der frz.Gotik des 14. Jhs. Frz. rayonnant; sp. radiante.
Rechteckchor, ein quadrat. oderrechteckiger Raum, der gegenüberdem Kirchensaal zumeist um Mau-
erdicke oder mehr eingezogen undentweder voll geöffnet oder mittelsMauerzungen abgeschnürt ist. Hin-sichtl. seiner Funktion ist er ident.mit der → *Apsis. Er findet sich vor-nehml. bei einfachen Saalkirchen,seltener bei großen Kirchen; späterwählen häufig die Reformordenden R., der auch von rechteckigenNebenchören begleitet sein kannwie bei Zisterzienserkirchen. Engl. rectangular choir; frz. ch�ur rectan-gulaire; it. coro rettangolare; sp. coro rec-tangular.
Redan (frz.), offenes Werk als aus-springender Winkel in der Form derContregarde, jedoch nicht wie die-se an ein anderes Werk gebunden(→ Ravelin). Frz. redan; sp. resalto.
Redoute (frz.), 1. Tanzsaal. 2.Kleines, trapezförmiges oder poly-gonales Vorwerk einer Festung, ausgeraden Linien und aus aussprin-genden Winkeln bestehend. Engl. 2. redoubt; frz. 2. redoute; it. 1. sala daballo, 2. ridotta, ridotto; sp. 1. sala de baile,2. reducto.
Reduit (frz.), Versteck oder Rück-zugswerk (Turm) in einer Festung(→ Zitadelle).
Refektorium (lat.), redemtorium,Remter, Speisesaal in einem →*Kloster. Das R. liegt in der Regelin dem der Kirche gegenüberlie-genden Flügel des Kreuzgangs.Neben dem Kapitelsaal ist es bes.in Zisterzienserklöstern baukünst-ler. gestaltet; der längsrechteckigeRaum ist häufig durch eine Säu-lenstellung und Kreuzgrat- bzw.Kreuzrippengewölbe zweischiffiggeteilt und enthält ein Katheder
387 Refektorium
mit Bet- und Lesepult, das auch ineiner Mauernische erhöht ange-ordnet sein kann. Die Zisterzienserhatten im Westflügel der Klausurein zweites R. für die Konversen.Im späten MA. wurde neben demR. auch ein beheizbares Winter-R.eingerichtet. Im Barock kann derGrundriß auch oval sein. � Das R.in den orthodoxen Klöstern ist mitdem Katholikon (Kirche), einemgenau bestimmten Bau- und Deko-rationsprogramm, der zweitwich-tigste Bau. Es liegt unmittelbar ge-genüber dem Kirchenhauptportal,auch mit gemeinsamem Narthex.Seltener wird das R. als freistehen-der Sonderbau an die Klausurangefügt. Es ist ein flachgedeckter,selten gewölbter Saal, der im W. ineiner Apsis und zwei kleineren,seitl. Nischen für Weihrauch en-det. Der Eingang befindet sich ander Ostseite. Engl. refectory; frz. réfectoire; it. refettorio;sp. refectorio.
Regulae (lat.), kleine Plättchenmit sechs Tropfen (Guttae) unterder vorspringenden Leiste (Taenia)des Architravs der → *DorischenOrdnung. Die Anzahl der R. ent-spricht den Triglyphen und denMetopenfeldern.
Reiber, Vorreiber, Fensterbeschlag,drehbarer Griff zur Verriegelung derFensterflügel, bes. zur Betätigungdes senkrechten Stabs, dessen ge-bogene Enden in untere und obereÖsen eindrehen. Frz. frottoir; it. maniglia di finestra; sp. pe-rilla de ventana.
Reihendorf, Kettendorf, 1. inMarschgebieten das Marschhufen-dorf, dessen Häuser an der Innen-
seite des Deichs gereiht sind. 2. InGebirgsgegenden das Waldhu-fendorf, bei dem die Hufen mitden Gehöften an einem Bach bzw.an einer Talstraße aufgereiht sind(→ *Dorfformen).
Reihenhaus, miteinander in fort-laufender Reihung (Zeilenbauwei-se) verbundene ein- oder mehrge-schossige Einfamilienhäuser mitgemeinsamer Zwischenmauer undBrandmauern in Abständen vonetwa 30m. Engl. terrace(d) house, am. row house;frz. habitation individuelle en série; it. casaa schiera; sp. casa en hilera.
Reihentriforium → Triforium,dessen Öffnungen in einheitl. Aus-bildung und Folge von Dienst zuDienst reichen, in Burgund aus an-tiken Motiven entwickelt und derIle-de-France verbreitet. → *Wand-aufbau.
Reihung, → *gewundene Rei-hung, im Grundriß kurvenförmigausgebildete Gewölberippen. Engl. alignment; frz. alignée, alignement;sp. alineación.
Reitersparren, Schiftsparren(→ Schifter), die auf die Kehl-sparren aufgeklaut werden. Engl. dormer rafter; frz. chevron de croupe,empanon; it. puntone cavaliere; sp. cabiomontado.
Reithalle, rechteckiger Hallen-bau. Weitgespannte, freitragende,hölzerne Dachkonstruktionen mitseitl. Emporen. Seit dem 17./18. Jh.häufig in fürstl. Residenzstädtenfür die Ausbildung der Reiter instehenden Heeren, aber auch fürReiterspiele und Wettkämpfe des
Regulae 388
Hofadels. Seit dem 19. Jh. aus-schließl. als Exerzierhäuser fürberittene Truppenteile genutzt, inder Moderne für Sportzwecke. Engl. riding house; frz. manège couvert;it. maneggio coperto; sp. picadero (cubierto).
Reitstiege, Reittreppe, von Pfer-den benutzbare Innentreppe mitbreiten, flachen Stufen, deren Tritt-fläche häufig leicht ansteigt (Ram-penstiege); im 15. /16. Jh. im Bau-programm früher Schloßbauten(→ Eselstreppe). Frz. escalier à giron rampant, e. à pas-demule; it. cordonata; sp. escalera inclinadapara los caballos.
Rekonstruktion (lat.), Versuchder Wiederherstellung des urspr.Aussehens eines abgebrochenenoder durch Umbau stark veränder-ten Bauwerks. Die R. kann durch
eine R.zeichnung oder durch In-standsetzung bzw. Wiederaufbauerfolgen. Doch ist eine zu weitge-hende R. dann nicht zu empfehlen,wenn sie nicht ganz gesichert istoder nur noch unbedeutende ori-ginale Reste erhalten sind.
Relief (frz.), plast. Komposition, inder Form von → Basr., → Flachr.,Hochr., → Koilanaglyphen oderdergl. mehr oder weniger starkherausgearbeitet, jedoch immermit dem Mauergrund verbunden(→ *Baumodell). Engl., frz. relief; it. rilievo; sp. relieve.
389 Relief
Rekonstruktion (Beispiel: Krems/Donau, Gozzoburg)
vor der Rekonstruktion nach der Rekonstruktion
1 Relief mit versenktem Hintergrund (Flachrelief)
2 aufgetragenes Relief (Hochrelief)3 versenktes Relief (Koilanaglyph,
Basrelief)4 aufgetragenes Relief mit vertieften
Umrissen
Relief
Relieforthostaten, untersteSchicht des Mauerwerks aus grö-ßeren Steinen (→ *Orthostaten) mitReliefs. R. finden sich meist amUnterbau assyr. und hethit. Paläste.Engl. relief orthostat; frz. orthostate enrelief; it. ortostate con rilievi; sp. sócalo conrelieves.
Remise (frz.), Geräteschuppen,im Zusammenhang mit Schloßan-lagen bes. für Wagen und Kutschen. Engl. coach house, carriage house; frz. re-mise; it. rimessa; sp. cochera, cobertizo.
Rempart (frz.), an der Innenseiteder Ringmauer angeschütteter Wall.Engl. rampart; frz. rempart; it. ramparo;sp. muralla, fortificación.
Remter, Speisesaal (→ Refekto-rium) einer → *Ordensburg desDeutschordens. Engl. refectory; frz. réfectoire; sp. refectorio.
Retabel (lat.), Altaraufsatz über derMensa (→ *Altarr.). Engl., frz. retable; it., sp. retablo.
Retirade (frz.), Abschnittswall,auch kleines Verteidigungswerk aufder Contrescarpe. Engl. lavatory; frz. retirade; it. ritirata; sp. re-ducto.
Retrochor (Engl. retro-choir), inEngland ein den Seitenschiffen desLanghauses entsprechender Chor-umgang hinter den Chorgestühlen.
Revers (frz.), Kehrseite, die demVerteidiger Deckung bietende Seiteeiner Festungsanlage, z. B. die In-nenböschung des Walls oder dieäußere Grabenwand.
Rhombendach, Dach auf Tür-men, dessen Dachflächen ein gleich-
seitiges, schiefwinkliges Parallelo-gramm bilden (→ *Dachformen 19).Engl. rhomboid roof, helm r.; frz. comblerhomboïdal; it. tetto a falde romboidali;sp. techo romboidal.
Rhythmus (gr.), in der BaukunstAufeinanderfolge immer wieder-kehrender Gruppen von Grundele-menten, gleicher oder unterschied-licher Länge bzw. Art (Joche, Tra-vée, Haupt- und Nebenstützen,→ *Stützenwechsel). Engl. rhythm; frz. rythme; it., sp. ritmo.
Relieforthostaten 390
Remter(Beispiel: Marienburg, Ordensburg,
14./15. Jh.)
Ribat (arab.), dem pers.-türk. Hanentsprechende Herberge, die miteiner Medrese oder einem Mauso-leum verbunden sein kann, haupt-sächl. in Tunesien.
Riefelung, parallel geführte, verti-kale Rillen oder Kerben (→ Kanne-luren). Engl. fluting; frz. cannelure; it. scanalatura;sp. estría.
Riegel, 1. waagerechtes Holz zwi-schen Stützen gezapft oder überStützen geblattet; man unterschei-det Schwellr., Geschoßr., Sturzr.,Kopfr., Rähmr., Brustr. 2. Ein dreh-oder schiebbares (Schubr.) Ele-ment aus Holz oder Metall, um dieeine Öffnung verschließende Klap-pe oder Tür festzuhalten. → *Fach-werkbau. Engl. bar; frz. entretoise, moise; it. traversa;sp. tirante, traversa, cerrojo.
Riegelbalken, ein in einem Mau-erkanal einschiebbarer Balken, derbei geschlossenem Tor auf der In-nenseite über dieses hinweg in eineentsprechende Maueraussparunggeschoben wird und dadurch dieTorflügel auch gegen kräftigenDruck sichert. Engl. cross beam, rail beam; frz. épar(t), tra-verse, barre; it. chiavaccio, catenaccio, spran-ga di legno; sp. travesaño, tranca, barra.
Riemchen, 1. Riemenstein, derLänge nach gespaltener Backstein,der am Beginn bzw. Ende einerMauer als Ausgleichsstein in denVerband eingefügt wird. 2. → *Par-kett. 3. → Riemchendecke. Engl. thong, strap; frz. mulet, mulot, savon;it. mezzolungo, tozzetto; sp. tabletas de me-dio largo.
Riemchendecke, Bälkchendecke,Raumüberdeckung aus Kreuzhöl-
zern (Riemchen), in die die Bohleneingenutet sind, ein außerordentl.dichter Abschluß, bes. in süddt.Fachwerkhäusern bis ins 18./19. Jh.üblich. Frz. plafond à listel; sp. cielo de tabletas.
Riemchenfußboden, Holzfußbo-den aus schmalen Latten, die dichtaneinandergefügt sind, heute häu-fig zu quadrat. Platten zusammen-geklebt als Parkettersatz dienend. Frz. parquet à listel, p. la viennoise; it. par-quet; sp. piso de tabletas.
Riese, mhdt. »Ryse«, pyramiden-förmiger, krabbenbesetzter und ineiner Kreuzblume endigender Helmeiner → *Fiale. Engl. fortified church; frz. pyramidon; it. gi-gante; sp. piramidión.
Rikoschettscharte, Haubitzen-scharte, Schießscharte mit nach au-ßen ansteigender Überwölbung.
Ringanker, → Anker, der ein Ge-bäude oder einen Bauteil (Turm-helm, Kuppel) ringförmig um-schließt. It. tirante anulare, armatura a.; sp. anclajeanular.
Ringgewölbe, → *Gewölbeformmit kreisförmig verlaufender Schei-tellinie, meist eine Ringtonne. Frz. voûte annulaire; it. volta anulare; sp. bó-veda anular.
Ringkrypta, eine der halbkreisför-migen Apsismauer folgende → Stol-lenkrypta, → *Konfessio. Frz. crypte annulaire; it. cripta anulare;sp. cripta anular.
Ringmauer, 1. Mauerring, Bering,ringförmig verlaufende Stadtmau-
391 Ringmauer
er (→ *Stadtbefestigung). 2. Man-telmauer, Zingel, Cingulum, Um-fassungsmauer einer ma. → Burgoder einer frühgeschichtl. Flieh-burg. Engl. enceinte, ring wall; frz. mur d�encein-te; it. (muro di) cinta; sp. muro anular.
Ringpultdach, Pultdach, das sichringförmig um einen höheren, zen-tralen Baukörper, z. B. um einenChor, schließt (→ *Dachformen). It. tetto a falda troncoconica; sp. tejado sim-ple anular.
Ringsäule, Bundsäule, Säule mitdurch ringförmige Zwischenglie-
der (→ *Schaftring, Bund, Wirtel)unterteiltem Schaft. Engl. banded column; frz. cadenas à rou-leaux; it. colonna cerchiata; sp. columnaanillada.
Ringstab, ein mit ringförmigenZwischengliedern versehener Rund-stab (meist als Gewölberippe). Frz. baguette annelée, b. bandée; it. tondocerchiato; sp. junquillo anillado.
Ringstraße, eine ringförmig denalten Stadtkern umgebende undauf den eingeebneten Gräben undStadtwällen angelegte Straße. R.sind eine für das 19. Jh. typ. Form
Ringpultdach 392
m Votivkirchen Kaio Stadtparkp Schwarzenbergplatzq Operr Burgtheaters Lastenstraße
Ringstraße (Beispiel:Wien, Ring 1857 ff.)
A Stadt B Vorstadt a Donau-Kanal b Wienfluß c Ringstraße d nicht einbezogene
Restfläche des Glacise Stephansdom f Hofburg g Hofstallungen h Technische
Hochschule
i Palais Schwarzenbergj Karlskirche k »Forum« von G. Semper
(Neue Hofburg, Museen) Die westl. (linke) Hälfte der Neuen Hofburg nicht ausgeführt.
l Rathausviertel (mit Parlamentund Universität)
der Stadterweiterung und wurdenoft monumental ausgestaltet. Frz. voie de ceinture; it. ring, circonvalla-zione; sp. circunvalación.
Ringtonne, Ringgewölbe, ring-förmig um einen meist höherenBaukörper (Zentralbau) oder umeine Mittelstütze gelegte Tonne,z. B. über Ringkrypta, Chorum-gang, Zwerggalerie (→ *Gewölbe-formen). It. volta a botte anulare; sp. bóveda de cañónanular.
Rinne, offene Leitung mit Gefälleaus Holz, Metall oder Stein zurAbleitung von Flüssigkeiten. In derBaukunst hauptsächl. die → *Dach-rinne, beim antiken Tempelbau die→ *Rinnleiste (Sima). Engl. gutter; frz. cuvette, entonnoir; it. ca-nale di scolo; sp. canalón, canaleta.
Rinneisen, zum Tragen der Dach-rinne bestimmter eiserner Haken,der auf die Sparren genagelt wird. Engl. gutter hanger, g. brace; frz. gouttière,tuyau fendu; sp. gancho de apoyo del cana-lón.
Rinnleiste, eine in Karniesformaufgebogene Traufleiste (Sima)über dem Kranzgesims des antiken
Tempels. Die R. war zunächst ausTerrakotta, später meist aus Stein.Da Ablaufrohre nicht bekannt wa-ren, floß das Dachwasser durchWasserspeier, meist Löwenköpfe ab.It. sima; sp. moldura, sima.
Rinnstein → Gosse, → Abzugsgra-ben. Engl. gutter; frz. caniveau; it. tombino; sp. cu-neta.
Rippe, frz. Ogive, verstärkender,rippenartiger Konstruktionsteil ei-ner Stahlbetondecke (→ R.decke)oder eines Gewölbes (R.gewölbe).Die R. sind nicht immer sichtbar,sondern können in der Gewölbe-schale oder auch am Gewölbe-rücken (→ Obergurt) liegen. DasR.gefüge ist ein Skelett mit nicht-tragenden Füllungen (Wangen,Kappen u. dergl.). In der Spätzeitder Gotik sind R. oft nur dekorativunter eine tragende Gewölbeschalegesetzt. In der Endphase können
393 Rippe
Rinnleiste mit Wasserspeiern
Rippenprofile1 Bandrippe2 abgeschrägte R.3 ausgekehlte R.4 Rundstabr.5 �7 Birnstabr. mit Hohlkehlen
sich die R. auch ganz von der Ge-wölbeschale loslösen und frei hän-gen (Zweischichtengewölbe). Jenach der Lage der R. unterscheidetman entsprechend den dazugehö-rigen Bogen (→ Gewölbeformen)Wandr. oder Schildr., Querr. oderGurtr., Gratr., Diagonalr. oderKreuzr., Kehlr. und Scheitelr. Diefrühesten R. hatten rechteckigenQuerschnitt (Bandr.), doch kom-men auch Rundstäbe, teilweiseRingstäbe oder Bündelungen mitHohlkehlen, Birnstäbe, sowie Ver-bindungen und Varianten dieserFormen vor. Engl. rib, nerve; frz. nervure, côte; it. costo-la, nervatura; sp. cuaderna, nervio.
Rippendecke, Massivdecke ausStahlbeton. Die an der Untersichtin kurzen Abständen vortretendenschlanken Rippen und die querdarüber verlegte Deckenplatte bil-den eine stat. Einheit (→ *Platten-balkendecke). Engl. ribbed ceiling; frz. plancher à nervu-res; it. soletta nervata; sp. cielo nervado.
Rippengewölbe, ein von → *Rip-pen getragenes Gewölbe, z. B.Kreuzr., Sterngewölbe, Netzge-wölbe, Fächergewölbe, Domikalge-wölbe u. dergl. (→ *Gewölbefor-men). In der Spätzeit der Gotik gibtes auch Gewölbe mit nichttragen-den Stuckrippen, die nur formalals R. bezeichnet werden können,→ Zweischichtengewölbe, derenRippen frei unter der selbsttragen-den Gewölbeschale verlaufen, fer-ner frei nach unten durchhängen-de R. (→ *Abhängling 1) und R.mit → *gewundener Reihung. Engl. ribbed vault; frz. voûte à nervures;it. volta a costoloni, v. a nervature; sp. bóve-da nervada.
Rippenkuppel, eine → *Kuppelaus tragenden Rippen und nicht-tragenden Füllflächen. Die Rippentreten oft nicht aus der Gewölbe-schale hervor. Sind die füllendenKappen segelförmig gebläht, so daßdie Rippen zwischen ihnen alsscharfe Grate erscheinen, sprichtman von Segel- oder Schirmge-wölbe. Engl. ribbed dome; frz. voûte en dôme, v.coupole, v. domiciale; it. cupola a costoloni;sp. cúpula nervada.
Rippenzwickel, in der Baukunstdes Islams gebräuchl. Sonderformder Gewölbezwickel (Pendentifs)mit gekreuzten Rippen, die Rau-tenformen umschließen. (→ *Grab-moschee). It. pennacchio nervato; sp. pechina nervada.
Risalit (it.), vor die Flucht desHauptbaukörpers vorspringenderBauteil, der auch höher sein kannund oft ein eigenes Dach hat. R.kommen hauptsächl. bei Profan-bauten der Barockzeit vor. Je nachder Lage des R. unterscheidet manMittelr. (mit Giebel auch Fronti-spiz), Seitenr. bzw. Eckr. Ein nichtdurch alle Geschosse reichendervorgezogener Teil der Fassade heißtVorbau, weiter vorgezogene Eck-bauten nennt man Flügel. Einen
Rippendecke 394
Risalit(Beispiel: Johannishus/Karlskrona,
Schloß)a Seitenrisalit (Eckrisalit)b Mittelrisalit
vom Hauptbaukörper stärker abge-hobenen Eckr. mit besondererDachform nennt man auch → *Pa-villon. Engl. projection, wing pavilion; frz. avant-corps; it. avancorpo, risalto; sp. resalto.
Riß, zeichner. Darstellung einesObjekts (→ *Projektion). Man un-terscheidet Normalr. (Grundr., Sei-tenr., Aufr., Kreuzr.), Parallelr. (Axo-nometrie) u. → *Perspektive. AlsSchrägr. bezeichnet man die fron-tale Axonometrie mit den Sonder-formen Kavalierr. und Militärr. Die→ *Baurisse der Gotik sind Son-derfälle der Kotierten Projektion. Engl. crack; frz. plan perspectif; it. proiezio-ne; sp. proyección.
Ritterdach, Kronendach, eine Artder → *Dachdeckung, bei der jedeDachlatte zwei Reihen versetzterBiberschwanz-Ziegel trägt. Engl. high-pitched roof; frz. toit couronné,t. en cavalier; it. tetto a cavaliere; sp. tejadocoronado.
Riwaq (arab.), eigentl. Säulenvor-halle, meist aber speziell die einenHof umgebenden Säulenhalleneiner Moschee.
Rocaille (frz.), 1. Muschelwerk inkünstl. Grotten. 2. Muschelformenähnl., asymmetr. Dekorationsele-ment der Spätbarockzeit, nach demder ganze Stil auch Rokoko ge-nannt wurde. Engl., frz., it. rocaille; sp. rocalla.
Rofen, Dachschräghölzer, mit de-nen ein auf Dachbalken (Pfetten)liegendes oder hängendes Dach ge-bildet wird; sie sind kein Konstruk-tionsglied des eigentl. Dachgerüsts,sondern dienen nur dazu, bei gro-
ßen Abständen der Pfetten dieDachhaut zu tragen. Sie werdenurspr. mit ihren Wurzelenden andie Firstpfette gehängt oder mittelseingebohrtem Holznagel, auchpaarweise mittels Zapfenschloßoder Kämmung verbunden undüber die Firstpfette gelegt. Überden Rähmbalken (Fersenbaum) alsTraufrand sind sie frei vorgekragtund bilden den wandschützendenDachüberstand. Sie sind zu unter-scheiden vom → Sparren, der einverzimmertes, selbsttragendes Glieddes Dachgerüsts ist. Frz. chevron; it. travicello; sp. cabrio, cabio.
Rofendach → Rofen.
Roland, eine Ritterfigur mit erho-benem Schwert � wohl ein Rechts-symbol � auf dem Marktplatz einerStadt. Der bekannteste R. steht aufdem Markt zu Bremen. Engl. Roland column; frz. (statue de) Ro-land; it. statua di Orlando; sp. estatua deRolando.
Rolladen, → *Fensterladen, der auseinzelnen Holzlatten oder aus Well-blech besteht und auf einer Welleaufgerollt werden kann. An beidenSeiten ist eine U-Schiene zur Füh-rung angebracht, die Welle mit demaufgerollten Laden ist im Rolladen-kasten untergebracht. Engl. roller blind; frz. volet roulant, jalousievénitienne; it. persiana avvolgibil; sp. per-siana enrollable.
395 Rolladen
Rocaille
Rollenfries, → *Fries aus waage-rechten zylindr. Rollen, in mehre-ren übereinanderliegenden Lagenmit Hohlräumen abwechselnd. Engl. billet; frz. billettes, billette cylindrique,moulure hachée; it. fregio a rulli; sp. mol-dura cortada cilíndrica.
Rollschar, Rollschicht, gemauerteSchicht aus hochkant gestelltenBindern (→ *Mauerwerk). Engl. rowlock; frz. assise de briques poséesde champ; it. corso di mattoni di costa;sp. hilera de ladrillos colocados de canto.
Rolltreppe, Treppe mit mechan.fortbewegten Stufen. Engl. escalator; frz. escalier roulant; it. scalamobile; sp. escalera mecánica.
Rollwerk, hauptsächl. in der dt.Renaissance vorkommende Deko-ration mit verschlungenen und auf-gerollten Bandformen, vor allem beiWappen und Kartuschen, ähnl. dem→ *Beschlagwerk (→ *Kartusche). Engl. scrollwork; frz. (cartouche à) enroule-ment (s); it. cartoccio; sp. adornos de volu-ta.
Römisch-dorische Ordnung,modifizierte gr. → *Dorische Ord-nung, deren Säulen eine Basis undunter dem Echinus einen Halsringhaben. Der R.d.O. ist die toskan.Ordnung ähnlich (→ *Säulenord-nungen). Engl. Roman-Doric order; frz. ordre ro-main-dorique; it. ordine architettonicoromano-dorico; sp. orden románico dórico.
Römisch-ionische Ordnung,ziemlich schemat. Abwandlung dergr. → Ionischen Ordnung (→ *Säu-lenordnungen). Engl. Roman Ionic order; frz. ordre ro-main-ionique; it. ordine architettonico ro-mano-ionico; sp. orden románico-iónico.
Rondell (frz.), 1. runder, dickerTurm, runde Bastion oder halb-kreisförmiges Vorwerk vor einemTor. 2. Rundbeet, das häufig durchPlastiken, Wasserbecken oder Blu-menschmuck bes. hervorgehobenwird. Engl. 1. round tower, 2. rondel; frz. rondelle;it. 1. bastione circolare, 2. rondeau, rondò,aiuola circolare; sp. arandela.
Rondengang (frz.), gedeckterGang hinter dem inneren Wall ei-ner Festung, auch hinter einerBrustwehr oder einer Schartenmau-er.Frz. chemin rond, c. couvert; it. rondello;sp. ronda.
Rose, mit Maßwerk geschmücktesgot. → *Rundfenster. Engl. rose, rosette; frz. rose, rosace, rosette;it. rosone; sp. rosetón, rosa.
Rosette (frz.), stilisierte Abstrak-tion einer Blütenform, bei der umeinen runden Kern Blütenblätterangeordnet sind. R. sind schon inder babylon. Kunst (Babylon, Pro-zessionsstraße und Thronsaal)nachgewiesen und kommen in fastallen Epochen der Kunst vor.
Rostra (lat.), Name der Redner-tribüne auf dem Forum Romanum,
Rollenfries 396
Römisch-ionischeOrdnung
Römisch-dorischeOrdnung
genannt nach den an ihr angebrach-ten Schiffsschnäbeln.
Rotunde (lat.), Rundbau, Zen-tralbau von kreisrundem Grundriß(→ *Rundkirche). Engl. rotunda; frz. rotonde; it. rotonda;sp. rotunda, rotonda.
Rücken, die meist übermauerteOberseite eines → *Bogens oderobere Fläche eines → *Gewölbes. Engl. back, rear, ridge; frz. extrados, douelle(extérieure); it. estradosso; sp. dovela.
Ruine (lat.), Bauwerk im Zustanddes Verfalls. In früheren Epochenwurden R. als Steinbrüche ausge-beutet oder aber für neue Zwecke(meist Wohnbauten) adaptiert. Seitdem Spätbarock wurden in denParkanlagen künstliche R. errich-tet, und in der Zeit der Romantiksetzte eine sentimentale R.begei-sterung ein. Engl. ruin; frz. ruine; it. rovina; sp. ruina.
Rumpf, 1. bei → *Säulen derSchaft. 2. Bei → *Fialen der Leib. Engl. 1. trunk, torso; frz. 1. fût (de colonne);it. 1. tronco, fusto della colonna; sp. 1. fustede la columna, 2. cuerpo del pináculo.
Rundbau → Rotunde.
Rundbogen, Halbkreisbogen (→*Bogenformen). Engl. round arch, Roman a.; frz. (arc en)plein cintre; it. arco a tutto sesto; sp. arco demedio punto.
Rundbogenfenster, Fenster mithalbkreisförmigem Bogenabschluß(→ *Fensterformen). Engl. Roman window; frz. fenêtre arquée;it. finestra ad arco a tutto sesto; sp. ventanaarqueda.
Rundbogenfries, → *Fries auskleinen aneinandergereihten Rund-bogen, die auch von Konsolen ge-tragen werden können. R. kom-men vor allem an Gesimsen ro-man. Bauten vor, als Rahmung vonWandflächen zwischen Lisenen,auch als steigender R. unter Gie-belschrägen. Engl. blind arcade, round arch frieze;frz. frise en arceaux, f. en arquée; it. fregioad archetti; sp. friso arqueado.
Runddorf, Rundling, urspr. voneiner Hecke umgebenes Dorf, des-sen Häuser mit der Giebelseite umeinen runden, nur von einer Seitezugängl. Platz stehen (→ *Dorffor-men).
Rundfenster, Fenster mit kreis-runder Öffnung. R. ohne Unter-teilung oder mit eingefügten Mehr-pässen; R. mit speichenartigerUnterteilung heißen Radfenster,R. mit Maßwerkfüllung werdenRose (Fensterrose) genannt. (Abb.S.398)Engl. oculus; frz. fenêtre ronde; it. finestracircolare; sp. ventana circular.
Rundkirche, Kirche mit kreis-förmigem Grundriß, oft mit Um-gang. Hauptsächlich in Dänemark(Bornholm) und Schweden (Got-
397 Rundkirche
Rosetten an der Untersicht einesGesimses
land) vorkommend (→ Zentralbau,→ *Mittelstütze ). Engl. round church, rotunda; frz. égliseronde (é. circulaire); it. chiesa rotonda;sp. iglesia circular.
Rundling → Runddorf (→ *Dorf-formen).
Rundpfeiler, → *Pfeiler mit kreis-förmigem Querschnitt. Engl. round pier, circular pier; frz. pilierrond, p. circulaire; it. pilastro cilindrico;sp. pilar redondo.
Rundstab, stabförmiger zylindr.Bauteil, hauptsächl. bei Profilen,→ *Rippen, Fenster- und Portalge-wänden der Gotik (→ *Stab). EinDreiviertelstab ist ein R. mit Drei-viertelkreisquerschnitt. Engl. baston, astragal, torus; frz. baguette;it. tondo; sp. tapajuntas, junquillo.
Rundtempel, ein Tempel mit run-der Cella und runder Säulenhalleheißt Tholos (→ *Tempelformen),ein R. ohne Cella → *Monopteros(meist in barocken Parkanlagen). Engl. round temple; frz. temple rond, t. cir-culaire; it. tempio circolare; sp. templo cir-cular.
Rustika (lat.), opus rusticum,→ Quader, deren Ansichtsflächenin der Hauptsache als Bossenunbearbeitet stehen bleiben: unbe-arbeitete Buckelquader, die in derRegel nur Saum- bzw. Kanten-schläge (→ Randschlag) erhalten.Bereits in antiken Bauten vorkom-mend, bes. in der it. Renaissance(Toskana) verbreitet, erhalten biszum Barock, im Verputz nachge-ahmt und im 19. /20. Jh. bei Re-präsentationsbauten wiederaufge-nommen. → *Mauerwerk. Engl. rustication; frz. rustique; it. opus rus-ticum; sp. construcción rústica.
Rundling 398
Rundfenster1 Lochfenster 2 Radfenster
3 Maßwerkrose
Rundkirche(Beispiel: Petronell)
S
Saal, ein großer, oft monumenta-ler Raum in Schlössern, Burgen,Palästen, Rathäusern oder öffent-lichen Gebäuden. Engl. hall; frz. salle; it., sp. sala.
Saalbau, Gebäude, das im Haupt-geschoß (außer kleinen Neben-räumen) nur einen Saal enthält, fürFeste und Versammlungen. Engl. hall; it. edificio con una sala grande;sp. edificio con una sala.
Saalkirche, Kirche, deren Innen-raum ein (mit Ausnahme der Em-porenpfeiler) nicht durch Stützenunterteilter Saal ist, im O. zumeistmit eingezogener Apsis oder einemChor. Engl. hall church; frz. église-salle; it. chiesaad aula; sp. iglesia tipo sala.
Sacellum (lat.), Signa, Kultort zurAufbewahrung der röm. Feldzei-chen, häufig in Verbindung mit derPrincipia. Im MA. Bezeichnungfür Kapelle oder Betsäule.
Sacrarium (lat. Heiligtum), Gru-be oder Behälter südl. neben demAltar oder in der südl. Sakristei zurAufnahme unbrauchbar geworde-ner geweihter Gegenstände (Baum-wolle, Kerzen, Asche) sowie des zuliturg. Waschungen (→ Lavabo)verwendeten Wassers. Das S. isthäufig mit durchlochter Steinplat-te oder kleinem Puteal (Ein-gußbecken) abgedeckt. Auch ne-ben oder unter dem Taufstein sollein S. sein. Verbreitet im frühenMA., in der weiteren Entwicklungdes 13./14. Jhs. als → Piscina in derSüdwand des Chors oder der Sa-kristei.
Sägedach, Sheddach, Folge vonparallel angeordneten Satteldächernüber einem Baukörper, deren stei-ler angeordnete Flächen verglastsind (→ Dachformen). Engl. M-roof, double (triple, etc.) ridgedroof; frz. toit en dent de scie; it. tetto a rise-ga; sp. tejado en diente de sierra.
Sägezahnverzierung, sägeförmi-ge Verzierung der normann. Bau-kunst, hauptsächl. an → *Friesenvorkommend. Engl. notched moulding, hatched m.;frz. dents de scie; it. decorazione a denti disega; sp. decoración en diente de sierra.
Sahn, geräumiger Innenhof imWohnhaus Muhameds in Medina,dann seit frühislam. Zeit der offe-ne, von ein- oder mehrschiffigenUmgängen begrenzte Hof einerMoschee, in dessen Mitte der Rei-nigungsbrunnen steht. It. sahn; sp. patio interior musulmán.
Saillant, der Schnittpunkt der Fa-cen (Bastionsspitze) einer Festung.
Sakomar (russ.), Rundgiebel anFassaden, meist der Form der inne-ren Wölbungen entsprechend, aberauch rein dekorativ aufgesetzt. Ne-ben den Lisenen (Lopatki) Haupt-bestandteil des dekorativen Fas-sadenschmucks altruss. Kirchen.
Sakralbau, ein im Gegensatz zumProfanbau Kultzwecken dienendesBauwerk (→ Kirchenbau, → *Mo-schee, → *Tempelbau u. dergl.). Engl. church architecture; frz. constructionreligieuse; it. architettura sacra; sp. con-strucción sacra.
Sakramentshaus, ein turmartigesBauwerk, das aus einem Fuß, ei-nem Überleitungselement (Korb),
399 Sakramentshaus
dem Gehäuse und einem bekrö-nenden Baldachin besteht, seltenernur eine Wandnische (Sakraments-nische) an der Nordwand des Chor-raums. Das S. diente zur Aufbe-wahrung der Hostien, Kelche undliturg. Gefäße und wurde in spät-got. Zeit bes. prunkvoll ausgebildet.Engl., frz. tabernacle; it. edicola del sacra-mento; sp. sagrario.
Sakramentskapelle, Kapellenan-bau, in der das Sakrament (Hostie,Kelche usw.) aufbewahrt wird,stiller Andachtsraum, zumeist ineiner Seitenkapelle auf der Nord-seite großer, vielbesuchter Kirchen. Engl. sacrament chapel; frz. chapelle detabernacle; it. cappella del sacramento;sp. capilla del sagrario.
Sakramentsnische, mit Gitteroder Tür verschlossene Mauerni-
sche in der Nordwand des Chorsin der Nähe des Hauptaltars zurAufbewahrung der Hostien, Kel-che und liturg. Gefäße anstelle des→ *Sakramentshauses.
Sakristei, Treskammer, Dresekam-mer, Almaria, Almer, Gerkammer,Vestiarium, im 11. Jh. in der Regelvon Farfa erstmals sacristia ge-nannt. Abgesonderter, dem Pres-byterium im N., später auch im S.oder gelegentl. im O. angefügterRaum, in dem liturg. Geräte, Para-mente, Bücher und andere für denGottesdienst erforderl. Gegenstän-de aufbewahrt und wo die Vorbe-reitungen vorgenommen werden,u. a. Anlegen der Gewänder. An-fangs waren im N. und S. für ver-schiedene Funktionen zwei Räumeangefügt: → Pastophorien. Die S.kann einen eigenen Altar haben;bei bes. Reliquienreichtum oder beiNutzung als Mausoleum auch alsmonumentale Zentralbauten (Re-naissance, Barock) ausgebildet. ImBarock wurde die S. als eine ArtRequisitenkammer für die theatral.gestaltete Liturgie prunkhaft aus-gestattet und mit Altar und Para-mentenschränken als Gesamtkunst-werk aufgefaßt. Im protestantischenKirchenbau spielt die S. nur eineuntergeordnete Rolle und ist aufeinen kleinen Anbau oder eineAbschrankung hinter oder nebendem Altar beschränkt. Engl. sacristy, sextry; frz. sacristie, sacraire;it. sacrestia, sagrestia; sp. sacristía.
Sala (ind.), Versammlungshallebuddhist. Klöster.
Sala terrena (it.), Gartensaal imErdgeschoß eines Schlosses oder Pa-lastes, meist im Mittelrisalit unter
Sakramentskapelle 400
Sakramentshausmit Astwerkbekrönung
dem Hauptsaal als Übergang zumPark angeordnet. Die S. t. war ur-spr. offen und auch als Grotte aus-gestaltet.
Salon, großes Gesellschafts- oderEmpfangszimmer. Engl., frz. salon; it. salotto, salone; sp. salón.
Sängerbühne, eine Empore anden Langseiten, meist aber über demWesteingang einer Kirche (→ *Or-gelempore). Die S. waren urspr.nicht sehr groß. It. cantoria; sp. tribuna coral.
Sangharama (ind.), buddhist. Klo-steranlage, bestehend aus einer vonZellen umgebenen Halle oder Hofmit mehreren Stupas.
Sanktuarium (lat.), der Raum mitdem Heiligtum, bei christl. Kir-chen der Chor mit dem Hochaltar,aber auch der ganze der Meßhand-lung vorbehaltene Raum, der mit-tels Schranken, Gitter oder einesLettners vom Laienraum abge-trennt ist, also Chor, Querhaus mitVierung und auch vereinzelt daserste Langhausjoch. Engl. sanctuary; frz. sanctuaire; it., sp. san-tuario.
Sappe (frz.), Approche, Tranchée,beim förml. Angriff (Angriffsap-proche) ausgehobener Graben, derdem Vordringen des Belagerers ge-gen den Belagerten dient und ihmDeckung bietet. Um dem Frontal-feuer auszuweichen, wird die S.meist als Wendes. schräg zur Kapi-tallinie in mehrfachen Wendungenüber die Parallelen bis an denHauptwall vorgetrieben. Engl. sap, sapping; frz. sape; it. saliente, trin-cea d�approccio; sp. zapa.
Sarazenenbogen, gespitzer islam.Bogen, der von vier Zentren auskonstruiert ist und dem späteren→ Tudorbogen ähnl. ist, teilweisejedoch mehr gebust. Frz. arc brisé islamique (mauresque); it. ar-co saraceno; sp. arco sarraceno.
Sargwand, süddt. Bezeichnungfür die längsseitigen Umfassungs-mauern eines Gebäudes im Gegen-satz zu den Giebelwänden, auch dieüber den Seitenschiffarkaden auf-gehende Mauer (→ Obergaden). Frz. paroi latérale d�enceinte; sp. pared late-ral de un edificio.
Sarkophag (gr. fleischfressend),ein sichtbares, nicht wie ein Sargmit Erde überdecktes Grabdenk-mal aus Holz, Stein, Metall oderTon in Form einer einfachen Kiste,in Ägypten auch in Formen, diedem menschl. Körper bzw. derMumie angepaßt sind. Bei denGriechen und Römern, häufig auchim MA., nimmt der S. hausähnl.Formen an und erhält meist einGiebel-, seltener ein Walmdach. Eskommen sogar Analogien zumTempel- und Kirchenbau mit Quer-schiffen und bei der Sonderformder Reliquiare sogar mit Kuppelnvor, die Wände zeigen Architek-turgliederung (Portale, Säulenarka-den u. dergl.), das Dach Ziegel undDachbekrönungen (Akroterien). Engl. sarcophagus; frz. sarcophage; it. sarco-fago; sp. sarcófago.
401 Sarkophag
Antiker Sarkophag
Sarkophagaltar, Altar mit sarko-phagartigem Unterbau (→ *Altar 2d). Frz. autel de sarcophage; it. altare a sarcofa-go; sp. altar con sarcófago.
Sasse, bei Holzverbindungen derEinschnitt eines Holzes, in den sichder Ausschnitt des anderen einfügt,z.B. Blattsasse (→ Blatt 1).
Satellitenstadt → Trabantenstadt.
Sattelbalken, Balkenstück imDachwerk, das der Mauerschwelleaufgekämmt und mittels einer Fuß-strebe (als senkrechtes Holz Spar-renknecht) mit den Sparren imDreieck verbunden ist.
Sattelbogen → auch Eselsrücken. Frz. arcon, arc accolade; it. arco a sesto in-flesso.
Satteldach, Giebeldach, eine auszwei gegen einen gemeinsamenFirst ansteigenden Flächen beste-hende → *Dachform, die an denSchmalseiten von Giebeln ge-schlossen wird. Engl. saddleback (roof); frz. toit en bâtière;it. tetto a capanna; sp. tejado a dos aguas.
Sattelholz, ein waagerechtes Holzzur Verbreiterung des Auflagersüber einem Ständer und zur Un-
terstützung eines Unterzugs. DurchAnordnung von einem oder meh-reren S. kann die freie Spannweitevon Unterzügen wie durch Kopf-büge oder Streben verringert wer-den. Das S. hat auch die Aufgabe,das Hirnholz des Ständers vor demAufsplittern zu schützen. Formalsind auch verschiedene Kapitelle �z.B. das ion. � dem S. verwandt. Engl. bolster, corbel piece; frz. semelle, bois,sous-longeron; it. sottotrave, trave a sella;sp. sobre viga de madera.
Satteltreppe, aufgesattelteTreppe,deren Stufen auf ausgeschnittenenoder profilierten Wangen (Sattel-wange) ruhen oder deren Tritt-stufen mittels Knaggen auf demTragholm befestigt sind. Die Stu-fenstirn liegt frei. Frz. escalier à l�anglaise, e. crémaillère; sp. es-calera de peldaños sentados.
Sattelturm, Turm mit einem Sat-teldach (→ *Dachformen). Engl. saddleback roof tower; it. torre contetto a capanna; sp. torre con tejado a dosaguas.
Säule, 1. im → *Fachwerkbau je-des senkrechte Holz (Pfosten, Stiel,Ständer), bei der → *Dachkonstruk-tion die Stuhls., beim → *Hänge-werk die Hänges. 2. Im Steinbauein Stützglied mit kreisförmigemGrundriß und im Gegensatz zumRundpfeiler (→ *Pfeiler) mit Ver-jüngung und manchmal auch mitEntasis. Die S. ist gewöhnl. in Ba-sis, Schaft und Kapitell gegliedert.Die Basis besteht aus einer quadrat.Platte (Plinthe) und einem odermehreren Wülsten und Kehlen. DerSchaft besteht aus einem Stück(monolith) oder kann auch aus ver-schiedenen Trommeln zusammen-
Sarkophagaltar 402
Sattelholz
gesetzt sein. In der halben Höhedes Schaftes gibt es selten ringför-mige Betonungen (→ *Schaftring,Bund, Wirtel). Bei der toskan.Ordnung scheidet ein Halsringunter dem Kapitell den S.schaft
vom S.hals (→ *Säulenordnun-gen). Man unterscheidet freistehen-de S. an eckigen oder runden Pfei-lern und Wands. (meist Halbs., anEcken Dreiviertels.). Wands. vonkleinem Querschnitt und relativ
403 Säule
2 verschlungene Säule 3 Schlangensäule 4 Knotensäule 5 gedrehte Säule 6 Papyrosbündelsäule mit
geschlossenem Kapitell
7 Papyrossäule mit offenem Kapitell
8 Zeltstangensäule9 kretische Säule10 protodorische Säule
Säule1 Systemskizzea Kapitell b Verjüngungc Entasis d Schaft e Basis
großer Höhe, die auch gebündeltvorkommen können, nennt manDienste (→ *Dienstbündel). S. kön-nen auch in Gruppen aufgestelltsein, z. B. als Doppels. (→ *ge-kuppelte S.) oder Vierlingss. DerS.schaft kann verschiedene Formenhaben (→ Schaft). Sonst unter-scheidet man S. hauptsächl. nachder Form des → *Kapitells, das inÄgypten Pflanzenformen nachgebil-det (Lotoss., Papyross., Palmens.),aber auch stereometr. sein kann(Zeltstangens. mit glockenförmi-gem Kapitell und nach unten ver-jüngtem Schaft). Ein Kapitell (odernur einen Kapitellaufsatz) mit vierKöpfen der Göttin Hathor trägt dieHathors., während die sog. proto-dor. S. Ägyptens einen polygonalenSchaft mit Abakus zeigt. Die Über-leitung zur dor. S. bildet die kret.S. mit Basis, nach unten verjüng-tem Schaft und Kapitell, bestehendaus Wulst und Abakus. Zu denklass. Säulenordnungen der griech.und röm. Antike rechnet man die→ *Dor. Ordnung mit einem kan-nelierten S.schaft ohne Basis undeinem Kapitell mit Wulst (Echi-nus) und Abdeckplatte (Abakus),die → *Ion. Ordnung mit kanne-liertem Schaft, mit einer Basis (Plin-the, Wulst, Kehle, Wulst) und einemVolutenkapitell und die → *Ko-rinth. Ordnung mit einem Akan-thuskapitell. Die hauptsächlichfür die röm. Baukunst wichtigenOrdnungen (→ Kompositordnung,→ *Röm.-dor. Ordnung, → *Röm.-ion. Ordnung und → Toskan. Ord-nung) stellen Varianten der gr.Ordnungen dar, bei denen auchdie Form der S. leicht variiert wird. Engl. column; frz. colonne, poteau; it. co-lonna; sp. columna.
Säulenbasilika → *Basilika, derenSchiffe durch Säulen getrennt sind. Engl. column basilica; frz. basilique à co-lonnes; sp. basílica con columnas.
Säulenbogenstellung, ein in derröm. Antike und in der Renais-sance häufig vorkommender Ar-chitekturaufbau, bei dem die Bo-gen zwischen den Wandsäulen, dieein den Bogenscheitel berührendesGebälk tragen, stehen. Frz. travée romaine; sp. disposición de arcosentre columnas.
Säulenbündel, Zusammenfassungkleinerer → *Säulen oder Dienstezu einer Gruppe, fälschl. oft auch→ *Bündelpfeiler genannt. Frz. faisceau de colonne(s); it. fascio di co-lonne; sp. haz de columnas.
Säulenbasilika 404
Säulenbogenstellung(Beispiel: Rom, Kolosseum)
Säulenfigurenportal, ein gestuf-tes → Säulenportal, bei dem zwi-schen den Säulen des GewändesSkulpturen angeordnet sind. DasS. kommt in der frz. Baukunst derRomanik, vor allem aber bei denKathedralen der Gotik vor.
Säulenfuß → *Basis.
Säulengang, ein Gang, dessenÜberdeckung von Säulen mit waa-gerechtem Gebälk getragen wird.S. kommen z.B. als Pteron beim gr.Tempel (→ Peripteros), als Wandel-halle (→ Stoa) oder als Rahmung(Peristyl) von Platzräumen, vonHöfen in *Wohnhäusern und von→ *Tempelbezirken vor. Treten andie Stelle des Gebälks Bogen, sowird der S. zur → *Arkade. Engl. colonnade; it. (portico) colonnato;sp. columnata.
Säulenhalle, ein hallenartigerWandelgang vor öffentl. Gebäudenoder Kirchen und als Rahmungvon Plätzen (→ Säulengang). AuchVorhalle von Kirchen- und Profan-bauten (→ *Portikus). Engl. columned hall, hypostyle h.; frz. por-tique, salle hypostyle; it. loggia colonnato,portico c.; sp. pórtico.
Säulenhals, Hypotrachelion, Epi-trachelium, der obere Teil desSchaftes einer Säule unmittelbarunter dem Kapitell. Die untereGrenze des S. bildet bei der dor.Ordnung eine Kerbe (→ *Echi-nus), bei der → Toskan. Ordnungein Halsring. Engl. gorge; frz. georgerin, colarin; it. colla-rino (di colonna); sp. gorja.
Säulenordnungen, Proportionie-rung klass. Säulen und Gebälke.
Die Relationen und auch die An-ordnung der Bauelemente kannbei den klass. S. im Laufe derEntwicklung etwas schwanken. Beiden Griechen unterscheidet mandrei Ordnungen: die → *DorischeOrdnung, die → *Ionische Ord-nung, unterteilt in die att.- undkleinasiat.-ion. Ordnung, und die→ *Korinthische Ordnung. DieRömer übernahmen von den Grie-chen deren S. in abgewandelterForm als → *Römisch-dorische und→ *Römisch-ionische Ordnung.Eine Sonderform der röm.-dor. S.ist die → Toskanische (etrusk.)Ordnung. Eine Verbindung vonion. und korinth. Ordnung bringtdie → Kompositordnung. In derRenaissance wurde wieder an dieantiken, vornehmlich an die röm.S. angeknüpft, wobei Theoretiker(→ Architekturtheorie) Normenüber die Proportionierung (→ *Pro-portion) der S. aufstellten. Der Flo-rentiner L. B. Alberti (1404�1472)gewann aus Vitruvs Buch »Dearchitectura libri decem«, dem ein-zigen aus der röm. Kaiserzeit voll-ständig überlieferten, 1414 von P.Bracciolini in der St. Galler Klo-sterbibliothek als frühma. Ab-schrift wiederentdeckten Archi-tekturtraktat, die Anregung für seinHauptwerk »De re aedificatoria«,das seit etwa 1452 in Künstler- undHumanistenkreisen bekannt warund 1485 in lat. Sprache gedrucktwurde. Seine über Vitruv hinaus-gehende Leistung bestand in einerUmgruppierung und neuen Sinn-gebung der Angaben Vitruvs überdie Bauweise der Tempel, die er alshellenist. Säulenarchitektur auffaß-te und deshalb bes. auf die Formenund Maße der drei Grundarten der
405 Säulenordnungen
antiken Säulen, der dor., ion. undkorinth., und ihrer beiden Spielar-ten, der zusammengesetzten, kom-positen, und der toskanischen., kon-zentrierte. Alberti übertrug dieseRegeln auf christl. Kirchen, Paläste,Land- und Stadthäuser und vonden Säulen auch auf Pfeiler undPilaster. In seiner Nachfolge habenS. Serlio 1537, J. A. Du Cerceau1559, G. B. da Vignola 1562, J.Bullant 1563, Ph. Delorme 1567und A. Palladio 1570 die Archi-tekturtheorie weiterentwickelt undergänzt. So entstand die Lehre vonden S., die schließl. in Frankreichihre äußerste rationale und krit.Durchbildung erfuhr (F. Blondel,Cours d�Architecture, 1675 bzw.1698). Die Säulen ordnen, gliedernund erhöhen die Architektur.Zweck und soziale Stellung des
Bauherrn bestimmen die Wahl derjeweils angemessenen Ordnung,wobei jede bes. und typ. Eigen-schaften besitzt (W. Dietterlin,Architectura, Nürnberg 1591): dietoskan. naturverbunden für Sub-struktionen und Kellergeschoß, diedor. einfach, stark, männl. für Erd-geschoß, die ion. schlank, anmutig,heiter, fraul. für 1. Obergeschoß,die korinth. mächtig, stolz, reich,jungfräul. für 2. Obergeschoß, diekomposite prächtig, abwechslungs-reich, überird. für Söller- und At-tikageschoß. Engl. column orders; frz. ordres de co-lonnes, ordres d�architecture; it. ordiniarchitettonici; sp. ordenes de columnas,ordenes arquitectónicos.
Säulenportal, Portal, in dessen ab-getreppter Laibung (Stufenportal)
Säulenportal 406
Säulenordnungen
1 dorisch 2 attisch-ionisch 3 kleinasiatisch-ionisch4 korinthisch 5 toskanisch
Säulen eingesetzt sind. Bes. häufigkommt das S. in der roman. Bau-kunst vor. Engl. columned portal; frz. portail à co-lonnes; it. portale a smussi con colonnine;sp. portal con columnas.
Säulenportikus, Säulenhalle,meist der Schauseite eines Bau-werkes in der Achse des Haupt-portals vorgelegt (→ *Portikus). Engl. column portico; frz. portique à co-lonnes; it. portico colonnato; sp. pórtico concolumnas.
Säulensaal, ein Saal, dessen Dek-ke von Säulen getragen wird. Be-kannte S. sind die → *Apadana derpers. Königspaläste (Hunderts.),die Quersäle ägypt.Tempel und derS.moscheen (Hypostyl). Eine Son-derform des S. ist der ägypt. Saal,ein dreischiffiger S. der hellenist.Baukunst mit basilikal erhöhtemMittelschiff. Engl. columned hall, hypostyle h.; frz. salleà colonnes; it. sala ipostila; sp. salón con co-lumnas.
Säulenschaft → Schaft.
Säulenstuhl, seltene Bezeichnungfür → Stylobat.
Säulentrommel, ein Teilstück desnicht monolithen Säulenschafts(→ Trommel, → *Säule). Engl. column drum; frz. tambour decolonnes; it. tamburo della colonna, roc-chio della c.; sp. tambor de columna
Säulenvorlage, eine einem Pfeileroder einer Wand vorgelegte Halb-oder Dreiviertelsäule, deren Schaftallgemein aus Säulentrommeln be-steht, die zumindest teilweise indas Mauerwerk eingebunden oderdurch → *Schaftringe mit der Mau-er verbunden sind. Frz. pilastre; it. colonna incassata, c. alveo-lata; sp. pilastra.
Säulenweite, Abstand zwischenden Säulenachsen (→ *Interko-lumnium). Engl. intercolumnation; frz. entrecolonne;it. intercolunnio; sp. intercolumnio.
Saumleiste, Saumbrett, obere oderuntere Abschlußleiste an einemTürflügel oder Fensterladen zumSchutze des Hirnholzes gegen ein-dringende Feuchtigkeit. Engl. fillet; sp. listel.
Saumschwelle → Stockschwelle.
Scagliola (it.) → Stucco lustro.
407 Scagliola
Säulenportal
Säulensaal(Beispiel: Theben-Karnak,
Großer Amuntempel, sog. »Basilika«)
Scala sancta, Heilige Stiege, Pila-tusstiege, als Aufgang zu einer Ka-pelle dienende Treppe mit dreiArmen zu je 28 Stufen, in die Re-liquien eingelassen sein können.Den breiteren mittleren Arm be-gleiten zwei schmalere Arme. Sieist eine Nachbildung der Treppeam Haus des Pilatus, die Christuserstiegen haben soll, bzw. der Scalasancta in Rom. Im Barock beiWallfahrtsanlagen verbreitet.
Scamillus (lat.), an den → Stylobatangearbeitetes, keilförmiges Aus-gleichselement, das trotz dem durchdie Entwässerung bedingten Gefäl-le des Stylobats eine waagrechteStandfläche für die Säule schaffensoll. Engl. scamillus; it. scamillo; sp. cuña en elestilóbato.
Scenae frons (lat.), die architek-ton. gegliederte Rückwand der Büh-ne (Skene) zwischen den Paraske-nien des röm. Theaters (→ *Thea-terbau).
Schachbrettfries, Würfelfries,→ *Fries mit vor- und zurücksprin-genden Elementen. Engl. checkerboard frieze; frz. damier, échi-quier; it. fregio a scacchiera; sp. friso esca-queado.
Schacht, 1. im Bergbau und Brun-nenbau eine senkrechte Grube. 2.In der Baukunst eine senkrechteAussparung von meist geringem
Querschnitt, aber größerer Höhe(Lichts., Aufzugss., Lufts.). Engl. pit, shaft; frz. puits, bure; it. pozzo,tromba; sp. 1. pique, foso 2. ducto, aire-luz.
Schaft, Rumpf, der mittlereschlanke Teil der → *Säule, norma-lerweise monolith, vereinzelt sogarmit Basis und Kapitell aus einemStück gearbeitet, seltener ist der S.aus zylindr. Einzelstücken (Säulen-trommel) zusammengesetzt, bes.bei gr. Tempeln und in got. Kir-chen. Der S. verjüngt sich in derRegel nach oben zum Hals mehroder weniger und hat in der Antikedie von der gr. Säule bekannteAnschwellung in etwa einem Drit-tel der Höhe (→ Entasis). In halberHöhe oder seltener auch mehrfachkann eine ringförmige Unterbre-chung eingesetzt sein (→ *Schaft-ring, Wirtel). Der S. ist normaler-weise rund und glatt, bisweilenauch achteckig oder aus vier dün-nen, wulstartigen Schäften gedrehtoder geknotet (Knotensäule, bes. inder Romanik). Darüber hinaus kanner mit reliefartigen oder aufgemal-ten Ornamenten verziert sein, inder Romanik häufig mit Rautenund Zickzack, in der Renaissancemit Roll- oder Beschlagwerk undBlättern. An der gr. Säule ausgebil-det und von dort in alle antikisie-rende Stile übernommen (Roma-
Scala sancta 408
Scamillus unter einer attischen Basis
Schachta Lichtschacht b Luftschacht
nik, Renaissance, Klassizismus) fin-den sich senkrechte Rillen (→ Kan-neluren) als Gliederung des S.→ *Dorische Ordnung. Engl. shaft; frz. fût, tronc; it. tronco, fusto(della colonna); sp. fuste de la columna.
Schaftring, Bund, Wirtel, ringför-miges Zwischenglied am Schafteiner Säule. Der S. ist techn. alsBinder (Zungenstein) zu erklären,der Wandsäulen mit dem Mauer-werk verbindet. Doch kommenmanchmal auch S. an freistehen-den Säulen vor (Ringsäule, Bund-säule). Engl. annulet, shaft ring; frz. bague (decolonne), anneau; it. anello della colonna,cerchio (della c.); sp. anillo del fuste.
Schale, eine massive, krummflä-chige Tragkonstruktion mit gerin-ger Dicke und größerer Spannwei-te, z.B. die Gewölbeschale (→ *Ge-wölbe), bei modernen Ingenieur-konstruktionen eine Spannbetons.mit stark geschwungener Kontur. Engl. shell, bowl; frz. coque, voile mince;it. guscio; sp. cubierta en volado.
Schalenbrunnen, → *Brunnenmit einer oder mehreren Brunnen-schalen. It. fontana a vasca; sp. fuente de tazas, pila d. t.
Schalenturm, Halbturm, aus derWehrmauer (Ringmauer) einer Burg
oder Stadtbefestigung vorspringen-der, nach innen offener oder mitHolz geschlossenerTurm. Engl. semicircular tower; frz. demitour;it. baluardo semicircolare; sp. torre semicir-cular.
Schallarkade → Schallöffnung inArkadenform.
Schalldach, Schirmbrett, Schalla-den, schräggestellter Holzladen zumAbdecken der → Schallöffnung aneinem Glockenturm.
Schalldeckel, ein meist kunstvollausgebildeter, baldachinartigerÜberbau über einer → Kanzel. Engl. sounding board; frz. abat-voix; it. bal-dacchino del pulpo, cielo del p.; sp. balda-quín.
Schallöffnung, Schallfenster,Klangarkade, Schalloch, unverglas-te, fensterartige Maueröffnung an
409 Schallöffnung
Schaftring
Schalen
Türmen in der Höhe des Glocken-stuhls, häufig als gekuppelte Arka-den (Schallarkaden) oder maßwerk-gefüllte Fenster (Schallfenster), zurVerbreitung des Schalls dienend.Um das Eindringen von Schneeund Regen zu verhindern, wird dieS. mit Schallladen, Schallbretternoder Schalldächern versehen. Engl. louver window; frz. baie de clocher,ouïe; it. rosa (di campanile); sp. vano delcampanario.
Schalung, 1.Verbretterung einerFläche (Wands., Dachs.). 2. Hilfs-konstruktion, meist aus Schalbret-tern, zur Herstellung von Betonund dergl., wobei die S. nach Er-härten des Materials wieder abge-nommen werden kann. Frz. coffrage; it. 1. rivestimento di tavole, 2.cassaforma; sp. 1. techo de tablas, 2. encof-rado.
Schanze, kleines Festungswerkmit Brustwehr und Graben zur Ver-teidigung eines begrenzten Ab-schnitts, entweder geschlossen (Re-doute, Sterns.) oder offen (Redan,Hornwerk). Engl. entrenchment; frz. retranchement;it. trincea; sp. trinchera.
Schar, gleichhohe Schicht eines→ *Mauerwerks bzw. Folge vonDachziegeln, die in derselben Rei-he liegen (→ *Dachdeckung). Engl. sheath; frz. assise; it. filare; sp. hilada.
Scharnier (frz.), aus zwei um einGelenk drehbaren Metallplatten,von denen die eine am Rahmen,die andere am bewegl. Teil (Tür,Flügel) eines Möbelstücks ange-bracht ist. Ein S. in ganzer Längedes bewegl. Teils heißt Klavierband.Engl. hinge, joint; frz. charnière; it. cerniera;sp. charnela, bisagra.
Scharrieren, Oberflächenbehand-lung der Steine mit einem Schar-riereisen, wodurch schmale, paral-lele Rillen entstehen (Steinbearbei-tung). Engl. to drove; frz. ciseler; it. scalpellare scanalature parallele; sp. cincelar.
Schartenbacke, Schartenwange,die Seitenwand der → *Schieß-scharte. Frz. joue; it. sguincio della feroia; sp. paredlateral de una tronera.
Schartenladen, Schartenblende,Schartenschirm, vor oder in Schieß-scharten angebrachter, häufig mitBlech beschlagener Holzladen, dersich nach außen öffnet; er wird zu-meist von Zapfen, die in Klauenliegen, gehalten und schwingt umdie obere horizontale Achse. Erdient zur Deckung der Schützen. It. mantelletta; sp. postigo de una tronera.
Schartenmaul, feindseitige Öff-nung der → *Schießscharte. Frz. ouverture extérieure; it. bocca dellaferoia; sp. abertura exterior de una tronera.
Scharwachtturm, Hochwacht,Wichhaus, Pfefferbüchse, Tourelle,an der Ecke eines Turms, einesDachs oder einer Burg- oder Fe-stungsringmauer erkerartig vorkra-gendes Türmchen, ein- oder mehr-geschossig, oft mit Gußlöchernzwischen den Kragsteinen. Bezeich-nung im 16. Jh. eingeführt für Po-stenerker (→ Schießerker, → Sen-tinelle). Engl. échanguette, bartizan; frz. échauguette,tour de guet; it. torretta, guardiola, garta,sentinella; sp. garita.
Schalung 410
Scharnier
Schatzhaus, Thesauros, ein klei-nes Gebäude zur Aufbewahrungvon Weihegaben einer Stadt odereines Lands im Temenos gr. Kult-stätten. Engl. treasury; frz. trésor, trésorerie; it. teso-ro; sp. cámara del tesoro.
Schaubild, Übersicht über einBauwerk, meist in Form einer→ Perspektive oder Vogelperspek-tive. Engl. figure; frz. diagramme; it. schizzo;sp. croquis, bosquejo.
Schaufassade, Hauptansichtsseiteeines Gebäudes, die bes. reich aus-gebildet ist und den Gebäudequer-schnitt verdecken kann. Engl. main façade; frz. façade en trompe-l��il; it. facciata principale decorata; sp. fron-tis, fachada principal.
Schaufenster, mit Glas abge-schlossener Ausstellungsraum anStraßen und Passagen in Verbin-dung mit einem Laden, Geschäfts-oder Warenhaus. Engl. shop window; frz. (fenêtre d�) étalage,devanture de magasin; it. vetrina; sp. esca-parate.
Schaugiebel, bes. reich ausgebil-deter Giebel an der Hauptansichts-Fassade eines Gebäudes. Engl. ornamental gable; it. frontone princi-pale ornato; sp. frontón principal.
Schauinsland → Hochwacht.
Schaukasten, Vitrine, mit Glasabgeschlossener, kastenartiger Be-hälter, der Ausstellungszweckendient. Engl. display case; frz. vitrine; it. vetrina;sp. vitrina.
Schauspielhaus → *Theaterbau.
Scheibenbauweise, 1. schmale,langgestreckte Hochhäuser (Schei-benhochhaus), auch aus zwei oderdrei Scheiben bestehend, seit den1950er Jahren angewandt. 2. → Plat-tenbauweise.
Scheibenfries, ein meist in dernormann. Baukunst vorkommen-der → *Fries aus runden Scheiben. Engl. pellet moulding; frz. moulure discoïde,besans; it. fregio clipeato a dischi; sp. frisodiscoidal.
Scheidbogen, ein offenes Gewöl-bejoch seitl. begrenzender Bogen,zumeist zwischen Mittel- und Sei-tenschiffen einer Hallenkirche(wird gelegentlich auch bei räumli-cher Betrachtung für Arkadenbo-gen einer basilikalen Mittelschiff-wand benutzt). → *Gewölbefeld. Engl. partition arch; frz. grand-arc, arc bor-nant une voûte; it. arco laterale; sp. arco la-teral.
Scheidbogenrippe, an einemScheidbogen angebrachte oder ihnersetzende Rippe (Langrippe). It. costolone di arco laterale; sp. cuaderna deun arco lateral.
411 Scheidbogenrippe
Schatzhaus
Scheidewand, Scheidemauer, einenichttragende Zwischenwand, dieeinen Raum von einem anderentrennt. Engl. partition wall; frz. cloison, paroi deséparation; it. parete divisoria, tramezzo;sp. pared divisoria.
Scheinarchitektur, eine illusio-nist. gemalte oder durch Reliefwir-kung nur angedeutete Architektur,die räuml. nicht existiert. S. findetman vor allem in barocken Kirchen-bauten, um eine Raumausweitungzu erzielen (→ *Architekturma-lerei, → Fassadenmalerei). Engl. illusionistic architecture; frz. architec-ture simulée; it. architettura finta, a. trom-pe-l��il; sp. arquitectura aparente, a. simu-lada.
Scheinempore, eine emporeähnl.Maueröffnung zwischen Seiten-schiffarkade und Fensterzone, hin-ter der sich kein begehbarer Raumbefindet. S. führen meist in denoberen Teil der Seitenschiffe oderin den Dachraum. Engl. blind gallery; frz. tribune simulée, t.aveugle; it. falso matroneo; sp. galeríasimulada, tribuna s.
Scheingewölbe, ein nicht ausWölbsteinen gespanntes Gewölbe,zumeist aus Stuck oder Putzmörtelauf einem hölzernen Putzträger inGewölbeform, seit der Mitte des16. Jhs. verbreitet, bes. im Barock,im 20. Jh. als untergehängtesDrahtgewebe (→ Rabitzgewebe). Engl. blind vault; frz. fausse-voûte; it. fintavolta; sp. bóveda falsa.
Scheingrab, Kenotaph, ein Grab,in dem niemand bestattet ist(→ Grabdenkmal). Engl. cenotaph; frz. cénotaphe; it., sp. ceno-tafio.
Scheintriforium, zwischen Arka-den und Obergadenfenster einerdreischiffigen Basilika in denDachraum der Seitenschiffe geöff-nete Arkaden. Engl. blind triforium; frz. triforium simulé,t. aveugle; sp. triforio simulado.
Scheintür, eine Blendtür im letz-ten Raum einer → Mastaba, meistmit der Statue des Toten ge-schmückt. Hinter der S. führt einSchacht in die eigentl. Grabkam-mer. Engl. false door; frz. porte feinte, it. fausseporte; sp. puerta falsa.
Scheitel, höchster Punkt eines→ *Bogens oder eines → *Gewöl-bes. Engl. vertex, apex, crown; frz. vertex, apex,sommet; it. vertice, apice, cima; sp. vértice,ápice, cima.
Scheitelfuge, Fuge am höchstenPunkt eines Gewölbes oder Bo-gens, falls kein Schlußstein (Schei-telstein) vorhanden ist. Engl. crown joint; frz. joint de clé; it. fuga dichiave; sp. junta en el vértice.
Scheidewand 412
Scheintür
Scheitelhöhe, bei → Bogen und→ *Gewölben die Höhe, die zwi-schen Fußboden und Scheitel senk-recht gemessen wird, also die Sum-me aus Kämpferhöhe und Stichhö-he (Pfeil). Engl. height of apex; frz. hauteur sous clef;it. altezza in chiave; sp. altura del vértice.
Scheitelkapelle, eine meist derGottesmutter geweihte und im O.vorstehende Kapelle in der Mittel-achse eines → *Chors; in EnglandLady Chapel genannt. Engl. retrochoir; frz. chapelle terminale;sp. capilla saliente.
Scheitellinie, Linie entlang desScheitels eines → *Gewölbes odereines Bogens. Frz. ligne sommitale; it. cresta della volta,linea di chiave; sp. línea del vértice.
Scheitelrippe, Rippe, die entlangder Scheitellinie eines Gewölbesverläuft. Die S. kommt meistensbeim Fächergewölbe, Strahlenge-wölbe und Palmengewölbe derengl. Baukunst vor (→ *Gewölbe-formen). Engl. ridge rib; frz. nervure de sommet;it. nervatura di chiave; sp. arista del vértice.
Scheitelstein, Keilstein am höch-sten Punkt eines → *Bogens oder→ *Gewölbes (→ *Schlußstein 1)
bzw. ein Stein im Verlauf derScheitellinien eines Gewölbes. Engl. apex block; frz. clef (de l�arc); it. con-cio di chiave; sp. piedra angular en el vértice.
Scheitrechter Sturz, scheitrech-ter Bogen, Sturzbogen, Horizon-talbogen, trotz waagerechter Un-tersicht ein echter Bogen, d.h. dieFugen weisen zu einem angenom-menen gemeinsamen Mittelpunkt.Der Setzung des Mauerwerks wirdbei der Konstruktion des S. durcheine geringfügige Erhöhung derMitte oder durch Anordnung ei-nes Entlastungsbogens entgegen-gewirkt. Ist der S. aus Werksteinengefügt, so können zur Verbesse-rung der Tragfähigkeit auch → *Ha-kensteine verwendet werden. Engl. lintel; frz. arc en plate-bande, linteauéchancré; it. piattabanda; sp. dintel plano,dintel escotado.
Schenkel, 1. die Bogenhälftezwischen Kämpfer und Scheitel(→ *Bogen). 2. Die rahmendenHölzer des Fensterflügels. Deruntere S. eines nach innen aufge-henden Außenflügels ist mit eineraußen vorspringenden Wassernaseversehen und heißt daher Wetters.oder Wassers. (→ *Fenster). 3. Bei→ Triglyphen die Stege zwischenden Vertiefungen. Frz. branche; it. 1. fianco dell�arco1, mon-tante dell�a., 2. profili della finestra; sp. 1.rama de la bóveda, 2. maderos del bastidorde una ventana.
413 Schenkel
Scheitelkapelle
Scheitrechter SturzS Stützlinie
Schere, 1. → Tenaille. 2. Balken,parallel zu den Sparren, die sichkreuzen (→ Scherendach). 3. Beieiner Holzverbindung der zumEingreifen des → Scherenzapfenshergestellte Einschnitt am Spar-renende. Engl. scissors, shears; frz. ciseaux, cisaille;sp. tijera, cizalla.
Scherendach, 1. Untergruppe desPfettendachs, bei der die Firstpfettein einer »Schere«, zwei Hölzer par-allel zu den Sparren, ruht und aucheventuelle Mittelpfetten an dieserSchere befestigt sind (Sche-renbinder). 2. Untergruppe desSparrendachs, bei dem die Scher-sparren in der Regel am First mit-einander verkämmt bzw. überblat-tet sind, während echte Sparrendagegen mit Scherzapfen bündigverschlitzt sind. Da bei Scher-sparren der Scher(en)binder aufZug beansprucht ist, wird er mitVersatz an die Sparren angeblattet. Frz. toit en ciseaux; sp. techo en tijeras.
Scherengitter, ein durch scheren-artig bewegl. Glieder zwischen denVertikalstäben zusammenschiebba-res Gitter (Fenster, Türe). Engl. sliding lattice grate; frz. grille articu-lée; it. serranda a pantografo; sp. reja articu-lada.
Scherwand, eine leichtkonstru-ierte, versetzbare Scheidewand ausHolz oder dergl., zur Raumunter-teilung, bes. in Ausstellungsräumen.Frz. enfourchement; it. divisorio mobile;sp. tabique movible.
Scherwerk → Tenaille.
Scherzapfen, eine → *Holzver-bindung am Dachfirst, bestehend
aus dem mittleren Drittel einesSparrens (Zapfen), den die beidenäußeren Drittel des anderen Spar-rens umschließen. Engl. forked mortice and tenon joint;it. giunto a forcella; sp. unión bifurcada.
Scheuerleiste → Fußleiste.
Scheune, Scheuer, Stadel, land-wirtschaftl. Gebäude zum Lagernvon Stroh und Heu (→ *Gehöft). Engl. barn, grange; frz. grange; it. grangia;sp. granero.
Schicht, Schar, die in dersel-ben Reihe liegenden Steine eines→ *Mauerwerks. Engl. cars, course; frz. assise, cours; it. stra-to; sp. hilada.
Schichtmauerwerk, ein → *Mau-erwerk aus unregelmäßigen Bau-steinen, bei dem Ausgleichsschich-ten aus regelmäßigem Materialeingefügt sind, auch Wechsel vonverschiedenartigem oder verschie-denfarbigem Material (z. B. Back-stein-Werkstein, → *Polychromie). Frz. maçonnerie en assises, m. appareillée;it. muratura a ricorsi; sp. mampostería depiedras talladas.
Schichtwechsel, bei ordnungsge-mäßem Mauerverband ist in jezwei aufeinanderfolgenden Schich-ten auf den Wechsel der Stoßfugenzu achten, damit die Fugen zweierübereinanderliegender Schichtensich nicht entsprechen. Engl. alternating bands; it. sfalsamento deigiunti; sp. cambio de la junta vertical.
Schiebefenster, ein Fenster, beidem ein Flügel seitl. verschobenwerden kann. Der Begriff S. wirdheute aber auch für Fenster ver-wendet, deren unterer Flügel nach
Schere 414
oben gegen einen feststehendenoder sich herabsenkenden Flügelbewegt wird (Hebefenster). BeimSenkfenster wird hingegen der un-tere Flügel in die Zone der Fen-sterbrüstung bzw. des Fußbodensversenkt (→ *Fenster). Engl. sliding window; frz. fenêtre coulissan-te; it. finestra scorrevole; sp. ventana corre-diza.
Schiebeladen, Laden zum Ver-schluß einer Maueröffnung (Fen-ster), der im Gegensatz zum verti-kal bewegten Falladen horizontalverschiebbar ist (→ *Fensterladen). Engl. sliding shutter; frz. volet à coulisse;it. imposta scorrevole; sp. postigo corredizo.
Schiebetür, → *Tür mit horizon-tal zur Seite schiebbarem Türblatt. Engl. sliding door; frz. porte coulissante;it. porta scorrevole; sp. puerta corrediza.
Schieferdach, Schieferdeckung,Dachdeckung mit natürl. Schiefer-platten von 4�6 mm Dicke, dieDachneigung beträgt 1/4 bis 1/3der Gebäudetiefe. Das dt. S. isteifach oder doppelt gedeckt. DasEindecken erfolgt je nach der Pfet-tenseite von rechts nach links oderumgekehrt in schrägen Reihen(Scharen) auf einer dichten Holz-schalung, die auf die Sparren gena-gelt wird. Die schräge Lage derGebinde hat den Zweck, das Was-ser von einem Stein auf die Mitte
des anderen in dem nächst unterenGebinde abzuleiten. Zum First hinnehmen die Schieferplatten anGröße ab. Die sich 6�10 cm über-deckenden Platten werden mit je2�4 verzinkten Eisen- oder Kup-fernägeln auf der Schalung befe-stigt. Bei dem engl. S. liegen dieSchieferplatten auf einer Lattungauf, die Gebinde liegen parallel zurTraufe, die Platten sind in derRegel schindelartig oder rechteckigund werden auf den Latten mit jezwei Nägeln befestigt. Engl. slate roof; frz. toiture en ardoises;it. tetto d�ardesia; sp. tejado de pizarra.
Schießerker, Schußerker, Wehr-erker, erkerartiger, gemauerter oderhölzerner Vorbau mit Schießschar-ten, auch mit Senkscharten, ähnl.dem auf der Ecke angebrachtenund zumeist höheren → Schar-wachtturm. It. bertesca; sp. salidizo de tiro.
Schießscharte, ein schmaler Mau-erschlitz, meist in hoher Rechteck-
415 Schießscharte
Schießschartenformen
Schießscharte
form, mit unterer Ausweitung(Loch oder dergl.). Die S. kommenbei → *Wehrgängen, an Stadt-mauern, Stadttoren, Bergfrieden,Kirchenburgen u. dergleichen vor.Manchmal sind sie auch durch Bos-sen gerahmt und mit geschwun-genen Konturen ausgebildet. Engl. embrassure, loophole; frz. créneau;it. feritoia; sp. tronera, aspillera.
Schiff, Kirchenschiff, Innenraumin Langbauten, sprachl. mit demNaos des gr. und dem Navis (Cel-la) des röm. Tempels ident. Wäh-rend man von einschiffigen Kir-chen (Saalkirchen) sprechen kann,gibt es den Begriff des einschiffi-gen Raums im Profanbau nicht.Dagegen kann man von mehr-schiffigen Sälen auch bei profanenRäumen sprechen. Bei mehrschif-figen Anlagen heißt der mittlereRaum Mittels. (Haupts.), die seitl.,meist paarweise angeordneten undoft niedrigeren Räume Seitens.(Abseiten). Der obere Teil einesMittels. heißt bei → *BasilikenHochs. Das südl. Seitens. wirdmanchmal Männers., das nördl.
Frauens., die Langhauss., im Ge-gensatz zum Chor Laiens. genannt.Die einzelnen S. werden durchStützglieder (Säule, Pfeiler, manch-mal Stützenwechsel) getrennt undkönnen gleich hoch (Halle) oderverschieden hoch sein (Basilika,Pseudobasilika, → Staffelhalle). EinS. quer zum Haupts. heißt Quers.(Querhaus). Engl.; sp. nave; frz. nef; it. navata.
Schiffbrücke, Pontonbrücke, eine→ Brücke, die anstatt auf Pfeilernauf Schwimmkörpern oder Booten(Pontons) aufruht. Die S. wirdhauptsächl. bei militär. Unterneh-mungen verwendet, da sie bes.rasch montiert bzw. demontiertwerden kann. Die erste große S.wurde von Harpalos im Auftragedes Perserkönigs Xerxes über denHellespont gelegt. Engl. pontoon bridge, ponton b.; it. pontesu chiatte, p. su barche; sp. puente de pon-tones.
Schiffskehle, → Hohlkehle, derenEnden spitz zusammenlaufen, bes.an den Unterzügen von Balken-decken in der Gotik, Renaissanceund Barock.
Schifter, Schiftsparren, kurzesSparrenstück, das sich mit einemoder beiden Enden gegen einen Gratbzw. Kehlsparren lehnt (Kehls.,Doppels., → Grats.). Engl. creeping rafter, jack r.; frz. empanon,chevron de croupe; it. falso puntone; sp. tro-nera, aspillera.
Schikane, durch feste oder beweg-liche Hindernisse, durch abgewin-kelte oder verengte Führung desWegs behinderter Zugang zu einerBefestigung.
Schiff 416
Schiffa Lang-, Mittel-, Hauptschiffb, b1 Seitenschiffec Querschiff e Chorquadratd Vierung f Hochschiff
Schild, ein das Schlüsselloch(Runds.) umgebender oder Schlüs-selloch und Türschnalle (Langs.)zusammenfassender Beschlag. Engl. escutcheon; frz. écusson; it. scudo;sp. escudo.
Schildbogen, Schildgurt, der Bo-gen am Anschluß eines Gewölbesan die Mauer (Schildwand). Engl. formeret, wall rib; frz. (arc-) formeret;it. arco laterale, a. perimetrale; sp. arco ennicho.
Schilderhaus, kleines, dem Po-sten als Wetterschutz dienendesHolzgebäude, häufig neben demTor oder auf Brücken. Engl. sentry box; frz. guérite, échauguette;it. garitta; sp. garita.
Schildgurt → Schildbogen.
Schildmauer, Stirnmauer, 1.Mauer unter einem Schildbogen(→ *Gewölbe). 2. Hohe Schutz-mauer einer → *Burg, die an derStelle angeordnet ist, an der dasGelände höher ansteigt. Engl. curtain wall; frz.mur de clôture, m.bouclier; it. muro frontale, braga; sp. 1. mu-ro bajo el arco en nicho, 2. muro frontal.
Schildrippe, eine Wandrippe ander Schildmauer (→ Schildmauer 1)eines Gewölbes. Engl. wall rib; frz. nervure de formeret; it.costolone; sp. nervio de formero.
Schildwand → Schildmauer 1.
Schindeldach, → *Dachdeckungaus gespaltenen Holzschindeln.Ein S. wird auf Schalung verlegt.Schindeln, die nicht genagelt, son-dern bei flacher Dachneigung nurdurch Steine beschwert sind, wer-den Legschindeln genannt. Engl. shingle roof; frz. toit en bardeaux;it. tetto coperto di scandole; sp. tejado debardas, t. d. ripias, t. d. tablillas, t. d. tejuelas.
Schirmgewölbe, Schirmkuppel,Flachkuppel auf fächerförmigemGrundriß mit gebusten Kappenzwischen Graten oder Rippen, dieden Eindruck geblähter Segel (Se-gelkuppel) vermitteln; zu unter-scheiden von → Fächergewölbe(→ Faltkuppel). Engl. umbrella vault, u. dome; frz. voûte enforme de parasol; it. volta a ombrello; sp. bó-veda en paraguas.
Schlagladen, Fensterladen mittürähnl., senkrecht in Angelngefaßten Flügeln, die außen oderinnen gegen den Fensterrahmenoder in einen entsprechenden Falzschlagen, seit dem 12. Jh. nachge-wiesen, zunächst nur nach innenzu klappen, als Außenläden selten,erst im 19. Jh. wird der äußere S.üblich. Engl. hinged (window) shutter; frz. volet(pliant), judas; it. imposte ribaltabili; sp. pos-tigo rebatido.
Schlagleiste, mittlere Deckleistebei zweiflügeligen Fenstern oderTüren (→ *Anschlag). Engl. baffle plate; frz. battement; it. copri-battuta; sp. batiente.
Schlangensäule, eine aus mehre-ren miteinander verschlungenen
417 Schlangensäule
Rundschild Langschild
Schäften bzw. Leibern bestehende→ *Säule. Engl. serpent column; frz. colonne torse;it. colonna a balaustra; sp. columna balaus-trada.
Schleierwerk, eine Sonderformdes → *Maßwerks, das im Ge-gensatz zum Blendmaßwerk freieiner geschlossenen Wand, einem→ *Giebel oder einer Öffnung mitkleinerem Querschnitt vorgeblen-det ist. Engl. blind tracery; frz. rideau de pierre;sp. tracería velada.
Schleifzapfen, zum nachträgl.Einbringen von Verstrebungshöl-zern mit schräg zum Zapfenlochzulaufender Schleifnut und ver-kürztem Zapfen (→ Jagdzapfen).
Schleppdach, eine → *Dachform,die die Dachfläche des Hauptdachsüber einem Anbau oder über einerVorfahrt fortsetzt. Engl. shed roof; frz. toit en appentis, combleen potence; sp. tejado voladizo a simple ver-tiente.
Schleppgaupe, ein stehendes→ *Dachfenster mit Schleppdach. Engl. dust-pan dormer, shed d.; frz. chatière,tabatière; it. abbaino; sp. buhardilla contejado en voladizo.
Schlingrippengewölbe, Bogen-rippengewölbe, → *GewundeneReihung, spätgot. Ziergewölbe,dessen Rippen dreidimensionaleKurven bilden. Engl. looped vault; sp. bóveda de nerviosentrelazados.
Schlippe, in ma. Städten schmaleGasse zwischen den Häusern, umdas Übergreifen des Feuers bei
Bränden zu verhindern (Brandgas-se). Engl. slype; frz. tour de chat, ruelle; it. viuz-za, vicolo; sp. callejuela cortafuegos.
Schlitzfenster, schmale, hoch-rechteckige Maueröffnung mitabgeschrägter Innenlaibung zurBelichtung und Belüftung vonuntergeordneten Räumen, z. B.Keller, Untergeschoß, Neben-gebäude, oder von Treppen undTurmräumen. Nicht zu verwech-seln mit Schlitzscharten. Engl. oylet; frz. archière, embrasure; it. feri-toia; sp. ventana rasgada para ventilación yluz.
Schlitzung, Holzverbindung anEcken, vornehml. bei Schwellen-kranz; in die schlitzartige Ausar-beitung am Balkenkopf greift derim rechten Winkel anstoßendeBalken mit seinem die ganze Holz-breite einnehmenden Zapfen ein.
Schloß, als Beschlag zum Schlie-ßen von Türflügeln, zunächstSchubriegel, Fallriegel; zum Öff-nen dienten schlüsselartige Hebel,die durch ein Loch hindurchge-steckt wurden und durch die derStift oder Fallriegel angehobenwurde. Seit der Antike bekannt.Eine weitere Entwicklung erfolgteseit dem 13. Jh. bis zu den kompli-zierten Sicherheitsschlössern derNeuzeit. Engl. lock; frz. serrure; it. serratura; sp. ce-rradura.
Schloßbau, die verwandten Be-griffe Schloß und Burg überschnei-den sich, wobei häufig Grenzfälleauftreten. Während man unter derBurg immer ein stark befestigtesGebäude versteht, kann das reprä-
Schleierwerk 418
sentative Schloß auch unbefestigtsein. Die unbefestigten S. habenaber oft noch Ecktürme, die späterverkümmern oder durch Dacherkernur angedeutet werden. Das Schloßkann wie die Burg einen Hof ha-ben, der in der Barockzeit an derEingangsseite offen ist (→ Courd�honneur, → *Corps de logis),während auf der anderen Seite derachsial auf das Schloß bezogeneGarten liegt. Engl. palace; frz. château; it. castello; sp. cas-tillo, palacio.
Schloßkapelle, die Kapelle einesSchlosses. Engl. palace chapel, castle c.; frz. chapelleseigneuriale; it. cappella del castello; sp. ca-pilla de un castillo.
Schlot, gemauerter Rauchabzugs-schacht (→ *Schornstein), speziellbei Fabrikanlagen. Engl. smokestack; frz. cheminée; it. fu-maiolo, ciminiera; sp. chimenea.
Schlüssellochfenster, eine →*Fensterform mit reich bewegtem,
einem Schlüsselloch ähnl. Umriß,hauptsächl. in der rhein. Spätroma-nik vorkommend. Engl. keyhole window; it. finestra a toppa;sp. ventana con forma de ojo de cerradura.
Schlüsselscharte, vertikale →*Schießscharte mit einer rundenÖffnung, bes. für Handfeuerwaf-fen.
Schlußstein, Scheitelstein, 1. Steinim Scheitelpunkt eines → *Bogens,falls keine Scheitelfuge vorhandenist. 2. Stein am Hauptknotenpunktder Rippen eines → *Gewölbes. DieRippenquerschnitte sind noch teil-weise an den meist kreisrundenund figurierten S. angearbeitet.Seltener kommt der ringförmige S.
419 Schlußstein
Schloßbau(Beispiel: Chambord, Schloß, 16. Jh.)
Schloßkapelle(Beispiel: Schmalkalden, Schloß, 16. Jh.)
Schlußstein mit offenem Scheitelloch
mit offenem Scheitelloch vor, wäh-rend der hängende S. (→ *Ab-hängling 1) eine Sonderform ist. Engl. apex stone, keystone; frz. clef d�arc, c.de voûte; it. serraglia, chiave d�arco, c. divolta; sp. piedra angular, clave de arco.
Schmiege, aus einfacher Schrägebestehendes Profil von Gesimsenund Kämpfern oder eine zu einerschrägen, gekehlten Fläche abgear-beitete Kante (→ *Fase). Engl. bevel, chamfered moulding; frz. anglechanfreiné, chanfrein; it. smusso, smussa-tura; sp. bisel, chaflán, ángulo achaflanado.
Schnabel, an der Angriffsseite ei-nes Turms angebaute, keilförmigeMauerverdickung als Apprallschrä-ge für Geschosse. Engl. bill, beak, nozzle; frz. bec; sp. pico,engrosamiento cuneiforme de un muro de-fensivo.
Schnabelturm, Wehrturm, deran der Angriffsseite durch einen→ Schnabel verstärkt ist.
Schnecke, 1. spiralförmig gewun-denes Ornament, bes. die Voluteneines ion. oder korinth. Kapitells,häufig mit einer Scheibe im Zen-trum (S.auge). 2. Eine spiralförmigansteigende Treppe (→ *Wendel-treppe). Engl. volute, scroll; frz. volute, corne debélier, limaçon; it. voluta; sp. 1. voluta, 2.escalera de caracol.
Schneckenauge, 1. kleine, rundeScheibe im Zentrum der Volutedes ion. Kapitells (→ Auge 2). 2.Lichtspindel einer → *Wendeltrep-pe (→ Auge 4). Engl. centre of the Ionic volute; frz. �il devolute; it. occhio di voluta, centro della v., s.1. centro de la voluta, 2. pozo de una esca-lera de caracol.
Schneckengewölbe, Spindelge-wölbe, Spiralgewölbe, das denspiralförmigen Lauf einer → Wen-deltreppe unterbaut, meist einesteigende Ringtonne (→ *Gewöl-beformen). Engl. spiral vault; frz. voûte en limaçon,tonnelle helicoïdale; it. volta a chiocciola;sp. bóveda de caracol.
Schneckenstiege, -treppe →*Wendeltreppe.
Schneefang, Schneegitter, Vor-richtung, die das lawinenartige Ab-rutschen von Schnee auf den Dä-chern verhindern soll, entweder alsLatte oder als Gitter traufenparallelan Schneehaken befestigt. Frz. pare-neige; it. paraneve; sp. retenedorde nieve.
Schneuß, Fischblase, Mouchette(engl. Karnieshobel), ein Zwei-blatt, bei dem ein Blatt kürzer alsdas andere ist; häufig ist dasKleinere kielbogenartig ausgebil-det, und die Nasen kommen sehreng zusammen. Das S. kann auchS-förmig geschwungen sein und soeiner Fischblase ähnl. sehen. DreiS. in einem Kreis zusammenge-
Schmiege 420
Schornsteina gezogener Schornstein b Ziehung
c Schornsteinkopf
stellt ergeben eine Wirbelform, dasDreis. Im spätgot. Maßwerk seitAnfang des 14. Jhs. in England,Frankreich und Deutschland weitverbreitet. → *Maßwerk. Engl. bladder ornament, mouchette;frz. flamme; it. vescica di pesce; sp. traceríaburbuja de pez.
Schnürboden, 1. ebener, waage-rechter, zumeist hölzerner Boden,der zum Aufschnüren von Zimmer-manns- und Schreinerarbeiten innatürl. Größe dient. 2. → Ober-bühne. Frz. 1. chantier de cinglage, aire (de tra-çage); it. 1. piano di tracciamento, 2. soffit-ta del palcoscenico; sp. telar.
Schopfwalm, abgewalmte Giebel-spitze, bei der der kleine Walm
nicht in die Dachkonstruktion ein-greift, sondern vor der Giebelflä-che auskragt. Engl. half hip roof; frz. demi-croupe; sp. co-pete del frontón.
Schornstein, Rauchfang, Schlot(manchmal auch mundartl. fälschl.Kamin), gemauerter Rauchabzugs-schacht, der an der Außenmauer, anInnenwänden, meist jedoch an derMittelmauer und an Brandmauernerrichtet ist. Der Teil über derDachhaut heißt S.kopf (Kamin-kopf). S. können auch zu Gruppenzusammengefaßt oder architekton.gegliedert sein. Die Schrägführungeines S. nennt man Ziehung (gezo-gener S.). Engl. chimney; frz. cheminée; it. camino;sp. chimenea.
421 Schornstein
1 Dreischneuß 2 Sechsschneuß um ein Sechsblatt3 Vierschneuß 4 Vierschneuß um ein Vierblatt
Schneuß
Schornsteinaufsatz, Aufsatz,meist eine Röhre, über demSchornsteinkopf, um die Zug-wirkung des Schornsteins zu ver-bessern, in früherer Zeit oft archi-tekton. reich gegliedert. Engl. chimneyhead; frz. mitre; it. mitra;sp. capuchón, sombrerete.
Schoßrinne → Abweiseblech.
Schräggesims, Kaffgesims, Ge-sims mit schräger Abdeckung, vor-nehml. bei got. Bauten (→ *Gesims-formen). Engl. oblique cornice; it. cornice a spioven-te; sp. moldura oblicua.
Schrägriß, frontale Axonometrie,aus Grund- oder Aufriß entwickel-te schiefaxonometr. Darstellungeines Objekts bei beliebiger Blick-richtung. Der Kavalierriß entstehtdurch Auftragen der Tiefenmaßevor dem Aufriß, der Militärrißdurch Auftragen der Höhenmaßeüber dem Grundriß (→ *Projek-tion). Engl. oblique projection; it. assonometriacavaliera frontale; sp. proyección axonomé-trica oblicua.
Schrägschar, eine Reihe schräg-liegender Backsteine bei gewissenMauer- oder Gewölbeverbänden(→ *Ährenwerk).
Schranne, mit Schranken oderGittern eingefaßter Ort, bes. Markt-halle.
Schrein, hölzerner Behälter. DerBegriff wird vornehml. für be-stimmte Behälter (Reliquiens., Hei-ligens., Kastenaltar), vor allem aberfür den s.artigen Mittelteil eines→ *Flügelaltars verwandt. Engl. shrine; frz. écrin, châsse; it. scrigno;sp. relicario.
Schub, Seitenschub, horizontaleKomponente eines Kraftverlaufs in-nerhalb des Mauerwerks, der durchGewölbe oder durch Dachkon-struktionen hervorgerufen wird.Man begegnet dem S. durch Ver-stärkung des Mauerwerks (Strebe-mauern, Strebepfeiler, → *Strebe-werk, Strebe- und Schwibbogen)oder im Innenraum durch An-ordnen von → *Ankern. Engl. push, thrust; frz. poussée; it. spinta;sp. empuje, presión.
Schuh, unten angesetzter Teil ei-nes stehenden Holzes oder dessenMetallfassung (→ Anschuhung). Engl. shoe, sheath; frz. sabot; it. scarpa;sp. zapata.
Schulter, im Festungsbau die vonFace und Flanke gebildete Spitze(Schulterwehr, → Traverse). Engl. shoulder; frz. épaule; it. spalla; sp. es-paldas.
Schulterbogen, Konsolbogen,Kragsturzbogen, → *Bogenform,bei der der mittlere Kreisbogen
Schornsteinaufsatz 422
Schornsteinaufsatz
durch einen waagerechten Sturz er-setzt ist und die beiden seitl. aus-kragende Konsolsteine sind. Engl. shouldered arch; frz. (arc en) (pate-)bande surhaussée; it. arco a spalla; sp. arcosobre almohadillas.
Schuppen, ein in leichter Bauwei-se errichtetes Bauwerk zur Lage-rung und Unterbringung von Ge-genständen, manchmal an eineroder mehreren Seiten offen. Engl. shed; frz. remise, appentis; it. rimessa,tettoia; sp. cobertizo.
Schuppenfries, ein aus schuppen-ähnlichen Elementen bestehender→ *Fries der ma. Baukunst. Engl. scale frieze; frz. frise en écailles, it. fre-gio a squame; sp. friso en escamas.
Schurz, 1. unterer, vorstehenderTeil eines weit ausladenden Dachs,auch als kurze, senkrechte, vonoben herabhängende Verkleidung.2. Beim Kamin die als Rauchfangdienenden, schräggeführten, in den
Raum über der Feuerstelle hinein-hängenden Flächen. → *Kamin. Engl. apron; it. 1. sporgenza del tetto, 2.falda della cappa (del camino); sp. 1. reves-timiento de techo, 2. campana de la chime-nea.
Schutzdach, Vordach, meist einSchleppdach zum Schutz von Ein-gängen u. dergl. (→ *Dachformen).Engl. protecting roof; frz. abri, auvent; it. tet-toia; sp. alero.
Schutzkuppel, äußere Schale ei-ner zweischaligen → Kuppel odereine über einer Kuppel liegendezweite Kuppel, die als Wetterschutzdient. Engl. outer dome, exterior dome; frz. cou-pole extérieure, dôme extérieur; it. cupolaesterna; sp. cúpula protectora exterior.
Schwäbisches Weible, Strebe-konstruktion aus Ständer, Kopf-und Fußbändern, die sich nicht inhalber Höhe treffen, im südwestdt.Fachwerkbau des 15. /16. Jhs. ver-breitet.
423 Schwäbisches Weible
Schwarzwaldhausa Kücheb Stubec Stall
Schwalbenschwanz, 1. trapez-förmige Ausbildung zur zugfestenVerbindung zweier Hölzer, bei derder Ansatz schmäler ist als dasKopfende. 2. Tenailliertes Außen-werk (→ Tenaille). 3. S.verband,Gewölbeverband mit schrägge-stellten Schichten (Schrägschar),die V-förmig aufeinander treffen;dadurch konnte das Einwölbenvon Kreuzgewölben, preuß. undböhm. Kappen und Stichkappenfreihändig ohne Schalung nur miteinem Lehrbogen erfolgen. Engl. dovetail; frz. queue d�aronde; it. coda dirondine; sp. ensambladura a cola de milano.
Schwarzwaldhaus, Sonderformdes alemann. Einhauses. Das S.steht meist am Hang, wodurch ei-ne bequeme Einfahrtsmöglichkeitin die oberen Teile der → Tenne(Hochtenne) ermöglicht wird. Imvorderen Teil befinden sich imErdgeschoß die Ställe, im Ober-geschoß Wohnräume, vor denenHolzgalerien liegen. Das urspr.strohgedeckte S. hat ein Krüppel-walmdach, das an den Langseitenfast bis auf Geländehöhe herunter-geführt ist. (Abb. S.423)
Schwebeblatt → Ständerfußblatt.
Schwebebogen → *Schwibbogen.
Schwebegiebel, giebelseitig vor-kragende Sparren werden am Fußdurch einen auf dem vorkragendenRähm liegenden, in sich unver-rückbaren Dreiecksverband, demFlugsparrendreieck (Schweiz) oderSparrenknecht, gehalten.
Schweifwerk, eine dem → *Be-schlagwerk verwandte Dekorations-form der Frühbarockzeit, deren
Charakteristikum einzelne am En-de eingerollte Formen (Rollwerk)sind. Engl. scrollwork; frz. redents; it. fastigiocomposito; sp. adornos de voluta, resalto.
Schwelle, das untere Querholz des→ *Fachwerkbaus (Bunds.) odereines Türstocks (Türs.). Auch dieeinzelnen Elemente eines hölzer-nen Rosts bei schlecht tragendemBaugrund heißen S. Engl. sill; frz. sablière, seuil; it. soglia; sp. tra-viesa.
Schwellenriegel, eine zwischendie Ständer gezapfte → Schwelle.
Schwertriegel, aufgeblatteter übermehrere Ständer reichender Brust-riegel.
Schwertung, an mehrere kon-struktive Hölzer angeblattete Boh-le, zumeist schräg verlaufend, auchals angeblattetes Vollholz vorkom-mend (→ Schwertriegel).
Schwibbogen, Schwebebogen,waagrecht gespannter Bogen (→ Bo-gen II) zur Übertragung des Ho-rizontalschubs zwischen zwei Ge-bäuden, meist über engen Gassen. Engl. pier arch, straining a.; frz. arc-boutant,arc diaphragme; it. arco rampante, fornice,cavalcavia; sp. arco de tensión.
Schwalbenschwanz 424
Schwibbogen
Schwingflügeltür, Pendeltür, →*Tür mit nach beiden Seiten aus-schwingenden Türblättern. Engl. swinging door; frz. porte va-et-vient,p. oscillante; it. porta a vento (a due batten-ti); sp. puerta oscilante de dos hojas.
Schwingrippe, geschwungene,kurvig geführte Rippen, die einSchwingrippengewölbe oder ein→ Schlingrippengewölbe bilden.
Scriptorium (lat.), Schreib- undStudierzimmer in einem → Kloster.
Sebil (arab.), Brunnen. Bedeu-tende Brunnenanlagen mit weitvorspringendem Dachschirm ha-ben vor allem türk. Städte. Sp. fuente turca.
Seccomalerei (it.), im Gegensatzzur Freskomalerei eine Wandma-lerei auf trockener Putzfläche. Engl. secco painting; frz. peinture à secco;it. pittura a secco; sp. pintura en seco.
Sechsort, eine Symbolfigur, die ausder Durchdringung zweier gleichgroßer gleichseitiger Dreiecke ent-steht, deren Spitzen die Eckpunkteeines regelmäßigen Sechseckesmarkieren. It. esagramma; sp. hexagrama.
Sechsteiliges Gewölbe, eine →Gewölbeform, hauptsächlich desÜbergangsstils, bei der außer denvier Kreuzrippen noch zwei weite-re Rippen quer zur Längsachseverlaufen, so daß sechs Kappenentstehen (→ *Wandaufbau). Engl. sexparte vault; frz. voûte hexagonale;it. volta esapartita; sp. bóveda hexagonal.
Secondeflanke (frz.), zusätzlicheFlankierungslinie im Festungsbau,die u. a. im Mittelteil der Kurtinedurch etwa rechtwinklige Rück-wärtsbrechung der Kurtine ent-steht, bes. in Vaubans zweiter unddritter Manier vorkommend.
Secretarium (lat.), Nebenraumdes Chors sowie der → Pastopho-rien.
Sedile (lat.), allgemein fester Sitz,bes. der Abts- oder Bischofsstuhl,auch Chorgestühl, Dreisitz, Levi-tensitz.
Seelhaus, Bezeichnung für einma. Mietshaus, auch Zinshaus ge-nannt (Wien), häufig als Hinter-haus eines Anwesens.
Segelgewölbe, Schirmgewölbe,Gewölbe mit segelartig geblähtenKappen zwischen den Graten oderRippen einer → Kuppel. Engl. sail vault; frz. voûte en forme de para-sol; sp. bóveda con forma de quitasol.
425 Segelgewölbe
Türkischer Sebil (Ansicht und Schnitt)
Sechsort
Segmentbogen, Flachbogen,Stichbogen, eine → Bogenform,deren Kontur von einem Kreisseg-ment gebildet wird. Der Kreisaus-schnitt ist kleiner als beim Halb-kreisbogen (Rundbogen), bei rela-tiv großem Kreisdurchmesser undrelativ kleinem Ausschnitt näherter sich dem scheitrechten Sturz. Engl. segmental arch; frz. arc bombé, a. seg-mentaire; it. arco (a sesto) ribassato; sp. arcorebajado.
Segmentfenster, Fensterform,deren Öffnung durch einen Seg-mentbogen abgeschlossen wird. Engl. segmental window; it. finestra ad arcoribassato; sp. ventana con arco rebajado.
Segmentgiebel → *Giebel mitsegmentbogenförmigem Abschluß. Engl. segmental gable; it. frontone ad arcoribassato.
Seildach, Hängedach, durchhän-gendes Dach, dessen Konstruktionnur auf Zug beansprucht wird. Dielichte Höhe des darunterliegendenRaumes nimmt nach der Raum-mitte ab (→ *Dachformen). Engl. cable (-suspended) roof; frz. toit sus-pendu à câbles; it. copertura a vela in tensio-ne; sp. techo colgante suspendido por cables.
Seiler → Dachkehle.
Seilkonstruktion, Seilnetzkon-struktion, Seiltragwerk, ein ausZugelementen bestehendes, hän-gendes Tragwerk ohne Biegespan-nungen und dadurch geringererMaterialaufwand als bei einer Scha-lenkonstruktion. Die über Pylonegeführten Seilzüge müssen in Wi-derlagern im Erdreich oder Funda-ment verankert werden. ÄltesteKonstruktionen sind die Hänge-brücken aus Lianen in tropischenGebieten und die Sonnensegel in
röm. Amphitheatern. Die Erfin-dung des Flußstahls 1883 ermög-lichte große an Kabeln aufgehängteBrücken. In den 1950er Jahren wur-den freischwebende Hängedächerauf der Grundlage von Seilnetzenentwickelt, die mit Holz-, Metall-oder Kunststoffplatten als Dach-haut belegt werden. → Hängedach. Engl. rope construction, cable c.; frz. con-struction à câbles; it. tensostruttura; sp. con-strucción en malla de cables.
Seitenaltar, Nebenaltar, Altar ne-ben dem Hochaltar, meist zu beidenSeiten des Langhausabschlussesoder am Ostende der Seitenschiffe. Engl. side altar; frz. autel subordonné;it. altare laterale; sp. altar lateral.
Seitenflügel, Seitentrakt, oft paar-weise an einen Hauptbaukörperangeschlossene Flügel (→ *Corpsde logis). Engl. side wing; frz. aile; it. ala laterale;sp. ala lateral.
Seitenportal, Portal an der Sei-tenfront einer Kirche, bei mehre-ren Portalen an der → Fassade auchdie Eingänge seitl. des → Haupt-portals (→ *Turmfassade). Engl. side portal; frz. portail latéral; it. por-tale laterale; sp. portal lateral.
Seitenrisalit, Eckrisalit, im Ge-gensatz zum Mittelrisalit ein seitl.→ *Risalit, an den Enden eines Bau-körpers. Engl. lateral protruding façade bay;frz. avant-corps latéral; it. risalto laterale,avancorpo l.; sp. resalto lateral.
Seitenriß, Seitenansicht eines Ob-jekts (Bauwerk, Bauteil etc.) inNormalprojektion (→ *Projektion).Engl. side elevation; frz. projection latérale;it. proiezione laterale, prospetto l.; sp. planolateral.
Segmentbogen 426
Seitenschiff, Abseite, seitl., meistzu beiden Seiten des Mittelschiffsangeordnete Raumteile, durchWandöffnungen (Arkaden und der-gleichen) mit letzterem verbunden(→ *Schiff). Engl. aisle; frz. basse-nef, nef latérale; it. na-vata laterale; sp. nave lateral.
Seitenschub, Schub, horizontaleResultierende einer Gewölbekraft(→ *Bogen). Engl. lateral thrust, horizontal drift; frz.poussée oblique, p. horizontale, p. latérale;it. spinta laterale; sp. empuje lateral.
Sekos (gr.), Barkenkammer, dasAllerheiligste des ägypt. Tempels,in dem das Götterbild meist auf ei-ner Barke stand (→ *Tempelbau 2).
Selamlik (arab.), Männerabteilungdes islam. Hauses, vom Haremstreng abgesondert, auch Begrü-ßungs- und Empfangsraum.
Senana (ind.), Frauenteil des ind.Wohnhauses.
Senkfenster, Sonderform einesSchiebefensters, bei der man denFlügel in die Brüstungszone oderin den Fußboden versenken kann(→ *Fenster).
Senkscharte, schräg nach untengerichtete Schießscharte zum Schie-ßen oder Gießen von heißemWasser oder Pech (→ Maschikuli). Frz. mâchicoulis; it. caditoia, piombatoia;sp. matacán.
Sentinelle (frz.), Postenerker,Eskarpenerker, Schildwachthaus,Türmchen, das zur gedeckten Be-obachtung auf der Wallhöhe an denausspringenden Winkeln der Es-carpe, in der Regel über Konsolen
vorkragend, aufsitzt (→ Schar-wachtturm). Frz. sentinelle; it. sentinella; sp. salidizo paracentinela.
Sepulcrum (a mensa) (lat.), ein ineiner rechteckigen Nische aus demStein ausgehauenes Katakomben-grab mit liegender Deckplatte,dann auch das Reliquiendeposi-torium im Altar, entweder in derMensaplatte oder in der Stipes.
Sepultur → Mortuarium.
Serail, Serai (arab.), Palast, späterauch Frauenteil eines Palasts (Ha-rem). Engl. seraglio; frz. sérail; it. serraglio; sp. se-rallo, harem/harén.
Serapeum, Serapeon (gr.), Heilig-tum des Gottes Serapis, der spätermit dem ägypt. Apis-Stier gleichge-setzt wurde. Der Kult wurde auchvon den Römern und Griechenübernommen.
Serdab (pers.), Kellerraum, einunterird. Raum der ägypt. Ma-staba, in dem Statuen des Totenaufbewahrt wurden.
Serliana → Palladio-Motiv.
Setzfuge, eine Baufuge, die Riß-bildungen infolge ungleicher Set-zungen des Baugrunds verhindernsoll. Engl. settlement joint; frz. joint de tasse-ment; it. giunto di assestamento; sp. juntade asentamiento.
Setzholz, feststehender Mittel-pfosten eines → *Fensters (→ *An-schlag). Engl. window post, mullion; frz. meneauvertical de bois; it. montante di croce difinestra; sp. entreventana.
427 Setzholz
Setzstufe, das zwischen zweiTrittstufen einer Holztreppe einge-setzte, senkrechte Brett (→ *Trep-pe, → *Stufe). Engl. riser; frz. contre-marche; it. alzata;sp. contrahuella, tabica.
Sgraffito, Kratzputz, Putz ausmehreren farbig getönten Schich-ten. Durch Abkratzen der oberenSchichten stößt man auf die an-dersfarbigen unteren Schichten,wodurch man architekton., figürl.oder ornamentale Dekorationenvon großer Haltbarkeit erzielenkann. Engl. sgraffito; frz. sgraffite; it. graffito; sp. es-grafiado.
Sheddach → *Dachform aus paral-lelen, einhüftigen Satteldächern,deren steilere Flächen verglast sind,bes. bei modernen Fabrik- und Aus-stellungshallen. Engl. shed roof, sawtooth r.; frz. comble àshed, toit shed; it. tetto a shed, tetto a rise-ga; sp. techo de armazón tinglado.
Sherefeli (türk.), Umgang für denGebetsrufer am → *Minar einertürk. Moschee.
Sichelbogen, anschwellenderRundbogen, seit der Renaissanceals Florentin., Toskan. oder Siene-ser Bogen vorkommend. Frz. arc florentin, a. toscan; sp. arco falcifor-me.
Sichtbeton, auf Sicht berechneterund durch ausgewählte Zuschlag-stoffe und Schalung gestalteterBeton, bes. in den 1950/60er Jah-ren im Betonbau als Gestaltungs-mittel eingesetzt. Engl. fair-faced concrete, exposed c.; frz. bé-ton apparent; it. calcestruzzo faccia a vista;sp. hormigón a la vista.
Siechenhaus → Firmarie.
Siegessäule, monumentale Säulezur Erinnerung an einen Sieg, miteiner Plastik bekrönt und mitReliefs geschmückt (→ *Triumph-säule). Engl. triumphal column; frz. colonne tri-omphale, c. de triomphe; it. colonna trion-fale, c. della vittoria; sp. columna triunfal.
Siegestor, Ehrenbogen zur Erin-nerung an einen Kaiser (→ Tri-umphbogen 2). Engl. triumphal gate; frz. porte de la vic-toire; it. porta trionfale; sp. puerta triunfal.
Sikhara, Nagara (ind.), Turm überder Cella eines ind. Tempels (S.und Cella bilden das Vimana). DasS. kann in verschiedenen Ausfüh-rungen als Turm mit meist ungera-der Stockwerkzahl (→ *Pagode),als konvexer Turm, als Turm mitvertikaler Streifung oder mit acht-eckigem Grundriß (Dravidha) auf-treten und ist mit einem Wulst
Setzstufe 428
Sikhara(Beispiel: Bhuvanesvar, Rajarani-Tempel,
17. Jh.)
(→ Amalaka) und mit einem vasen-förmigen Aufsatz (Kalasa) bekrönt.
Sima (gr.), → *Rinnleiste der dor.,der ion. und anderer antiker Ord-nungen.
Sims → *Gesims.
Simsbrett, Fensterbrett (→ *Fen-ster).
Sinterzeug → Steinzeug, → Klin-ker.
Sinwellturm, alte Bezeichnungfür einen runden Turm, zumeistauf Burgen.
Sistrum-Säule, Hathor-Säule,Säule mit blockförmigem Aufsatzüber einem Hathorkapitell (→ *Ka-pitell).
Skelettbau, Gerippebau, eine Bau-weise, bei der im Gegensatz zumMassivbau alle tragenden Funk-tionen auf ein System tragfähigerGlieder, für die der Kräfteverlaufformbildend und maßgebend ist(Skelett), beschränkt werden. DieFunktionen des Raumabschlusseswerden gegebenenfalls von nicht-tragenden Füllungen übernom-men. Als Material eignen sich Holz(→ *Fachwerkbau), Stahl, Stein(→ *Strebewerk) und Stahlbeton.Das Skelett kann außen sichtbarsein (wie z. B. bei den got. Kathe-dralen) oder von einer meist vorge-hängten Fassade verdeckt werden(→ *Vorhangfassade). Allen Ske-lettbauten liegen Rastersystemezugrunde (→ *Raster). → Stahl-skelettbau. Engl. skeleton construction; frz. construc-tion en ossature (portante); it. costruzionecon struttura a scheletro; sp. construccióncon estructura de entramado.
Skene (gr.), Bühnenrückwand desgr. Theaters (→ Bühne).
Skulptur, dreidimensionales Bild-hauerwerk, das aus hartem Mate-rial herausgeschlagen oder heraus-geschnitten wird, ungenau auchauf bildnerisch, weiches Material(Ton, Bronze usw.) angewandt; inVerbindung mit Architektur in derRegel die selbständigen, dem Bau-werk angefügten Figuren im Unter-schied zu rein ornamentalen, relie-fierten Werken, die plast. Ornamen-te genannt werden. → *Bauplastik. Engl., frz. sculpture; it. scultura; sp. escultura.
Sockel, der Unterbau eines Ge-bäudes, einer Säule oder einer Sta-tue (→ *Postament, Piedestal). Engl. pedestal; frz. socle, piédouche; it. zoc-colo; sp. zócalo.
Sockelgeschoß, als Gebäudesok-kel ausgebildetes und stärker be-tontes → *Geschoß, bei manchenFassadengliederungen (Kolossal-ordnung) mit dem Erdgeschoßident. (→ *Fensterverdachung). Engl. basement level; it. piano basamentale;sp. piso base.
Sockelgesims → *Gesims, dasden Sockel oder das Sockelgeschoß(→ *Geschoß) abschließt. Engl. base moulding; frz. chanfrein desocle; it. cornice basamentale; sp. molduradel zócalo.
Sockelleiste, Fußleiste, → *Leistezwischen Fußboden und Innenputz.(Abb. S.430)Engl. baseboard; frz. plinthe, antébois; it. bat-tiscopa; sp. listón del zócalo.
Soffitte (it.), 1. Untersicht einerDecke. 2. Teil einer Theaterde-
429 Soffitte
koration, der den Einblick in dieOberbühne verhindert. 3. Lange,schmale Beleuchtungskörper, uspr.nur zur Beleuchtung von S. 2. Engl. soffit; frz. soffite; sp. 1. parte inferiordel cielorrazo, 2. sófito.
Sohlbank, Fensterbank, untererAbschluß eines → *Fensters, meistaus Stein. Die S. muß nach vornegeneigt sein, über das Mauerwerküberstehen und eine Wassernaseerhalten, am hinteren Ende läuftein Falz, auf dem der Fenster-rahmen aufsitzt. Innen wird die S.durch das Fensterbrett abgedeckt. Engl. window sill; frz. banquette, appui defenêtre; it. davanzale; sp. solera de la ven-tana.
Sohlbankgesims, Fensterbank-gesims, ein → *Gesims, das unterder Fensteröffnung durchläuft. Engl. sill cornice; it. cornice marcadavanza-le; sp. cornisa de la solera de la ventana.
Sohlgraben, Graben mit U-för-migem Profil.
Solarium (lat.), hochliegendesZimmer, das von der Morgen- undAbendsonne beleuchtet wird. Engl. solar; frz. solaire; it. solario; sp. sola-rium.
Solitude (frz.), häufiger Name fürLustschlösser des 18. Jhs., die ein-sam gelegen und zumeist einge-schossig waren; sie dienten Aus-flugsaufenthalten der Herrscher. Frz. solitude; sp. palacio de recreo.
Söller → *Altan, ein unterbauter,nicht überdeckter Austritt in einemObergeschoß im Gegensatz zu demauskragenden und überdeckten Er-ker. Engl. gallery; frz. plate-forme; it. altana;sp. azotea, terrado.
Sonnenblende, vor die Fenstergehängte oder über den Fensternauskragende, den direkten Sonnen-einfall verhindernde Konstruktion,bes. beim modernen Büro- undSchulbau. Engl. sun-blind; frz. brise-soleil, paresoleil;it. parasole; sp. quitasol, sombrilla.
Sonnenheiligtum, Sakralbau desAlten Reiches Ägyptens, bestehendaus Aufweg, Altar mit Opferplatteund Obelisk. Engl. sun sanctuary; sp. santuario del sol.
Sonnenladen, ein hölzerner mitLamellen versehener Fensterladen
Sohlbank 430
Sockelleiste
Sonnenheiligtum(Beispiel: Abu-Gurab-Abusir,
5. Dynastie)
(Fensterblende), der zum Schutzvor Sonneneinstrahlung außen vordie Fensteröffnung geklappt wird. Engl. sunshade, sun blind; frz. persienne;it, sp. persiana.
Sonnensegel, Segel als Sonnen-schutz in einem röm. → *Am-phitheater. Die S. wurden mittelsTauen an den Masten befestigt, dieam oberen Teil der Umfassungs-mauern aufgesetzt waren. Das S.hing in der Art eines Seildachsnach unten durch und hatte in derMitte über der Arena eine Öffnung(→ *Säulenbogenstellung). Engl. awning; frz. tendelet; it. tendone;sp. toldo.
Sopana, Treppenanlage eines→ *Stupa.
Sopraporte → *Supraporte.
Sortie (frz.), Ausfallöffnung imWall einer Festung.
Soufflet (frz.), langgezogener Vier-paß, bei dem das einander entge-gengesetzte Paar gerundet und dasandere kielbogig gespitzt ist, imengl. als Curvilinear-Maßwerk undim frz. als Flamboyant-Maßwerkbezeichnet. → *Maßwerk. Frz. soufflet; sp. tracería curvilínea, t. flam-boyant.
Souterrain (frz.), Untergeschoß,→ *Geschoß unter dem Erdge-schoß.
Spandach, Spließdach, eine einfa-che → *Dachdeckung, deren senkr.Fugen mit unterlegten Spließen(Spänen) abgedichtet sind.
Spandrille, Dreieckzwickel zwi-schen Bogen und senkrechter Be-
grenzung einer Maueröffnung(→ *Triumphbogen). Engl. spandrel; frz. écoinçon; it. pennacchiod�arco; sp. riñón de bóveda.
Spannriegel, der waagerechte,von Streben verspannte Balkeneines → *Sprengwerks. Engl. straining tie; frz. faux-entrait; it. bri-glia di collegamento; sp. riostra, tirantilla.
Spannweite, Stützweite, Abstandvon Auflager zu Auflager einerKonstruktion (Brücke, → *Bogen,Binder, → *Gewölbe). Engl. span, spread; frz. échappée, portée;it. luce; sp. distancia entre los apoyos.
Sparren, geneigte, einander ge-genüber angeordnete Hölzer einer→ *Dachkonstruktion, die dieDachhaut tragen. Sie sind mit denDachbalken oder Sattelbalken ver-zapft, verblattet oder versatzt oderstehen auf einer S.schwelle oderFußpfette (Mischkonstruktion). AnGraten und Kehlen der Dächersind die Grats. bzw. Kehls. zu fin-den. An diese anlaufende S. heißenSchifts. Unters. sind in der Ge-spärreebene mit Abstand unter denS. parallel zu diesen angeordnet.→ Kehlsparren. Engl. spar, rafter; frz. chevron; it. puntone;sp. cabio.
431 Sparren
S Spandrille
Sparrendach, Dachkonstruktionin Form eines Satteldachs, gebildetdurch zwei gegeneinander geneigte→ Sparren, die am oberen gemein-samen Punkt, dem Firstpunkt,miteinander verbunden sind. DerSeitenschub, den ein solches, stat.als Sprengwerk wirkendes Spar-renpaar an den Fußpunkten auf dieMauern oder die Wände ausübt,wird durch Dachbalken (Bund-balken) aufgehoben, mit denen dieSparrenfüße fest verbunden sind;so entsteht ein unverschieblicherDreicksverband. Der Längsverbandzwischen den einzelnen Gebindenwird durch Latten hergestellt, diein schräg ansteigender Richtungunter die Sparren genagelt werden(Windrispen). Eine Weiterbildungdes S. für größere Spannweitenerfolgt im Kehlbalkendach, dasgegenüber dem reinen Sparren-dach sehr häufig ist. → *Dachkon-struktion. Engl. rafter roof; frz. toit à chevrons; it. tettoa capriata semplice; sp. tejado de cabios.
Sparrenfuß, das untere, am Bin-der aufruhende Ende des Sparrenseines Sparrendachs. Frz. pied de chevron; it. piede del puntone;sp. pie de cabio.
Sparrenknecht → Schwebegiebel.
Speicher, ein Lagerhaus für Land-wirtschafts- und Handelsprodukte. Engl. granary, silo, storehouse; frz. grenier;it. magazzino, deposo; sp. granero, silo, al-macén, depósito.
Sphärisches Dreieck, Pendentif,Ausschnitt einer Kugeloberflächezur Überleitung vom Grundquadratdes Kuppelunterbaus zum Fußkreisder → *Kuppel (Teilgewölbe 2). Engl. spherical triangle; frz. triangle sphéri-que; it. triangolo sferico; sp. triángulo esfé-rico.
Sphinx (gr.), liegender Löwe mitmenschl. Haupt, wohl ein Symboldes Königs.
Spiegeldecke, eine → *Decke, de-ren mittleres Feld (→ Deckenspie-gel) von Profilen gerahmt ist. DerÜbergang zur Wand erfolgt mittelsKehlen (Deckenkehle, Voute) odermit einem Deckengesims. Engl. mirrored ceiling; frz. plafond en arcde cloître, p. bordé de moulures; sp. cieloraso bordeado de molduras.
Spiegelgalerie, ein langgestreckterRaum in barocken Schlössern, des-sen Wände von Spiegeln bedeckt
Sparrendach 432
Speicher(Beispiel: Ulm, Kornhaus, 16. Jh.)
Ägyptische Sphinx
sind, um den Raum opt. auszuwei-ten. Kleinere Räume dieser Artnennt man Spiegelkabinett. Engl. hall of mirrors; frz. galerie des glaces;it. galleria degli specchi; sp. galería de losespejos.
Spiegelgewölbe, 1. Muldenge-wölbe (→ *Gewölbeformen). 2.Irreführende Bezeichnung für eine→ Spiegeldecke. It. volta a schifo; sp. 1. bóveda amoldada, 2.bóveda de espejo.
Spina (lat.), Trennmauer zwischenden beiden Richtungsbahnen in derArena des röm. → Zircus.
Spindel, mittlerer zylindr. Teileiner →*Wendeltreppe. Die S. kanngeschlossen sein, d.h. sie setzt sichaus einzelnen an die Stufen angear-beiteten Teilzylindern zusammen,oder die S. ist offen (Hohls.,Treppenauge), d.h. ein Hohlraum,der von der schraubenartigen Licht-wange der Treppe begrenzt wird. Engl. newel; frz. noyau; it. anima, spina,pozzo; sp. 1. alma, núcleo, 2. escalera decaracol.
Spindelgewölbe, Schneckenge-wölbe, Spiralgewölbe, eine spiral-förmig ansteigende Ringtonne,meist als Unterbau einer Wendel-treppe (→ *Gewölbeformen). Engl. newel vault; frz. voûte sur le noyau, v.annulaire; it. volta a chiocciola, v. elicoidale;sp. bóveda helicoidal.
Spindeltreppe, Spindel 2 (→*Wendeltreppe). Engl. spiral staircase; frz. escalier en colima-çon; it. scala a chiocciola; sp. escalera decaracol.
Spirale, Schneckenlinie, 1. einehäufige ornamentale Grundform,
z.B. der Laufende Hund (→ *Fries).2. Um ein Auge als Zentrum ent-wickelt sich die → Volute des ion.Kapitells. Engl. spiral; frz., it. spirale; sp. espiral.
Spiralgewölbe → Spindelgewölbe,Schneckengewölbe (→ Wendel-treppe, → *Gewölbeformen). Engl. spiral vault; it. volta a chiocciola, v. eli-coidale; sp. bóveda en espiral.
Spiralturm, ein zylindr. Turm mitschraubenförmig gewundener Au-ßenrampe oder Spiraltreppen. Engl. spiral tower; frz. tour à rampe, t. héli-coïdiale; it. torre a spirale; sp. torre en espi-ral.
Spital → *Hospital.
Spitzbalken, österr. Bezeichnungfür → Hahnebaum. Engl. top beam; frz. faux-entrait; sp. tirantesuperior.
Spitzbogen, ein Bogen mit spitzerKontur. Die Krümmungsmittel-punkte des gedrückten S. liegenzwischen den Kämpferpunkten, diedes gleichseitigen S. in den Kämp-ferpunkten und die des überhöh-
433 Spitzbogen
Spiralturm
ten S. (Lanzettbogen) außerhalb derKämpferpunkte (→ *Bogenfor-men). Engl. pointed arch; frz. arc ogival, a. en ogi-ve, a. aigu; it. arco ogivale, a. (a sesto) acuto;sp. arco ojival, a. gótico.
Spitzbogenfries, ein → *Fries auskleinen Spitzbogen.
Spitzsäule, vom Dachbalken biszum First reichende Säule, an dievon beiden Seiten die Sparren an-liegen, vielfach mit angeblattetenoder eingezapften Kehlbalken imQuerverband und Unterzügen mitKopfbändern und Streben imLängsverband verknüpft. Die S.kommt auch im Giebelwandge-füge vor. Reichen die Säulen nurbis unter die Hahnenbalken, in diesie eingezapft sind, so spricht manvon Hochsäulen. Engl. king post; frz. poinçon (de faîte),obélisque; sp. pendolón.
Spitztonne, Tonnengewölbe mitspitzbogigem Querschnitt (→ *Ge-wölbeformen). Engl. pointed barrel vault; it. volta a botteogivale; sp. bóveda de cañón ojival.
Spließdach, Spandach → *Dach-deckung, deren senkrechte Fugenmit einem Spließ (Span) abgedich-tet sind. Engl. shingle roof; it. tetto di scandole;sp. tejado con eclisas.
Splint, 1. das Holz zwischenKernholz und Rinde. 2. Flacheisen,das durch die Öse des Ankerkopfs(→ *Anker) gesteckt wird undornamental verziert sein kann. Engl. 1. alburn, 2. sap; frz. 1. aubier, 2. gou-pille; it. 1. alburno, 2. bolzone, capochiave;sp. 1. albura, 2. chaveta, pasador.
Spolie (lat.), ein wiederverwende-ter Bauteil, der einem abgebroche-nen Gebäude entnommen ist (meistSäulenschäfte, Kapitelle, Friese,Gesimse). Engl. spolia; frz. remploi; it. spoglia; sp. pie-za de construcción reutilizable.
Sporn, 1. Strebepfeiler an Stütz-mauern. 2. Vorspringende Mauerzur Auflagerung einer Treppen-stufe. 3. Dreieckige Verdickung anVerteidigungsanlagen oder Tür-men (→ Schnabel). Engl. spur; frz. éperon; it. sperone; sp. con-trafuerte, espolón.
Spreize, ein zum Abspreizen,Abstützen verwandtes Holz. Engl. strut, stay; frz. étrésillon, étaie incli-née; it. sbadacchio; sp. codal.
Sprenggiebel, im Barock häufigeForm eines in der Mitte nicht ge-schlossenen, »gesprengten« Gie-bels, bes. über Risaliten, Fensternund Portalen. Engl. strutted gable; it. frontone spezzato,cimasa spezzata; sp. frontón.
Sprengwerk, eine meist hölzerneKonstruktion zur Aufnahme gro-ßer Lasten bzw. zur Überbrückunggroßer Spannweiten. Beim S. wirdder waagerechte Balken von zweigegeneinander gelehnten Strebenunterstützt. Bei größeren Spann-weiten wird zwischen die Streben
Spitzbogenfries 434
Sprengwerka Bundbalken b Strebe
c Spannriegel
ein Spannriegel eingefügt. S.kon-struktionen finden bei → Dach-konstruktionen, vor allem aber beiBrückenbauten Anwendung. Engl. strutted frame; frz. ferme à contrefi-ches, assemblage à c.; it. travatura con con-traffissi; sp. armadura con tirantes.
Springbrunnen, Zierbrunnen,mit durch Pumpenkraft oder Ge-fälledruck empor geschleudertemStrahl (→ *Brunnen). Engl. fountain; frz. fontaine (montante);it. fontana a zampillo; sp. fontana, surgiente.
Springgewölbe, spätgot. Gewöl-be mit alternierend angeordnetenSchlußsteinen, hervorgerufen vondreistrahlig geteilten Wölbungen,deren Fußpunkte wechselseitigalternieren. Die Gabelung einesRippendreistrahls überbrückt denfehlenden Anfallspunkt für dieGurtrippe. Dieses bewegte, hin-und herspringende Linienspiel fin-det sich im 14. Jh. bes. häufig inDeutschordensbauten sowie inSchlesien und Breslau. Auch beiParlerbauten, wobei durch Über-schneidung der Rippendreistrahledas → Netzgewölbe entsteht. Sp. bóveda con piedras angulares dispuestasalternadamente.
Sprosse, 1. Unterteilungsholz ei-ner Glaslichte (→ *Fenster). 2. Tritteiner Leiter. Engl. 1. (window) sash; frz. 1. croisillon, 2.échelon; it. 1. traversina (di finestra), 2.piolo; sp. 1. listones que dividen la hoja deuna ventana, 2. peldaño, escalón.
Sprossenfenster → *Fenster, des-sen Glasflächen durch Sprossen inFelder unterteilt werden. Engl. astragal window; frz. fenêtre à croisil-lons, f. à traverses; it. finestra con traversi-ne; sp. hoja de ventana dividida en compar-timientos.
Spundung, Holzverbindung vonBrettern, Bohlen, Pfählen mit Fe-der (Spund) und Nut. Engl. tongue-and-groove joint; frz. bouve-tage, emboîtement; it. Nut- u. Federverbin-dung in der Tischlerei: incastro a maschio efemmina, commettura a maschio e femmi-na; sp. machihembrado.
Stab, 1. ein stabförmiges Konstruk-tionsglied (→ Stabbau, → *Fach-werkbau). 2. Ein stabförmiges Zier-glied (Rundstab) oder Teile dessel-ben (Viertelstab), auch profiliertbzw. in einzelne Elemente unter-teilt vorkommend (Astragal, Perl-stab, Taustab, kannelierter Wulst,Blattstab). Engl. 1. bead, baton; frz. 1. bâton, boudin;it. 1. asta; sp. 1. barra, 2. bocel, cordón, toro,moldura redonda.
Stabbau, Hochbau, dessen run-de Eckstäbe zusammen mit denGrundschwellen und den Ober-schwellen einen festen Rahmenbilden, in den senkrechte Bohleneingespundet werden. Die bes. inSkandinavien verbreitete Bauweise
435 Stabbau
a Rundstabb Halbrundstabc Viertelstab d Perlstab
Stabe Taustabf Kannelierter Wulstg Blattstab
erreichte bei den → *Stabkirchenihre Vollendung. Engl. stave construction; it. costruzione atraliccio; sp. construcción empalizada.
Stabbur, Speicher der skandinav.Bauernhäuser, meist auf Pfählenstehende Blockbauten.
Stabkirche, skandinav. Holzkir-che, deren konstruktives Gerüstaus Masten besteht (Stabbau). DerInnenraum ist relativ klein unddurch die Masten verstellt. Engl. stave church; frz. stavkirke; it. chiesalignea norvegese; sp. iglesia escandinavaempalizada.
Stabwerk, senkrechte Stäbe zurUnterteilung der Glasflächen un-terhalb des Couronnements im→ *Maßwerk got. Fenster; nachLage und Dicke als Haupt- undNebenstäbe unterschieden, auch
als alte und junge Pfosten bezeich-net. Engl. bar tracery; frz. ossature de croisée;it. traforo ad asta; sp. tracería de crucero.
Stadel → Scheune.
Stadion (gr.), Laufbahn, derenGrundform zwei parallele, gerade,durch eine Kehre verbundene,mehrspurige Bahnen bilden. Zubeiden Seiten liegen ansteigendeZuschauerränge. Später zeigen dasHippodrom und der Zirkus diesel-be Grundform, während moderneS. eher einem ausgeweiteten Am-phitheater gleichen. Engl. stadium; frz. stade; it. stadio.
Stadt, Gemeinwesen beliebigerGrößenordnung, dessen Einwoh-ner keine Naturalwirtschaft betrei-ben und daher von der Größe undGüte des umgebenden Ackerlandesunabhängig sind. Die städt. Kul-tur basiert wirtschaftl. auf der Ar-beitsteilung und polit. auf weit-möglichster Selbstverwaltung. DasS.gefüge wird nach verkehrsrechn.,geograph., wirtschaftl. und künst-
Stabbur 436
Stabkirche (Grundriß und Ansicht)
Antikes Stadion
Modernes Stadion
lerischen Gesichtspunkten gestaltet(→ Städtebau, → *Stadtbaukunst). Engl. town, city; frz. ville, cité; it. città;sp. ciudad.
Stadtbaukunst, Gestaltung einesStadtgefüges nach vorwiegendkünstler. und ästhet. Gesichts-punkten. Die gr. Stadt war meistein locker gefügtes Konglomerat,dessen Fixpunkte die Agora und dieTempelbezirke waren. Das strengeSchachbrettraster des Hippodamusvon Milet wurde nur in Koloni-stenstädten angewandt. Auch dieetrusk. Stadt war infolge des meisthügeligen Geländes unregelmäßig.Erst röm. Provinzstädte zeigten den
regelmäßigen Schachbrettgrundrißdes röm. → *Castrums (Cardo,Decumanus). Im MA. wurdenviele neue Städte gegründet, meistim norddt. Raum, vor allem imnordostdt. Kolonisationsgebiet, aberauch in Österreich. Fixpunkte derma. Stadt sind Marktplatz undKirche. In der Renaissance verwirk-lichte man einzelne → *Idealstädtevon geometr. Grundrißstruktur. Inder Barockzeit wurden neue Städteangelegt, deren Grundrißstrukturentsprechend den damaligen abso-
437 Stadtbaukunst
A AgoraB StoaC BuleuterionD Prytaneion
E GymnasionF AthenatempelG GymnasionH Stadion
Gegründete ma. Stadt(Beispiel: Friedeberg/Neumark, E. 13. Jh.)
Stadtbaukunst
Gewachsene ma. Stadt (Beispiel:Nördlingen, 13./14. Jh.)
a Nordpforteb Westpforte
(Trajansbogen)c Südpforted Ostpforte
e Forumf Theater g Tempelh Thermeni Kapitol
Römische Stadt (Beispiel: Timgad)Schachbrettraster (Beispiel: Priene)
lutist. Gepflogenheiten auf dasSchloß bezogen war. Im 19. Jh. gabes als Folge des Abbruchs der Stadt-befestigungen zahlreiche Stadter-weiterungen und als neue Form derS. die Anlage einer → *Ringstraßeum den alten Stadtkern. Seit derstarken Vergrößerung der Städte inder neueren Zeit überwiegen techn.,verkehrstechn., hygien. und andereGesichtspunkte (→ Städtebau).
Stadtbefestigung, Sicherung ei-ner Stadt durch eine oder mehrereBurgen, Gräben und Wälle, Schan-zen, → *Bastionen oder Mauern(→ *Stadtmauer). Je nach der to-pograph. Lage der einzelnen Stadt-teile bzw. nach deren zeitl. Ent-stehung können diese auch einzelnbefestigt sein, wobei manchmal, wiebei der Burg, einzelne Befestigungs-abschnitte hintereinandergeschal-tet sind. Liegt die Stadt im Schutzeeiner Burg (Zitadelle), so ist das
Befestigungssystem von Stadt undBurg eine durch Flügelmauern mit-einander verbundene Einheit. Liegtdie Stadt auf einer Höhe, wird ih-re Ausdehnung weitgehend durchdie topograph. Struktur bestimmt.Bei Tallagen werden aus Verteidi-gungsrücksichten Flußschlingenbevorzugt. Brücken wird auf demjenseitigen Flußufer häufig einBrückenkopf als Vorposten der Ver-teidigung vorgelegt. Nach Einfüh-rung der Feuerwaffen wurden dif-ferenziertere Befestigungssysteme,wie Sternschanzen, → *Barbaka-nen, → *Bastionen und Außenwer-ke (Forts, Vorwerke) notwendig.Im 19. Jh. wurden die Befestigun-gen meist abgetragen, auf den ein-geebneten Gräben breite Straßen(»Graben«, »Ring«, »Esplanade«)errichtet (→ *Ringstraße). Engl. town fortification; frz. fortification deville; it. fortificazione urbana; sp. fortifica-ción urbana.
Stadtbefestigung 438
a Grabenb Ringmauer mit
Wehrgang
c Wehrturmd Torturm mit Zug-
brücke u. Pechnase
e Flußf Brückenkopfg Barbakane
h Glacisi Vorwerkj Zollwache
Stadtbefestigung
Städtebau, Zusammenfassungbautechn., verkehrstechn. und wirt-schaftl. Aufgaben, die sich bei derAnlage, Erweiterung (→ *Stadt-erweiterung) und Sanierung einerStadt ergeben. Die Stadtplanungberuht auf der Verarbeitung statist.Materials und soziolog. Untersu-chungen. Die Verwirklichung er-folgt auf Grund eines Flächenwid-mungs- und eines Bebauungsplans,in dem die Fluchtlinien und Bau-höhen festgelegt sind. Auch künst-ler. Gesichtspunkte müssen beimStädtebau berücksichtigt werden(→ *Stadtbaukunst). Engl. town planning; frz. urbanisme; it. ur-banistica; sp. urbanización.
Stadterweiterung, planmäßigeVergrößerung einer Stadt durchEinbeziehung neuen Baulands oderbestehender Vorstädte in das ge-meinsame Verteidigungssystemoder unter gemeinsame Verwal-tung, wobei die einbezogenen Sied-lungen ihre Selbständigkeit verlie-
ren. Die S. kann additiv erfolgen.Manchmal wurde der Altstadt eineNeustadt räuml. getrennt hinzuge-fügt, falls dies die topograph. Gege-benheiten erzwangen. Oft wurdeauch die alte Siedlung aufgelassenoder verlor das Stadtrecht. In neue-rer Zeit geschehen die S. oft plan-los oder aber in Form von → Tra-bantenstädten, die weitgehendselbständig und durch gute Ver-kehrsverbindungen an das Stadt-zentrum angeschlossen sind. Engl. town extension; frz. extension de villes;it. ampliamento urbano; sp. extensión urba-na.
Stadthalle, Halle oder Saal füröffentl. Veranstaltungen, Konzerte,z.T. auch Bühnenvorführungen, inneuerer Zeit auch für Sportver-anstaltungen. Waren die urspr. S.meist Saalbauten, so wurden inneuerer Zeit auch Großraumkon-struktionen mit zentralisierendemGrundriß entwickelt. Verschiede-nen Veranstaltungen dienen dieMehrzweckhallen, die durch Ver-änderung der Einrichtung der je-weiligen Funktion angepaßt werdenkönnen. Die Zuschauerränge sindmeist amphitheatral. angeordnet.Da die Besucherzahlen der einzel-nen Veranstaltungen oft sehr un-terschiedl. sind, werden teilweiseauch mehrere Säle verschiedener
439 Stadthalle
(Beispiel: Rostock. Von rechts nach links:Altstadt 1218, Mittelstadt 1232,
Neustadt 1252)
a Altstadtb Neustadtc Domburgd Marktkirchee Marktsiedlung
f Dorfg Klosterh Befestigung der
Marktsiedlung
Stadterweiterung(Beispiel: Hildesheim)
Größe zu einem S.gebäude zusam-mengefaßt. Engl. town hall; frz. halle municipale; sp. sa-lón municipal.
Stadtkern, Innenstadt, Zentrumeiner Stadt. Der S. ist bei europ.Städten meist der ehemals vonMauern, Gräben und Wällen um-gebene Teil (Altstadt). Im weiterenSinne des Worts auch das Zentrummit den Hauptgeschäftsstraßenund öffentl. Gebäuden (→ City) imGegensatz zu den Außenbezirkenbzw.Vorstädten. Engl. city centre, am. city center; frz. noyauurbain, centre-ville; it. centro (della città);sp. centro urbano.
Stadtkrone, Kernzelle einer Stadtmit den wichtigsten Monumental-bauten und in stark hervortreten-der, oft beherrschender Lage (Akro-polis, Kapitol u. dergl.). Engl. citadell; sp. núcleo urbano.
Stadtmauer, Mauerring, Bering,Ringmauer mit Wehrgang, Stadt-türmen und Stadttoren. Liegenmehrere Mauern hintereinander(Hauptmauer, Vormauern), sindzwischen diesen die Zwinger. DieStadttore konnten zusätzl. durchringförmige Außenwerke (Bastille,→ *Barbakane) gesichert sein. Engl. fortifications, town wall; frz. rempart;it. mura cittadine; sp. muralla de la ciudad.
Stadttor, Tor einer → *Stadtbe-festigung. Das S. ist Abwehr undEmpfang zugleich. Die Unterbre-chung der → *Stadtmauer mußtedurch einen Torturm oder durchzwei flankierende Türme oder aberdurch eine Verbindung von Turmund Flankentürmen gesichert wer-den. Bereits in der röm. Antikewurde das flankierende Turmpaarverwandt, das auch im MA. ofterrichtet wurde. Ferner S. mit ei-
Stadtkern 440
Stadthalle (Beispiel: Dortmund,Westfalenhalle)
Stadtmauer (Beispiel: Istanbul,Landmauer)
a innere Mauer (Hauptmauer)b Zwingerc äußere Mauer (Vormauer)d Brustwehre Graben
nem mittleren Torturm und seitl.Flankentürmen am Vortor. Seit derRenaissance werden S. durch einBollwerk oder eine → *Barbakanegeschützt (im arab. Bereich → Bâb).Engl. city gate; frz. porte de la ville; it. portadella città; sp. puertas de la ciudad.
Staffelbasilika, eine mindestensfünfschiffige Basilika mit niedrige-ren äußeren und höheren innerenSeitenschiffen, die selbst wiederniedriger als das Mittelschiff sind(→ *Emporenbasilika). (Abb. S.442)It. basilica a gradoni; sp. basílica escalonada.
Staffelchor → *Chor mit gestaf-felt angeordneten Apsiden, wobeiauch die Querhausapsiden einbe-zogen werden können. Engl. Benedictine choir; frz. ch�ur à ab-sides échelonnées, ch�ur bénédictin; it. co-ro a grandinata; sp. coro escalonado.
Staffelgiebel → *Giebel mit abge-treppter Kontur. Die Abtreppungerfolgte zunächst aus techn. Grün-den, um die einzelnen Steinschich-ten waagerecht durchführen, gera-de abschließen und mit Dachziegelneindecken zu können (→ *Back-steinbau). In der Renaissance alsZiergiebel mit aufgesetzten Volu-ten, Schnecken und Ornamentengeschmückt. Engl. corbie gable, stepped g.; frz. pignon enredan(s), p. en gradin(s), p. redenté; it. fron-tone a gradoni; sp. frontón escalonado.
441 Staffelgiebel
(Beispiel: Stendal, Ünglinger Tor, 15. Jh.)
(Beispiel: Perugia, etruskisches Stadttor)
(Beispiel: Köln, röm. Pfaffenpforte, 3./4. Jh. n. Chr.)
Stadttor
Staffelhalle, Pseudobasilika, einemehrschiffige → *Hallenkirchemit stufenförmig nach der Mittezu ansteigenden Decken bzw. Ge-wölben in den einzelnen Schiffen,jedoch ohne direkte Belichtung desMittelschiffs (und der inneren Sei-tenschiffe, falls äußere Seitenschiffevorhanden sind → *Staffelbasilika).
Staffelkirche → *Staffelbasilika,→ *Staffelhalle.
Stahlbeton, ein Verbundkörperaus Beton und einer Stahlbeweh-rung, der so ausgeführt ist, daß derBeton nur die Druckspannungen,der Stahl jedoch meist nur dieZugspannungen aufzunehmen hat.Der S. wird auf vorfabrizierten odereigens für einen bestimmten Bauteilangefertigten Schalungen gegossen,die nach Erhärten des Materialswieder entfernt werden können. Jenach Art der Ausbildung einerS.konstruktion unterscheidet man
→ *Pilz-, Rippen-, Platten- und→ *Plattenbalkendecken, Rahmen,Schalen u. dergl. Engl. reinforced concrete; frz. béton armé;it. cemento (calcestruzzo) armato, calce-struzzo armato; sp. hormigón armado.
Stahlfenster, Fenster aus Stahl-profilen. Engl. steel window; frz. fenêtre (en) acier,châssis métallique; it. finestra metallica;sp. ventana metálica.
Staffelhalle 442
Staffelbasilika(Beispiel: Beauvais,Kathedrale, 13. Jh.)
Staffelhalle(Beispiel: Poitiers, Notre Dame, 12. Jh.)
Stahlskelettbau, aus Stahlprofi-len gebildetes, in sich starres, tra-gendes Gerippe, dessen Wände nurdem Raumabschluß zu dienenhaben. Vorgefertigte Teile werdenauf der Baustelle vernietet oder ver-schweißt. Vorteilhaft ist die weit-gehende Vorbereitung in der Werk-statt, die Kontrolle der Werkstoff-beschaffenheit, die Witterungsun-abhängigkeit und die Möglichkeit,ohne Gerüst schnell zu montieren.Die witterungsbeeinflußte Außen-wand kann vorgehängt werden, sodaß die Konstruktion geschützt ist.→ Skelettbau. Engl. steel-frame construction, steel skele-ton c.; frz. construction à ossature en acier;it. costruzione a scheletro d�acciaio; sp. con-strucción con estructura metálica.
Stahltür, Türblatt und Rahmenaus Stahlblech oder Stahlprofilen. Engl. steel door; frz. porte en acier; it. portad�acciaio; sp. puerta metálica.
Staken, 1. Ausfüllung der Balken-gefache einer Wand oder Decke mitStakhölzern, die verflochten undmit Strohlehm umgeben sind. 2.→ *Abkreuzung (Versteifung) von
Balken durch kreuzweise angeord-nete Stakhölzer (Kreuzstakung). Engl. 1. stake, pole; frz. 1. palançon, polis-son, bois de clayonnage; it. 1. introduzionedi torselli fra le travi, 2. sbadacchiamento acroce; sp. 1. tapiar, 2. reforzar con codalesen cruz.
Stalaktit (gr.), Muqarnas, zellen-artiges Schmuckelement der isla-mischen Baukunst (S.gewölbe,S.kapitell → *Kapitell, S.kuppel,S.portal, → *Mihrab).
Stalaktitengewölbe → *Gewöl-beform der islam. Baukunst, dieaus Stalaktiten zusammengesetztist (→ *Mihrab). Engl. stalactite vault; frz. voûte en stalacti-tes; it. volta a stalattiti; sp. bóveda de estalac-titas.
Stalaktitenkapitell → *Kapitellder islam. Baukunst, das aus Stalak-titenformen zusammengesetzt ist. Engl. stalactite capital; frz. chapiteau en sta-lactites; it. capitello a stalattiti; sp. capitel deestalactitas.
Stalaktitenkuppel, Kuppel derislam. Baukunst, die aus Stalakti-tenformen zusammengesetzt ist. Engl. stalactite dome; frz. coupole en stalac-tites, dôme en s.; it. cupola a stalattiti; sp. cú-pula de estalactitas.
Stalaktitenportal, Portal der is-lam. Baukunst, das von Stalaktitenabgeschlossen wird. Engl. stalactite portal; frz. portail en stalacti-tes; it. portale a stalattiti; sp. portal de esta-lactitas.
Stallen, Sitze eines → *Chorge-stühls. Engl. stalls; it. stalli; sp. sitial de coro.
Stambha, Dhvadscha S. (ind.),Säule zur Erinnerung an Ereignisseim Leben Buddhas.
443 Stambha
Detail vom Anschluß einer Stütze an einePlattendecke mit Unterzug
Stahlbeton
Ständer, auf Boden, Stein, Sok-kelmauer oder Schwelle aufgesetz-te, auch durch mehrere Geschossereichende Stütze in einer Fach-werkwand (→ Pfosten, → *Säule,→ Stiel). → *Fachwerkbau. Engl. stud, upright beam; frz. montant, po-teau, piédestal; it., sp. montante.
Ständerbau, 1. eine Bauweise, beider tragende Wände aus senkrech-ten Holzstützen (Ständer) gefügtwerden (zum Unterschied vomBlockbau). 2. Auch verwendet alsSammelbezeichnung für alle Holz-bauweisen mit tragendem Gerüstaus Ständern. Engl. post-and-beam construction; it. cos-truzione a traliccio; sp. construcción demontantes.
Ständerbohlenbau, Geschoßbau,dessen Außenwände durch Bohlengeschlossen sind, die in Nuten oderFalze des Gerüsts eingesetzt sindund im Unterschied zum → Stab-bau keine aussteifende Funktionbesitzen.
Ständerfußblatt, untere Verdik-kung des Ständers durch ein Blatt,das von dem mit einfachem Zapfen
versehenen Fuß bis zur halbenoder ganzen Höhe der Schwelleherunterreicht und die Fugen zwi-schen Ständer und Schwelle deckt,bes. im südwestl. Fachwerkbau des15./16. Jhs. (veraltet Schwebeblatt).
Ständerlehmbau, Geschoßbau,bei dem die Lehmausfachung auchüber die dünneren, einige Zen-timeter gegenüber der Bundebenezurückgesetzt verzimmerten Rie-gel und Streben reicht und diesedamit verdeckt.
Statik (gr.), die Wissenschaft vomGleichgewicht der Kräfte, die auffeste, starre Körper einwirken, beiBaukonstruktionen als Baus. be-zeichnet. Engl. statics; frz. statique; it. statica; sp. está-tica.
Staudamm, Staumauer, ein künst-lich errichteter Damm, Wall odereine Mauer, um Wasser für Ener-giegewinnung und Bewässerungaufzustauen. Engl. (retaining) dam; frz. barrage; it. argi-ne; sp. muro de contención.
Staupsäule, Pranger, Schandpfahlin einer ma. Stadt, an dem De-linquenten festgebunden und mitRuten geschlagen wurden. Engl. pillory; frz. pilori, carcan; it. colonnainfame; sp. picota.
Steg, 1. verbindendes Element,z. B. kleine Brücke (meist ausHolz). 2. Vorspringende Elementezwischen den → Kanneluren einerSäule. 3. S. zwischen den Schlitzeneiner Triglyphe. 4. S. zwischen denFlanschen eines Profilträgers. Frz. 1. passerelle, 2. filet, canne, 4. âme;it. allg. listello, filetto, 1. ponticello, passa-rella, 2. stria, 3. femore, 4. anima (della tra-ve); sp. 1. pasarela, 2. filete, 3. puente, 4. alma.
Ständer 444
Ständerbaua Bohlenwand (tragendes Ständergerüst
mit Bohlen ausgefacht)b Ständerbau
Stehender Dachstuhl → Dach-stuhl.
Stehfalz, hakenförmige, stehendeVerbindung zweier Blechplatten(→ *Falz). Engl. (welted) standing seam, standing welt;frz. joint (debout); sp. engatillado vertical.
Steigband, eine diagonal einenStänder überblattende Verstrebungim Fachwerkbau. It. fascia controvento; sp. apoyo diagonal deun ensamble de media madera.
Steigender Bogen, einhüftigerBogen, → *Bogenform mit steigen-der Kämpferlinie. Engl. rising arch; frz. arc rampant; it. arcorampante; sp. arco por tranquil, a. inclina-do, a. en declive.
Steigung, das Verhältnis der Höhezur Länge eines ansteigendenGeländes oder einer Treppe. Engl. rise; frz. montée, pente; it. pendenza;sp. pendiente.
Steinanker, → *Ankerstein zurVerbindung von Mauerteilen. Engl. through stone; sp. piedra ancla.
Steinbalken, Balken, Überlageroder Unterzug aus Stein. S. wurdenhauptsächl. in der ägypt., in der gr.und in der röm. Baukunst ver-wandt (→ Gebälk, Epistyl, → *Ar-chitrav, → *Architravbau). Engl. stone beam; frz. poutre en blocs, p. encorps; it. architrave (di pietra); sp. viga depiedra.
Steinbearbeitung, Oberflächen-bearbeitung von Werksteinen. Dieeinzelnen Arbeitsschritte nach An-legen des 1,5�4 cm breiten Rand-schlags mittels Schlageisen undKlöpfel sind: Bossieren bzw. Spit-zen = grobes Abarbeiten mit dem
Spitzeisen oder der Spitze (beidhän-dig geführte spitze Hacke); Flächen= feines Abarbeiten des Spiegels(die vom Randschlag umgebeneFläche) mit der beidhändig geführ-ten, beilähnl. Fläche; Scharrieren =feines Abarbeiten des Spiegels miteinem breitschneidigen Schlagei-sen, wodurch schmale, parallele Ril-len, eine Art Riefelung, entstehen,erst seit dem 16. Jh. üblich; Krö-neln = feines Überarbeiten miteinem Kröneleisen, das aus einersenkrecht angeordneten Reihe vonSpitzen besteht; Stocken = Überar-beiten mit dem aus vielen Pyrami-denspitzen bestehenden Stockham-mer. Der Spiegel kann aber auch alsBosse (Rohform) vor den Rand-schlag vorstehen (Rustikamauer-werk = opus rusticum) als Buckel-quader- oder → Bossenmauerwerk. Engl. dressing; frz. travail des pierres, (exé-cution de la) taille; it. lavorazione della pie-tra; sp. labrado de la piedra.
445 Steinbearbeitung
Steg2 Kanneluren 3 Triglyphe
4 Doppel-T-Träger
Steingarten, ein bes. in Japan ent-wickelter Garten mit Steinen undFelsen, in Europa meist mit Alpen-pflanzen (Alpengarten) geschmückt.Engl. rock garden; frz. jardin alpin; it. giar-dino roccioso; sp. jardín rocoso.
Steinguß, Guß von Bauteilen (Ge-wölberippen etc.) und Bildhauer-arbeiten aus einer Masse ausSteinmehl und Bindemittel in Ne-gativformen, vor allem um 1400verbreitet. Engl. casting of imitated stone; it. stucco,scultura a stampo; sp. fundición de piedra,piedra colada.
Steinkammer, ein vorgeschichtl.Grab mit Grabkammer aus Steinen(→ Grabbau, → *Dolmen) und dar-über aufgeschüttetem Erdhügel. Engl. megalithic tomb; sp. tumba megalítica.
Steinkreis, eine runde Steinset-zung aus senkrecht stehenden Mo-nolithen oder Steinplatten, die eineKultstätte bzw. ein Grab umgeben(→ *Architrav). Engl. stone circle; it. cromlech; sp. círculode piedras.
Steinmetzzeichen, meist geome-trisches, auch monogrammartigesZeichen als persönl. Signum einesSteinmetzen, als Gütezeichen undwohl auch zur Abrechnung, in derSpätgotik auch als Meisterzeichen;seit etwa 1130 auf der Sichtflächedes Quaders eingehauen und biszur Spätgotik weit verbreitet, ver-einzelt in Renaissance und Barock. Engl. stonemason�s mark; frz. signe lapi-daire, s. maçonique; it. monogramma discalpellino; sp. marca del cantero.
Steinschnitt, Fugenschnitt, geo-metr. bzw. stereometr. Ausmittlungder Wölb-, Kopf-, Lager- und Stoß-
flächen von Werksteinen, vor allembei Bogen (→ *Bogenquaderung)und → *Gewölbe. Engl. stone cutting; frz. stéréotomie, coupede pierres, taille de p.; it. lotomia; sp. cortede piedras.
Steinwerk, Kemenate, ein zu-meist quadrat., zweigeschossigerSteinbau in norddt. Städten und aufAmtssitzen von Ministerialen aufdem Land, aus Bruchsteinen errich-tet und eingewölbt, im 12. /13. Jh.freistehend, später mit Fachwerk-wohnbau verbunden, als feuer-und einbruchsicherer Bau. Engl. masonry, stonework; sp. mampostería.
Steinzeug, Sinterzeug mit bes.harten Scherben aus geschmolze-nem Ton, das hauptsächlich fürFliesen und Kanalisationsrohre ver-wandt wird. Engl. stoneware, crockery; frz. grès (-céra-me); it. gres, terracotta; sp. gres.
Steinzeugplatte → Fliese ausSteinzeug.
Steingarten 446
Steinmetzzeichen
Stele (gr.), eine aufrechtstehendeSteinplatte als Gedenkstein, haupt-sächl. bei → *Grabdenkmälern. Engl. stele, stela; frz. stèle, cippe; it. stele;sp. estela.
Stelzbogen, eine gestelzte odergefußte → *Bogenform. Engl. stilted arch; frz. arc exhaussé, a. su-rélevé; it. arco sopralzato, a. a sesto rialzato,a. bizantino; sp. arco de medio punto elevado.
Stelzung, die kurze Weiterfüh-rung der Vertikalen zwischenKämpferlinie und Bogen- oder Ge-wölbekrümmung (→ *Bogenfor-men, → *Gewölbeformen). Engl. stilting; frz. exhaussement; it. rialzo,sopralzo; sp. elevación de arco, e. d. bóveda.
Stereobat (gr.), Krepidoma, Kre-pis, Stufenunterbau antiker Bau-werke, vor allem der Tempel, beste-hend aus Fundament, Euthynterie,Krepis und Stylobat. Engl., it. stereobate; frz. stéréobate; sp. este-reóbato.
Sternbogen, seltene BezeichnungdesVorhangbogens (→ *Bogenfor-men). Engl. inflected arch; frz. arc en contrecour-be; it. arco a controcurve, a. a tenda; sp. arcoen contracurva.
Sterngewölbe, Sternrippengewöl-be, spätgot. Gewölbe mit sternför-mig angeordnetem Rippensystem,oft ein radiales Dreistrahl- oderRautengewölbe streng geometr.Art, auch ein Schwingrippengewöl-be in vegetabilen Formen, oder alsSternnetzgewölbe. → *Gewölbe-formen. Engl. stellar vault; frz. voûte en étoile;it. volta stellata; sp. bóveda en estrella.
Sternhaus, ein moderner Wohn-haustyp, bei dem um ein zentralesTreppenhaus mehrere Wohnungenradial angeordnet sind. It. edificio a stella, e. stellare; sp. edificio enforma de estrella.
Sternrippengewölbe → Sternge-wölbe.
Sternschanze, Etoile, Feldschan-ze als geschlossenes Außenwerk aufsternförmiger Grundfläche, auchmit einspringenden Winkeln, inregelmäßigen oder unregelmäßi-gen Formen eines drei- bis zehn-strahligen Sterns. Im 17. Jh. bes.
447 Sternschanze
Stereobat eines griechisch-dorischenTempels
Sternhaus
von Vauban für Festungsbautenangewandt. Engl. star fort; frz. fort étoilé, f. à étoile;it. trincea a stella; sp. trinchera en forma deestrella.
Sternwarte → Observatorium.
Stich, 1. Stichhöhe, Höhe desScheitels eines → *Bogens odereines → *Gewölbes über der Kämp-ferlinie. 2. Überhöhung des Ge-wölbescheitels gegenüber der Schei-telhöhe der Schild- oder Gurtbo-gen. 3. → S.balken. Frz. 1. flèche, montée; it. 1. freccia, monta,2. rialzo, 3. trave zoppa; sp. 1. flecha, mon-tea, 2. peralte, 3. viga embrochalada.
Stichbalken, ein mit einem Endeauf einem Deckenbalken oder aufeinemWechselbalken und mit demanderen Ende auf der Außenwandaufruhender → *Balken. Engl. half-beam, tail beam; frz. entrait re-troussé; it. trave zoppa; sp. viga embrocha-lada, madero cojo.
Stichhöhe, Stich, → Pfeil, Höhedes Bogenscheitels über der Kämp-ferlinie (→ *Bogen). Engl. rise, pitch; frz. hauteur sous clef, mon-tée de voûte; it. monta, freccia; sp. altura delvértice.
Stichkappe, ein → *Gewölbe, dasquer zur Achse des Hauptgewölbesverläuft und in dieses einschneidet.Die S. ist gegen das Hauptgewölbedurch einen Kappenkranz begrenzt.S. kommen hauptsächl. bei Fensternoder anderen Maueröffnungen, diein die Gewölbezone eingreifen,vor. Liegen die Scheitel zweier ge-genüberliegender S. so hoch wie derScheitel des mittl. Tonnengewöl-bes, entsteht ein → Kreuzgewölbe. Engl., frz. lunette; it. lunettone, lunetta;sp. luneta.
Stiege → *Treppe.
Stiel, nur gering tragendes, senk-rechtes Holz zwischen Riegeln,Schwellen und Rähm in einerFachwerkwand, das meistens eineÖffnung begrenzt. Engl. handle, helve, post, upright, stud;frz. manche, hampe, montant, poteau; it. pi-lastro, gamba, coscia; sp. jamba.
Stierkapitell, → Kapitell der →pers. Säule mit zwei Stierleibern. Engl. bull capital; frz. chapiteau à taureaux;it. capitello tauriforme; sp. capitel taurino.
Stift, mit Grundbesitz und eige-nem Rechtsstatus ausgestatteteKlerikergemeinschaft (Kanoniker,Kanonissen) an einer Domkirche(Doms.) oder einer nicht klösterl.Kirche (Kollegiats). Baul. Gestal-tung ähnl. dem Kloster, seit dem12. Jh. wohnen die Mitglieder in ei-genen, am Rande der Stiftsimmu-nität gelegenen Häusern (Kanoni-kerhäuser). In Österreich auchBezeichnung für Klöster andererOrden. Engl. convent; frz. fondation; it. opera pia,fondazione; sp. cabildo eclesiástico, capítu-lo de una orden.
Stiftskirche, Kirche einer geistl.Stiftung (→ Stift). Engl. collegiate church; frz. (église) collé-giale; it. collegiata.
Stil, auf wesentl. Eigenschaftenberuhende Gleichartigkeit künst-ler. Mittel, d.h. die Art der An-wendung von Formen und derenAuswahl, die Einbindung des Indi-viduellen ins Allgemeine: die Eigen-heit einer Künstlerpersönlichkeit(Individuals.), einer Landschaft(Raum-, Nationals.), einer Zeit(Zeits., wie Romanik, Gotik, Re-
Sternwarte 448
naissance, Barock, Rokoko, Klassi-zismus, Historismus, Jugendstilusw.) oder eines Materials (Ma-terials.). Aus der Erkenntnis vonStilmerkmalen an fest datiertenWerken kann eine Stilentwicklungrekonstruiert und undatierte Wer-ke mit einer gewissen Genauigkeitder Datierung eingefügt werden. Engl., frz. style; it. stile; sp. estilo.
Stilisieren, Vereinfachen von Na-turformen (z.B. Blattwerk) zu einercharakterist., oft geometr. Grund-form. Engl. stylize, conventionalize; frz. styliser;it. stilizzare; sp. estilizar.
Stipes, Träger der Platte (Mensa)eines → *Altars. Engl. stipes; it. stipe, stipite; sp. estípite.
Stirn, Haupt, vordere Ansichts-fläche eines → *Bogens, eines offe-nen → *Gewölbes, eines Back-steins, eines Balkens u.a. Engl. front side; frz. front; it. fronte;sp. frente.
Stirnbogen, vorderer Bogen einesoffenen → *Gewölbes, z. B. einerApsis. Engl. face arch; frz. arc du front, a. de dé-part, premier a.; it. arco frontale; sp. arcofrontal.
Stirnbrett, Stirnbohle, ein Brett,das vor die Stirn der Dachbalken-lage, also vor die nach unten schräg
einwärts abgeschnittenen Balken-köpfe genagelt ist und die Stelle desGesimses einnimmt. Engl. eaves board; frz. chanlatte, planche derive, bordure de pignon; sp. saledizo.
Stirnwand, beim Tonnengewölbedie Quermauer, beim Kreuzgewöl-be alle vier Mauern, daher auchmit Schildwand verwechselbar, dienur unter dem Schildbogen liegt. Engl. front wall; frz. mur frontal; it. muro ditesta; sp. muro frontal.
Stirnziegel, Antefixa, beim anti-ken Tempel ein Dachziegel mit auf-recht stehender Ansichtsfläche, derüber der Traufkante den Stoß derFlachziegel überdeckt und meistmit einer Palmette geschmückt ist(→ Dachdeckung). Engl. antefix; frz. antéfixe; it. antefissa; sp. an-tefija.
Stoa (gr.), eine Säulenhalle (Le-sche), meist am Rande der → *Ago-ra. Eine Säulenhalle mit geschlos-sener Rückwand vor einem anderenGebäude wird auch → *Portikusgenannt.
Stocken, Behandlung der Ober-fläche eines Steins (→ Steinbear-beitung) mit einem Stockhammer. Frz. boucharder; it. bocciardatura; sp. escodar.
Stockschwelle, Stockwerkschwel-le, Saumschwelle, Schwelle dereinzelnen Stockwerke im Fach-werkbau. Engl. top plate; frz. sablière d�étage; sp. um-bral de cada piso.
Stockwerk, Stock, aus dem Holz-bau stammende Bezeichnung fürein Obergeschoß (→ *Geschoß). Engl. floor, storey, am. story; frz. étage, ni-veau; it. piano; sp. piso.
449 Stockwerk
StilisierenNaturvorbild Kunstform
Stockwerkbau, Fachwerkbauwei-se aus in sich abgezimmerten, je-weils als selbständige Gerüste ge-bildeten, übereinandergestelltenEtagen (Unterstock, Oberstöcke);veraltet Rähmbau, Stockwerkrähm-bau → Geschoßbau. Engl. multi-storey building; sp. construc-ción en pisos.
Stockwerkshöhe → Geschoßhö-he, Maß von der Fußbodenoberkan-te eines Stockwerks bis zur Fußbo-denoberkante des nächsten, alsolichte Raumhöhe plus Deckendik-ke. Engl. storey height; frz. hauteur d�étage;it. interpiano.
Stollen, unterird. vorgetriebenerGang, bes. im Befestigungsbau. Engl. adit (-level); frz. galerie, areine; it.galleria; sp. galería subterránea.
Stollenkrypta, ein halb oder ganzunterird., tonnengewölbter Gang(Stollen), der innen oder außen derRundung der Apsis folgt (→ Ring-krypta). Im Scheitel der Apsis öff-net sich der Gang mit einem Fen-sterchen (Fenestella) oder in einemkurzen Stollen zu einer unter oderhinter dem Hauptaltar gelegenenKammer (→ *Konfessio) mit demMärtyrer- oder Heiligengrab. Durchden Grundriß des Chors oderChorquadrats bedingt können dieStollen rechtwinklig geführt undim O. auch kammerartig erweitertsein oder, bes. in Westfrankreich,in parallelen Kammern enden.
Stoß, Verbindungsstelle zweierKonstruktionselemente. Beim Mau-erverband die → Fuge zwischenzwei nebeneinanderliegenden Stei-nen (S.fuge). Auch Hölzer können
durch einen S. miteinander ver-bunden sein (→ *Holzverbindung).Engl. joining; frz. joint, abouement; it. giun-to; sp. empalme.
Stoßfuge → Fuge, an der zweinebeneinanderliegende Konstruk-tionsteile zusammentreffen. Engl. vertical joint; frz. joint montant, j.vertical, j. d�assise; it. linea di giunzione;sp. fuga del empalme.
Strahlengewölbe, Fächergewöl-be, Palmengewölbe, ein durch zahl-reiche vom Scheitel bzw. von einerStütze ausgehende Rippen unter-teiltes Gewölbe (→ *Gewölbefor-men). Engl. fan vaulting; frz. voûte à nervuresrayonnantes; it. volta a ventaglio; sp. bóvedaen abanico.
Straßendorf, Dorf mit beidseiti-ger Bebauung entlang einer Straße(→ *Dorfformen 4).
Strebe, schräggestelltes, verstei-fendes Holz zur Aufnahme vonDruckkräften, zumeist eingezapft,seltener angeblattet (→ Band); zweisich überkreuzende S. werdenKreuzs. (→ Schere) oder Andreas-kreuz genannt. Eine kurze S.(Kopf- und Fußs.) wird auch fälsch-lich Band genannt. → *Sprengwerk.Engl. strut; frz. jambe de force, étrésillon;it. contraffisso, saettone; sp. puntal.
Strebebogen, Hochschiffstrebe,veraltet fliegende Strebe, im got.→ *Strebewerk ansteigender Bogenzur Aufnahme des Gewölbeschubsund des Winddrucks, meist ein mitAufmauerung (Spreize) versehenerHalbbogen; auch als SchwebendeArkade oder Maßwerkbrücke aus-gebildeter, durchbrochener S.; waa-
Stockwerkbau 450
gerecht verlaufende S., die derAbstützung zwischen zwei Mau-ern oder Gebäuden dienen, heißen→ *Schwibbogen. Engl. flying buttress; frz. arc-boutant, arca-de aérienne; it. arco rampante; sp. arco ram-pante, a. arbotante.
Strebemauer, Mauerzunge zurAufnahme des Widerlagerdruckseines Gewölbes oder einer Stütz-mauer, zumeist schräg abfallendeAußenkante oder zumindest mitoberer schräger Abdeckung (→*Strebewerk). Engl. buttress wall; it. (muro a) contraffor-te; sp. muro de contrafuerte.
Strebepfeiler, pfeilerartige Mau-erverdickung an einem Punkt, derhohen Druck- und Schubkräftenausgesetzt ist, meist schräg gegeneine Mauer gestellt oder abgekafft(→ Kaffgesims), nach außen vor-springend oder auch nach inneneingezogen (→ Einsatzkapellen).Bei Basiliken in der Umfassungs-mauer der Seitenschiffe angefügtund mit Strebebogen versehen(→ *Strebewerk). Engl. counterfort, buttress, abutment;frz. contrefort, éperon; it. contrafforte, spe-rone; sp. contrafuerte, botarel.
Strebewerk, ein konstruktives Ver-spannungssystem zur Ableitung derGewölbeschübe vor allem got. Ba-siliken. → Strebepfeiler überneh-men die von den Strebebogen, dieüber den Seitenschiffgewölben freiansteigen, übertragenen Gewölbe-schübe und leiten sie auf die Fun-damente ab. Die Strebebogen wer-den dabei möglichst leicht ausgebil-det, die Strebepfeiler aber möglichstschwer und erhalten gewichtigeAufsätze in Form von → *Fialen
oder Türmchen, um die stat. Ver-hältnisse zu verbessern. Bei mehr-schiffigen Anlagen werden zwi-schen den Seitenschiffen weitereStrebepfeiler errichtet, hochragen-de Schiffe können durch mehrereübereinanderliegende Strebebogenabgestützt werden (→ *Wandauf-bau). Engl. buttressing; frz. étançonnage; it. con-traffortatura, contraffortamento; sp. contra-fuerte.
Streckerverband, Binderverband,ein → Mauerwerk, das nur aus Bin-dern besteht. Frz. appareil à boutisses; it. concatenamen-to in chiave, c. di testa; sp. trabazón en ti-zón.
Streckmetall, netzartig durchbro-chenes Blech, das 1893 erstmalig inden USA hergestellt wurde und alsPutzträger dient (→ Rabitzgewebe).Engl. expanded metal; frz. métal déployé;it. lamiera stirata; sp. metal desplegado, m.extendido.
Streichbalken, 1. wandparalleles,zumeist auf Konsolen liegendesHolz, das als Auflager für eineBalkenlage dient. 2. Neben einerWand liegender Deckenbalken. Frz. poutre de bordure, p. de rive, linsoir;it. dormiente; sp. viga de retallo, junta almuro.
451 Streichbalken
Strebewerka Strebemauerb Strebepfeilerc Strebewerk (Strebepfeiler und
Strebebogen)
Streichwehr → Caponniere.
Stromschicht, Sägeschicht, imMauerverband eine Steinschicht,bei der die Steine in der Art desÄhrenwerks, d.h. schräg zur Mau-erflucht verlegt sind, tritt eine S. inder Maueransicht in Erscheinung,so bildet sie einen Zahnfries, imnorddt. Backsteinbau verbreitet. Engl. diagonal bond; it. corso obliquo;sp. hilada de ladrillos en espiga.
Stube, in einem Haus gelegener,verschließbarer, heizbarer undrauchfreier Wohnraum. Die S. istgegenüber der weiten Diele relativklein, sie hat dicht schließendeWände und eine feste, nicht zuhohe Decke und ist mit einemOfen ausgestattet, der zumeist vomVorraum beschickt wurde undeinen Schornstein besaß. Die S.war der bevorzugte Wohn- und Ar-beitsraum, der der engeren Familievorbehalten war. Die S. hat sich imnordeurop. Bauern- und Bürger-haus im frühen und hohen MA.ausgeformt und bis ins 20. Jh.gehalten. Engl. room, chamber; frz. pièce, chambre;it. camera, stanza; sp. habitación, cuarto,pieza.
Stucco lustro (it.), Stuckmarmor(Scagliola), ein seit dem Barockangewandter, marmorierter Innen-putz, der aus verschieden gefärbtenPasten geknetet, aufgetragen, gebü-gelt und poliert wurde. Engl. scagliola; frz. stucco lustro; it. stuccolustro, s. romano; sp. escayola.
Stuck, ein mit Leimwasser ange-machter Gipsmörtel. Je nach denZusätzen (Kalk, Marmor) unter-scheidet man Gipss., Weißs., S.mar-mor (Stucco lustro), Kalks., Ze-
ments. und Graus. S. ist nichtwetterfest (Gips!) und wird dahermeist in Innenräumen verwendet.Seiner spezif. Eigenschaften wegenwird er bes. zur Herstellung freiaufgetragener Dekorationen, zumZiehen von Profilen mit Schabloneoder für geschliffenen und polier-ten Wandputz verwendet (→ Stuk-katur). Engl. stucco, parget; frz. stuc; it. stucco;sp. estuco, yeso de estucar.
Stuckatur, eine aus → Stuck her-gestellte Bekleidung von Bauteilen,die an Mauerwerk aus Stein direkt,auf alle anderen Materialien nurmit Hilfe eines Putzträgers aufge-tragen werden kann. Dieser bestehtentweder aus einem Latten- oderSchilfrohrgeflecht (S.rohr), auseinem Drahtziegelgewebe (Rabitz-gitter) oder aus Holzwolleleicht-bauplatten. Unter S. versteht maninsbesondere die plast. Stuckver-zierungen, die seit dem Barock all-gemein üblich wurden. Diese kön-nen vom Stuckateur frei aufgetra-gen, mit Schablone gezogen oderaber auch in Form gegossen undals fertige Teile versetzt werden(→ Stuckdekoration). Engl. stuccowork; frz. stucage; it. stuccatu-ra; sp. estucado.
Stuckdekoration, Verzierung vonWänden und Decken in meist orna-mentaler, aber auch figürl. → Stuk-katur. Einen Höhepunkt erreichtedie S. in der Zeit des Barock undRokoko, wobei verschiedene Deko-rationsformen wie → *Bandel-werk, → Blattstab, Akanthusrankenund → *Rocaille entwickelt wurden.Engl. stucco decoration; frz. décoration enstuc; it. decorazione a stucco; sp. decoraciónen estuco.
Streichwehr 452
Stuckmarmor → Stuck.
Studiolo (lat.), kleiner, fein ausge-statteter Schreib- und Studierraummit Wand- und Deckendekoratio-nen und Wandgemälden als Haupt-schmuck, aber auch mit Skulp-turen. Im 16. Jh. ging das zumSammlungsraum über, und damitendete seine Bedeutung für West-europa. Frz., it. studiolo; sp. pequeño estudio.
Stufe, Tritt, das einzelne Steigungs-element einer → *Treppe, auch einAbsatz eines → *Stufenbergs. Dieerste S. eines Treppenlaufs ist dieAntritts., die letzte die Austritts.Die Blocks. ist eine massive S. mitrechteckigem Querschnitt, die stetsmassive Antritts. einer Holztreppe.Eine Keils. ist eine massive S. mitschräger Unterseite und ermög-licht eine kontinuierlich steigende,nicht abgetreppte Untersicht desTreppenlaufs. Bei einer Holztreppenennt man die horizontalen Tritt-bretter Tritts., sie können mit verti-kalen Setzs. verbunden sein. DasVerhältnis von S.höhe zur Auf-trittsbreite ist das Steigungsverhält-
nis (Steigung). Verändert sich dieAuftrittsbreite einer S. (z.B. bei ei-ner → *Wendeltreppe), so sprichtman von einer Spitzs. Engl. step; frz. degré, marche; it. gradino,scalino; sp. escalón, peldaño.
Stufenberg, abgestufter Unterbaueines Hochtempels mit Freitrep-pen in Mesopotamien (→ *Zikku-rat), in Hinterindien (→ *Prang,Prasat) und in Altamerika.
Stufengiebel, ein → *Giebel mitabgetreppter Kontur (→ Staffelgie-bel).
Stufenmastaba → Mastaba mit ab-gestuftem Baukörper. Der Grund-riß der S. ist im Gegensatz zu demeiner Stufenpyramide rechteckig. Engl. stepped mastaba; frz. pyramide à gra-dins; it. mastaba a gradini; sp. mastaba esca-lonada.
453 Stufenmastaba
a Blockstufe (Antrittstufe)
b Trittstufec Setzstufe
d Blockstufe(Antrittstufe)
e Keilstufe
Stufe
Stufenberg(Beispiel: Chichen-Itza, Kukulcantempel)
Stufenportal → Portal mit vonaußen nach innen zurückgestuftemGewände, so daß die meist relativgeringe Öffnung bei großen Mau-erdicken in der Fassade wesentl.erweitert erscheint. Das Gewändekann durch eingestellte Säulen, diesich in oft ornamental verziertenArchivolten fortsetzen (→ *Säulen-portal) und durch Skulpturen zwi-schen den Säulen (Säulenfiguren-portal) bereichert werden. Engl. stepped portal; it. portale a smussi;sp. portal escalonado.
Stufenpyramide, abgestufte →*Pyramide. S. kommen in Ägyp-ten, in Mesopotamien (→ *Zik-kurat), in Hinterindien (→ *Prang)und bei den altamerikan. Kulturenvor (→ *Stufenberg). Engl. ziggurat, stepped pyramid; frz. pyra-mide à gradins; it. piramide a gradini; sp. pi-rámide escalonada.
Stufenzinne, Mauerzinne mitabgetreppter Kontur. Sie kommt vorallem in Mesopotamien und in derislam. Baukunst vor (→ *Zinne). Engl. stepped merlon; frz. créneau à gra-dins; it. merlo a gradini; sp. almena escalo-nada.
Stuhl → Dachstuhl.
Stuhlsäule, senkrechter Ständerzur Unterstützung der Pfetten einer→ *Dachkonstruktion. Frz. poinçon, chandelle; it. colonnetta; sp. piederecho.
Stuhlschwelle, waagerechtes,rechtwinklig auf den Dachbalkenverlaufendes Holz, das die Druck-kräfte von Stuhlsäulen auf mehrereBalken überträgt.
Stuhlwand → Dachkonstruktion.
Stupa, Dagaba (ind.), ein aus demGrabhügel entstandener ind. Reli-quienbehälter, ein kuppelförmiger
Stufenportal 454
Stupa(Beispiel: Santschi,2. Jh. v. Chr.)
Aufbau über kreisrundem Grund-riß mit einem würfelförmigen Auf-satz. Den oberen Abschluß bildetein schirmförmiges Gebilde, Chat-tra (Tschattra, Tschatravali, Hti), ei-gentlich das Herrscherzeichen, dasman auf den Grabhügel steckte. DerBegriff Tschaitya (Gehäuftes) wirdim eigentlichen Sinn auch für S. ver-wendet. Sonderformen sind Tschor-te (in Tibet) und Tsedi (in Birma). Engl., frz., it., sp. stupa.
Sturmlatte, schwache Hölzer, diegegen den Winddruck kreuzweiseübereinander zwischen die liegen-den Stuhlsäulen oder an der Innen-seite der Sparren angebracht wer-den (→ Windrispe). Engl. sprocket; frz. auvent, poinçon ram-pant, queue de vache; it. controvento;sp. riostra de contraviento.
Sturz, gerader oberer Abschlußeiner Tür- oder Fensteröffnung(→ *Scheitrechter S.). Engl. lintel; frz. linteau, sommier; it. archi-trave; sp. dintel.
Sturzbalken → Sturz.
Sturzbogen, segmentbogenför-miger Abschluß einer Fenster- oderTüröffnung, mißverständl. auchfür einen → *Scheitrechten Sturz. Engl. flat arch; frz. arc en plate-bande; it. ar-co ribassato (di porta o di finestra); sp. arcoachatado.
Sturzpfostenportal, einfachstePortalform, bei der zwei aufrecht-stehende Monolithe als seitl. Be-grenzung und ein Sturz den hoch-rechteckigen Durchgang rahmen,eine seit vorgeschichtl. Zeit übli-che und bes. im Profanbau bisheute gebräuchl. Form. It. trilite; sp. portal sencillo.
Sturzriegel, waagerechtes Holz(Riegel) über der Tür- oder Fen-steröffnung eines → Fachwerk-baus. Engl. lintel, transom; frz. poirtail; it. archi-trave (di legno); sp. tirante, traversa.
Stütze, aufrechtes, meist stabför-miges Bauglied, das je nach seinemQuerschnitt als Säule oder alsPfeiler bezeichnet wird. Im Holz-bau nennt man die S. Pfosten, Stän-der, Mast, Steher, Stiel oder auch→ *Säule. Engl. support, column, pillar; frz. support,colonne, poteau; it. puntello, colonna,pilastrino; sp. soporte, columna de apoyo,pilar d. a.
Stützenstellung, Folge von Stüt-zen in einer Reihe oder in Stock-werken. Die S. kann mit gleichenStützabständen (→ *Interkolum-nium) in fortlaufender, oder mitabwechselnd kürzeren und länge-ren Abständen in rhythm. Reihungausgebildet sein. Bei einem Wech-sel der Stützenform einer S. sprichtman vom → *Stützenwechsel. BeiStockwerksanordnung können Säu-lenabstände und Säulenordnungenwechseln. → *Palladio-Motiv.(Abb. S.456)Sp. serie de soportes.
Stützenwechsel, ein wiederkeh-render Wechsel von Pfeilern und
455 Stützenwechsel
Stütze
V-Stütze Kreuzstütze
Säulen, bei dem ein Pfeiler auf eineoder mehrere Säulen folgen kann. Engl. alternating supports; frz. alternance desupports; it. alternanza dei supporti; sp. so-portes dispuestos alternadamente.
Stutzkuppel, Kuppel, deren Fuß-kreis über die Grundfläche desüberwölbten Raums hinausreichtund deren Gewölbeanfall an denÜberschneidungsstellen mit derGrundfläche endet; an diesen Stel-len spannen sich offene Bogen, oderes erhebt sich eine Aufmauerungmit Schildbogen. → *BöhmischeKappe. Frz. coupole pendante, dôme pendant; it. vol-ta a vela a sesto ribassato; sp. bóveda esférica.
Stützmauer, eine Mauer aus Back-stein, Naturstein oder Beton, dierutschgefährdete Erde, Felsen u.dergl. stützen soll. Engl. supporting wall; frz. mur de soutène-ment; it. muro di sostegno; sp. muro deapoyo.
Stützweite → Spannweite, für diestat. Berechnung maßgebende Ent-
fernung zwischen den senkrechtenMittellinien der beiden Auflager ei-nes Trägers im Unterschied zu derkleineren, freien Länge zwischenden inneren Kanten der Auflage. Engl. span, bearing distance; it. luce, distanzatra gli appoggi; sp. distancia entre los apoyos.
Stylobat (gr.), oberste Stufe desantiken Tempelunterbaus (Stereo-bat), auf dem die Säulen aufruhen.→ *Dorische Ordnung.
Stutzkuppel 456
Stützenwechsel1 Niedersächsischer Stützenwechsel2 Rheinischer Stützenwechsel
Stützenstellung1 Geschoßanordnung (am dor. Tempel)2 Rhythmische Anordnung3 Geschoßanordnung (mit verschie-
denen Säulenordnungen)
Subsellien (lat.), Sessel der Beam-ten und Würdenträger im gr. Thea-ter (→ Theaterbau), aber auch diein der Apsis umlaufende, steinerneSitzbank.
Substruktion (lat.), Unterbaueines Bauwerks auf wenig tragfähi-gem Grund bzw. zur Herstellungeiner ebenen, horizontalen Fläche. Engl. substructure; frz. substruction; it. so-struzione; sp. subestructura.
Sudatorium (lat.), Schwitzraumin einer röm.→ Therme.
Supermullion (engl.), entspre-chend der → Mullion Fortsetzungder Stäbe im Bogenfeld des →*Maßwerks; senkrechter Stab, derauf der Spitze des die Fensterbah-nen abschließenden Bogens beginntund bis zum Fensterbogen einesMaßwerkfensters im → Perpendi-cular Style reicht.
Supertransom (engl.), horizonta-ler Stab (Maßwerkbrücke), derzwei oder mehrere Mullions oder
Supermullions im Couronnementeines Maßwerkfensters verbindet,im engl. → Perpendicular Style vor-kommend.
Supraporte, Sopraporte (lat.), einein der Renaissance und Barockzeitoft bildl. oder dekorativ belebteund gerahmte Fläche über demTürsturz. Engl. sopraporta, overdoor; frz. fronton,dessus de porte; it. sovrapporta; sp. sobre-puerta.
Symbol (gr.), ein abstrahiertesKennzeichen oder Sinnbild füreinen Begriff (→ Bausymbolik).
Symmetrie (gr.), urspr. die Aus-gewogenheit im Verhältnis desGanzen zu seinen Teilen, späternur noch die Spiegelgleichheit aufeine Mittelachse bezogener Teileeines Ganzen (→ Pendant). Engl. symmetry; frz. symétrie; it. simmetria;sp. simetría.
Synagoge (gr.), Bethaus und Kult-stätte der Juden. Der Innenraumhat manchmal Emporen für dieFrauen. Die Einrichtung siehteinen Platz für den Vorleser undauf einem erhöhten Standort zwi-schen siebenarmigen Leuchtern
457 Synagoge
Supraporte
Synagogea Emporeb Schrein (Bundeslade)c Almemor
einen Schrein für die Gesetzes-rollen vor. Die Kanzel für Bibel-lesungen (Bima, Almemor) stehtin der Mitte oder bei der Eingangs-wand des Raums. Die Blickrichtungder Gemeinde geht zur Eingangs-wand, die nach Jerusalem weist. Dieältesten S. gehen nicht über diespäthellenist. bzw. röm. Epochezurück. Engl., frz. synagogue; it., sp. sinagoga.
Systylos (gr.), Säulenstellung, de-ren → *Interkolumnium zwei un-tere Säulendurchmesser beträgt.
T
Tabernae (lat.), röm. Läden fürden Einzelverkauf, sie lagen im Erd-geschoß der Mietshäuser entlangder Hauptstraßen, an den Markt-plätzen häufig in festen Laden-zeilen, oft hinter Säulengängen.
Tabernakel (lat.), 1. das im röm.Militärwesen als tabernaculum be-zeichnete Zelt wird als Begriffauch auf zelt- und baldachinartigeAnlagen und Bauteile übertragen;so werden vor die Fassade vor-springende Ädikulen mit einge-stellten Statuen an späthellenist.und röm. Prachtbauten T. genannt.2. Seit dem 12. Jh. verwandte Be-zeichnung für Gefäße und Schrei-ne, in denen eucharist. Elementeund Öl für die Krankensalbungaufbewahrt werden, später auchfür Monstranzen verwandt. DieBezeichnung lehnt sich an das Zeltdes Alten Testaments an, das zurAufbewahrung der Bundesladediente und als Wohnung Gottes
galt. 3. Allgemeine Bezeichnungfür den von Stützen getragenenÜberbau eines Altars (→ *Zibo-rium). 4. Von 1. und 3. abgeleiteteBezeichnung für einen von Säulenund Spitzdach gebildeten, zumeistviereckigen Aufbau mit oder ohneeingestellter Statue in der got.Baukunst, zu unterscheiden voneiner → *Fiale. Engl., frz. tabernacle; it. tabernacolo; sp. ta-bernáculo.
Tablettmauer (frz.), Futtermauerder äußeren Brustwehrböschungüber dem Kordon.
Tablinum (lat.), Hauptraum undSpeisesaal des röm. → *Wohnhau-ses, meist an der Rückseite des Atri-ums gegenüber dem Eingang gele-gen (→ Triklinium).
Tabor, mit Wällen umgebenes La-ger der Hussiten, später in Öster-reich und auf dem Balkan kastell-artiger Burgtyp, auch Kirchenburg.
Tabularium (lat.), Gebäude zurAufbewahrung öffentl. und priva-ter Urkunden, bes. im antiken Rom.
Tabulariummotiv, röm. Joch,Wandgliederung aus Pfeilerarka-den, denen Halbsäulen auf Posta-menten mit Architrav vorgeblendetsind.
Tacara → Tatschara.
Tadsch (arab.), im Irak: Kapitell;in Indien: Rahmung des → Mihrab.
Taenia, vorspringende Leiste amEpistyl der → *Dorischen Ordnung.
Tafelbau → Plattenbauweise.
Systylos 458
Täfelwerk, Täfelung, Wand- oderDeckenbekleidung mit Holztafeln. Engl. paneling, wainscoting; frz. tabletterie,lambrissage (en bois); it. rivestimento li-gneo, boiserie; sp. revestimiento de madera,artesonado, entarimado.
Talar (pers.), die Säulenhalle desvorderasiat. und pers. Hauses, diesich zum Hof oder Garten öffnetund zu beiden Seiten von Räumenumgeben ist.
Talayoten, mit den → Nuragenverwandte und nach oben verjüng-te steinerne Rundtürme, die in vor-geschichtl. Zeit auf den Balearenerrichtet wurden. Frz. talayot(s); it. talayotz; sp. talayotes.
Talsperre, Staudamm quer überein Tal, dessen Wasser zur Energie-gewinnung oder Bewässerung ge-nutzt wird. Engl. barrage, dam; frz. barrage (de vallée);it. diga a valle; sp. represa de valle.
Taltempel, der an der Grenze vonFruchtland und Wüste gelegeneTorbau eines ägypt. Totentempels(→ *Grabtempel). Engl. valley temple; frz. temple de vallée;it. tempio in valle; sp. templo de valle.
Tambour (frz. Trommel), 1. zy-linderförmiger oder polygonalerUnterbau einer Kuppel, auch mitFenstern. 2. Torschanze, Sperrbe-festigung aus Palisaden mit Schieß-löchern, häufig vorhofartig voreinem Tor,Vorläufer der → *Barba-kane. Engl., frz. tambour; it. tamburo; sp. tambor.
Tambourkuppel, eine über einemTambour errichtete → *Kuppel.
Tanzhaus, Hochzeitshaus, Saalge-bäude für festl. Veranstaltungender Bürger in spätma. und früh-neuzeitl. Städten, bestehend auseinem großen Saal und Nebenräu-men, aus Stein oder Fachwerk er-richtet, zumeist zweigeschossig. Engl. dance hall; frz. salle de danse; sp. salónde baile.
Tapete (lat.), eine meist gemuster-te Wandbekleidung aus Geweben,Tapisserien, Leder, Papier oderHolz (Furnier). Engl. wallpaper; frz. papier peint, tenture;it. stoffa da parati, carta da p.; sp. tapiz, em-papelado, colgadura.
Tapetentür, eine unauffällige Zwi-schentür mit verdecktem Rahmenund bündig in der Wandfläche lie-gendem, tapeziertem Türblatt. Engl. concealed door, jib d.; frz. porte déro-bée, p. recouverte de tapisserie; it. portatappezzata; sp. puerta tapizada.
Tapisserie (frz.) → Wandteppich.
Tarma, Tarimah (arab.), eine Vor-halle oder eine Säulenhalle im In-nenhof des arab. → *Wohnhauses,mit dem gr. Peristyl vergleichbar.
Taschana, Takhana (pers.), derunterird. Wohnraum des pers.Hauses, der während der heißenJahreszeit aufgesucht wird.
Tas-de-charge (frz.) → Anfänger.
Tatschara, Tacara (pers.), Wohn-halle pers. Paläste, die in der kaltenJahreszeit benutzt wurde, Winter-palast.
Taufkapelle → *Baptisterium.
459 Taufkapelle
Taukreuz, T-Kreuz, T-förmigesKreuz mit abschließendem oberemQuerbalken (→ Antoniuskreuz). Engl. twisted rope cross; frz. croix de Saint-Antoine; it. croce a tau; sp. cruz de tau.
Taustab, tauartig gedrehter → *Stabals Schmuckglied der normann.und roman.Architektur des 12. Jhs.sowie im dt. Fachwerkbau des15. /16. Jhs. Engl. rope moulding; frz. câble torsadé;it. cordeliera, treccia; sp. entorchado.
Teilgewölbe, 1. die in ein → *Ge-wölbe einschneidenden Zwickel(Stichkappen). 2. Die zwischen ei-nem Gewölbe und seinem Unter-bau vermittelnden Wölbungen(Pendentifs, → Kuppel, → *Trom-pe). Engl. squinch arch; frz. dôme à pendentifs(courbes); sp. bóveda con pechinas.
Tekje, Tekke (türk.), islam. Kloster.
Tektonik (gr.), struktureller Auf-bau eines Gebäudes, wobei die Ein-zelteile technisch wie formal einekünstler. Einheit bilden. Gegensatzdazu: → Atektonisch. Engl. tectonics; frz. tectonique; it. tettonica;sp. tectónico.
Telamon (gr.), Gebälkträger (→*Atlant, → *Gigant).
Telesterion (gr.), Bau für eine ver-sammelte Gemeinde bei sakralenHandlungen gr. Mysterienkulte,als großer Säulensaal angelegt,zumeist über Treppen erhoben.
Tellerkapitell, ein dem Kelchka-pitell verwandtes → Kapitell, dasoben von mehreren übereinander-liegenden Scheiben abgeschlossenist.
Temenos (gr.), Altis, auch Peri-bolos, der durch eine Mauer oderSäulenhalle begrenzte und durchein Propylon zugängl. gr. → *Tem-pelbezirk.
Tempelbau, 1. den Kern des gr.und des röm. Tempels bildet dieCella (Naos), deren Tür meist ander Ostseite liegt. Während diesergegenüber im Innern das Götterbildmanchmal in einem bes. Raum(→ *Adyton, Abaton) steht. DieCella erhebt sich über einem drei-stufigen Unterbau (Stereobat, Kre-pis oder Krepidoma), dessen ober-ste Stufe Stylobat (Eutyntherie)heißt. Die unterste Schicht desmeist aus gleichgroßen (isodomen)Quadern errichteten Cellamauer-werks bildet ein Sockel mit Abdeck-platten und manchmal größeren,oft hochkant stehenden Orthosta-ten. Die die Cella meist umgeben-den Säulen (→ *Tempelformen)stehen am Rande des Stylobats, deroft nicht eben, sondern zur Mitteleicht überhöht ist. Diese opt. Kor-rektur teilt sich auch noch demGebälk mit und wird → Kurvaturgenannt. Die Säulenschäfte sindverjüngt und entweder aus einemStück (monolith) oder aus mehre-ren Zylindern (Trommeln) zusam-
Taukreuz 460
Tempelbau 1(Beispiel: Olympia, Zeustempel,
5. Jh. v. Chr.)
mengesetzt und verdübelt (→ *Säu-le). Die Kapitelle der Säulen leitenzum Gebälk (Epistyl) über, das inArchitrav, Fries und Kranzgesims(Geison) gegliedert ist und bei Holz-konstruktionen auch mit Terra-kotten bekleidet sein kann (→ *An-tefixa). Den Abschluß bildet die mitWasserspeiern versehene → *Rinn-leiste (Sima) am Dachsaum. DieDachkonstruktion ist immer ausHolz. Die Traufziegel (Stirnziegel)sind bes. ausgebildet (→ *Dachdek-kung). Auch das Giebelfeld (Tym-panon, Aëtoma) wird von einemschrägen Geison und einer Sima be-grenzt. Die Ecken des Giebels sindwie dessen Spitze von → *Akro-terien bekrönt. Ist die Cella für dieÜberdeckung zu breit, so könnenim Innern Mauerzungen aufgebautoder der Innenraum durch Säulenin Schiffe unterteilt werden. Das dieCella umgebende Pteron (Peri-dromos) ist meist durch eine stei-nerne Kassettendecke (→ *Kassette),deren Felder ornamental verziertsein können, abgeschlossen. Baupla-stik ist beim antiken Tempel auf
den Metopen der → *DorischenOrdnung, auf den Friesen der att.→ *Ionischen Ordnung und in denGiebelfeldern, seltener im Innernoder an der Außenseite der Cellazu finden. Die Tempel sind meistaus Marmor errichtet, doch wur-den auch gröbere Gesteine ver-wandt, die mit Stuck überzogenwurden. Fast der ganze Tempel, zu-mindest aber dessen wichtigste Tei-le, waren bunt bemalt (→ *Poly-chromie). Der Tempel kann isoliertsein, steht aber meist in einem→ *Tempelbezirk (Heiliger Bezirk,Altis, Temenos), dessen Umfas-sungsmauern von einer innerenSäulenhalle (Peribolos) begleitetsein können. Der röm. Tempel liegtoft nach etrusk. Vorbildern auf ei-nem hohen Unterbau und wird des-halb → *Podiumtempel genannt.Auf das Podium führt nur eineFreitreppe an der Frontseite, mitmanchmal von Skulpturen ge-schmückten Wangen. Der Tempel-bezirk einer röm. Stadt wirdmanchmal in Anlehnung an denHaupttempelbezirk von Rom Ka-pitol genannt. Nach der Gottheit,der der Tempel geweiht ist, nenntman ihn Olympieion (Zeus),Heraion (Hera), → Asklepieion(Asklepios), → *Nymphäum(Nymphen) und → *Mithräum(Mithras).
461 Tempelbau
A HofB VorhalleC Säulensaal
D BarkenkammerE Saal
Tempelbau 2(Beispiel:Theben-Karnak, Chonstempel,
20. Dynastie)
Tempelbau 3(Beispiel: Babylon, Ninmachtempel)
2. Die Ägypter errichteten → *Grab-tempel (Totentempel), die im Al-ten Reich vor der Pyramide lagenund aus Taltempel, Aufweg undTotenopfertempel bestanden. Derägypt. Tempel war meist ein recht-eckiger, ummauerter Bezirk. DieFront bildete der → *Pylon mitdem Tempeltor. Es folgen ein Hof(oder mehrere Höfe), von Säulenumgeben, eine Vorhalle, ein meistquer gelagerter → *Säulensaal (Hy-postyl) mit basilikal erhöhtemMittelschiff (ägypt. Saal). Den Ab-schluß bildete die Barkenkammer(Sekos) mit dem Götterbild. Vordem Pylon können Kolossalstatuenoder → *Obelisken angeordnetsein. Bei Tempeln der Spätzeitsteht vor dem Eingang auch ein→ *Geburtshaus (Mammisi). Wid-der- oder Sphingenalleen begleitenden Weg zum Tempeltor. Sonder-formen des ägypt. Tempels sind der→ *Terrassentempel, der → *Höh-len- bzw. Felsentempel, der demApis (Serapis, → Serapeum) undder der Göttin Hathor geweihteTempel (Hathortempel).3. In Mesopotamien sind die Tem-pelanlagen meist um einen odermehrere Tempel gruppierte Kult-bezirke, oft ohne axiale Beziehungzum Eingang. Eine von den Su-
merern entwickelte Sonderform istder Stufenberg (→ *Zikkurat), aufdem ein über Freitreppen erreich-barer Hochtempel stand, den manals Wohntempel der Gottheit ansah(Turm von Babylon).4. Bei den altamerikan. Kulturensteht der Tempel bzw. die Götter-cella häufig auf einem → *Stufen-berg (Pyramide). Die aztek.Tempelheißen → Teocalli und waren vongroßen Höfen umgeben. Manch-mal kommen auch zwei Götter-zellen, zu denen zwei Freitreppen
Tempelbau 462
Tempelbau 4 (Beispiel:Chichen-Itza,Jaguartempel)
Tempelbau 5(Beispiel: Somnathpur, Keshavatempel,
13. Jh.)
an der Front der Stufenpyramideemporführen, nebeneinander vor.Ebenso häufig standen aber dieKultplätze auf Terrassen.5. In Indien ist der Tempelgrund-riß meist dreiteilig. Auf eine odermehrere offene Versammlungs-hallen (→ *Mandapa, in SüdindienTschaultri) mit Vorhallen (Antara-la) folgt die Cella (Garbha Griha),in der ein Lingam als Kultsymbolsteht. Über der Cella ist meist einhoher Turm (→ *Sikhara) aufge-baut, dessen Grundriß quadrat.(Nagara), aber auch achteckig (Dra-vidha) oder rund sein kann. Cellaund Turm zusammen werden inSüdindien Vimana genannt. Bei ei-nem sitzenden Götterbild kommtanstelle des Sikhara auch ein flachesKuppel- oder Walmdach (→ *Asa-na) vor. Sonderformen sind Tem-pel mit Kleeblattabschluß und dreiCellaräumen um die → Mandapaund der → Doppeltempel mit zweinebeneinanderliegenden Manda-pas. Ein → *Felsentempel, der meistmonolith aus dem Felsgestein ge-hauen und dem Götterwagen nach-
gebildet ist, wird ebenso wie ande-re Sonderformen → *Ratha ge-nannt. Die → *Tschaityahalle istein Höhlenheiligtum.6. Bei den hinterind. Anlagen kön-nen Tempel in einem großen Klo-sterbezirk (Vat) stehen und voneinem Glockenstupa (Stupa) odereinem → Phraprang oder einem→ Phra Chedi abgeschlossen sein.Auch können Göttercellen auf ei-nem Stufenberg stehen (→ *Prang,Prasat) und mit einem stufenpyra-midenförmigen Aufbau versehensein (Tschandi). Ein Turmaufbaumit ungerader Geschoßzahl übereinem Thronbau wird Pyatthatgenannt.
463 Tempelbau
Tempelbau 6(Beispiel: Tempel vomTypus Orissa)
Tempelbau 7(Beispiel: Nara, Horyuii-Traumhalle, 8. Jh.)
7. Die ostasiat.Tempelanlagen sinduns hauptsächl. durch japan. Bei-spiele, die zahlreiche Einzelge-bäude in gestufter Struktur zeigen,bekannt. Die Hauptachse verläuftin nord-südl. Richtung, das Ein-gangstor liegt im Süden. Die Haupt-gebäude (→ *Goldene Halle, Pre-digthalle) sind zentral an dieserAchse aufgereiht und von Neben-gebäuden symmetr. umgeben. DieStellung der → *Pagoden ist ver-schieden. Außerdem gibt es Hallenfür die vier Himmelskönige, Pavil-lons für Glocke und Pauke, Spei-cher und Wandelhallen. Die Hallen
sind Holzständerbauten mit inne-ren und äußeren Stützen, so daßdas Heiligtum umschreitbar ist.Mehrgeschossige Hallen sind sel-ten, die oberen Geschosse sind nurdekorativ aufgesetzt. Charakterist.sind die Gruppen zahlreicher Sat-telhölzer, der weite Dachvorsprungund das geschwungene Irimoya-Dach.
Tempelbezirk, ein heiliger Bezirk,in dessen Zentrum ein oder meh-rere Tempel stehen und der von ei-ner Mauer umgeben wird, an derenInnenseite Kammern (→ *Schatz-
Tempelbezirk 464
GriechischerTempelbezirk(Beispiel: Delphi,Altis)
A ApollotempelB AltarC TheaterD Schatzhäuser
häuser) oder Säulenhallen liegenkönnen. Der T. ist durch einen odermehrere Torbauten (Propylon) zu-gängl. In Griechenland wird der T.Temenos, Altis oder Peribolos, in
Rom häufig Kapitol genannt. Auchin Indien, Ostasien und in Alt-amerika gibt es große T., die durcheine Einfriedung (Prakdra, Vedika)abgeschlossen und durch Torbau-
465 Tempelbezirk
Indischer Tempelbezirk(Beispiel: Madura, Minakshi-Sundareshvara-Tempel, 17. Jh.)
AltamerikanischerTempelbezirk(Beispiel: Chichen-Itza,Stadt des RegengottesChac)1 Ballspielplatz mit
Jaguartempel2 Terrasse des
Schädelgerüstes3 Adlertempel4 Morgensterntempel5 Kukulcantempel6 Kriegertempel7 Tausendsäulenkomplex8 sog. Hohepriestergrab9 Caracoltempel
(Observatorium)10 Wandtafeltempel
ten (in Indien: Gopuram) zugängl.sind und in denen mehrere Tem-pel, Pagoden oder andere Kultbau-ten stehen, manchmal auch heiligeTeiche (in Indien: Teppakulam) lie-gen (→ *Tempelbau, → *Akropolis). Engl. temple precinct; it. area sacra; sp. re-cinto del templo.
Tempelformen, beim gr. undröm. Tempel unterscheidet man jenach der Grundrißform, der An-ordnung der Anten bzw. Säulen ander Stirn des Tempels und demSäulenkranz verschiedene T. DerKern ist die aus dem → *Megaronhervorgegangene Cella (Naos), inderen hinterem Teil ein Allerhei-
ligstes (→ *Adyton, Abaton) liegenkann. Diese T. ohne Säulen nenntman Astylos. Der Antentempel hateinen Pronaos zwischen → Anten.Wiederholt sich diese Anordnungan der Rückseite der Cella (→ Opis-thodomos), so spricht man vomDoppelantentempel. Ist der Opis-thodomos nur als Scheinarchitek-tur angedeutet, so spricht man voneinem Pseudo-Opisthodomos. Istder Tempelfront eine Säulenhallevorgelegt, nennt man den Tempeleinen Prostylos, und falls sich dieseAnordnung an der Rückseite wie-derholt, einen Amphiprostylos. EinTempel mit Wandsäulen anstelleder Frontsäulen heißt Pseudopro-stylos. Tempel ohne Säulen an denLangseiten heißen Apteraltempel.Hat der Tempel ringsum ein Pte-ron, das den um die Cella laufen-den Umgang (Peridromos) enthält,so heißt er Peripteros. Ist dieserSäulenkranz an den Langseiten nurdurch Wandsäulen vorgeblendet,ohne daß ein Peridromos entsteht,so heißt der Tempel Pseudoperi-pteros. Ein Tempel mit doppeltemSäulenkranz ist ein Dipteros. EineT. mit Doppelpteron ohne zweiteSäulenstellung oder einfachem Pte-ron mit Wandsäulen heißt Pseu-dodipteros. Rundtempel, die voneinem Säulenkranz umgeben sind,nennt man → Tholos oder (ohneCella) → *Monopteros. Nach derZahl der Frontsäulen bezeichnetman die Tempel als Tetrastylos(vier Säulen), Pentastylos (fünfSäulen), Hexastylos (sechs Säulen),Heptastylos (sieben Säulen), Okta-stylos (acht Säulen), Dekastylos(zehn Säulen), Dodekastylos (zwölfSäulen) und Polystylos (vielsäulig).Wichtig für die Erscheinung desTempels ist auch das → *Interko-
Tempelformen 466
Römischer Tempelbezirk(Beispiel: Baalbek)
A VorhofB AltarhofC ReinigungsbeckenD BrandaltarE Tempel des Jupiter Heliopolitanus
lumnium. Nach dem Verhältnis vonInterkolumnium zu Säulendurch-messer unterscheidet man dichtsäu-lig (pyknostylos), engsäulig, diasty-los, eustylos, systylos, aräostylos(lichtsäulig). Sonderformen sindder röm., auf einem Podium ste-hende → *Podiumtempel, der nurüber eine Fronttreppe zugängl. ist,der → *Hypäthraltempel ohne Dachüber der Cella und der → *Dop-peltempel, bei dem zwei Cellaräu-me, die verschiedenen Gottheitengeweiht sind, neben- oder hinter-einander liegen.
Templon, → Ikonostasis einer by-zant. Kirche in Form einer → *Ko-lonnade.
Tenaille (frz. Zangenbewegung),Scherwerk, Zange, niedriges, vorder → Kurtine im Hauptgrabengelegenes Außenwerk aus zwei Fa-cen, die einen einspringenden Win-kel bilden. Engl., frz. tenaille; it. tenaglia; sp. tenaza.
Tenaillon (frz.), ein Ravelin mitzwei halben → Contregarden (vorjeder Face eine), die einen einge-henden Winkel bilden und durcheinen Redan oder ein anderes
467 Tenaillon
Tempelformen1 Tholos2 Antentempel3 Doppelantentempel4 Prostylos5 Amphiprostylos6 Peripteros7 Pseudoperipteros8 Dipteros9 Pseudodipteros10 Pseudodipteros
Außenwerk gedeckt sind, ähnl. dengroßen Lünetten. Frz. tenaillon; it. tenaglione; sp. tenallón.
Tenne, der Teil einer Scheune, derzum Dreschen des Getreides dient.Beim → *Schwarzwaldhaus kommtoft eine Hochtenne mit günstigerZufahrt von der Bergseite vor. Engl. threshing floor; frz. aire; it. aia; sp. era.
Teocalli (aztek.), ein auf einer Stu-fenpyramide errichteter → *Tem-pelbau der Azteken.
Tepidarium (lat.), lauwarmes Badeiner röm. → *Therme.
Teppakulam (tamil.), ein heiligerTeich für rituelle Bäder in einemsüdind. Tempelbezirk.
Terrakotta (it.), unglasierter ge-brannter Ton als → *Baukeramik,meist dekoriert (Fries) und mitReliefs geschmückt.
Terrasse (frz.), eine nicht über-deckte, künstl. geebnete, waage-rechte Fläche. Auf von der Um-gebung abgehobenen T. wurdenassyr. und pers. Paläste und altame-rikan. → *Tempelbauten errichtet.Auch in barocken → *Gärten spie-len T. eine bedeutende Rolle(→ *Terrassentempel). Engl. terrace; frz. terrasse; it. terrazza; sp. ter-raza.
Terrassendach, ein als begehbareTerrasse angelegtes → Flachdach. Engl. terrace roof; frz. toit-terrasse, plan-cher-t.; it. tetto a terrazza; sp. techo terraza.
Terrassenhaus, ein Haus, dessenGeschosse stufenförmig versetztsind, so daß jedes Stockwerk eineDachterrasse hat. Das T. kommtmeist bei Hanglage im VorderenOrient, in Mesopotamien und inIndien vor. Auch die Pueblos deraltamerikan. Kultur sind ähnl. aus-gebildet. Das T. wird auch im mo-dernen Wohnbau verwandt. Engl. terrace house; frz. maison en terrasses;it. casa a gradoni; sp. edificio escalonado enterrazas.
Terrassentempel, Tempel, die aufeiner Terrasse ruhen, wie manchealtamerikan. → *Tempelbauten,
Tenne 468
Terassenhaus(Beispiel: A. Loos, Haus Scheu,Wien,
1912)
A VorhofB Mittlerer HofC Haupthof
Terrassentempel(Beispiel: Theben � Der el bahri, Tempelder Hatschepsut, 18. Dynastie)
oder in mehreren Terrassen, diedurch Rampen miteinander ver-bunden sind, ansteigen, wie ägypt.Grabtempel. Engl. terraced temple; frz. temple en ter-rasses; it. tempio su terrazzamento; sp. tem-plo escalonado en terrazas.
Terrazzo (it.), urspr. ein venezian.Estrich aus Kalk und Steinstück-chen, der in mehreren Schichtenaufgetragen werden muß. Heutewird der Begriff auch für zement-gebundene Kunststeinestriche ver-wandt. Engl., frz., it. terrazzo; sp. piso veneciano.
Tetrakonchos (gr.), Zentralbaumit vier Konchen um ein Quadrat.
Tetrapylon (gr.), Quadrifrons(lat.), ein vierseitiger Torbau mitÖffnungen auf jeder Seite.
Tetrastylos (gr.), Tempel mit vierSäulen an der Frontseite (→ *Tem-pelformen).
Thalamos (gr.), Frauengemachund Schlafgemach im gr. → Wohn-haus.
Theaterbau, das gr. Theater ist soin die Landschaft eingefügt, daß dieSitzreihen auf dem natürl. Geländeaufruhen. Ein Altar (Thymele) imZentrum der als kreisrunder Tanz-platz ausgebildeten Orchestra bil-det die Mitte des Theaters, um diekonzentr. Sitzstufen ansteigen. Zwi-schen diese ist manchmal ein etwasbreiterer Umgang (Diazoma) ein-
469 Theaterbau
Tetrapylon. Ansicht und Grundriß
Griechisches Theater(Beispiel: Epidauros, Teilrekonstruktion)
A OrchestraB Sitzreihen (Kerkides)
Römisches Theater(Beispiel: Orange)
A Orchestra B SitzreihenC Scenae frons D Proscenium
E Paraskenien
C SkeneD Parodoi
gefügt. Die Sitzränge sind durchradiale Treppen in einzelne Sekto-ren (Kerkides) unterteilt. Hinter derOrchestra ist meist ein Bühnen-haus (Skene) für Theaterrequisitenangefügt, das aber kaum eine archi-tekton. Bedeutung hat, jedoch miteinem Vorbau (Hyposkenion) ver-sehen sein kann. Zwischen Skeneund Zuschauerrängen liegen seitl.die Eingänge (Parodoi). Die Sesselder Beamten und Würdenträger(Subsellien) sind meist am Randeder Orchestra, seltener am Diazo-ma zu finden. Das röm. Theatersteht meist ohne Rücksicht auf dasGelände in einer Stadt, so daß dieSitzstufen durch Umgänge und
Treppenanlagen unterbaut werdenmüssen. Das Bühnenhaus wirdjetzt als Scenae frons in gleicherHöhe wie die Sitzränge ausgebautund mit diesen durch die Paraske-nien so verbunden, daß ein rings-um geschlossenes Gebäude ent-steht. Der Platz, auf dem gespieltwird, ist jetzt nicht mehr dieOrchestra, sondern die der Scenaefrons vorgelagerte und von denParaskenien seitl. begrenzte Bühne(Proscenium), deren mittlerer TeilPulpitum heißt. Die Schauwandder Scenae frons ist in mehrerenStockwerken durch Säulenstellun-gen, Nischen, Aedikulen, Gebälkeund Gesimse gegliedert. Das ober-ste Geschoß heißt bei VitruvEpiscenium (→ *Amphitheater).Die Renaissance nahm die Grund-konzeption des röm. Theaters wie-der auf, doch wurden die Theaterin allen Fällen überdacht. Beim
Theaterbau 470
Renaissancetheater(Beispiel: Vicenza, Teatro Olimpico,
A. Palladio)
Theater mit veränderlichem Bühnen- und Zuschauerraum
(Beispiel: W. Gropius, Totaltheater, 1922)A Bühne B Drehbühne mit Sitzplätzen
Typ des barocken Logentheaters(Beispiel: Paris, Odeon, 1799)
Barocktheater wurden die amphi-theatral. Zuschauerränge durchEmporen (Ränge, Galerien) mitLogen ersetzt, während das Parkettund das dahinterliegende Parterrezunächst von Bestuhlung frei blieb.Die Bühne wurde durch einenBühnenrahmen, durch Proszeni-umslogen und durch den Orche-stergraben vom Zuschauerraumgetrennt und war für vielfältigeillusionist. Verwandlungen einge-richtet (Guckkastenbühne). Dermoderne T. hat dieses barockeSchema übernommen. Es wirdversucht, die bisherige Guckkasten-bühne durch eine mit dem Zu-schauerraum verbundene Raum-bühne zu ersetzen. Auch auf rascheUmwandlungsmöglichkeit dieserSysteme im gleichen T. wird Wertgelegt, wobei der Orchestergrabenzwischen Parkett und Bühne über-deckt werden kann. Das Bühnen-haus wird durch komplizierte tech-nische Einrichtungen, wobei dieBühnenbilder und Kulissen in dieOberbühne aufgezogen, in die Un-terbühne versenkt, in die Seiten-bühnen abgeschoben oder mitDrehscheiben verändert werdenkönnen, ein sehr großer Baukör-per, der auch in der Außener-scheinung des T. stark mitspricht. Engl. theater; frz. théâtre; it. teatro; sp. con-strucción del teatro.
Thermen (gr.), röm. Badeanlagen.Zwar hatten bereits die gr. Gym-nasien Bäder, doch haben erst dieRömer die Bäder systematisch zugroßen Anlagen weiterentwickelt,die streng symmetr. angeordnetsind. Auf den Auskleideraum (Apo-dyterium, Vestiarium) folgen dasKaltbad (Frigidarium) mit einemSchwimmbecken (Piscina), das lau-
warme Bad (Tepidarium) und dasheiße Bad (Caldarium). Danebengab es Salbräume (Aleipterion), dasSchwitzbad (Sudatorium) und eineganze Reihe weiterer Einrichtun-gen. Die Heizung wärmte Luft, diedurch unterird. Kanäle (→ *Hypo-kausten) und in Wandkanälen (Zu-buli) weitergeleitet wurde. Wäh-rend das Frigidarium oft nichtüberdeckt ist, können über demTepidarium Kreuzgewölbe vor-kommen, die von Quertonnen überseitl. Nebenräumen verspannt sind.Das Caldarium ist oft ein von einerKuppel überwölbter Zentralraum.Dieser Grundtyp wird in den ein-zelnen röm. Provinzen, vor allem
471 Thermen
Schema einer Therme
A Apodyterium F FrigidariumC Caldarium T Tepidarium
P Palästra1, 2, 3 Wasch-, Schwitz-, Massageräume
Doppeltherme mit vierThermalbaderäumen
(Beispiel: Badenweiler)
aus regionalen Gründen, starkvariiert. So liegt nördl. der Alpendas Caldarium meist an derSüdseite der T. Bei Thermalbäderngibt es weitere Differenzierungen.Die Tradition der röm. T. lebte imtürk. Bad (→ *Hammam) fort. Frz. thermes; it. terme; sp. termas.
Thermenfenster, diokletian. Fen-ster, ein halbkreisförmiges Fenster,das durch zwei senkrechte Pfostendreigeteilt ist. Im 16. Jh., bes. durchPalladio, wieder aufgegriffen undin Nachfolgebauten (Palladianis-mus) übernommen. Engl. Diocletian window; it. palladiana;sp. ventana diocleciana.
Thesauros (gr.) → *Schatzhaus imgr. Tempelbezirk.
Tholos (gr.), Rundtempel, dessenCella von einem Säulenkranz um-geben war (→ *Tempelformen). Engl. tholos; it. tholos, tolo; sp. templo cir-cular.
Thymele, Altar in der Mitte derOrchestra des gr. Theaters (→ Thea-terbau).
Tibari, Tibara (ind.), Säulenhalledes ind. Wohnhauses.
Tiefbau, Ingenieurbau, jener Be-reich des Bauwesens, der die Her-stellung von Straßenbauten, Fluß-regulierungen, Dammbauten, Ei-senbahnbauten, Brückenbauten u.dergl. umfaßt. Frz. construction au niveau du sol, c. sou-terraine; it. costruzione sotto al livello delsuolo; sp. construcción subterránea.
Tierceron (frz.), vom Kämpferaufgehende Nebenrippe in spätgot.Fächer- oder Netzgewölben. Engl., frz., it. tierceron; sp. arco tercelete.
Tischaltar, ein Altar in Tischform,dessen Platte (Mensa) von Stützen(meist Säulchen) getragen wird(→ *Altar 2 a). It. altare a mensa; sp. altar con forma de mesa.
Titulus (lat.), Inschrift auf einerTafel oder Platte, dann wegen derTafel mit Angaben des Besitzersüber dem Hauseingang Bezeich-nung für frühchristl. Gemeinde-häuser in Rom, im 4. Jh. auf diedort errichteten Basiliken übertra-gen mit gleichzeitigem Austauschder Besitzernamen gegen Heili-gennamen, später allgemein derWeihe-T., d.h. die auf den Nameneines Heiligen vollzogene Weiheder Kirche.
Toilette (frz.), urspr. das auf demPutztisch ausgebreitete Tuch, dannübertragen auf alle Geräte desPutztischs und auf diesen selbst.Seit Ende des 19. Jhs. Lehnwort,auch im Sinne von Waschraum(→ *Abtritt).
Tonne → Tonnengewölbe, → *Ge-wölbeformen.
Tonnendach, → *Dachform mitTonnenquerschnitt. Engl. compass roof; frz. toit-voûte, com-blevoûte; it. tetto a botte; sp. tejado en for-ma de tonel.
Tonnengewölbe, → *Gewölbe-form mit längs einer Achse gleich-bleibendem viertelkreis-, halb-kreis-, segmentbogen- oder spitz-bogenförmigem Querschnitt. Engl. barrel vault, tunnel v.; frz. voûte enberceau, tonnelle; it. volta a botte, bersò;sp. bóveda de cañón.
Tonsur (lat.), Bezeichnung für dasBrunnenhaus an Klosterkreuzgän-
Thermenfenster 472
gen, das den Mönchen als Wasch-raum und zum Rasieren sowie zumSchneiden (tonsura) der Haarediente. Engl. fountain house, lavabo; frz. tonsure;it. tonsura; sp. tonsura, cuarto de aseo, lavabo.
Topfgewölbe, Gußgewölbe, indessen Schale topfähnl. Tonhohl-körper eingegossen sind, um dasGewicht herabzusetzen. Bei Kup-peln sind die Töpfe meist spiralför-mig angeordnet. T. kommen in derspätantiken und byzantin. Baukunstvor. Frz. voûte en poterie(s) creuse(s); it. voltadoliare; sp. bóveda de pote.
Tor, größere Maueröffnung, meistoben geschlossen, aber bei Einfrie-dungen (Gartenmauer, Hofmauer,Zaun) auch oben offen (→ Portal).Eine Toranlage in selbständigemBaukörper wird → T.bau oder, miteiner inneren T.halle, T.gebäudegenannt. Engl. gate, gateway; frz. porte, portail; it. por-tone, porta; sp. pórtico, portón de entrada.
Torana (ind.), Torbau im Zaun(Vedika) eines → *Stupa. Die T. be-steht aus Pfosten, die durch meh-rere obere Querbalken miteinanderverbunden und plast. geschmücktsind. Obwohl die Konstruktiondem Holzbau entstammt, sind diemeisten T. aus Stein.
Torband → *Beschlag zum Bewe-gen größerer Türblätter.
Torbau, Torgebäude, größere, selb-ständige Toranlage wie → *Stadt-tor, → *Triumphbogen oder Burg-tor. In Ägypten → *Pylon, inGriechenland → *Propylon (in Son-derfällen Propyläen, → Dipylon,Tripylon und → *Tetrapylon)genannt. Engl. monumental gateway, propylaeum;frz. propylée, pylône; it. porta; sp. portón deentrada a una ciudad/fortaleza.
Torburg, größerer, weitgehendselbständiger Wehrbau einer Ring-mauer mit einem Außentor, Fang-hof mit Wehrgängen, Schießschar-ten, Gußlöchern, Fallgrube undeinem Innentor.
Torhalle, Torgang, Innenraum ei-nes Torbaus. Engl. porch; frz. porche; it. porticato; sp. pór-tico.
Torhaus, Torbau, oft mit derWohnung des Torhüters oder an-deren Räumen. Engl. gatehouse; sp. portería.
Torii (japan. Vogelsitz), das Toreines shintoist. Tempelbezirks, dasaus zwei senkrechten und zwei waa-gerechten Holzbalken gebildet ist.
Torsion, Verdrehung eines Bau-körpers (Turmhelm) oder Bauteils(→ *Säule) in korkzieherähnlicherForm. Engl., frz. torsion; it. torsione; sp. torsión.
Torturm, Turm über oder nebeneinem Tor (→ *Stadttor). Engl. gate tower; frz. tour-porte; it. portafortificata; sp. torre-portada.
473 Torturm
Topfgewölbe
links: Querschnittrechts: Längsschnitt und Ansicht der
ineinandergesteckten Tonkörper
Torus, Wulst der att. → *Basis.
Torzwinger, Fanghof, der zwi-schen Außen- und Innentor liegen-de Raum einer Torburg (→ Kam-mertor), entwickelt aus dem → Pro-pugnaculum röm. Kastelltore. Frz. barbacane; sp. barbacana.
Toskanische Ordnung, tuskischeOrdnung, etruskische Ordnung,eine der → *Römisch-dorischenOrdnung ähnl. antike → *Säulen-ordnung der Römer, deren Schaftoft keine Kanneluren, aber eineBasis hat. Unter dem Echinus liegtein Halsring. Die Ecktriglyphensind achsial auf die Ecksäulen be-zogen, die Mutuli entfallen, wäh-rend zusätzl. noch ein Zahnschnittangeordnet sein kann. Engl. Tuscan order; frz. ordre toscan; it. or-dine architettonico toscano; sp. orden ar-quitectónico toscano.
Totenleuchte, Lichthäuschen, ta-bernakelartiges Türmchen zurAufnahme eines Totenlichts. T. inmonumentaler Form wurden im11. Jh. in Frankreich entwickeltund kommen bis zum Ende desMA. auf Friedhöfen vor. Frz. fanal de cimetière, lanterne des morts;sp. fanal de cementerio.
Tourelle (frz.) → Scharwachtturm.
Tower (engl.), Kontrollturm,turmartiges Gebäude auf Flug-häfen, dient der Flugsicherung aufGrund des Überblicks auf Flug-hafen-Vorfeld und Start- und Lan-debahnen.
Trabantenstadt, Satellitenstadt,eine baul. in sich abgeschlossene
und wirtschaftl. selbständige Ne-benstadt einer Großstadt. Engl. satellite town, suburb; frz. ville satel-lite; it. città satellite; sp. ciudad satélite.
Tracé (frz.), Befestigungssystem,Festungsumriß, bes. der Verlaufder Hauptkampflinie sowie dieUmwallung, der Verlauf der De-fenslinien bei den Außenwerkenund vorgeschobenen Stellungen. Engl. ground-plan, layout, line; frz. tracé;it. tracciato; sp. trazado.
Trachelion (gr.) → Säulenhals.
Träger, 1. tragender Balken, derandere Bauteile (Balken, Decke)trägt und aus Holz, Stein, Stahl oderStahlbeton ausgeführt sein kann.Es gibt T. über zwei Auflagern undT. über mehreren Auflagern(Durchlauft.). T. können als Un-terzug oder als Überzug ausgebil-det sein. 2. Tragwerk aus Holz(→ Dachkonstruktion) oder Stahl(→ Binder 2). Nach der Konstruk-tion werden Blecht., → *Gittert.,Fachwerkt., Parallelt., Parabelt. u.a.unterschieden. 3. → RäumlichesTragwerk. 4. Walzprofil (T-T. undDoppel-T-T. mit durch einen→ *Steg verbundenen Flanschen). Engl. (supporting) beam, girder; frz. poutre,poutrelle; it. trave di sostegno; sp. viga.
Tragmauer, eine Mauer, die kon-struktiv tragend ausgebildet ist. Engl. bearing wall; frz. mur porteur, m. por-tant; it., sp. muro portante.
Tragstein, Kraftstein, Balkenstein,vorspringende → *Konsole. Engl. truss, ancone, console; frz. coussinet,ancone, console (isolée); it. mensola, modi-glione; sp. ménsula, almohadilla.
Tragwerk → Räumliches Trag-werk.
Torus 474
Trakt, Teil eines größeren, geglie-derten Baukörpers, Mittelt., Hoft.,Vordert., Hintert., Seitent. (Flügel).Engl. tract; it. tratto; sp. tracto.
Tranchée (frz.) → Sappe, Ap-proche.
Transenna (lat., Mz. Transennen),Verschluß der Fensteröffnung mitdurchbrochenen Stein- oder Holz-platten oder auch mit dünn ge-schliffenen Marmorplatten, vorEinführung der Fensterverglasung(→ *Quamriya). Engl., it. transenna.
Transept (frz.), durch Schranken abgeteilter, nördl. Querhausflügel,im Plural auch für das ganze→ *Querhaus gebraucht. Engl., frz. transept; it. transetto; sp. crucero.
Transom (engl.), horizontale Stäbe(Maßwerkbrücke), die zwei odermehrere Stäbe eines Maßwerk-fensters verbinden, in England im→ Perpendicular style vorkom-mend. Engl. transom; sp. montante.
Transversalbogen, ein quer zurLängsachse eines Raums verlau-fender Bogen (Querbogen, → Gurt-bogen, Schwibbogen). Engl. transverse arch; frz. (arc) doubleau, ar-ceau; it. arco trasversale; sp. arco transversal.
Trapezkapitell, → Kapitell mittrapezförmigen Ansichtsflächen,das hauptsächl. in der byzantin.Baukunst vorkommt. Eine ähnl.Form hat auch das Würfelkapitellim → Backsteinbau. Engl. trapezoidal capital; frz. chapiteau tra-pézoïdal; it. capitello bizantino; sp. capitelbizantino.
Traufe, Dachtraufe, Traufkante,Dachbord, Saum, Schlagbrett, un-tere, waagerechte Begrenzung derDachfläche parallel zum First, zugl.Ablaufkante des Regenwassers,entweder als Traufkante oder inRinnen, die sichtbar entlang derTraufe (Hängerinne) oder verdeckt(Stand- oder Kastenrinne) ange-bracht sind; das Wasser wird durchWasserspeier oder Fallrohre abge-leitet. Bei Walmdächern läuft die T.in einheitl. Höhe um das ganzeHaus. → *Dachausmittlung. Engl. eaves; frz. égout, gouttière, chéneau;it. gronda, grondaia; sp. canalón, socarrén,alero, tejaroz.
Traufenhaus, ein Haus, das derStraße die Traufe zukehrt.
Traufgang, Schlippe, schmalerGang zwischen zwei Häusern, diemit ihren Traufen nebeneinander-stehen.
475 Traufgang
Transennen
Transversalbogen
Traufgesims → *Gesims unterder Traufe (→ *Dachdeckung).
Traveé (frz.), Gewölbefeld, beigot. Kathedralen auch eine Einheitmit dem → Strebewerk, abgeleitetvon trabes = Jochbalken über zweiZugtieren, dann Brückenjoch.
Traverse (frz.), Quer- oder Schul-terwall vor einer Festung oder aufdem Hauptwall. Engl. strut, crosspiece; frz. traverse; it. tra-versa; sp. travesaño.
Trennwand, Scheidewand, die ei-nen Raum unterteilende nichttra-gende Wand. Engl. bulkhead, partition; frz. cloison (deséparation); it. tramezzo, divisorio; sp. pa-red divisoria.
Treppe, Stiege, Verbindung vonzwei auf verschiedenen Höhen lie-genden Ebenen, im Innern alsInnent. (T.haus), außen als Freit.,in Verbindung mit Gebäuden auchAußent. Eiserne Außent. für Not-fälle werden Feuert. oder Nott. ge-nannt. Eine vor allem bei starkemVerkehr angeordnete T. mit me-chan. bewegten Stufen ist die Rollt.Man unterscheidet je nach Lageder T. im Grundriß Haupt- undNebent., nach der Lage in denGeschossen Keller-, Dach- oderBodent., Zwischent. führen nichtdurch alle Geschosse. T. könnenaus Holz, Stein, Stahl oder Stahl-beton errichtet sein. Die Stein- undStahlbetont. können auf einer Lauf-platte aufliegen, unter der Licht-wange konstruktiv unterstützt oderfreitragend in die T.hausmauer ein-gespannt sein. Das Einzelelementeiner T. heißt Stufe. Das Verhältnisvon Stufenauftrittsbreite zur Stu-
fenhöhe ist die → Steigung (Stei-gungsverhältnis). Eine ununter-brochene Folge von Stufen nenntman T.lauf. Die erste Stufe einesT.laufs heißt Antrittsstufe, die letz-te Austrittsstufe. Ein zwischenzwei T.läufe eingefügter Absatzheißt Podest (T.podest). Bei rei-cheren → *T.formen bezeichnetman die Folge von T.läufen zwi-schen zwei Geschossen als T.arm.Die seitl., brusthohe Begrenzungist das T.geländer (→ *Geländer),das durch einen → Handlauf abge-schlossen wird. Die → *Stufenkönnen rechteckigen (Blockstufe)oder auch keilförmigen (Keilstufe)Querschnitt haben. Bei der Holzt.können massive Keilstufen aufzwei tragenden Balken aufgesetzt
Traufgesims 476
Eingestemmte Holztreppe
a Treppenwechsel unter der Austrittstufeb Setzstufec Trittstufed Lichtwangee Krümmlingf Geländerstäbeg Geländerholm (Handlauf)h eiserne Zugstange zwischen den
Wangen (Treppenschließe)
sein, meist besteht aber die Holzt.aus zwei Wangen, zwischen dieBretter als Tritt- und Setzstufeneingesetzt (vollgestemmt) sind. DieWangen kommen auch selbst abge-treppt vor, so daß die Stufenbretteraufgesetzt (aufgesattelt) werden
können. Die unterste Stufe (An-trittsstufe) ist jedoch massiv (Block-stufe) und die Austrittsstufe liegtauf einem Deckenbalken oder aufeinem Wechsel auf. Man unter-scheidet Wandwange und Lichtwan-ge, zwischen denen der T.lauf liegt.
477 Treppe
Treppenformena gerade, einläufigb gerade, zweiläufigc gerade, zweiläufig mit Richtungswechsel (gegenläufig)d gerade, dreiläufig mit gegensinnigem Richtungswechsele gerade, dreiläufig mit gleichsinnigem Richtungswechself gekrümmt, zweiläufigg gerade, zweiläufig mit gezogenen Stufenh Wendeltreppe mit gemauerter Spindeli zweiarmig, dreiläufig mit gemeinsamem Antrittj zweiarmig, vierläufig mit gemeinsamem Austrittk zweiarmig, sechsläufig mit gemeinsamem An- und Austrittl zweiarmig, dreiläufig mit gemeinsamem Antrittm dreiarmig, vierläufig mit gemeinsamem Antritt
Treppenabsatz 478
Die kurvierte Überleitung zwi-schen zwei Wangen heißt Kröpf-ling oder Krümmling (→ *Wendel-treppe). Engl. stairs; frz. escalier; it. scala; sp. escalera.
Treppenabsatz, ein zwischenzwei Läufen einer → Treppe einge-fügtes Podest (→ *Treppenformen).Engl. landing; frz. palier (d�escalier); it. pia-nerottolo; sp. descanso, rellano.
Treppenarm, Folge mehrererTreppenläufe zwischen zwei Ge-schossen bei reicheren (zweiarmi-gen, dreiarmigen, mehrarmigen)→ *Treppenformen. Engl. stair shapes; frz. montée (d�escalier),aile (d�e.); it. rampa di scala; sp. ala de laescalera imperial, brazo d. l. e. i.
Treppenauge, Auge, Lichtspin-del, offene Spindel einer → *Wen-deltreppe. Engl. round staircase well; frz. jour (d�esca-lier), �il (d�e.); it. pozzo di scala elicoidale;sp. ojo central de la escalera caracol.
Treppenformen, eine Treppekann einläufig sein, also ohne Ab-satz (Podest) von Geschoß zu Ge-schoß führen, sie kann mehrläufigsein und bei den Podesten auchihre Richtung ändern. Eine Treppekann zweiarmig sein, das heißt, sieist in zwei getrennte, verschiedengerichtete Wege geteilt, die nach ei-nem ersten Lauf von einem gemein-samen Podest ausgehen. Jeder Armkann wieder durch Zwischen-podeste in mehrere Läufe geteiltsein und seine Richtung ändern.Auch Treppenanlagen, deren Wegenicht gemeinsam beginnen oderenden, werden als zwei- oder mehr-armig bezeichnet, wenn ihre Wegeräuml. zusammengehören. Mehr-
armige Treppen sind selten, manbezeichnet so Treppen mit mehre-ren verzweigten Wegen. Eine Son-derform sind parallel übereinan-der geführte Treppen, deren Wegeauf gemeinsamen Podesten be-ginnen und enden, ohne sich da-zwischen zu berühren. Alle dieseT. können mit geraden, gekrümm-ten oder gewendelten Läufen vor-kommen (→ *Wendeltreppen). Beigekrümmten Treppen werden dieStufen verzogen, d.h. es wird einallmähl. Übergang vom geradenzum gekrümmten Verlauf herge-stellt, um die Bequemlichkeit beimBesteigen der Treppe zu erhöhen.Bes. in der Barockzeit wurden groß-artige T. in den Schlössern (→ Trep-penhaus) errichtet. (Abb. S.477)Sp. tipos de escalera.
Treppengeländer, Geländer einer→ *Treppe.
Treppengiebel, Staffelgiebel, Stu-fengiebel, abgetreppter → *Giebel. Engl. crowstep gable; frz. pignon en ren-dan(s), p. en gradin(s); it. frontone a grado-ni; sp. frontispicio con peldaños.
Treppenhaus, Stiegenhaus, Mo-numentale Treppen sind meist alseigener Bauteil ausgebildet. Bei derWendeltreppe bringt dies in derRegel auch konstruktive Vorteile(→ *Treppenturm). Engl. staircase; frz. cage d�escalier; it. gabbiadella scala, vano scala; sp. caja de la escalera.
Treppenlauf, eine ununterbro-chene Stufenfolge zwischen zweiGeschossen oder zwischen zwei Po-desten einer Treppe (→ *Treppen-formen). Engl. flight of stairs; frz. volée (d�escalier);it. rampa di scala; sp. tramo.
Treppenloch, Treppenöffnung, 1.die Öffnung einer Geschoßdeckeoder Balkenlage (→ *Balken 8),durch die eine Treppe führt. 2. Auchdie Öffnung zwischen den Licht-wangen der mehrläufigen Treppe. Frz. 1. logement d�escalier; it. 2. pozzo dellascala, tromba delle scale; sp. abertura en elpiso por donde pasa una escalera.
Treppenspindel, Spindel einer→ *Wendeltreppe. Engl. (newel) post; frz. noyau (d�escalier),fût; it. piantone (della scala a chiocciola),anima (della scala a c.), spina (della scala ac.); sp. alma de una escalera de caracol.
Treppensteigung, das Verhältnisvon Auftrittbreite zu Stufenhöhebzw. das Verhältnis der Länge einesTreppenlaufs zu der von ihm über-wundenen Höhe (→ *Stufe). Engl. rise; frz. pente, montée; it. pendenzadella scala; sp. altura del escalón, contra-huella, tabica.
Treppenstraße, Treppenweg, einaußerhalb von Gebäuden liegender(öffentl.) nicht befahrbarer Ver-kehrsweg, der als Treppe ausgebil-det ist oder in dessen Verlauf Trep-pen eingeschaltet sind. Frz. rue en escalier; it. strada a gradonata, s.a cordonata; sp. calle con gradas.
Treppenturm, Stiegenturm, Wen-delstein, turmartiger Gebäudeteil,häufig der Gebäudefront vorge-stellt oder in einen Winkel einge-fügt, in dessen Innern meist eineWendeltreppe als Verbindung zuden oberen Geschossen aufsteigt. Engl. stair turret, s. tower; frz. tour d�escalier,tourelle, tourillon; it. torre delle scale, t. conscala a chiocciola; sp. torre con escalera decaracol.
Treppenwange, seitl. Begrenzungeiner → *Treppe. Man unterschei-
det Wandwange und Lichtwange,die das Geländer trägt. Engl. string, stringer; frz. limon d�escalier;sp. limón, zanca, alfarda de la escalera.
Treppenwechsel, Wechselbalken,der quer zum übrigen Gebälk ver-laufend das Treppenloch begrenzt(→ *Balken, → *Treppe).
Tres(e)kammer → Sakristei.
Triangulation (lat.), Triangulatur,Proportionsschlüssel zur Bestim-mung der Maßverhältnisse: eingleichseitiges Dreieck, dem einzweites diagonal einbeschrieben istusw., dient zur Festlegung von Bau-maßen mit Zirkel und Richtscheit.Wie weit tatsächl. die T. bei derBemessung got. Bauten maßgebendwar, ist umstritten (→ Quadratur). Engl., frz. triangulation; it. triangolazione;sp. triangulación.
Trianon (frz.), ein vom Hauptge-bäude entfernter Parkpavillon. Frz., it., sp. trianon.
479 Trianon
Treppenturm
Tribolon (gr.), Dreierarkade, diein einer byzant. Kirche den Nar-thex vom Langhaus scheidet, da-zwischen drei Vorhänge (tri-vela). It. tribolon; sp. construcción de tres arcadasen la iglesia bizantina.
Tribuna (lat.), halbrunder Ab-schluß einer röm. Markt- oder Ge-richtsbasilika (→ *Apsis 1, → *Ba-silika 1).
Tribunal (lat.), erhöhtes Podium,oft am Ende einer röm.-antikenBasilika, auf dem der Prätor Rechtsprach. Engl., frz. tribunal; it. tribuna; sp. tribunal.
Tribüne (mittellat. tribuna: Red-nerbühne), Empore, Galerie, fer-ner allgemein soviel wie Zuschau-erbühne, Schaugerüst. Engl. rostrum, tribune; frz. tribune, galeriehaute; it. tribuna, podio; sp. tribuna.
Trichorum → *Dreikonchenan-lage.
Trichtergewölbe, Trichternische,Gewölbe in der Form eines halbenHohlkegels mit nach unten gekehr-ter Öffnung (→ *Trompe). Engl. conical vault; frz. voûte conique, v.normande, v. anglo-saxonne; it. volta nor-manna, v. a imbuto; sp. bóveda cónica, b.normanda.
Triforium, erstmals bei Gervasiusvon Canterbury 1180 für denLaufgang zwischen den Arkadenoder Emporen und der Fensterzo-ne einer Basilika verwandt. Das T.kommt bereits in roman. Zeit alsGliederung der Hochschiffwand inder Zone der Seitenschiffdächervor. Bei der got. Kathedrale mitdrei- und vierzonigem Aufbau ist
das T. integrierender Bestandteildes → *Wandaufbaus. Entfällt derGang und sind der Wand nur Blend-bogen vorgeschaltet, so sprichtman von einem Blendt. Das echteT. kann in verschiedener Weisekonstruiert sein: 1. ZwischenRückwand und Arkaden entstehtein Laufgang unter einem vonDienst zu Dienst gespannten Mau-erbogen; der Gang läuft nicht hin-ter den Gewölbediensten durch;jeder Abschnitt ist vom Dachraumdes Seitenschiffs aus zugängl. 2.Der Laufgang ist mit Steinplattenoder einer Längstonne überdecktund hinter den Gewölbedienstendurchgeführt. 3. Die Rückwanddes T. wird durchfenstert (durch-lichtetes T.), so daß die Oberga-denfensterzone bis auf die Sei-tenschiffgewölbe heruntergezogenscheint (seit ca. 1230 in der Ile-de-France ausgebildet). In der Ansichtsind zu unterscheiden das in Bur-gund aus antiken Motiven entwik-kelte Reihent., das in einheitl.Arkadenfolge immer von Dienstzu Dienst reicht, und das in derNormandie ausgebildete Grup-pent., bei dem die zumeist unterBlendbogen oder Blendgiebeln ge-kuppelten Zwillings- oder Dril-lingsarkaden in die Mauerflächeeingeschnitten sind. Das T. kannim Langhaus, Querschiff und auchim Chor auftreten und findet sichvornehmlich in Frankreich und imRaum Köln bis Basel in der Zeitzwischen 1100 und 1260. Engl. triforium; frz. triforium, trifoire; it.,sp. triforio.
Triglyphe (gr.), Dreischlitzplatteam Fries der → *Dorischen Ord-nung. Die T. sind als im Steinbaunachgebildete Balkenköpfe zu ver-
Tribolon 480
stehen. Ohne seitl. Halbschlitzenennt man diesen BalkenkopfDiglyph (→ *Steg). Engl. triglyph; frz. triglyphe; it., sp. tríglifo.
Triglyphenfries, Triglyphon, Friesder → *Dorischen Ordnung, beidem Triglyphen und Metopenabwechseln. Die Metopen tragenmeist reliefplast. Schmuck. Der T.war polychrom gestaltet. Engl. triglyph frieze; frz. frise à triglyphe;it. fregio a triglifo; sp. fresco con tríglifos.
Triglyphenkonflikt, bei der →*Dorischen Ordnung sind die Tri-glyphen in der Regel auf die Säu-lenachse bzw. auf die Mitte desInterkolumniums bezogen, nur dieEcktriglyphe sitzt genau an derEcke. Eine Triglyphe ist aber meistschmäler als der obere Säulen-durchmesser, so daß die Differenzim letzten Interkolumnium ausge-glichen werden muß. Das ge-schieht durch Verringerung desletzten Interkolumniums (Eckkon-traktion).
Triglyphon → Triglyphenfries der→ *Dorischen Ordnung.
Triklinium (lat. /gr.), Speisezim-mer des röm. → *Wohnhauses.
Trikonchos (gr.), Trichorum, An-lage mit drei kleeblattförmig ange-ordneten Konchen (→ *Dreikon-chenanlage).
Trilithon (gr.), ein aus zwei Tor-pfosten und einem Sturzstein be-stehender Torbau der Altsteinzeit.
Trittstufe, Auftritt, Tritt, waage-rechtes Brett einer Holztreppe(→ *Stufe, → *Treppe). Engl. tread; frz. giron, marche; it. gradino;sp. huella.
Triumphbalken, Querbalken zwi-schen Kirchenschiff und Chor zurAufstellung eines Triumphkreuzesoder einer Kreuzigungsgruppe. Engl. candle beam, rood b.; sp. viga soportedel crucifijo.
Triumphbogen, 1. Ehrenbogenzur Erinnerung an einen Kaiser,
481 Triumphbogen
Triglyphenkonflikt
Ecklösung mit gleichen Interkolumnien
Eckkontraktion
Triumphbogen(Beispiel: Rom, Titusbogen, 70 n. Chr.)
seltener an eine Schlacht. Der T.kann eine Öffnung haben, dochhaben die bekanntesten T. einehöhere Mittelöffnung zwischenniedrigeren Seitenöffnungen. EineSonderform ist der Quadrifrons(→ *Tetrapylon), eine quadrat. An-lage mit je einem Bogen an allenvier Schauseiten. Über dem Haupt-durchgang ist immer eine In-schrifttafel, als Abschluß standüber der Attika des T. eine Qua-driga. 2. Bogen zwischen dem Mit-telschiff bzw. der Vierung und demChor einer ma. Kirche. Engl. triumphal arch; frz. arc de triomphe;it. arco di trionfo, a. trionfale; sp. arco detriunfo.
Triumphkreuz, Kreuz unter demTriumphbogen einer Kirche (→ Tri-umphbogen 2), das aufgehängtsein, jedoch auch auf einem Tri-umphbalken stehen kann. Engl. rood cross; frz. croix triomphale; it. cro-cifisso sotto l�arco trionfale; sp. crucifijo ba-jo el arco de triunfo.
Triumphsäule, Ehrensäule, einefreistehende monumentale Säulemit Darstellungen aus dem Lebeneines röm. Kaisers in spiralförmigangeordneten Reliefbändern. Die T.wurde von einer Statue des Kaisersbekrönt. Im Innern führt eine Wen-deltreppe zur oberen Plattform. Engl. triumphal column; frz. colonne detriomphe, c. triomphale; it. colonna com-memorativa; sp. columna de triunfo.
Triumphtor, der häufig auch füreinen Triumphbogen verwandteBegriff bezeichnet richtiger einEhrentor, das als festl. Schauarchi-tektur für Empfänge von Fürstenerrichtet wurde. Engl. triumphal arch; it. porta trionfale;sp. arco de triunfo, puerta d. t.
Trochilus, Hohlkehle der atti-schen → *Basis.
Trockenmauerwerk, ein ohneMörtel errichtetes Mauerwerk. Engl. dry wall; frz. maçonnerie de pierressèches; it. muratura a secco; sp. mamposte-ría seca.
Trommel, 1. zylindr. Einzelele-ment eines Säulenschafts (→ Säule,Säulent.). 2. Selten verwandte Ver-deutschung von Tambour (→ *Kup-pel). Frz. tambour; it. 1. rocchio, tamburo dellacolonna, 2. tamburo; sp. tambor.
Triumphkreuz 482
Triumphsäule(Beispiel: Rom, Trajanssäule)
Trompe (frz.), Trichtergewölbe,Trichternische, Teilgewölbe, Ge-wölbezwickel in der Form eineshalben Hohlkegels mit nach untengekehrter Öffnung. Über einemQuadrat, z.B. einer Vierung, kanndurch vier T. an den Ecken (Eck-trichter) ein Klostergewölbe odereine T.kuppel errichtet werden. Engl. trompe, squinch; frz. trompe (d�unevoûte); it. pennacchio conico, p. a tromba;sp. trompa.
Trompenkuppel, eine über Eck-trichtern (→ *Trompe) errichteteKuppel. Ungenau auch für einüber Trompen errichtetes Kloster-gewölbe. Engl. squinch dome; frz. coupole sur trom-pe(s); it. cupola su tromba; sp. cúpula sobreuna trompa.
Tropaion (gr.), Siegesdenkmal(Trophäe 1), das an dem Ort einerSchlacht errichtet wurde. Urspr.hängte man die Waffen besiegterFeinde an Bäumen auf. Später wur-den derartige Darstellungen auchan Triumphbogen angebracht.
Trophäe (lat.), 1. Siegesdenkmal(→ *Tropaion); 2. Embleme desKrieges, wie Fahnen, Standarten,Schilde, Lanzen, Rüstungen, Hel-me, Schwerter oder dergl., die aneinem Tropaion oder an einemTriumphbogen angebracht sind. Engl. trophy; frz. trophée; it., sp. trofeo.
Trulli (it.), spitzkuppelförmige,steinerne Wohnbauten mit unech-ten Gewölben in Süditalien, die oftzu ganzen Gruppen zusammenge-
483 Trulli
Barockes Triumphtor
Trompe
Römisches Tropaion(Beispiel: La Turbie)
faßt sind. Ähnl. Konstruktionenwurden bereits in vorgeschichtl.Zeit entwickelt (Nuragen).
Trumeau (frz.), mittlerer Stein-pfeiler eines Portals, der das Tym-panon unterstützt, seit der Spätro-manik und bes. in der Gotik ver-breitet. Der T. kann ornamentaloder figürl. geschmückt und in derGotik durch eine vorgesetzte Figur(T.-Figur) eines Heiligen oder vonChristus oder Maria ausgezeichnetsein. Engl., frz., it. trumeau; sp. entrepaño.
Tschaitya (ind.), 1. → *Stupa. 2.Heiligtum in Indien, in Hinterin-dien auch Tsedi (Chedi) genannt,in dem ein Stupa steht (→ *Tschai-tyahalle).
Tschaitya-Giebel, Kudu, dergeschwungene Giebel des ind. Ton-nendachs, der an der Frontseite ei-ner → *Tschaityahalle angebracht ist.
Tschaitya-Halle, ind. Höhlenhei-ligtum mit tonnengewölbtem Mit-telschiff zwischen halbtonnenge-wölbten Seitenschiffen, die alsUmgang eine halbrunde Apsis um-schließen, in der ein Stupa (Dago-ba, Tschaitya) steht.
Tschakra (ind.), Kapitell einer ind.Gedenksäule (Stambha).
Tschandi (hinterind.), stufenför-mig bekrönte Göttercella übereinem Stufenberg in Hinterindien.
Tschatravali, Hti, Chattra, Tschat-tra (ind.), stockwerkartig geglieder-ter Schirm (Herrschersymbol) alsBekrönung eines → *Stupas.
Trumeau 484
TrulliGrundriß und Ansicht
Tschaitya-Halle (Beispiel: Karli, um Chr. Geb.)
Tschatri (ind.), Gartenhaus oderPavillon mit Zeltdach. Ein T. kannauch auf Dächern von Palästenoder in Miniaturform auf Tempelnund Kuppeln angeordnet sein.
Tschaultri (ind.), Pfeilerhalle süd-ind. Tempel.
Tschorte (tibet.), Sonderform des→ *Stupa in Tibet.
Tsedi, Chedi (birm.), Sonderformfür → *Stupa in Birma.
T-Träger, ein Walzprofil mit T-förmigem Querschnitt (→ *Steg,→ Träger 4). Engl.T-beam; frz. poutre en T; it. trave a T;sp. viga T.
Tuchhalle → Gewandhaus.
Tudorblatt, Tudorblume, eine ei-nem Efeublatt ähnl. Dekorations-form der engl. Gotik. Engl. Tudor flower; frz. feuille d�ache; it. ro-sa Tudor; sp. hoja Tudor, rosa T.
Tudorbogen, Bogen aus je zweiSegmenten zweier kleiner undgroßer Kreise (→ *Bogenformen). Engl. Tudor arch, four-centred a., am. four-centered a.; frz. arc Tudor; it., sp. arco Tudor.
Tumba (lat.), rechteckiges →*Grabdenkmal, auf dem die Grab-platte, oft mit einem Relief odereiner vollplast. Darstellung des To-ten, liegt. Die Grabplatte kann aufFüßen oder auf einem geschlosse-nen und mit Plastik geschmücktenUnterbau ruhen. Manchmal istauch ein Baldachin über der T.angeordnet.
Tumulus (lat.), Grabhügel aufkreisrundem Grundriß. Die Grund-form des T. kommt hauptsächl. beimyken. Gräbern, Grabhügeln in derGegend von Pergamon, bei etrusk.und röm. Gräbern vor (→ Grab-bau). Engl., frz. tumulus; it. tumulo; sp. túmulo.
Tür, Durchgangs- und Eingangs-öffnung in Wänden und Mauern.Man unterscheidet je nach LageEingangst., Haust., Gartent.,Innent., Wohnungst., Flurt., Kel-lert., Zwischent., → Tapetent. und→ *Fenstert. (im Möbelbau auchSchrankt.). Die T.öffnung wirdoben durch einen geraden T.sturzoder einen Bogen, unten durchdie waagerecht liegende Schwelle(T.schwelle) und seitl. durch dieim rechten Winkel zur Mauer ein-geschnittene T.laibung oder durchdas schräg eingeschnittene T.ge-wände begrenzt. Die T. sitzt ineinem am Mauerwerk befestigtenRahmen (T.stock, Zarge). Die Lai-bung kann mit einem Futter be-deckt sein, das in der Mauerfluchtdurch eine Bekleidung abgeschlos-
485 Tür
Tür
1 rechts angeschlagene, einflügeligeSperrholztür
a Schwelleb Sturz b + c Stockc Laibungd Türblatte Bekleidung
sen wird. Ist die T.öffnung unter-teilt, so heißt das feststehende obe-re Querholz T.kämpfer, über demein durch ein Gitter (T.gitter) gesi-chertes Fenster (Oberlicht) liegenkann. Der bewegl. Teil der T. heißtT.blatt (T.flügel). Wird die T.öff-nung von zwei T.blättern verschlos-sen, so spricht man von einer zwei-flügeligen T. Weitere Möglich-keiten zum Verschluß breiterer T.
oder von T.wänden sind die Faltt.oder die Harmonikat. T.blätter, dienach beiden Seiten bewegl. sind,nennt man Pendel- oder Schwing-flügelt. Eine Dreht. hat ein umeine mittlere Achse bewegl. Blatt,das Blatt einer Schiebet. ist seitl.verschiebbar. Eine Hebet. wirddurch bes. Beschläge erst angeho-ben, ehe sie gedreht werden kann.Die T. kann aus Metall (Metallt.,Stahlt.), auch mit einem Gitter alsT.blatt (bes. bei Gartent.) ausgebil-det sein (Gittert.). Das Blatt einerGlast. kann ganz aus Glas bestehen(Ganzglast.), wird jedoch vielfachvon einem Holz- oder Stahlrah-men umgeben. Die Holzt. bestehtentweder aus Brettern, die durchEinschubleisten verbunden sind,oder aus Latten (Lattent.), die aufeine Unterkonstruktion genageltwerden (meist Kellert.). Die häu-figste Konstruktion ist die Rahmen-und Füllungst. (Zweifüllungst.,Dreifüllungst.). Werden zwei LagenHolz aufeinander gesetzt (meistRahmen und Füllung mit außenaufgedoppelten Brettern), so ent-steht die Doppelt. Das Blatt einerSperrholzt. besteht aus einem Blind-rahmen, auf den zwei Sperrholz-platten geleimt sind. Die innereKonstruktion der Sperrholzt. kannauch aus verschiedenen schmalenLeisten bestehen. Die T.öffnungkann durch Bogen (→ *Bogen-formen) oder reichere architekton.Rahmung, Supraporte, Spandrille,Säulen, Gebälke, Verdachungen,Hermen, Atlanten, Karyatiden undBauplastik betont sein. Auch dar-überliegende Fenster oder Balkonekönnen in die T.komposition ein-bezogen sein (→ Portal). Engl. door; frz. porte; it. porta; sp. puerta.
Tür 486
2 zweiflügelige Rahmen-Füllungstür3 links angeschlagene Doppeltür4 Falttür (Harmonikatür)
6 Drehtür7 Hebetür
11 Aufgedoppelte Tür12 Ganzglastür
5 Schwingflügeltür (Pendeltür) mitGlaslichte
8 Schiebetür9 Kipptor10 Lattentür
Türbe (türk.), → Grabbau einesSultans, Wesirs oder eines anderenWürdenträgers. Die T. ist ein Zen-tralbau mit Kuppel- oder Kegel-dach.
Türblatt, Türflügel, bewegl. Ver-schluß der Öffnung einer → *Tür. Engl. door leaf; frz. ouvrant de porte; it. bat-tente di una porta; sp. hoja de la puerta.
Türgewände, schräg in die Mau-erfläche eingeschnittene, seitlicheBegrenzung einer Tür, → Gewände.
Türklopfer, bewegl., oft orna-mental ausgestalteter Beschlag, derzum Klopfen um Einlaß diente. Engl. knocker; frz. heurtoir, marteau deporte; it. battaglio, picchiotto.
Türlaibung, Türleibung, quer zurMauerfläche eingeschnittene, seitl.Begrenzung einer Tür. Engl. reveal; frz. embrasure de porte, ta-bleau de p.; it. stipi della porta, imbottedella porta; sp. vano de la puerta.
Turm, ein über im Verhältnis zurHöhe kleiner Grundfläche errich-tetes Bauwerk, das frei stehen,aber auch in Verbindung mit ande-
ren Baukörpern vorkommen kann.T. kommen in der Antike haupt-sächlich als bastionsartiger Vor-sprung an → *Stadtmauern oderneben → *Stadttoren vor (Wehrt.).Monumentale Ausmaße und archi-tekton. Rang erhielt der T. in derBaukunst des MA. Die Kirchenerhielten zunächst meist einen T.(→ *Kampanile), später auch zweiFassadentürme (→ *T.fassade), sel-tener Dreit.gruppen (→ *West-werk), oft auch → *Chortürme, ei-nen → Vierungsturm und seltenerQuerhaustürme. Die → Eselstür-me ersetzten im MA. den Baukran.Im islam. Bereich kommt bei Mo-scheen das → *Minar (Minarett)vor. Zu den ind. Tempeltürmenvgl. → *Tempelbau 4 und 5, zu denostasiat. → *Pagode. Auch Burgenund Schlösser hatten im MA. ofteinen T. (→ *Bergfried), ebensodie → *Stadtbefestigung und die→ *Stadttore. Zum ma. Verteidi-gungssystem gehörten auch Wacht-und Warttürme (Warte) auf den An-höhen in der Nähe der Stadt oderder Burg. Bes. in Italien waren dieWohnhäuser des Stadtadels als T.aufgebaut (→ *Geschlechtert.).
487 Turm
Osmanische Türbe
Türklopfer
Auch → *Rathäuser und öffentl.Gebäude können durch T. ausge-zeichnet sein, z.B. in den belg.-nie-derländ. Gebieten der → *Belfried(Beffroy), Stadtturm. In neuererZeit gibt es den → Leuchtt., → Was-sert., → Aussichtst. und Fernmel-de- bzw. → Fernseht. Der obereAbschluß eines T. kann sehr ver-schieden gestaltet sein (→ *Dachfor-men, T.helm). Der Übergang vondem meist quadrat. Unterbau zudem reicher differenzierten Helm-aufbau kann durch verschiedeneÜberleitungselemente (Schmie-gen, Halbpyramiden, Verdachun-gen, Fialengruppen) erfolgen. Engl. tower; frz. tour; it., sp. torre.
Turmburg, bewohnter Wehrturm(→ *Donjon) oder kleine Burganla-ge mit Ringmauer, oft ohne Neben-gebäude und Bering (→ Motte). Engl. tower fortress; sp. torre fortificada.
Turmfassade, einheitliche Gestal-tung der Schauseite eines Bau-
werkes unter Einbeziehung einesoder mehrerer Türme. Die T. kannmit nur einem Turm versehen sein,der entweder vor der Fassade steht(Fassadenturm) oder aber organ.aus derselben herauswächst. Meistwerden aber zwei Türme mit einerFassadenkomposition verbunden(Doppelt., Zweit.). Diese Art derT. erreichte in der franz. Gotikeinen Höhepunkt, als senkrechteund waagerechte Elemente einan-der harmon. überlagerten und eineFensterrose das Zentrum bildete.
Turmburg 488
TurmFernsehturm, Eiffelturm, Wasserturm
Turmfassade(Beispiel: Freckenhorst,
Stiftskirche, 12. Jh.)
Einen weiteren Höhepunkt er-reichte die Gestaltung der Zweit.in der Barockzeit, wobei das zwi-schen den Türmen liegende Fas-sadenelement konkav oder konvexausgebildet wurde. Dreit., bei de-nen ein mittlerer, höherer Turm vonzwei seitlichen Türmen oder einturmähnlicher Mittelbau von Trep-pentürmen flankiert ist (→ *West-werk), sind seltener (→ *Lisene). It. facciata torrita; sp. fachada de la torre.
Turmgrab, turmähnl. → *Grabbaumit pyramidenförmigem Abschluß.Engl. high tomb, altar t.; it. edicola funera-ria con tetto piramidale; sp. tumba torre.
Turmhaus, ein hohes Haus überkleiner Grundfläche (→ Hoch-haus) in ma. Zeit als → Wohnturmoder → *Geschlechterturm. It. casa a torre; sp. casa torre.
489 Turmhaus
(Beispiel: Limburg/Lahn, Dom, 13. Jh.)
(Beispiel: Wahlstatt, Klosterkirche, 18. Jh.)
(Beispiel: Zwettl, Stiftskirche, 18. Jh.)
Turmhelm, der obere Abschlußeines Turms mit geneigten Dach-flächen, meist in Pyramidenform(→ Dachformen). In der Romanikgab es massive Steinhelme, in derGotik durchbrochene und ausMaßwerkformen gebildete. In derBarockzeit wurden außer Zwiebel-formen auch mit Voluten undSkulpturen geschmückte, steiner-ne T. errichtet. Engl. polygonal spire; frz. flèche, aiguille;sp. flecha de la torre, remate d. l. t.
Turmknopf, Knauf, kugelförmi-ger Abschluß eines Turmhelmsoder Turmdachs. Engl. pomel, pommel; frz. boule (de tour),pomme; sp. pomo del remate de la torre.
Turmtor, zumeist als Stadttorüber quadrat. oder rechteckigemGrundriß in mehreren Geschossenaufragender und im Erdgeschoßvon einer Durchfahrt bestimmterBaukörper, allseitig in massiverBauweise Viermauertor, stadtseitigin Fachwerk oder offen Dreimau-ertor. Liegt der Turm seitl. einesMauertors, so nennt man diesenTorturm, ist das Tor von zwei Tür-men als Schalen, Röhren oder Zy-linder flankiert, so ist es ein Dop-pelturmtor. Engl. tower gate; it. porta a torre; sp. puertatorreón.
Turnierhof, größerer, rings vonZuschauergalerien umgebener Hof.
Turmhelm 490
Turmfassade(Beispiel: Laon, Kathedrale, 13. Jh.) (Beispiel: Freiburg/Breisgau,
Münster, 14. Jh.)
Im 13.�16. Jh. zur Abhaltung ma.Kampfspiele. Engl. tiltyard; it. campo del torneo; sp. liza,palenque.
Türschwelle, waagerechte, untereBegrenzung einer → *Tür. Engl. threshold, doorsill; frz. seuil (deporte); it. soglia della porta; sp. umbral.
Türstock, fest mit dem Mauer-werk verbundener Rahmen einer→ *Tür, in dem das bewegl. Tür-
blatt sitzt. Man unterscheidet denflachen, eingestellten Türrahmenund den Zargenstock (Zarge), dereingemauert wird. Engl. door frame; frz. châssis de porte, bâtide p.; it. chiassile della porta, telaio della p.;sp. marco.
Türsturz, oberer waagerechter Ab-schluß der Öffnung einer → *Tür. Engl. lintel; frz. linteau (de porte), sommier(de p.); it. architrave della porta; sp. dintel.
Tuskische Säulenordnung →Toskanische Ordnung.
Tympanon, 1. Giebelfeld einesantiken Tempels, meist mit Bau-plastik geschmückt. 2. Fläche übereinem Portal innerhalb des Bogen-felds, häufig mit Reliefs. Engl. tympanum; frz. tympan; it. timpano;sp. tímpano.
Typenhaus, Wohnhaus mit typi-sierter (genormter) Grundriß- undAufrißgestaltung, vor allem in Ko-lonisationsgebieten oder in Sozial-
491 Typenhaus
Tympanon 1 (Beispiel: Athen, Akropolis, Alter Athenatempel, Rekonstruktion)
Ma. Tympanon 2K. Schwerzek, Rekonstruktion des
Westgiebels des Parthenons, 1896; ders.,Versuch einer Rekonstruktion des östl.
Parthenongiebels, 1904
Typenhaus1 Augsburg � Fuggerei, 1511�15252 Hanau-Neustadt, Typenhaus, um 1600
siedlungen. Typenhäuser werdenmeist aneinandergereiht (Reihen-haus), doch können sie auch frei-stehend gruppiert werden.
U
Überblattung, Verblattung, eine→ *Holzverbindung mittels eines→ Blatts. Engl. halved joint, halving; frz. assemblage àmi-paune, entaille à mi-bois; it. giunto amezzo legno; sp. ensamble a media madera.
Überfangbogen, 1. Obergurt, Ver-stärkungsbogen, der über der Ge-wölbeschale auftritt und im Innerndes Raums nicht sichtbar ist. 2. Bo-gen, der zwei oder mehr Bogen-öffnungen oder Arkaden in einerWandnische überfängt. Engl. discharging arch, relieving a., framinga.; frz. arc de décharge, a. d�encadrement;it. arco estradossato di una volta; sp. arco derefuerzo.
Überhang, Überschuß, Vorkra-gung, auskragender Teil eines Ge-bäudes, bes. im ma. und frühneu-zeitl. Fachwerkbau als vorkragendeStockwerke. Das Maß des Ü. wardurch Ortssatzungen festgelegtund wurde vom Rat kontrolliert.→ *Auskragung. Engl. overhang; frz. surplomb, partie sail-lante; it. sporto, aggetto; sp. alero.
Überschneidung, Überstabung,Durchdringung von Profilen,Rundstäben u. dergl. bei Eckaus-bildung spätgot. Portale, Nischenoder Fenster. Ü. entstehen auch,wenn ein Bogenlauf von einemRechteckrahmen überlagert wird. Engl. overlap; frz. recoupement; sp. ensam-ble cruzado.
Überzimmer, vorkragende Erkerund Galerien aus Holz an Ge-bäuden und Wehrmauern. It. sporto in legno; sp. pieza sobresaliente demadera.
Überzug, ein Entlastungsträger,der im Gegensatz zum → Unter-zug über der Balkenlage oderDecke liegt. Engl. cover, coverlet; frz. couche, enduit,recouvrement; it. trave estradossata; sp. vigamaestra de suspensión.
Ulu Dschami, Ulu Djami (türk.»Große Moschee«), Hauptmoscheeeiner türk. Stadt (→ *Moschee).
Umbauter Raum, das von denUmfassungsmauern und von denDachflächen umschlossene Volu-men eines Baukörpers, das für eine
Überblattung 492
Überschneidung
überschlägige Baukostenberech-nung wichtig ist. Engl. enclosed area, interior space; frz. vo-lume construit; it. volume dell�edificio;sp. espacio reconstruído.
Umfassungsmauern, Umfas-sungswände, sind die ein Bau-werk umschließenden Außenmau-ern (-wände), im Gegensatz zu denInnenwänden (Trennwänden). Engl. outwall, enclosing wall; frz. mur exté-rieur, m. de pourtour; it. muri perimetrali;sp. muros exteriores.
Umgang, der um einen mittlerenBauteil herumgeführte Gang(Chorumgang, → *Chor, → *Am-bitus 1), kann auch als selbständi-ger Bauteil von einer → *Wallfahrts-kirche zur Gnadenkapelle führen. Engl. ambulatory; frz. ambulatoire, c(h)a-role; it. ambulacro, deambulatorio; sp. de-ambulatorio.
Umgangschor, ein mit einemUmgang versehener → *Chor. It. deambulatorio; sp. coro con corredor.
Umgebindehaus, ein als Blockbauerrichtetes Haus, dessen Oberge-schoß oder Dach (Dachgeschoß) aufeiner selbständigen äußeren Trag-konstruktion aus Säulen oder Stän-dern, Rähm, Riegeln und Strebenbzw. Kopfbändern ruht.
Ummantelung, Verkleidung oderVerstärkung von Bauteilen zur Er-höhung der Feuer- oder Wetterbe-ständigkeit oder zur Erhöhung derTragfähigkeit. Engl. coating, casing; frz. gaine, revêtement,chemise en béton; it. rivestimento; sp. re-vestimiento.
Unechter Bogen, ein Bogen, dernur aus vorkragenden Steinen mithorizontalen Parallelfugen gemau-ert ist (→ *unechtes Gewölbe). Engl. false arch, corbel a.; it. pseudoarco;sp. arco falso.
Unechtes Gewölbe, ein Gewöl-be, das nur aus vorkragenden Stei-nen mit horizontalen Parallelfugengemauert ist. It. pseudovolta; sp. bóveda falsa.
493 Unechtes Gewölbe
Umgebindehaus
KragkuppelUnechtesDreiecksgewölbe
Unechtes Kraggewölbe
Unterchor, am östl. Ende desKirchenschiffs, westl. vom HohenChor, tiefer als dieser gelegen, vonSchranken umgrenzter Raum fürSänger und niedere Kleriker oderin Klosterkirchen für kranke Mön-che (→ chorus minor). Engl. antechoir; frz. ch�ur bas, c. inférieur;it. coro inferiore; sp. coro inferior.
Unterglied, Bauelement unter derDeckplatte eines Kranzgesimses(→ Gesimsformen). Engl. bed moulding, horizontal joint;frz. sous-moulure; sp. bajo moldura.
Untergurt, → *Gurtbogen, der imGegensatz zum Obergurt an derLaibung eines Gewölbes vortritt. Engl. bottom boom; it. arco intradossato diuna volta; sp. cabeza inferior.
Unterkirche 1. → *Krypta. 2. Erd-geschoß einer → *Doppelkapelle. Engl. 2. lower church; frz. 2. église inférieure;it. 2. chiesa inferiore; sp. iglesia inferior.
Unterrähmverzimmerung →Rähm.
Unterschneidung, eine Quer-schnittsschwächung bei vorsprin-genden Baugliedern (Profilen), z.B.die Neigung der unteren Flächeeiner Gesimsplatte nach außen(→ *Gesimsformen). Engl. distinction; it. assottigliamento; sp. go-terón.
Unterzug, ein Entlastungsträger,der im Gegensatz zum Überzug un-ter einer Balkenlage, einer Deckeoder unter einer Auflast (Mauer)liegt. Engl. bearer, girder, summer; frz. souspou-tre, poutre inférieure; it. trave intradossata;sp. viga de apoyo (inferior).
Utlucht → *Auslucht.
V
Vat (hinterind.), buddhist. Kloster-anlage. Innerhalb einer Umfas-sungsmauer können verschiedeneTempel, → Phraprang und → PhraChedis (→ *Tempelbau 6) angeord-net sein.
Vaubansystem, von dem frz. Bau-meister Vauban entwickeltes Befe-stigungssystem mit → Sternschan-zen. Engl. Vauban system; it. sistema alla Vau-ban; sp. sistema Vauban.
Vedika (ind.), dem Holzzaun nach-gebildeter Steinzaun buddhist. Tem-pelanlagen und → *Stupas.
Vedute (it.), Ansicht einer Stadtoder einer Landschaft (→ Architek-turdarstellung). Engl., it. veduta; frz. vedute; sp. vista.
Veranda (span.), ein gedeckter,manchmal auch verglaster, erdge-schossiger Anbau eines Wohnhau-ses. Engl., it., sp. veranda, am. porch; frz. véranda.
Verankerung, zugsichere Verbin-dung eines Bauteils mit einem an-deren (→ *Anker, → *Ankerstein). Engl. anchoring, mooring, frz. ancrage; it. in-catenamento, allacciamento, ancoraggio;sp. anclaje.
Verband, Verbindung von ein-zelnen Bauteilen, vor allem vonMauersteinen (→ *Mauerwerk,→ *Holzverbindung). Engl. bond, connexion; am. connection; frz.assemblage, appareil, liaison; it. commessu-ra, concatenamento, apparecchio; sp. traba-zón, aparejo.
Unterchor 494
Verblattung, Verbindung, die derunverschiebbaren, winkelfesten ge-genseitigen Verlängerung, Über-kreuzung oder Eckverbindung vonHölzern in der gleichen Ebenedient; sie ist meistens durch einenHolznagel gesichert; der Einschnittdes einen Holzes, der das Blatt desanderen aufnimmt, wird Blattsasse(regional Blattsitz) genannt. Engl. scarving, frz. assemblage par feuillure,enchevauchure; it. giunzione a mezzo le-gno; sp. gárgol.
Verblender, ein Stein aus besse-rem Material, der zum Verklei-den (Verblenden) einer Mauer (→*Mauerwerk) aus einfacheremMaterial dient (→ Blendstein). Engl. facing brick, f. tile; frz. pierre de revête-ment, brique de parement; it. listello darivestimento, l. da paramento, mattone darivestimento; sp. ladrillo de paramento.
Verblendmauerwerk, Blendmau-erwerk, ein mit Blendsteinen (Ver-blendern) verkleidetes → Mauer-werk. Engl. facing masonry; frz. maçonnerie enbriques de parement; it.muratura rivesta (acortina); sp. mampostería de paramento.
Verblendung, Oberflächenver-kleidung, die Massivität aus besse-rem Material vortäuscht (→ Beklei-dung 1). Engl. facing, face work; frz. parement, revête-ment; it. rivestimento; sp. chapeado.
Verbundfenster, Fenster, dessenparallele Flügel gemeinsam ange-schlagen und mit einem einzigenHandgriff zu öffnen sind. Frz. fenêtre à vitrage double, f. composée;it. finestra a doppia chiusura; sp. ventanacon cierre doble.
Verdachung, vorspringendes Bau-element über einer Maueröffnung(→ *Fensterv., Türv. usw.). Frz. entablement; it. tettuccio; sp. cornisa.
Verdübelung, schubsichere Ver-bindung zweier Teile durch → *Dü-bel (→ *Holzverbindungen). Engl. dowel joint, dowelling; it. spinatura;sp. entarugar.
Verfallung, Grat, der verschiedenhohe Firstpunkte miteinander ver-bindet (→ *Dachausmittlung).
Verjüngung, die Verringerung desDurchmessers, z. B. des Schaftseiner → *Säule vom unteren zumoberen Querschnitt. Engl. taper, tapering; frz. contracture, ré-duction, conicité; it. rastremazione; sp. re-ducción de columna.
Verkämmung, Verbindung zwei-er zumeist sich kreuzender, nichtbündig übereinanderliegender Höl-zer, indem der an der Unterseitedes oben liegenden Holzes ausge-schnittene Kamm in die auf derOberseite des unteren Holzes ent-sprechend eingeschnittene Sasseeingreift (→ *Ankerbalken). Engl. cogging, cocking, notching; frz. assem-blage à entaille(s), a. à mi-bois; it. Holz-verbindung: immorsatura, giunzione a code;sp. mortaja, escopladura.
Verklauung, Aufklauung, →*Holzverbindung mit einer Klaue. Frz. chevronnage, assemblage à panne etentaille; sp. trabazón con garra.
Verkleidung, → Verblendung, →Bekleidung 1.
Verkröpfung, Kröpfung, Vorzie-hen eines Gebälks samt Fries und
495 Verkröpfung
Gesims, eines Gesimses u. dergl.über einem vorstehenden Bauteil(Wandsäule, Wandpfeiler, Pilaster,Mauervorsprung u. dergl.). Dievorstehende Kante des verkröpftenElements heißt Kropfkante. DerHöhe nach verkröpfen wird auf-kröpfen genannt. Frz. recoupement, crossette; it. risalto, ri-piegatura; sp. acodadura.
Verlies, ein nur durch eine Dek-kenöffnung zu erreichendes, meistunterird. Gefängnis (z. B. bei ei-nem → *Bergfried). Engl. keep; frz. oubliette, (cul de) bassefosse;it. segreta; sp. calabozo.
Verputz → Putz.
Versatzbossen, an Steinblöcken,z.B. Säulenschäften, stehengelasse-ner Vorsprung, der ein Abrutschender Hebetaue beim Versetzen ver-hindert, zumeist paarweise ange-ordnet und anschließend abgear-beitet.
Versatzung, Verbindung zweierschiefwinklig zusammentreffenderHölzer in einer Ebene durch fla-ches Einschneiden der Hölzerineinander. → *Holzverbindung. Frz. embrèvement; it. augnatura; sp. encaje,embarbillado.
Verschalung → Schalung.
Versetzen, 1. Einfügen von Werk-steinen am Bau mit Hilfe eines Ver-satzplans. 2. Versetztes Anordnenvon Stoßfugen im → Mauerwerk. Engl. 2. to tamp; it. 2. sfalsare (i giunti);sp. colocación.
Verstäbung → *Pfeife.
Verstrebung, Sicherung eines Bau-werks, Bauteils oder einer Baugru-be durch Streben (→ *Strebewerk). Frz. contreboutement; it. controventatura;sp. tornapunta, apuntalamiento.
Verzahnung, 1. zahnartig inein-andergreifende Ausschnitte zurschubsicheren → *Holzverbindung.2. Beim Mauerwerk seitl. Ausbil-dung der Mauerenden, die sich ausdem Schichtwechsel des einzelnenMauer-Verbands ergibt. Engl. indenting, denticulation; frz. 1. assem-blage en adents, endenture, 2. harpe, arrache-ment, redan; it. addentellato, immorsatura;sp. formación de dentículos.
Verzapfung, Verbindung, bei deran der Schnittfläche eines der bei-den Hölzer ein Zapfen (im Quer-schnitt reduziertes Ende) ausgear-beitet wird, der sich in den am an-deren Holz eingearbeiteten Schlitzeinfügt; bei durchgehendem Zap-fenloch Schlitzzapfen genannt.→ *Holzverbindung. Engl. mortising; frz. emmortaisement, en-clavage, empatture; it. incastro, calettatura,calettamento; sp. ensamble de espiga.
Verzogene Stufe, eine nach be-stimmter Gesetzmäßigkeit gezoge-ne Stufe bei gebogenem Treppen-lauf (→ *Treppenformen). Frz. marche balancée, m. gironnée; sp. pel-daño balanceado.
Veste → *Festung.
Verlies 496
a Verkröpfung um Mauervorlagenb Aufkröpfung um Maueröffnung
Vestiarium (lat.), 1. Umkleide-raum in antiken Thermen. 2. Klei-derkammer in einem Kloster. 3.Bezeichnung für → Sakristei. Sp. 1. guardarropa.
Vestibül (lat.), Vestibulum, 1. Vor-hof, Vorhalle vor dem Eingang desröm. Hauses, die in die Baufluchteinbezogene Haustür bildet denhinteren Abschluß, seitl. von Lädenoder anderen Räumen flankiert.Vom V. geht der Raum mit derObergeschoßtreppe ab. 2. In derjüngeren Neuzeit zunächst einVorraum hinter der Haustür vorden Zimmern, häufig mit Garde-robe ausgestattet, dann auch jedesVorzimmer. 3. → *Atrium. Engl., frz. vestibule; it. vestibolo; sp. vestí-bulo.
Viadukt (lat.), Brücke zur Über-führung eines Wegs oder einerEisenbahnlinie über einen Talein-schnitt. Engl. viaduct; frz. viaduc; it. viadotto; sp.viaducto.
Vielpaß, Figur des got. Maßwerksmit zahlreichen → *Pässen ineinem Kreis. Engl. multifoil; frz. ornement polylobé;it. polilobo; sp. ornamento polilobulado.
Vielpaßbogen, Zacken- oder Fä-cherbogen, eine → Bogenform mitzahlreichen rahmenden Pässen ander Laibung. Engl. quatrefoil arch; frz. arc (à réseau d�in-trados) polylobé; it. arco polilobato; sp. arcopolilobulado.
Vierblatt, aus vier gleichgroßenSpitzbogen bestehende Figur desgot. Maßwerks (→ *Blatt 2). Engl. pointed quatrefoil; frz. quatrefeuille( s),quadrilobe; it. quadrifoglio; sp. cuatrifolio.
Vierkanthof, eine hauptsächlichin Oberösterreich vorkommendeForm eines Bauernhauses, bei derWohn- und Wirtschaftsgebäudeeinen allseitig geschlossenen Hofumgeben. Der V. ist meist ausBackstein- oder Schichtmauerwerk,einzelne Teile der Wirtschaftsge-bäude auch als Holzkonstruktionmit Verschalung errichtet.
Vierkonchenanlage, Tetrakon-chos, → *Zentralbau, bei dem vierNischen (Konchen) an ein mittleresQuadrat angefügt sind (→ *Kuppel).It. tetraconco, quadriconco; sp. construc-ción de cuatro conchas.
Vierpaß, Figur des got. Maßwerksmit vier → *Pässen in einem Kreis. Engl. quatrefoil; frz. quadrilobe; it. quadri-lobo; sp. ornamento cuatrilobulado.
Vierschneuß, Figur des got. Maß-werks, bei dem vier → *Schneußein einem Kreis angeordnet sind.
497 Vierschneuß
Vierkanthof � Grundriß und Ansicht
Vierspänner, Typ eines Miethau-ses, bei dem in jedem Geschoß vierWohnungen an einem Treppen-haus angeordnet sind.
Viertelstab, Rundstab mit einemViertelkreisprofil (→ *Stab). Engl. quarterround; frz. (baguette) quart derond; it. modanatura convessa a quarto dicerchio.
Vierung, der in der Kreuzung vonMittelschiff, Querhaus und Chorgelegene, mittlere, rechteckigeRaum des Querhauses, der mit denanschließenden Räumen durch jeeine weite Bogenöffnung über Pfei-lervorlagen oder Mauerzungenverbunden ist. Die ausgeschiedeneV. erhebt sich über quadrat. Grund-riß; ihre V.bogen sind gleich hochund ruhen auf Pfeilervorlagen,deren Tiefe geringer ist als ihreBreite; außerdem fluchten alle vierangrenzenden Räume mit denV.seiten. Bei der abgeschnürten V.müssen die vier Bogenöffnungender V. über rechteckigem Grundrißannähernd gleich hoch sein; darausfolgt, daß die an die V. anschließen-den Räume in ihrer Höhe nichtwesentl. voneinander abweichen;die Bogen ruhen auf Mauerzungen
und können zu den Querhausar-men aus der V.achse versetzt sein.In barocken Kirchen tritt an dieStelle der V. häufig ein ovaler,überkuppelter Zentralraum. Engl. crossing; frz. croisée du transept, in-tersection (de la nef); it. quadrato di incro-cio fra navata e transetto; sp. crucero.
Vierungskuppel, über einer Vie-rung mittels → *Trompen oderPendentifs angeordnete → Kuppel(ungenau auch für ein Kloster-gewölbe über der Vierung). Engl. crossing dome; frz. coupole de la croi-sée; sp. cúpula sobre un crucero.
Vierungspfeiler, die gegliedertenund mit Vorlagen versehenen Pfei-ler an den Ecken einer → *Vierung).Engl. crossing pier; frz. pilier de la croisée;sp. pilares de un crucero.
Vierungsturm, als Zylinder, Ku-bus oder Achteck auf der Vierungruhender und über das Kirchen-dach aufragender Turm; er kannmehrgeschossig sein und seinenQuerschnitt ändern. Zunächst alsHolzkonstruktion (5.�10. Jh.) biszu drei Geschossen (Tristegum)hoch, besteht er seit Anfang des10. Jhs. aus Stein und ruht auf→ *Trompen. Engl. crossing tower; frz. tour du transept;sp. torre de un crucero.
Vihara (ind.), ein in den natürl.Fels gehauenes Kloster (→ *Felsen-kloster, Felsenv.).
Villa (lat.), Landhaus, in der röm.Baukunst seit dem 2. Jh. v. Chr.Herrenhaus des Landeigentümers,ähnl. in der Renaissance. Im 19. Jh.wurde die V. das Wohnhaus deswohlhabenden Bürgers, oft am
Vierspänner 498
Vierung
a nicht ausgeschieden mit durchgehen-dem Langschiff
b nicht ausgeschieden mit durchgehen-dem Querschiff
c ausgeschiedene Vierungd abgeschnürte Vierung
Stadtrand gelegen, heute anspruchs-volles, freistehendes Einfamilien-haus.
Vimana (ind.), Cella (Garbha Gri-ha) und Turmaufbau (Sikhara) ei-nes südind. Tempels (→ *Tempel-bau 5).
Visierung, Planriß, → *Bauriß,eine Aufnahme-, Werk- oder Ent-wurfszeichnung der Gotik.
Vitrine → Schaukasten.
Vogelperspektive, Vogelschau,eine → *Perspektive mit hoch lie-gendem Horizont oder mit nachunten geneigter Blickrichtung. Engl. bird�s-eye perspective; frz. perspectiveà vue d�oiseau; it. prospettiva a volo d�uc-cello; sp. perspectiva a vista de pájaro.
Vollmauerwerk, massives Mau-erwerk, im Gegensatz zum Hohl-mauerwerk. Engl. solid masonry; frz. maçonnerie pleine;it. muratura piena; sp. mampostería maciza.
Volute (frz.), Spiral- oder Schnek-kenform, die häufig an → *Kon-solen, → *Giebeln (V.-giebel) und→ *Kapitellen (ion. Kapitell) vor-kommt. Engl., frz. volute; it. voluta; sp. voluta, espiral.
Volutengiebel, ein seitlich vonVoluten gerahmter Giebel. Engl. scroll gabel, volute g.; frz. pignon àvolutes; it. frontone con volute; sp. frontóncon volutas.
Volutenkapitell, → Kapitell mitbeidseitigen Volutenendigungen(ion. Kapitell, äol. Kapitell). Engl. volute capital, scroll c.; frz. chapiteau àvolutes; it. capitello a volute; sp. capitel convolutas.
Vorarlberger Schema, Bezeich-nung für ein Bauschema, das ausVorarlberg stammende Meister(Thumb, Beer, Moosbrugger) beiihren Kirchenbauten oft angewandthaben. Das Schema zeigt ein ton-nengewölbtes Langhaus zwischenKapellennischen und darüberlie-genden Emporen. Das Querhausladet meist nur wenig aus und istschmaler als das Mittelschiff desLanghauses. In dem etwas eingezo-genen Chor setzt sich das Langhaus-system modifiziert fort. Das V. S.ist in der Schweiz und in Süd-deutschland in der Zeit um 1700weit verbreitet.
Vorburg, eine befestigte Anlage zurSicherung des Tors einer → *Burg. Frz. faubourg; sp. arrabal fortificado.
Vordach, in Niederdeutschland:Abdach, vorspringendes Dach übereinem Eingang oder Sitzplatz. Engl. canopy, projecting roof, overhangingr.; frz. avant-toit, auvent, abat-vent; it. pen-silina, tettoia, tettuccio; sp. techo sobresa-liente, alero.
499 Vordach
Volutengiebel
Vorarlberger Schema(Beispiel: Obermarchtal, Klosterkirche)
Vorfertigung, im Industriebau diein der Fabrik vorgenommene Fer-tigung von Konstruktions- oderRaumteilen, die auf der Baustellezusammengesetzt werden. Eine fürden ma. und neuzeitl. Fachwerk-bau und für den Steinmetzglieder-bau der Gotik ebenfalls zutreffendeProduktionsweise. Engl. prefabrication; frz. préfabrication;it. prefabbricazione; sp. prefabricación.
Vorgelege, im Bauernhaus des17.�19. Jhs. vorhandener kleinerRaum, von dem aus die Öfen inden Stuben beschickt werden. Frz. communicateur; sp. cuarto para ali-mentación de las estufas.
Vorhalle, 1. Vorbau vor einemHauseingang, z. B. eine → *Porti-kus. 2. Vorraum in einem Haus(Vestibül, → *Wohnhaus). Engl. 1. porch; frz. 2. vestibule; it. 2. vesti-bolo, atrio; sp. vestíbulo, pórtico.
Vorhangbogen, Sternbogen, einBogen, der von konvexen Bogen-linien begrenzt wird (→ *Bogen-formen). Engl. inflected arch; frz. arc infléchi, a. à in-flexions multibles; it. arco a tenda; sp. arcotorcido.
Vorhangfassade, Curtain Wall,eine dem konstruktiven Skelett(→ Skelettbau) vorgehängte, nichttragende Fassadenhaut, meist ausMetall und Glas. Engl. curtain wall; frz. façade rideau, mur-ri-deau it. curtain wall, facciata appesa; sp. mu-ro cortina.
Vorkirche, großer Vorraum imWesten einer Kirche, einer Vorhalleoder einem → Narthex ähnl., je-doch mehrschiffig und mehrjochig,zumeist hallenförmig und auch
zweigeschossig, in Burgund ausge-bildet, von den Cluniazensern ver-breitet und in Deutschland bes. vonder Hirsauer Kongregation über-nommen. Frz. antéglise, église annexe; sp. iglesia anexa.
Vorkragung → *Auskragung→ Überhang, .
Vorlage, Gliederung oder Verstär-kung einer → *Mauer, (Mauerv.,Wandv.) oder eines → *Pfeilers(Pfeilerv.) durch einen → Pilaster,eine Halbsäule, → Dienste, → *Li-senen oder dergl. Engl. projection; frz. avant-corps; sp. refuer-zo.
Vorlaubenhaus, ländl. oder städt.Wohnhaus mit einer dreiseitigoffenen Vorlaube vor der Haustür.Die Laubenständer tragen bei derGiebellage den Oberstock oder dasDach, bei der traufseitigen Lage dasDach oder ein Zwerchhaus, ver-breitet im unteren Weichselraum,in West- und Ostpreußen. It. casa porticata; sp. casa con glorieta, c. c.pérgola.
Vormauer, niedrigere äußere Mau-er einer → *Stadtmauer zur Bil-dung eines → Zwingers. Engl. outer wall, bulwark; frz. boulevard;it. antemurale; sp. muralla exterior.
Vorfertigung 500
VorhangfassadeAnsicht und Schnitt
Vorwerk, 1. vom Gehöft getrenn-tes landwirtschaftl. Gebäude. 2.Außenwerk (→ Bastide). Engl. 1. outwork; frz. 2. ouvrage avancé;it. 1. fabbricato rurale distaccato, 2. bastide;sp. edificio exterior.
Voute, Deckenkehle, konkav ge-rundeter Übergang zwischenWand und Decke. Die mit oft sehrgroßen V. gerahmten Spiegeldek-ken werden fälschl. auch Spiegel-gewölbe (→ *Gewölbeformen) ge-nannt. Engl. haunch; frz. voûte; it. sguscio; sp. bó-veda.
W
Wachtturm, Luginsland, Warte,Burgwarte, Wartturm, ma. Turm,der mit einer Plattform versehen ist,um von dort ein Lager, eine Gren-ze oder ein Vorgelände einer Stadtoder Burg zu beobachten, auch aufAnhöhen vor der Stadt oder an denGrenzen eines Hoheitsbereichs ge-legen, untereinander und mit derStadt oder Burg in Sichtverbindung.Engl. watchtower; frz. tour de guet; it. torredi vedetta; sp. atalaya.
Waldhufendorf, Reihen- oderKettendorf in Gebirgsgegenden,dessen Gehöfte längs eines Bachsoder einer Straße liegen und dieHufen in langen parallelen Streifenquer dazu zum Gebirgswald füh-ren (→ *Dorfformen).
Wall, Erdaufschüttung einer Befe-stigung, meist verbunden mit einemGraben. Engl. rampart; frz. rempart; it. vallo, terra-pieno; sp. terraplén.
Wallfahrtskirche, Gnadenkirche,Kirche an einem Gnadenort. In derKirche oder hinter dem Chor kanneine bes. Gnadenkapelle angeord-net und mit der W. durch einenUmgang verbunden sein. Engl. church of pilgrimage; frz. église de pè-lerinage; it. santuario; sp. santuario, iglesiade peregrinación.
Walm, Dachfläche anstelle einesGiebels. Ist nur an einer Seite desDachs ein W., so spricht man vomHalbw.dach, ist nur der obere Teildes Giebels abgewalmt, vom Krüp-pelw., falls nur der untere Teil ab-gewalmt ist, von Fußw. (→ *Dach-formen). Engl. hip; frz. croupe; it. spiovente a trian-golo; sp. copete.
Walmdach → Walm (→ *Dachfor-men).
Wand, urspr. Bezeichnung für einFlechtwerk aus Ruten, d.h. für dielehmverschmierten Flechtwerk-wände, heute Raumabschluß oderRaumtrennung aus Holz, Fach-werk oder Glas im Gegensatz zurmassiven → *Mauer, im allgemei-nen Sprachgebrauch wird aberhäufig jeder Raumabschluß als W.bezeichnet, zumindest die Innen-Ansichtsfläche. Engl. partition, wall; frz. paroi, cloison;it. parete; sp. pared, muro.
501 Wand
Barocke Wallfahrtskirchemit Prozessionsweg (a)(Beispiel: Maria Teinitz)
Wandaufbau, Gliederung der In-nenseiten der Mittelschiffmauerneiner Basilika. In verschiedenen Ge-schossen können Arkaden, Empo-ren, Triforien und Obergaden-fenster angeordnet sein. Nach derAnzahl der übereinanderfolgendenElemente spricht man von zweizo-nigem (Arkade, Fenster), dreizoni-gem (Arkade, Empore, Fenster oderArkade, Triforium, Fenster) undvierzonigem W. (Arkade, Empore,Triforium, Fenster). Bei gewölbtenBasiliken erfolgt die senkrechte Tei-lung der Wände nach Jochen durchWanddienste oder Dienstbündel. Engl. wall structure; sp. estructura mural.
Wandbekleidung, Bekleidung ei-ner Wand mit Wandplatten, Tafel-werk, Tapeten oder dergl. Engl. wall hangings; frz. revêtement desmurs; it. rivestimento di parete; sp. revesti-miento de muro.
Wandbespannung, als Bespan-nung von Innenwandflächen aus
Stoffen, die auf Holzrahmen ge-spannt sind, entweder aus aneinan-dergenähten Bahnen als durchlau-fende Fläche oder in die Rahmenals voneinander getrennte Füllun-gen eingespannt.
Wandbogen, 1. Blendbogen (→*Blendbogen). 2. Stirnbogen (→*Gewölbe). 3. Schildbogen (→ *Ge-wölbeformen). Frz. arc engagé, a. mural; sp. arco mural derefuerzo.
Wanddienst → Dienst.
Wandelaltar, ein → *Flügelaltarmit mehreren Flügelpaaren, wo-durch sich mehrere Wandlungs-möglichkeiten ergeben. Frz. pentaptyque; sp. altar con aletas modi-ficable.
Wandelhalle, eine zum Umher-gehen bestimmte Halle, bes. an öf-fentl. Gebäuden wie Theater, Bä-der, auch an Plätzen (→ Stoa), ein
Wandaufbau 502
Dreizoniger Wandaufbaumit Reihentriforium(Beispiel: Reims,Kathedrale)
gegen Regen geschützter, teilweiseoffener Raum unterschiedl. Ge-staltung. Engl. covered walk; frz. salle des pas perdus,promenoir; it. portiei; sp. paseo, galería.
Wandfliese → Fliese, → *Bau-keramik.
Wandgliederung, Gliederung ei-ner → *Fassade oder der Wände ei-nes Innenraums (→ *Wandaufbau)durch Maueröffnungen (Fensterund Türen), Arkaden, Galerien,Kolonnaden, Nischen, Vorbauten,durch → *Blendbogen, Rahmenund Füllungen, durch Wandvor-lagen (→ *Lisenen, Pilaster u. der-gl.), durch Bänder, Friese, Gesimseu. dergl. und durch die Ausbildungvon Achsen. Engl. wall articulation; frz. division deparois; it. articolazione di una parete;sp. articulación mural.
Wandmalerei, Bemalung vonWänden in Innenräumen, aber auchvon Fassaden (→ *Fassadenmale-rei). Bereits die Ägypter schmück-ten ihre Gräber mit W. Die Kreterverwandten sie zur Ausschmük-kung ihrer Paläste, die Römer glie-
derten ihre W. durch Architektur-motive. Auch im frühen MA., inder Renaissance und vor allem inder Barockzeit spielte die W., er-gänzt durch → Deckenmalerei,eine bedeutende Rolle. Dargestelltwurden Architekturgliederungen(→ *Architekturmalerei), figürl.Szenen und Landschaften, in derBarockzeit wurde eine illusionist.Raumausweitung angestrebt. Diehäufigste Technik der W. ist dieFreskomalerei. Bes. im byzantin.Kulturbereich war die W. durch dasMosaik, in der Gotik durch die→ Glasmalerei ersetzt. Die farbigeBehandlung des architekton. Auf-baus nennt man → *Polychromie. Engl. mural painting; frz. peinture murale;it. pittura murale; sp. pintura mural.
Wandpfeiler → *Pfeiler. Engl. engaged pier, pilaster; frz. pilastre; it. pa-rasta; sp. pilastra mural.
Wandpfeilerkirche, einschiffigeKirche mit Wandpfeilern, zwischendenen anstelle des früheren Seiten-schiffs Kapellen liegen. Bereits in
503 Wandpfeilerkirche
Vierzoniger Wandaufbau(Beispiel: Laon, Kathedrale)
der Spätgotik vorkommend (→ Ein-satzkapellen), wird die W. bevor-zugtes Kirchenbauschema der Re-naissance und bes. des Barocks(→ *Vorarlberger Schema,→ *Hal-lenchor). Engl. pilaster church; frz. église à pilastres;sp. iglesia con pilastras murales.
Wandsäule, Säule, die einer Wandvorgelagert ist (meist Halbsäule, anEcken Dreiviertelsäule), mit dieseraber auch konstruktiv verbundensein kann (→ *Schaftring). Eine W.von geringem Querschnitt und gro-ßer Höhe wird → Dienst genannt. Engl. engaged column; frz. colonne enga-gée; it. colonna incassata, c. alveolare; sp. co-lumna entregada.
Wandteppich, Tapisserie, ein Tep-pich zum Schmuck oder zur Be-kleidung (Bespannung) der Wand(Gobelin). Engl. tapestry; frz. tapisserie, gobelin; it. araz-zo; sp. tapiz, gobelino.
Wandvorlage, Mauervorlage, Glie-derung und Verstärkung einerWand bzw. einer Mauer durch vor-gelegte → *Lisenen, Mauerpfeiler,Pilaster oder dergl. (→ *Mauer).
Wange, 1. seitlicher Abschluß derBank eines → *Chorgestühls, einer→ *Treppe (Wandw., Lichtw.) odereines offenen → *Kamins. 2. Diedem Kämpfer zugeordneten Teileeines Tonnengewölbes, aus denenein Klostergewölbe zusammenge-setzt ist (→ *Gewölbeformen). Engl. 1. Treppe: stringer; frz. 1. Treppe: limon,courbe rampante; it. 1. Chorgestühl: diviso-rio degli stalli, 2. fuso; sp. zanca.
Warenhaus, ein Gebäude, in demWaren aller Art verkauft werden.Im MA. meist als → *Kaufhaus in
der Nähe des Markts gelegen undnur für den Verkauf weniger Wa-rengattungen bestimmt. Größere W.entstanden erst im 19. Jh. mit derEinführung der Gewerbefreiheit.Die W. der Zeit um 1900 haben ei-nen durch alle Geschosse reichen-den, von oben erhellten Mittelraum,an dessen Schmalseite Treppen zuumlaufenden Emporen führen. Inneuerer Zeit sind die einzelnen Ge-schosse durch Rolltreppen oder Per-sonenaufzüge miteinander verbun-den. Da das W. hauptsächl. aufkünstl. Beleuchtung eingestellt ist,wird die Fassade neuerdings ausFormsteinen oder Lichtblendengestaltet. Engl. ware-house; frz. grand magasin (devente); it. grande magazzino; sp. almacén.
Wartturm, Warte, → Wachtturm,außerhalb von ma. Städten auf An-höhen liegender Turm zur Beob-achtung herannahender Feinde. Engl. watch tower, lookout t.; frz. tour deguet; it. torre di vedetta; sp. atalaya.
Wasserburg, Wasserschloß, einevon Wasser umgebene Niederburg(→ *Burg). Engl. moated castle; it. castello circondatodall�acqua; sp. fortaleza rodeada de foso.
Wasserkünste, 1. Anlage mitkünstl. bewegtem Wasser als Spring-brunnen oder Wasserfall in Gar-ten- und Parkanlagen sowie auf öf-fentl. Plätzen. In der Renaissanceüberlaufende Becken und hoheKaskadenfälle mit Schleierbildungdes Wassers. Im Manierismus dün-ne Wasserstrahlen. In barockenGartenanlagen ist das sich ständigverändernde Wasserspiel der Fon-tänen nicht wegzudenken. 2. Gele-
Wandsäule 504
gentl. Bezeichnung für einen ma.-frühneuzeitl. → Wasserturm. Engl. 1. waterworks; frz. 1. machine d�eau,fontaine; it. 1. giochi d�acqua, 2. torredell�acqua; sp. juegos de agua.
Wasserlaub, Blätter des lesb. Ky-mations (→ Kyma). Engl. tongue and dart; frz. cymaise les-bienne; sp. cimacio lesbio.
Wassernase, (→ Nase 2) Tropflei-ste an der vorderen Kante einesWasserschlags (→ *Gesimsformen).Engl. drip (nose); frz. mouchette; it. gronda,cavettino, gocciolatoio; sp. goterón, corta-goteras.
Wasserschenkel → Wetterschenkel(→ *Fenster). Engl. water drip; frz. revers d�eau, reverse-au; it. gocciolatoio (della finestra); sp. bota-guas, vierteaguas.
Wasserschlag, → Kaffgesims, einunterschnittenes Gesims mit Was-sernase und Hohlkehle zur Was-serabweisung an Bauwerken. DerW. kommt bes. häufig in der Gotikals Gesims in der Höhe der Fen-stersohlbank (→ *Gesimsformen)
und an den Vorsprüngen vonStrebepfeilern vor. Engl. cant, weathering; frz. biseau, rejetd�eau, coupe-larmes; it. cornice-gocciola-toio intermedia; sp. moldura de la ventanade medio punto.
Wasserschloß, Wasserburg, vonWasser umgebene Niederburg(→ *Burg). Engl. moated castle; frz. château d�eau; it.castello circondato dell�acqua; sp. castillorodeado de foso.
Wasserschräge, Abschrägung derDeckplatte von Gesimsen (→ *Ge-simsformen), Wasserschlägen undFensterbänken (→ *Fenster). Engl. weathering; frz. biseau; it. spiovente;sp. pendiente, vierte-aguas.
Wasserspeier, Abtraufe, Ansetz-traufe, wasserabführendes Rohraus Blech oder Stein an einer Rinn-leiste, oft in figürl. Ausschmückungals Tier, Drache, Mensch, so bes.an Tempeln und got. Kathedralen,falls keine Abfallrohre der Dach-rinne vorhanden sind. Engl. gargoyle; frz. gargouille; it. doccione;sp. gárgola.
Wasserturm, Wasserhochbehälter,der in der Ebene auf einem turm-ähnl. Unterbau angeordnet wer-den muß (→ *Turm). Engl. water tower; it. serbatoio dell�acquasopraelevato; sp. torre de agua.
Wechsel, Balken, der quer zumübrigen Gebälk verläuft und inzwei → *Balken eingezapft ist. EinW. ist vor allem bei Deckenöffnun-gen (Treppenwechsel) und bei derSchornsteindurchführung (Kamin-wechsel) notwendig. Engl. trimmer; frz. chevêtre, linoir; it. ca-vallo; sp. brochal, viga secundaria.
505 Wechsel
Wasserspeier
Wehrbau, Bauten, die durch Mau-ern, Bastionen u. dergl. geschütztsind (→ *Burg, → *Wehrkirche,→ *Stadtbefestigung, → *Festung,→ *Stadtmauer). Engl. fortified building, fortress; it. costru-zione fortificata; sp. construcción fortifica-da.
Wehrgang, Letze, Rondengang,Mordgang, Verteidigungsgang aufeiner Wehrmauer (Stadt-, Burg-oder Landmauer, Wehrkirche). DerW. liegt entweder hinter der Mauerauf einer auskragenden Holzkon-struktion und ist gegen die Feind-seite durch Schießscharten oder→ Zinnen geöffnet, oder er kragtüber Konsolen mit zwischenliegen-den → Maschikulis und Zinnendarüber nach außen vor, er kannaber auch hinter einer schmalenBrüstungsmauer (Brustwehr) aufder Ringmauer aufruhen. Ebensokann der W. auf der Mauer aufsit-zen als beidseitig auskragenderHolzaufbau (→ Hurde). Die Brust-wehr hat entweder → Schießschar-ten oder besteht aus wechselnd
rechteckigen, nicht überdecktenMaueröffnungen (→ Zinnenfenster,Zinnenscharte) und geschlossenenMauerstücken (Zinne), die je nachGegend und Zeit verschiedengeformt sind. Der W. kann an denMauerecken in kleine vorkragendeTürmchen (→ Scharwachtturm)einmünden. Der W. kann über-dacht sein, um den Verteidiger vorBeschuß von oben zu schützen,auch mehrgeschossige W. kommenvor. Engl. wall walk, alure; frz. chemin de ronde;it. cammino di ronda; sp. adarve.
Wehrkirche, eine zu Verteidi-gungszwecken eingerichtete Kirche.Engl. fortified church; frz. église fortifiée;it. chiesa fortificata; sp. iglesia fortificada.
Wehrturm, Turm einer → *Stadt-befestigung oder → *Burg. Engl. fortified tower; frz. tour de défense;it. torre di difesa; sp. torre de defensa.
Weiler, bäuerl. Einzelgehöft, dasdurch Erbteilung zur regellosen An-häufung einiger kleinerer Gehöfte,zum Weilerdorf,wird; bes. in Süd-westdeutschland. Engl. hamlet; frz. hameau; it. casale; sp. al-dehuela, caserío.
Wehrbau 506
1 mit Schießscharten2 mit Maschikulis und Zinnen
Wehrgang
Wehrkirche
Wellenbrecher, Vorkopf, die meistspitzwinkelig ausgebildete und derStrömung zugewandte Seite desFlußpfeilers einer → *Brücke. Engl. breakwater; frz. brise-lames; it. spero-ne della pila; sp. rompeolas.
Weller(holz), strohumwickelteund lehmbeschmierte Staken alsEinschub zwischen die Deckenbal-ken. Frz. palanton; sp. pértiga envuelta con lodoy paja.
Welsche Haube, Haubendach,Dachhelm, Turmdach mit ge-schweifter Kontur (→ *Dachfor-men). Engl. bulbous dome; frz. comble à l�impéri-ale , toit à l�i.; it. tetto ad elmo, t. all�imperi-ale; sp. techo imperial.
Wendelrampe, Rampe mit gewen-deltem Lauf. Von der Wendeltrep-pe unterscheidet sie sich durch dasFehlen der Stufen und durch fla-chere Steigung. Die W. kann um ei-ne massive Spindel angeordnet sein(→ Eselsturm), ist jedoch meist umeine Lichtspindel größeren Durch-messers angeordnet (→ *Parkhaus).Manchmal führt die W. auch außenum einen Turm (→ *Spiralturm)herum. Engl. spiral ramp, helicline; frz. rampe en vis,r. helicoïdale; it. rampa elicoidale; sp. rampahelicoidal.
Wendelstein, eine dem Bauwerkvorgelagerte Wendeltreppe mitdurchbrochenem Gehäuse, in derRenaissance teilweise mit loggia-ähnl. Formen. Engl. spiral stair tower; frz. escalier en vis àcage ajourée; it. torretta con scala a chioc-ciola; sp. escalera caracol con caja calada.
Wendeltreppe, Schnecke (2),Treppe mit im Grundriß nach der
Mitte zu schmäler werdenden Stu-fen (Spitzstufen), die schrauben-förmig um eine geschlossene Spin-del oder um ein Treppenloch (Au-ge, Treppenauge, offene Spindel,Lichtspindel) ansteigen (Hohltrep-pe). Die geschlossene Spindel ist andie Stufe angearbeitet, doch kannzwischen Stufe und Spindel einekleine Kerbe sein, so daß sich imZentrum eine in ganzer Treppen-höhe durchlaufende Stütze (Spin-del) bildet. Die Lichtwange deroffenen Spindel kann bei größerenÖffnungen von Säulchen unter-stützt sein. Die Untersicht des Trep-penlaufs kann abgetreppt sein, aberauch bei Keilstufen kontinuierl.ansteigen und noch reliefiert sein.Der Lauf einer W. kann auch mitsteigender Tonne (Spiral-, Schnek-kengewölbe) unterbaut sein. Mankann zwei oder mehrere W. übergemeinsamer Spindel anordnen,zwei verschiedene W. in einem Laufvereinen und wieder trennen unddie Laufrichtung wechseln (links-gewendelt, rechtsgewendelt), wobeiallerdings die Spindel beim Wech-sel versetzt angeordnet sein muß.W. sind oft in einem bes. → *Trep-penturm vor der Fassade angeord-net oder diese stehen frei, wie z.B.→ *Triumphsäulen und → *Minars(vor allem in der türk. Baukunst). Engl. winding stair; frz. escalier en colima-çon, e. à vis; it. scala elicoidale; sp. escaleracaracol.
507 Wendeltreppe
Wendeltreppea mit massiver Spindelb mit offener Spindel
c Auge
Wendischer Verband, ein dem→ got.Verband ähnl. Mauerwerk. It. concatenamento vendico; sp. mampos-tería.
Werk, 1. → Opus, jede Baumaß-nahme oder deren Teile (z. B.Handwerk). 2. Im Festungsbau die→ Befestigung (Befestigungswerk). Engl. 1. work; frz. 1. ouvrage; it. 1. lavoro,opera; sp. 1. obra.
Werksatz, wird die Werkzeich-nung für ein Dachwerk (→ *Dach-konstruktion) genannt, in der auf-grund der → *Dachausmittlung dieBinder (Bundgespärre) und alletragenden Konstruktionsteile alsGrundriß aufgetragen werden. Sindauch die Sparren eingezeichnet, soheißt der Plan Sparrenlage. Frz. rayure, enrayure, bâti; it. pianta dellacarpenteria orizzontale del tetto; sp. enray-ado, armazón.
Werkstein, Haustein, Quader, einvon einem Steinmetzen sorgfältigzugerichteter Naturstein. Engl. ashlar; frz. pierre de taille, p. d�appa-reill; it. pietra da taglio, p. squadrata, con-cio; sp. sillar, piedra de talla.
Werksteinbearbeitung → Stein-bearbeitung.
Werksteinmauerwerk, ein ausWerksteinen (Quadersteinen) be-stehendes → *Mauerwerk. Engl. ashlar masonry; frz. maçonnerie enpierres de taille; it. muratura in pietra dataglio; sp. mampostería de piedras labradas,m. d. sillares.
Westbau, architekton. gestalteteWestfront einer Kirche (→ *West-werk, → Westchor). Engl. west end; frz. massif occidental; sp. fa-chada occidental, f. poniente.
Westchor, Chor im W. einer Kir-che bzw. als Gegensatz zum Ost-chor. Der W. kommt hauptsächl. inder karoling. und otton. Baukunstvor. Die → *Doppelchörige Anlagekann liturg. begründet sein (Dop-pelpatrozinium). Engl. west apse, w. choir; frz. contre-abside,contre-chevet; it. controabside; sp. corooccidental, c. poniente.
Westchorhalle, ein im Nieder-rhein-Maas-Gebiet zwischen 1160und 1190 ausgebildeter, dreiseitigvon Emporen umschlossener, drei-geteilter, türmeüberhöhter Recht-eckraum, ohne Westeingang als→ Westchor.
Westquerhaus, westl. Querhausbzw. Querhaus, das an einen →Westchor (→ *Doppelchörige An-lage) angefügt ist. Engl. west transept; frz. transept occidental;it. transetto occidentale; sp. crucero occi-dental.
Westwerk, im Westen an eine Kir-che angefügter, architektonisch undliturgisch selbständiger Baukörperaus mittlerem, turmüberhöhtemRaumschacht und von Emporenumgeben, die über Treppentürme inden westl. Winkeln zugängl. sind;
Wendischer Verband 508
Werksatz(Beispiel: Pfettensparrendach)
links: Werksatza Fußpfetteb Mittelpfettec Binder
rechts: Sparrenlagea Sparrenpaarb Gratsparrenc Schiftsparren
kann auch über einem über vierStützen gewölbten Erdgeschoß er-hoben sein (Vollwestwerk genannt).Engl. westwork; frz. clocher-porche; it. west-werk; sp. construcción poniente anexa, por-tal-campanario.
Wetterdach, Schutzdach, → Vor-dach über Eingängen, Vorfahrtenoder Abstellplatz für Geräte, zu-meist als Pultdach ausgebildet. Engl. oriel, shelter; frz. abri, abrivent, au-vent; it. tettoia; sp. alero.
Wetterfahne, drehbares, oft orna-mental verziertes Blechstück, dasauf Türmen oder dem First einesGebäudes die Windrichtung an-zeigt. Engl. weathervane; frz. girouette; it. bande-ruola; sp. veleta.
Wetterschenkel, Wasserschenkel,unterer Schenkel nach innen auf-gehender Flügel eines → *Fenstersoder einer Außentür mit einerWassernase. Engl.weather groove,water drip; frz. rever-seau, jet d�eau.
Wichhaus → Scharwachtturm.
Widerlager, Auflage eines → *Bo-gens, Brückenbogens (Landfeste)oder → *Gewölbes, das auf Druckund Schub beansprucht ist. Engl. springing wall, butment, abutment;frz. appui butée, culée; it. spalla, piedritto;sp. estribo.
Wimperg, Giebelgebänk, giebelar-tige Bekrönung got. Portale undFenster, die oft Maßwerkschmuckzeigt. Der W. wird von Krabbenund → *Fialen gerahmt und voneiner Kreuzblume abgeschlossen.(Abb. S.510)Frz. guimberge; it. ghimberga; sp. rematehastial gótico.
509 Wimperg
Westwerk(Beispiel: Corvey, 9. Jh.)
Windbrett, Stirnbrett, Brett an derGiebelseite, das die Dachdeckung(Legschindel, Pfannen) gegen Wind-angriff schützt. Engl. gableboard, bargeboard; frz. bordurede pignon, planche de rive; sp. saledizo.
Windfang, Vorraum oder Vorbauan einer Außentür, der das Haus-innere gegen das Eindringen vonKälte schützt. Engl. porch, draft lobby; frz. tambour (deporte); it. ingresso protetto; sp. porche.
Windrispe, eine schräg zur Trauf-linie verlaufende Latte, die als Wind-verband (Längsverband) eines Spar-rendachs dient (→ *Dachkonstruk-tion). Engl. cross lath, sprocket; frz. contrevent,queue de vache; it. controvento; sp. riostrade contraviento.
Windverband, Längsversteifungdurch Diagonalrispen (Windris-pen) unter den Sparren einer→ *Dachkonstruktion. Engl. wind brace; frz. contreventement;it. controventatura; sp. contraviento.
Winkelholz, in der Wandflächeliegendes Holzdreieck im Winkelvon Stütze und Schwelle (Fußw.)bzw. Rähm (Kopfw.). Engl. knee; sp. codo.
Wintergarten, ein mit großenGlasfenstern versehener Innen-raum oder Vorbau eines Gebäudes,der vornehml. zur Pflege von Pflan-zen bestimmt ist und dem → Ge-wächshaus (→ *Orangerie) ver-wandt ist. Engl. winter garden, conservatory; frz. jar-din d�hiver; it. giardino d�inverno; sp. jardínde invierno.
Wirtel, Bund, Zungenstein, ring-förmige Verstärkung am Schafteiner Säule (→ *Schaftring). Engl. annulet, shaft ring; frz. bague (decolonne); it. anello nel fusto di una colon-na; sp. anillo en el fuste de una columna.
Wohnbau, beim W. unterscheidetman Einfamilienhaus, Zweifami-lienhaus und Mehrfamilienhaus,das meist mehrgeschossige Miets-haus (Zinshaus), das Eigenheim,Stockwerks- und Wohnungseigen-tum. Zum dauernden Wohnen,meist getrennt für verschiedeneAlters- oder Berufsgruppen, die-nen Wohnheime wie das Alters-heim (manchmal auch Spital oderBürgerspital), Ledigenheim, Lehr-lingsheim, Schwesternhaus, Klo-sterpflegehof u. dergl. Zu zeitl.begrenztem Wohnen dienen Hotel,Gasthaus, → *Hospital, Apparte-menthaus u. Motel. Nach der Bau-weise gliedert sich der W. in Flach-bau oder Geschoßbau, Kleinhäuser,Reihenhäuser, → *Terrassenhäuser,Atriumhäuser, Hochhäuser, dienach der Grundrißdisposition auchTurm- oder Sternhäuser sein kön-
Windbrett 510
Wimperg
nen. Sind mehrere Wohnungennicht direkt vom Treppenhaus,sondern nur über einen an derHofseite laufenden Gang zugängl.,heißt der W. → *Laubenganghaus.Nach der sozialen Gliederung derBewohner bzw. nach deren Gewer-be unterscheidet man → Bauern-haus, → *Bürgerhaus, Ackerbür-gerhaus und → *Handwerkerhaus(in verschiedenartigen Formen,z. B. Gerberhaus). W. des Adels inder Stadt (Stadtadel, Patriziat)nennt man → *Patrizierhaus, Palast(Palais), in Frankreich auch → *Hô-tel (Adelshôtel). Befestigte W. derma. Zeit sind → *Geschlechter-turm, Wohnturm, Steinhaus, inFrankreich → *Donjon. BefestigteW. außerhalb oder am Rande einerStadt sind Burg und Schloß. Eineunbefestigte Anlage außerhalb einerStadt nennt man Villa oder Land-haus. Nach der Konstruktion sinddie W. in Holzhaus (→ *Umgebin-dehaus, Blockhaus, Fachwerkhaus)und Steinhaus zu unterscheiden. Engl. residential building; frz. constructionrésidentielle, habitation; it. edificio d�abita-zione, e. residenziale; sp. construcciónhabitacional.
Wohnhaus, ein vorwiegend demWohnen dienendes Gebäude. DasW. ist je nach Zeit, Kultur, Klimaund Bautechnik eine sehr verschie-denartige Erscheinung. Wir findenbereits in frühester Zeit neben Ein-raumwohnungen Baukomplexe vonsehr differenzierter Organisation(Ägypten, Kreta). Das ägypt. W. hatmeist einen Vorhof, oft mit einemWasserbasin, auf den eine Vorhalle,ein Quersaal und eine tiefe Halle,die von vielen Nebenräumen um-geben sind, folgen. Außer diesemHaus der Vornehmen gibt es aber
511 Wohnhaus
Röm.Wohnhausa Vorhaus d Alaeb Atrium e Speisesaalc Impluvium f Gang
g Garten
Griech.Wohnhausa Hof c Megaronb Vorhalle d Eingang
Arab. Wohnhausa Hof c Liwanbb Tarma d Eingange Empfangsräume
Obergeschoß
Erdgeschoß
Ägypt.Wohnhausa Vorhof c Quersaalb Vorhalle d Tiefe Halle
auch ganz einfache Typen, die oftals Reihenhäuser aufgebaut sind.Das um einen Hof gruppierte Mit-telmeerhaus entwickelte sich spä-ter auch in dem ähnl. disponiertenarab. und span. W., dessen Innen-hof Patio heißt, weiter. Beim arab.W. schließt an einer Seite des Hofs(in der Form des Peristyls: Tarma)eine zu diesem geöffnete Haupt-halle (Liwan), wodurch der Grund-riß T-Form annimmt (Qa�a, Ka�a).Die Empfangsräume heißen Man-dara bzw. Maq�ad und Selamlik(auch für Männerteil), die Frauen-gemächer Harem (Harimlik), spä-ter auch Serail (urspr. allgemein einPalast). Der Kiosk (urspr. ein Gar-tenhaus) ist die Vorstufe des türk.W., das seine Wohnräume im Ober-geschoß meist symmetr. um einemittlere Halle gruppiert. Die be-reits in Troja und in Mykenae vor-kommende Urform des gr. W. hateinen Vorhof, an den der rechtek-kige Herdraum (→ *Megaron)meist mit einer Vorhalle (Prostas)anschließt. Später wird das gr. W.differenzierter ausgebildet und miteinem Innenhof (Aula) versehen.Man unterscheidet den Speisesaal(Andron), Oecus (Saal) und die nurMännern (Andronitis) bzw. Frauen(Gynäkeion, Thalamos) vorbehal-tenen Teile. In Italien gibt es eineReihe von Steinbauten aus vor-oder frühgeschichtl. Zeit (Tumu-lus, Nuragen), deren späte Nach-läufer, die → *Trulli, heute noch inSüditalien als W. errichtet werden.Das etrusk. Haus war hingegen einum einen Mittelraum gruppiertesEinhaus aus Holz. Das Mittelmeer-haus in seinen gr. und etrusk. For-men ist später für das röm. Hausbestimmend geworden. Über eineVorhalle (Prodomus) gelangt man
in das → *Atrium (urspr. der Herd-raum), das ein Wasserbecken (Im-pluvium) enthält. An das Atriumschließen seitl. Räume (Alae) und anseiner Rückseite der Speisesaal (Ta-blinum, Triclinium) an. Vom Atri-um kann ein Gang (Andron) zudem allenfalls vorhandenen hinte-ren Hausteil (Postica, Posticum)führen, der sich um einen von Säu-lenhallen umgebenen Garten (Peri-stylhof) gruppiert, an dessen Rück-seite sich eine Exedra befindenkann. In Mitteleuropa findet maneine große Vielzahl von → *»Ein-häusern«, also um einen Mittel-raum (Halle) geschlossene W., die inihrer Grundform dem → Bauern-haus folgen, jedoch meist mehrge-schossig angelegt waren. Danebenkommt auch noch das Hofhaus (→*Bürgerhaus) und das → *Gehöftvor. Insgesamt findet man schonim MA. eine Vielzahl von W.-Ty-pen, differenziert nach Landschaftund örtl. Bautradition. Die Renais-sance und die Barockzeit bevor-zugte in Südeuropa wieder das umeinen Innenhof gruppierte W.(Palast), während sich im N. dasbodenständige Hallenhaus hielt.Der moderne → Wohnbau verwen-det z.T. die auch früher schonbekannten Typen, entwickelte aberauch völlig neue Ideen. Engl. mansion, residence; frz. maison d�ha-bitation, immeuble d�h.; it. casa d�abitazio-ne; sp. casa habitación, residencia.
Wohnturm, ein Turm, der ständigoder vorübergehend Wohnzwek-ken dient, in der ma. Stadt haupt-sächl. → *Geschlechtertürme und→ *Patrizierhäuser, in Burgen der→ *Donjon (→ Keep, → Motte).Im Gegensatz zum W., bei dem derWehrcharakter vorherrschend ist,
Wohnturm 512
nennt man turmähnl. Wohngebäu-de der neueren Zeit → Turmhaus. Engl. donjon, tower house; frz. donjon, tourd�habitation; it. torre d�abitazione; sp. to-rreón, torre habitación.
Wölbstein, keilförmiger Steinoder Backstein (Formstein) fürWölbungen, vor allem bei sichtbargemauerten Bogen. Engl. arch stone, voussoir; frz. claveau,voussoir, douelle; it. concio di volta; sp. pie-dra cuneiforme.
Wölbung → *Gewölbe, → *Ge-wölbeformen.
Wolkenkratzer, ein Gebäude vonüberdurchschnittl. Höhe, ähnl.dem Hochhaus bzw. Turmhaus.Die aus Amerika stammende Be-zeichnung (Skyscraper) wird haupt-sächl. für amerikan. Hochhäuserverwendet. Engl. sky-scaper; frz. gratte-ciel; it. gratta-cielo; sp. rascacielos.
Wulst, → *Stab, Rundstab, Vier-telstab u. dergl. als Element vonGesimsen, Friesen, an Säulenba-sen: Torus (att. → *Basis).Sp. toro.
Würfelfries, Schachbrettfries, einma. → *Fries aus schachbrettartigangeordneten vor- und zurück-springenden Elementen. Engl. billet moulding; frz. damier, échi-quier, billette carrée; it. fregio a scacchiera;sp. moldura ajedrezada.
Würfelkapitell, ein ma. → *Ka-pitell, dessen stereometr. Grund-form aus einer Halbkugel miteinem abgeschnittenen Segmentals Säulenauflager gebildet wird,der ein Würfel so einbeschriebenwird, daß vier halbkreisförmige
Ansichtsflächen entstehen, die glattoder reliefiert sein können; häufigmit Halsring und → Abakus. Son-derformen sind das sog. Doppelw.,das in jeder Ansichtsfläche zweimaldie Form des W. zeigt, und das demTrapezkapitell ähnl. sog. Backsteinw.Engl. cushion capital, cubiform c.; frz. cha-piteau cubique (simple); it. capitello cubi-co; sp. capitel cúbico.
X
Xystos (gr.), überdeckte Laufbahnim gr. Gymnasion, die seit dem 5.Jh. v. Chr. neben dem freien Dro-mos liegt, der von den RömernXystus genannt wird. In der anti-ken röm. Villa ein von Portikenund Kryptoportiken gesäumterWeg in der Landschaft bzw. in Ver-bindung mit Säulenhallen beiThermen und Gymnasien.
Y
Yakata, Kultbauten der Tarasken inAltamerika auf einer Plattform mitrunden Vorbauten (→ Tempelbau 4).
Z
Z siehe auch unter »C«.
Zackenbogen, Vielpaß-, Fächer-bogen, Bogen mit zahlreichen rah-menden Pässen an der Laibung(→ *Bogenformen). Engl. chevron arch; frz. arc chevronné;sp. arco encabriado.
513 Zackenbogen
Zahnfries, Deutsches Band, aushochkantigen übereckgestelltenBacksteinen bestehender → *Fries. Engl. zigzag, chevron; frz. frise dentée, zig-zag; it. fregio a zig-zag; sp. friso dentado.
Zahnschnitt (gr. geisipodes), ausBalkenköpfen abstrahierter Friesder kleinasiat. → Ionischen Ord-nung. Eine Sonderform mit untengerundeten Balkenköpfen nenntman Kälberzähne (→ *Korinthi-sche Ordnung). Engl. dentil, toothed moulding; frz. rangéede denticules, dentelure; it. dentello; sp. den-tículo, dentellón.
Zahnsteine, Verzahnungen anMauerenden, die durch vor- undzurückspringende Backsteinschich-ten gebildet werden, um einennahtlosen Weiterbau zu ermögli-chen. Frz. amorce, pierres d�attente, arrachement;it.Verzahnung: addentellato, ammorsatura,immorsatura, vorspringende Steine einer Ver-zahnung: borni; sp. enjarge.
Zange, 1. auf Zug beanspruchter,horizontaler Teil einer → *Dach-konstruktion, meist paarweise vor-kommend. 2. → Schere, → Tenaille.Engl. 1. binding piece, straining piece; frz. 1.moise, entrait; it. 1. staffa del colmo; sp.crucero, riostra, tenazas.
Zapfen, → *Holzverbindung (Ver-zapfung) mit einem an der Quer-schnittsfläche eines Balkens unddergl. vorspringenden Elementkleineren Querschnitts, das in einegleichgroße Negativform des zwei-ten Holzteils eingreift. Engl. tenon, mortise (Holz); frz. tenon; it. te-none, calettatura; sp. espiga.
Zapfenschloß, durch ein Zap-fenloch durchgesteckter Zapfen,
der mit einem Keil (Splint) gesi-chert (geschlossen) ist.
Zarge (mhdt.), 1. rahmenartige,hölzerne Einfassung von Türenund Fenstern (Zargenfenster) ausBohlen oder Vierkantholz; die Z.ist bündig mit der äußeren Mau-erflucht versetzt und wird beimAufführen des Mauerwerks miteingemauert. 2. Konsolartig ausge-bildete Wangenmauer bei Vortrep-pen (Zungenmauer, Sporn). 3. Ein-geschobene Leiste zur Verstärkungoder Versteifung von Vollholz-platten (Türflügel, Tischplatte). Engl. top rail (of chairs, tables), surround(of doors, windows); frz. dormant (d�atten-te), prédormant; it. telaio fisso; sp. cerco deuna ventana, marco d. u. v.
Zargenfenster → Zarge 1.
Zaun, Einfriedung aus Brettern(Bretterz.), Latten (Lattenz.), Draht(Drahtz.) oder anderem Material. Engl. fence; frz. clôture, enclos; it. recinto,steccato; sp. cerca.
Zelle (lat.), urspr. der Raum einerGottheit, Aufenthalts- und Schlaf-raum eines Mönchs oder einerNonne in christl. Klöstern, erst imSpätmittelalter wurden die Schlaf-säle (→ Dormitorium) in Z. unter-teilt. Später auch als Bezeichnungfür Gefängnisraum, Umkleideraum(→ Cella). Engl. cell; frz. cellule; it. cella; sp. celda.
Zellengewölbe, spätgot. → *Ge-wölbeform, die durch Übereck-stellung der Backsteine an denGraten entstehen. Die Flächenzwischen den Graten sind tief ein-geschnitten und verputzt. Engl. net vault, lierne v.; it. volta a ombrel-lo; sp. bóveda celular.
Zahnfries 514
Zeltdach, Pyramidendach, übervieleckigem oder quadrat. Grund-riß errichtetes, allseitig abgewalm-tes Dach, dessen Flächen zu einerSpitze anstelle des Firsts zusam-menlaufen (→ *Dachformen). Engl. tent roof; frz. comble en pavillon,Sonnenzeltdach: vélum; it. tetto a piramide,tetto ad ombrello; sp. tejado de pabellón.
Zeltdachkonstruktion, durchden Architekten Frei Otto entwik-keltes Flächentragwerk aus Poly-ester und PVC, dessen zugbean-spruchbare Haut bei Flächenkrüm-mung Kräfte aufzunehmen vermag.Engl. tent-roof construction; it. coperturasospesa; sp. construcción resistente tipo pa-bellón.
Zentralbau, ein Baukörper mitgleich oder annähernd gleich lan-gen Hauptachsen, so daß keineRichtung vorherrscht. Grundfor-men des Z. sind der Kreis, das Qua-drat und das regelmäßige Vieleck.Differenziertere Formen sind dasgr. Kreuz, die → *Kreuzkuppel-kirche, die → Vierkonchenanlageund Z. mit Umgängen. Zu diesenFormen können noch kleinere rah-mende Elemente treten, die demHauptraum untergeordnet sind,wie Rechteckkapellen oder Apsi-
515 Zentralbau
ZentralbauVierkonchenanlage (Beispiel: Mailand,
S. Lorenzo)
(Beispiel: Rom, Pantheon)
Zentralbau mit Mittelstütze(Beispiel: Wolgast/Greifswald,
St. Gertrud, 15. Jh.)
(Beispiel: Rom, Minerva Medica)
den. Der Z. ist in der Regel über-wölbt. Die entsprechenden Ge-wölbeformen sind → *Kuppel undKlostergewölbe. Bei den differen-zierten Formen steigen die Ge-wölbe von den äußeren Apsidenüber Halbkuppeln bis zur mittlerenHauptkuppel an (osman. → *Mo-schee). Z. kommen in allen Epo-chen vor, wenn auch die Vorliebefür diese Bauform vor allem inihren monumentalen Zeugnissenstarken Schwankungen unterliegt. Engl. central plan; frz. ouvrage à plan cen-tral; it. costruzione a pianta centrale; sp. con-strucción de plano central.
Zentralperspektive, Zentralpro-jektion (→ *Perspektive). Engl. central perspective; frz. perspectivecentrale; it. prospettiva centrale; sp. per-spectiva central.
Zentralraum, Raum mit gleichoder annähernd gleich langenHauptachsen, z. B. der Innenraumeines → *Zentralbaus. Engl. central-plan space; it. spazio centrale;sp. espacio central.
Zeughaus, Arsenal, Gebäude, dasdem Waffenlager einer Stadt dient. Engl. arsenal, armoury; am. armory;frz.; sp. arsenal; it. arsenale.
Ziborium (gr.-lat.), Ciborium, einsteinerner, auf Säulen ruhender,runder, quadrat. oder polygonalerÜberbau in Form eines → *Bal-dachins. Zwischen den Säulen hin-gen in frühchristl. Kirchen Vorhän-ge. Urspr. nur über einem Thronoder Altar mit Heiligengrab, späterallgemein zur Hervorhebung desAltars; auch über einem Grab oderspäter über einem Brunnen. DasZ. stammt aus der Antike undwurde im frühen und hohen MA.allgemein verwandt, in Deutsch-
Zentralperspektive 516
(Beispiel: Rom, St. Peter, Bramanteplan)
(Beispiel: Ravenna, San Vitale)
Ziborium
land bes. im späten MA. verbreitet,in Italien bis ins 17. Jh. auch voreiner Wand stehend, im Barockerneut weit verbreitet und schließl.weitgehend aufgegeben. Engl. ciborium; frz. ciboire; it. ciborio;sp. ciborio, píxide.
Ziboriumaltar, Altar unter einem→ *Ziborium.
Zickzackfries, normann.roman.→ *Fries.
Ziegel (lat. tegula), der aus ge-branntem Ton hergestellte Dach-ziegel: → Biberschwanz, → Pfan-nendach, → Leistenz., → Hohlz.,Krempz., Falzz. sowie Sonder-formen wie Grat-, First und Ortz.(→ *Dachdeckung). Heute häufigfälschl. für → Backstein verwandt. Engl. tile; frz. tuile; it. tegola; sp. teja.
Ziegelboden, Bodenpflaster ausflach (Flachschicht) oder hochkantverlegten Backsteinen. Engl. brick floor; frz. (couvre-) sol en bri-ques; it. pavimento di cotto; sp. pavimentode ladrillos.
Ziegellatte → Dachlatte, →*Dachdeckung. Engl. roof batten; frz. latte à tuiles, l. double;it. horizontal: listello del tetto, wie Dachnei-gung: correntino del tetto; sp. lata del tejado.
Ziegelwürfelkapitell → Trapez-kapitell in Backsteinbau.
Ziehbrunnen, Sodbrunnen →*Brunnen, aus dem das Wasser ineinem Eimer hochgezogen wird.Das Gerüst mit einer Seilrolle odereinem Rad zum Aufziehen desEimers besteht aus zwei oder meh-reren Stützen mit darüberliegen-dem Balken. In der Renaissance
sind Z. oft sehr reich ausgebildet.Eine einfache Form des Z. verwen-det anstelle der Seilrolle einenHebelbalken. Engl. draw-well; frz. puits à roue, p. à pou-lie; it. pozzo a carrucola; sp. pozo de noria.
Ziergewölbe, Gewölbe mit vor-wiegend dekorativer Form, figu-rierte Gewölbe wie Netzrippenge-wölbe, Flechtrippengewölbe unterVerwendung von Zierrippen, diekeine tragende Funktion haben,vorwiegend in der Spätgotik ver-wandt. Engl. decorative vault; frz. voûte décor(ative), v. ornamentale; sp. bóveda orna-mental.
Ziergiebel, ein Giebel, der keinenDachraum abschließt, sondern inder Art von Zwerchgiebeln und→ Blendgiebeln vor allem dekora-tiv angeordnet ist. Engl. decorative gable; frz. pignon dé-cor(atif); it. cimasa ornamentale, frontoneo.; sp. frontón ornamental.
Zikkurat, ein künstl. Stufenbergmit Rampen oder Treppen, aufdem ein Hochtempel (Wohntem-pel) der Gottheit stand.
517 Zikkurat
Zikkurat(Beispiel: Babylon, Turm)
Zimmerflucht, mehrere Zim-mer, die an einer Türflucht gereihtsind (→ *Enfilade). Engl. suite (of rooms); frz. enfilade (de piè-ces); it. fuga di stanze; sp. crugía.
Zingel, Bering, Mantelmauer,Ringmauer einer → *Burg. Engl. enceinte, ring wall, enclosing wall;frz. enceinte, rempart; it. (muro di) cinta;sp. muro anular, m. circular.
Zinne, Brustwehr an Wehrgängenaus wechselnd rechteckiger, nichtüberdeckter Maueröffnung (→ Z.-fenster, Scharte) und geschlosse-nem Mauerstück (Z., Windberg).Je nach Gegend und Zeit sind dieZ. verschieden geformt: recht-eckig, schwalbenschwanzförmig(Kerbz., bes. in Italien in der zwei-ten Hälfte des 12. Jhs. und im 13.Jh.) oder gestuft (Doppelz.). In denZ. finden sich auch Schlitze alsSpählöcher. Engl. battlement, merlon; frz. créneau,merlon; it. merlo; sp. merlón.
Zinnenfenster, Schießfenster,Zinnenscharte, der zwischen denZinnen liegende offene Abschnitt(Zinnenlücke), von dem aus dieVerteidigung vorgenommen wurde.Engl. merlon window; it. saettiera; sp. aber-tura en el merlón.
Zippus (lat.), urspr. ein eiförmigerFelsen oder größerer Stein, deraufgerichtet und beschriftet denRömern als Wegmal diente; auchein kleiner, eiförmiger Denksteinauf einem Grabmal. It. cippo; sp. cipo.
Zircus (lat. circus: Kreis), für Wa-genrennen, aber auch für Tri-umphfeierlichkeiten, Tierhetzen,Seeschlachten und andere Volks-unterhaltungen oder für Versamm-lungen benutzte Anlage der Römer,die vermutl. auf das gr. → Hippo-drom zurückgeht. Die langge-streckte Sandbahn (arena) war derLänge nach weitgehend durch einebreite Mauer (spina) geteilt, an dereinen Schmalseite der Sandbahndie Startstände (carceres) und anden Längsseiten wie an der ande-ren, abgerundeten Schmalseite an-steigende Zuschauerreihen (cavea),die oft durch einen Kanal (euripus)und Gitter gegen die Kampfbahnabgesichert und unbedacht waren.Die runde Schmalseite war durchdie Porta triumphalis durchbro-chen. Auf der Gegenseite war überden zum Ausgleich der Wegstreckeschräg angeordneten Carceres einePlattform (podium) für die Kampf-richter und seitl. je ein Turm (oppi-dum) für die Musiker. Auf derSpina mit vorgesetzten, kegelför-mig zugespitzten Zielsäulen (me-tae) waren an ihren Enden kleine
Zimmerflucht 518
d Karniesbogenzinnee Rundbogenzinnef Dachzinne
a Zinneb Stufenzinnec Kerbzinne
Zinne
Zippus
Heiligtümer, Altäre, Obeliskenoder Statuen errichtet, die von derreligiösen Bedeutung der Spielezeugen. Auf den röm. Zirkus unddas Amphitheater geht der neu-zeitl. Zirkus zurück. Engl. circus; frz. cirque; it., sp. circo.
Zisterne (lat.), Cisterne, gedeck-ter, zumeist unterird. Raum zumSammeln von Regenwasser, bes. inwasserarmen Gegenden, auf Hö-henburgen und Festungen, sofernkeine Wasserversorgung durchBrunnen mögl. ist. Entweder alsoffenes Bassin (alberca) oder ge-
schlossen (aljibe), um das Verdun-sten und Erwärmen zu verhindern,in Konstantinopel meist unterird.,von großer Abmessung mit zahl-reichen Säulenreihen, die die ge-wölbte Decke tragen. Engl. cistern; frz. citerne; it., sp. cisterna.
Zitadelle (it.), bes. befestigtesKernwerk in einer Festung oder ineiner befestigten Stadt und vondieser noch durch Gräben und einSchußfeld (Esplanade) getrennt.Die Z. diente als Kernfestung,zugleich auch als Zeughaus undKaserne, nach Verlust der Werkeauch als Reduit genutzt. Engl. citadel; frz. citadelle; it. cittadella;sp. ciudadela.
Zither, in Kirchen aus Stein er-richtete Schatzkammer zur Auf-bewahrung von Kirchenschätzenund zur Unterbringung von Ar-chiven, teilweise auch als Sakristeigenutzt. Engl. zither, cithara; frz. cithare; sp. cítara.
Zollturm, Zollburg, Mautturm,Mautburg, befestigte Anlage zurErhebung des Wege- oder Was-
519 Zollturm
Zircus (Beispiel: Rom, Circus Maximus)
Zisternea Auffangfläche b Zisternec Schlammfang d Überlauf
e Brunnen
serzolls, entweder neben einerStraße oder einem schiffbaren Flußoder in diesem gelegen, vorrangigim Spätmittelalter. It. torre doganale; sp. torre de aduanas.
Zophoros (gr.), Bilderfries der att.→ *Ionischen Ordnung.
Zubuli, Tubuli, senkrechte Heiz-kanäle in den Wänden röm. Bautenund vor allem der → Thermen(→ *Hypokausten).
Zuganker, ein meist eiserner→ *Anker (Anker 2), der Zug-spannungen aufzunehmen hat; ausHolz: → *Ankerbalken. Engl. tension tie, anchor bolt; frz. tirant(d�arc); it. catena, tirante; sp. tirante.
Zugbrücke, → *Brücke, derenBrückenplatte am vorderen Endean Seilen oder Ketten befestigt ist,die zum Heben der Brückenplatteauf eine Rolle oder einen Well-baum gewickelt werden, sowohlvor Burg- und Stadttoren als An-näherungshindernis und Torver-schluß, als auch über Flüssen undKanälen zur Öffnung der Schiffs-durchfahrt. Engl. drawbridge; frz. pont-levis; it. pontelevatoio; sp. puente levadizo.
Zunfthaus, Gildehaus, Gesell-schafts- und Verwaltungsbau derstädt. Handwerkerzünfte und Kauf-mannsgilden seit dem späterenMA., bes. aufwendig waren die→ Gewandhäuser der Tuchmacher.Das Z. besaß einen großen Saal fürVersammlungen und Festlichkei-ten, Verwaltungsräume und teilwei-se auch Lager- und Schauräume. Engl. guildhall; frz. maison commune, siègede la corporation; it. sede della corporazio-ne, casa della c.; sp. sede gremial.
Zungenmauer, Mauerzunge, 1.zwischen den Treppenwangen zu-sätzlich zur Unterstützung derStufen angeordnete Mauer. 2.Trennmauer zwischen zwei Schorn-steinrohren. 3. Länger als breiteMauervorlage, bes. an der → *Vie-rung oder am Choranschluß. Sp. pared divisoria.
Zungenstein, Bund, Wirtel, einStein, der eine Wandsäule kon-struktiv mit der Mauer verbindet(→ *Schaftring).
Zuspang → Abseite in einemBauernhaus.
Zweibündig, zweihüftig, Anord-nung von zwei Zimmerfluchten aneinem Mittelgang. It. a corpo di fabbrica triplo; sp. disposiciónde dos crugías.
Zweischichtengewölbe, → *Ge-wölbeform der Spätgotik, unterderen figurierter Gewölbeschalenoch eine von dieser losgelösteRippenfiguration vorhanden ist. It. volta gotica a doppio guscio; sp. bóvedade dos capas.
Zweischlitz, Diglyph, Sonder-form einer → Triglyphe (→ *Steg)ohne seitl. Halbschlitze. Frz. diglyphe; it. diglifo; sp. tríglifo de doscanales.
Zweischneuß, eine Figur des go-tischen → *Maßwerks, bei der zwei→ *Schneuße (Fischblasen) in ei-nen Kreis eingefügt sind.
Zweiseithof, im Unterschied zumwinkelförmig angelegten Hof ste-hen sich bei dem Z. die Gebäudegegenüber, zumeist auf der einen
Zophoros 520
Seite das Wohn- oder Wohnstall-haus und auf der anderen Seite dieStälle und die Scheune.
Zweispanner, Wohnhaustyp, beidem je zwei Wohnungen einesGeschosses an einem Treppenhausliegen.
Zweiturmfassade, Doppelturm-fassade (→ *Turmfassade). Engl. twin-tower facade; frz. façade à deuxtours; it. facciata a due torri; sp. fachada dedos torres.
Zwerchdach, 1. → *Lukarne. 2.Querdach, ein senkrecht zumHauptdach ausgerichtetes, kleine-res Dach, bes. bei got. Seiten-schiffen verwandt,wo über jedemJoch ein Walm- oder Satteldachaufsitzt und damit eine Reihungergibt, auch vereinzelt angewandt,dort auch als → Ziergiebel. Engl. transverse roof; frz. toit transversal;it. tetto trasversale; sp. techo transversal.
Zwerchgiebel, Querdach → *Lu-karne.
Zwerchhaus → *Lukarne.
Zwerggalerie, 1857 von H. Otteals Galerie mit kleinen (Zwerg-)Säulen in die kunstwissenschaftl.Literatur eingeführt, unter derTraufe herumgeführter Laufgang,der sich in Säulenarkaden, auchzwischen Pfeilern oder Mauerre-sten, öffnet und mit einer Längs-tonne (niederrhein. Z.) oder mitQuertonnen (it.-oberrhein. Z.)überdeckt ist. Am Niederrhein ste-hen die Säulen auf einer Brü-stungsmauer, die außen einen Plat-tenfries tragen kann. Engl. dwarf gallery; frz. galerie naine; it. gal-leria ad arcatelle; sp. galería con columnasenanas.
Zwickel, Eckzwickel, Teilgewölbe(→ *Trompe), das zu einer → Kup-pel oder zu einem Klostergewölbeüberleitet. Ein Z. in Form einessphär. Dreiecks ist der → Pen-dentif. Engl. gore, lune, spandrel; frz. clef de voûte;it. pennacchio; sp. pechina.
Zwiebeldach, Welsche Haube,Kaiserdach, ein unten konvex undoben konkav geschwungenes Hau-bendach (→ *Dachformen). Frz. toit en oignon; it. tetto a bulbo, t. a ci-polla; sp. tejado imperial, t. persa.
Zwiebelkuppel → *Kuppel miteinem Zwiebeldach (→ *Denkmal-kirche). Frz. coupole bulbeuse, dôme bulbeux; it. cu-pola a bulbo, c. a cipolla; sp. cúpula contejado imperial, c. c. t. persa.
Zwiebelturm, Turm mit einemZwiebeldach (→ *Dachformen). Engl. onion-domed tower; frz. clocher àbulbe, it. torre con tetto a bulbo; sp. torrecon tejado imperial, t. c. t. persa.
Zwiehof, Paarhof, ein Bauern-haus, dessen Wohnhaus und Stallgetrennt nebeneinander stehen.Der Z. kommt hauptsächl. in denOstalpen vor. (Abb. S.522)It. fattoria; sp. granja con instalaciones sepa-radas.
Zwillingsfenster → *gekuppeltesFenster. Engl. gemel window; frz. fenêtre jumelée;it. bifora; sp. ventanas gemelas.
Zwillingskapelle, zwei Kapellenam Ostende eines Querhausarms(→ *Querhaus). It. cappelle orientali del transetto; sp. capil-las gemelas.
521 Zwillingskapelle
Zwinger (lat.), Parcham, Bereichzwischen zwei Wehrmauern oderWällen, zumeist zwischen Ring-und Vormauer. Diente zur Ver-besserung der Verteidigungsfähig-keit und war vor der Einführungder Feuerwaffen von Bedeutung,auch als Tiergehege oder für Wett-kämpfe genutzt, wurde durch denFestungsbau abgelöst. Engl. outer courtyard, enclosure; frz. bayleextérieur, it. pomerio (bei röm. Stadtmauer);sp. recinto exterior cercado.
Zwischenbalken → Fehlbalken.
Zwischendecke, Decke, die zwi-schen zwei Geschoßdecken dieRaumhöhe unterteilt oder vermin-dert. Die Z. kann auch begehbarsein, wodurch ein Zwischenge-
schoß (Entresol, Mezzanin) ent-steht. Engl. false ceiling; it. soppalco; sp. cielofalso, techo intermedio.
Zwischenrippe → Lierne.
Zwischenwand, Trennwand, einenichttragende Scheidewand zwi-schen zwei Räumen. Frz. entre-deux, entrecoux; it. parete divi-soria, tramezzo, divisorio.
Zyklopenmauerwerk, ein ausbes. großen, unregelmäßigen,manchmal aber sehr gut gefügtenNatursteinen bestehendes → *Mau-erwerk. Z. kommt hauptsächl. inder myken. Epoche, bei den He-thitern und bei Inkabauten vor. Engl. cyclopean masonry; frz. maçonneriecyclopéenne; it. mura ciclopiche; sp. mam-postería ciclópea.
Zwinger 522
1 Altenwohnhausa Laubeb Rauchstubec Nebenstubed Kammer
Zwiehof
2 Wohnhausa Laubeb Rauchstubec Nebenstubed Keller e Holzlage
3 Speicher4 Stall
a Futterb Mistc Durchfahrt
5 Schweinestall
525 Dorischer Tempel
A
Ster
eoba
t1
Kre
pis,
Kre
pido
ma
2 St
ylob
at
B
Säul
e 3
Scha
ft m
it E
ntas
is
4 K
anne
lure
n5
Inte
rkol
umni
um
C
Kap
itell
6 Sä
ulen
hals
7 E
chin
us8
Aba
kus
D
Geb
älk
9 E
pist
yl10
Reg
ulae
(m
it G
utta
e)11
Tae
nia
12 T
rigl
yphe
n13
Met
open
14 H
änge
plat
te (
Mut
ulus
)
E
Gieb
el15
Tym
pano
n16
Sch
rägg
eiso
n17
Sim
a18
Akr
oter
ien
Cell
a19
Ort
host
aten
20 A
nten
pfei
ler
Dor
isch
er T
empe
l
527 Ionischer Tempel
A
Ster
eoba
t1
Kre
pis,
Kre
pido
ma
2 St
ylob
at
B
Säul
e3
Bas
is4
Toru
s 5
Troc
hilu
s6
Scha
ft m
it E
ntas
is7
Kan
nelu
ren
8 In
terk
olum
nium
C
Kap
itell
9 W
ulst
körp
er m
it E
iers
tab
10 P
alm
ette
nfri
es11
Vol
uten
12 A
baku
s
D
Geb
älk
13 E
pist
yl, A
rchi
trav
14 F
aszi
en15
Kym
a16
Fri
es
E
Gieb
el17
Gei
son
18 S
chrä
ggei
son
19 S
ima
20 T
ympa
non
21 A
krot
erie
n
Cell
a22
Soc
kel
23 O
rtho
stat
en24
Tür
rahm
ung
25 T
ürflü
gel (
Rah
men
und
Füllu
ng)
26 T
ürst
urz
27 O
berl
icht
28 T
ürve
rdac
hung
29 K
onso
le30
Dec
keng
esim
s
Ion
isch
er T
empe
l
529 Römischer Tempel
1K
repi
s, K
repi
dom
a 2
Post
amen
t 3
Bas
is4
Säul
ensc
haft
5 K
anne
lure
n6
Kor
inth
isch
es K
apite
ll7
Epi
styl
, Arc
hitr
av
8 Fr
ies
9 B
auin
schr
ift
10K
onso
lges
ims
11 G
eiso
n 12
Tym
pano
n13
Sch
rägg
eiso
n14
Sim
a
15 A
krot
erie
n16
Soc
kel
17 O
rtho
stat
en18
Cel
lam
auer
19 T
ürve
rdac
hung
20 K
onso
le21
Göt
terb
ild
Röm
isch
er T
empe
l
531 Römisches Theater
Römisches Theater
1 Säulenbogenstellung2 Arkade3 Basis4 Wandsäule5 Kämpfergesims6 Architravierter Bogen7 Römisch-dorisches Kapitell8 Gebälk9 Fries10 Gesims11 Postament12 Römisch-ionisches Kapitell13 Korinthische Ordnung14 Konsolgesims15 Pilaster16 Konsole17 Korinthisches Pilasterkapitell18 Konsolgesims (Kranzgesims)19 Masten für Sonnensegel20 Taue für Sonnensegel21 Aufziehwinde für Sonnensegel22 Brüstung23 Kassettendecke24 Korinthisches Kapitell25 Säule26 Ringtonne mit Stichkappen27 Ringtonne28 Kämpfergesims29 Stockwerksumgang
533 Altchristliche Basilika
1 M
ittel
schi
ff
2 In
nere
s Se
itens
chiff
3
Äuß
eres
Sei
tens
chiff
4
Hau
ptap
sis
5 N
eben
apsi
s6
Hoc
hsch
iff
7 H
ochs
chiff
enst
er8
Hoc
hsch
iffw
and
9 K
ämpf
erge
sim
s10
Kol
onna
den
11A
rkad
en12
Bas
is13
Pos
tam
ent
14 S
eite
nsch
iffda
ch (
Pultd
ach)
15 M
ittel
schi
ffda
ch (
Satt
elda
ch)
16 O
ffen
er D
achs
tuhl
17 A
psis
gew
ölbe
(H
albk
uppe
l)18
Geb
älk
19 A
mbo
nen
20 Z
ibor
ium
Alt
chri
stli
che
Bas
ilik
a
535 Romanische Kirchenfassade
Romanische Kirchenfassade
1 Sockel2 Sockelgesims3 Portalgewände4 Portaltympanon5 Archivolte6 Satteldach7 Lisene8 Apsisfenster9 Fenstergewände10 Apsis11 Rundbogenfries12 Halbkegeldach13 Wandsäule14 Kleeblattbogen15 Zwerggalerie16 Pultdach17 Gekuppeltes Fenster18 Blendbogen19 Dachgesims20 Pyramidendach21 Giebeldreieck22 Drillingsfenster23 Rautendach
537 Romanische Emporenbasilika
1 Vo
rhal
le2
Ark
aden
3 So
ckel
4
Die
nst
5 Sä
ulen
vorl
agen
6 K
apite
ll7
Seite
nsch
iffen
ster
(R
undb
ogen
fens
ter)
8 Fe
nste
rlai
bung
9 E
mpo
re10
Dri
lling
söff
nung
en11
Ton
neng
ewöl
be12
Vie
rung
13 V
ieru
ngsb
ogen
14 V
ieru
ngsp
feile
r15
Dri
lling
sfen
ster
16 T
rom
pen
17 K
uppe
l18
Vie
rung
stur
m19
Hal
lenk
rypt
a20
Cho
rark
aden
21 C
horu
mga
ng22
Rin
gton
ne m
it St
ichk
appe
n23
Rin
gpul
tdac
h24
Rad
ialk
apel
le
Rom
anis
che
Em
pore
nba
sili
ka
539 Gotische Zweiturmfassade
Gotische Zweiturmfassade
1 Hauptportal2 Linkes (nördliches) Seitenportal3 Rechtes (südliches) Seitenportal4 Gewände5 Archivolten6 Tympanon7 Wimperg8 Portalwimperg9 Galerie10 Fensterrose11 Maßwerkfenster12 Stabwerk13 Maßwerk14 Fensterwimperg15 Galerie16 Fialbaldachin17 Turmfenster18 Blendfenster19 Fialturm20 Turmoktogon21 Oktogonfenster22 Pyramidenstumpf23 Fialen24 Kreuzblumen25 Laterne26 Pyramide27 Kreuzblume
541 Gotische Kathedrale (Grundriß)
Gotische Kathedrale (Grundriß)
1 Chor2 Querhaus (Querschiff)3 Langhaus (Langschiff)4 Turmfront5 Mittelschiff6 Inneres Seitenschiff7 Äußeres Seitenschiff8 Seitenschiffeld9 Mittelschiffeld10 Joch (Jochfeld)11 Vierung12 Nördlicher Querhausarm13 Südlicher Querhausarm14 Chor15 Chorpolygon16 Chorumgang17 Kapellenkranz18 Strebepfeiler19 Vierungspfeiler20 Chorpfeiler21 Mittelschiffpfeiler22 Seitenschiffpfeiler23 Turmpfeiler24 Westfassade25 Querhausfassade26 Querhausmittelportal27 Querhausseitenportal28 Hauptportal29 Linkes (nördliches) Seitenportal30 Rechtes (südliches) Seitenportal
Prototypen der Baukunst 542
Gotischer Wand-aufbau innen
1 Pfeilersockel2 Bündelpfeiler3 Stabwerk4 Seitenschiffenster5 Figurenbaldachin6 Kapitell7 Maßwerk8 Liegender Fünfpaß9 Bogengewände10 Blattgesims11 Triforium12 Dreipaß13 Sohlbank14 Dienstbündel15 Stabwerk16 Kapitell17 Hochschiffenster18 Gurtbogen19 Maßwerk20 Kreuzrippe21 Kappe22 Schildrippe23 Schlußstein
543 Gotischer Wandaufbau außen
Gotischer Wandaufbauaußen
1 Sockel2 Sockelgesims3 Sohlbank4 Strebepfeiler5 Kaffgesims6 Stabwerk7 Seitenschiffenster8 Maßwerk9 Liegender Fünfpaß10 Fenstergewände11 Blattgesims12 Maßwerkgalerie13 Seitenschiffwalmdach14 Triforienfenster15 Fenstergalerie16 Stabwerk17 Fialturm18 Hochschiffenster19 Maßwerk20 Fenstergewände21 Blendmaßwerk22 Dachgesims23 Dachgalerie24 Fensterwimperg25 Kreuzblume26 Fiale
545 Barocke Kirchenfassade
Barocke Kirchenfassade
1 Seitenportale2 Hauptportal3 Sockel4 Pilaster5 Supraporte6 Hauptgebälk7 Segmentgiebel8 Voluten9 Frontispiz10 Tambour11 Attika12 Eckvoluten13 Kuppelfenster14 Spitzkuppel15 Turmhelm16 Helmknauf17 Laterne18 Kuppel der Laterne
547 Barocke Palastfassade
1 H
aupt
port
al
2 N
eben
port
al
3 So
ckel
gesc
hoß
4O
chse
naug
e5
Schl
ußst
ein
6 Fe
nste
rbrü
stun
g7
Fens
terb
ankg
esim
s8
Hau
ptge
scho
ß9
Fens
terv
erda
chun
g10
Pila
ster
11 P
ilast
erka
pite
ll12
Hau
ptge
sim
s13
Att
ikag
esch
oß14
Dac
hges
ims
15 W
alm
dach
16 S
egm
entg
iebe
l17
Fro
ntis
piz
18 G
iebe
lpla
stik
19 M
ansa
rdda
ch
Bar
ocke
Pal
astf
assa
de
LITERATURVERZEICHNIS
INHALT
1. Nachschlagewerke
2. Fachwörterbücher, Glossare
3. Überblicksdarstellungena) Allgemeinesb) Epochen, Gebäudeformen, Bauformen
4. Einzelthemena) Architekturtheorie, BaubetriebMethodenlehre (550) – Architekturtheorie (551) – Bedeutung der Bauformen(551) –Baubetrieb, Bautechnik (551) – Bauzeichnung und Modell (552)b) GebäudeformenSaalkirche (552) – Basilika (552) – Hallenkirche (553) – Zentralbau (553) –Vierung (555) – Chor (555) – Westbau (556) – Kirchturm (556) – Krypta (557) –Atrium (557) – Klosterbau (557) – Bibliothek (557) – Hospital (558) – Universität(558) – Synagoge (558) – Antike Tempel (558) – Hausforschung (558) – Burgen(558) – Schloß (559) – Festung (560)c) Baumaterial und BauformenMaßwerk (560) – Steinbearbeitung (560) – Mauerwerk (560) – Fachwerkbau(561) – Beton (561) – Putz (561) – Stuck (561) – Stütze (561) – Säulenordnung(561) – Kapitell (562) – Bogen (562) – Portal (563) – Fenster (563) – Erker (563)– Empore (564) – Triforium (564) – Zwerggalerie (564) – Treppe (564) – Lettner(564) – Wandgliederung (564) – Ornament (565) – Farbe (565) – Gewölbe (565)– Dach (566) – Fußboden (566)
ABKÜRZUNGEN(vgl. S. X)
1. Nachschlagewerke
E.VIOLLET-LE-DUC: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe auXVIe siècle, 10 Bde., Paris 1854 –1868. – E. BOSG: Dictionnaire raisonné d’archi-tecture et des sciences et arts qui s’y rattachent, 4 Bde., Paris 21883 –1884. – O.LUEGER (Hrsg.): Lex. der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, 7 Bde.,Stuttgart /Leipzig 1894. – Wasmuths Lex. der Baukunst, 5 Bde., Berlin 1929–1937. –Reallex. zur Dt. Kg. 8 Bde. (A-F), Stuttgart / München 1937–1998. – Reallex. zur
Bd./Bde. = Band/BändeBeitr. = BeiträgeBll. = BlätterFS = FestschriftJb. = JahrbuchND = Nachdruck, NeudruckNF = Neue FolgeHb. = Handbuch
Hrsg. = Herausgeber, Herausgegeben von
Kunstwiss. = KunstwissenschaftLex. = LexikonLit. = LiteraturangabenRDK = Reallexikon zur Deut-
schen KunstgeschichteWb. = Wörterbuch
Byzantin. Kunst, 6 Bde. (A-M), Stuttgart 1966 –1997. – N. PEVSNER /H. HONOUR /J. FLEMING: Lex. der Weltarchitektur, München 21987. – Lex. der Kunst, 7 Bde.,Leipzig 1987–1994.
Reallex. für Antike und Christentum, 18 Bde. (A-J), Stuttgart 1950 –1997. – Lex. fürTheologie und Kirche, 11 Bde., Freiburg i. Br. 21957–1967, 31993 ff. (A-M). – Derkleine Pauly. Lex. der Antike, 5 Bde., Stuttgart 1964 –1975. – Lex. des MA., 9 Bde.,München 1980 –1998. [baugesch. Artikel von G. Binding]
2. Fachwörterbücher, Glossare
O. MOTHES: Illustriertes Bau-Lex., 4 Bde., Leipzig/Berlin 41881–1884. – J. HARRIS/J. LEVER: Illustrated Glossary of Architecture 850 –1830, London 1966. – R. OUR-SEL: Glossaire de termes techniques à l’usage des lecteurs de »la nuit des temps«, Paris21971. – F. SALET/S. STYM-POPPER u.a.: Principes d’analyse scientifique. Architec-ture. Méthode et Vocabulaire, 2 Bde., Paris 1972. – Glossarium artis. DreisprachigesWb. der Kunst. Redaktion R. HUBER /R. RIETH, München. Bd. 1: Burgen und FestePlätze, 31995; Bd. 3: Bogen und Arkaden, 1973; Bd. 5: Treppen, 21985; Bd. 6: Ge-wölbe, 31988; Bd. 7: Festungen, 1990; Bd. 8: Das Baudenkmal, 21994; Bd. 9: Städte,1987; Bd. 10: Holzbaukunst, 1997. – C. M. HARRIS (Hrsg.): Dictionary of Architec-ture and Construction, New York u. a. 1975. – H.-J. KADATZ: Wb. der Architektur,Leipzig 1980. – J. ZAJAC: Beitr. zu einer dt.-frz.Terminologie der Baukunst unterbesonderer Berücksichtigung der Gotik, Frankfurt a.M. 1982. – H. J. COWAN/P. R.SMITH: Dictionary of Architectural and Building Technology, London / New York1986. – M. L. APELT: English-German Dictionary: Art History – Archaeology. Engl.-dt. Wb. für Kg. und Archäologie, Berlin 1987. – J. H. PARKER: A Concise Glossaryof Architectural Terms, London 1989. – G. BINDING (Hrsg.): Fachterminologie fürden histor. Holzbau. Fachwerk – Dachwerk, Köln 21990. – E. JASMUND u. a.: Fach-wortschatz für die Handwerkl. Denkmaltechnologie aus Handwerk, Bauwesen, Ar-chitektur. Dt./Niederländ., Niederländ./Dt., Raesfeld 1990. – J. R. PANIAGUA SOTO
Vocabulario básico de arquitectura, Madrid 61990. – F. D. K. CHING: Bildlex. der Ar-chitektur, Frankfurt a. M./New York 1996. – A. GORNY: Wb. Archäologie, München1997. – M. GERNER: Fachwerklexikon, Stuttgart 1997. – M. SCHRADER / J. VOIGT:Bauhistorisches Lexikon. Baustoffe, Bauweisen, Architekturdetails, Suderburg 2003.
3. Überblicksdarstellungen
a) AllgemeinesF. KUGLER: Gesch. der Baukunst. Abgeschlossen von W. Lübke, 5 Bde., Stuttgart1856 –1872. – Hb. der Architektur. II.Teil, Darmstadt 1881 ff. – G. DEHIO/G. VON
BEZOLD: Die kirchl. Baukunst des Abendlandes, 7 Bde., Stuttgart 1884 –1901 (NDHildesheim 1969). – R. REDTENBACHER: Leitfaden zum Studium der ma. Bau-kunst. Formenlehre, Leipzig 21888. – F. BURGER /A. E. BRINCKMANN (Hrsg.): Hb.der Kunstwiss., Potsdam 1915-1930. – F. HESS: Konstruktion und Form im Bauen,Stuttgart 21946. – G. BANDMANN: Die Bauformen des MA., Bonn 1949. – Kunst derWelt, Baden-Baden 1963 –1971. – W. MCDONALD: The Architecture of the RomanEmpire I-II, New Haven / London 1965 –1986. – The Pelican History of Art, Har-mondsworth 1965 ff. (A. W. LAWRENCE: Greek Architecture; A. BOËTHIUS/J. B.WARD-PERKINS: Etruscan and Roman Architecture; R. KRAUTHEIMER: Early Chris-tian and Byzantine Architecture; K. Conant: Carolingian and Romanesque Archi-
549 Literaturverzeichnis
tecture, 800 –1200; P. FRANKL: Gothic Architecture; J. WHITE: Art and Architecturein Italy: 1250 –1400; R. WITTKOWER: Art and Architecture in Italy: 1600 –1750; E.HEMPEL: Baroque Art and Architecture in Central Europe; A. BLUNT: Art and Ar-chitecture in France: 1500 –1700; W. GRAF KALNEIN/ M. LEVEY: Art and Architec-ture of the Eighteenth Century in France; J. SUMMERSON: Architecture in Britain:1530 –1830; J. ROSENBERG u.a.: Dutch Art and Architecture: 1600 –1800; H. GER-SON/E. H. TER KUILE: Art and Architecture in Belgium: 1600–1800; H.-R. HITCH-COCK: Architecture. Nineteenth and Twentieth Centuries). – H. BUSCH (Hrsg.):Epochen der Architektur, Frankfurt a. M. 1968 /69 (E. ADAM: Vorromanik undRomanik; W. GROSS: Gotik und Spätgotik; E. HUBALA: Renaissance und Barock; H.VOSS: 19. Jh.). – A. MALRAUX /A. Parrot (Hrsg.): Universum der Kunst, München1968 –1973. – La nuit des temps, Paris 1955 ff. – Propyläen Kg., Berlin 1969 –1972(ND 1984). – P. L. NERVI (Hrsg.): Weltgesch. der Architektur, Stuttgart 1971ff. (H. E.KUBACH: Romanik; L. GRODECKI: Gotik; P. MURRAY: Renaissance; C. NORBERG-SCHULZ: Barock; C. MANGO: Byzantin. Architektur). – O. BÜTTNER / E. HAMPE:Bauwerk, Tragwerk, Tragstruktur, Berlin / Stuttgart 1977. – H. LAUTER: Die Archi-tektur des Hellenismus, Darmstadt 1986. – N. PEVSNER /H. HONOUR / J. FLEMING:Lexikon der Weltarchitektur, München 21987. – W. MÜLLER-WIENER: Gr. Bau-werke in der Antike, München 1988. – W. KOCH: Baustilkunde, München 111991. –F. OSWALD u.a.: Vorromanische Kirchenbauten, München 1966, Nachträge 1991. –N. PEVSNER: Europ. Architektur von den Anfängen bis zur Gegenwart, München81994. – P. GROS: L’architecture romaine, Paris 1996. – H. STIERLIN (Hrsg.):Taschens Weltarchitektur, Köln 1996–99. – G. BINDING: Architekton. Formenlehre,Darmstadt 41998. [mit Lit.] – H. R. SENNHAUSER (Hrsg.): Frühe Kirchen im öst-lichen Alpengebiet, 2 Bde. München 2003. – G. BINDING: Meister der Baukunst.Geschichte des Architekten- und Ingenieurberufes, Darmstadt 2004. [mit Lit.]
b) Epochen, Gebäudeformen, BauformenE. EGLI: Gesch. des Städtebaus, 3 Bde., Zürich 1959 –1967. – L. BENEVOLO: Gesch.der Architektur des 19. und 20. Jh., 2 Bde., München 1964. – H. E. KUBACH /A.VERBEEK: Roman. Baukunst an Rhein und Maas, 4 Bde., Berlin 1976 –1989. – W.HANSMANN: Baukunst des Barock, Köln 1978. – G. KOWA: Architektur der Engl.Gotik, Köln 1990. – N. NUSSBAUM: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik,Darmstadt 21994. – D. KIMPEL / R. SUCKALE: Die got. Architektur in Frankreich1130 –1270, München 21995. – G. BINDING: Was ist Gotik? Darmstadt 2000. – S.LIEB: Was ist Jugendstil? Darmstadt 2000. – A. SCHUNICHT-RAWE (Hrsg.): Hand-buch der Renaissance, Köln 2002. – N. NUSSBAUM u.a. (Hrsg.): Wege zur Renais-sance, Köln 2003. – S. HOPPE: Was ist Barock? Darmstadt 2003. – A. HARTMANN-VIRNICH: Was ist Romanik? Darmstadt 2004. – M. TÜTING: Rokoko-Gotik. EinPhänomen des engl. Gothic Revival im 18. Jh., Hildesheim 2004.
4. Einzelthemen
a) Architekturtheorie, Baubetrieb
MethodenlehreB. SCHWEITZER: Strukturforschung in Archäologie und Vorgesch. In: Neues Jb. fürAntike und dt. Bildung, NF 1 (1938), 163–179. – D. FREY: Kunstwissenschaftl.Grundfragen, Wien 1946 (ND Darmstadt 1972). – H. SEDLMAYR: Zum Wesen des
Literaturverzeichnis 550
Architektonischen. In: DERS., Epochen und Werke, Bd. 2.,Wien/München 1960, 203–210. – H. BAUER: Architektur als Kunst. In: Kg. und Kunsttheorie im 19. Jh., Berlin1961, 133 –171. – D. GRÖTZEBACH: Der Wandel der Kriterien bei der Wertung desZusammenhanges von Konstruktion und Form in den letzten 100 Jahren, Diss. Berlin1965. – H. BAUER: Kunsthistorik, München 21979. [mit Lit.] – K. und G. KASTER:Kunstgeschichtl. Terminologie, Nürnberg 31980. – I. HABIG / K. JAUSLIN: Der Auf-tritt des Ästhetischen. Zur Theorie der architekton. Ordnung, Frankfurt a.M. 1990.
ArchitekturtheorieF. PIEL: Der histor. Stilbegriff und die Geschichtlichkeit der Kunst. In: Probleme derKunstwiss. 1, Berlin 1963, 18 –37. – J. JAHN: Die Problematik der kunstgeschichtl.Stilbegriffe, Berlin 1966. – H. VON EINEM: Der Strukturbegriff in der Kunstwiss. In:Abhandl. der Akademie der Wiss. und der Lit. Mainz, Geistes- und sozialwiss.Klasse, Wiesbaden 1973, 3 –16. – K. DÖHMER: »In welchem Style sollen wir bauen?«Architekturtheorie zwischen Klassizismus und Jugendstil, München 1976. – H. W.KRUFT: Gesch. der Architekturtheorie, München 1985. [mit Lit.] – G. POCHAT:Gesch. der Ästhetik und Kunsttheorie, Köln 1986. [mit Lit.] – G. GERMANN:Einführung in die Gesch. der Architekturtheorie, Darmstadt 21987. – G. BINDING/A. SPEER (Hrsg.): Ma. Kunsterleben nach Quellen des 11. bis 13. Jh., Stuttgart 1993.– J. PAHL: Architekturtheorie des 20. Jh., München 1999. – A. FORTY: Words andBuildings, New York 2000. – B. EVERS/C. THOENES (Hrsg.): Architekturtheorievon der Renaissance bis zur Gegenwart, Köln 2003. – A. MORAVÁNSZKY: Archi-tekturtheorie im 20. Jh., Wien 2003.
Bedeutung der Bauformen R. KRAUTHEIMER: Introduction to an Iconography of Mediaeval Architecture. In:Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942), 1– 33. – G. BANDMANN:Ikonologie der Architektur. In: Jb. für Ästhetik und allg. Kunstwiss., 1951, 67–109(ND Darmstadt 1969). – G. BANDMANN: Ma. Architektur als Bedeutungsträger,Berlin 1951 (81985). – B. SMITH: Architectural Symbolism of Imperial Rome andthe Middle Ages, Princeton 1956. – S. VON MOOS: Turm und Bollwerk. Beitr. zueiner polit. Ikonographie der it. Renaissancearchitektur, Zürich 1974. – A. REINLE:Zeichensprache der Architektur, Zürich / München 1976. – F. OHLY: Schriften zurma. Bedeutungsforschung, Darmstadt 1977. – H. BRINKMANN: Ma. Hermeneutik,Darmstadt 1980. [mit Lit.] – F. OHLY: Typologie als Denkform der Geschichtsbe-trachtung. In: Natur, Religion, Sprache, Universität. Universitätsvorträge 7, Münster1983, 68 –102. – G. BINDING: Der früh- und hochma. Bauherr als sapiens architec-tus, Darmstadt 21998. [mit Lit.] – G. BINDING: Die Bedeutung von Licht und Farbefür den mittelalterlichen Kirchenbau (= Sitzungsber. d. Wiss. Ges. a. d. Univ. Frank-furt XLI, 3) Stuttgart 2003.
Baubetrieb, BautechnikL. F. SALZMAN: Building in England down to 1540, Oxford 1952. – J. HARVEY: TheMediaeval Architect, London 1972. – M. S. BRIGGS: The Architect in History, NewYork 1974. – J. HARVEY: Mediaeval Craftmen, London 1975. – M. WARNKE: Bau undÜberbau. Soziologie der ma. Architektur nach den Schriftquellen, Frankfurt a. M.1976. – K. PFARR: Gesch. der Bauwirtschaft, Essen 1983. – Bauplanung und Bau-theorie der Antike. Hrsg. Dt. Archäolog. Institut, Berlin 1983. – U. SCHÜTTE:Architekt und Ingenieur. Baumeister in Krieg und Frieden, Wolfenbüttel 1984. –
551 Literaturverzeichnis
W. MÜLLER: Grundlagen got. Bautechnik, München 1990. – G. BINDING: Bau-betrieb im MA., Darmstadt 1993. [mit Lit.] – M. DONDERER: Die Architekten derspäten röm. Republik und der Kaiserzeit, Erlangen 1996. – G. BINDING: Der mit-telalterliche Baubetrieb in zeitgenössischen Abbildungen, Darmstadt und Stuttgart2001. – G. BINDING/S. LINSCHEID-BURDICH: Planen und Bauen im frühen undhohen MA nach den Schriftquellen bis 1250, Darmstadt 2002.
Bauzeichnung und ModellF. OSTENDORF: Die dt. Baukunst im MA., Bd. 1: Aufnahme und Differenzierungder Bautypen, Berlin 1922. – D. FREY: Architekturzeichnung. In: RDK 1, 1937,992–1013. – Plan und Bauwerk. Katalog, München 1957. – K. HECHT: ZurMaßstäblichkeit der ma. Bauzeichnung. In: Bonner Jb. 166 (1966), 253 –268. – H.KOEPF: Die got. Planrisse der Wiener Sammlungen, Köln /Graz 1969. – P. PAUSE:Got. Architekturzeichnungen in Deutschland, Diss. Bonn 1973. [mit Lit.] – G.BINDING: Baubetrieb im MA., Darmstadt 1993. [mit Lit.] – A. LEPIK: Das Architek-turmodell in Italien 1335 –1550, Worms 1994. – H. REUTHER / E. BERCKENHAGEN:Dt. Architekturmodelle, Berlin 1994. – B. EVERS (Hrsg.): Architekturmodelle derRenaissance, München 1995.
b) Gebäudeformen SaalkircheH. WENTZEL: Aula. In: RDK 1, 1937, 1277–1279. – E. BACHMANN: Kunstland-schaften im roman. Kleinkirchenbau Deutschlands. In: Zs. des dt.Vereins für Kunst-wiss. 8 (1941), 159 –172. – E. ROGGE: Einschiffige roman. Kirchen in Friesland undihre Gestaltung, Diss. Stuttgart 1943. – W. BOECKELMANN: Grundformen im früh-karoling. Kirchenbau des östl. Frankenreiches. In: Wallraf-Richartz-Jb. 18 (1956),27–69. – E. LEHMANN: Saalraum und Basilika im frühen MA. In: FormositasRomanica. FS J. Gantner, Frauenfeld 1958, 129–150. – E. LEHMANN: Zum Typus vonSanto Stefano in Verona. In: Stucchi e mosaici alto mediaevali, Mailand 1962, 287–299. – H. SEDLMAYR: Mailand und die Croisillons Bas. In: Arte in Europa, scritti distoria dell’arte in onore di E. Arslan, Mailand 1966, 113 –128. – G. BINDING: Berichtüber Ausgrabungen in niederrhein. Kirchen 1964 –1966. In: Bonner Jb. 167 (1967),bes. 380–387. – H. E. KUBACH /A. VERBEEK: Roman. Baukunst an Rhein und Maas,Bd. 4, Berlin 1989. – Lex. der Kunst 6, 1994, 319 –321. [mit Lit.] – Z. CARVIEZEL-RÜEGG: Die Kirche Kleinhöchstetten Kanton Bern, Bern 1996.
H. G. FRANZ: Die Wandpfeilerhalle im böhm. Barock. In: Forschungen und Fort-schritte 35 (1961), 87–91. – J. BÜCHNER: Die spätgot. Wandpfeilerkirche Bayernsund Österreichs, Nürnberg 1964. – V. KONERDING: Die »Passagenkirche«, Berlin1976. (Bespr.: U. BANGERT/ B. LAULE / H. WISCHERMANN: Kirchen mit »Passagesberrichons« oder »Passagenkirchen«? Berichte und Forschungen zur Kg. 2, Freiburgi. Br. 1979.) – N. LIEB/ F. DIETH: Die Vorarlberger Barockbaumeister, München /Zürich 31976.
BasilikaJ. HECHT: Basilika. In: RDK 2, 1948, 1480 –1488. [mit Lit.] – J. CHRISTERN: DieGrundrißtypen der frühchristl. Basiliken in Algerien und Tunesien, Diss. Bonn1960. – A. MASSER: Die Bezeichnungen für das christl. Gotteshaus in der dt.Sprache des MA., Berlin 1966. – E. LANGLOTZ: Der architekturgeschichtl. Ur-
Literaturverzeichnis 552
sprung der christl. Basilika, Opladen 1972. – K. OHR: Die Form der Basilika beiVitruv. In: Bonner Jb. 175 (1975), 113–127. – P. ZANKER: basilica. In: Reallex. derGerman. Altertumskunde 2, 1976, 81–86. – Reallex. zur byzantin. Kunst 1, 1966, 81–86. – Lex. der Kunst 1, 1987, 417– 420. [mit Lit.]
HallenkircheH. ROSEMANN: Die Hallenkirche auf german. Boden, Diss. München 1924. – L.STOLTZE: Die roman. Hallenkirchen in Alt-Bayern, Diss. Leipzig 1929. – H.PETERS: Das Aufkommen der Hallenkirche in Westfalen, Diss. Tübingen 1930. – H.ROSEMANN: Die westfäl. Hallenkirchen in der ersten Hälfte des 13. Jh. In: Zs. fürKg. 1 (1932), 203 –227. – E. FINK: Die got. Hallenkirchen in Westfalen, Diss.Münster 1934. – S. THURM: Norddt. Backsteinbau. Got. Backsteinhallenkirchenmit dreiapsidialem Grundriß, Berlin 1935. – E. RINGLING: Die Hallenkirchen derSpätgotik in Altbayern, Diss. Freiburg i. Br. 1951. – H. THÜMMLER: Westfäl. und it.Hallenkirchen. In: FS M. Wackernagel, Köln /Graz 1958, 17–36. – E. MUNDT: Diewestfäl. Hallenkirchen der Spätgotik (1400 –1550), Lübeck / Hamburg 1959. – J.MICHLER: Got. Backsteinhallenkirchen um Lüneburg, St. Johannis. Eine Bauten-gruppe im nordöstl. Niedersachsen, Diss. Göttingen 1965. – K. GERSTENBERG: Dt.Sondergotik, Darmstadt 21969. – P. SCHOTES: Spätgot. Einstützenkirchen und zwei-schiffige Hallenkirchen im Rheinland, Diss. Aachen 1970. – H. MEUCHE:Anmerkungen zur Gestalt der sächs. Hallenkirchen um 1500. In: Aspekte zur Kg.von MA. und Neuzeit. K. H. Clasen zum 75. Geb., Weimar 1971, 167–189. – R.RÖKKENER: Die münsterländ. Hallenkirchen gebundener Ordnung, Diss. Münster1980. – N. NUSSBAUM: Die Braunauer Bürgerspitalkirche und die spätgot. Drei-stützenbauten in Bayern und Österreich, Köln 1982. – R. WEIDL: Die ersten Hallen-kirchen der Gotik in Bayern, München 1987. – Lex. der Kunst 3, 1991, 95 f., 101 f.[mit Lit.] – N. NUSSBAUM: Dt. Kirchenbaukunst der Gotik, Darmstadt 21994.
R. KRAUTHEIMER: Lombard. Hallenkirchen. In: Jb. für Kunstwiss. 6 (1928), 176 –188. – G. WEISE: Die Hallen-Kirchen der Spätgotik und Renaissance im mittlerenund nördl. Spanien. In: Zs. für Kg. 4 (1935), 214 –247. – W. KRÖNIG: Hallenkirchenin Mittelitalien. In: Kg. Jb. der Bibliotheca Hertziana 2 (1938), 1–142. – R. WAG-NER-RIEGER: Die it. Baukunst zu Beginn der Gotik. 2 Bde., Graz /Köln 1956/57. –R. WAGNER-RIEGER: It. Hallenkirchen (Zur Forschungslage). In: Mitt. der Ges. fürvgl. Kunstforsch. in Wien 12 (1960), 127–135. – H. THÜMMLER: Vorstufen derzweischiffigen Hallenkirchen Gotlands. In: Acta Visbyensia III, Visby 1969, 189 – 220.– H. E. KUBACH / I. KÖHLER-SCHOMMER: Roman. Hallenkirchen in Europa,Mainz 1997. [mit Lit.]
ZentralbauS. GUYER: Grundlagen ma. abendländ. Baukunst, Einsiedeln 1950. – C. GROSS: Derfrühgot. Zentralbau in Altbayern, Diss. Erlangen 1952. – W. LOTZ: Die ovalenKirchenräume des Cinquecento. In: Röm. Jb. für Kg. 7 (1955), 35 –54. – G.MÖRSCH: Der Zentralbaugedanke im belg. Kirchenbau des 17. Jh., Diss. Bonn1965. – S. SINDING-LARSEN: Some functional and iconographical aspects of thecentralized church in the Italian Renaissance. In: Acta ad archaeologiam et artiumhistoriam pertenentia 2, 1965, 203 –255. – J. H. MÜLLER: Das regulierte Oval,Bremen 1967. – W. GÖTZ: Zentralbau und Zentralbautendenzen in der got. Archi-tektur, Berlin 1968. [mit Lit.] – R. WITTKOWER: Grundlagen der Architektur im
553 Literaturverzeichnis
Zeitalter des Humanismus, München 1969. – B. DIETRICH: Die architekturge-schichtl. Stellung des quadrat. stützenlosen Kapellenraumes im span. Sakralbau des14. Jh., Diss. München 1973. – I. DOLLINGER: Zentralbauten in Tirol, Innsbruck1975. – J. WEIBEZAHN: Gesch. und Funktion des Monopteros, Untersuchungen zueinem Gebäudetyp des Spätbarock und des Klassizismus, Hildesheim 1975. – M.UNTERMANN: Der Zentralbau im MA., Darmstadt 1989. [mit Lit.] – M. LANGEL:Der Taufort im Kirchenbau, Siegburg 1993. – H. R. SENNHAUSER: Battisteri … inSvizzera. In: Il Battistero di Riva San Vitale. Hrsg. R. Cardani, Locarno 1995. – A.LONGHI (Hrsg.): L’architettura del battistero, Mailand 2003. [mit Lit.]
W. HORN: Das Florentiner Baptisterium. In: Mitt. des Kunsthist. Inst. Florenz 5,1938, 99 –151. – K. GALLWITZ: Untersuchungen zum it. zentralen Grab- undMemorialbau des 15. und 16. Jh., Diss. Göttingen 1957. – W. SCHADENDORF:Grillenburg, Weißkirchen und Prag, Zentralbauten im 12. Jh. In: Beitr. zur Kg. Fest-gabe für R. Rosemann, München / Berlin 1960, 33–52. – A. KHATCHATRIAN: Lesbaptistères paléochrétiens, Paris 1962. [mit Lit.] – E. H. LEMPER: Entstehung undBedeutung der Krypten, Unterkirchen und Grufträume vom Ende der Romantik biszum Ende der Gotik. Ms. Habil. Leipzig 1963. [Zentral-Krypten] – A. VERBEEK:Zentralbauten in der Nachfolge der Aachener Pfalzkapelle. In: Das erste Jahr-tausend, Düsseldorf 1964, 898 –947. – G. BANDMANN: Die Vorbilder der AachenerPfalzkapelle. In: Karl der Große III, Düsseldorf 1965, 424–462. – W. GÖTZ: Senones– Honcourt – Metz. Drei verschwundene roman. Zentralbauten. In: AachenerKunstbll. 32 (1966), 97–105. – A. VERBEEK: Die architekton. Nachfolge der Aache-ner Pfalzkapelle. In: Karl der Große IV, Düsseldorf 1967, 113 –156. – W. ERD-MANN/A. ZETTLER: Zur Archäologie des Konstanzer Münsterhügels. In: Schriftendes Vereins für die Gesch. des Bodensees 95 (1977), 19 –134.
H. KOETHE: Frühchristl. Nischenrundbauten, Marburg 1928. – A. MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ: Einfache mitteleurop. Rundkirchen, Prag 1970. – V. GERVERS-MOL-NAR: Roman. Rundkirchen im ma. Ungarn, Budapest 1972 (ungar. mit engl.Zusammenfassung). – H. KÜAS/M. KOBUCH: Rundkapellen des Wiprecht vonGroitzsch, Berlin1977. – J. HAWROT: Die Problematik der vorroman. und roman.Rotunden auf dem Balkan, in Böhmen und in Polen. In: Biuletyn Historii Sztuki 24,Warschau 1962, 255 –283. [poln. mit frz. Zusammenfassung]
J. HUBERT: Les églises à rotonde orientale. In: Frühma. Kunst in den Alpenländern,Lausanne 1954, 309 –320. – A. REINLE: Die Rotunde im Chorscheitel. In: DiscordiaConcors, FS E. Bonjour, Basel / Stuttgart 1968, 727–758. – G. BINDING: Burg undStift Elten am Niederrhein, Düsseldorf 1970, 72–77. – G. BANDMANN: Zur Bestim-mung der roman. Scheitelrotunde an der Peterskirche zu Löwen. In: Beitr. zur Rhein.Kg. und Denkmalpflege II, Düsseldorf 1974, 69 –79. – A. REINLE: Zeichenspracheder Architektur, Zürich / München 1976, 161–173 (Chorscheitelrotunde), 127–131(Heilig- Grab-Bau). – W. SCHLINK: Saint-Bénigne in Dijon, Berlin 1978.
M. CARPA: Die Karner Niederösterreichs, Diss. Wien 1926. – O. HECKMANN: Ro-man. Achteckanlagen im Gebiet der mittleren Tauber, Diss. Berlin 1940 (FreiburgerDiözesanarchiv NF 41, 1941). – F. ZOEPFL: Beinhaus. In: RDK 2, 1948, 204 –214.[mit Lit.] – R. WESENBERG: Wino von Helmarshausen und das kreuzförmige Ok-togon. In: Zs. für Kg. 12 (1949), 30 – 40. – G. SCHWERING-ILLERT: Die ehemaligefrz. Abteikirche Saint-Sauveur in Charroux (Vienne) im 11. und 12. Jh., Düsseldorf1963. – U. ZÄNKER-LEHFELD: Die Matthiaskapelle auf der Altenburg bei Kobern,
Literaturverzeichnis 554
Diss. Bonn 1970. – F. HULA: Ma. Kultmale,Wien 1970. [Karner] – W. WESTER-HOFF: Karner in Österreich und Südtirol, St. Pölten / Wien 1984. – M. KLING:Roman. Zentralbauten in Oberitalien, Hildesheim 1995.
P. A. WAGNER: Brunnenhaus. In: RDK 2, 1948, 1310 –1318. – K. HOFFMANN: ZurDeutung klösterl. Brunnenhäuser des MA. In: Schülerfestg. für H. VON EINEM,Bonn 1965, 102–111. – G. WEBB: Architecture in Britain. The Middle Ages, London21965, 58 – 63, 153 –156. [Chapter House]
Vierung H. BEENKEN: Die ausgeschiedene Vierung. In: Rep. für Kunstwiss. 51 (1930),207–231. – C. PFITZNER: Studien zur Verwendung des Schwibbogens in frühma.und roman. Baukunst, Diss. Bonn 1932 (Düren 1933, 44 – 47). – S. GUYER: Grund-lagen ma. abendländ. Baukunst, Einsiedeln / Zürich / Köln 1950. – G. URBAN: DerVierungsturm bis zum Ende des roman. Stils, Diss. Frankfurt a. M. 1953. – W.BOECKELMANN: Die abgeschnürte Vierung. In: Neue Beitr. zur Kg. des 1. Jt., Bd.2: Frühma. Kunst, Baden- Baden 1954, 101–113. – A. MANN: Doppelchor und Stif-termemorie. In: Westfäl. Zs. 111 (1961), 149 –262. – G. NOTH: Frühformen derVierung im östl. Frankenreich, Diss. Göttingen 1967. – E. LEHMANN: ZuQuerschiff, Vierung und Doppeltransept in der karoling.-otton. Architektur. In: Actahistoriae artium 28 (1982), 219 –228.
ChorL. GIESE: Apsis. In: RDK 1, 1937, 858 – 881. [mit Lit.] – G. BANDMANN: Die Be-deutung der roman.Apsis. In:Wallraf-Richartz-Jb. 15 (1953), 28 – 46. – K. H. ESSER:Über den Kirchenbau des hl. Bernhard von Clairvaux. In: Arch. für mittelrhein.Kirchengesch. 5 (1953), 195 –222. – E. GALL: Chor. In: RDK 3, 1954, 488 –513. – K.PILZ: Chörlein. In: RDK 3, 1954, 538 –546. – E. GALL: Chorumgang. In: RDK 3,1954, 575 –589. [mit Lit.] – A. SCHMIDT: Westwerke und Doppelchöre. In: Westfäl.Zs. 106 (1956), 347– 438. – E. LEHMANN: Bemerkungen zum Staffelchor der Bene-diktinerkirche Thalbürgel. In: FS J. Jahn, Leipzig 1957, 111–130. – A. MANN: Dop-pelchor und Stiftermemorie. In: Westfäl. Zs. 111 (1961), 149 –262. – M. F. HEARN:The Rectangular Ambulatory in English Mediaeval Architecture. In: Journal of theSociety of Architectural Historians 30 (1971), 187–208. – G. ADRIANI: Der ma.Predigtort und seine Ausgestaltung, Stuttgart 1966. – L. ANDERSEN: Exedra. In:RDK 6, 1973, 648 – 671. [mit Lit.] – Lex. des MA. 1, 1980, 812– 814. – U. LOBBEDEY:Die Ausgrabungen im Dom zu Paderborn 1978 /80, Bonn 1986, 150 –157. – S.SCHÜNKE: Entwicklungen in den Chorformen engl. Kirchen vom 11. bis ins 13. Jh.,Diss. Köln 1986. – A. VERBEEK: Roman. Chorformen in Köln und am Niederrhein.In: Baukunst des MA. in Europa. H. E. Kubach zum 75. Geb., Stuttgart 1988, 199 –212. – P. PIVA: La Cathedrale doppia, Bologna 1990. – U. GENTZ: Der Hallen-umgangschor in der städtischen Backsteinarchitektur Mitteleuropas 1350 –1500,Berlin 2003. – A. MORAHT-FROMM (Hrsg.): Kunst und Liturgie: Choranlagen desSpätmittelalters, Ostfildern 2003.
S. STEINMANN-BRODBECK: Herkunft und Verbreitung des Dreiapsidenchores. In:Zs. für schweizer. Archäologie und Kg. 1 (1939), 65 –95. – R. EGGER: Diakonikon.In: RDK 3, 1954, 1382–1387. – G. BANDMANN: Über Pastophorien und verwandteNebenräume im ma. Kirchenbau. In: Kg. Studien für H. Kauffmann, Berlin 1956,
555 Literaturverzeichnis
19 –58. – H. E. KUBACH: Dreiapsidenanlagen. In: RDK 4, 1958, 397– 403. [mit Lit.]– A. VERBEEK: Dreikonchenchor. In: RDK 4, 1958, 465 – 475. [mit Lit.] – G.SCHADE: Der Hallenumgangschor als bestimmende Raumform der bürgerl. Pfarr-kirchenarchitektur in den brandenburg. Städten von 1355 bis zum Ende des 15. Jh.,Diss. Halle 1962. – H. SEDLMAYR: Mailand und die Croisillons Bas. In: Arte inEuropa, scritti di storia dell’arte in onore di E. Arslan, Mailand 1966, 113 –126. – W.GÖTZ: Zentralbau und Zentralbautendenzen in der got. Architektur, Berlin 1968. –H. J. KUNST: Die Entstehung des Hallenumgangschores. In: Marburger Jb. fürKunstwiss. 18 (1969), 1–103. – G. BINDING: Burg und Stift Elten am Niederrhein,Düsseldorf 1970, 104–107. [mit Lit. zu Zellenquerbauten] – F. WOCHNIK: Ursprungund Entwicklung der Umgangschoranlage im Sakralbau der norddt. Backsteingotik,Diss. Berlin 1981. – M. KITSCHENBERG: Die Kleeblattanlage von St. Maria imKapitol zu Köln, Köln 1990. [mit Lit.] – Lex. der Kunst 3, 1991, 99 f. [mit Lit.]
WestbauE. REINHARDT: Über die Cluniazenser Vorhallen. In: Anzeiger für Schweiz. Alter-tumskunde NF 6 (1904/05), 222ff. – A. VERBEEK: Roman. Westchorhallen an Maasund Rhein. In: Wallraf-Richartz-Jb. 9 (1936), 59 – 87. – H. J. DICKE: Westbauten imöstl. England, Diss. Köln 1956. – E. VON KNORRE: Die Westanlage von St.Thomasin Straßburg und in St. Georg in Schlettstadt und der Typus des eintürmigenWestquerbaus. In: Jb. der Staatl. Kunstsammlungen in Baden-Württemberg 2 (1965),7– 48. – R. SCHMITT: Zum Westbau des Havelberger Domes: Bergfried,Wehrturmoder Kirchturm? In: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 6, 1997, 6 – 40. – D. v.SCHÖNFELD DE REYES: Westwerkprobleme, Weimar 1999. [mit Lit.]
KirchturmH. KUNZE: Das Fassadenproblem der frz. Früh- und Hochgotik, Leipzig 1912. – N.KARGER: Der Kirchturm in der österr. Baukunst vom MA. bis 1740, Diss. Würzburg1937. – H. SCHAEFER: The Origin of the Tow-Tower Façade in RomanesqueArchitecture. In: Art Bulletin 27 (1945), 85 –108. – W. ORTH: Fassade und Einzel-turm in der kirchl. Baukunst des dt. Hausteingebietes in der Zeit von 1250 –1550,Diss. Erlangen 1950. – R. KLESSMANN: Die Baugesch. der Stiftskirche zu Möllen-beck a. d. Weser und die Entwicklung der westl. Dreiturmgruppe, Diss. Göttingen1952. – G. URBAN: Der Vierungsturm bis zum Ende des roman. Stils, Diss.Frankfurt a.M. 1953. – G. LOERTSCHER: Die roman. Stiftskirche von Schönenwerd.Ein Beitrag zur Doppelturmfassade im 11. Jh., Basel 1952. – E. BACHMANN:Chorturm. In: RDK 3, 1954, 567–575. – R. KLESSMANN: Dreiturmgruppe. In: RDK4, 1958, 551–556. [mit Lit.] – G. W. HOLZINGER: Roman. Turmkapellen in West-türmen überwiegend ländl. Kirchen im südl. Teil des alten Erzbistums Köln, Diss.Aachen 1962. – W. MÜLLER: Die Ortenau als Chorturmlandschaft, Bühl / Baden1965. – A. REINLE: Die Doppelturmfassade der Vorarlberger Meister. In: Montfort18 (1966), 342–361. – R. LIESS: Die Braunschweiger Turmwerke. In: FS W. Gross,München 1968, 79–127. – H. SCHNELL: Die Entwicklung des Kirchturms und seineStellung in unserer Zeit. In: Das Münster 22 (1969), 85 –96, 177–192. – R. BEYER:Eselstreppe, Eselsturm. In: RDK 6, 1973, 21–24. – A. VON KNORRE: Turmvoll-endungen dt. got. Kirchen im 19. Jh., Köln 1974. – Lex. der Kunst 7, 1994, 459– 461.[mit Lit.] – P. CASTON: Spätma. Vierungstürme im deutschsprachigen Raum,Petersberg 1997. – G. BINDING: Die »Glockentürme« des alten Kölner Doms. In:Wallraf-Richartz-Jb. 63 (2002), 19–32. [mit Lit.]
Literaturverzeichnis 556
KryptaH. BUSCHOW: Studien über die Entwicklung der Krypta im dt. Sprachgebiet, Diss.Würzburg 1934. – R. WALLRATH: Die Krypta, Ms. Habil. Köln 1944. – H. CLAUS-SEN: Heiligengräber im Frankenreich, Diss. Marburg 1950. – A. VERBEEK: DieAußenkrypta. In: Zs. für Kg. 13 (1950), 7–38. – D. WEIRICH: Die Bergkirche zuWorms- Hochheim und ihre Krypta, Worms 1953. [Vierstützenkrypta] – H. CLAUS-SEN: Spätkaroling. Umgangskrypten im sächs. Gebiet. In: Karoling. und otton.Kunst, Wiesbaden 1957, 118 –140. – L. HERTIG VON RÜDERSWIL: Entwicklungs-gesch. der Krypta in der Schweiz, Diss. Zürich 1958. – H. CLAUSSEN: Krypta. In:Lex. für Theol. und Kirche 6, Freiburg i. Br. 21961, 651– 653. [mit Lit.] – E. H.LEMPER: Entwicklung und Bedeutung der Krypten, Unterkirchen und Grufträumevom Ende der Romanik bis zum Ende der Gotik, Ms. Habil. Leipzig 1963. – F.OSWALD: Würzburger Kirchenbauten des 11. und 12. Jh.,Würzburg 1966, bes. 208 –214. – W. GÖTZ: Zentralbau und Zentralbautendenzen in der got. Architektur,Berlin 1968, bes. 236 –252. – L.-F. GENICOT: Les églises mosanes du XIe siècle,Löwen 1972, bes. 116 –168. – M. BURKE: Hall crypts of First Romanesque, Berkeley1976. – J. KRAFT: Die Krypta in Latium, München 1978. – M. MAGNI: Cryptes duhaut Moyen Age in Italie. In: Cahiers archeologiques 28 (1979), 41– 85. – F.WOCHNIK: Zur Entstehung der Umgangschoranlage und der Ringkrypta. In: Stu-dien und Mitteilungen zur Gesch. des Benediktinerordens 96 (1985), 87–131. – U.ROSNER: Die otton. Krypta, Köln 1991. [mit Lit.] – H.-P. GLIMME: Die Krypta inEngland, Weimar 1995.
AtriumL. JOUTZ: Der ma. Kirchenvorhof in Deutschland, Diss. Berlin 1936. – H. REIN-HARDT: Atrium. In: RDK 1, 1937, 1197–1206. – P. C. CLAUSSEN: Chartres-Studien.Zu Vorgesch., Funktion und Skulptur der Vorhallen, Wiesbaden 1975.
KlosterbauW. BRAUNFELS: Abendländ. Klosterbaukunst, Köln 1969. – C. BROOKS: Die großeZeit der Klöster 1000–1300, Freiburg i. Br. 1976. – A. ZETTLER: Die frühen Klo-sterbauten der Reichenau, Sigmaringen 1988. – H. R. SENNHAUSER (Hrsg.): Wohn-und Wirtschaftsbauten frühma. Klöster, Zürich 1996. – H. M. SIMON: ZurEntwicklung und Bedeutung der Brunnenhäuser, Frankfurt a. M. 1997. – W.SCHENKLUHN: Architektur der Bettelorden, Darmstadt 2000. [mit Lit.] – G.BINDING/M. UNTERMANN: Kleine Kg. der ma. Ordensbaukunst in Deutschland,Darmstadt 32001. [mit Lit.] – M. UNTERMANN: Forma Ordinis. Die mittelalterli-che Baukunst der Zisterzienser, München 2001. – P. KLEIN (Hrsg.): Der mittelal-terliche Kreuzgang, Regensburg 2004.
BibliothekE. LEHMANN: Die Bibliotheksräume der dt. Klöster im MA., Berlin 1957. – J. F.O’GORMAN: The Architecture of the Monastic Library in Italy 1300–1600, New York1972. – M. BAUR-HEINOLD: Schöne alte Bibliotheken, München 21974. – A. VERNET
(Hrsg.): Histoire des bibliothèques françaises (6. Jh.–1530), Premodes 1989. – W.JAKSCH / E. FISCHER / F. KROLLER: Österreichischer Bibliotheksbau, Bd. 1, Graz1992. – LEHMANN: Die Bibliotheksräume der dt. Klöster in der Zeit des Barock,Berlin 1996.
557 Literaturverzeichnis
HospitalU. CRAEMER: Das Hospital als Bautyp des MA., Köln 1963. – D. LEISTIKOW: Hospi-talbauten in Europa aus zehn Jh.en, Ingelheim 1967. [mit Lit.] – E. GRUNSKY: Dop-pelgeschossige Johanniterkirchen und verwandte Bauten, Diss.Tübingen 1970. – W.BRAUNFELS: Ma. Sozialpflege im Spiegel ihrer Bauten. In: Das Münster 26 (1973),49 – 60. – D. JETTER: Grundzüge der Hospitalgesch., Darmstadt 1973. [mit Lit.]
Universität K. RÜCKBROD: Universität und Kollegium. Baugesch. und Bautyp, Darmstadt 1977.[mit Lit.] – M. KIENE: Die engl. und frz. Kollegientypen, Diss. Münster 1981. – M.KIENE: Der Palazzo della Sapienza. Zur it. Universitätsarchitektur des 15. und 16. Jh.In: Röm. Jb. für Kg. 23/24 (1988), 219 –271. – M. KIENE: Die it. Universitätspalästedes 17. und 18. Jh. In: Röm. Jb. für Kg. 25 (1989), 329 –380.
SynagogeA. GROTTE: Dt., böhm. und poln. Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX. Jh.,Berlin 1915. – R. KRAUTHEIMER: Ma. Synagogen, Berlin 1927. – R. HALLO: Alme-mor. In: RDK 1, 1937, 384 –387. – O. DOPPELFELD: Die Ausgrabungen im KölnerJudenviertel. In: Die Juden in Köln. Hrsg. Z. ASARIA, Köln 1959, 71–145. – O. BÖ-CHER: Die Alte Synagoge zu Worms (Der Wormsgau, Beiheft 18),Worms 1960. – K.GALLING: Synagoge. In: Die Religion in Gesch. und Gegenwart 6,Tübingen 31962,557–559. – H. HAMMER-SCHENK: Synagogen Deutschland, Hamburg 1981. – H.-P. SCHWARZ (Hrsg.): Die Architektur der Synagoge, Frankfurt a.M. 1988. [mit Lit.]– C. H. KRINSKY: Europas Synagogen, Stuttgart 1988 (engl. New York 1985). – Lex.der Kunst 7, 1994, 160 –162. [mit Lit.]
Antike TempelG. GRUBEN: Die Tempel der Griechen, Darmstadt 41986.
HausforschungG. BINDING (Hrsg.): Das dt. Bürgerhaus, 36 Bde., Tübingen 1959 –1995. – H.-G.GRIEP: Kleine Kg. des dt. Bürgerhauses, Darmstadt 1985. – K. BEDAL: Histor.Hausforschung, Bad Windsheim 1993.
BurgenO. PIPER: Burgenkunde, München/Leipzig 31912 (ND 1967). – B. EBHARDT: DerWehrbau Europas im MA., Bd. 1, Berlin 1939, Bd. 2, Stollhamm 1958. – H. GRAF
CABOGA: Die ma. Burg, Rapperswil 1951. – K. H. CLASEN: In: RDK 3, 1954,126 –173, 221–225. – A. TUULSE: Burgen des Abendlandes, Wien / München 1958.– H.-J. MRUSEK: Burgen in Europa, Leipzig 1973. – W. HOTZ: Kleine Kg. der dt.Burg, Darmstadt 41979. [mit Lit.] – Reallex. der German. Altertumskunde. Hrsg. J.Hoops, Bd. 4, Berlin 1979, 117–216. – W. HOTZ: Pfalzen und Burgen der Stau-ferzeit, Darmstadt 1981. – W. MEYER: Burgen, München 1982. – Lex. des MA. 2,München 1983, 957–1003. – T. BILLER: Die Adelsburg in Deutschland, München1993. – U. ALBRECHT: Der Adelssitz im MA., München/Berlin 1995. – R. HUBER /R. RIETH: Burgen und feste Plätze. Glossarium artis 1, München 31995. [mit Lit.]– J. ZEUNE: Burgen. Symbole der Macht, Regensburg 1996. – T. BILLER /G. U.GROSSMANN: Burg und Schloß, Regensburg 2002.
Literaturverzeichnis 558
R. A. BROWN: English Mediaeval Castles, London 1954. – E. GALL: Deutschordens-burg. In: RDK 3, 1954, 1304 –1312. – H. WÄSCHER: Feudalburgen in den BezirkenHalle und Magdeburg, Berlin 1962. – S. TOY: The Castles of Great Britain, London31963. – W. BORNHEIM gen. SCHILLING: Rhein. Höhenburgen, Neuss 1964. – G.BINDING u. a.: Burg und Stift Elten am Niederrhein, Düsseldorf 1970. – G. BIN-DING: Schloß Broich in Mülheim/Ruhr, Düsseldorf 1970. – G. ANGHEL: Ma. Bur-gen in Transsilvanien, Bukarest 1973. – C. ROCOLLE: 2000 ans de fortification fran-çaise, 2 Bde., Limoges / Paris 1973. – C. MECKSEPER: Ausstrahlungen des frz.Burgenbaus nach Mitteleuropa im 13. Jh. In: Beitr. zur Kunst des MA. FS H.Wentzel, Berlin 1975, 135 –144. – J. FRYCZ: Der Burgenbau des Ritterordens inPreußen. In: Wiss. Zs. der Univ. Greifswald 29 (1980), 45 –56. – H. und A. FABINI:Kirchenburgen in Siebenbürgen, Leipzig 1985. – G. BINDING: Dt. Königspfalzen,Darmstadt 1996. [mit Lit.]
G. GOZZADINI: Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali primaappertennero, Bologna 1875. – W. BLEYL: Der Donjon,Aachen 1973. – H.-K.PEHLIA: Wehrturm und Bergfried im MA., Diss. Aachen 1974. – R. GUTBIER:Zwinger und Mauerturm. In: Burgen und Schlösser 17 (1976), 21–29. – R.STROBEL: Das Bürgerhaus in Regensburg, Tübingen 1976, 32–50. [Geschlechter-türme] – A. ANTONOW: Burgen des süddt. Raums im 13. und 14. Jh. unter bes.Berücksichtigung der Schildmauern, Bühl 1978. – H. HINZ: Motte und Donjon,Köln 1981. – U. WIRTLER: Spätma. Repräsentationsräume auf Burgen im Rhein-Lahn-Mosel-Gebiet, Köln 1987. – U. STEVENS: Burgkapellen, Darmstadt 2003.
SchloßE. BERCKENHAGEN: Barock in Deutschland – Residenzen, Berlin 1966. – C. L.FROMMEL: Der röm. Palastbau der Hochrenaissance, 3 Bde.,Tübingen 1973. – W.HOTZ: Kleine Kg. der dt. Schlösser, Darmstadt 21974. [mit Lit.] – S. VON MOOS:Turm und Bollwerk, Zürich 1974. – R. WAGNER-RIEGER: Gedanken zum fürstl.Schloßbau des Absolutismus. In: Fürst – Bürger – Mensch, Wien 1975, 42–70. – R.ZÜRCHER: Rokoko-Schlösser, München 1977. – W. HANSMANN: Baukunst desBarock, Köln 1978. [mit Lit.] – H. HERZOG: Rhein. Schloßbauten im 19. Jh., Köln1981. – W. PRINZ/R. KECKS: Das frz. Schloß der Renaissance, Berlin 1985. – U.ALBRECHT: Von der Burg zum Schloß. Französische Schloßbaukunst im Spätmittel-alter, Worms 1986. – J.-P. BABELON: Châteaux de France au siècle de la Renaissance,Paris 1989. – S. HOPPE: Die funktionale und räuml. Struktur des frühen Schloßbausin Mitteldeutschland 1470 –1570, Köln 1996.
W. OHLE: Die protestant. Schloßkapellen der Renaissance in Deutschland, Diss.Leipzig/Stettin 1936. – C. ELLING: Function and Form of the Roman Belvedere. In:Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskabarkaeologisk-kunsthistoriske meddelelse 3,Nr. 3 (1950), 1–59. – H. KREISEL: Dt. Spiegelkabinette, Darmstadt 1953. – E. HER-GET: Die Sala terrena im dt. Barock unter bes. Berücksichtigung ihrer Entwicklungaus der abendländ. Grottenarchitektur, Diss. Frankfurt a.M. 1954. – A. GEBESSLER:Der profane Saal des 16. Jh. in Süddeutschland und den Alpenländern, Diss. Mün-chen 1957. – H. A. FRENZEL: Brandenburg.-preuß. Schloßtheater, Berlin 1959. – D.HENEBO/A. HOFFMANN: Gesch. der dt. Gartenkunst, 3 Bde, Hamburg 1962–1965.– H. ARNDT: Gartenzimmer des 18. Jh., Darmstadt o.J. (1963). [mit Lit.] – W. GÖTZ:Dt. Marställe des Barock, München / Berlin 1964. – F. V. RAUDA: Schloßkirchenund Schloßkapellen des Barock in Österreich und Deutschland, Diss. Wien 1965.
559 Literaturverzeichnis
– L. HAGER: Enfilade. In: RDK 5, 1967, 333 –340. – L. HAGER: Eremitage. In:RDK 5, 1967, 1203 –1229. – N. KNOPP: Das Garten-Belvedere, München / Berlin1967. – E. HERGET/ W. BUSCH: Fasanerie. In: RDK 7, 1975, 437– 461. – W. LIEBEN-WEIN: Studiolo, Berlin 1977. – E. ULFERTS: Große Säle des Barock, Petersberg 2000.
FestungM. LE BOND: Elements de Fortification, Paris 1756 (81786). – Kleines Kriegswb.,Frankfurt a.M. 1794. – A. VON ZASTROW: Hb. der vorzüglichsten Systeme und Ma-nieren der Befestigungskunst, Berlin 1828. – O. MOTHES: Illustrirtes Baulex., Bd. 2,Leipzig / Berlin 1875, 293 –299. – K.-H. CLASEN: Bastion. In: RDK 2, 1948, 1508–1512. – E. EGLI: Gesch. des Städtebaus, Bd. 3, Zürich / Stuttgart 1967. [mit Lit.] –C. ROCOLLE: 2000 ans de fortification française, 2 Bde., Limoges / Paris 1973. – S.VON MOOS: Turm und Bollwerk, Zürich 1974. – H. EICHBERG: Militär und Tech-nik, Schwedenfestungen des 17. Jh. in den Herzogtümern Bremen und Verden,Düsseldorf 1976. – H. NEUMANN: Bemerkungen zur Notwendigkeit der Festungs-forschung und Festungsnutzung in der Bundesrepublik Deutschland. In: Burgenund Schlösser 19 (1978), 63 –70. [mit Lit.] – J. R. KENYON: Castles,Town Defencesand Artillery Fortifications in Britain: a Bibliography 1945 –1974, London 1978. – W.MÜLLER-WIENER: Festung. In: RDK 8, 1983, 304 –348. – U. SCHÜTTE (Hrsg.):Architekt und Ingenieur in Krieg und Frieden, Wolfenbüttel 1984. – H. NEUMANN:Festungsbaukunst und Festungsbautechnik, Koblenz 1988. [mit Lit.] – R. HUBER /R. RIETH: Festungen. Glossarium artis 7, Tübingen 1990. [mit Lit.] – S. AMT/ W.BETTAUER: Festung Nienburg. Die baul. Entwicklung der Festungsanlagen, Nien-burg 1996. – H. R. NEUMANN (Hrsg.): Historische Festungen, 2. Bde. Stuttgart1995, 2000.
c) Baumaterial und Bauformen
MaßwerkG. BINDING: Maßwerk, Darmstadt 1989. – U. KNAPP: Salem, Stuttgart 2004, 93–113.– A. CAMPBELL: Transoms in the Windows of Gothic Churches on the EuropeanMainland, Köln 2004.
SteinbearbeitungF. RUPP: Inkrustationsstil der roman. Baukunst zu Florenz, Straßburg 1912. – A.KIESLINGER: Gesteinskunde für Hochbau und Plastik, Wien 1951. – E. REUSCHE:Polychromes Sichtmauerwerk byzantin. und von Byzanz beeinflußter BautenSüdosteuropas, Diss. Köln 1971. – A. CLIFTON-TAYLOR: The Pattern of EnglishBuilding, London 1972. – K. MAIER: Ma. Steinbearbeitung und Mauertechnik alsDatierungsmittel. Bibliograph. Hinweise. In: Zs. für Archäologie des MA. 3 (1975),209 – 216. – A. KAMPHAUSEN/K. MÖSENEDER: Feldsteinbau. In: RDK 7, 1981,1086 –1137. – D. HOCHKIRCHEN: Ma. Steinbearbeitung und die unfertigen Kapi-telle des Speyerer Domes, Köln 1990. – Lex. der Kunst 4, 1992, 617– 621. [mit Lit.]
MauerwerkE. RUPP: Gesch. der Ziegelherstellung, Heidelberg o. J. – R. HAUPT: Kurze Gesch.des Ziegelbaus und Gesch. der dt. Ziegelbaukunst bis durch das 12. Jh., Heide inHolstein 1929. – O. STIEHL: Backstein. In: RDK 1, 1937, 1340 –1345. [mit Lit.] – E.NEUMANN: Die Backsteintechnik in Niedersachsen während des MA. In: Lüne-burger Bll. l0, 1959, 21– 44. – J. HOLLESTELLE: De Steenbakkerij in de Nederlanden
Literaturverzeichnis 560
tot omstreeks 1560, Diss. Utrecht 1961. – F. HART/ E. BOGENBERGER: Der Mauer-ziegel, München 1967. – G. BINDING: Das Aufkommen von Backstein und Ziegelin Deutschland. In: Gebrannte Erde, Stuttgart 1973. [mit Lit.] – K. B. KRUSE:Backsteine und Holz. Baustoffe und Bauweisen Lübecks im MA. In: Jb. f. Haus-forschung 33 (1983), 37–61.
FachwerkbauU. GROSSMANN: Der Fachwerkbau, Köln 1986. – G. BINDING/ U. MAINZER /A.WIEDENAU: Kleine Kg. des dt. Fachwerkbaus, Darmstadt 41989. – G. BINDING: Fach-terminologie für den historischen Holzbau: Fachwerk-Dachwerk, Köln 21990. – M.IMHOF: Historistisches Fachwerk. Zur Architekturgeschichte im 19. Jh., Bamberg 1996.
BetonLex. der Kunst 1, 1987, 514 –516. [mit Lit.] – H.-O. LAMPRECHT (Hrsg.): Beton-Lex., Düsseldorf 1990.
PutzP. VIERL: Putz und Stuck. Herstellen – Restaurieren, München 1984. – W. NICOL
(Hrsg.): Der Dom zu Limburg, Mainz 1985. – J. PURSCHE: Histor. Putze. Befundein Bayern. In: Zs. für Kunsttechnologie und Konservierung 2 (1988), 7–52. – Kon-servierung und Restaurierung von verputzten Mauerflächen (Arbeitsheft des Bayer.Landesamtes für Denkmalpflege 45), München 1990. – H. HOFRICHTER (Hrsg.):Putz und Farbigkeit an ma. Bauten, Braubach 1993. – J. SCHÄFER / H. HILSDORF:Struktur und mechan. Eigenschaften von Kalkmörteln. In: Erhalten histor. bedeutsa-mer Bauwerke. Jb. 1991 des Sonderforschungsbereichs 315, Karlsruhe 1993, 65 –76.– F. FRÖSSEL: Lexikon der Putz- und Stucktechnik, Stuttgart 1999.
StuckH.-J. KLEIN: Marmorierung und Architektur, Diss. Köln 1976. – G. BEARD: Stuck.Die Entwicklung plast. Dekoration, Herrsching 1983. – S. HOFER: Studien zur Stuck-ausstattung im frühen 18. Jh., München/Berlin 1987. – Lex. der Kunst 6, 1994, 106 –110. [mit Lit.] – M. EXNER (Hrsg.): Stuck des frühen und hohen MA., München1996 (ICOMOS 19). – B. RINN: Italienische Stukkateure zwischen Elbe undOstsee, Kiel 1999.
Stütze G. HUMANN: Stützenwechsel in der roman. Baukunst, Straßburg 1925. – W. MAU-ERBRECHER: Die Form der Stütze im frühen 12. Jh., Sonneberg 1929. – W. SCRIBA:Basis. In: RDK 1, 1937, 1492–1506. – W. HERRMANN: Abakus. In: RDK 1, 1937,12–16. – W. RAVE: Echinos. In: RDK 4, 1958, 700–703. – W. RAVE: Eierstab. In: RDK4, 1958, 939–944. – L. WILDE: Die Entwicklung der Stützenformen in der ma. Back-steinarchitektur des Ostseeraumes, Diss. Greifswald 1960. – Lex. der Kunst 6, 1994,419 – 423. [mit Lit.] – E. L. SCHWANDNER (Hrsg.): Säulen und Gebälk, Mainz 1994.
SäulenordnungE. FORSSMAN: Säule und Ornament. Stockholm 1956. – E. FORSSMAN: Dorisch,Jonisch, Korinthisch, Studien über den Gebrauch der Säule in der Architektur des16.–18. Jh., Stockholm 1961. – H.-W. SCHMIDT: Die gewundene Säule in der Archi-tekturtheorie von 1500–1800, Stuttgart 1978. – G. GERMANN: Albertis Säule. In: Ar-
561 Literaturverzeichnis
chitektur und Sprache. Gedenkschrift R. Zürcher. Hrsg. C. BRAEGGER, München1982, 79 –95. – H. W. KRUFT: Gesch. der Architekturtheorie, München 1985. [mitLit.] – R. CHITHAM: Die Säulenordnungen der Antike und ihre Anwendung in derArchitektur, Stuttgart 1987. – H. GÜNTHER (Hrsg.): Dt. Architekturtheorie zwischenGotik und Renaissance, Darmstadt 1988. – C. DENKER-NESSELRATH: Die Säulen-ordnungen bei Bramante, Worms 1990. – Lex. der Kunst 6, 1994, 419–423. [mit Lit.]
Kapitell (vgl. Säulenordnung)R. HAMANN: Die Kapitelle im Magdeburger Dom. In: Jb. für preuß. Kunstsamm-lungen 30, 1909, 56 –138. – E. AHLENSTIEHL-ENGEL: Die stilist. Entwicklung derHaupt- Blatt-Form der roman. Kapitellornamentik in Deutschland. In: Rep. fürKunstwiss. 43 (1922), 135 –220. – H.-A. DIEPEN: Die roman. Bauplastik in Kloster-rath und die Bauornamentik an Maas und Niederrhein im letzten Drittel des 12. Jh.,Diss. Würzburg 1926. – R. KAUTZSCH: Kapitellstudien. Beitr. zu einer Gesch. desspätantiken Kapitells im Osten vom 4.–7. Jh., Berlin / Leipzig 1936. – H. WEIGERT:Das Kapitell in der dt. Baukunst des MA. In: Zs. für Kg. 5 (1936), 17–21, 120 –137(SD Halle 1943). – W. SENF: Das Nachleben antiker Bauformen. In: Wiss. Zs. derHochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 11 (1964), 579 –590. – R. STRO-BEL: Roman. Architektur in Regensburg. Kapitell, Säule, Raum, Nürnberg 1965. –G. RESSEL: Schwarzrheindorf und die frühstauf. Kapitellplastik am Niederrhein,Köln 1977. – D. HOCHKIRCHEN: Ma. Steinbearbeitung und die unfertigen Kapitelledes Speyerer Domes, Köln 1990. – K. S. FREYBERGER: Stadtrömische Kapitelle,Mainz 1990. – S. LIEB: Die Adelog-Kapitelle in St. Michael zu Hildesheim und ihreStellung innerhalb der sächs. Bauornamentik des 12. Jh., Köln 1995. [mit Lit.] – H.MERTENS: Studien zur Bauplastik der Dome in Speyer und Mainz, Mainz 1995.[mit Lit.] – R. MEYER: Frühma. Kapitelle und Kämpfer in Deutschland. Typus-Technik-Stil, Berlin 1997. – J. KRAMER: Spätantike korinthische Säulenkapitelle inRom, Wiesbaden 1997. – M. DENNERT: Mittelbyzantinische Kapitelle, Bonn 1997.– M. ANGHEBEN: Les chapiteaux romans de Bourgogne, Turnhout 2003.
K. NOTHNAGEL: Adlerkapitell. In: RDK 1, 1937, 180 –187. – H. WEIGERT: Blatt-kapitell. In: RDK 2, 1948, 855 – 867. – D. GROSSMANN: Das Palmetten-Ringband-kapitell. In: Ndt. Beitr. zur Kg. 1 (1961), 23 –56. – H.-G. EVERS: Entstehung desWürfelkapitells. In: FS K. Oettinger, Erlangen 1967, 71–72. – M.-M. KNOCHE: DasPilzkapitell. In: Aachener Kunstbll. 41 (1971), 201–210. – R. STROBEL: Die HirsauerReform und das Würfelkapitell mit Ecknase. In: Zs. für Württ. Landesgesch. 30(1971), 21–116.
E. ALP: Die Kapitelle des 12. Jh. im Entstehungsgebiet der Gotik, Freiburg i. Br.1926. – A. GESSNER: Die Entwicklung des got. Kapitells in Südwest- und West-deutschland im 13. Jh., Würzburg 1935. – P. ZUBECK: Studien zum Kapitell korinth.und kompositer Ordnung der dt. Baukunst im Spätbarock und Rokoko, Diss. Kiel1966. – C. SYNDIKUS: Leon Battista Alberti. Das Bauornament, Münster 1996.
BogenE. ERDMANN: Der Bogen. In: Jb. für Kunstwiss. 1929, 100 –144. – C. PFITZNER:Studien zur Verwendung des Schwibbogens in frühma. und roman. Baukunst,Düren 1933. – L. GIESE: Arkade, Arkatur. In: RDK 1, 1937, 1040 –1050. [mit Lit.] –D. FREY: Archivolte. In: RDK 1, 1937, 1018 –1025. [mit Lit.] – E. FIECHTER:Architrav. In: RDK 1, 1937, 1014 –1018. [mit Lit.] – F. VARENS: Bogen. In: RDK 2,
Literaturverzeichnis 562
1948, 976 –994. – H. E. KUBACH: Drillingsbogen. In: RDK 4, 1958, 561–566. – R.BEYER: Eselsrücken. In: RDK 6, 1973, 1–21. – H. E. KUBACH: Schwibbogen undDienst im roman. Kirchenbau. In: FS W. Messerer, Köln 1980, 107–119. – K.WINNEKES: Studien zur Kolonnade, Diss. Köln 1984. – S. HOHMANN: Blendar-kaden und Rundbogenfriese der Frühromanik, Frankfurt a. M. 1999 – R. HUBER /R. RIETH: Bogen und Mauerwerk. Glossarium artis 3, München 31999. [mit Lit.].
PortalW. MITTASCH: Das Portal der dt. Renaissancebauten, Diss. Königsberg 1911. – H.HAASE: Roman. Kirchenportale vom Ausgang des 12. bis zur Mitte des 13. Jh., Diss.Hannover 1948. – D. FREY: Bogenfeld. In: RDK 2, 1948, 996 –1010. [mit Lit.] – H.MECKENSTOCK: Portalarchitektur dt. Spätgotik, Diss. Innsbruck 1951. – D. UN-KENBOLD: Untersuchungen zur Entwicklung des dt. Kirchenportals von ca. 1250 bis1350, Diss. Göttingen 1955. – P. SCHLOPSNIES: Die roman. Backsteinportale Nord-westmecklenburgs. In: Wiss. Zs. der Techn. Hochschule Dresden 6 (1956/57), 443 –464. – R. HIEPE: Prinzipien der Gesamtgestaltung monumentaler Türen von derAntike bis zur Romanik, Diss. Hamburg 1958. – H. HOLLÄNDER: Das roman. Tym-panon, Diss. Tübingen 1959. – U. GÖTZ: Die Bildprogramme der Kirchentüren des11. und 12. Jh., Diss. Tübingen 1971. – E. NEUBAUER: Die roman. skulptiertenBogenfelder in Sachsen und Thüringen, Berlin 1972. – H. MÜLLER: Portale. DieEntwicklung eines Bauelementes von der Romanik bis zur Gegenwart, Leipzig 1976.– M. CLAUSSEN: Roman. Tympana und Türstürze in der Normandie, Diss. Mainz1978. – W. PRINZ / R. G. KECKS: Der Torbau, das Portal und die Treppe als Höhe-punkte des offiziellen Empfangsweges und ihr bildkünstler. Programm. In: Dies.: Dasfrz. Schloß der Renaissance, Berlin 1985, 237–296. – G. FISCHER: Figurenportale inDeutschland 1350 –1530, Frankfurt a.M. 1989. – Lex. der Kunst 5, 1993, 699 –701.
FensterJ. DURM: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Hb. der Architektur 5, Leipzig1914. – W. RANKE: Frühe Rundfenster in Italien, Diss. Berlin 1968. – Y. CHRISTE / K.MÖSENEDER: Fenestella. In: RDK 7, 1981, 1227–1252. – W. HAAS: Fenster. In: RDK7, 1981, 1253 –1466. [mit Lit.] – A. REINLE: Fensterladen. In: RDK 7, 1981, 1501–1524. – W. SAGE: Fenstererker. In: RDK 7, 1981, 1467–1474. – E. FITZ / W. HASS / F.KOBLER: Fensterverschluß. In: RDK 8, 1982, 213 –255. – F. KOBLER: Fensterrose.In: RDK 8, 1982/84, 65 –203. – S. LIETZ: Das Fenster des Barock. Fenster und Fen-sterzubehör in der fürstl. Profanarchitektur zwischen 1680 und 1780, München1982. – M. BARBKNECHT: Die Fensterformen im rhein.-spätroman. Kirchenbau, Köln1986. – C. GERLACH: Fenster aus Westfalen, Detmold 1987. – Lex. der Kunst 2, 1989,482– 484. [mit Lit.] – H. GIESS: Fensterarchitektur und Fensterkonstruktion in Bay-ern zwischen 1780 und 1910, München 1990. – E. HEIL: Fenster als Gestaltungs-mittel an Palastfassaden der it. Früh- und Hochrenaissance, Hildesheim 1995. – B.SCHOCK-WERNER (Hrsg.): Fenster und Türen im historischen Wehr- und Wohn-bau, Stuttgart 1995.
ErkerC.-A. ISERMEYER: Balkon. In: RDK 1, 1937, 1418 –1423. – W. HAUBENREISSER:Der Erker als Architekturmotiv in der dt. Stadt, Diss. Tübingen 1959. – M.CEREGHINI: Der Erker in der alpinen Architektur, Mailand 1962. – E. MULZER:Nürnberger Erker und Chörlein, Nürnberg 1965. – K. PILZ / M. FISCHER: Erker.
563 Literaturverzeichnis
In: RDK 5, 1967, 1248 –1279. [mit Lit.] – B. KELLER: Der Erker. Studie zum ma.Begriff nach literar., bildl. und architekton. Quellen, Bern /Frankfurt a.M. 1981.
EmporeP. O. RAVE: Der Emporenbau in roman. und frühgot. Zeit, Bonn/Leipzig 1924. – V.MENCL: Panské tribuny v nasi romanské architekture. In: Umeni 13, Prag 1965,29–62. [Herrschaftsemporen] – R. LIESS: Der frühromanische Kirchenbau des 11. Jh.in der Normandie, München 1967. – H. M. VON ERFFA / E. GALL: Empore. In:RDK 5, 1967, 261–322. – A. TOMASZEWSKI: Romanskie Koscioly z emporamizachodnimi na obszarze Polski, Czech i Wegier, Warschau 1974. [Westemporen; mitdt. Resümee] – W. HAAS: Der roman. Bau des Domes in Freising. In: Jb. der Bayer.Denkmalpflege 29 (1975), 18 –34. [Emporenkirchen] – G. ENTZ: Zur Frage derWestemporen in der ma. Kirchenbauarchitektur Ungarns. In: Architektur des MA.Hrsg. F. MÖBIUS/E. SCHUBERT, Weimar 1984, 240 –245. – I. ACHTER: Querschiff-Emporen in ma. Damenstiftskirchen. In: Jb. der Rhein. Denkmalpfl. 30 / 31 (1985),39 –54. – H. E. KUBACH /A. VERBEEK: Roman. Baukunst an Rhein und Maas, Bd.4, Berlin 1989. – Lex. der Kunst 2, 1989, 322 f. – S. DANICKE: Emporenbauten imdeutschen Kirchenbau des ausgehenden Mittelalters, Weimar 2001.
TriforiumH. E. KUBACH: Rhein.Triforienkirchen der Stauferzeit, Köln 1934. – H. E. KU-BACH: Das Triforium. In: Zs. für Kg. 5 (1936), 275 –288. – H.-J. GREGGERSEN: DieEntwicklung des Triforiums in Frankreich, Köln 2000.
ZwerggalerieG. KAHL: Die Zwerggalerie, Würzburg 1939. – J. G. PRINZ VON HOHENZOLLERN:Die Königsgalerie der frz. Kathedralen, München 1965. – H. E. KUBACH: ZurEntstehung der Zwerggalerie. In: Kunst und Kultur am Mittelrhein. FS für F. Arens,Worms 1982, 21– 26. – H. E. KUBACH /A. VERBEEK: Roman. Baukunst an Rheinund Maas, Bd. 4, Berlin 1989. – T. WERNER: Die Gliederungssysteme der frühstau-fischen Chorfassaden im Rhein-Maas-Gebiet, Köln 2001.
TreppeR. HUBER / R. RIETH: Treppen und Rampen, Glossarium artis 5, Tübingen 1973. –F. MIELKE: Hb. der Treppenkunde, Hannover 1993. – F. MIELKE: Treppen derGotik und Renaissance, Fulda 1999.
LettnerM. SC H M E L Z E R: Der mittelalterliche Lettner im deutschsprachigen Raum,Petersberg 2004.
WandgliederungE. GALL: Die got. Baukunst in Frankreich und Deutschland, Leipzig 1925. – T.STRAUB: Ma. Backsteingiebel im Profanbau der Hansestädte des wend. Kreises,Diss. Rostock 1929. – T. WOLFF: Ma. Backsteingiebel der Mark Brandenburg undihre Ausstrahlungsgebiete, Diss. Rostock 1933. – H. SEDLMAYR: Spätantike Wand-systeme, München 1958. – H. SEDLMAYR: Das erste ma. Architektursystem. In:Epochen und Werke, Bd. 1, Wien 1959, 80 –139. – J. SOMMERSON: The Classical
Literaturverzeichnis 564
Language of Architecture, Cambridge / Mass. 1963. – H. REINHARDT: Die Ent-wicklung der got. Travée. In: Gedenkschrift E. Gall, München 1965, 123 –142. – J.MICHLER: Zum Typus der Giebel am Altstädter Rathaus zu Hannover. In: Hann.Gesch.bll. 21 (1967), 1–36. – W. DIESEROTH: Der Triumphbogen als große Form inder Renaissancebaukunst Italiens, Diss. München 1970. – E. UNNERBÄCK: WelscheGiebel, Stockholm 1971. – H. LORENZ: Zur Architektur L. B. Albertis. Die Kirchen-fassaden. In: Wiener Jb. für Kg. 29 (1976), 65 –100. – P. H. BOERLI u. a.: Fassade. In:RDK 7, 1978, 536 – 690. [mit Lit.]
OrnamentG. IRMSCHER: Kleine Kg. des europ. Ornaments seit der frühen Neuzeit (1400 –1900), Darmstadt 1984.
FarbeF. KOBLER / M. KOLLER: Farbigkeit der Architektur. In: RDK 7, 1981, 274 – 428. –H. HOFRICHTER (Hrsg.): Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten, Stuttgart1993. – D. VERRET: La couleur et la pierre, Paris 2002. – J. PURSCHE (Hrsg.): Histo-rische Architekturoberflächen, Kalk–Putz–Farbe, München 2003 (ICOMOS 39).
GewölbeR. KAUTZSCH: Die ältesten Kreuzrippengewölbe. In: FS P. Clemen, Bonn 1926,304 – 308. – W. MÜLLER: Birnstab. In: RDK 2, 1948, 768–770. – R. FEUCHTMÜLLER:Die spätgot. Architektur und Anton Pilgram, Wien 1951. – O. FELD: Der Beitrag desElsaß zur Gesch. des Kreuzrippengewölbes. In: Les Cahiers techniques de l’art 4,2(1961), 15–29. – H. LÖMPEL: Die monumentale Tonne in der Architektur, Diss. Mün-chen 1963. – M. GRASSNICK: Die got. Wölbungen des Domes zu Xanten und ihreWiederherstellung nach 1945, Diss. Darmstadt 1963. – J. BÜCHNER: Ast-, Laub- undMaßwerkgewölbe der endenden Spätgotik. In: FS K. Oettinger, Erlangen 1967, 265–302. – J. H. ACLAND: Medieval Structure: The Gothic Vault, Toronto 1972. – R. HU-BER / R. RIETH: Gewölbe und Kuppeln. Glossarium artis 6, München 31988. [mit Lit.]– B. BAUMÜLLER: Bogenrippen- und Schlingenrippengewölbe in der Spätgotik inBayern und Österreich, München 1989. – F. BISCHOFF: Anmerkungen zum Umbauder Seitenschiffe des Ulmer Münsters unter Burkhard Engelberg (spätgot. Gewölbe-konstruktion einschl. Rippenvorfabrikation und Einnistung). In: Gesch. des Kon-struierens IV. Wölbekonstrukionen der Gotik 1. Konzepte SFB 230, Heft 33, Stuttgart1990, 155–191, bes. 172–179. – W. MÜLLER: Grundlagen got. Bautechnik, München1990. – N. NUSSBAUM: Der kreuzgewölbte Raum. Streifzug durch die Gesch. einerBauidee. In: Architektur Geschichten. FS G. Binding. Hrsg. von U. MAINZER / P.LESER, Köln 1996, 49 – 62. – H. G. URBAN: Gewölbe im Burgenbau des Mittelrhein-gebietes, Braubach 1997. – N. NUSSBAUM /S. LEPSKY: Das gotische Gewölbe, Darm-stadt 1999. [mit Lit.] – M. RADOVÁ /O. RADA: Das Buch von den Zellengewölben,Prag 2001.
W. MÜLLER Das Sterngewölbe des Lorenzer Hallenchores. In: Nürnberger For-schungen 20 (1977), 171–196. – W. C. LEEDY: Fan Vaulting, A Study of Form,Technology and Meaning, Santa Monica / Cal. 1980. – N. NUSSBAUM: Die Brau-nauer Bürgerspitalkirche und die spätgot. Dreistützenbauten in Bayern und Öster-reich, Diss. Köln 1982, 112–127, 187. – E. ULLMANN: Gesch. der dt. Kunst 1470 bis1550. Architektur /Plastik, Leipzig 1984, 75–82.
565 Literaturverzeichnis
W. RAVE: Das Domikalgewölbe. In: Dt. Kunst und Denkmalpflege 1955, 33 – 43. –H. REUTHER: Das Platzlgewölbe der Barockzeit. In: Dt. Kunst und Denkmalpflege1955, 121–139. – C. SPULER: Opaion und Laterne. In: Das Münster 27, 1974, 16–23.– H. REUTHER: Gotländ. Sonderformen des Domikalgewölbes. In: Ndt. Beitr. zurKg. 23, 1984, 43 – 62. – M. SAUDAN/ S. SAUDAN-SKIRA: Coupoles, Genf 1989.
DachH. VOGT: Dach. In: RDK 3, 1954, 911–968. [mit Lit.] – H.-G. GRIEP: Histor.Dachdeckungen im Nordharzgebiet, Köln 1962. – H. G. GRIEP: Das Dach in Volks-kunst und Volksbrauch, Köln 1983. – J. GOLL: Kleine Ziegel-Gesch. In: StiftungZiegelei- Museum Cham, Jahresbericht 1984, 29 –102. [mit Lit.] – G. HEMMEL-HEBER / F. KOBLER: Firstbekrönung. In: RDK 9, 1988, 2–18. – G. BINDING/A.STEINMETZ: Tondachziegel für die Denkmalpflege, Bonn 1987. [mit Lit.] – Lex. derKunst 2, 1989, 59 f. – U. KNAPP: Dachziegel – ein Fall für die Kg.? Die »goldenenDächer« von Salem und Konstanz. In: Kunstchronik 49 (1996), 513 –524.
F. OSTENDORF: Gesch. des Dachwerks, Berlin/Leipzig 1908 (ND Hannover 1982).– G. BINDING: Das Dachwerk auf Kirchen im dt. Sprachraum vom MA. bis zum18. Jh., München 1991. [mit Lit.] – M. SCHULLER: Histor. Bautechnik und Bau-organisation. In: Bauforschung und ihr Beitrag zum Entwurf, Zürich 1993, 67–91. –K. BEDAL: Histor. Hausforschung, Bad Windsheim 1993. – N. NUSSBAUM / C.NOTARIUS: Der roman. Dachstuhl der ehem. Stiftskirche St. Pankratius (Königs-winter- Oberpleis). In: Denkmalpflege im Rheinland 11 (1994), 49 –56. – M.SCHULLER: Bamberger Dachwerke von 1350 bis 1800. In: Haus, Hof, Landschaft.FS K. Bedal. Hrsg. von K. KREILINGER /G. WALDEMER. Bamberg 1994, 122–138.– J. M. DEINHARD: Systembedingte Schäden an Dachwerken, Fulda 1996. – J.CRAMER / T. EISSING: Dächer in Thüringen, Leipzig 1996. – E. RÜSCH: Baukon-struktion zwischen Innovation und Scheitern: Verona, Langhans, Gilly und dieBohlendächer um 1800, Petersberg 1997.
FußbodenM. HASAK: Einzelheiten des Kirchenbaues. Hb. der Architektur II, 4,4, Leipzig21927, 247–259. – E. S. EAMES: Medieval Tiles. A Handbook, London 1968. – H.KIER: Der ma. Schmuckfußboden, Düsseldorf 1970. [mit Lit.] – H. KIER: DerFußboden des Alten Domes in Köln. In: Kölner Domblatt 33/34 (1971), 109 –124. –G. SALIES: Untersuchungen zu den geometr. Gliederungsschemata röm. Mosaiken.In: Bonner Jb. 174 (1974), 1–178. – H. KIER: Schmuckfußböden in Renaissance undBarock, München 1976. [mit Lit.] – R. WIHR: Fußböden, München 1985. – S.CODREANU-WINDAUER: Der roman. Schmuckfußboden in der KlosterkircheBenediktbeuren, München 1988. – E. LANDGRAF: Ornamentierte Bodenfliesen desMA, Stuttgart 1993. [mit Lit.]
Literaturverzeichnis 566
abacus Abakusabacus flower Abakusblumeabaton Abatonabbey Abtei, Badiaabbey church Badiaabove-ground Hochbau
construction abutment Kämpfer, Strebe-
pfeiler, Widerlageracanthus AkanthusAcropolis Akropolisacroterion Akroter,
Giebelreiterad quadratum gebundenes Systemadit, a.-level Stollenadytum Adytonaedicula ÄdikulaAeolian capital äolisches Kapitellaetoma, aetos Aetomaagora Agoraagraffe Agraffeairport Flughafenaisle Seitenschiffalae Alae
alburn Splintalcazar Alkazaralcove Alkoven, Erkeralignment Bauflucht, Reihungalmonry Almosenhausaltar Altaraltar chest Altarschreinaltar rail Altarschrankenaltar tomb Turmgrabalternating bands Schichtwechselalternating Stützenwechsel
supports alure Wehrgangambo Amboambry Armariumambulatory Ambulacrum,
(Chor-) Umgangamphiprostyle Amphiprostylosamphitheatre, Amphitheater
am. amphitheater anchor beam Ankerbalkenanchor bolt Zugankeranchor Ankeranchoring Verankerung
FREMDSPRACHIGES FACHGLOSSAR
Vorbemerkung
Die Angabe der englischen, französischen, italienischen und spanischenFachbegriffe unter den Artikeln erfolgt auf der Grundlage der Defini-tionen in diesem Wörterbuch. Die folgenden fremdsprachig-deutschenGlossare erschließen umgekehrt die Artikel vom fremdsprachigen Begriffaus. Dabei entsprechen die deutschen Begriffe den Artikelstichwörterndieses Wörterbuchs; es empfiehlt sich daher, die Definition des deutschenFachbegriffs nachzuschlagen. Bei der alphabetischen Einordnung gilt das gesamte Stichwort, z.B. einzusammengesetzter Terminus, als ein Wort in normaler Buchstabenfolge.
Daß auch bei technischen Begriffen nicht immer Übertragungen eins zueins möglich sind, versteht sich von selbst. In allen Sprachen gibt es gera-de im Bereich der Architektur starke regionale Unterschiede im Begriffs-gebrauch. Ein allgemein gebräuchlicher, verbindlich definierter Begriffwar daher nicht immer auszumachen, wurde aber angestrebt. Trotz gro-ßer Anstrengungen konnten nicht für alle deutschsprachigen Begriffe ver-bindliche fremdsprachige Bezeichnungen festgestellt, nicht alle Lückengeschlossen werden. Bei Ergänzungs- oder Korrekturvorschlägen sindZuschriften an den Verlag sehr willkommen: (Alfred Kröner Verlag, Reinsburgstr. 56, 70178 Stuttgart).
ENGLISCH-DEUTSCH
ancone Tragsteinangle brace Bügeangle contraction Eckkontraktionannexe, am. annex Annexannulet Schaftring, Wirtelannulets Anulianta Anteanta capital Antenkapitellantecabinet Antikabinettantechamber Antichambreantechoir Unterchorantefix Antefix, Stirnziegelantependium Antependium,
Frontaleanthemion Anthemionapadana Apadanaapartment Appartementapex Scheitelapex block Scheitelsteinapex stone Schlußsteinapodyterium Apodyteriumapophyge Ablauf, Apophyge,
Escapeapothesis Anlaufapotropaic image Neidkopfappareille Appareil,Verbandapron Schurzapron wall Fensterbrüstungapse Apsis, Chornischeapsidal chapel Apsidialkapelleapsidiole Apsidiole,
Nebenapsisapteral temple Apteraltempelaqueduct Aquäduktarabesque Arabeske, Maureskearbour, am. arbor (Garten-) Laubearcade cornice Arkadengesimsarcaded court Arkadenhofarcades Arkade(-nbögen),
Laubearcature Arkaturarcade window Arkadenfensterarc doubleau Gurtbogenarch Bogenarched frieze Bogenfriesarched portal Bogenportalarched window Bogenfensterarch feint Blendbogenarchitect Architekt,
Baumeisterarchitectural Architekturkritik
criticism architectural Architektur-
description darstellungarchitectural Bauzeichnung
drawing
architectural Architekturbildimage
architectural Bauornamentornament
architectural Architektur-representation darstellung
architectural Bauplastiksculpture
architectural style Baustilarchitectural Bausymbolik
symbolism architectural Architekturtheorie
theory architecture Architektur,
Baukunstarchitecture Architekturmalerei
painting architrave Architrav,
Hauptbalkenarchivolt Archivoltearchmullion alter Dienstarcosolium Arcosoliumarch stone Wölbsteinarch stones Bogensteinearena Arenaark Archearmament Armierungarmarium Armariumarmature Beschlagarmoury, Zeughaus
am. armory arris Gratarris beam Gratbalkenarris fillet Gratleistearris rafter Gratsparrenarris vault Gratgewölbearsenal Arsenal, Zeughausartesonado Artesonadoashlar Haustein, Werk-
stein, Quaderashlar masonry Werksteinmauer-
werkashlering Dachschalung
(innen)Asiatic Ionic kleinasiatisch-
order ionische Ordnungassembly Montagebauastragal Astragal, Rundstabastragal window Sprossenfensteratectonic atektonischatlas Atlantatrium Atrium, Lichthofatrium house Atriumhausattic Attika, Dachboden,
Dachgeschoß,Mansarde
Fachglossar 568
Attic base attische BasisAttic storey, Attikageschoß
am. Attic story Attic Ionic attisch-ionische
order Ordnungauditorium Auditoriumaumbry Armariumauricle OhrAuvergne-type Auvergnatischer
transept Querriegelawning Markise,
Sonnensegelaxial inclination Achsenneigungaxis Achseaxonometric Axonometrie
projection azulejo Azulejos
bab Bâbback arch Laibungsbogenback fillet Fensteranschlagback Dorsale, Rückenbacking Hintermauerungbaffle plate Abweiseblech,
Schlagleistebailiwick Balleibalcony Altan, Balkon,
Erkerbaldachin Baldachinbalk Balkenballflower Ballenblumeballoon-frame Ballon-Bauten
buildings balloon-frame Ballon-Bauten
construction ballroom Ballhausbaluard Baluardebaluster Baluster, Dockebalustrade Balustradeband Band, Bandeisenbanded column Ringsäuleband moulding Bandrippebaptistery Baptisteriumbar Riegelbar joist Gitterträgerbar tracery Stabwerkbarbacan Barbakane,
Hochwachtbargeboard Windbrettbarizan Ausschußbarn Banse, (Feld-)
Scheune, Grangiebarracks Kasernebarrage Talsperrebarrel vault Tonnengewölbebarricade Barrikade
bartizan Erkertürmchen, Scharwachturm
base Basis, Postamentbaseboard Fußleiste,
Sockelleistebaseline Fluchtliniebasement Basement, Kellerbasement level Sockelgeschoßbase moulding Fußgesims,
Sockelgesimsbasilica Basilikabasin Cuvettebasket capital Kelchkapitell,
Korbkapitellbas-relief Flachrelief,
Basreliefbastide Bastidebastile Bastille, Burgbastille Bastillebastion Bastei, Bastion,
Bollwerkbaston Rundstabbaton Stabbatten Lagerholzbattery Batteriebattlement Creneau, Zinnebaulk Balkenbay Feld, Gewölbefeld,
Jochbay window Ausluchtbead Stabbead and reel Perlstabbeak Schnabelbeam Balkenbeam end Balkenkopfbeam head Balkenkopfbearer Unterzugbearing Auflagerbearing distance Stützweitebearing wall Tragmauerbed Lagerbed-built joint Untergliedbed course Lagerfugebed joint Lagerfugebed moulding UntergliedBeguine convent Beg(h)inenhofbel étage Beletagebelfry Belfried,
Glockenturmbell cage Glockenstuhlbell capital Kelchkapitellbell cot Glockengiebelbellevue Bellevuebell gable Glockengiebelbell roof Glockendachbell stupa Glockenstupa
569 Englisch-Deutsch
bell tower Glockenturmbelt course Gurtgesimsbelvedere Aussichtstempel,
Belvederebema Bemabench Sohlbankbenching AbtreppungBenedictine choir Staffelchorberm Bankett, Bermebevel Abgratung,
Schmiegebill Schnabelbillet Rollenfriesbillet moulding Würfelfriesbinder Binderbinding agent Bindemittelbinding piece Zangebinding stone Binderbird's-eye Vogelperspektive
perspective bladder ornament Schneußblank window Blendfensterblind arcade Blendarkade,
Rundbogenfriesblind arch Blendbogenblind door Blendtüreblind gable Blendgiebelblind gallery Scheinemporeblind glazing Blankverglasungblind niche Blendnischeblind ornament Blendeblind rosette Blendrosetteblind tracery Blendmaßwerk,
Schleierwerkblind triforium Blendtriforium,
Scheintriforiumblind vault Scheingewölbeblind window blindes Fenster,
Blendfensterblock (of houses) Baublockboard Brettboast bossierenBohemian vault böhmische Kappebolster Sattelholzboltel Dienstbond Verbandbone house Beinhausbonnet Bonnetbosket, bosquet Boskettboss Bossebottom boom Untergurtbottom step Antrittboulder Findlingbouleuterion Buleuterionboulevard Boulevardbow Bogen, Bug
bower Kemenate, Laubebowl Cuvette, Schalebowtell Dreiviertelstab,
Dienstbox Kofferbox altar Kastenaltarbox gutter Kastenrinnebrace Knaggebracket Kragsteinbranch tracery Astwerkbreach Breschebreakwater Wellenbrecherbreast moulding Brüstungsgesimsbreast wall Epaulementbreastwork Brustwehrbrick Backsteinbrick Backsteinbau
construction brick floor Ziegelbodenbridge Brückebridge chapel Brückenkapellebridgehead Brückenkopfbridge tower Brückenturmbridle joint Einhälsungbroach post Hahnebaum,
Helmstangebroken ceiling gesprengte Deckebroken gable gesprengter Giebelbud capital Knospenkapitellbuilding Gebäude,
Baukörperbuilding block Bausteinbuilding clamp Balkenankerbuilding code Bauordnungbuilding group Baugruppebuilding Bauinschrift
inscriptionbuilding line Fluchtliniebuilding period Bauperiodebuilding phase Bauabschnitt (zeitl.)building pit Baugrubebuilding plan Bauplanbuilding plot Bauplatzbuilding section Bauabschnitt
(räuml.)building unit Bauelementbulbous dome welsche Haubebulkhead Trennwandbull capital Stierkapitellbull's-eye Ochsenaugebull's-eye glass Butzenscheibenbulwark Propugaculum,
Vormauerbundle pier Bündelpfeilerbungalow Bungalowbunker Bunker
Fachglossar 570
burial church Coemetrialkirche, Memoria
butment Widerlagerbutt joint Gerader Stoßbuttress Strebepfeilerbuttressing Strebewerkbuttress wall StrebemauerByzantine dome byzantinische
Kuppel
cabin Hüttecabinet Kabinettcable construction Seilkonstruktioncable (-suspended) Seildach
roof calathus Kalatoscaldarium Caldariumcalibre, am. caliber Lehrecalotte Kalottecamarín Camarincamber Pfeil, Pfeilhöhecamber (of arch) Bogenpfeilcamp Lagercampanile Kampanilecanal Grachtcancelli Cancelli
(Kanzellen),Chorschranken
candelabrum Kandelabercandle beam Triumphbalkencanephora Kanephorecanopy Vordachcant Wasserschlagcantilever Auskragungcantilevered arch Kragbogencantilevered beam Kragbalkencantilevered Kragträger
girdercantilevered roof Kragdachcantilevered freitragende
staircase Treppecantilevered wall freitragende Wandcantoned kantoniertcapital Kapitell, Capital-
linie, KnaufCapitol Kapitolcaravansary, Karawanserei
caravanserai carriage house Remisecars Schichtcartouche Kartuschecaryatid Karyatidecascade Kaskadecasemate Kasemattecasement Fenstereinfassungcasement fastener Einreiber-Verschluß
casing Ummantelungcasino Kasinocast vaulting Gußgewölbecastellum Kastellcastle Burgcastle chapel Burgkapelle,
Schloßkapellecastle gate Burgtorcastle town Burgstadtcatacomb Katakombecatafalque Katafalkcatapult Ballistariumcathedra Kathedracathedral Bischofskirche,
Dom, KathedraleCatherine wheel Katharinenradcatholicon Katholikoncat's-head tile Kaffziegelcauldron Kesselcavalier Kavaliercavalier Kavalierriß
perspectivecavalier projection Kavalierrißcave church Höhlenkirchecave temple Felsentempel,
Höhlentempelceiling Decke, Rabitzgewöl-
be, Rabitzdeckecell Zelle, Klausecellar Kellercemetery Friedhofcemetery street Gräberstraßecenotaph Ehrenmal, Keno-
taph, Scheingrabcentering Lehrgerüstcentral perspective Zentralperspektivecentral-plan Zentralbau
building central-plan space Zentralraumchamber Gemach, Kammer,
Stubechamfer Abgratung, Fase,
abfasenchamfered Schmiege
moulding chamfered rusti- Polsterquader
cation, c. stonechannel Fallrohr, Kehlechapel Kapellechapel for Beichtkapelle
confession chaplet Perlstabchapter house Kapitelhauschapter room Kapitelsaalcharnel house Karner, Beinhauscharter-house Kartause
571 Englisch-Deutsch
checkerboard Schachbrettfriesfrieze
chemist's shop Apothekechevet Chorhauptchevron Zahnfrieschevron arch Zackenbogenchimney Esse, Kamin,
Schornsteinchimney flue Abzugskaminchimneyhead Schornsteinaufsatzchimney hood Rauchfangchip carving Kerbschnittchoir Chorchoir arch Chorbogenchoir bay Chorjochchoir chapel Chorkapellechoir loft Emporechoir screen Chorschranken,
Chorgitterchoir stalls Chorgestühlchoragic choregisches
monument Monumentchord Kämpferliniechurch architecture Sakralbauchurch buildings Kirchenbautenciborium Ziboriumcinquefoil Fünfblatt, Fünfpaßcircular pier Rundpfeilercircumvallation Enceinte,
Mauerringcircus Circuscistern Zisternecitadel Zitadelle, Stadtkronecithara Zithercity Stadtcity centre, Stadtkern
am. city center city gate Stadttorcity wall Stadtmauercivic buildings Bürgerbautenclasp Agraffeclearstory Lichtgaden,
Obergadenclinker Klinkerclock Zwickelcloister Klausur, Kreuzgangcloister vault Klostergewölbecloth hall Gewandhausclustered column Bündelsäulecoach house Remisecoating Ummantelungcob construction Pisébau (-weise)cocking Verkämmungcoffer Kassettecoffered ceiling Felderdeckecogging Verkämmung
collar beam Kehlbalkencollegiate church Stiftskirchecollier Säulenhalscolonnade Kolonnade,
Säulengangcolossal order Kolossalordnungcolosseum Kolosseumcolumbarium Kolumbariumcolumn Säule, Stützecolumn basilica Säulenbasilikacolumn drum Säulentrommelcolumned hall Säulenhalle,
Säulensaalcolumned portal Säulenportalcolumn Ehrensäule
monument column orders Säulenordnungencolumn portico Säulenportikuscomb Kammcommandery Komtureicommodité Commoditécommunity center Gemeindehauscompartment Gefachcompass roof Tonnendachcomposite capital Kompositkapitellcomposite order Kompositordnungcompound pier Bündelpfeilerconcave mould Hohlkehleconcave moulding Kehlgesimsconcealed door Tapetentürconch Koncheconcrete Betonconfessio Konfessioconical vault Kegelgewölbe,
Trichtergewölbeconnexion, Anschluß, Verband
am. connection conservatory Wintergartenconsole Konsole, Kraftstein,
Notstein, Tragsteinconsole cornice Konsolgesimsconstruction Bauriß
drawing construction Bauweise
method construction site Baustellecontinuous beam Durchlaufträgercontinuous Bankett
foundation continuous girder Durchlaufträgerconvent Konventconventionalize stilisierencoparcenary castle Ganerbenburgcoping Couronnementcoping stone Abdecksteincorbel arch unechter Bogen
Fachglossar 572
corbel piece Sattelholzcorbel Balkenstein, Kon-
sole, Kraftstein, Kragstein
corbie gable Staffelgiebelcore KernwerkCorinthian order korinthische
Ordnungcorner bond Eckverbandcorner cogged Eckkamm
joint corner Eckpilaster
construction cornerstone Grundsteincornice Gesimscorona Coronacorps de logis Corps de logiscorridor Korridor, Gangcottage, tied c. Katecounterfort Strebepfeilercountermure Futtermauercounterscarp Contrescarpecounting house Kontorcouple Dachgespärrecoupled gekuppeltcoupled pilaster Doppelpilastercoupled rafters Bundgespärrecourse Schichtcoursed masonry lagerhaftes
Mauerwerkcourt Hofcourthouse Gerichtsgebäudecover Schornsteinaufsatz,
Überzugcovered walk Foyer, Wandelhallecovering aufkröpfencoverlet Überzugcraal (kraal) Kraalcrack Rißcraftman's house Handwerkerhauscreeping rafter Schiftercrematorium Krematoriumcrenel, crenelle Creneaucrenelated wall crenelierte Mauercrepidoma Krepidomacrest Crete, Dachkamm,
Mauerkronecrest tile Firstziegel,
KammerziegelCretan column kretische Säulecrockery Steinzeugcrocket Krabbe, Nasecrop Kreuzblumecross Kreuzcross beam Holm, Riegelbalkencross bond Kreuzverband
crossing Vierungcrossing dome Vierungskuppelcrossing pier Vierungspfeilercrossing tower Vierungsturmcross lath Windrispecrosspiece Traversecross rib Kreuzrippecross springer Gratbogen,
Kreuzbogencross stay Kreuzbandcross vault Kreuzgewölbecross window Fensterkreuzcrown Krone, Scheitel,
Bekrönungcrown joint Scheitelfugecrowstep gable Treppengiebelcruciform pier Kreuzpfeilercrusader's castle Kreuzfahrerburgcrypt Kryptacryptoporticus Cryptoporticuscubiculum Cubiculumcubiform capital Würfelkapitellcupola Kuppelcuria Kuriecurtain Kurtinecurtain wall Curtainwall,
Schildmauer,Vorhangfassade
curvature Kurvaturcushion Polstercushion capital Würfelkapitellcut stone Quadercyclopean Zyklopen-
masonry mauerwerkcyma Karnies, Kymacymatium Karniesrinne
dais Dagnum, Estradedam Staudamm,
Talsperredance hall Ballhaus, Tanzhausdead facade Blendfassadedead floor Blindbodendead space gefangener Raumdead wall Blendmauerdeal (Holz-)Bohle, Dieledecastyle Dekastylosdecor Dekordecoration Dekorationdecorative gable Ziergiebeldecorative painting Fassadenmalereidecorative vault Ziergewölbedeflector Abweiserdemilune Demilunedenticulation Verzahnungdentil Zahnschnitt
573 Englisch-Deutsch
dependency Communsdepressed Kesselgewölbe
domical vault desert palace Badiadiaconicon Diakonikondiagonal arch Diagonalbogendiagonal bond Stromschichtdiagonal bracing Dreieckverbanddiagonal rib Diagonalrippediagonal strut Kreuzstrebe,
Kreuzholzdiamond work Diamantierungdiazoma Diazomadiglyph DiglyphDiocletian diokletianisches
window Fenster, Thermenfenster
dipteral temple Dipterosdipylon Dipylondischarge spout Ablaufrinnedischarge wall Dechargemauerdischarging arch Entlastungsbogen,
Überfangbogendisplay case Schaukastendistinction Unterscheidungditch Graben, Grachtdivergence Divergenzdodecastyle Dodekastylosdog Knaggedogtooth ornament Hundszahndolmen Dolmendome Dom, Kuppeldomed roof Kuppeldachdomical vault Domikalgewölbe,
Klostergewölbedonjon Bergfried, Donjon,
Wohnturmdoor Türdoor frame Türstock,
Blendrahmendoor handle Klinkedoor leaf Türblattdoorsill TürschwelleDoric order dorische Ordnungdomed basilika Kuppelbasilikadormer rafter Reitersparrendormer window Dachfenster,
Gaube, Dacherker,Kaffenster
dome-shaped Kuppelbasilikabasilika
dormitory Dormitoriumdouble choir doppelchörige
Anlagedouble cushion Doppelwürfel-
capital kapitell
double door Doppeltürdouble jack rafter Doppelschifterdouble monastery Doppelklosterdouble pilaster Doppelpilasterdouble-pitch roof Giebeldachdouble shell Doppelschalen-
dome kuppeldouble vault Doppelgewölbedouble window Doppelfensterdovetail Schwalbenschwanzdowel Dübeldowel joint Verdübelungdowelling Verdübelungdraft lobby Windfangdrain Graben, Gosse,
Grachtdrainage Abzugsgrabendrapers' guild Gewandhausdrapery Draperie, Faltwerkdrawbridge Zugbrückedrawn step gezogene Stufedraw-well Ziehbrunnendressing Steinbearbeitungdressing-room Anrichtedrip molding Kaffgesimsdrip (nose) Wassernasedrove scharrierendry construction Montagebaudry wall Trockenmauerwerkdungeon Kerkerdust-pan dormer Schleppgaubedwarf gallery Zwerggaleriedwarf rafter Schifter
ear Ohrear of corn Ähreeast apse Ostapsiseaves Traufe, Abtraufe,
Dachtraufeeaves board Stirnbretteaves moulding Dachgesimséchauguette Scharwachturmedge bond Eckverbandedifice Gebäudeegg and dart Eierstab
(pattern) Egyptian cross AntoniuskreuzEgyptian hall ägyptischer Saalelevation Aufrißelliptical arch Ellipsenbogenelliptical vault elliptisches
Gewölbeemblem Emblemembrasure Schießscharte, Em-
brassure, Fenster-nische, -laibung
Fachglossar 574
embroidery green Broderieparterreemergency stairs NottreppeEmpire Kaiserstilenceinte Bering, Enceinte,
Ringmauer, Zingelenclosed area umbauter Raumenclosing wall Bering, Mauerring,
Umfassungs-mauern, Zingel
enclosure Zwingerenfilade Enfiladeengaged column Dreiviertelsäule,
Wandsäuleengaged pier WandpfeilerEnglish bond englischer Verband,
BlockverbandEnglish cross bond holländischer
VerbandEnglish landscape englischer Garten
garden engobe Engobeentablature Gebälkentering catch Einreiber-Verschlußentrance hall Foyer, Hausflurentrenchment Schanzeentresol Mezzaninepiscopal church Bischofskircheepistle desk Epistelpultepistle-side Epistelseite,
Männerseiteepistyle Epistylionepitaph Epitaphescalator Rolltreppeescape Escapeescarp Böschungescarp gallery Escarpengalerieescutcheon Schildesplanade Esplanadeeuthynteria Euthynterieexedra Exedraexhibition halls Messebautenexonarthex Exonarthexexpanded metall Streckmetallexpansion joint Dehnfugeexposed concrete Sichtbetonexterior dome Schutzkuppel,
Außenkuppelexterior plaster Außenputz,
Feinputzexterior pulpit Außenkanzelexterior ramp Außenrampeexterior stair Freitreppe,
Außentreppeexterior walls Außenmauerneye Auge, Nabel,
Rauchloch
eyebrow window Fledermausdach-fenster
eyelet Luke
facade Fassade, Frontfacade Fassadenabwicklung
developmentfacade painting Fassadenmalereifacade tower Fassadenturmface arch Stirnbogenfacet Facetteface work Verblendungfacing Verblendungfacing brick Verblenderfacing masonry (Ver-) Blendmauer-
werkfacing stone Blendsteinfacing tile Verblenderfagot Faschinefaience Fayencefair-faced concrete Sichtbetonfalse arch unechter Bogenfalse ceiling Einschub, Fehl-
boden, Zwischen-decke
false door Scheintürfalse vault falsches Gewölbefalsework Lehrgespärrefamily tower Geschlechterturmfanlight Oberlichtefan-shaped window Fächerfensterfan vault Fächergewölbe,
Perpendiculär-gewölbe
fan vaulting Strahlengewölbefarm Gehöftfarmhouse Bauernhaus, Farmfarmstead Gehöftfascia Faszienfascine Faschinefence Zaunfender pole Radabweiserfenestella Fensternischefestoon Festonfield church Feldkapellefieldwork Feldschanzefigural capital Figurenkapitellfigural frieze Figurenfriesfigure Schaubildfiligree Filigranfiller Füllholzfillet Band, Saumleistefinal coat Feinputzfinial Kreuzblumefinishing coat Feinputzfire escape Feuertreppe
575 Englisch-Deutsch
fire wall Brandmauerfirring Aufschieblingfirst step Antrittfish plate LascheFlamboyant (style) Flamboyant,
Flammenstilflange flanschenflank Flankeflap tile Kremperflashing Abweiseblechflat Appartement,
Wohnungflat arch Flachbogen,
Sturzbogenflat barrel vault Flachtonneflat dome Flachkuppelflat roof Flachdachflattening Abplattungflat tile Biberschwanz,
Flachziegel,Plattenziegel
flight Laufflight of stairs Treppenlauffloor Fußboden, Etage,
Stockwerkfloor batten Lagerholzflooring Fußboden,
Balkenlageflower capital Blütenkapitell
(Egyptian) fluting Kanneluren,
Riefelungflying buttress Strebebogenflying (monk) bond märkischer Verbandfoil Paßfolding door Falttürfolding partition Faltwandfolding shutter Klappladenfolds Faltwerkfoliage Blattwerk,
Laubwerkfoliate mask Blattmaskefoliated capital Laubkapitellfoot brace Fußband, Fußstrebefootpath Beischlagforked mortice and Scherzapfen
tenon jointformeret Schildbogenfort Fort, Kastellfortification Befestigungfortified building Wehrbaufortified church Riese,Wehrkirchefortified tower Wehrturmfortress Festung, Burgus,
Fort, Wehrbaufortress chapel Burgkapelle
fortress gate Burgtorfortress town Burgstadtforum Forumfoundation Fundamentfoundation arch Fundamentbogenfoundation stone Grundsteinfountain (Spring)- Brunnenfountain house Tonsurfour-centred arch, Tudorbogen
am. four-centered arch
frame Rahmenframe of joists Balkenlageframework (Fachwerk-) Gerüstframing Balkenlageframing arch ÜberfangbogenFrench garden französischer ParkFrench order französische
OrdnungFrench window Fenstertürfresco painting Freskomalereifriars' churches Bettelordenkirchenfrieze Friesfront Frontfrontal Fenstergiebel,
Frontalefrontal perspective Frontalperspektivefrontispiece Frontispizfronton Fenstergiebelfront side Stirnfront wall Stirnwandfunerary chapel Grabkapellefunerary temple Grabtempel
gable Giebelgableboard Windbrettgable(d) house Giebelhausgable moulding Giebelgesimsgable ornament Giebelziergable post Giebelsäulegable roof Giebeldachgable tower Giebelturmgalilee Galilaeagallery Altan, Empore,
(-numgang), Galerie, Laufgang, Söller
gallery of kings Königsgaleriegap site Baulückegarden Gartengarden city Gartenstadtgarden house Laubenhausgargoyle Wasserspeiergarland Kranzgarret Dachbodengate Tor
Fachglossar 576
gatehouse Torhausgate of honor Ehrentorgate tower Torturmgateway Pforte, Torgauge (Blech-) Lehregeison Geisongemel window ZwillingsfensterGerman order deutsche
Säulenordnungghetto Ghettogiant Gigantgirder Dachbalken,
Unterzug, Trägerglacis Abdachung, Glacisglass block Glasbaustein,
Glasziegelglass brick Glasbaustein,
Glasziegelglass door Fenstertür, Glastürglass house Glashausglass roof Glasdachglass roundel Butzenscheibenglass tile Glasziegelglazed bricks Baukeramikglyptotheca Glyptothekgolden hall goldene Hallegolden section goldener Schnittgore Zwickelgorge SäulenhalsGospel side Frauenseite,
EvangelienseiteGothic bond gotischer Verbandgrain silo Kornhausgranary Speichergrange Grangie, Scheunegrate Gatter, Gittergrave Gruftgreat hall AulaGreek cross griechisches KreuzGreek key MäanderGreek order griechische
Säulenordnunggreenhouse Gewächshausgrid Rastergriffe (Eck-) Klaue,
Eckknollegroin arch Kreuzbogengroin vault (Kreuz-)
Gratgewölbegroove Kehle, Nutgrotesque Groteskegrotto Grotteground floor Parterre,
Erdgeschoßground plan Grundriß,Tracégroundsill Grundschwelle
guardstone Prellsteinguildhall Zunfthausgun turret Geschützturmgutter Ablaufrinne, Dach-
rinne, Fallrohr, Gosse, Rinne, Rinnstein
gutter brace Rinneisen, Balkenanker
gutter hanger Rinneisengynaeceum Gynekeion
hagioscope Hagioskophalf-beam Stichbalkenhalf hip roof Krüppelwalmdach,
Schopfwalmhalf-timber Halbholzhalf-timbered Fachwerkbau
construction half-tunnel vault Halbtonnehall Halle, Saal(bau),
Dielehall choir Hallenchorhall church Hallenkirche,
Saalkirchehall nave Hallenlanghaushall of mirrors Spiegelgaleriehall transept Hallenquerhaushalved joint Überblattunghalving Überblattunghamlet Weilerhammam Hammamhandle Stielhandrail Handlaufhangar Hangarhanging truss Hänge-Spreng-
(frame) werk, Hängewerkharem Haremhatch Lukehatched moulding Sägezahnverzierunghaunch VouteH-beam Doppel-T-Trägerhead Kopf, Rähmheight of apex Scheitelhöheheight of a pier Pfeilerhöheheight of camber Pfeilhöhehelicline Wendelrampehelix Helikeshelm roof Rhombendachhelve Stielherm Hermehermitage Klauseherringbone Ähre, Fischgratherringbone work Ährenwerkherse Fallgatterhexastyle Hexastylos
577 Englisch-Deutsch
H-girder Doppel-T-Trägerhigh altar Choraltarhigh-pitched roof Kronendach,
Ritterdachhigh relief Hochreliefhigh tomb Turmgrabhigh wall hohe Wandhinge Angel, Gelenk,
Scharnierhinged arch Gelenkbogenhinged column Pendelstützehinged frame Gelenkrahmenhinged (window) Schlagladen
shutter hip Walmhip a roof abwalmenhip (jack) rafter Gratschifter,
GratsparrenHippodamian hippodamisches
system Systemhippodrome Hippodromhip tile Gratziegelhorizontal joint Untergliedhollow Einziehunghollow block Hohlblocksteinhollow brick Hohlziegelhollow clay block Hourdidecke
floor hollow masonry Hohlmauerwerkhollow out abkehlenHoly Sepulchre heiliges Grabhorizontal (longi- Längsverband
tudinal) bracing horizontal drift Seitenschubhorizontal thrust Horizontalschubhorseshoe arch Hufeisenbogenhospice Hospizhospital Hospital, Kranken-
haushostel Herbergehouse Haushunting castle Jagdschloßhut Baracke, Hüttehypethral temple Hypethraltempelhypocaustum Hypokaustenhypogeum Hypogäumhypostyle hall Hypostyl, Säulen-
saal, Säulenhallehypotrachelium Hypotrachelion
I-beam Doppel-T-Trägerice apron Eisbrechericonostasis Ikonostasisideal city Idealstadtideal plan IdealplanI-girder Doppel-T-Träger
illusionistic Scheinarchitekturarchitecture
imbrex Imbreximperial cathedral Kaiserdomimperial palace Pfalzimpost Auflager, Kämpferimpost level Kämpferhöheincrustation Inkustrationindenting Verzahnungindustrial building Industriebauinferior purlin Fußpfetteinfill Ausfachunginfirmary Infirmarie,
Krankenhausinflected arch Sternbogen,
Vorhangbogeninlay, wood i. Intarsiainn Gasthaus, Herbergeinner walls Innenmauernintarsia Intarsiaintercolumnation Interkolumnium,
Säulenweiteinterior space umbauter Rauminterior walls Innenmauerninterlace Bandgeflecht,
Flechtbandinterlacing Bandelwerk, Band-
verschlingunginterlacing arches Kreuzbogenfriesinterlocking tile Falzziegelintermediate rafters Leergespärreinvected capital FaltenkapitellIonic order ionische
Säulenordnungisometric projection Isometrie
jack rafter Schifterjalousie Jalousiejamb Gewände, Laibungjambstone Fenstergewändejettied truss Freigespärrejetty Auskragung, Molejib door Tapetentürjoggle post Hängesäulejoining Stoßjoint (Arbeits-, Bau-)
Fuge, Scharnierjubé Doxalejunction Anschluß, Knoten
kalathos Kalatoskatholikon Katholikonkeep, castle k. Bergfried,Verlieskerb, k.stone Prellsteinkerkis Kerkideskettle Kessel
Fachglossar 578
keyhole window Schlüssellochfensterkeystone SchlußsteinKing Arthur's Artushof
Court king post Firstsäule, Spitz-
säule, Hängesäuleknee Winkelholzknob Knauf, Knolle,Naseknocker Türklopferknot Knolle, Knorre,
Knotenknotted column Knotensäuleknurl Knorrekremlin Kreml
labyrinth Labyrinthlacunar KassetteLady chapel Marienkapellelancet window Lanzettfensterland pier Landpfeilerlanding Podest,Treppenab-
(of staircase) satzlantern Laterne, Dachauf-
bautenlararium Larariumlatch Klinkelateral chapel Einsatzkapellenlateral protruding Seitenrisalit
facade baylateral thrust Seitenschublath, lathing Latte, PutzträgerLatin cross lateinisches Kreuzlatrina, latrine Latrine, Abtrittlattice Gatter, Gitter(fries)lattice girder Gitterträgerlattice truss Gitterträgerlatticework Flechtwerklavabo Lavabo, Tonsurlavatory Lavatorium, Klosett,
Retiradelavra Lawralay altar Laienaltarlayout Tracélead glazing Bleiverglasungleaf Blattleaf and dart Blattwelleleaf capital Blattkapitelllean-to roof (freitragendes)
Pultdachlectern Lesepultlecture hall Auditoriumleveling course Ausgleichsschichtlibrary Bibliotheklierne vault Zellengewölbelifting door Hebetür
lifting window Hebefensterlighted triforium durchlichtetes
Triforiumlighthouse Leuchtturmlight shaft Lichtschachtlight well Lichtschachtline Tracélinenfold Faltwerklining Bekleidung, Futter,
Aufkröpfenlink Gelenklintel Fenstersturz, scheit-
rechter Sturz,Sturzriegel, Türsturz
lip Leistenziegellobby Foyerlobe Paßlock Schloßloculus Nischengrablodge Hütteloft Dachbodenlog construction Blockbaulong-and-short Lang- und
work Kurzwerklongitudinal oval Längsovallongudinal wall Längswandbauweise
construction lookout tower Wartturmlooped vault Schlingrippen-
gewölbeloophole Schießschartelot Parzellelotus column Lotussäulelouver, l. window Dachhaube,
Schallöffnunglow relief Flachrelieflower church Unterkirchelozenge Rautelozenge fret Rautenfrieslozenge roof Rautendachlucarne Dachlukelune Zwickellunette Stichkappeluthern Dachhaube
machicolation Maschikuli, Pechnase
madrasah, madrassa Medresemagazine MagazinMagdalen Chapel Bußkapellemain facade Schaufassademain girder Hauptbalkenmain storey, Hauptgeschoß
am. story manner Manier
579 Englisch-Deutsch
manor house Manor Housemansard roof Mansarde,
Mansarddachmansion Wohnhausmantel Mantel, Rauchfangmantelpiece Kaminaufsatzmanteltree Rauchfangholzmarket hall Markthallemarketplace Marktplatzmarquetry Marketeriemartyrium Martyriummascaron Maskaronmasonry Mauerwerk,
Steinwerkmason's guild Bauhüttemason's mark Meisterzeichenmason's workshop Bauhüttemast Mastmatroneum Matroneummausoleum Mausoleummeander Mäandermedallion Medaillonmedium Bindemittelmegalithic Megalith-Bauten
buildings megalithic tomb Ganggrab,
Steinkammermegaron Megaronmemorial builing Memorialbaumemorial church Denkmalkirche,
Martyriummenhir Menhirmerlon Zinnenmerlon window Zinnenfenstermeta Metametope Metopemews Marstallmezzanine Mezzaninmica Marienglasmikvah Mikwemilitia Landwehrminbar Mimbarmine Mineminster Münstermint Münzemirrored ceiling Spiegeldeckemiserere, Miserikordie
misericord mitre, am. miter Gehrungmoat, fortress m. Halsgrabenmoated castle Wasserburg,
Wasserschloßmodel Baumodellmodule Modulmole Molemonastery Kloster
monastic church Klosterkirchemonkey Bärmonks' choir Mönchschormonopteral temple Monopterosmonument Denkmalmonumental Torbau
gateway mooring Verankerungmortar Mörtelmortise Nut, (Holz-)
Zapfenmortising Verzapfungmortuary chapel Grabkapellemosaic Mosaikmosque Moscheemotel Motelmotorway Rasthaus
restaurant motte Mottemouchette Schneußmould abkehlenmoulded brick Formsteinmoulding, Gesims, Leiste
am. molding mountain BergM-roof Sägedachmud plaster Lehmputzmud walling Lehmbau (-weise)mullion Fensterpfosten,
Setzholzmultifoil Vielpaßmultifoil arch Vielpaßbogenmulti-storey Geschoßbau
building, am. multistory
mural painting Wandmalereimushroom column Pilzstützemushroom floor Pilzdeckemutule Dielenkopf
nailed roof framing Nagelbindernailhead Nagelkopfnaiskos Naiskosnarthex Narthexnaumachia, Naumachie
naumachy nave Langhaus, Schiff,
Nabelneck Halsnecking Halsringneck moulding Halsringnecropolis Gräberstadt,
Nekropolenerve Rippenet vault Netz-, Rauten-
Zellengewölbe
Fachglossar 580
newel, n. post (Treppen-) Spindelnewel vault Spindelgewölbeniche Nischenode Knotennotched Kerbzinne
crenellationnotched moulding Sägezahnverzierungnotching Verkämmungnozzle Schnabelnun Nonnenun's gallery Nonnenemporenuraghe Nuragenymphaeum Nymphaeum
obelisk Obeliskoblique cornice Schräggesimsoblique projection Schrägrißobservatory Observatoriumoctagon Achteck, Oktogonoctastyle Okastylosoculus Okulus,
Rundfensteroffice building Bürohausogee arch Kielbogen,
Eselsrückenogee moulding Birnstabold people's home Altersheimolive Oliveonion-domed Zwiebelturm
tower opaion Nabel, Opäum,
Rauchlochopen construction offene Bauweiseopen stair Freitreppeopus Gußmauerwerk
caementiciumopus figuratum figurierter Verbandoratory Bethausorbel capital Kelchkapitellorchestra pit Orchestergrabenorgan loft Orgelemporeoriel Chörlein, Erker
(-fenster), Wetterdach
orientation Orientierungorillion Orillonornament Ornamentornamental gable Schaugiebelorthostat OrthostatOsiris pillar Osirispfeilerossuary Beinhausoubliette Angstlochouter courtyard Zwingerouter crypt Außenkryptaouter dome Schutzkuppelouter garments Oberzug
outer wall Vormaueroutlet Abschlagoutside stair Freitreppeoutwall Umfassungsmauernoutwork Vorwerkoverdoor Supraporteoverhang Überhangoverhanging roof Vordachoverlap Überschneidungoylet Schlitzfenster
palace chapel Palastkapelle, Schloßkapelle
palace Palast, Schloßbaupalisade Palisadenbaupalmette Palmettepalmette frieze Palmettenfriespalmiform column Palmensäulepalm vault Palmengewölbepane Fensterscheibepanel Feld, Paneel,
Füllungpanel board Füllbrettpanel construction Plattenbauweisepaneled door Rahmen- und
Füllungstürpaneling Täfelwerkpantile Dachpfannepantiled roof Pfannendachpantry Anrichtepapyrus column Papyrussäulepapyrus-bundle Papyrusbündelsäule
columnparabolic arch Parabelbogenparadise Paradiesparallel ribbed Parallelrippen-
vault gewölbeparapet Brüstung,
Brustwehrparavent Paraventparcel Parzelleparget Stuckparish church Pfarrkircheparish hall Gemeindehauspark Parkparking garage Parkhausparlour, am. parlor Empfangszimmerparlour, unheated p. Peselparquet Parkett, am. Parterrepartition (Bund-,Trenn-)
Wandpartition arch Scheidbogenpartition wall Scheidewandpassage Gangpassagewary Durchfahrthaus
building
581 Englisch-Deutsch
patrician house Patrizierhauspattern Musterpavement Estrich, Pflasterpavilion Pavillonpedestal Piedestal,
Postament, Sockelpediment Aetoma, Giebelfeldpeg Dübelpellet moulding Scheibenfriespendant Abhängling,
Pendantpendentive Gewölbeschale,
Pendentifpentagram Pentagrammpenthouse Penthouseperforated brick Lohsteinpergola Pergolaperistyle Peristylperpendicular Perpendiculär-
vault gewölbeperron PerronPersian column persische Säuleperspective Perspektivepharmacy am. Apothekepheasant-house Fasaneriepicture frame stage Guckkastenbühnepier Pfeilerpier arch Schwibbogenpier buttress Pfeilervorlagepilaster Pilaster, Wandpfeilerpilaster church Wandpfeilerkirchepile construction Pfahlbaupile work Pfahlbaupillar Pfeiler, Stützepillory Staupsäulepin Stift, wooden p.:
Holznagelpine cone Pinienzapfenpinnacle Fiale, Pinakelpipe Pfeifepit Schachtpitch Stichhöhepivot Angelplace Ort, Platzplain tile Biberschwanzplan Baurißplanetarium Planetariumplank Diele, (Holz-)Bohleplank ceiling Bohlendeckeplank wall Bohlenwandplaster Putzplaster coat Putzhautplaster floor Estrichplate Platteplatform Altan,Tribünepleasure palace Lustschloß
plinth Plintheplug (wooden p.) Holznagelpodium temple Podiumstempelpoint block Punkthaus
building pointed arch Spitzbogenpointed barrel Spitztonne
vaultpointed quatrefoil Vierblattpole Mast, Stakenpole plate DachschwellePolish bond polnischer Verbandpolychromy Polychromiepolygonal choir Polygonchorpolygonal Polygonal-
masonry mauerwerkpolygonal spire Turmhelmpolygonal system Polygonalsystempomel, pommel Turmknopfpontoon (ponton) Pontonbrücke,
bridge Schiffbrückepoop Dachstuhl, Gebindepoorhouse Armenhausporch am. Torhalle, Veranda,
Vorhalle, Wind-fang, Laube
portal Portalportcullis Fallgatterportico Portikus, Laubeportiere Portièrepost Mast, Pfosten, Stielpost-and-beam Ständerbau
construction postern Ausfalltor, Pforte,
Poterneprayer chapel Bethauspredella Altarstaffel, Predellaprefabricated Bauelement
building unit prefabrication Vorfertigungprelature Prälaturprincipal rafter Hauptsparrenprincipal shaft alter Dienstpriory Prioratprison Kerker, Gefängnisprivate chapel Hauskapelleprofile Profilprojecting roof Abdach,Vordachprojection Projektion, Risalit,
Vorlageproportion Proportionproportional key Proportions-
(scheme) schlüsselpropylaeum Torbauproscenium Proszeniumprotecting roof Schutzdach
Fachglossar 582
proto-Doric protodorische Säulecolumn
provostship PropsteiPrussian vault preußische Kappepublic house Gaststättepulpit Kanzelpulpit altar Kanzelaltarpulpit house Kanzelhauspulvinus Pulvinuspurlin (Dach-) Pfettepush Schubputlog holes Gerüstlöcherpyramid Pyramidepyramid roof Pyramidendach
quadratura Quadraturquarry stone Bruchsteinequarter round Viertelstabquatrefoil Vierpaßquoin Eckquader
rabbet Anschlag, Fensterlaibung
radial Radialradial city Radialstadtradiating chapel Apsidialkapelleradiating chapels Kapellenkranzrafter Sparrenrafter roof Sparrendachrafters (Dach-) Gespärreragwork vault Plänergewölberail beam Riegelbalkenrail Rähmrailing Geländerraised platform Estraderam Bärrammed loam Lehmstampfbau
construction rammer Bärramp Ramperampant arch ansteigender Bogen,
einhüftigrampart Propugaculum,
Rempart,Wallratio Proportionravelin Ravelinrear stalls Parterrerear Rückenrebate Anschlagreception Empfangsgebäuderecess Absatz, Einziehungrecessed margin Randschlagrectangular choir Rechteckchorredoubt Redouterefectory Refektorium,
Remter
reinforced Eisenbeton,concrete Stahlbeton
reinforcement Bewehrungreinforcement Moniereisen
steel, Moniergeweberelief Reliefrelief orthostat Relieforthostatenrelieving arch Entlastungsbogen,
Überfangbogenrelieving wall DechargemauerRenaissance Knorpelwerk
scrollwork rental housing Miethausrepetition Rapportresidence Wohnhausresidential building Wohnbaurespond Dienstrestaurant Gasthausrest stop Rasthausretable (Altar-) Retabelretaining arch Erdbogenretaining wall Epaulement,
Futtermauerreticulated vault Netzgewölberetrochoir Scheitelkapellereveal Türlaibungrevetment Bekleidungrevolving door Drehtürrevolving stage Drehbühnerhomboid roof Rhombendachrhythm Rhythmusrib Ripperibbed ceiling Rippendeckeribbed dome Rippenkuppelribbed vault (Kreuz-) Rippen-
gewölberibbon window Fensterbandridge Crete, First,
Rückenridged roof (dou- Sägedach
ble, triple, etc.) ridge purlin Firstpfetteridge rib Gurtrippe,
Scheitelripperidge tile Firstziegel,
Gratziegelriding house Reithallering wall Bering, Ringmauer,
Zingelrise Bogenpfeil, Pfeil
(-höhe), (Trep-pen-) Steigung, Stichhöhe
rise of arch Bogenhöheriser Blindstufe,
Setzstufe
583 Englisch-Deutsch
rising arch steigender Bogenrising masonry aufgehendes
Mauerwerkriver pier Flußpfeilerroadside cross Betsäulerocaille Muschelwerk,
Rocaillerock-cut church Felsenkirche,
Höhlenkircherock-cut temple Felsentempel,
Höhlentempelrock-cut tomb Felsengrabrocker column Pendelstützerock fortress Felsenburgrock garden SteingartenRoland column Rolandroller blind RolladenRoman arch RundbogenRoman Doric römisch-dorische
order OrdnungRoman Ionic römisch-ionische
order OrdnungRoman window Rundbogenfensterrondel Rondellrood altar Laienaltarrood beam Triumphbalkenrood cross Triumphkreuzrood loft Doxalerood screen Doxale, Lettnerroof Dachroof batten Dachlatte, Ziegellatteroof construction Dachkonstruktionroof covering Dachdeckungroof curb Dachbruchroof frame Dachbinder,
Dachwerkroof framework Dachgespärreroof garden Dachgartenroofing Dachdeckungroofing felt Dachpapperoofing slate Dachsteineroof joist Dachbalkenroof lath Dachlatteroof overhang Abdachroof pitch Dachneigungroof planking Dachschalung
(außen)roof pyramid Dachpyramideroof skin Dachhautroof slab Dachplatteroof space Dachraumroof terrace Dachterrasseroof timbers Dachgebälkrooftree Giebelbalkenroof truss Bundgespärre,
Dachbinder
room Zimmer, Gemach, Stube
rope construction Seilkonstruktionrope moulding Taustabrose, r. window Rose, Fensterroserosette Fächerrosette, Roserostrum Tribünerotunda Rotunde,
Rundkircherough cast Rauhputzroughcast plaster Rauhputzrough-hew bossierenrough-hew Bindemittel
medium round arch Rundbogenround arch frieze Rundbogenfriesround church Rundkircheround pier Rundpfeilerround (staircase) Lichtspindel
well round temple Rundtempelround tower Rondellround well Hohlspindelrow house am. Reihenhausrowlock Rollscharroyal court Königshofroyal hall Königshallerubble Bruchsteine,
Feldsteinrubble masonry Feldsteinbaurubble vault Gußgewölberuin Ruinerunner Läuferrunning dog laufender Hundrustic house Bauernhausrusticated arch Bogenquaderungrusticated ashlar Buckelquaderrusticated stone Bossenquaderrustication Rustika
sacrament chapel Sakramentskapellesacristy Sakristeisaddle Dachsattelsaddleback (roof) Satteldachsaddleback roof Sattelturm
tower sail vault Hängekuppel,
SegelgewölbeSaint Andrew's Andreaskreuz,
cross KreuzholzSaint Anthony's Antoniuskreuz
cross Saint Michael's Michaelskapelle
chapel salient angle Bollwerkswinkelsalient corner Bollwerkswinkel
Fachglossar 584
sally port Ausfalltor, Manns-loch, Poterne
salon Salonsaltier cross bar Kreuzbandsample Mustersanctuary Allerheiligstes,
Sanktuarumsanctuary (with Barkenkammer
sacred bark) sap, sapping Sappe, Splintsarcophagus Sarkophagsash, window s. Fensterflügel,
Sprossesatellite town Trabantenstadtsawtooth roof Sheddachscaffold Bühne, Gerüstscaffold boards Gerüstbretterscagliola Stucco lustroscale frieze Schuppenfriesscalloped capital Pfeifenkapitellscamillus Scamillusscarving Verblattungscissors Scherescreen Gitter, Rasterscroll Helikes, Schneckescroll capital Volutenkapitellscroll gable Volutengiebelscrollwork Rollwerk,
Schweifwerksculpture Skulpturseam Lagersecco painting Seccomalereisectroid Gewölbekappesecular building Profanbausedile Dreisitzsegmental arch Flachbogen,
Segmentbogen, Sichelbogen
segmental gable Segmentgiebelsegmental window Segmentfensterselenite Marienglassemicircular tower Schalenturmsemidome Halbkuppelsentry box Schilderhaussepulchral building Grabbausepulchral Grabdenkmal
monument sepulchral mosque Grabmoscheeseraglio SerailSerlian motif Palladio-Motiv,
Serlianaserpent column Schlangensäulesettlement joint Setzfugesexpartite vault sechsteiliges
Gewölbesextry Sakristei
sgraffito Sgraffitoshaft Schacht, Schaftshaft ring Schaftring,Wirtelshaped brick Formsteinshears Scheresheath Schar, Schuh, Futtersheathed wall Mantelmauershed Bauden, Hütte,
Schuppenshed dormer Schleppgaubeshed roof Schleppdach,
Sheddachshell Schaleshell vault Muschelgewölbeshelter Wetterdachshingle roof Schindeldach,
Spließdachshoe Schuhshop Ladenshop buildings Ladenbautenshop window Schaufenstershoulder Brüstung, Schultershouldered arch Kragsturzbogen,
Schulterbogenshrine Schreinshutter Fensterladen, Ladenside altar Seitenaltarside apse Nebenapsisside chapel Einsatzkapellenside elevation Seitenrißside portal Seitenportalside wing Seitenflügelsill Schwellesill cornice Sohlbankgesimssill course Fensterbankgesimssilo Speichersingle-pitch roof Pultdachsite Ortsite plan Lageplanskeleton Skelettbau
construction skew arch Diagonalbogenskirting board Fußleisteskylight Oberlichte,
Dachlukeskyscraper Wolkenkratzer,
Hochhausslab-and-beam Plattendecke
floor slate roof Schieferdachsliding door Schiebetürsliding lattice grate Scherengittersliding shutter Schiebeladensliding window Schiebefensterslit-and-tongue Anschlitzung
joint
585 Englisch-Deutsch
slope Abdachung,Böschung
slot Nutslype Schlippesmoke flue Fuchssmokeroom house Rauchstubenhaussmokestack Schlotsoffit Sofittesolar Solariumsolid ceiling Massivdeckesolid construction Massivbausolid masonry Vollmauerwerksolid step Klotzstufe,
Blockstufesommer Dachbalkensopraporta Supraportesound floor Einschub,
Fehlbodensounding board Schalldeckelspace Baulücke, Raumspace frame räumliches
Tragwerkspan Spannweite,
Stützweitespandrel (Gewölbe-)
Zwickel, Hinter-mauerung, Spandrille
spandrel step KeilstufeSpanish tile Klosterziegelspar Sparrenspatial structure räumliches Tragwerkspecimen Musterspherical arch Diagonalbogenspherical calotte Kugelkappespherical house Kugelhausspherical triangle sphärisches Dreieckspike Mauerhakenspiral Spiralespiral ornament Helikesspiral ramp Wendelrampespiral staircase Spindeltreppespiral tower Spiralturmspiral vault Schneckengewölbe,
Spiralgewölbesplay Ausschrägungspolia Spoliespot Ortspread Spannweitespring Brunnen, Federspringer Kämpfersteinspringer of arch Anfangssteinspringing line Kämpferliniespringing stone Anfangssteinspringing wall Widerlagerspring line Bogenanfang
sprocked eaves Dachbruchsprocket Aufschiebling,
Sturmlatte, Windrispe
spur Eckknolle, (Eck-)Klaue, Sporn
spur stone Radabweisersquinch Trompesquinch arch Teilgewölbesquinch dome Trompenkuppelsquint Hagioskopstables (royal s.) Marstallstadium Stadionstage Bühne, Geschoßstage house Bühnenhausstained glass Glasmalereistaircase Treppenhausstaircase with Podesttreppe
landing stairhead Austrittstairs Treppestair shapes Treppenarmstair tower Treppenturm,
Wendelsteinstair turret Treppenturmstake Stakenstalactite capital Stalaktitenkapitellstalactite dome Stalaktitenkuppelstalactite portal Stalaktitenportalstalactite vault Stalaktitengewölbestalls Stallenstandard Musterstanding seam Stehfalz
(welted s. s.) standing welt Stehfalzstar-fort Sternschanzestatics Statikstave church Stabkirchestave construction Stabbaustay Spreizesteel door Stahltürsteel-frame Stahlskelettbau
construction steel girder Profilträgersteel section Profilträgersteel skeleton Stahlskelettbau
construction steel window Stahlfenstersteeple Glockenturmstela, stele Stelestellar vault Sterngewölbestep Stufestepped gable Staffelgiebelstepped mastaba Stufenmastabastepped merlon Stufenzinnestepped portal Stufenportal
Fachglossar 586
stepped pyramid Stufenpyramidestepping Abtreppungstereobate Stereobatstilted gestelztstilted arch Stelzbogenstilting Stelzungstipes StipesStock Exchange Börsestone beam Steinbalkenstone circle Steinkreisstone corbel Notstein, Kraftsteinstone cutting Steinschnittstonemason's mark Steinmetzzeichenstoneware Steinzeugstonework Steinwerkstore Kaufhausstorehouse Speicherstorey, am. story Etage, Geschoß,
Stockwerkstorey height Geschoßhöhe,
Stockwerkshöhestraining arch Schwibbogenstraining piece Zangestraining tie Spannriegelstrap Riemchenstrapwork Beschlagwerkstretcher Läuferverband
(running) bond string Treppenwangestringcourse Balkengesims,
Gurtgesimsstringer Treppenwange,
Wangestring wreath Kröpflingstrip iron Bandeisenstructural element Baugliedstructure Gefügestrut Fußstrebe, Kopf-
band, Spreize,Strebe, Traverse
strutted frame Sprengwerkstrutted gable Sprenggiebelstucco Stuck, Feinputzstucco architecture Putzarchitekturstucco coat Putzhautstucco decoration Stuckdekorationstuccowork Stuckaturstud Bundsäule, Ständer,
Stielstudio Atelierstupa Stupastyle Stilstylize stilisierensubstructure Substruktionsuburb Trabantenstadtsuburbium Burgus
suite (of rooms) Zimmerfluchtsummer Unterzugsummerhouse Gartenhaussun blind Markise,
Sonnenladen, Sonnenblende
sun sanctuary Sonnenheiligtumsunshade Sonnenladensuperstructure Hochbausupport Auflager, Stützesupporting beam Trägersupporting wall Stützmauersurbased spherical Platzelgewölbe
vault surround Zarge (bei Türen
und Fenstern)suspended floor Hängebodensuspended roof Hängedachswell Anschwellungswinging door Pendeltür,
Schwingflügeltürsymmetry Symmetriesynagogue Synagoge
tabernacle Sakramentshaus,Tabernakel
tail beam Stichbalkentambour Tambourtamp versetzentaper, t.ing Verjüngungtapestry Wandteppichtavern am. GasthausT-beam T-Trägertectonics Tektoniktelamon Atlanttelevision tower Fernsehturmtemplate Schablonetemple in antis Antentempeltemple precinct Tempelbezirktemple with twin Doppeltempel
sanctuaries tenaille Tenailletenement house Miethaustenon Zapfentension tie Zugankertent roof Zeltdachtent-roof Zeltdachkon-
construction struktionterrace Terasseterrace(d) house Reihenhaus,
Terrassenhausterraced temple Terrassentempelterrace roof Terrassendachterrazzo Terrazzotheater Theaterbauthole Dollen
587 Englisch-Deutsch
tholos Tholostholos tomb Kuppelgrabthong Riemchenthree-hinged arch Dreigelenkbogenthree-quarter Dreiviertelstab
roundthree-winged Dreiflügelanlage
complex threshing floor Tennethreshold Türschwellethrough stone Steinankerthrough vault Muldengewölbethrust Schubtierceron Tiercerontile Kacheltile decoration Azulejostiles Fliesen, Ziegeltiltyard Turnierhoftimber framing Gebälk, Holzbautimber work Holzbautimberyard Bauhoftimbre Helmtoilet Klosetttomb Grufttomb construction Grabbautongue and dart Blattwelle,
Wasserlaubtongue-and- Spundung
groove joint toothed moulding Zahnschnitttop Firsttop beam Spitzbalken,
Giebelbalkentop boom Obergurttop-hinged Klappfenster
window top plate Kopfstrebe,
Stockschwelletop rail Zarge (bei Stühlen
und Tischen)top step Austritttorsion Torsiontorso Rumpftorus Rundstabtower Turmtower fortress Turmburgtower gate Turmtortower house Wohnturm,
Geschlechterturmtown Stadttown fortification Stadtbefestigungtown hall Rathaus, Stadthalletown planning Städtebautown wall Stadtmauertrabeated architravierttrabeation Gebälk
tracery Maßwerktracery bridge Maßwerkbrücketracery vault Maßwerkgewölbetract Trakttrading post Kontortransenna Transennatransept Querhaus,Transepttransept apse Querhausapsidetransept arm(s) Querhausarm,
Kreuzarmetransept tower Querhausturmtransom Sturzriegel,
Transom, Holmtransverse arch Gurtbogen, Trans-
versalbogen, Quergurt
transverse barrel Quertonnevault
transverse hall Quersaaltransverse rib Gratbogentransverse roof Querdach,
Zwerchdachtrap door Falltürtrapezoidal capital Trapezkapitelltread Trittstufetreasury Schatzhaustrefoil Dreiblatt, Dreipaßtrefoil arch Kleeblattbogentrefoil window Kleeblattfenstertrellis Gittertrench Abzugsgraben,
Grabentriradial ribs Dreistrahltriangular arch Giebelbogentriangular fillet Dreikantleistentriangular notch Klauetriangulation Triangulationtriapsidial choir Dreiapsidenchortriapsidial hall Dreiapsidensaaltribunal Tribunaltribune Tribünetriconch apse Dreiapsidenanlage,
(church) Dreikonchen-anlage
triforium Triforiumtriglyph Triglyphe,
Dreischlitztriglyph frieze Triglyphenfriestrimmer WechselTrinity church Dreifaltigkeitskirchetriumphal arch Triumphbogen,
Triumphtortriumphal column Siegessäule,
Triumphsäuletriumphal gate Siegestortrompe Trompe
Fachglossar 588
trophy Trophäetrumeau Trumeautrunk Koffer, Rumpftruss Dachstuhl, Ge-
binde, Tragsteintrussed beam Fachwerkbindertub CuvetteTudor arch TudorbogenTudor flower Tudorblatttumulus Tumulustunnel vault TonnengewölbeTurkish bath Hammamturret DachreiterTuscan order toskanische
Ordnungtwisted rope cross Taukreuztympanum Tympanon, Bogen-
feld, Giebelfeld
umbrella dome Schirmgewölbeumbrella vault Schirmgewölbeundercroft Hallenkryptaupholstery Polsterupright Stielupright beam Ständerurban extension Stadterweiterung
valley Dachkehlevalley rafter Kehlsparrenvalley temple Taltempelvalve FalltürVauban system Vaubansystemvault Gewölbe, Gruftvault axis Gewölbeachsevaulted roof Bogendachvaulting Gewölbeschalevault rib Bandrippevault rise Gewölbehöhevault springer Gewölbeanfängerveduta Vedutevehicle Bindemittelveneer FurniereVenetian blind Jalousievent Abschlagventilating shaft Luftschachtveranda Verandaverge roof (v. r.ing) Ortziegelverge Ortgangvertex Scheitelvertical joint Stoßfugevestibule Vestibül, Dieleviaduct Viaduktvillage Dorfvine scroll pattern BlattfriesVitruvian scroll laufender Hundvolume Baukörper
volute Schnecke,Volutevolute capital Volutenkapitellvolute gable Volutengiebelvoussoir(s) Wölbstein, Bogen-
steine, Keilstein
wainscot Paneelwainscoting Täfelwerkwall Mauer, Wand,
Enceintewall articulation Wandgliederungwall crown Mauerkronewall hangings Wandbekleidungwall hook Mauerhakenwallpaper Tapetewall passage Laufgangwall plate Dachschwelle,
Mauerlattewall rib Blendrippe, Schild-
rippe, Schildbogenwall structure Wandaufbauwall walk Wehrgangwar memorial Ehrenmalwardrobe Garderobewarehouse Kaufhaus, Magazin,
Warenhauswaste pipe Ablaufrohrwatchtower Wachturm, Burg-
warte, Wartturmwatch turret Hochwachtwater drip Wasserschenkel,
Wetterschenkelwaterworks Wasserkünstewayside shrine Betsäuleweather groove Wetterschenkelweathering Kaffgesims,
Wasserschlag, Wasserschräge
weathervane Wetterfahnewedding house Hochzeitshauswedge Keilsteinwedge joint Keilfugewell Brunnenwell house Brunnenhauswest apse Westchorwest choir Westchorwest end Westbauwest transept Westquerhauswestwork Westwerkwheel window Radfenster,
Katharinenradwhispering dome Flüstergewölbewhispering gallery Flüstergewölbewhorl anwirtelnwicker Flechtwerkwicket Einlaßpforte
589 Englisch-Deutsch
Fachglossar 590
wind brace Windverbandwinding stair Wendeltreppewindow Fensterwindow arcades Fensterarkadenwindow axis Fensterachsewindow frame Blendrahmen,
Fensterrahmenwindow grating Fenstergitter,
Fensterkorbwindow grille Fensterkorbwindow jamb Fensterstockwindow ledge Fensterbankwindow lock Fensterverschlußwindow opening Fensteröffnungwindowpane Fensterflächewindow post Setzholzwindow rabbet Fensteranschlagwindow recess Fensternischewindow sill Fensterbank,
Fensterbrettwindow sill cornice Fensterbankgesimswindow stay Fensterhakenwing Communs, Flügelwinged altarpiece Flügelaltar
wing pavilion Risalitwinter garden Wintergartenwire lathing Rabitzgewebewire plaster Rabitzgewölbe,
ceiling Rabitzdeckewood-beam ceiling Holzbalkendeckewood (-block) Holzpflaster
paving wooden flooring Dielenfußbodenwooden transom Kämpferholzwooden structure Holzbauwork Werkworm's-eye view Froschperspektivewreath Kranz
X-brace Abkreuzung
yard Hofyeomanry LandwehrYorkshire bond märkischer Verband
ziggurat Stufenpyramidezigzag Zahnfrieszither Zither
abaque Abakusabattant Falladenabat-vent Vordachabat-voix Schalldeckelabbaye Abteiabouement Stoßabout de poutre Balkenkopfabri Schutzdach,
Wetterdachabrivent Wetterdachabside Apsis, Chornischeabside de transept Querhausapsideabside secondaire Apsidioleabsidiole Apsidioleacanthe Akanthusaccolade, arc en a. Kielbogen,
Eselsrückenaccoudoir Armlehne am
Chorgestühl, Fensterbrett
accouplé gekuppeltacier à béton Moniereisen,
Moniergewebeacier d'armature Moniereisen,
Moniergewebeacropole Akropolisacrotère Akroteradjonction Anschlußadobe Adobeadossement Böschungadyton Adytonaerarium Aetomaaéroport Flughafenaffleurement Fluchtagglomérant Bindemittelagora Agoraagrafe Agraffe, Falzaiguille (Turm-) Helmaile Alae, (Seiten-)
Flügelaile (d'escalier) Treppenarmaile de transept Querhausarm,
Kreuzarmeaire Estrich, Fußboden,
Tenneaire de service Rasthaus
principale aire (de traçage) Schnürbodenaire en planches Dielenfußbodenaisselier Bugalcazaba Alcazabaalcazar Alcazaralcôve Alkovenalignée Reihung
alignement Bauflucht, Flucht-linie, Reihung
allée couverte Ganggrabaltane Altanalternance de Stützenwechsel
supports altis Altisambitus Ambitusambon Amboambulatoire Umgang,
Ambulacrumâme Steg (eines
Profilträgers)amorce Zahnsteineamphiprostyle Amphiprostylosamphithéâtre Amphitheateranberonnière Hakenblattancone Tragsteinancrage Verankerungancre Mauerhaken, Ankerancre d'about Balkenankerancre de poutre Balkenankerandrôn Andronandronitis Andronitisangle chanfreiné Schmiegeanneau Schaftring, Bundannelets Anuliannexe Annexantarala Antaralaante Anteantébois Fußleiste,
Sockelleisteantéfixe Antefix, Stirnziegelantéglise Vorkircheantependium Antependiumanthémion Anthemionantichambre Antikabinettapadana Apadanaapex Scheitelaplatissement Abplattungapodyterium Apodyteriumapophyge Apophyge, Ablaufappareil Appareil, Verband,
Gefügeappareil à boutisses Streckerverbandappareil dit anglais englischer Verband,
Blockverbandappareil en besace gotischer Verbandappareil en feuilles Ährenwerk
de fougère appareil en Läuferverband
paneresses appareil hollandais holländischer
Verband
591 Französisch-Deutsch
FRANZÖSISCH-DEUTSCH
appareil polonais polnischer Verband
appartement Appartementappentis Abdachappui Fensterbrüstung,
Lagerappui butée Widerlagerappui de fenêtre Fensterbank,
Sohlbankappui pendulaire Pendelstützeaqueduc Aquäduktarabesques Arabeskearbalétrière Armbrustschartearc (Strebe-) Bogenarc accolade Sattelbogen,
Eselsrückenarcade Arkadearcade aérienne Strebebogenarcade de fenêtres Fensterarkadenarcade de volée Maßwerkbrücke
d'arc-boutant arcade géminée Doppelarkadearcades Arkadenbögen,
Laubearc à fasces Faszienbogenarc aigu Spitzbogenarc à inflexions Vorhangbogen
multibles arc à joints Kragbogen
horizontaux arc à moulures Faszienbogenarc (à réseau d'in- Vielpaßbogen
trados) polylobé arc arêtier Gratbogenarc articulé, Gelenkbogen
poutre en a. a. arc (à trace) Parabelbogen
parabolique arc à trois rotules Dreigelenkbogenarcature Arkaturarcature aveugle Blendarkadearcature simulée Blendarkadearcature ternée Drillingsbogenarc aveugle Blendbogenarc bombé Segmentbogen,
Stichbogenarc bornant une Scheidbogen
voûte arc-boutant Schwibbogen,
Strebebogenarc brisé islamique Sarazenenbogenarc brisé Sarazenenbogen
mauresque arc chevronné Zackenbogenarc de décharge Überfangbogen,
Entlastungsbogen
arc de départ Stirnbogenarc de fondation Erdbogen,
Fundamentbogenarc d'encadrement Überfangbogenarc de parabole Parabelbogenarc de triomphe Triumphbogenarc diagonal Diagonalbogen
(Kreuzbogen)arc diaphragme Schwibbogenarc d'ogive Diagonalbogen
(Kreuzbogen)arc-doubleau Gurtbogenarc doubleau Quergurt
transversal arc d'une fenêtre Fensterbogenarc du front Stirnbogenarc d'une péné- Raumbogen
tration (de voûte)arceau Transversalbogenarc en accolade Eselsrückenarc en contre- Sternbogen
courbearc en ellipse Ellipsenbogenarc en encor- Kragbogen
bellementarc en fer à cheval Hufeisenbogenarc engagé Wandbogenarc en mitre Giebelbogenarc en ogive Spitzbogenarc en orbe voie Blendbogenarc en plate- scheitrechter
bande Sturz, Sturzbogenarc en plate-bande Schulterbogen
surhaussée arc en renfort Entlastungsbogenarc exhaussé Stelzbogenarc feint Blendbogenarc florentin Sichelbogenarche Archearchère Armbrustscharte,
Bogenschartearchière Schlitzfensterarchitecte Architekt,
Baumeisterarchitectonique Architektonikarchitectono- Architektur-
graphie darstellungarchitecture Scheinarchitektur
simulée architecture Architektur,
Baukunstarchitrave Architravarchitravé architraviertarchivolte Archivoltearc infléchi Vorhangbogenarc mural Wandbogen
Fachglossar 592
arc ogival Spitzbogenarcon Sattelbogenarcosolium Arcosolium,
Nischengrabarc outrepassé Hufeisenbogenarc polylobé Fächerbogenarc rampant steigender Bogenarcs d'arcades Arkadenbögenarc segmentaire Segmentbogen,
Stichbogenarc surélevé Stelzbogenarc toscan Sichelbogenarc tréflé Kleeblattbogenarc Tudor Tudorbogenareine Stollenarène Arenaarête Gratarête de poisson Fischgratarêtier Gratschifterarêtiers Lehrgespärrearmature Armierung, (Bau-)
Beschlag, Bewehrung
armature à clefs Hängewerkpendantes
armement Armierungarmement de voûte Lehrgerüstarmoir Armariumarrachement Verzahnung (im
Mauerwerk),Zahnsteine
arrière-cour Lichthofarrière-voussure Laibungsbogenarsenal Arsenal, Zeughausartesonado Artesonadoarticulation Gelenkasklépiéion Asklepeionassemblage Verbandassemblage à blocs Blockverbandassemblage à Sprengwerk
contrefiches assemblage à Verkämmung
entaille(s) assemblage à Verkämmung
mi-bois (Holzverbindung)assemblage à Überblattung
mi-paune assemblage Eckverband
angulaire assemblage à Verklauung
panne et entaille assemblage d'angle Eckkammassemblage de Holzverbindung
boisassemblage en Verzahnung
adents
assemblage en Lang- und longueur Kurzwerk
assemblage par Anschlitzungembrèvement (par enfourchement, affourchement)
assemblage par Einhälsungenfourchement en T
assemblage par Verblattungfeuillure
assise Schicht, Scharassise d'arase Ausgleichsschichtassise de briques Rollschar
posées de champ assommoir Maschikuliastragale Astragalatectonique atektonischatelier Atelieratlante Atlantatrium Atriumattique Attikaauberge Gasthaus, Herbergeaubier Splintauditoire, Auditorium
auditorium aumônerie Almosenhaus,
Armenhausautel de sarcophage Sarkophagaltarautel principal Choraltar (Hochaltar)autel subordonné Seitenaltarautel Altarauvent Schutzdach, Sturm-
latte, Vordach, Wetterdach
avant-bec Eisbrecheravant-corps Risalit,Vorlageavant-corps à côté Auslucht
de l'entrée avant-corps central Mittelrisalitavant-corps latéral Seitenrisalavant-toit Vordachaxe Achseaxe de fenêtre Fensterachseaxe d'une voûte Gewölbeachseazulejo Azulejos
bâb Bâbbadia Badiabague Bundbague (de colonne) Schaftring, Wirtelbaguette Rundstabbaguette annelée Ringstabbaguette bandée Ringstabbaie de clocher Schallöffnungbaie serlienne Palladio-Motiv
593 Französisch-Deutsch
baillie Balleibalcon Balkonbaldaquin Baldachinbalustrade Balustrade,
Geländerbalustre Baluster, Polster,
Dockebanc d' œuvre Chorgestühlbande Bandbande à la grecque Mäanderbandes de vagues laufender Hundbande surhaussée Schulterbogenbanquette Bankett, Fenster-
tritt, Sohlbankbaptistère Baptisteriumbaraque Barrackebarbacane Barbakane,
Torzwingerbarrage (de vallée) Staudamm,
Talsperrebarre Riegelbalkenbarreaux de fenêtre Fenstergitterbarre du gouvernail Helmstangebarricade Barrikadebase Basisbase attique attische Basisbasilique Basilikabasilique à Säulenbasilika
colonnes basilique à coupole Kuppelbasilikabasilique à piliers Pfeilerbasilikabasilique à tribunes Emporenbasilikabas-relief Basrelief, Flachreliefbasse-fosse, Verlies
cul de b.-f. basse-nef Seitenschiffbasse-taille Basreliefbastide Bastidebastille Bastille, Burgbastion Bastion, Bastei,
Bollwerkbatellement Dachtraufebâti Werksatzbâti de porte Türstockbatière Dachsattelbâtiment Gebäudebâtiment à étages Geschoßbaubâtiment à niveaux Geschoßbaubâtiment concentré Punkthausbâtiment d'accueil Empfangsgebäudebâtiment en Penthouse
appentis bâtiment en pisé Pisébau (-weise)bâtiment Montagebau
préfabriqué bâtiment(s) de foire Messebauten
bâtiments Megalith-BautenMegaliths
bâton Stabbattant Flügelbattant de fenêtre Fensterflügelbattée Anschlagbattement Schlagleistebatterie Batteriebau Balkenbayle extérieur Zwingerbec Schnabelbeffroi Belfried, Bergfried,
Glockenturmbéguinage Beginenhofbelétage Beletage,
Hauptgeschoßbélier Bärbellevue Bellevue, Belvederebelvédère Aussichtsturmbema Bemaberceau Gartenlaubeberme Bermebesans Scheibenfriesbéton Betonbéton apparent Sichtbetonbéton armé Eisenbeton,
Stahlbetonbiais Gehrungbiaisement Gehrungbibliothèque Bibliothekbillette carrée Würfelfriesbillette cylindrique Rollenfriesbillettes Rollenfriesbillot de batte Bärbiseau Wasserschlag,
Wasserschrägebiseauter abfasenbloc creux Hohlblocksteinbloc erratique Findlingbloc perforé Gittersteine
en treillis bois Sattelholzbois à section Ganzholz
entière bois croisé Kreuzholzbois de brin Ganzholzbois de clayonnage Stakenbois gisant Lagerholzbois mi-plat Halbholzbois mort Astwerkbonnet Bonnetbordure de pignon Windbrett,
Stirnbrettbosquet Boskettbosse Bossebosser (la pierre) bossieren
Fachglossar 594
bossette Bosseboucharder stockenbouche de lumière Lichtschachtboudin Stabboudoir Boudoirboule (de tour) Turmknopfbouleutérion Buleuterionboulevard Boulevard,
Vormauerbourrelet flanschenbourse Börsebouteroue Prellsteinboutisse, Binder
pierre en b. bouton en olive Ohrbouton Knollebouvetage Spundungbranchage Astwerkbranche Schenkelbras de transept Querhausarmbras force Büge (Bug)brèche Breschebretèche Pechnasebride Flanschen
(Rohrflansch)brique Backsteinbrique à rainure Falzziegelbrique creuse Hohlblockstein,
Hohlziegelbrique de mur Mauerziegelbrique de Verblender
parement brique de verre Glasbausteinbrique moulurée Formsteinbrique profilée Formsteinbrique tanisée Lohsteinbrise-glace Eisbrecherbrise-lames Wellenbrecherbrise-soleil (Sonnen-) Blendebrisis d'un toit Dachbruchbrisure Brisurebroderie en pierre Maßwerkbucrâne Bukranion,
Ochsenschädelbungalow Bungalowbunker Bunkerbure Schachtbureau Kontorbutoir Prellstein
cabane de bauge Lehmtennecabane de Lehmtenne
bousillage cabinet Kabinettcabinets Klosettcâble torsadé Taustab
cachot Faulturm, Kerkercadenas à rouleaux Ringsäulecadre Rahmencadre articulé Gelenkrahmencadre (de fenêtre) Fensterrahmencage de clocher Glockenstuhl
(Glockengerüst)cage d'escalier Treppenhauscaisson Feld, Deckenfach
(Kassette)calathus Kalathoscaldarium Caldariumcalibre Lehre (in der
Schlosserei)calotte Kalotte, Kugelkappecalotte bohémienne böhmische Kappecamarin Camarincame Kammcamp Lagercamp retranché Camp retranchécampanile Kampanile,
Glockenturmcanal Grachtcancel Chorschrankencandélabre Kandelabercanéphore Kanephorecanevas de cintre Lehrgerüst
(Rippengestell)caniveau Gosse, Rinnsteincanne Steg (Kannelierung)canneler Kandelcannelure Riefelungcannelures Kannelurencanon Fallrohrcanton de voûte Gewölbekappecantonné kantoniertcapitale Capitalliniecapitole Kapitolcaravansérail Karawansereicarcan Staupsäulecarneau Fuchscarreau de vitre Fensterscheibecarreaux Fliesen, Kacheln,
Platten, Quadercarrelages Fliesencarroyage Quadrierungcartilage Knorpelwerkcarton bitumé Dachpappecartouche Kartuschecaryatide Karyatidecascade Kaskadecasemate Kasemattecaserne Kasernecasino Kasinocassette Kassettecastel Kastell
595 Französisch-Deutsch
catacombes Katakombecatafalque Katafalkcathédrale Kathedrale, Dom,
Münstercavalier Kavaliercave Kellercaveau Gruft, Kellercavet Anlaufcellule Zellecénotaphe Kenotaph,
Scheingrabcentre-ville Stadtkerncéramique Baukeramik
préfabriquée chaîne d'encoi- Eckverband
gnurechaire Kanzelchaire de prédica- Außenkanzel
teur en saillie (enencorbellement)
chalet Baudenchambranle de Fenstereinfassung
fenêtre chambre Gemach, Kammer,
Stubechambre à feu Dürnitzchandelle Stuhlsäulechanfrein Fase, Schmiegechanfrein de socle Sockelgesimschanfreiner abfasenchanlatte Stirnbrettchantier Baustellechantier de Schnürboden
cinglage chantignole Knaggechape Estrich, Gewölbe-
kappe, Holmchapeau Holmchapelet Perlstabchapelle (Feld-) Kapellechapelle absidiale Apsidialkapelle,
Chorkapellechapelle à deux Doppelkapelle
doubles étageschapelle de chœur Apsidialkapellechapelle de la Marienkapelle
(Sainte) Vierge chapelle de la Beichtkapelle
pénitence chapelle de palais Palastkapellechapelle de pont Brückenkapellechapelle de Michaelskapelle
Saint-Michel chapelle de Sakramentskapelle
tabernacle chapelle expiatoire Bußkapelle
chapelle funéraire Grabkapellechapelle latérale Einsatzkapellenchapelle Hauskapelle
particulière chapelle Apsidialkapelle
rayonnante chapelle Schloßkapelle
seigneuriale chapelle sépulcrale Grabkapellechapelle terminale Scheitelkapellechapiteau Kapitell, Knaufchapiteau à Knospenkapitell
bourgeons chapiteau à Knospenkapitell
crochets chapiteau à Blattkapitell
feuillage chapiteau à Kelchkapitell
tambour chapiteau à Stierkapitell
taureaux chapiteau à volutes Volutenkapitellchapiteau avec Pfeifenkapitell
godrons chapiteau Glockenkapitell
campaniforme chapiteau Glockenkapitell
campanulé chapiteau Kompositkapitell
composite chapiteau corbeille Korbkapitellchapiteau cubique Würfelkapitell
(simple)chapiteau cubique Doppelwürfel-
divisé kapitellchapiteau d'ante Antenkapitellchapiteau dorique dorisches Kapitellchapiteau en Stalaktitenkapitell
stalactites chapiteau éolien äolisches Kapitellchapiteau figuré Figurenkapitellchapiteau Faltenkapitell
godronné chapiteau Trapezkapitell
trapézoïdal chappelles Kapellenkranz
rayonnantes charité Armenhauscharnier Beinhauscharnière Gelenk, Scharnierc(h)arole Umgangcharpente Dachgebälk,
Dachstuhlcharpente clouée Nagelbindercharpente de (Dach-) Gespärre
chrevrons
Fachglossar 596
charpente de toit Dachwerkcharpente de voûte Lehrgerüstchartreuse Kartausechâsse Schreinchasseroue Radabweiserchâssis Gatterchâssis de porte Türstockchâssis d'osier Fensterkorbchâssis métallique Stahlfensterchâteau Schloßbau, Burgchâteau d'eau Wasserschloßchâteau de chasse Jagdschloßchâteau de Lustschloß
plaisance château des Kreuzfahrerburg
templiers chatière Schleppgaubechaudière Kesselchaudron Kesselchef d'abside Chorhauptchemin couvert Rondengangchemin de ronde Wehrgangchemin rond Rondengangcheminée Esse, Kamin, Schlot,
Schornsteincheminée de Abzugskamin
ventilation chemise Putzchemise en béton Ummantelungchenal Fallrohrchéneau Dachrinne, Kasten-
rinne, Traufecherche (Muster-) Lehrechevet Apsis, Chorhauptchevet triabsidial Dreiapsidenchorchevêtre Wechselcheville Dübelcheville de bois Holznagelchevron Rofen, Sparrenchevron d'arêtier Gratsparrenchevron de croupe Reitersparren,
Schifterchevronnage Klaue (Aufklauung),
Verklauungchevronnée Gespärrechevrons Lehrgespärre
directeurs chœur Chorchœur à absides Staffelchor
échelonnées chœur à trois Dreizellenchor
niches chœur bas Unterchorchœur bénédictin Staffelchorchœur des moines Mönchschorchœur-halle Hallenchor
chœur inférieur Unterchorchœur polygonal Polygonchorchœur Rechteckchor
rectangulaire ciboire Ziboriumciel Deckecimaise Blattstabcimetière Friedhofcinq-feuille Fünfblattcippe Stelecirque Zircuscisaille Schereciseaux Schereciseler scharrierencitadelle Zitadellecité Stadtcité-jardin Gartenstadtciterne Zisternecithare Zitherclaire-voie (Licht-, Ober-)
Gadenclaveau Keilstein, Wölbsteinclaveau à crosette Kröpflingclaveau de départ Anwölberclaveau engrené à Hakenstein
crossette claveaux Bogensteineclayonnage Bundwand,
Flechtwerkclef Scheitelsteinclef d'arc Agraffe, Scheitel-
stein, Schlußsteinclef de voûte Schlußstein,
Zwickelclef pendante Abhängling, Hänge-
Sprengwerkcléristère Lichtgadenclincker Klinkercloche arcade Glockengiebelclocher Glockenturmclocher à bulbe Zwiebelturmclocher-porche Westwerkclocheton Glockenstuhlclochette Kälberzähnecloison (Bund-, Scheide-)
Wandcloison Trennwand
(de séparation) cloison pliante Faltwand
(en accordéon) cloître Kreuzgangclôture Kreuzgang, Zaunclôture de chœur Chorschrankenclou d'épingle Stiftcœur allongé Fischblasecoffrage Schalung
597 Französisch-Deutsch
coffrage de (Beton-) plafond Deckenschalung
coffre Koffercoffre d'autel Altarschreincoin en pierre Keilsteincolarin Säulenhals, Halsringcollégiale, église c. Stiftskirchecollier Halsringcolonnade Kolonnadecolonne Säule, Stützecolonne annelée Bundsäule
(bandée) colonne- Pilzstütze
champignon colonne crétoise kretische Säulecolonne de Jupiter Jupitersäulecolonne de Triumphsäule,
triomphe Siegessäulecolonne de trois Dreiviertelsäule
quarts colonne d'honneur Ehrensäulecolonne en lotus Lotussäulecolonne engagée Wandsäule,
Dreiviertelsäulecolonne grotesque Grottensäulecolonne Hathorsäule
hathorique colonne oratoire Betsäulecolonne Palmensäule
palmiforme colonne Papyrussäule
papyriforme colonne perse persische Säulecolonne protodorische Säule
protodorique colonne torse Schlangensäulecolonne Triumphsäule,
triomphale Siegessäulecolossé Kolosseumcolumbarium Kolumbariumcomble Dachcomble à chevrons Sparrendachcomble à chev- Bogendach
rons recourbés comble à croupe Fußwalm (-dach)
boîteuse comble à croupe Halbwalmdach
faîtière comble à Fußwalm
demicroupe comble à la Mansarddach
Mansart comble à welsche Haube
l'impériale comble à potence Pultdachcomble à shed Sheddach
comble en Pultdachappentis
comble en pavillon Zeltdachcomble en potence Schleppdachcomble pyramidal Pyramidendachcomble rhomboïdal Rhombendachcombles Dachbodencomble transversal Querdachcomble-voûte Tonnendachcommanderie Komtureicommodité Commoditécommunicateur Vorgelegecommuns Communscompartiment Deckenfach
creux de plafond (Kassette)composition de Dachausmittlung
toit comptoir Kontorconcavité Busungconduite de Luftschacht
ventilation congé d'en haut Ablaufcongé renversé Anlaufconicité Verjüngungconque Koncheconsole Konsoleconsole (isolée) Tragsteinconstruction Bauwerkconstruction à Seilkonstruktion
câbles construction à Stahlskelettbau
ossature en acier construction au Tiefbau
niveau du sol construction offene Bauweise
discontinue construction en Holzbau
bois construction en Blockbau
bois blindés construction en Backsteinbau
briques construction en Lehmpatzenbau
briques en limon(- de glaise)
construction en Fachwerkbaucolombage
construction en Lamellenbaulamelles
construction en Längswandbauweisemurs longitudi-naux
construction en Skelettbauossature (portante)
construction en Lehmstampfbaupisé
Fachglossar 598
construction en Feldsteinbauroche erratique
construction en Hochbausurface
construction en Lehmbau (-weise)terre glaise
construction en Lehmwellenbautorchis
construction en Lehmfachwerktreillis de bousillage
construction Penthousehors-toit
construction Industriebauindustrielle
construction Pfahlbaulacustre
construction Langbaulongitudinale
construction Sakralbaureligieuse
construction Wohnbaurésidentielle
construction Tiefbausouterraine
contracture Verjüngungcontre-abside Westchorcontreboutement Verstrebungcontre-chevet Westchorcontre-fiche Kopfstrebecontre-fiches en Kreuzstaken,
croix Kreuzverbandcontrefort Strebepfeilercontrefort intérieur eingezogene Strebecontremarche Blindstufe,
Setzstufecontre-mur Futtermauercontre-placage Furnierecontre-porte Doppeltürcontreretable à Altarschrein
volets contrescarpe Contrescarpecontrevent (Fenster-) Laden,
Windrispecontreventement Windverbandconvexité Busungcoque Schalecoquilles Muschelwerkcorbeau Balkenstein, Kon-
sole, Kragstein, Notstein
corde Kämpferliniecordon Arkadengesimscordon d'étage Balkengesimscorne de bélier Schneckecorniche Gesims
corniche au pied Dachgesimsdu toit
corniche de fenêtre Fensterverdachungcorniche de niveau Giebelgesimscorniche principale Dachgesimscorniche supérieure Dachgesimscorps Leibcorps de coussin Polsterquadercorps de logis Appartement
Corps de logis,corridor Gang, Korridorcôte Rippecôté de l'Epître Epistelseite,
Männerseitecôté de l'Evangile Evangelienseite,
Frauenseitecouche Lager (eines Werk-
steines), Überzugcouchis Einschlubleistecouloir Gang, Korridorcoupe basilicale basilikaler
Querschnittcoupe de pierres Steinschnittcoupe-larmes Gurtgesims,
Wasserschlagcouplé gekuppeltcouple de chevrons Dachgespärrecouple de remplage Leergespärrecoupole Kuppelcoupole aplatie Flachkuppel,
Kugelkappecoupole bulbeuse Zwiebelkuppelcoupole byzantine byzantinische
Kuppelcoupole- Glockendach
campanuléecoupole-coque Doppelschalen-
double kuppelcoupole de la Vierungskuppel
croisée coupole en Stalaktitenkuppel
stalactites coupole extérieure Schutzkuppelcoupole pendante Hängeplatte,
Stutzkuppelcoupole sur Trompenkuppel
trompe(s) coupole surbaissée Flachkuppelcour Hofcour à arcades Arkadenhofcour impériale Königshofcourbe Bogen, gewundene
Reihungcourbe rampante Wange (Treppe)courbure gewundene Rei-
hung, Kurvatur
599 Französisch-Deutsch
couronne Gurtgesims, Kranz, Krone
couronne de Mauerkronerempart
couronnement Bekrönung, Couronnement
couronne murale Mauerkronecours Schichtcourtine Kurtinecoussin Polstercoussinet Kämpfer, Kämpfer-
stein, Polster, Tragstein
couvent Konventcouvent-forteresse Ordensburgcouverture Dachhautcouverture d'un Dachdeckung
toit couvreface Couvrefacecouvre-joint Deckleistecouvre-sol en Ziegelboden
briques coyau Aufschieblingcoyer Gratbalkencrampon Mauerhakencrématorium Krematoriumcréneau Creneau, Zinne,
Schießschartecréneau à gradins Stufenzinnecrépi (Rauh-) Putzcrépissure Rauhputzcrête Crete, Dachkamm,
Firstbekrönung, Grat
creux d'escalier Hohlspindelen colimaçon
critique Architekturkritikarchitecturale
crochet Knolle, Krabbe, Nasecrochet de mur Mauerhakencrochet en pierre Knorrecrochet tempête Fensterhaken
de fenêtre croisée d'ogive Gratbogen,
Kreuzbogencroisée du transept Vierungcroisillon Kreuzarme, Quer-
hausarm, Sprossecroisillon de Kämpferholz
croiséecroix Kreuzcroix de croisée Fensterkreuzcroix de Saint- Andreaskreuz,
André Kreuzstakencroix de Saint- Antoniuskreuz,
Antoine Taukreuz
croix grecque griechisches Kreuzcroix latine lateinisches Kreuzcroix triomphale Triumphkreuzcrosse Kreuzblume, Gie-
belblume, Krabbecrossette Eckzier, Verkröpfungcroupe Walmcroupe d'église Chorschlußcrue Anlaufcrypte Kryptacrypte annulaire Ringkryptacul-de-four Kesselgewölbeculée Widerlagercunette Abzugsgrabencurie Kuriecuvette Cuvette, Rinnecyma Kymacymaise ionique Eierstabcymaise lesbienne Wasserlaub
dais Dagnumdalle Plattedalle de plafond Deckenplattedamier Schachbrettfries,
Würfelfriesdéambulatoire Chorumgangdécharge Abschlagdéchargeoir Ablaufrohrdécor Dekor, Musterdécoration Dekorationdécoration en stuc Stuckdekorationdégorgeoir Ablaufrinnedégouttement Abtraufedegré Stufedehors d'une place Außenwerkdélardement Abgratungdemi-colonne à alter Dienst
grand diamètre demi-croupe Schopfwalmdemi-laine Bandeisen (in der
Schlosserei)demi-lune Demilunedemi-rondin Halbholzdemi-rosace en Fächerrosette
éventail demi-tour Schalenturmdemoiselle Bärdentelure Zahnschnittdenticule Kälberzähnedenticules deutsches Banddents de scie Sägezahnverzierungdépôt de matériel Bauhof
de chantier déroulement Abwicklungdescente d'eaux Fallrohr
pluviales
Fachglossar 600
dessin Musterdessin de bâtiment Bauzeichnungdessus de porte Supraportedevanture de Schaufenster
magasin développement Abwicklungdiagramme Schaubilddiastole Diastolediglyphe Zweischlitzdimension lichte Maße
intérieure (Innenmaß)diptère Dipterosdipylon Dipylondivergence Divergenzdivision de parois Wandgliederungdodécastyle Dodekastylosdolmen Dolmendôme (Außen-) Kuppel,
Domdôme à pendentifs Teilgewölbe(courbes) dôme bulbeux Zwiebelkuppeldôme en stalactites Stalaktitenkuppeldôme extérieur Schutzkuppeldôme pendant Stutzkuppeldonjon Donjon, Bergfried,
Wohnturmdormant Blendrahmendormant (d'attente) Zargedorsal Dorsaledos d'âne Eselsrückendouble mur Hohlmauerwerkdouble porte Doppeltürdoubleau, arc d. Transversalbogendoublure Futterdouelle Wölbsteindouelle (extérieure) Rückendraperie Draperiedressoir Anrichtedromos Dromos
ébrasement Ausschrägung, Fensteröffnung
écart à croc Hakenblattéchafaud Bühne, Gerüstéchafaudage Gerüstéchancrure Echancruteéchancrure de Fensternische
fenêtre échappée Spannweiteéchauguette Ausschuß, Schar-
wachturm, Schilderhaus
échelon Sprosseéchiquier Schachbrettfries,
Würfelfries
échoppe Hütteécoinçon Spandrilleécoutille Lukeécran Gitterécrin Schreinécurie Marstallécusson Schildédicule Ädikulaédifice Gebäudeéglise à deux étages Doppelkircheéglise à double doppelchörige
abside Anlageéglise à double doppelchörige
chevet Anlageéglise annexe Vorkircheéglise à pilastres Wandpfeilerkircheéglise à plan Dreikonchenanlage
trichonque église à tour Chorturmkirche
de chœur église à tribunes Emporenhalleéglise champêtre Feldkapelleéglise conventuelle Klosterkircheéglise de la Trinité Dreifaltigkeits-
kircheéglise de pèlerinage Wallfahrtskircheéglise des ordres Bettelordenkirchen
mendiants église épiscopale Bischofskircheéglise fortifiée Wehrkircheéglise-halle Hallenkircheéglise inférieure Unterkircheéglise paroissiale Pfarrkircheéglise ronde Rundkirche
(é. circulaire) église rupestre Felsenkirche,
Höhlenkircheéglise-salle Saalkircheéglise triabsidiale Dreiapsidenanlageégout Abtraufe, Traufeélément constructif Bauelementélévation Aufrißembase Basementembasement Bankettembassement Basementemblème Emblememboîtement par Anschlitzung
embrèvement (par enfourche- ment, affourche- ment)
emboîtement Spundungembrasure Embrasure, Fenster-
öffnung, Laibung, Schlitzfenster
embrasure de porte Türlaibung
601 Französisch-Deutsch
embrasure en Fensterlaibungtableau
embrèvement Versatzemmortaisement Verzapfungempanon Reitersparren,
Schifterempanon d'arête Gratschifterempanon double Doppelschifterempatture Verzapfungemplacement d'un Bauplatz
bâtiment empoutrerie Balkenlage, Gebälkenceinte Enceinte, Mauer-
ring, Zingelenchevauchure Verblattungenclavage Verzapfungenclos Zaunencoche Kerbschnittencorbellement Auskragung, Erkerencorbellement Fensterbankgesims
de fenêtre endenture Verzahnungendossure Dachkamm, First-
bekrönungendroit Ortenduit Putz, Überzugenduit de finition Feinputzenduit en argile Lehmputzenduit externe Außenputzenduit fouetté Rapputzenfaîteau Dachsattelenfeu Nischengrabenfilade (de pièces) Zimmerfluchtenflure Anschwellungenfourchement Scherwandengobe Engobeenrayure Werksatzenroulement(s), Rollwerk
cartouche à e. enseigne de maison Hausmarkeentablement Gebälk, Hauptge-
sims, Verdachungentablement Fensterverdachung
de fenêtre entaillage d'angle Ecküberblattung
à mi-bois entaille à mi-bois Überblattungentamure Lascheentonnoir Rinneentrait Ankerbalken,
Spannriegel, Zangeentrait de ferme Bundbalkenentrait retroussé Stichbalkenentrait supérieur Kehlbalkenentrecolonne, Säulenweite
entrecolonnement
entrecoux Zwischenwandentre(-)deux Zwischenwandentrée Diele (als Raum)entrelacs Entrelacs, Bandel-
werk, Flechtbandentrepôt Magazinentresol Mezzaninentretoise (Brust-) Riegelentretoises croisées Abkreuzung
au sautoir entrevous Einschlubleisteenveloppe Enveloppeépar(t) Riegelbalkenépaule Schulterépaulement Brüstung,
Epaulementéperon Eisbrecher, Sporn,
Strebepfeilerépi Ähreépi de pignon Giebelähreépistyle Epistelseiteépitaphe Epitaphépîtrier Epistelpultépure Baurißéremitage Eremitageérestier Gratsparrenescalier Treppeescalier à Satteltreppe
crémaillère escalier à giron Reitstiege
rampant escalier à l'anglaise Satteltreppeescalier à pas-de- Reitstiege
mule escalier à repos Podesttreppeescalier à vis Wendeltreppeescalier d'incendie Feuertreppeescalier de secours Feuertreppe,
Nottreppeescalier en Wendeltreppe,
colimaçon Spindeltreppeescalier en vis à Wendelstein
cage ajourée escalier roulant Rolltreppeescaliers extérieurs Außentreppenescalier suspendu freitragende Treppe
à jour central escalier vis Eselstreppe
St. Gilles escape Escapeespace Raumesplanade Esplanadeestrade Beischlag,
Estradeétage Etage, Geschoß,
Stockwerk
Fachglossar 602
étage clair Gadenétage en attique Attikageschoßétage mansardé Dachgeschoßétage principal Hauptgeschoßétaie inclinée Spreizeétalage, fenêtre d'é. Schaufensterétançon Fensterkorbétançonnage Strebewerkétape de Bauabschnitt
construction étrésillon Spreize, Strebeexèdre Exedraexhaussé gestelztexhaussement Stelzungexonarthex Exonarthexextension de villes Stadterweiterungextrados Rücken
façade Fassade, Frontfaçade à Doppelturmfassade,
deux tours Zweiturmfassadefaçade en Schaufassade
trompe-l'œil façade rideau Vorhangfassadeface Front, Haupt (Stirn-
fläche), Abgratungfacette Facette, Abgratungfaïence Fayencefaisanderie Fasaneriefaisceau Faschinefaisceau de Säulenbündel,
colonne(s) Bündelsäulefaisceau de perches Dienstbündelfaîtage Dachstuhlfaîte First, Giebelfaîteau Firstbekrönungfanal de cimetière Totenleuchtefasces Faszienfascine Faschinefassade feinte Blendfassadefassade revêtue Blendfassadefaubourg Vorburgfausse-fenêtre Blendfenster, blin-
des Fensterfausse porte Blendtüre,
Scheintürfausse-voûte Scheingewölbefaux-arc Blendbogen,
Kragbogenfaux-entrait Spitzbalken,
Spannriegelfaux parement Bekleidungfaux-parquet Blindbodenfaux-pignon Blendgiebelfaux-plancher Fehlbodenfenestella Fenestella
fenêtre Fensterfenêtre à croisillons Sprossenfensterfenêtre à l'espagnole Fensterkorbfenêtre à lever Hebefensterfenêtre à Klappfenster
rabattement fenêtre à soufflet Kippfensterfenêtre à tabatière Dachlukefenêtre à traverses Sprossenfensterfenêtre à vitrage Verbundfenster
double fenêtre arquée (Rund-) Bogen-
fensterfenêtre aveugle Blendfensterfenêtre cintrée Bogenfensterfenêtre composée Verbundfensterfenêtre coulissante Schiebefensterfenêtre d'arcade Arkadenfensterfenêtre dormante blindes Fensterfenêtre double Doppelfensterfenêtre (en) acier Stahlfensterfenêtre en corniche Fenstererkerfenêtre en éventail Fächerfensterfenêtre en lancette Lanzettfensterfenêtre en longueur Fensterbandfenêtre en saillie Fenstererker,
Erkerfensterfenêtre jumelée Zwillingsfensterfenêtre rayonnante Katharinenrad
de Sainte-Catherine
fenêtre ronde Rundfensterfenêtres continues Fensterbandfenêtres en bande Fensterbandfenêtre tiercée Drillingsfensterfenêtre tombante Kippfenster
intérieure fenêtre tréflée Kleeblattfensterfenêtre triplet Drillingsfensterfenton Dübelfer en rubans Bandeisenfer feuillard Bandeisenfer spaté Bandeisenferme Bauernhaus, Farm,
Gehöft, Dachbin-der, Dachstuhl
ferme à contre- Sprengwerkfiches
ferme clouée Nagelbinderferme de remplage Leergespärreferme débordante Freigespärreferme en arbalète Hängewerkfermeture à Espagnolette-
espangolette Verschlußferraillage Armierung,
Bewehrung
603 Französisch-Deutsch
ferrure Beschlagferrure en croix Kreuzband
(Beschlag)ferrures Beschlagwerkfeuillage Blattfries, Blatt-
werk, Laubwerkfeuille d'ache Tudorblattfeuille de placage Furnierefeuille lancéolée Blattfeuilles Blattwerkfeuillure Anschlag, Falzfeuillure de Fensteranschlag
fenêtre fiche diagonale Kreuzstockfilet Steg (Kannelierung)filet de mur Mauerlattefilière Dachpfetteflamme Schneußflanc Flankefléau Klemmbalkenflèche Bogenhöhe (Bogen-
stich), Stich(-höhe), (Turm-)Helm, Pfeil
fleuron Giebelblume, Kreuzblume
fondaco Fondacofondations Fundamentfontaine Brunnen, Wasser-
künstefontaine (montante) Springbrunnenformeret, arc-f. Schildbogenfort à étoile Sternschanzefort étoilé Sternschanzeforteresse Festungfortification Befestigungfortification de Abschnittbefesti-
secteur gungfortification de Stadtbefestigung
ville fortin Feldschanzefossé Graben, Halsgrabenfossé de Baugrube
construction fossé de décharge Abzugsgrabenfossé de secteur Abschnittsgrabenfossé détaché Abschnittsgrabenfosse d'orchestre Orchestergrabenfourchette Abweiseblechfourrure Futterfoyer Foyerfrange festonnée Bogenfriesfrise Friesfrise animée Figurenfriesfrise arquée Rundbogenfriesfrise à triglyphe Triglyphenfries
frise de losanges Rautenfriesfrise de palmettes Palmettenfriesfrise dentée Zahnfries, deutsches
Bandfrise en arcatures Kreuzbogenfries
intersectées frise en arceaux Rundbogenfriesfrise en écailles Schuppenfriesfrise en feuilles Blattfriesfrise en panneaux Plattenfriesfront Stirnfrontispice Frontispizfronton Giebel, Supraportefrottoir Reiberfumior, maison Rauchstubenhaus
de f. fusarolle Eierstab, Perlstabfût Leib (Rumpf), Schaft,
Treppenspindelfût creux Lichtspindelfût (de colonne) Rumpf
gabarit (Schweiß-) Lehregaine Ummantelunggalerie Galerie, Laufgang,
Stollengalerie des glaces Spiegelgaleriegalerie des Rois Königsgaleriegalerie haute Empore,Tribünegalerie naine Zwerggaleriegaletas Dachwohnunggalilée Galilaeagarage à étages Parkhausgarde-corps Geländergarde-fou Balustrade,
(balustré) Geländergarde-robe Garderobegargouille Wasserspeiergarniture (Bau-) Beschlaggarniture de Dachdeckung
comble garniture de Bandelwerk
volutesgeôle Kerkergeorgerin Säulenhalsghetto Ghettogigant Gigantgiron Trittstufegirouette Wetterfahnegisement Lager (eines
Werksteines)glacis Glacisglutinant Bindemittelglyptothèque Glyptothekgobelin Wandteppichgodron Pfeife
Fachglossar 604
gond Angelgorge Einziehung, (Hals-)
Grabengothique Perpendicular style
perpendiculaire goudron à oves Eierstabgoujon Dübelgoupille Splint, Stiftgousset Fußstrebe, Knagge,
Aufschieblinggouttière Dachrinne,
Rinneisen, Traufegracht Grachtgradin d'un Absatz
empattement gradins Dreisitzgrainure Gefügegrand-arc Scheidbogengrand cavet Deckenkehlegrande crue Hochwachtgrand magasin Warenhaus
(de vente) grange Grangie, Scheunegrange extérieure Feldscheunegratte-ciel Hochhaus,
Wolkenkratzergrenier Dachboden, Dach-
raum, Kornhaus, Speicher
grès (-cérame) Steinzeuggriffe Eckklauegrille Gittergrille articulée Scherengittergrille de chœur Chorgittergrille de fenêtre Fenstergittergrotte Grottegroupé gekuppeltguérite Schilderhaus,
Auslugerkerguette Bandgueule redressée Kropfleisteguichet Einlaßpforteguimberge Wimperggynécée Gynekeiongypse cristallin Marienglasgypse en fer de Marienglas
lance
habitation indivi- Reihenhausduelle en série
habitation Wohnbauhall d'accueil Hallehalle Markthallehall(e) de réception Hallehalle municipale Stadthallehalles aux draps Gewandhaus
hameau Dorf, Weilerhammam Hammamhampe Stielhangar Hangarharem Haremharpe Verzahnung (beim
Mauerwerk)hauteur d'étage Geschoßhöhe,
Stockwerkshöhehauteur de voûte Gewölbehöhehauteur d'imposte Kämpferhöhehauteur du jour lichte Maße (lichte
Höhe)hauteur sous clef Bogenhöhe (-stich),
Pfeil, Scheitel-,Stichhöhe
haut-relief Hochreliefhémisphère Halbkuppelherse Fallgatterheurtoir Türklopferhippodrome Hippodromhôpital Hospital,
Krankenhaushospice Hospizhôtel Gasthaushôtel de justice Gerichtsgebäudehôtel de la monnaie Münzehôtel de ville Rathaushôtel-Dieu Armenhaushôtellerie Gasthaushotte Rauchfanghourd Hurdehourdage Ausfachunghourdage de Ausstakung
torchis huisserie Fensterstockhutte Hüttehypocauste Hypokaustenhypogée Hypogäumhypostyle Hypostyl
iconostase Ikonostasisimmeuble de Bürohaus
bureaux immeuble Wohnhaus
d'habitation imposte Kämpfer, Oberlichteimposte à Kämpfergesims
ornements incrustration Inkrustrationinfirmerie Infirmarieintarse Intarsiainterrompu gesprengte Deckeintersection Vierung
(de la nef) isométrie Isometrie
605 Französisch-Deutsch
jalousie Jalousiejalousie vénitienne Rolladenjambage Fensterstock,
Gewändejambe Gewändejambe de force Strebejambette Drempel, Fußstre-
be, Gewändejardin Gartenjardin alpin Steingartenjardin anglais englischer Gartenjardin d'hiver Wintergartenjardin français französischer Parkjardin-terrasse Dachgartenjet d'eau Fensterschenkel,
Wetterschenkeljetée Molejoint Fuge, Stoßjoint creux Hohlfugejoint cunéiforme Keilfugejoint d'assise Lagerfuge, Stoßfugejoint (debout) Stehfalzjoint de clé Scheitelfugejoint de Baufuge
construction joint de dilatation Dehnfugejoint de lit Lagerfugejoint de reprise Arbeitsfugejoint de rupture Bruchfugejoint de tassement Setzfugejoint droit gerader Stoßjoint du sommier Anfangsfugejoint montant Stoßfugejoint vertical Stoßfugejonction Anschlußjoue Schartenbackejour d'en haut Oberlichtejour (d'escalier) Treppenaugejubé Lettnerjudas Schlagladen
kiosque KioskKremlin Kreml
labyrinthe Labyrinthlambourde de Fehlbalken
plafond lambrequin Lambrequinlambris Lambrislambrissage Täfelwerk
(en bois) lancis Fenstergewändelandwehr Landwehrlanguette Anschlag, Federlanguette Einschub
d'entrevous
lanterne Laternelanterneau Oberlichtelanterne des morts Totenleuchtelanternon de la Dachreiter
croisée laraire Larariumlargeur lichte Maße
(Innenmaß)larme Kälberzähnelarmier Gurtgesimslas, lassière Banselatrine Abtrittlatte Lattelatte à tuiles Ziegellattelatte de toiture Dachlattelatte double Ziegellattelatte triangulaire Dreikantleistenlaure Lawralavoir Brunnenhauslavra Lawraletteron Lesepultliaison Bindemittel,
Verbandlibrairie Bibliotheklien Band (im Holzbau)lien d'angle Bügelien de base Fußbandlierne Liernelieu Ortlieu de Bauplatz
constructionligne capitale Capitallinieligne d'égout Dachtraufeligne d'imposte Kämpferlinieligne de naissance Anfallinieligne sommitale Scheitellinielimaçon Schneckelimon Wange (einer Treppe)limon d'escalier Treppenwangelinoir Wechsellinsoir Streichbalkenlinteau (Fenster-) Sturzlinteau (de porte) Türsturzlinteau échancré scheitrechter Sturzlinteau sur Kragsturzbogen
coussinets lisière Lisenelisse Holmlisteau (Ornament-) Leistelistel Leistelit Lager (eines
Werksteines)lit d'attente Auflangerlobe Paßlobe lancéolé Blattloge Hütte, Loge
Fachglossar 606
loge maçonnique Bauhüttelogement d'escalier Treppenlochlogement mansardé Dachwohnungloggia Loggialongrine Dachschwellelosange Rautelouver aufkröpfenlucarne faîtière Dachhaube (als
Dachkappe), Dacherker
lucarne Dachfenster, Dach-gaube, Dachluke, Gaube, Lukarne
lunette Bogenfeld, Gewöl-bekappe, Lunette, Ohr, Stichkappe
mâchicoulis Maschikuli, Pech-nase, Senkscharte
machine d'eau Wasserkünstemaçonnerie, Mauerwerk
ouvrage de m.maçonnerie Schichtmauerwerk
appareillée maçonnerie Zyklopenmauer-
cyclopéenne werkmaçonnerie de Trockenmauerwerk
pierres sèches maçonnerie de Hintermauerung
remplissage maçonnerie en Schichtmauerwerk
assises maçonnerie en Verblendmauer-
briques de werkparement
maçonnerie en Gußmauerwerkcoulis
maçonnerie en Werksteinmauer-pierres de taille werk
maçonnerie pleine Vollmauerwerkmaçonnerie Polygonalmauer-
polygonale werkmadrier (Holz-) Bohle, Diele
(Fußbodenbrett)magasin, grand m. Kaufhausmain-courante Handlaufmaison Hausmaison à arcades Laubenhausmaison à atrium Atriumhausmaison à patio Atriumhausmaison à pignon Giebelhausmaison à triplet Dreifensterhausmaison capitulaire Kapitelhausmaison com- Gemeindehaus (für
munale eine Dorfgemeinde)maison commune Zunfthaus
maison d'artisan Handwerkerhausmaison de jardin Gartenhausmaison de rapport Mietshausmaison de retraite Altersheimmaison des mar- Artushof
chands à Dantzig maison de verre Glashausmaison d'habi- Wohnhaus
tationmaison élevée Hochhausmaison en terrasses Terrassenhausmaison natale Geburtshausmaisonnette de Laube
jardin maisonnette de Brunnenhaus
puits maison paroissiale Gemeindehaus (für
eine Kirchen-gemeinde)
maison patricienne Patrizierhausmaison rustique Bauernhausmaison sphérique Kugelhausmaître-autel Choraltar (Hochaltar)maître-chevron Hauptsparrenmaître d'œuvre Baumeistermaître-poutre Dachbalkenmaîtresse-ferme Dachbindermanche Stielmanège couvert Reithallemanière Maniermanoir Manor Housemansarde Mansardemanteau Mantelmanteau de Rauchfang
cheminée maquette Baumodellmarche (Tritt-) Stufemarche balancée gezogene Stufe,
Keilstufe, ver-zogene Stufe
marché couvert Markthallemarche dansante gezogene Stufemarche gironnée gezogene Stufe,
Keilstufe, ver-zogene Stufe
marche massive Blockstufemarche pleine Blockstufe,
Klotzstufemarque de maison Hausmarkemarquet(e)rie Marketeriemarquetage Marketeriemarqueture Marketeriemarquise Markisemarteau de porte Türklopfermartyre Martyriummascaron Maskaron
607 Französisch-Deutsch
masque à feuillage Blattmaskemassif occidental Westbaumât Mastmatroneum Matroneummauresque Maureskemausolée Mausoleumméandre Mäander, laufender
Hundmédaillon Medaillonmédian Mittelrisalitmédressé Medresemégaron Megaronmémorial Ehrenmal,
Memoriameneau vertical Mullion,
Fensterpfostenmeneau vertical Setzholz
de bois menhir Menhirméplat Bandeisen (in der
Schlosserei)merlon Zinnemeta Metamétairie Gehöftmétal déployé Streckmetallméthode de Bauweise
construction métope Metopemeule courante Läufermeurtrière Armbrustscharte,
Bogenschartemezzanine Mezzaninmimbar Mimbarminar Minarmine Minemiséricorde Miserikordiemitre Schornsteinaufsatzmodule Modulmoellon Bruchsteinemoellon d'appareil Hausteinmoise Riegel, Zangemoise inclinée Bügemôle Molemonastère Abtei, Klostermonasterium Doppelkloster
duplex mont Bergmontant Pfosten, Ständer,
Stiel, Drempelmontant de croisée Fensterpfostenmontée Bogenhöhe (Bogen-
stich), Pfeil, Stich(Höhe), Steigung, Treppensteigung
montée (d'escalier) Treppenarmmontée de voûte Stichhöhe
montoir Aufsteigesteinmonument Denkmal, Memoriamonument aux Ehrenmal
victimes de la guerre
monument choregisches chorégique Monument
monument Memorialbaucommémoratif
monument Grabdenkmalfunéraire
monument sépulcral Grabdenkmalmonuments Megalith-Bauten
mégalithiques moraillon à Hakenblatt
amberons moresque Maureskemortier Mörtelmosaïque Mosaikmosquée Moscheemotel Motelmotte Mottemoucharaby Maschikulimouchette Wassernasemoulure Gesims, Kymamoulure au-dessus Arkadengesims
des arcades moulure concave Hohlkehlemoulure de la base Fußgesimsmoulure discoïde Scheibenfriesmoulure en trois Dreiviertelstab
quarts de rond moulure hachée Rollenfriesmouton Bärmulet, mulot Riemchenmur Mauermur à double paroi Hohlmauerwerkmurage coulé Gußmauerwerkmuraillement Mauerwerkmur autoportant freitragende Wandmur bouclier Schildmauermur coupe-feu Brandmauermur crénelé crenelierte Mauermur d'ébrasement Fensterlaibungmur de chemise Futtermauermur de clôture Schildmauermur de pourtour Umfassungsmauernmur de remplage Füllmauermur de Stützmauer
soutènement mur d'enceinte Ringmauermur en hauteur hohe Wandmur en madriers Bohlenwandmur extérieur Umfassungsmauernmur frontal Stirnbrettmur haut hohe Wand
Fachglossar 608
mur pare-feu Brandmauermur portant, Tragmauer
m. porteur mur qibla Qiblawandmurrage Mauerwerkmur-rideau Vorhangfassademurs extérieurs Außenmauernmurs intérieures Innenmauernmusée Museummutule Dielenkopf
naiskos Naiskosnaissance Kämpferlinienaissance d'enduit Faschenaissance d'un fût Anlaufnarthex Narthexnattes Flechtbandnaumachie Naumachienécropole Nekropolenef Schiffnef centrale Hauptschiff,
Langhausnef latérale Seitenschiffnervure Rippenervure à profil Bandrippe
rectangularie nervure de croisée Kreuzrippenervure de Schildrippe
formeret nervure de sommet Scheitelrippenervure diagonale Diagonalrippenervure écotée Astrippenervure médiane Gurtrippeniche Nischeniche feinte Blendnischeniveau Stockwerknœud Knotennombre d'or goldener Schnittnoquet Abweiseblechnoue Dachkehlenoulet Kehlenoulet-chevron Kehlsparrennoviciat Noviziatnoyau (d'escalier) (Treppen-) Spindelnoyau urbain Stadtkernnuraghe Nuragenymphée Nymphaeum
obélisque Obelisk, Spitzsäuleobservatoire Observatoriumoctogone Achteck, Oktogonoculus Okulusœil Augeœil-de-bœuf Ochsenaugeœil de coupole Opäumœil de dôme Opäum
œil d'escalier Treppenaugeœil de volute Schneckenaugeœil du tailloir Abakusblumeœillet Lukeœuvre mussif musivische Arbeitoffice Anrichteogive Kreuzrippeolive (bouton en o.) Oliveombilic Nabelonglet Falz, Gehrungoppidum Oppidumordonnances sur les Bauordnung
constructions ordre colossal Kolossalordnungordre composite Kompositordnungordre corinthien korinthische
Ordnungordre dorique dorische Ordnungordre français französische
Ordnungordre grec griechische
Säulenordnungordre ionien- attisch-ionische
attique Ordnungordre ionique ionische Säulen-
ordnungordre ionique kleinasiatisch-ioni-
d'Asie Mineure sche Ordnungordre romain- römisch-dorische
dorique Ordnungordre romain- römisch-ionische
ionique Ordnungordres Säulenordnungen
d'architectureordres de colonnes Säulenordnungenordre toscan toskanische
Ordnungoreille Ohr, Polsteroreillon Eckzier, Ohroriel Chörleinorientation Orientierung,
Ostungorillon Orillonornement Ornamentornement Bauornament
architectural ornement polylobé Vielpaßorthostate Orthostatorthostate en relief Relieforthostatenossature de croisée Stabwerkossuaire Beinhausouïe Schallöffnungoubliette Verlies, Faulturmouverture Schartenmaul
extérieure ouvrage Werk
609 Französisch-Deutsch
ouvrage à plan Zentralbauouvrage avancé Vorwerk (im
Festungsbau)ouvrage couronné Kronwerkouvrage de Feldschanze
campagne ouvrage extérieur Außenwerkouvrage maçonné Massivbauouvrage profane Profanbauouvrage sépulcral Grabbauouvrant de porte Türblatt
paire de chevrons Bundgespärrepalafitte Pfahlbaupalais Palastpalais impérial Pfalzpalançon Stakenpalanton Wellerholzpalier Austritt, Podestpalier (d'escalier) Treppenabsatzpalissade Palisadenbaupalmarium Palmenhauspalmette Palmettepan Feld, Füllung,
Gefachpaneresse Läuferpanne Dachpfanne,
(Dach-)Pfettepanneau Feld, Füllbrett,
Paneelpanneau Füllung
(de remplissage) panneau de vitre Fensterscheibepanne faîtère Firstpfettepanne inférieure Dachschwelle,
Fußpfettepanne sablière Fußpfettepapier peint Tapeteparadisus Paradiesparaflane Paraflaneparapet Brüstung, Brust-
wehr, Fenster-brüstung
paravent Paraventparc Parkparcelle (de terrain) Parzelleparchemin plié Faltwerkparclose Dockeparement Verblendungpare-neige Schneefangpare-soleil (Sonnen-) Blendeparoi Wandparoi de charpente Bundwandparoi de séparation Scheidewandparoi latérale Sargwand
d'enceinte
parquet Parkettparquet à la Riemchenfußboden
viennoise parquet à listel Riemchenfußbodenparterre Parterrepartie en saillie Erkerpartie inférieure Oberzugpartie saillante Überhangparure Bekleidungpassage Gang, Laufgangpassage à arcade Bogengangpasserelle Steg (kleine Brücke)patio Lichthofpatte Blattzapfen, Klauepatte de base Eckklaue, Eckknollepavage en bois Holzpflasterpavé Estrich, Pflasterpavé en bois Holzpflasterpavillon Gartenhaus, Pavillonpeinturage de Fassadenmalerei
façade peinture à fresque Freskomalereipeinture Architekturmalerei
architecturale peinture à secco Seccomalereipeinture de Deckenmalerei
plafondpeinture murale Wandmalereipeinture sur verre Glasmalereipendant Pendantpendentif Gewölbezwickel,
Pendentifpentagone lobé Fünfblattpentagramme Pentagrammpentaptyque Wandelaltarpente Böschung, (Treppen-)
Steigungpente de toiture Dachneigungperche colonnette Dienstpergola Pergolapériode de Bauperiode
construction péristyle Peristylperron Beischlag, Frei-
treppe, Perronperron de palas Gredeperron d'un Grede
château fort persienne Fensterladen,
Sonnenladenperspective à ras Froschperspektive
de terre perspective à vue Vogelperspektive
d'oiseau perspective centrale Frontalperspektive,
Zentralperspektive
Fachglossar 610
perspective Perspektivespéculative
pétale Blattpetit entrait Kehlbalken,
Kehlstichbalkenphare Leuchtturmpharmacie Apothekepièce Stubepièce d'appui Brustriegelpièce de Füllholz
remplissage pied de chevron Sparrenfußpiédestal Piedestal, Posta-
ment, Ständerpiédouche Sockelpierre à bâtir Bausteinpierre carrée Quaderpierre d'ancrage Ankersteinpierre d'appareil Werksteinpierre de Baustein
construction pierre de coussin Polsterquaderpierre de Abdeckstein
couverture pierre de façonné Hausteinpierre de parement Blendsteinpierre de Verblender
revêtement pierre de taille Haustein,Werksteinpierre façonné Hausteinpierre fonda- Grundstein
mentale pierre rustique Bossenquader,
Buckelquaderpierres brutes Bruchsteinepierres d'attente Zahnsteinepignon Giebelpignon à volutes Volutengiebelpignon décor(atif) Ziergiebelpignon en Staffelgiebel,
gradin(s) Treppengiebelpignon en Staffelgiebel,
redan(s) Treppengiebelpignon redenté Staffelgiebelpilastre Pfeilervorlage,
Pilaster, Säulen-vorlage, Wandpfeiler
pilastre d'angle Eckpilasterpilastre double Doppelpilasterpile Pfeilerpilier Pfeilerpilier circulaire Rundpfeiler
(p. rond) pilier d'arc- eingezogene Strebe
boutant
pilier de la croisée Vierungspfeilerpilier en faisceau Bündelpfeilerpilier en forme Kreuzpfeiler
de croix pilier osirique Osirispfeilerpilori Staupsäulepinacle Pinakelpipe Pfeifepivot Angelpivot central Hahnebaum,
Helmstangeplacage Furniereplace Ort, Platzplace du marché Marktplatzplafond Deckeplafond à caissons Felderdeckeplafond à listel Riemchendeckeplafond bordé de Spiegeldecke
moulures plafond en arc de Spiegeldecke
cloître plafond en poutre Holzbalkendecke
caisson plafond Rabitz Rabitz-
gewölbe, Rabitzdecke
plafonnage Deckenschalungplafonnage du toit Dachschalung
(innen)plan basilical gebundenes Systemplanche Brett, Diele (Fußbo-
denbrett), Fuß-boden
planche d'appui Fensterbrettplanche Gerüstbretter
d'échafaudage planche de rive Stirnbrett,
Windbrettplanchéiage de Dachschalung
comble (außen)plancher à hourdis Hourdideckeplancher à nervures Rippendeckeplancher- Pilzdecke
champignon plancher de Plattendecke
poutres plancher de Plattenbalkendecke
poutres en T plancher en dalles Plattendeckeplancher en Bohlendecke
madriers plancher Massivdecke
ininflammable plancher-terrasse Terrassendachplan de Bauplan
construction
611 Französisch-Deutsch
plan de situation Lageplanplanétarium Planetariumplan horizontal Grundrißplan idéal Idealplanplan perspectif Rißplaque de plafond Deckenplatteplate-bande Friesplate-forme Bühne, Söllerplein cintre, Rundbogen
arc en p. c.plinthe Fußleiste, Plinthe,
Sockelleistepoignée Klinkepoinçon Hahnebaum,
Stuhlsäulepoinçon (de faîte) Firstsäule,
Spitzsäulepoinçon rampant Sturmlattepoint Nasepoint d'appui Anfallspunktpointe de diamante Nagelkopfpoirtail Sturzriegelpolisson Stakenpolychromie Polychromiepomme Turmknopfpomme de pin Pinienzapfenpont Brückepont de bateaux Pontonbrückepont de pontons Pontonbrückepont-levis Zugbrückeporche Torhalleportail Portal, Torportail à colonnes Säulenportalportail central Hauptportalportail en stalactites Stalaktitenportalportail latéral Seitenportalporte Tür, Tor, Pforteporte à lever Hebetürporte à panneaux Rahmen- und
Füllungstürporte à tambour Drehtürporte battante Pendeltürporte coulissante Schiebetürporte de la victoire Siegestorporte de la ville Stadttorporte de mariage Brauttürporte dérobée Tapetentürporte d'honneur Ehrentorportée Spannweiteporte en accordéon Falttür
(pliante) porte en acier Stahltürporte feinte Blendtüre, Scheintürporte-fenêtre Fenstertürporte oscillante Pendeltür,
Schwingflügeltür
porte recouverte Tapetentürde tapisserie
porte tournante Drehtürporte va-et-vient Pendeltür,
Schwingflügeltürporte vitrée Glastürportière Portièreportillon Pforteportique Portikus,
Säulenhalleportique à colonnes Säulenportikusportique voûte Bogengangpositionneur (Schweiß-) Lehreposte Pfostenpoteau Mast, Pfosten, Stän-
der, Stiel, Stützepoteau de fenêtre Fensterstockpoteau de fond Firstständerpoteau d'huisserie Fensterpfostenpoteau principal Bundständer,
Hauptpfostenpoterne Ausfalltorpoterne de secours Mannsloch, Poternepoussée Schubpoussée latérale Horizontalschub, (horizontale) Seitenschubpoussée oblique Seitenschubpoutrage Balkenlage, Gebälkpoutraison Balkenlage, Gebälkpoutre Balken, Träger,
Unterzugpoutre à treillis Fachwerkbinder
(Fachwerkträger)poutre continue Durchlaufträgerpoutre de bordure Streichbalkenpoutre de décharge Entlastungsträgerpoutre de hotte Rauchfangholzpoutre de pignon Giebelbalken,
Ortbalkenpoutre de rive Streichbalkenpoutre de Klemmbalken
verrouillage poutre droite Type Howeträger
How poutre en blocs Steinbalkenpoutre en corps Steinbalkenpoutre en porte Kragbalken,
à faux Kragträgerpoutre en T T-Trägerpoutre en treillis Gitterträgerpoutre faîtière Gratbalkenpoutre gemelle Doppel-T-Trägerpoutre inférieure Unterzugpoutre laminé Profilträgerpoutrelle Trägerpoutre maîtresse Hauptbalken
Fachglossar 612
poutre principale Hauptbalkenpoutre profilé Profilträgerprédelle Altarstaffel, Predellaprédormant Zargepréfabrication Vorfertigungprélature Prälaturpremier arc Stirnbogenprieuré Propsteipriorat Prioratprofil Profilprojection Projektionprojection à cotes kotierte Projektionprojection Axonometrie,axonométrique Militärrißprojection de toit Dachausmittlungprojection Normalprojektion
générale projection latérale Seitenrißproportion Proportionpropylée Torbauproscenium Proszeniumprothèse Prothesispuits Brunnen, Schachtpuits à poulie Ziehbrunnenpuits à roue Ziehbrunnenpulvinus Pulvinuspupitre Lesepultpylône Mast, Torbaupyramide Pyramidepyramide à gradins Stufenpyramide,
Stufenmastabapyramidon Riese
quadrature Quadraturquadrilobe Vierblatt, Vierpaßquart de rond, Viertelstab
baguette q. de r. quatre-feuille(s) Vierblattqueue d'aronde Schwalbenschwanzqueue de vache Sturmlatte,
Windrispequille Holmquintefeuille Fünfblatt, Fünfpaß
racinal de comble Dachschwelleradial Radialrainure Nutrameaux Astwerkrampe carrossable Eselstrepperampe (d'accès) Ramperampe en vis Wendelramperampe extérieure Außenramperampe helicoïdale Wendelramperang de feuilleté Blattstabrangée d'ardoises Gebinde
(Schieferdach)
rangée de Zahnschnittdenticules
rapport Rapportravelin Ravelinrayère Lichtschachtrayon Rayonrayonnant Rayonnantrayure Werksatzrebord de fenêtre Fensterbankrecoupement Überschneidung,
Verkröpfungrecouvrement Überzugredan Redan, Verzahnung
(beim Mauerwerk)redent Absatzredents Schweifwerkredoute Redouteréduction Verjüngungréfectoire Refektorium,
Remterrefend Randschlagreins de voûte Gewölbezwickelrejet d'eau Wasserschlagrelief Reliefremblai Abdachungremenée Entlastungsbogenremise Remise, Schuppenrempart Rempart, Stadtmau-
er, Wall, Zingelrempart de secteur Abschnittswallremparts extérieurs Außenmauernremplage aveugle Blendmaßwerkremplage simulé Blendmaßwerkremploi Spolierenard Blendfassaderenflement Anschwellungrepli Falzrepos Podestréseau Maßwerkrésidence Ansitzressort Federrestaurant Gaststätteretable (Altar-) Retabelretable à volets Flügelaltarretirade Retiraderetombée de l'arc Bogenanfallretranchement Schanzeretroussé Kehlstichbalkenrevers d'eau Wasserschenkelreverseau Fenster-, Wasser-,
Wetterschenkelrevêtement Bekleidung,
Ummantelung, Verblendung
revêtement des Wandbekleidungmurs
613 Französisch-Deutsch
rez-de-chaussée Erdgeschoß, Parterre
rez-de-chaussée Hochparterresurélevé
rhombe Rauterideau de pierre Schleierwerkrigole de pavé Gosserinceau Blattfries, Blatt-
werk, Laubwerkrive Ortgangrive de pignon Ortgangrive de toiture Ortgangrocaillage Muschelwerkrocaille Rocaille,
Muschelwerkroche erratique FeldsteinRoland, statue Roland
de R.rond de verre Butzenscheibenrondelle Rondellrosace Roserose Roserose de fenêtre Fensterroserose du bras Radfensterrose du tailloir Abakusblumerosette Roserotonde Rotunderoue de Sainte- Katharinenrad,
Cathérine Radfensterrue en escalier Treppenstraßeruelle Schlipperuine Ruineruisseau de rue Gosserustique Rustikarythme Rhythmus
sablière (Grund-) Schwellesablière d'étage Bundbalken,
Stockschwellesablière supérieure Rähmsabot (Eisen-) Schuhsacraire Sakristeisacristie SakristeiSaint-Sépulcre Heiliges Grabsalle Saalsalle à colonnes Säulensaalsalle capitulaire Kapitelsaalsalle de bal Ballhaussalle de danse Tanzhaussalle de dresse Anrichtesalle de réception Empfangszimmersalle des pas per- Wandelhalle
dus, promenoir salle (d'un palais) Gemachsalle égyptienne ägyptischer Saalsalle hypostyle Säulenhalle
salle transversale Quersaalsalle triabsidiale Dreiapsidensaalsalon Salonsanctuaire Allerheiligstes,
Sanktuariumsape Sappesarcophage Sarkophagsarrasine Fallgattersavon Riemchenscène Bühnescène tournante Drehbühnesculpture Skulptursculpture Bauplastik
architecturalesecond entrait Kehlbalkensection d'or goldener Schnittsemelle Dachschwelle,
Sattelholzsentinelle Sentinellesépulture Sepultursérail Serailserre Gewächshaus,
Glashausserrure Schloßserviette repliée Faltwerkseuil Schwelleseuil (de porte) Türschwellesgraffite Sgraffitosiège Ansitzsiège de la Zunfthaus
corporation signature de Meisterzeichen
contremaître signe lapidaire Steinmetzzeichensigne maçonique Steinmetzzeichensocle Sockelsoffite Sofittesol Fußbodensolaire Solariumsol en briques Ziegelbodensolitude Solitudesolive Balkensolive de comble Dachbalkensolivure Balkenlagesol planchéié Dielenfußbodensommet Scheitelsommier Anfangsstein,
Kämpferstein, (Tür-)Sturz
sommier de porte Türsturzsortie de Ausfalltor
contreattaque soubassement Basementsoufflet Souffletsouillard Eisbrechersoupente Dach-, Hängeboden
Fachglossar 614
sous-faîte Giebelsäulesous-longeron Sattelholzsous-moulure Untergliedsous-poutre Unterzugspirale Spiralestade Stadionstalles du chœur Chorgestühlstation de poste Posthofstatique Statikstavkirke Stabkirchestèle Stelestéréobate Stereobatstéréotomie Steinschnittstrotére Dreisitzstructure de forme Faltwerk
prismatiquestructure spatiale räumliches
Tragwerkstructure tridi- räumliches
mensionnelle Tragwerkstuc Stuckstucage Stuckaturstucco lustro Stucco lustrostudiolo Studiolostupa Stupastyle Stilstyle flamboyant Flamboyantstyliser stilisierensubstruction Substruktionsuperstructure Hochbausupport Auflager, Mast,
Stützesupport d'enduit Putzträgersurélevé gestelztsurface d'appui Auflagersurface d'enduit Putzhautsurface extérieure Haupt (Stirnfläche)surface porteuse Flächentragwerksurface vitrée Fensterflächesurplomb Überhangsymétrie Symmetriesynagogue Synagogesystème de Pavillonsystem
pavillons système de toit Dachkonstruktionsystème Hippodamisches
hippodamique Systemsystème lié (roman) gebundenes Systemsystème polygonal Polygonalsystem
tabatière Schleppgaubetabernacle Sakramentshaus,
Tabernakeltableau de porte Türlaibungtablette de fenêtre Brüstungsgesimstablette de poutre Balkenkopf
tabletterie Täfelwerktaille de pierres Steinschnitttaille, exécution Steinbearbeitung
de la t. talayot(s) Talayotentalus Abdachung,
Böschungtambour Tambour, Trommeltambour de Säulentrommel
colonnes tambour (de porte) Windfangtapisserie Wandteppichtas de charge Auflangertasseau d'arêtier Gratleistetectonique Tektoniktemple à antes Antentempeltemple à podium Podiumstempeltemple circulaire Rundtempel
(t. rond) temple de feu Feuertempeltemple de vallée Taltempeltemple d'Hathor Hathortempeltemple double Doppeltempeltemple en terrasses Terrassentempeltemple hypêtre Hypethraltempeltemple monoptère Monopterostenaille Tenailletenaillon Tenaillontendelet Sonnensegeltenon Stift, Zapfentenon à chasse Jagdzapfententure Tapete (aus Stoff)terrasse Terrasseterrazzo Terrazzotête Kopftête bouchon Knauftête conjuratoire Nagelkopf,
Neidkopftête de bélier Aaskopftête de bœuf Aaskopftête de clou Nagelkopftête de pont Brückenkopftexture Gefügethéâtre Theaterbauthéorie Architekturtheorie
architecturale thermes Thermentierce-feuille Dreiblatttierceron Tiercerontimbre Helmtirant (d'arc) Zuganker,
Bogenankertoilettes Klosetttoit Dachtoit à chevrons Sparrendachtoit à coupole Kuppeldach
615 Französisch-Deutsch
toit à croupe Krüppelwalmdachboiteuse
toit à demi-croupe Krüppelwalmdachtoit adossé Pultdachtoit à l'impériale welsche Haubetoit à pignon Giebeldachtoit avancé Abdachtoit cintré Bogendachtoit couronné Kronendach,
Ritterdachtoit en appentis Schleppdachtoit en bardeaux Schindeldachtoit en bâtière Satteldachtoit en cavalier Kronendach,
Ritterdachtoit en ciseaux Scherendachtoit en cloche Glockendachtoit en coupole Dachhaubetoit en demicroupe Halbwalmdachtoit en dent de scie Sägedachtoit en Kragdach
encorbellement toit en oignon Zwiebeldachtoit en pannes Pfannendachtoit en porte à faux Kragdachtoit en saillie Kragdachtoit en verre Glasdachtoit parallèle Paralleldachtoit plat Flachdachtoit pyramidal Pyramidendachtoit shed Sheddachtoit suspendu Hängedachtoit suspendu à Seildach
câbles toit-terrasse Terrassendach,
Dachterrassetoit transversal Querdach,
Zwerchdachtoiture Dachdeckung,
Dachhauttoiture en ardoises Schieferdachtoiture en tuiles Mönch- und
mâles et femelles Nonnendachtoit vitré Glasdachtoit-voûte Tonnendachtolet Dollentombe Grufttombeau Grufttombeaux creusés Felsengrab
dans le roc tonnelle Gartenlaube,
Tonnengewölbetonnelle helicoïdale Schneckengewölbetonsure Tonsurtorsion Torsiontour Turm
tour à hélicoïdiale Spiralturmtour à rampe Spiralturmtour à rampe Eselsturm
carrossable tour de chat Schlippetour de chœur Chorturmtour de défense Wehrturmtour de façade Fassadenturmtour de guet Scharwachturm,
Wachturm,Wartturm
tour de pont Brückenturmtour d'escalier Treppenturmtour de télévision Fernsehturmtour de transept Querhausturmtour d'habitation Wohnturmtour du transept Vierungsturmtourelle Geschützturm,
Treppenturmtour en saillie Erkertürmchentourillon Treppenturmtourniquet intérieur Einreiber-Verschlußtour-porte Torturmtracé Tracétracé général Lageplantracé géométrique Maßwerktrame Rastertranche de travaux Bauabschnitttranchée Grabentransept Querhaus, Transepttransept occidental Westquerhaustrappe Falladen, Falltürtrappe d'oubliette Angstlochtravail des pierres Steinbearbeitungtravail mussif musivische Arbeittravée Jochtravée romaine Säulenbogenstellungtraverse Riegelbalken,
Traversetraverse de fenêtre Kämpferholztravon Holmtrèfle Dreiblatt, Dreipaßtrèfle flamboyant Dreischneußtreillage Gattertreillis Fenstergitter,
Flechtband, Gatter, Gitter
treillis triangulaire Dreieckverbandtrésor, trésorerie Schatzhaustriangle sphérique sphärisches Dreiecktriangulation Triangulationtrianon Trianontribunal Gerichtsgebäude,
Tribunaltribunal d'église Apsistribune Empore, Tribüne
Fachglossar 616
tribune aveugle Scheinemporetribune de Nonnenempore
religieuse tribune d'orgue Orgelemporetribune simulée Scheinemporetrifoire Triforiumtriforium Triforiumtriforium aveugle Blendtriforium,
Scheintriforiumtriforium simulé Scheintriforiumtriglyphe Dreischlitz,
Triglyphetrilobe Dreipaßtrilobé Kleeblattbogentriplet d'arc trompe Drillingsbogen
(d'une Trompe voûte)
tronc Schafttrophée Trophäetrou d'homme Mannslochtrumeau Trumeautuile Dachsteine, Ziegeltuile à bord Kremper
retroussé tuile à crochet Biberschwanztuile à onglet Falzziegeltuile creuse Hohlziegeltuile cuite plate Dachplattetuile de crête Kammziegeltuile de pignon Ortziegeltuile de rive Ortziegeltuile (émaillé) Glasziegel
de verre tuile en auge Falzziegeltuile en faîteau Firstziegeltuile en forme Dachpfanne
de S couché tuile en oreille Kaffziegel
de chat tuile faîtière Firstziegel,
Gratziegeltuile femelle Nonnetuile mâle Klosterziegeltuile plate Biberschwanz, Plat-
ten-, Flachziegeltumulus Tumulustuyau fendu Rinneisentympan Bogenfeld, Giebel-
feld, Tympanon
urbanisme Städtebau
vade in pace Faulturmvaisseau centrale Langhausvalet Angelvalvule Falltür
vedute Vedutevélum (Sonnen-) Zeltdachvéranda Verandaverrou de fenêtre Fensterverschlußvertex Scheitelvessie de poisson Fischblasevestiaire Garderobevestibule Hausflur, Vestibül,
Vorhalleviaduc Viaduktvide Lichtevillage Dorfville Stadtville idéale Idealstadtville radiale Radialstadtville satellite Trabantenstadtvitrage clair Blankverglasungvitrage en plomb Bleiverglasungvitrine Schaukastenvoie de ceinture Ringstraßevoile mince Schalevolée (d'escalier) (Treppen-) Laufvolet Fensterladen, Ladenvolet à coulisse Schiebeladenvolet pliant Klappladen,
Schlagladenvolet roulant Rolladenvolume construit umbauter Raumvolute Schnecke, Volutevousseau de départ Anwölbervoussoir Wölbsteinvoussoir de départ Gewölbeanfänger
d'une voûte voussoir de départ Anwölbervoussoirs Bogensteinevoûte Gewölbe, Voutevoûte à croisée Kreuzrippen-
d'ogives gewölbevoûte à nappes Platzelgewölbevoûte à nervures Rippengewölbevoûte à nervures Fächergewölbe,
rayonnantes Strahlengewölbevoûte anglo- Trichtergewölbe
saxonne voûte annulaire Ringgewölbe,
Spindelgewölbevoûte à trompe Muldengewölbevoûte bohémienne böhmische Kappe,
plate Platzelgewölbevoûte cloisonnée Klostergewölbevoûte conique Trichtergewölbevoûte coulée Gußgewölbevoûte croisée Kreuzgewölbevoûte d'arêtes Gratgewölbe,
Kreuz(grat)-gewölbe
617 Französisch-Deutsch
Fachglossar 618
voûte décor(ative) Ziergewölbevoûte de remplage Maßwerkgewölbevoûte domicale Domikalgewölbevoûte double Doppelgewölbevoûte en arc Klostergewölbe
de cloître voûte en baquet Muldengewölbevoûte en berceau Tonnengewölbevoûte en conche Muschelgewölbevoûte en coupole Rippenkuppelvoûte en dôme Rippenkuppelvoûte en Rippenkuppel
domiciale voûte en ellipse elliptisches Gewölbevoûte en étoile Sterngewölbevoûte en éventail Fächergewölbevoûte en forme Schirmgewölbe,
de parasol Segelgewölbevoûte en limaçon Schneckengewölbevoûte en poterie(s) Topfgewölbe
creuse(s) voûte en stalactites Stalaktitengewölbevoûte hexagonale sechsteiliges
Gewölbe
voûte montante ansteigender Bogenvoûte normande Trichtergewölbevoûte ornamentale Ziergewölbevoûte ornée de figurierter Verband
figuresvoûte palmiforme Palmengewölbevoûte perpen- Perpendiculär-
diculaire gewölbevoûte Rabitz Rabitzgewölbevoûte rampante ansteigender Bogenvoûte réticulée Netzgewölbe,
Rautengewölbevoûte sur le noyau Spindelgewölbevoûte transversal Quertonnevoûtin à la preußische Kappe
prussienne vue Dachfenstervue faîtière Dacherker
water-closet Klosett
zigzag Zahnfries
abaco Abakusabaton Abatonabazia, abbazia Abteiabbaino Dachfenster, Gaubeabbaino a casetta Dachhäuschenabbaino a cuffia Fledermausdach-
fensterabbaino a veranda Dacherkerabbaino ricurvo Fledermausdach-
fensterabside Apsis, Chornischeabside del transetto Querhausapsideabsidiola Apsidioleacanto Akanthusaccantonato kantoniertaccoppiato gekuppeltaccrescimento Anschwellunga corpo di zweibündig
fabbrica triplo acquedotto Aquäduktacropoli Akropolisacroterio Akroteraddentellato Zahnsteine
(Verzahnung)adito Abaton (Adyton)adobe Adobeaeroporto Flughafenaffresco Freskomalereiaggetto Überhangaggraffatura Falz (in der
Klempnerei)agorà Agoraagrafe Agraffeaia Tenneaiuola circolare Rondell (Rundbeet)ala Flanschen, Flügel
(Baukörper)alae Alaeala laterale Seitenflügelalbergo Herbergealburno Splint (Holz zwi-
schen Kernholz undRinde)
alcazar Alcazaralcova Alkovenaletta del piliere (junger) Dienstallacciamento Verankerungallineamento (Bau-) Flucht
(edilizio) altana Altan, Sölleraltare Altaraltare a blocco Blockaltaraltare a cofano Kastenaltaraltare a mensa Tischaltar
altare a sarcofago Sarkophagaltaraltare davanti al Laienaltar
tramezzo altare laterale Seitenaltaraltare maggiore Choraltar,
Hauptaltaraltare-pulpito Kanzelaltaralternanza dei Stützenwechsel
supporti altezza d'imposta Kämpferhöhealtezza in chiave Scheitelhöhealtorilievo Hochreliefalzata Setzstufealzata di legno Blindstufeambito Ambitusambone Amboambulacro Ambulacrum,
Umgangammorsatura Zahnsteineampliamento Stadterweiterung
urbano ancona ad ante Flügelaltarancoraggio Verankerungandrone Andronandronitis Andronitisanello Schaftring
(della colonna) anello nel fusto di Wirtel
una colonnaanfiprostilo Amphiprostylosanfitalamo Amphithalamusanfiteatro Amphitheateranima Spindel (einer
Wendeltreppe)anima (della scala Treppenspindel
a chiocciola) anima (della trave) Steg (eines
Profilträgers)annesso Annexanta Ante, Flügel (bei
Türen, Fenstern, Altären)
antefissa Stirnziegel, Antefixantemio Anthemionantemurale Vormauerantependium Antependium,
Frontaleantigabinetto Antikabinettanuli Anuliapadana Apadanaapertura della Fensteröffnung
finestra apertura della Angstloch
segreta
619 Italienisch-Deutsch
ITALIENISCH-DEUTSCH
apice Scheitelapoditerio Apodyteriumapofige Apophygeapothesis Apothesisapparecchio Appareil,Verbandappartamento Appartementappartamento del Dachwohnung
sottotetto appoggio Auflagerapside Apsis, Chornischearabesco Arabeskearabesco moresco Maureskearazzo Wandteppicharca Archearcareccio Pfette, Dachpfettearcareccio inferiore Fußpfettearcata Arkade, Arkaden-
bögenarcata cieca Blendarkadearcata doppia Doppelarkadearcata finta Blendarkadearcate Arkaturarchitetto Architekt,
Baumeisterarchitettonica Architektonikarchitettura Baukunst,
Architekturarchitettura dipinta Architekturmalereiarchitettura finta Scheinarchitekturarchitettura sacra Sakralbauarchitettura Scheinarchitektur
trompe-l'œil architravato architraviertarchitravatura Balkenlagearchitrave Sturz, Architravarchitrave del Rauchfangholz
camino architrave della Fenstersturz
finestra architrave della Türsturz
porta architrave Sturzriegel
(di legno) architrave Steinbalken
(di pietra)archivolto Archivoltearco Bogenarco a cerniere Gelenkbogenarco a chiglia Kielbogenarco a controcurve Sternbogenarco a ferro di Hufeisenbogen
cavallo arco a schiena Eselsrücken
d'asino arco (a sesto) Spitzbogen
acuto
arco a sesto Sattelbogeninflesso
arco a sesto Stelzbogenrialzato
arco (a sesto) Segmentbogen,ribassato Flachbogen,
Stichbogenarco a spalla Schulterbogenarco a tenda Vorhangbogenarco a tre cerniere Dreigelenkbogenarco a trifoglio Kleeblattbogenarco a tutto sesto Rundbogenarco bizantino Stelzbogenarco cieco Blendbogenarco con archivolto Faszienbogen
a fascia arco del coro Chorbogenarco della finestra Fensterbogen (oberer
Abschluß eines Bogenfensters)
arco di scarico Entlastungsbogenarco di trionfo Triumphbogenarco diagonale Diagonalbogen,
Kreuzbogenarco d'incrocio Gratbogen
delle volte arco d'interse- Raumbogen
zione all'incrocio fra volte
arco ellittico Ellipsenbogenarco estradossato Obergurt,
di una volta Überfangbogenarco finto Blendbogenarco fittizio Kragbogenarco frontale Stirnbogenarco intradossato Untergurt
di una volta arco laterale Scheidbogenarcone laterale Schildbogenarcone transversale Quergurt,
Gurtbogenarco ogivale Spitzbogenarco parabolico Parabelbogenarco perimetrale Schildbogenarco polilobato Vielpaßbogen,
Zackenbogenarco polilobo Fächerbogenarco rampante Strebebogen,
Schwibbogen, steigender Bogen
arco rampante Maßwerkbrückeornato a traforo
arco ribassato (di Sturzbogenporta o di finestra)
arco rovescio Erdbogen, Grundbogen
Fachglossar 620
arco saraceno Sarazenenbogenarco scemo Flachbogenarcosolio Arcosoliumarco sopralzato Stelzbogenarco trasversale Transversalbogenarco trilobato Kleeblattbogenarco trionfale Triumphbogenarco triplo Drillingsbogenarco Tudor Tudorbogenarea delimitata dalla Bering
cinta muraria area fabbricativa Bauplatzarea sacra Tempelbezirkarena Arenaareostilo Aräostylosargine Staudammarmadio Armariumarmatura Armierung,
Bewehrungarmatura anulare Ringankerarmatura del tetto Dachkonstruktionarmatura (per Moniereisen,
calcestruzzo) Moniergewebearsenale Arsenal, Zeughausartesonado Artesonadoarticolazione di Wandgliederung
una parete asclepieo Asklepeiona sesto rialzato gestelzta spina di pesce Acoltelloasse Achseasse della finestra Fensterachseasse della volta Gewölbeachseasse di frontone Ortgangassito Blindboden,
Dielenfußbodenassito inferiore Einschubassito inferiore del Fehlboden
solaio assonometria Axonometrieassonometria Kavalierriß
cavaliera assonometria Schrägriß
cavaliera frontaleassonometria Militärriß
cavaliera militare assottigliamento Unterschneidungasta Stabastilo Astylosastragalo Astragalatettonico atektonischatlante Atlantatrio Foyer (allg.), Diele,
Vorhalle, Atriumattico Attikaauditorio Auditorium
augnatura Versatzaula triabsidata Dreiapsidensaalautogrill Rasthausautosilo Parkhausavancorpo Risalitavancorpo a lato Auslucht
dell'ingresso avancorpo Mittelrisalit
centrale avancorpo laterale Seitenrisalitavanguardia Avantgardeaviorimessa Hangarazulejo Azulejos
badia Badiabague Bundbalaustrata Balustradebalaustro Balusterbalcone Balkonbaldacchino Baldachinbaldacchino del Schalldeckel
pulpito balestriera Ballistarium
cruciforme baluardo Baluarde, Bollwerkbaluardo Schalenturm
semicircolare bamboccio sul divi- Docke
sorio degli stalli banchina di gronda Dachschwellebandella Fensterband (Teil
des Beschlages), Band (-eisen)
bandella a croce Kreuzbandbanderuola Wetterfahnebaracca Barackebarocca a volute Bandelwerkbarricata Barrikadebarulla Fundamentbogenbasamento Basement,
Postamentbase Basisbase attica attische Basisbasilica Basilikabasilica a gradoni Staffelbasilikabasilica con Kuppelbasilika (mit
cupola Kuppel über der Vierung)
basilica con Emporenbasilikamatronei
basilica con navata Kuppelbasilika (mita cupole einer Folge von
Kuppeln)bassorilievo Bas-, Flachreliefbastide Vorwerk (Außen-
werk)
621 Italienisch-Deutsch
bastiglia Bastillebastione circolare Rondell (als
Bauwerk)bastione Bastion, Bollwerk,
Basteibastita Festungbattaglio Türklopferbattente Flügel (bei Türen,
Fenstern, Altären)battente della Fensterflügel
finestra battente di porta Blattbattente di una Türblatt
porta batteria Batteriebattiscopa Sockelleiste,
Fußleistebattistero Baptisteriumbattuta Anschlag (bei Türen
und Fenstern), Falz (in der Tischlerei)
battuto Lehmtennebay window a Erkertürmchen
torretta bay-window Auslugerker
d'angolo beccatello Knagge, Kragstein,
Kraftsteinbeffroi Belfriedbeghinaggio Beginenhofbelfredo Bergfriedbelvedere Bellevue, Belvederebema Bema, Hieratikonberma Bermebersò Tonnengewölbebertesca Schießerker,
Pechnasebiblioteca Bibliothekbiella Pendelstützebifora Zwillingsfensterbinato gekuppeltbisellare abfasenbisello Fase, Schmiegeblocco Baublockblocco forato Hohlblocksteinbocca della feritoia Schartenmaulbocciardatura stocken (kröneln)boiserie Täfelwerkbolzone Splint (Flacheisen),
Ankersplintbordo del concio Randschlagbordo intrecciato Flechtbandborni Zahnsteine (vor-
springende Steine einer Verzahnung)
borsa Börse
boschetto Boskettbotola Falltürboudoir Boudoirboulevard Boulevardbovindo Erkerbozza Bosse (nicht vollendete
Bildhauer oder Steinmetzenarbeit)
braccio del Querhausarm,transetto Kreuzarme
braga Schildmauerbreccia Breschebriglia di Spannriegel
collegamentobucranio (fregio a) Ochsenschädel, Bu-
kranion, Aaskopfbugna Bosse (an
Werksteinen)bugna a cuscino Polsterquaderbugna arrotondata Polsterquaderbugnare bossierenbugna rustica Bossenquader,
Buckelquaderbugnato a punta Diamantquader
di diamante bugnatura Bogenquaderung
(dell'arco) buleuterio Buleuterionbungalow Bungalowbunker Bunkerburgus Burgus
caditoia Pechnase, Senkscharte
calato Kalathoscalcestruzzo Betoncalcestruzzo armato Stahlbetoncalcestruzzo faccia Sichtbeton
a vista calcina Mörtelcalettamento Verzapfungcalettatura Zapfen, Verzapfungcalidario Caldariumcalotta Kalottecalotta sferica Kugelkappecamarin Camarincamera Kammer, Stube,
Gemachcamino Kamin, Schornstein,
Essecamino di Abzugskamin
ventilazione camminata Kemenatecammino di ronda Wehrgangcampanile Glockenturmcampanile a vela Glockengiebel
Fachglossar 622
campata Jochcampata del coro Chorjochcampata di volta Gewölbefeldcampidoglio Kapitolcampione (Muster-) Lehrecampo del torneo Turnierhofcamposanto Friedhofcampo trincerato Camp retranchécanale di gronda Dachrinnecanale di scolo Rinnecanaletta di scarico Ablaufrinnecancellata del coro Chorgittercancelli d'altare Altarschrankencancorrente laufender Hundcandelabro Kandelabercanefora Kanephorecannoniera Embrasurecantiere Baustellecantiere edile Bauhofcantina Kellercantinella Lattecantonale Gratsparrencantoria Orgelempore,
Sängerbühnecapitello Kapitellcapitello a calice Kelchkapitellcapitello a cesto Korbkapitellcapitello a fiore Blütenkapitellcapitello a fogliame Blattkapitellcapitello a fungo Pilzkapitellcapitello a ganci Knospenkapitellcapitello a stalattiti Stalaktitenkapitellcapitello a uncini Knospenkapitellcapitello a volute Volutenkapitellcapitello bizantino Trapezkapitellcapitello composit Kompositkapitellcapitello cubico Würfelkapitellcapitello dell'anta Antenkapitellcapitello dorico dorisches Kapitellcapitello eolico äolisches Kapitellcapitello figurato Adlerkapitell
con aquile capitello istoriato Figurenkapitellcapitello rudentato Pfeifenkapitellcapitello scanalato Doppelwürfel-
kapitellcapitolo Kapitelhauscapo Kopfcapo chiave Splint (Flacheisen)cappa del camino Rauchfangcappella Kapellecappella absidale Chorkapellecappella ad ambi- Doppelkapelle
enti sovrapposti cappella Beichtkapelle
confessionale
cappella del Kaminaufsatzcamino
cappella del Burgkapelle,castello Schloßkapelle
cappella della Marienkapellemadonna
cappella della MarienkapelleVergine
cappella Beinhaus, Karnerdell'ossario
cappella del Beinhaus, Karnersacramento
cappella domestica Hauskapellecappella funeraria Grabkapellecappella mortuaria Grabkapellecappella palatina Palastkapellecappella Bußkapelle
penitenziale cappella privata Hauskapellecappella sepolcrale Grabkapellecappella su ponte Brückenkapellecappelle orientali Zwillingskapellecapriata del Hängewerk, Dach-
transetto binder, Gebindecapriata campione Lehrgespärre (als
Muster)capriata composta Binder (beim
principale Dachwerk)capriata maestra Lehrgespärrecapriata principale Hauptgebindecaravanserraglio Karawansereicarbonaia Gelaßcarcere Kerkercariatide Karyatidecarpenteria Holzbaucarpenteria del tetto Dachstuhlcarta da parati Tapetecartella Kartuschecartiglio Kartuschecartoccio Rollwerkcartone catramato Dachpappecasa Hauscasa a ballatoio Kanzelhaus,
Laubenganghauscasa a corte Atriumhaus (allg.)casa a gradoni Terrassenhauscasa artigiana Handwerkerhauscasa a schiera Reihenhauscasa a torre Turmhauscasa colonica Bauernhaus, Katecasa comunale Gemeindehaus (für
eine Dorfgemeinde)casa con tetto a Giebelhaus
due falde casa con tetto Giebelhaus
a due spioventi
623 Italienisch-Deutsch
casa d'abitazione Wohnhauscasa d'affitto Miethauscasa dell'abate Abtshauscasa della Zunfthaus
corporazione casale Weilercasamatta Kasemattecasa parrocchiale Gemeindehaus (für
eine Kirchen-gemeinde)
casa patrizia Patrizierhauscasa porticata Vorlaubenhauscasa rurale Bauernhauscascata Kaskadecaserma Kasernecasino Kasinocassaforma Schalung
(Hilfskonstruktion)cassettone Deckenfach,
Kassettecastelletto Ansitzcastelletto di caccia Jagdschloßcastello Kastell, Schloßbaucastello circondato Wasserburg,
dall'acqua Wasserschloßcastello crociato Kreuzfahrerburgcastello di Lustschloß
campagna castello fortificato Burgcasupola Hüttecatacomba Katakombecatafalco Katafalkcatena Zugankercatena (di legno) Ankerbalkencatenaccio Balkenriegel,
Klemmbalken, Riegelbalken
cattedra Kathedracattedra tripla Dreisitzcattedrale Bischofskirche,
Kathedralecavalcavia Schwibbogencavaliere Kavaliercavallo Wechselcavettino Wassernasecavetto (Hohl-) Kehlecavicchio Holznagelc.c.a. Eisenbeton,
(= conglomerato Stahlbetoncementizio armato)
cella Zelle, Klausecella penitenziale Bußzellecemento (calce- Eisenbeton,
struzzo) armato Stahlbetoncenobio Konoibion
cenotafio Kenotaph, Scheingrab
centinatura Lehrgerüstcentro (della città) Stadtkerncentro della voluta Schneckenaugeceramica da Baukeramik
rivestimento cerchio (della Schaftring
colonna)cerniera Gelenk, Scharniercertosa Kartausechiassile della porta Türstockchiavaccio Balkenriegel,
Klemmbalken, Riegelbalken
chiave d'arco Schlußsteinchiave di testa Balkenankerchiave di volta Schlußsteinchiave di volta Abhängling
pendente chiave pendente Hängezapfenchiesa ad aula Saalkirchechiesa a sala Hallenkirchechiesa a sala con Emporenhalle
matronei chiesa a salone Hallenkirchechiesa cimiteriale Coemetrialkirchechiesa con torre Chorturmkirche
sovrastante il coro chiesa conventuale Klosterkirchechiesa degli Bettelordenkirchen
ordini mendicanti chiesa della trinità Dreifaltigkeitskirchechiesa doppia Doppelkirchechiesa fortificata Wehrkirchechiesa inferiore Unterkirchechiesa lignea Stabkirche
norvegese chiesa rotonda Rundkirchechiesa rupestre Felsenkirche,
Höhlenkirchechiodo di legno Holznagelchiostro Kreuzgang, Kioskchiusino Gosseciborio Ziboriumcielo del pulpito Schalldeckelcima Scheitelcimasa Giebel, Kymacimasa ornamentale Ziergiebelcimasa spezzata Sprenggiebelciminiera Schlotcimitero Coemeterium,
Friedhofcinta Enceinte, Zingelcinta muraria Mauerringcinta, muro di c. Ringmauer, Zingel
Fachglossar 624
cippo Zippuscippo funerario Grabzippuscippo sepolcrale Grabzippuscirco Zircuscirconvallazione Ringstraßecisterna Zisternecittà Stadtcittà dei morti Nekropolecittadella Zitadellecittà giardino Gartenstadtcittà ideale Idealstadtcittà radiale Radialstadtcittà satellite Trabantenstadtclaristorio (Ober-, Licht-)
Gadenclausura Klausurcoccia Kachelcoda di rondine Schwalbenschwanzcollare Halsringcollarino (Säulen-) Hals
(di colonna) collegamento Holzverbindung
del legno collegiata Stiftskirchecolmareccio Firstpfettecolmo, First (-ziegel)
(tegola di) c. colombario Kolumbariumcolonna Säule, Stützecolonna a balaustra Schlangensäulecolonna a fascio Bündelsäule
(egitto) colonna alveolare Wandsäule,
Säulenvorlagecolonna a palma Palmensäulecolonna atorica Hathorsäulecolonna a tre Dreiviertelsäule
quarti di cerchio colonna cerchiata Bundsäule,
Ringsäulecolonna Triumphsäule
commemorativacolonna cretese kretische Säulecolonna della Siegessäule
vittoria colonna di Giove Jupitersäulecolonna egizia Papyrusbündelsäulecolonna incassata Wandsäule,
Säulenvorlagecolonna infame Staupsäulecolonna onoraria Ehrensäulecolonna Papyrussäule,
palmiforme Palmensäulecolonna persiana persische Säulecolonna protodorische
protodorica Säule
colonnato, Kolonnade, portico c. Säulengang
colonna trionfale Siegessäulecolonne ofitiche Knotensäulecolonnetta Stuhlsäulecolonnina votiva Betsäulecolosseo Kolosseumcommessura Verbandcommettitura Gefügecommettitura a Spundung
maschio e femmina
commodité Commoditécommuns Communscomplesso Baugruppe
architettonico compluvio Dachkehleconca (absidale) Koncheconcatenamento Verband (im
Mauerwerk)concatenamento Blockverband
a blocco concatenamento Läuferverband
a cortina concatenamento Kreuzverband
a croce concatenamento a Fischgratverband,
spina di pesce Ährenwerk (im Mauerwerk)
concatenamento Eckverband (im d'angolo Mauerwerk)
concatenamento Läuferverbanddi fascia
concatenamento Binderverbanddi testa
concatenamento holländischerfiammingo Verband
concatenamento gotischer Verbandgotico
concatenamento Streckerverbandin chiave
concatenamento englischer Verbandinglese
concatenamento holländischerolandese Verband
concatenamento märkischer Verband,polacco polnischer Verband
concatenamento wendischervendico Verband
concio Haustein, Werkstein
concio comune Eckquaderconcio con angoli Hakenstein
sventrati concio d'angolo Eckquaderconcio di chiave Scheitelstein
625 Italienisch-Deutsch
concio d'imposta Anwölber, della volta Gewölbeanfänger
concio d'imposta Anfangsstein, Kämpferstein
concio di volta Wölbsteinconcio squadrato Quadercondotto del fumo Fuchs
(tra focolare efumaiolo)
confessione Konfessioconglomerato ce- Stahlbeton
mentizio armato connessione Anschlußcontraffisso Band (Holzverbin-
dung), Büge, Kopf-band, Kopfstrebe
contraffortamento Strebewerkcontraffortatura Strebewerkcontrafforte Strebemauer,
Strebepfeilercontrazione Eckkontraktion
angolare controabside Westchorcontrocatena Kehlbalkencontroporta Doppeltür (mit hin-
tereinander angeordne-ten Türblättern)
controscarpa Contrescarpecontroventatura Verstrebung,
Windverbandcontroventatura Längsverband
(di falda del tetto)controvento Sturmlatte,
Windrispeconvento Konventconvento rupestre Felsenklosterconversa (Dach-) Kehlecoperta Putzcopertina del Dachsattel
colmo copertina di pietra Abdecksteincopertura a vela in Seildach
tensione copertura del Dachdeckung
tetto copertura di vetro Glasdachcopertura sospesa Zeltdachkonstruk-
tion, Hängedachcoppia di puntoni Gebinde,
Dachgespärrecoppo Klosterziegel,
Nonnecopribattuta Schlagleistecordeliera Taustabcordonata Reitstiegecordone Cordonstein
cornice Rahmen (mit Füllung), Gesims
cornice a spiovente Schräggesimscornice Sockelgesims
basamentale cornice coprigiunto Deckgesims
orizzontale cornice del Fußgesims
basamento cornice del Rauchfangholz
caminocornice del Fensterbankgesims
davanzale cornice del Giebelgesims
frontone cornice del soffitto Deckengesimscornice d'imposta Kämpfergesimscornice-gocciola- Wasserschlag
toio intermedia cornice marcada- Sohlbankgesims,
vanzale Brüstungsgesims, Fenstergesims
cornice Gurtgesimsmarcapiano
cornicione Hauptgesimscornicione con Konsolgesims
mensole cornicione Dachgesims
di gronda coro Chorcoro a gradinata Staffelchorcoro dei monaci Mönchschorcoro inferiore Unterchorcoro poligonale Polygonchorcoro rettangolare Rechteckchorcoro triabsidato Dreiapsidenchorcorona Kronecorona di cappelle Kapellenkranz
absidali coronamento Bekrönung,
Couronnementcoronamento della Fensterbekrönung
finestra coronamento Gesprenge
dell'ancona corpo di fabbrica Baukörpercorrente (Dach-) Latte, Pfettecorrente del Brustriegel
davanzale corrente di testa Mauerlattecorrentino del tetto Ziegellatte (wie
Dachneigung)corridoio Gang (in einem
Gebäude), Korridor, Hausflur
corrimano Handlauf
Fachglossar 626
corso di Ausgleichschichtlivellamento (oberste Schicht des
Mauerwerks)corso di mattoni Rollschar
di costa corso obliquo Stromschichtcorte Hofcortile Hofcortile ad arcate Arkadenhofcortile a lucer- Lichthof
nariocortile con coper- Lichthof
tura di vetri cortina Blendmauer
(Füllmauer mit Vor-mauerung), Kurtine
coscia Stielcostola Rippecostolone Schildrippecostolone a sezione Bandrippe
rettangolare costolone Diagonalrippe
diagonale costolone di arco Scheidbogenrippe
laterale costruttore edile Baumeistercostruzione Bauwerk, Gebäudecostruzione a mu- Massivbau
ratura portante costruzione a Palisadenbau
palizzata costruzione a Zentralbau
pianta centrale costruzione a sche- Stahlskelettbau
letro d'acciaio costruzione a Stabbau,
traliccio Ständerbau,Fachwerkbau
costruzione a tra- Lehmfachwerkliccio tamponatacon argilla
costruzione con Skelettbaustruttura a scheletro
costruzione di Hochbaufabbricati
costruzione Wehrbaufortificata
costruzione Grabbaufuneraria
costruzione in Lehmbau(weise)argilla
costruzione in Lehmstampfbauargilla compressa
costruzione in Holzbaulegno
costruzione in Backsteinbaumattoni
costruzione in Lehmpatzenbaumattoni d'argilla
costruzione in pie- Feldsteinbautre di campo
costruzione in Blockbautronchi d'albero
costruzione Hochbausoprassuolo
costruzione sotto al Tiefbaulivello del suolo
costruzioni di Kirchenbautenchiese
costruzioni Industriebauindustriali
costruzioni Megalith-Bautenmegalitiche
costruzioni Ballon-Bautenpneumatiche
crematorio Krematoriumcremlino Kremlcrepidine Krepidomacresta della volta Scheitelliniecresta del camino Kaminaufsatzcripta Krypta, Kruftcripta anulare Ringkryptacripta a sala Hallenkryptacripta esterna Außenkryptacriptoportico Cryptoporticuscritica Architekturkritik
d'architettura croce Kreuzcroce a tau Taukreuzcroce decussata Andreaskreuzcroce della finestra Fensterkreuzcroce di Sant' Andreaskreuz
Andrea croce di Sant' Antoniuskreuz
Antonio, croceantoniana
croce greca griechisches Kreuzcroce latina lateinisches Kreuzcrociera della Kreuzstock
finestra crocifisso sotto Triumphkreuz
l'arco trionfale cromlech Steinkreiscubicolo Cubiculumcunei Bogensteinecuneo Keilsteincuneo d'imposta Gewölbeanfänger
della volta cunetta Abschlag, Abzugs-
graben,Gossecupola Kuppel
627 Italienisch-Deutsch
cupola a bulbo Zwiebelkuppelcupola a cipolla Zwiebelkuppelcupola a Faltkuppel,
costoloni Rippenkuppelcupola a doppia Doppelschalen-
calotta kuppelcupola a sesto Flachkuppel
ribassato cupola a stalattiti Stalaktitenkuppelcupola bizantina byzantinische
Kuppelcupola esterna Außenkuppel,
Schutzkuppelcupola su tromba Trompenkuppelcuria Kuriecurtain wall Vorhangfassade,
Curtainwallcurtis Curtiscurvatura Kurvaturcuspide Helmcyma Kyma
davanzale Fensterbank, Sohlbank
davanzale (interno) Fensterbrettdeambulatorio Ambulacrum,
(Chor-) Umgangdecastilo Dekastylosdeclivio Abdachungdecorazione Dekor, Dekorationdecorazione a denti Sägezahnverzirung
di sega decorazione a Stuckdekoration
stucco decorazione che Beschlagwerk
imita lo sbalzo decorazione Muschelwerk
conchiliforme decorazione d'an- Eckzier
golo protezionale decorazione del Firstbekrönung
colmo decorazione pitto- Fassadenmalerei
rica della facciata decorazione pitto- Deckenmalerei
rica del soffitto dente Absatzdente di cane Hundszahndentello Zahnschnittdeposito Speicherdiaconico Diakonikondiagonali di Kreuzstrebe
rinforzo diazoma Diazomadiga a valle Talsperrediglifo Diglyph, Zweischlitz
dima Lehre (Werkzeug)di piatto, Flachschicht
pavimento con mattoni disposti di p.
diptero, dittero Dipterosdisassamento Achsenneigungdisegno Bauriß
architettonico disegno di Bauzeichnung
costruzione dispositivo Balkenanker
d'ancoraggio disposizione a Pavillonsystem
padiglioni distanza rego- Bauwich
lamentare distanza tra Stützweite
gli appoggi dittero Dipterosdivergenza Divergenzdivisorio Trennwand,
Zwischenwand, Scheidewand
divisorio freitragende Wandautoportante
divisorio degli Wange (einesstalli Chorgestühls)
divisorio mobile Scherwanddoccia di gronda Dachrinne; Kandeldoccione Abtraufe,
Wasserspeierdodecastilo Dodekastylosdolmen Dolmendongione Donjondoppia finestra Doppelfensterdoppia porta Doppeltür (ausge-
doppelte Tür)dormiente Streichbalkendormitorio Dormitoriumdorsale Dorsaledorso del muro Mauerkronedrapperia Draperiedrolerie Droleriedromos Dromosduomo Münster, Dom
echino Polsteredicola Ädikulaedicola del Sakramentshaus
sacramento edicola funeraria Turmgrab
con tetto piramidale
edifici fieristici Messebautenedifici pubblici Bürgerbauten
Fachglossar 628
edificio Gebäudeedificio a pianta Langbau
longitudinale edificio a scala Punkthaus
centrale edificio a stella Sternhausedificio comme- Memorialbau
morativo edificio con una Saalbau
sala grande edificio Wohnbau
d'abitazione edificio multipiano Hochhaus
(Wolkenkratzer)edificio per uffici Bürohausedificio profano Profanbauedificio residenziale Wohnbauedificio sferico Kugelhausedificio stellare Sternhausedilizia Hochbauelemento Bauelement
costruttivo elemento edilizio Baugliedelemosineria Almosenhauselice Helikesemblema Emblemembrice Leistenziegel,
Imbrexemporio Kaufhausemporio di stoffe Gewandhausenfilade Enfiladeepistilio Epistylionepitaffio Epitapherario Aerariumeremo Klauseerma Hermeesagramma Sechsortesastilo Hexastylosesedra Exedraesonartece Exonarthexestrade Estradeestradosso Rückenestremità della Bauelement
trave euthynteria Euthynterie
fabbricato rurale Vorwerk (landwirt-distaccato schaftl. Gebäude)
fabricato viaggiatori Empfangsgebäudefaccetta Facettefaccia Haupt (beim
Mauerwerk)facciata Front, Fassadefacciata a due torri Doppelturmfassade,
Zweiturmfassadefacciata appesa Vorhangfassade
facciata a torre Einturmfassadefacciata cieca Blendfassadefacciata principale Schaufassade
decorata facciata torrita Turmfassadefaenza Fayencefagianiera Fasaneriefalda della cappa Schurz
(del camino) falsa volta Plänergewölbefalso matroneo Scheinemporefalso puntone Schifterfalso puntone di Gratschifter
displuvio farmacia Apothekefaro Leuchtturmfascia Lager (bei Steinen),
Band (Gesims),Faszien
fascia controvento Steigbandfascia (di porta o Fasche
di finestra) fascia intrecciata Flechtbandfascina Faschinefascio di nervature Dienstbündelfastigio composito Schweifwerkfattoria Gehöft, Farmfemmina Nutfemore Steg (an einer
Triglyphe)fenestella Fenestellaferitoia Schießscharte,
Schlitzfensterfessurazione da Bruchfuge
taglio festone Festonfiammeggiante Flammenstil,
Flamboyantfianco Flankefianco dell'arco Schenkel (eines
Bogens)filare Scharfiletto Stegfiligrana Filigranfinestra Fensterfinestra ad arco Rundbogenfenster
a tutto sesto finestra (ad arco) Lanzettfenster
lanceolato finestra ad Segmentfenster
arco ribassato finestra a doppia Verbundfenster
chiusura finestra a lunetta Kaffensterfinestra a nastro Fensterband (Reihe
von Fenstern)
629 Italienisch-Deutsch
finestra a ribalta Klappfensterfinestra a rosone Katharinenradfinestra a scorri- Hebefenster
mento verticale finestra a toppa Schlüssellochfensterfinestra a trifoglio Kleeblattfensterfinestra a vasistas Kippfensterfinestra centinata Bogenfensterfinestra cieca Blendfenster,
blindes Fensterfinestra circolare Rundfensterfinestra con Doppelfenster
controfinestra finestra con Sprossenfenster
traversine finestra del Erkerfenster
bay window finestra finta Blendfensterfinestra metallica Stahlfensterfinestra ogivale Lanzettfensterfinestra orbicolare Ochsenaugefinestra poliloba Fächerfensterfinestra scorrevole Schiebefensterfinestra sporgente Fenstererkerfinestra trilobata Kleeblattfensterfinestra trompe blindes Fenster
l'œil finestrella d'area- Dachluke
zione del tetto finestrino Lukefinta volta Scheingewölbefinto rosone Blendrosettefiore cruciforme Kreuzblumefiore del frontone Giebelblumefodera dell'imbotte Futterfoglia Blatt (beim got.
Maßwerk)foglia angolare Knorpelwerk, Knollefogliame Blattwerkfoglia rampante Krabbefondaco Magazinfondazione, Fundament, Stift
Pl. fondamenta fondi di bottiglia Butzenscheibenfontana Brunnenfontana a vasca Schalenbrunnenfontana a zampillo Springbrunnenfornice Schwibbogenforo Forumforte Fortfortezza Festungfortificazione Befestigungfortificazione Landwehr
confinaria fortificazione di Abschnittbefestigung
settore
fortificazione Stadtbefestigungurbana
fortino Feldschanzefossa Grabenfossato Halsgrabenfossato di settore Abschnittsgrabenfoyer Foyerfrascato Laube (Gartenhaus)freccia Pfeil (-höhe), Stich
(-höhe)freccia dell'arco Bogenhöhe,
Bogenpfeilfreccia della volta Gewölbehöhefregio Friesfregio ad archetti Kreuzbogenfries
intrecciati fregio ad archetti (Rund-)Bogenfriesfregio a girali Blattfriesfregio a losanghe Rautenfriesfregio a palmetta Palmettenfriesfregio a pannelli Plattenfriesfregio a riquadri Felderfriesfregio a rulli Rollenfriesfregio a scacchiera Schachbrettfries,
Würfelfriesfregio a squame Schuppenfriesfregio a triglifo Triglyphenfriesfregio a zig-zag Zahnfriesfregio clipeato Scheibenfries
a dischi fregio istoriato Figurenfriesfregio scolpito a Faltwerk
pieghe fronte Stirn, Frontispiz,
Frontfrontone Giebelfrontone ad arco Fensterbogen
di finestra (Fensterverdachung)frontone ad arco Segmentgiebel
ribassato frontone ad arco gesprengter Giebel
spezzato frontone a gradini Staffelgiebel,
Treppengiebelfrontone angoloso Knickgiebelfrontone cieco Blendgiebelfrontone con Volutengiebel
volute frontone della Fenstergesims,
finestra Fenstergiebelfrontone di Fensterverdachung
finestra frontone Ziergiebel
ornamentale frontone principale Schaugiebel
ornato
Fachglossar 630
frontone spezzato Sprenggiebelfuga cuneiforme Keilfugefuga del piano Anfangsfuge
d'imposta fuga di chiave Scheitelfugefuga di stanze (Zimmer-) Fluchtfumaiuolo Schlot, Essefusaiola Perlstab, Eierstabfusarola Perlstabfuso Wange (eines
Tonnengewölbes)fusto Leibfusto (della Schaft, Rumpf
colonna)
gabbia a vetri Lichtschachtgabbia della scala Treppenhausgabinetto Kabinett, Klosettgalilea Galilaeagalleria Galerie, Stollen,
Laufganggalleria ad Zwerggalerie
arcatelle galleria degli Spiegelgalerie
specchi galleria dei re Königsgaleriegalleria del coro Emporenumganggalleria superiore Emporegamba Stielgancio da muro Mauerhakengaritta Scharwachturm,
Schilderhausgarta Scharwachturmgattone Krabbegazebo Aussichtstempelgeisipodes Balkenkopfgeison Geisongelosia Gittergemino gekuppeltgerontocomio Altersheimghimberga Wimperggiardino Gartengiardino (alla) französischer Park
francese giardino all'inglese englischer Gartengiardino d'inverno Wintergartengiardino pensile Dachgartengiardino roccioso Steingartengigante Haupt (Riese)gineceo Gynäkeiongiochi d'acqua Wasserkünste
(Wasserspiel)giunto Fuge (zwischen anein-
ander liegenden Elementen), Stoß, Baunaht
giunto a dardo Hakenblattdi Giove
giunto a forcella Scherzapfengiunto a mezzo Überblattung
legno giunto a mezzo Hakenblatt
legno con risalto giunto angolare Eckverband (im
Holzbau)giunto di Setzfuge
assestamento giunto di Dehnfuge
dilatazione giunto di Gibilterra Hakenblattgiunto di posa Lagerfugegiunto di ripresa Arbeitsfugegiunto orizzontale Lagerfugegiuntura semplice gerader Stoß
diretta giunzione a code Verkämmung
(Holzverbindung)giunzione a Eckkamm
denti angolare giunzione a Verblattung
mezzo legno glittoteca Glyptothekgocce Guttaegocciolatoio Abschlag (an Gebäu-
den), Wassernasegocciolatoio Wasserschenkel
(della finestra) gola Karniesgradino Trittstufegradino a sezione Klotzstufe
rettangolare gradino a sezione Keilstufe
trapezoidale gradino d'invito Antrittgradino nel vano Fenstertritt
della finestra gradino Stufegradonamento Abtreppunggraffito Sgraffitogranaio Kornhausgrande magazzino Waren-, Kaufhausgrangia Scheunegrata Gittergrata del coro Chorgittergrata di cantoria Doxalegraticciata Flechtwerk (im
Fachwerkbau)grattacielo Hochhausgres Steinzeuggronda (Dach-) Traufe,
Wassernasegrondaia Traufe, Dachrinne
631 Italienisch-Deutsch
grondaia a sezione Kastenrinnerettangolare
grotta Grottegrottesca Groteskeguardaroba Garderobeguardiola Scharwachturmguarnitura Beschlag
metallica guarnizione Bandelwerkguglia Fialeguscio Schaleguscio superiore Ablauf
hamman Hammamhangar Hangar
iconostasi Ikonostasisil volgere a oriente Ostungimbotte Laibungimbotte della porta Türlaibungimmagine Architekturbild
d'architettura immorsatura Verkämmung (Holz-
verbindung), Zahn-steine, Verzahnung
impalcato Blindbogenimpalcato delle Balkenlage
travi impalcatura Gerüst, Gebälkimpannata Fensterrahmenimpiallacciatura Furniereimpianto a modulo quadratisches
quadrato Schema, gebunde-nes System
impianto basilicale doppelchörigea due cori Anlage
impianto basilicale basilikaler Querschnitt
impianto triabsidale Dreiapsidenanlageimposta (Fenster-) Ladenimposta a battente Klappladenimposta (dell'arco Kämpfer (an Bogen
o della volta) oder Gewölbe)imposta scorrevole Schiebeladenimposta scorrevole Falladen
verticale imposte ribaltabili Schlagladenincastellatura Hurdeincastellatura della Glockenstuhl
campana incastro Verzapfungincastro ad adden- Kamm
tellato incastro a dente Blattzapfen
multiplo incastro a denti Klaue
incastro a maschio Anschlitzung, e femmina Spundung (Nut und
Federverbindung in der Tischlerei)
incastro d'angolo Ecküberblattungincastro ligneo Blatt (im Holzbau)incatenamento Verankerungincavallatura Dachbinder,
Hängewerkincavallatura Hauptgebinde
principale incrostazione Inkrustrationinfermeria Infirmarieinferriata (della (Fenster-) Gitter
finestra) inferriata Fensterkorb
inginocchiatainfilata di stanze (Zimmer-) Fluchtingobbio Engobeingresso Dieleingresso protetto Windfanginquadratura della Fenstereinfassung
finestra intaglio Kerbschnittintaglio a Faltwerk
pergamena intarsio Intarsiaintavolato Dielenfußbodenintelaiatura Rahmen (mit
Füllung)intercolunnio Interkolumnium,
Säulenweiteinterpiano Geschoßhöhe,
Stockwerkshöheintonaco Putzintonaco d'argilla Lehmputzintonaco esterno Außenputzintonaco rustico Rauhputzintrecci Entrelacsintrecciatura Flechtwerk (im
Fachwerkbau)intreccio Bandgeflechtintreccio a rami Astwerkintroduzione di Staken (Ausfüllung
torselli fra le travi der Balkengefache)invito massiccio Blockstufe
(di scala lignea) ipocausto Hypokaustenipogeo Hypogäumipostilo Hypostylipotrachelio Hypotrachelionippodromo Hippodromiscrizione di un Bauinschrift
edificio isolato Baublockisometria Isometrie
Fachglossar 632
kerkides Kerkidesklinker Klinkerkraal Kraalkymation Blattwelle, Kyma
labirinto Labyrinthlacunare Deckenfach,
Kassettelambrecchini Lambrequinlambrì Lambrislamiera di Abweiseblech
protezione lamiera stirata Streckmetalllanterna Laternelanternino Dachreiterla prima pietra Grundsteinlarario Larariumlastra Plattelastra di solaio Deckenplattelastra di vetro Fensterscheibe
(per la finestra) laterizio modellato Formstein
in forma (Backstein)lato degli uomini Männerseitelato epistolae Epistelseitelato evangelii Evangelienseitelatrina Latrine, Abtrittlaura Lawralavabo Lavabolavatorium Lavatoriumlavorazione della Steinbearbeitung
pietra lavoro Werklavoro musivo musivische Arbeitlavra Lawralegante Bindemittelleggio Lesepultleggio dell'epistola Epistelpultlegnaia Gelaßlegname in tronco Ganzholz (Vollholz)
scortecciato legname mezzo Halbholz
tondo lesena Lisenelierne Liernelinea di chiave Scheitellinielinea di colmo Firstlinea di (Dach-) Kehle
compluvio linea di displuvio Grat (Schnittkante
zweier Dachflächen)linea di giunzione Stoßfugelinea d'imposta Kämpferlinielinguetta Federlista Leistelistello Leiste, Latte
listello a sezione Lattetriangolare
listello coprigiunto Dreikantleisten, Steglistello da incasso Laschelistello da Deckleiste
paramento listello da Einschlubleiste
rivestimento listello del tetto Verblenderlitotomia Ziegellatte (horizon-
tal)lobo Dachlattelocanda Gasthausloculo Nischengrabloggia Loggia, Altanloggia colonnata Säulenhalleloggiato Laube (Halle)losanga Rautelotto Bauabschnittluce Lichte, Spannweiteluce della finestra Fensteröffnunglucernario Oberlichtelunetta Lunettelunettone Stichkappeluogo Ortluogo di nascita Geburtshaus
(Mammisi)
madrasa Medresemagazzino Speicher, Magazinmalta Mörtelmancorrente Handlaufmaneggio coperto Reithallemaniera Maniermaniero Manor Housemaniglia Klinkemaniglia di finestra Reibermansarda Mansardemantelletta Schartenladenmanto di copertura Dachhautmantovana Kastengesimsmarchio di casata Hausmarkemarquise Markisemartirio Martyriummartyrion Coemetrialkirchemaschera Neidkopf
apotropaica maschera fitomorfa Blattmaskemascherone Maskaronmaschio Keep, Donjon
(di castello) masseria Gehöftmassetto Estrichmasso erratico Feldstein (Findling)mastaba a gradini Stufenmastabamastio Donjon
633 Italienisch-Deutsch
matrice geometrica Proportionsschlüsselmatroneo Matroneum,
Emporemattone Backsteinmattone da Verblender
paramento mattone da Verblender
rivestimentomattone di fascia Läufermattone di forma Formstein
speciale mattone di testa Binder (im
Mauerverband)mattone di vetro Glasbausteinmattone forato Hohlziegelmattone in chiave Binder (im
Mauerverband)mattonelle Fliesenmattoni forati Gittersteinemausoleo Mausoleummazzetta Anschlagmazzetta della Fensteranschlag
finestra meandro Mäandermedaglione Medaillonmembratura a se- Birnstab
zione piriforme memoria Memoriamensola Konsole, Tragstein,
Kraftsteinmensola di legno Knaggemensola di pietra Balkenstein, Not-
stein, Kragsteinmercato coperto Markthallemerlo Creneau, Zinnemerlo a due Dachzinne
spioventi merlo a gradini Stufenzinnemerlo ghibellino Kerbzinnemeta Metametopa Metopemezzaluna Demilunemezzanino Mezzaninmezzolungo Riemchenmica Marienglasmina Mineminareto Minarminbar Mimbarmisericordia Miserikordiemisure interne lichte Maßemitra (del camino) Schornsteinaufsatz,
Kaminaufsatzmitreo Mithräummodanatura Gesimsmodanatura a tre Dreiviertelstab
quarti di cerchio
modanatura Kehleconcava
modanatura con- Viertelstabvessa a quarto di cerchio
modello Baumodell, (Muster-) Lehre
modiglione Konsole, Tragsteinmodulo Modulmodulor Modulormolo Molemonaco Hängesäulemonaco centrale Hahnebaum, Helm-
stange, Kaiserstielmonastero Klostermonogramma di Meisterzeichen
mastro scalpellino monogramma di Steinmetzzeichen
scalpellino monoptero Monopterosmonta Stich (-höhe), Pfeil
(-höhe)montante Pfosten, Ständermontante dell'arco Schenkel (eines
Bogens)montante di croce Setzholz
di finestra montante di Fensterpfosten
finestra montante di Firstsäule
sostegno del colmareccio
monte Bergmonumento Ehrenmalmonumento Denkmal
commemorativo monumento choregisches
coregico Monumentmonumento Grabdenkmal
funerario monumento Denkmal
onorario monumento Grabdenkmal
sepolcrale mosaico Mosaikmoschea Moscheemotta Mottemunicipo Gemeindehaus (für
eine Dorfgemeinde)mura ciclopiche Zyklopenmauerwerkmura cittadine Stadtmauermuratura Mauerwerkmuratura a Hohlmauerwerk
cassavuota muratura a Hohlmauerwerk
intercapedire
Fachglossar 634
muratura a ricorsi Schichtmauerwerkmuratura a secco Trockenmauerwerkmuratura colata Gußmauerwerkmuratura di aufgehendes
elevazione Mauerwerkmuratura di Hintermauerung
ridosso muratura di Hintermauerung
riempimento muratura in pietra Werksteinmauer-
da taglio werkmuratura in pietra lagerhaftes
sbozzata Mauerwerkmuratura piena Vollmauerwerkmuratura rivestita Verblendmauerwerk
(a cortina) murature Außenmauern
perimetrali muri interni Innenmauernmuri perimetrali Umfassungsmauernmuro Mauermuro a cortina Blendmauer (Füll-
mauer mit Vormauerung)
muro a sacco Füllmauermuro di Futtermauer
rivestimento muro di Futtermauer
protezione muro di sostegno Stützmauermuro di testa Stirnwandmuro frontale Schildmauermuro merlato crenelierte Mauermuro portante Tragmauermuro spartifuoco Brandmauermuro tagliafuoco Brandmauermuseo Museummutulo Hängeplatte,
Dielenkopf
naiskos Naiskosnartece Narthexnasello, sporto Nasenaso Pechnasenaumachia Naumachienavata Schiffnavata centrale Hauptschiffnavata laterale Abseite,
Seitenschiffnavata per il Laienschiff
pubblico naviglio Grachtnecropoli Nekropole,
Gräberstadtnegozio Laden (Verkaufsraum)nervatura Rippe
nervatura a gomito Kropfkantenervatura della Kreuzrippe
crociera nervatura di chiave Scheitelrippenervatura trasver- Gurtrippe
sale di volta nicchia Nischenicchia cieca Blendnischenicchia della Fensternische
finestra ninfeo Nymphaeumnodo stradale (Verkehrs-) Knotennodo strutturale Knoten (von Kon-
struktionselementen)noviziato Noviziatnuraghi Nurage
obelisco Obeliskocchio della cupola Auge, Nabel (einer
Kuppel)occhio della voluta Schneckenaugeocchio di bue Ochsenaugeocchio di tirante Auge (am Ankerkopf)occhio di voluta Auge (am Kapitell)octastilo Oktastylosoculo Okulusoffice Anrichteogiva Kreuzbogenoliva Oliveombelico Nabelopaion Opäumopera cieca Blendeopera colata Gußmauerwerkopera cosmatesca Cosmatenarbeitopera finta Blendeopera muraria Mauerwerkopera musiva musivische Arbeitopera pia Stiftopera poligonale Polygonalmauer-
werkopere di fortifi Außenwerk
cazione esterne oppido Oppidumopus rusticum Rustikaorchestra, buca Orchestergraben
dell'o.ordine architetto- Kompositordnung
nico composito ordine architetto- griechische
nico greco Säulenordnungordine architetto- kleinasiatisch-
nico ionico- ionische Ordnungasiatico
ordine architetto- römisch-dorischenico romano- Ordnungdorico
635 Italienisch-Deutsch
ordine architetto- römisch-ionischenico romano- Ordnungionico
ordine architetto- toskanischenico toscano Ordnung
ordine colossale Kolossalordnungordine corinzio korinthische
Ordnungordine dorico dorische Ordnungordine francese französische
Ordnungordine gigante Kolossalordnungordine ionico ionische
Säulenordnungordine ionico- attisch-ionische
attico Ordnungordini archi- Säulenordnungen
tettoniciorditura dei Dachgespärre
puntoni orecchio Ohrorientamento Orientierungornamentazione a Diamantierung
punta di diamante ornamento Ornament, Dekorornamento a Nagelkopf
capoccia ornamento a Laubwerk
fogliame ornamento a Flechtwerk (orna-
treccio mentale Flächen-füllung)
ornamento a Mustermotivi ripetuti
ornamento Bauornament(architettonico)
ortostata Orthostatortostate con rilievi Relieforthostatenospedale Hospital,
Krankenhausospizio Armenhaus, Hospizospizio per i Altersheim
vecchi ossario Beinhaus, Karnerossatura di legno Gerüst (eines Holz-
gebäudes), Gebälkossatura inclinata Gespärre
del tetto osservatorio Observatoriumostello Herbergeosteria Gasthausottagono Achteck
padiglione Gartenhaus, Pavillon
palafitta Pfahlbau
palanche Gerüstbretterpalazzi per Messebauten
esposizioni palazzo Palastpalazzo di giustizia Gerichtsgebäudepalazzo municipale Rathauspalco Loge, Laubepalco a tre fronti Raumbühnepalcoscenico Bühne (eines
Theaters)palcoscenico con Guckkastenbühne
boccascena palcoscenico Drehbühne
girevole paliotto Frontalepalladiana diokletianisches
Fenster, Thermenfenster
palmetta Palmettepalo Pfostenpancone Bohlepannello Feld, Füllung,
Paneelpannello centrale Altarschrein
dell ancona paracarro Abweiser, Prellsteinparacarro (di porta Radabweiser
carraia)paradiso Paradiesparaneve Schneefangparapetto Geländer, Brustwehrparapetto della Fensterbrüstung
finestra parasole Sonnenblendeparasta Wandpfeiler,
Pilasterparasta angolare Eckpilasterparavento Paraventparcella Parzelleparco Parkparete Wandparete a graticcio Bohlenwand
tamponata con assicelle
parete a soffietto Faltwandparete della qibla Qiblawandparete divisoria Zwischenwand,
Scheidewandparodo Bühnengasseparquet Parkett (Bodenbelag),
Riemchen-fußboden
parrocchia Pfarrkircheparterre Parterre (Erdge-
schoß), (Broderie-) Parterre
Fachglossar 636
passaggio Laufgangpassaggio pedonale Gangpassarella Steg (verbindendes
Element)pavimentazione Pflasterpavimentazione a Ährenwerk (beim
spina di pesce Backsteinpflaster)pavimento Fußbodenpavimento della Dachboden
soffitta pavimento di Holzpflaster
blocchetti di legno
pavimento di cotto Ziegelbodenpavimento di Dielenfußboden
tavole pedata del Austritt
pianerottolopendant Pendantpendenza Steigungpendenza della Treppensteigung
scala pendenza del tetto Dachneigungpendio Böschung,
Abdachungpennacchio (Gewölbe-) Zwickelpennacchio a Trompe
tromba pennacchio conico Trompepennacchio d'arco Spandrillepennacchio nervato Rippenzwickelpennacchio sferico Hängezwickel,
Pendentifpensilina Abdach, Kragdach,
Vordachpentafoglio Fünfblattpentagramma Pentagrammpentalobo Fünfpaßpenthouse Penthousepergola Pergola,
Gartenlaubeperiodo di Bauperiode
costruzione peristilio Peristylperno Angelpersiana Sonnenladenpersiana avvolgibile Rolladenpian terreno Parterre (eines Thea-
ters), (Broderie-)Parterre
pianerottolo Treppenabsatz, Podest
piano Etage, Geschoß, Stockwerk
piano ammezzato Mezzaninpiano attico Attikageschoß
piano basamentale Sockelgeschoßpiano di Schnürboden
tracciamento piano d'imposta Anfalliniepiano nobile di Hauptgeschoß,
arco sopralzato Beletagepiano rialzato Hochparterrepiano terra rialzato Hochparterrepiano terreno Erdgeschoßpianta Grundrißpianta a ovale Längsoval
longitudinale pianta della carpen- Werksatz
teria orizzontale del tetto
pianta ideale Idealplanpianterreno Erdgeschoßpiantone (della Treppenspindel
scala a chiocciola) piastra Plattepiastrella Kachel, Platte,
Fliesepiattabanda scheitrechter Sturzpiatto Lager (bei Steinen)piazza Platzpiazza del mercato Marktplatzpicchiotto Türklopferpiccolo contraffisso Bugpiccolo contraffis- Fußband, Fuß-
so di piede strebepicola abside Apsidiolepiede del puntone Sparrenfußpiedistallo Piedestalpiedritto Widerlagerpiega Falz (allg.)pietra Bruchsteinepietra artificial- Lohstein
mente porosa pietra da costru- Baustein
zione pietra da rivesti- Blendstein
mento pietra da taglio Werksteinpietra di Ankerstein
ancoraggio pietra di spalla Kämpfersteinpietra lavorata Formstein
(Naturstein)pietra scapolo Bruchsteinepietra squadrata Werksteinpietra tagliata Hausteinpietre di copertura Dachsteinepigna Pinienzapfenpila in golena Landpfeilerpila Brückenturm,
Pfeiler
637 Italienisch-Deutsch
pilastrino Stützepilastrino Hauptpfosten
principale pilastro Pfeiler, Stielpilastro a croce Kreuzpfeilerpilastro ad erma Hermenpilasterpilastro a fungo Pilzstützepilastro binato Doppelpilasterpilastro cilindrico Rundpfeilerpilastro Kreuzpfeiler
cruciforme piliere Bündelpfeilerpilone Pfeiler,
Brückenturmpinnacolo Fiale, Pinakelpiolo Sprossepiombatoia Pechnase,
Senkschartepiramide Pyramidepiramide a gradini Stufenpyramidepittura a secco Seccomalereipittura murale Wandmalereipittura su vetro Glasmalereiplanetario Planetariumplanimetria Lageplanplastico Baumodellplinto Plinthepluviale Ablaufrohr, Fallrohrpodere Gehöftpodio Tribünepoggiolo Austrittpolicromia Polychromiepolifora Arkadenfensterpolilobo Vielpaßpolistilo Säulenbündelpolittico Flügelaltar (mehr-
flügelig)pomerio Zwinger (bei röm.
Stadtmauer)pomo Knaufponte Brückeponte coperto Dachbrückeponte di barconi Pontonbrückeponte levatoio Faltbrücke,
Zugbrückeponte su barche Schiffbrückeponte su chiatte Schiffbrückeponteggio Gerüst (Baugerüst)ponticello Steg (kleine Brücke)pontile Lettnerporta Tür, Pforte,
Tor(-bau)porta a due ante Doppeltür
(Zweiflügeltür)porta a due battenti Doppeltürporta a fisarmonica Falttür
porta a libro Falttürporta a ribalta Hebetürporta a soffietto Falttürporta a torre Turmtorporta a vento Schwingflügeltür,
(a due battenti) Pendeltürporta cieca Blendtüreporta d'acciaio Stahltürporta del castello Burgtorporta della città Stadttorporta della sposa Brauttürporta finestra Fenstertürporta finta Blendtüreporta fortificata Torturmporta girevole Drehtürportale Pforteportale a smussi Säulenportal
con colonnine portale a smussi Stufenportalportale a stalattiti Stalaktitenportalportale ad arco Bogenportalportale laterale Seitenportalportale principale Hauptportalporta scorrevole Schiebetürporta specchiata Rahmen- und
Füllungstürporta tappezzata Tapetentürporta trionfale Siegestor,
Triumphtorporta vetrata Glastürportello Einlaßpforte,
Mannslochporticato Torhalleportici Wandelhalleportico Portikusportico colonnato Säulenhalle,
-portikus, -gangportone Pforteposterla Ausfalltor, Poternepostierla Poterneposto Ortposto di ristoro Rasthauspozzo Spindel (einer
Wendeltreppe), Brunnen, Schacht
pozzo a carrucola Ziehbrunnenpozzo (all'interno Brunnenhaus
del chiostro) pozzo della scala Treppenlochpozzo di luce Lichtschachtpozzo di scala Auge (einer Wendel-
elicoidale treppe), Lichtspin-del, Treppenauge, Hohlspindel
pozzo di Luftschachtventilazione
Fachglossar 638
predella Altarstaffelprefabbricazione Montagebau,
Vorfertigungprefabbricazione ad Plattenbauweise
elementi pianiprepositura Propsteiprigione Kerkerprime file della Parkett (im Theater)
platea priorato Prioratprofilato Profilträgerprofili della finestra Schenkel (eines
Fensterflügels)profili (di finestra) Fensterschenkelprofilo Profilprogetto di Bauplan
costruzione proiezione Riß, Projektionproiezione laterale Seitenrißproiezione Grundriß
orizzontale proiezione Normalprojektion
ortogonale proiezione quotata kotierte Projektionproporzione Proportionpropugnacolo Propugnaculumproscenio Bühne (eines Thea-
ters), Proszeniumprospettiva Perspektiveprospettiva a volo Vogelperspektive
d'uccello prospettiva centrale Zentralperspektiveprospettiva dal Froschperspektive
bassoprospettiva frontale Frontalperspektiveprospetto Aufrißpseudoarco unechter Bogenpseudovolta falsches (unechtes)
Gewölbepulpito Kanzelpulpito esterno Außenkanzelpulvino Kämpferaufsatz,
Pulvinuspuntello Stützepunto d'incontro di Anfallspunkt
più di due falde puntone Sparrenpuntone cavaliere Reitersparrenpuntone d'angolo Gratsparrenpuntone Kehlsparren
d'impluvio puntone principale Hauptsparrenpuntoni di capriata Bundgespärre
principale com-posta
pusterla Poterne
quadrato di incro- Vierungcio fra navata etransetto
quadratura Quadraturquadriconco Vierkonchenanlagequadrifoglio Vierblattquadrilobo Vierpaßquartabuono Gehrung
radiale Radialrampa Lauf, Ramperampa di scala Treppenarm,
Treppenlauframpa elicoidale Wendelramperampa esterna Außenramperampante einhüftigramparo Rempartrapporto Rapportrappresentazione Architektur
architettonica darstellungrappresentazione Bogenaustragung
dell'arco in veraforma
rastremazione Verjüngungrecinto del coro Chorschrankenrecinto Zaun, Gatterrefettorio Refektoriumregolamento Bauordnung
edilizio reni Bogenanfallresidenza estiva Lustschloßresidenza imperale Pfalzresidenza prelatizia Prälaturretablo Altarretabelrete portaintonaco Rabitzgewebereticolo Rasterrialzo Busung, Stelzung,
Stichricorso Ausgleichschicht (im
Bruchsteinmauer-werk)
ricorso laterizio Durchschußridotta Redouteridotto Foyer (im Theater)rigonfiamento Anschwellungrilievo Reliefrimessa Schuppen, Remisering Ringstraßeringhiera Geländerripiegatura Verkröpfungrisalto Risalit, Verkröpfungrisalto centrale Mittelrisalitrisalto laterale Seitenrisalitrisega di Bankett
fondazione ristorante Gaststätte
639 Italienisch-Deutsch
ritmo Rhythmusrito propiziatorio Bauopferritto Pfostenrivellino Ravelinrivestimento Ummantelung,
Verblendung, Bekleidung
rivestimento di Wandbekleidungparete
rivestimento di Schalung tavole (Verbretterung)
rivestimento Täfelwerkligneo
rocaille Rocaillerocca Burgrocchio della Trommel
colonna (Säulentrommel)rombo Rauterompighiaccio Eisbrecherrondeau Rondell (Rundbeet)rondello Rondengangrondò Rondell (Rundbeet)rosa (di campanile) Schallöffnungrosa Tudor Tudorblattrosone Radfenster,
(Fenster-)Roserosone cieco Blendrosetterotonda Rotunderotonda del coro Chorscheitelrotunderovina Ruinerudente Pfeife
sacrestia Sakristeisaetta Pfeil (-höhe)saettiera Zinnenfenstersaettone Strebesagoma Lehre (Werkzeug)sagrestia Sakristeisahn Sahnsala Saal, Hallesala capitolare Kapitelsaalsala da ballo Redoutesala egizia ägyptischer Saalsala ipostila Säulensaalsala trasversale Quersaalsaliente Sappesaliscendi Einreiber-Verschlußsalottino privato Boudoirsalotto Empfangszimmer,
Salonsalvietta piegata FaltwerkSanto Sepolcro Heiliges Grabsantuario Allerheiligstes,
Sanktuariumsaracinesca Fallgattersarcofago Sarkophag
sbadacchiamento Staken (Abkreuzunga croce von Balken)
sbadacchio Spreizesbadacchio a croce Kreuzstakensbozzatura Bogenquaderungscala Treppescala a chiocciola Spindeltreppescala antincendio Feuertreppescala a piú rampe Podesttreppe
per piano scala con gradini freitragende Treppe
a sbalzo scala di emergenza Feuer-, Nottreppescala di sicurezza Nottreppescala elicoidale Wendeltreppescala mobile Rolltreppescalea Freitreppescale esterne Außentreppenscalinata Freitreppescalino Stufescalpellare scana- scharrieren
lature parallele scamillo Scamillusscanalare abkehlenscanalatura Kanneluren, (Hohl-)
Kehle, Riefelung (einer Säule), Nut
scantonare abfasenscapolo Bruchsteinescarpa Absatz, Abdachungscarpata Böschungscavo di Baugrube
fondazione scena girevole Drehbühneschema geometri- Dachausmittlung
co della coper-tura
schienale Dorsaleschizzo Schaubildscompartimento Gefachscozia (Hohl-) Kehlescrigno Schreinscuderia Marstallscudo Schildscultura Skulpturscultura Bauplastik
architettonica scultura a stampo Steingußsede della Zunfthaus
corporazione seggio triplo Dreisitzsegreta Verliesselenite Marienglassemicatino Halbkuppelsemicatino Muschelgewölbe
conchiliforme
Fachglossar 640
semicolonna Dienst(maggiore) di un piliere
semicupola Halbkuppelseminterrato Basementsemipilastro Pilastersentinella Scharwachturm,
Sentinellesepolcro Gruftserbatoio dell'acqua Wasserturm
sopraelevato serliana Palladio-Motivserra Gewächshaus,
Glashausserra delle palme Palmenhausserraglia Schlußsteinserraglio Serailserranda a Scherengitter
pantografo serratura Schloßsezione aurea goldener Schnittsfalsamento dei Schichtwechsel
giunti sfalsamento della Aufkröpfen
modanatura sfalsare (i giunti) versetzen (beim
Mauerwerk)sformellatura Abplattungsguinci della Fenstergewände
finestra sguincio della Schartenbacke
feritoia sguscio Voutesguscio del soffitto Deckenkehlesima Rinnleistesimbologia Bausymbolik
architettonica simmetria Symmetriesinagoga Synagogesistema alla Vauban Vaubansystemsistema hippodamisches
ippodamico Systemsistema poligonale Polygonalsystemsito Ortsmussare abfasensmussatura Fase, Schmiegesmusso Fase, Schmiegesoffitta Dachboden,
-geschoß, -raum, -bühne
soffitta del Schnürbodenpalcoscenico
soffitto Deckesoffitto a scomparti Felderdeckesoffitto di travi Holzbalkendecke
di legno
soglia Schwellesoglia della porta Türschwellesolaio Deckesolaio a fungo Pilzdeckesolaio a soletta Plattendecke
di c.c.a. piena solaio a tavelloni Hourdidecke
curvi solaio a tavoloni Bohlendeckesolaio pieno su Plattenbalkendecke
travi di c.c.a.solaio pieno Massivdeckesolario Solariumsoletta nervata Rippendeckesoppalco Zwischendeckesopralzo Stelzungsordino della Fensterbogen
finestra (Entlastungsbogen)sostruzione Substruktionsottotetto Dachraum,
Dachbodensottotrave Sattelholzsovrapporta Supraportespagnoletta Espangolette-
Verschlußspalla Schulterspalto Glacisspazio Raumspazio centrale Zentralraumspecchio del Deckenspiegel
soffitto sperone Strebepfeiler, Spornsperone della pila Wellenbrecherspianata Esplanadespiga Ährespiga del frontone Giebelährespigolo all'incrocio Grat (an einem
delle volte Gewölbe)spina Spindel (einer Wen-
deltreppe), Angelspina (della scala Treppenspindel
a chiocciola) spina di pesce Fischgratspinatura Verdübelungspinta Schubspinta laterale Seitenschubspinta orizzontale Horizontalschubspiovente Wasserschrägespiovente a Walm
triangolo spirale Spiralespirone Eckknollespoglia Spoliesponda Brüstungsporgenza del Mauerzunge
muro
641 Italienisch-Deutsch
sporgenza del tetto Schurzsporto Erker, Auskragung,
Überhangsporto in legno Überzimmerspranga di legno Balkenriegel,
Riegelbalken, Klemmbalken
squadratura Bogenquaderung(dei cunei)
stabilitura Feinputzstadio Stadionstaffa del colmo Zangestalli Stallenstalli del coro Chorgestühlstanza Stube, Gemachstanze di Paradezimmer
rappresentanza statica Statikstatua di Orlando Rolandsäulestazione di posta Posthofsteccato Gatter, Zaunstele Stelestereobate Stereobatstile Stilstile perpendicolare Perpendicular stylestilizzare stilisierenstipe Stipesstipite Gewändestipite della finestra Fensterlaibungstipiti della porta Türlaibungstoffa da parati Tapetestrada a cordonata Treppenstraßestrada a gradonata Treppenstraßestrato Schichtstrato di intonaco Putzhautstria Steg (an einer Säule)strombatura Ausschrägungstrombatura della Fensterschräge
finestra struttura diafana diaphane Strukturstruttura portante Flächentragwerk
bidimensionale struttura portante räumliches
reticolare spaziale Tragwerkstuccatura Stuckaturstucco Steinguß, Stuckstucco lustro Stucco lustrostucco romano Stucco lustrostudio Atelierstudiolo Studiolostupa Stupastupa a campana Glockenstupasuola del muro Mauersohlesuperficie della Fensterfläche
finestra sviluppo Abwicklung
tabernacolo Tabernakeltaglio a dentelli deutsches Bandtalayotz Talayotentamburo Trommel
(Kuppelunterbau)tamburo della Trommel
colonna (Säulentrommel)tamponamento Ausfachungtassello Dübeltavola di frontone Ortgangtavola di pavi- Diele (Fußboden-
mento brett), Holzbohletavolato del soffitto Deckenschalungtavolato esterno Dachschalung
della copertura tavolato interno Dachschalung
della copertura tavole da ponte Gerüstbrettertavolone Bohleteatro Theaterbautegola Ziegeltegola coppocanale Krempertegola di bordo Ortziegeltegola di cantonale Gratziegeltegola di colmo Kammziegel
decorata tegola di vetro Glasziegeltegola fiamminga Dachpfannetegola marsigliese Falzziegeltegola olandese Dachpfannetegola piana a Biberschwanz,
squama Dachplattetegola romana Klosterziegeltelaio (Blend-) Rahmen
(Tragwerk)telaio della finestra Fensterrahmentelaio della porta Türstocktelaio fisso di Fensterstock, Zarge
finestra telaio incernierato Gelenkrahmentelamone Atlanttempio atorico Hathortempeltempio attero Apteraltempeltempio circolare Rundtempeltempio doppio Doppeltempeltempio in antis Antentempeltempio in valle Taltempeltempio ipetrale Hypethraltempeltempio ipetro Hypethraltempeltempio rupestre Felsentempel,
Höhlentempeltempio sepolcrale Grabtempeltempio su podio Podiumstempeltempio su Terrassentempel
terrazzamento tenaglia Tenaille
Fachglossar 642
tenaglione Tenaillontendone Sonnensegeltenone Zapfentenone obliquo Jagdzapfentensostruttura Seilkonstruktionteoria dell' Architekturtheorie
architettura terme Thermenterminazione del Chorschluß
coro terra battuta Lehmtenneterracotta Steinzeugterrapieno Wallterrazza Terrasseterrazzino Beischlag
d'ingresso terrazzo Terrazzoterzera (Dach-) Pfetteteschio di bue Ochsenschädeltesoro Schatzhaustesta Kopftesta della trave Balkenkopftesta di ponte Brückenkopftestata del coro Chorhauptteste di cavallo Pferdeköpfetetraconco Vierkonchenanlagetetto Dachtetto a botte Tonnendachtetto a bulbo Zwiebeldachtetto a campana Glockendachtetto a canali Mönch- und
Nonnendachtetto a capanna Satteldach,
Giebeldachtetto a capriata Sparrendach
semplice tetto a cavaliere Ritterdachtetto a cipolla Zwiebeldachtetto a coppi Mönch- und
Nonnendachtetto a corona Kronendachtetto a crociera Kreuzdachtetto a cupola Kuppeldachtetto a cuspide Dachhelm
piramidale tetto a cuspide Helmdachtetto ad arcarecci Aasdach
tipico scandi-navo
tetto ad arco Bogendachtetto ad elmo welsche Haubetetto ad ombrello Zeltdachtetto a doppia Giebeldach
falda tetto a due Giebeldach
spioventi
tetto ad una falda Pultdachtetto a falda Ringpultdach
troncoconica tetto a falde Rautendach,romboidali Rhombendachtetto a falde Krüppelwalmdach
spezzate tetto all'imperiale Kronendachtetto a mansarda Mansarddachtetto a piramide Pyramidendach,
Zeltdachtetto a risega Sägedach (Sheddach)tetto a sbalzo Kragdachtetto a schiena Giebeldach
d'asino tetto a terrazza Dachterrasse,
Terrassendachtetto centinato Bogendachtetto coperto di Schindeldach
scandole tetto d'ardesia Schieferdachtetto di scandole Spließdachtetto di tegole Pfannendach
fiamminghe tettoia Schuppen,Vor-,Wet-
ter-, Schutzdachtettonica Tektoniktetto piano Flachdachtetto sospeso Hängedachtetto trasversale Zwerchdachtettuccio Vordach,
Verdachungtholos Tholostierceron Tiercerontimpano Bogenfeld, Giebel-
feld, Tympanontipologia edilizia Bauweisetirante (Zug-) Ankertirante anulare Ringankertirante (dell'arco) Bogenankertomba Grufttomba a Baldachingrabmal
baldacchino tomba a cupola Kuppelgrabtomba moschea Grabmoscheetomba rupestre Felsengrabtombino Rinnsteintondino fitomorfo Blattstabtondo Rundstabtondo cerchiato Ringstabtonsura Tonsurtorre Turmtorre al lato del Chor(flanken)turm
coro torre a spirale Spiralturmtorre campanaria Glockenturm
643 Italienisch-Deutsch
torre con scala a Treppenturmchiocciola
torre con tetto a Zwiebelturmbulbo
torre con tetto a Sattelturmcapanna
torre d'abitazione Wohnturmtorre dell'acqua Wasserkünste
(Wasserturm)torre della facciata Fassadenturmtorre della Fernsehturm
televisione torre delle scale Treppenturmtorre del ponte Brückenturmtorre del transetto Querhausturmtorre di difesa Wehrturmtorre di guardia Burgwarte
(del castello) torre di vedetta Wachturm,
Wartturmtorre doganale Zollturmtorre gentilizia Geschlechterturmtorre panoramica Aussichtsturmtorre scenica Bühnenhaustorre sovrastante Chorturm
il coro torretta Geschützturm,
Scharwachturmtorretta con scala Wendelstein
a chiocciola torrione Keeptorsione Torsiontozzetto Riemchentrabeazione Gebälktracciato Tracétraforo Maßwerktraforo ad asta Stabwerktraforo a tripla Dreischneuß
vescica di pesce traforo cieco Blendmaßwerktraforo Flowing tracery
serpeggiante traliccio Flechtwerk (im
Fachwerkbau)trama Mustertramezzo Zwischenwand,
Scheidewand, Trennwand
tramezzo di irrigi- Bundwanddimento (in costruzioni a graticcio)
transenna Transennatransetto Transept, Querhaustransetto Westquerhaus
occidentale
transetto tipico Auvergnatischer dell'Alvernia Querriegel
tratto Trakttrattoria Gasthaustravatura Gebälktravatura con Sprengwerk
contraffissi travatura del tetto Dachgebälktrave Balkentrave a doppia T Doppel-T-Trägertrave a sbalzo Kragbalken,
Kragträgertrave a sella Sattelholztrave a T T-Trägertrave a traliccio Gitterträgertrave continua Durchlaufträgertrave del piano Dachbalken
d'imposta del tetto
trave (di edificio Rähma ossatura lignea)
trave di scarico Entlastungsträgertrave di soglia Grundschwelletrave di sostegno Trägertrave estradossata Oberzug (Überzug)trave intradossata Unterzugtrave maestra Hauptbalkentrave reticolare Gitterträger,
Fachwerkbindertraversa Riegel, Traversetraversina Sprosse
(di finestra) traverso della Kämpfer (an einem
finestra Fenster), Kämpferholz
travetto Lagerholztrave zoppa Stich (-balken)travicello Lagerholz, Rofentreccia Taustabtriangolazione Triangulationtriangolo sferico sphärisches Dreiecktrianon Trianontribolon Tribolontribuna Tribüne, Tribunaltribunale Gerichtsgebäudetriconco Dreikonchenanlagetrifoglio Dreiblatttrifora Drillingsfenstertriforio Triforiumtriforio cieco Blendtriforiumtriforio finestrato durchlichtetes
Triforiumtriglifo Triglyphe,
Dreischlitztrilite Sturzpfostenportaltrilobo Dreipaß
Fachglossar 644
645 Italienisch-Deutsch
trincea Schanzetrincea a stella Sternschanzetrincea d'approccio Sappetrittico Triptychontrofeo Trophäetromba Schachttromba a vetri Lichtschachttromba delle scale Treppenlochtronco Rumpf, Schafttumulo Tumulus
ufficio Kontorultima mano Feinputz
d'intonaco unghia Gewölbekappe,
Kreuzkappe, Kehle(bei einem Kloster-gewölbe)
unghie d'angolo Kreuzkappeurbanistica Städtebauurna cineraria a Hausurne
forma di casa
vallo Wallvano della finestra Fensternischevano scala Treppenhausveduta Vedutevela Kreuzkappevelo Feinputzveneziana Jalousieveranda Verandavertice Scheitelvescica di pesce Schneuß, Fischblasevestibolo Vorhalle, Diele,
Hausflurvetrata Bleiverglasungvetratura incolore Blankverglasungvetrina Schaufenster,
Schaukastenvetro Fensterscheibe
(della finestra) viadotto Viaduktvicolo Schlippevillaggio Dorfviuzza Schlippevolgere a oriente, il Ostungvolta Gewölbevolta a bacino Kesselgewölbevolta a botte Ringtonne
anulare volta a botte con Muldengewölbe
testate di padiglione
volta a botte Quertonnedisposta traversalmente
volta a botte Spitztonneogivale
volta a botte Flachtonneribassata
volta a botte Tonnengewölbevolta a catino Kesselgewölbevolta a chiocciola Schneckengewölbe,
Spiralgewölbe, Spindelgewölbe
volta a costoloni Rippengewölbevolta a crociera Kreuz(-grat)-
gewölbevolta a crociera Kreuzrippen-
a costoloni gewölbevolta a crociera Kreuzrippen-
a nervature gewölbevolta a doppia Doppelgewölbe
calotta volta a imbuto Trichtergewölbevolta a mezza botte Halbtonnevolta a nervature Rippengewölbevolta anulare Ringgewölbevolta a ombrello Zellengewölbe,
Schirmgewölbevolta a padiglione Klostergewölbevolta a schifo Spiegelgewölbevolta a stalattiti Stalaktitengewölbevolta a vela Hängekuppelvolta a vela a sesto böhmische Kappe,
ribassato Platzelgewölbe, Stutzkuppel
volta a ventaglio Fächergewölbe, Strahlengewölbe, Palmengewölbe
volta cellulare Figuriertes Gewölbe
volta colata Gußgewölbevolta conica Kegelgewölbevolta doliare Topfgewölbevolta domicale Domikalgewölbevolta elicoidale Spiralgewölbe,
Spindelgewölbevolta ellittica elliptisches
Gewölbevolta esapartita sechsteiliges
Gewölbevolta gettata Gußgewölbevolta gotica a Zweischichten-
doppio guscio gewölbevolta nervata a Rautengewölbe
proiezioniromboidali
volta normanna Trichtergewölbevolta reticolare Netzgewölbevolta reticolare a Parallelrippen
nervature binate gewölbe
volta (soffittatura) Rabitz, Rabitz-gewölbe(-decke)
volta stellata Sterngewölbevoltina a sesto preußische Kappe
ribassato volume dell' umbauter Raum
edificio
voluta Volute, Schneckevuoto edilizio Baulücke
zanella Gossezecca Münzezoccolo Fußleiste, Sockelzoccolo a panchina Banksockel
Fachglossar 646
ábaco Abakusabadía Abtei, Badiaabertura en el Zinnenfenster
merlónabertura en el piso Treppenloch
por donde pasa una escalera
abertura exterior Schartenmaulde una tronera
abertura para la Rauchlochsalida del humo
abertura que per- Hagioskopmite mirar el altar desde afuera
abertura superior Angstlocha un calabozo
abolsamiento de Busungla bóveda
ábside Chornische, Abside,Apsis, Chorhaupt
ábside de crucero Querhausapsideábside lateral Nebenapsisabsidiola, ábside Apsidiole
secundariaacanaladura Nutacanaladuras Kannelurenacanalar abkehlenacanto Akanthusacequia Gosseacero de armadura Moniereisenacodadura Verkröpfungacoplado gekuppeltacrópolis Akropolisacrotera Akroter,
Giebelreiteracueducto Aquäduktadarve Wehrgangaditamento sobre Kämpferaufsatz
un capiteládito Abaton, Adytonadobe Adobeadorno de volutas Knorpelwerkadorno diente de Hundszahn
perroadornos de voluta Rollwerk,
Schweifwerkaeropuerto Flughafenaetoma Aëtomaaglomerantes Bindemittelágora Agoraágrafe Agraffeaguilón Ortbalkenahuecar abkehlenaire-luz Schacht
ala Alaeala de edificio Flügelala de la escalera Treppenarm
imperialala lateral Seitenflügelalas de crucero Kreuzarmealbergue Herbergealbergue de Fondaco
comerciantesalbura Splintalcazaba Alcazabaalcázar Alcazaralcoba Alkovenaldea Dorfaldehuela, caserío Weileralero Dachtraufe, Füll-
brett, Schutzdach, Überhang, Vor-dach, Wetterdach
alfarda de la escalera Treppenwangealfeizamiento Ausschrägungalféizar Brustriegel,
Fensteranschlagalineación Reihung, (Bau-)
Fluchtalineamiento Fluchtlinieallanado Abplattungalma Spindel, Stegalmacén Magazin,
Waren-, Kaufhausalmacén de maderas Bauhofalmacén familiar Gadenalma de una esca- Treppenspindel
lera de caracolalmena Creneaualmena con termi- Dachzinne
nación en dos aguas
almena escalonada Stufenzinnealmocárabe Entrelacs,
Flechtbandalmohadilla Tragsteinalquitranado Dachpappealtar Altaraltar ahuecado en Kastenaltar
la basealtar con alas Flügelaltaraltar con aletas Wandelaltar
modificable altar con forma Tischaltar
de mesaaltar con funda- Blockaltar
mento macizoaltar con sarcófago Sarkophagaltar
647 Spanisch-Deutsch
SPANISCH-DEUTSCH
altar del púlpito Kanzelaltaraltar lateral Seitenaltaraltar mayor Choraltaraltar secular Laienaltaraltis Altisalto relieve Hochreliefaltura de arranque, Kämpferhöhe
a. de impostaaltura de la montea Pfeilhöhealtura del escalón Treppensteigungaltura del piso Stockwerkshöhealtura del vértice Stich-, Scheitelhöhealtura de piso Geschoßhöhealtura de una Gewölbehöhe
bóvedaámbito Ambitusambón Amboambulacro Ambulacrumancla Ankerancla de viga Balkenankeranclaje Gebinde, Veranke-
rung, Bogenankeranclaje anular Ringankeranclaje principal Hauptgebindeandamio Gerüstandrón Andronandronitis Andronitisanexo Annexanfipróstilo Amphiprostylosanfitálamo Amphithalamusanfiteatro Amphitheaterángulo acha- Schmiege
flanadoángulo saliente Bollwerkswinkelanillo de columna anwirteln
adosadaanillo del fuste Schaftringanillo en el fuste Wirtel
de una columnaanta Anteantecámara Antichambreantefija Antefixa, Stirnziegelantegabinete Antikabinetantepecho Brüstungsgesims,
Fensterbrüstungantepuerta Portièreantesala a la tumba Konfessio
de un mártirapadana Apadanaaparejo Verband, Appareilaparejo en alforjas gotischer Verbandaparejo en forma Ährenwerk
espinapezaparejo gótico gotischer Verbandaparejo inglés Blockverband
(sencillo, normal)
apertura de ventana Fensteröffnungápice Scheitelapoditerio Apodyteriumapófige Ablauf, Apophigeaposento Gemachaposento para las Kemenate
mujeres en una fortaleza
apótesis Apothesis, Anlaufapoyo Auflager, Lagerapoyo de ventana Fensterbrettapoyo diagonal de Steigband
un ensamble de media madera
apoyo pendular Pendelstützeapuntalamiento Verstrebungarabesco Arabeskearandela Rondellarbotante Strebebogenarca Archearcada Arkadearcada ciega Blendarkadearcada doble Doppelarkadearcada falsa Blendarkadearcadas de ventana Fensterarkadenarcada simulada Blendarkadearcatura Arkaturarco Bogenarco achatado Sturzbogenarco apuntado Gurtbogenarco árabe Hufeisenbogenarco articulado Gelenkbogenarco ciego Blendbogenarco con bandas Faszienbogen
de arquitrabearco cóncavo Grundbogenarco conopial Eselsrückenarco de carena Kielbogenarco de descarga Entlastungsbogenarco de fundación Fundamentbogenarco de intersec- Raumbogen
ción y ensamble cruzado
arco del coro Chorbogenarco de medio Rundbogen
puntoarco de medio Stelzbogen
punto elevadoarco de refuerzo Überfangbogenarco de tensión Schwibbogenarco de tres bisagras Dreigelenkbogenarco de triunfo Triumphbogenarco de una Fensterbogen
ventanaarco diagonal Diagonalbogenarco elevado ansteigender Bogen
Fachglossar 648
arco elíptico Ellipsenbogenarco en abanico Fächerbogenarco encabriado Zackenbogenarco en contracurva Sternbogenarco en declive steigender Bogenarco en mitra Giebelbogenarco en nicho Schildbogen,
Blendbogenarco en saliente, Kragbogen
a. en voladizoarco falciforme Sichelbogenarco falso Blendbogen,
unechter Bogenarco frontal Stirnbogenarco gótico Spitzbogenarco herradura Hufeisenbogenarco inclinado steigender Bogenarco invertido Erdbogen
de cimientosarco lateral Scheidbogenarco mural de Wandbogen
refuerzoarco ojival Spitz-, Kreuzbogenarco parabólico Parabelbogenarco polilobulado Vielpaßbogenarco por tranquil steigender Bogenarco rampante Strebebogenarco rebajado Flachbogen,
Segmentbogenarco sarraceno Sarazenenbogenarcos de arcadas Arkadenbögenarcos entrelazados Kreuzbogenfriesarco simulado Blendbogenarco sobre Kragsturzbogen,
almohadillas Schulterbogenarcosolio Arcosoliumarco tercelete Tierceronarco toral Gurtbogenarco torcido Vorhangbogenarco transversal Quergurt,
Transversalbogenarco trebolado, Kleeblattbogen
a. trilobuladoarco triple Drillingsbogenarco Tudor Tudorbogenarea rodeada de Bering
murallas de una fortaleza
arena Arenaareóstilo Aräostylosarimez central Mittelrisalitarista Gratarista del vértice Scheitelrippearista secundaria Liernearmadura con Sprengwerk
tirantes
armadura de techo Bundgespärrearmadura metálica Bewehrungarmario Armariumarmatura Armierungarmazón Werksatzarmazón colgante Hängewerkarmazón de tejado Dachwerkarmazón entrete- Flechtwerk
jido de mimbre con adobe
armazón que sos- Glockenstuhltiene la campana
arquitecto Architektarquitectónico Architektonikarquitectura Architektur,
Baukunstarquitectura apa- Scheinarchitektur
rentearquitectura en Putzarchitektur
estucoarquitectura Architekturmalerei
pictóricaarquitectura simu- Scheinarchitektur
ladaarquitrabado architraviertarquitrabe Architrav, Epistylionarquivolta Archivoltearrabal fortificado Vorburgarranque del arco Bogenanfallarrollo de la calle Gossearsenal Arsenal, Zeughausartesón Deckenfachartesonado Artesonado,
Täfelwerkarticulación Brisure, Gelenkarticulación mural Wandgliederungasclepieion Asklepieionasilo de ancianos Altersheimasilo de pobres Armenhausaspillera Schießscharte,
Schifterasta central Helmstangeastilo Astylosastrágalo Astragalatado Gebindeatado de columnas Bündelsäuleatalaya Geschützturm,
Wachtturm, Wartturm
atectónico atektonischatelier Atelierático Attika, Dachbodenatlante Atlantatrio Atrium, Paradiesatrio abierto de Antarala
templo hindú
649 Spanisch-Deutsch
auditorio Auditoriumaula Aulaaxonometría Axonometrieayuntamiento Buleuterion
griegoazotea Altan, Belvedere,
Söllerazotea jardín Dachgartenazulejo Fliesen, Kachelazulejos Azulejos
bailío Balleibajo moldura Untergliedbajorelieve Flachreliefbalaustrada Balustrade, Dockebalaústre Balusterbalcón Balkon, Erkerbaldaquín Baldachin, Dagum,
Schalldeckelballestera Ballistrarium
cruciformebaluarte Baluardebanda de arquitrabe Faszienbaño ritual judío Mikwebaño turco Hammambanqueta Bankettbaptisterio Baptisteriumbaranda Brüstungbarandilla Geländerbarbacana Armbrustscharte,
Barbakane, Torzwinger
barra Riegelbalken, Stabbarraca Baracke, Bauhüttebarra decorada Blattstab
con hojasbarrera del circo Oppidumbarreras del coro Chorschrankenbarricada Barrikadebasamento Basementbase Basis, Lager,
Postamentbase ática attische Basisbasílica Basilikabasílica con Säulenbasilika
columnasbasílica con cúpula Kuppelbasilikabasílica construída Pfeilerbasilika
con pilaresbasílica con Emporenbasilika
tribunasbasílica escalonada Staffelbasilikabastida Bastidebastidor (Fenster-)Rahmenbastión Ballei, Bollwerk,
Bastei, Bastion
batería Batteriebatiente Anschlag, Fenster-
flügel, SchlagleisteBauhaus Bauhausbeaterio Beg(h)inenhofbeguinaje Beg(h)inenhofberma Bermebiblioteca Bibliothekbiombo Paraventbisagra Angel, Bandeisen,
Scharnierbisel Abgratung,
Schmiegebiselar abfasenbloque errático Findlingbloque perforado Gittersteine
en entramadosbocel Stabbollón Knollebolsa Börsebonete Bonnetborde revestido Fasche
de aberturasbosquejo Schaubildbosquete Boskettbotaguas Wasserschenkelbotarel Strebepfeilerbotón Knollebóveda Gewölbe, Voutebóveda amoldada Spiegelgewölbebóveda anular Ringgewölbebóveda bohemia Platzelgewölbe
planabóveda celular Zellengewölbebóveda con ador- figuriertes
nos geométricos Gewölbebóveda con aristas Gratgewölbebóveda con aristas Kreuzgratgewölbe
en cruzbóveda con cúpula Domikalgewölbebóveda con forma Segelgewölbe
de quitasolbóveda cónica Kegelgewölbe,
Trichtergewölbebóveda con Kreuzrippen-
nervios en cruz gewölbebóveda con Teilgewölbe
pechinasbóveda con piedras Springgewölbe
angulares dis-puestas alterna-damente
bóveda cruciforme Kreuzgewölbebóveda de cañón Tonnengewölbebóveda de cañón Ringtonne
anular
Fachglossar 650
bóveda de cañón Spitztonneojival
bóveda de capas Doppelgewölbeseparadas
bóveda de caracol Schneckengewölbebóveda de claustro Klostergewölbebóveda de dos Zweischichten-
capas gewölbebóveda de espejo Spiegelgewölbebóveda de Stalaktitengewölbe
estalactitasbóveda de Flüstergewölbe
murmullo bóveda de nervios Schlingrippen-
entrelazados gewölbebóveda de pote Topfgewölbebóveda de tracería Maßwerkgewölbebóveda elíptica elliptisches
Gewölbebóveda en abanico Strahlengewölbe,
Fächergewölbebóveda en artesa Muldengewölbebóveda en cañón Halbtonne
semisesgadabóveda en concha Muschelgewölbebóveda en espiral Spiralgewölbebóveda en estrella Sterngewölbebóveda en paraguas Schirmgewölbebóveda esférica Stutzkuppelbóveda falsa falsches Gewölbe,
unechtes G., Plänerg., Scheing.
bóveda helicoidal Spindelgewölbebóveda hexagonal sechsteiliges
Gewölbebóveda moldeada Gußgewölbebóveda nervada Rippengewölbebóveda nervada en Parallelrippen
paralelo gewölbebóveda normanda Trichtergewölbebóveda ornamental Ziergewölbebóveda palmiforme Palmengewölbebóveda perpen- Perpendikulär-
dicular gewölbebóveda rebajada Flachtonnebóveda rebajada böhmische Kappe
de bohemiabóveda reticular Netzgewölbebóveda romboidal Rautengewölbebóveda sobre gestelzt
elevadabóveda transversal Quertonnebóveda tubular Kesselgewölbebóveda vaciada Gußgewölbebóveda y cielo Rabitzgewölbe,
sistema Rabitz Rabitzdecke
bovedilla prusiana preußische Kappebrazo de crucero Querhausarmbrazo de la Treppenarm
escalera imperialbrazos de crucero Kreuzarmebrecha Breschebrochal Wechselbruta y sin labrar Bruchsteinebucráneo Aaskopf, Bukranionbuhardilla Dachboden, Gaubebuhardilla Fledermausdach-
arqueada fensterbuhardilla con te- Schleppgaupe
jado en voladizobulevar Boulevardbungalow Bungalowbunker Bunkerburgus Burgusbutacas posteriores Parterre
caballeriza Marstallcaballero Kavaliercaballete First, Ortziegelcabaña Hütte, Katecabaña en la Bauden
montañacabeza Kopfcabeza de clavo Nagelkopfcabeza de puente Brückenkopfcabeza de viga Balkenkopfcabeza inferior Untergurtcabezas de caballo Pferdeköpfecabildo Stift
eclesiásticocabio Rofen, Sparrencabio de lima-hoya Kehlsparrencabio intermedio Leergespärrecabio montado Reitersparrencabio principal Hauptsparrencabriada de techo Dachbindercabriada maestra Lehrgespärrecabrio Rofencabrio de limatesa Gratsparrencabrio empalmado Gratschifter
a la limatesacadena angular Eckverbandcaja de la escalera Treppenhauscalabozo Kerker, Verliescalato Kalathoscaldario Caldariumcaldera Kesselcalle con gradas Treppenstraßecalle entre Gräberstraße
sepulcroscallejuela Schlippe
cortafuegos
651 Spanisch-Deutsch
calota Kalottecámara Kammercámara del tesoro Schatzhauscamarín Camarin cambio de la junta Schichtwechsel
verticalcampamento Lagercampana de la Rauchfang, Schurz
chimeneacampanario Glockenturmcampanil Glockenturm,
Kampanilecampo atrincherado Camp retranchécaña Dienstcanal de desagüe Grachtcanal descendente Fallrohr
de aguas plu-viales
canaleta Rinnecanaleta de desagüe Ablaufrinnecanalón Dachrinne, Rinne,
Traufecanalón de corte Kastenrinne
transversal rectangular
canalón de tejado Kandelcandelabro Kandelabercanéfora Kanephorecañonera Embrasurecaño pluvial Ablaufrohrcántaro Kantharuscanto acodado Kropfkantecantonado kantoniertcapa de estuco Putzhautcapa de ladrillos Durchschuß
para refuerzocapa niveladora Ausgleichsschichtcaperuza de la Kaminaufsatz
chimeneacapialzado Laibungsbogencapilla Bethaus, Kapellecapilla absidal Chorkapellecapilla absidial Apsidialkapellecapilla de campo Feldkapellecapilla de Karner
cementeriocapilla de la Marienkapelle
Santa Virgencapilla del castillo Burgkapellecapilla del palacio Palastkapellecapilla del sagrario Sakramentskapellecapilla de Bußkapelle
penitenciacapilla de puente Brückenkapellecapilla de Michaelskapelle
San Miguel
capilla de un Schloßkapellecastillo
capilla funeraria Grabkapellecapilla lateral Einsatzkapellecapilla mortuoria Grabkapellecapilla para la Beichtkapelle
confesióncapilla privada Hauskapellecapilla saliente Scheitelkapellecapillas dispuestas Kapellenkranz
en forma radialcapillas gemelas Zwillingskapellecapillas super- Doppelkapelle
puestascapitel Kapitell, Knaufcapitel acampanado Glockenkapitellcapitel adornado Knospenkapitell
con capulloscapitel adornado Blütenkapitell
con florescapitel adornado Blattkapitell
con hojascapitel bizantino Trapezkapitellcapitel compuesto Kompositkapitellcapitel con figuras Figurenkapitellcapitel con forma Korbkapitell
de canastocapitel con forma Pilzkapitell
de hongocapitel con gallones Pfeifenkapitellcapitel con Volutenkapitell
volutascapitel cúbico Würfelkapitellcapitel cúbico do- Doppelwürfel-
ble /dividido kapitellcapitel decorado Adlerkapitell
con águilascapitel de Stalaktitenkapitell
estalactitascapitel del anta Antenkapitellcapitel dórico dorisches Kapitellcapitel en cáliz Kelchkapitellcapitel eoliano äolisches Kapitellcapitel lobulado Laubkapitellcapitel taurino Stierkapitellcapitolio Kapitolcapítulo de una Stift
ordencapuchón Schornsteinaufsatzcapullo del capitel Knollecapullo rastrera Krabbe
que adornaun borde
caquete Kalottecara Hauptcaravanera Karawanserei
Fachglossar 652
caravanserrallo Karawansereicarbonera Gelaßcariátide Karyatidecarrera Rähmcartela Konsolecartucho Kartuschecartuja Kartausecasa Hauscasa a dos aguas Giebelhauscasa capitular Kapitelhauscasa con atrio Atriumhauscasa con frente de Dreifensterhaus
tres ventanascasa con glorieta, Vorlaubenhaus
c. con pérgolacasa con púlpitos Kanzelhauscasa cueva Grubenhauscasa de arriendo Miethauscasa de campo Bauernhauscasa de campo Rauchstubenhaus
con cocina sin campana
casa del abate Abtshauscasa de la comuna Gemeindehauscasa de limosnas Almosenhauscasa de moneda Münzecasa de vidrio Glashauscasa en hilera Reihenhauscasa habitación Wohnhauscasamata Kasemattecasa natal Geburtshauscasa para celebrar Hochzeitshaus
matrimonios /bodas
casa patricia Patrizierhauscasa torre Turmhauscascada Kaskadecaseta sobre un Brunnenhaus
pozocasino Kasinocastillo Kastell, Schloßbaucastillo de los Kreuzfahrerburg
cruzadoscastillo de una Ordensburg
orden religiosacastillo fortificado Burgcastillo rodeado Wasserschloß
de fosocatacumba Katakombecatafalco Katafalkcátedra Kathedracatedral Bischofskirche,
Dom, Kathedrale, Münster
catolicón Katholikoncavea Kerkides
caveto Deckenkehle, Hohlkehle
celda Klause, Zellecelda de penitencia Bußzellecelosía Jalousiecementerio Coemeterium,
Friedhofcenefa Markisecenobio Koinobioncenotafio Kenotaph,
Scheingrabcentral de defensa Kernwerk
de una fortalezacentro de la voluta Schneckenaugecentro urbano Stadtkerncepa de un puente Flußpfeilercerámicos Baukeramikcerca Zauncercha de Fachwerkbinder
entramadocerco de una Zarge
ventanacerradura Schloßcerradura de torni- Einreiber-Verschluß
quete embebidocerramiento a Espagnolette-
la españoleta Verschlußcerrojo Riegelcerrojo de ventana Fensterverschlußchaflán Polsterquader,
Schmiegechaflanado Fasechaflanar abfasenchapeado Verblendungcharnela Band, Scharnierchaveta Splintchimenea Esse, Kamin, Schlot,
Schornsteinchimenea de Abzugskamin
ventilaciónciborio Ziboriumciega Blendarkadecielo Deckecielo de tabletas Riemchendeckecielo de tablones Bohlendeckecielo falso Zwischendeckecielo nervado Rippendeckecielo raso bordeado Spiegeldecke
de moldurascielorraso Plafondcielorraso Felderdecke
artesonadocielorraso con Holzbalkendecke
vigas de maderacielorraso curvo Hourdidecke
tipo hourdi
653 Spanisch-Deutsch
cielorraso quebrado gesprengte Deckecierre de viga Balkenriegelcima Scheitelcimacio Kymacimacio lesbio Wasserlaubcimbra Kuf, Lehrgerüstcimera Gesprengecimiento Fundamentcincelar scharrierencintra Kuf, Lehrgerüstcipo Zippuscipo funerario Grabzippuscirco Zircuscírculo de piedras Steinkreiscircunvalación Ringstraßecisterna Zisternecítara Zitherciudad Stadtciudadela Kastell, Zitadelleciudad ideal Idealstadtciudad jardín Gartenstadtciudad junto a un Burgstadt
castillociudad radial Radialstadtciudad satélite Trabantenstadtcizalla Schereclaraboya Dachfenster, Luke
Obergaden, -lichte claristorio Gadenclaustro Kreuzgangclave de arco Schlußsteinclave pendiente Abhänglingcobertizo Remise, Schuppencochera Remisecodal Spreizecodo Winkelholzcofia de tejado Dachhaubecofre Koffercofre del altar Altarschreincolgadura Tapetecoliseo Kolosseumcollarino Anulicollar toscano Halsringcolocación Versetzencolumbario Kolumbariumcolumna Säulecolumna anillada Bund-, Ringsäulecolumna anudada Knotensäulecolumna Schlangensäule
balaustradacolumna cretense kretische Säulecolumna de apoyo Stützecolumna de Júpiter Jupitersäulecolumna delgada junger Dienst
embebidacolumna de triunfo Triumphsäule
columna de un Giebelsäulefrontón
columna egipcia Hathorsäulehathórica
columna embebida Dienst, Dreiviertel-c. entregada säule
columna entregada WandsäuleDreiviertelsäule
columna grutesca Grottensäulecolumna loto Lotossäulecolumna Palmensäule
palmiformecolumna Papyrussäule
papiroformecolumna persa persische Säulecolumna protodorische Säule
protodóricacolumnata Kolonnade,
Säulengangcolumna triunfal Siegessäulecolumna votiva Betsäulecomandancia Komtureicomedorm para Imaret
estudiantes necesitados
comodidad Commoditécompartimento del Gefach
entramadocomplejo Baugrupppe
arquitectónicocomplejo de tres Dreiflügelanlage
alascomposición des- Palladio-Motiv
arrollada por Serlio y Palladio
concha Koncheconducto de Luftschacht
ventilaciónconducto del humo Fuchsconexión Anschlussconfesionario Konfessioconsola Konsoleconstrucción Bauwerkconstrucción offene Bauweise
abiertaconstrucción con Lehmwellenbau
adobesconstrucción con Lehmstampfbau
arcilla apisanadaconstrucción con Lehmfachwerk
entramado en arcilla
construcción con Skelettbauestructura de entramado
Fachglossar 654
construcción con Stahlskelettbauestructura metálica
construcción con Lehmpatzenbauladrillos de arcilla
construcción Memorialbauconmemorativa
construcción con Plattenbauweisepaneles prefa-bricados
construcción de Vierkonchenanlagecuatro conchas
construcción de Palisadenbauempalizada
construcción de Fachwerkbauentramado
construcción de Backsteinbauladrillos
construcción del Theaterbauteatro
construcción de Holzbaumadera
construcción de Ständerbaumontantes
construcción de Zentralbauplano central
construcción de Langbauplanta longi-tudinal
construcción de Grabbausepulcros
construcción de Dachkonstruktiontejado
construcción de Tribolontres arcadas en la iglesia bizantina
construcción de Blockbautroncos
construcción de Grabbautumbas
construcción Stabbauempalizada
construcción en Pisébauweiseadobe
construcción en Gebäude, Geschoß-altura bau, Hochbau
construcción en Lehmbauweisearcilla
construcción en Lamellenbauláminas
construcción en Seilkonstructionmalla de cables
construcción en Längswand-muros longitu- bauweisedinales
construcción en Stockwerkbaupisos
construcciones Megalith-Bautenmegalíticas
construcciones Ballon-Bautenneumáticas
construcciones para Messebautenferias comerciales
construcción Wehrbaufortificada
construcción Wohnbauhabitacional
construcción Industriebauindustrial
construcción ma- Gewölbeschalesiva de una bóveda
construcción Westwerkponiente anexa
construcción Montagebauprefabricada
construcción pre- Nuragehistórica de piedra
construcción Zeltdachkon-resistente struktiontipo pabellón
construcción Rustikarústica
construcción sacra Sakralbauconstrucción
sólida Massivbauconstrucción Tiefbau
subterráneacontracción angular Eckkontraktioncontraescarpa Contrescarpecontrafijo Bügecontrafuerte Sporn, Strebepfeiler,
Strebewerkcontrafuerte para Pfeilervorlage
pilastrascontrahuella Blind-, Setzstufe
Treppensteigungcontrapuerta Doppeltürcontravidriera Doppelfenstercontraviento Windverbandconvento Kloster, Konventconvento rupestre Felsenklostercopete Walm, Fußwalmcopete del frontón Schopfwalmcordón Cordonstein, Stabcornisa Arkaden-, Dach-
gesims, Karnies, Verdachung,(Fenster-)Gesims
cornisa con Kämpfergesimsimposta
655 Spanisch-Deutsch
cornisa con Konsolgesimsménsula
cornisa cubrejuntas Deckgesimscornisa de la solera Sohlbankgesims
de la ventanacornisa del cielo Deckengesimscornisa de Fensterverdachung
ventanacornisamento Giebelgesimscoro Chorcoro alto Emporecoro con corredor Umgangschorcoro con naves Hallenchorcoro con tres Dreizellenchor
nichoscoro de las monjas Nonnenemporecoro de los monjes Mönchschorcoro escalonado Staffelchorcoro inferior Unterchorcorona Gurtgesims, Kranz,
Krone, Coronacorona de una Gewölbekappe
bóvedacorona del muro Mauerkronecoronamiento Bekrönung,
Couronnementcoro occidental Westchorcoro poligonal Polygonchorcoro poniente Westchorcoro rectangular Rechteckchorcoro triabsidal DreiapsidenchorCorps de logis Corps de logiscorral Kraalcorrea Dachpfette, Pfettecorrea de cumbrera Firstpfettecorrea inferior Fußpfettecorredor Gang, Korridorcorredor arqueado Bogengangcorredor de
distribución Hausflurcorredor exterior Laubecorredor sub- Cryptoportikus
terráneocortagoteras Wassernasecorta lágrimas Gurtgesimscorte de juntas Bogenquaderungcorte del borde Randschlagcorte del Rey Artushof
Arturocorte de piedras Steinschnittcorte real Königshofcortina Kurtinecrematorio Krematoriumcresta Cretecripta Kryptacripta anular Ringkrypta
cripta con naves Hallenkryptacripta externa Außenkryptacristal Fensterscheibecristal abombado Butzenscheiben
y emplomadocrítica de Architekturkritik
arquitecturacroquis Schaubildcrucero Querhaus, Transept,
Vierung, Zangecrucero de una Hallenquerhaus
iglesia con varias naves
crucero de ventana Fensterkreuzcrucero occidental Westquerhauscrucifijo bajo el Triumphkreuz
arco de triunfocrugía Zimmerflucht,
Gewölbefeldcruz Kreuzcruz de San Andrés Andreaskreuzcruz de San Antoniuskreuz
Antoniocruz de tau Taukreuzcruz de ventana Kreuzstockcruz griega griechisches Kreuzcruz latina lateinisches Kreuzcuaderna Rippecuaderna de bó- Bandrippe
veda con perfil rectangular
cuaderna de un Scheidbogenrippearco lateral
cuaderna diagonal Diagonalrippecuaderna falsa Blendrippe
c. simuladacuaderna triradiada Dreistrahlcuadra Baublockcuadral (Kopf-)Bandcuadratura Quadraturcuadrícula Quadrierungcuadrícula de Kassette
artesonadocuartel Kasernecuarto Raum, Stubecuarto de aseo Tonsurcuartón Lagerholzcuarto para alimen- Vorgelege
tación de las estufas
cuarto sin salida gefangener Raumdirecta
cuatrifolio Vierblattcubertura de una Kreuzkappe
bóveda en cruzcubeta Cuvette
Fachglossar 656
cubículo Cubiculumcubierta de Dachsattel
cumbreracubierta de losa Plattenbalkendecke
con vigas Tcubierta de losa Plattendecke
sin soportescubierta de tejado Dachdeckung, -hautcubierta en cúpula Kuppeldachcubierta en salien- Kragdach
te, c. en voladizo cubierta en volado Schalecubierta sólida Massivdeckecubrejunta Lasche, Deckleistecuello Halscuerpo Baukörpercuerpo del pináculo Rumpfcumbrera First, Giebelbalkencuña en el Scamillus
estilóbatocuneta Abschlag, Rinnstein,
Abzugsgrabencúpula Kuppelcúpula aplanada Flachkuppelcúpula bizantina byzantinische
Kuppelcúpula con tejado Zwiebelkuppel
imperial / persacúpula de apoyo Hängekuppelcúpula de Stalaktitenkuppel
estalactitascúpula externa Außenkuppelcúpula nervada Rippenkuppelcúpula plegada Faltkuppelcúpula protectora Schutzkuppel
exteriorcúpula sobre una Trompenkuppel
trompacúpula sobre un Vierungskuppel
crucerocuria Kuriecurva del ojo Kröpfling
de escaleracurvatura Kurvaturcúspide de tejado Dachhelm
deambulatorio (Chor-), Umgangdecastilo Dekastylosdeclive de Kaffgesims
derramedecoración Dekorationdecoración angular Eckzierdecoracion Muschelwerk
conchiformedecoración de Bandelwerk
volutas
decoración en Sägezahnverzierungdiente de sierra
decoración en Stuckdekorationestuco
decoración pictó- Fassadenmalereirica de la fachada
decoración pictóri- Deckenmalereica del cielorraso
decoración tallada Faltwerken pliegues
decorado Dekordecorado de hojas Blattwelledefensa en fuerte Blendedefensas en una Paraflanc
trincheradentellón Zahnschnittdentículo Zahnschnittdentículos Kälberzähnedependencias Communsdepósito Magazin,
Speicherderrame Fensterlaibungderrame de la Fensterschräge
ventanadesaguadero Abschlagdesarrollo Abwicklungdesarrollo de la Fassadenabwicklung
fachadadesarrollo del Manier
sistema de bastio-nes / baluartes
descanso Absatz, Podest, Treppenabsatz
diacónico Diakonikondiagonal Kopfstrebediagonales de Kreuzstrebe
refuerzodiástole Diastolediazoma Diazomadibujo de Bauzeichnung
construccióndiglifo Diglyphdimensiones lichte Maße
interioresdintel Fenstersturz, Sturz,
Türsturzdintel escotado scheitrechter
d. plano Sturzdiosa egipcia del Hathortempel
amordique transversal Bärdiseño Bauzeichnung,
arquitectónico Baurißdisposición de Säulenbogen-
arcos entre stellungcolumnas
657 Spanisch-Deutsch
disposición de zweibündigdos crugías
distancia entre Spann-, Stützweitelos apoyos
distancia Bauwichreglamentaria
distintivo de Hausmarkeuna casa
divergencia Divergenzdoble cuartón Doppelschifterdobleventana Doppelfensterdodecástilo Dodekastylosdolmen Dolmendormitorio Dormitoriumdosel Dagumdoselete Dagumdovela Rückendovela de arran- Gewölbeanfänger
que de una bóveda
dovelaje Archivoltedrapeado Draperiedrenaje Abzugsgrabendromos Dromosducto Schachtducto de luz Lichtschacht
edículo Ädikulaedificación junto Gerichtslaube
a la iglesia /al ayuntamiento
edificio Bauwerk, Gebäude, Geschoßbau
edificio alto Hochhausedificio con Laubenganghaus
corredores exteriores
edificio con Saalbauuna sala
edificio de Parkhausestacionamientos
edificio del Bühnenhausescenario
edificio de Empfangsgebäuderecepción
edificio en forma Sternhausde estrella
edificio escalonado Terrassenhausen terrazas
edificio esférico Kugelhausedificio exterior Vorwerkedificio palaciego Hôteledificio para Bürohaus
oficinasedificio profano, Profanbau
e. secular
edificios para Kirchenbautencomunidades religiosas
edificios públicos Bürgerbautenedificio tipo torre Punkthausedificio transitable Durchfahrthausegión (ejión) Knaggeeje Achseeje de la ventana Fensterachseeje de una bóveda Gewölbeachseelemento Bauelement
constructivoelemento deco- Drolerie
rativo grotescoelemento Bauglied
estructuralelementos con- Dachaufbauten
structivos del tejado /techo
elevación Aufriß, Frontelevación de arco, Stelzung
e. de bóvedaelevación del arco Bogenhöhe, -pfeilembarbillado Versatzungembasamiento Bankettemblema Emblemempalme Stoßempapelado Tapeteemparejado gekuppeltemparejamiento Flucht
de edificios empuje Schubempuje horizontal Horizontalschubempuje lateral Seitenschubencabriado de Gespärre
cubiertaencaje Versatzungencastre Anschlitzungencastre de madera Kammencastre tipo garra Klaueencofrado Schalungenfermería de un (In-)Firmarie
monasterioenfilade Enfiladeengatillado vertical Stehfalzengobe Engobeengrosamiento cu- Schnabel
neiforme de un muro defensivo
enjarge Zahnsteineenlucido Feinputzenlucido áspero Rapputz, Rauhputzenrayado Werksatzenrejado Gatter, Gitter ensambladura Blatt, Falz, Holz-
verbindungen
Fachglossar 658
ensambladura a Schwalbenschwanzcola de milano
ensamblaje Holzverbindungenensamblaje angular Eckkammensamblaje por en- Einhälsung
cabriamiento en Tensamble Holzverbindungenensamble a media Überblattung
maderaensamble a media Hakenblatt
madera con tacónensamble angular Ecküberblattung
a media maderaensamble Lang- und
combinado Kurzwerkensamble cruzado Überschneidungensamble de espiga Verzapfungentalladura Kerbschnittentalladura de Kerbzinne
almenaentarimado Täfelwerkentarugar Verdübelungéntasis Entasisentorchado Taustabentramado de Dachstuhl
tejadoentrelazado Bandverschlingungentrepaño Gewölbefeld,
Trumeauentrepiso Mezzaninentrepiso colgante, Hängeboden
e. suspendidoentreventana Fensterpfosten,
Setzholzenvigado Balkenlage, Gebälkenvigado colgante Hänge-Sprengwerkenvigado reforzado Freigespärreenvoltura de fierro Eisenschuh
fundidoepistilo Epistylionepitafio Epitaphepitraquelión Hypotrachelionequino Echinus, Polsterera Tenneerario Aerariumermita Eremitageescala de propor- Modulor
ciones de Le Corbusier
escálamo Dollenescalera Treppeescalera caracol Wendeltreppeescalera caracol Wendelstein
con caja caladaescalera con gradas freitragende Treppe
en voladizo
escalera con uno o Podesttreppemás descansos
escalera de caracol Schnecke, Spindel, Spindeltreppe
escalera de emer- Feuertreppe, gencia / escape Nottreppe
escalera de pel- Satteltreppedaños sentados
escalera exterior Außentreppeescalera inclinada Reitstiege
para los caballosescalera mecánica Rolltreppeescalinata Freitreppe, Grede,
Perronescalinata de Beischlag
ingresoescalón Sprosse, Stufeescalonamiento Abtreppungescaño triple Dreisitzescaparate Schaufensterescarpa Böschung,
Escarpeescayola Stucco lustroescenario Bühneescenario Guckkastenbühne
enmarcadoescenario Drehbühne
giratorioescenario moderno Raumbühne
unido a la sala de espectadores
escodar stockenescopladura Verkämmungescotilla Lukeescudo Schildescuela árabe Medreseescultura Skulpturescultura Bauplastik
arquitectónicaescultura del Herme
dios Hermesesgrafiado Sgraffitoespacio bajo el Dachraum
techoespacio central Zentralraumespacio entre dos Interkolumnium
columnasespacio pequeño Gelaßespacio umbauter Raum
reconstruídoespaldas Schulterespejo del cielo Deckenspiegelespejuelo Marienglasespiga Ähre, Zapfenespiga central Kaiserstiel,
Helmstange
659 Spanisch-Deutsch
espiga con ensam- Blattzapfenbladura gruesa
espiga oblicua Jagdzapfenespigón de un Giebelähre
frontónespina de pez (tra- Fischgrat
bazón o aparejo)espiral Spirale, Voluteespolón Spornesquema de módu- quadratisches
los cuadrados Schemaesquema Proportions-
de proporciones schlüsselestablecimiento Armenhaus
de caridadestación de Correo Posthofestática Statikestatua de Rolando Rolandestela Steleestereóbato Krepidoma,
Stereobatestilizar stilisierenestilo Stil, Manierestilo gótico Flamboyant
flamígeroestilo perpen- Perpendicular style
dicularestípite Stipesestrado Estradeestrechamiento Einziehungestría Riefelungestrías Kannelurenestribo Widerlagerestructura de Gefüge
maderaestructura de Dachwerk
tejadoestructura diáfana diaphane Strukturestructura espacial räumliches
Tragwerkestructura mural Wandaufbauestructura mural Lopatka
rusaestructura plegable Faltwerkestructura resisten- Flächentragwerk
te bidimensionalestructura räumliches
tridimensional Tragwerkestucado Stuckaturestucado fino Feinputzestuco Putz, Stuckestuco de arcilla Lehmputzesviaje Gehrungetapa Bauabschnittexcavaciones Grabenexedra Exedra
explanada Esplanadeextensión urbana Stadterweiterungextremo de viga Balkenkopf
faceta Facettefachada Fassade, Frontfachada de dos Doppelturmfassade,
torres Zweiturmfassadefachada de la torre Turmfassadefachada de torre Einturmfassadefachada falsa Blendfassadefachada occiden- Westbau
tal, f. ponientefachada principal Schaufassadefachada simulada Blendfassadefaisanería Fasaneriefajina Faschinefalso cielorraso Fehlbodenfalso tirante Kehlbalkenfanal de cementerio Totenleuchtefarmacia Apothekefaro Leuchtturmfase de Bauabschnitt
construcciónfenestella Fenestellafestón Festonfilete Stegfiligrana Filigranflanco Flankeflecha Stichflecha del arco Bogenpfeilflecha de la torre Turmhelmfleje Bandeisenflor de ábaco Abakusblumeflorón Giebelblume,
Kreuzblumeflorón adornado Knorre
con capullosflor rastrera Krabbe
que adornaun borde
follaje Blattwerkfontana Springbrunnenforma de colgar Imbrex
tejas árabes /huecas / de canal
forma de Acoltellopavimento
formación de Verzahnungdentículos
formas de arcos Bogenformenformas de tejado Dachformenformas de ventana Fensterformenforo Forumforro Futterfortaleza Bastille, Fort
Fachglossar 660
fortaleza rodeada Wasserburgde foso
fortaleza rupestre Felsenburgfortificación Rempartfortificación Landwehr
defensivafortificación de Abschnitts-
un sector befestigungfortificación Stadtbefestigung
urbanafortín de campo Feldschanzefosa Graben, Gruft,
Gracht, Schachtfoso alrededor de Halsgraben
una fortalezafoso de la orquesta Orchestergrabenfoso de un sector Abschnittsgrabenfoyer Foyerfrente Stirn, Frontfresco Freskomalereifresco con triglifos Triglyphenfriesfriso Friesfriso arqueado (Rund-)Bogenfriesfriso artesonado Felderfriesfriso bucráneo Ochsenschädelfriso con figuras Figurenfriesfriso de arcos Kreuzbogenfries
ojivalesfriso de Gitterfries
mamposteriafriso dentado deutsches Band,
Zahnfriesfriso de palmetas Palmettenfriesfriso discoidal Scheibenfriesfriso en escamas Schuppenfriesfriso en paneles Plattenfriesfriso escaqueado Schachbrettfriesfriso formado Blattfries
por hojasfriso romboidal Rautenfriesfrontis Schaufassadefrontispicio Frontispizfrontispicio Treppengiebel
con peldañosfrontón Sprenggiebel,
Giebel, Frontispizfrontón Glockengiebel
acampanadofrontón con Volutengiebel
volutasfrontón escalonado Staffelgiebelfrontón falso Blendgiebelfrontón ornamental Ziergiebelfrontón principal Schaugiebelfrontón quebrado gesprengter Giebelfrontón simulado Blendgiebel
frontón sobre la Fenstergiebelventana
fuente Brunnen, Kantharusfuente de tazas Schalenbrunnenfuente turca Sebilfuerte Festung, Fortfuga de empalme Stoßfugefundación Fundamentfundición de piedra Steingußfuste Leibfuste de la columna Rumpf, Schaft
gabinete Kabinettgalería Galerie, Laube,
Laufgang, Wandelhalle
galería alta Emporegalería con colum- Zwergalerie
nas enanasgalería de los Spiegelgalerie
espejosgalería de las Nonnenempore
monjasgalería de tribunas Emporenumganggalería real Königsgaleriegalería simulada Scheinemporegalería subterránea Stollen, Crypto-
portikusGalilea Galilaeagallón Pfeifegancho Nasegancho de apoyo Rinneisen
del canalóngancho para muro Mauerhakengarganta Hohlkehlegarganta de tejado Dachkehlegárgol Verblattunggárgola Abtraufe,
Wasserspeiergarita Auslugerker, Schar-
wachtturm, Schil- derhaus, Ausschuß
geison Geisonghetto Ghettogigante Gigantgineceo Gynäkeionglacis Glacisgliptoteca Glyptothekglorieta Gartenlaube, Laubegobelino Wandteppichgola Kymagorja Säulenhalsgota Guttaegoterón Gurtgesims, Unter-
schneidung, Wassernase
661 Spanisch-Deutsch
grada con corte Keilstufeacuñatado
gradería de un Gredecastillo
granero Banse, Kornhaus,(Feld-)Scheune, Grangie, Speicher
granja Farm, Gehöftgranja con instala- Zwiehof
ciones separadasgremio de los Bauhütte
constructoresgres Steinzeuggrotesca Groteskegrupo de tres torres Dreiturmgruppegruta Grotteguarda ruedas Radabweiserguardacantón Prellsteinguardapolvo Fußleisteguardarropa Vestiariumguardarropas Garderobehabitación Stube, Dornsehabitación Dürnitz
calefaccionada
hacienda Farmhall Hallehangar Hangarharem, harén Serail, Haremhaz de cañas unidas Dienstbündel
en un pilarhaz de columnas Säulenbündelhélice Helikesherraje Beschlagherraje en cruz Kreuzbandhexagrama Sechsorthilada Auflanger, Läufer,
Schar, Schichthilada de ladrillos Stromschicht
en espigahilera de ladrillos Rollschar
colocados de canto
hipocausto Hypokaustenhipódromo Hippodromhipogeo Hypogäumhipóstilo Hypostylhoja Fensterflügelhoja de la puerta Türblatthoja de madera Furnierehoja de ventana Sprossenfenster
dividida en compartimientos
hojalatería de Abweiseblechproteccion
hoja Tudor Tudorblatt
hormigón Betonhormigón a la Sichtbeton
vistahormigón armado Stahl-, Eisenbetonhospedería Hospizhospicio Hospizhospital Hospital,
Krankenhaushospital de un (In-)Firmarie
monasteriohostería Gasthaushueco interior que Hohlspindel
forma una escalera caracol
hueco para anclar Gerüstlöcherel andamio
huella Trittstufehuella de escalera Lauf
iconostasio Ikonostasisiglesia anexa Vorkircheiglesia circular Rundkircheiglesia con cúpulas Kreuzkuppelkirche
cruzadasiglesia con dos doppelchörige
coros Anlageiglesia con- Denkmalkirche,
memorativa Memoriaiglesia con naves Hallenkircheiglesia con Wandpfeilerkirche
pilastras muralesiglesia con torre Chorturmkirche
de coroiglesia con Emporenhalle
tribunasiglesia conventual Klosterkircheiglesia de Coemetrialkirche
cementerioiglesia de Wallfahrtskirche
peregrinacióniglesia dispuesta Dreikonchenanlage
en tres conchasiglesia episcopal Bischofskircheiglesia escandinava Stabkirche
empalizadaiglesia fortificada Wehrkircheiglesia inferior Unterkircheiglesia monástica Klosterkircheiglesia parroquial Pfarrkircheiglesia rupestre Felsenkirche,
Höhlenkircheiglesias contiguas Doppelkircheiglesias de frailes Bettelordenkirchen
mendicantesiglesias de la Dreifaltigkeits-
Trinidad kirchen
Fachglossar 662
iglesia tipo sala Saalkircheiglesia triabsidal Dreiapsidenanlageimagen de Architekturbild
arquitecturaimposta Kämpferimposta cruzada Gratbogenimposta de arco Anwölberimposta superior Anfangssteinimposte de Gewölbeanfänger
arranque de una bóveda
inclinación del eje Achsenneigunginclinación de Dachneigung
tejadoincrustación Inkrustationinglete Gehrunginodoro Klosettinscripción de Bauinschrift
un edificiointercolumnio Interkolumnium,
Säulenweiteintercolumnio de Gewölbefeld
una bóvedainvernadero Gewächshausinvernadero para Palmenhaus
palmerasisometría Isometrie
jabalcón Drempeljamba Gewände, Laibung,
Stieljambas Fenstergewändejardín Gartenjardín de invierno Wintergartenjardín francés französischer
Gartenjardín inglés englischer Gartenjardin rocoso Steingartenjefe de obras Baumeisterjuegos de agua Wasserkünstejunquillo Rundstabjunquillo anillado Ringstabjunta Baunaht, -Fugejunta abierta Bruch-, Hohlfugejunta al muro Streichbalkenjunta de Setzfuge
asentamientojunta de dilatación Dehnfugejunta de imposta Anfangsfugejunta de sepa- Arbeitsfuge
raciónjunta en el vértice Scheitelfugejunta hueca Hohlfugejuntura Fugejuntura en forma Keilfuge
de cuña
kiosco Kioskkremlin Kreml
laberinto Labyrinthlabrado de la Steinbearbeitung
piedralado de la epístola Männerseitelado del evangelio Epistelseitelado de los Evangelienseite
evangelioslado norte de la Frauenseite
nave centralde una iglesia
ladrillo Fliesen, Mauerziegel
ladrillo acuñado Keilsteinpara bóvedas
ladrillo artificial- Lohsteinmente poroso
ladrillo cocido Backsteinladrillo de arran- Kämpferstein
que / impostoladrillo de Verblender
paramentoladrillo de vidrio Glasbausteinladrillo en el apa- Binder
rejo de cabezaladrillo formado Formsteinladrillo holandés Klinkerladrillo hueco Hohlblocksteinladrillo moldeado Formstein
formadoladrillo vítreo Klinkerlarario Larariumlarguero superior Obergurtlata del tejado Ziegellattelaura Lawralavabo Tonsurlavamanos Lavabolavatorio Lavatoriumleñera Gelaßlengüeta Anschlag, Einschub,
Federlengüeta de muro Mauerzungeletrina Abtritt, Latrinelima-hoya Kehle, Dachkehlelimatesa Gratsparrenlimón Treppenwangelinea capital Capitallinielinea de arranque Kämpferlinielinea de circun- Enceinte
valaciónlinea de imposte Kämpferlinielinea del vértice Scheitel-, Anfallinielinterna Laternelinternón Dachreiter
663 Spanisch-Deutsch
listel Saumleistelistel acanalado de Karniesrinne
la gola / del cimacio
listel de inter- Einschubleisteposición
listón Band, Latte, Leistelistón acodado Kropfleistelistón de cuña Gratleistelistón del zócalo Sockel-, Fußleistelistón de muro Mauerlattelistón de tejado Dachlattelistones que Sprosse
dividen la hoja de una ventana
listones triangulares Dreikantleistenliza Turnierhofllave de pro- Proportions-
poreiones schlüssellóbulo Paßlocales comer- Ladenbauten
cialesLoculus Nischengrablogia Loggialosa (Decken-)Plattelosange Rauteloza de Fayenza Fayencelucarna Lukarne, Dach-
erker, -häuschenlugar Ortlugar consagrado a Matroneum
las matronaslugar consagrado a Nymphaeum
las ninfaslugar de culto al Mithräum
dios Mitralumbrera Dachfenster, -lukeluneta Ohr, Stichkappeluneto Lünetteluquete Kalotte
machihembrado Spundungmachón Pfeilermadeja Gebindemadera escuad Lagerholz
radamaderamen de Dachgespärre
cabios de tejadomaderamen de Nagelbinder
clavosmaderamen Freigespärre
reforzadomaderas cruzadas Kreuzholzmadero Diele, Bohlemadero cojo Stichbalkenmadero de relleno Füllholz
maderos del Schenkelbastidor de una ventana
mampostería wendischer Verband,Mauer-, Steinwerk
mampostería Zyklopenmauer-ciclópea werk
mampostería de Verblendmauer-paramento werk
mampostería de Werksteinmauer-piedras labradas werk
mampostería de Schichtmauerwerkpiedras talladas
mampostería de Hintermauerungrelleno
mampostería de Werksteinmauer-sillares werk
mampostería en lagerhaftes piedra de Mauerwerkcantera lisa
mampostería en Feldsteinbaupiedra rupestre
mampostería falsa Blendmauerwerkmampostería hueca Hohlmauerwerkmampostería Vollmauerwerk
macizamampostería Polygonalmauer-
poligonal werkmampostería seca Trockenmauerwerkmampostería Blendmauerwerk
simulada mansarda Dachwohnung,
Mansardemanzana Baublockmaqueta Baumodellmarca del cantero Steinmetzzeichenmarca del maestro Meisterzeichen
de obramarco Fensterrahmen,
Rahmen, Türstockmarco articulado Gelenkrahmenmarco de una Zarge
ventanamarco fijo Blendrahmenmarquesina Markisemarquetería Marketeriemartirio Martyriummáscara a
potropaica Neidkopfmáscara foliácea Blattmaskemascarón Maskaronmastaba escalonada Stufenmastabamastador Aufsteigsteinmástil Mastmatacán Maschikuli, Pech-
nase, Senkscharte
Fachglossar 664
mausoleo Mausoleummazmorra Kerkermeandro laufender Hund,
Mäandermedallón Medaillonmediacaña Hohlkehlemedialuna Demilunemedio rodón Halbholzmégaron Megaronmenhir Menhirménsula Balkenstein, Kon-
sole, Kraftstein, Tragstein, Krag-stein
mercado central Markthallecubierto
merlón Zinnemeta Metametal extendido Streckmetall
m. desplegadométopa Metopemezquita Moscheemezquita funeraria Grabmoscheemica Marienglasmikrab Mihrabmimbar Mimbarmina Mineminarete Minarmirador Aussichtstempel,
Belvedere, Erkermisericordia Miserikordiemodillón Balken-, Notsteinmodillón de Kraftstein
piedramodo de Bauweise
construcciónmódulo Modulmoldura Cordonstein,
(Fenster-)Gesims, Rinnleiste
moldura Gurtgesimsacordonada
moldura ajed Würfelfriesrezada
moldura cóncava Kehlgesimsmoldura con Konsolgesims
ménsulamoldura con perfil Dreiviertelstab
de tres cuartos de círculo
moldura convexa Eierstabornamental
moldura cortada Rollenfriescilíndrica
moldura Kaffgesimscortagoteras
moldura de cuentas Perlstabmoldura de Kämpfergesims
impostamoldura de la Fensterbankgesims
repisa / soleramoldura de la Wasserschlag
ventana de medio punto
moldura del zócalo Fuß-, Sockelgesimsmoldura de ma- Kastengesims
dera tipo cajónmoldura de viga Balkengesimsmoldura exterior Fenstereinfassung
de ventanamoldura oblicua Schräggesimsmoldura principal Hauptgesimsmoldura redonda Stabmoldura seccionada Birnstab
en forma de peramolo Molemonasterio Kloster, Konventmonasterio dúplice Doppelklostermonóptero Monopterosmontaña Bergmontante Mullion, Ständer,
Transommontante de la Kämpferholz
ventanamontante principal Bundständermontea Pfeil, Stichmonumento Denkmalmonumento con- Ehrendenkmal
memorativo alos caídos
monumento corega choregisches Monument
monumento del Grabdenkmalsepulcro
monumento de Grabdenkmaltumba
monumento en Ehrensäuleforma de columna
monumento Grabdenkmalfunerario
morisco Maureskemortaja Verkämmungmortero Mörtelmosaico Mosaikmota Mottemotel Motelmunicipalidad Rathausmuralla Rempartmuralla de descarga Dechargemauermuralla de la Stadtmauer
ciudad
665 Spanisch-Deutsch
muralla de sector Abschnittswallmuralla exterior Vormauermuralla moldeada, Gußmauerwerk
m. vaciadamuro Wand, Mauermuro adornado figurierter Verband
geométricamentemuro almenado crenelierte Mauermuro alto de apoyo hohe Wand
a la techumbre de un agua
muro anular Ringmauer, Zingelmuro articulado Lettner
que separa el coro del trascoro
muro autopor- freitragende Wandtante
muro bajo el arco Schildmaueren nicho
muro circular Zingelmuro cortafuego Brandmauermuro cortina Vorhangfassademuro de apoyo Stützmauermuro de Mauerring
circunvalaciónmuro de Epaulement,
contención Staudammmuro de Strebemauer
contrafuertemuro de elevación aufgehendes
Mauerwerkmuro de relleno Füllmauermuro de Futtermauer
revestimientomuro envolvente Mantelmauer
circularmuro falso Blendmauermuro frontal Schildmauer,
Stirnwandmuro portante Tragmauermuro posterior del Dorsale
sitial del coromuros exteriores Außen-, Umfas-
sungsmauernmuro simulado Blendmauermuros interiores, Innenmauern
m. intermediosmuseo Museummútula Dielenkopf,
Hängeplatte
naiskos Naiskosnártex Narthexnártex exterior Exonarthexnaumaquia Naumachienave Schiff
nave central Hauptschiff, Langhaus
nave central de Hallenlanghausuna iglesia
nave lateral Seitenschiffnave secular Laienschiffnecrópolis Gräberstadt,
Nekropolenegocio Ladennervadura adornada Astrippe
con toconesnervadura mediana Gurtrippe
n. transversalnervio Rippenervio de formero Schildrippenervio diagonal Kreuzrippe
de bóveda de crucería
nervio falso Blendrippenervio secundario Liernenervio simulado Blendrippenicho Nischenicho ciego Blendnischenicho de las Mihrab
plegariasnicho de ventana Fensternischenoviciado Noviziatnúcleo Spindelnúcleo urbano Stadtkronenudo estructural Knoten
n. vial
obelisco Obeliskobra Baustelle, Werkobra corona Kronwerkobservatorio Observatoriumoctógono Achteck, Oktogonodeón Odeionoficina contable Kontorojiva cruzada Gratbogenojo Augeojo central de la Treppenauge
escalera caracolojo de buey Ochsenauge, Okulusojo de cúpula Opäumojo de la cúpula Nabeloliva Oliveombligo Nabeloratorio Bethausorden arquitec- griechische
tónico griego Säulenordnungorden arqui- kleinasiatisch-
tectónico iónico- ionische Ordnungasiático
orden arquitec- toskanische tónico toscano Ordnung
Fachglossar 666
orden colosal Kolossalordnungorden compuesto Kompositordnungorden corintio korinthische
Ordnungorden dórico dorische Ordnungórdenes arquitec- Säulenordnungen
tónicosórdenes de Säulenordnungen
columnasorden francés französische
Ordnungorden germánico deutsche
Säulenordnungorden iónico ionische Ordnungórden ionico-ático attisch-römische
Ordnungorden románico- römisch-dorische
dórico Ordnungorden románico- römisch-ionische
iónico Ordnungorejón Orillonorientación Orientierungorientación al este Ostungornamento Ornamentornamento Ballenblume
abotonadoornamento Bauornament
arquitectónicoornamento cince- Diamantierung
lado en forma de diamante
ornamento con Beschlagwerkherrajes
ornamento Vierpaßcuatrilobulado
ornamento de Dachkammcumbrera
ornamento de Fensterbekrönungdintel de ventana
ornamento de Laubwerkfollaje
ornamento de Firstbekrönung, una cumbrera Firstverzierung
ornamento de Giebelzierun frontón
ornamento en Pinienzapfenforma de piña
ornamento en for- Fischblasema de vejiga pez
ornamento Vielpaßpolilobulado
ornamento Blendesobrepuesto
ornamento sólo Musterdecorativo
ornamento Dreipaßtrilobulado
osario Beinhaus, Karnerovalado Oval
pabellón Gartenhaus, Laube, Pavillon
pabellón de caza Jagdschloßpalacio Palast, Schloßbaupalacio árabe en el Badia
desiertopalacio de recreo Lustschloß, Solitudepalacio imperial Pfalzpalafito Pfahlbaupalco Laube, Logepalenque Turnierhofpalmeta Palmettepalo Mastpanel Feld, Paneel, Plattepantalla Paraventparaíso Paradiesparapeto Brüstung,
Brustwehrparcela Parzellepar de lima-hoya Kehlsparrenpar de limatesa Gratsparrenpared Wandpared de tablones Bohlenwandpared divisoria Scheidewand,
Trennwand, Zungenmauer
pared frente a la Qiblawandentrada de una mezquita
pared lateral de Schartenbackeuna tronera
pared lateral de Sargwandun edificio
par principal Hauptsparrenparque Parkparque francés Broderieparterre
barrocoparquet Parkettparte de la bisagra Fensterband
de una ventana parte de un claustro Klausurparte de un edificio Bauteilparte inferior del Soffitte
cielorrazopasadizo Gangpasador Splintpasaje Laufgangpasamano Handlaufpasarela Stegpaseo Wandelhallepasillo Korridor
667 Spanisch-Deutsch
pasillo entre esce- Bühnengassenario y espec-tadores
patio Curtispatio de arcadas Arkadenhofpatio interior Hofpatio interior con Lichthof
techo de vidriopatio interior Sahn
musulmánpavimento Estrich, Pflasterpavimento con la- Flachschicht
drillos dispuestos por su lado plano
pavimento de Ziegelbodenladrillos
pavimento de Holzpflastermadera
pechina Gewölbezwickel, Hängezwickel, Pendentif, Zwickel
pechina nervada Rippenzwickelpedestal Piedestal,
Postamentpeldaño Austritt, Sprosse,
Stufepeldaño balanceado gezogene Stufe,
verzogene Stufepeldaño macizo Block-, Klotzstufependiente Pendant, Steigung,
Wasserschrägependiente de las Dachbruch
aguas de un te-jado de mansarda
pendiente de tejado Dachneigungpéndola Fußstrebependolón First-, Spitzsäulepentagrama Pentagrammpenthouse Penthousepequeña torre de Hochwacht
vigilanciapequeño altar en Chörlein
planta altapequeño contrafijo Bugpequeño estudio Studiolopequeño salón Boudoirperalte Stichperfil Profilperfiles de ventana Fensterschenkelperfil transversal basilikaler
de una basílica Querschnittpérgola Pergolaperilla de ventana Reiberperíodo Bauperiode
arquitectónicoperistilo Peristyl
pernio Angelpersiana Jalousie, Markise,
Fensterladen, Sonnenladen
persiana enrollable Rolladenperspectiva Perspektiveperspectiva a ras Froschperspektive
de tierraperspectiva a vista Vogelperspektive
de pájaroperspectiva Kavalierriß
caballeraperspectiva central Zentralperspektiveperspectiva frontal Frontalperspektivepértiga envuelta Weller(holz)
con lodo y pajapestillo Fensterhakenpicadero (cubierto) Reithallepicaporte Klinkepico Schnabelpicota Staupsäulepie de cabio Sparrenfußpie derecho Stuhlsäulepiedra acuñada Bogensteine
del arcopiedra ancla Steinankerpiedra angular Eckquader,
Schlußsteinpiedra angular en Scheitelstein
el vérticepiedra colada Steingußpiedra cuneiforme Wölbsteinpiedra de anclaje Ankersteinpiedra de arran- Kämpferstein
que / impostapiedra de cantera Bruchsteinepiedra de cantera Haustein
labrada cuadradapiedra de Baustein
construcciónpiedra de corona Knaufpiedra de gancho Hakensteinpiedra de Abdeckstein
revestimientopiedra de talla Werkstein, Quaderpiedra fundamental Grundsteinpiedra para revestir Blendsteinpiedra rupestre Feldsteinpiedra rústica Bossenquaderpiedra rústica Buckelquader
protuberantepiedras de cober- Dachsteineturapieza Stubepieza de construc- Spolie
ción reutilizable
Fachglossar 668
pieza sobresaliente Überzimmerde madera
pila de tazas Schalenbrunnenpilar Pfeilerpilar articulado Gliederpfeilerpilar colgante Hängesäulepilar cruciforme Kreuzpfeilerpilar de apoyo Stützepilar de arbotante eingezogener
Strebepfeilerpilar de nervios Bündelpfeilerpilar de Osiris Osirispfeilerpilar de un puente Flußpfeilerpilar en haz Bündelpfeilerpilares de un Vierungspfeiler
cruceropilar redondo Rundpfeilerpilastra Pilaster,
Säulenvorlagepilastra angular Eckpilasterpilastra de Hermes Hermenpilasterpilastra doble Doppelpilasterpilastra mural Wandpfeilerpilastras acopladas Doppelpilasterpilón Brückenturmpináculo Fiale, Kreuzblume,
Pinakelpináculo con ter- Dachzinne
minación endos aguas
pintura en seco Seccomalereipintura en vidrio Glasmalereipintura mural Freskomalerei,
Wandmalereipique Schachtpirámide Pyramidepirámide Stufenpyramide
escalonadapiramidión Riesepiso Diele, Etage, Fuß-
boden, Gaden, Ge-schoß, Stockwerk
piso base Sockelgeschoßpiso de arcilla Lehmtennepiso de tablas Dielenfußboden
cepilladaspiso de tabletas Riemchenfußbodenpiso en ático Attikageschoßpiso falso Blindbodenpiso principal Beletage,
Hauptgeschoßpiso sobre las vigas Dachbodenpiso veneciano Terrazzopivote central Hahnebaumpíxide Ziboriumplan ideal Idealplan
plancha Platteplancha para techar Dachplatteplanchas de un Flanschen
perfilplanetario Planetariumplano de Bauplan
construccionplano general de Lageplan
ubicaciónplano ideal Idealplanplano lateral Seitenrißplanta Etageplanta baja Erdgeschoß,
Parterreplanta baja elevada Hochparterreplanta de óvalo Längsoval
longitudinalplanta de un diseño Grundrißplanta de un muro Mauersohleplantilla Lehreplantilla de arco Bogenaustragung
escala 1:1plataforma alta Doxaleplatea Parkettplatillo del anclaje Ankersplintplaza Platzplaza del mercado Marktplatzplinto Gurtgesims, Plinthepoblado africano Kraalpodio Bühnepolicromía Polychromiepomo del remate Turmknopf
de la torreporche Windfang, Laubeportada con dos Dipylon
pilonesportal Pforte, Portalportal-campanario Westwerkportal con Säulenportal
columnasportal de estalactitas Stalaktitenportalportal del Brauttür
matrimonioportal escalonado Stufenportalportal lateral Seitenportalportal principal Hauptportalportal sencillo Sturzpfostenportalportería Torhausportezuela de Einlaßpforte
entradapórtico Portikus, Säulen-
halle, Tor, Tor-halle, Vorhalle
pórtico con Säulenportikuscolumnas
portón Pforte
669 Spanisch-Deutsch
portón de entrada Torportón de entrada Torbau
a una ciudad /fortaleza
portón del castillo Burgtorportón levadizo Hebetürposada Gasthausposte Pfeiler, Pfostenposte contínuo des- Firstständer
de la base hasta el caballete del tejado
poste principal Hauptpfostenpostigo Fensterladen, Ladenpostigo corredizo Schiebeladenpostigo deslizante Falladen
verticalpostigo de una Schartenladen
tronerapostigo plegable Klappladenpostigo rebatido Schlagladenpoterna Ausfalltor, Manns-
loch, Poternepozo Brunnenpozo de noria Ziehbrunnenpozo de una esca- Lichtspindel,
lera de caracol Schneckenaugeprado baroco Parterrepredela Altarstaffel, Predellaprefabricación Vorfertigungprelatura Prälaturpresión Schubprimera grada Antrittpriorato Prioratprisión Bastilleproporción Proportionpropugnáculo Propugnaculumproscenio Bühnen,
Prosceniumprotección envol- Mantel
vente de una muralla
protector Abweiserprótesis Prothesisproyección Projektion, Rißproyección acotada kotierte Projektionproyección Militärriß
axonométricaproyección axono- Schrägriß
métrica oblicuaproyección de un Dachausmittlung
tejadoproyección general Normalprojektionproyección Isometrie
isométricaproyección normal Normalprojektion
general
pueblo Dorfpuente Brücke, Stegpuente de pontones Pontonbrücke,
Schiffbrückepuente de tracería Maßwerkbrückepuente levadizo Brückenplatte,
Zugbrückepuente plegable Faltbrückepuente techado Dachbrückepuerta Türpuerta árabe Babpuerta caediza Falltürpuerta con marco Rahmen- und
y entrepaños Füllungstürpuerta corrediza Schiebetürpuerta de dos Doppeltür
hojaspuerta de honor Ehrentorpuerta de triunfo Triumphtorpuerta de vaivén Pendeltürpuerta de vidrio Glastürpuerta falsa Blend-, Scheintürpuerta giratoria Drehtürpuerta metálica Stahltürpuerta oscilante Schwingflügeltür
de dos hojaspuerta plegable Falttürpuertas de la ciudad Stadttorpuerta simulada Blendtürepuerta tapizada Tapetentürpuerta torreón Turmtorpuerta triunfal Siegestorpuerta-ventana Fenstertürpúlpito Kanzel, Mimbarpúlpito externo Außenkanzelpunta de diamante Nagelkopfpuntal Strebepuntales en cruz Kreuzstakenpunto de encuentro Anfallspunkt
de mas de dos faldones
pupitre de lectura Lesepultpupitre de lectura Epistelpult
de epístolas
quiebre Brisurequitasol Sonnenblende
radial Radialradiante Rayonnantrama de la bóveda Schenkelramaje Astwerkrampa Ramperampa exterior Außenramperampa helicoidal Wendelramperampante einhüftig
Fachglossar 670
rampa tipo caracol Eselstrepperanura Anschlag, Nutrascacielos Hochhaus,
Wolkenkratzerrasilla Hohlblocksteinrastrillo Fallgatterrealce de las Bogenquaderung
piedrasrealce rústico de Bosse
una piedra realzar una piedra bossierenrebajo Falzrecinto Raumrecinto del templo Tempelbezirkrecinto exterior Zwinger
cercadorecinto fortificado Oppidumrecuadro Feld, Gewölbefeldrecuadro del coro Chorjochreducción de Verjüngung
columnareducto Redoute, Retiraderefectorio Refektorium,
Remterreforzar con Staken
codales en cruzrefuerzo Vorlagerefuerzo de pilar Lisenerefugio Baudenreglamento Bauordnung
edificioreja Gitter reja articulada Scherengitterreja del coro Chorgitterrejas de altar Altarschranken,
Cancellirejas de ventanas Fenstergitterrejas de ventanas Fensterkorb
sobresalientesrelicario Schreinrelieve Reliefrelieve de base Basreliefrelieve hundido Koilanaghlyphrellano Treppenabsatz,
Ausfachung, Füllung, Futter
relleno de adobe Ausstakungremate Couronnementremate de cum- Helm
breraremate de la torre Turmhelmremate hastial Wimperg
góticorepetición regular Rapport
de un modelorepisa Fensterbank
repostero Anrichterepresa de valle Talsperrerepresentación Architektur-
arquitectónica darstellungresalto Fenstertritt, Mittel-
risalit, Redan, Ri-salit, Schweifwerk
resalto de un marco Ohrresalto lateral Seitenrisalitresidencia Ansitz, Wohnhausresidencia del Propstei
prebosteresidencia del Prälatur
preladoresidencia estival Lustschloßrestaurante Gaststätterestaurante de Rasthaus
carreteraretablo Altarretabel, Retabelretablo con alas Flügelaltarretenedor de nieve Schneefangretículo Rasterrevellín Ravelinrevestimiento Bekleidung,
Ummantelungrevestimiento del Antependium
altarrevestimiento de Täfelwerk
madera revestimiento de Wandbekleidung
murorevestimiento de Schurz
techorevestimiento de Lambris
zócalo interiorrevestimiento en Deckenschalung
madera del cielorraso
revestimiento Frontalefrontal del altar
revoque exterior Außenputzriñón de bóveda Spandrilleriostra Abkreuzung, Spann-
riegel, Zangeriostra de Sturmlatte,
contraviento Windrisperistrel Aufschieblingritmo Rhythmusrito propiciatorio Bauopferrocalla Rocaillerollo lateral del Pulvinus
capitel iónicorombo Rauterompehielos Eisbrecherrompeolas Wellenbrecherronda Rondengang
671 Spanisch-Deutsch
rosa Roserosa Tudor Tudorblattroseta en abanico Fächerrosetteroseta falsa Blendrosette
r. simuladarosetón Fensterrose, Roserosetón de Fünfblatt
cinco hojasrosetón de cinco Fünfpaß
lóbulosrotonda Rotunderotonda del coro Chorscheitelrotunderuina Ruine
sacristía Gerkammer,Sakristei
sagrario Sakramentshaussala Halle, Saalsala capitular Kapitelsaalsala de baile Redoutesala de estar Dornse
calefaccionadasala de incubación Inkubationsraumsala del gremio de Gewandhaus
los fabricantes de tela
sala de recepción Empfangszimmersala de reunión en Lesche
un peristilosala de sacerdotes Hieratikon
de iglesia ortodoxasala de templo goldene Halle
budistasala egipcia ägyptischer Saalsala ostentosa Peselsala real Königshallesala transversal Quersaalsala triabsidal Dreiapsidensaalsaledizo Stirn-, Windbrett,
Erker, Mittelrisalitsalidizo de tiro Schießerkersalidizo en forma Erkertürmchen
de torrecillasalidizo para Sentinelle
centinelasaliente Auskragungsalón Salonsalón con columnas Säulensaalsalón de baile Ball-, Tanzhaussalón de descanso Foyersalón de gala Paradezimmersalón municipal Stadthallesanto sepulcro Heiliges Grabsantuario Allerheiligstes,
Sanktuarium, Wallfahrtskirche
santuario del sol Sonnenheiligtumsantuario del Barkenkammer
templo egipciosarcófago Sarkophagsección áurea goldener Schnittsede gremial Zunfthaussemi columna de Alter Dienst
gran diametrosemicúpula Halbkuppelsepulcro Gruftsepulcro megalítico Ganggrabsepultura Mortuariumserallo Serailserie de soportes Stützenstellungserie de tejados Paralleldach
a dos aguas sillar Quader, Werksteinsillar con realce Diamantquader
en forma de diamante
sillería Chorgestühlsilo Kornhaussilo almacén Speichersima Rinnleistesimbolismo Bausymbolik
arquitectónicosimetría Symmetriesinagoga Synagogesistema defensivo Polygonalsystem
poligonalsistema de Pavillonsystem
pabellonessistema entramado gebundenes
Systemsistema ipodamico hippodamisches
Systemsistema Vauban Vaubansystemsitial de coro Stallensitio Ortsitio de Bauplatz
construcciónsobrepuerta Supraportesobretecho con Lichtgaden
ventanas lateralessobre viga de Sattelholz
maderasócalo con relieves Relieforthostatensócalo de edificio Banksockel
con bancossócalo de la cella Orthostatsocarrén Traufesófito Soffittesoga Läufersolar Bauplatzsolarium Solariumsolera Fensterbank
Fachglossar 672
solera de la ventana Sohlbanksolera inferior Grundschwellesombrerete Schornsteinaufsatzsombrerete Kaminaufsatz
giratoriosombrilla Sonnenblendesoporte Stützesoporte con forma Pilzstütze
de hongosoporte de estuco Putzträgersoporte en seco de Landpfeiler
puente en bóveda
soportes dispuestos Stützenwechsel alternadamente
sotabanco Dachgeschoßsótano Besement, Kellerstupa Stupastupa acampanada Glockenstupasubestructura Substruktionsuelo Fußbodensujeción Befestigungsuperficie de Fensterfläche
ventanasuperficie exterior Hauptsurgiente Springbrunnen
tabernáculo Tabernakeltabica Treppensteigung,
Setzstufetabique Bundwandtabique movible Scherwandtabique plegable Faltwandtabla Brett, Dieletabla del zócalo Fußleistetablas de andamiaje Gerüstbrettertablas de revesti- Dachschalung
miento de techo tabletas de medio Riemchen
largotablón Bohle, Dieletalayotes Talayotentaller de artesanía Handwerkhaustalud Abdachung,
Böschungtambor Tambour, Trommeltambor de columna Säulentrommeltapacán Ortgangtapajunta Deckleiste,
Rundstabtapiar Stakentapiz Tapete, Wand-
teppichtaracea Parketttaracea en mármol Cosmatenarbeittarugo Dübel
tarugo colgante Hängezapfentarugo de madera Holznageltecho Dachtecho acampanado Glockendachtecho adosado Pultdachtecho a dos aguas Giebeldachtecho arqueado Bogendachtecho colgante Hängedachtecho colgante Seildach
suspendido por cables
techo de armazón Sheddachtinglado
techo de cuatro Krüppelwalmdachaguas
techo de la Mansarddachmansarda
techo de tablas Schalungtecho de tejas Pfannendach
acanalonadastecho de vidrio Glasdachtecho en cruz Kreuzdachtecho en tijeras Scherendachtecho en voladizo Abdachtecho imperial welsche Haubetecho intermedio Zwischendecketecho macizo Massivdecketecho macizo sobre Pilzdecke
soportes con forma de hongo
techo piramidal Pyramidendachtecho romboidal Rautendach,
Rhombendachtecho semisesgado Halbwalmdachtecho sobresaliente Vordachtecho terraza Dachterrasse,
Terrassendachtecho transversal Querdach,
Zwerchdachtectónico Tektonikteja Ziegelteja árabe Hohlziegelteja a reborde Kremperteja canalón Nonneteja castor Biberschwanzteja de aguilón Ortziegelteja de canal Mönch- und
Nonnendachteja decorada Kammziegel
de cumbrerateja de cumbrera First-, Gratziegelteja de encaje Falzziegelteja de encastre Kremperteja de vidrio Glasziegeltejado Dachtejado a dos aguas Satteldach
673 Spanisch-Deutsch
tejado con eclisas Spließdach, Spandach
tejado coronado Ritterdachtejado de bardas Schindeldachtejado de cabios Sparrendachtejado de claustro Mönch- und
con teja árabe Nonnendachtejado de corona Kronendachtejado de pabellón Zeltdachtejado de pizarra Schieferdachtejado de ripias / Schindeldach
tablillas / tejuelastejado en diente Sägedach
de sierratejado en forma Tonnendach
de toneltejado imperial, Zwiebeldach
t. persatejado pirámide Dachpyramidetejado plano Flachdachtejado simple Ringpultdach
anulartejado voladizo a Schleppdach
simple vertienteteja en forma de S Dachpfanneteja española Klosterziegelteja heuca Mönch- und
Nonnendachteja oreja de gato Kaffziegelteja plana Flachziegel,
Plattenziegelteja plana Biberschwanztejaroz Traufetejas a reborde Krämpziegeltejuela de listones Leistenziegeltelar Schnürbodentemplo aptero Apteraltempel templo circular Rundtempel,
Tholostemplo con anta Antentempeltemplo con ocho Oktastylos
columnas fron-tales
templo consagrado Hathortempela Hathor
templo de valle Taltempeltemplo díptero Dipterostemplo doble Doppeltempeltemplo escalonado Terrassentempel
en terrazastemplo funerario Grabtempeltemplo griego de Hexastylos
seis columnastemplo ipetral Hypäthraltempeltemplo rupestre Felsen-, Höhlen-
tempel
templo sobre Podiumtempelpodio
tenallón Tenaillontenaza Tenailletenazas Zangeteoría de la Architekturtheorie
arquitecturatermas Thermenterminación del Chorschluß
coroterrado Söllerterraplén Wallterraza Belvedere, Terrasseterreno no Baulücke
edificadotextura sistema Rabitzgewebe
Rabitztienda Kaufhaustijera Scheretímpano Bogenfeld,
Giebelfeld, Tympanon
tipo de casa de Manor Housecampo Ingles
tipo de granja Laubenhauscon galerías
tipos de bóveda Gewölbeformentipos de escalera Treppenformentipos de moldura Gesimsformentipos de ventana Fensterformentirante Sturzriegel,
Zuganker, Riegeltirante de arco Ankerbalkentirante del arco Bogenankertirante superior Spitzbalkentirantilla Spannriegeltoldo Markise,
Sonnensegeltolete Dollentonsura Tonsurtope Nasetornapunta Verstrebung,
Kopfbandtoro Stab, Wulsttorre Turmtorre al lado del Chorflankenturm
corotorre calabozo Faulturmtorre con escalera Treppenturm
de caracoltorre con rampa Eselsturm
tipo caracoltorre con tejado Sattelturm
a dos aguastorre con tejado Zwiebelturm
imperial /persa
Fachglossar 674
torre de acecho Geschützturmtorre de aduanas Zollturmtorre de agua Wasserturmtorre de crucero Querhausturmtorre de defensa Wehrturmtorre de guardia Burgwarte
del castillotorre de la fachada Fassadenturmtorre de la forta- Bergfried
leza medievaltorre de la Fernsehturm
televisióntorre del Belfried
ayuntamientotorre de puente Brückenturmtorre de un crucero Vierungsturmtorre de vigilancia Escarpenerkertorre en espiral Spiralturmtorre fortificada Turmburgtorre habitación Wohnturmtorre habitada por Geschlechterturm
la nobleza en ciudades italianas
torreón Keep, Wohnturmtorreón habitable Donjon
fortificadotorre panorámica Aussichtsturmtorre portada Torturmtorre semicircular Schalenturmtorres gruesas de Migalet
una mezquitatorre sobre el Chorturm
recuadro del corotorre sobre un Giebelturm
frontóntorsión Torsiontrabajo coronada Kronwerktrabajo de Intarsia
marqueteríatrabajo musivo musivische Arbeittrabazón Verbandtrabazón angular Eckverbandtrabazón con garra Verklauungtrabazón cruzada Kreuzverbandtrabazón de Läuferverband
hiladastrabazón en gotico gotischer Verbandtrabazón en tizón Streckerverband
Binderverbandtrabazón holandesa holländischer
Verbandtrabazón inglés englischer Verbandtrabazón inglés Blockverband
(sencillo, normal)trabazón Längsverband
longitudinal
trabazón polaca märkischer Verband,polnischer Verband
trabazón triangular Dreieckverbandtracería Maßwerktracería burbuja Schneuß
de peztracería curvilínea Soufflettracería de Stabwerk
crucero tracería falsa Blendmaßwerktracería flamboyant Soufflet
curvilíneatracería lanceolada Blatttracería ondeante Flowing tracerytracería simulada Blendmaßwerktracería velada Schleierwerktracería vesicular Dreischneuß
tripletracto Trakttragaluz Dachfenster, Ober-,
lichte, Luketramo Treppenlauftranca Riegelbalkentraversa Riegel, Sturzriegeltraversa tipo auvergnatischer
Auvergne Querriegeltravés Jochtravesaño Holm, Riegel-
balken, Traversetravesaño de la Kämpferholz
ventanatravesaño de Kämpfer
ventanatravesaños del piso Fehlbalken
entablonadotraviesa Schwelletrazado Tracétrazado geométrico Maßwerktrébol Dreiblatttrenzado de Bandgeflecht
enlacestriangulación Triangulationtriángulo esférico sphärisches Dreiecktrianon Trianontribuna Empore, Tribüne,
Hurde tribuna coral Sängerbühnetribuna del orador Bematribuna del órgano Orgelemporetribunal Tribunaltribunales de Gerichtsgebäude
justiciatribuna para coro Doxale
y órganotribuna simulada Scheinemporetrifolio Dreiblatt
675 Spanisch-Deutsch
triforio Triforiumtriforio falso, Blendtriforium
t. simulado Scheintriforiumtriforio trans- Durchlichtetes
parentado Triforiumtriglifo Triglyphe,
Dreischlitztriglifo de dos Zweischlitz
canalestrinchera Schanzetrinchera en forma Sternschanze
de estrellatrofeo Trophäetrompa Trompe tronera Schifter, Embrasure,
Schießschartetronera para Bogenscharte
arquerostumba Grufttumba en baldaquín Baldachingrabmaltumba en cúpula Kuppelgrabtumba megalítica Steinkammertumba rupestre Felsengrabtumba torre Turmgrabtúmulo Tumulus
umbral Türschwelleumbral de cada Stockschwelle
pisounión Baunaht, Baufugeunión bifurcada Scherzapfenunión de tope gerader Stoßunión pie derecho- Fußband
soleraurbanización Städtebauurna doméstica Hausurne
vanguardia Avantgardevano Lichtevano de la puerta Türlaibungvano del Schallöffnung
campanario vano Gewölbefeldveleta Wetterfahneventana Fensterventana arqueada Bogenfenster
Rundbogenfensterventana ciega blindes Fensterventana circular Rundfensterventana con arco Segmentfenster
rebajadoventana con Verbundfenster
cierre dobleventana con forma Schlüsselloch-
de ojo de fenstercerradura
ventana con Katherinenradrosetón
ventana corrediza Schiebefensterventana de Kipp-, Klappfenster
básculaventana de medio Kaffenster
punto /ojoventana de mirador Erkerfensterventana diocle- Thermenfenster,
ciana diokletianisches Fenster
ventana en abanico Fächerfensterventana falsa Blendfensterventana giratoria Klappfensterventana lan- Lanzettfenster
ceoladaventana metálica Stahlfensterventana-mirador Fenstererkerventana radiada de Katherinenrad
Santa Catalinaventana rasgada Schlitzfenster
para ventilación y luz
ventanas de la Arkadenfensterarcada
ventanas entre- Fensterbandlazadas
ventanas gemelas Zwillingsfensterventana simulada Blendfensterventana tipo Hebefenster
guillotinaventana tipo Radfenster
ruedaventana trebolada, Kleeblattfenster
v. trilobuladaventana triple Drillingsfensterveranda Verandavértice Scheitelvestíbulo Diele, Haus-
flur, Vestibül, Vorhalle, Flötz
viaducto Viaduktvidrio Fensterscheibevidrio ornamen- Bleiverglasung
tado y unido con plomo
vidrios incoloros Blankverglasungv. transparentes
vierteaguas Wasserschräge, Wasserverglasung
viga Balken, Trägerviga continua Durchlaufträgerviga cumbrera Gratbalkenviga de alero Dachschwelleviga de apoyo Unterzug
(inferior)
Fachglossar 676
viga de celosía Gitterträgerviga de cierre Klemmbalkenviga de descarga Entlastungsträgerviga de la campana Rauchfangholz
de la chimeneaviga de lima-hoya Kehlbalkenviga de piedra Steinbalkenviga de retallo Streichbalkenviga de techo Dachbalkenviga doble T Doppel-T-Trägerviga embrochalada Stich, Stichbalkenviga embrochalada Kehlstichbalken
a la viga de lima-hoya
viga en barras Gitterträgerviga en saliente Kragbalken, -trägerviga entramada Gitterträgerviga en voladizo Kragbalken, -trägerviga exterior Oberzugviga maestra Überzug
de suspensiónviga perfilada Profilträgerviga principal Hauptbalkenviga secundaria Wechselviga soporte del Triumphbalken
crucifijoviga superior Giebelbalken
viga superior de Bundbalkenunión
viga T T-Trägerviga tipo Howe Howeträgerviga tronco Ganzholzvista Vedutevitrina Schaukastenvivienda Appartementvolumen del Baukörper
edificiovolumen sobresa- Auslucht
liente del ingreso
voluta Schnecke, Volute
yeso cristalino Marienglasyeso de estucar Stuck
zanca Docke, Treppen-wange, Wange
zanja de drenaje Grachtzanja de fundación Baugrubezapa Sappezapata Schuh, Kragsteinzócalo Sockelzona restringida de Rayon
una fortificación
677 Spanisch-Deutsch