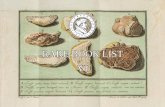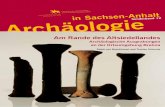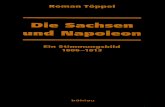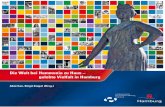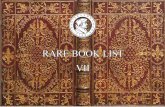Ausgrabungen im Peter-Ulrich Haus in Pirna. Ausgrabungen in Sachsen 3 (2012), 193 - 199
Transcript of Ausgrabungen im Peter-Ulrich Haus in Pirna. Ausgrabungen in Sachsen 3 (2012), 193 - 199
201Ausgrabungen in Sachsen 3
christof Schubert
Ausgrabungen im Peter-Ulrich-Haus in Pirna
Ende 2009 begannen umfassende Sanierungsarbei-ten am Markt 3, dem sogenannten „Peter-Ulrich-Haus“ in Pirna . Das Gebäude ist nach seinem Erbauer Peter Ulrich (Peter von Pirna) benannt . Dieser war von 1502 bis zu seinem Tode 1513/14 Baumeister der Pirnaer Marienkirche . 1503 erwarb Ulrich das damals stark baufällige Gebäude an der Nordoste-cke des Marktplatzes (Abb . 1) und begann 1505 mit der Errichtung eines Neubaus, von dem sich trotz zahlreicher Umbauten große Teile bis heute erhalten haben (Speck 1900, 41 ff .) . Das seit mehreren Jahren leerstehende Gebäude wird nun durch die Ilse-Bäh-nert-Stiftung saniert . Es sollen unter anderem eine Kleinkunstbühne, ein Cafe und Ausstellungsräume entstehen .
Drei kleinere, im Rahmen von Bauvoruntersu-chungen 2009 angelegte Sondagen zeigten, dass unter den rezenten Fußböden mit archäologischer Substanz zu rechnen war1 . Da die Planungen im gesamten Erdgeschoss einen Neuaufbau des Fuß-bodens unter Freilegung der Kellergewölbe und Bodeneingriffen von bis zu 0,80 m Tiefe in den nicht unterkellerten Bereichen vorsahen, wurden umfang-reiche archäologische Grabungen notwendig . Die
Untersuchungen konzentrierten sich auf die nicht unterkellerten Bereiche .
Während sich die zahlreichen Umbauten, die nach dem Tod Ulrichs an dessen Bau durchgeführt wurden, sehr gut nachvollziehen lassen2, erbrach-ten die archäologischen Untersuchungen vor allem wichtige Hinweise zur Entwicklung der Parzelle im 14 . und 15 . Jahrhundert . Die früheste, leider nur auf einer kleinen Fläche in Raum 2 nachgewiesene Bau-phase datiert in das 14 . Jahrhundert . Ältere Befunde sind darunter sicher noch vorhanden, konnten jedoch aufgrund der begrenzten Bautiefe nicht untersucht werden . Ein kleines Fundament sowie ein zugehöriger Laufhorizont belegen zumindest eine Bebauung, wenn auch aufgrund des begrenzten Aufschlusses über deren Form und Ausmaße keine Aussagen möglich sind .
1 Die Dokumentation der Sondagen wurde von Eva Lorenz durchgeführt. 2 Für die Bauforschung war der Restaurator Dirk Böhme verantwortlich, dem an dieser Stelle für die intensive und fruchtbare Zusammenarbeit herzlich gedankt sei. Die Ergeb-nisse sollen in einer, in Vorbereitung befindlicher Publikation der Ilse-Bähnert-Stiftung zum gesamten Sanierungsprojekt vorgestellt werden.
abb. 1. Pirna PL 65. Das Peter-Ulrich-Haus (rot) liegt im Zentrum der mittel-alterlichen Altstadt Pirnas, an der Nordostecke des Marktplatzes.
N
202 AFD . Beiheft ##
Für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts kann ein massiver, zumindest im Erdgeschoss steinern ausgeführter Neubau mit Unterkellerung nach-gewiesen werden (Abb. 2). Ein tonnengewölbter Kellerraum, der zu großen Teilen bis heute erhal-ten ist, verfügte über zwei Zugänge: einen in der Nordostecke, der offenbar in einen zweiten, sich anschließenden Kellerraum führte und einen weiteren in der Südwestecke, der den Keller vom Marktplatz aus erschloss. Solche außerhalb des Gebäudes gelegenen, zum Marktplatz gerichteten Kellerzugänge konnten beispielsweise auch am Dresdner Altmarkt beobachtet werden (Salmen 2009, 126). Er kann damit als einer der sogenann-ten „Hakenkeller“ angesprochen werden, die an der Ostseite des Marktes lagen und als Verkaufsräume der Gewandschneider dienten (Albrecht 2000, 58 f.). Der Grundriss des Kellers lässt darauf schlie-ßen, dass das heutige Grundstück ursprünglich aus zwei Parzellen bestand, die erst im Laufe des 15. Jahrhunderts zusammengelegt wurden. Für die
nördliche der beiden Parzellen kann anhand der Baubefunde im Keller ein Gebäude mit leicht poly-gonalem Grundriss von etwa 12,3 x 10,2 m Größe rekonstruiert werden. Die Fassade des Gebäudes liegt dabei 3,3 m hinter der heutigen. Erst Peter Ulrich rückte die Fassade seines Neubaus in den Marktplatz hinein. Das östliche Drittel des Grund-stücks scheint nicht bebaut gewesen zu sein; hier fanden sich Reste einer stark gestörten Rundlat-rine. Da im Bereich der südlichen Parzelle keine relevanten Bodeneingriffe durchgeführt wurden, deuten hier nur einige schwer zu datierende Bau-befunde im Keller und dem Aufgehenden auf eine in Ost-West-Richtung mit der nördlichen Parzelle vergleichbar dimensionierte Bebauung hin.
In der zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts erfolgte unter Beibehaltung des bestehenden Gebäudes des-sen Erweiterung nach Osten (Abb . 3) . In dem neuen Gebäudeteil konnten zwei als Öfen anzusprechende Anlagen erfasst werden . Der südliche Ofen weist einen T-förmigen Grundriss auf (Abb . 4) . Das trog-
Bestand Peter-Ulrich-Haus
Rekonstruktion 2. Hälfte 14. Jh.
Fundament 2. Hälfte 14. Jh.
Kellergewölbe
Latrine
Fußboden
Verfüllung
Rekonstruktion Keller
0 5m
N
abb. 2. Pirna PL 65. Grabungsbefunde und der rekonstruierte Gebäudegrundriss in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, hinterlegt mit dem Bestandsaufmaß vor Beginn der Sanierungsarbeiten. Der rekonstruierte Kellergrundriss ist gestrichelt dargestellt.
203Ausgrabungen in Sachsen 3
Bestand Peter-Ulrich-Haus
Rekonstruktion 15. Jh.
Rekonstruktion Keller
Aufplanierung/Verfüllung
Fundament 15. Jh.
Fußboden
Ofen
Ansatz Ofenkuppel
Baugrube
0 5m
N
abb. 3. Pirna PL 65. Der rekonstruierte Gebäudegrundriss im 15. Jahrhundert. Der östliche Anbau wurde handwerklich genutzt, hier finden sich die beiden Öfen. Im Laufe des 15. Jahrhunderts muss auch die Zusammenlegung mit der schmaleren südlichen Parzelle erfolgt sein.
abb. 4. PL 65. Ofenanlage mit T-förmigem Grundriss, 2. Hälfte 15. Jahrhundert. Die grau-gelb verfärbten Ziegel direkt südlich der modernen Trennwand zeigen die Stelle der größten Hitzeeinwirkung an.
204 AFD . Beiheft ##
förmige Bauwerk ist aus Handstrichziegeln in Lehm gesetzt und etwa 0,40 m in den Boden eingetieft . Wie die sich nach Norden verstärkenden Spuren von Hitzeeinwirkung und eine als Aschegrube anzu-sprechende Vertiefung am nördlichen Ende zeigen, erfolgte die Beschickung des Ofens von dieser Seite . Der obere Abschluss der Ofenwandung ist leider nicht erhalten .
Auch der unmittelbar nördlich gelegene zweite Ofen verfügt über einen Boden und eine Wandung aus Handstrichziegeln gleichen Formats (Abb . 5) . Diese Anlage konnte nur teilweise erfasst wer-den und ist im Westen und Norden durch jüngere Befunde gestört . Dieser Ofen ist von rechteckigem Grundriss mit rundbogigem Abschluss nach Osten . Dort hat sich der Ansatz einer aus Sandsteinen gesetzten Ofenkuppel erhalten .
Bei beiden Öfen handelt es sich eindeutig nicht um Heizanlagen . Peter Ulrich erwarb das Gebäude von der Tuchmacherfamilie Nack (Bachmann 1929, 189) . Es erscheint daher naheliegend, die Funk-tion der Öfen im Bereich der Textilverarbeitung zu suchen . Sowohl zum Walken als auch zum Färben der Stoffe wurde warmes beziehungsweise kochendes Wasser benötigt (Dewilde/van Bellingen 1998, 68 ff .) . Mittelalterliche Walk- und Färbeöfen sind beispiels-weise aus Winchester (Biddle 1970, 250 ff .), London (Egan 1991, 12 ff .) und Brügge (de Witte 2006, 120 f .) bekannt . Beide Öfen wurden im Zuge der Baumaß-nahmen Peter Ulrichs, die sich im archäologischen Befund ansonsten nur in geringem Umfang abzeich-
abb. 5. Pirna PL 65. Ofenanlage mit halb-
rundem Abschluss. Von der aus Sandsteinen in
weißen Mörtel gesetzten Ofenkuppel hat sich die
unterste Lage erhalten. Die nördliche Hälfte des Ofens
wird durch ein jüngeres Fundament gestört.
nen, abgebrochen und verfüllt . Aus der Verfüllung des nördlichen Ofens stammen 350 Fragmente von Ofenkacheln, die teilweise wieder zusammengesetzt werden konnten . Es lassen sich sechs Typen (a–f) unterscheiden, von denen fünf mehr oder weniger gut erhaltene Reste eines gold- bzw . silberfarbe-nen Glimmerüberzugs aufweisen . Der goldfarbene Glimmer konnte als Biotit bestimmt werden3, bei dem silberfarbenen handelt es sich vermutlich um Muskovit .
a) Hochrechteckige Blattkachel mit zylinderseg-mentförmigem Rumpf und goldfarbenem Glimme-rüberzug: Der Rumpf dieses Kacheltyps besteht aus dem Segment eines scheibengedrehten Zylinders, welches zu einer Seite mit dem Gefäßboden ver-schlossen ist . Wie die Spuren an den Kacheln zeigen, wurde auch die Oberseite durch das Anfügen eines Scheibensegments abgedeckt . In das Zylinderseg-ment sind zwei vermutlich spitzovale Öffnungen eingeschnitten . Auf diesen Rumpf ist das modelge-formte, geschlossene Kachelblatt montiert . Aus den erhaltenen Fragmenten lassen sich die Maße des Kachelblattes von etwa 36 x 18 cm rekonstruieren . Dem Typ a können sicher ein, möglicherweise auch zwei Motive zugeordnet werden . In beiden Fällen handelt es sich um ein Maßwerkornament aus Spitz-bögen und Fischblasen (Abb . 6) .b) Quadratische Blattkachel mit scheibengedreh-tem Gefäßoberteil als Rumpf und goldfarbenem Glimmerüberzug: Für diesen Typ wurde ein quad-ratisches, modelgepresstes Relief von 17 x 17 cm auf ein scheibengedrehtes Gefäßoberteil montiert . Der Rumpf ist in allen Fällen nur ansatzweise erhalten, es schient sich jedoch um ein mit Typ c vergleichbares Gefäßteil zu handeln . Die Kacheln dieses Typs zei-gen zwei verschiedene Motive: eine Rosette (Abb . 7) sowie eine Fantasieblüte (Abb . 8) . c) Quadratische Blattkachel mit scheibengedreh-tem Gefäßoberteil als Rumpf: Diese Kacheln wei-sen das gleiche Konstruktionsprinzip wie Typ b auf, jedoch ist hier kein Überzug mit Glimmer nachweis-bar . Einzelne Glimmerstückchen sowohl auf dem Blatt als auch dem Rumpf deuten jedoch darauf hin, dass diese Kacheln in der gleichen Werkstatt wie die anderen hergestellt wurden . Bei den meis-ten Stücken dieses Typs ist der Rumpf der Kacheln besser erhalten als bei Typ b . Es handelt sich um ein
3 Die mikroskopische Bestimmung erfolgte freundlicher-weise durch Dr. Jan-Michael Lange und Martin Kaden, Sen-ckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden.
205Ausgrabungen in Sachsen 3
abb. 6. Pirna PL 65. Ofenkachel mit Glimmerüberzug um 1500: Kacheltyp a, aus zwei Fragmenten teilrekonstruiertes Maßwerkmotiv.
scheibengedrehtes Gefäßoberteil mit umgeschlage-nem Rand . Der Boden wurde abgeschnitten, sodass hier das Kachelblatt angebracht werden konnte . Die Kachelblätter dieses Typs sind zwischen 17,5 x 18 cm und 18 x 18 cm groß . Es können vier, möglicher-weise fünf Motive unterschieden werden . Eindeutig ansprechbar sind eine Darstellung des Sündenfalls (Abb . 9) sowie des Evangelisten Matthäus (Abb . 10) . Die weiteren Motive sind leider nur sehr fragmenta-risch überliefert .
abb. 7. Pirna PL 65. Ofenkachel mit Glimmerüberzug um 1500: Kacheltyp b, Rosette.
abb. 8. Pirna PL 65. Ofenkachel mit Glimmerüberzug um 1500: Kacheltyp b, aus drei Fragmenten rekonstruierte Fan-tasieblüte.
206 AFD . Beiheft ##
d) Quadratische Napfkachel mit silberfarbenem Glimmerüberzug: Der größte Teil der Scherben stammt von Napfkacheln mit quadratischer Mün-dung . Die Kacheln verfügen über einen etwa 5 cm unterhalb des Randes auf der Innenseite abgebrach-ten umlaufenden Steg . An der Außenseite wurde unter dem Rand eine spiralförmig umlaufende Rille gezogen . An einem Teil der Scherben haben sich auf der Gefäßinnenseite Reste eines Überzugs aus sil-berfarbenem Glimmer erhalten . Die Kacheln dieses
abb. 9. Pirna PL 65. Ofenkachel um 1500: Kacheltyp c, Adam und Eva.
abb. 10. Pirna PL 65. Ofenkachel um 1500: Kacheltyp c, Evangelist Matthäus.
Typs weisen eine Mündung zwischen 18 x 18 cm und 18,5 x 18,5 cm und eine Höhe zwischen 14 cm und 15,5 cm auf (Abb . 11) . e) Rechteckige Napfkachel mit silberfarbenem Glimmerüberzug: Die Kacheln dieses Typs unter-scheiden sich von Typ d lediglich durch ihre Größe: Es handelt sich um „halbe“ Kacheln mit einer Mün-dung von 17,5 x 11 cm und einer Höhe von 11,5 cm (Abb . 11) .f) Schüsselkachel mit silberfarbenem Glimmerü-berzug: Bei einer quadratischen Mündung von 17 x 17 cm weisen diese Kacheln nur eine Höhe von 7 cm auf . Es handelt sich ebenfalls um scheibengedrehte Gefäße mit quadratisch ausgezogener Mündung . In der Mitte verfügen sie über eine kreisrunde Mulde, in der sich geringe Reste von silberfarbenem Glim-mer finden (Abb . 11) .
Die Kacheln können anhand der Befundlage ein-deutig dem Gebäude zugeordnet werden, welches Peter Ulrich 1502/1503 von Paul Nack erwarb und in der Folge für seinen Neubau größtenteils abbrach . Sie scheinen alle aus derselben Werkstatt zu stam-men und waren vermutlich in demselben Ofen verbaut . Bislang konnte nur für das Rosetten-Motiv ein sehr ähnlicher, wenn nicht gar identischer Ver-gleichsfund identifiziert werden . Es handelt sich um eine um 1500 datierte Kachel von der etwa 60 km westlich von Prag gelegenen Burg Týřov (Angerbach) (Pavlík/Vitanovský 2004, 306; 432 Kat .-Nr . 1228) . Einer Datierung des Ofens in das ausgehende 15 . Jahrhundert oder um 1500 würden auch die anderen Motive nicht widersprechen .
Bei diesem Fundkomplex aus Pirna handelt es sich um den ersten Nachweis von Ofenkacheln mit Glimmerüberzug in Sachsen . Eine größere Anzahl solcher Kacheln ist aus Böhmen, Mähren, Ungarn sowie Österreich bekannt . Die Technik kommt im 15 . Jahrhundert auf und scheint besonders in der zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts beliebt gewesen zu sein . Einige Fundstücke datieren noch in das 16 . Jahrhundert (Wagner 2008, 58; Menousková 2008) .
Literatur:Albrecht 2000: A. Albrecht, Zur Entwicklung eines mittelal-
terlichen Stadtquartiers zwischen Marktplatz und Stadt-kirche in Pirna. In: Gesellschaft für historische Städtefor-schung in Böhmen und Sachsen e. V. (Hrsg.), Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum (Ústí nad Labem 2001) 56–66.
Bachmann 1929: W. Bachmann, Die Stadt Pirna – Die Kunst-denkmäler des Freistaates Sachsen 1, (Dresden 1929).
Biddle 1970: M. Biddle, Winchester: The Brooks. Current Arch. 20, 1970, 250–255.
207Ausgrabungen in Sachsen 3
Dewilde/van Bellingen 1998: M. Dewilde/S. van Bellingen, Excavating a Suburb of Medieval Ypres (Belgium) – Evidence for the Cloth Industry?. In: M. Dewilde/ A. Ervynck/A. Wielmans (Hrsg.), Ypres and the Medieval Cloth Industry in Flanders (Asse-Zellik 1998) 57–72.
de Witte 2006: H. de Witte, Craft in the town of Brugge: archaeological evidence. In: M. Gläser (Hrsg.), Lübe-cker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum V (Lübeck 2006) 115–122.
Egan 1991: G. Egan, Industry an economics on the medi-eval and later London waterfront. In: G. L. Good (Hrsg.), Waterfront archaeology (London 1991) 9–18.
Menousková 2008: D. Menousková, Krása, která hřeje (Uher-ské Hradiště 2008).
abb. 11. Pirna PL 65. Ofenkacheln um 1500: Auswahl der Kacheltypen d, e und f
Pavlík/Vitanovský 2004: Č. Pavlìk/M. Vitanovský, Encyklo-pedie Kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Prag 2004).
Salmen 2009: A. Salmen, Die archäologischen Ausgrabungen auf dem Altmarkt in Dresden (DD-159), In: R. Smolnik (Hrsg.) Ausgrabungen in Sachsen 1. Arbeits u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. Beih. 20 (Dresden 2009) 121–126.
Speck 1900: O. Speck, Meister Peter von Pirna, Neues Archiv Sächs. Gesch. 21, 1900, 40–54.
Wagner 2008: J. Wagner, Der „Goldene Ofen“ von Stift Alten-burg – Ein Beitrag zur kunstgeschichtlichen, archäologi-schen und handwerksgeschichtlichen Forschung anhand eines spätmittelalterlichen Fundkomplexes. Unveröff. Diss. Univ. Graz (Graz 2008).