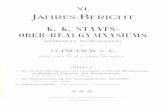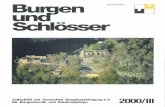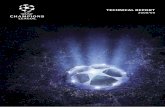Pietrele, ,,Maˇgura Gorgana‘‘ Bericht u ̈ber die Ausgrabungen und geomorphologischen...
Transcript of Pietrele, ,,Maˇgura Gorgana‘‘ Bericht u ̈ber die Ausgrabungen und geomorphologischen...
Pietrele, ,,Magura Gorgana‘‘
Bericht uber die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2009
Von Svend Hansen, Meda Toderas, Agathe Reingruber, Ivan Gatsov, Marvin Kay, Petranka Nedelcheva,Dirk Nowacki, Astrid Ropke, Joachim Wahl und Jurgen Wunderlich
Schlagworter: Rumanien/Walachei/Pietrele/Donau/Kupferzeit/Gumelnita-Kultur/Okologie/Keramik/AnthropologieKeywords: Romania/Wallachia/Pietrele/Danube/Copper Age/Gumelnita-culture/Ecology/Ceramics/
Anthropology˚º2O(+ß( æº;+-: —#?ß=Ł'/´-º-ıŁ'/ˇŁ($&(º(/˜#=-Ø/3(*=ßØ +(Œ/ˆ#?(º5=Ł!-/.Œ;º;ªŁ'/˚(&-?ŁŒ-/
F=$&;:;º;ªŁ'
Einleitung
Die bisherigen Ausgrabungen auf dem Siedlungs-hugel Magura Gorgana in Pietrele (Abb. 1) habeneine Vielzahl von Materialien zur Rekonstruktionder wirtschaftlichen Grundlagen und der sozialenOrganisation der fruhen Kupferzeit an der UnterenDonau erbracht, deren großes Potential sich erstdurch die geomorphologischen Untersuchungenzur Landschaftsrekonstruktion sinnvoll erschließenlasst.1 Zugleich stellte sich heraus, dass die Sied-lung nicht allein auf den Wohnhugel begrenzt war,sondern eine Art Außensiedlung umfasste, derenzeitliches und soziales Verhaltnis zum Wohnhugelerstmals im Sommer 2009 untersucht werden konn-te.2 Dabei bewaltigte unser gesamtes Ausgrabungs-team eine erhebliche Arbeitsleistung.3
Es war eines der Ziele der Ausgrabungen,Grundlagen zur Datierung der fruhen Kupferzeit ander Unteren Donau zu legen. Hierzu gehorte insbe-sondere eine stratigraphisch abgesicherte Keramik-sequenz und ein dicht geknupftes Netz von 14C-Da-ten, denn die Entwicklung der Keramik war imWesentlichen stilistisch begrundet und die Zahl der14C-Daten vergleichsweise gering. Aufgrund der gro-ßen Zahl von verbrannten Hausern mit reichhalti-gem Inventar lasst sich die Entwicklung der Keramikim Wesentlichen auf der Basis vor allem vollstan-diger Gefaße aus gleichsam geschlossenen Komple-
xen nachzeichnen. Bislang wurden 24 14C-Datierun-gen durchgefuhrt. Das ist mehr als bisher fur dieGumelnita-Kultur insgesamt vorliegen und es ist mog-lich, die ,,Hausgenerationen‘‘ zeitlich einzugrenzen(Abb. 2).4 Daneben haben wir moglichst aus jedemarchaologischen Befund einen Knochen eines klei-nen Wiederkauers entnommen, so dass fur metho-disch orientierte 14C-Datierungen die Materialien zurVerfugung stehen. Das gilt gleichermaßen naturlichfur die botanischen Makroreste. Diese eher techni-schen Details sind der Erwahnung nur wert, weil diebisherigen Vorstellungen zur Chronologie der Kup-ferzeit an der Unteren Donau bzw. im westlichenSchwarzmeerraum insgesamt durch 14C-Daten ausden Grabern des Friedhofs von Varna offenbar er-heblich korrigiert werden mussen.5 Die neuen Datie-rungen zeigen, dass die reichsten Graber in Varnabereits zwischen 4600 und 4500 v. Chr. angelegtworden sind (Abb. 3). Diese Graber erscheinen dem-nach nicht das Ergebnis einer langeren kupferzeit-lichen Entwicklung des ,,Kodzadermen-Gumelnita-Karanovo VI-Komplexes‘‘ zu sein, sondern stehenoffenbar an ihrem Anfang.
Diese neuen Datierungen wurden im Zusam-menhang mit der gegenwartig in Vorbereitung be-findlichen Gesamtpublikation des Friedhofs ange-fertigt.6 Sie wird die Grundlage fur die weiterewissenschaftliche Diskussion zur Bewertung der un-gleichen Verteilung des Beigabenreichtums der Gra-ber bilden. Die uberraschend fruhe zeitliche Einord-nung hat die Frage aufgeworfen, ob dahinter einReservoireffekt der 14C-Daten stehen konnte, auf-grund einer durch Fisch gepragten Ernahrung her-vorgerufen worden sein konnte. Wegen der Kusten-lage von Varna liegt diese Vermutung zwar nahe,musste aber durch die Stickstoffisotopenwerte be-
1 Ohne die bestandige Unterstutzung durch Herrn AkademikerProf. Alexandru Vulpe ware das nicht moglich gewesen, wofurihm auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
2 Fur die Forderung auch dieser Untersuchungen gilt unser herz-licher Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) undnamentlich Herrn Dr. Hans-Dieter Bienert.
3 Neben den Autoren waren Joni Abuladze, Nele Beckmann, Dr. IrmaBerdzenishvili, Katrin Beutler, Sven Brummack, Huang Chao,Richard Ehrich, Lili Gatsova, Elena Gavrila, Cristina Georgescu,Verena Henrich, Mehmet Karaucak, Dr. Jorrit Kelder, Dr. FlorianKlimscha, Ute Koprivc M. A., Michael Muller, Ass. Prof. Wang Peng,Dr. Michael Prange, Kai Ruess, Nils Schakel, Konstantin Scheele,Stefanie Schlunz, Christoph Schroder, Dr. Daniel Spanu, LevanTchabashvili, Stanislav Terna M. A., Tilmann Vachta M. A., Dimi-tri Zhvania und Petar Zidarov M. A. an den Grabungen beteiligt.
4 Reingruber/Thissen 2009, 751 ff.; Weninger u. a. im Druck.5 Higham u. a. 2007.6 Die Vorlage des Graberfelds ist durch Vl. Slavcev im Rahmeneines Alexander von Humboldt-Stipendiums an der Eurasien-Ab-teilung des DAI in Arbeit.
legt werden. Auf einen weiteren, durch Thermal-quellen verursachten Reservoireffekt wurde unlangstaufmerksam gemacht.7
Die altesten bislang aus Pietrele vorliegenden14C-Daten gehoren in das 45. Jh. v. Chr. Die Besied-lung endet um 4250 v. Chr., was durchaus im Ein-klang mit den Daten aus bulgarischen Wohnhugelnsteht.8 Zu Beginn unserer Arbeiten in Pietrele warenwir der Ansicht – damals vor dem Hintergrund dergelaufigen Chronologievorstellungen – die Entwick-lung der Zeit vor Varna durch unsere Grabungenbeleuchten zu konnen und damit einen Beitrag zurErklarung dieses sozialgeschichtlich so bedeutsa-men Phanomens leisten zu konnen, das unlangstJ.-P. Demoule pointiert als ,,l’origine des inegalites‘‘bezeichnet hat.9 Nach den vorliegenden Daten mus-sen wir jedoch davon ausgehen, die Zeit nach Varnazu untersuchen. Daraus wurden sich vollig neuePerspektiven ergeben, nicht zuletzt fur das Phano-men der Siedlungshugel selbst. Denn die zeitlicheKongruenz des Einsetzens dieser Siedlungsform ander Unteren Donau und in Nordostbulgarien mitdem Auftreten der reichen Graber in Varna setzt dieFrage nach dem Herrschaftsbezug der Siedlungs-hugel auf die Tagesordnung.10 Den 14C-Daten ausPietrele kommt somit eine Schlusselposition zu.
Daruber hinaus mussen die neuen Daten auchin einem uberregionalen Kontext neu eingeordnetwerden. Folgt man ihnen, sind verschiedene zeitlicheGleichsetzungen der ostbalkanischen Stufe KGK VImit Kulturen im Karpatenbecken und im Zentralbal-kan sowie in Griechenland zu uberprufen. So ist dieParallelisierung mit der zentralbalkanischen VincaD-Zeit wahrscheinlich hinfallig. Nach den jungstenZusammenstellungen von 14C-Daten durch D. Boricendet die die Stufe Vinca D sogar bereits zwischen4650 und 4600 v. Chr., auf die dann die StufenProto-Tiszapolgar und Tiszapolgar A folgen.11 DieDaten fur den Bereich des Vinca-Zeichensystems le-gen uberdies nahe, dass bereits fur die erste Halftedes 5. Jts. mit erheblichen bergmannischen und me-tallurgischen Aktivitaten zu rechnen ist. Daher mussman davon ausgehen, dass dem scheinbar plotz-lichen Auftreten so vieler ausgepragter Metallfor-men in Varna eine erhebliche Entwicklungszeit vonvielleicht bis zu 500 Jahren vorausgeht. Im Lichte
3
Abb. 1.Pietrele. Der Siedlungshugel ,,Magura Gorgana‘‘ und die Außen-siedlung mit Flache J (Luftbild: K. Scheele).
7 Higham u. a. 2010.8 Vgl. die Daten bei Gorsdorf/Bojadziev 1996.9 Demoule 2007, 79 ff.
10 Zum Beginn der Tellbesiedlung vgl. Brummack 2009.11 Boric 2009, 191 ff.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.44
dieser neuen Daten erscheint das bisherige archao-logische Konzept der Kupferzeit in Sudosteuropaeiner Revision zu bedurfen, welche allerdings aufder Basis neuer 14C-Datierungen, beispielsweise ausdem Karpatenbecken, zu erfolgen hat. So weisen die14C-Daten von Rakoczifalva-Bagi-fold, einem Fried-hof der Bodrogkeresztur-Kultur, in das letzte Vierteldes 5. Jts. v. Chr.12
Es entsprach unseren anfanglichen Erwartun-gen, dass sich um den eigentlichen Wohnhugel wei-tere Siedlungsspuren auffinden lassen konnten, dievorzugsweise mit handwerklichen Aktivitaten, z. B.der Keramikherstellung, im Zusammenhang stehensollten. Es war daher eine Uberraschung, als B. Songin der geomagnetischen Prospektion nordlich undsudwestlich des Siedlungshugels eine Reihe von gro-ßeren, regelmaßigen Anomalien nachweisen konnte.Bohrungen zeigten, dass unter einem bis zu 2,5 mmachtigen Kolluvium massive Brandschichten liegen.Seine vorlaufige Interpretation des Magnetogrammsder Siedlung im Norden des Tells erbrachte die An-nahme von sieben weiteren Hausreihen mit jeweils5–8 Hausern. Insgesamt vermutete er allein in die-sem Bereich mehr als 40 Hauser.13
Erstmals konnte somit fur einen Siedlungs-hugel der ostbalkanischen Kupferzeit wahrschein-lich gemacht werden, dass der Wohnhugel nur derKern einer deutlich großeren Siedlung gewesen seindurfte. Damit stellte sich aber die Frage nach denmoglichen funktionalen, okonomischen und sozia-len Unterschieden zwischen Tell- und Flachsiedlung.Insbesondere das uberdurchschnittliche hohe undqualitatvolle Fundaufkommen auf dem Siedlungshu-gel (u. a. 225 Kupfer-, 63 Spondylusobjekte sowieeinzelne Objekte aus Gold) ware mit der Außensied-lung zu vergleichen.14
Der Grabungsbefund
Die Fulle der aus diesen neuen Entdeckungen resul-tierenden Fragen ist nur durch Ausgrabungen in derFlachsiedlung zu beantworten. Dank der weiterenForderung durch die Deutsche Forschungsgemein-schaft konnten 2009 die Untersuchungen auf dieAußensiedlung ausgedehnt werden. Obwohl die
"
Abb. 2.Pietrele. Stratigraphisches Altersmodell fur die Radiocarbondaten(B. Weninger).
12 Csanyi/Raczky/Tarnoki 2009, 13 ff.13 B. Song in Hansen 2006, 4 ff. Abb. 5–9.14 In Polgar-Csoszhalom (Ungarn) konnte durch geomagnetische
Prospektionen und Testgrabungen ebenfalls eine Flachsiedlungvon 28 ha nachgewiesen werden, mit markanten Unterschiedenim Tierknochenmaterial: vgl. Raczky/Anders 2008.
Pietrele 2009 45
Machtigkeit des Kolluviums durch Bohrungen vonB. Song mit dem Ejkelkamp-Bohrer bekannt war,wurden in den beiden Flachen regelmaßig sorgfaltiggeputzte Plana angelegt, um eventuelle Siedlungs-spuren dokumentieren zu konnen. Insbesondere inFlache J, wo das Kolluvium 1,7 m machtig war, ver-schlangen diese Arbeiten einen großen Teil der zurVerfugung stehenden Zeit. Eine großflachige Unter-suchung großerer Teile der Außensiedlung wird da-her nur durch den maschinellen Abtrag des Kollu-viums zeitlich und finanziell zu leisten sein.
Flache G
Bereits bei den ersten Sondierungen kam bei Aus-schachtungsarbeiten etwa 60 m ostlich des Sied-lungshugels, direkt an der Terrassenkante zur Do-nauaue, unter einem uber 1 m machtigen Kolluviumeine massive Scherbenpackung zum Vorschein.15
Daher wurde 2009 die 5 " 10 m große Flache G imBereich dieser Fundkonzentration in leichter Hang-lage auf einer Hohe von 28,50–27,75 m angelegt.Erwartungsgemaß wurden bei 27,49 mNN mehrerezerbrochene, aber rekonstruierbare Tongefaße so-
wie verschiedene Kleinfunde aufgedeckt (Abb. 4,40–46). Von hier stammt auch das Tongefaß miteingeritztem Wirbeldekor (Abb. 38), das typologischan den Beginn der Gumelnita-Entwicklung gehort.Die Funde sprechen dafur, dass es sich um den Be-reich eines Hauses handelt, doch wurden in derGrabungsflache entweder keine Wandstrukturen er-fasst oder konnten wahrend der Grabung nicht er-kannt werden. Bei ca. 26,40 mNN wurde der gewach-sene Boden erreicht, die Flache verkleinert und zurSicherheit noch einmal um ca. 50 cm abgegraben.
Flache J
Eine zweite Flache J wurde ebenfalls in leichterHanglage ca. 50 m nordlich vom Tell bei 32,63 mNNim Norden angelegt. Die Flache war zunachst 5,5 "6 m groß und wurde spater um zwei Meter nachWesten und Suden erweitert. Bis zu einer Tiefe von30,85 mNN handelte es sich um dunkelbraune Erde,in der keine archaologischen Strukturen erkennbarwaren und aus der Funde geborgen wurden, dietypologisch von der Boian-Kultur bis zur mittelal-terlichen Dridu-Kultur reichten.16 Unter diesem uber
Abb. 3.14C-Daten aus Varna
(nach Highamu. a. 2007).
15 Seinerzeit auch als Flache D bezeichnet (vgl. Hansen u. a. 2004,44–45).
16 Fur die Bestimmung der mittelalterlichen Scherben danken wirDr. Adrian Ionita herzlich.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.46
1,60 m machtigen Kolluvium kamen dann uberra-schend gut erhaltene Befunde zwischen und unterverbrannten Wandfragmenten zum Vorschein. ImEinzelnen handelt es sich um einen relativ schlechterhaltenen und aus seiner ursprunglichen Positionverschobenen Ofen im Suden der Flache (Abb. 5; 6).Im Norden sind die Reste einer 140 " 200 cm gro-ßen Lehminstallation erhalten, die ursprunglich direktan den Ofen angeschlossen haben durfte (Abb. 7).In dieser fanden sich zwei große, 40 und 60 cmlange Mahlsteine und unmittelbar daneben ein Ton-gefaß in situ. Westlich davon lagen Scherben meh-rerer Vorratsgefaße. Architekturreste konnten nichtmit Sicherheit nachgewiesen werden. Allerdings falltins Auge, dass der Bereich, in dem die verbranntenBefunde zutage kamen, scharf begrenzt ist und sichin den nordlichen Teilen der Flache keine Fundkon-zentrationen fanden.
Aufgrund von Zeitmangel konnte die Kon-struktion der Lehminstallation und des Ofens nichtgenauer untersucht werden. Doch erscheint sehr vielversprechend, dass alle Objekte in Flache J, unddas gleiche gilt fur Flache G, von einer Sinterschichtuberzogen sind (Abb. 8). Dies bedeutet im Falle derKeramik und sonstiger Funde eine arbeits- und zeit-intensive Prozedur der Entfernung des Sinters, zuder es aber keine Alternative gibt.17 Hingegen be-deutet die Versinterung der verbrannten Lehmar-chitektur, dass diese deutlich besser erhalten seinkonnte als auf dem Hugel.
Flache B
Die Arbeiten in der Flache B beschrankten sich imWesentlichen auf den Bereich der Suderweiterungder Flache, die 2007 begonnen wurde, um die Sud-wand des unverbrannten Hauses im Osten der Gra-bungsflache zu dokumentieren.18
"
Abb. 4.Pietrele. Gesamtansicht von Flache G (Foto: S. Hansen).Abb. 5.Pietrele. Flache J mit Ofen, Lehminstallation und Scherbenkonzen-tration (Foto: S. Hansen).
17 Die Restauratorin Nele Beckmann (Bielefeld) berichtet dazu:,,Die z. T. 1–2 mm dicken Sinterauflagen wurden in einer Bad-losung aus Wasser, Essig und Zitronensalz gelockert und durchSchaber und Burste entfernt. Zum Vorbereiten wurden die ver-sinterten Scherben 2–4 Stunden in Wasser eingelegt. Die Scher-ben wurden dann fur vier Stunden in die Losung gelegt. Sehrdicke Sinterschichten konnten oft nicht in einem Durchlauf ent-fernt werden, so dass mehrere Baddurchlaufe notwendig wa-ren. Anschließend mussten die gereinigten Scherben fur min-destens 4–6 Stunden in Wasser neutralisiert werden. Dabeiwurde das Bad mehrmals gewechselt.‘‘
18 Hansen u. a. 2009, Abb. 4–6.
Pietrele 2009 47
Abb. 6.Pietrele. Fundverteilung
um Ofen undLehminstallation
(Grafik: M. Karaucak).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.48
Ab einer Tiefe von ca. 33,80 mNN konnten dieNordhalften der bereits 2008 sichtbaren verbranntenHauser ausgegraben werden (Abb. 9), die zu derzweiten der vier Hauserzeilen auf dem Tell gehoren.Im zentralen Bereich des Sudprofils, aber auch in derSudostecke der Flache, wurden einfache Ofenkon-
struktionen angetroffen, so dass womoglich von zweiseparaten Gebauden in diesem Areal auszugehenist, was auch aufgrund der Keramikauswertung un-termalt werden kann (s. u.). In den stark verkohltenBereichen dieser Gebaude wurden unter den rekon-struierbaren Gefaßen Silexklingen (P09B739CER09)und Getreidevorrate (P09B739CER19, P09B742,P09B783) angetroffen, die noch in der Auswertungsind.
Flache F
In der letzten Woche der Ausgrabung 2008 wurdenauf einer Hohe von etwa 30,50 m NN die Reste ei-nes verbrannten Gebaudes erkennbar.19 Die Annah-me, dass es sich um einen intentional verfullten Ge-bauderest handeln konnte, bestatigte sich bei denAusgrabungen 2009 jedoch nicht. Die West- undNordwand des Gebaudes waren vergleichsweise gutzu erkennen. Sie positiv auszugraben gelang jedochnicht, doch wurde der Wandverlauf im Zusammen-
Abb. 7.Pietrele. Flache J mit Lehminstallation und Mahlsteinen (Foto: S.Hansen).
Abb. 8.Pietrele. Mit Sinter uberzogener ,,Gluthalter‘‘ aus P09G520 (Foto:S. Hansen).
Abb. 9.Pietrele. VerbrannteHausstrukturen amSudprofil der Flache B(Foto: S. Hansen).
19 Hansen u. a. 2009, Abb. 21–22.
Pietrele 2009 49
hang mit den Profilen im Bereich der Pfosten guterkennbar (Abb. 10; 11). Die hohlen Pfostenstand-spuren, die 2008 mit Gips ausgegossen worden wa-ren, enthielten teilweise noch Holzreste. Ostlich derWand schließt sich ein etwa 1,5 m breiter Streifenan, in dem sich nur wenige Funde und auch nichtso ausgepragte Brandspuren fanden. In einer scharfbegrenzten Linie folgt dann der Bereich mit demOfen und zahlreichen verbrannten Tongefaßen, dievon teilweise sehr großen Wandfragmenten bedecktwaren. Am westlichen Rand des Ofens konnten dieAbdrucke einer Reihe von ca. 8 cm im Durchmesserbetragenden Pfosten entdeckt werden, die zu einerdunnen Zwischenwand gehort haben durften (Abb.12; 13), welche auch im Norden partiell nachweisbarist. Dadurch entstand eine Art Korridor. Moglicher-weise ist dies mit dem obersten Haus in Flache Fvergleichbar, wo ebenfalls entlang der Westwandkeine Gefaße aufgestellt waren, sondern verschie-dene Gerate fur eine Art Werkraum sprechen.20
Sudlich an den Ofen gebaut ist eine vier-kammrige Lehminstallation, deren sudlicher Teil ab-gesackt ist, was mit einer Senkung des Untergrundszu tun haben konnte. Innerhalb einzelner Abteilun-gen fanden sich noch kleine Tongefaße sowie Resteeines großeren Gefaßes (Abb. 14). Mit 170 " 120 cmist es die bisher großte Lehminstallation die wir inPietrele aufdecken konnten. Ein zerbrochener Laufereiner Muhle fand sich außerhalb der Installationhart an der Ostwand. An diese schloss eine massiveLehmbank an, deren nordliche Kante erhalten ist(Abb. 15). Auch im Suden war der Raum durch einedunne Zwischenwand begrenzt, wie die Abdruckeder Pfosten belegen.
Im ubrigen Teil des Raums fanden sich ca. 200zerscherbte, aber rekonstruierbare Gefaße (Abb. 16).Verschiedentlich konnten Gefaße mit verkohltenPflanzenresten dokumentiert werden (Abb. 17; 18).
Abb. 10.Pietrele. Unverbrannter
Wandverlaufin Flache F.
Abb. 11.Pietrele. Unverbrannter
Wandverlaufin Flache F.
Abb. 12.Pietrele. Dunne
Zwischenwand mitAbdrucken von ver-
kohlten Pfosten(Foto: S. Hansen).
Abb. 13.Pietrele. Verbranntes Gebaude in Flache F (Foto: S. Hansen).
20 Hansen u. a. 2005, 352 ff.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.50
Zwei verkohlte Holzpfosten stehen wohl mit derDachkonstruktion in Zusammenhang (Abb. 19). Ne-ben diesen schwach verbrannten bzw. verkohltenStellen fanden sich aber auch Hinweise auf deutlichhohere Temperaturen, so verschlackte Wandfrag-mente (Abb. 20).
Tatsachlich erscheint es vielleicht auf den ers-ten Blick seltsam, dass Lehmhauser mit so hohenTemperaturen verbrennen sollen. Die Rekonstruk-tion eines Teils der Stadtmauer von Hattusa hat ei-ne Fulle von Erkenntnissen zum bronzezeitlichenBauen erbracht, das in Teilen auch auf andere vor-geschichtliche Perioden ubertragen werden darf.21
In unserem Zusammenhang ist die Herstellung vonLehmziegeln von besonderem Interesse. Jurgen See-her hat fur die Stadtmauer Lehmziegel mit einemGewichtsverhaltnis (!) von 26–28 kg Lehm zu einemKilogramm Strohhacksel herstellen lassen.22 Tat-sachlich lassen viele der verbrannten Mauerstucke
Abb. 14.Pietrele. Vierkammerige Lehminstallation sudlich des Ofens in Fla-che F (Foto: S. Hansen).
Abb. 15.Pietrele. Massive Lehmbank ostlich der Lehminstallation (Foto:S. Hansen).
Abb. 16.Pietrele. Starkzerscherbte, aber re-konstruierbare Gefaßenordlich des Ofensin Flache F(Foto: S. Hansen).
Abb. 17.Pietrele. Gefaß inP09F257 mit verkohltenGetreideresten(Foto: S. Hansen).
Abb. 18.Pietrele. Gefaß inP09F277 mit verkohltenPflanzenresten(Foto: S. Hansen).
21 Seeher 2007.22 Seeher 2007, 38.
Pietrele 2009 51
aus Pietrele die große Menge des beigegebenenHacksel erkennen (Abb. 21). Das bedeutet, dass derBrennstoff schon in den Mauern enthalten war undgar nicht zusatzlich in ein Haus eingebracht werdenmusste. Das erklart auch, dass die verbranntenWande schlecht nachzuweisen sind und im bestenFall eine staubartige Masse darstellen. Der Branddes Hauses durfte in einer ersten Phase den Dach-stuhl mit dem strohgedeckten Dach erfasst haben.In einer zweiten Phase begannen die Holzbalkeninnerhalb der Lehmwande und die hackselgemager-ten Wande selbst durchzugluhen, wodurch jenehohen Temperaturen entstanden, die stellenweisezur Schlackenbildung fuhrten (Abb. 20). In diesemZusammenhang sei nur an entsprechende Phanome-
ne mitteleuropaischer Holz-Stein-Mauern des 1. vor-christlichen Jahrtausends erinnert, die in der alterenForschungsliteratur auch als ,,Schlackenwalle‘‘ be-kannt wurden, weil bei diesen Schadensfeuern selbstBasaltsteine bei etwa 1.000 !C geschmolzen sind.23
Abb. 19.Pietrele. Verkohlte
Holzpfosten imGebaude der Flache F
(Foto: S. Hansen).
Abb. 20.Pietrele. Verschlacktes
Wandfragmentaus P09F204
(Foto: S. Hansen).
Abb. 21.Pietrele. Verbrannter Huttenlehm mit großen Mengen beigemischtenHacksels (Foto: S. Hansen).
Abb. 22.Pietrele. W. Peng beim Auffinden des Scheibenanhangers (Foto:S. Hansen).
23 Baitinger 2008, 13 Abb. 6.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.52
Am letzten Tag der Ausgrabungen wurde inder Osthalfte des verbrannten Hauses ein goldenerScheibenanhanger zusammen mit einer kleinenGoldspirale und zahlreichen Spondylusperlen gefun-den (Abb. 22; 23). Vergleichbare Anhanger sind ausdem Karpatenbecken und dem westlichen Schwarz-meergebiet, darunter auch dem Graberfeld von Var-na bekannt.24
(S.H./M.T.)
Geomorphologische Untersuchungenim Raum Pietrele
Die seit 2005 in der naheren Umgebung des Tellsdurchgefuhrten palaookologischen und fluvialmor-phologischen Untersuchungen zeigten, dass etwazur Zeit der kupferzeitlichen Besiedlung des Tellsein Umbruch im Sedimentationsverhalten der Do-nau erfolgte. Dieser wird in den lithologischen Pro-filen, die in einem Umkreis von ca. 2 km um denTell erbohrt wurden, in einem markanten Sediment-wechsel von Sanden und Kiesen zu feinkornigenHochflutsedimenten erkennbar. Wahrend die Basisder Hochflutsedimente auf etwa 4000 bis 4500 calBC datiert werden konnte, liegen aus den Sandenbislang noch keine Datierungsergebnisse vor. Alseine mogliche Ursache fur den Sedimentationswech-sel werden zunehmende anthropogene Eingriffe imEinzugsgebiet der Donau angesehen. Rodungen und
eine Zunahme der Landnutzung seit dem Neolithi-kum konnten als Ausloser verstarkter Bodenerosionund einer Zunahme der Schwebfracht in den Flus-sen angesehen werden, was wiederum zu verander-ten Abfluss- und Sedimentationsbedingungen fuhrte.Die Uberdeckung einer Donauterrasse mit Hochflut-lehm als Reaktion auf den postglazialen Anstiegdes Schwarzen Meeres wird ebenfalls als Erklarungfur den abrupten Sedimentwechsel diskutiert.
Um der Klarung dieser Fragen naher zu kom-men, konzentrierten sich die Untersuchungen wah-rend der Gelandekampagne 2009 zum Einen aufden tellnahen Bereich, wo sowohl auf dem Talhangals auch in der Aue weitere Bohrungen durchgefuhrtwurden. Damit sollten die bisherigen Erkenntnissezum lithologischen Aufbau der Donauaue und derenVerzahnung mit Hangsedimenten weiter verdichtetwerden. Zum Anderen wurde das Untersuchungs-gebiet nach Suden in Richtung des rezenten Donau-laufs ausgedehnt und es wurden erste Bohrungenim Bereich der mittlerweile trockengelegten SeenLacul Greaca und Lacul Pietrelor durchgefuhrt. Beiden in den ehemaligen Seen kontinuierlich abgela-gerten Sedimenten handelt es sich um Geoarchive,die palynologisch und palaobotanisch ausgewertetwerden konnen. Auf diese Weise lassen sich Infor-mationen zur holozanen Umwelt- und Vegetations-entwicklung gewinnen. Auch außerhalb des Donau-tals wurden geeignete Archive gesucht, die sich mitBlick auf die Vegetationsentwicklung und mensch-liche Eingriffe in den Naturhaushalt pollenanalytischauswerten lassen. Auf Corona-Satellitenbildern wur-den mehrere potenzielle ehemalige Seen auf dem
Abb. 23.Pietrele. Scheiben-anhanger, Goldspiraleund Perlen ausBefund P09F257(Foto: M. Toderas).
24 Hansen 2007, 282 ff. mit Verbreitungskarte Abb. 175.
Pietrele 2009 53
an das Donautal angrenzenden Plateau identifiziert.An den Lokalitaten konnte jedoch kein geeignetesMaterial erbohrt werden.25
Wahrend der Gelandekampagne 2009 wurdeninsgesamt 29 Rammkernsondierungen mit Bohr-tiefen von bis zu 16 m durchgefuhrt.26 Bereits imGelande fand die Ansprache und Beprobung statt.Es wurden Korngroße, Farbe, Karbonatgehalt undbesondere Merkmale wie Schichtung/Laminierung,Gradierung oder das Vorkommen von Knochen-, Ke-ramik- oder Muschelfragmenten aufgenommen. Andrei Standorten wurden zudem geschlossene Kerneerbohrt und lichtdicht verpackt. Sie werden im Geo-labor des Instituts fur Physische Geographie derGoethe-Universitat Frankfurt/Main weiter bearbeitet.Ferner werden an einzelnen Abschnitten dieser Kerneam Lumineszenzlabor des Geographischen Institutsder Universitat Heidelberg OSL – Datierungen durch-gefuhrt. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Zudemwurden an organischem Material AMS-14C-Alters-bestimmungen vorgenommen (Abb. 24).
Bohrungen in Tellnahe
Die Lage der wahrend der Gelandekampagne 2009abgeteuften Bohrungen in Tellnahe ist in Abb. 25dargestellt. Beispielhaft soll ein N-S-Profil (Abb. 26)vom ostlichen Hangfuß des Tells uber die Terras-senkante bis in die Aue naher erlautert werden. DerVerlauf des Profils entspricht in etwa dem des Geo-
elektrikprofils GE08.27 Die Bohrungen Piet 57–59wurden auf dem Hang oberhalb des Steilabfalls zurAue abgeteuft. Bohrung Piet 58 liegt unmittelbar amFuß des Tells im Bereich der den Tell umgebendenkreisformigen Struktur, die in Magnetogrammen28
markant hervortritt. Piet 57 und 59 sind in einerflachen Rinne gelegen, die unmittelbar nordostlichdes Tells auf die Hangkante ausgerichtet ist. DieBohrungen Piet 60–62 liegen unterhalb der Hang-kante auf Auenniveau.
Die Bohrprofile von Piet 57–59 zeigen biszu vier Meter machtige Kulturschichten und Kollu-vien, die Siedlungsmaterial enthalten. In der Rinne(Piet 57) sind die Kulturschichten mit 4,5 m beson-ders machtig. Darunter folgen sehr feste, marmo-rierte, meist rotliche Tone, die in Piet 58 noch vonSanden uberlagert werden. Niveau und Auspragungder Tone und Sande entsprechen denen, die bereitsin anderen Bohrungen und den Geoelektrikprofilenals Tellbasis identifiziert wurden.29 Unmittelbar amFuß der steilen Hangkante wurden die marmorier-ten, rotlichen Tone von 1 m unter Gelandeoberflache(GOF) bis zur Endteufe von 6 m angetroffen. Dies be-legt die beachtliche Machtigkeit der Tone und deu-tet darauf hin, dass sie im Bereich des Steilabfallsanstehen. Eine offensichtlich kunstlich geschaffeneHohlform im Bereich des Steilhangs ostlich des Pro-fils sowie der Steilhang selber konnten ein Hinweisdarauf sein, dass der Ton hier abgebaut wurde, wiedies auch gegenwartig noch an Ausbissen des Tonsin Ortschafen im Bereich des Talhangs praktiziertwird. Der lineare Verlauf der Gelandekante und derSteilhang, deren Entstehung nur schwer durch na-
Lab.-Nr. Bohrung Proben-Nr. Material Tiefe(cm u. GOF)
14C–Alter KalibriertesAltersintervall
!13C (‰)
KIA 41255 Piet 63 63-A Holz 431–436 1105 % 20 BP 895–985 cal AD –23.82 % 0.15
KIA 41256 Piet 63 63-B Holzkohle 844–848 5620 % 90 BP 4690–4270 cal BC –31.97 % 0.49
KIA 41257 Piet 64 64-A Holzkohle 475–478 4685 % 30 BP 3625–3370 cal BC –24,10 % 0,14
KIA 41258 Piet 73 73-A organisches Material 410–420 365 % 20 BP 1455–1630 cal AD –23.94 % 0.44
KIA 41259 Piet 73 73-B organisches Material 420–430 400 % 20 BP 1440–1615 cal AD –29.67 % 0.13
KIA 41260 Piet 73 73-C organisches Material 450–460 460 % 20 BP 1420–1450 cal AD –26.31 % 0.23
KIA 41261 Piet 73 73-D organisches Material 510–520 625 % 20 BP 1290–1395 cal AD –27.01 % 0.25
KIA 41263 Piet 80 80-A organisches Material 635–640 3375 % 20 BP 1740–1615 cal BC –23.25 % 0.18
KIA 41264 Piet 80 80-B organisches Material 860–865 1715 % 20 BP 255–395 cal AD –25.84 % 0.42
KIA 41265 Piet 80 80-C organisches Material 905–910 2980 % 20 BP 1295–1125 cal BC –23.73 % 0.12
KIA 41266 Piet 80 80-D organisches Material 950 3325 % 25 BP 1685–1530 cal BC –23.36 % 0.22
Abb. 24.Pietrele. AMS-14C-Alters-
bestimmungen anorganischem Material
aus Bohrkernen der Ge-landekampagne 2009.
Die Datierungenwurden von Prof. Dr.P. M. Grootes, LeibnizLabor fur Altersbestim-mung und Isotopenfor-schung der Christian-Albrechts-Universitat
Kiel, Deutschland,vorgenommen.
25 Der Survey wurde unterstutzt durch Dr. Elena Marinova, Universi-tat Leuven, Belgien. Sie ubernahm zudem dankenswerterweisedas Auslesen und die Analyse botanischer Makroreste aus dengemeinsam entnommenen Bohrkernen.
26 Ein Teil der Bohrungen wurde mit Unterstutzung von Kai Ruess,Frankfurt/Main, und Mitgliedern des Grabungsteams durchge-fuhrt.
27 Hansen u. a. 2009, Abb. 28.28 Hansen u. a. 2006, Abb. 9.29 Hansen u. a. 2009.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.54
Abb.25.
Pietrele.TopographischeKartederUmgebungdesTells
mitLagederBohrungenmehrererGelandekampagnensowie
LagedesProfils
Piet58-Piet62(rote
Linie)(Datengrundlage:topographischeAuf-
nahmeM.Ullrich).
Pietrele 2009 55
Abb. 26.Pietrele. Lithologische
Profile entlang der Pro-fillinie Piet 58-Piet 62vom Hang ostlich des
Tells in die Aue.Die Bohrprofile zeigen
den Ubergang von alte-ren roten Tonen und
Sanden im Bereich desTalhanges zu holo-
zanen Hochflutsedimen-ten (Lage der Profile
vgl. Abb. 24).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.56
turliche Prozesse zu erklaren ist, konnte aber auchzur Ausweitung der Anbauflache kunstlich geschaf-fen worden sein. In Piet 61 sind die Tone nicht mehrzu beobachten. Hier treten in entsprechender TiefeSande und Kiese auf, bei denen es sich moglicher-weise um Terrassenreste handelt, die aber auch denVerlauf eines im Holozan aktiven Gerinnes markierenkonnten. In 62 ist die fur die Aue charakteristischeAbfolge zu beobachten, die durch feinkornige Hoch-flutsedimente und Stillwasserablagerungen, welchein etwa 9,5 m unter Gelandeoberflache glimmerrei-che Feinsande uberlagern, gekennzeichnet ist. Einevergleichbare Abfolge wurde in Bohrung Piet 18 be-obachtet.
Bohrungen zwischen Tell und Donau
Im Zuge der Erweiterung des Arbeitsgebietes inRichtung Suden wurden Bohrungen im Bereich einerin topographischen Karten und Satellitenbildernidentifizierbaren Maanderstruktur sudostlich desTells (Piet 72–74, vgl. Abb. 27) durchgefuhrt. Wei-tere Bohrungen wurden entlang eines N-S-Profilsvom einstigen See Lacul Pietrelor bis in unmittel-bare Nahe des aktuellen Donaulaufs abgeteuft (Piet64, Piet 79, Piet 78, Piet 80, vgl. Abb. 27).
Bohrung Piet 72 liegt in dem derzeit trocken-gefallenen maandrierenden Gerinne, wahrend dieBohrungen Piet 73 innerhalb und Piet 74 außerhalbder Maanderschleife liegen. Die drei in Abb. 28 dar-gestellten lithologischen Profile lassen erneut diecharakteristische Gliederung erkennen. Uber Sandenfolgen tonige Stillwasserablagerungen, die wieder-um von sandigen und schluffigen, in dem Gerinneauch tonigen Sedimenten uberlagert werden. DieBasis dieses obersten Abschnittes liegt bei den dreiBohrungen etwa im gleichen Niveau, wahrend diedarunter folgende Stillwasserfazies in Piet 74 mitca. 6,5 m machtiger als in den beiden anderen Boh-rungen ist. Allerdings lasst sich in allen drei Bohrun-gen in vergleichbarer Tiefe (in Piet 73 bei ca. 7,0 munter GOF) ein dunkler, schwarzlich-grauer Bereichmit geringeren Karbonatgehalten identifizieren. Die-ser markante Horizont, der auch in mehreren an-deren Bohrungen in vergleichbarer Tiefe nachgewie-sen wurde, konnte als Indiz fur eine Phase derEutrophierung eines Stillgewassers angesehen wer-den. Weiterfuhrende Analysen des Schwefelgehal-tes, der Biomasse und/oder des Phosphatgehaltessollen hieruber Aufschluss geben. Unterhalb diesesHorizontes folgen in Piet 72 und 73 zunachst starkschluffige Sedimente. Die Obergrenze der darunteranstehenden Sande liegt in Piet 72 ca. 2 m hoherals in Piet 74. Diese starke horizontale Variabilitatder Sedimente kann als Hinweis darauf gewertetwerden, dass die Donauaue zeitweise durch ein Ne-beneinander von Stillwasser- bzw. Uberflutungsbe-
reichen und sandigen Terrassenresten gepragt war,bis schließlich der gesamte Talboden in den Ein-flussbereich der Hochfluten kam und ausgedehnteSeen und sumpfige Areale die Aue bedeckten. Pol-len- und Großrestanalysen an Kern Piet 73 (Abb. 29)deuten darauf hin, dass sich zwischen 5,40 m und6,0 m ein Wechsel im Baumpollenspektrum voll-zieht. Pragen zwischen 7,0 und 6,0 m noch Quercus,Corylus, Ulmus, Tilia, und Carpinus den regionalenBaumpollenanteil, so verschieben sich die Prozent-werte im jungsten Spektrum in Richtung steigenderFagus, Quercus cerris type, Pinus und Picea. Folgtman Tantau,30 so steigt die Fagus-Kurve zu Beginndes Subatlantikums (ca. 500 v. Chr.) rasch an – zuUngunsten der anderen Laubbaume. Damit ist diein Piet 73 erbohrte Stillwasserfazies vermutlich indas mittlere Holozan zu stellen. Leider fehlen ver-wertbare AMS-14C-Datierungen fur diesen Bereich.Fur die daruber liegenden schluffigen Sande liegenmehrere Altersbestimmungen vor. Sie zeigen, dassdiese Sedimente weitaus junger sind und innerhalbder letzten tausend Jahre zur Ablagerung kamen(Abb. 28). Der Sedimentwechsel bei 5,40 m unterGOF durfte somit einen Hiatus dokumentieren. Diejungeren Sedimente spiegeln die starke Dynamikmit der Verlagerung von Gerinnen innerhalb derAue wider, die vermutlich einer ruhigeren Phase mitder Ablagerung von Stillwassersedimenten folgte.
Die entlang des N–S-Profils durchgefuhrtenBohrungen Piet 64, Piet 79 und Piet 78 (Abb. 27)ließen ebenfalls die typische Abfolge erkennen(Abb. 30). Die Grenze zwischen Feinsand und Hoch-flutsedimenten konnte in Tiefen zwischen 6 und8 m unter GOF lokalisiert werden. Aus der im Be-reich des ehemaligen Sees Lacul Pietrelor gelege-nen Bohrung Piet 64 liegt zudem aus 4,75 m Tiefeein 14C-Alter von 3626–3370 cal BC (KIA 41257)vor (Abb. 30), wodurch das mittelholozane Alter derHochflut- bzw. Seesedimente in dieser Tiefe belegtwird, sofern das datierte verkohlte Holz nicht umge-lagert wurde.
Die Lithologie des der Donau am nachsten ge-legenen Kerns Piet 80 unterscheidet sich grundle-gend von allen anderen Kernen des N–S-Profils. Abetwa 70 cm unter GOF besteht die Sedimentfolgenahezu ausschließlich aus Sanden, teilweise sogaraus Kies. Einzige Unterbrechung dieser Sandfaziesstellen wiederholt auftretende Tonbander dar. Insge-samt wurden vier Datierungen an diesem Kern vor-genommen (Abb. 30), die zeigen, dass bis in 10 mTiefe vergleichsweise junge Sedimente auftreten.Die in Abb. 30 zu erkennende Altersinversion ist alsHinweis darauf zu werten, dass es sich um umge-lagertes Material handelt. Sofern es sich bei Probe80-B nicht um Nachfall handelt, wird durch die
30 Tantau u. a. 2009.
Pietrele 2009 57
Abb. 27.Pietrele. Uber-
sichtskarte mit Lageder Bohrungen derGelandekampagne
2009 sowie Verlauf desProfils Piet 64-Piet 80(rote Linie). Ebenfalls
dargestellt sind ehema-lige Seen im Bereich
der Donauaue.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.58
Datierung das Maximalalter dieser Ablagerungen aufden Zeitraum zwischen 250 und 400 cal AD festge-legt. Aufgrund der sandigen Fazies ist anzunehmen,dass es sich um Sedimente handelt, die durch dieVerlagerung der Donau, eines Donauarms oder ei-ner der zahlreichen Donauinseln zur Ablagerungkamen. Dabei wurden wiederholt altere Sedimenteaufgearbeitet, d. h. erodiert, transportiert und erneutakkumuliert. Derartige Verlagerungsprozesse sindauch heute noch zu beobachten und spiegeln sichin den morphologischen Strukturen entlang des Do-naulaufs wider.
Der zwischen den Bohrungen Piet 78 undPiet 80 auftretende Wechsel in der Lithologie mitdem horizontalen Ubergang von feinkornigen Hoch-flutsedimenten zu jungen Donausanden nimmt eineSchlusselstellung hinsichtlich der Auengenese einund wird wahrend der nachsten Gelandekampagnenweiter eingegrenzt und genauer untersucht werden.
Bohrungen im Bereich des trockengelegtenSees Lacul Greaca
Im Gebiet des ehemaligen Lacul Greaca, der bis in die1960er Jahre ostlich von Pietrele existierte, wurdeninsgesamt drei Kerne (Piet 63, Piet 77a, Piet 77b)entnommen. Piet 63 wurde nahe dem nordlichenUfer abgeteuft, wahrend die Bohrungen Piet 77a(offene Sonde) und Piet 77b (geschlossene Sonde)weiter sudlich, jedoch noch nicht im Profundal desehemaligen Sees lokalisiert sind. Die Gelandeober-flache liegt hier 2,8 m tiefer als bei Piet 63.
In Bohrung Piet 63 wurden in Oberflachen-nahe sandig-schluffige Sedimente erbohrt, unter de-nen bis zu einer Tiefe von 9,0 m unter GOF vor-wiegend tonige Ablagerungen mit geringmachtigensandigen Einschaltungen und Muschelbruchstuckenfolgen. Bei den tonigen Sedimenten durfte es sichum Seesedimente handeln, wahrend die sandigenEinschaltungen vermutlich Hochflutereignisse repra-sentieren. Auch in diesem Kern weisen einzelne Ab-schnitte innerhalb der tonigen Sequenzen deutlichdunklere, teilweise fast schwarze Verfarbungen beigleich bleibender Korngroße auf. Die dunklen Be-reiche fallen durch geringere Karbonatgehalte auf.Inwieweit diese Horizonte mit den zuvor aus denBohrungen Piet 72–74 beschriebenen und auch inanderen Bohrungen beobachteten grauschwarzenHorizonten zu parallelisieren sind, ist noch naher zuuntersuchen. An organischem Material aus Piet 63wurden 2 AMS-14C-Datierungen vorgenommen (Abb.31). Sie erbrachten fur eine Probe aus ca. 8,45 mTiefe ein Alter von 4690–4270 cal BC (KIA 41256),was zeitlich der Besiedlung des Tells entspricht. AufGrund zu geringer Kohlenstoffkonzentration ist die-ses Alter jedoch als unsicher anzusehen. Allerdingswird es durch die Ergebnisse palynologischer Uber-
blicksanalysen an drei Proben aus Tiefen zwischen8,5 und 9,0 m gestutzt. Die Pollenanalysen belegeneine regionale Baumpollenzusammensetzung mitQuercus, Corylus, Tilia und Ulmus und Einzelfundenvon Carpinus, wodurch eine Einordnung in das Atlan-tikum moglich erscheint.31
In Bohrung Piet 77a wurden ebenfalls tonigeAblagerungen angetroffen. An der gleichen Lokali-tat wurde ein geschlossener Kern mit 7 m Bohrtiefeentnommen, an dem neben Pollenanalysen weiteresedimentologische, mikrofaunistische und geochro-
Abb. 28.Pietrele. LithologischeProfile mit 14C-Daten imBereich einer Maander-schleife sudlich desTells (Lage der Profiles. Abb. 26).
31 Lazarova/Bozilova 2001; Tantau u. a. 2009.
Pietrele 2009 59
nologische Untersuchungen durchgefuhrt werdensollen, um die Existenz des Lacul Greaca wahrendder kupferzeitlichen Tellbesiedlung nachweisen undVergleiche mit anderen Stillwassersedimenten imUntersuchungsgebiet ziehen zu konnen.
(D.N./A.Ro./J.W.)
Die Keramik
2009 wurden auf dem Tell und in der Außensiedlunginsgesamt 327 rekonstruierbare Gefaße und 45.000Einzelscherben geborgen, so dass zu den bislang7,5 Tonnen Keramik weitere 1,75 hinzukommen.Das enorme Fundaufkommen und die anspruchsvol-len und zeitintensiven Restaurierungsarbeiten mach-ten es unmoglich, alle Gefaßeinheiten bis zum Endeder Kampagne einer abschließenden Dokumenta-tion zu unterziehen. Das trifft vor allem auf dieGefaße aus den beiden verbrannten Gebauden inFlache F zu: Allein in dem zentralen Gebaude lagenbis zu 200 Gefaßeinheiten – die genaue Anzahlkann erst nach Abschluss der Restaurierungsarbei-ten ermittelt werden. Die Keramik aus Flache F wirdfolglich in einem zukunftigen Bericht vorgestellt.
Die Keramik vom Tell
Durch die Erweiterung der Flache B nach Suden wur-den die Hausinventare der in den Vorjahren erforsch-ten Gebaude vervollstandigt. So stammen vom Sud-profil, aus einer Hohe von 34,80 mNN, zwei Becherund ein Kumpf aus P09B708 (Abb. 32); sie gehorenzu dem unverbrannten Osthaus, das 2006 und 2008ausgegraben wurde.32
Bereits 2008 wurden im Suden der Flache B,sudlich der ,,Lehmkasten‘‘33 in einer Tiefe von ca.34,15 mNN die Oberkanten von verbrannten Gebau-den angetroffen, die zur zweiten der vier Hauserzei-len in Flache B gehoren. Ebenfalls 2008 traten inder daran anschließenden Suderweiterung auf glei-cher Hohe in P08B437 weitere stark verbrannte undauf mehrere Fundeinheiten verstreute Gefaßfrag-mente auf.34 Zu diesen 16 Gefaßen aus den oberenLagen der Brandruinen kamen 2009 weitere 24 Ge-faße hinzu, die zwischen 33,80–33,15 mNN gebor-gen wurden.
Das keramische Inventar mit nunmehr 40 Gefa-ßen gehorte womoglich zwei benachbarten Gebau-den an: In beiden Bereichen, sowohl im Sudwestenals auch im Sudosten der Flache, wurde je ein Ofenangetroffen, jedoch sind diese, so wie die Haus-wande selbst, stark zerstort. Zwei distinkte Bereiche
Abb.29.
Pietrele.Pollenubersichtsdiagramm
desunterstenAbschnitts
(5,5
–7,0
munterGOF)
vonPiet73(Bearbeitung:A.Ropke).
32 Hansen u. a. 2009, Abb. 37.33 Hansen u. a. 2009, 16–19.34 Hansen u. a. 2009, Abb. 38–39.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.60
Abb. 30.Bohrprofile entlangeines Profils vom ehe-maligen See LaculPietrelor bis zum aktu-ellen Donaulauf. DieAMS-14C-Alter aus Piet80 belegen, dass dieseLokalitat, im Gegensatzzu den anderen Bohr-punkten, stark von derjungen Dynamik derDonau beeinflusstwurde.
Abb. 31.Bohrprofile aus demBereich des ehemaligenSees Lacul Greaca.Lage des Sees und derBohrungen siehe Karte(Kartengrundlage:Militarische Topographi-sche Karten Osterreich-Ungarn 1 : 200.000,1869–1911).
Pietrele 2009 61
konnen auch anhand der Gefaßverteilungen defi-niert werden: Wahrend in der Sudostecke die Ge-faßfragmente uber mehrere Befunde streuten, sosind die Gefaße im Sudwestbereich oft in Konzen-trationen als ,,Scherbennester‘‘ erhalten. Dennochmussen die Hausinventare unvollstandig bleiben,da nur die nordlichen Hausareale in der Flache er-fasst wurden; die sudlichen verschwinden unter demProfil.
Einige unvollstandige Gefaße von 2008 fan-den Anpassungen in 2009 – so konnte das Vorrats-gefaß von Abb. 33 mit weiteren Scherben erganztwerden. Das ca. 24 Liter fassende geschlosseneSchultergefaß weist im Wechsel von polierten undaufgerauten Flachen Wellenmotive und Kreise auf,wie sie im Schaleninneren oder auf Deckeln mit ei-ner Graphitpaste aufgemalt wurden.
Vor allem von den Gefaßen unmittelbar amSudprofil sind nur Fragmente vorhanden. Dennoch
gelang es, einen Großteil der Gefaße zu restaurie-ren, vornehmlich die zum Teil sehr gut erhaltenenGefaße aus dem Sudwestgebaude. Zu diesen geho-ren die beiden großen Vorratsgefaße mit 25–35 Li-ter Inhalt (Abb. 34,3.4) sowie zwei kleinere Gefaßemit 7–8 l Inhalt (Abb. 34,2). In dieser Großenord-nung liegt auch ein tiefer Topf mit 11 l Inhalt, eineForm, die sowohl mit als auch ohne Schlickerauf-trag vorkommt (Abb. 34,1). Schlicker tragen auch diekumpfartigen Gefaße mit leichtem Bauchknick von1–2,5 l Inhalt (Abb. 35).
Zu den Gefaßen mit polierter Oberflache ge-horen weitmundige Schalen und doppelkonischeBecher sowie ein großer Deckel. Einige davon sindmit komplexen Graphitmustern verziert. Die bereitsrestaurierten Schalen aus den sudlichen Gebaudenweisen alle einen Durchmesser zwischen 40–48 cmauf und konnten 4–6 Liter fassen. Mit acht Mal amhaufigsten tritt die Schale mit kurzem, konkavenRand auf, nur zwei besitzen einen eingerollten Randund eine weist eine nach innen verdickte Lippe auf.
Einige der Schalen sind vollstandig erhalten; siewaren zum Teil ineinander gestapelt (P09B739CER06und P09B739CER08). Die bemalte Schale mit kon-kavem Rand (Abb. 36) weist ein komplexes Orna-ment mit sich paarweise wiederholenden Motivenauf: Um den ,,Omphalos‘‘ im Inneren der Schaleentsteht durch die Segmentierung der Malflache ingleich große Viertel ein Quadrat. Die Symmetrie wirddurch vier gleich breite Bander gewahrt, aber diejeweils gegenuberliegenden Zwickel zwischen Randund Band sind mit ,,Wellen‘‘ respektive ,,Tropfen‘‘
Abb. 32.Pietrele. Zwei Becher
aus dem unverbranntenGebaude in der Sud-
erweiterung der Flache B(Foto: S. Hansen).
Abb. 33.Pietrele. Ritzverziertes
Gefaß aus der Sud-erweiterung in FlacheB; Dm 28 cm (Zeich-nung: C. Georgescu).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.62
ausgefullt. Ein wesentliches Detail verleiht den Ein-druck von Dynamik: die Wellenmuster werden teil-weise vom angrenzenden Band verdeckt. Bewegungim oder gegen den Uhrzeigersinn wird des weiterendurch die Wiederholung der Muster hervorgerufen.Sie sind namlich nicht spiegelverkehrt aufgemalt,sondern werden um den Gefaßmittelpunkt um 90/180! gedreht. Somit scheinen die vier Malfelder umeinen Mittelpunkt zu rotieren.
Die Aufteilung der Malflache auf großen Scha-len und Deckeln in zwei oder vier Teile bzw. in kon-zentrische Bander ist eine im Chalkolithikum deswest- und nordpontischen Raumes weit verbreiteteErscheinung, die nicht nur fur den KGK VI-Komplexkennzeichnend ist, sondern auch in der Cucuteni-Tripol’e-Kultur Anwendung fand.35 Dabei sind ent-
weder beide bzw. alle vier Malfelder identisch oderaber die beiden jeweils einander gegenuberliegen-den Felder sind mit gleichartigen Motiven versehen.Eine Darstellung auf einem sehr viel jungeren Ton-tafelchen aus dem sudmesopotamischen Fara/Su-ruppak (Fruhdynastisch III) weist ebenfalls eineVierteilung der Flache auf, in die identische Motiveeingeritzt wurden: vier identische L-formige Musterscheinen um einen Mittelpunkt zu ,,rotieren‘‘. In ei-nem Winkel von 90! werden sie von Wellenliniendurchzogen, die Wiggermann als Flusse deutet, dieFelder durchkreuzen. Er sieht in dieser Zeichnungeine der altesten Nachweise einer Landkarte.36 Nunsind die Motive auf den Schalen und Deckeln ausdem westpontischen Raum nicht als Landkarten zulesen, aber gemessen an den zahlreichen Rohstof-
Abb. 34.Pietrele. Vorratsgefaßeaus dem Sudwest-gebaude in Flache B(Zeichnungen:1–2 T. Vachta, 3–4 C.Georgescu).
35 Schmidt 1932, Taf. 5,1; Zbenovic 1996, Taf. 18,7; 23,12. 36 Wiggermann 1996, 208 Abb. 2.
Pietrele 2009 63
fen und Endprodukten, die Pietrele aus unterschied-lichen Gegenden erreichten,37 darf vermutet wer-den, dass die Gemeinschaften der Kupferzeit ubergewisse geographische Kenntnisse verfugten. Zu-mindest aber rufen die Vierteilung und die Rota-tionsbewegung um einen Mittelpunkt Assoziationenmit den vier Himmelsrichtungen hervor.38
Ein ahnlich komplexes Muster besaß auch derDeckel P09B742CER01 mit hohem Riefenrand undim Negativ ausgespartem ,,Wellendekor‘‘ (Abb. 37).In Flache G tritt diese Art Deckel zusammen mit tie-fen Schusseln auf (Abb. 40). Deckel mit großemDurchmesser konnen aber auch entsprechend weit-mundige Schalen bedecken. In den Museen Giurgiuund Ruse liegen große Deckel mit im Negativ darge-stellten ,,Wellen‘‘ auf entsprechend großen Schalenauf.39
Mit Graphit bemalt wurden auch die Becher.Zwei stark verbrannte Becher mit rundem Umbruch
kamen 2008 im Sudostgebaude vor.40 Die drei Exem-plare von 2009 aus dem Sudwestgebaude weisenebenfalls geschwungene Profile auf. Der BecherP09B766CER02 (Abb. 39) ist mit einem ahnlichenMotiv versehen wie der Becher von 2008: Bei bei-den sind auf dem großten Umfang vier im Negativausgesparte Kreise mit einer schmalen Diagonaleverbunden, wodurch ein wellenartiges Motiv ent-steht.41 Beim Becher von 2009 ist allerdings derStreifen auf dem Hals nicht ausgefullt, sondern mitKreisen versehen. Ein Kreis ist auch auf dem Bodendes Gefaßes eingeritzt – womoglich eine Topfer-marke? Ungewiss ist des weiteren, wie ein kleinesKupferfragment in die Tonpaste gelangte. DiesesGefaß blieb trotz des Feuers, das das Haus zer-storte, unversehrt. Die Farbe des Gefaßes ist gold-braun, der Graphit dunkelgrau – ein Farbkontrast,der bei zwei Gefaßen aus Varna durch den Auftragvon Goldstaub auf die dunkelgraue Oberflache er-reicht wurde.42
Hervorzuheben ist fur diesen Bereich der auf-fallend hohe Anteil an komplex verzierten Schalen,Deckeln und Bechern. Anders als in den jungeren,daruberliegenden Gebauden sind keine Henkelkru-ge43 oder Kumpfe mit darauf passenden Deckeln44
verburgt.
Die Keramik aus der Außensiedlung
Die Keramik aus Flache G
Die 43 restaurierbaren Gefaße in Flache G stammenaus der 60 cm dicken, grau verfarbten Kulturschicht.Zu diesen gehoren auch die drei Gefaße, die bereits2002 in dem Schnitt P02D auf gleicher Hohe auf-traten. Von den insgesamt 46 Gefaßen war lediglicheines durch sekundare Feuereinwirkung verformt.Die Gefaßeinheiten streuten mit unterschiedlich dich-ten Konzentrationen in einem Bereich von 6 " 6 m,ohne dass aber die Konturen eines Gebaudes zu er-kennen gewesen waren. Ob es sich hierbei um eingeschlossenes Hausinventar handelt oder ob dieObjekte nicht zeitgleich, sondern eher zeitnah in denBoden kamen, muss durch weitere Analysen beur-teilt werden. Denkbar ist namlich auch, dass hierunbrauchbar gewordene Gegenstande entsorgt wur-den.
Abb. 35.Pietrele. Gefaße mitBauchknick aus demSudwestgebaude in
Flache B (Zeichnungen:1 T. Vachta, 2 J. Kelder).
37 Reingruber 2007, 81–100.38 Voinea 2005, 61.39 Sultana: Andreescu/Popa 2003, Abb. 19; Tell Ruse: Cernakov
2009, 91 Nr. 150–151.
40 Siehe Hansen u. a. 2009, Abb. 39: durch die Lage im Schadens-feuer ist der Becher rot durchgluht, von der Graphitmalpaste istnur noch der weiße Kalkanteil ubrig geblieben. Seine ursprung-liche Farbgebung konnte, wie im Falle seines Pendants aus derAusstellung im Historischen Museum der Stadt Ruse, ebenfallsdunkelgrau mit silbrig glanzendem Graphitauftrag gewesen sein.
41 Ein vergleichbares Motiv wird von Schmidt ,,Tangentenkreis-band‘‘ genannt (Schmidt 1932, 35–36; 15,11).
42 Ivanov 1992, 5; 14.43 Hansen u. a. 2006, Abb. 34–35.44 Reingruber 2010.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.64
Abb. 36–38.Pietrele. Schalen undDeckel mit komplexenMustern (Fotos: S.Hansen, Zeichnungen:1 und 3 I. Berdzenish-vili, 2 C. Georgescu).
Pietrele 2009 65
Zu den vorherrschenden Formen gehoren mit15 Vertretern große Gefaße fur das Aufbewahrenvon fester oder flussiger Nahrung. Es treten sowohlVorratsgefaße mit Barbotineauftrag als auch solchemit geglatteter Oberflache auf. Vor allem letzterebesaßen Deckel mit bis zu 48 cm großem Durch-messer.
Ein geglattetes Gefaß mit runder Schulter undkurzem Rand besitzt ebenfalls einen passenden De-ckel: nicht nur durch entsprechenden Durchmesser,sondern auch durch den Dekor sind die beiden alsSet zu verstehen: Auf dem Deckel werden im Wech-sel von geglatteten und unregelmaßig geritzten Fla-chen Einzelmotive wie Kreise und ,,Wellen‘‘ zu ei-nem komplexen Muster kombiniert (Abb. 38).
Sind die graphitbemalten Schalen und Deckelvom Tell mit Motiven versehen, die paarweise kon-zipiert wurden oder auch konzentrisch angelegt sind,so ist auf dem Deckel P09G534CER03 eine Dritte-lung der Oberflache vorgenommen worden. Auf diedurch einen Kreis mit integriertem Kreuz prazise de-finierte Mitte ist ein Triskele bezogen: Drei ineinan-der geschlungene Wellen wurden durch den Kontrastvon geglatteten und aufgerauten Flachen in Positiv-Negativtechnik herausgearbeitet.45 Sowohl das Mo-tiv als auch die Technik sind auf einem Deckel ausTırpesti vorhanden: Wird er 1974 noch in die PhasePracucuteni III datiert,46 so heißt es in der spaterenMonographie des Fundortes nur noch sehr allgemein,dass er aus der Pracucuteni-Zeit stammt.47 Wahrendim nordwestpontischen Raum seit Pracucuteni IIprazise ausgefuhrte Ritzlinien die Konturen be-stimmen,48 sind auf dem Deckel aus Pietrele dieRitzmuster sehr unregelmaßig, die Konturen derWellen wirken unbeholfen, einige der Kreise wurdenoffensichtlich falsch gesetzt und leicht verschobenerneuert.
Triskele sind nach Meinung von Voinea zahl-reich in der karpato-balkanischen Kupferzeit undseien aus der Spirale und dem Wirbel entstanden.49
Sie konnen aber aus viel alteren Vorlagen abgelei-tet werden, denn dreiteilige ineinander geschlungeneWellenmuster treten bereits auf Deckeln der Pracu-cuteni I-Stufe auf, vermehrt dann in Pracucuteni IIund III.50 Paarweise oder sogar vierteilige Mustersind seltener bzw. seltener abgebildet. Anders ver-halt es sich im westpontischen Raum, wo die drei-
teiligen Muster eine Ausnahme bilden. Zwar sindnur wenige Deckel in den Publikationen zu den Kul-turen Boian und Hamangia zuganglich gemachtworden,51 doch sie treten zahlreich in dem Graber-feld von Durankulak auf. In der nur in der bulgari-schen Forschung etablierten Periode der mittlerenKupferzeit (Stufe Hamangia IV)52 sind die Deckelmit z. T. spiegelgleichen, z. T. rotierten Paarmusternversehen, und das trifft auch auf die Außenflachender Gefaße zu.53 Das Motiv der umlaufenden Welleist auf einer Schussel mit Trichterrand aus Grab 299verburgt: Drei nicht miteinander verbundene Wellensind ebenfalls in Negativ-Positiv-Technik dargestellt,allerdings sind die Negativ-Flachen eingestempeltund nicht eingeritzt.54
Ein mit Pietrele vergleichbares Ornament istmit dieser Ausnahme sudlich der Donau nicht vor-handen.55 Bei einer Zusammenstellung samtlicherMotive des 6.–5. Jts. im Strumatal wird ein Triskelelediglich auf einem dreieckigen Tischchen gezeigt,bei dem die Form womoglich das Motiv vorgab. Im5. Jt. tritt das vierteilige ,,Svastika‘‘-Motiv auf, dasum die Mitte des Jahrtausends so beliebt wird undsowohl auf Deckeln als auch im Inneren von Scha-len und Bechern Anwendung fand.56 Die Innenbe-malung ist in Durankulak mit dem Auftreten derGefaßstander in der Stufe Hamangia IV verbunden:Nicht nur die ausgezogenen Lappenrander dieserSchalen, sondern auch das Innere von Fußschalenwurde nun bemalt.57
Die Form des Deckels ist im Gumelnita-Reper-toire durchaus bekannt. Auch die Technik, das Motivdurch unregelmaßige Einritzungen zu umschreiben,ist in der Gumelnita-Kultur verbreitet (z. B. Abb. 33).Der Positiv-Negativ-Effekt mag aus der Pracucuteni-Kultur entlehnt sein, wobei dort aber nicht Ritzun-
45 Diese Art der Darstellung findet spater in dem KGK VI-Komplex,allerdings in einer anderen Dekortechnik, namlich der Graphit-bemalung, uberwiegend Anwendung.
46 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 61,1.47 Marinescu-Bılcu 1981, Fig. 82,6.48 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 44,14; 45,8; 47,10.49 Voinea 2005, 61. Sie sind in der Petresti-Kultur verburgt (Paul
1992, Taf. XLVII,2–3).50 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 33,2; 43,1; 44,14; 61,1.5. Triskele-
artige Motive finden sich auch anschließend in allen Stufen derCucuteni-Kultur wieder: Dumitrescu 1979, Abb. 5; 8; 36; 130.
51 Neagu 2003, Taf. XLV,1; LXXIV,1; LXXV,1; Hasotti 1997, Fig.35,2.7; 37,9; Comsa 1974, Taf. 7; Comsa 1987, Fig. 1, 3; Berciu1961, Fig. 253,2; Berciu 1966, Fig. 149,4.
52 Todorova 2002a, 36–37, Abb. 24.53 Todorova 2002b, Abb. 113; Todorova 2002c, Taf. 41,7; 60,1,
92,13 (Deckel); Taf. 65,14; 76,9 (Schalen). In Varna I werdenDeckel mit zwei- bzw. viergeteilter Zierflache haufiger, wobeidie rotierten Muster uberwiegen: Todorova 2002c, Taf. 51,11;53,3; 78,18; 85,8; 87,8.14; 95,15.19.
54 Todorova 2002c, Taf. 37,7. Diese Schale weist nach Meinungvon V. Slavcev Merkmale der Pracucteni-III-Keramik auf – sieist also nicht typisch fur den Hamangia-Keramikstil (Slavcev2002, 299).
55 Z. B. werden in Stara Zagora seit dem Beginn des 5. Jts. bereitsVierteilungen der Malflachen vorgenommen (Kalchev 2005, 27;34). In Drama ist die ritz-, kerb- und einstichverzierte KaranovoV-Keramik ebenfalls mit Komplementarmustern versehen (Li-chardus u. a. 2000, 89, Abb. 36,1–2). Die Schalen und Becherder Hamangia-Kultur hingegen sind ausschließlich außen miteingestochenen Winkelmuster verziert (Berciu 1966, Abb. 100–120).
56 Chohadzhiev 2007, 100 Fig. 79,227–39 Fig. 90,249–5; Triske-le: Fig. 99,A–10.
57 Todorova 2002c, Taf. 4,9; 50,1; 76,9; 82,4; 120,10; 123,5;124,15.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.66
gen sondern Stempelungen angewendet wurden.Das Motiv des Triskele selbst weist ebenfalls in dennordwest-pontischen Raum, wo es bereits in Pracu-cuteni II auftritt.58 Der Fund aus der Außensiedlungdurfte alter sein als das bislang bekannte Materialvom Tell. Diese Vermutung wird auch durch dieAuswertung des Scherbenmaterials aus Flache Gerhartet (siehe unten). Dass die Bewohner des Tellsihre Wurzeln nicht nur in den strikt lokalen spat-neolithischen Kulturerscheinungen (Boian) gehabthaben mogen, sondern aus unterschiedlichen Re-gionen Anstoße und Impulse erhielten (Pracucuteni,Hamangia), kann anhand der Keramikherstellungals gesichert gelten.59 Die Gleichzeitigkeit der ge-nannten Kulturstufen: Spat-Boian, Hamangia IV undPracucuteni III wird in der neueren Literatur weitest-gehend anerkannt. Den neuesten 14C-Daten zufolgekonnen sie in die Zeit vor oder um 4600 v. Chr. da-tiert werden.60
Ein geglatteter Topf mit bandformigem Schul-terabsatz besitzt einen hohen konkaven Rand. Da-rauf passt sowohl vom Durchmesser als auch vonder Hohe des Randes ein Deckel, der drei Meterostlich vom Gefaß lag (Abb. 40).61 Das Gefaß fasstknapp uber 20 Liter.
Zahlreich in dieser Flache sind jedoch Deckelmit kleinerem Durchmesser von 14–16 cm (Abb.41,1–4). Sie konnen nicht sicher einem der Gefaßemit entsprechend geringem Mundungsdurchmesserzugeordnet werden (Abb. 42–44).
Die polierten Becher mit konkavem Rand, aberauch eine Flasche und ein Askos (Abb. 45) werdenwohl am ehesten noch in Verbindung mit Flussig-keiten genutzt worden sein. Ungeklart muss vorerstdie Nutzung eines gelochten Kegels bleiben, eineForm, die gerne als ,,Sieb‘‘ oder ,,Gluthalter‘‘ oderauch als ,,Rauchergefaß‘‘ bezeichnet wird (Abb. 4;46). Ein gleichfalls komplett gelochtes, bauchigesGefaß auf Fußchen stellt eine bislang in Pietrelenicht bekannte Form dar. Es ist das einzige Gefaß,das sekundar verbrannt ist – seine Scherben streuenuber mehrere Fundeinheiten.
Zusatzlich zu den restaurierbaren Gefaßen wur-den 8.098 Einzelscherben (141,48 kg) aufgenom-men. 5.365 Scherben konnten einer bestimmten Ka-tegorie zugeordnet werden. Davon stammen 4.219
aus der grauen Kulturschicht. In dem daruberlie-genden Kolluvium fanden sich 821 Scherben, unterihnen zahlreiche scheibengedrehte sowie einigeglasierte Keramikfragmente; z. T. waren die Bruchestark verrollt (Abb. 47). Lediglich 412 Scherben ausder Kulturschicht zeigen Einwirkungen eines sekun-daren Brandes (9,8%).
Mit 2.733 Scherben (33,74%) ist der Anteilsehr kleiner Fragmente (kleiner als 2,5 " 2,5 cm) be-sonders hoch. 78% davon lagen in der Kulturschicht.Dies konnte ein Indiz dafur sein, dass der Bereichostlich der Tellsiedlung nach seiner Aufgabe langereZeit offen lag und wiederholt betreten wurde.
Die Scherben wurden nach ihrer Machart inzwei Gruppen sortiert, je nachdem ob der Ton mitmineralischen Bestandteilen gemagert war oder diePaste einen hohen organischen Anteil besaß. Zurzweiten Gruppe mit Spreumagerung gehoren 1.093Scherben (also 26%) aus der Kulturschicht (Abb. 48).
Eine erste statistische Auswertung zeigt einehohe Korrelation zwischen Ware, Oberflachenbe-handlung und Ziertechnik. Je nachdem, ob dem Ton
Abb. 39.Pietrele. BecherP09B766CER02 mit Gra-phitbemalung, Dm 8 cm(Foto: S. Hansen, Zeich-nung: T. Vachta).
Abb. 40.Pietrele. GefaßP09G575CER01 mitSchulterband(Dm 45 cm) und dazupassendem DeckelP09G589CER01(Dm 48 cm) (Zeich-nungen: T. Vachta).
58 Marinescu-Bılcu 1974, Fig. 44,14.59 Aus der direkten Kontaktzone zwischen den Kulturen Pracucu-
teni und Hamangia, aus der Variante Bolgrad-Aldeni (bzw. Stoi-cani-Aldeni) des KGK VI-Komplexes, sind ebenfalls keine Triskelebekannt (Pandrea 2002, 122–146). Nicht nur die geschlossenen,sondern auch die offenen Gefaße sind ausschließlich außen ver-ziert (Dragomir 1983, Fig. 31–34 Beilage II; IV).
60 Rassamakin im Druck; Lazarovici 2010a, 130–132; Lazarovici2010b; Bojadziev 2002, 67; Slavcev 2002, Tab. 27; Palaguta2007, Fig. 97.
61 Vergleichbare Gefaßensembles werden von Berciu in seine StufeGumelnita I datiert (Berciu 1961, Fig. 203; 266).
Pietrele 2009 67
Abb. 41.Pietrele. Deckel aus
Flache G (Zeichnungen:1–3 I. Berdzenishvili,
4 T. Vachta).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.68
Abb. 42.Pietrele. Becher und Schalen aus Flache G (Zeichnungen: 1 und 4I. Berdzenishvili, 2 W. Peng, 3 T. Vachta).
3
Abb. 43.Pietrele. Fußschale P09G575CER02, Dm 12,5 cm (Foto: S. Hansen).
Abb. 44.Pietrele. BecherP02D-01 mitHohlfuß, Dm 12,5 cm(Foto: S. Hansen).
Abb. 45.Pietrele. AskosP02D-03, Dm 8 cm(Foto: S. Hansen,Zeichnung: J. Kelder).
Pietrele 2009 69
eine organische Magerungsart wie Spreu oder anor-ganische Magerungsmittel wie Sand, Quarz, Scha-motte, etc. beigegeben wurden, kamen unterschied-liche Dekortechniken zum Tragen:
Eine tonverdrangende Technik ist die Impres-soverzierung. Dazu gehoren Eindrucke mit der Fin-gerkuppe oder auch mit einem runden Gegenstand.Solche Einstichreihen finden sich oft unter demRand auf spreugemagerter Ware (Abb. 49,1.2): dasVerhaltnis von mineralisch zu organisch gemagertenScherben ist 1 : 7. Auch die einfachen Tupfen ohneLeisten treten meist in Verbindung mit Spreumage-rung auf (2 : 6). Wenn sie aber auf einer zusatzli-chen Leiste eingedruckt sind, so ist diese meist aufmineralisch gemagerten Tonen vorhanden. Auch dieFingernageleindrucke treten auf beiden Waren auf,ofter allerdings in den vegetabil gemagerten (9 : 12).Handelt es sich um Punktimpresso oder Fingerzwi-cken, sind sie mit 5 : 2 respektive 4 : 1 auf minerali-schen Oberflachen haufiger (Abb. 49,3.4).
Eine Besonderheit stellt die Verzierung mitMuscheleindrucken dar, wodurch parallele Reihenvon regelmaßigen Klammern entstehen. Sie sindmeist auf den Schultern von geschlossenen Gefaßenund seltener auf Deckeln zu finden. Bis auf eineAusnahme sind sie nur auf mineralisch gemagertenWaren nachweisbar (12 : 1).
Zu den Ritzverzierungen gehoren alle in Ne-gativtechnik durch Einritzen und Einschneiden ent-standene Muster, wodurch der Ton oberflachlichverdrangt wird. Zu unterscheiden sind die einfachen
Abb. 46.Pietrele. ,,Gluthalter‘‘
P09G520CER01,Dm 11 cm (Zeichnung:
I. Berdzenishvili).
Zierstile Humusn = 169
Kolluviumn = 821
Kulturschichtn = 4219
Verfullungn = 156
Summentotal = 5365
Graphitbemalung – 1 33 – 34
Ritzverzierung 2 31 154 2 189
Kerbschnitt – 3 11 – 14
Einstich (Impresso) – 6 41 2 49
Politurmuster – 11 69 6 86
Summe 2 50 307 10 nverziert = 369
Zierstile auf organischer Magerung Humusn = 7
Kolluviumn = 111
Kulturschichtn = 1093
Verfullungn = 65
Summentotal = 1276
Graphitbemalung – – – – –
Ritzverzierung 1 11 79 1 92
Kerbschnitt – 3 11 – 14
Einstich (Imprresso) – 1 18 1 20
Politurmuster – 11 61 6 78
Summe 1 24 176 8 nverziert = 209
Abb. 47.Pietrele. Zierstile auf
Scherben der Flache G.
Abb. 48.Pietrele. Zierstile auf
organisch gemagertenScherben in Flache G.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.70
Abb.49.
Pietrele.Zierstile
aufScherbenderFlachenGundJ(Fotos:
T.Vachta,Layout:A.Reuter).
Pietrele 2009 71
Linienmuster, die regelmaßig oder auch unregelma-ßig in den noch weichen Ton mit spitzen Werkzeu-gen eingeritzt wurden, von den komplexen Mustern,die einen großen Teil der Oberflache einnehmen (Abb.49,5.6). Letztere sind von einer weiteren Technikbegleitet, dem Kerbschnitt, der mit der spanabhe-benden Holzschnitzerei verwandt ist (Abb. 49,7.8).Wahrend die einfachen Linienmuster auf beidenWaren vorkommen (48 min: 17 org.), sind die kom-plexen Muster mit einer Ausnahme auf die organischgemagerte Ware beschrankt (74:1 bzw. 17 : 0 beiKerbschnitt).
Meist auf große Gefaße wurden plastische Zier-elemente wie Leisten, Rippen, Riefen oder auch ein-fache Knubben aufgelegt. Einzelknubben treten aufbeiden Waren auf, die flachige Knubbenzier ist nureinmal belegt (Abb. 49,12), aber bei den Leisten istein klarer Bezug auf mineralisch gemagerte Tonge-faße zu erkennen (Knubben 13 : 5; flachige Knubben1 : 0 und Leisten 31 : 1). Eine Eigenheit in Flache Gsind die aufgelegten Kreise (Abb. 41,2; 49,11).
Ebenfalls sich plastisch abhebend sind die fei-nen, schmalen, eng aneinanderliegenden Rippchen(ripples). Sie stellen eine Mischtechnik zweier Zier-stile dar, da sie nicht durch das zusatzliche Auftra-
gen von Ton entstehen, sondern durch das Verdran-gen der Tonmasse durch ein stumpfes Instrument,und konnen dementsprechend auch als Politurmus-ter angesprochen werden (Abb. 49,9.10). 78 nach-gewiesene Politurrippchen treten auf spreugemager-ten Scherben auf und nur acht auf mineralischen.69 stammen aus der Kulturschicht, elf aus dem Kol-luvium und sechs aus einer Verfullung. Sie tretensowohl auf braunen Oberflachen (32 Mal), als auchauf schwarzen (13 Mal) und auf dunklen (41 Mal)auf. Die dabei entstehenden Muster sind konzentri-sche Kreise oder parallele Linien. Politurmuster tre-ten auch zusammen mit Impressozier oder mit Ein-zelknubben auf (Abb. 49,10).
Nur 33 Scherben aus der Kulturschicht trugeneinen Graphitauftrag (Abb. 49,13.14). 13 davon la-gen direkt auf dem gewachsenen Boden, so dassdiese Ziertechnik mit den altesten Ablagerungen inG auftritt. Meist ist nur die Oberflache außen bemalt(29 Mal) und nur zwei Mal innen bzw. zweimal in-nen und außen. Bemalt wurden kleinformatige Ge-faße mit einem Durchmesser von 16–22 cm. Uber-wiegend wurde die Graphitpaste auf dunkle undschwarze Oberflachen aufgetragen (25 Mal) und nur8 Mal auf braune.
Die Keramik aus Flache J
Ahnlich wie in Flache G war die graue Kulturschichtin Flache J von einem hohen Kolluvium bedeckt.Die 60 cm machtige Kulturschicht fiel ebenfalls vonN–S ab. In ihr lagen 28 zum Teil stark verbrannte Ge-faße in mehreren Konzentrationen mit einem deut-lichen Bezug auf eine Mahlinstallation und einenOfen. Die genaue Ausdehnung des Gebaudes muss2010 noch untersucht werden – die Scherbenstreu-ung betragt bislang 4 " 4,5 m.
Auf und in der Mahlinstallation lagen siebenrekonstruierbare, z. T. sehr große Gefaße, die alleEinwirkungen eines Brandes zeigen. Auf der ostli-chen Kammer der Lehminstallation befanden sichmehrere große Gefaße mit Barbotineauftrag, darun-ter ein weitmundiges Gefaß mit Ausguss (Abb. 50).Das siebartig gelochte Gefaß aus diesem Befundwar stark verbrannt und leicht verzogen (Abb. 51).
In der rechten Kammer der Mahlinstallation, inder NW-Ecke, hatte das Vorratsgefaß P09J387CER01seinen Platz neben den bereits erwahnten Mahl-steinen. Das mit breiten Ritzlinien verzierte Gefaßwar sekundar rot verbrannt, in den Schlaufen fan-den sich aber noch Reste einer weißen Paste.
Westlich der Installation erstreckte sich aufeinem Areal von 2 " 2,8 m ein Scherbenteppich,aus welchem mindestens 14 Gefaße separiert wer-den konnten. Es uberwiegen die großen, geglatte-ten, z. T. ritzverzierten Vorratsgefaße mit hohem zy-lindrischem Hals.
Abb. 50.Pietrele. Gefaß
P09J377CER01 mitAusguss, Dm 37 cm(Foto: S. Hansen).
Abb. 51.Pietrele. ,,Gluthalter‘‘
P09J377,Dm 15 " 11 cm
(Foto: S. Hansen).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.72
Die statistische Auswertung des Scherbenma-terials in Flache J beruht auf insgesamt 6.267 Scher-ben (105,08 kg). Mit 41% (2.574 Fragmente) ist derAnteil sehr kleiner Scherben etwas hoher als in Fla-che G, aber anders als dort lagen in Flache J nurknapp ein Drittel der kleinen Fragmente in der Kul-turschicht. 65% entstammen dem Kolluvium undder Humusschicht.
Von den 1.849 Scherben aus der Kulturschicht(Abb. 52) zeigten insgesamt 589, also ca. 32%, Ein-wirkungen von Schadensfeuer. Lediglich 165 (9%)sind organisch gemagert (Abb. 53).
Das aufgrund der Keramik in Flache G gewon-nene Bild kann durch die Scherben aus Flache J be-statigt werden: die Art der Magerung korreliert deut-lich mit den angewandten Ziertechniken.
Die in Flache G haufiger auftretenden Finger-tupfen oder Einschnitte unter dem Rand sind in Jentweder gar nicht bzw. nur ein Mal nachgewiesen.Impressozier ist aber mit einigen Stucken belegt;so treten die Punktreihen und Nageleindrucke aufje vier organisch gemagerten, Fingerzwicken jedochauf drei anorganisch gemagerten Scherben auf(Abb. 49,15.16). Das sind geringe Stuckzahlen, diezufallsbedingt sein mogen. Die mit Muschel einge-druckten Klammerreihen sind ausschließlich auf an-organisch gemagerten Bruchstucken zu finden (sie-ben Mal).
Auch die regelmaßigen Einritzungen weiseneinen eindeutigen Bezug auf mineralische Magerungauf (16 : 0 fur dunne und 17 : 2 fur breite Linien).Die komplexen Ritzmuster (Abb. 49,17.18) treten je-doch auf spreugemagerten Gefaßen auf (4 : 14 bzw.
1 : 12). Diese und auch die Kerbschnittmuster (Abb.49,19) sind, anders als in Flache G, nicht ausschließ-lich auf spreugemagerter Keramik zu finden. Das giltauch fur die Politurmuster (ripples) mit 8 : 6 Scherbenzugunsten der Spreumagerung (Abb. 49,20).
Der Besenstrich und die plastische Verzierungmit Rippen, Leisten und Riefen fallt eindeutig mitden mineralisch gemagerten Gefaßen zusammen(25 : 2, respektive 22 : 1). Knubben kommen mit ei-nem ausgewogenen Verhaltnis von 3 : 4 auf beidenGattungen vor (Abb. 49,21.22). Graphitbemalung trittauf 19 mineralisch gemagerten Scherben auf (Abb.49,23.24).
Das Nebeneinander zweier verschiedener tech-nologischer Gruppen mit organischer respektive an-organischer Magerung ist demnach auch in Flache Jgegeben. Dass in Flache J nur 9% der Scherbenspreugemagert sind (in G waren es 26%), konntevon chronologischer Relevanz sein.62 Aufgrund desKeramikinventars ist eine Gleichzeitigkeit mit denverbrannten Gebauden vom Tell durchaus moglich.Ob dieser Bereich spater als der weiter ostliche mitFlache G in Nutzung kam, muss auch durch 14C-Da-ten gepruft werden. Wie in Flache G konnte jedochauch fur die Scherben aus J gezeigt werden, dassGefaße mit Graphitauftrag und solche mit geometri-schen Ritzverzierungen gleichzeitig in Nutzung wa-ren.
Zierstile Humusn = 199
Kolluviumn = 1604
Kulturschichtn = 1849
Sondagen = 41
Summentotal = 3693
Graphitbemalung – 2 17 – 19
Ritzverzierung 4 49 48 – 101
Kerbschnitt 1 7 2 – 10
Einstich (Impresso) – 20 14 – 34
Politurmuster – 4 10 – 14
Summe 5 82 91 0 nverziert = 178
Zierstile auf organischer Magerung Humusn = 8
Kolluviumn = 78
Kulturschichtn = 165
Sondagen = 6
Summentotal = 257
Graphitbemalung – – – – –
Ritzverzierung 1 5 12 – 18
Kerbschnitt – 7 2 – 9
Einstich (Impresso) – 1 2 – 3
Politurmuster – 1 7 – 8
Summe 1 14 23 0 nverziert = 38
Abb. 52.Pietrele. Zierstile aufScherben der Flache J.
Abb. 53.Pietrele. Zierstile auforganisch gemagertenScherben in Flache J.
62 Auf dem Tell tritt Spreumagerung nur in den untersten bislanggegrabenen Schichten auf und nur vereinzelt in den jungeren(vgl. Hansen u. a. 2009). Zwar sind organisch gemagerte Warenin der Kupferzeit noch in Nutzung, nehmen aber im Laufe derZeit deutlich ab.
Pietrele 2009 73
Zusammenfassung Keramik
Die Betrachtung der restaurierbaren Gefaße zeigt,wie unterschiedlich die Gefaßinventare in den ver-schiedenen Bereichen ausfallen: wahrend in denFlachen B und F der Anteil an graphitbemalten Ge-faßen ca. ein Viertel des Inventars betragt (10 von40 Gefaßen in B und 48 von 218 Gefaßen in F), sofehlen diese komplett in Flache G, und in Flache Jtritt nur eines auf. In beiden letzteren Bereichensind plastische Zier und Ritzverzierung mit je vierGefaßen in ausgewogenem Verhaltnis vertreten undprozentuell zahlreicher als in F und B (30% im Ver-gleich zu 10%). Erstaunlich ausgewogen ist in allenFlachen das annahernd 1 : 1 Verhaltnis von geglat-teten Oberflachen zu solchen mit Schlickerauftrag.
In der Außensiedlung von Pietrele treten wei-terhin die seit dem Neolithikum bekannten Me-thoden der Gefaßverzierung mit Fingernageln odereinfachen Instrumenten wie runden oder spitzenStockchen auf.63 Dadurch entstehen regelmaßig oderunregelmaßig eingeritzte Linien, runde Einsticheoder Fingernageleindrucke und -zwicken. Diese ein-fachen Zierweisen sind sowohl auf spreugemagerterals auch auf mineralisch gemagerter Keramik vor-handen.
Hinzu kommen aber auch die sehr speziali-sierten, komplexen Ziertechniken von hoher kunst-lerischer Anforderung, einhergehend mit grundlicherKenntnis uber Tone und Magerungsbestandteile,Rezepturen fur die Malpaste und die Beherrschungdes Brennprozesses. Es konnte gezeigt werden,dass die aufwandigen Ziertechniken wie Graphitbe-malung, komplexe Ritzmuster, z. T. mit Kerbschnitt,sowie kunstvolle Reihen regelmaßig eingestochenerKlammern und nicht zuletzt die Politurmuster anbestimmte Waren gebunden sind. Nie sind spreuge-magerte Scherben mit Graphit versehen; hingegentreten geometrische Ritzmuster mit oder ohne Kerb-schnitt und Politurmuster fast nur auf spreugema-gerten Gefaßen auf. Somit besteht eine hohe Kor-relation zwischen Spreumagerung und Ziertechnik.Dieser Sachverhalt wird in der Literatur gerne alschronologische Tatsache hingestellt, wonach Spreu-magerung/Ritzverzierung/Rippchendekor spatneoli-thisch (Boian-Kultur) und Graphitbemalung kupfer-zeitlich sei (Gumelnita-Kultur). In der Außensiedlungvon Pietrele treten sie aber gleichzeitig auf. DieseGleichzeitigkeit hatte sich bereits in der Keramikder Flachen B und F vom Tell angedeutet.64
(A.R.)
The projectile points
During the campaign of 2009 813 chipped stonesartifacts were processed. Thus the total amount offlint artifacts included in our data base reached thenumber of 8488 pieces. The distribution of the sin-gle categories is shown in the diagram Abb. 54.
The present study is conceived as a prelimi-nary view of the projectile points occurring in thelithic assemblage from ‘‘Magura Gorgana’’ (Abb. 55).The projectile points recovered among the lithicmaterials exhibit a high level of manufacturing tech-niques.65 They are defined as a late-stage bifacewith intact or visible remnants of a hafting appara-tus or basal thinning that would facilitate hafting.66
Abb. 54.Pietrele. Distribution ofchipped stones artifacts
by categories.
Abb. 55.Pietrele.
Projectile points(Foto: S. Hansen).
63 Comsa 1971, Abb. 13; Abb. 16 (Keramik aus Dudesti).64 Hansen u. a. 2009.65 Hranicky 2007.66 Ritter/Burcell 1998, 32.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.74
Until 2009 sixteen finely made projectilepoints were documented. They display considerablevariability in size and shape and were produced byflat bifacial retouch, demonstrating considerableabilities in craftsmanship. The bifacial retouch cov-ers the entire body of the tool and forms a more orless sharp point. In some cases a small area on thedorsal part of the implement was left unretouched.The projectile points are featured as regular andsymmetrical triangular and elongated shapes with astraight, concave or a rounded base. In order tobetter describe the differences between the speci-men found at Magura Gorgana, we will follow thetypology proposed by J. Lichardus and M. Lichar-dus-Itten.67
Type ‘‘B’’: triangular projectile point with astraight base and straight edges; three pieces
Type ‘‘C’’: specimen with straight edges and aconcave base; two pieces
Type ‘‘F’’: specimen with convex edges and aconvex base; two pieces
Type ‘‘G’’: specimen with convex edges and astraight base; seven pieces
Type ‘‘H’’: specimen with convex edges and aconcave base; two pieces
It should be mentioned that no unifacialpieces, unifacial untanged projectile points, bifacialuntanged or tanged varieties and shouldered onesoccurred in the whole assemblage. The temporalvariability of the projectile point design is strictlyconnected with the 5th millennium BC. From the closeexamination of the projectile points, it can be sug-gested that some of the tools considered as arrow-heads were initially points. Within the utilization se-quence they were probably reshaped and graduallyreduced and, thus, transformed into arrowheads.
(I.G/P.N.)
Pietrele Prismatic Blade Use-wear Project,2009
This report discusses an ongoing microscopic, use-wear investigation of prismatic blades from Pietrele,Romania. With the exception of one obsidian speci-men that will not be further considered here, all aremade of flint. Included are 155 blades examined in2008 and 217 blades examined in 2009, which to-gether represent substantial but small portions ofthe several thousand specimen found in Pietrele. Anoverview of the goals, analytical approaches andtraces of tool-wear are presented in my report of2008.68 The major purpose is to model elements ofearly agriculture technology now arguably evident
in Pietrele. This draws comparisons with the Pre-Pottery B Neolithic at the village site of Ayn AbuNukhayla in the Negev desert in Jordan and theprismatic blades excavated there in houses.69 Thesite represents an earlier (roughly three millennia)experimentation with plant and animal domestica-tion. In addition, this summary comments uponaspects of the overall functional classification ofPietrele prismatic blades from both the 2008 eva-luation of excavation area B and the 2009 evalua-tion of a house and adjacent alleyway in excavationarea F. These evaluations entailed mass spectro-meter identification of residues and metals, whichwere carried out by Michael Prange. It then high-lights preliminary statistical evaluations and func-tional classifications of the house and alleyway inarea F to show the potential for identifying differ-ences in the usage of interior and exterior spacesin Pietrele dwellings. Assistance with graphic eva-luations was provided by Pepa Nedelcheva.
Early Agriculture Technology
Proportional differences in types of prismatic bladetools that were observed between Pietrele and AynAbu Nukhayla seem to document the increasedtechnological value of and reliance upon agricultur-al implements at Pietrele. Of the 200 randomly cho-sen prismatic blades from Ayn Abu Nukhayla thatwere analyzed, 67 (33.5%) are burins (or chisel-liketools) and 23 (11.5%) are sickle blades. The com-parable number of 372 analyzed prismatic bladesfrom Pietrele are six (1.6%) burins and 108 (29%)sickle blades.
In addition to this near reversal in the propor-tion of dominant tool types, the sickle blades showa progression in hafting techniques (Abb. 56); mostimportant is the presence of ‘‘triangular’’ hafting ofsickle blades in Pietrele. Within the region, sickleblades with triangular hafting approaches are de-scribed as Karanova type.70 They were inset withincurved sections of antler. None to date has beenfound as hafted forms, however, at Pietrele, althoughthe curved antler sickles seems reasonable for Pie-trele too.
The reason for this switch to triangular haftingof sickle blades is uncertain. It could have been amore efficient way to cut herbaceous plant stalks, away to conserve stone material for making tools, orsome combination of the two. In any case, the pre-dominant hafting mode at Pietrele remains hori-zontal within a groove (Abb. 56b; 57). However, theedge reaches a greater proportion in double- to sin-gle-bladed forms among the triangular (>33%) to
67 Lichardus/Lichardus-Itten 1993, 24–26 Abb. 7.68 Hansen u. a. 2009, 42–47.
69 Kay n.d.70 Skakun 1993, 364.
Pietrele 2009 75
horizontal (<20%) hafting modes, or what wouldbe accomplished by switching the ends and/or lat-eral edges of tools. This would seem to be a delib-erate attempt in keeping with engineering designprinciples to further conserve tool stone and extendthe use life of the triangular hafted sickle blades atPietrele. The implication is that the greater effort ex-
pended on maintaining the triangular hafted formsreflects their preferential use and desirability. If theconjoined pieces of a Pietrele prismatic blade foundtogether in area B in 2009 are indicative of theirmounting within single sickles, then triangular sickleblades were employed in multiples of three or atmost four.
Sickle blade recycling is a – if only – minormeasure of conservation of stone for tool-making atPietrele. In all but one instance, the direction is aconversion of a sickle blade to another tool type(Abb. 58).
Stages of sickle blade-wear compared toblade-edge repair as initially developed at Ayn AbuNukhayla71 have yet to be systematically applied inPietrele. Nevertheless, the latter, more developedsickle wear is evident without question at Pietrele.More developed stages of wear are indicative ofprolonged sickle usage and a greater likelihood oftool-edge repair.
Functional Classification of Prismatic Blades
Excavation areas B and F in Pietrele are the primaryfocus of this evaluation. A red pigment, likely softhematite, was observed on the tool edges and onadjacent surfaces of a graver, an end scraper, anda perforator from area B. A micro perforator fromarea J, excavated in 2009, has an adhering groundshell residue. From area F are micro spheroidal ob-jects identified by mass spectrometry as manganeseand are likely post-depositional. Mass spectrometerassessment also further confirmed the identificationof gold particles on the surface of a broken bifacialpoint from the house in area F. A gold object hadbeen previously identified from this house. The ex-act connection, if any, between the two artifacts isstill uncertain.
The most common and, to me, intriguing or-ganic residue identified are micro fish scales, firstfound in 2008 in area B and now identified also inarea F. These define two fish scaling tools (scalers)from area B, six from area F and four others re-cycled from other tool forms (1 from area B, 3 fromarea F). There is a greater range in fish scale mor-phology than illustrated in the 2008 report. Differ-ences in the seasonal final growth of fish scales areevident too between the two excavation areas. Taxo-nomic and seasonal identification have yet to bemade.
The number of end scrapers in areas B (n = 16)and F (n = 34) is substantial, although the exactsignificance is less certain. In any case, end scra-pers from the house in area F are worthy of furthermetrical evaluation, as reported below. Other tools
Abb. 56.Prismatic blade sickle
blade hafting ap-proaches reconstructedfrom microscopic wear
traces at Ayn AbuNukhayla (a–b) and
Pietrele (b–c).
Tool edges Sickle blades(flint)
Total
one lateral 5871
two lateral 13
one triangular 2737
double triangular 10
Total 108
Sickle blades(tool edges)
Recycled Total
end scraper from burin burin fish scaler burnisher
one lateral 6 0 1 1 0 8
two lateral 1 0 2 0 1 4
one triangular 3 1 0 0 0 4
double triangular 1 0 1 2 0 4
Total 11 1 4 3 1 20
Abb. 57.Pietrele. Class –
Material – Tool edges,Crosstabulation.
Abb. 58.Pietrele. Sickle tooledges – Recycled,Crosstabulation.
71 Kay n.d.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.76
that show potential activity differences between thetwo main excavation areas are wedges (n = 8) andburnishing tools (n = 13) from area F only, and amicrolith point from area B. The microlith is roughlytrapezoidal in form and looks much like those fromthe Mesolithic period.
Evaluations of the House and Alleyway in Area F
Having once developed a functional classification ofstone tools and other elements of prismatic bladetechnology, these technological classes can be eval-uated statistically within sample collections. The en-gineering design approach taken here is adaptedfrom that used at Ayn Abu Nukhayla. For illustrativepurposes, this variation is shown as a box-and-whiskers plot for the intra-quartile ranges of lengthsfor these technological types, and in which the errorbars represent confidence intervals at the 95 per-cent level. A second step in these evaluations en-tails analyses of variance (ANOVA) of sample meansmade individually according to the length, width,and thickness of technological types that are identi-fied by the use-wear analysis. This will be em-ployed later to reveal statistically important differ-ences among them (p < 0.05).
For our present purposes, however, the crucialconcern of the use-wear analysis is simply this:when the cost of repair exceeds the benefit of con-tinued use of a stone tool, the tool is likely to beeither discarded or recycled. Prismatic blade lengthturns out to be the key variable in understandingthis dynamic of tool use and repair. If the blade it-self is too short for a particular task, the tool islikely to be either discarded or recycled for anotherpurpose; if the haft length relative to the tool edgelength would not allow for further edge repair, thetool would suffer similarly. Predicting when this tip-ping point is reached has implications beyond thatof the technology itself. They extend to how socialspace is configured. The area F excavation of a houseand its alleyway provides an instructive test case.
The technological classes involved in investi-gations of the house and alleyway in the area F aresickles, end scrapers and waste debris or likelydebitage, defined as waste flakes and tool blanks.Abb. 59 shows the proportion of 56 sickle bladesbetween the house and the alleyway (the ashy area),and the notable inverse relationships between dou-ble lateral- and double triangular-edged sickles be-tween them. If only in this respect, there are appar-ent differences between these household areas.
Double-edged triangular sickle blades tend tobe the larger of the two; and, indeed, they areamong the largest sickle blades from the area F ex-cavation (Abb. 60). This result runs counter to theexpectations of conserving tool stone; assuming re-
Abb. 59.Pietrele. Prismatic blade sickle blade hafting approaches reconstructed from microscopic weartraces for excavation area F.
Abb. 60.Pietrele. Box-and-whiskers plot for prismatic blade sickle blade hafting approaches recon-structed from microscopic wear traces.
Pietrele 2009 77
versal of the ends of the triangular sickle blades isdue to the breakage or dulling of the original tooledge and switching ends leads to the double edgetriangular ones. The normal, and logical, expecta-tion would be smaller double edge triangular sickleblades. In grouping all prismatic sickle blades fromthe area F house and its alleyway, (Abb. 60) eitherdocuments an unusual contrary trend in overallsickle blade length or masks variation that would beclear were the functional residential areas separated.
When examined specifically for the area Fhouse and its alleyway, and in comparison to therefitted triangular sickle blades from area B, sub-stantial differences clearly exist in sickle blade toolstorage and discard (Abb. 61). These help clarify, inpart, the double triangular sickle blade problem.The area F house displays the logical expectation inengineering design outlined earlier of sickle bladeuse and maintenance. It appears to be comparableto the refitted sickle blades from area B. Overall, thelarger sickle blades are triangular, the smaller dou-ble triangular. This area F house pattern appears toreflect tool retention, repair, and continued use. Incontrast, the alleyway triangular sickle blades arefar smaller as a whole; seemingly too small to befurther used. So they likely represent discards. Sofar so good. But inexplicable is the alleyway’s dou-ble triangular sickle blades. These are well abovethe size range of those from the house. And, apply-ing the size-in-length approach to identifying stillserviceable sickle blade tools, they would have tobe regarded as such. The unsolved mystery is, whatare they doing in the alleyway?
The size-in-length approach seems to workwell too for the lateral sickle blades, actually per-haps better than for the triangular ones. But in a mir-ror opposite way that might indicate different tech-nological expectations between these two sickleblade hafting strategies. Double lateral edged sickleblades from the area F house have a larger lengthrange than single lateral ones. But the midpointsare reversed such that the length of single lateralsickle blades is far greater–actually the greatest ofany within the house and perhaps more in keepingwith the overall length model for sickle blade servi-ceability. In the alleyway the double lateral sickleblades have an exceedingly small range in bladelength, not grossly different than that of triangularsickle blades. That makes them too to be spent dis-cards, consistent with engineering design expecta-tions.
Abb. 61.Pietrele. Box-and-whiskers plot for prismatic blade sickle blade hafting approaches recon-structed from microscopic wear traces at area F house and alleyway (i.e., ashy area) and con-joined refitted blade fragments from area B.
3
Abb. 62.Pietrele. Box-and-whiskers plot for prismatic blade end scrapersreconstructed from microscopic wear traces at area F, house andalleyway (i.e., ashy area).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.78
Within the house relative to its alleyway, thetrend (Abb. 61; 62) is for larger tool elements with-in the house, whether these are sickle blades orend scrapers. The exception is for double triangularsickle blades and undifferentiated single edge sickleblades. These are largest in the alleyway. The areaB triangular sickle blades are slightly larger thanthose from area F, and most comparable to thosefrom its house rather than the substantially smallerones from the alleyway. So it is likely on this basisthat they too come from a residence, or relate di-rectly to one. Thus, larger sickle blade lengths dif-ferentiated among the hafting approaches are indi-cative of retention and serviceability. The alleywayseems to have either still serviceable or repairabledouble triangular sickle blades and undifferentiatedsingle edge sickle blades but not other types ofsickle blades or end scrapers. It also has if onlyslightly larger prismatic blade tool blanks (Abb. 63)that might have made the alleyway an equally pre-ferred tool manufacture area.
(M. K.)
Ein Teilskelett mit Brandspuren und einungewohnliches Knochenartefakt –Die menschlichen Skelettreste aus derGrabung 2008
Die im Rahmen der Grabungskampagne 2008 gebor-genen menschlichen Skelettreste wurden im Fruhjahr2009 zur Begutachtung ubergeben. Sie erscheinendemnach im aktuellen Vorbericht mit einjahriger Ver-zogerung. Dazu kommen drei Nachzugler aus demJahr 2007. Das vorliegende Knochenmaterial stammtaus den Flachen A, B und F.
Der Katalogteil ist – wie ublich – nach folgen-dem Schema gegliedert:
Fundnummer
1. Skelettelement2. Angaben zum Erhaltungszustand; Beurteilung der Bruch-
kanten; Benennung der Zahnpositionen nach internatio-naler Nomenklatur; evtl. abnehmbare Maße in mm (n. m.= nicht messbar)
3. Taphonomische Hinweise; Verbissspuren, Hitzeeinwir-kung (Angabe der Verbrennungsstufen nach Wahl72 ),Wurzelfraß, Spuren von Gewalteinwirkung, Versinte-rungsspuren
4. Sterbealter (Angabe ,,o. a.‘‘ bedeutet ,,oder alter‘‘)5. Geschlecht6. Anpassungen; mogliche oder wahrscheinliche Zugeho-
rigkeit7. Sonstige Aussagemoglichkeiten und Bemerkungen; pa-
thologische Erscheinungen; epigenetische Merkmale
Menschenknochen aus Flache F
P07F471
1. rechter Oberschenkelknochen2. zwei, uber alte, eindeutig im Frischzustand des Kno-
chens entstandene, Bruchkanten zusammenpassendeFragmente der proximalen Diaphysenhalfteoberer transversaler Dm 31.1oberer sagittaler Dm 23.9
3. eindeutige Verbissspuren im Bereich des Trochantermajor und umlaufend am Collum femoris
4. allg. Erscheinungsbild und Spongiosastruktur: eher jun-gerer Erwachsener
5. mittlere Robustizitat, Muskelmarkenrelief (schwach-)mit-tel: unbest.
6. –7. distal Bruchkomplex mit Komponenten einer Biegungs-
und Torsionsfraktur infolge stumpfer Gewalteinwirkung
Unter P07F471 aus der N–S-Gasse im Außenbereich desverbrannten Hauses in Flache F wurde bereits ein Frag-ment des linken Radius eines etwa 13–14jahrigen Jugend-lichen mit Verbissspuren und fraglicher Feuereinwirkungpubliziert.73 Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Knochendem als Ind. C bezeichneten Individuum aus dem Innerendieses Hauses zuzurechnen ist.
Abb. 63.Pietrele. Box-and-whiskers plot forprismatic bladedebitage reconstructedfrom microscopic weartraces at area F,house and alleyway(i.e., ashy area).
72 Wahl 1981. 73 Wahl in Hansen u. a. 2008, 91.
Pietrele 2009 79
Das neu vorgelegte Femurbruchstuck aus derselbenFundlage reprasentiert dagegen ein (eher jungeres) er-wachsenes Individuum mit eindeutigen Spuren von Ge-walteinwirkung am frischen Knochen. Es konnte vom an-thropologischen Befund her durchaus von Ind. D., einer18–25jahrigen Frau aus demselben Haus, stammen, vonder bis jetzt noch kein Teil des rechten Oberschenkelkno-chens angesprochen werden konnte. Die Verbissspurenkonnten die raumliche Verlagerung erklaren.
P07 F473
1. linke (?) Femurdiaphyse2. 94 mm langes Fragment des ventralen Anteils; vorwie-
gend alt, distal ursprunglich vielleicht im Frischzustandgebrochen
3. –4. allg. Erscheinungsbild: (wohl) erwachsen5. unbest.6. –7. in mazeriertem Zustand umgelagert
Der linke (?) Oberschenkelknochen P07F473 wurde im In-neren des verbrannten Hauses angetroffen. Er lag in un-mittelbarer Nahe desselben Ofens in der Sudostecke imErdgeschoss des verbrannten Hauses wie die bereits pu-blizierten Knochen P07F419a) und b).74 Bei diesen handeltes sich um ein stark hitzeexponiertes Unterkieferfragmenteines spatadulten-maturen, vielleicht eher weiblichen Indi-viduums und einen Teil des linken Schulterblattes mit frag-lichen Verbissspuren eines jungeren erwachsenen, mogli-cherweise mannlichen Individuums. Ein direkter Bezug zuP07 F473 kann nicht hergestellt werden. Seine Bruchkan-ten weisen auf eine Umlagerung nach langerer Liegezeithin. Er konnte also eher im Rahmen spaterer Planierungs-oder Aufschuttungsarbeiten hierher gelangt sein.
P08F705
1. Kalottenfragment2. ca. 90 mm " 75 mm großes Bruchstuck des rechten Os
parietale mit uber die Sutura sagittalis (Bereich S3/4)anhangendem, kleinen Anteil des linken Scheitelbeins;leicht dunkelfleckig; umlaufende Bruchkanten evtl. teil-weise im Frischzustand entstanden (fragliche Berstungs-frakturen)Kalottendicke um 6
3. Bruchflachen versintert; Kantenbereich uber ca. 30 mmmit alter, partieller Verrundung und Teilabsprengungen:moglicherweise vorubergehende Verwendung als Arte-fakt
4. Suturae sagittalis und lambdoidea ekto- und endokra-nial noch unverwachsen: (fruh)adult
5. unbest.6. –7. Sutura sagittalis trotz geringen Alters eingesenkt
P08F716
1. rechte Clavicula2. mehr oder weniger vollstandig erhalten, Knochenenden
alt abgebrochen
3. leicht dunkelfleckig; Oberflache und Bruchflachen (late-ral) versintert; eindeutige Verbissspuren
4. ausgesprochen grazil: infans II o. a.5. unbest. (wenn erwachsen, dann weiblich)6. –7. –
Die beiden Knochen P08F705 und P08F716 wurden im Be-reich der N–S-Gasse gefunden. Sie zeigen ubereinstim-mend Versinterungen, durften allerdings von zwei ver-schiedenen Individuen stammen. Die partiell abgenutzteKantenregion an dem Schadelrest lasst sich am ehestenmit einer vorubergehenden Verwendung des Stuckes alsArtefakt erklaren. Die Bissmarken am Schlusselbein spre-chen hingegen fur eine Verschleppung durch Hunde. Einentsprechendes Gegenstuck von der linken Korperseite istaus der naheren Umgebung bislang noch nicht gefundenworden.
P08F743
1. rechte Ulna2. Diaphysenfragment; rezent beschadigt, distal moglicher-
weise im Frischzustand gebrochen3. proximal mit eindeutigen Verbissspuren4. Große und allg. Erscheinungsbild: spatjuvenil o. a.5. relativ grazil: unbest.6. –7. –
P08F744
1. linker Radius2. 69 mm großes Diaphysenbruchstuck; proximal und dis-
tal rezent gebrochen3. Verbrennungsstufe II4. Große: juvenil o. a.5. relativ grazil: unbest.6. direkt an P08F745 a) und indirekt an P08F872 passend7. in drei separat geborgenen Fragmenten vorliegende,
linke Speiche eines eher weiblichen, wohl erwachsenenIndividuums; distales Ende fehlt, geschatzte großteLange um 230
P08F745 a)
1. Radiusdiaphyse2. ca. 57 mm, großes Fragment aus dem mittleren Schaft-
bereich; proximal und distal rezent gebrochen3. Verbrennungsstufe II4. allg. Erscheinungsbild: juvenil o. a.5. relativ grazil: unbest.6. direkt an P08F744 und indirekt an P08F872 passend7. siehe P08F744
P08F745 b)
1. linke Ulna2. großeres Diaphysenbruchstuck; distal alt gebrochen3. Verbrennungsstufe II, proximal mit Verbissspuren4. Große: (spat)juvenil o. a.5. mittlere Robustizitat: unbest.6. –7. moglicherweise zum selben Individuum wie P08F744
gehorig74 Wahl in Hansen u. a. 2008, 89.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.80
P08F745 c)
1. Radiusdiaphyse (Seitenbestimmung fraglich)2. 68 mm großes Fragment; proximal und distal rezent ge-
brochen3. Verbrennungsstufe II4. allg. Erscheinungsbild: juvenil o. a.5. relativ grazil: unbest (- viell. eher weiblich)6. –7. moglicherweise als Teil des rechten Unterarms zum sel-
ben Individuum wie P08F744 gehorig
P08F764 a)
1. linker Humerus2. großeres Bruchstuck der Schaftmitte; proximal und dis-
tal rezent gebrochenkleinster Dm Diaphyse 15.6großter Dm Diaphyse 22.0kleinster Umfang Diaphyse 58
3. Wurzelfraß, leicht dunkelfleckig4. Große: spatjuvenil o. a.5. mittlere Robustizitat: unbest.6. –7. –
P08F764 b)
1. linke Tibia2. Fragment aus der Diaphysenmitte; proximal und distal
rezent gebrochen3. distal mit Verbissspuren4. Große: juvenil o. a.5. unbest.6. –7. medial schwache, verheilte Periostitis
P08F764 c)
1. Fibuladiaphyse (Seitenbestimmung fraglich)2. Fragment der Schaftmitte, proximal und distal rezent
gebrochen3. distal mit fraglichen Verbissspuren4. Große und allg. Erscheinungsbild: spatjuvenil o. a.5. mittlere Robustizitat: unbest.6. –7. –
P08F764 d)–h)
1. Funf Diaphysensplitter von großen Langknochen (Hume-rus, Femur und Fibula)
2. Fragmentgroße zwischen 42 und 77 mm; meist rezentgebrochen
3. Verbrennungsstufe II–IV/V4. Große: juvenil o. a.5. unbest.6. keine Anpassung an P08F75?/F7?5 oder P08F7657. –
P08F765 a) þ b)
1. Fibuladiaphyse (Seitenbestimmung fraglich)2. zwei Schaftfragmente; rezent gebrochen3. Verbrennungsstufe II und II/III
4. Große und allg. Erscheinungsbild: wohl erwachsen5. unbest.6. –7. keine direkte Anpassung
P08F765 c)
1. rechte Ulna2. Schaftfragment; proximal alt, distal rezent gebrochen3. Verbrennungsstufe II4. Große: juvenil o. a.5. unbest.6. –7. –
P08F765 d)–f )
1. (rechter) Radius2. Schaftfragmente; vorw. rezent gebrochen3. –4. Große: juvenil o. a.5. unbest.6. –7. –
P08F765 g)– i)
1. Femurdiaphyse (Seitenbestimmung fraglich)2. Schaftfragmente; alt und rezent gebrochen3. Verbrennungsstufe III– IV4. Großenentwicklung: infans II (o. a.?) und spatjuvenil o. a.5. unbest.6. –7. moglicherweise von zwei verschiedenen Individuen
P08F765 j)
1. Humerusdiaphyse (?)2. kleines Schaftfragment; rezent gebrochen3. –4. Große: juvenil o. a.5. unbest.6. –7. –
P08F765 k)
1. Diaphysenfragment2. Langknochensplitter; rezent gebrochen3. –4. Große: infans II o. a.5. unbest.6. –7. –
P08F765 l)
1. rechte Rippe2. Fragment aus dem oberen bis mittleren Brustkorbbe-
reich; rezent gebrochen3. unverbrannt?4. allg. Erscheinungsbild: juvenil o. a.5. grazil: unbest.6. –7. –
Pietrele 2009 81
gesamt P08F765 a)– l)
Sammelsurium von zwolf Langknochenbruchstucken vonmoglicherweise zwei Individuen (Fragmentgroße zwischen34 und 96 mm); trotz vielfach rezenter Bruchkanten keineweiteren Anpassungen moglich.
P08F789
1. rechtes Schulterblatt2. Fragment der Spina scapulae; rezent beschadigt3. versintert; zur Cavitas glenoidalis hin mit fraglichen Ver-
bissspuren; fragliche, sekundare Kohlenstoffverfarbung;moglicherweise im Sprodzustand entstandene Stau-chungsfraktur
4. Große und allg. Erscheinungsbild: spatjuvenil o. a.5. mittlere Robustizitat: unbest.6. –7. alt umgelagert?
P08F819
1. rechter (?) Humerus2. 54 mm großes Diaphysenbruchstuck; proximal rezent,
distal im Sprodzustand gebrochenkleinster Dm Diaphyse 16.1großter Dm Diaphyse n. m.
3. Feuereinwirkung (Verbrennungsstufe II)4. Große und allg. Erscheinungsbild: (spat)juvenil o. a.5. unbest.6. –7. Umlagerung in mazeriertem Zustand
P08F821
1. Femur (Seitenbestimmung fraglich)2. kleines Diaphysenfragment aus dem dorsalen Anteil;
rezent beschadigtBreite der Linea aspera 9.5
3. dunkelfleckig, im Bruch kalkweiß: fragliche Hitzeexpo-sition
4. eher kleiner Schaftdurchmesser: juvenil o. a.5. Linea aspera sehr prominent, aber kaum profiliert: un-
best.6. –7. –
Zwischenauswertung P08F743–F745und P08F764–F821 (Sudhaus)
Unter den aufgefuhrten Fundnummern sind ausdem Sudhaus bislang 28 Knochenbruchstucke von20 Skelettelementen des Postkraniums uberliefert.Davon passen P08F744 und P08F745a) uber einenrezenten Bruch eindeutig zusammen. Zum selbenlinken Radius konnte nach anatomischen Kriterienauch P08F872 (unter dem Sudhaus) gehoren. Alspassende linke Ulna kommt P08F745b) in Frage.Den rechten Unterarm dazu bilden womoglich dieUlna P08F743 sowie der Radius P08F745c). Mogli-cherweise zugehorig sind auch die RadiusfragmenteP08F765d)– f) und das Ulnabruchstuck P08F765c).Bis auf zwei weisen alle diese Knochen uberein-
stimmend Verbrennungsstufe II auf, zwei zeigenVerbissspuren und je einer ist moglicherweise imFrischzustand bzw. alt gebrochen. Sie konnen durch-gehend einem spatjuvenilen oder alteren, d. h. wahr-scheinlich erwachsenen, Individuum unbestimmtenGeschlechts zugeordnet werden. Drei weitere Kno-chenstucke (Scapula, Tibia, Fibula) zeigen (fragliche)Bissmarken und funf Stucke (fragliche) Anzeichenvon Feuereinwirkung (Humerus, Fibula und 3" Fe-mur), wobei die Langknochen aus P08F764d)–h)und P08F765g)– i) offensichtlich den hochsten Hitze-graden (bis Verbrennungsstufe IV/V) ausgesetzt wa-ren. Theoretisch konnten auch diese Knochen nochzum selben Individuum gehoren.
Hinweise auf Sprodbruche sind v. a. an demrechten Schulterblatt P08F789 und dem rechten (?)Oberarmknochen P08F819 festzustellen. Hier sindalso eher Beschadigungen nach langerer Liegezeit,evtl. im Rahmen von Erdumlagerungen (Planierungs-arbeiten o. a.), anzunehmen. Außer diesem Scapula-bruchstuck, das zudem moglicherweise sekundarmit Feuer in Beruhrung gekommen ist, und dem Rip-penfragment P08F765l) gehoren alle vorliegendenSkelettelemente zu den großen Langknochen. Teilevon Schadel, Becken, Wirbelsaule, Handen und Fu-ßen fehlen bislang ganzlich. Alles in allem kann eineMindestindividuenzahl von 2 (maximal 3) Erwachse-nen angenommen werden. Anhaltspunkte, die aufdas Geschlecht der Individuen deuten konnten, feh-len.
P08F751
1. Kalottenreste2. mehrere Fragmente, rezent gebrochen
Kalottendicke um 5–63. eindeutig hitzeexponiert: Verbrennungsstufe II, Innen-
und Außenoberflache partiell Verbrennungsstufe III4. Nahtbefund (vermutlich Sutura sagittalis): (spat)juvenil –
adult5. mittlere Robustizitat: unbest.6. nicht direkt aneinander passend, aber wahrscheinlich
zusammengehorig7. Cribra cranii
P08F859
1. Rechter Oberschenkelknochen2. Fragment aus dem proximalen Diaphysenbereich; distal
im Sprodzustand gebrochenoberer transversaler Dm 33.2oberer sagittaler Dm 24.6
3. Oberflache verwittert und dunkelfleckig, im Bruch kalk-weiß, frei liegende Spongiosa proximal mit Versinterungs-spuren
4. Große und Erscheinungsbild: spatjuvenil o. a. (wohl er-wachsen)
5. relativ robust, Ansatz der Linea aspera prominent: un-best. – eher mannlich
6. –7. Umlagerung in mazeriertem Zustand
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.82
Zwischenauswertung P08F751 und F859(unter verbranntem Gebaude von 2007)
Die Kalottenreste P08F751 waren eindeutig demFeuer ausgesetzt und stammen von einem vielleichtschon erwachsenen, aber junger als 40jahrigen Indi-viduum. Der Oberschenkelknochen P08F859 lag be-reits langer – aufgrund typischer Korrosionserschei-nungen oberflachennah – in der Erde, bevor er anden Fundort verlagert wurde.
P08F871
1. Tibia (Seitenbestimmung fraglich)2. ca. 70 mm großes Diaphysenbruchstuck aus dem Be-
reich der Margo anterior; alt und rezent gebrochen3. partiell versintert, Verbissspuren4. Große und allg. Erscheinungsbild: juvenil o. a.5. unbest.6. –7. –
P08F872
1. linker Radius2. proximales Drittel; proximal und distal rezent bescha-
digt bzw. gebrochenDm proximal um 22
3. homogene Braunfarbung (Verbrennungsstufe II)4. proximale Epiphyse verwachsen: spatjuvenil o. a.5. relativ grazil: unbest. (- eher weiblich)6. uber rezenten Bruch direkt an P08F745 a) und indirekt
an P08F744 passend7. siehe P08F744
Zwischenauswertung P08F871–F872(unter Sudhaus)
Das Schienbeinfragment P08F871 war sowohl imFrischzustand von Hunden o. a. traktiert, als auchspater noch ein zweites Mal umgelagert worden.Das zweite Stuck aus diesem Kontext stammt eben-falls vom Postkranium. P08F872 lasst sich uber ei-nen rezenten Bruch direkt an P08F745a) anpassenund aufgrund der anatomischen Gegebenheiten in-direkt mit P08F744 zu einem Radius kombinieren.Beide Stucke stammen aus dem Sudhaus. Der Kno-chen ist einem weiblichen, wohl erwachsenen Indi-viduum zuzuordnen. Aus der geschatzten großtenLange von um 230 mm ergibt sich fur die Frau eineKorperhohe von etwa 1.60 m.
P08F840
1. Fibula (Seitenbestimmung fraglich)2. 88 mm großes Diaphysenbruchstuck; rezent beschadigt
und gebrochen3. eine Bruchkante (moglicherweise) im Frischzustand ent-
standen, Versinterungsspuren4. Große: juvenil o. a.5. relatv grazil: unbest.
6. –7. leichte, verheilte Periostitis
Das Wadenbeinfragment P08F840 kann einem jugendlichenoder alteren Individuum zugeschrieben werden. Es wurdeim Bereich des Sudwesthauses gefunden und ist ursprung-lich wohl im Frischzustand zerbrochen.
P08F75? oder F7?5
1. rechte Tibia2. Bruchstuck aus der Schaftmitte (lateraler/ventraler As-
pekt)3. Verbrennungsstufe II4. Große und allg. Erscheinungsbild: juvenil o. a.5. relativ grazil: unbest.6. keine direkte Anpassung an vorhandene Tibiafragmente
moglich7. –
Aufgrund unvollstandiger Beschriftung ist dieses Fragmentkeiner bestimmten Fundsituation mehr zuzuordnen. Es warzweifelsfrei hitzeexponiert und stammt von einem jugend-lichen oder alteren Individuum. Eine Anpassung an andereBruchstucke von Schienbeinen ist leider nicht moglich.
Menschenknochen aus Flache A
P08A206
1. Teilskelett. Reprasentiert sind: Clavicula re; Ulna undRadius re; Mc I, II und IV re; einige wenige Rippen- undWirbelfragmente; Pelvis re und li, Sacrum; Femur re undli; Tibia re und li; Fibula re und li; Patella re und li; Cal-caneus re, Talus re und li, Os naviculare re und li, Oscuboideum re, Os cuneiforme II und III re, Mt II–V re undMt III li
2. bis auf wenige Skelettelemente meist fragmentarisch undunvollstandig uberlieferte Knochenreste, vielfach rezentbeschadigt und gebrochen; Femurdiaphyse re im Frisch-zustand gebrochen (Messerer-Keil); Maße: siehe Abb. 64
Clavicula li, großte L (um 130–135)
Acetabulum, Dm 47
Femur li/re, großte Lnaturliche Loberer transversaler Dmoberer sagittaler Dmsagittaler Dm Diaph.mittetransversaler Dm Diaph.mitteUmfang Diaph.mitteDm proximalEpicondylenbr.
407/410403/40331.0/30.324.0/23.326.9/(25.3)28.6/27.285/8240/3971.5/n.m.
Patella li/re, HBrD
37.5/37.538/3718.5/18.0
Tibia li/re, großte LEpiphysenbr. proximalsagittaler Dm For. nutr.transversaler Dm For. nutr.kleinster Umfang
(um 320)/n.m.65/6531.2/30.421.9/22.771/71
Fibula re, großte L 324
Talus re, großte L 52
Abb. 64.Pietrele. Maße desTeilskeletts P08A206;um 30 Jahre, eher weib-lich (Angaben in mm).
Pietrele 2009 83
3. fragliche Nagespur am Schlusselbein; Versinterungen anTibia und Fibula li sowie Patella und Fibula re; partiel-le, unregelmaßige Hitzeeinwirkung (VerbrennungsstufeII(–III)) uber das gesamte Skelett verteilt; unverbranntePartien an Clavicula, Talus re und Becken (v. a. dorsalund kaudal); nahezu unverbrannt: LWS und Sacrum
4. Verwachsung der Epi- und Apophysen, Struktur der Be-ckensymphyse und Rippenenden: adult (um 30 Jahre)
5. Beckenmerkmale, allg. Grazilitat, Maße und Proportio-nen: eher weiblich
6. einige Kleinteile aus P08A207 direkt anpassend oder(wahrscheinlich) zugehorig
7. geschatzte Korperhohe: um 1,60 m; unregelmaßigeFeuereinwirkung spricht eher fur Katastrophenfeuer alsfur intentionelle Verbrennung; stumpfe Gewalteinwir-kung auf den re Oberschenkel von vorne rechts (keineHeilungserscheinungen); verheilte Periostitis an Tibiaund Fibula re; (schwache) arthrotische Veranderungenan Mc prox., Acetabulum li, beiden Patellae und Fibu-lae (prox.), Fußwurzelknochen; Asymmetrie im Becken-bereich, rechtes Ilio-Sakralgelenk mit starker entzund-licher Reaktion und Randleistenbildung, beidseitige(leichte) Coxa vara, Fehlstellung in beiden Kniegelen-ken; vl mit geringfugigen Degenerationserscheinungen
P08A207 a)–c)
1. zwei unvollstandig erhaltene Lendenwirbel2. drei Teilstucke, rezent gebrochen3. –4. Wirbelscheiben verwachsen, keine nennenswerten de-
generativen Veranderungen: (jungerer) Erwachsener5. relativ grazil: unbest. (- eher weiblich?)6. zwei der Stucke direkt anpassend an P08 A2067. beginnende Spondylarthrose und Osteochondrose
P08 A207 d)–f)
1. drei Wirbelfragmente: vt und vl2. Processus spinosus und zwei Bruchstucke des Corpus
vertebrae, ein Corpusfragment rezent gebrochen3. zweites Corpusfragment schwarz gefarbt (Verbrennungs-
stufe II)4. Wirbelscheiben verwachsen: erwachsen5. unbest.6. wohl ebenfalls zum selben Individuum wie P08A206 ge-
horig7. –
P08A207 g)
1. kleines Beckenfragment (Os ilium)2. rezent gebrochen3. –4. Crista iliaca verwachsen: erwachsen (um 25 Jahre o. a.)5. unbest.6. wahrscheinlich zum selben Individuum wie P08A206 ge-
horig7. –
P08A207 h)
1. rechter Metacarpus V2. vollstandig erhalten
gr. Lange 48
3. –4. distal verwachsen, keine degenerativen Veranderungen:
spatjuvenil o. a.5. sehr grazil: (eher) weiblich6. nach Große und Proportionen sehr wahrscheinlich zu
den ubrigen Handknochen von P08A206 gehorig7. –
P08A214
1. linker Oberschenkelknochen2. proximales Gelenkende inklusive Collum und Anteil der
Diaphyse; Trochanter major alt abgebrochen, Trochan-ter minor alt bestoßen (gestaucht), distal im Frischzu-stand gebrochenDm proximal 45
3. medial auf Hohe des Trochanter minor mindestens drei,horizontal und parallel zueinander verlaufende Sage(?)-oder Schnittspuren; auf derselben Hohe eine runde,trichterformige, 9 mm tiefe und einen maximalen Dmvon 19.5 mm aufweisende Bohrung mit umlaufend kon-zentrisch verlaufenden Riefen sowie in der Tiefe infolgekleinster Stauchungen abgerundetem Profil; fraglicheVerbissspuren an der Basis des Trochanter major; kleine,kirschkerngroße, spiegelnde Schliffflache ventral ober-halb des Epiphysenrandes
4. allg. Erscheinungsbild, Spongiosabefund: (eher junge-rer) Erwachsener
5. mittlere Robustizitat mit Tendenz zu grazil: unbest.6. –7. als Artefakt verwendetes Knochenstuck; ,,Reiterfacette‘‘;
moglicherweise leichte Coxa vara
Auswertung P08A206/207 und P08A214
Das Teilskelett P08A206 aus dem alten Grabungs-schnitt von D. Berciu ist einem (eher) weiblichen,ca. 1,60 m großen Individuum von ca. 30 Jahrenzuzuordnen. Nach Ausweis der Robustizitatsunter-schiede zwischen rechtem und linkem Bein handeltes sich um eine Rechtshanderin. Geringergradigedegenerative Veranderungen an verschiedenen Ge-lenken weisen auf eine gewisse Arbeitsbelastungbereits in jungeren Jahren hin. Pathologische Veran-derungen im Becken und Kniebereich sowie amrechten Schien- und Wadenbein durften dagegenauf verschiedene traumatische Erlebnisse und evtl.Wachstumsstorungen zuruckgehen. Die Knochenres-te sind unvollstandig uberliefert, aber zum großtenTeil im anatomischen Verband angetroffen worden.Es fehlen v. a. der linke Arm, der rechte Humerus,fast der gesamte Schultergurtel, große Partien desTorsos, der Halswirbelsaule sowie der kompletteSchadel inklusive Unterkiefer. Fragliche Nagespurenam rechten Schlusselbein konnten dafur sprechen,dass der Korper uber eine gewisse Zeit an der Ober-flache gelegen hat und fur Tiere zuganglich war, be-vor er eingebettet wurde. Die restlichen Abschnittekonnten auf diese Weise verschleppt worden sein.Die Fundsituation dokumentiert eine Totenhaltung
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.84
in Ruckenlage. Die Oberschenkel waren parallel zu-einander und zur rechten Seite hin leicht gegen dieKorperlangsachse angehockt, der rechte Unterschen-kel angewinkelt und mit dem Fuß im Bereich des Un-terschenkels des gestreckten linken Beins gelegen.
Die bereits in situ in unmittelbarer Nahe derSkelettreste festgestellten Feuerspuren lassen sichauch an den Knochen selbst nachweisen. Der Kor-per der Frau ist demnach nicht erst spater in dieBrandschicht geraten. Nahezu das gesamte Skelettweist eindeutige Spuren von Hitzeeinwirkung auf. Da-bei belegen typische Braun- und Schwarzfarbungeneine Expositionstemperatur von bis zu 450/500 !C.Einige Partien, z. B. im Lendenwirbel-Beckenbereich,linkem Huft- und Fußgelenk, sind unverbrannt. Esdurfte sich demnach nicht um eine intentionelle Ein-ascherung, sondern eher um ein Schadenfeuer han-deln. Im Zusammenhang mit einer Brandkatastro-phe ware auch die im Frischzustand des Knochensentstandene Fraktur des rechten Femurschaftes in-folge stumpfer Gewalteinwirkung – etwa durch he-rabfallende Gebaudetrummer o. a. – zu erklaren.
Die Skelettelemente P08A207a)–h) sind entwe-der uber direkte Anpassungen (zwei Lendenwirbel)oder nach Große, Proportionen, Erhaltungszustandund Alter sowie angesichts ihrer Lagebeziehunghochstwahrscheinlich als zugehorige, erganzendeTeile von P08A206 anzusehen.
Das isoliert aufgefundene Stuck P08A214 zeigtverschiedenartige Manipulationsspuren und durfteam ehesten als Artefakt in handwerklichem Kontextanzusprechen sein. Es ist ehedem im Frischzustandgebrochen, weist mehrere Schnitt-(evtl. Sage-?)spu-ren und eine intentionell angebrachte Bohrung auf.Im Inneren der Bohrung sowie an zwei weiterenStellen lassen sich Stauchungen, in anderen Berei-chen zusatzliche Hinweise auf ,,Abnutzung‘‘ feststel-len. Nach dem Spurenbild zu urteilen, konnte derKnochen als Arbeitsunterlage bzw. Widerlager beimBohren o. a. benutzt worden sein.
Die am Collum femoris festgestellte ,,Reiterfa-cette‘‘ deutet darauf hin, dass die Person, von derdieser Knochen stammt, haufig und uber einen lan-geren Zeitraum eine sitzende Haltung mit gespreiz-ten Beinen eingenommen hat.
Menschenknochen aus Flache B-Suderweiterung
P08B403
1. Linke Tibia2. plus/minus vollstandige Diaphyse; proximal und distal
alt abgebrochengroßte Lange ((um 325–330))Foramen nutr. transversal 22.0Foramen nutr. sagittal 37.3kleinster Umfang 78
3. schwarzfleckig, proximal und distal mit (fraglichen) Ver-bissspuren, starker Wurzelfraß
4. Große und Proportionen: erwachsen5. relativ robust, gedrungen: eher mannlich6. –7. verheilte Periostitis
P08B418
1. rechte Clavicula2. vollstandig erhalten
großte Lange 1453. Wurzelfraß4. sternale Apophyse noch nicht verwachsen: juvenil –
fruhadult (max. um 20 Jahre)5. ausgesprochen schlank und grazil: eher weiblich6. nicht zu P08B585 passend7. –
P08B424 a)
1. Kalottenfragment2. ca. 45 mm " 30 mm großes Bruchstuck des Scheitel-
beins; umlaufend alte, in mazeriertem Zustand entstan-dene BruchkantenKalottendicke 4–5
3. Innenoberflache dunkel verfarbt4. Nahtrest endo- und ektokranial offen: juvenil – fruhadult5. unbest.6. –7. –
P08B424 b)
1. rechter Metacarpus II2. vollstandig erhalten (gr. Lange 69)3. –4. distal verwachsen, ohne degenerative Veranderungen:
juvenil o. a.5. mittel(-grazil): unbest.6. –7. –
Auswertung P08B403–B435
Das linke Schienbein P08B403 gehort evtl. zum Au-ßenbereich eines schon 2006 angegrabenen Hauses.Es stammt von einem erwachsenen, eher mannli-chen Individuum und weist Anzeichen einer verheil-ten Knochenhautentzundung auf. Die Verbissspurendeuten darauf hin, dass der Knochen im Frischzu-stand fur Karnivoren zuganglich war, der Wurzelfraßauf eine spatere, (zwischenzeitlich) oberflachennaheLagerung. Die dunklen Flecken konnten u. a. durchMangananreicherung aus dem umgebenden Erd-reich entstanden sein.
Die Knochen P08B418 und P08B424 (Schadel-fragment, Schlusselbein und Mittelhandknochen)stammen aus dem grau-lehmigen Bereich zwischenH: 34,70 und 34,40. Sie konnten theoretisch ein unddemselben Individuum, einer juvenilen-fruhadulten(maximal 20jahrigen) Frau (?) zuzuschreiben sein.Das Kalottenfragment zeigt allerdings umlaufendBruchkanten, die auf Umlagerung in mazeriertem
Pietrele 2009 85
Zustand hinweisen. Die Stucke liegen gleich unter-halb der Grauen Gasse und etwas hoher als jenevon P07B531–B561 (siehe unten). Dort ließen sichReste einer jungeren Frau, eines zweiten erwachse-nen, wohl eher mannlichen Individuums sowie ei-nes Kindes der Altersstufe infans II nachweisen. Ein-zig vergleichbarer taphonomischer Befund ist der altbeschadigte Halswirbel P07B553, der wie das Ka-lottenbruchstuck P08B424 a) offenbar nach langererInhumierung umgelagert wurde.
Menschenknochen aus Flache B
P07B561 a) 1 und 2
1. Kalottenfragment2. zwei, uber einen alten Bruch aneinander passende
Teilstucke des rechten Scheitelbeins mit kleinem Anteildes Os occipitale; rezent beschadigt
3. schwarzfleckig, teilweise versintert4. Sutura lambdoidea ekto- und endokranial noch unver-
wachsen: (spat)juvenil – adult5. Kalottendicke mittel(-dunn): unbest.6. sehr wahrscheinlich zum selben Schadel wie P07B561
b) gehorig7. –
P07B561 b)
1. Kalottenbruchstuck2. kleineres Fragment des linken (?) Os parietale; alte, in
mazeriertem Zustand entstandene Bruchkanten3. schwarzfleckig4. Sutura coronalis endo- und ektokranial noch unver-
wachsen: (spat)juvenil – adult5. unbest.6. nach Farbung, Dicke, Entwicklungszustand, Krummung
u. a. sehr wahrscheinlich zu P07B561 a) gehorig7. –
Die Kalottenreste P07B561 a) und b) durften einemjungeren erwachsenen, vielleicht eher weiblichen (?)Individuum zuzuordnen sein. Der Fund steht inraumlichem Bezug zu den bereits publizierten Ske-lettteilen P07B531, B537, B543 a) und b), B550 undB553, wurde allerdings etwas tiefer als diese gefun-denen.
Die fruher erfassten, meist kleinen Bruchstuckesind einem Halswirbel, ansonsten durchgehend gro-ßen Langknochen zuzuordnen (je 2" Humerus, Fe-mur und Tibia, 1" Fibula). Sie stammen von zweierwachsenen Personen (einer Frau und einem deut-lich robusteren, wohl eher mannlichen Individuum)und einem Kind der Altersstufe infans II. Drei derFragmente zeigen (fragliche) Brandspuren, jeweilsfunf Anzeichen von Tierverbiss und Frakturen, die(moglicherweise) im Frischzustand des Knochensentstanden sind. Der Halswirbel P07B553 ist alt be-schadigt, wurde also nach langerer Bodenlagerungumgelagert. Und das kann ebenso fur die oben ge-
nannten Kalottenreste P07B561 angenommen wer-den. Weitere Ubereinstimmungen im Hinblick auftaphonomische Spuren sind nicht erkennbar, mog-liche Anpassungen aufgrund der anatomischen Ge-gebenheiten nicht moglich.
P08B585
1. linke Scapula2. Fragment; lateral rezent gebrochen3. medial mit fraglichen Verbissspuren4. Große und Proportionen: juvenil o. a.5. grazil, relativ kurz: unbest. (- viell. eher weiblich?)6. nicht zu P08B418 passend7. –
P08B590
1. Oberschenkelknochen (Seitenbestimmung fraglich)2. 118 mm langer Diaphysensplitter; Bruchkanten eindeu-
tig im Frischzustand entstanden3. –4. Große und Proportionen: spatjuvenil o. a.5. unbest.6. –7. –
Zwischenauswertung Planum 1 (P08B585–P08B590)
– zwei Knochenfragmente– 1" eindeutig im Frischzustand gebrochen; 1" mit frag-
lichen Verbissspuren– MIZ 1: spatjuveniles o. a., moglicherweise weibliches (?)
Individuum
P08B639 a)
1. Kalottenbruchstuck2. rechtes Os parietale mit kleinem Anteil der Sutura coro-
nalis; rezent beschadigt, meist alte Bruchkanten (einemit Biegebruchcharakter)Kalottendicke 3.2–5.8
3. Innenoberflache schwarzfleckig4. mittlere Robustizitat: (spat)juvenil o. a.5. unbest.6. –7. –
P08B639 b)
1. linker Oberschenkelknochen2. lose distale Epiphyse; Teil der medialen Kondyle alt ab-
gebrochendistale Breite ((großer/um 81))
3. leicht schwarzfleckig, Verbissspuren4. Großenentwicklung: juvenil5. unbest.6. –7. –
P08B642
1. Oberschenkelknochen (Seitenbestimmung fraglich)2. ca. 141 mm langer Abschnitt der Diaphyse3. schwarzfleckig, im Bruch altweiß-kalkweiß
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.86
4. Große und Proportionen: erwachsen5. relativ robust: unbest. (- viell. eher mannlich?)6. –7. auffallend schwer, fragliche Feuereinwirkung oder spe-
zifische Lagerung (wie z. B. P08B111 und P08B140)
P08B648
1. rechter Oberschenkelknochen2. proximales Viertel; distal rezent gebrochen
Dm proximal 35oberer transversaler Dm 29.2oberer sagittaler Dm 19.6
3. –4. Trochanter major, minor und proximale Epiphyse ver-
wachsen; Verwachsungslinien noch sichtbar: fruhadult(20–25 Jahre)
5. (sehr) grazil: (eher) weiblich6. –7. leichte Coxa vara
P08B654
1. rechter Metatarsus V2. fast vollstandig erhalten; proximal und distal rezent be-
stoßen3. fragliche Feuereinwirkung4. distal verwachsen, keine degenerativen Veranderungen:
juvenil o. a.5. grazil: unbest (- eher weiblich)6. –7. –
Zwischenauswertung Planum 2 (P08B639–P08B654)
– funf Knochenfragmente– Hinweise auf Umlagerung mazerierter Knochen; fragliche
Feuereinwirkung; 1" fraglich im Frischzustand gebro-chen; 1" wie ,,petrifiziert‘‘
– MIZ 3: 1 jugendliches Individuum; 1 erwachsenes, mog-licherweise eher mannliches Individuum; 1 fruhadulteFrau
– leichte Coxa vara am re Femur P08B648
P08B659
1. rechter Oberschenkelknochen2. Diaphysenfragment (Bereich Linea aspera/Facies popli-
tea); Bruchkanten umlaufend alt, distal moglicherweiseim Frischzustand entstanden
3. –4. Große und Proportionen: erwachsen5. (relativ) robust; Linea aspera breit, aber nicht beson-
ders prominent: unbest. (- eher mannlich)6. –7. –
P08B670
1. linke Rippe2. Caput costae aus dem unteren Brustkorbbereich; nach
ventral rezent gebrochen3. –4. Große, Wirbel-Rippen-Gelenk mit arthrotischer Randleis-
te: erwachsen
5. mittlere Robustizitat: unbest.6. –7. –
Zwischenauswertung Planum 3 (P08B659–P08B670)
– zwei Knochenfragmente– Hinweise auf Umlagerung mazerierter Knochen; 1" frag-
lich im Frischzustand gebrochen– MIZ 1: erwachsenes, moglicherweise eher mannliches
Individuum
P08B683
1. mehrere Schadelfragmente2. fazialer Anteil des Os frontale, linke Maxilla mit teilwei-
ser Bezahnung, linkes Os zygomaticum, linker großerKeilbeinflugel, Kleinteile; umlaufende Bruchkanten inmazeriertem Zustand entstanden, geringfugige, rezenteBeschadigungenkleinste Stirnbreite 102Biorbitalbreite ((96))Obergesichtshohe 65Orbitalbreite 37Obitalhohe 31Nasenbreite ((um 23))Nasenhohe 43Maxillarlange 48Maxillarbreite ((60))Gaumenlange 39Gaumenbreite ((32))
3. Bruchkanten teilweise ubersintert; weitere Sinterspurenauf der Außen- (Maxilla) und Innenoberflache (Stirnbein);21 und 22 postmortal ausgefallen
4. Zahnbefund, Großenentwicklung: infans II (um 11–12Jahre)
5. Detailmerkmale infantil-weiblich: unbest. (- viell. eherweiblich)
6. alle Fragmente offensichtlich zum selben Schadel gehorig7. Margo aperturae piriformis verrundet, mit lediglich
schwachem Grat zur Spina nasalis anterior; 28 nichtangelegt, Foramen zygomaticofaciale li doppelt; Zahn-stein, Parodontose, schwache Schmelzhypoplasien; Cri-bra orbitalia; alt umgelagerte Knochenreste
P08B688
1. rechte Tibia2. ca. 137 mm langer Diaphysensplitter aus dem dorsalen
Anteil; alte Bruchkanten, rezent bestoßentransversaler Dm For. nutr. (um 18.0)
3. Innenseite versintert, proximal mit Verbissspuren4. Große und Proportionen: juvenil o. a.5. sehr grazil: unbest. (- eher weiblich?)6. –7. –
P08B695
1. linker Oberschenkelknochen2. proximales Ende inklusive Collum femoris; rezent be-
schadigtDm proximal 50
3. –4. proximale Epiphyse verwachsen, Spongiosa nicht redu-
ziert: jungerer Erwachsener
Pietrele 2009 87
5. (relativ) robust: eher mannlich (?)6. –7. Reiterfacette
Zwischenauswertung Planum 4 (P08B683–P08B695)
– zwei separate Knochenfragmente und mehrere, zusam-mengehorige Teile eines Kalvariums
– mit einer Ausnahme alt umgelagerte Knochen; 2" Spu-ren von Versinterung
– MIZ 2: 1 Individuum der Altersstufe infans II (um 11–12Jahre), vielleicht eher weiblich?; 1 jungerer Erwachsener,eher mannlich?
– Reiterfacette am li Femur P08B695
P08B108 a) 1
1. Kranium2. auf einer Flache von 0.43 m2 und einer Hohendifferenz
von 10 cm in vier separat eingemessenen Fundeinhei-ten geborgene Teilstucke (Os frontale, Os parietale re,Os parietale und Os temporale li, Unterkiefer mit nahe-zu vollstandiger Bezahnung) desselben Schadelskleinste Stirnbreite 91großte Stirnbreite 118med.sag. Frontalbogen 130med.sag. Parietalbogen 118med.sag. Frontalsehne 109med.sag. Parietalsehne 107Unterkiefer, Kondylenbreite 109
Winkelbreite 97Lange 71Kinnhohe 35Asthohe 53Astbreite li/re (32.5)/(31)Astwinkel 135!
3. postmortal deformiert, rezente Beschadigung oberhalbder li Orbita und am re Processus coronoideus desUnterkiefers, Sinterspuren; li Processus coronoideus altabgebrochen (evtl. im Frischzustand); 44 postmortalausgefallen; Komplex von Biegungs- und Berstungsfrak-turen auf dem linken Scheitelbein (Zentrum im Bereichder Linea temporalis) infolge stumpfer Gewalteinwirkungvon außen
4. alle Schadelnahte endo- und ektokranial noch offen,Zahnbefund: juvenil (ca. (15–)16 Jahre)
5. Detailmerkmale eindeutig, kindlich-grazil: weiblich6. moglicherweise zum selben Individuum wie P08B108
b) gehorig7. Sutura frontalis partialis, Foramen parietale beidseitig
fehlend, 38 und 48 vorhanden; Zahnstein, Stellungs-anomalien, Schmelzhypoplasien; schwache Cribra orb-italia; zusammen mit dem rechten Scheitelbein wurdeein Milchzahn eines zweiten Individuums gefunden:P08B108 a) 2
P08B108 a) 2
1. Milchbackenzahn2. isolierter, vollstandiger Zahn 553. –4. Wurzel vollstandig, moglicherweise erste Resorptionser-
scheinungen apikal, geringe Zahnkronenabrasion: spa-tinfans I (um 4–6 Jahre)
5. Zahngroße: unbest.6. –7. zusammen mit dem rechten Os parietale von P08B108
a) 1 gefunden
P08B108 b)
1. linker Humerus2. proximal beschadigt, distale Epiphyse fehlt
gr. Lange (um 270)kleinster Dm Diaphyse 13.7großter Dm Diaphyse 17.4kleinster Umfang Diaph. 49Hohendm proximal 36Breitendm proximal 33
3. Versinterungen proximal und distal; distales Diaphysen-ende mit Verbissspuren
4. proximale Epiphyse verknochernd: spatjuvenil (17–20Jahre)
5. infantil(-grazil): weiblich6. Zugehorigkeit zu P08B108 a) 1 vom anthropologischen
Befund her nicht ausgeschlossen7. ausgesprochen graziles Individuum
P08B111
1. Rechter Oberschenkelknochen2. mehr oder weniger vollstandige Diaphyse
großte Lange (um 450)oberer transversaler Dm 30.8oberer sagittaler Dm 24.2transversaler Dm Diaph.mitte 25.2sagittaler Dm Diaph.mitte 28.8Umfang Diaph.mitte 83
3. proximal und distal mit eindeutigen Verbissspuren; allefrei liegenden, spongiosen Bereiche flachig ubersintert;weißgrau gefarbter Knochen, schwarzfleckig und imBruch altweiß
4. Große und allg. Erscheinungsbild, keine Auflockerungder Spongiosa: (spat)juvenil – adult
5. Robustizitat: (mittel-)grazil, Muskelmarkenrelief (sehr)schwach: eher weiblich?
6. –7. wie petrifiziert oder verbrannt, aber ohne typische Hitze-
risse; evtl. besondere Lagerungsbedingungen
P08B114
1. Schadel2. vergleichsweise vollstandig uberliefertes, aber fragmen-
tiertes und postmortal stark deformiertes Kalvarium mitnahezu vollstandiger Bezahnung; großere Fehlstellenim Bereich des rechten Os parietale sowie der Schadel-basis; durchgehend alte Bruchkanten, linker Processusmastoideus alt bestoßen (Umlagerung)kleinste Stirnbreite ((>100))Nasenhohe (um 41)Nasenbreite 26Lange Foramen magnum 38Breite Foramen magnum (31)
3. Innenoberflache starker korrodiert; 11,12 und 22 post-mortal ausgefallen
4. Zahn- und Nahtbefund: juvenil (um 16–17 Jahre)5. Detailmerkmale uneindeutig bzw. sich teilweise wider-
sprechend: unbestimmt (Tendenz viell. eher weiblich?)
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.88
6. –7. Relativ dicke Kalotte, relativ schwerer Schadel; Margo
aperturae piriformis verrundet, mit lediglich schwachemGrat zur Spina nasalis anterior; 18 und 28 vorhanden,accessorischer Hocker bukkal an 27, 15 zweiwurzelig,Sutura frontalis partialis, Foramen parietale re fehlend,Foramen zygomaticafaciale li und re doppelt; Parodon-tose, Zahnstein, Schmelzhypoplasien, Cribra cranii undCribra orbitalia, entzundliche Reaktion im Bereich desre und li außeren Gehorgangs
Zwischenauswertung Planum 5 (P08B108–P08B114)
– drei isolierte Skelettelemente sowie ein Kranium undein Kalvarium, jeweils in mehreren Fragmenten
– Kranium P08B108 a) 1 mit Spuren stumpfer Gewaltein-wirkung am frischen Knochen; Kalvarium P08B114 mitdurchgehend alten Bruchkanten (Umlagerung!) und deut-lichen Korrosionserscheinungen; zwei Langknochenfrag-mente mit Verbissspuren und Versinterung (P08B111zusatzlich wie ,,petrifiziert‘‘)
– MIZ 3: 1 kindliches Individuum (um 4–6 Jahre); 2 (spat)juvenile Individuen (1" weibliches, 1" vielleicht weib-lich?)
– P08B114 mit verrundeter Margo aperturae piriformis
P08B127
1. rechter Humerus2. mehr oder weniger vollstandige Diaphyse; distal rezent
beschadigtgroßte Lange ((um 305))kleinster Dm Diaphyse 13.8großter Dm Diaphyse 18.7kleinster Umfang Diaph. 51
3. leicht dunkelfleckig; distal mit eindeutigen, proximalmit fraglichen Verbissspuren
4. Große und Proportionen: juvenil o. a.5. (infantil-)grazil, Muskelansatzstellen mittel: wohl eher
weiblich6. –7. –
P08B128 a)
1. rechte Rippe2. unterer Brustkorbbereich; sternales Ende rezent abge-
brochen3. leicht dunkelfleckig4. Große: juvenil5. unbest.6. –7. –
P08B131 a)
1. rechter Oberschenkelknochen2. plus/minus vollstandige Diaphyse
großte Lange Diaphyse ((um 345))oberer transversaler Dm 25.5oberer sagittaler Dm 18.3transversaler Dm Diaph.mitte 19.2sagittaler Dm Diaph.mitte 23.2Umfang Diaph.mitte 66
3. dunkelfleckig, Bruchflachen teilweise ubersintert; distalmit eindeutigen, proximal mit fraglichen Verbissspuren
4. Großenentwicklung: infans II – juvenil5. infantil(-grazil), Muskelmarkenrelief (schwach-)mittel:
unbest.6. Zusammengehorigkeit mit P08B131 b) nicht ausge-
schlossen7. –
P08B131 b)
1. linkes Darmbein2. mehr oder weniger vollstandiges Os ilium3. leicht dunkelfleckig, Apophysenflachen versintert, Ver-
bissspuren4. Acetabulum und Crista iliaca noch unverwachsen, Gro-
ßenentwicklung: infans I/II5. relativ starker S-Schwung, Incisura ischiadica major
eher weit: unbest.6. Zusammengehorigkeit mit P08B131 a) nicht ausge-
schlossen7. –
P08B131 c)
1. rechte Beckenhalfte2. mehrere Teilstucke; rezent beschadigt und fragmentiert
Dm Acetabulum (um 49)3. grau, im Bruch altweiß (verbrannt?); Acetabulum und
frei liegende spongiose Abschnitte teilweise zugesintert;Ansatz des Tuber ischiadicum mit fraglichen Verbiss-spuren
4. Tuber ischiadicum und Crista iliaca verwachsen, keineDegenerationserscheinungen: adult (um 30 Jahre) o. a.
5. S-Schwung schwach, Sulcus praeauricularis (sehr) deut-lich, Incisura ischiadica major uneindeutig: (eher) weib-lich
6. –7. –
P08B132
1. Schadelfragment2. Bruchstuck der Pars basilaris des Os occipitale; rezent
beschadigt, ursprunglich wohl im Frischzustand gebro-chen
3. –4. Große, Sphenobasilarfuge noch offen: juvenil5. unbest.6. –7. Canalis hypoglossi li doppelt
P08B134 a)
1. Kalottenbruchstuck2. ca. 65 mm " 45 mm großes Fragment des rechten (?)
Scheitelbeins mit uber die Sutura sagittalis anhangen-dem, kleinen Anteil des linken (?) Os parietale; umlau-fende Bruchkanten allesamt alt und zumindest teilweiseim Frischzustand des Knochens entstanden (zwei mitBiegebruchcharakter)Kalottendicke um 4
3. –4. Nahtbefund: plus/minus spatadult
Pietrele 2009 89
5. Knochendicke: unbest. (Tendenz viell. eher weiblich?)6. –7. relativ komplizierter Nahtverlauf; stumpfe Gewalteinwir-
kung peri- oder fruhpostmortal
P08B134 b)
1. Sacrum2. Wirbelkorper (vs 1 und 2) mit anhangenden Anteilen der
Partes laterales; alt bestoßen und rezent beschadigt3. –4. Wirbelkorper noch nicht vollst. verwachsen: fruhadult
(um 30 Jahre)5. dorsoventrale Krummung nicht beurteilbar; Proportio-
nen, Grazilitat: (viell.) eher weiblich6. –7. keine nennenswerten Degenerationserscheinungen
P08B135
1. rechter Oberschenkelknochen2. großeres Diaphysenfragment, proximales und mittleres
Drittel; distal rezent beschadigtgroßte Lange Diaphyse ((um 330))oberer sagittaler Dm 19.9oberer transversaler Dm 25.3sagittaler Dm Diaph.mitte 22.4transversaler Dm Diaph.mitte 22.2Umfang Diaph.mitte 70
3. dunkelfleckig, proximal mit Verbissspuren, distal fragli-che Verbissspuren
4. Großenentwicklung: infans II – juvenil5. infantil-grazil, Muskelansatzstellen (sehr) schwach: un-
best.6. –7. –
P08B140
1. linker Oberschenkelknochen2. großeres Diaphysenbruchstuck; stark fragmentiert
transversaler Dm Diaph.mitte um 28sagittaler Dm Diaph.mitte um 30.5Umfang Diaph.mitte n. m.
3. rissige Oberflache, Compacta kalkweiß (wie petrifiziert);proximal mit Verbissspuren
4. Große und Proportionen: (wohl) erwachsen5. mittel-robust, Muskelmarkenrelief schwach-mittel: un-
best.6. –7. gedrungen wirkender Schaft; sekundare Hitzeeinwirkung
und/oder starke Feuchtigkeitsschwankungen?
Zwischenauswertung Planum 6 (P08B124–P08B140)
– zehn Knochenfragmente, davon 8x vom Postkranium– 2" Hinweise auf Umlagerung; fragliche Feuereinwir-
kung; ein Schadelknochen im Frischzustand, der zweitefraglich im Frischzustand gebrochen; ein Langknochenwie ,,petrifiziert‘‘; 6" mit (fraglichen) Verbissspuren
– MIZ 3: 2 jugendliche Individuen; 1 adulte Frau (um 30Jahre)
Zusammenfassende Beurteilung Plana 1–6(P08B585–B695 und P08B108–B140)
In Flache B sind im Jahr 2008 zwischen H: 34,14 undH: 33,11 sechs Plana angelegt worden (Abb. 65).Diese unterscheiden sich im Hinblick auf die Men-schenknochen bezuglich der Fundmengen ebensowie auch der eruierten Mindestindividuenzahlen.Aus Planum 1 sind aus zwei Fundstellen zwei
Fundeinheiten Hohe (mNN) Skelettteile MIZ Alter Geschlecht
P07B531–P07B550 34,50–34,30Planum 2007/2
4 2 1 adult1 infans II
mannlich–
P07B553 34,30–34,20Planum 2007/3
3 1 1 spatjuvenil-adult weiblich?
P07B561 34,20–34,15Planum 2007/4
3 1 1 fruhadult weiblich?
P08B585–P08B590 34,10–33,90Planum 2008/1
2 1 1 spatjuvenil weiblich?
P08B639–P08B654 33,90–33,75Planum 2008/2
5 3 1 juvenil1 adult1 fruhadult
–mannlich?weiblich
P08B659–P08B675 33,75–33,60Planum 2008/3
2 1 1 adult mannlich?
P08B683–P08B695 33,60–33,45Planum 2008/4
3 2 1 infans II (11–12 J)1 fruhadult
weiblich?mannlich?
P08B108–P08B114 33,45–33,30Planum 2008/5
6 3 1 infans I (4–6 J)2 spatjuvenil
–weiblich?
P08B124–P08B140 33,30–33,15Planum 2008/6
10 3 2 juvenil;1 adult (30 J)
–weiblich
Gesamt 38 mind. 6 Individuen
Abb. 65.Pietrele. Mindestzahl,Alter und Geschlecht
der Individuen inFlache B (2007–2008).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.90
Skeletteile uberliefert, die von ein und derselbenPerson stammen konnten (MIZ 1). Fur die ubrigenPlana ergeben sich folgende Werte. Planum 2:4 Fundstellen, 5 Skelettteile, MIZ 3; Planum 3:2 Fundstellen, 2 Skelettteile, MIZ 1; Planum 4:3 Fundstellen, 3 Skelettteile, MIZ 2; Planum 5:3 Fundstellen, 6 Skelettteile, MIZ 3; Planum 6:7 Fundstellen, 10 Skelettteile, MIZ 3. Demnach kannv. a. fur die beiden unteren Plana 5 und 6 eine er-hohte Reprasentanz menschlicher Knochenreste (zu-sammen 16 von 28 Skelettteilen) festgestellt werden.Alles in allem sind sowohl kindliche und jugend-liche Individuen als auch Hinweise auf mannlicheund weibliche Erwachsene vertreten. Bei einer ge-meinsamen Betrachtung aller Schichten ergabe sicheine MIZ von 6 (1" infans I; 1" infans II; 2" juve-nil, davon 1" eher weiblich; 1 vielleicht eher mann-licher, eher jungerer Erwachsener und 1 Frau imAlter von etwa 25–30 Jahren). Rein rechnerisch lie-gen somit im Durchschnitt 4,7 Knochenstucke proIndividuum vor. Tatsachlich sind allerdings die Sub-adulten meist nur durch ein oder zwei Teile prasent.Die meisten Fragmente stammen von spatjuvenilenoder alteren Personen.
Eindeutige, direkte Anpassungen uber ver-schiedene Fundnummern oder auch Plana hinwegsind leider nicht moglich. Bemerkenswert in diesemKontext ist jedoch das Kranium einer etwa 16jahri-gen, jungen Frau P08B108. Insofern als Kalvariumund zugehoriger Unterkiefer direkt beieinander ange-troffen wurden, kann hier ausnahmsweise von einemTeilskelett gesprochen werden. Dies konnte – mussaber nicht – bedeuten, dass hier bei der Verlagerungnoch ein gewisser Weichteilverband bestand. Evtl.mogliche Zusammengehorigkeiten ergeben sich da-neben aber aufgrund des anthropologischen Befun-des (z. B. re Femur P08B648 und Sacrum P08B134),wobei letztlich nur von archaologischer Seite ent-schieden werden kann, ob – wie in diesem Fall –Teile aus Planum 2 und Planum 6 uberhaupt zu einund demselben Individuum gehoren konnten.
Das vorliegende Skelettelementespektrumzeigt erneut, dass (mit Ausnahme der Artefakte)offensichtlich keine Auswahl hinsichtlich einzelnerKorperpartien getroffen wurde. Das spricht u. a. da-fur, dass das vorliegende Ensemble an Menschen-knochen im Tellbereich nicht – etwa zu kultischenZwecken – gezielt selektiert wurde, sondern sichnach dem Zufallsprinzip zusammensetzt.
Als eine gewisse Regelhaftigkeit innerhalb die-ses Ensembles konnen die gleichermaßen in oberenwie unteren Plana zu beobachtenden, taphonomi-schen Spuren gedeutet werden. Im Frischzustandentstandene Bruchkanten, Spuren von Tierverbiss,fragliche Feuereinwirkung und Sprodbruche tretenmehr oder weniger in allen Schichten auf. Das sprichtfur eine vergleichbare oder zumindest ahnliche Gene-
se. In Kombination mit der Tatsache, dass verschie-dene Altersgruppen und beide Geschlechter nach-gewiesen sind, konnten dabei u. a. Aufschuttungenmit Erdmaterial aus einem ehemaligen Friedhofsarealeine Rolle gespielt haben. Lediglich die Sinteranhaf-tungen beschranken sich ausschließlich auf Skelett-reste aus den Plana 4 bis 6. Dieses Phanomen ließesich wohl am ehesten durch unterschiedliche geolo-gische Liegemilieus (in Fundlage oder am Herkunfts-ort?) erklaren.
Besondere Erwahnung verdienen in diesemFundkomplex noch einige interessante Detailbeob-achtungen:– In mehreren Fundeinheiten (v. a. P08B111,
P08B131, P08B140 und P08B642) lassen sichKnochenteile ansprechen, die wie ,,petrifiziert‘‘erscheinen. Sie sind deutlich schwerer als ver-gleichbare Fragmente, im Bruch weiß, zeigen abernicht die typischen Risse, die bei der Verbrennungvon frischen Knochen mit hoheren Temperatureneinhergehen. Sie konnten vielleicht mit sekun-darer Hitzeeinwirkung, evtl. in Kombination mitFeuchtigkeitsschwankungen o. a. Bedingungen inVerbindung stehen.
– Der linke Oberschenkelknochen P08B695 (jun-gerer Erwachsener, eher mannlich) zeigt eine sogenannte Reiterfacette. Diese wird zwar vielfachmit exzessivem Reiten in Verbindung gebracht,weist allerdings nur auf eine haufig und uber ei-nen langeren Zeitraum eingenommene Sitzhaltungmit gespreizten Beinen (,,rittlings‘‘) hin. Denkbarware somit auch ein Zusammenhang mit hand-werklichen Tatigkeiten. Dasselbe Phanomen lasstsich auch an dem als Artefakt verwendeten Ober-schenkelknochen aus Flache A erkennen.
– An zwei Gesichtschadeln kann ein – zumindestfur Mitteleuropa eher seltenes – typologischesMerkmal beobachtet werden, eine verrundeteMargo aperturae piriformis, die lediglich einenschwachem Grat zur Spina nasalis anterior hinaufweist: P08B114 (Planum 5) und P08B683(Planum 4). Dass es sich in beiden Fallen um sub-adulte und vielleicht eher weibliche Individuenhandelt, konnte Zufall sein. Sobald eine großereStichprobe an Skeletten aus dem Friedhof unter-sucht ist, lasst sich abschatzen, ob es sich dabeium Vertreter der ansassigen Bevolkerung oderevtl. um Fremde handelt.
(J. Wa.)
Pietrele 2009 91
Literaturverzeichnis
Andreescu/Popa 2003R. R. Andreescu/T. Popa, Sultana Malu-Rosu – Catalogselectiv. Cercetari Arheologice 12, 2003, 59–67.
Baitinger 2008H. Baitinger, Die Burg der Keltenfursten – Die Ausgra-bungen auf dem keltischen Furstensitz Glauberg. In: DerGlauberg in keltischer Zeit. Zum neuesten Stand der For-schung. Offentliches Symposium 14.–16. 9. 2006 Darm-stadt (Wiesbaden 2008) 5–19.
Berciu 1961D. Berciu, Contributii la problemele neoliticului ın Romı-nia in lumina noilor cercetari (Bucuresti 1961).
Berciu 1966D. Berciu, Cultura Hamangia. Noi contributii (Bucuresti1966).
Bojadziev 2002J. Bojadziev, Die absolute Chronologie der neo- undaneolithischen Graberfelder von Durankulak. In: H. Todo-rova (Hrsg.), Durankulak, Band II, Teil I. Die prahistori-schen Graberfelder (Sofia 2002) 67–70.
Boric 2009D. Boric, Absolute Dating of Metallurgical Innovations inthe Vinca Culture of the Balkans. In: T. L. Kienlin/B. Ro-berts (Hrsg.), Metals and society. Studies in honour ofBarbara S. Ottaway (Bonn 2009) 191–245.
Brummack 2009S. Brummack, ,,Untersuchungen zur Chronologie undBeigabenstruktur im neolithischen und chalkolithischenGraberfeld von Durankulak‘‘ (unveroffentlichte Magister-Hausarbeit an der FU Berlin, 2009).
Cernakov 2009D. Cernakov, Rousse Tell, Guide book – Catalogue (Ruse2009).
Chohadzhiev 2007St. Chohadzhiev, Neolithic and Chalkolithic Cultures inthe Struma River Basin (Veliko Tarnovo 2007).
Comsa 1971E. Comsa, Donees sur la civilisation de Dudesti. Prahis-torische Zeitschrift 46, 1971, 195–249.
Comsa 1974E. Comsa, Istoria comunitatilor culturii Boian (Bucuresti1974).
Comsa 1987E. Comsa, Neoliticul pe teritoriul Romaniei – consideratii(Bucuresti 1987).
Csanyi/Raczky/Tarnoki 2009M. Csanyi/P. Raczky/J. Tarnoki, Elozetes jelentes a rezkoribodrogkereszturi kultura Rakoczifalva-Bagi foldon feltarttemetojerol. Preliminary report on the cemetery of theBodrogkeresztur culture excavated at Raoczifalva-Bagi-fold. Tisicum 38, 2009, 13–34.
Demoule 2007J.-P. Demoule (Hrsg.), La revolution neolithique en France(Paris 2007).
Dragomir 1983I. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul Romaniei. Aspectulcultural Stoicani-Aldeni (Bucuresti 1983).
Dumitrescu 1979V. Dumitrescu, Arta Culturii Cucuteni (Bucuresti 1979),
Ellis 1984L. Ellis, The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study in Tech-nology and the Origins of Complex Society BAR Interna-tional Series 217 (London 1984).
Gorsdorf/Bojadziev 1996J. Gorsdorf/J. Bojadziev, Zur absoluten Chronologie derbulgarischen Urgeschichte. Berliner 14C-Datierungen vonbulgarischen archaologischen Fundplatzen. Eurasia Anti-qua 2, 1996, 105–173.
Hansen u. a. 2004S. Hansen/A. Dragoman/N. Benecke/J. Gorsdorf/F. Klim-scha/S. Oanta-Marghitu/A. Reingruber, Bericht uber dieAusgrabungen in der kupferzeitlichen Tellsiedlung Ma-gura Gorgana bei Pietrele in Muntenien/Rumanien imJahre 2002. Eurasia Antiqua 10, 2004, 1–53.
Hansen u. a. 2005S. Hansen/A. Dragoman/A. Reingruber/I. Gatsov/J. Gors-dorf/P. Nedelcheva/S. Oanta-Marghitu/B. Song, Der kup-ferzeitliche Siedlungshugel Pietrele an der Unteren Do-nau. Bericht uber die Ausgrabungen im Sommer 2004.Eurasia Antiqua 11, 2005, 341–393.
Hansen u. a. 2006S. Hansen/A. Dragoman A. Reingruber/N. Benecke/I. Gat-sov/T. Hoppe/F. Klimscha/P. Nedelcheva/B. Song/J. Wahl/J. Wunderlich, Der kupferzeitliche Siedlungshugel Pietrelean der Unteren Donau. Bericht uber die Ausgrabungenim Sommer 2005. Eurasia Antiqua 12, 2006, 1–62.
Hansen u. a. 2008S. Hansen/M. Toderas/A. Reingruber/I. Gatsov/F. Klim-scha/P. Nedelcheva/R. Neef/M. Prange/T. D. Price/J. Wahl/B. Weniger/H. Wrobel/J. Wunderlich/P. Zidarov, Der kup-ferzeitliche Siedlungshugel Magura Gorgana bei Pietrelein der Walachei. Ergebnisse der Ausgrabungen im Som-mer 2007, Eurasia Antiqua 14, 2008, 19–100.
Hansen u. a. 2009S. Hansen/M. Toderas/A. Reingruber/N. Becker/I. Gatsov/M. Kay/P. Nedelcheva/M. Prange/A. Ropke/J. Wunderlich,Pietrele: Der kupferzeitliche Siedlungshugel ,,MaguraGorgana‘‘ und sein Umfeld. Bericht uber die Ausgrabun-gen und geomorhologischen Untersuchungen im Som-mer 2008. Eurasia Antiqua 15, 2009, 15–66.
Hasotti 1997Puiu Hasotti, Epoca neolitica ın Dobrogea (Constanta1997).
Higham u. a. 2007T. Higham/J. Chapman/V. Slavchev/B. Gaydarska/N. Honch/Y. Yordanov/B. Dimitrova, New perspectives on the Varnacemetery (Bulgaria) – AMS dates and social implicati-ons. Antiquity 81, 2007, 640–654.
Higham u. a. 2010T. Higham/R. Warren/A. N. Belinskij/H. Harke/R. Wood,Radiocarbon Dating, Stable Isotope Analysis, and Diet-Derived Offsets in 14C Ages from Klin-Yar Site, RussianNorth Caucasus. Radiocarbon 52, 2010.
Hranicky 2007W. J. Hranicky, Prehistoric projectile points found alongthe Atlantic coastal plain (Boca Raton, Florida 20072).
Ivanov 1992Ivan Ivanov, The Birth of European Civilisation (Sofia1992).
Kalchev 2005P. Kalchev, Neolithic Dwellings. Stara Zagora Town Ex-position Catalog (Stara Zagora 2005).
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.92
Kay n.d.M. Kay, The Ayn Abu Nukhayla 200. Report to Ayn AbuNukhayla, Jordan Project. Department of Anthropology,University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma.
Lazarova/Bozilova 2001
M. Lazarova/E. Bozilova, Studies on the Holocene his-tory of the vegetation in the Region of lake Srebama(northeast Bulgaria). Vegetation History and Archaeobo-tany 10, 2001, 87–95.
Lazarovici 2010aC.-M. Lazarovici, Cucuteni Ceramics: Technology, Typol-ogy, Evolution, and Aesthetics. In: D.W. Anthony undJ. Y. Chi (Hrsg.), The Lost World of Old Europe: TheDanube Valley, 5000–3500 BC (Princeton und Oxford2010) 128–161.
Lazarovici 2010bC.-M. Lazarovici, New data regarding the chronology ofthe Precucuteni, Cucuteni and Horodistea-Erbiceni cul-tures. In: P. Kalabkova/B. Kovar/P. Pavuk/J. Sutekova,Pantha Rhei. Studies in chronology and cultural devel-opment of the SE and Central Europe in earlier prehis-tory presented to Juraj Pavuk on the occasion of his 75.birthday (Bratislava 2010).
Lichardus/Lichardus-Itten 1993
J. Lichardus/M. Lichardus-Itten, Das Grab von RekaDevnja (Nordostbulgarien). Ein Beitrag zu den Beziehun-gen zwischen Nord- und Westpontikum in der fruhenKupferzeit. Sastuma 2 (Bonn 1993).
Lichardus u. a. 2000J. Lichardus/A. Fol/L. Getov/F. Bertemes/R. Echt/R. Katin-carov/I. K. Iliev, Forschungen in der Mikroregion vonDrama (Sudostbulgarien). Zusammenfassung der Haupt-ergebnisse der bulgarisch-deutschen Grabungen in denJahren 1983–1999 (Bonn 2000).
Marinescu-Bılcu 1974S. Marinescu-Bılcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul Ro-maniei (Bucuresti 1974).
Marinescu-Bılcu 1981
Tırpesti. From Prehistory to History in Eastern Romania.BAR International Series 107 (Oxford 1981).
Neagu 2003M. Neagu, Neoliticul Mijlociu la Dunarea de Jos cu privirespeciala asupra centrului Munteniei. Cultura si Civilizatiela Dunarea de Jos 20, 2003.
Nuzhnyi 1993D. Nuzhnyi, Projexctile weapons and technical progressin the Stone Age. In: P. C. Anderson, S. Beyries, M. Otteund H. Plisson (Hrsg.), Traces et function: les gestes ret-rouves, Volume 1, ERAUL 50 (Liege 1993) 41–53.
Palaguta 2007I. Palaguta, Tripolye Culture during the Beginning of theMiddle Period (BI). The relative chronology and localgrouping of the sites. BAR International Series 1666(Oxford 2007).
Pandrea 2002St. Pandrea, Debuts de la culture de Goumelnitsa aunord-est de la plaine Rounaine. In: Vladimir Dumitrescu100 de ani de la nastere. Cultura si Civilizatie la Duna-rea de Jos (CCDJ) 19, 2002, 122–146.
Paul 1992I. Paul, Cultura Petresti (Bucuresti 1992).
Rassamakin im DruckJu. Rassamakin, Die neuen 14C-Daten: zur absoluten Chro-nologie des Aneolithikums im Steppen-Schwarzmeerge-biet.
Reingruber 2007A. Reingruber, Mobilitat an der Unteren Donau in derKupferzeit: Pietrele im Netz des Warenverkehrs. DasAltertum 52, 2007, 81–100.
Reingruber 2010A. Reingruber, Wohnen und Wirtschaften auf dem Tell,,Magura Gorgana‘‘ bei Pietrele. In: S. Hansen (Hrsg.),Leben auf dem Tell als soziale Praxis. Berlin, 26.–27. Februar 2007 (Bonn 2010) 157–174.
Reingruber/Thissen 2009
A. Reingruber/L. Thissen, Depending on 14C Data: Chron-ological Frameworks in the Neolithic and Chalcolithic ofSoutheastern Europe. Radiocarbon 51, 2009, 751–770.
Ritter/Burcell 1998E. W. Ritter/Julie Burcell, Projectile Points from ThreeSisters’ Lagoons of West Central Baja California. In: Pa-cific Coast Archaeological Society Quarterly 34(4), 1998,29–66.
Schmidt 1932H. Schmidt, Cucuteni in der Oberen Moldau, Rumanien.Die befestigte Siedlung mit bemalter Keramik von derSteinkupferzeit bis in die vollentwickelte Bronzezeit(Berlin, Leipzig 1932).
Seeher 2007J. Seeher, Die Lehmziegel-Stadtmauer von Hattusa. Be-richt uber eine Rekonstruktion (Istanbul 2007).
Skakun 1993N. N. Skakun, Agricultural implements in the Neolithicand Eneolithic cultures of Bulgaria. In: P. C. Anderson,S. Beyries, M. Otte und H. Plisson (Hrsg.), Traces et func-tion: les gestes retrouves, Volume 2, ERAUL 50 (Liege1993) 361–368.
Slavcev 2002V. Slavcev, Die Beziehungen zwischen Durankulak, demBereich der Pracucuteni-Tripol’e-Kultur und der GruppeBolgrad-Aldeni. In: H. Todorova (Hrsg.), Durankulak,Band II, Teil I. Die prahistorischen Graberfelder (Sofia2002) 297–308.
Tantau u. a. 2009I. Tantau/M. Reille/J.L. Beaulieu/S. Farcas/S. Brewer, Ho-locene vegetation history in Romanian Subcarpathians.Quaternary Resaerch 72, 2009, 164–173.
Todorova 2002aChronologie, horizontale Stratigraphie und Befunde. In:H. Todorova (Hrsg.), Durankulak, Band II, Teil I. Die pra-historischen Graberfelder (Sofia 2002) 35–52.
Todorova 2002bH. Todorova, Die Sepulkralkeramik aus den Grabernvon Durnakulak. In: H. Todorova (Hrsg.), Durankulak,Band II, Teil I. Die prahistorischen Graberfelder (Sofia2002) 81–116.
Todorova 2002cH. Todorova (Hrsg.), Durankulak, Band II, Teil II. Dieprahistorischen Graberfelder (Sofia 2002).
Voinea 2005V. M. Voinea, Ceramica complexului cultural Gumelnita-Karanovo VI. Fazele A1 si A2 (Constanta 2005).
Pietrele 2009 93
Wahl 1981J. Wahl, Beobachtungen zur Verbrennung menschlicherLeichname. Archaologisches Korrespondenzblatt 11,1981, 271–279.
Weninger u. a. im DruckB. Weninger/A. Reingruber/S. Hansen, Konstruktion einesstratigraphischen Altersmodells fur die Radiocarbonda-ten aus Pietrele, Rumanien. In: P. Kalabkova/B. Kovar/P. Pavuk/J. Sutekova, Pantha Rhei. Studies in chronol-ogy and cultural development of the SE and Central Eu-
rope in earlier prehistory presented to Juraj Pavuk onthe occasion of his 75. birthday (Bratislava 2010).
Wiggermann 1996F. Wiggermann, Scenes from the Shadow Side. In:M. Vogelzang (Hrsg.), Mesopotamian Poetic Language:Sumerian and Akkadian (Groningen 1996) 206–230.
Zbenovic 1996V. G. Zbenovic, Siedlungen der fruhen Tripol’e-Kulturzwischen Dnestr und Sudlichem Bug. Archaologie in Eu-rasien 1 (Espelkamp 1996).
S v end Han senAga t h e Re i n g r ube rEurasien-Abteilung desDeutschen Archaologischen InstitutsIm Dol 2–6D-14195 Berlin
I v an Ga t s o vNational Archaeological Institute and Museum-BASNew Bulgarian University
P e t r a n k a Nede l c h e v aNew Bulgarian UniversityDepartment of ArchaeologyMontevideo 21; Corpus 2, Room 219BG-1618 Sofia
Ma r v i n Ka yDepartment of AnthropologyUniversity Of ArkansasFayetteville, AR 72701United States of America
D i r k Nowa c k iJ u r g e n Wunde r l i c h
Institut fur Physische GeographieJ. W. Goethe-Universitat
Campus RiedbergAltenhoferallee 1
D-60438 Frankfurt am Main
A s t r i d R o p k eJohann Wolfgang Goethe-Universitat
Institut fur Archaologische WissenschaftenLabor fur Archaobotanik
Gruneburgplatz 1D-60323 Frankfurt am Main
Meda Tode r a sInstitutul de Arheologie ,,Vasile Parvan‘‘
str. Henri Coanda 11RO-010667 Bucuresti
J o a ch im Wah lRegierungsprasidium StuttgartLandesamt fur Denkmalpflege
Arbeitsstelle Konstanz, OsteologieStromeyerdorfstr. 3D-78467 Konstanz
Zusammenfassung
Die bisherigen Ausgrabungen auf dem SiedlungshugelMagura Gorgana in Pietrele haben eine Vielzahl von Mate-rialien zur Rekonstruktion der wirtschaftlichen Grundlagenund der sozialen Organisation der fruhen Kupferzeit an derUnteren Donau erbracht, deren großes Potential sich erstdurch die geomorphologischen Untersuchungen zur Land-schaftsrekonstruktion sinnvoll erschließen lasst. Zahlreiche,bis zu 16 m tiefe Bohrungen zwischen Hochterrasse undDonau haben gezeigt, dass sich wahrend der kupferzeitli-chen Besiedlung auf dem Tell das Sedimentationsverhaltender Donau anderte. Dies kann mit zunehmenden anthropo-genen Eingriffen im Einzugsbereich der Donau erklart wer-den. Die starke Variabilitat der Sedimente zeigt an, dassdie Donauaue durch ein Nebeneinander von Stillwasser-bzw. Uberflutungsbereichen und sandigen Terrassenrestengepragt war. Doch erst nach Aufgabe des Siedlungsplatzeswurden im mittleren Holozan Hochflutsedimente abgela-gert, bis schließlich der gesamte Talboden von ausgedehn-ten Seen und sumpfigen Arealen bedeckt war.
Bereits 2005 stellte sich heraus, dass die Siedlungnicht allein auf den Wohnhugel begrenzt war, sondern
eine Art Außensiedlung umfasste, die erstmals im Sommer2009 erforscht werden konnte. In beiden bislang unter-suchten Arealen wurden Siedlungsspuren entdeckt: In derostlichen Flache G traten in der 60 cm dicken Kulturschicht39 restaurierbare Gefaße auf, die typologisch und tech-nologisch an den Beginn der Gumelnita-Kultur gehoren. Inder nordlich vom Tell gelegenen Flache J konnten die Resteeines verbrannten Gebaudes ausgegraben werden, das –ahnlich wie die Hauser vom Tell – neben einem Ofen aucheine Lehminstallation mit Mahlsteinen und zahlreicheBruchstucke großer Gefaße enthielt.
Auf dem Tell wurde im nordlichen Bereich in der ge-samten Flache B ein Niveau erreicht, in welchem nebenquadratischen Kasten auch zahlreiche Menschenknochenauftraten. Eine gezielte Knochenauswahl hinsichtlich ein-zelner Korperpartien lasst sich an den 38 Einzelknochennicht ablesen, sondern diese setzen sich nach dem Zufalls-prinzip zusammen. An dem verbrannten Gebaude in dersudlichen Flache F konnten architektonische Merkmale do-kumentiert werden, die prazisere Einblicke in die Art undWeise des Hausbaus aber auch der Gestaltung der Innen-einrichtungen mit einer Lehmbank und einer vierkammeri-gen Installation gewahren.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.94
Durch das Offnen großer Areale in der Außensied-lung wird 2010 das zeitliche und soziale Verhaltnis zumWohnhugel umfassender beleuchtet werden konnen. Auchdie Zeitstellung der Kreisgrabenanlage auf der Terrassewird durch gezielte Schnitte untersucht werden.
Rezumat
Sapaturile efectuate pana ın momentul de fata ın tell-ulaflat pe Magura Gorgana, ın hotarul satului Pietrele, auscos la iveala o cantitate remarcabila de materiale careservesc la reconstituirea bazelor economice si a organizariisociale din epoca timpurie a cuprului la Dunarea de Jos;marele potential stiintific al acestor rezultate se contureazaınsa ın mod judicios de-abia prin cercetarile geomorfolo-gice efectuate pentru reconstituirea peisajului. Numeroaseforaje, atingand adancimi de pana la 16 m, realizate ıntreterasa ınalta si Dunare, au aratat ca ın decursul locuirii dinepoca cuprului de pe tell s-a schimbat situatia sedimente-lor Dunarii. Aceasta evolutie poate fi explicata prin inter-ventiile antropogene tot mai accentuate din bazinul fluviu-lui. Marea variabilitate a sedimentelor ne arata ca luncaDunarii era caracterizata de existenta concomitenta a zo-nelor cu apa statatoare, respectiv a zonelor inundabile sia portiunilor ocupate de catre terasele de nisip. S-a pututınsa constata ca de-abia dupa abandonarea arealului locuits-au depus, ın cursul holocenului mijlociu, sedimente deinundatii (de mare anvergura) pana cand tot terenul vaii afost acoperit de lacuri ıntinse si de areale mlastinoase.
Inca din anul 2005 s-a remarcat faptul ca asezareanu era limitata doar la suprafata tell-ului, ci ca ea cuprin-dea si un fel de locuire exterioara, care a putut fi investi-gata pentru prima data ın vara anului 2009. In cele douaareale explorate pana acum, au fost descoperite urme deasezare: ın suprafata G, amplasata ın est, au aparut ınstratul de cultura cu o grosime de 60 cm, 39 de vase res-taurabile, care apartin din punct de vedere tipologic sitehnologic ınceputului culturii Gumelnita. In suprafata J,trasata la nord de tell, au putut fi sapate ramasitele uneicladiri distruse de incendiu, care – asemenea caselor depe tell – contineau alaturi de cuptor si o amenajare dinlut cu rasnite si nenumarate fragmente provenind de lavase mari.
Pe tell a fost atins, ın arealul nordic, pe toata supra-fata B un nivel ın care alaturi de casete patrate, au aparutsi numeroase oase umane. In cazul celor 38 de oase izo-late nu s-a putut sesiza o alegere intentionata de catreoamenii preistorici a unor parti specifice ale corpului, se-lectia oaselor petrecandu-se mai degraba ıntr-un mod ın-tamplator. La casa distrusa de incendiu din suprafata F,plasata ın sud, au putut fi documentate elemente arhitec-tonice, care permit observatii mai precise referitoare lamodalitatile de construire ale edificiului, dar si la aranja-mentul interiorului cu o banca din lut si cu o instalatie dinlut ımpartita ın patru compartimente.
Prin deschiderea, ın asezarea exterioara, ın anul2010 a unor suprafete de sapatura extinse se va puteaıntelege ın mod mai cuprinzator raportul cronologic si so-cial al acesteia fata de tell. De asemenea va fi cercetata siplasarea cronologica a amenajarii cu sant circular de peterasa prin trasarea unor sectiuni cu destinatii bine preci-zate.
Summary
Excavations conducted thus far at the settlement moundof Magura Gorgana in Pietrele (Romania) have broughtforth a huge amount of material that enables the recon-struction of the economic basis and the social organisa-tion of the early Copper Age on the lower Danube River.Recent geomorphological investigations have supplemen-ted this potential wealth of information so that now a rea-sonable reconstruction of the landscape can be made. Nu-merous drillings reaching up to 16 m in depth were carriedout in the area between the high terrace and the Danube.They show that during the Copper Age habitation of thetell, there was a change in the course of sedimentation ofthe river. The alterations can be explained by the increas-ing anthropogenic interventions in the catchment area ofthe Danube. The strong variation in sediments indicatesthat the Danube riverine meadows at that time were char-acterised by the close proximity of areas of standing waterand/or inundation and sand terraces. Only after the settle-ment site had been abandoned, could sediments fromhigh water and floods accumulate during the middle Holo-cene, until ultimately the entire river valley was coveredextensively with bodies of water and swamps.
Field work in 2005 already revealed that habitationwas not limited to the settlement mound alone, but wasalso present in the form of an outer settlement that wasinvestigated in the summer of 2009. Traces of settlementwere discovered in both investigated areas: In the easterntrench G, 39 restorable vessels were found in the 60-cmthick cultural layer, which typologically and technologicallycan be assigned to the beginning Gumelnita culture. Intrench J to the north of the tell, remains of a burnt build-ing were excavated, which like the houses on the tell hada clay installation with grinding stones and numerous frag-ments of large vessels.
In the northern part of the tell itself a level wasreached in all of trench B, in which the outline of rectan-gular structures were visible on the surface and numeroushuman bones were found as well. An intentional choice ofbones from specific parts of the body was not recognisa-ble among the 38 individual bones; instead they appearedto be a random selection. Architectural features of theburnt building in the southerly trench F could be docu-mented, which allow more precise insight into the mannerand method of house construction as well as the interiorarrangements, for example, with a clay bench and an in-stallation with four compartments.
Excavation in 2010 will open a larger area in theouter settlement, which should enable a more comprehen-sive picture of its temporal and social relationship to thetell. Also, the temporal position of the circular-ditch com-plex will be investigated by means of purposefully locatedtrenches that cut these anomalies.
—$#%"$
´ &(@#º5$-$( -&ı(;º;ªŁO(æŒŁı &-æŒ;:;Œ =- ı;º?( ––:;æ(º(=ŁŁ 3-ª#&- ˆ;&ª-=- # æ(º- ˇŁ($&(º( Æߺ; :;º#-O(=; Æ;º5ł;( Œ;ºŁO(æ$+; *-==ßı, *-2øŁı +;@?;B=;æ$5&(Œ;=æ$&#Ł&;+-$5 4Œ;=;?ŁO(æŒ#2 Æ-@# Ł æ;!Ł-º5=#2
Pietrele 2009 95
æ$&#Œ$#&# 4:;ıŁ &-==(Ø ?(*Ł =- ˝ŁB=(? ˜#=-(, - :;:&;+(*‚==ß? ª(;?;&";º;ªŁO(æŒŁ? Łææº(*;+-=Ł'? Æß-º- :&(*:&Ł='$- :;:ß$Œ- &(Œ;=æ$&#Œ!ŁŁ º-=*ł-"$-*-==;ª; &(ªŁ;=- + Ł=$(&(æ#2ø#2 =-æ 4:;ı#. 3-$(&Ł-º,:;º#O(==ßØ Ł@ ?=;ª;OŁæº(==ßı Æ#&;+ßı æŒ+-BŁ= ªº#-ÆŁ=;Ø *; 16 ?, @-º;B(==ßı =- $(&&Ł$;&ŁŁ ?(B*# +ßæ;-Œ;Ø $(&&-æ;Ø Ł ˜#=-(? :;Œ-@-ºŁ, O$; =-OŁ=-' æ 4:;ıŁ?(*Ł, Œ Œ;$;&;Ø Ł ;$=;æŁ$æ' :;æ(º(=Ł(, æ$&#Œ$#&- &(O-=ßı ;$º;B(=ŁØ @=-OŁ$(º5=; Ł@?(=Łº-æ5. .$;, :; +Ł*Ł-?;?#, Æߺ; +ß@+-=; -=$&;:;ª(==ß? +?(ł-$(º5æ$+;? +4Œ;æŁæ$(?# ˜#=-'. —(@Œ-' Ł@?(=OŁ+;æ$5 ;æ-*;O=ßı:;&;* ;Æœ'æ='($æ' $(?, O$; :;Ø?- ˜#=-' ;Æ&-@;+-º-æ5+æº(*æ$+Ł( @-$;:º(=Ł' ;$&(@Œ;+ :(æO-=ßı $(&&-æ. ˛*-=-Œ;, $;º5Œ; + æ&(*=(? ª;º;!(=(, #B( :;æº( $;ª;, Œ-Œ:;æ(º(=Ł( Æߺ; :;ŒŁ=#$;, ;æ-*;O=ß( =-=;æß ;$ &-@-ºŁ+- &(ŒŁ :&Ł+(ºŁ Œ @-Æ;ºaOŁ+-=Ł2 ?(æ$=;æ$Ł Ł ;Æ&--@;+-=Ł2 ;ÆłŁ&=ßı ;@‚& =- +æ(Ø $(&&Ł$;&ŁŁ *;ºŁ=ß.
HB( +; +&(?' &-æŒ;:-Œ 2005ª. +ß'æ=Łº;æ5, O$;:;æ(º(=Ł( =( ;ª&-=ŁOŁ+-º;æ5 ºŁł5 BŁºß? ı;º?;?, -:&;æ$Ł&-º;æ5 Ł @- (ª; :&(*(ºß. ¸($;? 2009 ª;*- $-?Æߺ; @-º;B(=; *+- &-æŒ;:-, + Œ;$;&ßı ÆߺŁ =-Ø*(=ßæº(*ß :;æ(º(=Ł'. ´ +;æ$;O=;? &-æŒ;:( G, + Œ#º5$#&-=;? æº;( $;ºøŁ=;Ø 60 æ?, ÆߺŁ ;Æ=-&#B(=ß 39 :;**--2øŁıæ' &(æ$-+&-!ŁŁ æ;æ#*-, ;$=;æ'øŁıæ' :; $Ł:;º;-ªŁO(æŒŁ? Ł :; $(ı=;º;ªŁO(æŒŁ :&Ł@=-Œ-? Œ =-O-º5=;?#4$-:# Œ#º5$#&ß ˆ#?(º5=Ł!-. ´ &-æ:;º;B(==;? Œ æ(+(&#;$ $(ºº' &-æŒ;:( J ÆߺŁ ;Æ=-&#B(=ß ;æ$-$ŒŁ æª;&(+-
ł(ª; @*-=Ł', + Œ;$;&;?, Œ-Œ Ł + @*-=Ł'ı =- æ-?;?$(ºº(, &'*;? æ :(O52 =-ı;*Łºæ' ªºŁ='=ßØ :;?;æ$, =-Œ;$;&;? º(B-ºŁ @(&=;$‚&ŒŁ, - $-ŒB( ?=;ª;OŁæº(==ß("&-ª?(=$ß Æ;º5łŁı :; &-@?(&-? Œ(&-?ŁO(æŒŁı æ;æ#-*;+.
´ æ(+(&=;Ø O-æ$Ł $(ºº' =- +æ(Ø :º;ø-*Ł &-æ-Œ;:- B Æߺ *;æ$Łª=#$ ª;&Ł@;=$, =- Œ;$;&;?, =-&'*# æ?=;ª;OŁæº(==ß?Ł Œ+-*&-$=ß?Ł æ$&#Œ$#&-?Ł, ÆߺŁ =-Ø-*(=ß O(º;+(O(æŒŁ( Œ;æ$Ł. ˇ&Ł Łı Ł@#O(=ŁŁ +ß'æ=Ł-º;æ5, O$; 38 ;Æ=-&#B(==ßı Œ;æ$=ßı "&-ª?(=$- =( :&Ł-=-*º(B-$ Œ Œ-Œ;Ø-ºŁÆ; ;:&(*(º‚==;Ø O-æ$Ł æŒ(º($- Ł,æº(*;+-$(º5=;, =;æ'$ æŒ;&(( æº#O-Ø=ßØ, O(? æŁæ$(?--$ŁO(æŒŁØ ı-&-Œ$(&. ˛Æ=-&#B(==ß( + 2B=;Ø O-æ$Ł &-æ-Œ;:- F ;æ$-$ŒŁ :;ªŁÆł(Ø ;$ :;B-&Łø- :;æ$&;ØŒŁ *-ºŁ+;@?;B=;æ$5 :;º#OŁ$5 Æ;º(( $;O=;( :&(*æ$-+º(=Ł( =($;º5Œ; ; Œ;=æ$&#Œ!ŁŁ :;?(ø(=Ł', =; Ł ; (ª; +=#$&(=-=(? #æ$&;Øæ$+(, + O-æ$=;æ$Ł ; ªºŁ='=;? :;?;æ$( Ł ;O($ß&‚ıŒ-?(&=;Ø æ$&#Œ$#&( Ł@ $;ª;-B( ?-$(&Ł-º-.
˙-:º-=Ł&;+-==ß( =- 2010 ª;* ;ÆłŁ&=ß( &-æŒ;:-ŒŁ +=(ł=(ª; :;æ(º(=Ł' *-*#$ +;@?;B=;æ$5 :;º#OŁ$5+æ(;Æœ(?º2ø(( :&(*æ$-+º(=Ł( ; æ;;$=;ł(=ŁŁ – Œ-Œ +æ;!Ł-º5=;?, $-Œ Ł + ı&;=;º;ªŁO(æŒ;? :º-=( – ?(B*#+=#$&(==Ł? Ł +=(ł=(? :;æ(º(=Ł'?Ł. ˙-:º-=Ł&;+-=;$-ŒB( Łææº(*;+-=Ł( &-æ:;º;B(==;ª; =- $(&&-æ( :--?'$=ŁŒ- – «Œ;º5!(+ßı Œ-=-+» – :#$‚? :º-=;?(&=;Ø@-Œº-*ŒŁ =- =(? =(æŒ;º5ŒŁı &-æŒ;:;+.
S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber u. a.96