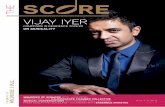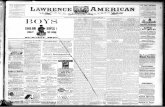Aufschlüsse und Bohrungen in der Altstadt von Schwäbisch Hall
-
Upload
uni-heidelberg -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Aufschlüsse und Bohrungen in der Altstadt von Schwäbisch Hall
Redaktion: Gabriete Süsskind und Britta Rabold Herstellung: Siegtried Fischer
Die Deutsche Bibliothek- CIP-Einheitsaufnahme
Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg ... lhrsg. vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg . .. -Stuttgart: Theiss
Erscheint jährl. 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 (1994)
Umschlagbild: Freiberg-Beihingen. Goldene Filigranscheibenfibel (Durchmesser 6,5 cm) aus einem fränkischen Adelsgrab; Mitte 7. Jh. n. Chr.
Gedruckt auf Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff
© Konrad Theiss Verlag GmbH & Co., Stuttgart 1994 ISBN 3-8062-1118-3 ISSN 0724-8954 Alle Rechte vorbehalten Gesamtherstellung: Grafische Betriebe Süddeutsche Zeitungsdienst, Aalen Printed in Gennany
Inhalt
Vorwort 5 Fortsetzung der Sondagen in der endneolithischen Moorsiedlung Seekirch-Stockwiesen,
Verzeichnis der Autoren 13 Kreis Biberach (H. Schlichtherle) 57
Das Archäologische Landesmuseum BadenWürttemberg im Jahre 1993 (D. Planck, J. Heiligmann) 17
Neue jungpaläolithische Funde aus dem H~hle Fels bei Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (A. Scheer) 24
Eine mesolithische Stratigraphie in Auelehmen bei Rottenburg, Kreis Tübingen (C.-J. Kind) 27
Die ersten 14-C-Daten aus der ältestbandkeramischen Siedlung in Rottenburg a. N., Kreis Tübingen (H. Reim) 31
Zum Abschluß der Ausgrabungen beim Viesenhäuser Hof, Stuttgart-Mühlhausen (G. Kurz) 34
Siedlungsreste der Hinkelstein- und Großgartaeher Kultur bei Heilbronn-Neckargartach, »Böllinger Höfe« (J. Biel) 38
Abschluß der Grabungen am Erdwerk der Michelsberger Kultur in Bruchsal, Landkreis Karlsruhe (R.-H. Behrends) 41
Nachuntersuchungen in der Schussemieder Siedlung Alleshausen-Hartöschle im nördlichen Federseeried, Kreis Biberach (M. Strobel, P. Schweizer, U. Maier) 47
Sechzig Jahre danach: Neues vom Goldberg, Riesbürg-Goldburghausen, Ostalbkreis (A. Zeeb) 54
Zum Stand der taucharchäologischen Untersuchungen im Steeger See bei Aulendorf, Kreis Ravensburg (J. Köninger, H. Schlichtherle) 61
Zum vorläufigen Abschluß der Ausgrabungen in Hornstaad-Hörnle, Kreis Konstanz (B. Dieckmann, R. Vogt) 67
Nußdorf-Strandbad - Die Tauchsoorlagen 1992 und 1993 in der Horgener Siedlung westlich der Liebesinsel, Überlingen-Nußdorf, Bodenseekreis (J. Köninger, H. Schlichtherle)
73
Taucharchäologische Untersuchungen 1m Zuge von , Erosionsschutzmaßnahmen in der Pfahlbaubucht von Sipplingen , Bodenseekreis (M. Kolb, H. Schlichtherle) 78
Ein Gräberfeld der Urnenfelderzeit in Mannheim-Sandhofen, Scharhof (H. P. Kraft, A. Wieczorek, R.-H. Behrends) 83
Eine Siedlungsgrube mit reichhaltigen Keramik-, Botanik- und Tierknochenresten der späten Urnenfelderkultur in Knittlingen, Enzkreis (E. Schallmayer) 87
Rettungsgrabungen im Taubertal bei Distelhausen, Stadt Tauberbischofsheim , MainTauber-Kreis (R. Krause) 89
Spätbronzezeitliche Gräber bei Unterbaibach im Taubertal, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis (R. Krause) 91
9
Ein Steinhügel bei Burladingen-Melchingen, Zollernalbkreis (S. Oberrath) 95
Abschließende Untersuchungen in Eberdingen-Hochdorf, Kreis Ludwigsburg (J. Biel)
97
Zwei Bestattungen der Hallstattzeit bei Nonnenweier, Ortenaukreis (H. J. Behnke) 99
Siedlungsfunde der Hallstattzeit von Forchheim, Kreis Emmendingen (Cbr. Maise) 102
Fortführung der Grabungen im Fürstengrabhügel (Hügel 3) von Kappel a. Rh., KappelGrafenhausen, Ortenaukreis (R. Dehn) 106
Ein späthallstattzeitliches Fürstengrab von Ihringen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (R. Dehn) 109
Ein befestigtes Gehöft der Spätlatenezeit bei Heilbronn-Neckargartach (J. Briel) 112
Archäologische Begehungen im Oppidum Heidengraben, Gemeinde Grabenstetten, Kreis Reutlingen (M. K. H. Eggert, Th. Hopp~ 1M
Zur Viereckschanze »Klinge« bei Riedlingen, Kreis Biberach (F. Klein) 119
Aufschlüsse und Bohrungen in der Altstadt von Schwäbisch Hall (E. Fischer, M. Rösch)
121
Latenezeitliche Eisenerzverhüttung mit Grubenöfen in LieVKarlshof, Gemeinde Schliengen, Kreis Lörrach (A. Deffner, G. Gassmann) 125
Eine Siedlung der Neckarsueben in Heidelberg-Kirchheim (R. Ludwig) 126
10
Spuren eines römischen Militärstützpunktes auf dem Rettig in Baden-Baden (P. Knierriem, E. Löhnig, E. Schallmayer) 129
Elektro- und geomagnetische Prospektion des Welzheimer Ostkastells, Rems-Murr-Kreis (H. v. d. Osten) 135
Die römische Stadtmauer von Ladenburg und andere Aspekte des antiken LOPODVNVM, Rhein-Neckar-Kreis (C. S. Sommer, M. G. Meyer, H. Schaeff) 140
Neues zur Stadtmauer von Sumelocenna, Rottenburg, Kreis Tübingen (H. Reim) 147
Untersuchungen im römischen und mittelalterlichen Rottweil (C. S. Sommer) 151
Archäologische Ausgrabungen im römischen Kastellvicus bei Burladingen, Zollernalbkreis (H. Reim) 154
Neues zum römische9 Vicus Grinario-Köngen, Kreis Esslingen (D. Planck) 158
Abschließende Ausgrabungen in der Heidenbeimer Ploucquetstraße (B. Rabold) 162
Letzte Spurensicherung im Areal der einstigen Brauerei Neff, Heidenheim (B. Rabold) 167
Zu den Grabungen im römischen Lahr-Dinglingen, Ortenaukreis (G. Fingerlin) 172
Grabungen in Ettlingen, Landkreis Karlsruhe - Neue Aufschlüsse zur Römerzeit und zum Mittelalter in der Altstadt (E. Schallmayer)
175
Der Gesamtplan der Villa urbana von Heitersheim, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (H. Allewelt, K. Kortüm, H. U. Nuber) 181
Ein römischer Gutshof bei Herbolzheim, Kreis Emmendingen (D. Rothacher) 185
Villa rustica in Obemdorf-Bochingen, Kreis Rottweil (C. S. Sommer) 190
Wohnbau- Bad- Refugium(?): GebäudeS in Sontheim/Brenz, Kreis Heidenheim (H. U. Nuber, G. Seitz) 192
Ein zweites Gräberfeld und weitere Grabbauten in Sontheim/Brenz >>Braike<<, Kreis Heidenheim (A. Hagendorn, H. U. Nuber, J. Scheuerbrandt) 198
Ausgrabungen im Gutshof von HechingenStein, Zollemalbkreis (S. Schrnidt-Lawrenz)
202
Die Villa rustica in Ohmberg bei Öhringen, Hohenlohekreis (H. v. d. Osten) 205
Frühalamannische Siedler in einem römischen Gutshof bei Wurmlingen, Kreis Tutdingen (G. Fingerlin) 207
Zum Abschluß der vor- und frühgeschichtlichen Siedlungsgrabungen im Neuseser Tal bei lgersheim, Main-Tauber-Kreis (R. Krause) 210
Eine langobardische Gürtelgarnitur aus dem Reihengräberfeld von Deißlingen, Kreis Rottweil (G. Fingerlin) 214
Das Reihengräberfeld von Bad SchönbornMingolsheim, Landkreis Karlsruhe (K. Banghard) 217
Ein Reihengräberfeld von Illingen, Enzkreis (R.-H. Behrends) 220
Zur Fortsetzung der Untersuchung des fränkischen Gräberfelds in Beihingen, Stadt Freiberg am Neckar, Kreis Ludwigsburg (1. Stork)
223
Neue Siedlungsstrukturen und Holzbefunde in Lauchheim, Ostalbkreis (I. Stork) 227
Neue Untersuchungen im Friedhof und der Siedlung >>Beim alten Kirchhof<< von Leonberg-Eitingen, Kreis Böblingen (Chr. Moll, I. Stork) 231
Funde aus einem frühmittelalterlichen Handwerkerareal in der Bäderstraße in Neuhausen, Kreis Esslingen (U. Gross) 235
Untersuchungen zur Siedlungsgeschichte von Herrenberg-Kuppingen, Kreis Böblingen (S. Amold) 239
Grabungen im Bereich des Kirchhofs in Schwieberdingen-Vöhingen, Kreis Ludwigsburg (S. Arnold) 242
Ein erwähnenswerter Siedlungsbefund aus Leonberg-Höfingen, Kreis Böblingen (S. Arnold) 245
Ein Beitrag zur Frühgeschichte von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (D. Lutz, U. Gross) 248
Neufunde aus der Töpferei der rotbemalten Feinware in Remshalden-Buoch, Rems-MurrKreis (U. Gross) 253
Nachuntersuchungen in der Ruine Waidenburg, Stadt Neuenbürg, Enzkreis (D. Lutz, U. Gross) 255
11
Bauarchäologische Dokumentation an der Kapelle St. Ulrich am Glöcklehof in Bad Krozingen-Oberkrozingen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (M. Untermann) 261
Zur Auswertung der Klostergrabung von 1958 in St. Georgen im Schwarzwald, SchwarzwaldHaar-Kreis (St. Westphalen) 265
Baugeschichtliche Beobachtungen in der ev. Kirche in Neckargemünd, Rhein-NeckarKreis (D. Lutz) 268
Feinstratigraphie mit römischen Funden am alten Seerheinufer in Konstanz (M. Dumitrache) 271
Zum Abschluß der Untersuchungen auf dem Münsterplatz in Ulm (A. Bräuning) 273
Hochmittelalterliche Siedlungsreste im Bereich der Metzgergasse in Tübingen (E. Schmidt) 277
Archäologische Beobachtungen im Sanierungsgebiet Gänsbühl in Ravensburg (E. Schmidt) 282
Archäologische Untersuchungen im Konstanzer Neugasse-Viertel (M. Dumitrache) 285
Mittelalterliche Keramik aus einer Latrine und einem Töpferofen in Schwäbisch Hall (U. Gross, M. Weihs) 297
Bauarchäologische Untersuchungen im Gebäude Stadelgasse 1 in Ravensburg (E. Schmidt) 300
Die ehemalige Michaelskapelle in Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis (M. Weihs) 305
Mittelalterliche Eisenverhüttung bei Prickenhausen, Kreis Esslingen, und Metzingen, Kreis Reuttingen (M. Kempa) 308
Montanarchäologische Ausgrabungen im Bergbaurevier Sulzburg, Kreis BreisgauHochschwarzwald (C. Pause, S. Spiong, S. Stelzle-Hüglin, H. Steuer) 314
Mittelalterliche Bleierzverhüttungen in Bollschweil, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (M. Siebenschock. H. Wagner) 320
Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Verhüttung von Antimonerzen bei Sulzburg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (G. Goldenberg, M. Siebenschock. H. Wagner) 323
Fundmünzen aus Württemberg (U. Klein) 328
Die Geschichte einer Parzelle, Untersuchun- Ortsregister 339 gen in der Apothekergasse 3 in Heidelberg (Chr. Balharek, D. Lutz) 293 Bildnachweis 345
12
Aufschlüsse und Bohrungen in der Altstadt von Schwäbisch Hall
Im Herbst 1993 ließ die Telekom auf dem »Platz hinter der Post« in Schwäbisch Hall, unmittelbar an der Nordwestecke des Postgebäudes, eine Grube für den Neubau eines Verteilerkastens ausheben. Dabei traten archäologische Befunde zutage, und das Landesdenkmalamt wurde eingeschaltet. Das Vorfinden geschichtsträchtigen Untergrundes konnte in der Altstadt von Schwäbisch Hall keineswegs überraschen. Als bedeutende und schon früh durch Salzgewinnung und Salzhandel zu Wohlstand gekommene frühere Freie Reichsstadt sollte sie die Spuren ihrer großen, mittelalterlichen Vergangenheit im Boden bewahrt haben. Zudem waren im Jahre 1939 beim Neubau der Kreissparkasse südlich der Post in einer Entfernung von nur 30 m bereits reiche archäologische Befunde und Funde zutage getreten und auch untersucht worden. Die tiefsten archäologischen Horizonte waren dabei in Tiefen bis zu 7 m unter der Oberfläche angeschnitten und aufgrund datierender archäologischer Funde in die Latenezeit gestellt worden. Die Befunde, teilweise mit unverkohlten Hölzern, wurden als keltische Salzsiede-AnJage gedeutet. Damit wurde eine Nutzung der Haller Salzquellen seit keltischer Zeit belegt. Es wurden damals auch Pflanzenreste beobachtet und entnommen. Ein Teil davon lag dem Pionier der Archäobotanik in Württemberg, Karl Bertsch, zur Untersuchung vor. Er identifizierte Getreidekörner von Hafer und Gerste, Fruchtsteine von Pflaumen, Süßkirschen, Schlehen und Himbeere, Nüßchen der Walderdbeere sowie Traubenkerne, die er der Wilden Weinrebe (Vitis sylvestris), einer Auenwald-Liane zuwies. Seinerzeit verfolgte die Archäologie andere Fragestellungen als heute mit anderen Methoden. Inzwischen sind umwelt-und wirtschafts-
geschichtliche Fragen in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, die hauptsächlich mit naturwissenschaftlichen Methoden angegangen werden. Hierbei kommt Ablagerungen mit Feuchterhaltung von organischem Material für die bioarchäologische Forschung eine besondere Bedeutung zu. Die Brisanz dieses Bodeneingriffs auf dem »Platz hinter der Post<< und die Chance, hier an ein für die keltische Zeit einmaliges Material heranzukommen , wurde zwar sofort erkannt, die praktische Umsetzung erwies sich jedoch als schwierig: Eine systematische Ausgrabung auf einer Grundfläche von etwa 5 x 5 m bis in eine Tiefe von knapp 8 m wäre technisch sehr aufwendig geworden und war aus organisatorischen und finanziellen Gründen kurzfristig nicht zu verwirklichen . Das zeichnete sich spätestens ab , als in einer kleinen Sondage ein 1,3 m mächtiges Profil in den mittelalterlichen Ablagerungen aufgenommen und beprobt werden konnte . Dieses Profil reichte bis zur Sohle der Baugrube, 3,8 m unter dem Gehniveau. Darüber lagen 2,5 m neuzeitliche Auffüllungen. Diese anstehenden mittelalterlichen Ablagerungen waren sehr steinig und relativ trocken, enthielten aber Tierknochen und unverkohlte Pflanzenreste in großer Menge und bestem Erhaltungszustand. Das war bereits vor Ort zu beobachten und wurde durch die ersten Analysen bestätigt. Nachdem an diesem Punkt die Grabungen abgebrochen werden mußten, wurde von der Sohle der Baugrube aus eine Bohrung mit einem Stechrohr-Kolbenbohrer abgeteuft. Dieses Gerät ist eigentlich für Bohrungen in limnischen oder marinen Lockersedimenten bestimmt, die keine Steine enthalten und bei geringer Lagerdichte und hohem Wassergehalt leicht zu durchteufen sind. So mußte die Boh-
121
rung mit 2,2 m Kerngewinn in einer Tiefe von 5 m unter Pflaster wegen unüberwindlichen Bohrwiderstandes abgebrochen werden. Aufgrund der Beobachtungen von Emil Kost im Jahre 1939 konnte man nicht davon ausgehen, daß in 5 m Tiefe bereits der anstehende Muschelkalk erreicht war. Zur Klärung des Problems und zum Gewinn eines vollständigen Profils wurde die Baustoff- und Bodenprüfstelle des Regierungspräsidiums Stuttgart um Amtshilfe zur Durchführung einer technischen Bohrung gebeten. Am 5. November rückte ihr Bohrteam mit schwerem Gerät an, und es gelang, eine Rammkern-Bohrung bis 7,8 m unter das Pflaster abzuteufen, wo bei 273,3 m ü. NN der anstehende Muschelkalk erreicht wurde. Das Profil besteht durchgehend aus dunklen, humosen, steinigen, nach unten zusehends feuchter werdenden Kulturschichten mit zahlreichen organischen Resten. Eine genaue Zeiteinstufung ist derzeit noch nicht möglich, doch läßt der Vergleich mit den Untersuchungen von Kost die keltischen Schichten nahe der Profilbasis etwa 7 m unter Pflaster erwarten. Darüber folgen dann mächtige mittelalterliche Ablagerungen. Die gewonnenen Bohrkerne werden nun im Labor für Archäobotanik wissenschaftlich untersucht und ausgewertet. Dies geschieht hauptsächlich mit den Methoden der Pollenanalyse und der botanischen Großrestanalyse. Erste Ergebnisse aus den mittelalterlichen Schichten liegen bereits vor. Aus der großen Zahl nachgewiesener Pflanzen seien einige bemerkenswerte Arten herausgegriffen. 24 Nutzpflanzenarten geben Einblick in Speisezettel und Alltag der mittelalterlichen Stadt. Dabei sind diese Nachweise vorläufig lediglich als Hinweise auf örtlichen Anbau und Nutzung dieser Arten zu sehen, die sich durch den Vergleich mit anderen Fundplätzen und mit historischen Quellen untermauern lassen. Für den sicheren Nachweis von Art und Umfang der
122
Abb. 66 Schwäbisch Hall, Hinter der Post. Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opu/us), Steinfrucht, Originallänge 8,3 mm
Nutzung bestimmter Pflanzen, insbesondere wildwachsender, bedarf es weiterer Untersuchungen. Mit Hafer, Roggen und Einkorn wurden bislang drei Getreidearten gefunden. Der Ge-
Abb. 67 Schwäbisch Hall. Hinter der Post. Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis), Nüßchen, größter Durchmesser des Originals 3,8mm
baute Lein war einerseits Nahrungspflanze, andererseits -und hier lag wohl seine Hauptbedeutung - Lieferant pflanzlicher Fasern als Grundlage zur Textilherstellung. In der Rubrik Gemüse/Gewürze trug die Linse als Hülsenfrucht wesentlich zur Versorgung mit pflanzlichein Eiweiß bei. Die Sellerie- seit römischer Zeit im Land bekannt- kann als Wurzel- oder Blattgemüse, aber auch als Gewürz oder Heilpflanze verwendet werden. Der Fuchschwanz (Amaranthus blitumlgraecizans) ist heute als Gemüse nicht mehr gebräuchlich. Während die vorgenannten Arten in Gärten kultiviert wurden, konnte man die als Würze verwendeten Beeren des Wacholders in den Wäldern sammeln. Dort war dieser bewehrte Strauch häufig zu finden, denn die Wälder waren infolge der Waldweide und ungeregelter Holznutzung licht und in schlechtem Zustand. Wenn es um Obst und Nüsse ging, stand der Haller Bevölkerung ein breitgefächertes Angebot zur Verfügung, das vermutlich bislang nur teilweise erlaßt wurde. An kultivierten Arten sind dies Walnuß, Apfel, Birne, Süßkirsche und Pflaume, an wildwachsenden und gesammelten Arten Weißdorn, Wald-Erdbeere, Judenkirsche (Physalis alkekengi), Schlehe, Eichel (Quercus spec.), Hagebutte (Rosa div. spec), Brombeere, Himbeere und Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus, Abb. 66). Die Blutwurz (Potentilla erecta), eine Fingerkraut-Art feuchter, sauerer, humoser Böden in Heiden und lichten Wäldern, hat einen rötlichen Wurzelstock, reich an Bitterstoffen. Der alkoholische Auszug ist als Magenbitter beliebt. Vor der Erfindung synthetischer Farbstoffe färbte man Textilien u. a. mit Naturfarben, die großenteils aus Pflanzen gewonnen wurden. Eine solche Färbepflanze ist der Färber-Wau (Reseda luteola). Seine blühenden Triebe liefern einen gelben Farbstoff, deshalb wurde er früher auch angebaut. Wild wächst er in Unkrautfluren auf trockenen Bö-
den, an Wegrändern usw. Von den zahlreichen Wildpflanzen seien nur wenige erwähnt. Aus der großen Gruppe der Acker- und Gartenunkräuter, die überwiegend als Nahrungsabfälle oder Nahrungsbeimengungen abgelagert worden sind, sind das Kornblume ( Centourea cyanus) und Kornrade (Agrostemma githago) , Stinkende und Acker-Hundskamille (Anthemis cotula und A. arvensis), Acker-Frauenmantel (Aphanes arvensis/microcarpa) , Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis) , Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis, Abb. 67), Gefurchter Feldsalat (Valerianella rimosa) und Breitblättrige Wolfsmilch (Euphorbia platyphyllos). Diese Arten sind heute durch erfolgreiche Maßnahmen der Unkrautbekämpfung in Garten- und Feldbau sehr selten geworden und gelten als bedroht. Kornrade, Frauenmantel, Feldsalat und AckerHundskamille kommen heute in der Gegend um Schwäbisch Hall nicht mehr vor. Als Ruderalpflanzen im weitesten Sinne (Unkräuter wüster Plätze in Siedlungsnähe) können die Wegwarte (Cichorium sp.), der Sardische Hahnenfuß (Ranunculus sardous), der Kleine Wiesenknopf (Sanguisorba minor) , der Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis) , der Gift-Schierling (Conium maculatum) und das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) gelten. Von diesen fehlen Hahnenfuß, Schierling und Bilsenkraut heute um Schwäbisch Hall. Bei Cichorium sp. war noch keine sichere Artbestimmung möglich. Deshalb könnte es sich hier statt um die wildwachsende Wegwarte ( Cichorium intybus) auch um die angebaute Salatpflanze Cichorium endivia (Endivie, Abb. 68) handeln. Zahlreiche Pflanzen nasser Standorte wurden gefunden, dabei neben unterschiedlichen Sauergräsern auch Früchte der Seebinse (Schoenoplectus lacustris, Abb. 69) . Das spricht für erhebliche Nässe im Stadtgebiet in der Umgebung der Salzquelle. Bis zum Abschluß der Untersuchungen wird
123
Abb. 68 Schwäbisch Hall. Hinter der Post. Wegwarte oder Endivie (Cichorium intybusil -endivia), Frucht (Achäne), leicht beschädigt, Originallänge 2,1 mm
Abb. 69 Schwäbisch Hall. Hinter der Post. Seebinse (Schoenoplectus lacustris), Nüßchen, Originallänge 3,1 mm: Die erhaltenen Perigonborsten belegen den hervorragenden Erhaltungszustand des pflanzlichen Materials.
124
noch einige Zeit vergehen, doch ist jetzt schon abzusehen, daß die Telekom mit ihrer Baugrube die Initialzündung geliefert hat zu einer Entwicklung, die Schwäbisch Hall den Stellenwert für die Landesarchäologie verschaffen könnte, der dieser Stadtaufgrund ihrer historischen Bedeutung und der hier gegebenen archäologischen Quellenlage zukommt. Großflächig ausgebildete Kulturschichten mit Feuchterhaltung organischen Materials aus prähistorischer Zeit und aus dem Mittelalter sind nämlich innerhalb der Städte im Land eine seltene Erscheinung. Vergleichbares hat allenfalls noch Konstanz zu bieten. Ansonsten sind solche Materialien nur punktuell in künstlichen Eintiefungen wie Brunnen oder Gruben, bestenfalls noch, wie in Esslingen, in Gräben erhalten und als Spezialfälle zu werten, aus denen allgemeine Aussagen schwer abzuleiten sind; anders in Schwäbisch Hall, wo sich die Bewohner am Osthang des Kochertals offenbar über Jahrtausende auf ihrem eigenen Müll in die Höhe gewohnt haben. Dadurch bewahrt die Stadt in ihr~m Untergrund ihr eigenes Archiv, bestehend aus kulturhistorischen Dokumenten materieller Art und in bestem Erhaltungszustand. Darüber hinaus enthalten die Fehlböden und Gefache noch stehender Haller Häuser, die in ihrer aufgehenden Bausubstanz mindestens bis ins Späte Mittelalter zurückreichen, reichhaltiges Pflanzenmaterial sozusagen in Herbarqualität, wie Untersuchungen an Gebäuden in der Langen Straße gezeigt haben. Dadurch können die Erkenntnisse aus Bodenfunden in idealer Weise ergänzt werden. Die Erhaltung sowie die sachgemäße Bergung und Untersuchung dieser Schätze, wo es aufgrund von Baumaßnahmen und Bodeneingriffen notwendig werden wird, ist eine Aufgabe der Zukunft. Die besondere wissenschaftliche Bedeutung dieses Bodendenkmals sei noch an einem Beispiel für die eisenzeitlichen Schichten erläu-
tert: Aufgrund von Bodenfunden, hauptsächlich aus römischen Brunnen, und aufgrundvon historischen Quellen wird der Gartenbau mit kultivierten Obstarten, eingeführten und angepflanzten Gemüsen und Gewürzen als eine Errungenschaft der Römer angesehen. Den prähistorischen Epochen billigt man außerhalb der mediterranen und orientalischen Hochkulturen nur Ackerbau mit Getreide und anderen Feldfrüchten zu. Was Obst und sonstige Nahrungspflanzen anbetrifft, geht man von Sammelwirtschaft und der ausschließlichen Verwendung einheimischer Wildarten aus. Bislang konnte nämlich aus der vorrömischen Eisenzeit nur verkohltes pflanzliches Material untersucht werden, wobei Obst, Gemüse und Gewürze kaum Nachweischancen besitzen und die schriftlichen Quellen schweigen. Bereits die Untersuchungen von Kar! Bertsch mit den Nachweisen von Pflaume, Weintraube und Kirsche lassen hier erste Zweifel an der Richtigkeit dieser Lehrmeinung aufkommen. Hier besteht nun die Chance, solche Fragestellungen an einem ge-
eigneten, zuverlässig stratifizierten und datierten Material neu aufzurollen und die alten Ansichten gegebenenfalls zu revidieren. Wir danken der Telekom, der Baustoff- und Bodenprüfstelle des Regierungspräsidiums Stuttgart und der Stadt Schwäbisch Hall für ihr Interesse, ihr geduldiges Verständnis und für tatkräftige und hilfreiche Unterstützung!
Elske Fischer und Manfred Rösch
Literaturhin weise H. Haeupler/P. Schönfelder, Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland (2. Auf!.; 1989). - E. Kost, Die Keltensiedlung über dem Haalquell im Kochertal in Schwäbisch Hall. Württembergisch Franken, 20121 , 1939, 39 ff. - J. Oexle, Arch. Ausgr. Bad.-Württ. 1986, 253 ff.- J. Oexle, Mittelalterliche Stadtarchäologie in BadenWürttemberg, in: D. Planck, Archäologie in Württemberg (1988), 381 ff. - M. Rösch/S. Karg/M. Sillmann, Vierhundert Jahre alt: Pflanzenreste in Dek-: ken und Wänden. Botanische Dokumente zu Ernährung, Landwirtschaft und Landschaft im alten Hall aus der Langen Straße 49. Haus(ge)schichten. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Hällisch-Fränkischen Museum (1994). -H. Schäfer, Arch. Ausgr. Bad.-Württ. 1992, 339 ff.- 0. Sebald/S. Seybold/G. Philippi, Die Farn- und Blütenpflanzen BadenWürttembergs 1-4 (1990 und 1992)
Latenezeitliche Eisenerzverhüttung mit Grubenöfen in Liel/Karlshof, Gemeinde Schliengen, Kreis Lörrach
1992 wurden bei Begehungen mehrere Eisenschlackenklötze südwestlich des Wohnhauses des Karlshofes aufgefunden, die aufgrund von 14-C-Daten der Latenezeit zuzuordnen sind. Ein Exemplar von 70 kg Gewicht eröffnete die Möglichkeit eines vorläufigen Rekonstruktionsversuches zur Verhüttungstechnologie, wonach die Verhüttung in Grubenöfen erfolgte, die wahrscheinlich nur jeweils einmal in Betrieb waren. Dieser Fund legte die Vermu-
tung nahe, daß, trotz Tiefpflügens, der für diese Zeitstellung in Süddeutschland erstmalige Nachweis eines Grubenfeldes mit Eisenerzverhüttungsanlagen ohne Schlackenabstich zu finden wäre. An diesem Fundplatz, im Zentrum der Hohnerzlagerstätten des Markgräflerlandes an der Hohen Schule, wurde eine Fläche von etwa 200 m2 untersucht. Das Grabungsareal lag im nördlichen Abschluß eines kleinen Tales, in der Nähe eines Bachlaufes.
125