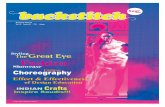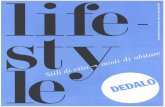ARCH+PREIS 2001 Urbane Tendenzen - ARCH+
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of ARCH+PREIS 2001 Urbane Tendenzen - ARCH+
10
ARCH+ PREIS 2001Urbane Tendenzen
Der von ARCH+ gestiftete Archi-tekturpreis für die besten Ab-schlußarbeiten eines Jahres wur-de zum zweiten Mal verliehen.Nach dem Start mit dem ARCH+PREIS 2000 und der Veröffent-lichung von 33 herausragendenArbeiten in 154/155 ARCH+“Nachwuchstalente", hat die Re-daktion den Preis regulär ausge-schrieben und in Form einesWettbewerbsverfahrens institu-tionalisiert.
Die Teilnahme am Wettbewerbwar mit insgesamt 571 einge-reichten Arbeiten außergewöhn-lich hoch. Die Teilnehmer warenAbsolventen von 88 Hochschulenaus dem In- und Ausland. Ver-treten waren 70 deutsche Hoch-schulen mit 470, 13 europäischemit 73 und 5 amerikanische mit5 Arbeiten. Von den 70 deut-schen Hochschulen waren 46Fachhochschulen und 24 Uni-versitäten bzw. Kunsthochschu-len oder -akademien. 23 Arbei-ten ließen sich nicht zuordnen.Die TU Stuttgart führte mit 38Einsendungen die Tabelle an,dicht gefolgt von der RWTH Aa-chen mit 31 Arbeiten. Österreichstellte mit 55 Arbeiten denHauptteil der europäischen Teil-nehmer. Die übrigen Einsendun-gen aus dem Ausland kamen inder Regel von Deutschen, die ihrStudium teilweise im Auslandabsolvierten bzw. durch einenAustausch zu einer Diplomarbeitan einer Partneruniversität an-geregt wurden.
VorprüfungDie Vorprüfung durch die Redak-tion fand zwischen dem 25.2.und 6.3.2002 statt. Der Vorprü-fungsgruppe gehörten AndreasBittis, Anh-Linh Ngo und SaraStroux an.
Nach eingehenden Diskussio-nen wurde eine Vorauswahl von73 Arbeiten zur Begutachtungdurch die Jury getroffen. Nebender Beurteilung der Qualität einerArbeit berücksichtigte die Vor-prüfungsgruppe die große Band-breite der Themen. Diese um-faßte u.a. Wohnen, Hochhäuser,Edutainment, Mobilität, Urbanis-mus bzw. städtebauliche undlandschaftliche Strategien, Vir-tualität und “Verrücktes”. Leiderwurden nur sehr wenige theore-tische Arbeiten, meist zu städte-baulichen Fragestellungen, ein-gesandt. Die Ausschreibung fürden ARCH+ Preis 2002 fordertdeshalb ausdrücklich dazu auf.
Da, wie die vielen Anfragenzeigen, jeder Teilnehmer amWettbewerb wissen möchte, wieweit er es mit seiner Arbeit imWettbewerbsverfahren geschaffthat, ist eine Liste der 73 Arbei-ten, die in die engere Wahl ge-kommen sind, auf der ARCH+Homepage unter www.archplus.baunetz.de einzusehen.
PreisgerichtAm 12.4.02 tagte die Jury unterdem Vorsitz von Sabine Kraftaus der Aachener Redaktion. Ihr gehörten an:Carola Dietrich, Preisträgerin desARCH+ PREISES 2000Klaus Kada, Graz/AachenBernd Kniess von b&k+, KölnBart Lootsma, Rotterdam/WienErich Schneider-Wesseling, Kölnsowie die Vorprüfungsgruppemit 1 Stimme.
Nach mehrstündiger Prüfungder einzelnen Arbeiten durch dieJury wurde jede Arbeit intensivdiskutiert und die Auswahl indrei Abstimmungsrunden auf 10Arbeiten eingeschränkt. Andersals bei dem ARCH+ Preis 2000entschloß sich die Jury zur Ver-gabe von zwei ersten Preisen, ei-nem zweiten Preis sowie einemSonderpreis und sechs Anerken-nungen.
PreisträgerDie beiden 1. Preise mit jeEUR 2800 werden vergeben an Dagmar Pelger für die Arbeit“Wohnen am Bahnhof" (TUKarlsruhe) und an Henrik Mauler für die Arbeit“Popular Mechanics – ChicagoLoop" (Akademie der KünsteStuttgart).Der 2. Preis mit EUR 1600 gehtan Dirk Zweering für die Arbeit“Konzerthalle Aachen" (RWTHAachen).Der Sonderpreis mit EUR 800geht an Wolf Schmelter für denFilm “Illusionsmaschine" (RWTHAachen).
Die sechs Anerkennungen werdenSusanne Lorentz für “Stadtsanie-rung Shanghai" (TU Berlin); Ste-fan Werrer für “andScape" (TUStuttgart); Alexander Philip An-germaier für “Schiphol Zipped"(TU Wien); Oliver Schaeffer/Dietmar Geiselmann für “Termi-nals für Magnetschwebebahnen"(TU München); Mark Mücken-heim für “Urban Farming" (Bart-lett School London); und MarenSostmann für “Skintower" (TUStuttgart) ausgesprochen.
Was beim ARCH+ PREIS 2000noch als zufälliges Ergebnis an-gesehen werden konnte, scheintsich als Tendenz herauszukri-stallisieren: Arbeiten von unge-wöhnlicher Qualität sind häufigselbstgewählte urbanistischeAufgaben- und Themenstellun-gen, die mit einem strategisch-konzeptuellen Ansatz, der anKomplexität die übliche Bebau-ungsplanung hinter sich läßt,konkrete städtebauliche wie ar-chitektonische Vorschläge ent-wickeln. Das gilt für die beiden1. Preise “Wohnen am Bahnhof"und “Popular Mechanics – Chi-cago Loop", aber auch für dieAnerkennungen “StadtsanierungShanghai", “andScape", “Schi-phol Zipped" und “Urban Far-ming". Mit dem 2. Preis “Kon-zerthalle Aachen" und den An-erkennungen “Terminals fürMagnetschwebebahnen" und“Skintower" wurden Hochbau-entwürfe ausgezeichnet, die einegestellte Bauaufgabe nicht nurfunktional und formal ausge-zeichnet lösen, sondern auch in-novativ interpretieren.
Henrik Maulers “Popular Mechanics –Chicago Loop” erhielteinen ersten Preis: eineurbanistische Strategievon subversiv-spieleri-scher Qualität.
Ein weiterer erster Preisging an Dagmar Pelger:“Wohnen am Bahnhof”entwickelt ein Wohnmo-dul, das in Tokios urbaneResträume implantiertwerden kann.
Bewertung der prämierten Projektedurch die Jury1. Preis: “Wohnen am Bahnhof"Anhand einer Analyse der spezi-fischen Wohnkonditionen vonTokio werden sowohl neue For-men des Wohnens entwickelt wieauch neue Orte des Wohnensaufgespürt und zu einer einfühl-samen urbanistischen Strategieverknüpft. “Wohnen am Bahn-hof" entwickelt ein Wohnmodul,das in die urbanen Resträume,die sich um und in der Verkehrs-infrastruktur ergeben, implantiertwerden kann. Dabei werden dieklassischen Topoi von Öffent-lichkeit und Privatheit in einemneuen Modell der Raumzonie-rung hinterfragt. Das Projektspannt nicht nur den Bogen vonder Stadtanalyse bis zum konkre-ten architektonischen Entwurfder Wohnmodule und ihrer Ein-bauelemente, sondern themati-siert gleichermaßen Fragen derurbanistischen Entwicklung wieder Perspektive des Wohnens.
1. Preis: “Popular Mechanics —Chicago Loop"Ausgangspunkt für die Entwick-lung einer urbanistischen Stra-tegie von subversiv-spielerischerQualität sind die Defizite einesmonofunktionalen Business-distrikts. “Popular Mechanics"zeigt, wie ein bereits hochver-dichtetes Gebiet mit einer neuen,teils realen, teils virtuellen Ebeneüberlagert und dadurch mitkommunikativen Funktionenangereichert werden kann. Dieseneue Ebene wird durch Minimal-eingriffe definiert, die sich ander bestehenden Infrastruktur,dem “Chicago Loop", orientieren.
len wird dem Betrachter das Ge-fühl des unaufhörlichen Kreisensum ein imaginäres Zentrum ver-mittelt. Die Aneinanderreihungimmer derselben Filmsequenzwird durch die rhythmischeWiederholung der strukturieren-den Elemente der Landschaft wieStrommasten und ein Waldstückzu einer zeitlichen Folge, die ineinem zeitlosen Raum wiederverschwimmt. Der Film stellt mitden Mitteln der Abstraktion undRepetition gewohnte Wahrneh-mungsmuster und räumlicheVerortung in Frage und ziehtmit seinem eigenartigen ästheti-schen Reiz den Betrachter in sei-nen Bann.
Die Veröffentlichung und aus-führliche Dokumentation derprämierten Arbeiten erfolgt in162 ARCH+. Alle eingereichtenArbeiten werden auf Wunschzurückgesandt, wenn an denARCH+ Verlag ein frankierterRückaufkleber oder Briefmarkenim Wert von EUR 3,68 geschicktwerden.
Die Redaktion dankt der FirmaFSB - Franz Schneider Brakel,insbesondere Jürgen W. Braun,für ihre finanzielle Unterstützungdes ARCH+ PREIS-Projekts.
Redaktion ARCH+
ZeitungZu den Minimaleingriffen gehö-ren sowohl stationäre wie beweg-liche Elemente, die neue Wegeder Aneignung des Stadtraumsweisen. Das Projekt beinhaltetneben der Stadtanalyse die kon-krete Ausarbeitung der einzelnenElemente und thematisiert dasVeränderungspotential behutsa-mer Eingriffe.
2. Preis: “Konzerthalle Aachen"Der Hochbauentwurf für dieKonzerthalle Aachen löst nichtnur die gestellte Bauaufgabe,sondern schafft es mit minimalenraumstrukturierenden Mitteln,das Gebäude sowohl räumlichwie städtebaulich in die beste-hende Parklandschaft einzubin-den: Die Konzerthalle wird nichtals abgeschlossenes Gebäude,sondern als Teil einer “infor-mierten Topographie" begriffen.Dabei wird das Dach sowohl alsGebäudebegrenzung wie auchtopographisch definiert. DieWände des großen Konzertsaalssind vollständig zu öffnen underweitern seine eigentliche Nut-zung um zusätzliche Dimensio-nen. Die Verspiegelung ihrerAußenseite verstärkt die Ver-schmelzung des Gebäudes mitder Umgebung.
Sonderpreis: “Illusionsmaschine"Eine linear aus einem Zugfensteraufgenommene weitläufige,weiße Landschaft wird in einerFilmsequenz zu einem spiralför-migen Wahrnehmungsraummontiert. Durch die aus demMittelpunkt fluchtenden Radia-
11
Dirk Zweering erhielt mit“Konzerthalle Aachen”den zweiten Preis. DerHochbauentwurf schafftkein abgeschlossenesGebäude, sondern ist Teileiner “informierten Topo-graphie”.
ARCH+ PREIS 2002
Die Ausschreibung für denARCH+ PREIS 2002 läuft biszum 31.3.2003.
Preissumme: 8000 EUR
Teilnehmer:Absolventen des WS 2001/2002,SS 2002 und WS 2002/2003 allerHochschulen, Akademien undUniversitäten des In- und Aus-lands.Voraussetzung für die Teilnahmeam Wettbewerb ist die Registrie-rung auf der Homepage vonARCH+ unter www.archplus.bau-netz.de. Diese ist ab Anfang Junimöglich und muß vor der Ein-sendung der Arbeit erfolgen.
Einsendeschluß:31.3.2003, Poststempel
Unterlagen:1. Auf maximal 15 losen Blätternim Format DIN A3 in lesbarerGröße alles, was an Zeichnungen,Modellfotos, Renderings Textenetc. erforderlich ist, um das Pro-jekt zu verstehen. Vor allem Mo-dellfotos erleichtern eine Würdi-gung des Projektes sehr. Bittekeine Daten!2. Kurzbeschreibung des Projek-tes auf einer DIN A4 Seite.3. Persönliches Foto.Ausnahmen: Bei rein theoreti-schen Arbeiten darf eine Bro-schüre, bei Filmen ein Videobzw. eine CD-ROM eingesandtwerden.
Bitte keine Rollen, sondern Map-pen schicken. Soll die Arbeitzurückgeschickt werden, mußein ausreichend frankierterRückaufkleber oder Umschlagbeigelegt werden.
Adresse:Redaktion ARCH+Charlottenstr. 1452070 Aachen
12
gärten und Gemeinschaftszen-tren, Straßen, Bürgersteige, Fuß-wege, Treppenanlagen und Plät-ze). Außerdem werden Parzellenregistriert und ihren Bewohnernüberschrieben. Eingriffe in be-stehende Strukturen werden ausKostengründen so gering wiemöglich gehalten. Deshalb be-halten die Favelas das ihnen ei-gene organische Erscheinungs-bild. Die Organisation und Ver-besserung des Wohnens auf derprivaten Parzelle bleibt Angele-genheit der Bewohner und wirdnach den eigenen Möglichkeitenund Bedürfnissen durchgeführt.Tatsächlich können durch dieSumme der privaten Umbaumaß-nahmen innerhalb von wenigenJahren Wohngebiete entstehen,deren Erscheinungsbild dem vonlegalen Wohnvierteln in vielenAspekten überraschend ähnelt.
Die Favela Tamarutaca, einSlum im Südosten des metropo-litanen Großraums São Paulo, indem ca. 1100 Familien wohnen,ist eine von vier informellenSiedlungen in der GemeindeSanto André, die gegenwärtig aneinem durch EU-Mittel geförder-ten städtischen Urbanisierungs-programm teilnehmen. Das Pro-jekt wirft ein Licht auf Fragennach Verhältnis, Bedeutung undGründen eines individualisiertenund gleichwohl standardisiertenTyps im Wohn- und Siedlungs-bau. In Tamaratuca werden nichtnur die Infrastruktur und öffent-liche Räume angelegt wie bei
Eindruck. In informellen Sied-lungen bestimmen neben denkonstruktiven auch soziale undwirtschaftliche Gesetzmäßigkei-ten und Konventionen die Formder Häuser und des Zusammen-lebens. An Orten, wohin die offi-ziellen gesellschaftlichen Institu-tionen nicht gelangen, bildensich parallele Systeme, welchedie Rolle des Staates überneh-men. Selbst auf illegal besetztemGrund existieren Woh-nungsmärkte: Wohneinheitenwerden vermietet oder weiter-verkauft. Das, was ungeordnetund anarchisch individuell er-scheint, ist in Wirklichkeit einemNetz von Normen unterworfen.
Während sich also bei for-mellen Vierteln, sofern sie alsGanzes geplant sind, Individua-lität im Sinne der Vielfältigkeitder gebauten Ausprägung alspostmoderner Luxus der Ober-fläche zeigt, ist sie in informellenSiedlungen Ausdruck eines Be-ziehungsgeflechtes von Notwen-digkeiten.
In diesem Spannungsfeld vonformeller und informeller Stadtbewegen sich diejenigen brasi-lianischen Projekte, die seit den1980er Jahren durch innere Sa-nierung und Konversion Alter-nativen zum Abriß von Favelasentwickeln. Bei diesen Sanie-rungsprojekten werden Favelasmit infrastrukturellen Leistungenversorgt und erhalten rechtlicheGrundlagen, die in der formellenStadt selbstverständlich sind:technische und soziale Infrastruk-tur sowie klar definierte öffentli-che Freiräume (Strom, Wasser,Abwasser, Müllabfuhr, Kinder-
Die gute StubeFavela-Sanierung inTamarutaca
Elendsviertel an der Peripherieder Welt vermitteln mancherortsden Eindruck von kreativer Viel-falt und chaotischer Individuali-tät. Viertel wie die Boca in Bue-nos Aires entwickeln sich obdieser scheinbaren Qualitätensogar zu touristischen Attraktio-nen und Imageträgern für diegesamte Stadt. Tatsächlich gibtes in informellen SiedlungenFormen der Individualität, diesich insbesondere in der Organi-sation des Wohnens und somitauch in der Grundrißdispositionbemerkbar machen. Dafür gibtes mehrere Einflußfaktoren:Haushalte unterliegen in Größeund Art der Zusammensetzungstarken Schwankungen, wäh-rend die uneinheitlichen Zu-schnitte und Größen der Grund-stücke für ähnliche Haushalts-größen unterschiedlichsteLösungen verlangen. Die Knapp-heit der finanziellen Mittel führtnaturgemäß zu Improvisationenund dazu, daß stadtplanerischeRegeln, falls überhaupt vorhan-den, nicht umgesetzt werdenkönnen. Da die Behausungenwegen ihres provisorischen workin progress-Charakters außerdemleicht veränderbar und somit denBedürfnissen der Bewohner an-paßbar sind, prägen diese Fakto-ren die Raumdisposition viel un-mittelbarer als bei formellen,sprich legalen, Stadtvierteln.
Bei genauerem Hinsehen wirdallerdings offenbar, daß die bunteOberfläche täuscht und es häufigdie eigenen Exotismen sind,welche die Vielfalt des Betrach-tungsgegenstandes vermitteln.Insbesondere die konstruktivenLösungen sowie die verwendetenMaterialien sind an einem Ortmeist ähnlich, und lediglich dieungewohnte Kleinteiligkeit undInformalität der Behausungensuggeriert den gegenteiligen
Individualisierung pur?Auf den ersten Blickfasziniert in informellenSiedlungen das schein-bare Fehlen jeglicherStandardisierung. Ein-drücke aus der FavelaTamarutaca im SüdostenSão Paolos.
anderen Sanierungsprogrammen.Es wird auch eine grundsätzlicheurbane Flurbereinigung durch-geführt, indem allen Haushalteneine standardisierte Parzelle zu-gewiesen wird. Das Ergebnis istein hybrider lowtech-Urbanismus,der eine organische Straßenfüh-rung, die sich aus der Topografie,den Wasserscheiden und beste-henden Markierungen ergibt, miteiner weitgehend regelmäßigenParzellierung verbindet. Damithandelt es sich bei dem Projektnicht nur um eine Wohnumfeld-verbesserung, sondern auch umeine grundsätzliche Verbesserungder individuellen Wohnsituation.
Der Umbau findet unter denBedingungen eines regulärenFunktionierens bei zwar laufen-dem Alltag, jedoch sich schritt-weise verändernden Lebensbe-dingungen statt. Die Bewohnerwerden sukzessiv nach Bauab-schnitten umgesetzt und kommenübergangsweise entweder in ei-nem direkt neben der Siedlungliegenden provisorischen Wohn-heim, in den Hütten bereits um-gezogener Familien oder in Ein-zelfällen bei Verwandten undBekannten unter. Die Entwick-lung des Gebietes ist bei dieserVorgehensweise sehr langsam, dasich die Kapazität an Haushalten,die gleichzeitig umgesetzt werdenkönnen, auf ungefähr 45 beläuftund da Plätze erst wieder freiwerden, wenn eine neu ausge-wiesene Parzelle zumindest an-teilig bebaut und bezugsfertig ist(in der Regel das Erdgeschoß imRohbau). Zuweilen läßt sich die-
13
Zeitung
Aus dem Typenkatalog wird inAbsprache mit den jeweiligenBewohnern eine Variante ausge-wählt und diese nach deren Be-dürfnissen sowie entsprechendden variierenden Parzellentiefenmodifiziert und eingepaßt. Fürjede Parzelle wird dann auf die-ser Grundlage ein persönlichesProjekt entworfen und dokumen-tiert, dessen Ausführung die Be-wohner selber unternehmen, beidem die Architekten allerdingstechnische Unterstützung leisten.Damit wird ein Service, den dieGemeinde normalerweise separatauf Nachfrage anbietet, nämlichdie Beratung bei architektoni-schen Lösungen für die Bebauungvon privaten Parzellen, direkt indas Vorhaben eingegliedert. ImRahmen dieser Rationalisierungumfaßt das Projekt letztendlichalle Aspekte, die traditionell imformellen Siedlungsbau berück-sichtigt werden.
Die Standardisierung vonParzellen, Baumaterialien undArchitekturen ermöglicht einer-seits eine sanitäre Verbesserungder Lebensumstände. Der damitverbundene Standard funktiona-ler Zuordnungen auf der Parzelleist aber außerdem die formaleKlammer für eine anteilige sozia-le Eingliederung der Bewohnerdurch das Mittel der architekto-nischen Raumorganisation. DasProjekt besitzt also auch eineaufklärerische und erzieherischeDimension. Die Bewohner glei-chen ihre Vorstellungen vonWohnen im Laufe der Beratun-gen den vorgeschlagenen Typen-lösungen an, und das Ergebnisist die Herstellung einer gesell-schaftlich sanktionierten Formvon Individualität im Rahmeneiner standardisierten Lösung,d.h. die formelle Organisationdes Viertels ist somit auch Aus-druck des hegemonialen Wirkensder gesellschaftlichen Normenim privaten Raum.
Für die ca. 500 Haushalte, dieAnfang der neunziger Jahre imersten Bauabschnitt von Tama-ratuca umgesetzt wurden, beliefsich die Mindestgröße einer Par-zelle auf 60 qm. Für die ca. 600Haushalte, die im zweiten Bau-abschnitt wohnen und seit 1997am Programm teilnehmen, muß-te die Mindestgröße auf 42 qmreduziert werden, um trotz derhöheren Haushaltsdichte desTeilgebietes noch ca. 85 % derFamilien unterbringen zu können.Im Gegensatz zum europäischensozialen Wohnungsbau ist dieParzelle für das Existenzmini-mum kein Standard, der sich ausdem Anspruch auf allgemeingül-tige Optimierung und Universa-lität ergibt, sondern eine Reak-tion auf die lokalen Faktorenund Sachzwänge.
Die Architekten von peabiruhaben für die 3,6 x 13 m mes-sende Typenparzelle eine Reihevon Typengrundrissen entwickelt,die mit Ausnahme der Eckgrund-stücke für den zweiten Sanie-rungsabschnitt gut anwendbarsind. Die geringen Abmessungenergeben Grundrisse, die als Va-riationen von Zimmern entlangeiner seitlichen Erschließung dasgesamte Grundstück besetzen.Die spezifische Organisation derzweigeschossigen Typen entstehtaus der Anordnung der Treppen,Naßzellen und Lichtschächte. Aufeine rückseitige Belichtungs-möglichkeit wurde verzichtet, dadie Erfahrung anderer Projektezeigt, daß die Bewohner die Hof-räume und die damit verbunde-nen Vorteile der Belichtung undQuerlüftung zugunsten von zu-sätzlichem Wohnraum opfern.Tatsächlich ist diese Tendenzauch in Tamarutaca erkennbar:Die Lichtschächte werden vonden Bewohnern kleiner ausge-führt, als in der Planung vorge-sehen.
lich ist die Oberfläche der Favelanicht frei verfügbar, es wird aberbeinahe vorgegangen, als ob siees wäre. Das ist nur denkbar, weilsich alle Bewohner ihrer gegen-wärtigen kollektiven Marginali-tät bewußt sind und um den Ge-winn wissen, den das Programmfür ihre zukünftigen Rechte so-wie ihren um ein Vielfaches er-höhten persönlichen Wohnkom-fort darstellt. Wenn also die Be-gründung für das Einverständnisder Bewohner zur Teilnahme amProgramm relativ leicht erklärbarist, so bleibt es trotzdem erstaun-lich, wie hier ein sozialer Raumvöllig verwaltbar wird. In jedemanderen Kontext würde solch ei-ne Maßnahme zu langwierigenrechtlichen oder gar gewaltsamenKonflikten führen, da die Verlie-rer dieses Prozesses schließlichsoziales Prestige sowie Wohn-raum und damit teilweise ihreExistenzgrundlage einbüßen: z.B.diejenigen, die vor der Sanierungin der Lage sind, Wohnraum un-terzuvermieten. Da die Verteilungder Grundstücke in der Favelavor der Sanierung ungleich ist,ergibt sich für viele Bewohneraber auch ein Flächengewinn.
In brasilianischen Favelassind Haushalte mit mehrerenMitgliedern, die auf weniger als10 qm Wohnfläche leben, nichtsUngewöhnliches. Im Mikrogebiet,das der Architekt Caio SantoAmore de Carvalho am äußerstenRand der größten Favela SãoPaulos, Heliópolis, untersuchthat, lassen sich diese Faktorengut verifizieren. In 27 mehrheit-lich aus Holz gebauten Hüttenvariiert die Größe der Häuser vonunter 9 bis über 60 qm, und einevierköpfige Familie kann z.B. ineinem einzigen Raum auf 9 qmoder in 3 Zimmern auf 40 qmleben.
ser Vorgang beschleunigen, in-dem die Bewohner mit den Ma-terialien ihres alten Heims eineprovisorische Unterkunft aufihrer neuen Parzelle errichten —um die herum sie dann schritt-weise das eigentliche neue Hauserrichten.
Das Projekt beschränkt sichalso, bedingt durch die Methode,nicht wie andere Sanierungspro-jekte auf ein Minimum an Inter-ventionen. Das Gegenteil ist derFall: In Tamarutaca werden jederKiesel, jeder Scheit und jederStein mindestens zweimal um-gedreht. Trotzdem kommen diemeisten Haushalte nach der Sa-nierung wieder in die Nähe ihresursprünglichen Wohnortes — essei denn, die Bewohner wünschenexplizit einen alternativen Stand-ort für ihr neues Domizil. DieSanierung ist unter diesen Be-dingungen ein mühsamer undvor allen Dingen intensive Be-treuung erfordernder Vorgang,der seit dem letzten Jahr von derNRO 'peabiru' geleitet wird. Dadie Kontakte zu den Bewohnernund deren Organisation und Be-ratung genauso wichtig sind fürdie Durchsetzbarkeit und dasGelingen wie die technischenAspekte der Sanierung, bestehtdas Team neben den Architektenund einem Bauingenieur auchaus einem Psychologen, einerSoziologin und einem Pulier.Auch außerhalb der wöchentli-chen Sitzungen mit der Gemein-schaft besteht die Arbeit vor Ortwesentlich aus Gesprächen, Be-ratungen und Überzeugungsar-beit mit den Bewohnern.
Die Umschichtung und Um-verteilung des Bodens in Tama-rutaca ist etwas ganz und garAußergewöhnliches: Sie stelltnichts weniger dar als die völligeUmwälzung und Nivellierungder sozialen und wirtschaftlichvorhandenen Grenzen einer eta-blierten Gemeinschaft. Schließ-
Architekt Caio SantoAmore de Carvalho unter-suchte die Wohnverhält-nisse einer Favela inHeliópolis: work in pro-gress.
Die vom Büro peabirugeleitete SanierungTamarutacas betrifftInfrastruktur und öffent-liche Räume. Aber aucheine Flurbereinigung wird
durchgeführt: eine uner-hörte Umwälzung vor-handener sozialer undwirtschaftlicher Grenzen.
14
te Organisation der Geschosse.Die Nutzung des privaten Rau-mes ist nach wie vor ein dyna-mischer Vorgang und seine funk-tionale Zuordnung bleibt modi-fizierbar. Auch im saniertenViertel sind die Gewohnheitender Bewohner gegenüber dersanften Modernisierungsarchitek-tur teilweise resistent. TradierteWohngewohnheiten bleiben imViertel erhalten, sie werden aller-dings in ihrer äußeren Erschei-nung homogenisiert.
Von der Favelahütte zumrechtlich gesicherten, in dieStadt integrierten Haus ist es einlanger und langwieriger Weg.Die Sanierung leistet einem ku-riosen Strukturwandel Vorschub:Tamarutaca wandelt sich von ei-nem zufälligen Habitat, geordnetnach individuellen funktionalenKriterien auf der Grundlage ei-ner empirischen Architektur, zueinem Viertel, dessen Architekturauf gemeinschaftlichen, rationa-len Kriterien fußt. Hierbei wirddie technische Organisation deskollektiven Raumes zwar an dieder Parzelle gekoppelt, die for-malen Aspekte beider Systemesind allerdings ganz unterschied-lich. Beide Systeme gehorchenStandards. Im Fall der Siedlungsind es Richtlinien, welche dieBreiten der Straßen und Bürger-
Sichten5Verfeinerung derWahrnehmung
Die “sichten”-Ausstellungsreihewurde vor Jahren von Architek-turstudenten der TU Darmstadtins Leben gerufen und fand Ende2001 zum fünften mal statt. Da-bei hat sich jedes Jahr ein neuesTeam gefunden, das mit persön-lichem Engagement und enormenZeitaufwand die Ausstellung or-ganisiert. Die Leistungen und Er-fahrungen der Vorgängerteamsdienen der jeweiligen Gruppeauf dem für sie gänzlich neuenTerrain als Orientierung undspornen zu kontrastierendenSchwerpunkten an.
Der Ursprungsgedanke derAusstellung war der Wunschnach einem Forum in doppeltemSinn: Nach eigenen Kriterienausgewählte Arbeiten eines Jah-res sollen sowohl den Studentenals auch der breiten Öffentlich-keit präsentiert werden. Mit denwechselnden Schwerpunktenzeigt “sichten” die Bandbreite,die das Architekturstudium ander TU Darmstadt auszeichnet.
Klassische Architekturthemenwie Baukonstruktion, Wohnungs-bau und Städtebau werden solidefundiert oder auch experimentellgelöst. Es zeigt sich dabei, daßdie Universität den Raum bietet,um altbewährte Strukturen zuüberdenken und neue Wohn-und Raumwahrnehmungsformenzu entwickeln. Dem Betrachterbleibt es jedoch überlassen, durchdie "Sichtung" der einzelnen Ex-ponate zu seinem persönlichenGesamtbild des Fachbereichs zugelangen.
Einen wichtigen Schwerpunktder Ausstellung bilden die künst-lerischen Disziplinen wie Malen,Zeichnen, Siebdruck, Fotografiesowie künstlerisches Arbeitenmit Ton und Stein, durch die dasWahrnehmungsvermögen derStudenten geschult und verfeinertwird.
Wenn auch nicht die Schulungund Verfeinerung der Wahrneh-mung, so war es die Freude ander Betrachtung der Ideen undKonzepte das Hauptanliegen derletztjährigen Ausstellung. Diesespiegelt sich auch in dem imErnst Wasmuth Verlag erschie-nenen Ausstellungskatalog wi-der.
Das Team
sichten5. Jahresausstellung des Fachbe-reichs Architektur der TU Darmstadt,Wasmuth-Verlag, Tübingen 2001, EUR 23,00
Im Viertel ist durch die Par-zellierung und typisierte Archi-tektur zwar die Gußform desWohnens vereinheitlicht, ihreFüllung bleibt jedoch bei Wah-rung der räumlichen Grunddis-position flexibel. Diese Flexibi-lität ist ein entscheidender Un-terschied zu Architekturen imgroßmaßstäblichen sozialenWohnungsbau. Dabei entstehenin Tamarutaca Abweichungen,die in den Typengrundrissen, dieallesamt Varianten eines Einfa-milienreihenhauses sind, nichtvorgesehen sind, von den Archi-tekten allerdings planend unter-stützt werden. Die Bewohner le-gen zum Beispiel zur Gewin-nung von zusätzlichemSchlafraum Küchen und Wohn-zimmer in den zur Straße orien-tierten Räumen zusammen; ineinigen Häusern wird der Auto-stellplatz als Laden benutzt. Desweiteren kommt es vor, daß zweiFamilien, die vormals in einerWohneinheit gelebt haben, sichauch eine neue Parzelle teilenmüssen, da sie im Programm le-diglich als ein Haushalt regi-striert sind: auch für diesen Fallsind die Grundrisse anpassungs-fähig und erlauben eine getrenn-
steige bestimmen, im Fall derBesetzung der Parzelle sind esumfassende Grundrißentwürfe.Daß die Wohnungsprojekte flexi-bel sind, liegt dabei nur in zwei-ter Linie an der Architektur: vielwichtiger ist die Methode desVorgehens, die Umsetzung unddas Management des Prozesses,welche den Vorgang der Anpas-sung ermöglichen. Um den Stan-dard hinterfragen und verändernzu können, muß es ihn außerdemüberhaupt erst einmal gegebenhaben.
Oliver Schetter
Oliver Schetter ist Architekt in Berlin.Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiteram Institut für Städtebau der Uni-versität Hannover.
Die gesamte, 3,6 x 13 mmessenden Standardpar-zelle wird bebaut. EineErweiterung des Hausesin die Fläche ist damitausgeschlossen. Diespezifische Organisationdes zweigeschossigenTyps entsteht durch dieAnordnung der Treppen,Naßzellen und Licht-schächte.
Die Parzellengröße desersten Bauabschnittsbelief sich auf 60 qm, imzweiten Bauabschnittmußte diese auf 42 qmreduziert werden. Lage-plan.
15
ZeitungZeitungctrl [space]Kunst und Überwa-chungskultur
Leben wir in einer überwachtenGesellschaft? Welchen Einflußhaben Überwachungstechnikenauf unseren Alltag? Das ZKM inKarlsruhe zeigte in der Ausstel-lung ctrl [space], die am 24. Fe-bruar dieses Jahres zu Ende ging,Kunst, die sich mit dieser Frage-stellung auseinandersetzt. Zu derAusstellung ist nun auch ein Ka-talog erschienen.
“Rhetorik der Überwachungvon Bentham bis Big Brother"lautet der Untertitel von Katalogund Ausstellung. Da der Schwer-punkt bei künstlerischen Arbei-ten liegt, die seit den sechzigerJahre entstanden sind, werdenweder Ausstellung noch Katalogdem weitgespannten historischenRahmen und wissenschaftlichenAnspruch gerecht. Dennochboten die gezeigten Arbeiten, dienun in dem Katalog dokumentiertsind, interessante Einblicke indie künstlerische Auseinander-setzung mit der Bedeutung vonÜberwachung in unserer Gesell-schaft.
Ausgangspunkt dieses Dis-kurses ist das Benthamsche Pan-opticon (1787/91), ein Gefängnis,von dessen zentralem Wachturmaus alle Räume einsehbar sind.Durch diese allgegenwärtigeÜberwachung erhoffte sich Ben-tham eine freiwillige Selbstdiszi-plinierung der Gefangenen. Inctrl [space] fungiert BenthamsVision von Überwachung als pä-dagogische und disziplinierendeMaßnahme als Interpretations-schema für die heutige, immerstärker kontrollierte Gesellschaft.Die Vorstellung, daß Videoüber-wachung auf den Prinzipien despanoptischen Gefängnisses beru-hen, ist Leitmotiv des Kuratorsund Herausgebers, Thomas Y.Levin. Die Fernsehshow “Big
Brother” als soziales Überwa-chungsereignis markiert in dieserLogik die Perspektive der gegen-wärtigen Entwicklung: Überwa-chung ist heute nicht mehr nurdisziplinierend, sondern auchunterhaltend. Allerdings verfol-gen Ausstellung und Katalognicht das Ziel, diese Verschie-bung kultureller Praktiken zuthematisieren. Sie beschränkensich auf die Dokumentation derkünstlerischen Auseinanderset-zung mit Überwachung undÜberwachungstechnologie.
Ein Schwerpunkt ist dabei derretrospektive Blick auf die Ana-lyse von Videotechnik undÜberwachung. Während Video-arbeiten von Dan Graham oderBruce Nauman die gegenseitigeReferentialität von Beobachterund Beobachtetem untersuchen,setzten sich Arbeiten wie “FilmNo 6. Rape" von John Lennon/Yoko Ono (1969) mit der Phä-nomenologie von Überwachungauseinander: Eine zufällig aus-gesuchte Person wird in Londonmehrere Tage von einem Kame-rateam verfolgt, ohne auf dieverzweifelten Fragen der Ver-folgten einzugehen. Die visuelleVergewaltigung findet ihrenHöhepunkt in dem Eindringendes Kamerateams in die Woh-nung der Verfolgten.
Den zweiten Schwerpunktbilden zeitgenössische Arbeiten,die sich mit Techniken und Phä-nomenen von Überwachung
auseinandersetzen. Diese Kompi-lation umfaßt ironisierende,systematisierende und dokumen-tarische Arbeiten. So themati-siert Jonas Dahlbergs Installati-on “Safe zones, no 7 (The toiletsat ZKM)" auf ironische Weise dieFrage nach der Authentizitätvon Videoüberwachung. AufMonitoren vor dem Toilettenein-gang der Ausstellungsräumewerden Überwachungsbilder derToiletteninnenräume gezeigt.Erst nach Betreten der Toilettenentpuppen sich die gezeigtenBilder als Aufnahmen aus maß-stabgetreuen Modellen dieserRäume.
Zu diesem Kommentar der ei-genen Überwachungserwartun-gen läßt sich kaum ein größererGegensatz denken als JamieWaggs “History Painting, Shop-ping Mall 15:42:32, 12/02/93"(1993/94). Das großformatigeVideostill zeigt zwei Jungen miteinem Kleinkind an der Hand.Es stammt aus einem Überwa-chungsvideo einer ShoppingMall, anhand dessen die beidenJungen später für schuldig be-funden wurden, den kleinenJungen ermordet zu haben. Esist ein besonderes Verdienst vonThomas Levin, daß er die kon-troverse britische Debatte, obdiese Videostills als Kunstwerkeausgestellt und verkauft werdendürfen, anhand von Zeitungsar-tikeln dokumentiert. Die Arbeitzeigt deutlich, wo die Grenzenvon Videoüberwachung liegen.
Inhaltlich abgeschlossen wirdctrl [space] mit Arbeiten zu denstadträumlichen Implikationenvon Videoüberwachung. DasWeb-Projekt “iSEE" (2001) vomInstitute for Applied Autonomystellt nicht nur eine Karte allerÜberwachungskameras im öf-fentlichen Raum von Manhattanzur Verfügung, sondern ermitteltaus Start- und Zielort den über-wachungsfreien Weg durch Man-hattan. Der entstehende Zick-zack-Weg verdeutlicht die Über-wachungsdichte in Manhattan(www.redsee.org).
Historisch, technisch und in-haltlich unterschiedliche Arbei-ten werden unter dem Gesichts-punkt von Überwachung zusam-mengestellt: ctrl [space] istdamit die erste umfassende Aus-stellung, die künstlerische Arbei-ten der letzten 35 Jahre auf die-sen Aspekt hin untersucht, neueInterpretationsansätze eröffnetund zum Nachdenken überÜberwachung anregt. Die Dichtevon unterschiedlichen Arbeitenaus unterschiedlichen Kontextenführt aber auch dazu, daß demBesucher der Ausstellung der ro-te Faden zuweilen verloren geht.Da schafft auch der Katalog kei-
15
Die für ctrl [space]beauftragte, jedoch nichtrealisierte Ausstellungs-architektur von JürgenMayer H. und SebastianFinckh hätte das verän-derte kulturelle Handelnangesichts ubiquitärerÜberwachung erlebbargemacht. Die Bewegun-gen jedes Besucherswären vom CCTV aufge-zeichnet und ihm beimVerlassen der Ausstel-lung als Ausdruck über-geben worden.
modulorGneisenaustraße 43 - 45D-10961 BerlinTel. 030 / 690 36 - 0Fax 030 / 690 36 - 445E-Mail: [email protected]
material total
Katalog 700 S. Materialfür Architekten
Musterkistemit 170 Mustern
Katalog 2002
Alles für Architekten
• Modellbaumaterial
• Skizzenbücher und -papier
• Plotterpapier günstig
• Stifte, Büro- u. Zeichenbedarf
• Präsentationsmaterial
Anfordern unter www.modulor.deNEU!
Plotterpapier 85 g weiß, für Linienplotsb = 914 mm, l = 50 m
Plotterpapier 130 g weiß, für Vollfarbplotsb = 914 mm, l = 35 m
ab € 10,86
Eiermann Tischgestell
ab € 124,-
ab € 33,43
Plotterpapier 165 g seidenmatt, höchste Auf-lösung, b = 914, l = 35 m
ab € 123,75
16
ne direkte Abhilfe, weil er demadditiven Prinzip der Ausstellungverpflichtet bleibt. Durch dasreichhaltige Textmaterial, dasjede Arbeit erläutert, ergibt sichdem aufmerksamen Leser aberdie Möglichkeit, sich in die The-matik und Intention der einzel-nen Künstler und Künstlergrup-pen einzulesen.
Trotz der Materialfülle vonKatalog und Ausstellung werdennichtvisuelle Kontrolltechnikender Raumüberwachung in ctrl[space] nicht behandelt: EineAuseinadersetzung mit biometri-schen Verfahren, geographischerLokalisierung mit GPS, Raum-überwachung durch Sound-De-vices und die Diskussion umvernetzte Datenbanken, digitaleKryptographie und Datenschutzsucht man vergeblich, und auchim Katalog kommen sie nur amRande vor.
Der Ansatz der Ausstellung,Überwachungstechnologie imBenthamschen Sinne als kondi-tionierende Maßnahme zu be-trachten, vernachlässigt die kul-turelle Veränderung im Umgangmit Videoüberwachung. Video-überwachung ist längst auf un-terschiedlichsten gesellschaftli-chen Ebenen in neue Konzeptekulturellen Handelns integriertworden. Diese Transformationvon Surveillance zu “Happy-Veillance" wird in den Beiträgen“Big Brother" und “We Live inPublic" angeschnitten, aber nichtdiskutiert.
Die von Jürgen Mayer H. undSebastian Finckh entworfeneaber nicht realisierte Ausstel-lungsarchitektur wäre eine schö-ne Möglichkeit gewesen, dieseVeränderung in der Ausstellungräumlich erlebbar zu machen.Beim Eintreten in die Ausstellungsollte jeder Besucher einen klei-nen Sticker erhalten, der mit ei-nem Strichcode versehen ist. DasCCTV, das den Ausstellungsraumüberwacht (denn auch das ZKMist stets ein total überwachterRaum), kann über die integrierteSoftware jeden Besucher anhanddes Strichcodes identifizieren.Positionen, Bewegungen, Begeg-nungen und Verweildauer kön-nen so aufgezeichnet und ineiner Datenbank erfaßt werden.Die gefaltete Bodenstruktur hätteaber auch “blind spots”, alsonicht erfassbare Orte geschaffen.Beim Verlassen der Ausstellungsollte jeder Besucher einen Com-puterausdruck seiner Bewegungs-linien in Raum erhalten: das Be-sucherprofil als Andenken.
Kontrolltechnik wird nicht —nur — zur Überwachung einge-setzt, sondern mehr und mehrzur Inszenierung eines besonde-ren Erlebnisses. Beispiele für diekulturelle Aneignung von Über-wachungstechnologie und derenTransformation in ein kreatives
und performatives Medium gibtes viele — so auch die im ver-gangenen Herbst in New Yorkeröffnete Remote Lounge, in der70 Überwachungskameras und100 Monitore den Barbesucherndie Kontaktaufnahme unterei-nander ermöglichen sollen (www.remotelounge.com). ControlledEntropy Ventures, die das Kon-zept für die Remote Lounge ent-wickelt haben, stehen auch hin-ter der Weiterentwicklung des inctrl [space] vorgestellten Projekts“We Live in Public". 100 Tagelang hat Internet-UnternehmerJosh Harris sich — ebenso wieseine Freundin und alle Besucher— in seinem Loft von 32 Kamerasund 30 Mikrophonen ohne über-wachungsfreie Zonen filmen undvia Internet beobachten lassen.Aufgrund des großen Interesses— die Site hatte über 110.000Zugriffe — wird nun eine Home-Version von “We Live in Public"entwickelt, bei der ein Kamerakitmit Softwarepaket es den selbst-ernannten Mitgliedern der inter-nationalen voyeuristic commu-nity ermöglicht, ihr Leben 24Stunden am Tag live ins Netz zustellen (www.weliveinpublic.com).Mit dem neuen “We Live in Pu-blic" ist Videovoyeurismus und–exhibitionsimus in der kommer-zialisierten Populärkultur ange-kommen. In der kulturellen An-eignung von Videoüberwachungverschwimmen die Grenzen zwi-schen Kunst, Alltagskultur undKommerz. Überwachungstechnikwird in ein Mittel der Selbstin-szenierung transformiert, dasVerhältnis von Überwacher undÜberwachtem auf den Kopf ge-stellt. Was in Big Brother nochein vieldiskutiertes Experimentwar, wird alltägliche Wirklichkeit.
Auch wenn Ausstellung undKatalog nicht in der gesellschaft-lichen Realität der Gegenwartangekommen sind, sondern aufden Hügeln der kritischen Re-flektion verharren, ist der Katalogein spannendes und umfassendesNachschlagewerk, das künstleri-sche Arbeiten mit wissenschaft-liche Texte (z.B. von “Klassikern"wie Baudrillard, Colomina, De-leuze, Foucault oder auch SteveMann) zusammenbringt — undzwar nicht nur für diejenigen, diedie Ausstellung gesehen habenund mehr Hintergrundinforma-tion über die Vielzahl der gezeig-ten Arbeiten wünschen, sondernfür alle, die sich mit dem ThemaÜberwachung beschäftigen.
Friedrich von Borries
Thomas Y. Levin, Ctrl [space], ZKM,Karlsruhe / MIT Press, Cambridge,Massachusetts 2002, USD 39,95
http://ctrl-space.zkm.de/
Friedrich von Borries ist Architekt in Berlin.
Betrifft 158 ARCH+
Wir bedauern, einen Fotografennicht genannt zu haben. Das Fo-to “People 1:10” auf Seiten 110-111 ist von Martin Lauffer.
Buchtips
Abdruck Ausdruck – Max Boss-hard & Christoph Luchsinger. Deaedibus 3, Quart Verlag, Luzern2001, EUR 29,00
Altneu – Miroslav Sik. De aedi-bus 2, Quart Verlag, Luzern2000, EUR 29,00
Architekturzentrum Wien (Hrsg.),Sturm der Ruhe – What is Ar-chitecture? Verlag Anton Pustet,Salzburg 2001, EUR 18,90
Architone 012: gmp – Meinhardvon Gerkan und Volkwin Margerzählen, 2 CDs mit Buch, Archi-tone, Hamburg 2002, EUR 35
Diccionario Metápolis. Arquitec-tura Avanzada, Actar, Barcelona2001, EUR 40,87
Fecht, Tom, Dietmar Kamper(Hrsg.), Umzug ins Offene – VierVersuche über den Raum, Sprin-ger-Verlag, Wien 2000, EUR 31
Frank Lloyd Wright — ein foto-grafisches Porträt von TonyVaccaro, Kultur unterm Schirmc/o Büro für Gestaltung, Kir-chentellinsfurt 2001, EUR 17,90
Gustav Mesmer — Flugradbauer— Ikarus vom Lautertal genannt,Kultur unterm Schirm c/o Bürofür Gestaltung, Kirchentellins-furt 2001
Humpert, Klaus, Martin Schenk,Entdeckung der mittelalterlichenStadtplanung. Das Ende vomMythos der “gewachsenenStadt”, Theiss Verlag, Stuttgart2001, EUR 39,90
IN-EX projects (Hrsg.), Customize,Birkhäuser Verlag, Basel 2001, EUR 38,00
Klanten, Robert, Hendrik Heilige,Birga Meyer (Hrsg.), 72-dpi ani-me, Die Gestalten Verlag, Berlin2001, EUR 65,00
Kunz, Gerold, Hilar Stadler(Hrsg.), Waldhütten – Die Archi-tektur des Banalen, Scalo Verlag,Zürich 2001, EUR 22
17
ZeitungMeyer, Sibylle, Eva Schulze,Frank Helten, Bernd Fischer,Vernetztes Wohnen — Die Infor-matisierung des Alltaglebens,Edition Sigma Rainer Bohn Verlag, Berlin 2001, EUR 16,90
Mostafavi, Mohsen (Hrsg,), Ap-proximations. The Architectureof Peter Märkli, AA Publications,London 2002, GBP 30
Norman Foster and the BritishMuseum, Prestel Verlag, Mün-chen 2001, EUR 14,95
Pevsner, Nikolaus, et al., Lexikonder Weltarchitektur – CD-Rom,Directmedia Publishing, Berlin2000
Sack, Manfred (Hrsg.), Stadt imKopf. Hardt-Waltherr Hämer,mit einem DVD-Film von GerdConradt, Jovis 2002, EUR 25.80
Stasiowski, Frank A., Stayingsmall successfully. A Guide forArchitects, Engineers and DesignProfessionals, John Wiley & Sons,New York 2001, GBP 42,95
The Harvard Design School Gui-de to Shopping, Taschen Verlag,Köln 2002, EUR 45
Van der Woud, Auke, The Art ofBuilding — From Classicism toModernity: The Dutch Architec-tural Debate 1840-1900, Ash-gate, Hampshire 2001, GBP 35
Verb Processing. ArchitectureBoogazine, ACTAR, Barcelona2001, EUR 25
Welter, Volker M., James Lawson(Hrsg.), The City after PatrickGeddes, Peter Lang AG, Bern2000, EUR 56,20
Literatur zum ThemaBaier, Bernd (Hrsg.), Leicht BauKunst; Dokumentation des Sym-posiums im Fachgebiet Kon-struktive Gestaltung-Leichtbau,Universität Essen 2001
Dress, Andreas, Gottfried Jäger(Hrsg.), Visualisierung in Mathe-matik, Technik und Kunst, Vie-weg Verlag, Braunschweig 1999,EUR 27
Feuerstein, Günther, BiomorphicArchitecture — Menschen- undTiergestalten in der Architektur,Edition Axel Menges, Stuttgart2001, EUR 70
Frei Otto, Bodo Rasch, Gestaltfinden. Auf dem Weg zu einerBaukunst des Minimalen, EditionAxel Menges, Stuttgart 1995,EUR 48
Haeckel, Ernst, Kunstformen derNatur, Prestel Verlag, München1998, EUR 19,95
Hahn, Werner, Peter Weibel(Hrsg.), Evolutionäre Symmetrie-theorie, S. Hirzel. Wissenschaft-liche Verlagsgesellschaft, Stutt-gart 1996, EUR 34,80
Hargittai, István und Magdolna,Symmetrie – Eine neue Art, dieWelt zu sehen, Rowohlt Taschen-buch Verlag, 1998, EUR 13,50
Hildebrandt, Stefan, AnthonyTromba, Kugel, Kreis und Seifen-blasen — Optimale Formen inGeometrie und Natur, BirkhäuserVerlag, Basel 1996, EUR 45
Holgate, Alan, The Art of Struc-tural Engineering, Edition AxelMenges, Stuttgart 1997, EUR 86
Nachtigall, Werner, Kurt G. Blü-chel, Der große Buch der Bionik,DVA, München 2000, EUR 45
Isamu Noguchi, Sculptural De-sign, Vitra Design Museum, Weilam Rhein 2001, EUR 49,90
Konstruktionen von Natur —Von Blossfeldt zur Virtualität,Akademie der Künste, Verlag derKunst, Berlin 2001
Krätschmer, Wolfgang, HeikeSchuster (Hrsg.), Von Fuller biszu Fullerenen, Vieweg Verlag,Braunschweig 1996, EUR 34,95
Krausse, Joachim, Claude Lich-tenstein, R. Buckminster Fuller— Your Private Sky: Diskurs,Verlag Lars Müller, Baden 2001,EUR 49
Krausse, Joachim, Claude Lich-tenstein, R. Buckminster Fuller— Your Private Sky: Design alsKunst einer Wissenschaft, VerlagLars Müller, Baden 1999, EUR 49
Künzle, O. et al., Demonstratio-nen an Tragwerksmodellen, ETHZürich, Zürich 2001, EUR 32
natürlichkünstlich. Das VirtuelleBild, Jovis Verlag, Berlin 2001,EUR 25,80
Pearce, Peter, Structure in Natureis a Strategy for Design, MITPress, Cambridge 1978, EUR 38,40
Portoghesi, Paolo, Nature andArchitecture, Skira editore, Milan2000, EUR 85,90
Rapaport, Brooke K., Kevin L.Stayton, Vital Forms – AmericanArt and Design in the AtomicAge 1940-1960, Harry N. AbramsPublishers, New York 2001, USD 49,50
Scriba, C. J., P. Schreiber, 5000Jahre Geometrie, Springer Verlag,Berlin 2001, EUR 34,95
Stocker, Gerfried, ChristineSchöpf, Ars Electronica 99 – Life-Science, Springer-Verlag, Wien1999, EUR 17
Stoschek, Erwin P., DagmarSchönfeld, Computergraphik imSpannungsfeld zwischen Algori-thmus und Phantasie, VerlagHarri Deutsch, Thun 2000, EUR 34,80
Tarrasow, L., Symmetrie, Sym-metrie!, Spectrum AkademischerVerlag, Heidelberg 1999, EUR9,95
Türme sind Träume: der Killes-bergturm von Jörg Schlaich. av-Edition, Ludwigsburg 2001, EUR 39
Tzonis, Alexander, Liane Lefaivre(Hrsg.), Santiago Calatrava'sCreative Process, 2 Bde., Birkhäu-ser Verlag, Basel 2001, EUR 130
Vogel, Steven, Von Grashalmenund Hochhäusern, WILEY-VCHVerlag, Weinheim 2000, EUR 24,90
18
Überlagerung derKoordinatensystemedes Beckens vonArchaeopteryx undApatornis mit drei in-terpolierten Zwischen-stadien der Evolution.Durch Koordinaten-transformation könnenhypothetisch möglicheFormen generiert undmit tatsächlich vor-kommenden verglichenwerden.
aus: D’Arcy Thompson‘On Growth and Form’