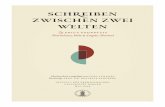Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen. Zwei Neufunde aus dem spätneolithischen Galeriegrab II...
Transcript of Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen. Zwei Neufunde aus dem spätneolithischen Galeriegrab II...
Herausgegeben vom
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz
in Verbindung mit dem
Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie
Sonderdruck aus
ArchäologischesKorrespondenzblatt
Jahrgang 41 · 2011 · Heft 3
Diese pdf-Datei ist nur zum persönlichen Verteilen bestimmt. Sie darf bis Oktober 2013 nicht auf einer Homepage im Internet eingestellt werden.
This PDF is for dissemination on a personal basis only. It may not be published on the world wide web until October 2013.
Ce fichier pdf est seulement pour la distribution personnelle. Jusqu’à octobre 2013 il ne doit pas être mis en ligne sur l’internet.
Paläolithikum, Mesolithikum: Michael Baales · Nicholas J. Conard
Neolithikum: Johannes Müller · Sabine Schade-Lindig
Bronzezeit: Christoph Huth · Stefan Wirth
Hallstattzeit: Markus Egg · Dirk Krauße
Latènezeit: Rupert Gebhard · Hans Nortmann · Martin Schönfelder
Römische Kaiserzeit im Barbaricum: Claus v. Carnap-Bornheim · Haio Zimmermann
Provinzialrömische Archäologie: Peter Henrich · Gabriele Seitz
Frühmittelalter: Brigitte Haas-Gebhard · Dieter Quast
Wikingerzeit, Hochmittelalter: Hauke Jöns · Bernd Päffgen
Archäologie und Naturwissenschaften: Felix Bittmann · Joachim Burger · Thomas Stöllner
Die Redaktoren begutachten als Fachredaktion die Beiträge (peer review).
Das Archäologische Korrespondenzblatt wird im Arts & Humanities Citation Index®
sowie im Current Contents®/Arts & Humanities von Thomson Reuters aufgeführt.
Übersetzungen der Zusammenfassungen (soweit gekennzeichnet): Loup Bernard (L. B.)
und Manuela Struck (M. S.).
Beiträge werden erbeten an die Mitglieder der Redaktion oder an das
Römisch-Germanische Zentral museum, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, [email protected]
Die mit Abbildungen (Strichzeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotos), einer kurzen Zusammenfassung und der
genauen Anschrift der Autoren versehenen Manuskripte dürfen im Druck 20 Seiten nicht überschreiten. Die
Redaktion bittet um eine allgemein verständ liche Zitierweise (naturwissenschaftlich oder in Endnoten) und
empfiehlt dazu die Richtlinien für Veröffentlichungen der Römisch-Germanischen Kommis sion in Frankfurt a.M.
und die dort vorgeschlagenen Zeitschriftenabkürzungen (veröffentlicht in: Berichte der Römisch- Ger ma nischen
Kommission 71, 1990 sowie 73, 1992). Hinweise für Autoren finden sich in Heft 1, 2009, S. 147ff.
ISSN 0342 – 734X
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
© 2011 Verlag des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsRedaktion und Satz: Manfred Albert, Hans Jung, Marie Röder, Martin SchönfelderHerstellung: gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH, Mainz
Das für diese Publikation verwendete Papier ist alterungsbeständig im Sinne der ISO 9706.
REDAKTOREN
GISELA WOLTERMANN · KERSTIN SCHIERHOLD
AKTUELLE ANALYSEMETHODEN AN BERNSTEINPERLEN.
ZWEI NEUFUNDE AUS DEM
SPÄTNEOLITHISCHEN GALERIEGRAB II
VON ERWITTE-SCHMERLECKE (KR. SOEST)
Seit 2009 finden Ausgrabungen in Schmerlecke bei Erwitte im Kreis Soest statt. Bisher sind von der Flur
»Hunnenbrink« drei spätneolithische Galeriegräber (Gräber I-III) bekannt 1, deren Erforschung wesentlicher
Teil eines DFG-Projekts zur »Genese und Struktur der Hessisch-Westfälischen Megalithik am Beispiel der
Soester Gruppe« ist 2. Zwei Anlagen werden zurzeit ausgegraben, die bereits in der ersten Phase der Doku-
mentation viele neue Erkenntnisse erbracht haben. Die Galeriegräber von Schmerlecke gehören zu einer
Gruppe von etwa 40 bautypologisch eng verwandten Anlagen der Wartbergkultur, die zwischen 3500 und
2800 v.Chr. besonders in Ostwestfalen und Nordhessen errichtet und genutzt wurden 3. Sie waren in den
anstehenden Boden eingesenkt und überhügelt, der Zugang erfolgte meist an der Schmalseite über einen
Vorraum (Typ Züschen); in Westfalen sind auch Zugangskonstruktionen mittels eines Gangs an der Längs-
seite nachgewiesen (Typ Rimbeck). Sie dienten als kollektive Grablegen: Die 2-3m breiten und meist
20-30m langen Kammern konnten bis zu 250 Bestattungen aufnehmen. Typisch für die hessisch-west -
fälischen Galeriegräber der Wartbergkultur ist ihre Beigabenarmut, die in auffallendem Gegensatz zur Bei -
gabensitte der nordwestlich benachbarten Trichterbecherkultur steht. Zwar reicht die Ausstattung von
Schmuck bestandteilen verschiedenster Art über Jagd- und Arbeitsausrüstung bis hin zu Keramikgefäßen,
doch treten die Beigaben mengenmäßig im Vergleich zu denen anderer kollektiv bestattender Gemein-
schaften z.T. weit zurück.
Eine in Galeriegräbern selbst unter diesen Gesichtspunkten verhältnismäßig selten nachgewiesene Form
des Schmucks sind Bernsteinperlen. Diese sind durch die neuen Forschungen nun auch in zwei der drei ge -
nannten Gräber von Schmerlecke belegt. Zwei Perlen aus Grab II wurden computertomographisch sowie
infrarotspektroskopisch untersucht. Die Ergebnisse erweitern den Kenntnisstand hinsichtlich ihrer Anwend-
barkeit auf Bernstein sowie im Vergleich mit bereits publizierten Daten.
BERNSTEINSCHMUCK IN GALERIEGRÄBERN – ZUM STAND DER FORSCHUNG
Eingangs seien einige quellenkritische Bemerkungen zur Überlieferung von Bernstein in den Galeriegräbern
erlaubt. Neben der schon erwähnten allgemeinen Beigabenarmut ist zunächst auf die lange Nutzungszeit
der Gräber von z.T. mehreren Hundert Jahren hinzuweisen: Die Nachbestattungen verursachten in den
meisten Fällen nachträgliche Verlagerungen bereits bestatteter Individuen und dadurch auch zugehöriger
Beigaben. Fundlagen von Artefakten in den Kollektivgräbern sind folglich allenfalls eingeschränkt zu inter-
pretieren. Als wichtiger Faktor ist ebenso die Grabungstechnik, mit der die jeweiligen Gräber dokumentiert
wurden, zu betrachten. Viele hessisch-westfälische Galeriegräber sind bereits Ende des 19. bzw. zu Beginn
des 20. Jahrhunderts ausgegraben worden. Zu dieser Zeit wurde vor allem Wert auf die mög lichst exakte
Dokumentation des Grabbaus gelegt; demgegenüber ist das Kammerinnere bzw. die genaue Aufnahme
345ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
der Lage der Funde im Grab eher vernachlässigt worden. Meist ordnete man einen kompletten Aushub an
und sammelte die Funde dann ab. Dass dabei vieles übersehen wurde, zeigt beispielsweise die Nachunter-
suchung des Aushubs des Grabes von Rimbeck (Kr. Höxter) 4. Die uns heute bekannten Funde von Bern -
steinartefakten aus Galeriegräbern stammen fast ausnahmslos aus Grabungen, die auch den Kammerinhalt
möglichst genau dokumentierten 5; nur aus dem bereits in den 1830er-Jahren geöffneten Grab von
Beckum I (Kr. Warendorf) ist eine ringförmige, heute verschollene Perle überliefert 6. Gräber, die trotz guter
Erhaltung und aufwendiger Dokumentationstechnik keine Bernsteinartefakte enthielten, sind aber den -
noch vereinzelt bekannt, so Warburg III (Kr. Höxter; Grabung 1990/91) und Völlinghausen (Kr. Soest;
Grabung 1991-93) 7.
Schließlich ist noch auf das Material selbst kurz einzugehen: Inwiefern Bernstein als selten zu bekom-
mender Schmuck auch zu Grabraub verführt haben kann, ist letztlich nicht nachzuweisen. Ferner müssen
die Erhaltungsbedingungen für das fossile Harz in Betracht gezogen werden (s.u.; vgl. auch die Ausfüh-
rungen zu den Schmerlecker Exemplaren).
Aus neun Galeriegräbern waren bis zu den Grabungen im Jahr 2009 insgesamt 71 sicher zuweisbare Bern -
steinartefakte bekannt. Eine weitere, zylindrisch geformte Perle, die bei der Dokumentation des zer störten
Grabes von Oberzeuzheim (Lkr. Limburg-Weilburg) geborgen wurde, ist aufgrund der unsicheren Fund -
umstände möglicherweise auch latènezeitlich einzustufen 8. Die Fundverteilung schwankt sehr stark: Allein
auf das im ostwestfälischen Almetal gelegene Grab Wewelsburg I (Kr. Paderborn) entfallen bereits 36
Perlen, weitere 21 Exemplare sind aus dem mittelhessischen Grab von Niedertiefenbach (Lkr. Limburg-
Weilburg) bekannt. Alle anderen Gräber weisen nur ein bis vier Perlen auf (Warburg IV, Kr. Höxter: vier
Exemplare; Altendorf, Schwalm-Eder-Kreis: drei Exemplare; Beckum I, Kr. Warendorf; Calden I und II,
Lkr. Kas sel; Warburg I, Kr. Höxter: je ein Exemplar). Dieses quantitative Ungleichgewicht ist offenbar nicht
auf die Grabungstechnik zurückzuführen.
Es handelt sich bis auf wenige Ausnahmen um scheibenförmige bis zylindrische Perlen mit einem mittleren
Durchmesser von 1-2 cm (Abb.1, 1-3). Größere Stücke als diese mit Durchmessern von 3-4 cm oder knapp
346 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
Abb. 1 1-5 Bernsteinperlen aus dem Galeriegrab I von Wewelsburg (Kr. Paderborn). – (Nach Günther / Viets 1992, 117 Abb. 13, 1-3;20; 21). – M. = 1:1.
darüber sind äußerst selten, sie kommen nur je zweimal in Wewelsburg I
und in Niedertiefenbach vor. Eine Besonderheit unter den scheibenförmigen
Perlen bilden zwei große Fragmente mit peripheren kleinen Durchlochungen
aus Wewelsburg I (Abb.1, 4-5); sie werden auch als Schmuckscheiben be -
zeichnet 9.
Neben den scheibenförmigen Perlen treten vereinzelt weitere Formen auf:
Ein Exemplar aus dem Grab IV von Warburg besitzt einen D-förmigen
Querschnitt mit einem Durchmesser von 3,3 cm. Eine Perle in Form einer
Miniaturaxt ist aus dem Grab von Calden I bekannt geworden (Abb. 2; zu
Vergleichsfunden s.u.) 10.
Trotz der angesprochenen Schwierigkeiten bei der Interpretation der Fund-
lagen von Bernsteinperlen in den Gräbern sollen die wenigen bekannten hier
kurz vorgestellt werden. Die über 20 Perlen von Niedertiefenbach verteilen
347ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
sich fast alle auf drei von den Ausgräbern erkannte Bestattungsschichten (Schicht 4-6). In diesen Schichten
fanden sich auch einige ebenfalls sehr selten im Beigabenkanon der Wartbergkultur auftretende Kupfer -
spiralen. Analog zu einem Fund aus dem Megalithgrab von Buinen (prov. Drenthe) in den Niederlanden
wurden Bernsteinperlen und Kupferspiralen von den Ausgräbern als Teile einer Kette gedeutet 11. Eine der
zwei großen Bernsteinperlen fand sich zwischen den drei obersten, sprich jüngsten Bestattungsschichten,
sodass man bei den großen Exemplaren von Niedertiefenbach vielleicht auch auf eine Trageweise als Einzel-
stück an einer Kette schließen kann. Anders verhält es sich in Wewelsburg I: Hier lagen drei der vier großen
Bernsteinperlen bzw. Schmuckscheiben etwa in der Mitte der Kammer an der südlichen Wand bei sam -
men 12. Daneben fanden sich drei weitere kleinere Perlen. Diese Fundsituation könnte auf eine gemeinsame
Trageweise hindeuten. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe lag eine Fuchsunterkieferhälfte; diese wurden offen-
sichtlich als Amulette getragen 13. Mehrfach sind in Wewelsburg I einzelne Perlen auch zu sam menliegend
mit einem oder mehreren durchlochten Tierzahnanhängern nachgewiesen, sodass eine Kombination von
Bernsteinperle und Tierzahnanhänger(n) an einer Kette oder auch als Applikation an der Kleidung durchaus
vorstellbar erscheint. Eine ähnliche Fund situation ist aus dem Grab von Warburg IV bekannt: Hier kam die
einzige Bernsteinperle neben einem in der Warburger Nekropole allgemein nur selten nachgewiesenen
durchlochten Tierzahnanhänger zutage 14. Im Grab von Altendorf lagen die drei von dort be kannten Exem-
plare nach Wilhelm Jordan nahe beieinander 15; er äußerte im Grabungsbericht sogar die Vermutung, dass
sie aufgrund ihrer sehr ähnlichen Maße zu einem Ensemble gehört haben könnten 16. Für keinen der bisher
vorgestellten Funde ist eine Zuweisung zu einem Individuum möglich, sodass keine Aussagen hinsichtlich
einer sozialen Differenzierung einzelner Personen im Grab getroffen werden können. Noch schwerer bis gar
nicht zu interpretieren sind Perlen, die einzeln gefunden werden, denn sie können im Laufe der Belegungs-
zeit noch stärker verlagert worden sein als mögliche Ensembles, die durch die Kette wohl einen längeren
Zeitraum zusammengehalten worden sind. Ein solcher Fall ist die axtförmige Perle von Calden I (Abb. 2).
Sie fand sich auf der Kammersohle und könnte nach Otto Uenze sowohl zu Schädel 13 als auch zu Skelett 5
gehört haben 17; de facto ist eine Zugehörigkeit, welcher Art auch immer, nicht mehr nach zuvollziehen.
Dies gilt ebenso für die Exemplare von Warburg I 18.
DIE BERNSTEINPERLEN VON SCHMERLECKE
Die beiden Perlen, die hier besprochen werden sollen, wurden in Grab II entdeckt 19. Um solche Kleinfunde
möglichst vollständig und in ihrem eventuell noch vorhandenen ursprünglichen Zusammenhang bergen zu
Abb. 2 Axtförmige Bernstein -perle aus dem Galeriegrab I vonCalden (Lkr. Kassel). – (Nach Raet -zel-Fabian 2000, Taf. 52, 42). –M. = 1:1.
können, sind hohe Anforderungen an die Grabungstechnik gestellt.
Der Kammerinhalt wird mittels eines Quadrantensystems von 50cm
Kantenlänge untersucht; Plana werden in einem Abstand von 5 cm
dokumentiert. Alle Funde werden tachymetrisch erfasst. Die in
Schmerlecke aufgedeckte Fundsituation ent spricht dem, was bereits
aus vielen Kollektivgräbern bekannt ist: Knochen, Steine aus der
Konstruktion und Beigaben liegen, zunächst ohne erkennbare Regel,
in der Kammer verstreut. Dies trifft auch auf die beiden Bernstein-
perlen zu.
Die gut erhaltene Bernsteinperle (F 2637; vgl. Abb. 3) haftete an
einem einzeln gefundenen menschlichen Wirbel 20 und kam bereits
kurz unter der Pflugschicht in Planum 3, etwa 45cm unter der Ober-
fläche, zutage. Die solitäre Fundlage des Wirbels, der bisher keinem
Individuum zugeordnet werden kann, und das Fehlen weiterer Perlen
oder anderer Beigaben in unmittelbarer Umgebung lassen keine
348 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
Abb. 3 Bernsteinperle (F 2637) ausdem Galerie grab II von Schmerlecke(Kr. Soest). – (Zeichnung K. Schierhold). – M. = 2:1.
weiteren Interpretationen zu. Die stark korrodierte Bernsteinperle (F 4946; vgl. Abb. 8) fand sich nahe der
Kammersohle; sie lag im unteren Bereich (etwa 65-70cm unter der Oberfläche) einer über 25cm hohen
Ansammlung einer großen Menge menschlicher Knochenreste, die nach vorläufigen Erkenntnissen wohl
zum Ende der Be legungszeit des Grabes auf einer Fläche von nur 1m2 aufgehäuft wurden. Dabei ging
augenscheinlich jeg licher anatomischer Verband verloren, sodass eine Zuweisung zu einem Individuum
oder auch nur zu eventuell zugehörigen weiteren Beigaben auch hier aller Wahrscheinlichkeit nach unmög-
lich bleibt. Die beiden Bernsteinartefakte liegen etwa 1,7m voneinander entfernt.
Aufschlussreich ist hingegen, dass die Maße der Perlen sich kaum unterscheiden: Der Durchmesser sowohl
des gut erhaltenen Stücks als auch des stark korrodierten liegt bei 1,3 cm; der Durchmesser des Bohrlochs
beträgt bei beiden 0,4 cm. Allein die Dicke des korrodierten Exemplars liegt mit 0,4 cm leicht über der -
jenigen des besser erhaltenen; hier beträgt sie 0,3 cm. Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Gräbern, wo
ebenfalls sehr ähnlich große Perlen auch nahe beieinanderliegend gefunden wurden, könnte man in
gleicher Weise hier darauf schließen, dass die beiden Perlen trotz ihrer unterschiedlichen Fundlagen im
Grab, die ja in beiden Fällen eindeutig als sekundär zu bezeichnen sind, einmal zusammengehört haben
könnten.
Vergleichsfunde
Scheibenförmige Bernsteinperlen, wie sie in Grab II von Schmerlecke geborgen werden konnten, sind die
häufigste Perlenform in den hessisch-westfälischen Galeriegräbern. Ihr Durchmesser liegt zwischen 0,9 und
3,6cm, in der Regel zwischen 1,0 und 2,2 cm. Solche kleinen scheibenförmigen Perlen sind keine typischen
Schmuckformen der Wartbergkultur, sondern ein kulturverbindendes Merkmal der spätneolithischen Grup -
pen Norddeutschlands und der Mittelgebirgszone. Auch andere Bernsteinperlen der Wartbergkultur lassen
keine eigenständige Entwicklung erkennen, sondern zeigen Kontakte mit anderen Kulturen an: Aus dem
Galeriegrab von Kruft (Lkr. Mayen-Koblenz) stammt eine zylindrische Perle mit schwach ge wölb ten Seiten,
die im Kontext der Wartbergkultur eine Ausnahme darstellt und auf die Trichterbecherkultur verweist
(Abb. 4). Axtförmige Bernsteinperlen, wie das Exemplar aus dem Galeriegrab I von Calden (vgl. Abb. 2),
sind ebenfalls hauptsächlich in Norddeutschland verbreitet. Sie bilden eine quantitativ kleine und formal
sehr heterogene Gruppe, aus der keine direkte Parallele zu dem hessischen Stück bekannt ist. Von den
anderen axtförmigen Perlen unterscheidet sich die Miniaturaxt von Calden durch ihr stark verschmälertes
Schneidenprofil. Dieses stellt sie in die Nähe der sogenannten spitzhauenförmigen Bernsteinperlen. Vermut-
lich handelt es sich um den Rest einer solchen Perle, die entlang ihrer Zentrallochung zerbrach. Nach ihrer
Fragmentierung wurde die erhaltene Hälfte mittels einer Sekundärbohrung weiterverwendet. Das Profil
dieses ursprünglichen Bohrkanals ist im »Nacken« der Caldener Perle noch gut erkennbar. Rekonstruiert
man die fehlende Perlenhälfte symmetrisch, hätte die originäre spitzhauenförmige Perle eine Länge von
ca. 5,6 cm besessen. Spitzhauenförmige Perlen treten bevorzugt in mecklenburgischen Megalithgräbern
auf, wo sie mit Funden der Trichterbecher- und der Kugelamphorenkultur vergesellschaftet sind. Das größte
Exemplar mit 6,57cm Länge lieferte die Plattenkammer der Walternienburger Kultur von Schortewitz-
»Windmühlenberg« (Lkr. Anhalt-Bitterfeld). Diese Miniaturspitzhaue war ebenfalls entlang ihrer Zentral-
bohrung zerbrochen, dann aber mittels vier kleinerer Sekundärbohrungen repariert und offenbar in ihrer
ursprünglichen Form weiter genutzt worden (Abb. 5). Eine den spitzhauenförmigen Perlen nahestehende
Bernsteinapplikation von 8,5 cm Länge (Abb. 6) kam in einem Flachgrab der Nekropole von Schwerin-
Ostorf zutage. Solche mehrfach gelochten flachen Objekte, die vermutlich als Kleidungsbesatz dienten,
sind eng mit den Funden der Kugelamphorenkultur assoziiert. Auf denselben kulturellen Kontext verweisen
die großen Bernsteinscheiben, das sind scheibenförmige Perlen mit einem Durchmesser von mind. 3,0 cm.
Sowohl Applikationen als auch große Bernsteinscheiben fanden sich in dem Galeriegrab der Wartberg-
kultur von Wewelsburg I, allerdings ist eine sichere stratigraphische Zuweisung der Bernsteinartefakte zu
einem Be legungshorizont nicht möglich. Keramikfragmente aus derselben Anlage belegen Nachbestat-
tungen durch Angehörige der Kugelamphorenkultur 21.
Trotz unterschiedlicher Überlieferungsbedingungen zeigt das ungleichmäßig verteilte Auftreten von Bern -
steinobjekten in den Galeriegräbern deutlich (Abb. 7), dass dieser Rohstoff nur einem beschränkten Per -
sonenkreis zur Verfügung stand. Die Bernsteinartefakte der Wartbergkultur lassen darüber hinaus ein enges
349ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Abb. 4 Zylindrische Bernsteinperle aus dem Galeriegrab vonKruft (Lkr. Mayen-Koblenz). – (Zeichnung G. Woltermann; nachvon Berg 1994, Abb. 6, 12). – M. = 1:1.
Abb. 5 Spitzhauenförmige Bernsteinperle aus der Plattenkistevon Schortewitz-»Windmühlenberg« (Lkr. Anhalt-Bitterfeld). –(Nach Müller 2001, Abb. 221, 12-13). – M. = ca. 1:1.
Abb. 6 Bernsteinapplikation aus Grab 7/61 vonSchwerin-Ostorf. – (Nach Schuldt 1962, Abb. 104c). –M. = 1:1.
Kommunikationsnetz mit den nördlich bzw. nordöstlich positionierten spätneolithischen Kulturgruppen
erkennen, vor allem mit der Trichterbecher- und der Kugelamphorenkultur. Auch nimmt die Anzahl der
Bernsteinobjekte in den Galeriegräbern mit dem Horizont der ersten Funde der Kugelamphorenkultur in
der jüngeren Wartbergkultur zu (Niedertiefenbach; Wewelsburg I). Die erkennbare Einflussnahme der
Kugelamphorenkultur auf die westdeutsche Bernsteinnutzung erfolgt vor dem Hintergrund einer Verdich-
tung der interkulturellen Kontakte nach Mitteldeutschland. Dort lässt sich die Entwicklung großer Bern -
steinschmuckstücke auf ein gesteigertes Repräsentationsbedürfnis der dort ansässigen spätneolithischen
Gesellschaften projizieren.
Der Erhaltungszustand der Schmerlecker Perlen
Die jahrtausendelange Einbettung im Sediment hat deutliche Spuren an den Perlen aus dem Galeriegrab II
von Schmerlecke hinterlassen. Wie die meisten Bernsteinobjekte aus Megalithgräbern sind sie von einer
350 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
Abb. 7 Verbreitung der Kollektivgräber der Wartbergkultur. – � Gräber mit Bernsteinobjekten; � Gräber ohne Bernsteinobjekte. –1 Ostbevern-Schirl (?). – 2-3 Beckum I-II. – 4 Lippborg. – 5 Ostönnen. – 6 Hiddingsen. – 7-9 Erwitte-Schmerlecke I-III. – 10 Völling -hausen. – 11 Uelde. – 12 Wünnenberg(?). – 13 Brenken. – 14-15 Wewelsburg I-II. – 16 Neuhaus. – 17-18 Kirch borchen I-II. – 19 Etteln. – 20-21 Henglarn I-II. – 22-23 Atteln I-II. – 24 Rimbeck. – 25 Hohenwepel. – 26 Borgentreich-Großeneder. – 27-31 War-burg I-V. – 32-33 Calden I-II. – 34 Altendorf. – 35-38 Züschen I-IV. – 39 Gleichen. – 40 Gudensberg. – 41 Lohra. – 42 Mu schen heim. –43 Beselich-Niedertiefenbach. – 44 Oberzeuzheim. – 45 Niederzeuzheim. – 46 Kruft. – (Nach Günther 1997, Abb.1 mit Er gän zungen;Kartengrundlage: Schweizer Weltatlas).
tiefen Korrosionskruste überzogen. Bei der besser erhaltenen Perle (F 2637; vgl. Abb. 3) hat sich eine Rinde
von erdiger, rötlich brauner Farbe an der Oberfläche gebildet. Diese ist von makroskopisch sichtbaren Rissen
überzogen und an mehreren Stellen abgeplatzt, was den sich darunter befindlichen dunkelrotbraunen Kern
sichtbar werden lässt. Die Verwitterungskruste liegt nur noch relativ locker auf dem Kernmaterial auf. Der
Kern ist ebenfalls bereits oxidiert und mit einem feinen Netz aus Rissen durchzogen 22.
Die z.T. gravierenden Unterschiede im Erhaltungszustand der prähistorischen Bernsteinobjekte werden
bestimmt durch einen komplexen Korrosionsprozess. Bei Kontakt mit Sauerstoff werden die Bindungen des
in den Bernsteinmolekülen angelagerten Kohlenstoffs gelöst. Durch diese Aufspaltung des molekularen
Gerüsts verliert der Bernstein an Festigkeit und wird anfälliger für chemische Einflüsse. Flüchtige Terpene
wie Campher und Borneol dringen kontinuierlich an die Oberfläche des Objektes, wo sie langsam aus -
gasen. Durch diesen Masseverlust wird das Molekülnetz destabilisiert, und es entstehen neue Angriffs -
flächen für die Oxidation. Sichtbar wird dieser Vorgang in der Rissbildung, die oberflächlich beginnt und
immer tiefer bis zum Kern des Artefakts vordringt. Hierbei verstärken sich die oxidierende Wirkung von
Luft sauerstoff und der Volumenschwund infolge der Sublimation flüchtiger Stoffe gegenseitig. Verschie-
dene Faktoren, wie etwa UV-Strahlung, wirken zudem beschleunigend auf diesen Vorgang. Die Bernstein-
oxidation schreitet umso schneller voran, je lockerer und sauerstoffreicher der Boden ist 23. In einem gut
durchlüfteten Sandboden zersetzen sich kleine Bernsteinobjekte fast wie im Zeitraffer, eine Lagerung in
feuchtem Milieu verzögert dagegen die Verwitterung. Das hängt nicht nur mit dem geringeren Sauerstoff-
gehalt des Wassers zusammen, demzufolge der Oxidationsprozess langsamer abläuft als in trockener
Umgebung, sondern auch mit dem Wasserdruck, der das Ausgasen von flüchtigen Stoffen aus dem Mate-
351ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Abb. 8 Schmerlecke (Kr. Soest). CT-Schnittbilder der stark verwitterten Perle (F 4946): Ansicht im Grundriss, im Profil und in der 3D-Simulation. – (Abbildung CTM-do GmbH, Dortmund).
rial verzögert. Neben den Lagerungsbedingungen (Bodentyp, Bodenfeuchtigkeit, Luftdurchlässigkeit etc.)
hängt der Zersetzungsvorgang noch von einer Reihe weiterer Parameter ab, etwa vom Rohmaterial und
seiner anthropogenen Behandlung (Oberflächenbearbeitung, Abnutzung). Diesen komplexen Faktoren ist
geschuldet, dass Bernsteinartefakte aus einem Befund sehr unterschiedliche Verwitterungsgrade aufweisen
können, wie bei den beiden Perlen aus dem Schmerlecker Galeriegrab. Statt eines dunkelrotbraunen Kerns
wie beim ersten Stück waren bei der zweiten Perle (F 4946; vgl. Abb. 8) nur noch wenige, etwas dunklere
Stellen in der sandig-hellen Verwitterungskruste zu erkennen. Verwitterungsrisse hatten das Exemplar in
kleinste Fragmente aufgesplittert, die größtenteils lose im Sediment saßen. Da eine Freipräparation auf -
grund des fragilen Zustandes nicht infrage kam, wurde eine zerstörungsfreie Technik gewählt, um nähere
Informationen über Form und Maße des Bernsteinartefakts im Sediment zu gewinnen.
Analyse mittels Computertomographie (CT)
Dank der Unterstützung der Firma CTM-do GmbH in Dortmund konnte die stärker verwitterte Perle
(F 4946; vgl. Abb. 8) mittels industrieller Computertomographie (Micro CT) untersucht werden, um so
detaillierte Informationen über die Form, Lochung, Oberflächenstruktur und verwitterungsbedingte
Strukturmerkmale zu gewinnen 24. Bei den schichtweise erfolgten Scans werden die unterschiedlichen
Absorptionseigenschaften verschiedener Materialien genutzt. So setzt sich die optisch nur schwer zu iden-
tifizierende Bernsteinperle im Graustufenbild erkennbar von dem umgebenden Sediment ab. In den 3D-
realisier ten Schichtbildstapeln wird der Aufbau einer von Rissen durchzogenen scheibenförmigen Perle
deutlich, die durch ihre Lagerung im Sediment leicht deformiert wurde (Abb. 8). Die äußeren Kanten sind
abgerundet, die zentrale Lochung annähernd zylindrisch. Deutlich sind die Verwitterungsstrukturen
erkennbar, die die Perle mit einem dichten Netz von Rissen und größeren Bruchstellen überziehen. Der
Oxidationsprozess hat bereits das gesamte Exemplar durchdrungen, nur noch kleine Reste des Kerns sind
geringfügig oxidiert. Durch die CT wird deutlich, wie stark das fossile Harz in der Bodenlagerung den
Verwitterungseinflüssen ausgesetzt war. Eine solche Information hätte man mittels traditioneller Präpara-
tionsmethoden nicht erhalten, da eine völlige Fragmentierung des Objekts bei mechanischer Behandlung
zu erwarten war.
Infrarotspektroskopische Untersuchung
Die Infrarotspektroskopie (IRS) ist ein seit den 1960er-Jahren in der archäologischen Forschung auf Bern -
steinartefakte angewandtes Verfahren der optischen Spektroskopie 25. Diese Analysemethode nutzt die un -
ter schiedliche Reaktionsfähigkeit des Probenmaterials auf elektromagnetische Strahlung 26. Dabei wird die
Probe mit einer Lichtquelle im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums bestrahlt, das auf
charakteristische Weise von dem Probenmaterial absorbiert wird. Die dadurch angeregten intermolekularen
Bewegungen werden in Form von Absorptionsbanden in einem IR-Spektrum registriert 27. Archäologisch
am interessantesten ist der Wellenbereich zwischen 4 000 und 650cm–1, die sogenannte fingerprint region.
Hier zeigte sich bei dem Spektrum der Schmerlecker Perle (F 2637; vgl. Abb. 3) ein typischer Kurvenverlauf
bei 1250-1180cm–1 in Form einer kleinen Schulter. Die Massenuntersuchungen von Arte- und Geofakten
aus Bernstein durch C. W. Beck und seine Forschergruppe am Vassar College (Poughkeepsie, New York)
lassen erkennen, dass dieser Kurvenverlauf nur bei baltischem Bernstein zu finden ist, daher erhielt dieser
charakteristische Teil des Spektrums die Bezeichnung »Baltische Schulter« 28. Keine der nicht-baltischen
Bernsteingruppen zeigt diese Schulter. Bei der Interpretation der Spektren muss allerdings berücksichtigt
werden, dass sowohl der Erhaltungszustand des Objekts als auch die ins Material eingedrungenen Stoffe
352 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
(Silikate, Sulfate, Phosphate, Konservierungsmittel etc.) Einfluss auf die Aussagekraft der Absorptionskurve
nehmen 29.
Die besser erhaltene Perle aus Schmerlecke (F 2637) wurde mittels Fourier-Transform-Spektroskopie (FTIR),
einer speziellen Variante der Infrarotspektroskopie, die sich inzwischen als Standardmethode zur Bernstein-
analyse etabliert hat 30, untersucht. Als Probenmaterial dienten 2mg von dem Bernsteinartefakt, die mit
353ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Abb. 9 Infrarotspektro skopisches Spektrum der erhaltenen Bernsteinperle (F 2637) aus Schmerlecke (Kr. Soest). – (Diagramm AmberRe search Labora tory, Vassar College, Spektrum Nr. 8159).
Abb. 10 Infrarotspektro skopisches Spektrum eines Bernsteinrohlings aus einer Kiesgrube bei Sarstedt (Lkr. Hildesheim). – (DiagrammInstitut für Organische Chemie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster).
Kalium-Bromid vermischt und zu einem Pressling geformt wurden. Für ein Vergleichsspektrum wurde ein
Rohbernstein aus einer Kiesgrube bei Sarstedt (Lkr. Hildesheim) untersucht 31. Beide Proben konnten an -
hand der typischen »Baltischen Schulter« eindeutig als baltischer Bernstein identifiziert werden 32 (Abb. 9-10). Die bisher nur sehr schmale quantitative Basis der IR-Untersuchungen von neolithischen Bernstein-
perlen 33 wird somit erstmals durch ein Artefakt aus einem Galeriegrab der westdeutschen Mittelgebirgs-
landschaft bereichert.
DIE BINNENLÄNDISCHEN LAGERSTÄTTEN DES BALTISCHEN BERNSTEINS UND IHRE PRÄHISTORISCHE NUTZUNG
Als sogenannter baltischer Bernstein wird eine Bernsteinvarietät bezeichnet, die den Großteil der europäi-
schen Bernsteinvorkommen bildet. Infolge glazialer und postglazialer Umlagerungsprozesse umfasst ihr
Verbreitungsgebiet den östlichen bis südwestlichen Ostseeraum, Nordpolen, Norddeutschland, Dänemark,
die Niederlande und die südöstliche Nordsee bis an die englische Ostküste. Die maximale südliche Distri -
butionsgrenze entspricht den Haupteisrandlagen der beiden am weitesten vorgedrungenen Glazialen
(Elster- und Saalekaltzeit bzw. Drenthestadium) 34. Im Zuge der Aufarbeitung von Tertiärsedimenten durch
die pleistozänen Inlandvereisungen wurden größere bernsteinführende Schichtpakete aus dem südlichen
Ostseeraum von Gletschern mitgeschleift, abgelagert und erodiert. Darauf folgte in der Regel eine Um -
lagerung in fluviatile Sedimente durch gletscherbegleitende Schmelzwässer und postglaziale Prozesse 35.
Die Konzentration von Rohbernstein entlang den pleistozänen Hauptentwässerungsbahnen, allen voran
Unterlauf und Mündungsgebiet der Elbe, spiegelt die entscheidende Rolle des Wassertransports bei der
binnenländischen Verbreitung des fossilen Harzes wider.
Neuzeitliche Fundmeldungen bestätigen die oberflächliche Zugänglichkeit dieser natürlichen »Bernstein-
nester« in Norddeutschland 36. Eine prähistorische Nutzung der binnenländischen Depots ist daher generell
nicht auszuschließen, zumal sich das Distributionsgebiet dieser regionalen Lagerstätten auffällig mit dem
Verbreitungsraum der bernsteinführenden Trichterbechergruppen und anderer spätneolithischer Kulturen
in Norddeutschland deckt, was die Vermutung nahelegen würde, das lokal zur Verfügung stehende Mate-
rial sei für den neolithischen Bernsteinschmuck verwendet worden. Die Entwicklung der neolithischen
Bernsteinnutzung deutet jedoch vielmehr darauf hin, dass binnenländische Vorkommen eher eine unter -
geordnete Rolle bei der Rohstoffversorgung spielten: Während der Trichterbecherkultur setzte eine süd -
wärts gerichtete Ausbreitung der Bernsteinverwendung über ganz Norddeutschland ein. Die Wartberg-
kultur tradierte die Sitte des Bernsteinschmucks über die natürliche Distributionsgrenze der Eisrandlagen
hinaus bis in den südlichen Raum der hessisch-westfälischen Galeriegräber. Eine Bernsteinnutzung durch
ältere, bis in die west fälische Bucht vordringende, neolithische Gruppen wie Linearbandkeramik, Rössener
Kultur und Michelsberger Kultur erfolgte dagegen nicht, hier spielte möglicherweise die fehlende Anbin-
dung an die Roh stoffvorkommen der Nord- und Ostseeküsten eine entscheidende Rolle 37. Auch in anderen
Regionen mit bekannten Lokalitäten, wie etwa in der Altmark, bestimmen kulturspezifische Faktoren das
Auftreten von bernsteinführenden Befunden 38. Demnach lässt sich kein signifikanter Zusammenhang
zwischen der Verbreitung der binnenländischen Rohstoffvorkommen und dem neolithischen Bernstein-
schmuck erken nen. Vielmehr zeigt sich eine chronologisch differenzierte prähistorische Nutzung des
fossilen Harzes, die in erster Linie von kulturellen und sozialen Parametern bestimmt wurde.
354 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
Anmerkungen
1) Schierhold / Baales / Cichy 2010. – Schierhold im Druck.
2) Das Projekt wird von der Westfälischen Wilhelms-UniversitätMünster, der Georg-August-Universität Göttingen und derLWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, durch -geführt und ist Teil des DFG-Schwerpunktprogramms 1400»Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. Zur Ent-stehung und Entwicklung neolithischer Großbauten underster komplexer Gesellschaften im nördlichen Mitteleuropa«.
3) Vgl. auch Schierhold im Druck.
4) Das Grab wurde 1906 von Alfred Götze ausgegraben, derKammerinhalt ausgehoben und durchgesehen. – Trotz ver-hältnismäßig zahlreich dokumentierter Funde, die allerdingsnur z.T. publiziert wurden (Götze 1908. – Schierhold imDruck), konnte Klaus Günther 1994, fast 90 Jahre später,noch viele qualitätvolle Funde bergen (Günther 2007. –Schierhold im Druck). Ein Beitrag zur Forschungsgeschichtedes Grabes von Rimbeck ist in Vorbereitung.
5) Altendorf, Schwalm-Eder-Kreis (Grabung W. Jordan 1934). –Calden I, Lkr. Kassel (Grabung O. Uenze 1941). – Nieder -tiefenbach, Lkr. Limburg-Weilburg (Grabung K. Wurm u.a.1961). – Wewelsburg I, Kr. Paderborn (Grabung K. Günther /M. Viets 1986/87). – Warburg I, Kr. Höxter (Grabung K. Gün -ther 1987-89). – Calden II, Lkr. Kassel (Grabung D. Raetzel-Fabian 1990-92). – Warburg IV, Kr. Höxter (Grabung K. Gün -ther 1992). – Eine zylindrische Perle, die im Bereich des zerstörten Grabes von Oberzeuzheim (Lkr. Limburg-Weilburg)ge funden wurde, könnte auch aus latènezeitlichen Zusam -men hängen stammen (Grabung S. Gütter 1986).
6) Erhard 1836, 22.
7) Die Gräber des Altenautals bei Paderborn (Atteln I und II, Heng larn I und II, Kirchborchen I und II, Etteln) wurden in den1970er- und 1980er-Jahren von K. Günther vor allem hinsicht-lich ihrer Architektur untersucht; die Ausgrabungen der Kam-merinhalte, die z.T. bereits von August Stieren in Atteln II undHenglarn II initiiert wurden, erbrachten keine Bernsteinarte-fakte. Der Holzbau Warburg II, der nicht völlig zweifelsfrei alsGrab interpretiert werden kann, enthielt ebenfalls keinenBernstein (Günther 1997). – Erwähnt werden sollen noch dieGräber von Muschenheim, Lkr. Gießen (Nachuntersuchungvon M. Menke, vgl. Menke / Aichinger 1993), und Lohra, Lkr.Marburg-Biedenkopf (Uenze 1954), die ebenfalls vergleichs-weise aufwendig ausgegraben wurden und keine Bernstein -artefakte erbrachten, allerdings auch kaum anderes Tracht -zubehör.
8) Kriesel in Vorb., 162.
9) Günther / Viets 1992, 117.
10) Uenze 1951; vgl. auch Raetzel-Fabian 2000, 62-65.
11) Wurm u.a. 1963, 71.
12) Günther / Viets 1992, Beil. 3. Im Text werden die Fundlagennicht erwähnt.
13) Schierhold im Druck, Kap. 6.4.2.2.
14) Günther 1997, 106 Abb. 93.
15) Jordan 1954, 20.
16) Jordan 1934, 60.
17) Uenze 1951, 26.
18) Günther 1997, 28 Abb. 28.
19) Aus dem zeitgleich dokumentierten Grab III, in etwa 180mEntfernung zu Grab II, konnte 2009 ebenfalls Bernstein ge -borgen werden; es handelt sich um eine fragmentierte schei-benförmige Perle von annähernd gleichen Maßen.
20) Die anthropologischen Untersuchungen werden von SusanKlingner, Georg-August-Universität Göttingen, durchgeführtund befinden sich in Bearbeitung, sodass noch keine weiterenErkenntnisse zur Bestimmung der Knochen und auch zu mög-licher anatomischer Zusammengehörigkeit bekannt sind.
21) Günther / Viets 1992. – Schierhold im Druck, Kap. 6.7.
22) Letzte Korrosionsstufe V nach Jeberien 2003.
23) Ebenda.
24) Dr. Stephan Veil, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover,sei für die Anregung und die freundliche Vermittlung dieserUntersuchung gedankt.
25) Eine deutsche Forschergruppe beschäftigte sich 1959 mit In -frarotspektroskopie zur Herkunftsbestimmung (Schwochau /Hae ver nick / Ankner 1965). Anfang der 1960er-Jahre began-nen Curt W. Beck und andere am neu gegründeten AmberResearch Laboratory am Vassar College, Poughkeepsie/NewYork, mit umfangreichen IRS-Untersuchungen von Bernstein-objekten (erstmals veröffentlicht in Beck / Wilbur / Meret1964).
26) Banerjee / Landfester 1997, 67.
27) Die früher verbreitete Einheit der Wellenlänge λ (in μm) istheute unüblich (Prange 1997, 62).
28) Beck u.a. 1971, 235.
29) Beck u.a. 1965, 108. – Beck 1982. – Beck / Heider 1994, 64. –Kritik an der IRS für die Herkunftsbestimmung der Bern stein -artefakte übte vor allem Rolf C. A. Rottländer (1975, 11; 1984-85). – Zur kritischen Diskussion der Nutzung der IRS siehe auchSavkevič 1981. – Poinar 1992, 25.
30) Angelini / Bellintani 2005.
31) Für die Anfertigung der Spektren sowie ihre freundliche Un -terstützung danken wir dem Team des Amber Research Labo-ratory, vor allem den beiden Co-Direktorinnen Edith C. Stout,Research Professor of Chemistry, und Dr. Sarjit Kaur, AssociateProfessor of Chemistry, sowie Annika Stute und Julia Hederer,beide Institut für Organische Chemie der Westfälischen Wil-helms-Universität Münster.
32) Frdl. Mitt. Dr. Christian-Heinrich Wunderlich, Landesamt fürDenkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle.
33) Beck u.a. 1965, 105 Abb. 6; IR-Spektren Nr. 195 und 614 desAmber Research Laboratory.
34) Weitschat 1997. Aus diesem Grund kommen z.B. auch Roh-bernsteinfunde im Münsterländer Kiessandzug zutage (Neu-jahrsgruß 2007, 100 Abb. 46).
35) Alexander 2002.
36) Häpke 1875. – Meyn 1876. – Bohnstedt 1936. – Schulz 1993. –Neubauer 1994. – Krumbiegel 1997, 91. – Alexander 2002. – Inder Literatur werden auch die Funde infolge größerer Erdbewe-gungen (Deichbau, Kanalarbeiten etc.) genannt.
37) Der einzige sichere Bernsteinfund aus linearbandkeramischemKontext, der Anhänger von Erkelenz-Kückhoven (Kr. Heins -berg), wurde ebenfalls als baltischer Bernstein bestimmt (frdl.Mitt. Dr. Jürgen Weiner, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege imRheinland). Siehe dazu Woltermann 2010, 53.
38) In der Altmark treten Bernsteinfunde erst im Kontext derKugelamphorenkultur auf (Meyer 1993, 54), während dieMegalithgräber der Altmärkischen Gruppe der Tiefstichkera-mik praktisch bernsteinfundleer sind (siehe Ganggrab 6 vonHeidberg-Leetze, Altmarkkreis Salzwedel [Müller 2001, 187.480. 551], und Ganggrab von Schortewitz-»Heidenberg«, Lkr.Anhalt-Bitterfeld [Lüth 1988, 156-157 Kat.-Nr. 184. – Müller2001, 346-349. 535. 551]).
355ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Literatur
Alexander 2002: I. Alexander, Bernstein-Vorkommen in Nieder-sachsen. Untersuchungen zu geologischer Altersstellung, Her-kunft und Transportmechanismen [Diplomarbeit Universität Bre-men 2002].
Angelini / Bellintani 2005: I. Angelini / P. Bellintani, Archaeologicalambers from northern Italy: an FTIR-DRIFT study of provenanceby comparison with the geological amber database. Archaeo-metry 47/2, 2005, 441-454.
Banerjee / Landfester 1997: A. Banerjee / K. Landfester, Her kunfts -bestimmung von fossilen Harzen mittels NMR-Spektroskopieunter besonderer Berücksichtigung der Rumänite aus Colti(Rumänien). In: M. Ganzelewski / Th. Rehren / R. Slotta (Hrsg.),Neue Erkenntnisse zum Bernstein. Internationales Symposiumim Deutschen Bergbau-Museum, Bochum, 16.-17. September1996. Metalla Sonderh. Veröff. Dt. Bergbau-Mus. Museum 66(Bochum 1997) 67-70.
Beck 1982: C. W. Beck, Der Bernsteinhandel: Naturwissenschaftli-che Gesichtspunkte. Savaria 16, 1982, 11-24.
Beck / Heider 1994: C. W. Beck / J. A. Heider, Bronzezeitliche Bern -steinperlen aus Reinach (BL). In: C. Fischer / B. Kaufmann,Bronze, Bernstein und Keramik. Urnengräber der Spätbronze-zeit in Rheinach BL. Arch. u. Mus. 30 (Liestal/Schweiz 1994) 64-65.
Beck / Wilbur / Meret 1964: C. W. Beck / E. Wilbur / S. Meret, Infra-red spectra and the origin of amber. Nature 201, 1964, 256-257.
Beck u.a. 1965: C. W. Beck / E. Wilbur / S. Meret / D. Kossove / K.Kermani, The Infrared Spectra of Amber and the Identificationof Baltic Amber. Archaeometry 8, 1965, 96-109.
Beck u.a. 1971: C. W. Beck / A. B. Adams / G. C. Southard / C. Fel-lows, Determination of the Origin of Greek Amber Artifacts byComputer-Classification of Infrared Spectra. In: R. H. Brill(Hrsg.), Science and archaeology. A compilation of the paperspresented at the Fourth Symposium on Archaeological Chemis-try, Atlantic City, New Jersey, on September 9-11, 1968 (Cam-bridge, Mass u.a. 1971) 235-240.
von Berg 1994: A. von Berg, Ein neolithisches Steinkistengrab beiKruft, Kr. Mayen-Koblenz. In: C. Dobiat (Hrsg.), Festschrift fürOtto-Herman Frey zum 65. Geburtstag. Marburger Stud. Vor- u.Frühgesch.16 (Marburg 1994) 53-68.
Bohnstedt 1936: F. Bohnstedt, Ein Anhänger aus einheimischemBernstein von Brietz, Kr. Salzwedel. Jahresschr. Vorgesch.Sächs.-Thüring. Länder 24, 1936, 116-117.
Erhard 1836: H. A. Erhard, Nachricht von den bei Beckum entdeck-ten alten Gräbern (Münster 1836).
Götze 1908: A. Götze, Ein steinzeitliches Grab bei Rimbeck, KreisWarburg. Denkmalpflege 10, 1908, 92-93.
Günther 1997: K. Günther, Die Kollektivgräber-Nekropole War-burg I-V. Bodenalt. Westfalen 34 (Mainz 1997).
2007: K. Günther, Stichwort »Rimbeck«. Ausgr. u. Funde West-falen-Lippe 10, 2007, 118-120.
Günther / Viets 1992: K. Günther / M. Viets, Das Megalithgrab We -welsburg I, Stadt Büren, Kreis Paderborn. Mit einem Beitrag vonK. Steppan. Bodenalt. Westfalen 28, Teil B (Münster 1992).
Häpke 1875: L. Häpke, Der Bernstein im nordwestlichen Deutsch-land. Abhandl. Naturwiss. Ver. Bremen 4, 1875, 525-550.
Jeberien 2003: A. Jeberien, Archäologischer Bernstein – Untersu-chung verschiedener Festigungsmöglichkeiten (Hamburg 2003).
Jordan 1934: W. Jordan, Grabungsbericht Altendorf [unveröff.Manuskript 1934].
1954: W. Jordan, Das Steinkammergrab von Altendorf, Kr.Wolfhagen. Kurhessische Bodenalt. 3 (Marburg 1954) 5-26.
Kriesel in Vorb.: O. Kriesel, Kreisinventar Altkreis Limburg. Mat.Vor- u. Frühgesch. Hessen (in Vorb.).
Krumbiegel 1997: G. Krumbiegel, Bernstein (Succinit) – Die Bitter-felder Lagerstätte. In: M. Ganzelewski / R. Slotta (Hrsg.), Bern-stein – Tränen der Götter [Ausstellungskat. Bochum 1996-97](Essen 1997) 89-100.
Lüth 1988: F. Lüth, Der Schortewitzer Heidenberg und die Zeitstel-lung der anhaltinischen Megalithgräber. Acta Praehist. et Arch.20, 1988, 61-74.
Menke / Aichinger 1993: M. Menke / M. Aichinger, Neue Ausgra-bungen in der Megalithanlage »Heilige Steine« bei Muschen-heim (Lkr. Gießen). Vorbericht über die Ausgrabungskam -pagnen 1989 bis 1992. Germania 71, 1993, 279-314.
Meyer 1993: M. Meyer, Pevestorf 19. Ein mehrperiodiger Fund-platz im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Veröff. Urgesch. Slg.Landesmus. Hannover 41 (Oldenburg 1993).
Meyn 1876: L. Meyn, Der Bernstein der norddeutschen Ebene aufzweiter, dritter, vierter, fünfter und sechster Lagerstätte. Zeit -schr. Dt. Geol. Ges. 28/2, 1876, 171-198.
Müller 2001: J. Müller, Soziochronologische Studien zum Jung- undSpätneolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet (4100-2700 v.Chr.).Eine sozialhistorische Interpretation prähistorischer Quel len. Vor-gesch. Forsch. 21 (Rahden/Westf. 2001).
Neubauer 1994: M. Neubauer, Die Bernsteinverbreitung in glazia-len Ablagerungen insbesondere von Nordwestdeutschland [Ab -schlussarbeit Universität Bremen 1994].
Neujahrsgruß 2007: Neujahrsgruß 2007. Jahresbericht für 2006.Westfälisches Museum für Archäologie – Landesmuseum undAmt für Bodendenkmalpflege, Altertumskommission für West-falen (Münster 2007).
Poinar 1992: G. O. Poinar, Life in Amber (Stanford, Calif. 1992).
Prange 1997: M. Prange, Glossar zu Curt W. Beck: »Zur Herkunfts-bestimmung von Bernstein«. In: M. Ganzelewski / Th. Rehren /R. Slotta (Hrsg.), Neue Erkenntnisse zum Bernstein. Internatio-nales Symposium im Deutschen Bergbau-Museum, Bochum,16.-17. September 1996. Metalla Sonderh. Veröff. Dt. Bergbau-Mus. Bochum 66 (Bochum 1997) 62-64.
Raetzel-Fabian 2000: D. Raetzel-Fabian, Calden. Erdwerk undBestattungsplätze des Jungneolithikums. Architektur – Ritual –Chronologie. Univforsch. Prähist. Arch. 70 (Bonn 2000).
Rottländer 1973: R. C. A. Rottländer, Der Bernstein und seine Be -deutung in der Ur- und Frühgeschichte. Acta Praehist. et Arch.4, 1973, 11-32.
1984-85: R. C. A. Rottländer, Noch einmal: Neue Beiträge zurKenntnis des Bernsteins. Acta Praehist. et Arch. 16-17, 1984-85, 223-236.
Savkevič 1981: S. S. Savkevič, Physical Methods Used to Determinethe Geological Origin of Amber and Other Fossil Resins; SomeCritical Remarks. Physics and Chemistry of Minerals 7, 1981, 1-4.
Schierhold im Druck: K. Schierhold, Studien zur hessisch-westfäli-schen Megalithik: Forschungsstand und -perspektiven unterBerücksichtigung des europäischen Kontexts. Münster. Beitr. Ur-u. Frühgesch. Arch. 6 (im Druck).
356 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
Schierhold / Baales / Cichy 2010: K. Schierhold / M. Baales / E. Ci -chy, Spätneolithischen Großsteingräbern auf der Spur: Geomag-netik in Erwitte-Schmerlecke, Kr. Soest. In: Th. Otten (Hrsg.),Fundgeschichten. Archäologie in Nordrhein-Westfalen [Ausstel-lungskat. Köln, Herne 2010-11] (Mainz 2010) 74-77.
Schuldt 1962: E. Schuldt, Abschließende Ausgrabungen auf demjungsteinzeitlichen Flachgräberfeld von Ostorf 1961. Jahrb.Bodendenkmalpfl. Mecklenburg 1961 (1962), 131-178.
Schulz 1993: R. Schulz, Die natürlichen Vorkommen von Bernsteinin Nordbrandenburg und die Besiedlung in der Bronzezeit. Ver-öff. Brandenburgisches Landesmus. Ur- u. Frühgesch. 27, 1993,32-46.
Schwochau / Haevernick / Ankner 1965: K. Schwochau / Th. E. Hae -vernick / D. Ankner, Zur infrarotspektroskopischen Herkunfts -bestimmung von Bernstein. Jahrb. RGZM 10, 1963 (1965), 171-176.
Uenze 1951: O. Uenze, Das Steinkammergrab von Calden, Kr.Hofgeismar. In: O. Uenze, Steinzeitliche Grabungen und Funde.Kurhessische Bodenalt. 1 (Marburg 1951) 22-27.
1954: O. Uenze, Das Steinkammergrab von Lohra, Kr. Marburg.Kurhessische Bodenalt. 3 (Marburg 1954) 27-48.
Weitschat 1997: W. Weitschat, Bernstein in der Deutschen Buchtund in Jütland auf 3., 4., 5. oder 6. Lagerstätte. In: M. Ganze -lewski / R. Slotta (Hrsg.), Bernstein – Tränen der Götter [Ausstel-lungskat. Bochum 1996-97] (Essen 1997) 77-82.
Woltermann 2010: G. Woltermann, Bernstein im archäologischenFundmaterial. Ausgewählte Aspekte an Beispielen aus demMeso lithikum und Frühneolithikum. Kunde N.F. 60, 2009(2010), 49-60.
Wurm u.a. 1963: K. Wurm / K. Schoppa / C. Ankel / A. Czarnetzki,Die westeuropäische Steinkiste von Niedertiefenbach, Oberlahn-kreis. Fundber. Hessen 3, 1963, 46-78.
357ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Zusammenfassung / Abstract / Résumé
Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen. Zwei Neufunde aus dem spätneolithischen Galeriegrab II von Erwitte-Schmerlecke (Kr. Soest)2009 wurden bei Ausgrabungen in einem spätneolithischen Galeriegrab bei Erwitte-Schmerlecke neben Menschen-knochen, Tierzahnanhängern sowie einigen Flint- und Kupferobjekten auch zwei scheibenförmige Bern steinperlen ge -borgen. Diese typologisch unspezifischen Schmuckstücke konnten mit modernen Analyseverfahren ge nauer be trach -tet werden. Die infrarotspektroskopische Untersuchung hat bestätigt, dass es sich bei ihnen um die in Nord europa amweitesten verbreitete Bernsteinvarietät, den sogenannten baltischen Bernstein, handelt. Eine Com puter tomographieder am stärksten oxidierten Perle erbrachte eine 3D-Simulation ihres Aufbaus und ihrer Verwitterungsschäden. Damitwurde dieses zerstörungsfreie Analyseverfahren erstmals auf ein neolithisches Bernsteinobjekt an gewandt.
Recent methods of analysis on amber beads. Two newly discovered finds from the Late Neolithic gallery grave II at Erwitte-Schmerlecke (Kr. Soest)In 2009, excavations of a Late Neolithic gallery grave at Erwitte-Schmerlecke near Soest, revealed human bones andseveral grave-goods, among them animal tooth pendants, flint artefacts, and copper fragments, but especially twodiscoid amber beads. These artefacts, typologically indifferent, were analysed with modern methods. Infrared spec-troscopy of one of the beads shows a Baltic origin, the most widespread amber variety among Northern Europe. Acomputer tomography of a second bead enabled a 3D-view of its preservation. This method which does not causedamages to the objects during analysis was conducted the first time for a Neolithic amber.
Méthodes d’analyse actuelles sur les perles d’ambre. Deux nouvelles découvertes en provenance de l’allée couverte II datée du néolithique final à Erwitte-Schmerlecke (Kr. Soest)En 2009, lors des fouilles de l’allée couverte II du néolithique final à Erwitte-Schmerlecke, à côté de restes humains, decolliers en dents d’animaux, et d’objets en silex et en cuivre, deux perles d’ambre discoïdes ont été mises au jour. Ceséléments d’ornement, peu spécifiques au niveau typologique ont fait l’objet d’analyses précises. La spectroscopie infra-rouge a permis de déterminer qu’il s’agit de la variété d’ambre la plus répandue dans le Nord de l’Europe communé-ment désignée sous le terme »d’ambre de la baltique«. La tomodensitométrie/scanographie sur la perle la plus oxydéea permis de créer un modèle 3D de la production et de l’érosion de la pièce. C’est la première fois que ce type d’ana-lyses non destructives a été utilisé sur un objet néolithique en ambre. L. B.
Schlüsselwörter / Keywords / Mots clés
Nordrhein-Westfalen / Neolithikum / Wartbergkultur / Galeriegrab / ArchäometrieNorth Rhine-Westphalia / Neolithic / Wartberg culture / gallery grave / archaeometryRhénanie-du-Nord-Westphalie / Néolithique / culture de Wartberg / allée couverte / archéométrie
358 Woltermann · Schierhold · Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen
Gisela WoltermannWestfälische Wilhelms-Universität MünsterHistorisches Seminar, Abt. für Ur- und Frühgeschichtliche ArchäologiePrähistorische BronzefundeRobert-Koch-Str. 2948149 Mü[email protected]
Kerstin SchierholdWestfälische Wilhelms-Universität Münster Historisches Seminar, Abt. für Ur- und Frühgeschichtliche ArchäologieRobert-Koch-Str. 2948149 Mü[email protected]
ISSN 0342-734X
Peter Balthasar, Claudia Brümmer, Sandra Friedow, Nicole Gießmann, Stefan Lux, Clemens Pasda, Daniel Scherf, Kerstin Traufetter, Kahla-Löbschütz –
ein Fundplatz des Magdaléniens im mittleren Saaletal in Thüringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Inga Bergmann, Andreas Dahlmann, Clemens Pasda, Juliane Weiß,Etzdorf »Am Nassen Wald«: Steinartefakte aus Thüringen und ihre Diskussion
im Rahmen des späten Jungpaläolithikums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Sebastian Pfeifer, Neolithische Pfeilspitzen und ein Dolchhalbfabrikat
aus Kahla-Löbschütz (Saale-Holzland-Kreis) – Überlegungen zur zeitlichen Einordnung
bestimmter Silexgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Gisela Woltermann, Kerstin Schierhold, Aktuelle Analysemethoden an Bernsteinperlen.
Zwei Neufunde aus dem spätneolithischen Galeriegrab II
von Erwitte-Schmerlecke (Kr. Soest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Franka Schwellnus, Die Siedlung von Sopron-Krautacker (Westungarn)
in der späten Hallstatt- und frühen Latènezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Manuel Zeiler, Die Siedlung von Sopron-Krautacker (Westungarn) in der jüngeren Latènezeit . . . . . 375
Andreas A. Schaflitzl, Spielen an der Grenze – zu zwei römischen Spielbrettern
aus dem Limeshinterland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Stefan F. Pfahl, Der Fasanentrinkbecher aus Varpelev mit emailgemalter Inschrift DVB • P • –
die Signatur eines Glasdekorateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Magnus Holmqvist, Ein früher Westlandkessel aus Lunde im südlichen Nordschweden . . . . . . . . . . 411
Konstantin Skvorzov, Alexandra Pesch, Krieger, dicke Vögel und gehörnte Pferde?
Ein Sattelbeschlag aus Mitino (obl. Kaliningrad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Volker Arnold, Celtic Fields und andere urgeschichtliche Ackersysteme in historisch alten
Waldstandorten Schleswig-Holsteins aus Laserscan-Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
INHALTSVERZEICHNIS
Das Archäologische Korrespondenzblatt versteht sich als eine aktuelle wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der vor-und frühgeschichtlichen sowie provinzialrömischen Archäologie und ihrer Nachbarwissenschaften in Europa. Neben deraktuellen Forschungsdiskussion finden Neufunde und kurze Analysen von überregionalem Interesse hier ihren Platz.Der Umfang der Artikel beträgt bis zu 20 Druckseiten; fremdsprachige Beiträge werden ebenfalls angenommen.Unabhängige Redaktoren begutachten die eingereichten Artikel.
Kontakt für Autoren: [email protected]
Abonnement beginnend mit dem laufenden Jahrgang; der Lieferumfang umfasst 4 Hefte pro Jahr; ältere Jahrgängeauf Anfrage; Kündigungen zum Ende eines Jahrganges.
Kontakt in Abonnement- und Bestellangelegenheiten: [email protected]
Preis je Jahrgang (4 Hefte) für Direktbezieher 20,– € (16,– € bis 2007 soweit vorhanden) + Versandkosten (z.Z. Inland5,50 €, Ausland 12,70 €)
HIERMIT ABONNIERE ICH DAS ARCHÄOLOGISCHE KORRESPONDENZBLATT
Name, Vorname ________________________________________________________________________________________
Straße, Nr. ________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort ________________________________________________________________________________________
Sollte sich meine Adresse ändern, erlaube ich der Deutschen Bundespost, meine neue Adresse mitzuteilen.
Datum ______________________ Unterschrift _____________________________________________________
Ich wünsche folgende Zahlungsweise (bitte ankreuzen):
� Bequem und bargeldlos durch Bankabbuchung (innerhalb von Deutschland)
Konto-Nr. ________________________________________ BLZ __________________________________________
Geldinstitut ________________________________________________________________________________________
Datum _________________________ Unterschrift __________________________________________________
� Durch sofortige Überweisung nach Erhalt der Rechnung (Deutschland und andere Länder)Ausland: Nettopreis net price prix net 20,– €Versandkosten postage frais d’expédition 12,70 €Bankgebühren bank charges frais bancaires 7,70 €
Bei Verwendung von Euro-Standardüberweisungen mit IBAN- und BIC-Nummer entfallen unsere Bankgebühren (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55), ebenso wenn Sie von Ihrem Postgirokonto überweisen oder durch internationale Postanweisung zahlen.Das Römisch-Germanische Zentralmuseum ist nicht umsatzsteuerpflichtig und berechnet daher keine Mehrwertsteuer.
If you use the European standard money transfer with IBAN- and BIC-numbers there are no bank charges from our part (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55). This is also the case if you transfer the money from a Post office current account or with an international Post office money order.The Römisch-Germanische Zentralmuseum does not pay Sales Tax and therefore does not charge VAT (Value Added Tax).
L’utilisation de virement SWIFT avec le numéro IBAN et SWIFT supprime nos frais bancaires (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; SWIFT: MVBM DE 55); ils peuvent aussi être déduits en cas de réglement postal sur notre CCP (compte courant postal) ou par mandat postal international.Le Römisch-Germanische Zentralmuseum n’est pas imposable à la taxe sur le chiffre d’affaires et ne facture aucune TVA (taxe à la valeur ajoutée).
Senden Sie diese Abo-Bestellung bitte per Fax an: 0049 (0) 61 31 / 91 24-199
oder per Post an:
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte,Archäologisches Korrespondenzblatt, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Deutschland
Römisch-GermanischesZentralmuseum
Forschungsinstitut fürVor- und Frühgeschichte
R G Z M
BESTELLUNG DES ARCHÄOLOGISCHEN KORRESPONDENZBLATTS
3/0
8
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Mosaiksteine. Forschungen am RGZMBand 8
120 S., 129 meist farb. Abb. ISBN 978-3-88467-177-1
€ 20,–
Detlef Gronenborn (Hrsg.)
Gold, Sklaven und ElfenbeinMittelalterliche Reiche im Norden Nigerias
Während des Mittelalters entstanden in der Sahel- und Sudanzone West-afrikas etliche mächtige Staaten, die weitreichende Handelsverbindungenbis nach Indien und in den Vorderen Orient, aber auch nach Europa unter-hielten. Ihre wirtschaftliche Basis war der Export von Gold, Sklaven undElfenbein; geprägt waren sie vom Islam und der arabischen Welt, wiesenaber auch sehr eigenständige afrikanische Züge auf. Im 19. Jahrhundert wurden diese Reiche zum Ziel wirtschaftlicher und poli-tischer Expansionsinteressen der europäischen Kolonialmächte, darunterauch Deutschland. Trotz der folgenden Einbindung in die Kolonialreichehaben einige der traditionellen Staaten bis heute überdauert, so im NordenNigerias die Hausa-Stadtstaaten und das Emirat Borno. Der Band führt in den Naturraum ein und beleuchtet die Entstehung unddie Expansion der westafrikanischen Reiche über die letzten eintausendJahre. Im Mittelpunkt stehen kostbare Funde aus einem Gräberfeld, das diefaszinierende weltwirtschaftliche Rolle Westafrikas im ausgehenden Mittel-alter greifbar werden lässt.Alle Texte in deutscher und englischer Sprache.
RGZM – Tagungen, Band 51. Auflage 2011
310 S. mit 15 Farb- u. 157 sw-Abb.21×29,7cm, Softcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-178-8€ 45,–
Alessandro Naso (ed.)
Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria europeaAtti del convegno internazionale, Celano, 21-24 settembre 2000
Grabhügel und monumentale Grabformen sind in mehreren europäischenGebieten vorhanden und haben immer wieder das Interesse der Forschunggeweckt, insbesondere was die vorrömische Zeit betrifft. Die Denkmälerverschiedener Regionen Italiens und einiger europäischer Länder werdenhier erstmals gesammelt vorgestellt. Die Abfolge der einzelnen Beiträgeerfolgt nach geographischen Kriterien. Oberitalien ist durch die nord-öst-lichen und nord-westlichen Gebiete bis hin zur Emilia-Romagna vertreten.Mittelitalien wird repräsentiert durch das nördliche und südliche Etrurien,das südliche Latium und Kampanien. Unteritalien ist durch Beiträge überApulien, das in Daunien und Peuketien aufgeteilt ist, Kalabrien, Sizilien undSardinien vertreten. Als Vergleiche werden vorgeschichtliche Grabhügel sobedeutender europäischer Nationen wie Deutschland und Spanien mit ein-bezogen. Die Dokumentation der Denkmäler, die hier zum Teil das ersteMal vorgestellt wird, bildet einen originellen Beitrag, der sich daran beteili-gen soll, gemeinsame und unterschiedliche Charakteristika der europäi-schen Eliten der Vorgeschichte bestimmen zu können.
Populärwissenschaftliche Reihe136 S., 150 meist farb. Abb.
1. Auflage, 21×28cmPappband, fadengeheftet
ISBN: 978-3-88467-176-4 (RGZM)€ 24,95
NEUERSCHEINUNG
Ernst Künzl
Monumente für die EwigkeitHerrschergräber der Antike
Unter den Sieben Weltwundern des Altertums befanden sich zwei Königsgräber, die Pyramiden bei Gizeh und der rie-sige Grabbau eines Kleinkönigs in Westkleinasien – Maussollos von Halikarnassos –, der dieser Architekturgattung denNamen gab: Mausoleum. Die Lage eines Königsgrabes und die Gegenwart der sterblichen Überreste berühmter Herr-scher der Vergangenheit unterstützten die Politik vor Ort: So wurde der 323 v.Chr. in Babylon verstorbene Alexanderder Große im ägyptischen Alexandria bestattet, wodurch sein General Ptolemaios die von ihm gegründete Dynastie derPtolemäer legitimierte.Alexander selbst hatte mit seinem Besuch am Grab des Achilleus vor Troia den Brauch des Heroen- und Herrschergrab-besuchs initiiert. Alexanders Grab wiederum wurde zum Wallfahrtsort römischer Feldherrn und Kaiser. Mit den im men -sen Rundgräbern des Augustus und des Hadrian in Rom knüpften die Kaiser an die Gräber Alexanders des Großen wieder Helden vor Troia an. Die spätantiken Kaisergräber waren außerdem als Kuppelbauten architektonische Meister -leistungen. Auf germanische Fürsten und Könige wirkten die römischen Gräber als Vorbilder: Man ließ sich von derLage an Flussufern und Meeresküsten inspirieren. Die Wende kam mit Kaiser Constantin und seiner Grabstätte in Konstantinopel (337 n.Chr.): Seit Constantin und seit Chlodwig in Paris wurden die Herrscher in Kirchen begraben, wasim christlichen Europa über mehr als anderthalb Jahrtausende der Brauch blieb. Erst das 20. Jahrhundert erlebte danndie Rückkehr der antiken Herrschermausoleen.
Verlag Schnell & Steiner GmbHLeibnizstraße 13 · 93055 Regensburg · Tel.: 09 41/ 7 87 85-0 · Fax: 09 41/ 7 87 85-16E-Mail: [email protected] · Internet: www.schnell-und-steiner.de
in Zusammenarbeit mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 941. Auflage 2011, 184 Seiten
mit 91 Abb., 21×30cmHardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-174-0
€ 35,–
Holger Baitinger
Waffenweihungen in griechischen HeiligtümernBei Ausgrabungen in bedeutenden griechischen Heiligtümern wie Olympiaoder Delphi wurden große Mengen an Waffen und Rüstungsteilen aus dem8. bis 4. Jahrhundert v.Chr. gefunden. Sie gelten als Beutestücke, die grie-chische Stadtstaaten nach siegreichen Schlachten den Göttern gestiftethaben.Im vorliegenden Band wird die Sitte der Waffenweihungen in der griechi-schen Welt zwischen Sizilien und Zypern zusammenfassend untersucht.Mehr als 130 Heiligtümer mit Waffenfunden bilden die Basis der Auswer-tung, für die auch schriftliche und epigraphische Quellen herangezogenwurden. Dies macht den Band zum umfassenden Kompendium einer wich-tigen Votivsitte der griechischen Antike.
Monographien des RGZM, Band 92268 S. mit 270 meist farbigen Abb.ISBN 978-3-88467-172-6 (RGZM)
€ 76,–
Ljudmila Pekarska
Jewellery of Princely KievThe Kiev Hoards in the British Museum and The Metropolitan Museum of Art and Related Material
In the capital of Kievan Rus’, princely Kiev, almost 70 medieval hoards havebeen discovered to date. The hoards contained gold and silver jewellery ofthe ruling dynasty, nobility and the Christian Church. They were unique toKiev and their quantity and magnificence of style cannot be matched by any-thing found either in any other former city of Rus’, or in Byzantium. Most ofthe objects never had been published outside the former Soviet Union.During the 17th-20th centuries, many medieval hoards were gradually un -earthed; some disappeared soon after they were found. This book providesa complete picture of the three largest medieval hoards discovered in Kiev:in 1906, 1842 and 1824, and traces the history and whereabouts of otherlost treasures. Other treasures took pride of place in some of the world’stop museums.This publication highlights the splendid heritage of medieval Kievan jew-ellery. It illustrates not only the high level of art and jewellery craftsmanshipin the capital, but also the extraordinary religious, political, cultural andsocial development of Kievan Rus’, the largest and most powerful EastSlavic state in medieval Europe.
Neuerscheinungen
Monographien des RGZM
F. MangartzDie byzantinische Steinsäge von Ephesos –Baubefund, Rekonstruktion, ArchitekturteileBand 86 (2010); 122 S. mit 104 Abb., 23 Farbtaf.ISBN 978-3-88467-149-8 39,– €
H. KrollTiere im Byzantinischen Reich – Archäo -zoologische Forschungen im ÜberblickBand 87 (2011); 210 S. mit 105 Abb., 16 Farbtaf.ISBN 978-3-88467-150-4 55,– €
A. HunoldDie Befestigung auf dem Katzenberg bei Mayenund die spätrömischen Höhenbefestigungen in NordgallienBand 88 (2011); zugleich Vulkanpark-Forsch. Band 8453 S. mit 234 Abb., 21 Tab., 2 Farbtaf., 6 Beil.ISBN 978-3-88467-144-3 52,– €
K. M. TöpferSigna Militaria – Die römischen Feldzeichen in der Republik und im PrinzipatBand 91 (2011); 498 S. mit 1 Abb., 151 Taf.ISBN 978-3-88467-162-7 (RGZM) 110,– €
L. PekarskaJewellery of Princely Kiev – The Kiev Hoards in the British Museum and The MetropolitanMuseum of Art and Related MaterialBand 92 (2011); 268 S. mit 270 meist farb. Abb.ISBN 978-3-88467-172-6 (RGZM) 76,– €
H. BaitingerWaffenweihungen in griechischen HeiligtümernBand 94 (2011); 184 S. mit 90 Abb.ISBN 978-3-88467-174-0 35,– €
RGZM – Tagungen
D. Gronenborn u. J. Petrasch (Hrsg.)Die Neolithisierung Mitteleuropas –The Spread of Neolithic to Central EuropeBand 4 (2011); 665 S. mit 158 Abb.ISBN 978-3-88467-159-7 78,– €
A. Naso (ed.)Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria europea – Atti del convegnointernazionale, Celano, 21-24 settembre 2000Band 5 (2011); 310 S. mit 15 Farb- u. 157 sw-Abb.ISBN 978-3-88467-178-8 45,– €
A. Banerjee u. Ch. Eckmann (Hrsg.)Elfenbein und Archäologie – INCENTIVS-Tagungsbeiträge 2004-2007
Ivory and Archaeology – Proceedings of INCENTIVS-meetings 2004-2007Band 7 (2011); 181 S. mit 148 Abb., 5 Tab.ISBN 978-3-88467-167-2 38,– €
Mosaiksteine. Forschungen am RGZM
D. Gronenborn (Hrsg.)Gold, Sklaven und Elfenbein –Mittelalterliche Reiche im Norden NigeriasBand 8 (2011); 120 S., 129 meist farb. Abb. Alle Texte in deutscher und englischer Sprache.ISBN 978-3-88467-177-1 20,– €
Sonderdruck
A. MeesDer Sternenhimmel vom Magdalenenberg. Das Fürstengrab bei Villingen-Schwenningen –ein Kalenderwerk der Hallstattzeit47 S. mit 23 meist farb. Abb., 1 Beil.Sonderdruck aus Jahrbuch des RGZM 54, 2007 4,– €
Ältere Publikationen sind in der Regel ebenfalls noch lieferbar. Unser komplettes Publikations -
verzeichnis finden Sie im Internet auf unserer Homepage (www.rgzm.de) oder können es beim
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Forschungsinstitut für Vor- und Früh -geschichte, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Tel.: 06131/ 9124-0, Fax: 06131/ 9124-199, E-Mail: [email protected], kostenlos anfordern. Seinen Autoren gewährt der Verlag des RGZM einen
Rabatt von in der Regel 25% auf den Ladenpreis.