Kvalitetsevaluering av ytre orienteringselement til bilder tatt fra droner RPAS
2015.10: Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs "Bilder deiner großen Liebe (2014)"
Transcript of 2015.10: Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs "Bilder deiner großen Liebe (2014)"
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe (2014)
Yun-Chu Cho (Berlin)
Bilder deiner großen Liebe1 ist ein posthum veröffentlichter Text von Wolfgang Herrndorf aus dem Jahr 2014, der Wahnsinn2 und Tod als zentrale Motive wählt. Hierbei offenbaren sich im Wahnsinn die Regeln von Normalität und Realität; die Thematik des Todes spiegelt den unge-wöhnlichen Schaffensprozess des Werkes wider.
In dieser Fortsetzung von Herrndorfs bekanntestem Werk Tschick3, einer Road-Novel4 aus dem Jahr 20105, wird die zentrale Handlung aus der Sicht der Ich-Erzählerin Isa geschildert. Sie tritt schon in Herrn-dorfs Roman Tschick als Nebenfigur auf und entwirft somit eine Art comédie humaine en miniature.
Die willkürliche Aneinanderreihung von Episoden und Ereignissen verleiht dem Text einen grotesken Charakter. Herrndorf sucht dadurch bereits in der Grundkonzeption des Textes narrative Muster für die Darstellung des Wahnsinns seiner Hauptfigur. Für die Interpretation mit Hinblick auf Normalität und Wahnsinn dient die fragmentarische Form als eine Möglichkeit, fantastische Elemente und deutungsreiche Leerstellen in die Narration zu implementieren. Der Wahnsinn impli-ziert dabei eine Gesellschaftskritik, indem vermeintlich normale Figu-ren Isas anormales Verhalten vorführen. Dadurch werden jedoch der Habitus und die Strukturen der mutmaßlich gesunden Gesellschaft enttarnt. Auch die poststrukturalistische Ansicht Michel Foucaults über die Definition von Wahnsinn und Gesellschaft dient dazu, das in Herrndorfs Text oszillierende Verhältnis von Wahnsinn und Gesell-schaft herauszukristallisieren.
Die Thematik des Todes erlangt eine besondere Brisanz durch die rein biographische Notiz, da die Entstehung von Bilder deiner großen
Liebe in die letzten Lebensjahre des Autors fällt. Das Wissen über die Diagnose eines unheilbaren Tumors6 und der nachfolgende Freitod Herrndorfs legen sich zwangsweise über seinen Text. Als sekundäre und überaus wichtige Zugangsquelle zu diesem Roman dient deswe-gen Herrndorfs später auch in Buchform publizierter Blog Arbeit und Struktur7, welches laut Felicitas von Lovenberg in der Frankfurter All-gemeinen Zeitung von manchen als Herrndorfs „eigentliches Haupt-werk“8 gesehen wird. Das Online-Tagebuch, das er vom März 2010 bis zu seinem Tod im August 2013 führte, dokumentiert den Verlauf seiner Krankheit bis zu seinem Tod und den Schaffensprozess von Bilder dei-ner großen Liebe.
Isas Ticken oder: Wahnsinn und Gesellschaft„Verrückt sein“ ist auch das größte Problem von Isa. Bilder deiner großen Liebe beginnt mit der Beschreibung ihres Wahnsinns, welcher in Tschick schon mit einem „Ticken“9 beschrieben wird. Dieses „Ticken“ nimmt im Verlauf von Bilder deiner großen Liebe immer größeren Raum ein. Mit jeder Episode kristallisiert sich zunehmend die Andersheit Isas heraus, die sich in der Gesellschaft nicht zurechtfindet und sich immer wieder in die Isolation der Natur zurückzieht.
Indem Isa gleich zu Anfang ihren Wahnsinn thematisiert, outet sie sich von vornherein als eine offensichtlich unzuverlässige Erzählerin. Doch was darf man unter diesem „Verrückt sein“ verstehen? Und im Gegensatz dazu: Was ist normal?
Ein Ansatz findet sich bei Jürgen Link in seinem Buch Normale Kri-sen? Normalismus und die Krise der Gegenwart, wo er das Normale mit einem „Ticken“ gleichsetzt. In dem Satz „Ich ticke ganz normal“ steckt die „familiäre Metapher des Tickens [Hervorhebung der Verfasserin] [...]“.10 Der Wahnsinn als Krankheit korreliert demnach mit Normalität und Normativität und kann nur unter weitergehender Betrachtung die-ser Punkte untersucht werden. Das Anormale und das Normale kann nur mit dem jeweils anderen und nicht für sich alleine definiert werden: „[Der Begriff] stammt wohl von Uhren und soll störungsfreies Funktio-nieren signalisieren: keine Abweichung von der ,Normalzeit‘, und – falls es eine Kontrolluhr wäre – keine drohende Explosion. [...] Schon diese
150 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 151
alltägliche Formulierung impliziert mehrere Aspekte des Normalen: Bei jeder Berufung auf Normalität ist sozusagen im Schatten immer auch von Anormalität die Rede.“11
Bilder deiner großen Liebe beginnt exakt mit solch einer Abweichung von einem normalen Ticken, einem gestörten Funktionieren der Figur Isa. Aus ihrer Beschreibung erfährt man, dass sie sich hinter einem Tor mit Ärzten und Pflegern befindet. Somit befindet sie sich abgetrennt von der normalen Gesellschaft. Als „Herrscherin des Universums“12 bewegt sie die Sonne am Himmel und das Eisentor, welches sie zurück-hält, öffnet sich. Doch Isa ist keineswegs „bescheuert“: Der „Denorma-lisierung“, wie Link den „Verlust von Normalität“ nennt,13 ist sich Isa von Anfang an bewusst. Sie weiß, dass sie ihre Vernunft verliert und bald nicht mehr normal ticken wird:
[M]ein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde. [...] Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg kackt und weiß, dass das nicht üblich ist und dass so was nur Leute machen, die verrückt sind, und diese Angst macht, dass es einem auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken, ob die jetzt gucken oder nicht, weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat.14
Die „Leute“ stehen für die Gesellschaft, in die Isa nicht passt. Herrn-dorf schreibt am 03.10.2011 in Arbeit und Struktur: „Foucault und der andere philosophische Jahrhundertmüll [...] sagt mir wenig,“15 doch erhält man mit Foucaults Auffassung vom Wahnsinn (der Gesellschaft) in Bilder deiner großen Liebe zahlreiche Ansatzpunkte für mögliche Interpretationen des Wahnsinns in Herrndorfs Werk. Die Abgrenzung von Isa und der Welt kann also mit der Definition des Wahnsinns nach Foucault erklärt werden, der in Dits et Écrits I postuliert: „Der Wahn-sinn existiert nur in einer Gesellschaft, er existiert nicht außerhalb der Formen der Empfindsamkeit, die ihn isolieren, und der Formen einer Zurückweisung, die ihn ausschließen oder gefangen nehmen.“16 Dies bedeutet, dass Isa in einer geschlossenen Anstalt ist, da sie von der Gesellschaft als krank angesehen wird. Irrelevant ist hierbei, ob Isa auch denkt, dass sie verrückt ist. Foucaults These beinhaltet, dass Isas Wahn-
sinn nur von ihrem Umfeld aus definiert und wahrgenommen wird, da sie von der sozialen Norm abweicht,17 worauf später noch näher einge-gangen wird.
Zum „bescheuert sein“ bemerkt auch Hans Magnus Enzensberger in seinem Irrgarten der Intelligenz18, dass ein anormales Ticken oftmals mit Dummheit gleichgesetzt wird. Zwischen Krankheit und Dummheit wird nicht differenziert: „Das gängige Vokabular neigt dazu, Krankheit und Dummheit in einen Topf zu werfen. Unklar bleibt, ob es einem, der ‚nicht alle Tassen im Schrank‘ hat, nur an Klugheit fehlt oder ob es sich um einen Fall für die Psychiatrie handelt. Durch die Bank ignoriert werden die oft sehr beträchtlichen geistigen Fähigkeiten schizophrener oder autistischer Patienten [...].“19
Seine Feststellung impliziert, dass auf die geistigen Fähigkeiten Isas das Augenmerk gerichtet werden muss. In erster Linie tritt Isa zwar als unzuverlässige Erzählerin auf, doch gegen die von Enzensberger benannte Gleichsetzung von Wahnsinn und Dummheit wehrt sie sich von Anfang an: „Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.“20 Ihr Wahnsinn beeinträchtigt ihre Intelligenz demnach nicht. Vielmehr wird später deutlich, dass sie ihr Umfeld zwar anders wahrnimmt, es ihr aber keineswegs aufgrund ihres Verrücktseins an Intelligenz mangelt. Isa ist sich bewusst, was in der Gesellschaft als anormal angesehen wird, und sie weiß auch, dass sie und all die ande-ren „Verrückten“ aus dem gesellschaftlichen Rahmen fallen. Trotzdem konstatiert sie, dass sich das Verrücktsein nicht in jedem Fall „bescheu-ert“ anfühlt. Es ist die erste Andeutung für eine andere Sichtweise auf den Wahnsinn: „Weil das viele Leute denken, dass die superkomplett bescheuert sind, die Verrückten, nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken und was nicht alles. Und das ist ja auch so. Aber so fühlt es sich nicht an, jedenfalls nicht von innen, jedenfalls nicht immer.“21 Es ist ihr Versuch, den Wahnsinn der Ver-rückten von der Einfältigkeit zu trennen und eine Art Legitimität des anormalen Tickens festzulegen.
L’imbécilité, die den Wahnsinnigen einst nachgesagt wurde, findet man demzufolge bei Isa trotz ihres Wahnsinns nicht: Sie reflektiert über sich selbst, versucht das Irre in ihr in Worte zu fassen, sich selbst zu
152 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 153
begreifen. Für die spätere Erörterung von Wahnsinn in der Gesellschaft spielt dies eine wesentliche Rolle, denn die Details, die Isa in der Welt außerhalb des Heimes wahrnimmt, werden später ihren Wahnsinn widerlegen und stattdessen den der Gesellschaft thematisieren.
Indikatoren für den vermeintlichen Wahnsinn Isas tauchen zahlreich in Bilder deiner großen Liebe auf. Zunächst wird der heimliche Ausbruch Isas aus einer geschlossenen Anstalt mit Ärzten, Pflegern und einem Eisentor angedeutet. Auch die zwei Pillen22, die sie nicht geschluckt, sondern unter der Zunge versteckt und in ihre Tasche gesteckt hat, sind Zeichen für Isas stationäre Behandlung in einer Anstalt.23 Die Wahrneh-mung ihres Umfelds untermauern die These von Isas „Verrücktheit“: Isa findet eine Leiche im Wald, nimmt ihr eine Waffe ab und es heißt: „Jetzt können die Außerirdischen kommen.“24 Ihr Handeln scheint selbstver-ständlich und legitim, solange sie in der Natur auf sich allein gestellt ist. Für sie ist es nicht außergewöhnlich, einen toten Menschen im Wald zu finden, auch nicht, dass Außerirdische auftauchen könnten.
Die Entlarvung ihres Wahnsinns geschieht nur in Interaktion mit anderen; nur in den Momenten, in denen Isa auf andere Figuren in dem Roman trifft, zeigt sich ihre Abnormität. Erst im Vergleich zu vermeint-lich normalen Menschen bekommen ihre Handlungen einen verrück-ten Charakter. Als Isa von einem Schriftsteller aufgenommen wird, der ihr bei einem Unwetter die trockenen Kleidungsstücke seiner Tochter zur Verfügung stellt, läuft sie weg, anstatt das Ende des Regens abzu-warten. Isa wechselt wieder in ihre alte nasse Kleidung und lässt den Rucksack und die neue zurück. Dieses Verhalten ist zunächst nicht zu erklären. Erst auf dem zweiten Blick wird klar, dass es eine Logik hinter ihrer Handlung gibt: Da sowohl ihre alte als auch die neue, vom Schrift-steller bereitgestellte Bekleidung vom Regen nass geworden sind, gibt es keinen Grund, die neuen Kleidungsstücke anzubehalten. In ihrer Ano-malie spiegeln sich so Selbstlosigkeit und Unzweckmäßigkeit als posi-tive Eigenschaften Isas wider.
Als Isa auf Maik und Tschick trifft, erzählt sie ihnen, wie ein Astro-nom namens Weierstraß ihr außer Lesen und Schreiben alles andere für ihr Leben beigebracht habe. Die Wahl ihrer Worte lässt darauf schlie-ßen, dass sie verrückt ist, denn der wahre Weierstraß ist ein Mathema-
tiker, der lange vor ihrer Zeit gelebt hat. Sie hat ihn somit nicht treffen können. Andererseits lässt diese Aussage viele Interpretationsmöglich-keiten offen, da in dem ganzen Werk Herrndorfs Fantasie, Surreales und Erlebtes miteinander vermischt werden und eine Abgrenzung des einen vom anderen nicht möglich ist. Für Maik und Tschick mag ihre Geschichte eine Lüge darstellen; es kann ebenso möglich sein, dass Isa eine Figur namens Weierstraß wirklich kennengelernt hat, der sie tat-sächlich auf irgendeine Art und Weise beeinflusst hat. Die zeitliche Dis-krepanz zwischen Isa und Weierstraß, die ein Kennenlernen unmöglich macht, wird nicht aufgelöst.
Der Wahnsinn als NarrationsmodellAuch in der Form des Werkes selbst stellt Herrndorf den Wahnsinn dar. Zum Schaffensprozess von Isa findet man am 19.6.2011 einen Eintrag auf Herrndorfs Blog. Er hat eine „Tschick-Fortsetzung aus Isas Perspek-tive angefangen“25, welche er zunächst nicht weiter verfolgt. Im August 2012 erachtet er es sogar als unmöglich, dieses Romanprojekt fertig zu stellen.26 Fast zwei Jahre später heißt es allerdings am 31.3.2013, dass er einen ursprünglich geplanten Science-Fiction Roman „aus Kom-pliziertheitsgründen“ verwirft und sich „[s]tattdessen ,Isa‘“, einem „Roadmovie zu Fuß“ widmet. „Mit etwas Rumprobieren einen Ton gefunden, schreibt sich wie von selbst. Und praktisch: kein Aufbau. Man kann Szene an Szene stricken, irgendwo einbauen, irgendwo strei-chen, irgendwo aufhören.“27 Diese willkürliche Narrationsform von aneinandergereihten Episoden ermöglicht es, fantastische Elemente und deutungsreiche Leerstellen in den Text zu setzen. Obwohl Bilder deiner Liebe als Fortsetzung von Tschick in der Gegenwart und realen Welt spielen sollte, finden sich Momente im Werk, die so, wie Isa sie wortwörtlich darstellt, auf den ersten Blick nicht stattgefunden haben können. Die abrupten Enden erzeugen Leerstellen nach jedem Kapitel und viel Spielraum für Interpretationen. Die Grenzen zwischen Wahn-sinnigem und Normalem werden dadurch verwischt.
Die Episoden sind auf der Narrationsebene scheinbar wahllos anei-nandergereiht und stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang. Die Verkettung der fragmentarischen Episoden wird dem Leser sogleich im
154 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 155
Titel vorgelegt: Bilder deiner großen Liebe ist Ein unvollendeter Roman.28
Die Mehrheit der Kapitel scheint unvollendet. Mit Adornos Worten ist das Fragment29 jedoch eine „Kunst obersten Anspruchs“30. Das ausfor-mulierte „irgendwo“ bietet Herrndorf Freiheiten, sich nicht an einen einzelnen Erzählstrang binden zu müssen. Die literarische Landschaft, die in Bilder deiner großen Liebe dadurch gezeichnet wird, gewinnt so an Traumhaftigkeit und fantastischer Kraft, die durch die Protagonistin Isa wiederholt thematisiert werden. So reiht sich etwa die Geschichte, wie sie mit ihrem Vater im Garten zeltet an die Beschreibung, wie sie einen Laden ausraubt, gefolgt von der Beschreibung ihrer blutenden Füße. Diese sprunghafte Erzähltechnik ermöglicht zudem die Interpretation des Textes als Metafiktion: Die Fiktionalität des Werkes wird dem Leser durch die bewusst eingesetzten Brüche und durch Diskontinuitäten in der Erzählung immer wieder verdeutlicht. So stellt sogar die Grund-konzeption der narrativen Muster in Herrndorfs Werk den Wahnsinn der Ich-Erzählerin bildlich dar. Man kann ihrem Gedankengang kaum folgen, der Zusammenhang der Episoden wird für den Leser irrelevant gemacht.31
Die episodenhafte Aufteilung von Bilder deiner großen Liebe kann mit Antoine de Saint-Exuperys Le petit prince32 verglichen werden, der in ein zeitgenössisches Roadmovie33 umgesetzt wurde: Isa reist durch ihre Welt, Episode um Episode trifft sie Gestalten und erzählt ihre Geschichte. Die Figuren, die ihr auf dem Weg begegnen, stehen in keiner direkten Relation zueinander, außer dass sie einer Gesellschaft angehören, in die Isa nicht ganz gehört bzw. in der sie sich nicht zurecht findet. War in Tschick die Figur Andrej Tschichatschow ein „dingle-dody“34 im kerouacschen Sinne, dann stellt Isa die weibliche Version eines solchen Dean Moriarty dar - mit derselben „Flamme“, die in ihr brennt und mit derselben Unfähigkeit, mit den Normen der Gesell-schaft im Einklang zu sein.35 Ständig ist Isa unterwegs, sie verweilt nie lange an irgendeinem Ort und zieht ziellos umher. Die Rastlosigkeit spiegelt die Unzugehörigkeit Isas in der Gesellschaft wider.
Obwohl Bilder ein Road-Novel ist, ist auch eine Topografie der Ort-schaften, in denen Isa umherwandert, im konventionellen Sinne nicht möglich, da Isa anders tickt als ihr Umfeld. Das Leben ist laut Herrn-
dorf allenfalls als eine Straße36 zu interpretieren, auf der Isa immer wieder umherirrt. Auch bei Kerouac, mit dem Herrndorfs Werk ver-glichen wird, bezeichnet dies mit einer Straße: „Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no matter, the road is life [Hervorhebung der Verfasserin].“37 Anders als in Tschick ist für Isa also Raum kein konkretes Thema in Bilder deiner großen Liebe. Sie läuft barfuß, durch Dörfer und Felder, Wälder und Gärten. In Flashbacks erfährt man von ihrem anderen Leben, als sie noch kleiner war, und man vergisst, dass sie als Erzählfigur auch erst um die 14 Jahre alt ist, da ihre Auffassungsgabe von Episode zu Episode zu variieren scheint. Zeit wird bei Isa ebenfalls eher anhand von Hunger und Durst gemessen als durch Tagesangaben. So kommt der Wahnsinn auch durch die Narrationsform zur Geltung.
Verschwommene GrenzenDie Form der episodenhaften Darstellung verwischt die Grenzen zwi-schen Normalität und Wahnsinn bei Isa. Das Reale und der Wahn-sinn sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Gerade dadurch wird eine realistischere Interpretation Isas ermöglicht, die diese Mit-tel benutzt, um sich zwischen den Welten zurechtzufinden, denn Isa schwankt „seit fünf oder sechs Jahren“ zwischen den „zwei Welten“, die sie umgeben: „die dunkle und die andere.“38 Gemeint ist die gesunde und die verrückte.39
Immer wieder zieht sie rastlos zwischen Normalität und Ver-rücktheit, zwischen der normalen und der trugbildhaften Welt ihres Bewusstseins umher: „In einem Moment denkt man, man hat es. Dann denkt man wieder, man hat es nicht. Und wenn man diesen Gedanken zu Ende denken will, dreht er sich unendlich im Kreis, und wenn man aus dieser unendlichen Schleife nicht mehr rauskommt, ist man wieder verrückt. Weil man etwas verstanden hat.“40 Sie ist permanent gefangen in dem Konstrukt, verrückt zu sein (von der Gesellschaft aus gesehen) und nur dazu zu gehören, wenn sie sich von der Instanz der Verrückt-heit befreit – und auf der anderen Seite kann sie nur existieren, wenn sie sich von jener Gesellschaft abkapselt und flüchtet, und somit kein Teil der Gesellschaft ist.
156 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 157
Diese Erlebnisse fernab der Gesellschaft in der Wildnis schieben sich palimpsestartig41 über ihre Geisteskrankheit (oder auch: das Anor-male), die sie als scheinbar naive, unzuverlässige Erzählerin darstellt. Sie ist sich nur teilweise ihres Wahnsinns bewusst; sie fantasiert gele-gentlich in absurden Dimensionen, was aber ohne jegliche Verurteilung des Geschehens passiert. Diese Art von Phrenesie wird besonders in der Begegnung mit dem taubstummen Kind deutlich. Im 19. Kapitel42 folgt ihr ein kleiner, taubstummer Junge, der aus dem Nichts auftaucht. Sie hat keine Schwierigkeiten, mit ihm zu kommunizieren, ist er doch taub-stumm und somit auch „nicht normal“ und einer wie sie. Sie liest erst aus seinem Gesicht, dann unterhält sie sich mit ihm und erzählt ihm die Geschichte von einem verlassenen Hund, der dreitausend Kilome-ter nach Hause läuft, von Spanien nach Dortmund, dessen Beine dabei immer kürzer werden. Eine Allegorie, die von Treue handeln soll, die für Isa nicht gilt. Trotz des intensiven Austausches (Isa scheint eine sel-tene Zuneigung gegenüber dem kleinen Jungen zu empfinden) ist der Junge am nächsten Morgen verschwunden43 und Isa ist wieder allein. Auch hier findet sich eine unklare Grenze zwischen Traum und Wirk-lichkeit, Wahnsinn und normal Erlebtem. Es ist nicht klar, ob sie diese Begegnung geträumt hat oder ob sie wirklich passiert ist und ob sie sich nur fehlerhaft an die Begegnung erinnert.
Isa beschreibt in Bilder deiner großen Liebe, wie sich ein Trans-portwagenfahrer durch ihren Anblick befriedigt hat, während sie den Schweinen hinten im Laster Wasser zu trinken gibt. Er schreit ihr noch etwas hinterher: „Der Satz hallt noch lange in mir nach. Nach einigen Kilometern fällt mir auf, dass die Stimme nicht Das war ja komplett geil, vielen Dank gerufen hat, sondern Du bist ja komplett geisteskrank.“44 Eigentlich ist Isa die „Geisteskranke“, doch hier outet sich der Fahrer als ein Perverser und kehrt das Verhältnis zwischen normal und anormal um. Wenn man das Maß des Wahnsinns wie Foucault im „vernünfti-gen Menschen“45 (die vermeintlich normalen Menschen, welche Isa auf ihrem Roadtrip zu Fuß begegnet) sieht, so werden die Grenzen immer wieder undeutlich.
Die Figuren, denen Isa begegnet, sind keineswegs makellos oder normal, sondern eher pervers und mitunter gar töricht im Vergleich zu
ihr. Im foucaultschen Sinne könnte man sagen, dass die Rollen ausge-tauscht werden, denn wenn eine krankhafte Form des Wahnsinns die „Deformationen des moralischen Lebens“46 wäre, so würde zumindest der Fahrer des Schweinetransporters unweigerlich in diese Kategorie des krankhaften Wahnsinns gleiten, ein Pädophiler, der seinen perver-sen Sexualtrieb ungehemmt auslebt, der sich zwar nicht physisch an dem Mädchen vergeht, aber doch auf seine Art missbraucht. Der Text suggeriert somit immer wieder Zweifel an der geistigen Gesundheit der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Es wird immer unklarer, wer bei den Begegnungen „normal“ und wer „verrückt“ ist.
Auch finden sich bei Isa Parallelen zu Goethes erotisch anziehen-der Mignon47 oder Nabokovs Lolita48, in einem krankhaften Ausmaß. Herrndorf war ein bekennender Nabokov-Fan, und in Bilder deiner gro-ßen Liebe findet man vermehrt Anspielungen auf sein Vorbild.49 Genau in dieser Sexualisierung Isas durch ihr Umfeld verschwimmen jedoch erneut die Grenzen zum Wahnsinn. Viele ihrer Begegnungen erzählen von Figuren, die Isa von vornherein als eine Art Sexualobjekt wahr-nehmen, während Isa ihre Hilfe benötigt. Sie sind fast ausschließlich männlich: Der Fahrer des Schweinetransporters, der Isa ein Stück mit-nimmt,50 der Holzfäller, der ihr Wasser gibt und von seiner ersten gro-ßen Liebe erzählt, Wanderer, die ihr Brot geben, der Mann, der ihr sein Baguette gibt, Maik und Tschick, der Fährmann,51 der Hotelbesitzer – sie alle weisen Fehler und Makel auf, indem sie vermeintliche Retter von Isa sind, sich in diesen Begegnungen jedoch immer nur in einem Kreis von Zuneigung und Begierde bewegen. Selbst die väterliche Liebe, die Isa durch den Schriftsteller erfährt, wird von sexuellen Anspielun-gen durchdrungen: „Wenn er denkt, ich merke es nicht, schaut er auf meine Brust. Deshalb dreht er auch dauernd den Kopf.“52 Ihre Retter entpuppen sich jeweils lediglich als scheinbare Hilfspersonen.53 Nicht Isa ist hier die Wahnsinnige, sondern die Erwachsenen, die sie auf ihrer Reise trifft, sind die Kranken, Anormalen. Sogar bei der Fahrerin des ersten Autos, die Isa beim Trampen mitnimmt, ist letztendlich unklar, ob es wirklich eine Frau ist,54 und es kommt zu einem sexuellen Über-griff:
158 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 159
Ich erwache von dem schweren Gesicht an meiner Hüfte und davon, dass die Frau ihre Hand zwischen meinen Beinen hat. [...] ,Das müssen Sie nicht‘, sage ich. Sie macht es trotzdem, und ich habe den Eindruck, das ist gar keine Frau. Sie hat einen vollkommenen asymmetrischen Haarschnitt und ein Gesicht, das man nicht beschreiben kann, weil es kein Merkmal besitzt. Und da steige ich aus und gehe in den Wald.55
Isas Begegnungen mit lüsternen Männern, Alten, Eltern, Wanderern und Kindern sind wie schon erwähnt nach Antoine de Saint-Exupérys Le Petit Prince aufgebaut, episodenhaft, mit Traumsequenzen und Dialogen, die stark an Märchen erinnern. Es gibt jedoch einen Unterschied: Springt der kleine Prinz noch von Planet zu Planet und trifft bestimmte Prototypen von Charakteren, so trifft Isa im Grunde genommen immer nur dieselbe kranke Sorte von Menschen, wie beispielsweise Pädophile, Menschen mit eigenen seelischen Verletzungen und Kriminelle mit Geheimnissen.
Flucht in die NaturIsa entflieht unangenehmen Situationen (in denen sie auf Figuren aus der Gesellschaft trifft) indem sie sich in die Natur, in den Wald, ret-tet. Sie bevorzugt die Abgeschiedenheit von der Gesellschaft, so oft es ihr möglich ist. Bleibt sie in Interaktion mit den anderen Figuren, zeigt sie Gleichgültigkeit und Ennui gegenüber dem Geschehen in der Zivi-lisation, was bei Kluge und Vogl „Apathie“56 genannt wird. Neben der Apathie, z.B. das Desinteresse Isas an ihrem eigenen, schmerzenden Körper, wandelt sie ihr Anthropomorphisches immer wieder in Tier-metaphern um: Das Animalische dient ihr als eine andere Fluchtform aus der Realität die sie umgibt und gleichzeitig als ihre Lösung, um dort (als Wahnsinnige) zu existieren. Indem sie aus einem Heim, wie sie es nennt, ausbricht, beendet sie ihre Internierung und Abgrenzung von der normalen Gesellschaft, die es ihr ermöglicht, zu leben ohne bewer-tet zu werden.
So hetzt sie in Freiheit durch die Welt wie ein Tier, das dem Käfig entronnen ist.57 Sie fühlt sich eher dem wilden Getier zugehörig als den Menschen und auch die Sprache ist ihr fremd: „Wenn ich in die Stadt ging, war ich allein unter Menschen. Manche sprachen mich an. Viele sprachen zu sich selbst. Das meiste verstand ich nicht. Es hatte keinen
Sinn, und ich fragte mich, warum sie überhaupt redeten. Tiere mag ich lieber.“58 Das Tierische (Anormale) wird wiederholt gezeigt: „Mir ist Nacht lieber. Ich habe gute Augen“59, auch von anderen wird sie als Tier wahrgenommen. Schon in Tschick heißt es: „Auch das verdreckte Mädchen kletterte einsam wie ein kleines, schnelles Tier an mir vorbei, ohne mich anzusehen. Sie lief barfuß, ihre Beine waren schwarz bis zum Knie.“60 Diese tierhaften Züge schrecken Maik ab.61 Direkte Aussagen über das Tierhafte werden ebenfalls in Isas Selbstbeschreibung getrof-fen: „Manchmal bin ich ein Adler.“62; „Manchmal bin ich ein Marder. Und ich bewohne den goldenen Berg.“63
Um dem Konflikt der unklaren Grenzlinien zwischen Wahnsinn und Normalität zu entweichen, wäre ein animalischer Schrei die Erlösung aus dieser bedrohlichen Situation: Eine Abwehrhaltung, indem man sich von der Gefahr „abgrenzt“64, wie auch Joseph Vogl den Schrei beschreibt.65 Er dient zur Abgrenzung vom menschlichen, sexuellen Objekt, auf das Isa reduziert wird. Sie schreit jedoch zunächst nicht. Sie schweigt bei beiden offensichtlichen sexuellen Übergriffen durch die Fahrer der Wagen, die sie mitnehmen, als sie durch die Gegend trampt. Die „stimmlose Stimme eines wirklichen Konflikts“66 kommt durch Isas Schweigen zutage, und zwar der Konflikt ihres Wesens, ihrer Existenz und die der vermeintlich normalen Gesellschaft, der Realität. Diesem entzieht sie sich durch Apathie. Die „mühsamen Anstrengungen“, die von Nöten wären, sich ihren Körper wieder „zu eigen zu machen“ wer-den beiseitegeschoben.67
Ein vermeintlich erlösender Schrei kommt, als „Isa über die unend-liche Kleinigkeit und Enge über [ihr nachdenkt und hochschaut]“68. Erlösend deswegen, da dieser jähe Ausbruch oder Abbruch mit ihrem Umfeld der Moment ist, in dem sich Isa – erneut und in dem Moment komplett – von ihrem Umfeld distanziert: „Ich stehe fünf Minuten auf der Schwelle und schreie, der Boden fällt auf mich, und ich schreie und schreie, bis der Blick durch das Fenster zum Nachthimmel mich davon überzeugt, dass es doch überabzählbar viele sind, und zwar, weil alles andere nicht zum Aushalten wäre, und deshalb sind es überabzählbar unendlich viele Sterne über mir. Auf Beschluss der Herrscherin des Universums.“69
160 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 161
Doch dann holt sie der Wahnsinn wieder ein, sie verliert „es“70 wie-der: „Im einen Moment denkt man, man hat es, dann denkt man wie-der, man hat es nicht. Und wenn man diesen Gedanken zu Ende denken will, dreht er sich unendlich im Kreis, und wenn man aus dieser unend-lichen Schleife nicht mehr herauskommt, ist man wieder verrückt. Weil man etwas verstanden hat.“71
Selten zeigt Isa Emotionen,72 sie möchte ihre Gefühle nicht zum Aus-druck bringen, ihre Tränen versteckt sie. In den Fernsehgesprächen von Alexander Kluge und Joseph Vogl73 wird das Topos der Tränen bespro-chen. Vogl definiert hier die Tränen nicht nur als eine Unterstützung und Moderation von Schmerz, sondern auch als „Erregungs- und Kom-munikationsmittel“. Bei ihm heißt es, dass, wenn „Signale des Schmer-zes, etwa die Tränen produziert werden, eine Ansteckungsbedingung zur Verfügung“ gestellt wird.74 Folgt man ihm an dieser Stelle weiter über die Bestimmung der Tränen, so sind sie eine vieldeutige Chiffre, die hier als „Ausdrucksformen, Bekundungen, die sagen: Ich empfinde, ich fühle, ich nehme an deinem Schmerz teil, teile dir meinen eigenen Schmerz mit. Auftakt oder Aufruf zu einer Gemeinschaft der Rührung“ gelten. Isa möchte sich der Welt um sich herum jedoch nicht offen-baren. Sie weigert sich, öffentlich zu empfinden, sie darf nicht fühlen, nicht ihren Schmerz der Welt mitteilen, sie wäre sonst ein Teil der irdi-schen Welt, ein Teil der Welt, in die sie nicht gehört oder zu der sie nicht gehören will und auch nicht kann, da sie „verrückt“ ist.75 Aber gerade das verbindet sie wiederum mit der Welt, von der sie sich die ganze Zeit abgrenzt – denn auch das Weinen im „einsamen Kämmerchen“, wie Kluge es nennt, hat nach Vogls Ansicht die „Funktion, ein System daraus zu machen, von allem mit allen, in dem auch noch das Innerste, der tiefe Schmerz, zirkulieren kann.“76
Dass Isa generell keinen Schmerz empfindet, bedeutet, dass sie los-gelöst vom körperlichen und seelischen Schmerz ist. Bei Vogl heißt es: „Der Gegenpol von Schmerz wäre nicht, wie man landläufig meint, Freude, Vergnügen oder Spaß, sondern ich glaube, der Gegenpol von Schmerz wäre Apathie.“77 Diese zuvor schon bemerkte allgegenwärtige Apathie von Isa wird hierdurch erklärt. Erst, als sie mit anderen Men-schen interagiert, ist sie sich der Schmerzen, z.B. der Wunden an ihren
Füßen, bewusst. Als sie den Schiffer trifft, ist er es, dem die Wunden an ihr auffallen. Erst als er ihnen Aufmerksamkeit schenkt und sie dadurch an Signifikanz gewinnen, spürt Isa den Schmerz: „Plötzlich tut es weh.“78 Auch hier unterdrückt sie jeglichen formellen Ausdruck des Schmerzes, „Ich beiße auf meine Lippen.“79 Dies ist eine paradoxe Situation, denn laut Vogl ist „der Schmerz eine Art Selbstvergewisserung des Lebens“80, nur durch Schmerz kann Isa existieren. Jean-Luc Nancy schreibt, dass es keinen Sinn ergibt, Körper und das Denken separat voneinander zu erfassen, da beide ohne einander nicht existieren können.81 Das gegen-seitige „Berühren“ von beiden, das an Hand von „Freude, Schmerz und Pein“82 zugleich Abtrennung („Grenze“) und „Umrisse des Zwischen-raums“ darstellen, ermöglicht die Existenz Isas, die sich immer wieder in diesen Grenzgebieten wiederfindet und nicht so recht weiß, ob sie leben möchte (mit all dem Schmerz) oder doch in die surreale Welt des Wahnsinns abdriften sollte.
Die HeilungDie Rückerstattung der Vernunft83 und somit die Heilung kommt mit Hilfe der zweiten Tablette, die Isa bewusst einnimmt84 (Die erste, die sie bei Verlassen des Heimes eingenommen hat, war wirkungslos.85). Sie heilt sich selbst, indem sie sich willentlich dazu entschließt, also das Bewusstsein zurückfordert. Sie nimmt ihr Schicksal in ihre eigene Hand, so wie sie sich vorher ihrem Schicksal als Verrückte hingegeben hat: „Ich nehme die zweite Tablette und beschließe, geheilt zu sein. Ich spüre die Heilung klar. Am Abend spüre ich die Heilung noch klarer. Es ist vorbei. Es wird nicht wiederkommen.“86
Ihre „Schübe“87 scheinen zunächst tatsächlich vorüber zu sein, durch die Pille und durch ihren Willen zur Genesung oder aber auch, weil sie durch ihre Willenskraft von dem Wahnsinn befreit ist und wieder klar denken kann. Der Charakterzug eines Bildungsromans kommt hier besonders zum Ausdruck: Indem Isa ihre Mündigkeit wiedererlangt, scheint sie in diesem Moment ein Stück aus sich herauszuwachsen. Und jetzt trifft sie auf Maik und Tschick, kann ihnen bei der Entwendung von Benzin helfen, mit ihnen für eine Weile mit klarem Kopf interagie-ren.
162 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 163
Herrndorfs Sarkasmus, der in Arbeit und Struktur stark präsent ist, findet sich auch hier wieder: „Ich komme aus der Scheiße, und in die Scheiße gehe ich irgendwann auch wieder“, sagt Isa zu einer weiteren zufälligen Begegnung mit einem Jungen im Wald.88 Diese Passage steht stellvertretend für Herrndorfs Feststellung über den Lebenszyklus, aber auch, dass Isa erkennt, dass sie wieder in den Zustand versetzt werden kann, in dem sie auf den Gehweg „kackt“, wie es anfangs heißt.89 Wahn-sinn und Tod sind auch in diesem Aphorismus enthalten und die Erlö-sung ist nicht permanent. Der Tod des Autors in seinem WerkMithilfe von Meike und Sascha Lobo geht Wolfgang Herrndorf im September 2010 mit seinem Blog Arbeit und Struktur (zunächst pri-vat) online, nachdem ihm sein Hirntumor diagnostiziert worden ist. Während des Fortschreitens seiner Erkrankung arbeitet er an mehreren Romanprojekten.90 Bilder deiner großen Liebe, das er als Projekt unter dem Arbeitstitel Isa führte, ist eines davon. Dort wird die Kritik Saint-Exupérys an der Erwachsenenwelt und dem Kapitalismus vor allem durch Schlagwörter des Existentialismus ersetzt. Es geht besonders um Freiheit und Tod. Isa befreit sich aus einem Heim, kommt in die Frei-heit, ist nun für sich selber verantwortlich. Jedoch wird sie unentwegt mit dem Tod konfrontiert und thematisiert ihn wiederholt in ihrer Nar-ration. Zahlreiche Parallelen, Themen und Ängste aus Herrndorfs Tage-buch-Blog Arbeit und Struktur finden sich in Bilder deiner großen Liebe wieder. Die unheilbare Krankheit des Autors und sein unausweichliches Lebensende hängen wie ein Schleier über Bilder deiner großen Liebe. Arbeit und Struktur fängt mit einem Eintrag am 8.3.201091 über seine Einlieferung in eine Psychiatrie an, nachdem Herrndorf seine Krebsdi-agnose bekommt. Die Verzweiflung über sein bevorstehendes Lebens-ende durch seine Erkrankung erlangt besonders durch seinen Eintrag vom 13.3.201092 Nachdruck: „Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem. (geweint)“ – Herrndorfs größte Sorge ist zu diesem Zeitpunkt, dass er nicht in der Lage ist, seine diversen Literaturprojekte zu beenden.
Letztendlich ist Bilder deiner großen Liebe Herrndorfs Auseinander-
setzung mit seinem eigenen Tod. Am 16.7.2013 vermerkt Herrndorf dazu auf seinem Blog: „Nächster Versuch, meinen Nihilismus in der Öffentlichkeit zu beweisen und festzumachen. [...] Es gibt uns nicht. Wir sind vergangen.“93 Das kehrt immer wieder als Motiv in Herrn-dorfs Bilder wieder. Isa hinterfragt die aus ihrer Sicht unsinnigen Hand-lungen der Menschen: „[W]ozu. Sterben werden sie doch.“94 Parallel dazu heißt es in Arbeit und Struktur: „Während ich mit der Brötchentüte an der Ampel stehe, sehe ich neben mir einen unter seinem Schulran-zen begrabenen Erstklässler und schaue in den Himmel, damit er mich nicht weinen sieht. Er weiß nicht, dass er sterben wird, er weiß es nicht, er weiß es nicht, er weiß es nicht.“95 Die Apathie, die Isa in Bilder deiner großen Liebe zeigt, findet sich demnach zuerst im Tagebuch des Autors.
So wie Herrndorfs letzten Lebensjahre und sein Schaffen vom dro-henden Tod begleitet wurden, so begegnet auch Isa an vielen Stellen des Textes dem Tod: Sie stolpert über eine Computertasche mit der Nachricht „Ich habe mich umgebracht“96, dann findet sie bei Regen kurz Unterschlupf bei einem Schriftsteller, dessen Tochter Angela anscheinend im Kindesalter gestorben ist, die etwa Isas Alter gewesen wäre, würde sie noch leben,97 während die Ehefrau des Schriftstellers auf ihrem Bett dahinsiecht.98 Sie findet eine Leiche,99 und „[i]rgendwo stirbt ein kleines Tier im Maul eines größeren“100. Permanent ist sie von Tod umgeben, jedes Mal schafft Isa es, ihn als einen Teil des Lebens zu integrieren – ihm wird von ihr keine größere Bedeutung geschenkt als dem Leben.
Schließlich thematisiert sie zudem ihren eigenen Tod: „Ich denke darüber nach, habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht, wie ich mich umbringen würde, wenn ich mich umbringen würde. Ich würde Tabletten schlucken und mich dann auf den Rand eines Hochhauses setzen damit ich runterfalle, wenn ich müde bin. Das wollte ich schon mit fünf. Ich meine, ich wusste, dass ich so sterben will: fallen.“101 Am Ende des Romans steht Isa auf einer Balustradenkante102 und hat die Erkenntnis, dass sie nicht verrückt ist, sondern dass das Leben, wel-ches sie führt, das wahre ist. Frieden findet das Geschöpf zwischen den Grenzen von Wahnsinn und Normalität und somit erst im Ange-sicht ihres eigenen Todes.103 Souveränität zeigt sie, indem sie dem Tod
164 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 165
bewusst entrinnt: „Der Abgrund zerrt an mir. Aber ich bin stärker. Ich bin nicht verrückt. ... Ich bin dieselbe. Ich bin das Kind. [...] Ich kontrol-liere die P8. Ich drücke das Magazin aus, entnehme die Patronen, presse sie zurück. [...] Laden und entspannen. Laden und entspannen.“104 Erst, als sie sich loslöst von dem ihr zugeschriebenen Wahnsinn, erfährt sie die Rückkehr zur Reinheit.
„Laden und entspannen“ – die permanente Präsenz des Todes bei Herrndorf zeigt sich in dieser Szene ganz deutlich. Als Isa am Schluss doch noch die Pistole abdrückt, kehrt die Kugel millimetergenau zurück in die Waffe. Der Roman endet somit nicht wie erwartet mit einem Todesschuss, sondern mit einem Rewind, ein Zurückspulen der Zeit, der Uhren, des Ereignisses, einem phantastischen Moment, der uns wieder zurückwirft in die psychedelische Welt von Isa, der Figur die nicht richtig tickt und aus dem Rahmen der Normalität fällt, und doch gerade deswegen umgekehrt die Abnormität der Gesellschaft zeigt. Wahnsinn und Tod, die beiden Themen in Wolfgang Herrndorfs Leben durchziehen Bilder deiner großen Liebe. Am Ende hört der Roman so abrupt auf, wie er in medias res angefangen hat.
Isas Ticken zwischen der schmerzvollen Realität des Menschen sowie der Gesellschaft und der Apathie ihres Daseins, der Fantasiewelt als tierähnliches Geschöpf, lässt sie umherwandern zwischen Normalität und Wahnsinn. Erst bei der Einforderung ihrer Souveränität in Form der Heilung findet ihre Rückkehr als ein integriertes Teil des Ganzen (der Gesellschaft) statt. Isas Entscheidung stimmt hier mit Herrndorfs Entscheidung überein, den Text doch noch zu veröffentlichen und der Gesellschaft zugänglich zu machen. Somit findet das Fragment doch noch einen Platz im literarischen Diskurs, anstelle der Nichtveröffent-lichung, sozusagen in der eigenen Wortwelt und nach herrndorfschem Terminus abgetrennt von der Gesellschaft im „Verrücktsein“ verloren zu gehen. Jenseits einer Wertung endet Herrndorfs Fragment und hin-terlässt nicht nur eine märchenhafte Prosa, sondern auch die philoso-phische Frage nach dem (Wahn-)Sinn des Lebens.
Anmerkungen1. Wolfgang Herrndorf, Bilder deiner großen Liebe. Ein unvollendeter Roman,
Berlin: Rowohlt 2014. (Kürzel benutzt in dieser Arbeit: Bilder)2. Herrndorfs Auseinandersetzung mit der Frage des Wahnsinns ist auf seine
eigene Krankheitsgeschichte zurückzuführen, die hier nur im Ansatz erwähnt wird. Der Fokus dieser Arbeit gilt der konkreten Darstellung des Verrückt-seins bzw. Wahnsinns in dem Werk Bilder deiner großen Liebe.
3. Ders., Tschick, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 2012, 159. [Ber-lin: Rowohlt 2010.]
4. Ders., Arbeit und Struktur, Berlin: Rowohlt 2013, 213.5. Tschick wird oftmals in den Medien als moderne deutsche Version eines
Road-Novels z.B. Kerouacs On the road interpretiert, beispielsweise bei Mari-us Meller, „Road-Novel im Jugendstil!“, auf: deutschlandfunk.de. Beitrag vom 19. 11. 2010 (http://www.deutschlandfunk.de/road-novel-im-jugendstil.700.de.html?dram:article_id=84824). Zuletzt abgerufen am 15. 01. 2015.
6. Jens Bisky, „Abschließen wollte er, nicht aufhören“, in: Sueddeutsche.de, 07.12.2013 (http://sz.de/1.1837839). Zuletzt abgerufen am 01. 05. 2015.
7. Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur [Blog] (http://www.wolfgang-herrndorf.de). Zuletzt abgerufen am 01.05.2015.
8. Felicitas von Lovenberg: „Dieses zuviel ist niemals genug“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Online vom 27. August 2013 (http://www.faz.net/-gr0-7gyve). Zuletzt abgerufen am 18. 01. 2015.
9. Wolfgang Herrndorf 2014, 152: „Die tickt doch nicht sauber“.10. Jürgen Link: Normale Krisen? Normalismus und die Krise der Gegenwart. Kon-
stanz: Konstanz University Press 2013, 9.11. Ebd.12. Wolfgang Herrndorf 2014, 105 f.13. Jürgen Link 2013, 11.14. Wolfgang Herrndorf 2014, 7.15. Wolfgang Herrndorf 2013, 253.16. Michel Foucault: Dits et Écrits I, Nr. 5. „Der Wahnsinn existiert nur in einer
Gesellschaft“, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, 236. 17. Vgl. „Normalabweicher“ (Kaube), zitiert nach Jürgen Link 2013, 15. Später
erfährt man auch von Isa, dass sie aus einem Heim ausgebrochen sei (Herrn-dorf 2014, 121).
18. Hans Magnus Enzensberger, Im Irrgarten der Intelligenz. Ein Idiotenführer, Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp 2007, 19-22: „Ein weites und reich bestelltes Feld eröffnet sich, wenn statt von der Intelligenz von ihrer Abwe-senheit die Rede ist. Auch für die Dummheit nämlich gibt es kein Wort, das der Vielfalt der Erscheinungen gerecht werden könnte. Wir müssen uns hier, statt die subtilen Unterscheidungen, die da zutreffend wären, gebührend zu
166 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 167
würdigen, nolens volens mit einer schlichten Auflistung des Materials begnü-gen: [...] hirnverbrannt, plemplem, idiotisch[...]. Darüber hinaus können wir auf ein enormes Repertoire von idiomatischen Wendungen zurückgreifen, als da sind: [...] Er tickt nicht richtig; er spinnt; ist nicht ganz dicht; ballaballa [...]. Zweitens erscheint es den meisten, die ihre Verachtung für die Dummen aus-drücken wollen, schwerzufallen, zwischen Alltag und Klinik zu unterschei-den. Das gängige Vokabular neigt dazu, Krankheit und Dummheit in einen Topf zu werfen.“
19. A.a.O., 21 f.20. Wolfgang Herrndorf 2014, 7.21. Ebd.22. Eine ganz offensichtliche Anspielung auf die zwei Pillen in der Matrix (Vgl.
The Matrix, Regie die Wachowski Brothers: Warner Bros 1999), die wiederum auf Alice im Wunderland von Lewis Carroll verweisen. (Vgl. Lewis Carroll, Alice in Wonderland and Other Stories, New York: Barnes and Noble 2010.)
23. Herrndorf 2014, 7-9.24. A.a.O., 101.25. Herrndorf 2013, 213.26. A.a.O., 135.27. A.a.O., 316.28. Wolfgang Herrndorf 2014.29. Für eine Abhandlung über die Form des Fragments in der Romantik, vgl. Phi-
lippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy, The Literary Absolute: The Theory of Literature in German Romanticism, New York: State University of New York Press 1993.
30. Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, hrsg. von Gretel Adorno, Rolf Tie-demann, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984 (4. Aufl.) (= Gesammelte Schrif-ten, Band 7), hier S. 221.
31. Herrndorf sprach sich bis zuletzt dagegen aus, seine unvollendeten Manu-skripte zu veröffentlichen und Germanisten und Journalisten zugänglich zu machen. In Herrndorfs auf den 1. Juli 2013 datiertes Testament formulierte er über alle unvollendete Fragmente folgende Worte: „Keine Fragmente aufbe-wahren, niemals Fragmente veröffentlichen. Niemals Germanisten ranlassen. Freunde bitten, Briefe etc. zu vernichten. Journalisten mit der Waffe in der Hand vertreiben.“ (Herrndorf 2014, 136.) Allerdings entschied er sich einige Wochen später doch noch zur Veröffentlichung des Isa-Textes unter der Be-dingung, es würde nicht als Fragment in die Welt gehen. So heißt es weiterhin im Nachwort (ebd.) von Bilder deiner großen Liebe von den Herausgebern Marcus Gärtner und Kathrin Passig: „[...] am Ende sollte ein zusammenhän-gender Text dastehen, der vorhandene Lücken aber nicht verbirgt. Dazu ein erläuterndes Nachwort, das ganze Buch, so die Vorgabe, ohne jeden ,Ger-
manistenscheiß’. Den Titel ,Bilder deiner großen Liebe‘ legte der Autor fest.“ (Herrndorf 2014, 138.)
32. Antoine de Saint-Éxupery, Le petit prince, Paris: Gallimard 1945.33. Wolfgang Herrndorf 2013, 316.34. Nach Jack Kerouac ein Begriff, um „the ones who are mad to live, mad to talk,
mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a common place thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars“ zu beschreiben. Vgl. Kerouac (1998, 11).
35. Dadurch könnte sich der Konflikt mit Tschick erklären, da zwei dingledodies, also eine Art Alphatiere aufeinandertreffen, die unterschwellig bzw. unbe-wusst beide für das gleiche Liebesobjekt brennen.
36. Deswegen benutzt man hier die Begriffe „Roadmovie“ und „Road-Novel“.37. Jack Kerouac, On the road, London: Penguin Books 1998, 199. [Jack Kerouac,
On the road, 1957.] 38. Herrndorf 2014, 14.39. Genau kann man den Auslöser für die Einteilung in die zwei Welten nicht
nachverfolgen, da man Isa als Erzählerin nicht trauen kann, doch der Ur-sprung ist hier nicht von großem Belang.
40. Herrndorf 2014, 106.41. Gérard Genette, Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt am
Main: edition suhrkamp 1993.42. Herrndorf 2014, 65 – 72.43. A.a.O., 72.44. Herrndorf 2014, 113. 45. Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im
Zeitalter der Vernunft, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973, 176. 46. A.a.O., 193.47. Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1911. (Nach-
druck: Frankfurt am Main 2007).48. Vladimir Nabokov: Lolita (1955), in: Brian Boyd (editor), Novels 1955-1962,
New York 1996, 1-298.49. Als die etwa vierzehnjährige Isa an einem Kanal auf einem Lastkahn mitfah-
ren möchte und es letztendlich schafft, an Bord zu gehen, erzählt sie dem Bin-nenschiffer sie sei 18 oder 17, und „Wir könnten also was machen (Bilder 38)“. Oder sie bietet auf Seite 87 einem Jungen an, ihn für einen Euro oder fünfzig Cent auf dem Parkplatz oral zu befriedigen. Dort heißt es wortwörtlich zitiert: „,Hast du Geld?‘, rufe ich ihm hinterher. ,Nur ein bisschen. Ein Euro. Fünfzig Cent. [...] Ich blas dir auch einen.‘“ (Bilder 87) Sie kokettiert auch mit ihrer erotischen Anziehungskraft, z.B. auf Seite 105, als sie in einem Hotel einen Pirelli-Kalender an der Wand hängen sieht: „Ich drehe den Oberkörper ein wenig und drücke die Brüste raus.“
168 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 169
50. Herrndorf 2014, 106 – 113.51. A.a.O., 34 – 57.52. A.a.O., 92.53. Vgl. a.a.O., 72 – 74: Die Ausnahme könnte der Mann bilden, der Isa in Kapitel
20 ohne zu zögern ein halbes Baguette zu Essen gibt. Er geht auf dem ersten Blick auf ihren Wahnsinn ein und unterhält sich mit ihr über ihren Ursprung von einem anderen Planeten. Er scheint sie aus ihrer Sicht ernst zu nehmen, doch auch er als erwachsene Person spielt nur beim vermeintlichen Spiel Isas mit.
54. A.a.O., 10: „Als ich die Hand raushalte, bremst in derselben Sekunde ein Auto. Vorn auf der Windschutzscheibe ist ein gelber Aufkleber mit einer la-chenden roten Sonne drauf. Ich zeige mit dem Daumen auf den Aufkleber und sage: ,Ich habe die Sonne angehalten‘, und die Fahrerin nickt und lacht und hält mir sofort einen Vortrag über den Unterschied von Kernfusion und Kernspaltung, über die Gefahren der Stromerzeugung, über Kohlekraftwer-ke und Tschernobyl, über Ehen in Harrisburg, Mesmerismus und Jakob von Gunten, und da schlafe ich ein.“
55. A.a.O., 10.56. Alexander Kluge und Joseph Vogl: Soll und Haben. Fernsehgespräche, Zürich-
Berlin: diaphanes 2009.57. Eine Welt, die Isa eine Art Freiheit bietet, die sie jedoch nicht als solche emp-
finden mag, da sie ständig Bedrohungen ausgesetzt ist.58. Herrndorf 2014, 122.59. a.a.O., 84.60. Vgl. Wolfgang Herrndorf 2010, 150.61. A.a.O., 154 f.: „Aber dann kam sie uns auf einmal hinterhergelaufen. Und
irgendwie hatte ich gleich ein komisches Gefühl bei der Sache, als ich sah wie sie uns hinterherlief. Normalerweise können Mädchen ja nicht laufen, oder nur so schlenkerig. Aber die konnte laufen. Und sie lief mit ihrer Holzkiste im Arm, als ginge es um Leben und Tod. Ich hatte nicht direkt Angst vor ihr, wie sie da auf uns zuschoss. Aber ein bisschen unheimlich war sie mir schon.“
62. Herrndorf 2014, 97.63. a.a.O., 122.64. Joseph Vogl, Über den Schrei. Fakultätsvorträge der Philologisch-Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Heft 9), Göttingen: V & R unipress 2013, 15. „Der Schrei ist in jeder Hinsicht eine Grenze der Darstel-lung und wirkt nur durch seine Abwesenheit: in der Literatur und im Text dadurch, dass er sich nicht an- und aufschreiben lässt und zudem dazu be-stimmt ist, dass er vergeht; [...]. Im gellenden Schrei, so will es dieses ästhe-tische Programm, hört jede Verbindung, jede Sympathie oder jedes Mitleid mit dem Schmerz des Verletzten auf. Im Schrei stockt die Einfühlung, mit
ihm schwindet die Ähnlichkeit, die Menschengestalt, das anthropomorphe Substrat.“
65. Vogl behandelt im Wiener Vortrag den Schrei des 18. Jahrhunderts.66. Hart Nibbrig, Christiaan L., Rhetorik des Schweigens. Versuch über den Schat-
ten literarischer Rede, Frankfurt am Main: suhrkamp taschenbuch 1981, 172.67. Jean-Luc Nancy [übersetzt von Nils Hodyas und Timo Obergöker], Corpus,
Zürich-Berlin: diaphanes 2014, 11. [Jean-Luc Nancy, Corpus, Paris: Éditions Métailié 2000.]
68. Herrndorf 2014, 105.69. Herrndorf 2014, 105 f.70. Anm.: Die Vernunft.71. Wolfgang Herrndorf 2014, 106.72. A.a.O., 79 und 94.73. Alexander Kluge und Joseph Vogl 2009.74. A.a.O., 39.75. Wolfgang Herrndorf 2014, 7.76. Alexander Kluge und Joseph Vogl 2009, 40.77. A.a.O., 30.78. Herrndorf 2014, 36.79. Ebd. 80. A.a.O., 28.81. Jean-Luc Nancy [übersetzt von Nils Hodyas und Timo Obergöker], Corpus,
Zürich-Berlin: diaphanes 2014, 39 f. [Jean-Luc Nancy, Corpus, Paris: Éditions Métailié 2000.]
82. Ebd.83. Vgl. Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns
im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt am Main: suhrkamp edition 1973.84. Wolfgang Herrndorf 2014, 113.85. A.a.O., 10: „Ich nehme eine Tablette, um zu testen, was die macht, aber die
macht nichts [...].“86. a.a.O., 113.87. A.a.O., 7. 88. A.a.O., 117.89. A.a.O., 7.90. Ders. 2013.91. A.a.O., 9.92. Herrndorf 2013, 22.93. Herrndorf 2013, 421.94. Herrndorf 2014, 102.95. Herrndorf 2013, 123: „Rückblende Teil 6: Exorzismus“.96. Herrndorf 2014 58.
170 Yun-Chu Cho
Isas Ticken. Wahnsinn und Tod in Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe 171
97. a.a.O. 88-99. 98. a.a.O. 96. 99. A.a.O., 100: „Quer über dem Reh liegt ein Mann in grüner Kleidung. [...]
Der Oberkörper des Mannes ist schwarz von Blut. Es ist nicht sein eigenes. Im Reh ist ein Einschussloch, im Mann nicht. Vielleicht hat ihn der Schlag getroffen.“
100. a.a.O. 102.101. a.a.O. 126.102. a.a.O., 128: „[...] ich weiß nicht mehr, wo, aber ich weiß, dass ich das alles
schon erlebt habe, dass ich genau hier schon einmal genau so gestanden und den gleichen Gedanken gehabt habe, nämlich den Gedanken, diesen Ge-danken schon einmal gehabt zu haben, und dass ich genau diesen Gedanken jetzt wieder habe, und in diesem Moment ist plötzlich klar, dass das keine Erinnerung an diesen Gedanken ist und auch keine Erinnerung an eine frü-here Erinnerung und auch kein Déjà-vu, sondern dass das einfach das ist, was geschieht, dass das mein Leben ist.“
103. Ders., 2013, 438: Fragmente (12): „Sätze, die Sie als Vollidiot zum Thema Tod unbedingt sagen müssen: 1. Der Tod ist ein Tabuthema in unserer Ge-sellschaft. Er wird von ihr an den Rand gedrängt. 2. Der Tod ist ein Bestand-teil des Lebens. 3. Es weiß ja niemand, was danach kommt. 4. Ich habe keine Angst, ich weiß ja, was danach kommt.“
104. Herrndorf 2014, 128.































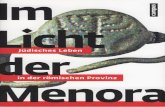
![Jähnichen, Gisa (2008). Musik Welt Bilder 1. Aachen, Shaker Media. [160 p.].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314a3bd3ed465f0570b3bf0/jaehnichen-gisa-2008-musik-welt-bilder-1-aachen-shaker-media-160-p.jpg)











